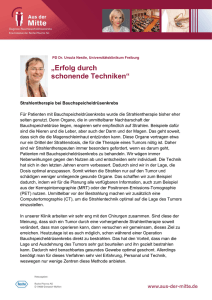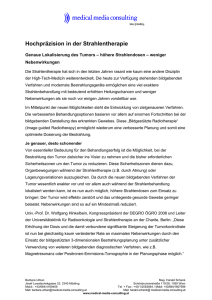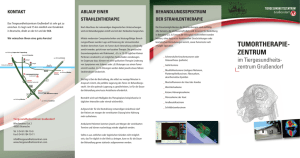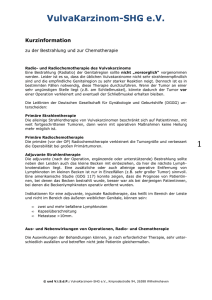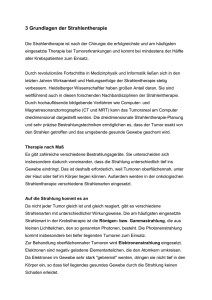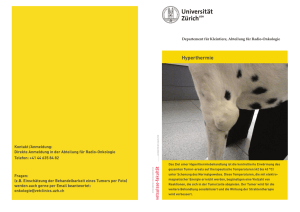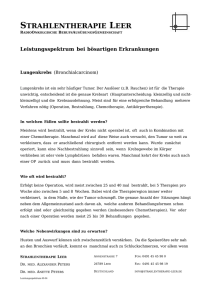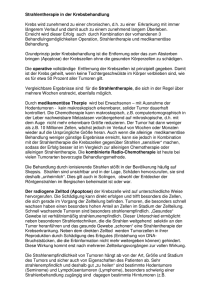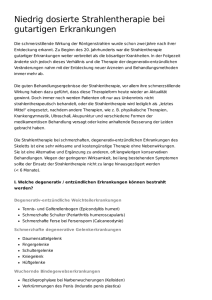Keine Angst vor den unsichtbaren Strahlen
Werbung
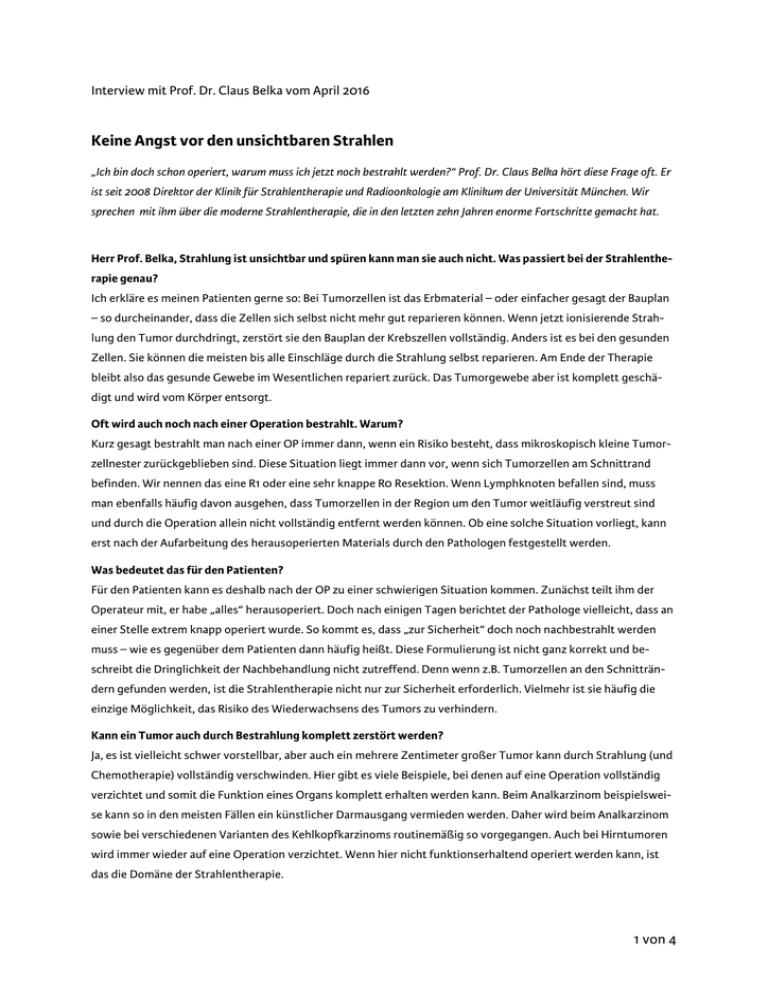
Interview mit Prof. Dr. Claus Belka vom April 2016 Keine Angst vor den unsichtbaren Strahlen „Ich bin doch schon operiert, warum muss ich jetzt noch bestrahlt werden?“ Prof. Dr. Claus Belka hört diese Frage oft. Er ist seit 2008 Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Klinikum der Universität München. Wir sprechen mit ihm über die moderne Strahlentherapie, die in den letzten zehn Jahren enorme Fortschritte gemacht hat. Herr Prof. Belka, Strahlung ist unsichtbar und spüren kann man sie auch nicht. Was passiert bei der Strahlentherapie genau? Ich erkläre es meinen Patienten gerne so: Bei Tumorzellen ist das Erbmaterial – oder einfacher gesagt der Bauplan – so durcheinander, dass die Zellen sich selbst nicht mehr gut reparieren können. Wenn jetzt ionisierende Strahlung den Tumor durchdringt, zerstört sie den Bauplan der Krebszellen vollständig. Anders ist es bei den gesunden Zellen. Sie können die meisten bis alle Einschläge durch die Strahlung selbst reparieren. Am Ende der Therapie bleibt also das gesunde Gewebe im Wesentlichen repariert zurück. Das Tumorgewebe aber ist komplett geschädigt und wird vom Körper entsorgt. Oft wird auch noch nach einer Operation bestrahlt. Warum? Kurz gesagt bestrahlt man nach einer OP immer dann, wenn ein Risiko besteht, dass mikroskopisch kleine Tumorzellnester zurückgeblieben sind. Diese Situation liegt immer dann vor, wenn sich Tumorzellen am Schnittrand befinden. Wir nennen das eine R1 oder eine sehr knappe R0 Resektion. Wenn Lymphknoten befallen sind, muss man ebenfalls häufig davon ausgehen, dass Tumorzellen in der Region um den Tumor weitläufig verstreut sind und durch die Operation allein nicht vollständig entfernt werden können. Ob eine solche Situation vorliegt, kann erst nach der Aufarbeitung des herausoperierten Materials durch den Pathologen festgestellt werden. Was bedeutet das für den Patienten? Für den Patienten kann es deshalb nach der OP zu einer schwierigen Situation kommen. Zunächst teilt ihm der Operateur mit, er habe „alles“ herausoperiert. Doch nach einigen Tagen berichtet der Pathologe vielleicht, dass an einer Stelle extrem knapp operiert wurde. So kommt es, dass „zur Sicherheit“ doch noch nachbestrahlt werden muss – wie es gegenüber dem Patienten dann häufig heißt. Diese Formulierung ist nicht ganz korrekt und beschreibt die Dringlichkeit der Nachbehandlung nicht zutreffend. Denn wenn z.B. Tumorzellen an den Schnitträndern gefunden werden, ist die Strahlentherapie nicht nur zur Sicherheit erforderlich. Vielmehr ist sie häufig die einzige Möglichkeit, das Risiko des Wiederwachsens des Tumors zu verhindern. Kann ein Tumor auch durch Bestrahlung komplett zerstört werden? Ja, es ist vielleicht schwer vorstellbar, aber auch ein mehrere Zentimeter großer Tumor kann durch Strahlung (und Chemotherapie) vollständig verschwinden. Hier gibt es viele Beispiele, bei denen auf eine Operation vollständig verzichtet und somit die Funktion eines Organs komplett erhalten werden kann. Beim Analkarzinom beispielsweise kann so in den meisten Fällen ein künstlicher Darmausgang vermieden werden. Daher wird beim Analkarzinom sowie bei verschiedenen Varianten des Kehlkopfkarzinoms routinemäßig so vorgegangen. Auch bei Hirntumoren wird immer wieder auf eine Operation verzichtet. Wenn hier nicht funktionserhaltend operiert werden kann, ist das die Domäne der Strahlentherapie. 1 von 4 Gibt es überhaupt ein Gebiet, wo die Strahlentherapie nicht zum Einsatz kommt? Tatsächlich sehen wir heutzutage kaum ein Krankheitsbild, bei dem die Strahlentherapie nicht in irgendeinem Stadium oder in irgendeiner Untergruppe zum Einsatz kommt. Selbst in der palliativen Behandlung und in der Therapie von Patienten, deren Krebserkrankung einen chronischen Verlauf nimmt, wird bestrahlt. Denn wenn einzelne Krebsherde nicht mehr auf Medikamente ansprechen oder eine Operation nicht möglich ist, ist die Strahlentherapie die einzig mögliche Antwort. Und eine hoch wirksame noch dazu. Worin bestehen die Fortschritte in der Strahlentherapie der letzten zehn Jahre? Ein großer technologischer Fortschritt betrifft das grundsätzliche Problem, dass Organe beweglich sind. Ob Blase, Magen, Lunge oder Prostata: Sie halten einfach nicht still, wenn man sie bestrahlt. Früher hat man deshalb mit großen Sicherheitsräumen dafür gesorgt, dass der Tumor vollständig getroffen wird. Heute wird die Bestrahlung engmaschig mit CT, Oberflächenscannern oder Ultraschall kombiniert und überwacht. Sobald der Patient also zuckt oder das Organ sich nur zwei Millimeter aus dem festgelegten Bestrahlungsfeld herausbewegt, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Eine gute Strahlentherapie zeichnet sich also heutzutage dadurch aus, dass der sogenannten Bildführung (IGRT) sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der zweite große Fortschritt: Wir können heute die Dosisverteilungen vorab exakt berechnen, selbst wenn diese sehr komplex sind. Und was wir mit der Bestrahlung treffen wollen, treffen wir auch, denn die Geräte sind geometrisch bis auf 0,5 Millimeter genau. So kann angrenzendes Gewebe bestmöglich geschont werden. Dennoch können wir nicht in jedem Fall verhindern, dass gesundes Gewebe bestrahlt wird. Wann gelingt es nicht, gesundes Gewebe zu schonen? Immer dann, wenn ein großer Bereich vom Tumor befallen ist und Tumorgewebe mit gesunden Strukturen vermischt ist. Beispiel Kehlkopfkarzinom. Wenn sich dieses in der Schleimhaut des Halses ausdehnt und Lymphknoten befallen waren, könnte ich zwar den sichtbaren Bereich des Tumors punktgenau bestrahlen. Doch die umgebende, scheinbar gesunde Schleimhaut werde ich nicht schonen können, sonst schone ich auch den Tumor, der in diese Bereiche mikroskopisch eingewachsen ist. Ein anderer Fall: Wenn ein Tumor mitten in einem Organ sitzt, werde ich das Organ selbst durch zielgenaue Bestrahlung nicht vollständig schonen können. Vielfach entstehen Nebenwirkungen gar nicht durch die Strahlentherapie, sondern sind darauf zurückzuführen, dass der Tumor dort, wo er sitzt, schon etwas zerstört hat. Hohe Präzision bei der Bestrahlung heißt also nicht, dass keine Nebenwirkungen auftreten. Allerdings können wir die Bestrahlungsfelder heute so klein machen, wie es wirklich notwendig ist, und den Patienten so sehr viele unnötige Belastungen ersparen. Die Nebenwirkungen der Bestrahlung sind also insgesamt betrachtet geringer? Ein Großteil der Nebenwirkungen der Strahlentherapie ist heutzutage ausgesprochen gering geworden. Viele Patienten, die hier bei uns mit Prostatakarzinom bestrahlt werden, berichten lediglich: „Na ja, manchmal brennt es ein bisschen beim Wasserlassen“, oder: „Ich bin ab und zu müde.“ Auch die früher gefürchteten Spätnebenwirkungen, wie die riesigen Lymphödeme beim Mammakarzinom, die nach einer großen Operation mit anschließender Nachbestrahlung des Lymphwegs auftraten, sehen wir heute praktisch nicht mehr. Anders ist es bei Kopf-Hals-Tumoren bzw. wenn die Schleimhäute der Patienten betroffen sind. Hier kommt es häufig zu Reizungen und Entzündungen an den Schleimhäuten, in welchen der Tumor wächst. In der Regel ist eine solche Therapie ohne intensive Unterstützungsmaßnahmen insbesondere am Ende der Therapie nicht zu bewältigen. 2 von 4 Was raten Sie Betroffenen zum Thema Nebenwirkungen? Mein Appell: Lassen Sie sich von jemandem beraten, der wirklich etwas davon versteht. Schenken Sie dieser qualifizierten, fachärztlichen Einschätzung Vertrauen und lassen Sie sich nicht von Geschichten anderer ängstigen. Wichtig ist, dass sich die Patienten früh und genau informieren. In München ist die Versorgung exzellent, wir haben zwei große Universitätskliniken sowie etliche spezialisierte Praxen. Man kann sich also auch sehr gut eine qualifizierte Zweitmeinung holen. Wer sich vorab gut beraten lässt, bekommt ein vernünftiges Bild von den Problemen, die entstehen können. Wir Spezialisten können natürlich nicht 100-prozentig vorhersehen, was in der Zukunft passiert. Aber wir können doch relativ gut abschätzen, welche Strahlentherapie eher problematisch wird und welche standardmäßig abläuft. Was ist der Grund für diese Fortschritte? Alle beteiligten Ärzte, Strahlentherapeuten ebenso wie Operateure haben über die Jahre eine Menge gelernt. Sie wissen viel genauer, was sie tun können und sie können vor allem sehr viel individueller behandeln. Diese riesen Bestrahlungsfelder – nach dem Motto „one size fits all“ – machen wir nicht mehr. Alles in allem ist heute die Angst vor Nebenwirkungen größer als diese in Wirklichkeit sind. Wie sieht eine Strahlentherapie in Ihrer Strahlenklinik aus? Neben der ambulanten und der stationären Behandlung gibt es auch Mischformen – je nachdem wie der Patient auf die Bestrahlung reagiert. Die Patientinnen mit Mammakarzinom z.B. kommen dreieinhalb bis sechseinhalb Wochen täglich zur Bestrahlung. Ähnlich gilt für das klassische Prostatakarzinom. Hier kommen die Patienten meist über siebeneinhalb Wochen täglich für ca. 15 Minuten zu uns. Bei Hirntumoren starten wir oft stationär und machen dann ambulant weiter, wenn es gut geht. Stationär behandeln wir vor allem Patienten, die gleichzeitig zur Strahlentherapie eine Chemotherapie zur Wirkungsverstärkung erhalten. Gerade wenn wir wissen, dass auf den Patienten anstrengende Nebenwirkungen zukommen, wie bei Bestrahlungen im Kopf-Hals-Bereich mit betroffenen Schleimhäuten. Auch hier warten wir im Einzelfall immer ab, wie der Patient reagiert. Das sind also recht lange Behandlungsintervalle? Ja, wir Strahlentherapeuten sehen die Patienten zum Teil über lange Therapieserien, manchmal auch über mehrere Serien hinweg. Die Vorstellung, dass Strahlentherapie eine reine Gerätemedizin ist, stimmt mit Sicherheit nicht. Und auch wenn wir hier mit ca. 2.000 Neupatienten pro Jahr ein Großversorger sind, bekommen wir ein ganz gutes Gefühl dafür, was der einzelne Patient braucht. Wie unterstützen Sie Patienten, die durch eine Therapie belastet sind? Bei uns in der Strahlenklinik hat das psycho-onkologische Begleitungsangebot seinen festen Platz. Konkret finanziert der Verein lebensmut seit 2010 pro Woche 19,25 Stunden Psycho-Onkologie in der Strahlentherapie. Das hat zwei Gründe. Zum einen erleben wir Ärzte, dass wir in unserem eng getakteten Arbeitsalltag der Akutmedizin oftmals nicht genügend Zeit haben, um die Nöte und Sorgen der Patienten mit der gebotenen Ruhe und Tiefe aufzufangen. Gleichzeitig sehen wir, wie hilfreich es für den betroffenen Menschen sein kann, wenn er gerade in den intensiven Phasen einer Therapie jemanden hat, der regelmäßig kommt. Diese Unterstützung bietet bei uns die psycho-onkologische Fachkraft und ihr Zuspruch kann entscheidend sein, um anstrengende Bestrahlungsintervalle durchzustehen. 3 von 4 Kann sich ein ehemaliger Patient auch nach Jahren mit Beschwerden an Sie wenden? Natürlich, das ist Teil der Nachsorge. Egal, ob er bei uns oder woanders bestrahlt wurde, jeder Betroffene kann zu uns kommen. Das gilt übrigens für alle großen Kliniken und hoffentlich auch für die kleinen. Wir untersuchen dann, ob die Beschwerden eine Bestrahlungsfolge sein können. Und wenn wir diesen Eindruck gewinnen, versuchen wir, den Patienten so gut es geht bei der Bewältigung der Spätfolgen zu unterstützen. Auch da kann die psychoonkologische Begleitung wieder ins Spiel kommen. Zum Schluss gefragt: Wo erwarten Sie die nächsten Fortschritte in der Strahlentherapie? Die nächsten großen Innovationen, die ich sehe, liegen im Einsatz von Wirkstoffen, welche die Strahlenwirkung zielgerichtet verbessern. Das sind Substanzen, die auf molekularer Ebene wirken und Tumorzellen empfindlicher gegen Strahlung machen. Bei Kopf-Hals-Tumoren wissen wir, dass es solche molekularen Schalter gibt. Bei Hirntumoren haben wir zumindest ein paar Hinweise, dass es so sein könnte. Auch in der Kombination mit der Immuntherapie eröffnet sich womöglich ein neues Feld. Die Frage lautet hier: Können wir den durch Strahlung sterbenden Tumor immunologisch nutzen, so dass der Körper bzw. das Immunsystem plötzlich den Tumor als fremd erkennt und bekämpft. Das Gespräch führte Regine Kramer © 2016 lebensmut e.V., München 4 von 4