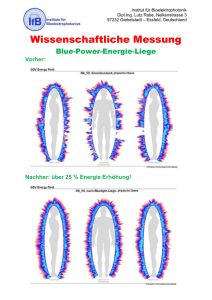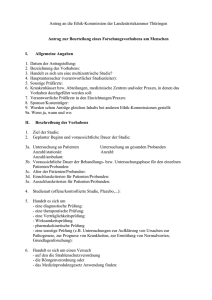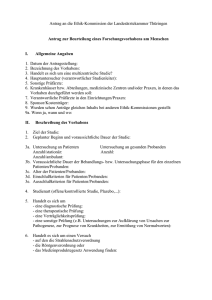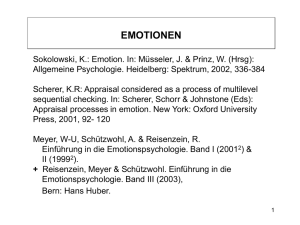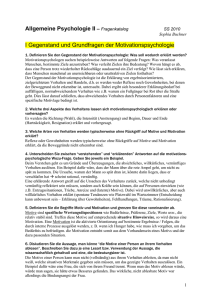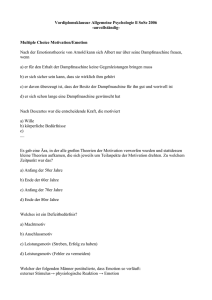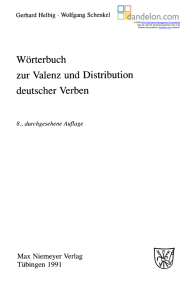Fragen zur Lernkontrolle: Allgemeine
Werbung
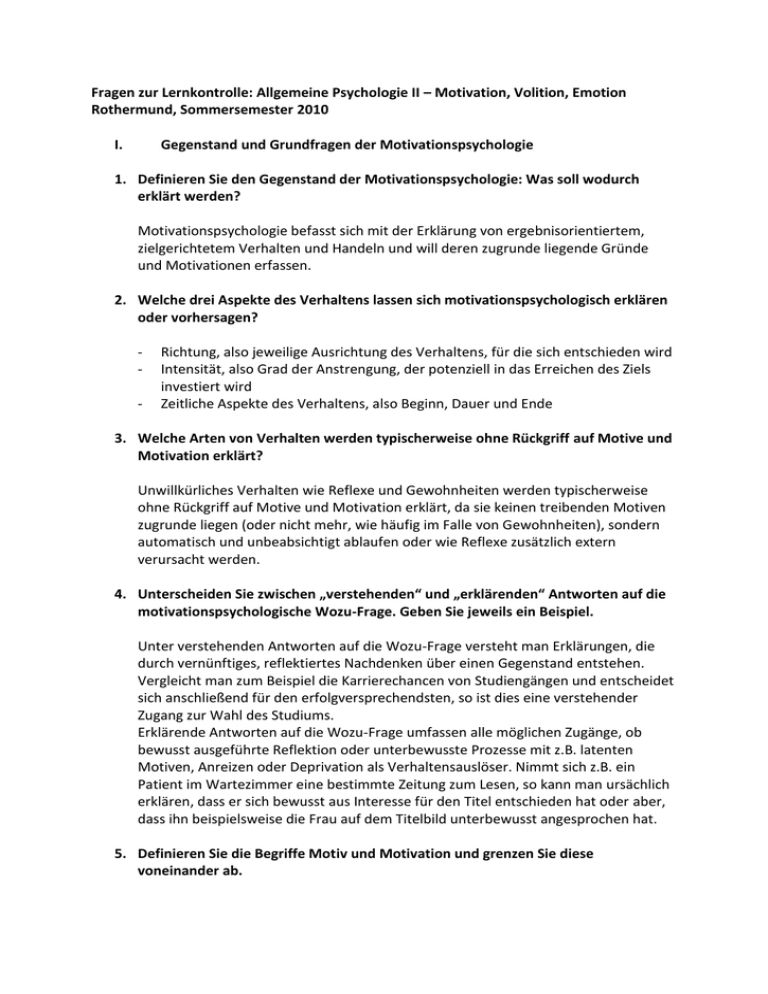
Fragen zur Lernkontrolle: Allgemeine Psychologie II – Motivation, Volition, Emotion Rothermund, Sommersemester 2010 I. Gegenstand und Grundfragen der Motivationspsychologie 1. Definieren Sie den Gegenstand der Motivationspsychologie: Was soll wodurch erklärt werden? Motivationspsychologie befasst sich mit der Erklärung von ergebnisorientiertem, zielgerichtetem Verhalten und Handeln und will deren zugrunde liegende Gründe und Motivationen erfassen. 2. Welche drei Aspekte des Verhaltens lassen sich motivationspsychologisch erklären oder vorhersagen? - Richtung, also jeweilige Ausrichtung des Verhaltens, für die sich entschieden wird Intensität, also Grad der Anstrengung, der potenziell in das Erreichen des Ziels investiert wird Zeitliche Aspekte des Verhaltens, also Beginn, Dauer und Ende 3. Welche Arten von Verhalten werden typischerweise ohne Rückgriff auf Motive und Motivation erklärt? Unwillkürliches Verhalten wie Reflexe und Gewohnheiten werden typischerweise ohne Rückgriff auf Motive und Motivation erklärt, da sie keinen treibenden Motiven zugrunde liegen (oder nicht mehr, wie häufig im Falle von Gewohnheiten), sondern automatisch und unbeabsichtigt ablaufen oder wie Reflexe zusätzlich extern verursacht werden. 4. Unterscheiden Sie zwischen „verstehenden“ und „erklärenden“ Antworten auf die motivationspsychologische Wozu-Frage. Geben Sie jeweils ein Beispiel. Unter verstehenden Antworten auf die Wozu-Frage versteht man Erklärungen, die durch vernünftiges, reflektiertes Nachdenken über einen Gegenstand entstehen. Vergleicht man zum Beispiel die Karrierechancen von Studiengängen und entscheidet sich anschließend für den erfolgversprechendsten, so ist dies eine verstehender Zugang zur Wahl des Studiums. Erklärende Antworten auf die Wozu-Frage umfassen alle möglichen Zugänge, ob bewusst ausgeführte Reflektion oder unterbewusste Prozesse mit z.B. latenten Motiven, Anreizen oder Deprivation als Verhaltensauslöser. Nimmt sich z.B. ein Patient im Wartezimmer eine bestimmte Zeitung zum Lesen, so kann man ursächlich erklären, dass er sich bewusst aus Interesse für den Titel entschieden hat oder aber, dass ihn beispielsweise die Frau auf dem Titelbild unterbewusst angesprochen hat. 5. Definieren Sie die Begriffe Motiv und Motivation und grenzen Sie diese voneinander ab. Unter einem Motiv versteht man eine spezifische Wertungsdisposition im Hintergrund (wie Interessen, Werte, etc.), die durch jeweilige situative Hinweise Motivation bedingen, also aktiviert werden müssen. Motive sind relativ zeitstabil. Motivation hingegen meint die spezifische Orientierung einer Person auf ein bestimmtes Ziel in einer bestimmten Situation. Sie entsteht durch Aktivierung eines Motivs und will eine Zielerreichung oder Bedürfnisreduktion bedingen. Motivation wird durch Aufmerksamkeitsfokusierung, Planung, Überlegung und Anstrengung in konkretes Verhalten übersetzt. 6. Diskutieren Sie die Aussage, man könne „die Motive einer Person an ihrem Verhalten ablesen“. Beschreiben Sie dazu je eine Lesart bzw. Verwendung der Aussage, die wissenschaftlich gehaltvoll und eine, die bedeutungsleer ist. Es mag in manchen Fällen möglich sein, die Motive einer Person am Verhalten abzulesen, häufig jedoch auch nicht. Um sichergehen zu können, dass ein bestimmtes wissenschaftlich gehaltvolles Motiv vorliegt, reicht der Rückschluss vom Verhalten ausgehend jedoch ohnehin nie aus, da das Motiv unabhängig vom Verhalten gemessen werden muss. Um wissenschaftlich von „Motiv“ sprechen zu können, muss man sich zudem auf wenige Grundmotive (Macht, Leistung, Anschluss) beschränken und Verhalten im Hinblick auf solche grundlegenden Kategorien untersuchen. Wenn man alltagspsychologisch unter „Motiv“ und „Motivation“ die bloße spezifische Zielgerichtetheit eines Verhaltens versteht, so kann man diese wohl leichter am Verhalten ablesen. Der Begriff ist jedoch dann trivial und bedeutungsleer, da keine zusätzlichen Erklärungen gegeben werden, sondern nur zirkulär argumentiert wird. 7. Warum ist es unbefriedigend, wenn ein häufiger Besuch von Partys darauf zurückgeführt wird, dass die betreffende Person ein „Party-Motiv“ hat? Nennen Sie eine motivationspsychologisch ernstzunehmende Erklärung für ein solches Verhalten und skizzieren Sie eine Möglichkeit, Ihre Aussage empirisch zu prüfen. Damit Erklärungen für Motive wissenschaftlich gehaltvoll sind, müssen die Motive unabhängig vom Verhalten gemessen werden, da die Erklärungen sonst trivial und zirkulär sind. Es ist also unbefriedigend von dem Verhalten der Person auf ein „PartyMotiv“ zu schließen, da hierdurch nichts erklärt und keine zusätzliche Information gewonnen wird. Eine motivationspsychologisch ernstzunehmende Erklärung könnte sein, dass die Person ein Bedürfnis nach sozialem Anschluss hat und dieses durch den Besuch von Partys und die vielen Menschen dort befriedigt wird. Um diese Aussage empirisch zu prüfen, könnte man Vermittlungsprozesse direkt manipulieren. Das Auf-PartysGehen wird in der These vermittelt durch ein Anschlussmotiv. Man könnte nun prüfen, ob die Person auch noch auf Partys geht, wenn dort nur wenige Leute sind, die zudem keine Freunde oder Bekannten sind, alle anderen Rahmenbedingungen wie Musik, Tanzen und Alkohol aber gleichgelassen würden. Täte sie das nicht, so könnte auf eine Richtigkeit der Aussage geschlossen werden. 8. Was sind die 8 Grundfragen der Motivationspsychologie? Geben Sie jeweils eine kurze Erläuterung. 1. Motivklassifikation: Was kann man als Motiv bezeichnen? inhaltliche Klassifikation angestrebter Handlungsziele und Aufstellung von Motivkatalogen; 2. Motivgenese: Wie entstehen Motive? Entstehung, Anfänge, Entwicklung und Änderung einzelner Motive; 3. Motivmessung: Wie kann man Motive messen? Verfahren zum Erfassen individueller Unterschiede in der Ausprägung einzelner Motive; 4. Motivanregung: Wann und wodurch werden Motive angeregt? Eingrenzung und Differenzierung der motivationsspezifischen Anregungsbedingungen der Situation; 5. Wechsel und Wiederaufnahme der Motivation: Kann eine Motivation gewechselt werden und welche Nachwirkungen hat eine frühere Motivation? 6. Motivierte Zielgerichtetheit und Motivationskonflikt: Sind Motive zielgerichtet und können verschiedene Motive im Konflikt miteinander stehen? Zielgerichtetheit als allgemeines Merkmal motivierten Verhaltens und Motivationskonflikt zwischen verschiedenen Handlungszielen; 7. Selbstregulatorische Zwischenprozesse der Motivation: Wie kann man Motivation mit Hilfe von selbstregulatorischen Zwischenprozessen rekonstruieren? Analytische Rekonstruktion von „Motivation“ unter Zugrundelegung hypothetischer, selbstregulatorischer Zwischenprozesse in einzelnen Phasen des Verhaltensabschnitts; 8. Motivationswirkungen: Welche Wirkungen hat Motivation auf Verhalten? Manifestation von Motivation in beobachtbarem Verhalten und seinen Resultaten; II. Kraft I – Triebtheorien 9. Definieren Sie den Begriff „Trieb“. Als Trieb bezeichnet man eine unspezifische Quelle der Verhaltensenergetisierung, die aktiviert werden muss, damit Verhalten manifest werden kann. Ein Trieb erzeugt einen inneren Druck, dem man nicht ausweichen kann und der nicht regulierbar ist. Er versetzt den Körper in Anspannung, deren Reduktion angestrebt und als befriedigend erlebt wird. 10. Wie motivieren Triebe Verhalten? Welche allgemeinen Grundsätze liegen einer triebhaften Verhaltenssteuerung zugrunde? Triebe motivieren Verhalten dadurch, dass sie einen inneren Druck erzeugen, der nicht regulierbar ist und dem nicht ausgewichen werden kann. Sie versetzen in einen Zustand der Anspannung, deren Reduktion als befriedigend erlebt wird und deshalb durch entsprechendes Verhalten angestrebt wird. Die allgemeinen Mechanismen, die hierbei wirksam sind, sind das Anstreben von Lust und das Vermeiden von Unlust. 11. Warum ist man unter Umständen Triebeinflüssen auf das Verhalten in stärkerem Maße „ausgeliefert“ als Einflüssen, die von Anreizen ausgehen? Sowohl äußere Anreize als auch innerer Druck, der durch Triebe erzeugt wird, können Motivation für bestimmtes Verhalten bedingen. Jedoch kann man äußeren Anreizen ausweichen und aus dem Weg gehen, wenn sie als unangenehm empfunden werden oder nicht erwünscht sind. Dies ist bei Triebdruck nicht möglich. Man ist ihm „ausgeliefert“. 12. Erläutern Sie die Auswirkungen von Triebzuständen auf das Denken und Handeln mit Hilfe der Begriffe Primär- und Sekundärprozess. Primärprozesse sind Prozesse, die das Verhalten direkt im Hinblick auf die Triebbefriedigung steuern, ohne dass gedankliche Prozesse eine Rolle spielen. Bei Sekundärprozessen dient das Ich als Vermittler zwischen Trieben und Verhalten, wenn z.B. die direkte Triebbefriedigung gesellschaftlich nicht akzeptiert ist oder erst durch Vorhandlungen geplant und ermöglicht werden muss. Hierunter fällt Aufschieben und Planen von direkter Triebbefriedigung oder auch Ersatzhandlungen. Kann oder darf ein Trieb nicht befriedigt werden, so werden Abwehrmechanismen in Kraft gesetzt, um die Triebspannung anderweitig zu reduzieren. Beispiele hierfür sind z.B. Leugnung, Sublimation, Verdrängung oder Projektion. 13. Schildern Sie Aufbau und Ergebnisse der Studie von McGinnies (1949) zur Verdrängung in der Wahrnehmung. Welches methodische Problem gibt es bei dieser Studie, das eine Interpretation der Ergebnisse im Sinne einer automatischen Wahrnehmungsabwehr fraglich erscheinen lässt? McGinnies (1949): Probanden werden neutrale Wörter wie „Apfel“ und tabuisierte Wörter wie „Hure“ so kurz gezeigt, dass sie nicht zu erkennen sind. Die Darbietungsspanne wird danach sukzessive erhöht und die Wahrnehmungsschwelle gemessen, die definiert wird als die Darbietungsspanne, ab der ein Proband ein Wort überzufällig häufig richtig erkennt; Wahrnehmungsschwelle für Tabuwörter signifikant höher! Beweis für automatische Wahrnehmungsabwehr? Der Effekt wird dadurch konfundiert, dass die Tabuwörter im Alltag seltener verwendet werden als die neutralen und somit schwerer erkannt werden; zudem Möglichkeit, dass die Probanden die Wörter zwar schon früher erkannt haben, jedoch nochmals sicher gehen wollten, das Tabuwort gesehen zu haben, bevor sie es wirklich dem Versuchsleiter sagten; 14. Erläutern Sie die Katharsis-Hypothese. Warum spricht der Befund, dass häufiger Konsum von Filmen mit Gewalt-Inhalten mit erhöhter Aggressivität einhergeht, nicht unbedingt gegen die Katharsis-Hypothese? Die Katharsis-Hypothese geht davon aus, dass Aggression bzw. Feindseligkeit durch stellvertretende Gewalt (z.B. Ego-Shooter-Spielen) abgebaut werden kann, da der Aggressionstrieb so reduziert werde. Der Befund, dass Gewaltfilme Aggressivität sogar erhöhen spricht nicht unbedingt dagegen, da zum einen in Korrelationsstudien Konfundierungen durch Variablen wie sozioökonomischer Status auftreten können (möglicherweise höhere Gewaltbereitschaft bei niedrigem SÖS, und die meisten der Teilnehmer an Studie haben niedrigen SÖS) und zudem Gewaltfilme ohnehin nur bei schon Aggressiven das Gewaltpotenzial verringern sollten. Bei wenig Aggressiven könnte es die Aggression erhöhen, da sie ihren Aggressionstrieb sonst anderweitig befriedigen und durch die Videos ein Vorbild für eine neue Möglichkeit dazu bekommen könnten. 15. Welche Beobachtungen haben dazu geführt, dass das Triebkonzept in die Lerntheorie eingeführt wurde? Die Beobachtung, dass satte Tiere in Experimenten weniger gut lernen als hungrige oder gelerntes Verhalten weniger häufig zeigen, führte zum Schluss, dass Triebbefriedigung als Verstärker wirken müsse. Dies führte dazu, dass die Stärke der Defizitmotivation, also eines unbefriedigten Bedürfnisses, als ein wichtiger Faktor für Lernen erkannt und in die Lerntheorie aufgenommen wurde. 16. Wie werden primäre Triebzustände in der Lerntheorie aufgefasst und wie werden sie operationalisiert? Primäre Triebzustände werden in der Lerntheorie als Verstärker für Verhalten verstanden, da sie eine Defizitmotivation erzeugen, durch die der Trieb befriedigt werden soll. Primäre Triebe werden auf wenige Kategorien beschränkt und als an physiologische Mangelzustände gekoppelt gesehen (z.B. Hunger Sättigungstrieb). Operationalisiert werden sie im Labor an Tieren durch Deprivationsintervalle, also die Zeitabschnitte, für die das Tier ein bestimmtes Bedürfnis nicht mehr befriedigen konnte und in denen sich eine Defizitmotivation aufgebaut hat. Je länger die Deprivationsphase, desto stärker der Trieb. 17. Welche Implikationen ergeben sich aus der multiplikativen Verknüpfung von Trieb und Habit in der Theorie von Hull? Die multiplikative Verknüpfung von Trieb und Habit spiegelt die interaktive Beziehung der beiden Größen wider. Ein Habit zeigt die Verstärkungsgeschichte eines Verhaltens in einer bestimmten Situation auf, also wie stark die jeweilige Situation mit einer potenziellen Verstärkung assoziiert wird. Implikationen aus der multiplikativen Verknüpfung sind, dass die Effektstärke des einen Faktors vom anderen abhängt. Ist der Trieb oder der Habit gleich null, so wird für jeden beliebigen Betrag des anderen Faktors kein Verhalten auftreten. Auch für beide Faktoren ungleich null hat bei einem starken Habit eine hohe Triebstärke einen viel größeren Effekt als bei einem schwachen. 18. Durch welche experimentelle Evidenz konnte das Postulat der multiplikativen Verknüpfung von Trieb und Habit belegt werden? Schildern Sie Aufbau und Ergebnisse der Studie. Perin (1942): Ratten wurden trainiert, Hebel zu drücken, um Futter zu erhalten; Später erhielten Ratten durch Drücken kein Futter mehr; UV 1: Anzahl der vorherigen Verstärkungen (Stärke des Habits) UV 2: Manipulation der Triebstärke durch Nahrungsdeprivation (3 Std. oder 22 Std.) AV: Löschungsresistenz des Hebeldrückens Ergebnisse: Löschungsresistenz am geringsten, wenn kurze Deprivation + niedrige Verstärkungsanzahl und am höchsten für lange Deprivation + hohe Verstärkungsanzahl; jedoch keine linearen Zusammenhänge, sondern für die jeweilige Deprivationszeit asymptotische Annäherung an bestimmtes Maß von Löschungsresistenz mit zunehmender Verstärkungsanzahl dieses ist für lange Deprivation etwa dreimal so groß; allgemein immer stärkerer Effekt für häufige Verstärkung, wenn längere Deprivationszeit, bei fast gleicher Ausgangs-Löschungsresistenz der beiden Deprivationsintervalle für sehr niedrige Verstärkungsanzahl; Beleg von Interaktionseffekten und damit der multiplikativen Verknüpfung von Trieb und Habit; 19. Schildern Sie die Untersuchung von Webb (1949) zum Nachweis, dass Triebe unspezifisch Verhalten energetisieren. Webb (1949): Tieren wird beigebracht, Hebel für Futter zu drücken; Sie werden danach entweder 22 Std. nahrungsdepriviert oder verschieden lang flüssigkeitsdepriviert (+ Kontrollgruppe), und die Löschungsresistenz des Hebeldrückens gemessen, nachdem dieser kein Futter mehr bringt; Ergebnisse: Obwohl stärkste Löschungsresistenz für Futterdeprivation, erhöht sich die Löschungsresistenz des Hebeldrückens auch mit Zunahme des Wasserdeprivations-Intervalls fast linear! Trinktrieb energetisiert also auch Verhalten, dass nur mit Futter assoziiert wird; Unspezifische Energetisierung von Verhalten; 20. Schildern Sie Aufbau und Ergebnisse der Untersuchungen von Crespi (1942) zum Nachweis von Anreizeffekten. Warum lassen sich diese Anreizeffekte mit der ursprünglichen Theorie von Hull nicht erklären? Crespi (1942): 3 Gruppen von Versuchstieren laufen in 20 Durchgängen durch ein Labyrinth und werden am Ende mit entweder 1, 16 oder 256 Futterkugeln verstärkt; nach dem 20. Durchgang wird die Futtermenge bei allen 3 Gruppen auf 16 gesetzt; gemessen wird die Laufgeschwindigkeit der Tiere in jedem Durchgang; Ergebnisse: erwartungsgemäß laufen die Tiere schon nach wenigen Durchgängen am schnellsten, die mit 256 Futterkugeln verstärkt werden, und die am langsamsten, die nur eine erhalten; Nach dem Anreizwechsel jedoch sinkt die Performanz der Gruppe, die zuvor 256 Kugeln erhielt massiv und schnell ab, wohingegen die der Gruppe, die zuvor 1 erhielt, genauso stark ansteigt; die Gruppe mit auch ursprünglich 16 erhöht die Laufgeschwindigkeit konstant wie zuvor; Mit ursprünglicher Theorie von Hull nicht erklärbar, da zwar bis Durchgang 20 je nach Verstärkungsmenge die Performanz kontinuierlich zunimmt (also verschieden starke habits gebildet werden), jedoch nach dem Anreizwechsel die Performanz jeweils drastisch und schlagartig absinkt bzw. ansteigt und nicht wie nach Hulls Theorie zu erwarten wäre, durch niedrigere/höhere Verstärkungsrate eine kontinuierliche Modifikation des habit stattfindet; 21. Wie lautet die Formel zur Berechnung der Verhaltensstärke im erweiterten Motivationsmodell von Hull? Erläutern Sie jede Komponente der Formel. V = D x SHR x K - - V = Stärke des gezeigten Verhaltens D = Triebstärke, die das Verhalten unspezifisch desto stärker energetisiert, je größer sie ist SHR = habit-Stärke, also Stärke der Assoziation der Situation mit einem bestimmten Verhalten, bedingt durch die Häufigkeit und Menge der vorherigen Verstärkung des Verhaltens in dieser Situation K = Stärke der Konsummation, also Stärke des Anreizes einer Situation bedingt durch antizipierte Verstärkungsmenge 22. Erklären Sie die Wirkung von Anreizen auf das Verhalten mit Hilfe des Mechanismus der fragmentarischen antizipatorischen Zielreaktion. In einer Situation S1 wird eine Reaktion R1 ausgeführt, in einer weiteren Situation S2 eine Reaktion R2, usw. bis eine antizipatorische Zielreaktion Rn auf eine Situation Sn die gewünschte Befriedigung in Form des Zielreizes sG zur Folge hat. Im weiteren Verlauf gewinnen nun schon die frühen Reaktionen R1 und R2 auf die Situationen S1 und S2 eine bestimmte sensorische Reizqualität, die später direkt mit der jeweils nächsten Reaktion assoziiert wird, und zwar auch ohne Eintreten der jeweils nächsten Situation. s1 wird direkt mit R2, s2 direkt mit R3, usw. assoziiert, so dass schließlich eine Assoziationskette entsteht, die bei S1 beginnt und sG zum Ziel hat und die schon allein durch S1 aktiviert wird. So wird S1 mit sG ohne weitere situative Hinweisreize oder Durchführung des Verhaltens direkt verknüpft. Das eigentliche Verhalten verkommt zu einem Rudiment. Wenn sich nun sG verändert, so wird dies direkt mit der Grundsituation S1 assoziiert und erhöht oder erniedrigt die Konsummations- und damit die Verhaltensstärke. 23. Erläutern Sie das Konzept der Triebreize. Schildern Sie die Untersuchung von Hull (1933) zum Nachweis der steuernden Funktion dieser Triebreize auf das Verhalten. Das Konzept der Triebreize besagt, dass auch Triebe selbst eine bestimmte Reizqualität besitzen und habit-erzeugende „Situationen“ sind. Der Trieb selbst bleibt hierbei unspezifisch, jedoch bildet sich ein triebspezifischer habit SDhR heraus, dessen R für triebspezifische Situationen die höchste Assoziationsstärke besitzt. Hull (1933): Ratten wurden nahrungs- oder flüssigkeitsdepriviert und in ein Labyrinth mit 2 Wegalternativen gesetzt, wobei jeweils eine am Ziel mit Wasser und die andere mit Futter verstärkt wurde; gemessen wurde die Wegpräferenz und ob sich hierbei eine triebspezifische Ausprägung abzeichnet; Ergebnis: es bilden sich nach und nach Präferenzen für den Weg heraus, der jeweils triebspezifisch verstärkt wird; der jeweils höhere Verstärkerwert bildet einen stärkeren habit aus; Beleg für steuernde Funktion der Triebreize; langsame Präferenzbildung entspricht kumulativem habit-Bildungs-Konzept; 24. Erläutern Sie das Yerkes-Dodson-Gesetz der Motivation. Inwiefern sind die hier beschriebenen Zusammenhänge wichtig für die Verhaltensvorhersage auf der Basis trieb- oder aktivationstheoretischer Ansätze? Das Yerkes-Dodson-Gesetz besagt, dass die Verhaltensleistung umgekehrt U-förmig vom Erregungsniveau abhängt, also die schlechteste Leistung bei sehr hoher oder sehr niedriger Aktivierung erbracht wird, und dass das Performanzmaximum zusätzlich von der Aufgabenschwierigkeit abhängt, wobei für leichtere Aufgaben ein höheres Aktivierungsniveau optimal ist als für schwere. Diese Zusammenhänge sind wichtig für die trieb- oder aktivationstheoretische Verhaltensvorhersage, da sie eine Unterscheidung zwischen Verhaltensstärke und qualität treffen und somit eine interaktive Komponente einführen, die das starre Konzept der Triebreduktion und habit-Bildung nicht erklären kann. Für die Vorhersage der Leistung muss also die Qualität des jeweiligen Verhaltens mit einbezogen werden. 25. Worin besteht die Kernannahme von Berlynes Aktivationstheorie? Die Aktivationstheorie von Berlyne geht davon aus, dass es ein optimales Aktivierungsniveau gibt, das vom Organismus angestrebt wird. Aktivierung findet nach Berlyne nicht nur durch Triebdruck, sondern auch durch die Umgebungskomplexität statt. Ist das Aktivierungsniveau zu hoch, so entsteht das Bedürfnis, es zu senken. Für eine komplexe Umweltstimulation würde hier durch spezifische Neugier eine Reduktion der Umgebungskomplexität und damit der Aktivierung angestrebt, um das Aktivierungsniveau auf ein optimales Level zu senken. Für eine zu niedrige Aktivierung würde bei einer den Organismus unterfordernden Umgebungskomplexität Explorationsverhalten auftreten, um dadurch die Stimuluskomplexität zu erhöhen, Langeweile und daraus resultierende innere Unruhe zu unterbinden und den Organismus auf ein optimales Aktivierungsniveau anzuheben. 26. Definieren Sie die Begriffe der spezifischen und diversiven Neugier. Was sind jeweils Auslösebedingungen für diese beiden Formen des Neugierverhaltens? Was ist ihre gemeinsame Funktion? Spezifische Neugier bedeutet die aktive Reduktion der Umgebungskomplexität durch Fokusierung auf bestimmte zielrelevante Informationen und Aspekte dieser. Diversive Neugier meint unspezifisches und exploratives Verhalten, bei dem allen Informationen und Aspekten gleiche Aufmerksamkeit geschenkt und kein spezifisches Ziel verfolgt wird. Spezifische Neugier wird ausgelöst durch eine den Organismus überfordernde Umgebungskomplexität, die auf diese Weise auf ein überschaubares Niveau gesenkt werden soll. Diversive Neugier zielt ab auf die Erhöhung der Komplexität bei den Organismus unterfordernden Umweltstimuli und wird durch ebensolche unterfordernden Umgebungen ausgelöst. Beide Formen des Neugierverhaltens haben das Ziel, das Aktivierungsniveau des Organismus auf einen optimalen Leistungslevel zu bringen. III. Kraft II – Feldtheorie 27. Warum heißt Lewins Motivationstheorie „Feld“-Theorie? Der Begriff „Feld“ ist in Lewins Theorie als analog zu einem physikalischen Kraftfeld zu sehen, in dem unsichtbare Kräfte wie elektro-magnetische Wellen Kräfte auf Körper ausüben. Ein dynamisches „Feld“, in dem sich eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet, setzt sich zusammen aus äußeren Umweltvariablen und Personenvariablen, so dass das Verhalten als Funktion von inneren und äußeren Einflüssen aufgefasst und als solches durch diese vorhergesagt und/oder erklärt werden kann. 28. Wie ist das Personenmodell in Lewins Feldtheorie aufgebaut? Lewins Personenmodell unterteilt die Person psychologisch in verschiedene Bereiche: Bedürfnisse wie Anerkennung oder Geborgenheit und Quasibedürfnisse. Zu letzteren zählen Ziele wie Familie und Karriere und Vornahmen, also konkrete Handlungsvorhaben, die in Verhalten umgesetzt werden. Diese drei Bereiche sind von innen nach außen gegliedert, wobei Bedürfnisse am weitesten innen und Vornahmen außen, dem Verhalten am nächsten, stehen. Ein Bedürfnis kann gespannt oder entspannt sein. Spannung wird jeweils solange aufrechterhalten, bis das spezifische Bedürfnis befriedigt wird. Dies kann nur über Ziele, Vorhaben und Verhaltensweisen geschehen, die mit dem Bedürfnis über Ähnlichkeitsverhältnisse verbunden sind. Ein angespanntes Bedürfnis aktiviert zielbezogene Verhaltensweisen und sensibilisiert Wahrnehmung und Gedächtnis für jeweilige bedürfnisrelevante Informationen und Inhalte. Sind mehrere Ziele und Vornahmen äquivalent, also mit demselben Bedürfnis verbunden, so kann durch Kraftübertragung das Bedürfnis durch jeweils verschiedene Alternativen (Substitution/Ersatzhandlungen) befriedigt werden, wenn ein ursprünglicher Bereich blockiert ist. Der Substitutwert eines alternativen Bereichs ist desto größer, je durchlässiger die Grenze zwischen den Bereichen ist, je ähnlicher sie sich also sind. Zwei Bereiche, die keine Grenze teilen, sind unabhängig voneinander, es kann keine Kräfteübertragung und somit keine Bedürfnisbefriedigung über nichtähnliche Ziele und Vornahmen erreicht werden. 29. Beschreiben Sie die Auswirkungen gespannter Bereiche in der Person auf Handeln und Kognition anhand eines Beispiels. Wenn z.B. das Bedürfnis nach Anerkennung gespannt ist und das Ziel berufliche Karriere aktiviert hat, kann eine Person die Vornahme haben, eine geschriebene Bewerbung in den nächsten Briefkasten zu werfen. Sie wird nun Orte aufsuchen, an denen sie Briekästen vermutet, eine sensibilisierte Wahrnehmung für die Farbe Gelb und Kästen entwickeln und darüber nachdenken, wo der nächste Briefkasten wohl zu finden sein mag, wozu ihr Gedächtnis für diesen spezifischen Inhalt sensibilisiert wird. 30. Wie kann ein in der Person herrschender Spannungszustand abgebaut werden? Nennen Sie unterschiedliche Möglichkeiten auf der Basis der Feldtheorie. Ein Spannungszustand ist auf spezifische Bedürfnisse zurückzuführen. Er kann entweder durch Befriedigung dieser oder benachbarter ähnlicher Bedürfnisse abgebaut werden. Es kann dabei eine Kräfteübertragung von einem in einen anderen Bereich stattfinden. Gleiches gilt für weiter außen gelegene Quasibedürfnisse, die sich aus Grundbedürfnissen ableiten. Sie können direkt oder im Falle einer Blockade auf Umwegen über Ähnlichkeitsverhältnisse mit Hilfe von Kräfteübertragung auf benachbarte Bereiche befriedigt werden. Bei einer alternativen Befriedigung und einem daraus folgenden Spannungsabbau spricht man von Substitution oder Ersatzhandlung. Grundsätzlich muss ein Bedürfnis über Quasibedürfnisse und konkrete Handlungen befriedigt werden. Dies ist nur über ähnliche und äquivalente Bereiche möglich. 31. Was ist nach Lewin eine Ersatzhandlung? Geben Sie ein Beispiel. Wie erklärt man Ersatzhandlungen? Eine Ersatzhandlung ist ein gezeigtes Verhalten, das durch Substitution statt eines eigentlichen Verhaltens gezeigt wird, jedoch die gleichen Quasibedürfnisse und Bedürfnisse wie die ursprünglich gewollte Handlung befriedigt und somit innere Spannung abbaut. Will man beispielsweise eine Familie gründen, kann aber keine eigenen Kinder bekommen, so kann das Ziel der Familiengründung auch über eine Adoption befriedigt werden. Erklärt wird dies durch Kräfteübertragung zwischen durchlässigen, benachbarten – also ähnlichen – Bereichen, bei der die Spannung übertragen und stellvertretend abgebaut wird. 32. Beschreiben Sie Ablauf und Ergebnisse der Untersuchung von Zeigarnik (1927). Wie erklärt man das Ergebnis auf der Basis der Feldtheorie? Zeigarnik (1927): kleine Kinder bekommen eine Reihe von leichten Aufgaben; bei der Hälfte der Aufgaben wird so viel Zeit gegeben, bis sie fertig sind, bei der anderen Hälfte werden sie vorher unterbrochen; am Ende werden die Kinder gefragt, an was sie sich noch erinnern können; These: innere Spannung bleibt so lange erhalten, bis die Aufgabe erledigt, also das subjektive Erfolgskriterium eingetreten ist; Ergebnis: die Aufgaben, die vor der Fertigstellung unterbrochen werden, können besser erinnert werden; Feldtheorie: dadurch, dass innere Spannung beim Lösen der Aufgabe noch nicht abgebaut wurde, da unterbrochen wurde, bleiben die Gedächtnisinhalte für diese Aufgaben zugänglicher, da zielbezogene Inhalte in Spannungszuständen zugänglicher sind; 33. Wie kann man mit der Feldtheorie erklären, dass in der Untersuchung von Marrow (1938) mehr abgeschlossene als unterbrochene Aufgaben erinnert wurden? Die Studie von Marrow wurde genauso durchgeführt wie die von Zeigarnik (1927), mit dem einen Unterschied, dass den Kindern gesagt wurde, sie würden beim Aufgabenlösen immer dann unterbrochen, wenn sie auf einem guten Weg seien und zeigen würden, dass sie in der Lage seien, die Aufgabe gut zu lösen. Somit wird das Unterbrochen-Werden bei den Aufgaben zum subjektiven Erfolgskriterium, so dass die innere Spannung dann erhalten bleibt, wenn nicht unterbrochen wird, also die Aufgabe scheinbar nicht gut genug bearbeitet wurde. Der Mechanismus der Feldtheorie der zielrelevanten Gedächtnisaktivierung unter Spannung ist genauso wirksam, nur das Kriterium zum Spannungsabbau wurde ins Gegenteil verkehrt. 34. Was versteht man unter Wiederaufnahmetendenzen? Schildern Sie hierzu Ablauf und Ergebnisse der Untersuchung von Ovsiankina und erklären Sie das Ergebnis auf der Basis der Feldtheorie. Ovsiankina (1928): Es wurden Kinder beim Lösen verschiedener Aufgaben unterbrochen oder nicht, und die spontane Wiederaufnahmetendenz für die unerledigten Aufgaben gemessen, d.h., wie häufig versucht wurde, die unterbrochenen Aufgaben zu vollenden, nachdem die eigentliche Zeit abgelaufen war; Ergebnis: in über 80% der Fälle wurde versucht, die unerledigten Aufgaben zu Ende zu bringen, und zwar selbst dann, wenn dies vorher verboten worden war; Feldtheorie: in den Kindern verblieb eine gewisse Restspannung, da dass Erfolgskriterium noch nicht eingetreten war, so dass sie diese durch zielbezogene Handlungen – also Erledigen der Aufgabe – reduzieren wollten; 35. In den Untersuchungen von Lissner & Mahler konnte gezeigt werden, dass die Wiederaufnahmetendenz durch zwischenzeitlich ausgeführte Aktivitäten reduziert werden kann. Wie erklärt man dieses Ergebnis? Welche Aktivitäten besitzen einen hohen Substitutwert, welche nicht? Die reduzierten Wiederaufnahmetendenzen bei Lissner (1933) und Mahler (1933) erklärt man dadurch, dass ausgeführte Ersatzhandlungen, die sich aus dem gleichen Ziel wie die ursprüngliche Handlung speisen, die innere Spannung durch Kräfteübertragung reduzieren. Somit wird durch gesenkte Spannung auch die Wiederaufnahmetendenz für die ursprüngliche Handlung reduziert. Einen hohen Substitutwert besitzen solche Aufgaben, die der ursprünglichen möglichst ähnlich oder äquivalent zu ihr sind, sich aus dem gleichen Ziel speisen und bei denen eine durchlässige Grenze mit der Ursprungshandlung (Handlungsvornahme) vorliegt. 36. Erläutern Sie, was mit Bereichen und Grenzen in Lewins Umweltmodell gemeint ist. Lewins Umweltmodell gliedert die Umwelt psychologisch in Handlungsmöglichkeiten, die als Wege zu einem subjektiven Ziel aufgefasst und nach Mittel-Zweck-Relationen und Konsummation eingeteilt werden. Sie sind subjektiv konstruiert, da je nach Ziel ganz unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten bestehen, und wiederum eine Situation für unterschiedliche Ziele ganz unterschiedlich bewertet werden kann. Die Bereiche sind hierbei die einzelnen Teilhandlungsschritte auf dem Weg zum Ziel, zwischen denen es verschiedene Hindernisse gibt, die überwunden werden müssen (zeitlich, räumlich, finanziell, etc.). Diese Hindernisse sind die Grenzen zwischen den Bereichen. Sie sind ebenfalls subjektiv konstruiert, da je nach Ziel eine bestimmte Gegebenheit eine Handlungsmöglichkeit oder aber auch ein Hindernis darstellen kann. 37. Warum wird die Umwelt in Lewins Modell als „hodologischer“ Raum bezeichnet? „hodos“ ist griechisch für „Pfad“. „Hodologischer“ Raum meint die Gesamtheit einer Person zur Verfügung stehender Umweltbereiche, also Wege zu verschiedenen Zielen. Die Umwelt ist somit nach Lewin ein subjektiver Raum aus Handlungsmöglichkeiten, die auf verschiedenen Wegen Ziele und Bedürfnisse befriedigen und dabei das Verhalten einer Person in verschiedene Richtungen, auf verschiedene „Pfade“ lenken. 38. Definieren Sie den Begriff der Valenz in Lewins Feldtheorie. Die Valenz Va eines Zielbereichs in Lewins Feldtheorie ist definiert als Funktion der Bedürfnisspannung s und den dazu korrespondierenden Eigenschaften des Zielobjekts Z: Va = f(s, Z) Das bedeutet, dass Dinge keine Valenz als Eigenschaft an sich besitzen, sondern hinsichtlich ihrer Dienlichkeit zum spezifischen Spannungsabbau – Und damit zur (Quasi-)Bedürfnisbefriedigung – eine positive oder negative Wertigkeit und einen Betrag bezüglich dieser qualitativen Richtung zugewiesen bekommen. 39. Wie lautet die Formel zur Berechnung der Kraft, die von einem Umweltobjekt auf eine Person wirkt, nach Lewins Feldtheorie? Va f(s, Z) K= d = d - - - K = motivationale Kraft, also Stärke der anziehenden bzw. abstoßenden Wirkung des Zielobjekts Quotient aus: Va = Valenz, definiert als Funktion der Bedürfnisspannung s und den korrespondierenden Zielobjekteigenschaften Z und d = Distanz zum Zielobjekt Je größer die Distanz, desto kleiner die motivationale Kraft; 40. Wovon wird das Verhalten einer Person beeinflusst: von der positiven oder negativen Valenz, die ein Objekt oder eine Situation für eine Person besitzt, oder von der Kraft, die von diesem Objekt bzw. dieser Situation ausgeht? Das Verhalten einer Person wird direkt von der motivationalen Kraft eines Objekts oder einer Situation beeinflusst, die als der Quotient aus Valenz und Distanz (nicht nur räumliche Distanz!) aufgefasst wird. Die Richtung und der Betrag der Kraft ist es, der letztlich bestimmt, wie und wie stark eine Person reagiert. Eine hohe Valenz kann hierbei durch große Distanz gepuffert werden, ebenso kann eine geringe Valenz durch große Nähe zum Zielobjekt in ihrer Wirkung gesteigert werden. Die Valenz beeinflusst das Verhalten somit zwar indirekt, jedoch ist die motivationale Kraft ausschlaggebend, die von dem Objekt oder der Situation ausgeht. Diese hängt zusätzlich von der Distanz zum Objekt ab. 41. Was bedeutet Distanz in Lewins Theorie (geben Sie mindestens zwei verschiedene Beispiele) und welche Rolle spielt die psychologische Distanz für das Umweltmodell in Lewins Feldtheorie? Distanz wird in Lewins Theorie grundsätzlich als psychologisches Konstrukt definiert. Es handelt sich um die Distanz zum Zielobjekt oder der Zielsituation aus subjektiver Sicht. Dies kann durchaus eine räumlich zu überbrückende Distanz sein, jedoch genauso eine zeitliche, eine Zahl zu vollbringender Handlungsschritte oder auch ein Geldbetrag, der eine Person von einem Zielobjekt trennt. Mit Distanz ist alles gemeint, was eine Person vom Erreichen des Ziels trennt. Will eine Frau z.B. teure Schuhe kaufen, so stellt abhängig von ihrem Reichtum der Preis der Schuhe eine mehr oder weniger große Distanz zu ihnen her. Auch ist die psychologische Distanz zum monatlichen Gehalt, abhängig von Tag im Monat, unterschiedlich groß. Sie ist nämlich dann am größten, wenn man zeitlich noch am weitesten von der nächsten Zahlung entfernt ist. In Lewins Feldtheorie setzt sich die motivationale Kraft eines Zielobjekts oder einer Zielsituation als Quotient aus der Valenz geteilt durch die psychologische Distanz zusammen. Hierbei ist die motivationale Kraft – also die abstoßende oder anziehende Wirkung – eines Objekts desto größer, je kleiner die Distanz zu ihm, und desto kleiner, je größer die Distanz. 42. Schildern Sie Aufbau und Ergebnisse der Untersuchung von Hull (1934) zum Zusammenhang von Zieldistanz und Verhaltensintensität. Hull (1934): Ratten wurden für das erfolgreiche Absolvieren eines Labyrinths mit Futter verstärkt, wobei jeweils die Zeit, die für die Wegabschnitte 0-5 bis zum Ziel benötigt wurde an den ersten drei Tagen und den darauf folgenden drei Tagen gemessen und gemittelt wurde; Ergebnis: Je näher ein Wegabschnitt dem Zielpunkt des Labyrinths ist, desto kürzer benötigen die Ratten, um ihn zu bewältigen; der Effekt nimmt zwar nach längerem Training in den zweiten 3 Tagen ab, da die ersten Abschnitte schneller durchlaufen werden, ist aber dennoch auch an Tag 4-6 stabil manifest; Je kleiner die Zieldistanz, desto größer die Laufintensität; 43. Was ist ein Konflikt und wie zeigt er sich im Verhalten? Wie erklärt man Konflikte in Termini der Feldtheorie Lewins? Ein Konflikt ist eine Situation, in der mehr als eine Kraft in unterschiedliche Richtungen widerstreitend auf eine Person wirkt. Im Verhalten zeigt sich ein Konflikt in Form von entweder Immobilität oder schnell wechselndem Hin und Her zwischen widersprüchlichen Verhaltensweisen. Lewins Feldtheorie erklärt Konflikte als Gleichgewicht anziehender und/oder abstoßender Kräfte, die typologisch in verschiedene Konfliktarten untergliedert sind. 44. Definieren Sie die unterschiedlichen von Lewin postulierten Konflikttypen. Welche Konflikte lassen sich vergleichsweise leicht auflösen, welche sind dagegen schwieriger aufzulösen? Warum? 1. Annäherungs-Annäherungs-Konflikt: 2 sich gegenseitig ausschließende Objekte positiver Valenz versetzen verschiedene Personenbereiche in Anspannung, und zwar auf eine solche Weise, dass der Quotient aus Valenz und Distanz für beide Handlungsalternativen kurzzeitig gleich ist; Vergleichsweise leicht aufzulösen: ein zufälliges Element verschiebt das Distanzgleichgewicht in eine bestimmte Richtung; dadurch wird die Asymmetrie im Kräftefeld eigendynamisch zugunsten der näheren Alternative verschoben; 2. Vermeidungs-Vermeidungs-Konflikt: 2 Objekte negativer Valenz versetzen verschiedene Personenbereiche in Anspannung, und zwar auf eine solche Weise, dass die negative motivationalen Kräfte, aus Valenz geteilt durch Distanz, gleich sind und für beide Handlungsalternativen die gleiche aversive Kraft entsteht, so dass beiden gleich stark ausgewichen werden will, wobei es keine dritte Handlungsalternative gibt; Schwierig aufzulösen, da Annäherung an eine Handlungsalternative die aversive Kraft dieser Alternative erhöht und die der anderen senkt, so dass wieder in die andere Richtung tendiert wird; Auflösung nur möglich, wenn sich Valenzen der Zielobjekte zugunsten eines der beiden verschieben; 3. Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt: ein ambivalentes Objekt versetzt zur selben Zeit verschiedene Personenbereiche in Anspannung, und zwar auf eine solche Weise, dass gleich große appetitive und aversive Kräfte entstehen, die sowohl Vermeidungs- wie auch Annäherungstendenzen bedingen; der Vermeidungsgradient verläuft hierbei steiler als der Annäherungsgradient, so dass bei einer Annäherung an das Objekt über den Punkt des Kräftegleichgewichts hinaus Vermeidungstendenzen überwiegen und zurückgeschreckt wird, wobei bei einer Entfernung vom Punkt des Kräftegleichgewichts aus Annäherungstendenzen überwiegen, so dass sich das Verhalten wieder in Richtung des Objekts umkehrt; Schwierig aufzulösen, da Annäherung an das Objekt stärker Vermeidungsverhalten und Entfernung vom Objekt stärker Annäherungsverhalten hervorruft; auflösbar nur durch Verschiebung im Valenzgleichgewicht, so dass entweder positive oder negative Aspekte des Objekts überwiegen; 4. Doppelter Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt: 2 ambivalente Objekte versetzen jeweils verschiedene Personenbereiche in Anspannung, und zwar auf eine solche Weise, dass für jedes appetitive und aversive Kräfte entstehen, die für beide Alternativen Annäherungs- und Vermeidungstendenzen bedingen; strukturell ähnelt dieser Konflikt dem Vermeidungs-Vermeidungs-Konflikt, nur dass bei Annäherung an ein Objekt, bevor der Punkt des Kräftegleichgewichts erreicht ist, zunächst eine appetitive Kraft zum Objekt hingeht; Schwierig aufzulösen, da für geringe Distanz zu einem der Objekte jeweils aversive und für größere Entfernung appetitive Tendenzen entstehen; im Gegensatz zu 1. Ist für Annäherung an ein Objekt noch keine sichere Entscheidung gefallen, da die aversiven Tendenzen desto stärker werden, je weiter sich angenähert wird; auflösbar durch Verschiebung des Valenzgleichgewichts für eine der beiden Alternativen; 45. Beschreiben Sie das Verhalten bei einem Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt (Beispiel) und erklären Sie das beobachtete Verhalten mit Millers Gradientenmodell. Wie erklärt sich die unterschiedliche Steigung der Gradienten? Das Verhalten bei einem Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt, z.B. bei einer Katze, die um den heißen Brei schleicht, sieht so aus, dass sie sich dem Brei immer wieder bis zu einem bestimmten Punkt annähert, um dann wieder umzukehren, bis sie wiederum an einem bestimmten Punkt kehrtmacht, um sich dem Brei erneut zuzuwenden. Millers Gradientenmodell nimmt an, dass der Vermeidungsgradient in Richtung des Zielobjekts steiler ansteigt als der Annäherungsgradient, so dass für Annäherung an das Objekt ab einem bestimmten Punkt aversive Tendenzen überwiegen und Vermeidungsverhalten gezeigt wird, wohingegen bei Entfernung vom Objekt über den Schnittpunkt der beiden Gradienten hinaus appetitive Tendenzen überwiegen und wiederum Annäherungsverhalten auslösen. Miller erklärt die unterschiedlich steilen Gradienten mit aversiver Konditionierung auf diskriminative Hinweisreize, in diesem Fall z.B. die vom Brei ausströmende Hitze, die sekundäre Furcht auslösen und bei Annäherung an das Objekt schließlich aversive Tendenzen überwiegen lassen. Bei Entfernung vom Objekt kommt es zu keiner konditionierten Furchtreaktion, so dass die Attraktion des Objekts überwiegt und sich wieder angenähert wird. 46. Erläutern Sie den Begriff des „Time discounting“. „Time discounting“ meint den Effekt, dass der motivationale Wert eines Anreizes desto schwächer ist, je weiter in der Zukunft er liegt, bzw. dass ein zukünftiger Anreiz einen desto größeren Wert erhält, je näher er der Gegenwart zeitlich kommt. Wichtig ist das Konzept des „Time discounting“, wenn die Struktur von Versuchungssituationen untersucht werden sollen, wenn man also wissen will, wann ein kurzfristiger Anreiz, der an sich schwach, aufgrund seiner zeitlichen Nähe jedoch stärker präsent ist, einen an sich großen, zeitlich aber weit entfernten Anreiz überwiegen kann und eine Person vom langfristigen Ziel abbringt. 47. Worin besteht eine Versuchungssituation? Wie kann man erklären, dass man einer Versuchung nachgibt? Welcher Zeitraum ist besonders kritisch? Eine Versuchungssituation besteht in der Konkurrenz eines starken, jedoch zeitlich noch weit entfernten und eines an sich schwachen, jedoch zeitlich unmittelbar verfügbaren und sofort realisierbaren Anreizes (smaller-sooner, SS vs. larger-later, LL). Einer Versuchung gibt man dann nach, wenn der Wert eines kurzfristigen Anreizes in unmittelbarer zeitlicher Nähe den des starken, jedoch weit entfernten und somit abgewerteten Anreizes überwiegt (SS-Dominanz). Kritisch ist hierbei die Zeitspanne, ab der der schwache Anreiz, der, wenn er ebenfalls in der Zukunft liegt, dem starken unterliegt, zeitlich immer näher rückt und sein Wert durch diese zeitliche Nähe schließlich gleich mit dem des starken Anreizes wird oder über diesen dominiert. Wenn ein schwacher, zeitlich naher Anreiz einem starken, weit entfernten Anreiz schließlich im Wert entspricht, ist er in kritische Nähe gerückt. 48. Erklären Sie, was mit preference reversal gemeint ist, und geben Sie ein Alltagsbeispiel. Preference reversal bezeichnet das Phänomen, dass zunächst bei zeitlicher Entfernung ein starker Anreiz (LL) schwache Anreize im Wert überwiegt, bei kritischer zeitlicher Nähe jedoch schließlich eine Handlungsalternative gewählt wird, die einem schwachen, unmittelbar realisierbaren Anreiz (SS) folgt, der den starken in dieser Situation dominiert. Es kehren sich nicht eigentlich die Präferenzen um, sondern es dominiert vielmehr der SS bei kritischer Nähe. Ein Alltagsbeispiel ist die Vornahme, am nächsten Morgen in die Vorlesung zu gehen. Solange der Morgen in zeitlicher Entfernung liegt, ist man fest entschlossen, die Vornahme zu realisieren. Am nächsten Morgen jedoch kann mitunter die Option, noch weiter zu schlafen, als sofort realisierbarer Anreiz überwiegen und spontan beschlossen werden, die Vorlesung nicht besuchen. 49. Warum kann man das Phänomen des preference reversal nicht mit einem einfachen linearen Diskontierungsmodell erklären? Wie muss der Diskontierungsprozess gefasst werden, damit man damit auch preference reversal erklären kann? Nennen Sie die entsprechende Formel und erläutern Sie deren Komponenten. Würde preference reversal einem linearen Diskontierungsmodell folgen, dann würde durch die lineare Steigung der Geraden stets eine Kurve oberhalb der anderen verlaufen und somit immer ein Anreiz überwiegen. Es könnte nicht zu einem scheinbaren Präferenzwechsel kommen, also keine Dominanz eines SS bei kritischer zeitlicher Nähe auftreten. Ein einmal einen anderen dominierender Anreiz könnte nicht mehr unterliegen. Damit preference reversal erklärt werden kann, muss von einem hyperbolischen Verlauf der Diskontierungskurven ausgegangen werden, der für unmittelbare zeitliche Nähe den Wert des SS rapide und disproportional ansteigen und die zunächst höher gelegene LL-Kurve schneiden und dann dominieren lässt. Die Formel V für eine Diskontierungsfunktion lautet: v = 1 + kd , wobei v dem aktuellen diskontierten Wert, V dem undiskontierten Wert, d der Distanz und k dem jeweiligen Diskontierungsparameter entspricht. Als Nenner wird 1 + kd statt nur kd gewählt, damit für eine sehr kleine Distanz der Wert des Bruches V entspricht und nicht gegen unendlich geht, was unplausibel wäre. 50. Beschreiben Sie den Aufbau und die Ergebnisse der Studie von Rachlin & Green (1972) zum preference reversal. Rachlin & Green (1972): Tauben wurden zunächst vor die Entscheidung gestellt, eine blaue oder eine gelbe Taste zu drücken, wobei Blau sofortige 2-sekündige Futtergabe und Gelb 4-sekündige Futtergabe mit 4 sec Verzögerung zur Folge hatte; eine zweite eingeführte Bedingung ließ die Tauben zunächst zwischen einer roten und einer grünen Taste wählen, wobei Rot nach 10 sec die ursprüngliche Entscheidungssituation Blau-Gelb zur Folge hatte, und für Grün nach 14 sec ohne erneute Entscheidungssituation eine 4-sekündige Futtergabe folgte; Ergebnisse: bei Entscheidung zwischen Blau und Gelb drücken die Tauben Blau, obwohl Gelb an sich attraktiver wäre; bei der vorgeschalteten RotGrün-Entscheidung jedoch bevorzugen die Tauben Grün, so dass die Versuchung des sofortigen kurzen Verstärkers nach 10 sec vermieden und nach 14 sec der längere Verstärker konsumiert werden kann; Preference reversal: SS-Dominanz über LL bei sofortiger SS-Gabe und LLLatenz von 4 sec nicht überwindbar, für gleiche Latenz bei möglicher SSGabe nach 10 sec jedoch schon für kritische Nähe lässt sich SSDominanz nicht überwinden; es wird, wenn möglich, die Situation bevorzugt, in der es zu keiner Versuchungsentscheidung kommt! 51. Wofür stehen die Begriffe SS und LL in Versuchungssituationen? Skizzieren Sie entsprechend dem Modell der hyperbolischen Diskontierung graphisch den Verlauf von Präferenzen in Abhängigkeit von der zeitlichen Entfernung in einer Situation, in der ein SS- und ein LL-Anreiz miteinander konkurrieren. In einer Versuchungssituation steht SS (smaller-sooner) für einen eigentlich kleinen Anreiz, der durch kritische zeitliche Nähe attraktiver wird. LL (larger-later) steht für einen eigentlich starken Anreiz, der jedoch durch größere zeitliche Entfernung abgewertet und weniger attraktiv wird. 52. Inwiefern haben wiederholte Entscheidungssituationen die Struktur eines Gefangenendilemmas? Wie lässt sich das Dilemma auflösen? Ergänzen Sie Ihre Ausführungen mit einem Beispiel. Ein Gefangenendilemma grundsätzlich ist eine durch Spieltheoretiker erdachte Wahlsituation mit zwei Beteiligten, in der zwei Verbrecher jeweils entscheiden müssen, ob sie gestehen oder schweigen. Schweigen beide, bekommen beide nur 1 Jahr Gefängnis. Redet einer, während der andere schweigt, bekommt der Schweigende 10 Jahre und der Redende ist frei. Reden beide, so bekommen sie beide 9 Jahre. Das Dilemma an der Situation ist nun, dass – egal, wie sich der andere entscheidet – Reden an sich immer besser ist. Denn schweigt der andere, bringt Reden die Freiheit, redet der andere bringt Reden 9 statt 10 Jahren Gefängnis. Für beide ist es also am logischsten zu reden, was jedoch dazu führt, dass beide 9 Jahre erhalten, obwohl für das Schweigen beider jeder nur 1 Jahr bekommen hätte. Die plausibelste Entscheidung für beide führt also nicht zum bestmöglichen Ergebnis. Auf wiederholte Wahlsituationen lässt sich dasselbe Entscheidungsmodell anwenden. Man hat z.B. jetzt und auch in der Zukunft die Entscheidung, für das Studium zu lernen oder zu faulenzen. Es entstehen vier Kombinationsmöglichkeiten. Wer jetzt faulenzt und in Zukunft lernt, der genießt jetzt und schafft das Studium (++). Wer jetzt und auch in Zukunft lernt, verfehlt den Genuss, schafft aber das Studium (+). Wer jetzt und in Zukunft faulenzt, genießt jetzt, schafft aber das Studium nicht (-), und wer jetzt lernt, aber in Zukunft faulenzt, verfehlt den Genuss und schafft das Studium nicht(--). Die beste Wahlalternative scheint also zu sein, jetzt zu faulenzen und in Zukunft zu arbeiten. Und auch, wenn man in Zukunft faulenzen will, ist jetzt zu faulenzen die bessere der beiden Alternativen. Faulenzen ist also in jedem Fall die bessere Entscheidung. Dies wiederum gilt jedoch für jeden einzelnen Tag, so dass man das Studium am Ende nicht schafft, wenn man jeden Tag faulenzt, obwohl dies an sich stets die beste Alternative ist. Dies ist das Dilemma: Jeden Tag das Beste zu wählen, lässt einen des Endziel verfehlen. Auflösen lässt sich das Dilemma, indem man sich klarmacht, dass Entscheidungen heute von Entscheidungen in der Zukunft nicht unabhängig sind, sondern sogar diagnostisch dafür. Faulenzt man heute, dann wird man es wahrscheinlicher auch morgen und in Zukunft tun als wenn man heute lernt. Somit lassen sich die beiden Wahlalternativen streichen, die voraussetzen, dass man in Zukunft anders handeln wird, nämlich die, heute zu faulenzen und in Zukunft zu lernen (++) und die, heute zu lernen und in Zukunft zu faulenzen (--). Was bleibt, ist immer zu faulenzen (-) oder immer zu lernen (+), wobei man sich dann für die bessere Alternative, nämlich immer zu lernen, entscheiden wird. IV. Rationale Kalkulation I – Nutzenmaximierung 53. Welcher Aspekt des Verhaltens soll durch Nutzenmaximierungs- und Erwartung x Wert-Ansätze vor allem erklärt werden? Durch Nutzenmaximierungs- und Erwartung x Wert-Theorien soll vor allem die Richtung des Verhaltens und weniger seine Stärke erklärt werden. Man hat hierbei einen kognitiven Ansatz, der vor allem Antizipation und Bewertung von Handlungskonsequenzen einbezieht und davon ausgeht, dass der Mensch je nach subjektiven Präferenzen eine Entscheidung zwischen mehreren Alternativen trifft, nicht also ein willenloser Spielball psychologischer Kräfte ist. 54. Was ist eine Nutzenfunktion? Eine Nutzenfunktion u ordnet als Vektoren verschiedener Aspekte gegebenen Ergebnissen subjektive Nutzenwerte zu und ordnet die Ergebnisse damit hierarchisch. Sie ist keine Theorie der Entstehung subjektiver Nutzenantizipation, sondern bildet lediglich den Nutzen von Ergebnissen auf eine uniforme und numerische Nutzendimension ab. Eine Nutzenfunktion kann nicht direkt abgebildet werden, sondern muss aus Entscheidungen einer Person erschlossen werden nach dem Prinzip, dass ein Ergebnis y, das über ein anderes Ergebnis x präferiert wird einen Nutzenwert u(y) > u(x) hat. 55. Was versteht die Nutzenmaximierungstheorie unter einem (Handlungs-)Ergebnis (outcome)? Unter einem Ergebnis versteht die Nutzenmaximierungstheorie einen Vektor verschiedener Bewertungsaspekte einer Situation. Dieser setzt sich zusammen aus allen nutzenrelevanten Aspekten und gibt den subjektiven Nutzen einer Handlungsalternative wider. Um Ergebnisse vergleichbar zu machen, müssen sie durch eine Nutzenfunktion u auf eine uniforme Nutzendimension abgebildet werden. 56. Wie lässt sich nach von Neumann & Morgenstern der erwartete Nutzen einer Handlung ermitteln, wenn das Ergebnis dieser Handlung unsicher ist? Der erwartete Nutzen einer unsicheren Handlung kann aus der Summe der Nutzenwerte der potenziellen Ergebnisse gewichtet mit ihren jeweiligen Auftretenswahrscheinlichkeiten errechnet werden. Hat eine Handlung die möglichen Ausgänge x und y, und x tritt mit der Wahrscheinlichkeit p und y mit der Wahrscheinlichkeit q auf, dann ist der Nutzen der Handlung: u(x,p; y,q) = u(x) ∙ p + u(y) ∙ q. 57. Was ist die Grundidee der Nutzenmaximierung? Die Grundidee der Nutzenmaximierung ist die, dass der Mensch immer danach strebt, die Option mit dem höchsten subjektiven Nutzen zu wählen. Das Kriterium einer rationalen Entscheidung ist der höchste subjektive Nutzen dieser. Der Nutzen selbst wird ermittelt durch die Abbildung von Ergebnisvektoren auf eine uniforme Nutzenwertdimension, die Nutzenfunktion u. 58. Erklären Sie, was mit Risikoaversion gemeint ist. Mit Risikoaversion ist gemeint, dass man bei potenziellen Gewinnen im Gegensatz zu potenziellen Verlusten sicher gehen will und statt einer Alternative mit hohem Wert, aber geringer Auftretenswahrscheinlichkeit, lieber eine mit niedrigerem Wert und dafür hoher Auftretenswahrscheinlichkeit wählt. Erklärbar ist dies mit dem asymptotischen Verlauf der Nutzenfunktion, da der Wert eines Gewinns desto weniger stark zunimmt, je größer er wird. Ein potenziell höherer Gewinn wird damit nicht proportional zu seiner absoluten gesteigerten Größe wertvoller im Vergleich zu einem niedrigeren Gewinn. Somit nimmt man lieber einen niedrigeren, aber sichereren Gewinn, da ein vollständiger Gewinnverlust durch den Verlauf der Nutzenfunktion auch dann schwerer wiegen kann als das Nicht-Gewinnen der Differenz von größerem und kleineren Gewinn, wenn er eigentlich kleiner als diese ist. 59. Bei welchen Entscheidungssituationen beobachtet man typischerweise Risikoaversion, und bei welchen Situationen findet man Risikosuche? Schildern Sie hierzu ein Entscheidungsszenario. Wie erklärt man dieses Ergebnis? In Entscheidungssituationen, in denen es zwei mögliche Gewinne unterschiedlicher Höhe gibt, von denen der höhere mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als der niedrigere eintritt, beobachtet man typischerweise Risikoaversion, also die Tendenz, den sichereren, aber kleineren Gewinn dem unsichereren, aber größeren vorzuziehen. Risikosuche findet man bei potenziellen Verlusten, wobei typischerweise ein größerer Verlust, der aber mit einem niedrigeren Risiko eintritt, einem kleineren aber sichereren Verlust vorgezogen wird. Würde man z.B. vor die Entscheidung gestellt, sicher 10 Euro oder aber 20 Euro mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zu erhalten, würden wahrscheinlich die sicheren 10 Euro bevorzugt werden. Umgekehrt würde man bei einem sicheren Verlust von 10 Euro oder aber einem Verlust von 20 Euro, der mit einer 50%-Chance eintritt, letztere Alternative wählen. Erklären lassen sich Risikoaversion bei Gewinnentscheidungen und Risikosuche bei Verlustentscheidungen mit dem doppelt asymptotischen Verlauf der Nutzenfunktion, die im ersten und dritten Quadranten sich jeweils einem positiven bzw. negativen Wert annähert. Dies impliziert, dass höhere Gewinne im Wert nicht proportional zu ihrer gesteigerten Höhe wachsen, sondern desto weniger wertvoller werden, je größer sie werden. Ein doppelt so hoher Gewinn wird also als weniger als doppelt so wertvoll angesehen. Umgekehrt verhält es sich bei Verlusten, so dass ein höherer Verlust nicht im gleichen Maße, in dem er höher wird, als solcher empfunden wird. Ein höherer Verlust wird also als desto weniger schwerer empfunden, je höher er ist. Ein doppelt so hoher Verlust wird also nicht als doppelt so schlimm empfunden. 60. Was ist mit der Aussage „losses loom larger than gains“ in der prospect-Theorie von Kahneman & Tversky gemeint? Nennen Sie einen Beleg für diese These. „Losses loom larger than gains“ meint die Tatsache, dass der asymptotische Verlauf der Nutzenkurve im negativen Bereich relativ zum Verlauf im positiven Bereich steiler ist, also ein Verlust schwerer wiegt als ein Gewinn gleichen Betrages es in die andere Richtung tut. Man würde sich beispielsweise nicht auf ein Spiel einlassen, bei dem man mit 50%iger Chance 10 Euro gewinnt und mit 50%iger Chance 10 Euro verliert, da der Verlust von 10 Euro mehr Gewicht hat als der Gewinn der selben Summe. 61. Was versteht man unter framing-Effekten? Nennen Sie ein Beispiel für einen solchen framing-Effekt. Inwieweit widersprechen framing-Effekte klassischen Axiomen einer rationalen Nutzentheorie? Unter framing-Effekten versteht man das Phänomen, dass aufgrund des steileren Verlaufs der Verlustkurve der Nutzenfunktion verglichen mit der Gewinnkurve ein und dieselbe Entscheidungssituation, abhängig davon, ob sie als Gewinn- oder Verlustentscheidung dargestellt wird, von Menschen mitunter unterschiedlich bewertet und entschieden wird. Bsp.: Eine Krankheit bedroht 600 Menschenleben. Wird Programm A eingesetzt so überleben 200 und sterben 400 Menschen sicher, wird Programm B eingesetzt, so überleben alle und niemand stirbt mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel, mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln jedoch sterben alle und niemand überlebt. Ja nachdem, ob man die Situation als Gewinnentscheidung („Entweder rettet man 200 sicher oder man rettet 600 mit einem Drittel Wahrscheinlichkeit.“) oder als Verlustentscheidung („Man verliert 400 sicher oder verliert alle mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln.“) formuliert, entscheiden Menschen sich in derselben Situation völlig unterschiedlich. Bei der Formulierung als Gewinnentscheidung wählen 72% die sichere Rettung von 200, im Falle einer Verlustentscheidung wählen 78% den Tod von allen 600 mit einer Zwei-DrittelWahrscheinlichkeit. Abhängig von der Formulierung entscheidet man sich also in derselben Situation für verschiedene Alternativen. Damit widersprechen framing-Effekte den Konsistenzpostulaten der rationalen Nutzentheorie, die voraussetzen, dass eine Entscheidung, die über eine andere präferiert wird, einen höheren Nutzenwert hat und somit immer der anderen vorgezogen werden muss. Dies ist im obigen Beispiel nicht der Fall. 62. Welche Anomalien postulieren Kahneman & Tversky bei der Übersetzung objektiver Wahrscheinlichkeiten in subjektive Entscheidungsgewichte? Nennen Sie ein Beispiel, das die Auswirkungen dieser Sprünge und Ungleichmäßigkeiten dieses Zusammenhangs auf das Entscheidungsverhalten belegt. Bei der Übersetzung objektiver Wahrscheinlichkeiten in subjektive Entscheidungsgewichte postulieren Kahneman & Tversky, dass es qualitative Sprünge im unteren und oberen Bereich der Gewichtungsfunktion gibt. Zwischen Unmöglichkeit (p = 0) und einer nur marginal über Null liegenden Wahrscheinlichkeit findet eine drastische Erhöhung des subjektiven Gewichts statt, so dass eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit dramatisch überschätzt wird. Genauso wird eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, marginal kleiner als 1, im Vergleich zum sicheren Ereignis (p = 1.0) durch die Gewichtungsfunktion drastisch gesenkt und unterschätzt. Im Bereich relativ niedriger bis sehr hoher Wahrscheinlichkeiten liegt das subjektive Gewicht stets unter der objektiven Wahrscheinlichkeit. Im Bereich niedriger Wahrscheinlichkeiten schneiden sich die objektive und die Gewichtungsfunktion, so dass für sehr niedrige Wahrscheinlichkeiten bis zum Punkt des qualitativen Sprungs auf Null die Gewichtungsfunktion über den objektiven Werten verläuft. Ein Beispiel für die Anomalien im unteren Bereich der Gewichtungsfunktion: Eine Versicherung gegen Erdbeben (Erdbebenwahrscheinlichkeit p gering) kostet eine bestimmte Prämie. Diese ist einem Kunden zu hoch, so dass der Versicherungskaufmann vorschlägt, die Prämie zu halbieren und Schutz gegen Erdbeben dafür nur an ungeraden Daten zu gewährleisten. Objektiv hat sich das Angebot nun verbessert, da für die Hälfte des Geldes an über der Hälfte aller Tage des Jahres Schutz gewährleistet ist. Jedoch würde niemand auf den Vorschlag eingehen, da die Differenz der Erdbebenwahrscheinlichkeit p - p/2 als wesentlich geringer als die von p/2 auf 0 empfunden wird. 63. Was ist das Ziel der Spieltheorie? Die Spieltheorie modelliert menschliche Entscheidungssituationen. Ihr Anspruch ist es, eine normative Theorie menschlicher Entscheidungen zu sein, die aufzeigt, was in einer Situation die objektive beste Entscheidung ist, unter der Voraussetzung, dass das Handeln von Menschen auf Nutzenmaximierung ausgerichtet ist. Die objektiv beste Strategie eines Spiels wird seine „Lösung“ genannt. Zudem will die Spieltheorie darstellen, wie Menschen sich tatsächlich entscheiden, was sich nicht immer mit der objektiv besten Lösung deckt. Besonders relevant ist dies, wenn mehrere Spieler beteiligt sind und der Ausgang des Spiels von den kombinierten Entscheidungen aller abhängt. 64. Was ist ein soziales Interaktionsspiel? Nennen Sie ein typisches spieltheoretisches Beispiel. Ein soziales Interaktionsspiel ist ein Spiel mit mehreren Spielern, bei dem der Ausgang von der kombinierten Entscheidung aller Spieler abhängt. Optimiert wird dabei nur der eigene Nutzen jedes einzelnen. Interesse am Ergebnis anderer Spieler in Form von Neid, Missgunst oder Mitleid wird als im eigenen Nutzenwert implizit aufgefasst. Ein typisches Beispiel ist das Gefangenendilemma, bei der die Gefängnisstrafe eines Verbrechers für Aussage oder Schweigen stets von der Entscheidung seines Mitgefangenen abhängt. 65. Von welchen Faktoren hängt das Ergebnis für einen Spieler im Interaktionsspiel ab? Das Ergebnis eines Interaktionsspiels hängt stets von den kombinierten Entscheidungen aller ab, also für einen einzelnen Spieler von seiner eigenen Entscheidung und der seiner Mitspieler. 66. Für die Maximierungsentscheidung eines Spielers sind einzig und allein die persönlichen Nutzenwerte entscheidend; die Nutzenwerte der Mitspieler sind vollkommen irrelevant – sie spielen nur für die Erwartung bzgl. der zu erwartenden Handlungen der Mitspieler eine Rolle. Auf welchem Weg können im Rahmen der Spieltheorie dennoch Ziele, die sich direkt auf den Nutzen anderer Spieler beziehen (z.B. der Wunsch, mehr zu haben als der andere, der Wert der Fairness, etc.) Einfluss auf die Entscheidung nehmen? Dem rein objektiven Maximierungsnutzen werden mögliche Interessen am Nutzenwert der anderen Spieler eingespeist, so dass diese bereits im persönlichen Nutzenwert enthalten sind. Dabei kann es sich um Interessen handeln, die z.B. von Neid, Missgunst oder aber Mitleid getragen werden, so dass der eigene Nutzen dann z.B. am höchsten ist, wenn man mehr als der andere hat, den Gewinn des anderen verhindert oder aber fair geteilt hat. 67. Nennen Sie zwei spieltheoretische Methoden, um optimale Verhaltensentscheidungen zu identifizieren und suboptimale Optionen zu eliminieren. Illustrieren Sie jede Technik jeweils mit einem spieltheoretischen Beispiel. Um optimale Verhaltensentscheidungen zu identifizieren, müssen Gleichgewichtspunkte in den Nutzenmatrizen bestimmt werden, an denen sich kein Spieler durch Abweichen von seiner Wahl verbessern kann. Um suboptimale Optionen zu eliminieren, muss man dominierte Strategien identifizieren und streichen. Dominierte Strategien sind solche, die in keinem Fall die beste Entscheidungsalternative darstellen und somit nicht zur Nutzenmaximierung geeignet sind. Bsp.: 1 und a sind dominierte Strategien, da 2 bzw. b immer besser ist; (16,16) ist ein Gleichgewichtspunkt, da sich kein Spieler durch alleinige Abweichung von der Entscheidung verbessern kann; 68. Was ist ein einfaches Spiel und was ist ein Superspiel? Geben Sie jeweils ein Alltagsbeispiel. Ein einfaches Spiel wird einmal durchgeführt und nicht wiederholt; der Nutzen aller Beteiligten wird nur im Hinblick auf den einmaligen Ausgang optimiert. Ein Alltagsbeispiel ist Taschendiebstahl. Obwohl man den Vorgang als Taschendieb vielleicht häufig durchführt, tut man dies immer wieder bei neuen Menschen, die einen nicht kennen und die man selbst nicht kennt. Der Nutzen wird durch den Diebstahl maximiert und keine Wiederholung des gleichen Vorgangs durchgeführt. Ein Superspiel ist ein Spiel, das in gleicher Konstellation mit gleichen Teilnehmern zu ähnlichen Nutzenkonditionen immer wieder durchgeführt wird. Teilnehmer haben hierbei die Möglichkeit, andere in folgenden Runden zu bestrafen, wenn sie von der vereinbarten, für alle idealen Strategie abweichen, indem sie sich in zukünftigen Durchgängen auch anders entscheiden. Ein Alltagsbeispiel ist Kloputzen in der WG. Der Nutzen aller ist auf Dauer am höchsten, wenn jeder regelmäßig dann putzt, wenn er an der Reihe ist. Tut er das nicht, so ist der Nutzen kurzfristig zwar höher, in Zukunft wird er mit dieser Strategie aber von den anderen bestraft werden, indem sie z.B. auch nicht putzen oder ihm häufiger den Putzdienst zuteilen. 69. Welche der folgenden Alltagsbeispiele sind Nullsummenspiele: Küssen, Boxkampf, versuchter Diebstahl, Spenden? Bitte kurze Begründung. Boxen, versuchter Diebstahl und Spenden sind Nullsummenspiele. Beim Boxen ist Gewinnmaximierung der Gewinn des Kampfes und den kann nur einer erhalten. Beim Diebstahl ist ebenfalls der Erfolg eines Spielers der Misserfolg des anderen. Entweder wird der Dieb ertappt und dem Besitzer kein Schaden zugefügt, jedoch dem Dieb, oder der Dieb kommt davon. Beim Spenden wird ein Geldbetrag aufgeteilt in einen, den man behält und einen, den man weggibt. Der Gewinn des Beschenkten ist immer der Verlust des Spenders. Küssen ist kein Nullsummenspiel, der der Pot nicht konstant ist. Der Kuss kann für beide sehr angenehm sein, oder nur für einen von beiden, oder aber für beide unangenehm. 70. Was ist ein Gleichgewichtspunkt? Beispiel. Ein Gleichgewichtspunkt ist ein Punkt in einer Nutzenmatrix, an dem sich kein Spieler durch eigenmächtiges Abweichen von der Entscheidung verbessern kann. Gleichgewichtspunkte sind die idealen Entscheidungen, da man durch seine Entscheidung den anderen zwingen kann, sich entsprechend dem Gleichgewichtspunkt zu entscheiden. Bsp.: siehe 67. 71. Was ist eine dominierte Strategie? Beispiel. Eine dominierte Strategie ist eine Handlungsalternative, die in keinem möglichen Fall des Spiels die beste Alternative darstellt, die also immer schlechter ist als mindestens eine andere. Bsp.: siehe 67. 72. Definieren Sie den Begriff des nicht-kooperativen Spiels. Wie kann in solchen Spielen dennoch Kooperation entstehen? In nicht-kooperativen Spielen findet im Gegensatz zum kooperativen Spiel kein bindender Vertragsschluss statt, dessen Nicht-Einhaltung extern sanktioniert werden könnte. Die Spieler entscheiden alle eigenmächtig im Sinne der eigenen Nutzenmaximierung. Kooperation entsteht dann dadurch, dass alle Spieler nach Gleichgewichtspunkten suchen, an denen sich kein anderer durch Abweichung von der Entscheidung verbessern und damit eventuell sie selbst verschlechtern kann. Wenn alle sich für den Gleichgewichtspunkt entscheiden, geht man auch in einem nicht-kooperativen Spiel den für alle besten Kompromiss ein, der stabil ist, und hat kooperiert. 73. Skizzieren Sie die payoff-Matrix des „chicken“-Spiels. Wie kann man den Mitspieler bei diesem Spiel dazu bringen, die vorsichtige Verhaltensoption zu wählen, so dass man selbst gute Chancen hat, durch Wahl der gefährlichen Option den maximalen Nutzen zu erzielen? - C = careful D = daring Um den Mitspieler dazu zu bewegen, die vorsichtige Verhaltensoption zu wählen, muss man ihm glaubhaft vermitteln, dass man selbst auf jeden Fall die gefährliche wählen wird, so dass er dann die Situation (-100,-100) vermeidet, indem er ausweicht. Hierzu sollte man z.B. das eigene Lenkrad abnehmen und aus dem Fenster werfen, so dass es an der eigenen Wahl keinen Zweifel mehr geben kann. 74. Inwiefern benutzen die Nutzen- und Spieltheorie einen verkürzten Begriff von Rationalität? In Nutzen- und Spieltheorie ist rational, was den eigenen Nutzen maximiert. Nutzen ist hierbei das, was den eigenen individuellen Präferenzen entspricht. Diese werden als gegeben vorausgesetzt. Individuelle Präferenzen können mitunter jedoch sehr unvernünftig sein und ein für die Person sehr schlechtes Ergebnis nach sich ziehen, so dass es verkürzt ist, Rationalität nur als Nutzenoptimierung hinsichtlich der individuellen Interessen zu verstehen. Eine Präferenz, die etwas Schlechtes zur Folge hat, kann nicht als rationales Kriterium der Nutzenmaximierung angesehen werden. 75. Nennen Sie Befunde zum Entscheidungs- und Wahlverhalten, die gegen eine rein egoistische Form der Nutzenmaximierung sprechen. Im Ultimatumspiel lehnen Spieler mitunter eine Pot-Aufteilung von 7:3 in ihrem Sinne als unfair für den anderen ab, und auch im Diktatorspiel sind 5:5 Verteilungen zu beobachten. Dies spricht dafür, dass Nutzenmaximierung nicht rein egoistisch geschieht, vielmehr gibt es eine gewisse Tendenz zu fairen Optionen. Der Einfluss von Eigeninteresse bei der Wahl einer Handlungsalternative scheint also in der Nutzenund Spieltheorie überschätzt zu werden. 76. Kontrastieren Sie die Begriffe des Maximizing und des Satisficing. Als Maximizing bezeichnet man die Wahl von Handlungsalternativen, die den eigenen Nutzenwert auf das höchstmögliche Niveau bringen, also das Verlangen nach maximaler Optimierung. Satisficing meint, nicht unbedingt das allerbeste Ergebnis erzielen zu wollen, sondern sich mit einem bestimmten Nutzenwert zufriedenzugeben, der gut genug ist. Hinter Satisficing steht auch die Angst, zu kurz zu kommen und daher schon weniger als die beste Optimierung zu akzeptieren. In Spielen findet man häufig statt Maximizing eher Satisficing. 77. Worin unterscheidet sich die von Herrnstein postulierte „meliorization“ von der in der Nutzenmaximierung geforderten „optimization“? Das Konzept der „optimization“ geht davon aus, dass ein Mensch sich immer so entscheidet, dass sein Nutzen kurzfristig- und langfristig bestmöglich optimiert wird. „Meliorization“ jedoch meint, dass ein Mensch seinen Nutzen zwar kurzfristig optimal erhöht, durch häufige Wahl kurzfristig guter Alternativen diese jedoch abwertet und nicht-gewählte Alternativen in ihrem Wert erhöht. Der Wert einer Alternative ist also abhängig davon, wie häufig oder selten sie gewählt wird. Das Konzept der „meliorization“ bezieht indirekte, reflexive Konsequenzen wiederholter Entscheidungen auf payoff-Strukturen mit ein, die im „optimization“-Konzept der Nutzenmaximierung nicht beachtet werden und nimmt an, dass Menschen durch Nicht-Beachtung langfristiger Veränderungen der payoff-Strukturen häufig zu kurzsichtig und dadurch mitunter irrational entscheiden. 78. Inwiefern kann sich die Proportion, in der die verschiedenen Handlungsalternativen in einer wiederholten Wahlsituation ausgeführt werden, auf die erreichbaren Nutzenwerte auswirken? Illustrieren Sie Ihre Ausführungen mit einem Alltagsbeispiel. Wählt man eine Handlungsalternative häufig, so senkt sich auf Dauer ihr Nutzenwert. Wählt man eine Handlungsalternative hingegen selten, so erhöht sich ihr Nutzenwert mit der Zeit. Der Nutzenwert einer Handlungsalternative hängt also von der Häufigkeit ab, mit der sie gewählt wird. Je nach Veränderung der Proportion einer Handlungsalternative verschieben sich die payoff-Strukturen zugunsten des Nutzenwerts der jetzt seltener gewählten und zuungunsten dessen der nun häufiger gewählten Alternativen. Ein Alltagsbeispiel ist Tennisspielen. Spielt man einen bestimmten Schlag sehr häufig, so wird er für den Gegner vorhersehbar und verliert an Wert. Gleichzeitig erhöht sich der Nutzenwert eines selten gespielten Schlags, da er für den Gegner desto unerwarteter kommt, je länger er nicht gespielt wurde. 79. Erklären Sie, warum die optimale Strategie der Verteilung von Handlungsmöglichkeiten nach dem meliorization-Ansatz nicht stabil ist. Da der Mensch nur kurzfristig von Situation zu Situation die jeweils optimale Entscheidung trifft, wird eine Alternative solange gewählt, bis eine andere im Nutzenwert höher ist. Diese wiederum wird solange gewählt, bis wieder die andere besser ist. Durch Verweilen an diesem lokalen Optimierungspunkt, nämlich dem Schnittpunkt der Nutzenwerte beider Handlungsalternativen, verharrt eine Person nicht beim eigentlichen globalen Maximum, dass vom Schnittpunkt verschieden ist, jedoch nicht identifiziert werden kann. Befindet eine Person sich am Maximum, so wird sie die aktuell bessere Handlungsalternative steigern, bis sie an Wert verloren hat. Die optimal proportionierte Strategie ist damit nicht stabil. 80. Erklären Sie das Phänomen der psychischen Abhängigkeit auf der Basis der meliorization-Theorie von Herrnstein. Am Beispiel eines Alkoholikers stellt sich die psychische Abhängigkeit nach der meliorization-Theorie dar als Wettstreit zwischen den Verhaltensalternativen des Trinkens alkoholischer oder nicht-alkoholischer Getränke. Die prinzipielle Situation ist übertragbar auf andere psychische Abhängigkeiten. Für einen schon länger trockenen Alkoholiker steigert sich die Attraktivität von sowohl alkoholischen wie auch nichtalkoholischen Getränken mit der Zeit, die er schon keinen Alkohol mehr getrunken hat. Der Alkohol wird immer verlockender, aber auch ein trockener Abend gewinnt an Attraktivität, da der direkte Entzug nachlässt. Das globale Maximum der Nutzenfunktion der beiden Alternativen befindet sich bei einem Verhältnis von über 95% nicht-alkoholischen Getränken und einer sehr seltenen Wahl von Alkohol. Diese dauerhaft optimale Strategie kann aber nicht identifiziert werden, sondern vielmehr wird sich ein ehemaliger Säufer eher für die Alternative Alkohol entscheiden, da sie kurzfristig attraktiver ist. Durch häufige Wahl von Alkohol im Vergleich zu nichtalkoholischen Getränken, verliert der Alkohol jedoch immer weiter an Attraktivität, da man in die volle Abhängigkeit mit allen negativen Konsequenzen zurückrutscht. Die Alternative des alkoholischen Getränks wird solange gewählt, bis schließlich das nicht-alkoholische einen höheren Nutzen hat, da die Nutzenkurve der nichtalkoholischen Getränke weniger steil nach links abfällt. Der Säufer wird sich nun immer im Bereich dieses lokalen Optimierungspunkts bewegen, da er gemäß dem meliorization-Ansatz stets kurzfristig optimiert, da er das globale Maximum nicht identifizieren kann und durch stetige Wahl der kurzfristig attraktiveren Alternative deren Wert und hier auch den Wert der nicht-gewählten Alternative senkt. Der lokale Optimierungspunkt an dem sich die beiden Nutzenfunktionen schneiden, befindet sich bei ehemaligen Alkoholikern weiter links als bei Nicht-Abhängigen. V. Rationale Kalkulation II – Erwartung x Wert 81. Welche Arten von Erwartungen unterscheidet das kognitive Erwartung x WertModell von Heckhausen? Erklären Sie anhand von Beispielen, was mit den unterschiedlichen Erwartungen gemeint ist. - - - Situations-Ergebnis-Erwartung P(E|S): Erwartung, wie weit der Ergebnisspielraum der Situation ist und inwieweit das Ergebnis schon feststeht; Bsp.: Noten in der Schule haben Spielraum 1-6; in bestimmten Fächern sehen manche Schüler ihre Note evntl. als unveränderbar festgelegt schlecht an; Handlungs-Ergebnis-Erwartung P(E|H,S): Erwartung, welches Verhalten in einer Situation welche Ergebnisse zur Folge haben wird; kommt Nutzenmaximierung nahe; Bsp.: Lernen vor Prüfung hat bessere Note zur Folge als Faulenzen; Ergebnis-Folge-Erwartung P(F|E): instrumentelle Verknüpfung übergeordneter Ziele mit konkreten Ergebnissen; Erwartung, inwiefern verschiedene Ergebnisse relevant für verschieden valente Ziele sind oder nicht; Bsp.: wer einen guten Abschluss hat, bekommt einen guten Studienplatz vs. Es gibt in dem Studienfach keinen n.c. Abschluss egal für Konsequenz; 82. Definieren Sie den Begriff der Instrumentalität. Instrumentalität ist die antizipatorische Verknüpfung übergeordneter Ziele mit bestimmten konkreten Handlungsergebnissen, also der Grad der Erwartung bestimmter Konsequenzen als Folge von erreichten Ergebnissen. Formalisiert ist Instrumentalität die bedingte Wahrscheinlichkeit einer Folge F, gegeben ein erreichtes Ergebnis E, P(F|E). 83. Welche Arten von Erwartungen stärken die Motivation, welche untergraben sie? Nennen Sie jeweils Beispiele. Eine hohe Situations-Ergebnis-Erwartung untergräbt die Motivation, wenn man annimmt, dass das Ergebnis durch die Situation ohnehin schon feststeht. Wenn man glaubt, durch Lernen seine Note nicht verbessern zu können, hat man keine Motivation zu lernen. Eine hohe Handlungs-Ergebnis-Erwartung bei niedriger Situations-ErgebnisErwartung stärkt die Motivation, wenn man annimmt, dass durch eigenes Handeln der Ausgang der Situation beeinflusst werden kann. Glaubt man, durch Lernen eine gute Note schreiben zu können, so ist man auch motiviert viel zu lernen. Eine hohe Ergebnis-Folge-Erwartung bei ebenfalls hoher Handlungs-ErgebnisErwartung stärkt die Motivation, wenn man glaubt, dass ein durch eigenes Handeln erreichtes Ergebnis eine positiv valente Konsequenz nach sich ziehen wird. Glaubt man, durch einen guten Abschluss einen guten Studienplatz zu bekommen, dann ist man motiviert zu lernen und gute Noten zu schreiben. Ist die antizipierte Konsequenz negativ valent, so untergräbt eine hohe Ergebnis-Folge-Erwartung die Motivation. Glaubt man, durch Diebstahl sicher ins Gefängnis zu kommen, so stiehlt man nichts. 84. Nutzen Sie das kognitive Erwartungs-Wert-Modell der Handlungserklärung von Heckhausen, um nach Erklärungen dafür zu suchen, warum eine Person ein sinnvolles oder wünschenswertes Verhalten nicht zeigt (z.B. nicht regelmäßig zum Zahnarzt geht, soziale Kontakte vermeidet, etc.). Nach dem kognitiven Erwartungs-Wert-Modell der Handlungserklärung von Heckhausen gibt es eine Reihe von Erklärungen, warum jemand ein sinnvolles Verhalten – wie z.B. mit dem Rauchen aufzuhören – nicht zeigt. Zunächst kann es sein, dass eine Person ein Ergebnis durch eine bestimmte Situation schon vorherbestimmt sieht und nicht glaubt, dass der Ausgang veränderbar ist. Weiterhin ändert man sein Verhalten nicht, wenn man glaubt, das Ergebnis nicht hinreichend durch eigenes Handeln beeinflussen zu können, wenn einem die Konsequenzen aus den Ergebnissen des Verhaltens nicht wichtig genug sind oder aber, wenn man denkt, dass ein durch ein Verhalten erreichtes Ergebnis gar nicht die erwünschten Folgen nach sich zieht. Es gibt also vier Erklärungen dafür, wieso man ein an sich wünschenswertes verhalten nicht zeigt. 85. Worin unterscheidet sich das von Bandura eingeführte Konzept der Selbstwirksamkeit („self-efficacy“) von den Handlungs-Ergebnis-Erwartungen der klassischen kognitiven Erwartung x Wert-Ansätze? Eine Handlungs-Ergebnis-Erwartung bezeichnet die Antizipation der Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte ausgeführte Handlung ein bestimmtes Ergebnis hervorrufen wird. Dies ist eine allgemeine Einschätzung der Ergebnisse von Handlungen. Das Konzept der Selbstwirksamkeit meint die personenbezogene Einschätzung, eine zielführende Handlung auch selbst ausführen zu können, also in der Lage zu sein, eine gemäß Handlungs-Ergebnis-Erwartung vorteilhafte Verhaltensweise auszuführen. Die Selbstwirksamkeit kann z.B. sehr niedrig sein, bei hoher Handlungs-Ergebnis-Erwartung im Hinblick auf die gleiche Situation. Man kann glauben, dass eine Verhaltensweise sicherlich zum gewünschten Ergebnis führt, sich aber selbst nicht befähigt sehen, diese Handlung auszuführen, weil beispielsweise die nötige Expertise fehlt. 86. Beschreiben Sie einen Fall, in dem Handlungs-Ergebnis-Erwartung und Selbstwirksamkeitserwartung dissoziieren, so dass die Motivation trotz starker Handlungs-Ergebnis-Erwartung niedrig ist. Es ist möglich, dass eine Person davon überzeugt ist, sehr viel Geld sparen zu können, wenn sie mit dem Rauchen aufhören würde, jedoch glaubt, zu abhängig zu sein, um jemals damit aufhören zu können. Es besteht in diesem Fall eine hohe HandlungsErgebnis-Erwartung, da sie sich sicher ist, das positive Ergebnis durch eine bestimmte Handlung erreichen zu können, sich aber nicht befähigt sieht, diese auszuführen. 87. Was sind spezifische und was sind generalisierte Erwartungen? Unter welchen Bedingungen wird das Verhalten von welchem Typus von Erwartungen stärker beeinflusst? Geben Sie jeweils ein Beispiel. Spezifische Erwartungen sind solche, die auf früheren Erfahrungen in einer genau gleichen oder sehr ähnlichen Situation basieren. Sie beeinflussen das Verhalten stärker, wenn man die gleiche Situation schon zuvor erlebt hat. Ein Beispiel ist das Halten eines Referats. Wenn man dies schon häufig gemacht hat und immer gut und verständlich geredet hat, so ist man zuversichtlich, dass man es auch dieses Mal gut schaffen wird. Bei generalisierten Erwartungen werden frühere Erfahrungen aus anderen Situationen auf aktuelle übertragen, auch wenn die frühere Situation mit der jetzigen sehr wenig gemein hat. Generalisierte Erwartungen beeinflussen das Verhalten vor allem in neuen und unbekannten Situationen. Ist man das erste Mal in seinem Leben zu einem Vorstellungsgespräch geladen, so weiß man nicht genau, was einen erwartet, wenn man jedoch meist sehr ungeschickt beim Reden vor anderen Leuten war, erwartet man, es auch in dieser Situation zu sein. Generalisierte Erwartungen können mitunter der Realität stark widersprechen, da sie oft aus Situationen kommen, die nicht auf die aktuelle übertragbar sind. 88. Was ist mit internalem und externalem locus of control gemeint? Internaler locus of control meint die Überzeugung, dass das Ergebnis einer Handlung der eigenen Kontrolle unterliegt und nur von einem selbst abhängt. Externaler locus of control ist hingegen die Überzeugung, dass äußere Faktoren wie Schicksal oder Zufall für die Ergebnisse von Handlungen verantwortlich sind und man selbst keinen Einfluss darauf hat. VI. Motive 89. Definieren Sie, was mit dem Begriff Motiv gemeint ist. Motive sind zeitlich stabile und bereichsübergreifende Wahrnehmungs- und Bewertungsdispositionen, die menschliches Verhalten steuern. In ihrer Eigenschaft sind Motive latent, also immer vorhanden und werden durch bestimmte Situationen und Reize aktiviert. 90. Was ist der Unterschied und worin besteht der Zusammenhang zwischen Motiv und Motivation? Motivation ist das Ergebnis des Zusammenwirkens eines Motivs und einer entsprechenden Situation. Dieses Zusammenwirken löst zielgerichtetes Verhalten zur Motivbefriedigung aus. Motivation kann als aktiviertes Motiv gesehen werden. 91. Nach welchen Inhaltsklassen werden Motive in der modernen Motivationspsychologie organisiert? Geben Sie zu jedem Basismotiv eine kurze inhaltliche Definition und grenzen Sie die verschiedenen Motive voneinander ab. - Leistungsmotiv: Bestreben, Rückmeldung über den Erfolg oder Misserfolg des eigenen Handelns zu erhalten, dieses dadurch zu optimieren, hochzuhalten und möglichst effektiv zum Einsatz zu bringen; entscheidend ist für das LM, dass - - Leistungen erkennbar das Resultat eigener Anstrengung und Fähigkeit sein müssen; Anschlussmotiv: Bestreben, soziale Beziehungen zu fremden Leuten aufzubauen und schon bestehende zu festigen und hierbei Konflikte zu vermeiden, um möglichst hohe Gruppenzugehörigkeit herzustellen; Machtmotiv: Bestreben, innerhalb sozialer Beziehungen den eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen und sich dadurch selbst zu behaupten, Führungspositionen einzunehmen und Entscheidungsträger zu werden; das MM widersetzt sich einem Untergehen des Einzelnen in der sozialen Gemeinschaft; In verschiedenen Situationen sind für verschiedene Motive verschiedene Aspekte von Bedeutung; für das Anschlussmotiv ist in einer sozialen Situation die möglichst harmonische Eingliederung in eine Gruppe von Bedeutung, für das Machtmotiv das Erkennen sozialer Hierarchien und das Einbringen in sie und für das Leistungsmotiv die Fähigkeiten und Leistungen der anderen und das Hochhalten und Optimieren der eigenen Fähigkeit zum Problemlösen im Vergleich mit ihnen; 92. Welche Funktion haben Motive für Individuen und die Spezies? Grundmotive erhöhen den evolutionären Vorteil einzelner und der gesamten Gruppe oder Spezies, indem sie effiziente Reaktionsmechanismen für bestimmte Typen von Situationen bereitstellen und somit dem ultimaten Ziel der Weitergabe des Erbguts durch bessere Anpassung dienlich sind. Kurzfristig haben Motive auch die Funktion der positiven Affektänderung und damit Stimulierung des Individuums. 93. Unterscheiden Sie zwischen ultimaten und proximalen Zielen von Motiven. Ultimates Ziel von Motiven ist die Erhöhung des evolutionären Vorteils durch effiziente Reaktionsmechanismen für bestimmte Situationen und die daraus folgende möglichst breite Weitergabe des Erbguts. Proximale Ziele von Motiven sind Affektänderungen hin zum Positiven, also beispielsweise soll durch das Anschlussmotiv ein Zustand der Unsicherheit und Einsamkeit überwunden werden, hin zum Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. 94. Welche Rolle spielen Emotionen/Affekte für das Motivationsgeschehen? Affekte steuern Motivationsgeschehen, indem Affektänderungen von negativ zu positiv Anreiz für motiviertes Verhalten darstellen (proximale Ziele). Die Affektänderung – z.B. von Unsicherheit zu Sicherheit durch sozialen Anschluss – verstärkt also ein bestimmtes Verhalten. Die Aktivierung eines Affekts steuert das motivierte Verhalten spezifisch hinsichtlich Appetenz respektive Aversion. Affekte sind mit Motiven über physiologische Apparate mit Neurotransmittern und Hormonen verbunden. 95. Was versteht Muray unter „need“ und „press“? Was versteht man unter „alpha press“ und „beta press“? Wie entsteht aus „need“ und „press“ Motivation? Ein „need“ ist nach Muray ein grundlegendes Motiv oder Ziel, das durch eine der drei Inhaltsklassen von Motiven – Machtmotiv, Leistungsmotiv und Anschlussmotiv – klassifiziert wird. Ein „press“ ist ein situativer Anreiz in Form einer Chance oder eines Risikos, der einen „need“ triggert. Es wird hierbei unterschieden zwischen „alpha press“, was objektive situationelle Charakteristika bezeichnet, die als Stimuli für ein Motiv dienen, und „beta press“, was die subjektive Interpretation einer Situation in einem Sinne, der ein Motiv anspricht, meint. Motivation entsteht in dem Maße, in dem ein situationeller objektiver oder subjektiv interpretierter „press“ einen „need“ triggert, also ein Anreiz ein Motiv aktiviert und ein Bedürfnis durch eigenes Handeln befriedigt bzw. ein Ziel dadurch erreicht werden kann. 96. Wie ist die Bedürfnispyramide nach Maslow (1943) aufgebaut? Unterscheiden Sie auf Basis dieses Modells zwischen Defizitmotiven und unstillbaren Bedürfnissen. Die Bedürfnispyramide nach Maslow unterscheidet 5 Bedürfnisse, die hierarchisch von unten nach oben angeordnet sind: physiologische Bedürfnisse wie Nahrungsaufnahme und Schlaf; das Sicherheitsbedürfnis nach z.B. Versorgung und körperlicher Unversehrtheit; das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen; das Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung der eigenen Person und erbrachten Leistungen; und das Bedürfnis nach Selbstaktualisierung in Form von Entfaltung des eigenen Potenzials. Die Hierarchie ist so aufgebaut, dass zunächst die untersten Bedürfnisse gestillt sein müssen, bevor die weiter oben gelegenen angegangen werden – es muss also z.B. zuerst der Hunger gestillt sein, bevor man nach sozialem Anschluss sucht. Physiologische Bedürfnisse sowie die Bedürfnisse nach Sicherheit und sozialen Beziehungen werden als Defizitmotive bezeichnet, die gestillt werden können und danach keine Verhaltensmotivation mehr hervorrufen. Die Bedürfnisse nach Anerkennung und Wertschätzung sowie Selbstaktualisierung jedoch werden als unstillbare Bedürfnisse bezeichnet, was heißt, dass ein Mensch nie genug davon bekommen kann und stets nach Maximierung strebt, ganz gleich wie viel Wertschätzung, Anerkennung und Selbstaktualisierung ihm schon zugekommen sind. Man könnte sagen, dass der Mensch deshalb nach immer mehr strebt und nie zufrieden ist, weil er stets noch Bedürfnisse hat, ganz gleich, wo er sich in der Pyramide befindet. Sind die unteren drei Stufen befriedigt, so können die darüber liegenden dennoch nie gestillt werden. 97. Was versteht man unter direkter und indirekter Messung von Motiven? Nennen Sie jeweils ein Beispiel für ein direktes und ein indirektes Messverfahren. Bei einer direkten Motivmessung gibt die zu untersuchende Person selbst, z.B. in Form eines Fragebogens, Auskunft über persönliche Präferenzen, Einstellungen und Beweggründe. Ein Beispiel hierfür ist das „Personality Research Form“ von Jackson (1974). Bei der indirekten Motivmessung wird bei der Instruktion kein expliziter Bezug auf Motive genommen, da man hier annimmt, dass Personen sich selbst gar nicht unbedingt über ihre eigenen Motive bewusst sind. Man verwendet projektive Testverfahren wie den „thematischen Apperzeptions-Test“ (Murray, 1938), um über subjektive Interpretationen mehrdeutiger Situationen Rückschlüsse auf zugrunde liegende Motive zu ziehen. 98. Diskutieren Sie Vor- und Nachteile direkter und indirekter Verfahren der Motivmessung. - Direkte Verfahren: o Vorteile: objektiv auswertbar; schnelle und einfache Durchführung o Nachteile: relativ geringe Validität, da Motive oft nicht reflektiert zugänglich sind; demand-Effekte; nur kurzfristige Verhaltensvorhersage; keine Motivaktivierung durch Interpretationsfreiraum; - Indirekte Verfahren: o Vorteile: Hohe Validität auch bei langfristigen Verhaltensvorhersagen; Erfassung von Motiven als affektive und automatisierte Reaktionstendenz durch interpretationsoffene Situationen; o Nachteil: hohe Subjektivität bei der Auswertung; gesenkte Reliabilität; aufwendige Durchführung; 99. Was ist ein projektiver Test? Ein projektives Test ist ein Verfahren der indirekten Motivmessung, bei dem mehrdeutige und interpretationsoffene Reizvorlagen dargeboten und in offenem Format geantwortet wird. Er dient dazu, Motive durch automatisierte und affektive Reaktionstendenzen zu erfassen und nimmt in der Instruktion keinen direkten Bezug zu Motiven. Ein Beispiel für einen projektiven Test ist der Thematische Apperzeptions-Test (TAT; Murray, 1938). 100. Welche Funktionen erfüllen Leistungs-, Macht- und Anschlussmotiv für das menschliche Leben und Überleben (für den einzelnen, für die Gemeinschaft)? Ordnen Sie jeder Motivklasse spezifische Funktionen zu. - - Leistungsmotiv: der Einzelne erlebt sich selbst als leistungsfähig und kompetent und erlebt dadurch Befriedigung und Selbstbestätigung; In der Gesellschaft wird durch kreatives Problemlösen die Gesellschaft vorangebracht und neue Kompetenzen werden erworben; Machtmotiv: Sicherung des Status und Zugangs zu Ressourcen für den Einzelnen; Stabilität durch Aufrechterhaltung der sozialen Hierarchie (z.B. auch im Tierreich); Anschlussmotiv: Sicherheit und Kooperation durch Gruppenzugehörigkeit und Attachment für Einzelnen; durch Eltern-Kind-Bindung und zwischenelterliche Bindung effizienteres Aufziehen des Nachwuchses, Stabilität im Familienverband und verbesserte Arterhaltung; 101. Welche Sozialisationsfaktoren sind günstig für die Entstehung von Leistungsmotivation? Frühe Erziehung von Kindern zur Autonomie und Selbstständigkeit sind förderlich für die Entstehung von Leistungsmotivation. Die Kinder sollten hierbei für erfolgreiches eigenständiges Problemlösen verstärkt werden. Weiterhin förderlich für Leistungsmotivation sind hohe nationale Achievement-Indizes, die angeben, wie präsent Leistungsorientierung in Medien, Kultur, Politik, etc. ist, sowie Protestantismus (hier besonders der Calvinismus), der ideologisch mit hoher Eigenverantwortlichkeit und Leistungsmotivation einhergeht. 102. Welche Evidenz lässt sich für den Zusammenhang zwischen Leistungsmotivation und dem ökonomischen Erfolg einer Gesellschaft anführen? In modernen Gesellschaften sagen nationale Motivindizes – gemessen über politische Reden, Medien, Kinderbücher, etc. – die nachfolgende wirtschaftliche Entwicklung voraus. Bei hoher Präsenz von Leistungsinhalten in der Gesellschaft erhöht sich die Zahl der angemeldeten Patente, das Brutto-Inlands-Produkt steigt an und der Energieverbrauch erhöht sich, was ebenfalls ein Indikator für wirtschaftliches Wachstum ist. Einem Anstieg der Leistungsmotivation folgt stets mit kurzem Abstand ein Anstieg solcher wirtschaftlicher Indikatoren. 103. Nennen Sie die beiden Komponenten, aus denen sich nach dem Risikowahlmodell die resultierende Motivationstendenz in einer Leistungssituation ergibt. Die Motivationstendenz im Risikowahlmodell nach Atkinson ergibt sich aus der Summe von Erfolgshoffnung und Furcht vor Misserfolg, also aus aufsuchenden und vermeidenden Tendenzen. RT = Te + Tm, wobei die Furcht vor Misserfolg Tm immer ein negatives Vorzeichen hat; 104. Welche drei Variablenwerte muss man kennen oder messen, um die resultierende Motivationstendenz in einer Leistungssituation nach dem Risikowahlmodell berechnen zu können? Welche drei anderen Variablen lassen sich aus der Erfolgswahrscheinlichkeit ableiten? Um nach dem Risikowahlmodell die Motivationstendenz in einer Leistungssituation berechnen zu können, müssen Erfolgsmotiv Me, Misserfolgsmotiv Mm und Erfolgswahrscheinlichkeit We bekannt sein. Die Motive werden hierbei über projektive Tests bestimmt, die Erfolgswahrscheinlichkeit lässt sich über die Aufgabenschwierigkeit manipulieren. Misserfolgswahrscheinlichkeit Wm, Erfolgsanreiz Ae sowie Misserfolgsanreiz Am lassen sich aus der Erfolgswahrscheinlichkeit ableiten. Hierbei ist die Misserfolgswahrscheinlichkeit Wm das Komplement der Erfolgswahrscheinlichkeit We: Wm = 1 - We. Erfolgs- und Misserfolgsanreiz Ae und Am sind lineare Funktionen von We, insofern, dass eine niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit einen hohen Erfolgsanreiz zur Folge hat und eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit einen hohen negativen Misserfolgsanreiz: Ae = 1 - We und Am = -We. 105. Wie lassen sich nach dem Risikowahlmodell der Erfolgs- und Misserfolgsanreiz aus der Erfolgswahrscheinlichkeit berechnen? Nach dem Risikowahlmodell sind Erfolgs- und Misserfolgsanreiz Ae und Am lineare Funktionen der Erfolgswahrscheinlichkeit We, insofern, dass der Erfolgsanreiz desto größer ist, je kleiner die Erfolgswahrscheinlichkeit, und der Misserfolgsanreiz desto größer negativ, je größer die Erfolgswahrscheinlichkeit: Ae = 1 - We, Am = -We. 106. Warum ist die resultierende Motivationstendenz eine parabelförmige Funktion der Erfolgswahrscheinlichkeit? Begründen Sie Ihre Argumentation mit einer kurzen Ableitungsskizze der entsprechenden Formeldarstellung des Risikowahlmodells. Durch Einsetzen der Komponenten der Motivationstendenz in die ursprüngliche Formel nach oben beschriebenen Eigenschaften ergibt sich: RT = Te + Tm = Me ∙ Ae ∙ We + Mm ∙ Am ∙ Wm = = Me ∙ (1 - We) ∙ We + Mm ∙ (-We) ∙ (1 - We) = = Me ∙ (We - We²) - Mm ∙ (We - We²) = = (Me - Mm) ∙ (We - We²). (Me - Mm) ist eine Konstante, da die Motivlage einer Person mittelfristig stabil ist. (We - We²) ist eine quadratische Funktion der Erfolgswahrscheinlichkeit, die mit dem Faktor (Me - Mm) multipliziert eine Parabel als Funktion der Erfolgswahrscheinlichkeit auf die Motivationstendenz ergibt. Als quadratische Normalform geschrieben lautet sie: RT = -(Me - Mm) ∙ We² + (Me - Mm) ∙ We. Da Erfolgs- und Misserfolgsanreiz sowie Misserfolgswahrscheinlichkeit von We abhängen und Erfolgs- und Misserfolgsmotiv Konstanten sind, lässt sich die resultierende Motivationstendenz schließlich als quadratische Funktion der Erfolgswahrscheinlichkeit darstellen. Inhaltlich liegt dies darin begründet, dass die Erfolgshoffnung bei mittlerer Erfolgswahrscheinlichkeit am größten und bei niedriger und hoher Erfolgswahrscheinlichkeit am geringsten ist, die Furcht vor Misserfolg jedoch genau umgekehrt am größten negativ ist für mittlere Erfolgswahrscheinlichkeit und am größten für niedrige und hohe. Gleichwohl liegt die Furcht vor Misserfolg stets im Negativen und die Hoffnung auf Erfolg im Positiven. Die beiden Tendenzen addiert ergeben wiederum die individuelle Ausprägung der Motivationstendenzfunktion, die aufgrund der quadratischen Form von Te und Tm immer parabelförmig ist. 107. Welche Vorhersagen ergeben sich für das Verhalten in Leistungssituationen aus der Tatsache, dass nach dem Risikowahlmodell der Zusammenhang von resultierender Motivationstendenz und Erfolgswahrscheinlichkeit für Erfolgsmotivierte umgekehrt u-förmig, für Misserfolgsmotivierte u-förmig verläuft? Dominant Erfolgsmotivierte (Me > Mm) bevorzugen dem Modell zufolge mittelschwere Situationen, strengen sich in ihnen am meisten an und zeigen dort die höchste Ausdauer. Dominant Misserfolgsmotivierte (Mm > Me) meiden dem Modell zufolge generell Leistungssituationen, jedoch am meisten mittelschwere Situationen. Die höchste Anstrengung und Ausdauer erbringen sie noch bei leichten und schweren Aufgaben, in mittelschweren Leistungssituationen sind sie am gehemmtesten und zeigen die geringste Anstrengung und Ausdauer. 108. Schildern Sie Ablauf und Ergebnisse der Untersuchung zur Anspruchsniveausetzung von Atkinson & Litwin (1960). Welcher Aspekt der Ergebnisse entsprach nicht exakt den Vorhersagen des Risikowahlmodells? Atkinson & Litwin (1960): Kinder werfen Ringe aus verschiedenen Entfernungen auf Stäbe, können die Distanz jedoch selbst festlegen (0-15 Fuß); gemessen wird die Entfernungspräferenz zum Stab für die einzelnen Kinder und ob sie erfolgsmotiviert oder misserfolgsmotiviert sind; die Entfernung zum Stab ist hier ein Maß für die Aufgabenschwierigkeit; Ergebnisse: wie erwartet präferieren erfolgsmotivierte Kinder deutlich mittlere Distanzen und damit mittlere Aufgabenschwierigkeit; ebenfalls ist die Präferenz bei Misserfolgsmotivierten wie erwartet höher für leichte und schwere Aufgaben als bei Erfolgsmotivierten und die Präferenz für mittlere Schwierigkeiten deutlich geringer; Allerdings kommt es nicht wie erwartet zu einer Umkehrung der Präferenzen bei Misserfolgsmotivierten, so dass diese etwa kurze und weite Distanzen mittleren vorzögen, sondern mittlere Distanzen werden immer noch am häufigsten gewählt; dies entspricht nicht exakt der Vorhersage des Risikowahlmodells; 109. Was versteht man unter der „kognitiven Wende“ in der Leistungsmotivationsforschung? Was sind die zentralen Charakteristika der neuen Forschungsrichtung? Grenzen Sie die neue Richtung von der bis dahin vorherrschenden Forschungsauffassung ab. Was sind die zentralen Unterschiede zwischen den beiden Auffassungen? Unter der kognitiven Wende versteht man in der Leistungsmotivationsforschung die 1975 durch Trope aufgekommene Theorie, dass der Anreiz für Leistungsmotivation das Ausmaß an Diagnostizität einer Aufgabe, statt Affektänderung sei. Die zentralen Charakteristika dieser Auffassung sind es, dass die Information über die eigene Fähigkeit das ausschlaggebende Kriterium für Leistungsmotivation ist, und Erfolgsmotivierte gegenüber Misserfolgsmotivierten eine stärkere Diagnostizitätsorientierung aufweisen. Bisher hatte man angenommen, entscheidend für Leistungsmotivation seien die Aufgabenschwierigkeit und die damit verbundene Affektänderung. Nach der neuen Theorie jedoch korreliert Aufgabenschwierigkeit zwar zunächst mit Diagnostizität, ausschlaggebend sei jedoch letztere, was daran erkennbar sei, dass sehr schwere Aufgaben von Erfolgsmotivierten nicht gewählt würden, da sie keine Aussage über die eigene Leistung zulassen, da man sie ohnehin kaum schaffen kann. Ebenfalls werden sehr leichte Aufgaben von allen geschafft und lassen keinen Rückschluss auf die eigene Fähigkeit zu. Misserfolgsmotivierte würden also deshalb schwere und leichte Aufgaben wählen, weil sie diagnostische Aufgaben vermeiden wollten. In der Dissoziation von Aufgabenschwierigkeit und Diagnostizität und Postulierung des letzteren als auschlaggebendes Kriterium für Leistungsmotivation liegt der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Auffassungen. Erfolgsmotivierte haben demnach kein höheres Streben nach Affektänderung, sondern ein höheres Streben nach Information über die eigene Fähigkeit als Misserfolgsmotivierte. 110. Schildern Sie die Untersuchung und die zentralen Ergebnisse der Studie von Trope (1975) zur Dissoziation der Effekte von Aufgabenschwierigkeit und Diagnostizität auf die Aufgabenwahl. Welche theoretische Schlussfolgerung wird durch dieses Ergebnis nahegelegt? Trope (1975): Probanden wurde eine Tabelle vorgelegt, die den Grad des Erfolges 6 verschiedener potentiell bearbeitbarer Tests vorstellte, unterteilt nach fähigen und wenig fähigen Schülern; diese waren unterteilt in solche mit hoher und solche mit niedriger Diagnostizität sowie innerhalb der beiden Kategorien nach schwierigen, mittleren und leichten; sie sollten daraufhin angeben, wie viele Aufgaben sie von welchem Typ bearbeiten wollten; außerdem wurde das Leistungsmotiv der Probanden erhoben; Ergebnisse: jede der 3 Aufgaben mit hoher Diagnostizität wurde häufiger gewählt als jeder der 3 mit niedriger; innerhalb der gleichen Diagnostizitätskategorie wurden leichtere Aufgaben schwereren vorgezogen; zwischen Leistungsmotiv und Diagnostizität zeigte sich in Interaktion dahingehend, dass Probanden mit niedrigem LM kaum eine diagnostische Kategorie der anderen vorzogen, mit leichter Tendenz zu hochdiagnostischen Aufgaben, jedoch Probanden mit hohem LM eine starke Präferenz für Aufgaben mit hoher Diagnostizität gegenüber solchen mit niedriger zeigten, also mehr hochdiagnostische und weniger niedrigdiagnostische wählten als Probanden mit niedrigem LM; Dissoziation der Bedeutung von Diagnostizität und Aufgabenschwierigkeit für Leistungsmotivation; für hoch Leistungsmotivierte ist Grad der Diagnostizität, statt Aufgabenschwierigkeit relevant, da sich Leistungsmotivation offenbar aus Erwartung von Informationen über die eigenen Fähigkeiten speist; 111. Nennen Sie die beiden zentralen Dimensionen der Ursachenerklärung von Leistungsergebnissen und erläutern Sie, was mit den beiden gegensätzlichen Ausprägungen dieser Dimensionen jeweils gemeint ist. Die beiden Dimensionen der Ursachenerklärung von Leistungsergebnissen sind Stabilität und Lokation. Auf der Stabilitätsdimension kann ein ursächlicher Einfluss auf den gegenüberliegenden Ausprägungen als entweder stabil oder variabel gesehen werden, also als konstanter, gleichbleibender Einfluss oder schwankende, unsichere Größe. Die beiden gegenüberliegenden Ausprägungen der Lokationsdimension sind internale und externale Lokation. Internale Lokation bedeutet Ursachenzuschreibung innerhalb der eigenen Person, und externale Lokation meint ursächliche Erklärung durch Einflüsse außerhalb der eigenen Person. 112. Beschreiben und skizzieren Sie die Selbststabilisierungszyklen in der Leistungsmotivation für erfolgs- und misserfolgsmotivierte Personen nach dem Selbstbewertungsmodell nach Heckhausen. Nach dem Selbstbewertungsmodell nach Heckhausen sind Leistungsmotive Selbstbewertungssysteme, die Anspruchsniveausetzung und Aufgabenschwierigkeit bedingen. Unterschiedliche Selbstbewertungen kommen demnach zustande durch Attributionsasymmetrien gemäß den zwei Dimensionen der Ursachenerklärung von Leistungsmotiven. Die hierbei wirkenden Selbstverstärkungszyklen kann man trennen nach Erfolgs- und Misserfolgsmotivierten: - Erfolgsmotivierte: Wahl hochdiagnostischer Ziele; Misserfolg wird variabel external attribuiert, Erfolg internal stabil; Misserfolgsmotivierte: Wahl unrealistischer Ziele mit niedriger Diagnostizität; Erfolg wird variabel external, Misserfolg internal stabil attribuiert; jeweils Verstärkung des schon vorherrschenden Motivs; bei Erfolgsmotivierten insgesamt positive Affektbilanz, bei Misserfolgsmotivierten negative; 113. Was sind günstige und ungünstige Attributionsasymmetrien von Leistungsergebnissen nach dem Selbstbewertungsmodell nach Heckhausen? Geben Sie eine detaillierte Beschreibung. Günstig ist es, Erfolg stabil internal und Misserfolg variabel external zu attribuieren, da dadurch bei Erfolg der Selbstwert gesteigert wird, da man die eigenen Fähigkeiten für den Erfolg verantwortlich macht, und bei Misserfolg nicht gesenkt wird, da dann zufällige externe Faktoren als Ursache für das Versagen herangezogen werden. Ungünstig ist es, Erfolge variabel external und Misserfolge stabil internal zu attribuieren, da dann ein Erfolg als nicht selbst herbeigeführt angesehen wird, jedoch ein Misserfolg den eigenen mangelnden Fähigkeiten zugeschrieben wird. Günstig ist es also, selbstwertdienlich zu attribuieren und ungünstig, dies selbstwertabträglich zu tun. 114. Wie wirkt sich die Wahl von Aufgaben mittlerer im Gegensatz zu extrem niedriger oder hoher Schwierigkeit auf Selbstwirksamkeitserfahrungen aus? Bei mittelschweren Aufgaben macht man die Erfahrung, dass durch erhöhte Anstrengung ein Erfolg erzielt werden kann. Hat man Erfolg, kann man es der eigenen Fähigkeit und Anstrengung zuschreiben, bei Misserfolgen kann man durch erhöhte Anstrengung beim nächsten Mal Erfolg haben. Man macht positive Selbstwirksamkeitserfahrungen. Bei sehr leichten oder sehr schweren Aufgaben hängt Erfolg oder Misserfolg kaum von der eigenen Anstrengung ab. Leichte Aufgaben schafft man ohnehin meist auch ohne große Anstrengung und sehr schwere schafft man meist sowieso nicht, auch wenn man sich mehr anstrengt. Man macht die Erfahrung, dass der Erfolg oder Misserfolg sich nicht durch eigene Anstrengung verändert und erlebt damit negative Selbstwirksamkeitserfahrung. 115. Was sind physiologische Korrelate eines angeregten Machtmotivs? Physiologische Korrelate eines angeregten Machtmotivs ist zum einen sympathische Aktivierung und damit einhergehende Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin, die kognitive und affektive Zustände modifizieren. Zum anderen wirkt ein zweiter Mechanismus als Folge eines angeregten Machtmotivs dann, wenn man in Machtsituationen unterliegt. In diesem Fall wird Kortisol ausgeschüttet, um kurzfristig das Immunsystem anzuregen und Infektionen bei auftretenden Verletzungen zu verhindern. Bei dauerhafter Kortisolausschüttung jedoch kommt es zu einer Schwächung des Immunsystems und damit einhergehendem erhöhten Infektionsrisiko. Bei dauerhafter Anregung des Machtmotivs kommt es neben dieser Hemmung des Immunsystems zusätzlich zu chronischem Bluthochdruck aufgrund der ständigen sympathischen Aktivierung. Abhängig davon, ob man in einer Machtsituation erfolgreich ist oder unterliegt wird als Folge mehr bzw. weniger Testosteron ausgeschüttet. 116. Mit welchen gesundheitlichen Konsequenzen ist ein hohes Machtmotiv verbunden? Warum? Ein hohes Machtmotiv ist verbunden mit erhöhtem Infektionsrisiko und chronischem Bluthochdruck. Durch hohe Kortisollevel wird dauerhaft das Immunsystem geschwächt und somit das Infektionsrisiko erhöht. Der Bluthochdruck ergibt sich aus der ständigen sympathischen Aktivierung und Adrenalin/Noradrenalinausschüttung, wodurch sich Metabolismus, Pulsrate, Blutdruck und andere Aktivitäten erhöhen. 117. Schildern Sie die Studie von Schultheiss & Brunstein (2002) zum Zusammenhang von Machtmotiv und Persuasionsverhalten. Schultheiss & Brunstein (2002): Probanden wurden unterteilt nach hoch und gering Machtmotivierten und danach, ob ihre Aktivitätshemmung hoch oder niedrig ist; ein hohes Machtmotiv gepaart mit hoher Aktivitätshemmung entspricht einem sozialisierten Machtmotiv, ein hohes Machtmotiv mit niedriger Aktivitätshemmung ist ein personalisiertes Machtmotiv; der Experimentalgruppe wurde mitgeteilt, sie sollen sich vorstellen, wie sie in einer gleich folgenden Diskussion über den Gesprächspartner dominieren würden, während er unterliegen würde („goal imagery“); gemessen wurde der geschätzte Persuasionsgrad in der darauffolgenden Diskussion; Ergebnisse: für Kontrollprobanden wenig Unterschiede, jedoch sind hoch Machtmotivierte etwas schlechter; unter „goal imagery“ sind diejenigen mit einem hohen sozialisierten Machtmotiv die weitaus besten, da ihr Machtmotiv angeregt zu sein scheint; hohe Aktivitätshemmung + niedriges Machtmotiv ist am schlechtesten; erstaunlich ist, dass diejenigen mit hohem personalisierten Machtmotiv fast am schlechtesten sind, obwohl ihr Machtmotiv offensichtlich angeregt ist; jedoch geraten sie leicht in körperliche Rage, was in Diskussionen unglaubwürdig wirkt; Persuasionserfolg für hohes Machtmotiv vermittelt über Aktivitätshemmung und Anregung des Machtmotivs durch „goal imagery“; ohne „goal imagery“ kein erhöhter Persuasionsgrad für Machtmotivierte; 118. Wie wirkt sich die Übernahme einer mächtigen/abhängigen sozialen Rolle auf das Verhalten von Personen aus? Bei Übernahme von mächtigen sozialen Rollen zeigen Personen geringe interpersonale Distanz, erhöhte Redelautstärke, eine Tendenz zum Unterbrechen und eine offenere Körperhaltung. Für abhängige soziale Rollen ist jeweils genau das Gegenteil der Fall. Zudem gibt man in einer abhängigen sozialen Rolle positives Feedback, obwohl es nicht der eigentlichen Überzeugung entspricht, z.B. lacht man evntl. über Witze von Vorgesetzten, obwohl sie nicht lustig sind. 119. Differenzieren Sie zwischen dem Anschluss- und dem Intimitätsmotiv. Das Anschlussmotiv (affiliation motive) bezieht sich auf den Wunsch nach sozialem Kontakt zu noch fremden Personen, also nach neuen sozialen Verbindungen. Das Intimitätsmotiv (intimacy motive) meint den Wunsch nach Vertiefung und Sicherung von bereits bestehenden Beziehungen zu Menschen. 120. Durch welche Situationen werden Bindungsmotive typischerweise angeregt? Bindungsmotive werden üblicherweise angeregt durch Trennung von Mitmenschen und Isolation des Einzelnen, durch Zurückweisung oder Hinweise auf Spannungen in bestehenden Beziehungen oder aber durch Kontakt mit bislang fremden Personen oder Gruppen, zu denen Kontakt aufgebaut werden soll. 121. Welche physiologischen Folgen hat die Anregung von Bindungsmotiven? Die Anregung von Bindungsmotiven führt zu gesteigerter parasympathischer Aktivierung und erhöhten Dopaminkonzentrationen, was zu einer Beruhigung des Organismus führt. Hormonell sind bei Anregung von Bindungsmotiven die Progesteronlevel erhöht. Insgesamt erhöht sich damit die Immunfunktion, wodurch das Infektionsrisiko sinkt. 122. Wie beeinflussen Bindungsmotive die Wahrnehmung? Bindungsmotivierte sind tendenziell sensitiver bei der Wahrnehmung von Gesichtern. Die automatische Aufmerksamkeitsausrichtung hin zu freundlichen Gesichtern, weg von unfreundlichen/neutralen, die Personen bei freundlichen Gesichtern Kategorisierungsaufgaben grundsätzlich schneller erledigen lässt, ist bei Bindungsmotivierten nochmals deutlich erhöht (Schultheiss & Hale, 2007). 123. Wie wirkt sich ein hohes Bindungsmotiv auf die Bereitschaft zur Teilnahme an sozialen Interaktionen und auf die Bewertung von potentiellen Interaktionspartnern aus? Ein hohes Bindungsmotiv steigert grundsätzlich die Bereitschaft zur Teilnahme an sozialer Interaktion und die Leistung in Kooperationsaufgaben. Hoch Bindungsmotivierte zeigen im Allgemeinen eine höhere Zustimmungstendenz. Bei der Bewertung von potentiellen Interaktionspartnern bevorzugen Bindungsmotivierte ähnliche Personen, mit denen sie erhöht interagieren, mehr Augenkontakt halten und für die sie größere Sympathien hegen, gegenüber Unähnlichen, von denen sie sich eher abgrenzen. VII. Ziele, Identität und Selbstkonzept 124. Definieren Sie den Begriff „Ziel“. Auf welche Weise regulieren Ziele menschliches Handeln? Ziele sind proximale Determinanten menschlichen Handelns, die im Gegensatz zu Motiven direkt Verhalten steuern, über die man sich bewusst ist und die man selbst auch als Erklärung für sein Verhalten heranzieht. Ziele bestimmen die erwünschten Handlungsergebnisse, deren kognitive Repräsentation sie enthalten, und sind die Basis für Handlungspläne und Strategien. Sie regulieren Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Bewertung und Denken auf zieldienliche Weise. 125. Vergleichen Sie den Einfluss von Zielen und basalen Motiven auf menschliches Handeln und Verhalten. Ziele sind spezifische, bewusst repräsentierte und handlungsleitende proximale Determinanten menschlichen Verhaltens. Sie sind die Basis von Handlungsplänen und Strategien und werden von Menschen selbst als Erklärung für ihr Verhalten herangezogen. Im Gegensatz dazu sind Motive basale Grundbedürfnisse, die meist unterbewusst wirken und abstrakter Natur sind. Sie sind nicht direkt handlungsleitend. Zielen und Motiven ist es jedoch gemeinsam, dass sie Einfluss auf basale kognitive und affektive Prozesse nehmen, indem sie Wahrnehmung, Fühlen und Denken modifizieren. 126. Skizzieren Sie ein einfaches kybernetisches Regelkreismodell der Handlungssteuerung durch Ziele. Erläutern Sie die verschiedenen Komponenten dieses Modells. Der Sollwert des kybernetischen Modells ist das zu erreichende Ziel, bzw. der gestellte Anspruch, das bzw. der angibt, wie die Regelstrecke einer bestimmten Situation aussehen soll. Über die Wahrnehmung – die als Messfühler fungiert – wird der Ist-Wert einer Situation, also die tatsächlichen Gegebenheiten, erfasst und der Bewertung zugeführt, die einen Ist-Soll-Vergleich durchführt, in dem die tatsächlichen Gegebenheiten mit den erwünschten verglichen werden. Fällt dieser Vergleich diskrepant aus, muss durch Handeln korrektiv auf die Situation eingewirkt werden, so dass der erwünschte Regelstreckenzustand erreicht und der Ist-SollVergleich positiviert werden kann. Die Grundlage des kybernetischen Modells ist das TOTE-Schema (Test Operate Test Exit), das eine Kontrollschleife des Regelkreises beschreibt, bei dem ein diskrepanter Ist-Soll-Vergleich zwischen Situation und Ziel korrektives Handeln aktiviert. 127. Erläutern Sie, was die Begriffe „Selbstaufmerksamkeit“ und „Optimismus“ bedeuten. An welchen Stellen beeinflussen diese Variablen Prozesse der Handlungsregulation im Modell von Carver und Scheier? Schildern Sie die Ergebnisse der Untersuchung von Carver, Blaney & Scheier (1979), mit der der Einfluss von Selbstaufmerksamkeit und Optimismus auf die Hartnäckigkeit der Zielverfolgung untersucht wurde. „Selbstaufmerksamkeit“ meint den Grad an Salienz persönlicher Ziele und der Wahrnehmung des Selbst und des eigenen Handelns, wodurch Diskrepanzen zwischen angestrebtem und tatsächlichem Zustand erkannt werden können. „Optimismus“ meint den Grad der persönlichen Kontrollüberzeugung. Bei internalem Kontrolllokus besteht ein höherer Grad an persönlicher Kontrollüberzeugung als bei externalem, und so ist auch der Optimismus größer, eine Situation kontrollieren zu können. Im Modell von Carver & Scheier macht ein hoher Grad an Selbstaufmerksamkeit persönliche Ziele salient und führt zu einem effizienteren Ist-Soll-Vergleich, da eigenes Handeln besser hinsichtlich der Handlungsziele eingeschätzt und beobachtet wird und Diskrepanzen besser erkannt werden. Optimismus beeinflusst die Einschätzung der Zielerreichungsmöglichkeiten dahingehend, dass bei größerer Kontrollüberzeugung der Ausgang einer Situation länger als positiv beeinflussbar wahrgenommen wird. Ein hoher Grad an Optimismus führt somit zu späterem Disengagement. Bei niedriger Kontrollüberzeugung findet früheres Disengagement statt. In der Untersuchung von Carver, Blaney & Scheier (1979) mussten Probanden Anagramme lösen, von denen eines unmöglich war. Gemessen wurde die Zeit der Bearbeitung dieses unmöglichen Anagramms (Disengagement) in Abhängigkeit von der Erfolgserwartung (Schwierigkeit der lösbaren Anagramme) und dem Grad der Selbstaufmerksamkeit (manipuliert durch Spiegel). Es zeigte sich, dass für hohe Selbstaufmerksamkeit Probanden mit hoher Erfolgserwartung das Anagramm viel länger bearbeiteten als solche mit niedriger Erfolgserwartung, also hohe Erfolgserwartung hartnäckiger bei der Zielverfolgung macht. Für niedrige Selbstaufmerksamkeit zeigte sich kein Unterschied zwischen den Erfolgserwartungen, da gar nicht erst in den Kontrollmodus gewechselt wird. 128. Erläutern Sie den Begriff des „disengagement“. Welche beiden Formen des „disengagement“ werden im Model von Carver & Scheier unterschieden? Unter welchen Umständen ist ein „disengagement“ wahrscheinlich? „Disengagement“ meint die Zielkorrektur in Form von Ablösung von der Zielverfolgung bei Einschätzung der Zielerreichungsmöglichkeiten als gering. Carver & Scheier unterscheiden behaviorales und mentales „disengagement“, wobei behavioral die körperliche Abwendung von der Zielverfolgung und mental die geistige Abwendung meint, wenn die behaviorale aufgrund äußerer Umstände nicht möglich ist. „Disengagement“ ist wahrscheinlicher bei niedriger Kontrollüberzeugung bzw. niedrigem Optimismus. 129. Wann entsteht nach dem Ansatz von Carver & Scheier positiver bzw. negativer Affekt bei der Zielverfolgung? Positiver Affekt bei der Zielannäherung entsteht nach Carver & Scheier bei möglichst geringer Diskrepanzwahrnehmung zwischen erwünschtem und gegebenem Zustand und bei schneller Annäherung an das Ziel von einem Ausgangszustand aus. Umgekehrt entsteht negativer Affekt bei großer wahrgenommener Diskrepanz zwischen gegebenem und erwünschtem Zustand und bei niedriger Zielannäherungsrate. 130. Ziele unterscheiden sich in ihrer Schwierigkeit und im Grad ihrer Konkretheit. Was ist damit genau gemeint und wie wirken sich diese Variablen auf die Effizienz der Zielverfolgung aus? Die Schwierigkeit eines Ziels meint sein Anspruchsniveau, das es an eine Person stellt. Die Konkretheit eines Ziels meint die Spezifizität seiner Formulierung. Anspruchsvollere Ziele führen üblicherweise zu höherer Leistung, jedoch nicht, wenn die Ziele unrealistisch schwer sind. Dann nämlich führt Misserfolg sofort zu disengagement und Zielaufgabe. Feedback über den eigenen Leistungstand bei der Zielerreichung ist nur für hochspezifische Ziele möglich. Eine Korrektur des eigenen Verhaltens kann nur bei klaren Ist-Soll-Verhältnissen erfolgen. Demnach ist die Leistung für hochspezifisch formulierte (konkrete) Ziele höher. Die Effizienz der Zielverfolgung ist also am besten für schwere, aber realistische Ziele mit hoher Spezifität. 131. Was versteht man unter „commitment“ bei der Zielverfolgung? Von welchen Variablen hängt das „commitment“ zu einem Ziel ab? Erläutern Sie die Aussage, dass „commitment“ eine Moderatorvariable für Prozesse der Zielverfolgung darstellt. Unter „commitment“ bei der Zielverfolgung versteht man den Grad, zu dem man sich mit einem Ziel identifiziert und es als verbindlich ansieht. Das „commitment“ hängt ab von der Instrumentalität des Ziels, der Erfolgswahrscheinlichkeit, dem Grad der Selbstwirksamkeit, der intrinsischen Passung der Ziele mit den eigenen Motiven und situativen Faktoren wie z.B. dem Gefühl der Beteiligung an der Zielfindung oder der Arbeits- oder Lernumgebung. „Commitment“ moderiert den Zusammenhang von Anspruchsniveau eines Ziels und erbrachter Leistung insofern, als dass hohes „commitment“ Voraussetzung dafür ist, dass ein hohes Anspruchsniveau zu hoher Leistung bei der Zielverfolgung führt. „Commitment“ wird nicht direkt in Leistung übersetzt, sondern moderiert den Effekt des Anspruchsniveaus auf die Leistung. 132. Erläutern Sie, was mit Selbstdefinitionen und Identitätszielen gemeint ist. Selbstdefinitionen und Identitätsziele sind typisch menschliche Motivationsquellen. Der Mensch denkt darüber nach, wie er ist und wie er gerne werden möchte und macht sich selbst und seine Eigenschaften zum Gegenstand des Handelns und der Modifikation. Ziel ist es dabei stets, ein positives Selbstbild mit hohem Selbstwert zu haben, zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Selbstdefinitionen meinen das aktuelle Selbstbild und Identitätsziele das angestrebte. 133. Was versteht man unter „possible selves“? Welche unterschiedlichen Typen von „possible selves“ gibt es? Wie wirken sich „possible selves“ auf das Handeln einer Person aus? Illustrieren Sie Ihre Antworten anhand eines Alltagsbeispiels. Ein „possible selve“ ist ein auf kürzere Sicht erreichbar scheinendes Selbst, das unmittelbare Motivationsquelle für Verhalten ist. „Possible selves“ sind sehr wichtig, da das ideale Selbst häufig sehr weit vom momentanen Zustand entfernt ist und als unmittelbare Motivationsquelle unrealistisch scheint. Man unterteilt in „desired“ und „undesired“ „possible selves“. Ein „desired possible self“ ist das auf absehbare Zeit beste Selbst, wenn alles so geht, wie man es erhofft, während ein „undesired possible self“ das Selbst ist, das man erreichen wird, wenn die Dinge anders kommen. Man strebt nach dem „desired self“ und schöpft daraus Motivation. Noch wichtiger fürs Aktivwerden ist jedoch die Vermeidung des „undesired possible self“, so dass man häufig erst dann etwas unternimmt, wenn man sich mögliche negative Ausgänge für das Selbstbild vorstellt. Bsp.: Ein Psychologiestudent möchte später idealerweise Professor werden. Da dies in weiter Zukunft liegt, wählt er als „desired possible self“ ein abgeschlossenes Bachelor-Studium. Dieses motiviert ihn, für seine Prüfungen zu lernen. Gleichzeitig will er das „undesired possible self“ eines durchgefallenen Versagers vermeiden und lernt auch, um diesem Selbstbild aus dem Weg zu gehen. 134. In der „self-discrepancy“-Theorie von Higgins werden zwei unterschiedliche Arten von Selbstdiskrepanzen unterschieden. Welche Arten der Selbstdiskrepanz sind das? Welche Auswirkungen hat das Erleben solcher unterschiedlichen Diskrepanzen auf die Handlungsregulation und auf das emotionale Erleben? Higgins unterteilt Selbstdiskrepanzen in Diskrepanzen zwischen dem Real- und dem Idealselbst und solche zwischen dem Real- und dem Pflichtselbst. Bei einer Diskrepanz zwischen Real- und Idealselbst wird die Handlungsregulation zur Annäherung und zum Nutzen von Chancen verwendet, wohingegen bei einem RealPflichtselbstkonflikt die Handlungsregulation auf Fehlervermeidung ausgelegt ist. Auf emotionaler Ebene gehen Real--Idealselbst-Konflikte mit depressiven Tendenzen einher, da man seinen eigenen Idealen nicht gerecht wird, was als Folge zu Motivationsdefiziten führt. Real--Pflichtselbst-Konflikte sind assoziiert mit sozialer Ängstlichkeit, da man den Erwartungen anderer an die eigene Person nicht gerecht wird. Hierdurch strengt man sich in Zukunft eher mehr an, um die Erwartungen erfüllen zu können. 135. Erläutern Sie die unterschiedlichen Arten von Selbstaufwertungsprozessen, mit denen das Selbstkonzept einer Person stabilisiert und gegen selbstwertbedrohliche Informationen geschützt werden kann. - - - Self-handicapping: absichtliche Selbstbehinderung durch externe Einflüsse in kritischen Situationen, so dass bei Misserfolg external attribuiert und die Schuld von der eigenen Person genommen werden kann; Attributional bias: selbstwertdienliche Attributionsstrategien, bei denen Erfolge internal und Misserfolge external attribuiert werden; Attributionsbias desto größer, je selbstwertbedrohlicher oder -bestärkender ein Misserfolg oder Erfolg ist; Excuse making: automatisches Generieren von Entschuldigungen für eigene Misserfolge und Versäumnisse, um diese nicht stabilen Eigenschaften der eigenen Person zuschreiben zu müssen; 136. Schildern Sie die Ergebnisse der Studie von Rosenfield & Stephan (1978) zum selbstwertdienlichen Attributionsbias. Welcher Aspekt der Ergebnisse belegt, dass es sich bei diesem Bias nicht um einen generellen Mechanismus der Selbstaufwertung, sondern um einen spezifischen Mechanismus der Selbstbildstabilisierung handelt? Rosenfield & Stephan (1978): Probanden wurden Aufgaben gestellt und dafür unabhängig von ihrer Leistung positives oder negatives Feedback gegeben; zudem wurde ihnen orthogonal zum eigenen Geschlecht mitgeteilt, dass die Aufgabe entweder für Männer oder Frauen leichter als für das andere Geschlecht sei; gemessen wurde Stärke und Art der Attribution von Erfolgen oder Misserfolgen in Abhängigkeit vom Geschlecht des Probanden und mitgeteilter Geschlechtsspezifität der Aufgabe; Ergebnisse: für positives Feedback attribuieren Probanden stark internal, für negatives eher external Beleg der grundsätzlichen Existenz eines selbstwertdienlichen Atrributionsbias; Attributionsbias ist jedoch stärker ausgeprägt, wenn eine Passung des Probandengeschlechts mit der mitgeteilten Geschlechtsspezifität der Aufgabe gegeben ist; Beleg, dass der selbstwertdienliche Attributionsbias ein spezifischer Mechanismus zur Selbstbildstabilisierung in potenziell selbstwertbedrohlichen Situationen ist (hier Selbstdefinition bezüglich der eigenen Geschlechterrolle); 137. Was versteht Swann unter „self-verification“? In welchen Fällen decken sich die Vorhersagen der Theorie der Selbstverifikation mit der Theorie der Selbstaufwertung, in welchen Fällen macht die Theorie der Selbstaufwertung eine gegensätzliche Vorhersage? Schildern Sie die Studie und die Ergebnisse von Swann & Pelham (2002), mit deren Untersuchung die Theorie der Selbstverifikation gestützt wurde. Unter „self-verification“ versteht Swann die Sicherung der personalen Identität durch das Aufsuchen von selbstbildbestätigenden Umgebungen, negative Selbstverifikation eingeschlossen! Hierin unterscheidet sie sich von der Theorie der Selbstaufwertung, die annimmt, dass man stets versucht, Umgebungen aufzusuchen, die das eigene Selbstbild aufwerten. Die Vorhersagen der beiden Theorien decken sich dann, wenn die entsprechende Person ein positives Selbstbild hat, da beide dann das Aufsuchen von Umgebungen, die einen positiv bestätigen bzw. aufwerten, vorhersagen würden. Gegensätzliche Vorhersagen machen die Theorien für den Fall, dass eine Person ein negatives Selbstbild hat. Die Selbstaufwertungstheorie würde vorhersagen, dass sie sich wie im ersten Fall in Umgebungen mit positiver Bestärkung begeben würde, so dass sie ihr negatives Selbstbild aufwerten kann. Die Selbstverifikationstheorie sagt hier jedoch voraus, dass sich eine Person mit negativem Selbstbild in Umgebungen begeben wird, die ihr negatives Selbstbild bestätigen, da es sonst zu Identitätsverwirrungen kommt! Swann & Pelham (2002): Studenten werden gefragt, welches Interesse sie daran haben, ihren Zimmerpartner beizubehalten; zuvor wurde das Selbstbild der Studenten und die Fremdeinschätzung durch ihre Zimmerpartner erhoben; Ergebnisse: es zeigt sich, dass Studenten immer dann ein höheres Interesse daran haben, ihren Zimmerpartner zu behalten, wenn sich Selbstbild und Fremdeinschätzung decken, also sowohl bei positivem Selbstbild und positiver Fremdbeurteilung, als auch bei negativem Selbstbild und negativer Fremdbeurteilung; Unterstützt Selbstverifikationstheorie, nach der man selbstbildbestätigende Umgebungen bevorzugt, selbst auf Kosten von positivem Affekt widerspricht Selbstaufwertungstheorie; 138. Welche Rolle spielen Symbole für die Selbstdefinition und Identitätsziele einer Person? Was bedeutet es, dass die Sicherung von Selbstdefinitionen „soziale Realität“ erfordert? Um das eigene Selbstbild aufrechtzuerhalten, bedarf es Bestätigung durch Symbole, die mit dem jeweiligen Selbstbild assoziiert werden. Symbole können auch für Identitätsziele instrumentalisiert werden, wenn mit ihrem Erreichen das Erreichen eines bestimmten Selbstbildes verknüpft ist. Mangelt es an Symbolen oder ist man selbstrelevant nicht erfolgreich, so kompensiert man diese „incompleteness“Erfahrungen durch Zur-Schau-Stellen zielassoziierter Symbole oder Instrumentalisierung anderer Personen zur Selbstsymbolisierung, die dann nicht mehr unbedingt der Realität entsprechen. Solche Symbole müssen jedoch öffentlich von anderen auch als Symbol des entsprechenden Selbstbildes oder Identitätsziels angesehen werden, sonst können sie nicht zur Selbstkomplementierung oder Sicherung des Selbstbildes bzw. Erreichen des Identitätsziels verwendet werden. Selbstdefinitionen können also nur dann mit Symbolen gesichert werden, wenn diese der „sozialen Realität“ genügen. 139. Erläutern Sie die Begriffe der „incompleteness“-Erfahrung und der Kompensation auf der Grundlage der Theorie der symbolischen Selbstkomplettierung. In welchem funktionalen Zusammenhang stehen „incompleteness“-Erfahrungen und Prozesse der Kompensation? Unter „incompleteness“-Erfahrungen versteht man gemäß der Theorie der funktionalen Selbstkomplettierung Situationen, in denen es entweder an Symbolen mangelt, die die eigene Selbstdefinition sichern und bestätigen oder in denen man Erfahrungen des selbstrelevanten Misserfolgs macht. Unter Kompensation werden Mechanismen gefasst, durch die „incompleteness“Erfahrungen ausgeglichen werden, so dass die eigene Selbstdefinition gesichert und bestätigt wird. Kompensation kann in Form öffentlicher Zur-Schau-Stellung selbstbildassoziierter Symbole oder auch durch Instrumentalisierung anderer Personen zur Selbstsymbolisierung geschehen. Symbole zur Kompensation von „incompleteness“-Erfahrungen entsprechen oft nicht den tatsächlichen Umständen bezüglich der Person. 140. Wie lässt sich aufdringliches und angeberisches Verhalten auf der Grundlage der Theorie der symbolischen Selbstkomplettierung erklären? Schildern Sie hierzu die Studie und Ergebnisse von Gollwitzer & Wicklund (1985). Gollwitzer & Wicklund (1985): männlichen Probanden wurde zunächst ein ihrem Selbstkonzept dienliches (ideal) oder ein selbstbildaversives (non-ideal) Feedback bezüglich ihrer Eigenschaften gegeben; danach wurden ihnen Bilder von attraktiven Frauen gezeigt, die sie treffen könnten und die angaben, dass sie entweder zurückhaltende (modesty) oder aber selbstbewusst auftretende (selfassertiveness) Männer bevorzugen würden; gemessen wurde im darauffolgenden tatsächlichen Gespräch mit der jeweiligen Frau die Positivität der Selbstdarstellung der Probanden in Abhängigkeit von der Art des anfänglichen Feedbacks und der Angabe der Männerpräferenz der Frau; Ergebnisse: Probanden, die ein ihrem Selbstkonzept dienliches Feedback erhalten hatten, passten sich im Grad der Positivität ihrer Selbstdarstellung den angegebenen Präferenzen der Frau an, stellten sich also positiver dar, wenn sei selbstbewusste Männer als bevorzugt angegeben hatte, und weniger positiv bei Präferenz für zurückhaltende Männer; Probanden mit selbstbildaversivem Feedback jedoch stellten sich unabhängig von der Präferenz der Frau immer sehr positiv dar; Selbstkomplettierung durch Kompensation nach „incompleteness“Erfahrungen macht unsensibel gegenüber anderen, da man das eigene Selbstkonzept um jeden Preis sichern will; fühlt man sich in seinem Selbstkonzept bestätigt, ist man flexibler und sensibler im Umgang mit anderen; demnach neigen besonders solche Leute zu unangebrachtem aufdringlichem und angeberischem Verhalten, die „incompleteness“Erfahrungen kompensieren müssen; VIII. Volition 141. Erläutern Sie die Begriffe Volition und Motivation. Worin bestehen die zentralen Unterschiede? Unter Motivation versteht man die Wahl von bestimmten Handlungs- und Identitätszielen. Motivationale Prozesse sind solche, die mit der Wahl bestimmter Ziele aufgrund deren Dienlichkeit für die eigene Person und ihrer Realisierbarkeit verknüpft sind. Im Gegensatz dazu fasst man unter Volition Prozesse, die ab der Festlegung auf bestimmte Ziele bis hin zu ihrer konkreten Realisierung ablaufen, wie z.B. das Planen von konkreten Handlungsschritten auf dem Weg zur Zielerreichung. Motivation steht also im Zusammenhang mit der Wahl von Zielen, und Volition im Gegensatz dazu mit der konkreten Realisierung von gewählten Zielen. 142. Wozu braucht man Volition für die erfolgreiche Zielverfolgung? Volition braucht man zur erfolgreichen Zielverfolgung, damit gesetzte Ziele auch tatsächlich realisiert werden können und effektiv mit Hindernissen bei der Zielverfolgung umgegangen werden kann, also im Hinblick auf Selbstüberwindung bei aversiven, aber zur Zielerreichung notwendigen Tätigkeiten. Volition braucht man für den Übergang von der Entscheidung zum eigentlichen Wollen. 143. Beschreiben Sie detailliert die vier Phasen des Rubikonmodells der Handlungssteuerung. Welche dieser vier Phasen haben eine motivationale, welche eine volitionale Charakteristik? Die erste Phase ist die prädezisionale Phase des Wählens, die charakterisiert ist von einer Fazit-Tendenz und während der verschiedene potenzielle Ziele abgewogen und bewertet werden. Sie hat eine motivationale Charakteristik und endet in der Intentionsbildung, wodurch der sogenannte „Rubikon“ überschritten wird, der dem Modell seinen Namen gibt und ab dem man sich auf ein bestimmtes Ziel definitiv festgelegt hat. Es folgt als zweite Phase nun die präaktionale Phase, die von einer Fiat-Tendenz charakterisiert ist und während der konkrete Handlungsschritte auf dem Weg zur Zielerreichung geplant werden. Sie endet mit der Intentionsinitiierung und hat volitionalen Charakter. Es schließt sich an die dritte aktionale Phase des Handelns, während der die Intentionsrealisierung abläuft und die geplanten Handlungsschritte tatsächlich ausgeführt werden. Sie hat ebenfalls volitionalen Charakter und endet mit der Intentionsdesaktivierung. In der vierten und letzten postaktionalen Phase des Bewertens wird das vorangegangene Handeln im Hinblick darauf bewertet, ob das gesetzte Ziel erreicht worden ist oder ob das Ziel ansonsten für die Zukunft modifiziert werden muss. Diese Phase hat wiederum motivationale Charakteristik. 144. Beschreiben Sie die Bewusstseinslagen des Abwägens und des Planens auf der Basis des Rubikonmodells. Schildern Sie Ablauf und Ergebnisse der Untersuchung von Gollwitzer, Heckhausen & Steller (1989), mit der die unterschiedlichen Bewusstseinslagen nachgewiesen wurden. Während der Phase des Abwägens, die einen motivationalen Charakter hat, findet eine offene und unvoreingenommene Informationsverarbeitung statt, mit deren Hilfe objektiv das beste potenzielle Ziel ausgewählt werden soll. Tendenziell werden Informationen bezüglich der Realisierbarkeit und Attraktivität von Zielen bevorzugt. Während des Planens hingegen ist die Informationsverarbeitung parteiisch und voreingenommen, da man sich auf ein Ziel definitiv festgelegt hat und dieses schützen und aufwerten will, indem man z.B. Gegenargumente ignoriert. Bevorzugt werden Informationen, die Handlungsschritte auf dem Weg zur Zielerreichung konkret spezifizieren. Gollwitzer, Heckhausen & Steller (1989): Probanden mussten eine Märchengeschichte über einen König zu Ende erzählen, der überlegte, wem er seine geliebte Tochter anvertrauen könnte, während er selbst in den Krieg ziehen würde; die Probanden wurden zuvor in motivationale oder volitionale Bewusstseinslagen versetzt, indem sie entweder ihre aktuellen Lebensentscheidungen abwägen (motivational) oder aber die frühere Umsetzung eines schwierigen Ziels beschreiben sollten (volitional) + Kontrolle; gemessen wurde die Häufigkeit deliberativer (abwägender) und implementativer (planender) Elemente in der Fortsetzung der Geschichte in Abhängigkeit von der Bewusstseinslage, in die die Probanden zuvor versetzt worden waren; Ergebnisse: alle Gruppen weisen mehr implementative als deliberative Elemente in ihren Geschichten auf, jedoch ist der implementative Anteil am geringsten bei Probanden in motivationaler Bewusstseinslage und am höchsten bei Probanden in volitionaler Bewusstseinslage; ebenfalls ist der deliberative Anteil am geringsten für volitionale Bewusstseinslagen und am höchsten für motivationale; bevorzugte Aufnahme, Erinnerung und Generierung phasenspezifischer Inhalte unterschiedliche Bewusstseinslagen beim Abwägen und Planen; 145. Beschreiben Sie das Vorgehen und die Ergebnisse der Untersuchung von Gollwitzer & Kinney (1989) zum Einfluss eines deliberativen vs. implementativen mind-sets auf das Phänomen der Kontrollillusion. Erklären Sie das Ergebnis mit Hilfe des Rubikonmodells der Handlungsphasen. Gollwitzer & Kinney (1989): Probanden Drücken auf Schalter, von dem sie nicht wissen, inwiefern er eine Lampe kontrolliert; unabhängig davon, ob sie drücken oder nicht drücken, ist die Wahrscheinlichkeit in einer Bedingung immer 25%, dass die Lampe aufleuchtet, in der anderen Bedingung 75%; gemessen wird in Anhängigkeit von der Bedingung und dem mind-set der Probanden (deliberativ vs. implementativ), inwieweit die Probanden glauben, mit einem Tastendruck die Wahrscheinlichkeit des Aufleuchtens der Lampe erhöhen zu können (entspricht dem Grad der Kontrollillusion); Ergebnisse: Phänomen der Kontrollillusion tritt in beiden Bedingungen auf und ist für die 75:75-Bedingung stets größer; Probanden in implementativer Bewusstseinslage jedoch glauben in der 75:75-Bedingung in viel höherem Maße als die in deliberativer, das Aufleuchten der Lampe durch Tastendruck häufiger hervorrufen zu können; bei ihnen ist die Kontrollillusion viel stärker ausgeprägt; Rubikonmodell: während der motivationalen Bewusstseinslage des Abwägens unvoreingenommene und offene Informationsverarbeitung, wobei man objektiver einschätzt; in der volitionalen Bewusstseinslage des Planens findet hingegen parteiische und voreingenommene Informationsverarbeitung statt, wobei Einschätzungen sehr subjektiv getroffen werden; Probanden in deliberativem mind-set sind objektiver und erliegen somit in der 75:75-Bedingung weniger leicht einer Kontrollillusion als solche in implementativem mind-set; 146. Was versteht man genau unter „implementation intentions“? Worin unterscheiden sie sich von der Absicht, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen? Warum sind „implementation intentions“ so wichtig für eine effiziente Zielverfolgung? „Implementation intentions“ sind konkrete Handlungsvorsätze, die Verhalten in einer bestimmten Situation festlegen. Von der Absicht, ein konkretes Ziel zu verfolgen unterscheiden sie sich insofern, als dass das Ziele abstrakt sind und sich an ihrer Wünschbarkeit orientieren, jedoch nicht spezifizieren, wann man sich in welcher Situation wie verhalten sollte, um genau dieses Ziel zu erreichen. Vielmehr ist ein Ziel ein generell erstrebenswertes Handlungsergebnis, nicht jedoch der konkrete „Fahrplan“ zu diesem Ergebnis hin. Dieser wird festgelegt durch „implementation intentions“. Die Zielerreichung ist desto effektiver, je konkreter und umfassender die Handlungsvorsätze formuliert werden. „Implementation intentions“ sind also deshalb so wichtig für eine effiziente Zielverfolgung, weil sie in vielerlei Hinsicht konkretisieren, welches Verhalten in welcher Situation gezeigt werden muss, um das Ziel zu erreichen. Dadurch ist man schneller und effizienter dabei, eine Zielintention zu verwirklichen. 147. Schildern Sie Ablauf und Ergebnisse der Untersuchung von Gollwitzer & Brandstätter (1997) zum Nachweis der Wichtigkeit von „implementation intentions“ bei der Zielverfolgung. Gollwitzer & Brandstätter: während eines Seminars wurde bekanntgegeben, dass bis nach den Weihnachtsferien eine Hausarbeit anzufertigen sei; die Kontrollgruppe wurde lediglich nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Arbeit nach den Ferien auch wirklich fertig sein müsse; mit der Experimentalgruppe wurde genau durchgesprochen, wo man sich während der Ferien befände, wann man welche Pläne habe und an welchem Ort und zu welcher Zeit man mit der Hausarbeit beginnen und wie viele Tage daran arbeiten solle; Ergebnisse: nach den Ferien zeigte sich, dass 70% der Seminarteilnehmer in der Experimentalgruppe, jedoch nur 30% in der Kontrollgruppe eine fertige Arbeit hatten, obwohl auch letztere nachdrücklich darauf hingewiesen worden waren; „implementation intentions“ essenziell für schnelle und effektive Umsetzung von Zielintentionen; desto besser, je konkreter; IX. Emotionen 148. Erklären Sie die Begriffe Emotion und Stimmung und grenzen Sie die beiden Phänomene voneinander ab. Emotionen sind objekt- oder ereignisbezogene spezifische und starke Affekte, deren Auslöser, Beginn und Ende bekannt oder bestimmbar sind und die im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Im Gegensatz dazu sind Stimmungen diffuse und abgeschwächte Auftretensformen der jeweiligen Emotionen, deren Anfang, Ende und Auslöser unbekannt sein können, und die über eine unbestimmte längere Zeitspanne hinweg andauern und das affektive Erleben kolorieren können. 149. Was bedeutet es, dass Emotionen einen Objektbezug haben? Erläutern Sie dies an einem Beispiel. Mit Objektbezug hinsichtlich Emotionen ist gemeint, dass eine bestimmte Emotion durch etwas Bestimmtes (ein Objekt oder etwa eine Situation) ausgelöst wird, das bewusst ist und im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Eine Emotion wird also hinsichtlich eines spezifischen Auslösers entwickelt. Anderenfalls spricht man von einer Stimmung. Die Emotion ist an das Objekt gebunden und stellt sich nach kurzer Zeit wieder ein, wenn das Objekt aus dem Fokus der Aufmerksamkeit verschwindet. Bsp.: Man sieht eine Spinne, die in den Fokus der Aufmerksamkeit gelangt und als emotionale Antwort Ekel auslöst. Der Ekel wird nur solange anhalten, wie die Aufmerksamkeit auf der Spinne ruht. Man ist sich auch bewusst darüber, dass man sich ekelt und dass man es wegen der Spinne tut. Verschwindet die Spinne aus dem Fokus der Aufmerksamkeit, weil man z.B. drauftritt, so flacht der Ekel schnell ab. 150. Wie kann man versuchen, die Vielzahl von Emotionsbegriffen, die in der Sprache vorkommen, auf grundlegende Emotionskategorien bzw. -dimensionen zu reduzieren? Die Vielzahl vom Emotionsbegriffen, die in der Sprache vorkommen, können durch Ähnlichkeitsurteile (Paarvergleiche), Kovaritionen im Erleben, semantische Differentiale sowie Cluster- und Faktorenanalysen bezüglich der Struktur auf grundlegende Emotionskategorien oder -dimensionen reduziert werden. 151. Was sind Basisemotionen, wie wurden sie identifiziert und wodurch sind sie charakterisiert? Nennen Sie mindestens 6 Basisemotionen. Basisemotionen sind kulturübergreifend auftretende charakteristische Grundemotionen, die überall auf der Welt eindeutig identifiziert werden können. Charakterisiert werden sie anhand ihrer spezifischen Mimik, wobei nur die Basisemotionen jeweils ein ganz eigenes mimisches Muster aufweisen. 6 Basisemotionen sind Freude, Furcht, Aggression, Ekel, Überraschung und Trauer. 152. Nennen Sie die beiden zentralen Dimensionen im Circumplex-Modell der Emotionen von Russell (1980) und verorten Sie die folgenden Gefühls- und Befindlichkeitszustände in diesem Modell: Angst, Freude, Trauer, freudige Überraschung, Entspannung, Müdigkeit/Schläfrigkeit. Die beiden Grunddimensionen des Circumplex-Modells der Emotionen nach Russel sind Valenz und Erregung. Angst entspricht hierbei hoher Erregung und mittlerer negativer Valenz, Freude mittlerer Erregung und stark positiver Valenz, Trauer mittlerer bis schwacher Erregung und stark negativer Valenz, freudige Überraschung hoher Erregung und mittlerer positiver Valenz, Entspannung niedriger Erregung und positiver Valenz und Müdigkeit/Schläfrigkeit sehr geringer Erregung und neutraler Valenz. 153. Skizzieren Sie das 2-Faktoren-Modell der Emotion von Watson, Clark & Tellegen (1988). Worin liegen die zentralen Unterschiede zum Circumplex-Modell von Russel? Wie hängen die beiden Modelle zusammen? Verorten Sie auch hier die in Frage 152 genannten Gefühlszustände. Die zentralen Unterschiede zum Circumplex-Modell von Russel liegen darin, dass im 2-Faktoren-Modell der Emotion statt der Dimensionen Valenz und Erregung die beiden Dimensionen des positiven und negativen Affektes verwendet werden. Diese werden im Gegensatz zum Circumplex-Modell als unabhängig und kombinierbar aufgefasst. Was bei Watson et al. nun auf der Winkelhalbierenden des ersten und dritten Quadranten liegt – also gleiche Anteile positiven und negativen Affekts besitzt – wäre im Circumplex-Modell valenzneutral. Das 2-Faktoren-Modell ist durch Drehung um 45° in das Circumplex-Modell überführbar, letztlich ist es also egal, welches der beiden Modelle zur Anwendung kommt. Im 2-Faktoren-Modell entspricht Angst mittlerem positivem und starkem negativem Affekt, Freude hohem positivem und niedrigem negativem Affekt, Trauer niedrigem positivem und hohem negativem Affekt, freudige Überraschung hohem positivem und hohem negativem Affekt, Entspannung mittlerem positivem und niedrigem negativem Affekt sowie Müdigkeit/Schläfrigkeit niedrigem positivem und mittlerem negativem Affekt. 154. Nennen Sie Probleme und Grenzen der dimensionalen oder kategorialen Strukturtheorien der Emotion. - Abhängigkeit der Analysenergebnisse vom verwendeten Item-Pool Unklare externe Validität; vllt. wird statt empirischen Zusammenhängen nur Sprachverständnis überprüft; Nur begrenzte Abbildung der Spezifität der Emotionsbegriffe 155. Was ist die Kernannahme der Appraisal-Theorien der Emotion? Erläutern Sie Ihre Ausführung mit Hilfe eines Beispiels. Die Kernannahme der Appraisal-Theorien der Emotion ist, dass Emotionen zwar immer einen Objektbezug haben, dass sie aber nicht durch ein bestimmtes Objekt generell festgelegt ist, sondern entscheidend für die ausgelöste Emotion die Gedanken und subjektiven Bewertungen des Objekts oder der Situation durch die Person ist. Verschiedene Objekte lösen bei verschiedenen Menschen verschiedene Emotionen aus, abhängig von ihrem Appraisal dem Objekt/der Situation gegenüber. Daraus schließen die Appraisal-Theorien, dass also eine bestimmte emotionale Reaktion auf ein Objekt/eine Situation ein guter Indikator persönlicher Einstellungen, Ansprüche und Normen ist. Bsp.: Kommt ein kleiner Junge dreckig nach Hause, so hängt die Emotion seiner Mutter ganz davon ab, wie sie die Situation bewertet. Sie kann denken, der Junge habe sicher viel Spaß gehabt und sei beim Spielen dreckig geworden, was eine positive Emotion zur Folge hätte. Genauso könnte sie aber böse werden, weil der Junge sich schon wieder dreckig gemacht hat. Aufgrund ihrer jeweiligen emotionalen Reaktion kann man ablesen, ob sie beispielsweise pedantisch und reinlich oder eher offen in der Erziehung ist. 156. Nennen Sie mindestens vier verschiedene Einschätzungsdimensionen, die für die Differenzierung emotionaler Zustände relevant sein können. Geben Sie für jede Dimension anhand eines Beispiels an, wie unterschiedliche Einschätzungen auf der jeweiligen Dimension (bei sonst gleicher Einschätzung auf den anderen Dimensionen) unterschiedliche emotionale Zustände bedingen können. - - - - Verantwortung/Absichtlichkeit: Glaubt man, selbst für etwas Schlechtes Verantwortung zu tragen, so wird man sich vllt. schuldig fühlen; im Gegensatz dazu, ist man wütend auf jemanden, dem man die Schuld an etwas anderem zuschreibt; schreibt man sich die Schuld am Tod eines verwandten zu, so fühlt man sich schuldig; schreibt man sie einem anderen zu, so ist man wütend auf ihn; Relevanz, Zieldienlichkeit/Valenz: Schätzt man ein Objekt oder eine Situation als zieldienlich bezüglich eigener Motive ein, so wird die resultierende Emotion positiver ausfallen als bei zielaversiver und –undienlicher Einschätzung; ein diplomierter Jurist wird auf eine Stellenanzeige in einer Anwaltskanzlei viel positiver reagieren als ein Mathematiker; Moralische Standards: Glaubt man, eine Situation habe moralischen Bezug und schätzt man sie so ein, dass moralische Standards gebrochen worden seien, dann wird die resultierende emotionale Reaktion negativer sein; glaubt man, dass der Chef einen unangemessen vor anderen Kollegen zurechtgewiesen hat, so wird man wegen Verletzung moralischer Standards den Chef schlecht bewerten; wenn man allerdings moralisch korrekt behandelt wird, wird man ihn positiv einschätzen; Bewältigungspotenzial/Handlungsressourcen: glaubt man, den Ausgang einer Situation selbst unter Kontrolle zu haben und zu einem guten Ergebnis führen zu können, so wird der emotionale Zustand positiver sein als bei jemandem, der glaubt dem Zufall oder anderen ausgeliefert zu sein; meint man, die Noten im Studium selbst durch mittleren Lernaufwand kontrollieren zu können, so fällt die Emotion bezüglich Prüfungen besser aus als wenn man meint, Noten würden mehr oder weniger per Zufall vergeben; 157. Erläutern und kontrastieren sie die beiden Auffassungen, kognitive Einschätzungen seien Ursachen vs. Konstitute von Emotionen. Nennen Sie Argumente für bzw. gegen die jeweiligen Auffassungen. Die Auffassung, kognitive Einschätzungen seien Ursachen von Emotionen geht davon aus, dass Emotionen bezüglich einer Situation oder eines Objekts überhaupt erst entstehen können, wenn diese kognitiv bewertet worden sind. Die Bewertungen lösen dann je nachdem spezifische Emotionen aus (analog zu Appraisal-Theorien). Im Gegensatz dazu gibt es Auffassungen, die meinen, Bewertungen seien stets nur logische Folgen von Emotionen, nicht aber Auslöser für diese. Dass Bewertungen auf Emotionen folgen, bestreiten auch Verfechter der ersten Auffassung nicht, sie gehen nur davon aus, dass sie hauptsächlich Emotionen ursächlich bedingen. Gestützt wird die Auffassung von kognitiven Einschätzungen als Konstitute durch Emotionen durch Zajoncs „mere exposure“-Effekt (1980), bei dem Probanden unabhängig von der Wiedererkennungsleistung durch reine Exposition Gegenstände positiver beurteilten. Dem ist aus Sicht der Appraisal-Theorien entgegenzuhalten, dass Zajonc lediglich Präferenzen, nicht aber Emotionen maß. Außerdem könnte kognitives Appraisal sehr schnell und selbst unbewusst ablaufen, was die Auffassung der ursächlichen kognitiven Bewertung ebenfalls stützt. 158. Schildern Sie die Kritik von Zajonc (1980) an den Appraisal-Theorien der Emotion. Wie entgegnen Vertreter kognitiver Appraisal-Theorien diese Kritik? Zanjonc kritisiert die Appraisal-Theorien auf der Grundlage des von ihm gemessenen „mere exposure“-Effekts (1980). Im zugehörigen Experiment, zeigte sich, dass Probanden unabhängig von der Wiedererkennungsleistung komplexe Stimuli hinsichtlich ihrer Valenz positiver bewerteten, wenn sie ihnen in Phase 1 schon einmal präsentiert worden waren, als neue Stimuli. Er schloss hieraus, dass Emotionen nicht notwendigerweise kognitives Appraisal als Ursache benötigen, sondern auch ohne dieses zustande kommen. Vertreter kognitiver Appraisal-Theorien entgegnen, dass Zajonc in seinen Untersuchungen nicht tatsächlich Emotionen, sondern nur Präferenzen gemessen habe, was keine Aussage über Bedingungen von Emotionen zulasse. 159. Skizzieren Sie die Instinkt-Definition von Emotionen von McDougall und nennen Sie für die folgenden Emotionen die zugehörigen Verhaltenstendenzen: Furcht, Ekel, Ärger, Zärtlichkeit. Nach der Instinkt-Definition von Emotionen nach McDougall werden Emotionen evolutionsbiologisch als instinktähnliche Reaktionsmuster auf bestimmte typische für das Überleben und die Reproduktion wichtige Situationen angesehen. Sie sind genetisch determiniert oder angeboren und lenken Perzeption und Kognition emotionsbezogen. Sie aktivieren über Affekte Verhaltensimpulse. Die zugehörige Verhaltenstendenz zu Furcht ist hierbei Flucht, zu Ekel Abstoßung (z.B. Zurückweichen), zu Ärger Kampf und zu Zärtlichkeit Fürsorge. 160. Welche Forschungsergebnisse sprechen dafür, Emotionen als zentrale Motivsysteme (appetitives vs. defensives Motivsystem) aufzufassen? - Konditionierte emotionale Furchtreaktionen, die mit instrumentellem appetitivem Verhalten interferieren; Lang et al. (1997): startle probe Betrachten negativer/positiver Bilder verstärkt/schwächt den defensiven Schreckreflex; Chen & Bargh (1999): Aktivierung von Beuge- oder Streckbewegungen durch entsprechend valente Reize; 161. Schildern Sie die Untersuchungsergebnisse von Lang et al. (1997) zur Modulation des Schreckreflexes (startle probe/Blinzelreflex) und geben Sie eine theoretische Interpretation dieser Ergebnisse. Lang et al. (1997): Probanden wurden neutrale, positive und negative Bilder gezeigt, und dann zu einem von 4 verschiedenen Zeitpunkten (max. 3 sec nach Präsentation) eine Blinzelreflex-Test durchgeführt; es zeigte sich, dass die Präpulsinhibition für emotionale Bilder 0.5 sec nach der Bildpräsentation zunächst stärker war als bei neutralen Bildern; bei einer Latenz von 1 sec ist die Startle-Reaktion bei positiven Stimuli schon am geringsten, und bei 2 sec. Ist die Reaktion für negativ am stärksten und weiterhin für positiv am schwächsten; Präpulsinhibition größer für emotionale Bilder; die legt nahe, dass für emotionale Inhalte stärkere Aktivierung von Motivsystemen stattfindet; für größere Latenzen ist die Reaktion stärker für negative Bilder und am schwächsten für positive; die entsprechenden Emotionen scheinen das appetitive bzw. defensive Motivsystem zu aktivieren und die StartleReaktion der entsprechenden Motivationstendenz anzupassen, indem das defensive Motivsystem den Organismus in größere Alarmbereitschaft versetzt und das appetitive stärker beruhigt; 162. Beschreiben Sie die Untersuchung von Chen & Bargh (1999) zur Aktivierung instrumenteller Annäherungs- und Vermeidungstendenzen durch valente Reize. Welche Ergebnisse wurden in diese Untersuchung erzielt und wie wurden diese Ergebnisse ursprünglich interpretiert? Welche Kritik lässt sich an dieser Interpretation üben? Beschreiben Sie hierzu die weitergehende Untersuchung von Markman & Brendl (2005). Chen & Bargh (1999): Probanden wurden positive vs. negative Bilder gezeigt; in Bedingung 1 (kongruente Bed.) musste für ein positives Bild ein Hebel herangezogen und für ein negatives ein Hebel von sich weggedrückt werden; in Bedingung 2 (inkongruente Bed.) war die Zuordnung verkehrt, also Ziehen für negative, Drücken für positive Bilder; gemessen wurden Reaktionszeiten in Abhängigkeit von der Bedingung; Ergebnisse: in der kongruenten Bedingung waren die Reaktionszeiten signifikant kürzer als in der inkongruenten; Ursprüngliche Interpretation: direkte reflexartige Bizeps- vs. Trizepsaktivierung in Abhängigkeit von valenten Stimuli; deshalb brauchen Inkongruente länger, da sie dieser Aktivierung gegensteuern müssen Markman & Brendl (2005): auf einem Bildschirm wurden über bzw. unter dem eigenen Namen positive vs. negative Wörter gezeigt; Probanden mussten jeweils die Handbewegung ausführen, die ein positives Wort ihrem Namen näher und ein negatives von ihrem Namen wegbrachte, oder sie mussten negative Wörter zu ihrem Namen und positive davon weg bringen; unabhängig davon, ob dazu eine Streck- oder Beugebewegung notwendig war, waren Probanden schneller, wenn sie positive Wörter dem eigenen Namen näher und negative weiter weg bringen konnten als umgekehrt (jeweils gleiche Reaktionszeiten für inkongruent vs. kongruent); Keine bloße Aktivierung motorischer Programme bei Verhaltensaktivierung durch valente Reize/Emotionen, sondern stattdessen flexibel umsetzbare Verhaltensziele; 163. Nennen Sie verschiedene Beispiele für verhaltenshemmende Effekte von Emotionen. Welche dieser Effekte verweisen möglicherweise dennoch auf eine funktionale emotionale Handlungsregulation? 1. Interrupt-Effekt der Emotion: Emotionen können mit laufenden Tätigkeiten interferieren und diese unterbrechen; kann sinnvoll sein, um Verhalten an neue Gegebenheiten anzupassen oder auch, um sich ergebende Chancen zu nutzen; 2. Verhaltensblockaden bei intensiven Emotionen: z.B. bei Furcht vor Prüfung Verkrampfen und Black-out; Bei intensiver Furcht vor Angriffen durch Räuber kann es vorteilhaft sein, sich nicht zu bewegen und unauffällig zu bleiben, daher das Freezing; 3. Antriebslosigkeit bei Depressivität/Trauer Kann der Vorbereitung der Zielablösung bei Aufgaben und Handlungsroutinen dienen, die ins Leere laufen und nicht mehr sinnvoll sind, um so Ressourcen zu schonen, z.B. wenn ein Partner verstorben ist und bestimmte Tätigkeiten ohne ihn nicht mehr vorteilhaft sind; 164. Was ist die Kernaussage der James-Lange-Theorie der Emotion? Getreu dem Zitat „Wir sind traurig, weil wir weinen.“, geht die James-Lange-Theorie der Emotion davon aus, dass Emotionen nicht nur Auslöser physiologischer Prozesse sind, sondern dass Emotion vielmehr durch Wahrnehmung peripher-physiologischer Veränderungen (hierbei besonders die Gesichtsmuskulatur) entstehen. Spontane Reaktionen mit vorprogrammiertem Verhalten lassen dann erst eine Emotion in zweiter Instanz entstehen. 165. Was besagt die „facial-feedback“-Hypothese? Schildern Sie als Beleg dieser Auffassung Ablauf und Ergebnisse der sog. „pen studies“ von Strack, Martin & Stepper (1988). Die „facial-feedback“-Hypothese nimmt an, dass nicht nur das emotionale Erleben sich in unserem Gesichtsausdruck widerspiegelt, sondern ebenso veränderte Gesichtsmuskelaktivität einen rückwirkenden Einfluss auf das emotionale Erleben hat, je nachdem welcher spezifische emotionstypische Ausdruck zustande kommt. Strack et al. (1988): Probanden müssen Comics nach ihrer Lustigkeit bewerten und halten dabei den Stift entweder in der nicht-dominanten Hand, so zwischen den Zähnen, dass dabei Lachen imitiert wird oder so zwischen den Lippen, dass ein positiver Gesichtsausdruck inhibiert wird; Ergebnisse: unabhängig von der Bewusstheit über die Natur des imitierten Gesichtsausdrucks findet die Zahngruppe die Comics signifikant lustiger und die Lippengruppe signifikant weniger lustig als die Handgruppe; Rückwirkender Einfluss peripherer Gesichtsmuskeln auf emotionales Erleben 166. Worin besteht die Hauptfunktion emotionalen Ausdrucksverhaltens (Mimik, Haltung)? Die Hauptfunktion emotionalen Ausdrucksverhaltens ist seine kommunikative Komponente. Es werden durch emotionales Ausdrucksverhalten Motivzustände und Verhaltenstendenzen an Interaktionspartner übermittelt. 167. Warum ist der typische emotionale Ausdruck keine notwendige Komponente einer Emotion? Man kann seine tatsächliche Emotion vor anderen verbergen, indem man z.B. künstlich lächelt, obwohl man sich schlecht fühlt. In einem solchen Fall tritt die Emotion unabhängig von ihrem typischen Ausdruck auf. 168. Schildern Sie die klassische Studie von Schachter & Singer (1962) zur Rolle von arousal bei der Emotionsentstehung. Welches Ergebnis wurde beobachtet und wie wird dieser Befund interpretiert? Schachter & Singer (1962): Probanden erhielten Adrenalin oder Placebo und wurden über mögliche Folgen des Adrenalins (arousal) richtig, falsch oder gar nicht informiert; danach füllten sie einen intimen Fragebogen zusammen mit einem Konföderierten aus, der sich hierbei ärgerlich oder euphorisch zeigte; Ergebnisse: die nicht oder falsch Informierten mit Adrenalin passten ihre Emotion tendenziell an die des Konföderierten an (besonders für Euphorie); allerdings wird auch Placebo-Bedingung und teilweise informierte Adrenalin-Bedingung beeinflusst bzw. in der Ärger-Bedingung die falsch-Informierten mit Adrenalin nicht beeinflusst; Es war erwartet worden, dass Placebo und informiert-Adrenalin weniger stark und falsch-Informierte und nicht Informierte stärker durch Konföderierten beeinflusst werden; die Hypothese das Emotionen durch Attribution unspezifischen arousals entstehen können, bestätigte sich zwar, jedoch scheint auch ohne das arousal ein Einfluss zu bestehen Arousal scheint für eine Emotion weder zwingend notwendig noch hinreichend zu sein; 169. Nennen Sie Argumente, warum physiologische Erregung (arousal) weder hinreichend noch notwendig für Emotion ist. Im Experiment von Schachter & Singer (1962) zeigte sich, dass unter unspezifischem physiologischem arousal nicht zwangsläufig die Emotion in eine manipulierte Richtung schwenkt und außerdem auch physiologisch Nicht-Erregte sich emotional beeinflussen ließen. In einer weiteren Untersuchung von Valins (1966) zeigte sich außerdem, dass auch durch falsches Feedback über den eigenen Herzschlag positivere Gefühle gegenüber erregenden Bildern entstehen, also auch vorgestelltes arousal ausreichen kann, um Emotionen zu beeinflussen. Außerdem zeigten Lang et al. (1997), dass erhöhtes arousal an sich valenzunspezifisch ist. Maranon (1924) zeigte, dass arousal auch ohne Emotion auftreten kann. Physiologisches arousal scheint somit weder für das Entstehen einer Emotion notwendig zu sein, noch zwingend zu einer Emotion zu führen. ENDE IM GELÄNDE.