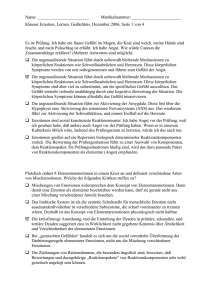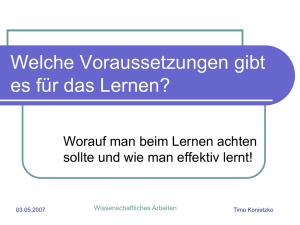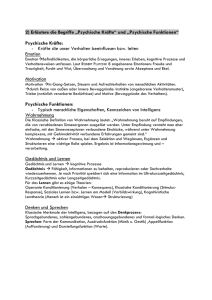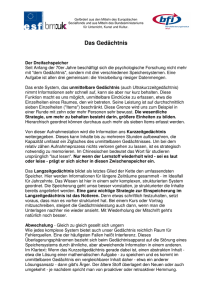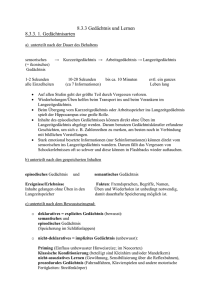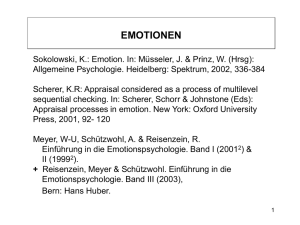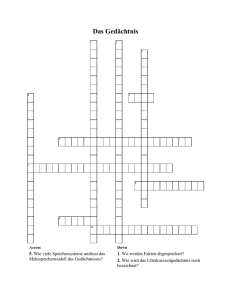Zusammenfassung der Inhalte Sommer 2017
Werbung

Hochschule Mannheim Fakultät Gestaltung Vorlesung Psychologie für Designer Zusammenfassung der Inhalte Wintersemester 2015/16 Dipl.-Psych. Dirk Berger Inhalt 1 Wissenschaftstheoretische Grundlagen.........................................................................................1 1.1 Das Verhältnis von Theorie und Empirie in der Wissenschaft..............................................1 1.2 Der Induktivismus.................................................................................................................1 1.3 Kritik am Induktivismus.......................................................................................................1 1.4 Der Falsifikationismus..........................................................................................................1 1.5 Probleme des Falsifikationismus..........................................................................................2 2 Methoden der empirischen Psychologie.......................................................................................2 2.1 Hypothesengenerierende Verfahren......................................................................................2 2.2 Hypothesentestende Verfahren..............................................................................................2 3 Lernen...........................................................................................................................................3 3.1 Das klassische Konditionieren..............................................................................................3 3.2 Kontiguität und Kontingenz..................................................................................................3 3.3 Reizgeneralisierung und Reizdiskrimination........................................................................4 3.4 Klassisches Konditionieren in der Werbung.........................................................................4 4 Gedächtnis....................................................................................................................................5 4.1. Das Ultrakurzeitgedächtnis..................................................................................................5 4.2. Das Kurzzeitgedächtnis........................................................................................................5 4.3 Das Langzeitgedächtnis........................................................................................................6 4.3.1 Das implizite Gedächtnis...............................................................................................6 4.3.2 Das explizite Gedächtnis...............................................................................................7 4.3.3 Wissensrepräsentation im Langzeitgedächtnis..............................................................8 4.4 Erinnern und Vergessen.........................................................................................................9 4.5 Der serielle Positionseffekt.................................................................................................10 5 Denken........................................................................................................................................10 5.1 Denken als Verhaltenssimulation........................................................................................10 5.2 Problemelösen.....................................................................................................................10 5.2.1 Problemraum und Problemtypen.................................................................................11 5.2.2 Algorithmen und Heuristiken .....................................................................................11 5.3 Urteilen und Entscheiden....................................................................................................11 5.3.1 Der Einsatz von Heuristiken bei der Urteilsbildung...................................................12 5.3.2 Rahmungseffekte bei der Entscheidungsfindung........................................................12 6 Emotion.......................................................................................................................................13 6.1 Abgrenzung des Emotionskonzepts....................................................................................13 6.2 Eigenschaften von Emotionen............................................................................................13 6.3 Formen von Emotionen.......................................................................................................13 6.4 Die Entstehung von Emotionen..........................................................................................14 6.5 Funktionen von Emotionen.................................................................................................14 6.6 Kommunikation von Emotionen.........................................................................................14 6.7 Emotion in der Werbung.....................................................................................................15 7 Einstellung..................................................................................................................................15 7.1 Einstellung und Verhalten...................................................................................................15 7.1.1 Verfügbarkeit...............................................................................................................15 7.1.2 Spezifität......................................................................................................................16 7.1.3 Modelle der Beziehung von Einstellung und Verhalten..............................................16 7.2 Einstellungserwerb und Einstellungsänderung...................................................................17 7.2.1 Einstellungserwerb durch Selbstwahrnehmung..........................................................17 7.2.2 Einstellungsänderung durch kognitive Dissonanz......................................................17 7.2.3 Persuasive Kommunikation.........................................................................................18 8 Aufmerksamkeit..........................................................................................................................18 8.1 Aufmerksamkeit ist begrenzt..............................................................................................18 8.2 Steuerung der Aufmerksamkeit...........................................................................................19 8.3 Aufmerksamkeit und Werbung............................................................................................19 9 Wahrnehmung.............................................................................................................................20 9.1 Wahrnehmung als aktiver Informationsverarbeitungsprozess............................................20 9.2 Wahrnehmungsmodalitäten.................................................................................................20 9.3 Ansätze der Wahrnehmungsforschung................................................................................21 9.4 Wahrnehmung von Licht und Helligkeit.............................................................................21 9.4.1 Physikalische Grundlagen der Farbwahrnehmung......................................................22 9.4.2 Farbwahrnehmung als Funktion von Antwortmustern der Photorezeptoren...............22 9.4.3 Die Gegenfarbentheorie von Hering...........................................................................24 9.5 Wahrnehmung räumlicher Tiefe..........................................................................................25 9.5.1 Monokulare Hinweisreize...........................................................................................25 9.5.2 Binokulare Hinweisreize.............................................................................................26 ..............................................................................................................................................27 1 Wissenschaftstheoretische Grundlagen 1.1 Das Verhältnis von Theorie und Empirie in der Wissenschaft Empirische Forschung ist durch das Zusammenspiel von Theorie und Empirie gekennzeichnet. Theorien als hypothetische Konstrukte interpretieren beobachtbare Sachverhalte (Empirie) und verleihen ihnen dadurch Sinn. Die beobachtbaren Sachverhalte ihrerseits bestätigen oder widerlegen Hypothesen, die aus den Theorien abgeleitet werden. Sie kontrollieren dadurch den Wahrheitsgehalt von theoretischen Behauptungen. Wissenschaftstheorien versuchen das Zusammenwirken von Theorie und Empirie beim Erkenntnisprozess eingehender zu beschreiben. 1.2 Der Induktivismus Nach dem Paradigma des Induktivismus beginnt der Erkenntnisprozess mit der Beobachtung. Wird ein bestimmter Sachverhalt in einer Vielzahl von Situationen wiederholt beobachtet, kann ein allgemeingültiges Gesetz formuliert werden. Dieser Vorgang, bei dem vom Speziellen auf das Allgemeine geschlossen wird, heißt Induktion. Die dadurch entstandene Theorie sagt voraus, dass auch in weiteren Situationen der bisher beobachtete Sachverhalt eintreffen wird. Bei dieser Deduktion genannten Vorhersage wird vom Allgemeinen auf das Spezielle geschlossen. Der Induktivismus geht also davon aus, dass vergangene Ereignisse eine zuverlässige Prognose für die Zukunft darstellen. 1.3 Kritik am Induktivismus Der Induktivismus setzt zwingend Beobachtungen voraus, die völlig objektiv, also frei von jeder Interpretation sind. Schließlich soll die Theoriebildung am Ende und nicht am Anfang des Erkenntnisprozesses stehen. Die Wahrnehmungspsychologie lehrt uns aber, dass interpretationsfreies Beobachten gar nicht möglich ist, da Wahrnehmung nicht einfach geschieht, sondern einen aktiven und damit hochgradig subjektiven Prozess darstellt. Z.B. ist jede Beobachtung bereits im Voraus von Erwartungen geprägt und kann damit nie völlig frei von Theorie sein. Die Unfähigkeit von Menschen zur objektiven Betrachtung stellt den Hauptkritikpunkt am Induktivismus dar. Ein weiteres Problem für den Induktivismus stellt die Forderung nach einer Vielzahl von Beobachtungswiederholungen dar. Wie viel davon reichen aus, um sicher zu sein, ein allgemeingültiges Gesetz formulieren zu können? Auch wenn ihre Anzahl noch so groß ist, können sie niemals mit absoluter Sicherheit gewährleisten, dass zukünftige Beobachtungen den bisherigen nicht widersprechen. Am Ende muss der Versuch, absolut allgemeingültige Gesetze zu formulieren, aufgegeben werden, um sich mit Wahrscheinlichkeitsaussagen zu begnügen. 1.4 Der Falsifikationismus Die immer lauter werdende Kritik am Induktivismus führte zu einem Paradigmenwechsel in der Wissenschaftstheorie. Der Falsifikationismus versucht die Schwächen des Induktivismus zu vermeiden, indem er einerseits die Theoriebildung an den Anfang des Erkenntnisprozesses rückt und andererseits die Entscheidung über ihren Wahrheitsgehalt am Ende von einer einzigen Beobachtung abhängig macht. Ist ein beobachtbarer Sachverhalt mit der Theorie vereinbar, gilt diese, zumindest vorläufig, als bestätigt (verifiziert); wenn allerdings auch nur eine Beobachtung gemacht wird, die mit der Theorie unvereinbar ist, so ist diese endgültig widerlegt (falsifiziert). Da die wiederholten Beobachtungen als Voraussetzung für die Formulierung einer Theorie entfallen, ist jede Theorie bis zu ihrer Falsifikation als gültig zu betrachten, egal wie kühn ihre Behaup1 tungen auch sein mögen. Ziel des Falsifikationismus ist es, eine Art evolutionären Prozess zu starten, bei dem Theorien, die durch eine neue Befundlage falsifiziert werden, durch neue bessere Theorien ersetzt werden, die dann früher oder später mit fortschreitendem Erkenntniszuwachs das selbe Schicksal ereilt. Der Wegfall der Beobachtung als Prämisse für die Theoriebildung heißt nicht, das diese nun völlig voraussetzungslos wäre. Ganz im Gegenteil, da das Ziel des Falsifikationismus ja die Widerlegung von nicht zutreffenden Theorien ist, müssen diese entsprechend widerlegbar formuliert sein, wozu ein gewisses Maß an Mut gehört. Eine Behauptung wie „Morgen regnet es oder nicht“ ist immer gültig und damit nicht falsifizierbar. 1.5 Probleme des Falsifikationismus Es wäre naiv, zu glauben, dass alle Wissenschaftler die Falsifikation ihrer Theorie durch eine einzige nicht theoriekonforme Beobachtung widerstandslos akzeptieren würden. Z.B. wird manchmal versucht, den Gültigkeitsbereich einer Theorie im Nachhinein einzuschränken, um diese wenigstens teilweise zu retten. Das ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber natürlich nicht im Sinne des falsifikationistischen Paradigmas. Ein weiteres Problem besteht in der Tatsache, dass eine Theorie nicht aus dem Nichts kommt, sondern einer gewissen Sachkenntnis bedarf. Diese ist allerdings im Forschungsalltag nicht immer in ausreichendem Ausmaß vorhanden, so dass, ganz induktivistisch, hypothesengenerierende Verfahren (s.u.) im Vorfeld der Theorieentwicklung angewandt werden. 2 Methoden der empirischen Psychologie 2.1 Hypothesengenerierende Verfahren Qualitative Verfahren, wie die teilnehmende Beobachtung oder Gruppendiskussion erlauben dem Forscher einen ersten vorläufigen Einblick in den Untersuchungsgegenstand. Sie sind hochgradig subjektiv, was aber auf dieser frühen Stufe des Forschungsprozesses bewusst in Kauf genommen wird. Existiert bereits eine große Menge von Datenmaterial, zum Beispiel in Form von Fragebogenergebnissen, empfiehlt es sich, quantitative Verfahren der mathematischen Datenreduktion wie Faktorenund Clusteranalysen einzusetzen. Ihr Beitrag zur Hypothesenbildung besteht im Aufzeigen von möglichen Sortierergebnissen von Personen oder Items in offene bzw. geschlossene Klassen. Sie sind objektiv und nachvollziehbar, verlangen aber ein hohes Ausmaß an methodischer Kompetenz. 2.2 Hypothesentestende Verfahren Feldstudien untersuchen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, die in natürlichen Umgebungen vorzufinden sind. Die Versuchspersonen werden dabei vom Versuchsleiter nicht manipuliert. Statt dessen werden die verschieden bereits vorhandenen Ausprägungen von Merkmalen der Versuchspersonen in Beziehung zu einer gewissen Wirkung (Kriterium) gesetzt. Es ist daher nicht möglich, unbekannte Einflussfaktoren zu kontrollieren. Ob dabei aufgefundene Zusammenhänge tatsächlich kausaler Natur (interne Validität) sind, kann daher nicht zweifelsfrei geklärt werden. Dafür entfällt naturgemäß die Frage nach der Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf reale Situationen (externe Validität). Mathematisch beschreiben Zusammenhangsmaße, allen vorweg der Korrelationskoeffizient, das 2 Ausmaß, in dem ein Merkmal (x) und ein Kriterium (y) bei den untersuchten Personen kovariieren. Das heißt, es wird dargestellt, inwieweit Personen, die auf dem verursachenden Merkmal (x) eine hohe Ausprägung besitzen, auch auf dem Kriterium (y) hohe Werte aufweisen et vice versa. Beim Experiment werden die Versuchspersonen durch Zufall einer Experimentalgruppe und einer Kontrollgruppe zugeordnet (Randomisierung). Die Experimentalgruppe wird einer Maßnahme ausgesetzt, von der angenommen wird, dass durch sie eine bestimmte Wirkung erzielt wird. Bei der Kontrollgruppe wird diese Maßnahme nicht angewandt. Unterscheiden sich nun die beiden Gruppen hinsichtlich der Wirkung (Kriterium), so kann sicher davon ausgegangen werden, dass dies ausschließlich auf die Maßnahme zurückzuführen ist. Die Wirkungsunterschiede werden durch einen Vergleich der Gruppenmittelwerte festgestellt. Wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen lassen den Schluss zu, dass die zufällige Einteilung der Probanden in Experimental- und Kontrollgruppe dazu führt, dass alle anderen Merkmale in beiden Gruppen annähernd gleich ausgeprägt sind und somit als weitere Einflussfaktoren auszuschließen sind. Ein hohes Maß an interner Validität ist dadurch gewährleistet. Nach dem Paradigma des Falsifikationismus stellt das Experiment daher die Methode der ersten Wahl dar. Die Kontrolle sämtlicher Einflüsse und die Manipulation der Experimentalgruppe durch den Versuchsleiter führen aber zu einer vollkommen künstlichen Laborsituation, die sich unter Umständen von einer realen Situation maßgeblich unterscheidet. Damit ist die Übertragbarkeit von Ergebnissen, die aus Experimenten stammen, auf das wirkliche Leben eingeschränkt. 3 Lernen Wenn eine Person in einer bestimmten Situation ein anderes Verhalten zeigt, als in einer vergleichbaren vorherigen Situation, hat sie gelernt, vorausgesetzt die Verhaltensänderung ist nicht durch andere Gründe, wie z.B. Krankheit zu erklären. Die psychologische Definition von Lernen lautet: Lernen ist eine relativ überdauernde Verhaltensveränderung, aufgrund bisher gemachter Erfahrungen. Es stellt eine Anpassung des Verhaltens an veränderte situative Bedingungen dar. 3.1 Das klassische Konditionieren Die Entstehung und Veränderung von Reiz-Reaktions-Beziehungen, sogenannte bedingte Reflexe, untersuchten die klassischen Behavioristen. Der von ihnen entdeckte Lernprozess wird klassisches Konditionieren genannt. Dabei wird ein bisher neutraler Reiz (CS) so oft zusammen mit einem ursprünglich eine bestimmte Reaktion (R) auslösenden Reiz (UCS) dargeboten, bis das Subjekt gelernt hat, auf den neuen Reiz genauso zu reagieren, wie auf den ursprünglichen. Nach Abschluss der Konditionierung hat dann der bisher neutrale Reiz gewissermaßen eine Stellvertreterfunktion für den originär die Reaktion auslösenden Reiz übernommen. Eine Reaktion kann aus einem bestimmten Verhalten, emotionalen Zuständen, körperlichen und kognitiven Reaktionen bestehen. Eine Reiz-Reaktion-Beziehung bleibt so lange stabil, bis sie von nachfolgenden Lernerfahrungen abgelöst wird. 3.2 Kontiguität und Kontingenz Die klassische Lernpsychologie postuliert, dass allein die Kontiguität, also das zeitliche Zusammentreffen, von konditioniertem und unkonditioniertem Reiz darüber entscheidet, wie gut eine neue Reiz-Reaktion-Verbindung gelernt wird. Spätere experimentelle Befunde weisen jedoch darauf hin, dass entscheidend ist, ob der konditionierte Stimulus das Eintreffen des konditionierten Stimulus vorhersagen kann. Diese Signalwirkung hängt von der Kontingenz ab, bei der zwei bedingte Wahrscheinlichkeiten in Beziehung gesetzt werden: 3 P (UCS|CS) – P(UCS|kein CS) Um eine Reiz-Reaktion-Beziehung schnell und stabil zu lernen, sollte der unkonditionierte Stimulus häufig mit dem konditionierten Reiz kombiniert werden, aber möglichst selten ohne ihn wahrgenommen werden. Für die Annahme, dass die Vorhersagekraft des konditionierten Reizes die wesentliche Rolle spielt, spricht auch die Tatsache, dass besser gelernt wird, wenn der unkonditionierte auf den konditionierten Reiz folgt. Bei umgekehrter Reihenfolge fällt dessen Signalfunktion weg, was sich negativ auf den Lernerfolg auswirkt. 3.3 Reizgeneralisierung und Reizdiskrimination Hat ein Subjekt gelernt auf einen bestimmten Reiz mit einer bestimmten Reaktion zu antworten, wird er auch bei ähnlichen Reizen die gleiche Reaktion zeigen; wenn auch in entsprechend abgeschwächter Form. Dabei gilt die Regel: je ähnlicher ein Reiz dem konditionierten Reiz ist, um so heftiger wird die erlernte Reaktion ausfallen. Erschrickt ein Kind, weil es von einem Hund angebellt (UCS) wird, so wird es in Zukunft Angst (R) vor anderen Hunden (CS) haben. Es wird aber auch auf andere Tiere, die vier Beine und Fell haben mit Angst reagieren, die um so stärker ausfällt, je ähnlicher das entsprechende Tier einem Hund ist. Die Angstreaktion wird generalisiert. Andererseits kann das Kind lernen, dass man mit Kaninchen kuscheln kann, ohne dass sie bellen. Diese neue Lernerfahrung widerspricht der bisherigen und die Reaktion auf die harmlosen Kaninchen wird in Zukunft eine komplett andere sein, als bei Hunden. Das Kind hat gelernt, bestimmte Reize von anderen zu unterscheiden und auf diese differenziert zu reagieren. Die Reizdiskrimination übernimmt gewissermaßen die Funktion des Gegenspielers der Generalisierung, und verhindert, dass erlernte Reaktionen unkontrolliert auf andere Reize übertragen werden. 3.4 Klassisches Konditionieren in der Werbung Die Möglichkeit, positive emotionale Reaktionen an zuvor neutrale Reize zu knüpfen, stellt eine interessante Perspektive für den Einsatz von Werbemitteln dar. Dabei sollen z.B. Firmenlogos durch die wiederholte Darbietung zusammen mit attraktiven Menschen, niedlichen Tierbabys oder schönen Landschaften etc. emotional aufgeladen werden. Aus lernpsychologischer Sicht hängt der Erfolg solcher Strategien vor allem von der Gewährleistung der Signalwirkung des eingesetzten Reizmaterials ab. Dies verlangt, dass zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens sollte der unkonditionierte Reiz (Markenlogo, Produkt etc.) stets vor dem unkonditionierten Reiz (schöne Landschaften, angenehme Musik etc.) wahrgenommen werden. Beim Einsatz zeitbasierten Medien stellt dies eine leicht zu lösende Aufgabe dar. Bei anderen Medien, wie z.B. Anzeigen oder Plakaten kann man sich mit dem geschickten Positionieren im Blickfeld und anderen gestalterischen Mitteln (Größe, Farbe etc.) behelfen. Zweitens sollte die Forderung nach Kontingenz erfüllt werden, in dem ein unkonditionierter Stimulus zum Einsatz kommt, der ausschließlich in Kombination mit dem konditionierten auftritt. Vom Einsatz allgemein bekannter Stimuli (Prominente, aktuelle Hits etc. ) muss aus lernpsychologischer Sicht abgeraten werden, da diese häufig ohne den konditionierten Reiz wahrgenommen werden. Der schnelle und stabile Aufbau der gewünschten Reiz-Reaktion-Beziehung kann dabei nicht gewährleistet werden. Letztendlich muss durch stetige Neugestaltung von Stimulusmaterial (Produktdesign, Logos etc.), das sich deutlich von dem der Mitbewerber unterscheidet, verhindert werden, dass Konkurrenten als Trittbrettfahrer Generalisierungseffekte ausnutzen. 4 4 Gedächtnis Das Gedächtnis stellt die Fähigkeit eines Individuums dar Informationen zu behalten, zu verarbeiten und zu erinnern. Es lässt sich zum einen hinsichtlich der Funktion verschiedener Gedächtnisstrukturen und zum anderen nach Art der Gedächtnisinhalte unterteilen. Das Drei-Speicher-Modell des Gedächtnisses unterscheidet seine Subsysteme vor allem anhand ihrer Speicherdauer: Kurzzeitgedächtnis Ultrakurzzeitgedächtnis Langzeitgedächtnis 4.1. Das Ultrakurzzeitgedächtnis Neue Informationen, die von den Sinnesorganen weitergeleitet werden, erreichen zuerst das auch als sensorisches Register bezeichnete Ultrakurzzeitgedächtnis(UKZ). Es wird in das ikonische Gedächtnis für visuelle Reize und das echotische Gedächtnis für akustische Reize unterteilt. Es hat eine sehr große Speicherkapazität, jedoch nur eine extrem kurze Speicherdauer, die bei visueller Information bis ca. 200 Millisekunden und bei akustischer Information bis ca. 2 Sekunden beträgt. Im UKZ werden unbewusst alle ankommenden sensorischen Reize für kurze Zeit gespeichert, um die Herstellung einer kontinuierlichen Wahrnehmung von Augenblick zu Augenblick zu gewährleisten. So unterbricht das visuelle System beispielsweise die Informationsaufnahme, während das Auge unwillkürliche kleine Bewegungen (Sakkaden) ausführt, die 15-100 Millisekunden andauern. Stattdessen speichert das ikonische Gedächtnis die vor dem Sakkadenstart gewonnenen visuellen Reize, um so die zeitliche Lücke im Sehprozess zu schließen. Bei der anschließenden Überführung von Information in das Kurzzeitgedächtnis übernimmt die Aufmerksamkeitssteuerung (s.u.) dann eine selektive Funktion. 4.2. Das Kurzzeitgedächtnis Das Kurzzeitgedächtnis (KG) ist durch eine relativ kurze Speicherdauer gekennzeichnet, im Vergleich zum UKZ verfügt es aber auch über eine sehr geringe Speicherkapazität von nur ca. sieben voneinander unabhängigen Einheiten. Die limitierte Kapazität kann besser genutzt werden, wenn es gelingt, einzelne Elemente zu größeren Sinneinheiten zu verknüpfen. Die folgenden Zahlen- bzw. Buchstabenreihen übersteigen eigentlich deutlich die Kapazität des KG: ADACZDFGMBHDGB 1914191819391945 Bei dieser als Chunking bezeichneten Methode werden durch die Verknüpfung der kleinsten Sinneinheiten (z.B. Buchstaben, Ziffern) zu größeren Sinneinheiten (Wörter, Jahreszahlen) die Anzahl der zu speichernden Einheiten reduziert und dadurch das KG entlastet: ADAC ZDF GMBH DGB 1914 1918 1939 1945 Die aus dem UKZ ausgewählten Informationen werden im KG also bewusst weiterverarbeitet (ela5 boriert) und mit Hilfe aus dem Langzeitgedächtnis stammender Information manipuliert. Aus diesem Grund wurde das KG in moderneren Theorien durch das ausführlichere Konzept des Arbeitsgedächtnisses präzisiert, welches eine Analogie zum Arbeitsspeicher der elektronischen Datenverarbeitung darstellt. Dieses umfasst wiederum drei Subsysteme: Die phonologische Schleife dient zur Speicherung sprachlicher Informationen, die durch Wiederholen verfügbar bleibt. So kann man sich z.B. eine Telefonnummer so lange merken, wie man diese innerlich aufsagt. Dieses innere Wiederholen verbaler Informationen führt bereits zur Speicherung im Langzeitgedächtnis. Ein Beispiel dafür ist das Auswendiglernen eines Gedichtes. Analog dazu speichert und verarbeitet der visuell-räumliche Notizblock visuelle Informationen. Diese bleiben so lange im Arbeitsgedächtnis präsent, wie man sie sich mit einem "inneren Auge" vorstellt. Kontrolliert werden diese zwei Unterspeicher durch die zentrale Exekutive, die auch durch die Steuerung der Aufmerksamkeit den Informationsstrom aus dem UKZ reguliert. Diese werden hier, wie bereits beim Konzept des KG dargestellt, mit Informationen aus dem Langzeitgedächtnis verknüpft. 4.3 Das Langzeitgedächtnis Das Langzeitgedächtnis (LZG) speichert dauerhaft Information und wird deswegen auch als permanentes Gedächtnis bezeichnet. Speicherdauer und Speicherkapazität gelten als unbegrenzt. Das Langzeitgedächtnis lässt sich nach der Art der abzurufenden Informationen unterteilen. Das implizite Gedächtnis speichert Informationen, die ohne geistige Anstrengung abzurufen sind. Das Erinnern geschieht gewissermaßen automatisch, ohne nachzudenken. Informationen aus dem expliziten Gedächtnis dagegen bedürfen bewusster Anstrengung um abgerufen zu werden. 4.3.1 Das implizite Gedächtnis Im allgemeinen verstehen wir unter implizitem Wissen eher unser Können, als das was wir "wissen". Dabei handelt es sich oft um Handlungsabläufe. Dann spricht man auch vom prozeduralen Gedächtnis. Wenn jemand auf die Frage, welcher Buchstabe auf T im Alphabet folgt, erst antworten kann, wenn er das komplette ABC aufsagt, bis er an der entsprechenden Stelle angelangt ist, ruft Inhalte aus dem impliziten bzw. dem prozeduralen Gedächtnis ab. Das implizite Gedächtnis kann als ein Netzwerk aufgefasst werden, in dem die gespeicherten Informationen assoziativ miteinander verknüpft sind. Wird ein Inhalt von außen aktiviert, so breitet sich die Aktivierung über damit verbundene Inhalte aus und schwächt sich dabei zunehmend ab. Bereits aktivierte Inhalte werden leichter erinnert als nicht aktivierte. Diese Aktivitätsausbreitung wird für Priming-Effekte verantwortlich gemacht, die sich folgendermaßen demonstrieren lassen. Eine Person soll folgende Fragen möglichst schnell beantworten: Welche Farbe hat ein Brautkleid? Welche Farbe hat Schnee? Welche Farbe hat ein Schwan? Was trinkt eine Kuh? 6 Die ersten drei Fragen dienen dazu, das Konzept "weiß" zu aktivieren. Direkt damit assoziierte Konzepte (Kreide, Milch, etc.) werden über die sich ausbreitende Aktivierung ebenfalls aktiviert, wenn auch in geringerem Maße. Da bei den meisten Menschen die Konzepte "Kuh" und "Milch" direkt miteinander assoziiert sind und "Milch" darüber hinaus durch den vorherigen Aufruf der Farbe "weiß" mit aktiviert wurde, antworten die meisten Personen auf die letzte Frage fälschlicherweise mit "Milch". Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Testpersonen möglichst schnell antworten. Andernfalls könnten sie die Frage mit Hilfe des expliziten Gedächtnisses beantworten, was allerdings mit bewusster Anstrengung, Konzentration und letztendlich auch mit zeitlichem Aufwand verbunden wäre. Die Wahrscheinlichkeit, dass die richtige Antwort "Wasser" genannt würde, wäre bei intensiver Reflexion der Frage natürlich deutlich höher. 4.3.2 Das explizite Gedächtnis Das explizite oder auch deklarative Gedächtnis speichert Information, die bewusst abgerufen werden muss. Es beinhaltet das episodische Gedächtnis, das persönliche Erlebnisse speichert. Der Abruf autobiografischer Erlebnisse hängt davon ab ob kontextspezifische Hinweisreize zur Verfügung stehen. Das semantische Gedächtnis ist ebenfalls Teil des expliziten Gedächtnisses. Es enthält das allgemeine, faktische Wissen einer Person über die Welt. Informationen des semantischen Gedächtnisses begegnen uns in vielen verschiedenen Kontexten und benötigen daher keine spezifischen Hinweisreize, um abgerufen werden zu können. Da das gesamte semantische Wissen ursprünglich episodisches Wissen war, kann entfallenes semantisches Wissen mit Hilfe spezifischer Hinweisreize aus dem episodischen Gedächtnis abgerufen werden. 7 4.3.3 Wissensrepräsentation im Langzeitgedächtnis Nach der Theorie der dualen Kodierung wird Wissen im Langzeitgedächtnis entweder in Form von räumlichen Vorstellungsbildern oder in Form linearer Ordnungen gespeichert. Die visuelle Modalität ist dabei an den räumlichen Code, die verbale Modalität an den linearen Code gebunden. Bedeutungsmäßiges Wissen dagegen wird in Form von Propositionen gespeichert, die nicht die genaue Struktur des erinnerten Ereignisses bewahren, sondern nur dessen Bedeutung. Die folgenden 4 Sätze haben, obwohl sie formal unterschiedlich sind, die gleiche inhaltliche Aussage: 1. Nixon schenkte Breschnew, dem Staatschef der UdSSR, einen schönen Cadillac. 2. Der Staatschef der UdSSR, Breschnew, bekam von Nixon einen Cadillac geschenkt, der sehr schön war. 3. Der schöne Cadillac wurde Breschnew, dem Staatschef der UdSSR, von Nixon geschenkt. 4. Das Staatsoberhaupt der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Breschnew, bekam von Nixon ein Präsent in Form eines schönen Cadillacs überreicht. Die unten dargestellten Propositionen stellen die gemeinsame Bedeutung der vier Sätze grafisch dar: Begriffe, die in mehreren Propositionen auftauchen, z.B. als Objekt, Subjekt oder Relation, dienen als Knotenpunkte eines Netzes. Vor allem Unterbegriffsrelationen verleihen dem propositionalen Netzwerk eine hierarchische Grundstruktur, bei der Begriffe in unterschiedliche Abstraktionsebenen unterteilt werden (s. Abb. u.). Propositionale Netzwerke können sehr umfangreich sein und unser gesamtes semantisches Wissen repräsentieren. 8 4.4 Erinnern und Vergessen Inhalte des semantischen Gedächtnisses können durch stetiges Wiederholen prozeduralisiert werden, d.h. in implizites Wissen verwandelt werden. Sie sind nun "in Fleisch und Blut übergegangen" und automatisch und ohne größere Anstrengung abrufbar. Dadurch wird das Kurzzeitgedächtnis, das hinsichtlich Behaltensdauer und Speicherkapazität sehr eingeschränkt ist, entlastet. Allerdings wird diese Automatisierung des Abrufs dadurch erkauft, das ein bewusster, absichtlicher Zugriff auf diese Inhalte nun nicht mehr möglich ist. Eine Reaktivierung dieser Inhalte, mit Hilfe der Stimulation durch Hinweisreize, bleibt aber möglich. Vergessen stellt daher weniger einen Informationsverlust dar, sondern beschreibt eher die Schwierigkeit, gespeicherte Informationen abzurufen. Das Ausmaß des Vergessens hängt entscheidend von der Methode des Erinnerns ab: Das freie Reproduzieren (recall) von Inhalten stellt eine deutlich schwierigere Aufgabe dar, als wenn die selben Inhalte nur wiedererkannt (recognition) werden müssen. Die weitaus besseren Ergebnisse bei Wiederkennen zeigen, dass bei Vergessen Informationen weniger verloren gehen, sondern einfach nicht gefunden werden. Im impliziten Gedächtnis sind vor allem Primingeffekte (s.o.) für Schwierigkeiten des Abrufs bestimmter Inhalte verantwortlich zu machen. Eine weitere Ursache des Vergessens besteht darin, dass jede Erinnerung einen aktiven Konstruktionsprozess darstellt, bei dem sich jedes mal Fehler einschleichen, wie bei der seriellen Reproduktion von Geschichten zu beobachten ist. Diese werden vereinfacht, Details akzentuiert oder so verändert, das sie besser zum Hintergrundwissen der betroffenen Person passen. 9 Ein wichtiges Konzept für unterschiedliche Behaltensleistungen stellt die Interferenz (s.u.) dar, nach dem Inhalte bei der Einspeicherung miteinander konkurrieren. 4.5 Der serielle Positionseffekt Inhalte am Anfang und am Ende einer Liste werden besser erinnert, als Inhalte mittlerer Position. Dieses als serieller Positionseffekt bezeichnete Phänomen tritt nicht ausschließlich in künstlichen Laborsituationen auf, sondern ist auch im alltäglichen Leben zu beobachten. Aus diesem Grund kosten z.B. Platzierungen von Werbespots am Anfang oder Ende eines Werbeblocks (Eckplatzierungen) ca. 20% mehr als eine Position dazwischen. Eigentlich setzt sich der serielle Positionseffekt aus zwei zu unterscheidenden Effekten zusammen. Der erhöhten Erinnerungsleistung von Inhalten am Anfang einer Liste, Primacy-Effekt genannt, steht die ansteigende Erinnerungsleistung von Inhalten vom Ende der Liste, der Recency-Effekt entgegen. Um die beiden Effekte erklären zu können, muss verstanden werden, dass sich sequentiell dargebotene Inhalte gegenseitig bei der Speicherung behindern. Dabei gilt: Je ähnlicher sich Inhalte sind, umso mehr stören sie sich. Man spricht von proaktiver Interferenz, wenn bereits gespeichertes Material nachfolgendes blockiert und von retroaktiver Interferenz, wenn nachfolgendes Material bereits gespeichertes verdrängt. Wenn die redaktionellen Inhalte vor und nach dem Werbeblock von den Rezipienten deutlich vom Werbeblock unterschieden werden können, kann davon ausgegangen werden, dass sie mit diesem kaum interferieren. Anders verhält sich dies innerhalb des Werbeblocks, vor allem, wenn die Inhalte als relativ ähnlich wahrgenommen werden. Spots in der Mitte eines Blocks werden gleichermaßen proaktiv wie auch retroaktiv gehemmt. Dies führt dazu, dass sie schlechter erinnert werden, als Spots am Anfang, die nur retroaktiv gehemmt werden und Spots am Ende, die nur proaktiv gehemmt werden. 5 Denken Lange galt das Denken als Teil einer metaphysischen Seele, was es als Gegenstand empirischer Forschung ausschloss. Spätestens aber, als Ergebnisse aus Tierexperimenten nahelegten, dass vor allem Affen eine gewisse Fähigkeit zur Einsicht zugestanden werden muss, änderte sich diese Auffassung grundlegend. 5.1 Denken als Verhaltenssimulation Das Denken stellt eine Möglichkeit der Verhaltensmodifikation dar, bei der, ganz im Gegensatz zum Lernen, auf Erfahrungen in ähnlichen Situationen verzichtet und die dabei entstehenden Risiken vermieden werden können. Stattdessen spielt das Subjekt gewissermaßen die verschieden Lösungsansätze mental durch, um sie hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Tauglichkeit zur Zielerreichung zu beurteilen. Dass sich dieses interne Probehandeln wahrscheinlich aus tatsächlichem Handeln entwickelt hat, zeigen Ergebnisse, z.B. aus Experimenten zur mentalen Rotation oder zu räumlichen mentalen Modellen. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass mentale Operationen an Vorstellungsbildern auffallend viele Gemeinsamkeiten mit realen physikalischen Operationen aufweisen. 5.2 Problemelösen Assoziationspsychologische Konzepte verstanden Denken als eine ungerichtete Ausbreitung von 10 Assoziationen. Erst die Erkenntnis, dass Denken stets zielgerichtet ist, qualifizierte es als einen Problemlöseprozess. Ein Problem kann, im Gegensatz zu einer Aufgabe, nicht durch erlerntes Verhalten gelöst werden, sondern es müssen neue, bisher unbekannte Lösungswege entwickelt werden. Die Zielgerichtetheit bezieht sich beim konvergenten Denken auf das Auffinden einer einzigen möglichen Lösung, wie dies vor allem beim logischen Schließen verlangt wird, oder beim divergenten Denken auf das Generieren möglichst vieler unterschiedlicher Lösungsansätze, das kreative Tätigkeiten qualifiziert. 5.2.1 Problemraum und Problemtypen Formal betrachtet lassen sich Probleme hinsichtlich folgender Elemente beschreiben: 1. dem Ausgangszustand, der eine gegeben, unbefriedigende Ist-Situation darstellt, 2. dem Zielzustand, den man durch den Problemlöseprozess zu erreichen hofft und 3. geistige Schritte, Operatoren genannt, mit deren Hilfe man versucht, den Ausgangszustand in den Zielzustand zu transformieren. Zusammen definieren diese drei Elemente den Problemraum, eine Art mentales Labyrinth, das bei der Lösungssuche mit Hilfe von Richtungsänderungen und Umwegen durchschritten werden muss. Die Steuerung übernehmen dabei Metaoperatoren, die als Teil des impliziten Gedächtnisses reflexhaft einsetzen und selbst nicht willentlich gesteuert werden können. Dieses automatisch ablaufende Operatoren-Management organisiert die Zerlegung des Gesamtziels in Zwischenziele. Häufig angewandte Metastrategien sind z.B. die Reduktion von Unterschieden, bei der sich sukzessive die Teilziele dem Gesamtziel angleichen oder die Rückwärtssuche, bei der vom Zielzustand aus versucht wird, den Ausgangszustand zu erreichen. Je nachdem, wie gut die verschiedenen Elemente des Problemraums definiert sind, unterscheidet man drei Arten von Problemen. Bei Interpolationsproblemen sind alle drei Elemente gut definiert, die Schwierigkeit besteht aber darin, aus einer unüberschaubaren Menge möglicher Operatorenkombinationen die zielführenden auszusuchen. Syntheseprobleme dagegen zeichnen sich dadurch aus, das unklar ist, welche Operatoren überhaupt zur Verfügung stehen, wie dies oft bei Danksportaufgaben der Fall ist. Die dialektischen Probleme sind dadurch gekennzeichnet, dass bei ihnen Ausgangszustand und Operatoren gut, der Zielzustand dagegen schlecht definiert ist. Viele künstlerische Problemstellungen beinhalten eine solche dialektische Barriere. 5.2.2 Algorithmen und Heuristiken Algorithmen sind Verfahren, mit denen man garantiert die korrekte Lösung eines Problems findet, falls sie existiert. Die einzelnen Schritte eines Algorithmus sind streng logisch und vollkommen explizit. Sowohl die Entwicklung und die Anwendung von Algorithmen sind oft mit enormem Aufwand versehen, so dass sie nur in wenigen, meist sehr bedeutenden Problemstellungen zum Einsatz kommen. Im alltäglichen Problemlösen verwenden wir weitaus häufiger Heuristiken, die gewissermaßen natürliche Faustregeln darstellen, wesentlich weniger aufwendig sind und meist schnell zu einer Lösung führen. Auch wenn sie sich im Alltag meist bewähren, sind sie nicht streng logisch und ihre Anwendung ist implizit. 5.3 Urteilen und Entscheiden Urteilen und Entscheidungen sind alltägliche Herausforderungen, die an das menschliche Denken gestellt werden. Beim Urteilen müssen wir Personen, Objekte oder Ereignisse bewerten, und entsprechende Schlussfolgerungen ziehen. Beim Entscheiden müssen wir aus einer Reihe möglicher Alternativen eine Auswahl treffen. Urteilen und Entscheiden sind Prozesse die ineinandergreifen. Unser gesamtes Konsumverhalten lässt sich als ein ständiger Bewertungs- und Auswahlprozess ver11 stehen, was die marktpsychologische Bedeutung von Urteils- und Entscheidungsfindung deutlich macht. 5.3.1 Der Einsatz von Heuristiken bei der Urteilsbildung Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, greifen Menschen beim Problemlösen in alltäglichen Situationen verstärkt auf informelle Faustregeln, sogenannte Heuristiken, zurück. Ihr Einsatz bei der Urteilsbildung ist durch mehrere Beispiele belegt. Z.B. bei der Verfügbarkeitsheuristik nutzen wir Informationen, die uns besonders leicht einfallen (s. recall), unabhängig davon, ob sie für das Urteil tatsächlich von Bedeutung sind. Z.B. schätzen Menschen die Einwohnerzahl einer Stadt umso größer ein, je mehr sie über eine Stadt wissen bzw. umso bekannter ihnen eine Stadt ist. Eine weitere Urteilsheuristik basiert auf dem induktiven Schließen. Stellen Menschen fest, dass ein Objekt bestimmte Eigenschaften besitzt, die Merkmale für typische Vertreter einer bestimmten Kategorie sind, so neigen sie dazu, das Objekt tatsächlich wie einen solchen prototypischen Vertreter dieser Kategorie zu behandeln. Wirklich Relevante Information wird bei der Repräsentativitätsheurisik dagegen missachtet. Stellt man Versuchspersonen z.B. die Frage: „Welchen Sport übt ein erfolgreicher Anwalt aus?“ antworten diese eher mit „Tennis“ als mit „eine Ballsportart“. Der Prototyp des erfolgreichen Anwalts spielt in unserer Vorstellung Tennis, unabhängig davon, dass Tennis ja Teilmenge der Menge der Ballsportarten ist und folglich weniger wahrscheinlich ist. Sollen Menschen die Qualität von Marken beurteilen, neigen sie dazu, die Rekognitionsheuristik anzuwenden. Marken, die sie leicht wiedererkennen (s. recognition), werden als hochwertig eingestuft. Bei der Ankerheuristik orientieren sich Menschen bei der Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses an Ausgangswerten. Schätzungen des Ergebnisses der folgenden Multiplikation: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 = _________ fallen stets niedriger aus, als wenn man die selbe Multiplikation rückwärts darstellt: 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = _________ Der Schätzwert liegt dann mit durchschnittlich 2250 über viermal höher als mit 512 unter der ersten Bedingung. Erklären kann man sich den Effekt dadurch, dass Menschen bei diesen Aufgaben die ersten zwei bis drei Rechenoperationen tatsächlich ausführen und dann fälschlicherweise einen relativ linearen weiteren Verlauf ihrer Schätzung zugrundelegen. 5.3.2 Rahmungseffekte bei der Entscheidungsfindung Entscheidungen zu treffen verlangt oft die Kosten oder den Gewinn von Alternativen abzuschätzen. Unterschiedliche Beschreibungen einer Wahlsituation führen zu verschiedenen Bezugspunkten, die die Entscheidungsfindung beeinflussen können. D.h. ein und die selbe Alternative wird von einem unterschiedlich dargestellten, wenn auch formal gleichen Kontext unterschiedlich bewertet und daraufhin entweder angenommen oder abgelehnt. Informiert man z.B. Personen darüber, dass die meisten Menschen bei der Partnerwahl auf die Charakterzüge Humor, Ehrlichkeit und Intelligenz wert legen und fordert sie dann auf, sich einen imaginären Partner vorzustellen, der zwei dieser drei geforderten Eigenschaften besäße, so beurteilen diese anschließend die Zukunft ihrer eigenen Beziehung eher positiv. Personen, die man dagegen auffordert, sich einen imaginären Partner vorzustellen, dem einer der drei Charakterzüge fehle, antworten deutlich pessimistischer. Unter der ersten Bedingung beurteilten wir die eigene Beziehung vor dem Hintergrund einer Gewinnsituation. Sie regt uns an, positive Merkmale des Partners zu suchen. Die zweite Bedingung beschreibt eine Ver12 lustsituation, vor deren Hintergrund wir angeregt werden, fehlende positive Merkmale des Partners zu suchen. In beiden Bedingungen werden wir fündig; die Entscheidung für oder gegen den Partner fallen daher tendenziell unterschiedlich aus. 6 Emotion Eine allgemein akzeptierte Definition von Emotion existiert, trotz vieler interessanter Ansätze, nicht. Allerdings ist ihre Entstehung, wie auch ihre Funktion ziemlich gut erklärt, was uns ein weitgehendes Verständnis von Emotion ermöglicht. 6.1 Abgrenzung des Emotionskonzepts Umgangssprachlich wird der Begriff Emotion synonym mit Gefühl verwendet. Das ist nachvollziehbar, vor allem wenn man bedenkt, dass Emotion von lat. emotio = heftige Bewegung stammt. Gefühle sind es, die uns innerlich bewegen und deren wir subjektiv gewahr werden. Dieses subjektive Erleben stellt als Endresultat eines komplexen Prozesses gewissermaßen die Spitze eines Eisberges dar. Dieser besteht aus Wahrnehmungen, physischen und kognitiven Reaktionen etc., die alle miteinander verwoben vom Emotionskonzept erfasst werden. Emotion stellt eine objektive Sicht, aus wissenschaftlicher Perspektive, auf die Prozesse, die dem subjektiven Gefühl zugrunde liegen, dar. Deutlich abzugrenzen ist das Emotionskonzept von dem der Stimmung. Während Emotion eher eine Reaktion auf eine bestimmte Situation darstellt, resultieren Stimmungen mehr aus Bedürfnissen, wobei die Auslöser eher in den Hintergrund treten. Sie sind zeitlich stabiler und werden als weniger intensiv erlebt. Stimmungen haben darüber hinaus weniger verhaltenssteuernden Charakter als Emotionen. Begrifflich schwer zu trennen ist Emotion von Affekt. Dieses Konzept wird häufiger im klinischen Kontext gebraucht (z.B. affektive Störung) und unterstreicht noch deutlicher die verhaltenssteuernden Funktion (Affekttat) gegenüber der Stimmung, als dies das Konzept der Emotion tut. Im wissenschaftlichen Kontext werden die beiden Begriffe oft als Synonyme verwendet. 6.2 Eigenschaften von Emotionen Emotionen haben immer eine Valenz, also eine bewertende Funktion, die über Annäherung und Vermeidung entscheidet. Diese Verhaltenstendenzen zeigen ihre Bedeutung und konzeptuelle Nähe zur Motivation. Emotionen werden stets von reger kognitiver Aktivität und deutlichen physiologischen Reaktionen begleitet. Verschiedene, sogar scheinbar widersprüchliche Emotionen können in ein und der selben Situation zusammen auftreten und ermöglichen so ein vielfältiges und komplexes emotionales Erleben. 6.3 Formen von Emotionen Die Frage nach den Grundbausteinen der Emotion, aus denen sich unser komplexes Gefühlsleben zusammensetzt, wird gern mit Hilfe des emotionalen Ausdrucks beantwortet. Angenommen wird dabei, dass Emotionen, die durch eine spezifische Mimik unverwechselbar erkennbar sind, eine mit Atomen vergleichbare Funktion übernehmen, während alle anderen Gefühlsqualitäten gewissermaßen Legierungen aus diesen Kernelementen darstellen. Demnach wären sechs bis sieben Grunddimensionen des emotionalen Erlebens identifizierbar. Neben Freude, Überraschung, Angst, Ärger, Ekel und Trauer zählen manche Emotionsforscher noch Verachtung zu den Grundemotionen, aus 13 denen sich alle weiteren Emotionen zusammensetzen. Es erscheint jedoch ziemlich unplausibel, dass so fundamental wichtige Emotionen, wie z.B. Humor, Geborgenheit oder Stolz usw. Kombinationen der oben genannten Grundelemente darstellen. Ein Blick auf die Entstehung von Emotion (s.u.) macht schnell deutlich, dass diese Art der Katalogisierung von Emotion weder möglich noch nötig ist. 6.4 Die Entstehung von Emotionen Unserer alltäglichen Selbsterfahrung zufolge, reagieren wir auf bestimmte Erlebnisse emotional. Die Emotion ihrerseits führt dann zu körperlichen und kognitiven Reaktionen. Diese naive Auffassung wird vor allem durch Ergebnisse aus Experimenten zur Fehlattribuierung in Frage gestellt. Dabei werden Menschen in einen körperlichen Erregungszustand versetzt (z.B. durch Sport, Stimulanzen, etc.), um anschließend zu beobachten, dass sie Situationen emotionaler erleben, als Personen, die nicht erregt wurden. Die Zwei-Faktoren-Theorie der Entstehung von Emotion nimmt daher an, das die physiologischen Reaktionen, die emotionalisierte Menschen zeigen, nicht etwa Resultat der Emotion sind, sondern deren Voraussetzung. D.h. der Körper reagiert bei einem bestimmten Erlebnis durch eine bis dahin relativ unspezifische Erregung. Sie muss anschließend kognitiv erklärt werden, wobei vordergründig plausible Erklärungen bevorzugt werden, die aber nicht unbedingt die korrekten sein müssen. Die ungeheure Komplexität, die sich aus der nahezu unbegrenzten Vielfalt körperlicher Reaktionen in Kombination mit unendlich vielen möglichen kognitiven Erklärungen ergibt, erklärt, warum eine abschließende Unterteilung der Formen von Emotion kaum möglich sein wird. In gewisser Weise steht jedes einzelne emotionale Erlebnis für sich selbst. 6.5 Funktionen von Emotionen Wie bereits oben ausführlich dargestellt, kann man menschliches Verhalten zu einem großen Teil mit angeborenen und gelernten Reiz-Reaktion-Beziehungen erklären. D.h. tritt ein Reiz auf, müsste dies eigentlich automatisch und unweigerlich zur entsprechenden Reaktion führen. Erst Lernerfahrungen könnten dieses Verhältnis modifizieren. Nun ist aber der Mensch zum Lernen durch Einsicht in der Lage (s.o. Denken). Er kann z.B. verstehen, das es irrational ist, auf einen generalisierten Auslöser mit Flucht zu reagieren. Wie ist es aber möglich, eine unwillkürlich ablaufende Reiz-Reaktion-Beziehung aufzubrechen? Die Lösung besteht darin, das tatsächliche Fluchtverhalten durch eine emotionale Reaktion, in diesem Fall Angst zu ersetzen. Sie rät zwar dringend zur Flucht, zwingt uns aber nicht dazu. Ganz im Gegenteil, dadurch dass wir uns unserer Angst bewusst werden, können wir ihr zuwider handeln. Durch Emotion ist der Mensch nicht mehr bedingungslos seinen Reiz-Reaktion-Beziehungen ausgeliefert, sondern kann diese überwinden, auch wenn er dies als inneren Konflikt wahrnimmt. Andererseits haben Emotionen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Kognitionen. Durch ihren stets wertenden Charakter kommt ihnen eine Steuerfunktion zu. Es kann von großem Vorteil sein, bei der Auswahl aus relativ ähnlichen Alternativen auch mal auf das „Bauchgefühl“ zu vertrauen, um so z.B. Entscheidungsaversionen bzw. unangemessen hohen kognitiven Aufwand zu vermeiden. 6.6 Kommunikation von Emotionen Emotionen stecken an. Es stellt einen großen Vorteil für die soziale Umwelt dar, zu wissen, welche Emotionen ein Individuum gerade erlebt, da man versteht, wie es eine bestimmte Situation wahrnimmt und wahrscheinlich darauf reagiert. Auch für eine Person, die Emotionen erlebt, ist es ebenfalls wichtig, dass andere Menschen ihren emotionalen Ausdruck richtig interpretieren, da dadurch gewährleistet ist, dass das soziale Umfeld angemessen auf sie reagieren kann. 14 In Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass Menschen ein und die selbe Situation emotional anders bewerten, wenn man sie dabei zu einem bestimmten emotionalen Ausdruck, z.B. durch einen Bleistift quer im Mund, zwingt. Offensichtlich ist Mimik, ähnlich wie andere körperliche Reaktionen (s.o.), nicht das Resultat eines bestimmten emotionalen Zustandes, sondern vielmehr dessen Ursache. Durch die Wahrnehmung und Kontrolle der eigenen Gesichtsmuskulatur (Propriozeption) können wird den emotionalen Ausdruck anderer simulieren und dann, durch den gerade beschriebenen Feedbackprozess, die Emotionen anderer Menschen nachempfinden. Dadurch wird deutlich, warum die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwahrnehmung die Grundlage für Empathie darstellt. 6.7 Emotion in der Werbung Die oben beschriebenen Handlungstendenzen, die Emotionen ausdrücken, legen es nahe, dass man versucht Marken, Produkte o.ä. emotional aufzuladen. D.h. kommunikative Maßnahmen (Werbung) sollen bisher neutrale Reize an positive Emotionen koppeln, um Rezipienten zu einer Annäherung (z.B. Kauf) zu bewegen. Der ansteckende Charakter von Emotionen spielt dabei eine wichtige Rolle. Menschen versuchen, wie bereits dargestellt, den emotionalen Ausdruck Anderer zu deuten, indem sie reflexartig versuchen, die Emotion des Gegenübers nachzuempfinden (Empathie). Wenn Modelle positive Emotionen ausdrücken, können wir uns ihnen daher kaum erwehren . Wie stark diese Wirkung ist, zeigen beispielsweise eingespielte Lacher bei Sitcoms. Die simulierte gute Laune soll anschließend, als Resultat eines Lernprozesses, die Reaktion auf das Produkt oder die Marke darstellen. 7 Einstellung Mit Einstellung bezeichnet man die positive oder negative Bewertung eines bestimmten Einstellungsobjektes. Dies kann ein konkretes Objekt, eine Person, eine bestimmte Verhaltensweise, aber auch eine politische oder religiöse Weltanschauung etc. sein. Die Einstellung äußert sich in bestimmten Meinungen und Überzeugungen, Gefühlen und Verhalten. 7.1 Einstellung und Verhalten Verschiedene Einstellungskomponenten können durchaus widersprüchlich ausfallen. Z.B. kann ein starker Raucher sehr wohl der Überzeugung sein, dass er seine Gesundheit riskiert, auf das Anzünden einer Zigarette jedoch mit einem positiven Affekt reagieren. Diese oft zu beobachtende Widersprüchlichkeit der kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Komponente erschweren die Vorhersage von Verhalten mit Hilfen des Einstellungskonzeptes. Das Wissen über einstellungsbezogene Meinungen (Kognitionen) und die Beobachtung affektiver Reaktionen (z.B. Erröten) lässt nicht immer einen sicheren Schluss über das künftige Verhalten einer Person zu. 7.1.1 Verfügbarkeit Eine bessere Vorhersage des Verhaltens gelingt, wenn eine gute Verfügbarkeit der Einstellung gegeben ist. D.h. wir neigen zu deutlicheren Bewertungen bei Einstellungsobjekten, die eine persönliche Relevanz für uns haben und die unmittelbare Erfahrung für uns darstellen. Ein Kenner der abstrakten Kunst wird eher zu einer konsistenten Bewertung eines abstrakten Gemäldes neigen, als eine Person die kein Interesse an Kunst hat. Die Verfügbarkeit lässt sich auch durch bloßes Wiederholen der Bewertung verbessern. Offensichtlich handelt es sich bei ihr um die Stärke der Assoziation zwischen Einstellungsobjekt und Bewertung. 15 7.1.2 Spezifität Wenn man Menschen mit relativ unspezifischen Fragen nach ihrer Einstellung fragt und diese mit relativ spezifischem Verhalten vergleicht, kann es leicht zu Divergenzen kommen. Die meisten Menschen würden auf die Frage „Ist Ihnen Umweltschutz wichtig?“ mit ja antworten. Dies gilt auch für Menschen, die dazu neigen, Obst in Kartonschalen zu kaufen, die in Plastik eingeschweißt sind. Hätte man die Personen spezifisch nach ihrer Einstellung zu Kunststoffverpackungen befragt, hätte man Antworten erhalten, die eher eine Prognose des künftigen Verhaltens erlauben. 7.1.3 Modelle der Beziehung von Einstellung und Verhalten Erwartungs- x Wert-Modelle (s. Abb. u.) versuchen die Beziehung zwischen den verschiedenen Komponenten der Einstellung und dem Verhalten zu erklären, wobei weitere, das Verhalten beeinflussende, Faktoren berücksichtigt werden. Zu Anfang werden Erwartungen (kognitive Komponente) genannt, die für sich genommen noch keine Einstellung ergeben. Dazu bedarf es der Wertung (affektive Komponente), ohne sie ist die Entwicklung einer Einstellung nicht möglich. Erst durch den multiplikativen Zusammenhang (Erwartung x Wert) kann sich eine Einstellung und ihre Richtung ergeben. Diese hat einen relativ direkten Einfluss auf das Verhalten. In diesen Modellen spielt der soziale Druck (normative Erwartungen), dem eine Person subjektiv ausgesetzt ist, eine weitere Rolle. Abhängig davon, in wie weit jemand diesem sozialen Druck nachgeben will (Willfährigkeit), einwickelt sich analog zur Einstellung die subjektive Norm. Auch hier sind die Komponenten multiplikativ miteinander verknüpft (normative Erwartungen x Willfährigkeit). Die subjektive Norm kann unter Umständen in die entgegengesetzte Richtung der eigenen Einstellung wirken. So kann ein Schüler, aufgrund seiner negativen Einstellung zur Schule, den Wunsch verspüren, das Gymnasium nach der 10. Klasse zu verlassen. Aber seine Eltern, Freunde oder andere, für den Schüler wichtige Personen, könnten die Erwartung an ihn stellen, das Abitur zu machen um anschließend zu studieren. Diese vom Schüler wahrgenommenen normativen Erwartungen und das Ausmaß, in denen er diesen Erwartungen entsprechen will (Willfährigkeit), ergeben die Subjektive Norm. Ob der Schüler nun das Abitur macht oder vorzeitig von der Schule abgeht, hängt davon ab, ob die persönliche Einstellung oder die Subjektive Norm stärker die Verhaltensabsicht beeinflussen. Diese Gewichtung ist von Mensch zu Mensch und von Einstellungsobjekt zu Einstellungsobjekt verschieden. 16 7.2 Einstellungserwerb und Einstellungsänderung Einstellungen können als Reiz-Reaktionsverbindungen aufgefasst werden, wobei das Einstellungsobjekt den Reiz und affektive, kognitive und verhaltensbezogene Komponenten als erlernte Reaktion darauf zu sehen sind. Erwerb und Änderung von Einstellungen sind aber nicht immer Ergebnis langwieriger Konditionierungen, sie können auch durch kognitive Prozesse angestoßen werden. 7.2.1 Einstellungserwerb durch Selbstwahrnehmung Die Theorie der Selbstwahrnehmung geht davon aus, dass Menschen in der Lage sind, ihr eigenes Verhalten so zu beobachten, als wäre es das einer anderen Person. Bei anderen Menschen schließen wir auf deren Einstellung, indem wir ihr Verhalten interpretieren. Hält ein Musikkritiker eine Lobrede über einen Komponisten, schließen wir drauf, dass er ihm gegenüber eine positive Einstellung hat. Wir entwickeln Einstellungen durch die Beobachtung des eigenen Verhaltens. Nehmen wir z.B. an einem Gewinnspiel teil, bei dem die Aufgabe darin besteht 10 Argumente zu finden, die für eine bestimmte Marke sprechen, kann es sein, dass wir im Nachhinein eine positive Einstellung dieser Marke gegenüber entwickeln. Das ist vor allem dann der Fall, wenn uns die von uns genannten Argumente tatsächlich plausibel erscheinen und/oder wir die Teilnahme am Gewinnspiel nicht als ausschließlichen Grund für ihre Formulierung verstehen. 7.2.2 Einstellungsänderung durch kognitive Dissonanz Bei bereits bestehenden Einstellungen erzeugt einstellungskonträres Verhalten aversiv erlebte, dissonante Kognitionen, die durch Einstellungsveränderung reduziert werden können. Solche Verhaltensänderungen können durch verschiedene Ansätze provoziert werden Eine grundlegende Erfahrung menschlichen Zusammenlebens besteht darin, dass wenn jemand etwas für uns tut, wir uns automatisch verpflichtet fühlen, auch etwas für diese Person zu tun. Lädt uns z.B. jemand zu sich ein, glauben wir, ihn zu einem Gegenbesuch einladen zu müssen. Das Verlangen nach Reziprozität kann ausgenutzt werden, um Verhaltensänderungen zu provozieren. Bietet man Menschen im Supermarkt Gratisproben von Lebensmitteln zum direkten Verzehr an, so fühlen sich viele Kunden anschließend verpflichtet, zumindest eine kleine Menge dieses Produkts zu kaufen. Dies ist jedoch nicht das eigentliche Ziel, das mit dem Verteilen der Proben verfolgt wird. Vielmehr geht es darum, Kunden zu einem Verhalten zu bewegen, das sie im Nachhinein weniger als Folge aus dem Wunsch nach Reziprozität interpretieren, sondern auf Qualitäten des Produkts zurückführen. Eine ebenfalls erfolgreiche Technik setzt darauf, dass Menschen ihr Verhalten als konsistent erleben möchten, denn Verbindlichkeit gilt schließlich als eine Tugend. Man erbittet einen kleinen Gefallen, den kaum jemand ausschlagen wird, um anschließend mit erhöhter Wahrscheinlichkeit das eigentliche Anliegen zu erreichen. Personen, die man zuerst eine Petition für die Durchsetzung von Menschenrechten in Unrechtsstaaten unterschreiben lässt, sind anschließend eher bereit, einer Menschenrechtsorganisation beizutreten, als Menschen, die man um keine Unterschrift bittet. Wenn Verkäufer besonders die Knappheit eines Produktes betonen („Das sind die letzten, die es gibt.“ oder „wird bald nicht mehr produziert.“) erreichen sie oft damit, dass Konsumenten glauben, sie könnten die Gelegenheit verpassen eine optionale Entscheidung das letzte mal treffen zu können. Im allgemeinen lassen sich Menschen aber ungern in ihrer Entscheidungsfreiheit einschränken. Viele Kunden entscheiden sich nur deswegen für ein vermeintlich knappes Produkt, weil sie Angst haben eine bestimmte Option in Zukunft nicht mehr wählen zu können. Auch hier gesteht man sich 17 den eigentlichen Grund seines Verhaltens nicht ein, sondern rechtfertigt den Kauf mit positiven Eigenschaften des Produkts, womit eine Einstellungsveränderung gestartet wird. 7.2.3 Persuasive Kommunikation Eine wichtige Rolle bei der Veränderung bereits bestehender Einstellungen spielt die Überredung (Persuasion). Die "Kunst des Überredens" kann dabei zwei verschiedene Wege der Informationsverarbeitung beschreiten: Die zentrale Route oder die periphere Route der Einstellungsveränderung. Bei Themen, die uns wichtig sind und/oder wir uns gut auskennen, neigen wir dazu, uns mit neuer Information, mit der wir im Verlauf eines Überredungsversuchs konfrontiert werden, sehr intensiv auseinander zu setzen. Die Argumente werden relativ unabhängig davon, wer sie äußert genau unter die Lupe genommen. Die Information wird dabei zentral verarbeitet. Ein Beispiel hierfür wäre eine fachliche Diskussion oder Disput unter Experten. Ist uns ein Thema weniger wichtig und/oder wir kennen uns nicht besonders gut aus, neigen wir dazu, die Information peripher zu verarbeiten. Dabei werden weniger die Inhalte des Überredungsversuchs beachtet, als von wem und wie sie geäußert werden. Es wird z.B. beachtet, ob der Gesprächspartner vertrauenswürdig ist, oder welches Ziel er mit dem Überredungsversuch verfolgen könnte. Hier wäre als Beispiel eine Präsentation zu nennen, bei der die Zuhörer nicht über die fachliche Kompetenz des Vortragenden verfügen, aber aus seinem sicheren Auftreten und gepflegten Äußeren auf dessen Kompetenz und die Güte der Argumente Rückschlüsse ziehen. Für die Werbemittelgestaltung resultieren daraus wichtige Implikationen. Bei relativ teuren Gütern, die für den Konsumenten von großer Bedeutung sind, kann davon ausgegangen werden, dass ein hohes Informationsbedürfnis auf Seiten der Zielgruppe besteht. Die Kommunikationsstrategie sollte daher in der zentralen Route der Überredung bestehen, d.h. der Werberezipient muss mit einer großen Fülle sachlicher Information versorgt werden und mit plausiblen und starken Argumenten überzeugt werden. Ganz anders sieht die bevorzugte Strategie bei Gütern des täglichen Bedarfs aus. Ihr meist sehr niedriger Preis, die kaum vorhandenen Qualitätsunterschiede zwischen den Marken und die geringe persönliche Bedeutung für den Konsumenten führen zu eher geringer Motivation sich mit Argumenten für das Produkt intensiv zu beschäftigen. Als geeignete Strategie erscheint hier die periphere Route der Überzeugung. So kommen bei kommunikativen Maßnahmen, die für Produkte des alltäglichen Bedarfs werben, oft beliebte Prominente zum Einsatz, die nur wenig sachliche Informationen vermitteln. Man geht davon aus, dass der Konsument in solchen Fällen gewissermaßen aus Bequemlichkeit eher der Seriosität des Prominenten vertraut, als sich intensiv und kritisch durch eine große Informationsdichte zu arbeiten. 8 Aufmerksamkeit Die Fähigkeit, seine kognitiven Ressourcen auf einen oder mehrere Inhalte zu verteilen, nennt man Aufmerksamkeit. Sich zu konzentrieren bedeutet irrelevante Information auszublenden, um so kognitive Ressourcen für die Bearbeitung anvisierter Inhalte frei zu machen. 8.1 Aufmerksamkeit ist begrenzt Die Verarbeitungskapazität der Aufmerksamkeit ist also begrenzt. Je mehr Inhalte die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, umso weniger steht jedem davon zur Verfügung, d.h., die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Inhalte wird mit steigender Anzahl zunehmend oberflächlicher und ungenauer. Dies gilt in besonderem Maße, wenn sich die Inhalte sehr ähneln bzw. gleiche Verarbeitungskanäle nutzen. Visuelle Reize beispielsweise interferieren stärker mit anderen visuellen Reizen, als 18 mit akustischen Reizen. Es gelingt uns gut, während einer Autofahrt eine Unterhaltung mit dem Beifahrer zu führen. Autofahren und gleichzeitig Fotoalben anschauen wäre dagegen ein hoch riskantes Unterfangen. Die Tatsache, dass die Aufmerksamkeit mit begrenzten Ressourcen haushalten muss, macht Analogien zum Konzept des Kurzzeitgedächtnisses (s.o.) deutlich, dessen Arbeit die eigentliche Basis der Aufmerksamkeit darstellt. 8.2 Steuerung der Aufmerksamkeit Der Cocktail Party-Effekt veranschaulicht, dass Menschen ihre Aufmerksamkeit willkürlich steuern können. Er zeigt, dass Menschen in der Lage sind, den Ausführungen einer bestimmten Stimme zu folgen, obwohl sich derweil, in unmittelbarer Nähe, andere Menschen ebenfalls laut unterhalten. Dabei gelingt es ihnen, gezielt die irrelevanten Geräusche herauszufiltern und sie zu unterdrücken, um so die Inhalte selektiv wahrnehmen zu können, für die sie sich interessieren. Sobald aber jemand plötzlich laut ihren Namen ruft, erfolgt unwillkürlich eine Orientierungsreaktion und die Aufmerksamkeit wendet sich nun ausschließlich diesem unvorhergesehenen Ereignis zu. Dies ist nur möglich, weil bestimmte Reize auch ohne Aufmerksamkeit (präattentiv s.u.) verarbeitet werden können und dadurch selbst eine aufmerksamkeitssteuernde Wirkung entwickeln. 8.3 Aufmerksamkeit und Werbung Aufmerksamkeit kommt marktpsychologischen Überlegungen zufolge eine moderierende Rolle bei der Vermittlung von Werbebotschaften zu. Auf den ersten Blick erscheint es plausibel, dass kommunikative Maßnahmen dann besonders gut wirken, wenn ihre Rezipienten ihnen ein Maximum an Aufmerksamkeit entgegenbringen. Viele ältere Stufenmodelle der Werbewirksamkeit, wie z.B. das ebenso bekannte, wie einfache AIDA-Modell, gehen von dieser Annahme aus. Z.Zt. ihrer Postulierung herrschten aber weitgehend andere Marktbedingungen als heute. Im sogenannten Verkäufermarkt, in dem viele Käufer ein knappes Produkt stark nachfragen, reicht es aus, auf dessen tatsächliche Vorzüge aufmerksam zu machen. Wird z.B ein gänzlich neues Produkt auf den Markt geworfen, das sich qualitativ maßgeblich von allen Wettbewerbsprodukten unterscheidet, ist es tatsächlich sinnvoll, dass seine herausragenden Qualitäten von den Verbrauchern auch wahrgenommen werden. Es liegen also starke Argumente vor, die für das Produkt sprechen und bei deren Vermittlung ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit seitens der Rezipienten hilfreich ist. Die allgemeine Marktsituation heutzutage ist aber vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass meist viele Wettbewerber Produkte anbieten, die sich hinsichtlich Qualität und Preis nicht maßgeblich unterscheiden. Im sogenannten Käufermarkt fällt es den Anbietern daher schwer, starke produktbezogene Argumente zu finden, mit denen sie die Konsumenten überzeugen könnten. In solchen Fällen empfiehlt sich eine Kommunikationsstrategie, die sich eher an der peripheren Route der Überredung, als an der zentralen (s.o.) orientiert. Der Einsatz von sympathischen Modellen, angenehmen Bildern, Prominenten etc. oder das Formulieren von kaum zu überprüfender Produkteigenschaften, wie z.B. „besonders“, „einzigartig“ usw. können aber nur Wirkung erzielen, wenn die Rezipienten sich nicht kritisch mit der Botschaft auseinandersetzen. Täten sie dies, wären sie in der Lage Gegenargumente zu formulieren und würden erkennen, dass nicht stichhaltig argumentiert wird. Eine oberflächliche, eher heuristische Verarbeitung der Botschaft ist am ehesten dadurch zu erreichen, dass sich der Adressat nicht vollkommen auf diese konzentriert, sondern durch andere Inhalte abgelenkt wird. In den meisten Fällen ist daher ein mittleres Aufmerksamkeitsniveau besonders günstig für die Vermittlung der meisten Werbebotschaften. 19 9 Wahrnehmung Per Definition umfasst Wahrnehmung alle psychischen Prozesse, die der Orientierung in der Umwelt dienen. Sie ermöglicht uns die Entwicklung einer mentalen Repräsentation der Umwelt, die uns einerseits die stetige Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen erlaubt und uns andererseits die Möglichkeit eröffnet, planvolle Eingriffe in unserer Umgebung vorzunehmen. 9.1 Wahrnehmung als aktiver Informationsverarbeitungsprozess Wahrnehmung geschieht nicht einfach, sondern stellt einen aktiven und subjektiven Informationsverarbeitungsprozess dar. Sie bildet nicht einfach nur Gegebenheiten unserer Umwelt eins zu eins ab, sondern wird erst durch die Arbeit der Sinnesorgane erschaffen. Der Knall einer Explosion entsteht erst, wenn die Sinnesorgane eines hörenden Subjekts die plötzliche Luftdruckveränderung als Geräusch interpretieren, oder einfacher ausgedrückt: Ohne Ohren ist die Welt vollkommen still. Wahrnehmungstäuschungen, wie z.B. durch die bekannte Müller Lyer-Figur (s.u.) verursacht, zeigen eindrücklich Diskrepanzen zwischen tatsächlichen und wahrgenommenen Objekten auf. Diese Abweichungen beweisen, dass Wahrnehmung das Resultat eines aktiven Verarbeitungsprozesses darstellt. 9.2 Wahrnehmungsmodalitäten Die Eigenschaften der Sinnesorgane bestimmen die Modalitäten der Wahrnehmung. Die berühmten fünf Sinne des Menschen sind die Modalitäten, die uns im allgemeinen spontan einfallen. Sie umfassen Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und den Tastsinn (Fühlen). Dazu kommen noch die Schmerzwahrnehmung, der Gleichgewichtssinn, das Temperaturempfinden und die Propriozeption (Wahrnehmung der Lage oder Stellung der eigenen Gliedmaßen im Raum und zueinander). Für viele physikalische Ereignisse in unserer Umwelt besitzen wir keine Wahrnehmungsmodalitäten und können sie daher nicht direkt wahrnehmen, wie z.B. Elektrizität, Magnetismus oder Radioaktivität. Vielmehr antworten Sinnesorgane bei jeder Art von Reizung stets in ihrer spezifischen Modalität. Auch wenn uns kein Sinn für Elektrizität gegeben ist, reagieren unsere Sinnesorgan auf einen Stromschlag z.B. über die Schmerzwahrnehmung, den Tastsinn etc. Auch innerhalb bestehender Modalitäten ist die Wahrnehmung limitiert. Beim Sehen dient nur eine kleiner Teil der elektromagnetischen Strahlung als sichtbares Licht, nämlich der Teil von ca. 380 bis 780 Nanometer Wellenlänge. Strahlung über (Ultraviolett) oder unterhalb (Infrarot) dieses Spektrums wird nicht mit dem Gesichtssinn wahrgenommen. 20 9.3 Ansätze der Wahrnehmungsforschung Mit der Erforschung der Physiologie der Wahrnehmung soll die Frage geklärt werden, wie die Umwelt von der Aktivität des Nervensystems repräsentiert wird. Wie diese Aktivität ihrerseits zu subjektiven Wahrnehmungsphänomenen führt, ist dabei nur von nachrangigem Interesse. Man spricht daher auch von objektiver Wahrnehmungsforschung. Die Psychophysik erforscht die Zusammenhänge der physikalischen messbaren Umwelt und ihrer mentalen Repräsentation im Menschen. Ziel der Psychophysik ist es, subjektive Wahrnehmungsphänomene objektiv messbar zu machen und die Relationen zur physischen Umwelt zu bestimmen. Die kognitive Psychologie (s.o.) erforscht höhere geistige Prozesse, wie Erwartungen, das Zuordnen von Bedeutungen oder das Nutzen von Vorwissen. Diese beeinflussen die Wahrnehmung maßgeblich (s. Abb. u.). 9.4 Wahrnehmung von Licht und Helligkeit Wahrnehmung wird ganzheitlich erlebt. Farbe wird daher zuerst als eine Eigenschaft von Objekten aufgefasst. Beim Betrachten einer Banane sehen wir nicht eine Banane mit gelber Farbe, sondern eine Banane. Noch heute existieren Naturvölker, die keine Farbbegriffe kennen, also die Abstraktion der Farbe vom wahrgenommenen Objekt nie vorgenommen haben. Dies zeigt, dass die Auffassung von Farbe als eine reine Empfindung eine kulturelle Errungenschaft darstellt, die wahrscheinlich darin begründet ist, das Menschen in moderneren Kulturen alltäglich erfahren, dass sich Objekte relativ willkürlich unterschiedlich einfärben lassen. Das Farbempfinden lässt sich in drei Eigenschaftsdimensionen beschreiben. Der Farbton bezieht sich auf die Buntheit von Farben. Chromatische (bunte) Farben lassen sich in die Grundfarbtöne Rot, Grün, Blau und Gelb, sowie in Mischfarbtöne wie Violett, Orange und Türkis unterscheiden. Die achromatischen Farben Weiß und Schwarz stellen Endpole der Dimension Helligkeit dar. Aber auch alle chromatischen Farben lassen sich hinsichtlich ihrer Helligkeit unterscheiden. So stellen z.B. Gelb und Braun denselben Farbton bei unterschiedlicher Helligkeit dar. Die Sättigung ist der Grad der Reinheit einer Farbe. Monochromatische (einfarbige) Farben sind hundertprozentig gesättigt, denn sie bestehen aus Licht mit einer einzigen Wellenlänge. Die Farbe Rosa stellt im Gegensatz zu Rot eine Mischung aus der chromatischen Farbe Rot und der achromatischen (unbunten) Farbe Weiß dar. Dies gilt auch für das irreführend benannte Hellblau. Umso ge21 ringer der achromatische Anteil einer Farbe ist, umso gesättigter ist sie. 9.4.1 Physikalische Grundlagen der Farbwahrnehmung Sichtbares Licht ist elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge von ca. 380 bis 780 Nanometer (nm). Die unterschiedlichen Wellenlängen erregen die Wahrnehmung der verschiedenen Farbtöne (s. Tab. u.). Rot Orange Gelb Grün Blau Violett 640 nm - 780 nm 600 nm - 640 nm 570 nm - 600 nm 490 nm - 570 nm 430 nm - 490 nm 380 nm - 430 nm Die Höhe des Ausschlags (Amplitude) der Wellen ist für die wahrgenommene Helligkeit einer Farbe verantwortlich (s. Abb. unten). Wellenlänge 1,0 y 0,5 Amplitude 0,0 -0,5 -1,0 -10 -5 0 x 5 10 9.4.2 Farbwahrnehmung als Funktion von Antwortmustern der Photorezeptoren Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts konnten Young und Helmholtz mit Experimenten, die auf der additiven Farbmischung beruhten, nachweisen, dass Menschen in der Lage sind, aus dem Licht der drei Primärfarben Rot, Grün und Blau, jede beliebige Farbe zu mischen. Dieses Funktionsprinzip begegnet uns alltäglich bei Fernsehbildschirmen oder Computermonitoren. Die von ihnen formulierte Dreifarbentheorie, postuliert, dass von den bei Tageslicht aktiven Photorezeptoren, den Zapfen, drei Unterarten existieren, die sich darin unterschieden, dass sie von Licht mit jeweils verschiedener Wellenlänge maximal gereizt werden. Sie vermuteten einen Kurzwellenrezeptor (Blaurezeptor) mit einer maximalen Empfindlichkeit bei kurzwelligem Licht, einen Mittelwellenrezeptor (Grünrezeptor) mit einer maximalen Empfindlichkeit bei Licht von mittellanger Wellenlänge und einen Langwellenrezeptor (Rotrezeptor) mit einer maximalen Empfindlichkeit bei langwelligem Licht. (s Abb. u.). 22 Die moderne physiologische Forschung konnte die Existenz dieser Rezeptoren bestätigen. Es konnten Zapfentypen identifiziert werden, die ziemlich genau denen von Young und Helmholtz entsprechen. Ihre maximalen Empfindlichkeiten liegen bei 420 nm (Kurzwellenrezeptor), 534 (Mittelwellenrezeptor) und bei 564 nm (Langwellenrezeptor) (s Abb. u.). Die nachtaktiven Stäbchen spielen bei der Farbwahrnehmung keine Rolle. Das Farbempfinden des Menschen resultiert aus dem Aktivitätsmuster, mit dem die drei Farbrezeptoren zusammen auf einen Lichtreiz reagieren. Die Abbildung unten zeigt schematisch, wie das unterschiedliche Zusammenspiel der drei Rezeptortypen (farbige Pfeile für rot=Langwelle, grün=Mittelwelle, blau=Kurzwelle) zu verschiedenen Farbeindrücken führt. Dabei entspricht die Länge der Pfeile dem Ausmaß an Aktivität (Reizung) des jeweiligen Rezeptortyps. 23 9.4.3 Die Gegenfarbentheorie von Hering Durch systematische Beobachtungen stellte Hering fest, dass zum einen die Farben Rot und Grün und zum anderen die Farben Blau und Gelb ein Gegensatzpaar darstellen, so wie dies für Hell (Weiß) und Dunkel (Schwarz) gilt. Diese Feststellung beruht auf drei Beobachtungen: (1.) Das längere Betrachten (ca. 30 sek.) einer farbigen Fläche erzeugt ein Nachbild in der jeweiligen Gegenfarbe. Bei diesem Adaptation genannten Prozess ermüden stärker beanspruchte Rezeptorentypen schneller als weniger stark beanspruchte. Z.B beim Betrachten einer blauen Fläche werden die Kurzwellenrezeptoren (Blaurezeptoren) stärker beansprucht als die Mittel- und Langwellenrezeptoren. Dies führt dazu, dass die nun, im Vergleich zu den anderen Rezeptortypen stärker ermüdeten Blaurezeptoren nicht mehr maximal auf einen Reiz reagieren können. Beim anschließenden Betrachten einer eigentlich weißen Fläche reagieren die noch frischen Grün- und Rotrezeptoren dann stärker als die ermüdeten Blaurezeptoren. Dieses Aktivitätsmuster führt aber eher zu einem gelblichen Farbeindruck (s. Abb. o.). 24 (2.) Beim Simultankontrast beeinflussen farbige Flächen durch laterale Inhibition (angrenzende Hemmung) das Aussehen benachbarter Flarbflächen in Richtung der eigenen Gegenfarbe (s. Abb. o.). (3.) Menschen können sich Mischungen nur bestimmter Farbenpaare vorstellen. So stellt man sich eine Mischung aus Rot und Gelb als Orange vor, Blau und Grün als Türkis etc. Aber wie sieht ein bläuliches Gelb oder ein rötliches Grün aus? Es ergibt genauso wenig Sinn, als wenn man versuchen würde, sich ein helles Dunkel vorzustellen. Gegenfarben lassen sich in unserer Vorstellung nicht mischen. Hering nahm an, dass die Wahrnehmung von Farben auf drei Gegenfarbenmechanismen beruht. Einer für die Unterscheidung des Rot- vs. Grünanteils einer Farbe, einer für die Unterscheidung des Blau vs. Gelbanteils einer Farbe und letztendlich einen Mechanismus, der die Helligkeit einer Farbe beurteilt. Beide Theorien können bestimmte Aspekte des Farbempfindens erklären und ergänzen sich daher. Die Abbildung unten zeigt einen theoretischen neuronalen Schaltkreis, der aus erregenden Signalen (+) und hemmenden Signalen (-) des Blaurezeptors, des Grünrezeptors und des Rotrezeptors den Gelb versus Grün-Mechanismus, den Blau versus Gelb-Mechanismus sowie den Hell versus Dunkel-Mechanismus erzeugt. K M L + + + + - + + - - + + + - Nach dem heutigen Wissensstand ist auf Rezeptorenebene die Theorie von Young und Helmholtz bestätigt. Aber auch die Beobachtungen Herings kann man heute erklären. Nimmt man an, dass die neuronale Weiterleitung der Information aus den Rezeptoren über ein bestimmtes Verschaltungsmuster geschieht, wie oben dargestellt, lassen sich beide Theorien vereinbaren. So wird die empirische Evidenz, die für die Existenz der von Young und Helmholz vermuteten Rezeptoren spricht, mit der beinahe alltäglichen Beobachtung der Gegenfarbeneffekte im Sinne Herings in Einklang gebracht. 25 9.5 Wahrnehmung räumlicher Tiefe Die Wahrnehmung räumlicher Tiefe stellt für das visuelle System eine besondere Herausforderung dar. Alles, was wir sehen, wird auf der Netzhaut unseres Auges abgebildet. Die Netzhaut (Retina) ist aber zweidimensional, die räumliche Wirklichkeit, die es zu erkennen gilt, ist jedoch dreidimensional. Da die Information, die vom Auge an das Gehirn weitergeleitet wird, auf zwei Dimensionen reduziert wird, muss das visuelle System bestimmte Hinweisreize berücksichtigen, um dennoch einen dreidimensionalen Tiefeneindruck vermitteln zu können. Man unterscheidet dabei monokulare von binokularen Hinweisreizen. 9.5.1 Monokulare Hinweisreize Monokulare Hinweisreize sind mit nur einem Auge wahrnehmbar. Sie sind besonders wichtig, da sie auch in Entfernungen über ca. 8 Meter Anhaltspunkte zur Konstruktion räumlicher Tiefe liefern. Ab diesem Bereich kann das visuelle System die Hinweisreize, die aus dem zweiäugigen Sehen gewonnen werden, nicht mehr interpretieren. Die wichtigsten monokularen Hinweisreize sind: (1) Das Verdecken von Objekten - Wenn Objekt A einen Teil von Objekt B verdeckt, wird Objekt A als vor B liegend gesehen. (2) Die relative Größe im Blickfeld - Objekte im Vordergrund nehmen einen größeren Teil des Blickfeldes in Anspruch als vergleichbare Objekte im Hintergrund. (3) Die gewohnte Größe von Gegenständen - Das Wissen um die tatsächliche Größe von Objekten beeinflusst die wahrgenommenen räumlichen Relationen. In der Abbildung erscheint die Centmünze näher als die Euromünze. Der Grund liegt darin, dass wir wissen, dass eine Centmünze kleiner ist, als eine Euromünze. Bei gleicher Größe im Blickfeld, muss sie daher folglich näher sein. (4) Die relative Höhe im Blickfeld - Objekte, die im Blickfeld weiter oben erscheinen, werden unter dem Horizont als weiter entfernt, über dem Horizont als näher wahrgenommen. (5) Die atmosphärische Perspektive - Weiter entfernte Objekte erscheinen weniger scharf. Die Ursache liegt in kleinen Partikeln in der Luft, wie Staub, Wassertropfen und diverse Verschmutzungen. (6) Die lineare Perspektive (8) Der Texturgradient - Elemente, die in einer Szene gleichweit voneinander entfernt sind, wirken mit zunehmendem Abstand immer dichter gepackt. (9) Bewegungsinduzierte Hinweisreize – Unbewegliche Elemente, die bei Eigenbewegung des 26 wahrnehmenden Subjekts, schneller durch das Blickfeld wandern, werden näher wahrgenommen, als Elemente, die langsamer durch das Blickfeld wandern (Bewegungsparallaxe). Gleiches gilt für unbewegliche Objekte, die bei Eigenbewegung temporär andere Objekte verdecken. 9.5.2 Binokulare Hinweisreize Das monokulare Tiefensehen setzt oft das Erkennen bestimmter Objekte und das Abschätzen ihrer Größe voraus, um einen räumlichen Eindruck vermitteln zu können. Das Binokulare Tiefensehen, die so genannte Stereopsis durch Querdisparation funktioniert auch ohne vorheriges Erkennen von Objekten. Dies weiß man, seit Bela Julesz 1971 die Autostereogramme entwickelte. Bei Autostereogrammen entsteht ein Tiefeneindruck, welcher uns erst das Erkennen eines versteckten Objekts ermöglicht (s. Abb. u.). Die binokulare Stereopsis nutzt die Divergenzen zwischen linkem und rechtem Netzhautbild, die durch den Augenabstand entstehen, aus. Die beiden unterschiedlichen Netzhautbilder müssen, damit wir keine Doppelbilder sehen, vom visuellen System integriert werden. Die Abweichungen zwischen linkem und rechtem Netzhautbild werden dabei als räumliche Tiefe interpretiert. Die Abbildung unten zeigt schematisch, wie vom Betrachter unterschiedlich weit entfernte Punkte an verschiedenen Stellen der Netzhaut abgebildet werden. Der blaue, fixierte Punkt wird in beiden Augen in der Fovea centralis, der Sehgrube, (gelb) abgebildet, also an identischen Stellen. Ähnlich verhält es sich mit dem grünen Punkt. Dieser liegt zwar außerhalb des Fixationsbereiches, wird aber in beiden Augen exakt an der gleichen Stelle leicht rechts, neben der Sehgrube, abgebildet. Punkte in beiden Augen an der gleichen Stelle abgebildet, werden als gleich weit entfernt wahrgenommen. Der rote Punkt dagegen, der deutlich weniger weit vom Betrachter entfernt ist, wird in einem Auge deutlich links neben der Sehgrube und im anderen Auge deutlich rechts neben der Sehgrube abgebildet. Das visuelle System ist in der Lage diese Abweichung (Disarität) als Hinweisreiz für räumliche Tiefe zu nutzen. Folglich wird der rote Punkt näher wahrgenommen als die anderen beiden. 27 28