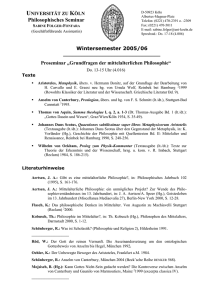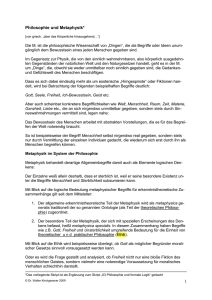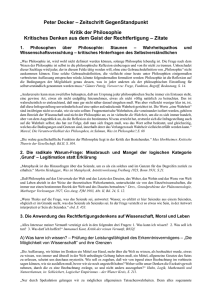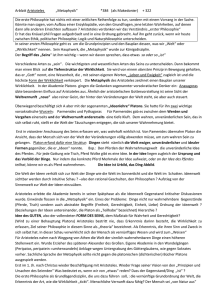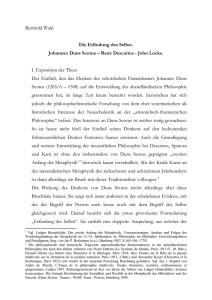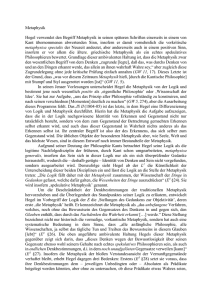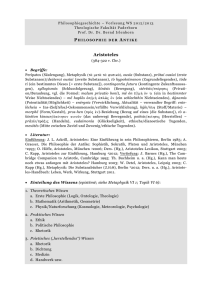Ludger Honnefelder Was ist Wirklichkeit?
Werbung

Ludger Honnefelder Was ist Wirklichkeit? 78491_Honnefelder.indd 1 17.02.16 14:19 78491_Honnefelder.indd 2 17.02.16 14:19 Ludger Honnefelder Was ist Wirklichkeit? Zur Grundfrage der Metaphysik Hrsg. von Isabelle Mandrella und Hannes Möhle Ferdinand Schöningh 78491_Honnefelder.indd 3 17.02.16 14:19 Umschlagabb.: Giorgio de Chirico, Great metaphysical interior (1917; Museum of Modern Art, New York) Veröffentlicht mit Unterstützung der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlags nicht zulässig. © 2016 Ferdinand Schöningh, Paderborn (Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) Internet: www.schoeningh.de Einbandgestaltung: Anna Braungart, Tübingen Printed in Germany Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Paderborn ISBN 978-3-506-78491-9 78491_Honnefelder.indd 4 17.02.16 14:19 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 „Einheit der Realität“ oder „Realität als Einheit“ – Metaphysik als Frage nach der Welt im ganzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 Die Frage nach der Realität und die Möglichkeit von Metaphysik . . . . . . . . 000 Zeit und Existenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 Die Bedeutung der Metaphysik für Glauben und Wissen . . . . . . . . . . . . . . . 000 Albertus Magnus und die kulturelle Wende im 13. Jahrhundert – Perspektiven auf die epochale Bedeutung des großen Philosophen und Theologen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 Johannes Duns Scotus – Denker auf der Schwelle vom mittelalterlichen zum neuzeitlichen Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 „Gott“ denken? Überlegungen im Anschluss an den Gottesbegriff des Johannes Duns Scotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 Freiheit und Rationalität. Die neue Verhältnisbestimmung von Verstand und Wille bei Johannes Duns Scotus . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 Wie sind Aussagen über Gott möglich? Thomas von Aquin über „gut“ als Prädikat Gottes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 Das Mittelalter als ‚zweiter Anfang‘ der Philosophie. Die Aristoteles-Rezeption als Leitfaden der Geschichte der Philosophie im Mittelalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 Säkularität und Moderne im philosophischen Diskurs: Die Frage nach dem Ursprung, der Bedeutung und der Legitimität des säkularen Verständnisses von Vernunft und Freiheit . . . . . . . . . . . . . . 000 Metaphysik und Transzendenz. Überlegungen zu Johannes Duns Scotus im Blick auf Thomas von Aquin und Anselm von Canterbury . . . . . . . . . 000 78491_Honnefelder.indd 5 17.02.16 14:19 6 INHALTSVERZEICHNIS Quellennachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 Schriftenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 78491_Honnefelder.indd 6 17.02.16 14:19 EINLEITUNG Auf den ersten Blick scheint die Frage „Was ist Wirklichkeit?“ weit entfernt von den Alltagsproblemen zu sein, mit denen sich jeder von uns unmittelbar konfrontiert sieht. Stehen wir zum Beispiel morgens beim Bäcker, lautet die erste ernstzunehmende Frage in der Regel nicht, was die Wirklichkeit sei, sondern ob man hell oder dunkel gebackene Brötchen bevorzuge. Von Interesse sind also jeweils Teile der Wirklichkeit – dunkle oder helle Brötchen –, aber nicht die Wirklichkeit als solche. Heißt das folglich, dass es sich bei der Frage nach der Wirklichkeit um eine Scheinfrage handelt oder bestenfalls um eine solche, die nur ein Randproblem betrifft, das künstlich zu einer Alltagsschwierigkeit stilisiert wird, mit der man sich ständig konfrontiert sieht? Spätestens wenn die dunkel gebackenen Brötchen ausgesucht und bezahlt sind, scheint der wohlgemeinte Gruß, man möge einen angenehmen Tag haben, alles Wesentliche zusammengefasst zu haben, ohne dass im Entferntesten auch nur eine einzige Überlegung der Wirklichkeit, d.h. was sie sei bzw. was sie nicht sei, gegolten hätte. Doch dass der angenehme Tag nicht die einzige Möglichkeit darstellt, wie der Tag wirklich verläuft, wird spätestens dann klar, wenn, zu Hause angekommen, der Vorwurf laut wird, man habe zwar im Prinzip das Richtige gekauft, nämlich Brötchen, habe sich aber für die mit den falschen Eigenschaften entschieden, denn verbrannte, bröselige und trockene Brötchen habe niemand gewollt, ja es sei überdies zweifelhaft, ob man das, was in der Tüte zum Vorschein kommt, überhaupt noch Brötchen nennen könne. Der Tadel sei zudem berechtigt, da es schließlich eine Wahl gegeben habe und nicht notwendig gewesen sei, dass der tatsächliche Inhalt der Brötchentüte genau dieser ist. Schnell wird deutlich: Auch der angenehme Tag ist nur eine Möglichkeit, die keinesfalls notwendig eintritt und umso mehr zu schätzen ist, wenn sie denn verwirklicht ist, da dies keinesfalls zwangsweise geschieht. Kurzum, der frühmorgendliche Disput macht deutlich, dass die Wirklichkeit nicht notwendig so ist, wie sie ist, da eben auch eine andere Wirklichkeit die Möglichkeit besessen hätte, Wirklichkeit zu werden. Zweifellos betreffen solche Überlegungen nicht unsere Alltagssorgen. Aber unser Alltag konfrontiert uns ganz selbstverständlich mit Unterscheidungen von ‚wirklich‘, ‚möglich‘, ‚zufällig‘, ‚notwendig‘ oder ‚unmöglich‘, die wir auf ganz unterschiedliche Bereiche des Lebens, auf Ereignisse, Gegenstände, Eigenschaften, Intensitäten, Befindlichkeiten oder Handlungs- und Gegebenheitsweisen anwenden. Diese Unterscheidungen spielen offensichtlich in vielen, wenn nicht gar in allen Alltagssituationen eine Rolle, auch wenn sie nicht als Alltagsprobleme selbst empfunden werden und demnach unausgesprochen bleiben. Sie treten als Hintergrundstruktur des Alltags hervor, sobald wir zu artikulieren versuchen, was unser Denken, Erkennen und Sprechen stets bedingt und begleitet. Die Frage „Was ist 78491_Honnefelder.indd 7 17.02.16 14:19 8 EINLEITUNG Wirklichkeit?“ steht stellvertretend für die Reflexion, mittels derer man den selbstverständlichen Umgang mit der Alltagswelt und deren Strukturen einer kritischen Prüfung unterzieht – und damit fällt sie prinzipiell unter die Aufgaben der Philosophie, genauer gesagt derjenigen philosophischen Disziplin, die man aufgrund ihrer transempirischen Ausgerichtetheit als Metaphysik bezeichnet hat. Über die Relevanz oder gar Notwendigkeit einer solchen metaphysischen Reflexion lässt sich streiten, ebenso über deren Reichweite: Inwiefern etwa betrifft die Frage nach der Wirklichkeit auch die Fragen nach deren Ursprung und/oder Ziel im Sinne eines abschließenden Grundes? Oder ist damit der Bereich des philosophisch zu Erfragenden endgültig überschritten? Zwei Momente sind an dieser Stelle in Erinnerung zu rufen, die die Metaphysik als Nachdenken über die Wirklichkeit stets begleiten: Die Beantwortung der Frage „Was ist Wirklichkeit?“, wie sie hier gestellt wird, betrifft zum einen eine philosophische, d.h. wissenschaftlich gesicherte und begründete Erkenntnis, die nicht einfach mit dem typisch menschlichen Bedürfnis, über das Empirische hinaus nach einem tieferen Sinn zu suchen, identifiziert werden kann. Das metaphysische Fragen mag Resultat einer Naturanlage im Menschen sein, doch die Metaphysik als philosophische Disziplin erhebt den Anspruch der Wissenschaftlichkeit. Zum anderen handelt es sich um eine Frage, die keine dogmatische Antwort zulässt, da wir über keine privilegierte Form der Erkenntnis verfügen, die uns einen unmittelbaren Zugriff auf die Wirklichkeit erlaubte. Die Beschäftigung mit der Grundfrage der Metaphysik impliziert vielmehr immer eine kritische Reflexion auf die eigenen Möglichkeiten, die ihrerseits konstitutiv in die Metaphysik einfließt; Metaphysik und Metaphysikkritik bilden so eine untrennbare Einheit. Wenn es zutrifft, dass die Überlegungen, die man im Alltag anstellt, etwas mit der Frage „Was ist Wirklichkeit?“ in der geschilderten Weise zu tun haben, dann ergibt sich daraus unschwer eine weitere, dritte Einsicht, nämlich dass diese oder ihr vergleichbare Fragen keine Antworten erhalten können, die man losgelöst vom jeweiligen Alltag und damit von den Unterschieden dem zeitlichen Wandel unterworfener Deutungsmuster gewinnen könnte. In dieser Hinsicht gibt es sehr viel tiefgreifendere Unterschiede als den zwischen hellen und dunklen Brötchen – eine Differenz, die zu erfassen in der Tat keiner Änderung unserer grundlegenden Weltsicht bedarf. In anderen Bereichen hingegen sind die Veränderungen sehr viel gravierender. So ist es etwa ein grundlegender Unterschied, das, was wir soeben als Möglichkeit bezeichnet haben, auf die Unbestimmtheit und Veränderlichkeit einer als ewig zu denkenden Materie zurückzuführen, wie es etwa Aristoteles tut, und nicht auf den freien Willen eines allein notwendigen Schöpfergottes, wie es für die christliche Tradition gilt. Im ersten Fall ist die Kontingenz des Weltverlaufs, also die Feststellung, dass etwas, was ist, auch anders hätte sein können, ein durch den Mangel an Bestimmtheit von der Materie bedingter Störfall, während sie im anderen Fall zur Signatur der endlichen Welt im Ganzen wird. Die Beschäftigung mit den in der Tradition als metaphysisch bezeichneten Grundsatzfragen, für die die nach der Wirklichkeit als paradigmatisch anzusehen ist, bedeutet keineswegs, einem zeitlosen und kontextunabhängigem Geschäft nach- 78491_Honnefelder.indd 8 17.02.16 14:19 EINLEITUNG 9 zugehen, sondern mögliche Antworten nur in der Auseinandersetzung mit der geschichtlich-konkreten Situation zu suchen. Wer Metaphysik betreibt, behandelt ebenso grundlegende wie historisch verankerte Probleme. Im Umkehrschluss bedeutet dies selbstverständlich auch, dass die historisch gegebene Position nicht qua Gegebenheit Überzeugung beanspruchen kann. Es ist genau diese Herangehensweise, die weder ahistorisch noch sachlich indifferent ist, die der Bonner Philosoph Ludger Honnefelder in der vorliegenden Auswahl seiner wichtigsten Arbeiten zur Metaphysik und ihrer Grundsatzfrage „Was ist Wirklichkeit?“ verfolgt. *** Verbindet man das sachliche Interesse mit der historischen Betrachtung, bedarf es der Leitfragen, die die Positionen und Entwicklungen in den Blick treten lassen, an denen Forschungsperspektiven, Problemkonstellationen, Wendepunkte und Innovationen erkennbar werden. So stellt sich eben auch mit Blick auf die Reflexion über die Wirklichkeit zunächst die Frage, was überhaupt der Klärungsbedarf ist, auf den die dann später als Metaphysik bezeichnete Disziplin antwortet. Denn ohne diesen sachlichen Hintergrund wird es kaum möglich sein, Entwicklungen in der Behandlung dieses philosophischen Gegenstandes erfassen zu können. Honnefelder sieht den Ursprung der Metaphysik in einem in der griechischen Antike aufkommenden Wissen-Wollen um die Welt als Ganze. Dieses Wissen zielt nicht auf spezifische Bereiche innerhalb der Welt, sondern auf die alle Teilbereiche umfassende Ganzheit bzw. Einheit. Das sachliche Interesse, das dieser Zuwendung zur Ganzheit zugrunde liegt, ist letztlich im Wesen des Wissen-Wollens selbst verankert, nämlich in der Suche nach den Gründen für das, was man erkannt hat. Die Gründe, die der Metaphysiker anstrebt, sind nicht nur Gründe für diese oder jene spezifische Überzeugung, die man als Wissenschaftler oder allgemein als Wissender haben kann, sondern es sind in dem Sinne letzte oder erste Gründe, als sie nicht noch einmal durch andere Gründe gerechtfertigt werden können. Letztgründe sind sie im Sinne eines abschließenden – vornehmlich epistemologisch, aber auch kausal oder teleologisch interpretierten – Urgrundes für die Gesamtwirklichkeit in ihrer Erkennbarkeit; Anfangsgründe, insofern sie in Form apriorischer Strukturen und Gegebenheiten unser Erkennen immer bereits bedingen. Die Leitfrage, die in beiden Perspektiven zum Ausdruck kommt, zielt also letztlich darauf, die Möglichkeiten und die Bedingungen von Wissen und Erkennen im engeren Sinne aufzuzeigen. Der aristotelischen Metaphysik kommt für Honnefelder in der Geschichte dieser Disziplin eine besondere Bedeutung zu, weil sie dezidiert solche Begründungsinstanzen von Wissen überhaupt in den Blick nimmt und von Anfang an zwei Antworten auf die Frage nach den ursprünglichen Gründen des Wissens bereit zu halten scheint, die beide wirkungsgeschichtlich fruchtbar geworden sind. Die eine Antwort des Aristoteles lautet, dass alles Wissen letztlich auf ein Wissen um den ersten Anfangsgrund, die erste Ursache oder das ausgezeichnete (nämlich immaterielle, göttliche) Seiende zurückzuführen ist. Die andere Antwort besagt, dass jede Erkenntnis ein Wissen um das Allgemeinste, nämlich den gänzlich unbestimmten 78491_Honnefelder.indd 9 17.02.16 14:19 10 EINLEITUNG Begriff des Seienden als solchen beinhaltet. Mit dieser doppelten Bestimmung eröffnet Aristoteles den Weg zu einer reihentheoretisch argumentierenden Konzeption einer Metaphysik des Transzendenten einerseits, sowie zu einer ganzheitstheoretisch ausgerichteten Metaphysik des Transzendentalen andererseits. Insbesondere dieser zweite Ansatz der aristotelischen Metaphysik, der mit dem Begriff des ‚Seienden, insofern es seiend ist‘ operiert, ist erklärungsbedürftig. Jedes Wissen darüber, dass einem Gegenstand eine bestimmte Eigenschaft zukommt, drückt sich in einem Satz aus, in dem einem Subjekt, das für den Gegenstand steht, ein Prädikat zugesprochen wird, das der Eigenschaft entspricht. Der Grundgedanke des Aristoteles bei dieser zweiten Interpretation dessen, was Metaphysik ist und womit sie zu tun hat, geht davon aus, dass die abschließende Art und Weise, Wissen zu begründen, darin besteht, die Struktur aufzuzeigen, die jedem Wissen eigen ist. In diesem Sinne sucht die Metaphysik nach einer allgemeinen, ja nach der allgemeinsten Struktur, durch die letztlich jede Erkenntnis bestimmt ist. Ein Satz wie der, dass Menschen sterblich sind, lässt sich auf den allgemeineren Satz zurückführen, dass Lebewesen sterblich sind. Diese Ableitung beruht darauf, dass das Subjekt des ersten Satzes – „Mensch“ – im Subjekt des zweiten Satzes – „Lebewesen“ – enthalten ist. In diesem Sinne ist der erste Satz nur mittels des zweiten zu rechtfertigen. Eine Letztbegründung läge dann vor, wenn das verwendete Subjekt, von dem etwas ausgesagt wird, nicht noch einmal auf einen allgemeineren Begriff, in dem es enthalten ist, zurückgeführt werden kann. Dieses Subjekt müsste folglich die größte Allgemeinheit besitzen, bzw. – was das gleiche besagt –, es müsste in allen anderen spezifischen Subjekten, z.B. in den Begriffen „Mensch“ oder „Lebewesen“, enthalten sein. Aristoteles deutet den Begriff des Seienden als solchen als diesen allgemeinsten Begriff. Weil er implizit in jeder Erkenntnis, in der etwas als etwas erfasst wird, enthalten ist, handelt es sich um den Gegenstand, um den es in der Metaphysik – zumindest nach dieser einen aristotelischen Deutung – geht. Unabhängig von der seit Beginn der Aristoteles-Rezeption kontrovers diskutierten Frage, wie mit den beiden Modellen, die Aristoteles in seiner Metaphysik vertritt, umzugehen ist, tritt die Metaphysik als eine allen anderen Wissenschaften gegenüber grundlegende Disziplin hervor; sie ist nach Aristoteles „erste Philosophie“, weil sie das behandelt, was alle anderen implizit voraussetzen. Ihr Wahrheitsanspruch ist ursprünglich, während der der anderen Wissenschaften nur indirekt vermittelt ist, da er nicht bis auf die ersten Gründe zurückgeht. Dieser Grundlegungscharakter der Metaphysik führt zu ihrer Vorordnung gegenüber der Vielheit der anderen Wissenschaften. Verständlicherweise ergibt sich in dem Augenblick eine ganz neue Problemkonstellation, in dem der aristotelische Ansatz der Metaphysik mit einem Wahrheitsanspruch konfrontiert wird, der von gänzlich anderer Natur, aber ebenso grundlegend und universal ist. Dieser Zeitpunkt ist durch die Begegnung der allein der natürlichen Rationalität verpflichteten aristotelischen Metaphysik mit dem auf Offenbarung gegründeten Wahrheitsanspruch der christlichen Lehre im lateinischsprachigen Westen gegeben. Tatsächlich handelt es sich nicht um einen einzigen Augenblick, sondern vielmehr um einen längeren Prozess, in dessen Verlauf zu- 78491_Honnefelder.indd 10 17.02.16 14:19 EINLEITUNG 11 nächst die Spannung der unterschiedlichen Ansätze erkennbar, Abgrenzungen vorgenommen und schließlich Lösungsmöglichkeiten für eine Zuordnung entwickelt werden. Dieser Prozess hat eminente Folgen für die Metaphysik in ihren verschiedenen Spielarten hervorgerufen, weshalb Ludger Honnefelder die heute breit rezipierte, wenn auch nicht unumstrittene Kennzeichnung eines „zweiten Anfangs der Metaphysik“ zur Charakterisierung dieses Vorgangs geprägt hat. *** Die in diesem Zusammenhang interessierenden christlichen Autoren des Mittelalters sind ex professo Theologen, allerdings solche, die bereits ein philosophisches Grundstudium absolviert haben. Sofern sie sich auf die Auseinandersetzung mit der Metaphysik einlassen – schließlich wurde die Metaphysik des Aristoteles nicht von allen Gelehrten bereitwillig rezipiert –, müssen sie die Frage beantworten, wie sich der christliche Wahrheitsanspruch zu dem, den die Philosophie in Gestalt der Metaphysik erhebt, verhält. Honnefelder diskutiert diesen Prozess der Auseinandersetzung vor allem mit Blick auf Autoren des 13. Jahrhunderts wie Albertus Magnus, Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus. Der Grund für diese Fokussierung liegt in deren besonderem Interesse an der Auseinandersetzung, die mit dem Bekanntwerden des lateinischen Textes der aristotelischen Metaphysik einschließlich der Kommentare der arabischen Philosophen Avicenna und Averroes beginnt. Was diese Situation noch einmal spezifisch verändert, ist, dass die sich anschließende Diskussion für Philosophie wie Theologie um die zusätzliche Herausforderung bereichert wird, die mit der ebenfalls im 13. Jahrhundert einsetzenden Rezeption der Wissenschaftstheorie des Aristoteles einhergeht. Theologen und Philosophen müssen sich die Frage stellen, ob und in welcher Weise sie Wissenschaft betreiben, und sie müssen Antwort darauf geben, wodurch sich ihr Betätigungsfeld von dem des jeweils anderen unterscheidet. Am Ende müssen beide ihr spezifisches Betätigungsfeld unter dem gemeinsam geteilten Anspruch bemessen, Wissenschaft treiben zu wollen. Es stellt sich also jeweils eine doppelte Herausforderung für beide Disziplinen, nämlich den jeweils eigentümlichen Gegenstand ihres Forschens zu bestimmen und den Nachweis zu erbringen, dass dieser auch als Gegenstand einer Wissenschaft im engeren Sinne in Frage kommt. Diese konkrete historische Situation führt zu einem Reflexionsprozess, der beide Seiten, theologische wie philosophische, dazu zwingt, die Möglichkeiten, aber eben auch die Grenzen des eigenen Betätigungsfeldes genau auszuloten. Aufgrund des Ansatzes der aristotelischen Metaphysik resultiert hieraus eine kritische Vergewisserung der Grenzen dessen, was die Philosophie mit den Mitteln der natürlichen Vernunft zu erkennen vermag. Die für das Mittelalter signifikante Begegnung mit dem Christentum zwingt die Philosophie dazu, Metaphysik als Kritik der Vernunft zu betreiben, d.h. darauf zu reflektieren, was die Voraussetzungen unseres Erkennens sind und unter welchen Bedingungen es überhaupt zu realisieren ist. Honnefelder geht in seinen Untersuchungen dem Ringen der mittelalterlichen Denker, sofern sie in diesen Prozess involviert sind, im Detail nach. Denn es zeigt 78491_Honnefelder.indd 11 17.02.16 14:19 12 EINLEITUNG sich, dass die sich daraus ergebende Auseinandersetzung durch eine Fortentwicklung des Problembewusstseins der beteiligten Autoren und somit auch nur durch sukzessiv und alternativ entwickelte Strategien zu behandeln ist. Mit dieser historisch argumentierenden Herangehensweise kann Honnefelder zeigen, dass es insbesondere die Metaphysikansätze des Mittelalters sind, die – gegen die Erwartung einer theologischen Voreingenommenheit – erkenntniskritisch verfahren und als Konsequenz daraus ontologische Ansätze bilden. Ontologisch meint in diesem Zusammenhang den Verzicht, die Grundlagenwissenschaft der Metaphysik unter Rückgriff auf einen ausgezeichneten Betrachterstandpunkt zu betreiben, der sich aus spezifisch theologischer Perspektive verbietet, weil dies hieße, den für Menschen unmöglichen Standpunkt Gottes einzunehmen – eine erkenntniskritische Einstellung, die sich freilich bereits in Platons Motiv der „zweitbesten Fahrt“ wiederfinden lässt. Stattdessen versteht sich die Ontologie als Rekonstruktion der fundamentalen Strukturen unseres Weltbezugs, der im Ausgang von den erkennbaren endlichen Gegenständen zu entfalten ist. Honnefelder zeigt in einer Reihe von Arbeiten, wie sich das Problembewusstsein der von ihm ins Auge gefassten Autoren weiter entwickelt und die Lösungsstrategien zunehmend differenzierter werden. In diesem Sinne handelt es sich bei den von ihm untersuchten Denkern – Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Johannes Duns Scotus – um Schlüsselfiguren der mittelalterlichen Philosophie. Für Honnefelder rücken jeweils die unterschiedlichen Strategien der Autoren in den Fokus der Betrachtung, mit denen sie versuchen, die unterschiedlichen Ansätze der aristotelischen Metaphysik in ein Verhältnis zu setzen. Diese Akzentsetzung seiner Untersuchung hat ein Fundament in der zu Beginn der Aristoteles-Rezeption prägenden Gegenüberstellung der von Avicenna und von Averroes bestimmten Deutungen des Gegenstandes der Metaphysik. Während Avicenna die Auffassung vertritt, der Gegenstand der Metaphysik sei der allgemeine Begriff des Seienden als solchen, erblickt Averroes diesen im ausgezeichneten Seienden, also in einer transzendenten ersten Ursache. Dass beide Autoren sich für ihre Deutung auf den Text der aristotelischen Metaphysik berufen können, macht die Aufgabe für ihre lateinischsprachigen Interpreten nicht leichter, deren Lösungsvorschläge dafür aber umso differenzierter. *** Ein besonderes Interesse Ludger Honnefelders, das sich nicht nur in den vorliegenden Aufsätzen, sondern auch in seinen monographischen Arbeiten niederschlägt, gilt der Metaphysik des Johannes Duns Scotus und ist eng mit dessen Deutung dieser Disziplin als Transzendentalwissenschaft verbunden, wobei Scotus der sachliche Unterschied zwischen transzendental und transzendent, obwohl ihm nur der eine lateinisch Begriff transcendens zur Verfügung steht, vollständig bewusst ist. Auch wenn die von Scotus unmittelbar als Gegenfolie seiner eigenen Deutung kritisch in den Blick genommene Position meist die des Heinrich von Gent ist, sind an zentralen Stellen oft Annahmen betroffen, die ebenso die Position des Tho- 78491_Honnefelder.indd 12 17.02.16 14:19 EINLEITUNG 13 mas von Aquin und anderer mittelalterlicher Gelehrten betreffen. Weder versteht man den Entwurf der scotische Metaphysik richtig, ohne den Kontext, in dem er entsteht, vor Augen zu haben, noch erkennt man die Brisanz, die seine Weichenstellungen in ihrem ganzen Ausmaß mit sich bringen, ohne die Verankerung einzelner Lehrstücke im Zusammenhang der anderen Entwürfe der Metaphysik zu überblicken. Was die scotische Position zunächst kennzeichnet, sind zwei konsequent verfolgte Entscheidungen. Zum einen versteht Scotus die Metaphysik als die Wissenschaft, die den allgemeinsten Begriff, den des Seienden, insofern es seiend ist, zum Gegenstand hat. Mit dieser Weichenstellung votiert Scotus für die eine Option der aristotelischen Metaphysik und schließt die andere, nämlich die, die ein ausgezeichnetes Seiendes für den Gegenstand der Metaphysik hält, konsequent aus. Zum anderen – und hiermit setzt sich Scotus von all seinen mittelalterlichen Vorgängern, aber auch von Aristoteles selbst ab – verbindet er diese Gegenstandsbestimmung mit der These, dass der Begriff des Seienden univok, also in einer eindeutig-einheitlichen Bedeutung, und nicht im Sinne einer analogen Verwendung ausgesagt wird. Diese zwei Optionen, die von der Sache her, so die Deutung Honnefelders, eng zusammen gehören und nur in ihrer Kombination ein wirklich tragfähiges Modell für die Metaphysik bereit stellen, sind einerseits ein Kennzeichen der Abkehr von den mittelalterlichen Entwürfen der Metaphysik, die eine Verbindung einer ontologischen Begriffsanalyse allgemeinster Prädikate mit einer kausaltheoretischen Deutung des Seienden von einem ersten, ausgezeichneten Seienden her versuchen. Andererseits bietet die scotische Konzeption der Metaphysik als scientia transcendens Anschlussmöglichkeiten für jede spätere Ausgestaltung der Metaphysik, die eine Rekonstruktion der als transzendental interpretierbaren Strukturen unseres primären Weltbezugs intendiert. Indem Scotus die für sein Verständnis zentrale These von der Univokation als Voraussetzung jeder möglichen Proposition definiert, in der von einem Subjekt ein Prädikat wahrheitsrelevant ausgesagt wird, und diese Eindeutigkeit der Begriffe als Bedingung für jedes Argument annimmt, das mehrere Sätze in einen Ableitungszusammenhang bringt, nimmt die scotische Position zentrale Anliegen einer sprachanalytischen Deutung vorweg. Der Begriff des Seienden kann für Scotus nur dadurch zum univok aussagbaren Begriff werden, d.h. zu einem Prädikat, das in derselben Bedeutung von Gott und Schöpfung wie auch von Substanz und Eigenschaft aussagbar ist, dass er als gänzlich unbestimmt gedacht wird. Seiendes als solches ist von sich aus weder notwendig oder kontingent, noch endlich oder unendlich, noch real oder bloß möglich. Vielmehr handelt es sich bei diesen Bestimmungen um erst zum Seienden hinzutretende Kennzeichnungen, die eine modale Charakterisierung zum Ausdruck bringen, also die Art und Weise näher bestimmen, in der ein Seiendes gegeben ist. Seiendes selbst besagt nichts anders, als der mögliche Träger nicht widersprüchlicher Bestimmungen zu sein. Scotus öffnet damit den Weg für eine Betrachtungsweise der Metaphysik, die Honnefelder „die modale Explikation“ genannt hat. Diese Analyse lässt das innerweltlich Seiende, also das Seiende, das wir selbst sind, so wie die Welt, in der wir leben, als radikal kontingent erscheinen. Dies führt 78491_Honnefelder.indd 13 17.02.16 14:19 14 EINLEITUNG Scotus zu neuen Begründungsstrategien: Denn das, was wir tun, geschieht nur deshalb, weil wir es wollen, und die Dinge in der Welt sind nur deshalb überhaupt, wie sie sind, weil ein unendliches Wesen, Gott, es so gewollt hat. Die Kontingenz verweist also auf ein ursprüngliches Vermögen, das Freiheit besitzt und alles von ihm Gewollte zu etwas kontingent Verursachtem werden lässt. Das Kontingente besitzt zwar aus sich heraus notwendig die Möglichkeit, existieren zu können, verdankt aber seine reale Existenz einer anderen Ursache, die letztlich auf den freien Willen eines anderen Vermögens verweist. Insbesondere die modale Bestimmung der Kontingenz wird für Scotus zum sachlichen Ausgangspunkt, das Wesen von Freiheit und Verursachung neu zu deuten, und zwar in einer Weise, die die Handlungstheorie und die wesentlichen Aspekte einer philosophischen Ethik in ein ganz neues Licht treten lassen. *** Was Metaphysik und Ethik miteinander verbindet und darüber hinaus insgesamt die Philosophie des Mittelalters in Honnefelders Deutung kennzeichnet, lässt sich am zutreffendsten unter dem Stichwort ‚Rationalität‘ fassen. Rationalität, das „umfassende Netzwerk der Gründe“ in Gestalt von Wissenschaft, so Honnefelder, ist nicht nur das genuin philosophische Programm, dem sich auch die Denker des Mittelalters verschrieben haben, sondern wird gleichzeitig zum normativen Maßstab, an dem sich ihre unterschiedlichen Beiträge messen lassen müssen. Auch diese Frage ist für Honnefelder nur dadurch zu beantworten, dass man die historischsystematischen Zusammenhänge berücksichtigt, in denen sich Rationalität und Rationalisierungsstrategien äußern. Für die Metaphysik und die theoretische Frage nach der Wirklichkeit sind diese Zusammenhänge bereits beleuchtet worden. Sie greifen in gleichem Maße für die Wirklichkeit, der sich der Mensch in seinem Handeln zu stellen hat. Auch hier kommt der Figur des Aristoteles ein besonderer Stellenwert zu, da er den mittelalterlichen Denkern die Begriffe und Konzepte praktischer Rationalität vermittelt, die in den ethischen Theorien des Mittelalters, etwa der Naturrechts- und Tugendethik, ihren Niederschlag finden. Insbesondere in der Vorstellung eines natürlichen Gesetzes (lex naturalis) im Menschen, d.h. der in seiner Vernunftnatur liegenden Fähigkeit, das zu tuende Gute und das zu lassende Schlechte zu erkennen, verwirklicht sich die bei Aristoteles vorgedachte Autonomie und Universalität einer praktischen Vernunft, die ihre Verbindlichkeit aus sich selbst heraus gewinnt. Das Ereignis der Aristoteles-Rezeption erhält somit in Honnefelders Interpretation eine Bedeutung, die über den unmittelbaren Einfluss auf die mittelalterliche Metaphysik und Ethik hinausgeht und zum Leitfaden wird, an dem sich die philosophiegeschichtliche Rekonstruktion der Epoche des Mittelalters insgesamt zu orientieren hat. Den Hintergrund bildet ein normatives Verständnis von Philosophie, das nicht jede beliebige Form des Erkennens und Denkens beinhaltet, sondern im engeren Sinne nur diejenige Reflexion auf die Wirklichkeit, die sich – kritisch und von der Frage nach universaler Gültigkeit der Gründe geleitet –, auf unsere primä- 78491_Honnefelder.indd 14 17.02.16 14:19 EINLEITUNG 15 re, d.h. noch unreflektierte Selbst- und Welterfahrung bezieht. So verstanden, vermag Honnefelder seine zunächst nur auf den engeren Begriff der Metaphysik bezogene Rede vom „zweiten Anfang“ auf die Philosophie des lateinischen Westens als Ganze zu übertragen, freilich ohne die spezifischen Vermittlungsleistungen der arabischen Denker in diesem Prozess unberücksichtigt zu lassen. Eine Schlüsselfunktion kommt dabei Albertus Magnus zu, der sich als erster bewusst der Aufgabe stellt, das aristotelische Denken zu rezipieren und auf der Basis eines neuen Wissenschaftsverständnisses zu transformieren. Das damit zutage tretende Philosophieverständnis ist freilich nicht allein eine historisch rekonstruierbare Gegebenheit, die es in neuscholastischer Manier womöglich wiederzubeleben gälte, sondern steht, wie Honnefelder immer wieder vor Augen führt, in ständiger Wechselwirkung mit aktuellen Fragestellungen und kann sich nicht nur, sondern muss sich auch von diesen aus befragen lassen. Die Spannung zwischen historischer Kontextgebundenheit auf der einen und systematischer Sachgebundenheit auf der anderen Seite ist es, die die Auseinandersetzung mit der Philosophiegeschichte des Mittelalters nicht nur lohnenswert, sondern auch für die Philosophie insgesamt unverzichtbar macht. Denn die unter den Stichworten ‚Vernunft‘ und ‚Freiheit‘ zum Ausdruck kommende Rationalisierungsleistung, die die Philosophie des Mittelalters kennzeichnet, hat fundamentale und an vielen Stellen deutlich nachweisbare Spuren in unserem modernen Verständnis von Philosophie hinterlassen. Die Frage „Was ist Wirklichkeit?“ ist eine solche philosophische, d.h. heute wie damals elementare Grundsatzfrage, die die philosophiegeschichtlichen Kontinuitäten deutlich werden lässt und erst durch deren Hinzuziehung einer philosophisch befriedigenden Antwort zugeführt werden kann. Honnefelder knüpft damit an seine 2008 erschienenen Studien Woher kommen wir? Ursprünge der Moderne im Denken des Mittelalters an. *** Es bedarf kaum der Erwähnung, dass Ludger Honnefelders Arbeiten zur Philosophie des Mittelalters in ihrer historisch-systematischen Ausrichtung nicht nur im engeren Kreis der philosophischen Mediävistik rezipiert werden, sondern weit darüber hinaus überall da Beachtung finden, wo das sachliche Interesse von Philosophen und Theologen die historische Vergewisserung nicht als verzichtbares Beiwerk, sondern als integralen Bestandteil des philosophisch-theologischen Kerngeschäfts selbst erscheinen lässt. Für die internationale Forschung der Philosophie des Mittelalters sind Honnefelders Untersuchungen zur Metaphysik und zur Ethik nicht nur in ihren Detailanalysen, sondern auch in der durch sie eröffneten Forschungsperspektive einschlägig. Dies betrifft in erster Linie Honnefelders Forschungen zu Duns Scotus und der Wirkungsgeschichte, die von seinem Denken ausgeht. Neben den zahlreichen Arbeiten zur scotischen Metaphysik und Ethik, die er initiiert hat, prägen vor allem seine eigenen Untersuchungen zur Metaphysik des Scotus nicht nur die mittelalterliche Spezialforschung, sondern haben darüber hinaus den Blick dafür geöffnet, 78491_Honnefelder.indd 15 17.02.16 14:19 16 EINLEITUNG welches Anschlusspotential die mittelalterliche Philosophie insbesondere in ihrer scotischen Deutung als Transzendentalwissenschaft für die neuzeitliche Auseinandersetzung beinhaltet. Honnefelder kommt es zu, die Gestalt des Scotus aus dem Schatten des Thomas von Aquin und damit aus ihrer ungerechtfertigten Marginalisierung herausgelöst und als einen ebenso innovativen wie wirkmächtigen Vermittler in der Geschichte der Metaphysik vor Kant präsentiert zu haben. Mit Blick auf die in der scotischen Metaphysik zum Ausdruck kommende Modalität der Kontingenz haben diese Zusammenhänge auch Konsequenzen für die Freiheitstheorien; Honnefelder wirkt damit entscheidend dazu bei, die Philosophie der Generation nach Thomas, als dessen herausragender Vertreter Scotus gelten darf, nicht als dekadente Epoche des Voluntarismus und Nominalismus zu disqualifizieren, sondern sie als eine entscheidende Weichenstellung auf dem Weg zu einem modernen, säkularen Verständnis von Vernunft und Freiheit zu benennen. Neben der intensiven Beschäftigung mit Scotus haben Honnefelders Forschungen zur mittelalterlichen Metaphysik in ihrer aristotelischen Prägung eine große Wirkung entfaltet. Die Rede von dem durch die Aristoteles-Rezeption freigesetzten ‚zweiten Anfang der Metaphysik‘ ist zwar aufgrund ihrer normativen Implikationen, die nur ein bestimmtes, eben aristotelisch geprägtes Verständnis von Metaphysik in den Fokus stellen, nicht immer kritiklos akzeptiert (und in manchem Forschungsbeitrag durch ihre alleinige Bezugnahme auf Scotus sogar falsch rezipiert) worden, doch bringt sie zweifellos einen historischen wie sachlichen Einschnitt zum Ausdruck, der insgesamt – nicht nur von philosophischer, sondern auch von theologischer Seite aus – auf breite Zustimmung stößt. Auch Honnefelders Beiträge zur mittelalterlichen Ethik und insbesondere zur Lehre vom Naturgesetz bei Thomas von Aquin haben im Anschluss an die Arbeiten von Wolfgang Kluxen das lang gehegte Bild von einer überholten und nicht anschlussfähigen praktischen Philosophie des Mittelalters gründlich revidiert. Auch hier ist der Rückgriff auf Aristoteles und seine Etablierung eines Bereiches des Praktischen, dem eine eigenständige, nicht vom Theoretischen ableitbare Dignität zukommt, von signifikanter Tragweite. Sowohl im Bereich der theoretischen wie der praktischen Philosophie zeigt Honnefelder immer wieder, wie sich im Mittelalter zwar eigene, aber doch mit der antiken Philosophie kompatible und für die Neuzeit aktuelle Rationalitäts- und Wissenschaftsstandards herausbilden. Damit eröffnet er philosophische Problemfelder, die in produktiver Weise eine zeitgenössische Rezeption des mittelalterlichen Denkens ermöglichen und fördern. *** Die vorliegenden zwölf Beiträge aus den Jahren 1990 bis heute sind zum Teil noch unveröffentlicht oder deutsche Übersetzungen bereits auf Englisch erschienener Artikel (siehe die Quellennachweise). In „Einheit der Realität“ oder „Realität als Einheit“ – Metaphysik als Frage nach der Welt im ganzen wendet sich Honnefelder dem Verstehen von Wirklichkeit zu, in- 78491_Honnefelder.indd 16 17.02.16 14:19 EINLEITUNG 17 dem er die scotische Ontologie zum Ausgangspunkt wählt und ihre transzendentalphilosophische Deutung mit Kant und der modernen sprachanalytischen Interpretation verbindet. Der metaphysische Zugriff auf das Ganze und der diesen erlaubende bzw. dafür konstitutive Gegenstandsbezug, den Scotus mit dem Begriff des Seienden, insofern es seiend ist, zum Ausdruck bringt, setzt sich fort in Kants Idee der objektiven Realität und lässt sich gleichermaßen im Grenzbegriff des ‚Gegenstandes überhaupt‘ wiederfinden, der in der sprachanalytischen Diskussion vorausgesetzt wird. Die Frage nach der Realität und die Möglichkeit von Metaphysik greift diese Zusammenhänge auf, bezieht sie jedoch stärker auf den Begriff der Wirklichkeit und verknüpft sie mit der in der analytischen Philosophie Michael Dummetts und Hilary Putnams geführten Diskussion um Realismus und Antirealismus. Honnefelder sucht die Auseinandersetzung mit diesen Positionen mittels des Rückgriffs auf die Geschichte der Metaphysik und insbesondere ihre scotische Bestimmung von Realität als innerer Nichtwidersprüchlichkeit zum Sein. Im Zentrum steht zudem die Einsicht, dass die Wirklichkeit nicht von einem God’s eye view aus in den Blick genommen zu werden vermag. So gelingt es Honnefelder nicht nur, die moderne Debatte um den metaphysischen Realismus auf ihre Schwachpunkte hin kritisch zu überprüfen, sondern auch, sie auf eine weiterführende Klärung zu verweisen, nämlich einer solchen, in deren Mittelpunkt die Aufdeckung der Grundvoraussetzungen unseres Sprechens, Denkens und Handelns steht. In Zeit und Existenz fragt Honnefelder nach dem Zusammenhang von Sein und Temporalität, die nicht aufeinander reduziert werden können. Wie aber hängen Existenzaussagen und Zeitbezug, Aktualität und Prozessualität, ‚es gibt‘ und ‚individuelle Existenz‘ miteinander zusammen? Hier ist vornehmlich Thomas von Aquin der Gesprächspartner, der in die Diskussion mit verschiedenen zeitgenössischen Positionen aus der analytischen Philosophie gestellt wird. Der Beitrag Die Bedeutung der Metaphysik für Glauben und Wissen erweitert die erkenntnistheoretische Perspektive um die existentielle Dimension, die im Glauben zum Ausdruck kommt. Diese Perspektivenverschiebung nimmt Honnefelder zum Anlass, die Metaphysik auf ihre Funktion und ihren Stellenwert hin zu befragen. Dabei stellt er heraus, dass und wie ein sich vergewissern wollender, d.h. vor der Vernunft verantwortbarer religiöser Glaube stets auf die Form von Metaphysik als erster Philosophie in Gestalt von Wissenschaft angewiesen bleibt. Dies hat Konsequenzen für die Rationalitätsbedingungen, unter denen Theologie und die Rede von Gott betrieben werden – wobei Honnefelder keineswegs die Spannung leugnet, die darin besteht, dass Glaube als Lebensvollzug sehr viel mehr umfasst als seine kognitiven Inhalte. In Albertus Magnus und die kulturelle Wende im 13. Jahrhundert behandelt Honnefelder die zentrale Rezeptions- und Transformationsrolle, die Albert der Große mit seinem Projekt der Kommentierung des aristotelischen Corpus spielt. Die breit angelegten Ausführungen machen deutlich, an wie vielen unterschiedlichen Stellen die Aristoteles-Rezeption Alberts bis in die Neuzeit hinein fruchtbar wurde und zentrale philosophische Begriffe geprägt hat. Albert wird als Wegbereiter erkenn- 78491_Honnefelder.indd 17 17.02.16 14:19 18 EINLEITUNG bar, der den nicht mehr umkehrbaren Prozess der Auseinandersetzung mit der paganen Philosophie und ihren Rationalitätsstandards einleitet und in den Strukturen prägt. Die folgenden drei Beiträge sind der Philosophie des Johannes Duns Scotus gewidmet. Johannes Duns Scotus – Denker auf der Schwelle vom mittelalterlichen zum neuzeitlichen Denken bietet eine umfassende Darstellung der Person und Position des Scotus. Honnefelder skizziert die philosophiehistorischen Hintergründe, vor denen Scotus als Schlüsselgestalt in Erscheinung tritt, sowie mit den Theorien der Wirklichkeit und des handelnden Ichs seine wichtigsten Lehrstücke im Bereich der theoretischen und praktischen Philosophie. „Gott“ denken? Überlegungen im Anschluss an den Gottesbegriff des Johannes Duns Scotus setzt sich mit der hier von JeanLuc Marion vertretenen Position auseinander, dass Gott in radikaler Transzendenz immer nur als das Unbedingte und ‚Ganz-Andere‘ zu denken sei, das unserer Erfahrung komplett entzogen ist. Honnefelder hält dem die scotische Position entgegen, vermittels derer er aufzeigt, dass nicht nur die Möglichkeit der Rede von Gott, sondern damit zusammenhängend die Möglichkeit von Offenbarung überhaupt nur sinnvoll erschlossen werden kann, wenn die Erkenntnisbedingungen geklärt sind, unter denen sie stattfinden. Dies leistet die scotische Metaphysik, in deren Zentrum die These steht, dass alles Erkennen den formalen Begriff des Seienden voraussetzt, der in seiner modalen Explikation als ‚unendliches Seiendes‘ die Basis bietet, auf der es überhaupt erst möglich wird, Gott zu denken oder von ihm zu sprechen – ohne ihn damit einfach unter die Seienden unserer Welterfahrung zu subsumieren und ihn seiner Transzendenz zu berauben. Der Beitrag Freiheit und Rationalität. Die neue Verhältnisbestimmung von Verstand und Wille bei Johannes Duns Scotus setzt hingegen bei dem immer wieder an Scotus herangetragenen Vorwurf an, er sei Voluntarist, der das Vermögen des Willens so stark in den Vordergrund stelle, dass eine Rückbindung an Rationalitätsbedingungen überflüssig sei. Honnefelder zeigt auf, wie Scotus den Willen als Vermögen ursprünglicher Selbstbestimmung ausweist, ohne jedoch auf die Verbindung von Freiheit und Rationalität zu verzichten. In Wie sind Aussagen über Gott möglich? Thomas von Aquin über „gut“ als Prädikat Gottes widmet sich Honnefelder der philosophischen Gotteslehre des Thomas und dessen Auseinandersetzung mit einem der wichtigsten Attribute Gottes, nämlich seiner Gutheit, in Summa Theologiae I 6. Thomas greift dabei auf die klassische Position des neuplatonischen Denkers Dionysius Pseudo-Areopagita zurück und nimmt dessen Behandlung zum Anlass, die Frage nach dem Verhältnis des Guten zum Seienden neu zu thematisieren. Wie verhält sich die ontologische Gutheit zum Begriff des Seienden als des Ersterkannten? In seinem Beitrag Das Mittelalter als ‚zweiter Anfang‘ der Philosophie. Die Aristoteles-Rezeption als Leitfaden der Geschichte der Philosophie im Mittelalter widmet sich Honnefelder dem Ziel, die Geschichte der Philosophie des Mittelalters nicht nur als beliebige Abfolge unterschiedlicher Denker und Texte zu präsentieren, sondern in der Aristoteles-Rezeption die leitende Kategorie herauszuarbeiten, die es erlaubt, einen normativen Begriff von Philosophie zu entwickeln, an dem sich mittelalter- 78491_Honnefelder.indd 18 17.02.16 14:19 EINLEITUNG 19 liche Autoren und Texte messen lassen müssen. Das so gewonnene Ergebnis besteht freilich weniger in bestimmten Inhalten, als vielmehr in einem bestimmten Problem- und Methodenbewusstsein, das sich in Fragestellung, Reflexion und Argumentation niederschlägt. In Säkularität und Moderne im philosophischen Diskurs: Die Frage nach dem Ursprung, der Bedeutung und der Legitimität des säkularen Verständnisses von Vernunft und Freiheit vertritt Honnefelder in Auseinandersetzung mit Hans Blumenberg und Jürgen Habermas seine These von der Bedeutung der mittelalterlichen Philosophie für das moderne säkulare Selbstverständnis von Vernunft und Freiheit, und zwar am Beispiel der Erneuerung des Verständnisses von Wissenschaft bei Albertus Magnus, der Betonung der moralischen Autonomie im Vernunftrecht des Thomas von Aquin und der Wende zu Kontingenz und Freiheit bei Johannes Duns Scotus. Der Schlussbeitrag Metaphysik und Transzendenz. Überlegungen zu Johannes Duns Scotus mit Blick auf Thomas von Aquin und Anselm von Canterbury schlägt noch einmal den Bogen zurück zur anfangs nachgezeichneten Geschichte einer transzendenten und transzendentalen Konzeption in der Metaphysikgeschichte des Mittelalters. Der genuinen Leistung des Scotus, die Frage nach der Wirklichkeit in Gestalt einer scientia transcendens gestellt zu haben, setzt Honnefelder zunächst die Position des Thomas gegenüber, um dann beide in Beziehung zum ontologischen Argument des Anselm von Canterbury zu setzen. Dass sowohl Thomas als auch Scotus sich ausdrücklich mit Anselm Argument auseinandergesetzt haben, erlaubt es Honnefelder, die Unterschiede zwischen dem reihentheoretischen, auf Analogie basierenden Metaphysikverständnis des Thomas einerseits, und der ganzheitstheoretischen, die Univokation vertretenden Metaphysikkonzeption des Scotus andererseits in ihrer Irreduzibilität voneinander abzuheben. Ein Gesamtverzeichnis der Schriften Ludger Honnefelders rundet den vorliegenden Band ab. *** Eine formale Vereinheitlichung der vorliegenden Beiträge wurde bewusst nur behutsam vorgenommen. Vereinheitlicht wurden die Kapitelnummerierungen und die Form der Literaturangaben in den Anmerkungen, während die spezifischen Zitierweisen sowie die Rechtschreibung in alter und neuer Form dem Original gemäß belassen wurden. Orthographische Fehler, unvollständige Literaturangaben und veraltete Zeitbezüge wurden korrigiert. Die noch nach der Vivès-Ausgabe zitierten Scotus-Texte wurden nach der Editio Vaticana aktualisiert; davon ausgenommen sind die Textstellen, die nach Allan B. Wolters klassischer, semikritischer Ausgabe Duns Scotus on the Will and Moraliy zitiert wurden. Das Titelbild des vorliegenden Buches, das dankenswerter Weise mit der finanziellen Unterstützung der Görres-Gesellschaft entstehen konnte, spiegelt einen zentralen Gedanken wider, der Honnefelders Metaphysikverständnis prägt. Giorgio de Chiricos Great Metaphysical Interior von 1917 führt mit seinen verschiedenen ineinander verschobenen Realitätsebenen visuell vor Augen, was die philoso- 78491_Honnefelder.indd 19 17.02.16 14:19 20 EINLEITUNG phische Problematik der Wirklichkeit in ihren vielfältigen Bedeutungsschichten zwischen Möglichkeit und Realität charakterisiert. Der Spiegel zur Rechten verweist, trotz seiner offensichtlichen Blindheit und folglich Inhaltsleere, darauf, dass die Frage „Was ist Wirklichkeit?“ nicht unabhängig von erkenntnistheoretischen Fragestellungen behandelt werden kann; der philosophiegeschichtlich höchst wirkmächtige und von den mittelalterlichen Autoren unzählige Male zitierte Vers aus dem Ersten Korintherbrief – „Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht (videmus nunc per speculum in aenigmate tunc autem facie ad faciem)“ (1 Kor 13, 12) – macht deutlich, dass und wie unsere Vorstellung der Wirklichkeit an unseren jeweiligen Betrachterstandpunkt gekoppelt bleibt und sich damit grundsätzlich als begrenzt und eingeschränkt herausstellt. Die Folge ist keine lähmende Resignation, die alle Erkenntnisbemühung obsolet werden ließe, sondern die produktive Einsicht in die eigene Bedingtheit: Was Wirklichkeit ist, kann nur geklärt werden, indem man sich der Bedingungen vergewissert, unter denen sich unsere Erkenntnis Wirklichkeit aneignet; über die Wirklichkeit zu philosophieren – also Metaphysik zu betreiben – setzt voraus, dass wir uns über die Fundamente und Prinzipien verständigen, die unserem Erkennen zugrunde liegen. Für die Vermittlung dieser Einsicht sowie des die vorliegenden Beiträge durchziehenden Verständnisses mittelalterlicher Philosophie, deren bleibende Aktualität durch die Verbindung historischer Rekonstruktion mit systematischen Fragestellungen in vielerlei Hinsicht gewonnen zu werden vermag, danken Herausgeberin und Herausgeber dem geschätzten Lehrer. Bonn, den 25. März 2016 Isabelle Mandrella und Hannes Möhle 78491_Honnefelder.indd 20 17.02.16 14:19 „EINHEIT DER REALITÄT“ ODER „REALITÄT ALS EINHEIT“ – METAPHYSIK ALS FRAGE NACH DER WELT IM GANZEN Ohne Zweifel gehört die Frage nach dem Verhältnis von Einheit und Vielheit zu den Grundproblemen, die die Philosophie und deren erste Disziplin, die Metaphysik, von ihren Anfängen an bis heute beschäftigen. Ob sie auch deren Hauptproblem darstellt, hängt davon ab, wie man die Beziehung zwischen dem Einen und dem Seienden bestimmt.1 Ist das Eine Prädikat des Seienden wie bei Parmenides oder Subjekt des Seins wie bei Zenon?2 Ist Seiendes die Voraussetzung, die allererst Einheit in der Vielheit der Seienden zu denken erlaubt, oder ist Seiendes Resultat, das von der Wahl des zugrundegelegten Strukturmodells von Einheit und Vielheit bestimmt wird? Ist das primäre Thema der Metaphysik‚ ‚Einheit der Realität‘ oder ‚Realität als Einheit‘? Wie an Heraklit und Parmenides zu verfolgen ist,3 wird die Seiendheit zum Thema, als deutlich wird, daß Einheit nicht ohne Vielheit und Vielheit nicht ohne Bezug auf Eines gedacht werden können. Will man vom Einen wie von dem Vielen zugleich sagen, es sei, ohne die Differenz zwischen „ist“ und „ist nicht“ aufzuheben, dann muß eine Verschiedenheit der Weisen des „ist“ möglich sein, die die Einheit des „Ist“-Sagens nicht in Frage stellt. Der Weg, der sich Platon und Aristoteles zunächst zur Lösung anbietet, nämlich bei der Einheit unseres Sprechens und Begreifens der Welt anzusetzen und „Seiendes“ als allgemeines Prädikat aufzufassen, das Alles als Ganzes zu begreifen erlaubt, muß in beider Augen jedoch an jenem Ausgrenzungscharakter scheitern, der die Einheit des Gattungsallgemeinen allererst zustandekommen lässt. Wenn das Seiende gerade in seiner Seiendheit Vieles und Verschiedenes ist und deshalb die Differenz nicht nichts ist, kann „Seiendes“ nicht Gattung sein.4 Platons Ausweg, die Einheit des Vielen in der Teilhabe an einem Allgemeinen gründen zu lassen, das selbst Seiendes ist, und zwar das wahrhaft Seiende der Idee ‚jenseits‘ des sinnlich Erfahrbaren, ist für Aristoteles keine Lösung.5 Doch bindet auch er die ganzheitstheoretische Perspektive zur Abwehr der Gattungsaporie an eine reihentheoretische Betrachtung, die auf ein erstes ausgezeichnet Seiendes Bezug nimmt. Das viele und verschiedene Seiende kann in seiner Einheit als Seiendes nur erfaßt werden, weil es bezogen ist auf Eines, das im eigentlichen Sinn Seiendes ist, nämlich auf das erste Seiende der Substanz, vornehmlich 1 Vgl. K. Gloy, Einheit und Mannigfaltigkeit. Eine Strukturanalyse des „und“. Systematische Untersuchungen zum Einheits- und Mannigfaltigkeitsbegriff bei Platon, Fichte, Hegel und in der Moderne, Berlin-New York 1981, 1ff. 2 Vgl. Parmenides, Frag. 8, 6; Zenon, Frag. 3. 3 Vgl. Parmenides, Frag. 2. 4 Vgl. Aristoteles, Met. III 3, 998 b 22-27. 5 Vgl. Aristoteles, Met. III 4, 1001 a 9ff. 78491_Honnefelder.indd 21 17.02.16 14:19 22 „EINHEIT DER REALITÄT“ ODER „REALITÄT ALS EINHEIT“ der göttlichen Substanz.6 Das Erste kann das Allgemeinste sein, weil es das Höchste ist. „Seiendes“ ist der alles Seiende umfassende Begriff, weil das erste Seiende der Inbegriff der Seiendheit ist. Damit kann Aristoteles den Dualismus vermeiden und einen Zusammenhang zwischen den drei Fragen der Metaphysik herstellen: der Frage nach den ersten Gründen, nach den allgemeinsten Bestimmungen und nach dem zuhöchst Seienden. Doch ist der Preis unübersehbar: Ontologie ist nur möglich in Vermittlung durch Theologie, Theorie des Einheit begründenden Transzendentalen nur durch Vermittlung einer Theorie des Einheit begründenden Transzendenten. Eben damit aber scheint der Weg, ‚Seiendes‘ als die Einheit des Vielen und damit Metaphysik als Frage nach der Welt im Ganzen zu begreifen, ebenso früh zu scheitern, wie er begonnen hat. Als Theorie des Transzendentalen scheitert er an der Logik der Prädikation, nämlich an Äquivokation oder Leere, als Theorie des Transzendenten an der Kritik der Erkenntnis, nämlich am Überschwang der Inanspruchnahme eines erfahrungstranszendenten ersten Seienden, sei es die sinnlich nicht erfahrbare Substanz, sei es ein welttranszendentes göttliches Seiendes oder ein transempirisches Selbstbewußtsein. Für die Frage nach Einheit und Vielheit scheint dann aber nur mehr der Weg offen zu sein, die beiden Begriffe als Bezugsgrößen eines kategorialen Strukturganzen zu betrachten, das seine „ontologische Festlegung“7 durch die Wahl seiner Prämissen selbst bestimmt und damit beliebig macht. Alles andere droht in den Verdacht zu geraten, Gestalt jener begrifflichen Totalität zu sein, deren „Leere“, „Scheinhaftigkeit“ oder „Sinnlosigkeit“ von Hegel bis zu Adorno und Carnap kritisiert worden ist,8 die für Wittgenstein eine Antwort darstellt, zu der die Frage nicht gestellt werden kann,9 und die die Autoren der Postmoderne allein durch die Obsession von der Totalität zu erklären vermögen, von der erst die Grundlagenkrisen des 20. Jahrhunderts die neuzeitliche philosophische Vernunft allmählich zu heilen beginnen.10 „Aber damit wird Heraklit“ – schreibt Nietzsche – „ewig recht behalten, daß das Sein eine leere Fiktion ist. Die „scheinbare“ Welt ist die einzige: die „wahre Welt“ ist nur hinzugelogen …“11 Daß Nietzsche die Rede von der Welt beibehalten muß, um deren Deutung zu kritisieren, und zudem gezwungen ist, jene Differenz zwischen wahr und falsch zu unterstellen, die Parmenides zur Verbindung von ἕν und ὄv veranlaßt, zeigt, daß 6 Vgl. etwa Aristoteles, Met. IV 1-2, 1003 a 21ff.; VI 1, 1026 a 30. Zur Differenz und zum Zusammenhang zwischen ganzheitstheoretischer und reihentheoretischer Betrachtung vgl. Met. XII 1, 1069 a 19ff.; dazu K. Gloy, Die Substanz ist als Subjekt zu bestimmen. Eine Interpretation des XII. Buches von Aristoteles’ Metaphysik, in: ZphF 37 (1983) 515-519. 7 Vgl. weiter unten Anm. 38 u. 39. 8 Vgl. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, 1. Teil, 1. Buch, 1. Abschn., 1. Kap.; Th. W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt 1966, 15; R. Carnap, Der logische Aufbau der Welt. Scheinprobleme in der Philosophie, Hamburg 1961. 9 Vgl. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 6.44-6.5. 10 Vgl. den Überblick bei W. Welsch, Philosophie zwischen Weisheit und Wissenschaft. Die aktuelle Balance, in: W. Oelmüller (Hrsg.), Philosophie und Wissenschaft, Paderborn 1988, 115-126. 11 F. Nietzsche, Götzendämmerung, in: Sämtl. Werke, hg. v. G. Colli / M. Montinari, Bd. 6, 75. 78491_Honnefelder.indd 22 17.02.16 14:19 „EINHEIT DER REALITÄT“ ODER „REALITÄT ALS EINHEIT“ 23 die ontologische Frage nach der Einheit von der Kritisierbarkeit bestimmter Antworten unabhängig ist und offensichtlich so lange als universales Thema diskutiert werden muß, als an der Differenz von Einheit und Vielheit, von Totalität und Totalisierung festgehalten werden soll. Der Ansatz dazu kann nur – wie an drei Modellen zu zeigen ist – in jener formalen Struktur der Prädikation liegen, auf die sich schon Aristoteles bezieht und die auch in der transzendentalphilosophischen und der universal-semantischen Deutung ihre ursprüngliche ontologische Bedeutung nicht verliert. I. Die ontologische Deutung der Einheit: Der transkategoriale Begriff des Seienden Das erste Modell ist die ganzheitstheoretische Deutung der Einheit, die Aristoteles konzipiert, aber erst Johannes Duns Scotus ausgearbeitet hat und die von F. Suárez und Chr. Wolff fortgeführt worden ist.12 Sie geht davon aus, daß die ontologische Deutung unverzichtbar ist, soll an der Einheit unseres Erkennens von Welt festgehalten werden können. Ich darf mich zur Erläuterung auf einige wenige Punkte beschränken: 1. Auch wenn das erste ausgezeichnet Seiende unmittelbarer oder mittelbarer Gegenstand unserer Erkenntnis wäre, so wird argumentiert, könnte der Zusammenhang mit dem ihm folgenden Vielen, auf den sich die reihentheoretische Deutung der Einheit stützt, nicht gedacht werden, ohne „Seiend“ (ens) als ein dem ersten, wie den ihm folgenden Gliedern gemeinsames Prädikat zu unterstellen.13 Denn selbst kontradiktorische Extreme einer Relation wie das Eine und das Viele oder das Identische und das Verschiedene oder ursprünglich verschiedene Extreme wie Gott und Geschöpf setzen ein gemeinsames Minimalmoment voraus, sollen sie als Relate überhaupt aufeinander beziehbar sein. Die Alternative wäre eine Heterogenität des Vielen, die nicht einmal die Rede von „Vielem“ erlaubt. Bezeichnenderweise kommt deshalb auch Aristoteles selbst, so der Hinweis bei Scotus, nicht umhin, bei dem Argument, die von der Gattung ausgeschlossene Differenz könne doch nicht nichts sein, von jener Gemeinsamkeit von „Seiend“ Gebrauch zu machen, die er mit eben diesem Argument bestreitet. 12 Vgl. dazu ausführlicher L. Honnefelder, Ens inquantum ens. Der Begriff des Seienden als solchen als Gegenstand der Metaphysik nach der Lehre des Johannes Duns Scotus, Münster 1979; ders., Scientia transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus – Suárez – Wolff – Kant – Peirce), Hamburg 1990. 13 Vgl. zum gesamten Zusammenhang I. Duns Scotus, Ord. I d. 3 p. l q. 3 nn. 152-166, ed. Vat. III 94-103; d. 8 p. l q. 3 nn. 27-156, ed. Vat. IV 164-229; dazu L. Honnefelder, Ens inquantum ens (Anm. 12) 343-395. 78491_Honnefelder.indd 23 17.02.16 14:19 24 „EINHEIT DER REALITÄT“ ODER „REALITÄT ALS EINHEIT“ 2. Hat aber „Seiend“ eine über die Gattungsallgemeinheit hinausgehende „übergroße Gemeinsamkeit“14, dann muß zwar die inkriminierte Deutung des Gattungsallgemeinen aufgegeben, der Charakter eines gemeinsamen Prädikats aber festgehalten werden. Wie an der transgenerischen Prädizierbarkeit deutlich wird, ist freilich das Prädikat, um das es sich hier handelt, völlig eigener Art. Weil „Seiend“ die Sache an ihr selbst betrifft, jedoch nur die „realitas“, nicht deren je bestimmten inneren Modus erfaßt, nennt Scotus seinen Begriff „real“, aber „unvollkommen“.15 Seine distinkte Bedeutung lässt sich nur im Rückstieg in die Voraussetzungen unseres Begreifens und Prädizierens kenntlich machen. Unterzieht man nämlich die Prädikate, durch die wir die Gegenstände unserer Welterfahrung in ihrem näheren Was bestimmen, einer Analyse der Gehalte, so erweist sich „Seiend“ als das stets mitausgesagte Prädikat, ja als die Bestimmung, die als die grundlegende „erste“ in jedem bestimmteren washeitlichen Prädikat enthalten ist und deshalb von schlechthin allem aussagbar ist, das überhaupt durch Prädikate bestimmt werden kann.16 Als solches besitzt es, wie Heidegger in seiner Scotus-Interpretation formuliert, „Letztheitscharakter“17: Denn alles, was durch kategoriale Prädikate erfaßbar ist, wird, sofern es erfaßt wird, als „Seiendes“ erfaßt; „Seiendes“ selbst kann aber nicht noch einmal „als ein …“ erfaßt werden. Es meint jene „erste“, „schlechthin einfache“, „immer schon bekannte“, „durch nichts Bekannteres zu erläuternde“, alle inhaltlich-kategorialen Bestimmungen „übersteigende“ (transcendens) rein formale Bestimmtheit, ein durch Prädikate bestimmbares Was überhaupt bzw. ein an einem solchen Was auftretendes reines quale zu sein.18 Als diese Bestimmtheit aller inhaltlichen Bestimmungen ist sie inhaltlich zwar notwendig unbestimmt und leer, formal aber die „bestimmte Bestimmtheit“19, in der die Vielheit und Verschiedenheit des prädikativen „Ist“ ihre Einheit besitzt. 3. Da wir die letzte formale Bestimmtheit nur über die begrifflichen Bestimmungen ermitteln können, in denen sie mitausgesagt wird, und diese begrifflichen Bestimmungen dem Schema von bestimmbarem und bestimmenden Moment folgen, verwundert es nicht, daß sich „Seiend“ für uns in einer aufeinander verwiesenen Zweiheit zeigt, nämlich als ein letztes rein bestimmbares quid und als ein an diesem quid ansetzendes und von ihm aussagbares rein bestimmendes quale.20 In dieser Differenz liegt der Anhaltspunkt für den Gattungseinwand. Bei näherem Zusehen aber zeigt sich, daß die doppelte Prädikationsweise „in quid“ und „in quale“, in der „Seiend“ sich als die erste grundlegende Bestimmtheit erweist, die Einheit des Sinns von „Seiend“ nicht nur nicht aufhebt, sondern im Gegenteil voraussetzt. 14 Vgl. I. Duns Scotus, Ord. I d. 3 p. l q. 3 n. 158, ed. Vat. III 95ff. 15 Vgl. I. Duns Scotus, Ord. I d. 8 p. l q. 3 nn. 138-150, ed. Vat. IV 222-227, Lect. I d. 8 p. l q. 3 n. 129, ed. Vat. XVII 46f. 16 Vgl. I. Duns Scotus, Ord. I d. 3 p. l q. 1-2 nn. 71-94, ed. Vat. III 49-61; dazu L. Honnefelder, Ens inquantum ens (Anm. 12) 146-168. 17 M. Heidegger, Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus (1916) (= Gesamtausgabe, I. Abt., Bd. 1), Frankfurt 1978, 26 (216). 18 Vgl. Anm. 16. 19 M. Heidegger, Die Kategorien- und Bedeutungslehre (Anm. 17) 24 (214f.). 20 Vgl. I. Duns Scotus, Ord. I d. 3 p. l q. 3 nn. 129-151, ed. Vat. III 80-94; dazu L. Honnefelder, Ens inquantum ens (Anm. 12) 313-343. 78491_Honnefelder.indd 24 17.02.16 14:19