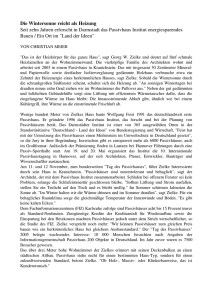Geld sparen mit dem Kuhstalleffekt
Werbung

Passivhäuser nutzen interne Wärmequellen zum Heizen Geld sparen mit dem Kuhstalleffekt Die erste Fabrik in Deutschland, die in Passivbauweise errichtet ist, beherbergt ein ChemieUnternehmen. Im Vergleich zu konventionell gebauten Produktionsstätten sind die Heizkosten auf ein Zehntel gesunken. Ein Eisbär braucht keine Heizung. Durch sein dichtes Fell kann die Körperwärme kaum entweichen. Das polare Raubtier fühlt sich wohlig warm auch bei -40 °C Umgebungstemperatur. Den gleichen Effekt nutzen auch Passivhäuser. Exzellente Dämmung minimiert die Wärmeverluste derart, dass die maximale Heizlast weniger als 10 W/m2 beträgt. Zum Vergleich: Die meisten Bestandsgebäude haben maximale Heizlasten von 100 W/m2. Mit anderen Worten: Die Heizkosten reduzieren sich auf ein Zehntel. Interne Wärmequellen, wie Glühbirnen, Waschmaschinen oder Menschen, reichen oft aus, um auf angenehme Temperaturen zu kommen, vergleichbar dem bekannten Kuhstalleffekt. Eine klassische Heizung mit aufwendiger Verrohrung und Heizkörpern ist überflüssig. Zwingend erforderlich ist hingegen das Lüftungssystem. Denn die Gebäudehülle eines Passivhauses muss luftdicht sein, damit keine Wärmebrücken entstehen. Die Feuchtigkeit im Gebäude wird deshalb über Lüftungskanäle abgeführt, gleichzeitig wird ständig Frischluft von außen angesaugt und dem Haus zugeführt. Beide Luftströme werden in Wärmetauschern in Kanälen aus wärmeleitendem Blech aneinander vorbeigeführt: Die warme, abströmende Luft erwärmt die einströmende Frischluft. 80 % der abströmenden Wärme bleibt so erhalten. Wärmetauscher können auch in umgekehrter Richtung zum Kühlen eingesetzt werden. Klimaanlagen sind in Passivhäusern unbekannt. Einen Umluftbetrieb gibt es nicht, ebenso wenig eine Luftbefeuchtung. Damit entfallen die sonst üblichen hygienischen Probleme von Lüftungsanlagen. Ganz im Gegenteil sorgt der ständige Luftaustausch dafür, dass etwa Staubpartikel durch den Luftstrom ins Freie oder in die Filter befördert werden. Dies reduziert auch Reinigungskosten. Wenn die Leistung der Wärmetauscher nicht ausreicht, wird die Luft durch mit Wasser gefüllte Kupferrohrspiralen, so genannte Register, in den Luftkanälen gekühlt oder geheizt. So weit, so genial. Bisher gibt es aber nur wenige Passivhäuser in Deutschland, die meisten sind Wohnhäuser. Teilweise höhere Investitionskosten und technische Probleme bei der Umsetzung der sehr hohen Qualitätsanforderungen halten die Euphorie noch in Grenzen. Produktionsbetriebe in Passivbauweise sind weltweit die absolute Ausnahme, weil der geforderte Luftaustausch und die oft notwendige Temperaturzonierung nur schwer mit den energetischen Forderungen eines Passivhauses unter einen Hut zu bringen sind. Die Bundesregierung fördert deshalb die Planung und die wissenschaftliche Begleitung von Neubauten, deren jährlicher Gesamtenergiebedarf einschließlich Strom unter 70 kWh/m2 liegen soll. Eines dieser Objekte ist der Neubau des Chemie-Unternehmens SurTec GmbH in Zwingenberg. Die Mehrkosten für den Passivhausstandard amortisieren sich infolge reduzierter Gaskosten nach weniger als drei Jahren, freut sich SurTecGeschäftsführerin Patricia Preikschat. Drei vormals getrennte Standorte wurden aufgelöst und im neuen Objekt zusammengefasst. Der Darmstädter Architekt Martin Zimmer musste Produktion, Lager und Büro auf einer kleinen Fläche unterbringen und entsprechend kompakt bauen. Mit seinem günstigen Verhältnis von viel Nutzund wenig Außenfläche schien das Gebäude für die energetische Optimierung im Sinne eines Passivhauses gut geeignet. Zimmer begeisterte die Bauherrin für die Passivhaus-Idee und beantragte die Förderung. Ein Vergleich der Investitionskosten zwischen Passivhäusern und Niedrigenergiehäusern ist eigentlich nicht möglich. Äpfel, Birnen und der Mathelehrer lassen grüßen. Würde man einen vorhandenen, konventionellen Neubau nochmal in der gleichen Architektur als Passivhaus bauen, so wären die Kosten wohl deutlich höher. Passivhäuser werden aber in aller Regel anders geplant und gebaut. Eines der Ziele besteht darin, das Verhältnis von Nutz- und Außenfläche zu optimieren. Die Bauleitung muss besonders gewissenhaft und genau arbeiten, weil selbst kleine Schlampereien an den kritischen Anschlüssen das Konzept zerstören können. Die hohe Qualität, die ein Passivhaus per se haben muss, führt später zu geringeren Instandhaltungskosten. Die dreifachverglasten Fenster kosten etwa doppelt so viel wie die sonst üblichen doppelt verglasten. Auch die gedämmten Fensterrahmen übersteigen die Kosten eines konventionellen Rahmens. Extrem niedrige Heizkosten gleichen diese Investitionen aber nach einigen Jahren wieder aus. Auch die fehlenden Installationskosten für Heizung und Klimaanlage kann das Passivhaus auf der Haben-Seite verbuchen. Gerade bei Industrie- und Bürogebäuden ist das Einsparpotenzial groß, betont Sören Peper, Projektbetreuer beim Darmstädter Passivhaus-Institut. Er hat das SurTec-Projekt wissenschaftlich begleitet. Zum einen sind Lüftungsanlagen die wir für ein Passivhaus zwingend brauchen in den meisten Fällen ohnehin vorgeschrieben. Zum anderen verfügen Fabriken über größere interne Wärmequellen, etwa durch die Abwärme der Maschinen. Die Nutzung dieser Wärme ist jedoch echte Pionierarbeit. Der SurTec-Neubau ist nicht von ungefähr ein Pilotprojekt, von dem sich die Förderer Erkenntnisse für den Massenmarkt erhoffen. Wie funktioniert das Energiekonzept im Detail? Die angesaugte Luft wird in 3,5 m Tiefe durch 60 m lange Betonrohre mit einem Durchmesser von 60 cm geführt. Diese Erdwärmetauscher erwärmen die Luft im Winter und kühlen sie im Sommer. Bei einer Außentemperatur von -10 °C erwärmt sich die Luft bis zum Haus auf +1 °C. Der Verlust an elektrischer Energie für die Ventilatoren wird durch den Gewinn an Wärmeenergie deutlich überkompensiert. Die Ingenieure haben das Volumen der Erdwärmetauscher bei SurTec jedoch etwas zu gering ausgelegt. Die eigentlich geforderte Frostfreiheit der Luft ist deshalb ab -11 °C Außentemperatur nicht mehr gewährleistet. Im Hochsommer reicht dieses System wiederum zur Kühlung nicht aus. Die Wärme tritt eben nicht immer genau zu dem Zeitpunkt und an der Stelle auf, wo man sie gerne hätte, erklärt Peper. In den Rührbehältern der SurTec-Produktion etwa finden exotherme Reaktionen mit einer Temperatur von etwa 60 °C statt. Solche Informationen berücksichtigen Architekt und Haustechniker bei der Konzeption der Heizung und der Dämmung, sagt der Wissenschaftler. Beide müssen von Anfang an eng zusammenarbeiten. Dabei ist Einfallsreichtum gefragt. So reduziert das System bei SurTec die Abwassermenge, indem es belastetes Abwasser eindampft. Die freiwerdende Wärme wird über ein Heizregister der Zuluft zugeführt und so genutzt. Oder sie wird gespeichert. Dazu führt der Kreislauf des Heiz- und Kühlsystems durch den Löschwassertank, der als riesiger Puffer fungiert. Das System gibt nach Bedarf Wärme an diesen Speicher ab oder entzieht sie ihm wieder. Genutzt wird das etwa, um das Endprodukt der chemischen Reaktion schnell abzukühlen und dann abfüllen zu können. Hierfür pumpt das System kaltes Wasser aus dem Löschwasserspeicher in die Kühlung der Rührbehälter. Haus- und Produktionstechnik greifen quasi symbiotisch ineinander. Die Planer haben auch die unterschiedlichen Temperaturbedarfe von Lager, Produktion und Büros berücksichtigt, indem sie die Wärmeabstrahlung der nichtgedämmten Innenwände bei der Auslegung der Luftheizung einkalkuliert haben. Die für Chemieproduktionshallen vorgeschriebenen fünf bis acht Luftwechsel pro Stunde waren das Hauptproblem der Planer. Der Anteil an Fremdwärme, um die Temperatur aufrecht zu erhalten, wäre für ein Passivhaus zu groß gewesen. Als Lösung wurde eine Quellabsaugung gewählt, die nur an den Stellen absaugt, an denen die Emissionen auftreten. So gelang es, den Luftwechsel auf ein energetisch akzeptables Maß zu reduzieren. SurTec spart mit dem Passivhaus nicht nur Energie. Die Firma baut auch ein Image als umweltbewusstes Chemieunternehmen auf. Das Projekt Passivhaus hat uns unschätzbare PR-Vorteile gebracht, berichtet die Geschäftsführerin. Alle Parteien im Ort haben der Bau- und Betriebsgenehmigung zugestimmt. Wir genießen große Akzeptanz bei den Nachbarn für einen Chemiebetrieb nicht selbstverständlich. Die Lokalpresse berichtet oft und positiv über das Gebäude. Sven Hardt ist freier Journalist in Neuenhagen bei Berlin Heft: Industrieanzeiger Jahr: 2002 Ausgabe: 024 Seite: 40