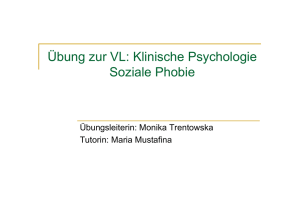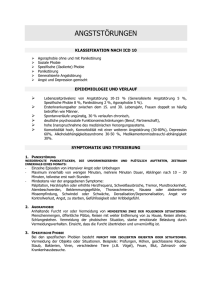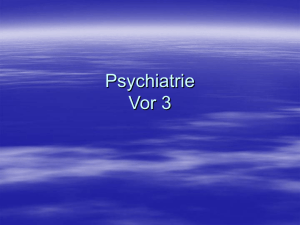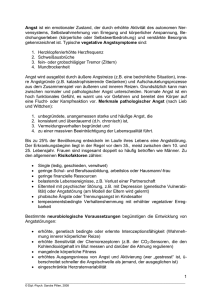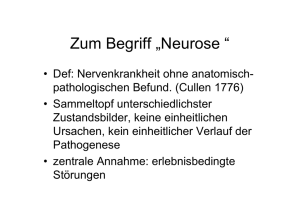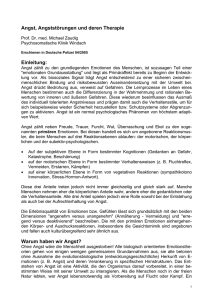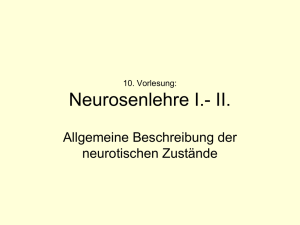Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES
Werbung

Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Emmelkamp, P.; Bouman, T. & Scholing, A. (1993) Angst, Phobien und Zwang 1 1. Phänomenologie 1.1 Was sind Angststörungen Wenn Menschen mit Angststörungen geholfen werden soll, muss zuerst eine Problemanalyse durchgeführt werden: Worin bestehen die Beschwerden, wovor hat jemand Angst, was erlebt, denkt und tut jemand mit Angst? Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Versuche unternommen, Ordnung zu schaffen in der oft unklaren Namensgebung dieser Erscheinungen. Das führte zur Aufstellung von diagnostischen Kriterien. Zur Zeit wird am meisten Gebrauch gemacht vom DSM-IV der American Psychiatric Association (1994) (Anmerkung: Die Autoren des Buches gehen noch vom DSM-III-R aus. In der Zusammenfassung werden ihre Angaben durch die aktuellen des DSM-IV ersetzt). Die Autoren des DSM-IV gehen dabei von einer atheoretischen Zugangsweise aus, in der manifeste Symptome als Kriterien aufgenommen werden. Ausgangspunkt ist eine multiaxiale Betrachtungsweise: 1. Achse I: Klinische Störungen andere klinisch relevante Probleme 2. Achse II: Persönlichkeitsstörungen geistige Behinderung 3. Achse III: Medizinische Krankheitsfaktoren 4. Achse IV: Psychosoziale oder umgebungsbedingte Probleme 5. Achse V: Globale Beurteilung des Funktionsniveaus Folgende Überlegungen zum DSM-IV müssen berücksichtigt werden: Es geht darum, Störungen einzuteilen, nicht primär Personen Die einzelnen Störungen und so auch Angst können oft nicht so kategorisch von anderen Störungen abgegrenzt werden, wie durch dieses Klassifikationssystem vermittelt wird. Angststörungen werden zur Achse I gezählt und werden folgerndermassen unterteilt: • Panikattacke • Agoraphobie • Panikstörung mit Agoraphobie • Agoraphobie ohne Panikstörung in der Vorgeschichte • Spezifische Phobie • Soziale Phobie • Zwangsstörung • Posttraumatische Belastungsstörung • Akute Belastungsstörung • Generalisierte Angststörung • Angststörung aufgrund eines medizinischen Krankheitsfaktors • Substanzinduzierte Angststörung • Nicht näher bezeichnete Angststörung In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels wird für jede Angststörung eine Übersicht der diagnostischen Kriterien des DSM-IV gegeben. Zusätzlich wird das klinische Bild besprochen. Die Falldarstellungen, durch die im Buch jeweils noch ergänzt wird, nehme ich in der Zusammenfassung nicht auf. 2 1.2 Panikstörung DSM-IV Kriterien: Das zentrale Kennzeichen der Panikstörung ist der Panikanfall, d.h. eine besondere Periode von intensiver Angst und Spannung, die oft unerwartet auftritt. In der Rubrik „Angststörungen“ des DSM-III-R bzw. –IV nimmt die Panikattacke einen wichtigen Platz ein. Im DSM-IV wird sie sogar gesondert aufgeführt und besprochen. Im DSMIV werden folgende Kriterien genannt für eine Panikattacke (mind. 4 müssen erfüllt sein): 1. Palpitationen, Herzklopfen oder beschleunigter Herzschlag 2. Schwitzen 3. Zittern oder Beben 4. Gefühl der Kurzatmigkeit oder Atemnot 5. Erstickungsgefühle 6. Schmerzen oder Beklemmungsgefühle in der Brust 7. Übelkeit oder Magen-Darm-Beschwerden 8. Schwindel, Unsicherheit, Benommenheit oder der Ohnmacht nahe sein 9. Derealisation und Depersonalisation 10. Angst, die Kontrolle zu verlieren oder verrückt zu werden 11. Angst zu sterben 12. Parästhesien (Taubheit oder Kribbelgefühle) 13. Hitzewallungen oder Kälteschauer Bei der Panikstörung wird zwischen solcher ohne bzw. mit Agoraphobie unterschieden (s. nächster Abschnitt). Klinisches Bild: • Typisch ist die unerwartete Art des Panikanfalls (spontaner Anfall) • Körperliche Symptome des Panikanfalls sind ähnlich derer, die bei Hyperventilation auftreten. Hyperventilation: Durch verstärktes Atemholen wird mehr O2 im Körper aufgenommen als nötig wäre. Dadurch wird mehr CO2 ausgestoßen als gewöhnlich. Nun sinkt der CO2-Gehalt im Blut und der pHWert steigt an. Wegen dieser Respiratorischen Alkalose können nun körperliche Beschwerden eintreten, die als Hyperventilationssyndrom bezeichnet werden: Atembeschwerden Parästhesien Neuromuskuläre Beschwerden Zerebrovaskuläre Beschwerden (Schwindel, unscharfes Sehen,…) Kardinale Beschwerden Temperaturempfindungen Gastrointestinale Beschwerden Psychische Beschwerden Müdigkeit und Schwächegefühl So kann Hyperventilation als körperliche Komponente eines Panikanfalls beschrieben werden. Als psychologische Komponente des Panikanfalls wird das akute und intensive Erleben von Angst angesehen. Diese Angst ist verantwortlich für das Fluchtverhalten, das zum Ziel hat, den Anfall zu beenden, was erst nach einiger Zeit gelingt. 3 Kognitionen von Angstpatienten haben oft den Charakter von Antizipationen gefürchteter Situationen (Antizipationsangst). Dadurch entsteht an sich bereits eine erhöhte Aktivierung, noch bevor der Betroffene sich wirklich in die Situation begibt. Menschen mit Panikattacken befürchten irgendwie die Kontrolle über einen Teil ihres Funktionierens zu verlieren. Hier können 4 Themen unterschieden werden: Die Angst vor somatischem, psychischem, verhaltensmässigem und sozialem Kontrollverlust: 1. somatischer Kontrollverlust: Angst vor einem Herzinfarkt, einer Hirnblutung oder einer Ohnmacht, oder allgemein Angst davor, dass sie der Körper im Stich lässt. 2. psychischer Kontrollverlust: Die Angst ist zentriert auf die als wahrscheinlich erlebte Möglichkeit, verrückt zu werden. 3. Verhaltensmässiger Kontrollverlust: Es wird eine totale Enthemmung befürchtet, wie z.B. mit etwas werfen, kreischen und schreien. 4. Sozialer Kontrollverlust: Manche schämen sich für die vermeintlichen Hinweise auf die zugenommene Aktivierung, wie z.B. Zittern, Weglaufen wollen, ohnmächtig werden und wie andere darauf reagieren. Bei einem Erstgespräch ist es sehr wichtig einen Eindruck darüber zu erhalten, wie der Patient einen Kontrollverlust erlebt. Viele Patienten mit Panikanfällen beginnen sehr rasch nach ihrem ersten Panikanfall die Situationen oder Aktivitäten zu vermeiden, von denen sie denken, dass diese einen Panikanfall auslösen könnten. Extremes Vermeidungsverhalten kann bewirken, dass jemand keine Panikanfälle mehr hat aber z.B. seine Wohnung nicht mehr verlässt. Die Diagnose „Panikstörung mit Agoraphobie“ wird gestellt, wenn die Beschwerden den Kriterien der Panikstörung und denen der Agoraphobie entsprechen. Garssen et al. (1983) konnten bei 60% der Agoraphobikern Hyperventilationsbeschwerden nachweisen, die allerdings teilweise nur sehr selten auftreten. Turner et al. (1986) suggerieren einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Panikstörung und Agoraphobie: agoraphobische Symptome entwickeln sich später und als Funktion des Panikanfalls. Damit wird Panik als Vorstadium der Agoraphobie aufgefasst. Thyer und Himle (1985) hingegen sehen Agoraphobie als sekundäre Manifestation von Panik. Für Williams (1985) widerspricht die Tatsache, dass agoraphobisches Verhalten auch in langen Perioden, in denen keine Panikanfälle auftreten, aufrechterhalten bleibt, gegen das Argument, dass Panik die primäre Ursache von agoraphobischer Vermeidung sei. Differentielle Diagnostik: Die Panikstörung muss u.a. unterschieden werden von: 1. generalisierter Angststörung 2. Hypochondrie 3. sozialer Phobie 4. organische Ursachen von Aktivierungserhöhungen (z.B. substanzinduziert) Die generalisierte Angststörung ist gekennzeichnet von einer umfangreichen Aktivierungserhöhung, die sich über eine Vielfalt von Situationen erstreckt. Bei der Panikstörung ist die Krankheitsüberzeugung hauptsächlich beschränkt auf die Periode der Anfälle selbst. Dazwischen ist der Patient im Stande, seine Besorgtheit zu relativieren, was bei hypochondrischem Verhalten nicht der Fall ist. 4 Organische Ursachen der Aktivierungserhöhung müssen ausgeschlossen werden. Unmäßiger Konsum oder Missbrauch von bestimmten Substanzen (z.B. Kaffee) führt zu Symptomen wie Rastlosigkeit, Nervosität und beschleunigtem Herzschlag, ebenso wie Entzugserscheinungen oder ein Kater nach Alkoholkonsum zu Symptomen wie Angst, autonomer Hyperaktivität wie z.B. Herzklopfen, Schwitzen und erhöhter Blutdruck. Auch der Reboundeffekt (s. Kapitel 2) von Tranquillizern darf nicht unerwähnt bleiben. 1.3 Agoraphobie DSM-IV Kriterien: Im neuen DSM-IV wird im Gegensatz zum DSM-III-R die Agoraphobie einzeln auch noch beschrieben, allerdings nicht als kodierbare Störung. Es wird weiter unterschieden zwischen (wie schon bei DSM-III-R) Panikstörung mit Agoraphobie und Agoraphobie ohne Panikstörung in der Vorgeschichte. Dieser Unterschied bezieht sich vor allem auf die Ursachen, warum jemand Situationen vermeidet. Bei der Agoraphobie mit Panikattacken wird die Angst beschrieben, sich auf Plätzen oder in Situationen zu befinden, aus denen man schwierig flüchten kann, oder wo im Fall einer Panikattacke nur schwer Hilfe verfügbar wäre. Bei Agoraphobie ohne Panikstörung geht es dagegen um die Angst vor plötzlich auftretenden Symptomen, die jemanden in Verlegenheit bringen oder hilfsbedürftig machen können (z.B. Verlust der Blasen- oder Darmkontrolle). Bei beiden Störungsbildern treten Verhaltensveränderungen auf (Einschränkung des Handlungsraumes, Verzicht auf größere Reisen etc.). Klinisches Bild: Das Vermeidungsverhalten ist eines der auffälligsten Merkmale der Agoraphobie. Dabei können ganz unterschiedliche Situationen gemieden werden, nicht nur wie oft angenommen wird weite Plätze. Das zentrale Thema ist meistens das „nicht weglaufen können“. Der Wunsch schnell wegkommen zu können bewirkt, dass manche Leute entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen (Auto, Fahrrad mitnehmen). Viele Autoren haben argumentiert, dass Agoraphobie vor allem eine Angst vor der Angst ist und nicht unbedingt vor bestimmten Orten. 95% der Agoraphobiker sind viel ängstlicher, wenn sie alleine unterwegs sind. Es kann sogar soweit kommen, dass sie in Begleitung von einer (bestimmten) Person in allen Situationen gehen, die sie alleine vermeiden würden. Einige hingegen berichten genau das Gegenteil: sie fühlen sich noch am sichersten alleine und sind ängstlicher in Begleitung. Darin ist der Unterschied, zwischen einem befürchteten Kontrollverlust somatischer Art bzw. sozialer Art zu finden. Differentielle Diagnostik: Vermeidung von Situationen kann andere Ursachen haben als eine Agoraphobie. Die Agoraphobie muss deshalb von folgenden Störungen unterschieden werden: Depression: Wegen Apathie&Energieverlust verlässt Person das Haus nicht mehr. Soziale Phobie: Personen vermeiden soziale oder Leistungssituationen, in denen sie Angst haben, sie könnten sich beschämend verhalten. Spezifische Phobie: Eine Person vermeidet bestimmte Objekte oder Situationen. Wahnhafte Störung: Wegen Verfolgungsängsten wird das Haus nicht verlassen. Zwangsstörung: Angst vor Kontamination kann zu Vermeidungsverhalten führen. Realistische Befürchtungen: Aufgrund tatsächlicher medizinischer Krankheitsfaktoren werden Situationen vermieden (z.B. Allergie). 5 1.4 Soziale Phobie DSM-IV Kriterien: Soziale Phobie wird umschrieben als eine anhaltende und hartnäckige Angst vor einer oder mehreren Situationen, in der die betroffene Person einer möglichen kritischen Beurteilung durch andere ausgesetzt ist (soziale oder Leistungssituationen), und in der sie Angst hat, sich lächerlich zu machen. Befindet sich eine Person in der gefürchteten Situation, löst dies fast immer eine Angstreaktion aus. Meistens werden deshalb diese Situationen vermieden oder können nur mit sehr viel Angst durchgestanden werden. Klinisches Bild: Merkmale, die häufig mit Sozialer Phobie einhergehen sind: Überempfindlichkeit gegenüber Kritik, negativer Bewertung oder Ablehnung Schwierigkeiten, sich selber zu behaupten Geringes Selbstbewusstsein Minderwertigkeitsgefühle Mangelnde soziale Fertigkeiten Beobachtbare Zeichen von Angst Wegen Prüfungsangst schlechteres Abscheiden an Prüfungen Vermeidung der aktiven Teilnahme am Unterricht Kleines soziales Netz In Extremfällen verlassen Sozialphobiker die Schule früher, sind eher arbeitslos, hängen an unbefriedigenden Beziehungen fest, verzichten auf Verabredungen und ziehen sich in ihre Herkunftsfamilie zurück. Über Vermeidungsverhalten sind nur wenige Forschungsergebnisse bekannt. Hingegen wurde die kognitive Komponente der sozialen Phobie untersucht. Zusammenfassend können folgende Punkte genannt werden: 1. Viel mehr negative Selbstbeschreibungen in sozialen Kontakten als Personen ohne soziale Angst 2. Übertrieben negative Evaluation des eigenen sozialen Verhaltens 3. Sehr hohe Anforderungen an das eigene Verhalten, im allgemeinen höher als an das Verhalten anderer (=>Perfektionismus) 4. Selektive Erinnerung: Angenehme oder positive Erinnerungen werden eher vergessen als unangenehme 5. Ursachen für guten Verlauf von sozialen Kontakten werden external attribuiert. Bei Untersuchungen wird immer wieder versucht bei der sozialen Phobie Subtypen zu definieren. Im DSM-IV werden solche Subtypen nicht erwähnt. Die einzige Zusatzdiagnose ist die „generalisierte soziale Phobie“. Damit ist gemeint, dass eine breite Skala von sozialen Situationen Angst auslösen kann. Die Autoren schlagen indes folgende Subtypen vor: 1. Erytrophobie (Angst vor Erröten) 2. Tremophobie (Angst vor Zittern) Die Autoren zeigen, dass viele Sozialphobiker (> andere Phobiker/Vergleichsgruppe) Alkoholprobleme aufweisen. Anfangs kann Alkohol ein vermehrtes Aufsuchen von vorher gemiedenen Situationen unterstützen. Erhöhter Alkoholkonsum verstärkt aber oft soziale Angst, da man sich schämt, getrunken zu haben. Differentielle Diagnostik: Hier ist vor allem die Abgrenzung der sozialen Phobie von den anderen Angststörungen und von der vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung schwierig. 6 1.5 Spezifische Phobie DSM-IV Kriterien: Die einfache oder spezifische Phobie wird gekennzeichnet als anhaltende und irrationale Angst vor einem bestimmten Objekt oder einer bestimmten Situation. Es besteht ein zwingendes Verlangen, das betreffende Objekt oder die Situation zu vermeiden. Wird der Betroffene mit der schwierigen Situation konfrontiert, erfolgt eine Angstreaktion. Der Betroffene sieht übrigens meistens ein, dass seine Angst überproportional und nicht gerechtfertigt ist. Klinisches Bild: Bei einer einfachen Phobie ist der gefürchtete Stimulus oft leicht zu vermeiden. Deshalb sind Patienten mit einer einfachen Phobie in den seltensten Fällen in Behandlung. Im DSM-IV werden folgenden Subtypen unterschieden: Tiertypus Umwelttypus (Höhen, Stürme, Wasser…) Blut-Spritzen-Verletzungstypus Situativer Typus (Flugzeuge, Fahrstühle…) Anderer Typus In der klinischen Praxis treten am häufigsten die Phobien vor bestimmten Tiersorten, vor kleinen geschlossenen Räumen, vor Höhe, vor Blut und ärztlichen Behandlungen, vor Unwetter und vor dem Essen von bestimmten Lebensmitteln auf. Bei der Tierphobie werden am häufigsten Spinnen, Mäuse, Katzen, Hunde und Pferde genannt, wobei vor allem die Bewegung des Tieres Angst auslöst. Sehen von Blut/Körperverletzungen löst bei vielen Menschen ein unangenehmes Gefühl aus, meistens Übelkeit. Eine echte Blutphobie aber kommt nur bei 2-3% der Population vor, womit dies allerdings eine der häufigsten Phobien bei Erwachsenen ist. Im Gegensatz zu anderen spezifischen Phobien kann bei Blutphobie eine Ohnmacht eintreten, da der Herzschlag nicht zunimmt, sondern sinkt. Differentielle Diagnostik: Die Diagnose einfache Phobie soll in Betracht gezogen werden, wenn die anderen Angststörungen ausgeschlossen worden sind. Schwierig ist vor allem die Abgrenzung von einer Agoraphobie mit Panikanfällen und der sozialen Phobie. Das Nicht-Berühren von bestimmten Gegenständen aus Angst vor Ansteckung fällt nicht unter die einfache Phobie, sondern unter Zwangsstörungen. 1.6 Zwangsstörung DSM-IV Kriterien: Bei der Zwangsstörung stehen Zwangsgedanken (obsessions) oder Zwangshandlungen (compulsions) im Mittelpunkt. Zwangsgedanken sind anhaltende Ideen, Gedanken, Impulse und Vorstellungen, die als aufdringlich und unangemessen wahrgenommen werden und ausgeprägte Angst oder Leiden verursachen. Zwangshandlungen sind sich wiederholende Verhaltensweisen, deren Ziel es ist, Wohlbefinden oder Befriedigung hervorzurufen. Beides wird von der betroffenen Person als nicht kontrollierbar erlebt, die Person sieht aber ein, dass die Zwangsgedanken und –handlungen ein Produkt ihres Geistes sind und ihr nicht von außen aufgezwungen werden. Ist wenig Einsicht vorhanden, kann die Zusatzkodierung „mit wenig Einsicht“ erwogen werden. Die Zwangsgedanken und –handlungen provozieren beträchtliche Schwierigkeiten und beanspruchen im Tagesablauf viel Zeit (mind. mehr als eine Stunde am Tag). 7 Klinisches Bild: Rituelle Zwangshandlungen und –gedanken hängen oft eng zusammen. Meistens gehen die Gedanken den Handlungen voraus, aber es kann auch umgekehrt sein. Die häufigsten Zwangsgedanken betreffen Angst vor Schmutz und Ansteckung. 25% der Patienten haben Gedanken über Gewalt oder dazu, jemandem etwas antun zu wollen. Häufige Zwangshandlungen sind zählen, putzen oder (Hände) waschen, kontrollieren und berühren. Putzzwang: wird meistens in Zusammenhang gebracht mit der Angst vor Ansteckung, gewaschen bzw. geputzt werden die Wohnung oder der Körper. Kontrollzwang: der Betroffene geht etliche Male zurück, um z.B. zu überprüfen, ob das Haus abgeschlossen, das Gas zugedreht etc. ist. Geht er nicht zurück, führt dies zu großer Anspannung, das Kontrollieren kann die Spannung reduzieren. Epidemiologie: Der Waschzwang wird häufiger bei Frauen diagnostiziert, der Kontrollzwang vorwiegend bei Männern. Die Situationen und Stimuli, die die Zwangshandlungen bzw. –gedanken auslösen können, werden häufig gemieden. Diese Komponente der Vermeidung wird als passiv bezeichnet, mit aktiver Vermeidung meint man hingegen die motorische Komponente der Zwangsstörung, wie kontrollieren und putzen. Differentielle Diagnose: Zur Abgrenzung von Agoraphobie: Der Unterschied zwischen einer Zwangsstörung und einer Agoraphobie liegt vor allem im Motiv für die Vermeidung von bestimmten Situationen. So haben Agoraphobiker Angst, einen Panikanfall zu bekommen, während die Zwangspatienten z.B. vor einer Ansteckung Angst haben. Sind Zwangsgedanken als Folge eines traumatischen Ereignisses zu sehen, spricht man eher von einer posttraumatischen Belastungsstörung als von einer Zwangsstörung. Bei einer Zwangsstörung kommt sekundär oft eine Depression vor. Verschwinden hingegen Zwangsgedanken, wenn die Depression vorbei ist, so muss eher die Diagnose Depression gestellt werden. Exzessive Besorgtheit um die eigene Gesundheit fällt unter die Diagnose Hypochondrie. Ticks unterscheiden sich von Zwangshandlungen darin, dass sie unwillkürlich auftreten. 1.7 Posttraumatische Belastungsstörungen DSM-IV Kriterien: Das traumatische Ereignis beinhaltet direktes persönliches Erleben oder Beobachten einer Situation, die mit dem Tod oder der Androhung des Todes, einer schweren Verletzung oder einer anderen Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit zu tun. Das traumatische Erlebnis wird hartnäckig wiedererlebt auf mind. eine folgende Art: 1. Wiederkehrende und eindringliche belastende Erinnerungen an das Ereignis, die Bilder, Gedanken oder Wahrnehmungen umfassen können. 2. Wiederkehrende, belastende Träume von dem Ereignis. 3. Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiederkehrt (Ereignis wiedererleben, Illusionen, Halluzinationen und dissoziative Flashback-Episoden, einschließlich solcher, die beim Aufwachen oder bei Intoxikation auftreten.) 4. Intensive psychische Belastung bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern. 8 Stimuli, die mit dem Trauma in Verbindung gebracht werden, werden vermieden. Drei der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein: 1. Bewusstes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen und Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen 2. Bewusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen 3. Unfähigkeit, einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern 4. Deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten 5. Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von anderen 6. Eingeschränkte Bandbreite des Affekts 7. Gefühl einer eingeschränkten Zukunft Von den folgenden Symptomen erhöhten Arousals müssen mindestens zwei vorliegen: 1. Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen 2. Reizbarkeit oder Wutausbrüche 3. Konzentrationsschwierigkeiten 4. Übermäßige Wachsamkeit (Vigilanz) 5. Übertriebene Schreckreaktion Das Störungsbild muss mindestens einen Monat vorliegen. Im DSM-IV werden zudem noch folgende Subkriterien katalogisiert: 1. Akut: Wenn die Symptome weniger als 3 Monate dauern 2. Chronisch: Wenn die Symptome mehr als 3 Monate dauern 3. Mit verzögertem Beginn: Der Beginn der Symptome erfolgt mindestens 6 Monate nach dem Belastungsfaktor Klinisches Bild: Bei vielen Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung treten vermehrt auf: 1. Schlafstörungen 2. Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenmissbrauch 3. Verstärktes Rauchen 4. Beschränkte Responsivität 5. Ein schweres Trauma kann sogar zu dissoziativen Störungen wie der multiplen Persönlichkeit führen 6. Depression 7. Selbstmordhandlungen und –gedanken 8. Phobische Ängste 9. Unerwartete aggressive Ausbrüche Im Allgemeinen muss jedoch festgehalten werden, dass diese Störung nicht sehr gut untersucht ist. Differentielle Diagnostik: Hier muss vor allem unterschieden werden zwischen einfachen Phobien, Zwangsverhalten und Agoraphobie. Depressive Störungen können als sekundäre Störungen auftreten. Bei Depressiven ist es daher oftmals sinnvoll nach tiefer liegenden Gründen für ihre Depression zu fragen. 9 Neu im DSM-IV: Akute Belastungsstörung (ICD: Belastungsreaktion) Im Gegensatz zum DSM-III-R wird im DSM-IV noch die akute Belastungsstörung aufgenommen. Das traumatische Ereignis muss auch selbst erlebt oder beobachtet worden sein (s. oben). Unterschiedlich zu den Kriterien der posttraumatischen Belastungsstörung sind die dissoziativen Symptome, die als Folge des extrem traumatischen Erlebnisses eintreten können, wobei auch drei davon erfüllt sein müssen: 1. Subjektives Gefühl von emotionaler Taubheit, von Losgelöstsein oder Fehlen emotionaler Reaktionsfähigkeit 2. Beeinträchtigung der bewussten Wahrnehmung der Umwelt 3. Derealisationserleben 4. Depersonalisationserleben 5. Dissoziative Amnesie Die Störung dauert mindestens 2 Tage und höchstens 4 Wochen (ansonsten ist es eine PTBS) und tritt innerhalb von 4 Wochen nach dem traumatischen Ereignis auf. 1.8 Generalisierte Angststörung DSM-IV Kriterien: Die Diagnose wird gestellt, wenn es um eine unrealistische oder außergewöhnliche Angst oder Besorgtheit bezüglich mehrerer Lebensbereiche geht (z.B. Unglücksfälle der Kinder, Geldangelegenheiten). Diese Sorgen dauern länger als sechs Monate und treten häufig auf. Die Angst muss mit mindestens drei der folgenden Symptome verbunden sein: 1. Ruhelosigkeit 2. Leichte Ermüdbarkeit 3. Konzentrationsschwierigkeiten Reizbarkeit 4. Muskelspannung 5. Schlafstörungen Zudem kann kein organischer Faktor festgestellt werden, der die Störung verursacht oder aufrechterhält. Klinisches Bild: Erhöhtes Arousal ist das deutlichste Merkmal dieser Störung. Andere Symptome sind: sich sorgen und grübeln über Dinge, die möglicherweise geschehen könnten, für deren Auftreten aber kein Grund vorhanden ist. Bei 64% der Patienten mit einer generalisierten Angststörung liegt eine phobische Vermeidung vor, die aber keinen spezifischen Fokus hatte wie bei einer einfachen Phobie oder der Agoraphobie. Häufig kann zudem ein übermäßiger Medikamentenkonsum, vor allem Tranquilizer, und bei 15% vermehrter Alkoholkonsum beobachtet werden. Differentielle Diagnostik: Die generalisierte Angststörung und die Panikstörung ähneln sich in gewisser Weise. Der Unterschied zwischen den beiden Störungsbildern besteht jedoch darin, dass die Angst bei der Panikstörung von einem drohenden neuen Anfall verursacht wird, während das bei der generalisierten Angststörung nicht der Fall ist. Bei Depression tritt ebenfalls eine verstärkte Neigung zum Grübeln auf. Der Inhalt ist jedoch eher düster als angstvoll gefärbt. 10 1.9 Schlusswort Schwierigkeiten bei der Verwendung von diagnostischen Kriterien: 1. Die Einordnung der Beschwerden verlangt vom Kliniker eine genaue Inventarisierung ihrer Art und Umstände, unter denen sie auftreten. 2. Die diagnostischen Kriterien sind relativ undeutlich und erhöhen deshalb die Schwierigkeit der Zuordnung. 2. Epidemiologie und Ätiologie von Angststörungen 2.1 Epidemiologie Bei Kindern: Angst, die nach dem 6. Lebensjahr entsteht, bleibt im Allgemeinen bis zur Adoleszenz bestehen. Bei Kindern sind echte Phobien wenig verbreitet (0.7%), wie Rutter et al. (1970) an einer Stichprobe von 2000 Kindern zwischen 10-11 Jahren feststellen konnten. Schulphobie gehört dabei zur wichtigsten phobischen Störung. In der Adoleszenz tritt vor allem soziale Angst häufig auf, und zwar bei Mädchen meistens einige Jahre früher als bei Jungen. Bei Erwachsenen: Die Lebenszeit-Prävalenz von Panikstörungen kann auf 2.3% und von Phobien auf 13% geschätzt werden. Phobien sind bei Frauen die häufigste psychopathologische Erkrankung, bei Männern die zweite nach Alkoholismus. Zudem scheint Agoraphobie häufiger aufzutreten als soziale Phobie. Das Durchschnittsalter beim ersten Auftreten einer sozialen Phobie beträgt zwischen 16-21 Jahre, bei der Agoraphobie tritt die erste Erkrankung zwischen dem 24.-32. Lebensjahr auf, bei der einfachen Phobie bereits zwischen 13-16 Jahren. Im Gegensatz zur Agoraphobie, die viel häufiger bei Frauen vorkommt, als bei Männern, scheint soziale Phobie bei beiden etwa gleichmässig aufzutreten. Sozialphobiker sind durchschnittlich besser ausgebildet als Agoraphobiker, gehören einer höheren sozialen Schicht an und haben weniger finanzielle Probleme. 2.2 Ätiologie der Angststörungen Nachfolgend werden zuerst einige Erklärungsmodelle dargestellt, dann wird spezifisch auf die Ätiologie der einfachen Phobie, Agoraphobie und Panikstörung, sozialen Phobie und Zwangsstörung eingegangen. 2.2.1 Lerntheoretisches Modell Die lerntheoretische Auffassung über die Entstehung von Phobien und Zwang beruht auf Mower´s Zwei-Faktoren-Theorie von Angst und Vermeidung. Dabei ist die klassische Konditionierung für das Lernen von Angst, die operante Konditionierung für das Lernen von Vermeidungsverhalten verantwortlich. Die Erlernung von Phobien durch klassische Konditionierung wurde in verschiedenen Experimenten bewiesen. Ein klassisches und oft zitiertes ist das Experiment von Watson und Rayner (1920), die den kleinen Albert auf eine Ratte klassisch konditionierten mit Hilfe eines aversiven Tons. Allerdings erinnern sich nicht alle Phobiker an ein traumatisches Ereignis, das ihre Phobie im Sinne einer klassischen Konditionierung erklären würde. Das Paradigma der klassischen Konditionierung bietet auch keine Erklärung in Fällen, wo sich eine Phobie graduell entwickelt. Mehr Evidenz gibt es dafür, dass die Konditionierung bei der Entwicklung von einfachen Phobien eine Rolle spielt. 11 2.2.2 Biologische Faktoren Erhöhtes Arousal: Patienten mit Panikstörung, Agoraphobie und Sozialphobiker haben ein erhöhtes Arousal. Die Autoren schlagen deshalb eine Interaktion zwischen Arousalniveau und Konditionierung vor. Es ist allerdings fragwürdig, ob das erhöhte Arousal bei Agoraphobikern und Sozialphobikern Ursache oder Folge phobischer Symptome ist. Beech et al. schlugen vor, ein erhöhtes Arousal beeinflusse die Effektivität des Konditionierungsprozesses. Diese Annahme konnte sie in Untersuchungen belegen. Genetische Faktoren: Bis jetzt gibt es nur wenige Studien. McGuffin und Reich (1984) fanden bei Sozialphobikern eine höhere Inzidenz sozialphobischer Familienmitglieder als bei Panikpatienten und „Normalen“. Genauso wie genetische Faktoren können aber auch Lernmodelle (z.B. Modelllernen) oder Umgebungseinflüsse diesen Zusammenhang erklären. In Zwillingsstudien konnten zudem nur beschränkt genetische Anteile bei der Entstehung von sozialer Angst nachgewiesen werden. Bei Zwangsstörungen liegen ähnliche Befunde vor wie bei der sozialen Phobie oben. Bei der generalisierten Angststörung und der posttraumatischen Belastungsstörung scheinen die Zusammenhänge noch schwächer zu sein. Bei einfachen Phobien scheinen genetische Faktoren ebenfalls keine guten Prädiktoren zu sein, außer bei Blutphobikern, wo 68% von Familienmitgliedern ähnliche Symptome aufweisen wie der Patient. Diese außerordentlich hohe Korrelation spricht dafür, dass tatsächlich eine genetische Komponente im Spiel ist, z.B. erblich bestimmte, äusserst starke Reaktion des autonomen Nervensystems. Neurotransmission: Angststörungen sollen mit folgenden Neurotransmittersystemen zusammenhängen: • Benzodiazepin-GABA-System • Noradrenergisches System • Serotonergisches System Annahmen beruhen auf Tierexperimenten, Angstprovokationstests und selektiver Wirkung diverser Medikamente. Es gibt nur sehr wenige Experimente bis heute. 2.2.3 Psychodynamische Sicht Die Abwehrmechanismen Verdrängung und Verschiebung sind bei der psychodynamischen Interpretation von Phobien wichtig. Dies bedeutet, dass die ursprüngliche Quelle der Angst verdrängt und die Angst auf einen anderen Gegenstand verschoben wird. Scheitern die Abwehrmechanismen, wird die Angst erlebt, entweder als eine frei flottierende Angst oder in Form von Panikanfällen. Phobien werden dabei als eine Art Abwehr der zweiten Linie aufgefasst. Manche Psychoanalytiker sind der Ansicht, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Art der Phobie und dem Inhalte der abgewehrten Ängste besteht. So wurde die Spinnenphobie aufgefasst als Äußerung der unbewussten Angst auf sexuellem Gebiet. Die Angst vor Flugzeugen wird teilweise als Angst vor Sexualität aufgefasst, wobei das Flugzeug die Gebärmutter darstellt. Über die soziale Phobie ist in der Psychoanalyse nur wenig geschrieben worden. Nur einer speziellen Form der sozialen Phobie der „Errötungsangst“ wurde einiges Forschungsinteresse zuteil. So wurde Errötung anfänglich als ein hysterisches Konversionssymptom aufgefasst (Verlagerung der unterdrückten genitalen Erregung auf das Gesicht), aber auch als Angst vor unbewussten exhibitionistischen Tendenzen. 12 2.2.4 Kognitive Aspekte In den letzten Jahren nahm das Interesse für kognitive Mechanismen besonders bei Angst und Depression zu. Beck und Emery (1985) sehen generalisierte Angst und Panik als Ergebnis von sogenannten Gefahren-Schemata. Diese Schemata enthalten wichtige Informationen über Erfahrungen in vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit, und über Regeln, Ideen und Erwartungen bezüglich der zukünftigen Ereignisse. Weiter sorgen die Schemata dafür, dass eine ängstliche Person Informationen aus der Umgebung selektiv verarbeitet und als gefährlich interpretiert. 2.2.5 Die Ätiologie einfacher Phobien Entwicklungsfaktoren: Manche Stimuli haben für ein bestimmtes Lebewesen einen bestimmten Angstwert. Dies scheint die Folge der Tatsache zu sein, dass jeder Organismus eine bestimmte Umgebung nötig hat zum Überleben. Stimuli, die diese Umgebung und deren Sicherheit gefährden, werden, wenn möglich, vermieden. So sind Höhenangst und z.B. Angst vor neuen Situationen oder unbekannten Objekten bei Menschen und Tieren ein bekanntes Phänomen. Auch die Angst, angeschaut zu werden, tritt nicht nur bei Sozialphobikern auf. Verschiedene Ängste treten in der normalen Kinderentwicklung auf. Viele Ängste entstehen zwischen dem 2.-4. Lebensjahr und verschwinden mit der Zeit wieder. Lerntheoretische Erklärung: Die klassische Konditionierung spielt hier eine wichtige Rolle. Allerdings konnte in einer 2.2.6 Agoraphobie und Panikstörung Trennungsangst: Verschiedene Autoren sehen einen Zusammenhang zwischen Trennungsangst bei einem Kind und der späteren Entwicklung einer Agoraphobie. So sind nach Bowlby Angststörungen bei Erwachsenen das Ergebnis langer und vielfältiger Trennung während der Jugend bzw. der Drohung mit so einer Trennung. Diese Trennungsangst kann sich nach Bowlby bei Kindern als Schulphobie, bei Erwachsenen in Form einer Agoraphobie äußern. Seiner Ansicht nach, handelt es sich in beiden Fällen um die Angst, das Haus zu verlassen, und dies sind wiederum Beispiele für Trennungsangst. Einfluss belastender Ereignisse (life events): Eine Agoraphobie scheint oft nach dem Auftreten eines sehr belastenden Ereignisses zu entstehen. Beispiele sind der Tod einer geliebten Person, Krankheit, die Geburt eines Kindes, zunehmende Verantwortung und Beziehungsprobleme. Life events scheinen aber nicht nur prädiktiv für die Entwicklung von Agoraphobie, sondern auch für die Entwicklung von Depression, psychosomatischen Erkrankungen und Schizophrenie (Rückfall). Weiter spielen auch Persönlichkeitsfaktoren eine wichtige Rolle. Einer davon ist die subjektive Kontrollüberzeugung. So scheinen negative Effekte eines negativen Ereignisses eine stärkere Wirkung auf Personen zu haben, die über vorwiegend externale Kontrollüberzeugung verfügen. 13 Rolle von Panik und Hyperventilation bei der Ätiologie der Agoraphobie: Panikanfälle sind nicht das direkte Ergebnis körperlicher Prozesse, sondern der katastrophalen Interpretation dieser körperlichen Zeichen der Hyperventilation. Erst durch die Überinterpretation entsteht ein Panikanfall. Systemtheoretische Sicht der Agoraphobie: Die Annahme von verschiedenen Autoren, dass die Partner von phobischen Patienten selber psychopathologisch auffällig waren und durch die Krankheit ihrer Partner ihre eigene Störung zu verstecken wussten, konnte von Arrindell und Emmelkamp nicht nachgewiesen werden. 2.2.7 Soziale Phobie Lerntheoretische Erklärung: Bei 58% der Sozialphobiker scheint ein traumatisches soziales Erlebnis voranzugehen. Eine andere Erklärung könnte das Modelllernen sein, wo Kinder ähnliche phobische Veranlagungen zeigten wie ihre Mütter. Wobei hier auch genetische Faktoren eine Rolle spielen könnten. Mangel an sozialen Fertigkeiten: In Untersuchungen konnte die Annahme nicht bestätigt werden, dass Sozialphobiker grundsätzlich über weniger soziale Fertigkeiten verfügten als die Vergleichspopulation. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass die Sozialphobiker glauben, dass sie diese Fertigkeiten nicht besitzen. Allerdings können soziale Phobiker in der Interaktion tatsächlich so wirken, als würden sie beschränkt über soziale Skills verfügen. Dies könnte daher kommen, dass sie während der Interaktion mehr mit sich beschäftigt sind („sie finden mich sicher komisch“; „ich werde erröten“…) und deshalb dem Gegenüber zu wenig Aufmerksamkeit schenken, was den Eindruck machen kann, dass sie eben keine sozialen Fertigkeiten besitzen. Kognitive Faktoren: Irrationale Ideen könnten als Ursache von sozialer Angst gesehen werden. Und obwohl verschiedene Untersuchungen einen solchen Zusammenhang zeigen konnten, ist die Relevanz dieser Resultate in verschiedener Hinsicht eingeschränkt. (Kleine Stichproben, keine sozialen Phobiker untersucht, etc.). Erziehungsstile: Negative Erfahrungen, in denen die Beurteilung durch andere eine wichtige Rolle spielte, könnten soziale Angst erklären. Auch scheinen Erziehungsstile der Eltern wichtig zu sein. Sozialphobiker beschrieben ihre Eltern oft als wenig affektiv, überfürsorglich. Zudem scheinen Sozialphobiker in der Kindheit wenig Freunde gehabt zu haben, und ihre Eltern haben sie von sozialen Ereignissen ferngehalten. 14 2.2.8 Zwangsstörung Lerntheoretische Erklärung: Die lerntheoretische Erklärung beruht auf der Mowrerschen Zwei-Faktoren-Theorie. Für den ersten Teil der Theorie, der auf der klassischen Konditionierung beruht, konnten nur wenige Nachweise gefunden werden. Mehr Beweise wurden für die zweite Phase (operante Konditionierung) von Mowerers Theorie gefunden. Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass Zwangsrituale Angst und Spannung reduzieren. Kognitive Störungen: Zwangspatienten können nur schwer doppeldeutige Situationen ertragen. Zwangspatienten scheinen zudem das größere Bedürfnis nach Entscheidungen zu haben als „Normale“, wollen aber anderseits eine Entscheidung aufschieben, wenn sie noch mehr Informationen sammeln können. Carr (1974) erklärte dies damit, dass Zwangspatienten die Wahrscheinlichkeit, dass eine Entscheidung negative Folgen haben könnte, abnormal hoch einschätzen. Prämorbide Persönlichkeit und Erziehung: Nach der psychoanalytischen Theorie haben Zwangspatienten prämorbid eine zwanghafte Persönlichkeit. Teilweise konnte diese Annahme nachgewiesen werden (71%). Zudem hatten die Zwangspatienten prämorbid weniger kritische Lebensereignisse erlebt, als Patienten ohne eine solche Persönlichkeit. Rachman (1976) schlug vor, dass Unterschiede im Zwangsverhalten durch Kontrollzwang in Familien, in denen die Eltern hohe Anforderungen stellen und sehr kritisch sind. Patienten mit Kontrollzwang versuchen, Fehler zu vermeiden aus Angst vor Kritik und Schuldgefühlen. Andererseits soll Putzzwang in Familien entstehen, in denen die Eltern überbeschützend sind. In der empirischen Überprüfung konnte schließlich nur belegt werden, dass Zwangspatienten ihre Eltern tatsächlich ablehnender und weniger zärtlich erlebten. Der Unterschied bezüglich der Typen Kontrollzwang bzw. Putzzwang konnte jedoch im Erziehungsstil nicht nachgewiesen werden. Der gefundene prädiktive Erziehungsstil wurde allerdings auch im Zusammenhang mit anderen psychopathologischen Störungen gefunden und lässt die Aussage zu, dass solche negativen Erziehungsstile ganz allgemein für Psychopathologie anfälliger machen. 3. 3.1 Allgemeine Ausgangspunkte bei der Behandlung Funktionsanalyse und Assessment (Bewertung) Nach der Feststellung der Diagnose folgt bei der VT eine weitere Inventarisierungsrunde. Es wird eine Funktionsanalyse erstellt. So können nämlich Störungen, die unter ein und denselben Nenner fallen im DSM-IV, durch verschiedene Faktoren verursacht oder aufrechterhalten werden. Im Folgenden soll nun die Funktionsanalyse kurz besprochen werden. Ich werde diese Zusammenfassung nicht allzu ausführlich halten, weil die Funktionsanalyse im Fliegel ausführlicher besprochen wird. 15 Funktionsanalyse: Bei der Funktionsanalyse, dem Kernstück der VT, sollen die funktionellen Relationen zwischen der Angststörung und anderen Beschwerdebereichen (Makroanalyse) bzw. innerhalb einer spezifischen Angststörung (Mikroanalyse) erklärt werden. Mikro-Analyse: Die von einem Patienten vorgetragenen Beschwerden müssen genauer analysiert werden. In den ersten Sitzungen wird sich das Gespräch hauptsächlich auf • Entstehung • Verlauf (Hat es Perioden gegeben, in denen die Beschwerden zu- bzw. abnahmen?) • heutigen Zustand der Beschwerden konzentrieren: o Unter welchen Umständen tritt die Angst auf? o Sind unterstützende Faktoren im Spiel? o Wie reagiert der Patient, wenn Angst aufkommt? o Was unternimmt der Patient darüber hinaus, um die Angst zu reduzieren oder zu vermeiden? o Welche physischen Empfindungen gehen mit dem Erlebnis der Angst einher? o Welche Gedanken hat der Patient während, vor und nach der Angstepisode? o Welches sind die kurzfristigen Konsequenzen des Vermeidungsverhaltens? o Welches sind die langfristigen Konsequenzen des Vermeidungsverhaltens? Makroanalyse: Oft stehen die Beschwerden, wegen derer sich ein Patient anmeldet, nicht isoliert. In den meisten Fällen findet sich eine Verbindung mit anderen Problemgebieten. In der Makroanalyse werden diese Beziehungen schematisch dargestellt. Wird eine Behandlung auf der Grundlage einer Makro-Analyse des Problemverhaltens aufgebaut, wird die Gefahr einer Symptomverschiebung unweigerlich abnehmen. Methoden zum Einholen von Informationen: 1. Verhaltensmessungen: Der Patient führt eine Serie von Handlungen aus, bei denen er vom Verhaltenstherapeut angeleitet wird. 2. In-vivo-Messungen: Der Patient legt eine bestimmte Route zurück. Dabei wird die Zeit gemessen, die er benötigt, um die Route zu bewältigen. 3. Hyperventilationsprovokation: Die Symptome einer Hyperventilation werden künstlich provoziert. Weitere Informationen dazu im Kapitel 5. 4. Selbstregistrierung: Der Patient soll ein bestimmtes Verhalten in gewissen Abständen erfassen. Möglichkeiten sind: o Strichlisten o Fragebögen o Gedanken notieren Ein Anwendungsbeispiel, wo mehrere Möglichkeiten kombiniert werden, ist auf der Seite 81 beschrieben (Emmelkamp, 1993). 16 3.2 Beschreibung einiger VT-Strategien Im Zusammenhang mit der Therapie von Phobikern wurden verschiedene Therapieformen angewendet. Bis heute hat sich vor allem die VT (vor allem in-vivoExposition) als überzeugend erwiesen. In diesem Kapitel werden deshalb schwerpunktmäßig VT-Methoden diskutiert. Die einzelnen klassischen VT-Methoden werde ich hier nicht besprechen, da sie im Fliegel (1994) ausführlicher beschrieben sind. • Systematische Desensibilisierung (Fliegel, S. 152ff) • Flooding (Fliegel, S. 213ff, 233) • Graduelle in-vivo-Exposition (Fliegel, S. 154, 157, 171, 217) • Kognitive Therapie und Anxiety-Management: hier gibt es verschiedene Ansätze zu unterscheiden: o Rational Emotive Therapy (RET): Ellis (1962) geht davon aus, dass irrationale Gedanken die Angst verursachen. In der Therapie gilt es, diese Gedanken zu korrigieren. o Störungen in kognitiven Prozessen: Beck und Emery (1985) sehen in der Angst die Schlussfolgerungen aus einer gestörten Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Der Patient soll in der Therapie seine Gedanken auf ihre Richtigkeit überprüfen (mehr dazu im Kapitel 5). o Selbstinstruktionstraining: Meichenbaum (1975) geht davon aus, dass die Angst die Patienten erleben durch negative Selbstinstruktionen verursacht wird. In der Therapie sollen die negativen Instruktionen durch positive ersetzt werden. o Anxiety Management: Wichtige Elemente dieser Methode sind Entspannung und Selbstinstruktion. • Andere Interventionen: oft ist es auch sinnvoll indirekt auf die Angststörungen einzuwirken, indem z.B. soziale Fertigkeiten trainiert werden, Beziehungsprobleme betrachtet werden etc. Die kognitive Therapie hat bei phobischen Stichproben in Untersuchungen schlechter abgeschnitten als die klassische VT-Methoden. 3.3 Die Durchführung der Behandlung Kurz zusammengefasst sind die erfolgreichsten Expositionsprogramme diejenigen, die in vivo während einer längeren, ununterbrochenen Periode durchgeführt werden und bei denen die Flucht verhindert wird. Allerdings trägt nicht nur die Auswahl des Verfahrens zum Therapieerfolg bei. Auch andere Variablen beeinflussen die Therapie nachhaltig: • Therapeutische Beziehung: Einige Psychotherapeuten haben die Vorstellung, dass die therapeutische Beziehung in der VT bzw. der kognitiven Therapie weniger wichtig sei als in anderen Therapierichtungen. Dies ist aber nicht so. • Bei der Exposition muss die Haltung des Therapeuten warm und energisch sein. Nur leistungsorientierte Therapeuten werden als gefühllos erlebt, was oft zum Misslingen der Therapie führt. • Die ersten Sitzungen sind ausschlaggebend für den weiteren Verlauf der Therapie. Die wichtigste Dimension scheint „Unterstützung“ zu sein, ein Sammelausdruck für Variablen wie „positives Feedback geben“, Vertrauen, Ermutigung und positives Neubenennen. 17 Der Therapeut soll zudem einen fachkundigen Eindruck machen: Kompetentes Auftreten, angemessene, nicht zu legere Kleidung, Pünktlichkeit, Respekt etc. • Widerstand kann auftreten, wenn o der Therapeut die Therapie ungenügend erkläret hat o der Patient selbst bestimmte Ideen bezüglich der Entstehung seiner Beschwerden hat und diese nicht äußern konnte o er nicht bereit ist für eine Therapie o er aus den Symptomen einen sekundären Krankheitsgewinn zieht • Umgang mit Schwierigkeiten während der Behandlung: o Rückfall: der Therapeut sollte versuchen, den Rückfall umzubenennen in eine Möglichkeit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. o Frühzeitiger Therapieabbruch: teilweise kann ein zu Beginn abgeschlossener Vertrag zwischen Therapeuten und Patienten, den Patienten bewahren in einem schwierigen Moment abzuspringen. o Psychopharmaka sollten während der Therapie nicht eingenommen werden, damit die Gefahr nicht besteht, dass nach Absetzen des Medikaments und Beenden der Therapie sofort ein Rückfall erlebt wird. o Den Patienten darauf aufmerksam machen, dass bei Absetzen vom Medikament (vor allem bei Benzodiazepinen) die Ängste kurzfristig stark zunehmen können (Rebound-Effekt). o Funktionsanalyse immer wieder überprüfen, vor allem wenn die Behandlung zuerst wenig erfolgreich ist. • 4. Die Behandlung einfacher Phobien 4.1 Forschungsergebnisse Einfache Phobien sind sehr häufig, gelangen aber selten zur Behandlung, da sie oft das alltägliche Leben nicht beeinträchtigen. Viele Untersuchungen mussten sich deshalb mit Versuchspersonen begnügen, die eine einfache Phobie mehr als sekundäre Störung aufwiesen. Diese Resultate aus solchen Studien sind nur bedingt auf echte phobische Patienten generalisierbar. Anfänglich wurden einfache Phobien durch Systematische Desensibilisierung und imaginäre Reizüberflutung behandelt, wobei beide Verfahren gleich erfolgreich waren. Zu Beginn der 70er Jahre wurden die ersten in-vivo-Behandlungen durchgeführt. Die Ergebnisse bezüglich der einfachen Phobien waren eindeutig: in allen Untersuchungen waren in-vivo-Verfahren effektiver als imaginäre Verfahren. Bei in-vivo-Verfahren wurde untersucht, welchen Effekt das Therapeutenverhalten hatte: Einerseits machte der Therapeut das gewünschte Verhalten vor (modeling), andererseits assistierte der Therapeut. Resultate dazu sind widersprüchlich. Das zusätzliche Erlernen von kognitiven Bewältigungsstrategien nebst der in-vivoExposition scheint zur Behandlung nichts beizutragen. Nur im Zusammenhang mit Höhenangst konnten in einer Studie kognitive Strategien als Unterstützung dienen. Untersucht wurden auch Zusammenhänge zwischen Behandlungsfaktoren und individuellen Eigenschaften der Patienten. Klaustrophobiker wurden in zwei Gruppen eingeteilt: „behavioral reactors“ und „physiological reactors“. In jeder Gruppe erhielt die Hälfte der Patienten eine mehr physiologisch orientierte Methode (Entspannung) oder eine mehr verhaltenstherapeutisch orientierte Methode (in-vivo-Exposition). Resultate: die in-vivo-Exposition war bei den „Behavioral reactors“ erfolgreicher und die Entspannung bei den „Physiological rectors“. So kann es vernünftig sein einem Patienten Entspannungsmethoden lernen zu lassen und diese während der in-vivoExposition anzuwenden. 18 4.2 Die Durchführung der Behandlung Wie bei anderen in-vivo-Expositionen, gilt auch bei der einfachen Phobie, • dass eine langfristige Exposition besser ist als eine kurzfristige • dass eine hohe Expositionshäufigkeit (täglich) besser ist als eine niedrige (1x pro Woche) • dass die Behandlung zu einem beträchtlichen Teil vom Patienten selbst durchgeführt werden kann. Als erstes muss die funktionale Analyse gemacht werden: Darin werden Informationen gesammelt, die Auskunft darüber geben, wann das Problemverhalten auftritt, wie es genau aussieht, welche Stimuli eine Rolle spielen, welche Konsequenzen dies für das alltägliche Leben hat und welche Kognitionen eine Rolle spielen. Es soll auch geklärt werden, welche Faktoren zur Entstehung beigetragen haben und welche das Verhalten aufrechterhalten. Während der Funktionsanalyse sollen auch die Ziele der Therapie festgelegt werden. Die Zielsetzungen sollen angemessen sein: Der Hundephobiker soll nicht lernen spontan alle Hunde auf der Strasse streicheln zu können, sondern an fremden Hunden vorbeigehen oder den bekannten Hund eines Nachbarn streicheln zu können. Allerdings ist es oft erwünscht, dass sich der Patient in der Therapiephase Situationen ausliefert, die viel schwieriger sind, als diejenigen, die in Wirklichkeit auftreten werden oder der höchsten Zielsetzung entsprechen. Zu Beginn der Behandlung erklärt der Therapeut, wie die Phobie aufrechterhalten wird, wobei auch die Rolle von Vermeidungsverhalten und Kognitionen erläutert werden soll. Die Grundlagen der in-vivo-Exposition sollen ebenfalls dargelegt werden. Wichtig sind auch die Instruktionen am Ende einer Therapiesitzung, wo der Patient darauf hingewiesen werden muss, dass er in seinem Alltag, die gefürchtete Situation nicht mehr vermeiden darf, im Gegenteil er soll sie sogar aufsuchen. Die Patienten können auch mit Hausaufgaben zur Konfrontation aufgefordert werden. Nach Öst (1989) kommen im Prinzip alle Phobien für eine in-vivo-Exposition in Frage, vor allem • Tierphobien • Angst vor dem Arzt • Höhenangst • Blut- bzw. Verwundungsphobien Dabei konnte er nachweisen, dass Tierphobiker meist mehr Behandlungszeit benötigen als Insektenphobiker. Die durchschnittliche Dauer einer Expositionssitzung beläuft sich auf 2 Stunden. Vorbehalte zum Gelingen der Therapie macht Öst (1989) bei Flugangst und Klaustrophobie. Allgemein die wichtigsten Kriterien zum Gelingen einer Therapie sind: • Phobie als einzige Störung • Gut umschriebener phobischer Stimulus (monosymptomatische Phobie) • Ausreichende Motivation des Klienten • Bereitschaft des Klienten sich kurzfristig großer Angst auszusetzen. Zur Erreichung einer Gewöhnung sind oft mehrere Expositionssitzungen notwendig. Dies gilt vor allem bei Patienten mit einer • Sturm- und Gewitterphobie • Lärmphobie • starken Klaustrophobie • Blut- und Verwundungsphobie • Schluckangst 19 Die Behandlung von Blutphobie: Blutphobiker haben ein diphasisches Reaktionsmuster. Nach einer kurzen Zunahme von Blutdruck und Herzschlag bei der Konfrontation mit einem blutigen Stimulus, folgt eine drastische Abnahme von Blutdruck und Herzschlag. Deshalb fragt sich, ob die in-vivo-Exposition in diesem Falle geeignet ist. Bis anhin wurde allerdings auf diesem Gebiet nur wenig geforscht, obwohl die Blutphobie eine der häufigsten einfachen Phobien ist. In einer Studie von Öst (1984) war die in-vivo-Exposition effektiver als eine aktive Form von Entspannung (applied relaxation, Kapitel 8). Bei der Durchführung einer in-vivo-Exposition bei Blutphobiker müssen folgende Punkte beachtet werden: • Das Behandlungsziel soll hier nicht die Abnahme eines Erregungsniveaus sein, sondern gerade die Zunahme (bis zum normalen Niveau) • Durch den drastischen Abfall der Herztätigkeit am Anfang der Konfrontation ist ein Herzstillstand möglich. Deshalb ist es notwendig, einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen vor der Durchführung. • Entspannungstechniken sollten nicht angewendet werden, da diese den Herzrhythmus und den Blutdruck zusätzlich senken. Kozak und Montgomery (1981) verwendeten sogar eine Anspannungstechnik, um den Blutdruck und den Herzschlag zu erhöhen (applied tension). Diese Anspannungstechnik kann in mehreren Sitzungen erlernt werden und anschließend vom Patienten bei Feststellen einer Blutdruckabnahme, bzw. Verlangsamung des Herzrhythmus, angewendet werden. Als Expositionsmöglichkeit haben sich folgende bewährt: • Betrachten von blutigen Videos (Operationen) • Zuschauen beim Blutspenden bzw. eigenes Blutspenden • Über blutige Themen sprechen • Teilnahme an Operationen im Spital 5. Die Behandlung von Panikstörung und Agoraphobie 5.1 Forschungsergebnisse Zuerst wird die Literatur zur Behandlung von Agoraphobie besprochen, vor allem Exposition und kognitive Ansätze, danach werden Modelle zur Behandlung von Panikattacken vorgestellt. Exposition bei Agoraphobie: Die Effektivität von Expositionsbehandlungen wurde ausführlich untersucht. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 1. in-vivo-Exposition ist effektiver als imaginäre Exposition 2. Langfristige Exposition ist effektiver als kurzfristige Exposition 3. schnelle Exposition ist effektiver als langsam durchgeführte 4. häufiges Üben ist effektiver als Üben mit großen Pausen 5. Exposition in der Gruppe ist in etwa genauso effektiv wie individuell durchgeführte Exposition 6. die Behandlung kann als Selbsthilfeprogramm durchgeführt werden 7. die Effekte von Expositionsprogrammen sind dauerhaft 8. individuelle Reaktionsmuster spielen keine Rolle bei der Effektivität der invivo-Exposition 20 Kognitive Therapie bei Agoraphobie: Kognitive Verfahren haben das Ziel, die angstauslösenden Gedanken in produktive Gedanken umzuwandeln. 1. in-vivo-Exposition ist effektiver als rational-emotive Therapie und Selbstinstruktionstraining 2. Behandlung, deren Ziel eine Verbesserung des Problemlösevermögens ist, verbessern den Expositionseffekt, allein sind sie aber nicht effektiv. Partner und die Behandlung von Agoraphobie: Die Hilfe eines Partners oder Freundes erhöht die Effektivität von Expositionsbehandlungen nicht. In Kapitel 2 wurde schon auf den fehlenden ursächlichen Zusammenhang zwischen der Qualität der (ehelichen) Beziehung und der Agoraphobie eingegangen. Ehezufriedenheit scheint kein Prädiktor für den Erfolg einer Behandlung mit in-vivo-Exposition zu sein. Kognitive Therapie bei Panikstörung: Clark (1986) schlägt vor, dass ein Panikanfall als Folge einer falschen Interpretation von an sich harmlosen körperlichen Empfindungen, die z.B. durch Hyperventilation verursacht werden, verstanden werden kann. Die Behandlung, die Clark vorschlägt, besteht aus einer Erklärung und Diskussion der Rolle der Hyperventilation bei Panikanfällen, dem Verschreiben von Atemübungen und der Neubenennung von den körperlichen Symptomen. In zwei Untersuchungen (allerdings ohne Kontrollgruppe) konnten dadurch die Panikanfälle reduziert werden. 5.2 Die Durchführung der Behandlung In diesem Kapitel werden zwei Behandlungsstrategien ausführlich besprochen; die eine richtet sich auf das Vermeidungsverhalten des Agoraphobikers, die andere auf den Umgang mit Panikanfällen. Eine Expositionsbehandlung bei Agoraphobie: Das Verfahren besteht aus den folgenden 3 Elementen: 1. Erklärung des Behandlungskonzepts: In diesem Teil soll der Patient mit der Behandlungsart, dem Ziel der Behandlung und möglichen auftretenden Problemen während der Behandlung vertraut gemacht werden. Der Patient soll wissen, dass viel von ihm erwartet wird, er selbst eine große Verantwortung trägt. 2. Aufstellen der Angsthierarchie: Es wird ein Angstthermometer erstellt, das hierarchisch geordnet Situationen enthält, die gar keine Angst auslösen (0) bzw. die maximale Angst auslösen (100). Die Hierarchieliste kann in der Therapie oder als Hausaufgabe erstellt werden. In dieser Phase soll auch das Therapieziel definiert werden. Das Ziel soll so gefasst werden, dass es auch tatsächlich realistisch ist, bis dahin zu gelangen. 3. Durchführen und Besprechen der Expositionsaufgaben: Die Hausaufgaben werden notiert und in Form eines strukturierten Tagebuchs können die durchgeführten Hausaufgaben notiert werden. Jeder Aufgabe sollten 1 ½-2 Stunden gewidmet werden, damit eine Abnahme der Angst in der Situation auch tatsächlich erlebt werden kann. In der Therapiesitzung ist es dann jeweils wichtig die gemachten Erfahrungen zu besprechen und Teilerfolge zu betonen, um erneute Frusterlebnisse zu vermeiden und negativen Bewertungen vorzubeugen. 21 In-vivo-Exposition als Hausaufgabe hat mehrere Vorteile gegenüber einer Exposition zusammen mit dem Therapeuten: Der Patient ist selbstverantwortlich, kann die Erfolge besser generalisieren und in der Therapie kann die Zeit für die Aufarbeitung des Erlebten verwendet werden und nicht nur für die zeitaufwendigen Expositionsaufgaben. Die Häufigkeit von gemeinsam durchgeführten Expositionsübungen hängt von Faktoren ab, wie Art und Ausprägung der Störung, dem Motivationsgrad des Patienten. Kognitive Therapie bei Panikstörung: Auslöser Katastrophale Interpretation Angst Überatmen Abnahme CO2 Zunahme pH Wahrnehmung Körperliche Symptome Das Ziel der Behandlung ist, die katastrophalen Gedanken durch realistischere oder rationalere zu ersetzen. Interventionen, die sich auf die Verbesserung der Atmung konzentrieren, haben in diesem Rahmen eine therapeutische Funktion. Beim Verfahren von Clark geht es um das Durchbrechen eines zirkulären Prozesses (s. nächste Abbildung): 1. ein externer oder interner Stimulus wird als bedrohlich wahrgenommen (1) 2. dies löst eine gewisse Angst aus (2) 3. es wird nun zu stark eingeatmet (CO2-Gehalt des Blutes sinkt, pH-Wert steigt) 4. als Folge treten verschiedene körperliche Symptome auf 5. der Patient nimmt diese Symptome wahr und interpretiert sie als katastrophal 6. dadurch nimmt die Angst noch zu und der Kreis beginnt neu In der Behandlung sind die folgenden Schritte zu unterscheiden: 1. Inventarisierung von körperlichen Symptomen und Kognitionen: Der Patient beschreibt, wie er sich während eines Panikanfalls fühlt, was er denkt etc. 2. Hyperventilationsprovokation: Die obige Inventarisierung kann oft verzerrt sein, deshalb kann es sinnvoll sein, beim Patienten durch eine provozierte Hyperventilation eine Panikattacke mitzuerleben. Für den Patienten kann dies auch der erste Lernschritt bedeuten. 3. Nachbesprechung der Provokation: Nach dem Test müssen Ähnlichkeiten und Unterschiede zu einer richtigen Panikattacke besprochen werden. Dieser Vergleich kann mittels eines Fragebogens geschehen, der jeweils für die echte Panikattacke bzw. die provozierte ausgefüllt wird. 4. Diskussion über die Rolle der Hyperventilation: Dem Patienten kann durch das Prinzip der Hyperventilation erklärt werden und das Schema wie es oben dargestellt ist. 5. Training von Bauchatmung: Eine der Schlussfolgerungen aus der Darstellung der Hyperventilation ist, dass eine andere Atmung erlernt werden muss: die tiefe Atmung in den Bauch und nicht mehr wie bei der Hyperventilation typische in den oberen Brustkorb 22 6. Erlernen nicht-katastrophaler kognitiver Reaktionen: Das Hauptziel ist das Erlernen adäquater nicht-katastrophaler Kognitionen. Der Patient soll lernen, dass er mit seinen Gedanken den Teufelskreis immer mehr beschleunigt, ohne dass tatsächlich ein objektiver Grund dazu da wäre. 7. Verhaltensexperimente: Auch in der kognitiven Therapie müssen bestimmte Aktivitäten ausgeführt werden, die zur Verifikation bzw. Falsifikation von katastrophalen Interpretationen führen. Eigentlich ist dies ähnlich wie bei einer Expositionsbehandlung. 8. Identifikation und Modifikation der Panikauslöser: Personen mit Panikattacken haben meistens den Eindruck, dass der Anfall wie aus heiterem Himmel kommt. Deshalb ist es wichtig, immer wieder zu erarbeiten, was alles vor dem Panikanfall getan, gedacht wurde, um die Stimuli zu eruieren und für den Patienten die Situation kontrollierbarer zu gestalten. 6. Die Behandlung von sozialer Phobie 6.1 Forschungsergebnisse In den 60er und 70er Jahren lag die Betonung auf einem Mangel an sozialen Fertigkeiten, der vor allem durch inadäquate Sozialisationsprozesse entstanden ist. Hier müssen neue soziale Fertigkeiten gelernt werden. Im zweiten Modell, in dem die konditionierte Angst im Mittelpunkt steht, liegt die Betonung daher auf der Angst, die durch eines oder mehrere unangenehme Erlebnisse entstanden ist und sich auf alle möglichen sozialen Situationen ausgeweitet hat. Hier ist das Ziel einer Behandlung, die Reduktion der Angst. Erst in den 80er Jahren kam mehr Interesse auf für mögliche kognitive Prozesse, die Angst auslösen oder verstärken können. In diesem Modell der kognitiven Inhibition, wird angenommen, dass vor allem irrationale, unrealistische Erwartungen und Einstellungen des Betroffenen für die Entstehung und Aufrechterhaltung von sozialer Angst verantwortlich sind. Ausgehend von den verschiedenen theoretischen Modellen, wurden im Lauf der Jahre diverse therapeutische Strategien entwickelt. Nachfolgend sollen die wichtigsten kurz erwähnt werden, zusammen mit den Ergebnissen aus der Therapieforschung: 1. Systematische Desensibilisierung zeigt bei Sozialphobikern fast keine Wirkung (z.B. Hall&Goldber, 1977) 2. Reizüberflutung ist bei Sozialphobikern wenig brauchbar (Shaw, 1979) 3. Entspannung ist vor allem bei den Sozialphobikern von Nutzen, die in sozialen Situationen eine erhöhte körperliche Aktivität zeigen. 4. Training von sozialen Fertigkeiten kann oft zu einer andauernden Verbesserung führen als Systematische Desensibilisierung. 5. in-vivo-Exposition gilt als Behandlung effektiv 6. Kognitive Verfahren sind ebenso effektiv wie in-vivo-Exposition 7. Kombinierte Verfahren zeigten sich effektiver als die reine Anwendung von kognitiven Verfahren bzw. in-vivo-Exposition 8. es scheint effizienter zu sein, verschiedene Verfahren hintereinander zu verwenden, als mehrere parallel 9. individuelle Behandlung ist genauso effektiv wie Gruppenbehandlung 23 6.2 Die Durchführung der Behandlung Zuerst sollen hier verschiedene häufige angewendete Verfahren besprochen werden. Anschließend wird noch kurz die Behandlung von speziellen Formen der sozialen Phobie angesprochen. Verschiedene Behandlungsformen: In allen Fällen ist immer zuerst eine genaue Funktionsanalyse notwendig. 1. Training sozialer Fertigkeiten: pro Sitzung wird eine bestimmte Fertigkeit behandelt. Das tatsächliche Verhalten des Patienten wird in einem rekonstruierenden Rollenspiel dem Therapeuten gezeigt. Danach soll der Patient sagen, wie er sich gerne verhalten hätte und welches Verhalten effektiver wäre. Dann erfolgt das Einüben angestrebten Verhaltens. Mögliche Probleme beim sozialen Kompetenztraining: soziale Phobie kann sich im Kontakt mit dem Therapeuten äußern. Darauf muss eingegangen werden. 2. Kognitive Therapie: hier geht es wieder darum, irrationale Gedanken zu erkennen und umzubenennen. Bei der rational-emotiven Therapie von Ellis wird vom ABCDE-Schema ausgegangen, wobei es folgendes bedeutet: o A: Activation event: die objektive Beschreibung des Ereignisses o B: Beliefs: die irrationalen, spannungsauslösenden Gedanken o C: Consequence: die emotionalen Folgen (Gefühle) der Gedanken o D: Discussion: die Fragen, die gestellt werden, um Gedanken unter B an der Wirklichkeit zu testen o E: Evaluation: die rationaleren Gedanken, die die Folge der Herausforderung unter D sind. Ziel der Behandlung soll vor allem sein, dass der Patient lernt, seine Gedanken kritisch zu betrachten, sie in Frage zu stellen und umzubenennen. 3. in-vivo-Exposition: die Anwendung von in-vivo-Exposition führt bei der sozialen Phobie zu einigen Problemen: o Die meisten sozialen Situationen sind vorhersagbar und deshalb ist es nicht einfach, eine gute Hierarchie aufzustellen. o Viele soziale Situationen dauern nur kurz und meistens zu kurz, damit eine Reduktion der Angst erfolgen kann. o Es herrscht der Eindruck, dass Sozialphobiker bereits im Alltag genügend Exposition erleben. o Bei der Agoraphobie steht die Angst im Mittelpunkt, körperliche Beschwerden zu erleben in der angstauslösenden Situation. Bei Sozialphobikern steht die Angst vor der kritischen Beurteilung durch andere im Mittelpunkt. In vielen Fällen kann darüber keine Information erlangt werden. Daher ist es oft hilfreicher, bestimmte Themen, die sich in den angstauslösenden Situationen wiederholen herauszuarbeiten und weniger eine Angsthierarchie im klassischen Sinne zu erstellen. 4. Gruppen- vs. Einzelbehandlung: Gruppentherapie hat den wichtigen Vorteil der dauernden Exposition im sozialen Kontakt. Zudem sind viele Sozialphobiker überzeugt, dass andere das gleiche haben, sehr relativierend wirken. Im Rollenspiel können zudem die anderen mitspielen. Der große Nachteil besteht darin, dass oft zu wenig Zeit ist, um auf die individuellen Probleme einzugehen. Zudem kann die Gruppe auf den Sozialphobiker auch die gegenteilige Wirkung haben, in dem sie finden, dass sie sogar unter Leuten mit ähnlichen Problemen noch auffällig sind. 24 7. Die Behandlung von Zwangsstörungen 7.1 Forschungsergebnisse Exposition und Reaktionsverhinderung: Für die klinische, stationäre Behandlung von Zwangspatienten entwickelten Meyer et al. (1974) ein Programm aus einer Kombination von Reaktionsverhinderung, Modelling und in-vivo-Exposition. Der Ablauf der Behandlung kann folgendermaßen beschrieben werden: 1. Erstellen der Funktionsanalyse 2. Verhindern am Ausführen der Zwangsrituale durch das Pflegepersonal 3. Nach der Elimination der Zwangsrituale, Konfrontation mit stärkeren Stressmomenten. Der Therapeut dient als Modell, macht die Handlungen vor, der Klient soll sie anschließend kopieren. Die Ergebnisse von Studien, die sich an diesem Modell orientierten werden im Folgenden besprochen: 1. Graduelle in-vivo-Exposition ist ebenso effektiv wie in-vivo-Flooding 2. Modelling durch den Therapeuten resultiert in der Regel nicht in einem größeren Behandlungseffekt 3. Selbstkontrollierte Exposition ist genauso effektiv wie durch den Therapeuten kontrollierte Exposition 4. die Einbeziehung des Partners steigert den Erfolg der Behandlung nicht 5. längere Expositionssitzungen sind effektiver als kürzere 6. Exposition führt im Allgemeinen zu einer stärkeren Verringerung der Angst im Vergleich zu Reaktionsverhinderung, während Reaktionsverminderung in der Regel in einer größeren Abnahme der Zwangsrituale resultierte. Die effektivste Behandlung bestand in der Kombination von beiden Varianten 7. Bei Zwangspatienten ist der Unterschied im Effekt von in-vivo- bzw. imaginärer Exposition weniger deutlich als dies bei der einfachen Phobie oder der Agoraphobie war (in-vivo-Exposition war deutlich überlegen) 8. Konzentrierte Exposition (4 Sitzungen pro Woche) ist nicht effektiver als dekonzentrierte Exposition (2 Sitzungen pro Woche) 9. eine ambulante Behandlung ist oftmals genauso effektiv wie eine stationäre Behandlung 10. die Behandlungseffekte sind von dauerhafter Natur 11. Folgende Faktoren scheinen mit dem Behandlungserfolg negativ zu korrelieren: o Ernst und Dauer der Beschwerden o Art des Zwangs (Kontrollzwang hat eine schlechtere Prognose als Waschzwang) o Wahnartige Zwangsgedanken o Negative Erziehungserfahrungen 12. Kognitive Therapie ist genauso effektiv wie in-vivo-Exposition Zwang kann auch der Verdrängung schmerzvoller Emotionen dienen. Hier ist es dann nicht angebracht, ausschließlich die Zwangshandlungen zu beschreiben, viel mehr muss nach der Quelle des Zwangs gesucht werden, damit die Behandlung erfolgreich sein kann. 25 7.2 Durchführung der Behandlung bei Zwangsverhalten Nach der Erfassung der benötigten Information über den Zwang konstruiert der Therapeut eine Hierarchie. Dann konstruiert er Aufgaben, zusammen mit dem Patienten, die jeweils ein Element der Reaktionsverhinderung und ein Expositionselement umfassen. Der Patient ordnet diese Aufgabe dann auf dem Kontinuum des Angstthermometers ein. Wichtig ist, dass der Patient erkennt, dass sein Problem sowohl durch die passive als auch die aktive Vermeidung (Zwangshandlung) aufrechterhalten wird. Bei einem Expositionsprogramm für Reinigungszwang besteht die Behandlung z.B. darin, dass der Patient zuerst mit „verseuchtem“ Material konfrontiert wird uns sich danach nicht waschen darf. Die Exposition mit diesen Stimuli wird so lange fortgesetzt, bis Furcht und Spannung des Patienten abnehmen. Für Patienten mit Kontrollzwang ist es sehr wichtig, dass sie sich für ihr Verhalten während der Exposition selbst verantwortlich fühlen. Zudem soll die gleiche Übung pro Sitzung nur einmal durchgeführt werden. Ansonsten kann es dazu kommen, dass bei der zweiten Durchführung nur noch kontrolliert wird, ob es beim ersten Mal gut gemacht wurde. Für eine erfolgreiche Therapie kann es oft notwendig werden, dass die Familienmitglieder über den Mechanismus des Zwangs instruiert werden. Wenn jemand z.B. sehr unsicher ist und aus Zwang immer wieder belanglose Fragen stellen muss, damit er sich beruhigen kann, soll die Familie dies wissen, damit solche zwanghaften Fragen nicht mehr beantwortet werden. 7.3 Falldarstellung: Die Behandlung von Annette Die Falldarstellung wird nicht zusammengefasst (s. S. 172-184) 7.4 Durchführung der Behandlung bei Zwangsgedanken Die VT-Behandlung von Zwangsgedanken wurde in der Forschung weitaus weniger behandelt als die VT-Behandlung von Zwangshandlungen. Die Ursache dafür liegt in der Tatsache, dass Zwangsgedanken, zumindest ohne die Erscheinung von Zwangshandlungen, nur relativ selten vorkommen oder nicht direkt ersichtlich sind. Grundsätzlich lassen sich folgende Behandlungsformen unterscheiden: 1. Behandlungen, gerichtet auf das Beenden der Zwangsgedanken (Gedankenstopp und Aversionstherapie) 2. Behandlungen, gerichtet auf Gewöhnung (lang andauernde Exposition und Saturationstraining) 3. Behandlungen, die nicht direkt auf die Zwangsgedanken gerichtet sind, sondern auf tiefer liegende Probleme Gedankenstopp-Methoden: Wolpe (1958) introduzierte die Gedankenstopp-Methode und beschrieb ihre erfolgreiche Anwendung bei einer Reihe von Patienten mit Zwangsgedanken. Danach haben auch andere Autoren über Erfolge mit der Gedankenstopp-Methode berichtet. In keiner der 4 auf diesem Gebiet publizierten Studien konnte sich Gedankenstopp als effektiver als Kontrollmethoden erweisen. Aversionstherapie (Elektroschock beim Melden eines Zwangsgedanken) ist effektiver als Nichtbehandlung. Ein Problem scheint dabei zu sein, dass in der Literatur über GedankenstoppMethoden nicht unterschieden wird zwischen Zwangsgedanken, die Angst hervorrufen und solchen, die eine Angst reduzierende Wirkung haben. 26 Konfrontation mit den Zwangsgedanken (imaginäre Exposition): Rachman (1976) wählte als Ausgangspunkt die Hypothese, dass man Zwangsgedanken als aversive Stimuli betrachten kann, an welche sich Patienten nur mit Mühe gewöhnen können. Als Behandlungsmethode schlägt Rachman ein Sättigungstraining vor. Bei dieser Behandlung werden die Patienten aufgefordert, ihre Zwangsgedanken in allmählich länger werdenden Perioden aufzurufen. Daneben erhalten sie Instruktionen zur Reaktionsverhinderung, falls den Zwangsgedanken neutralisierende Gedanken (Handlungen) folgen. Der Effekt dieser Behandlung ist aber bei Zwangspatienten noch nicht untersucht. Emmelkamp und Kwee (1977) entwickelten eine Methode, die auf Gewöhnung beruht. Hier werden die Patienten während mindestens 60 Minuten ununterbrochen den Zwangsgedanken ausgesetzt und dabei von der spannungslösenden Reaktion darauf abgehalten. Erst wenn eine bestimmte obsessive Szene keine Angst mehr weckt, wird sie nicht mehr angeboten. Hier werden von Anfang an die stärksten Stimuli verwendet. Emmelkamp (1982) konnte den Effekt dieser Behandlung in einer Untersuchung nachweisen. Andere Behandlungen: Bei vielen Zwangsgedanken spielt das Thema, sich selbst oder anderen Verletzungen zuzuführen eine wichtige Rolle. Diese Patienten zeigen oft Subassertivität. Emmelkamp&van der Heyden (1980) untersuchten die Hypothese, ob Zwangsgedanken dadurch entstehen, dass aggressive Gefühle zurückgehalten und daraus Schuldgefühle resultieren. Nun stellt sich die Frage, ob ein adäquater Umgang mit Aggression letztendlich zu einer Abnahme derartiger Zwangsgedanken führen würde. Emmelkamp&van der Heyden führten mit Zwangspatienten ein Assertivitätstraining durch und stellten fest, dass der Effekt dieser Methode sogar größer war, als jener bei Patienten mit Gedankenstopp-Behandlung. 7.5 Abschließendes Die Annahme scheint gerechtfertigt, dass 1. imaginäre Exposition eine gute Behandlungsform ist bei Zwangsgedanken 2. der Effekt von Gedankenstopp weniger deutlich ist 3. bei Zwangsgedanken mit dem Thema Verletzungen andere Personen ein Assertivitätstraining eine bedeutende Hilfe sein kann 8. Die Behandlung der übrigen Angststörungen In den vorherigen Abschnitten wurden Störungen behandelt, die bereits seit geraumer Zeit als solche benannt werden. Wesentlich jüngeren Datums ist die Aufmerksamkeit für Störungen, die nun hier besprochen werden sollen: die posttraumatische Belastungsstörung bzw. die generalisierte Angststörung. 8.1 Posttraumatische Stressstörung Forschungsergebnisse: Im Rahmen des lerntheoretischen Modells wird die Entwicklung der posttraumatischen Belastungsstörung anhand klassischer und operanter Konditionierung erklärt: das traumatische Ereignis fungiert als aversiver unkonditionierter Stimulus (UCS), welcher in extremer Spannung resultiert. Durch einen Konditionierungsprozess werden neutrale Stimuli, die mit der traumatischen Situation assoziiert werden, zu konditionierten Stimuli (CS), die anschließend die Angstreaktion selbständig hervorrufen können. Dies führt zur Vermeidung dieser konditionierten Stimuli. 27 Die Behandlung umfasst in den meisten Fällen eine direkte oder imaginäre Expositionsmethode. Veronen und Kilpatrick (1983) untersuchten den Effekt eines Stressmanagementtrainings bei Opfern von Vergewaltigungen. Das Stressmanagementprogramm wurde verglichen mit den Effekten von einer systematischen Desensibilisierung. Beide Verfahren zeigten vergleichbare Effekte. In einer Untersuchung von Defares und Brom (1986) wurden o Traumadesensibilisierung o Hypnose und o psychodynamische Methode verglichen. Alle drei Behandlungsweisen führten zu gleich großen, deutlichen Besserungen hinsichtlich der Beschwerden und Verarbeitung, während sich diese in der Kontrollgruppe nicht änderten. Frank et al. (1988) verglichen die kognitive Therapie nach Beck mit der systematischen Desensibilisierung bei Vergewaltigungsopfern. Beide Behandlungsformen zeigten sich gleich erfolgreich. Durchführung der Behandlung: Bei der Behandlung posttraumatischer Stressstörung kommt der Qualität der therapeutischen Beziehung großes Gewicht zu, weitaus mehr als bei der Behandlung anderer Angstbeschwerden. Hier muss auch immer wieder beurteilt werden, wie die psychische Elastizität der betroffenen Person und die Risiken von Dekompensation oder Selbstmord aussehen. Häufig besteht eine posttraumatische Belastungsstörung nicht isoliert, sondern neben anderen Beschwerden wie anderen Angstsyndromen und Depression. Bei der Therapie müssen diese anderen Beschwerden auch berücksichtigt werden, damit der Erfolg erzielt werden kann. 8.2 Generalisierte Angststörung Forschungsresultate: Bei vielen Personen, die an einer generalisierten Angststörung leiden, tritt zusätzlich eine Alkoholsucht oder eine Abhängigkeit von Anciolytica auf. Die Behandlungsansätze sind vor allem dadurch geprägt. In der Forschung haben sich vor allem Entspannungstechniken und die Modifikation angstauslösender Kognitionen als effektiv erwiesen. Entspannungsübungen: Der Patient soll lernen, die gelernten Entspannungsübungen in dem Augenblick durchzuführen, sobald er die somatischen Symptome der Spannung zu erkennen beginnt. Weit verbreitete Techniken sind: o Anxiety Management Training (AMT): Dies ist eine Kombination von Entspannung, beruhigendem Self-Talk und dem Hervorrufen angstauslösender und beruhigender Vorstellungen (image switching). Teilweise wird das image switching ersetzt durch eine in-vivo-Exposition, wodurch noch bessere Resultate erzielt werden konnten, als dies bereits mit dem ursprünglichen AMT möglich war. AMT wurde auch verglichen mit GT und einer Kontrollgruppe. Das AMT schnitt am besten ab, aber auch die Patienten, die mit GT behandelt wurden machten große Fortschritte. o Applied relaxation (AR): siehe Durchführung der Behandlung o Cue controlled relaxation: siehe Durchführung der Behandlung 28 Kognitive Therapie: Kognitive Umstrukturierung allein scheint wenig wirksam zu sein. Eine Kombination mit anderen Verfahren (Entspannungsübungen, systematische Desensibilisierung) zeigte sich jedoch als erfolgreich. Allerdings gibt es nur wenige, methodisch korrekte Studien, die kognitive Verfahren mit anderen vergleichen und so können keine harten Folgerungen gezogen werden. Durchführung der Behandlung: Öst (1986) führte die Applied relaxation ein. Der Patient soll hier lernen, die ersten Zeichen der Angst zu erkennen und mit ihr umzugehen. Bei der Einübung dieser Methode durchläuft der Patient folgende Phasen: 1. Phase: Der Patient übt die Progressive Relaxation (an- und entspannen von verschiedenen Muskelgruppen). 2. Phase: Das Anspannen der Muskeln entfällt, der Patient übt direkt das Entspannen. 3. Phase: Hier wird die cue controlles relaxation geübt. Das Wort „Entspann“ wird konditioniert mit der tatsächlichen Entspannung. Nach einigem Training lernt der Patient so, sich innerhalb von etwa 3 Minuten zu entspannen. 4. Phase: Die Entspannung wird auf verschiedene Situationen generalisiert (Applied relaxation). 5. Phase: Der Patient trainiert eine noch schnellere Relaxation, indem er sich täglich 15-20 Mal entspannt. Ziel: Entspannung in ca. 30 Sekunden. Wichtig ist hier vor allem, dass zuerst Medikamente abgesetzt werden oder eine Alkoholtherapie vorher oder zumindest parallel läuft. Zu den beiden Syndromen ist allgemein noch nicht viel Forschungsarbeit geleistet worden, da beide noch nicht lange als Störungsbilder katalogisiert worden sind. 9. Psychopharmakologische Behandlung An der Regulierung der Angst scheinen 3 Neurotransmittersysteme beteiligt: 1. Benzodiazepin-GABA-System: Gamma Amino Buttersäure (GABA) scheint bei der Senkung der Arousal eine Rolle zu spielen. 2. Noradrenalinsystem: Die Hyperaktivität dieses Systems kann an der Entstehung von Panikanfällen eine Rolle spielen. 3. Serotoninsystem: Sowohl das Noradrenalin- als auch das Serotoninsystem sollen eine Funktion beim Hang zum Grübeln und eine wichtige Rolle bei Zwangsstörungen haben. Zudem soll das Serotoninsystem mit dem Vorkommen von Panikanfällen zusammenhängen. 9.1 Generalisierte Angststörung Der größte Teil der Forschung untersuchte die Wirkung von Benzodiazepinen. In 3 kontrollierten Studien erwies sich ihr Effekt größer als der eines Placebos. Benzodiazepine sind nur in geringem Mass toxisch. Der große Nachteil liegt in ihrem Abhängigkeitspotential. Zudem führen vor allem Benzodiazepine mit einer kurzen oder mittellangen Halbwertszeit zu ernsthaften Nebenwirkungen wie Zittern, Übelkeit, Konzentrationsstörungen, Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, Transpirieren, Ermüdung und Gereiztheit. Teilweise werden auch trizyklische Antidepressiva bei der Behandlung des generalisierten Angstsyndroms angewendet. 29 9.2 Panik und Agoraphobie Benzodiazepine: Die Effektivität von Benzodiazepinen beim Paniksyndrom ist nicht überzeugend nachgewiesen. Angesichts der möglichen Abhängigkeit, der Entzugserscheinungen und Rebound-Panikanfälle, erscheint es nicht sinnvoll, dieses Medikament zu empfehlen. Momoaminoxidase-Hemmer (MAOH): Auch mit dieser Medikamentengruppe konnten nur begrenzt positive Resultate erzielt werden und wegen der zahlreichen Nachteile, die mit MAOH verbunden sind, erscheint große Zurückhaltung bei der Verschreibung geboten. Trizyklische Antidepressiva: Am deutlichsten nachgewiesen ist der Effekt dieser Medikamente bei Panikanfällen. Allerdings scheint der Effekt größer zu sein, wenn die Patienten sich in-vivoExposition übten, als wenn sie dies nicht taten. Der Wirkmechanismus wird so erklärt, dass durch die Einnahme des Medikaments eine Stimmungsverbesserung auftritt, wodurch die Patienten motivierter sind, die Situationen aufzusuchen, in denen sie vorher Panikanfälle hatten. Die letztliche Besserung der Agoraphobie ist dann das Resultat der Gewöhnung, die während der in-vivo-Exposition auftritt. Nachteilig an trizyklischen Antidepressiva ist, dass bei Behandlungsbeginn die Angst steigen kann, dass es häufiger zu Nebenwirkungen kommt und dass ein therapeutischer Effekt erst nach mehreren Wochen erwartet werden kann. Die Ausstiegsquote liegt bei ca. 30%, die Rückfallquote zwischen 2750%. Selektive 5HT-Aufnahme-Hemmer: Diese Stoffe haben einen selektiven Einfluss auf das Serotoninsystem, wirken aber nicht auf das GABA-System. So kann z.B. Fluvoxamin Angst und Panik verringern, hingegen hat Fluvoxamin wenig Einfluss auf das agoraphobische Vermeidungsverhalten. Nach zweimonatiger Behandlung sind deshalb viele Phobiker immer noch phobisch. Nach Ablauf einer dreiwöchigen VT bei einer Vergleichsgruppe waren die Erfolge deutlicher und zahlreicher. Beta-Rezeptorenblocker: Beta-Rezeptorenblocker beeinflussen das sympathische System, indem sie die Übermittlung bestimmter Reize blockieren. Als Folge davon werden eine Reihe autonomer, somatischer Reaktionen wie Herzklopfen, Zittern und Transpirieren gedämpft. Diese Medikamente schienen geeignet zur Unterstützung von Expositionstherapien. Bisher veröffentlichte Studien konnten dies jedoch nicht bestätigen. 9.3 Soziale Phobie Bei sozial ängstlichen Personen wurden die Effekte von Benzodiazepinen, MAOH und Beta-Rezeptorenblocker untersucht. Allerdings wurden nur 3 Studien mit SozialPhobikern durchgeführt, die übrigen Studien bezogen sich auf freiwillige Personen mit Lampenfieber. 30 Benzodiazepine: Diese Medikamentengruppe wurde noch nie an Sozial-Phobikern getestet. In anderen Studien schnitten Benzodiazepine schlechter ab als das Placebo, es gab nach der Behandlung viele Rückfälle, zudem müssen die Nebenwirkungen und dir Abhängigkeitsgefahr bedacht werden. Bei der Verschreibung dieser Medikamente ist große Vorsicht geboten. Beta-Rezeptorenblocker: Diese Medikamentengruppe scheint vor allem geeignet, um den somatischen Symptomen, wie Herzklopfen, Transpirieren etc. vorzubeugen. Bei Untersuchungen mit Sozialphobikern konnten keine Unterschiede zwischen dem Medikament und dem Placebo festgestellt werden. Momoaminoxidase-Hemmer: Hier gibt es eine Reihe sehr widersprüchlicher Forschungsresultate. Vor dem Hintergrund der kleinen Zahl von Untersuchungen, der widersprüchlichen Resultate sowie der Komplikationen, die bei der Verwendung von MAO-Hemmern auftreten können, scheint eine große Zurückhaltung beim Verschreiben wünschenswert. 9.4 Zwangsstörung In einer Reihe von Studien wurde der Effekt trizyklischer Antidepressiva bei Zwangspatienten untersucht. Es wurden vor allem Medikamente getestet, die ins Serotoninsystem eingreifen. Diese erwiesen sich als wirksamer als ein Placebo, aber nicht als effektiver als trizyklische Antidepressiva. Diese Erkenntnis entkräftet die Hypothese einer Störung des Serotoninsystems bei Zwangspatienten. Eine Behandlung mit trizyklischen Antidepressiva scheint vor allem von Bedeutung bei Zwangspatienten, die depressiv sind, als Unterstützung eines Programms, zusammengesetzt aus in-vivo-Expositionen und Reaktionsverhinderung. Wie bei Panikpatienten kommt es beim Absetzen der Medikation häufig zu Rückfällen. 31