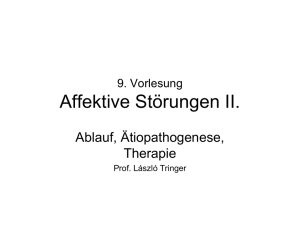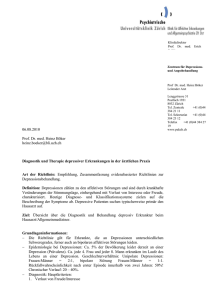ARD-Morgenmagazin Service
Werbung

ARD-MORGENMAGAZIN – SERVICE 09.10.2013 THEMA: Autorin: EXPERTE IM STUDIO: Funktion: HILFE BEI DEPRESSIONEN Uschi Müller DR. MOHSEN RADJAI Facharzt für Allgemeinmedizin Depressive Störungen gehören weltweit zu den häufigsten und am meisten unterschätzten Krankheiten – allein in Deutschland sind rund vier Millionen Menschen akut betroffen. Trotzdem ist die Depression ein Tabuthema. Viele Patienten versuchen, sich ihre Krankheit nicht anmerken zu lassen, solange es eben geht. Doch das große Schweigen beim Thema Depression verursacht unnötiges Leid. Man schätzt, dass bis zu 15% der unbehandelten Patienten mit einer schweren Depression Selbstmord begehen. Bereits 1621 beschrieb Robert Burton in seinem Buch "Anatomy of Melancholy" anschaulich, was eine Depression bedeutet: "Wenn es eine Hölle gibt auf Erden, dann findet man sie im Herzen eines melancholischen Menschen". Denn eine Depression ist nicht der vielzitierte "Moralische" oder "Durchhänger", sondern eine behandlungsbedürftige Krankheit, die Stimmung, Denken, Körperfunktionen und Verhalten beeinträchtigt. Aus diesem Grunde wird sie auch als eine psychobiologische Erkrankung bezeichnet, bei der Körper und Seele betroffen sind. Symptome Zu den Hauptsymptomen zählt man gedrückte, depressive Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit, Antriebsmangel und Ermüdung. Zu den Nebensymptomen gehören: Verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit, reduziertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit, übertriebene Zukunftsängste, Suizidgedanken oder gar Suizidversuche, Selbstverletzungstendenzen, Schlafstörungen und insbesondere Früherwachen, reduzierter Appetit mit Gewichtsverlust, reduziertes sexuelles Verlangen (Libidoverlust). Die Nebensymptome bestimmen den Schweregrad einer Depression mit. Es gibt auch Halluzinationen im Bereich des Geschmacks-, Geruchs- oder Tastsinns. Es können Mundtrockenheit, Übelkeit, Verstopfung, Durchfall oder diffuse Schmerzen auftreten. Verschlimmert sich die Depression, fühlt man sich zunehmend hilflos und glaubt sich in einer ausweglosen Situation, oft folgen Suizid oder zumindest die Gedanken daran. Bei manchen Menschen kann es auch zu Verhaltensänderungen kommen: Man bemerkt sie manchmal kaum, aber sie können zu enormen Problemen führen. Unter Umständen kämpfen die Betroffenen ständig mit den Tränen, machen einen permanent traurigen Eindruck, gehen stark gebeugt oder sind verlangsamt. Es kann auch das Gegenteil eintreten: Unruhe in Form von ständigem Auf- und Abgehen, Ruhe- und Rastlosigkeit, Händereiben oder ähnlichem. Manche Menschen sind durchaus in der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen, fühlen sich aber schrecklich deprimiert. Andere können noch nicht einmal die wesentlichen Dinge des Alltags wie Einkaufen gehen oder Geschirrspülen verrichten. Manche setzen ein Lächeln auf und versuchen ihre Niedergeschlagenheit zu überdecken. Doch die Aufrechterhaltung der äußeren Fassade ist ungemein anstrengend und erschöpfend. Betroffene beschreiben typischerweise ein Morgentief, was sich erst im Tagesverlauf abschwächt, um dann am nächsten Tag von neuem zu beginnen. Die unangenehmen Begleiter der Depression Depressive Menschen haben häufig neben ihrer Depression auch noch andere Krankheiten. Bei einigen liegt das daran, dass die Depression Folge der anderen Krankheit ist. So sind Zustand nach Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes mellitus und neurologischer Erkrankungen wie ARD-MORGENMAGAZIN – SERVICE 09.10.2013 -2- Parkinson und insbesondere auch chronische Schmerzen mit Depressionen vergesellschaftet. Es kann aber auch eine kranke Schilddrüse dahinter stecken. Deshalb muss der Arzt bei der Diagnose einer Depression zuerst prüfen, ob nicht andere körperliche Krankheiten vorliegen. Er wird auch nach Medikamenteneinnahme fragen, denn es ist bekannt, dass zum Beispiel manche Bluthochdruckmittel eine Depression verursachen können. Aber auch wenn die Depression nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit einer anderen Krankheit steht, so verschlechtert sie doch erheblich den Verlauf chronischer Krankheiten. Darüber hinaus gilt eine Depression z. B. als Risikofaktor für das Entstehen einer koronaren Herzerkrankung. Ursachen Die Ursachen für Depressionen können genetisch bedingt sein. In der Regel kommen aber weitere relevante Faktoren hinzu, die unter anderem im sozialen Umfeld des Betroffenen zu suchen sind. Kompensationsmechanismen zur Stressbewältigung scheinen ebenfalls eine Bedeutung zu haben. Biologische Faktoren: Gene und Hormone, Botenstoffe im Gehirn oder körperliche Krankheit. Wenn ein eineiiger Zwilling eine Depression bekommt, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 70%, dass auch der Andere eine Depression entwickelt. Bei Eltern, Kindern und Geschwistern ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Menschen in deren Verwandtschaft keine Depressionen auftreten bzw. aufgetreten sind, haben ein Risiko von 2-3%. Psychosoziale Faktoren: Missbrauch, Vernachlässigung, Armut, Scheidung, Tod. Bei mehr als 75% findet sich ein belastbares Lebensereignis in den 12 Monaten vor Begin der Krankheit. Unfähigkeit der Stressbewältigung: Stress ist relativ, es kommt darauf an, wie man den damit verbundenen Druck aushält und bewältigen kann. Im Blut und Urin findet man vielfach höhere Mengen des Stresshormons Kortisol. Psychodynamische Faktoren: eine wichtige Rolle spielt das Zusammensein mit anderen Menschen, in der Fachsprache Psychodynamik genannt. Vor allem das emotionale Verhältnis zu den Eltern prägt uns grundlegend. Bei depressiven Patienten sind diese ersten wichtigen Bindungen oft gestört, z. B. durch Krankheit, Vernachlässigung oder Tod eines oder beider Elternteile. Behandlung Forscher vermuten, dass bei einer Depression bestimmte Botenstoffe im Gehirn für die Reizweiterleitung eine zu geringe Aktivität zeigen. Hier sollen Antidepressiva unterstützen, indem sie das Angebot dieser Botenstoffe (Serotonin, Noradrenalin) im Nervengewebe anheben. Antidepressiva machen nicht abhängig, es besteht also keine Suchtgefahr. Weil es relativ lange dauert, bis man weiß, ob ein Medikament anschlägt, suchen Wissenschaftler nach Methoden, mit denen man schon früher voraussagen kann, welches Mittel für einen Patienten das Richtige ist. Stresshormon-Tests zum Beispiel könnten vielleicht dabei helfen. Das Stresshormonsystem vieler Depressiver reagiert überschießend. In einer Studie wurde gemessen, wie hoch der Gehalt an Stresshormonen im Blut war, und zwar einmal vor Beginn einer medikamentösen Therapie, und einmal zwei Wochen später. Bei den Patienten, deren Stresshormonhaushalt sich in der Zeitspanne zwischen den Blutentnahmen beruhigt hatte, schlugen die Medikamente gut an. Die Patienten aber, die wenig Veränderung im Stresshormonhaushalt zeigten, reagierten auch schlechter auf die Antidepressiva. Schlafentzugs-Therapie Dies ist vielleicht die einfachste aller Therapien – ihr einziger Nachteil: Die Wirkung hält nur einen Tag an. Bei der Schlafentzugstherapie werden die Patienten um ein Uhr morgens geweckt und bleiben dann den Rest der Nacht und den kompletten darauffolgenden Tag wach. Kein noch so kleines Nickerchen ist gestattet, sonst bleibt die gewünschte Wirkung aus. Und ARD-MORGENMAGAZIN – SERVICE 09.10.2013 -3- die ist durchschlagend: Direkt nach der durchwachten Nacht geht es zwei Dritteln der Patienten besser. Die Behandlung wird häufig in Kliniken durchgeführt, manchmal mehrmals wöchentlich. Warum sie so gut funktioniert, weiß niemand. Die Wirkung verfliegt zwar schon nach der nächsten durchschlafenen Nacht, aber viele depressive Menschen schöpfen wieder Hoffnung, wenn sie erfahren, wie sich ein Tag ohne Depression anfühlen kann. Lichttherapie Mittel der Wahl bei der saisonal abhängigen Depression, auch "Winterdepression" genannt. Der Name ist allerdings irreführend, da längst nicht jede im Winter auftretende Depression eine echte "Winterdepression" ist: Für die Lichttherapie gibt es spezielle Lampen mit hoher Lichtintensität – ein Lichtbad unter der Wohnzimmerlampe reicht nicht aus. Gewöhnliche Wohnraumbeleuchtung erreicht nämlich nur ungefähr ein Zehntel der Lichtintensität, die man draußen bei bedecktem Himmel durch das Tageslicht abbekommen kann. Vor den speziellen Tageslichtlampen für die Therapie sitzt der Patient täglich eine halbe Stunde oder länger. Man vermutet, dass das über die Netzhaut aufgenommene Licht im Gehirn die Ausschüttung von Botenstoffen beeinflusst. Bei schweren Formen von Winterdepression werden zusätzlich Psychotherapie oder Medikamente eingesetzt. Übrigens: Ein täglicher Spaziergang kann in leichteren Fällen ebenfalls nützen – da bekommt man das Lichtbad gratis. Elektrokrampftherapie und Magnetstimulation Es klingt drastisch: Stromschläge gegen die Depression. Doch die neuen Methoden haben nichts mit den grausamen Elektroschocks, mit denen Menschen in den Anfängen der Psychiatrie traktiert wurden, zu tun. Heute gehen die Ärzte viel vorsichtiger vor, und für manche Patienten ist eine moderne Elektrokrampftherapie das einzige, was sie aus ihrer tiefen Depression herausreißen kann. Die kontrollierten Stromschläge wirken bei vielen Patienten, bei denen Medikamente und Psychotherapie versagt haben. Durch den elektrischen Impuls wird eine Art künstlicher epileptischer Anfall ausgelöst; der Patient bekommt davon jedoch nichts mit, er befindet sich in Narkose. Die Behandlung wird innerhalb weniger Wochen mehrfach wiederholt. Wegen möglicher Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen und vorübergehender Gedächtnisschwäche bleibt die Elektrokrampftherapie trotz ihrer hervorragenden Wirksamkeit eine Reserve-Maßnahme für schwere Fälle. Transkranielle Magnetstimulation Arm an Nebenwirkungen ist dagegen die Anwendung von Magnetfeldern, die "repetitive transkranielle Magnetstimulation". Dabei wird am Kopf des Patienten eine Magnetspule befestigt. Das Magnetfeld soll den Stoffwechsel von Hirnzellen verändern; die Wirkung scheint allerdings eher schwach zu sein. Die repetitive transkranielle Magnetstimulation wird bei leichten bis mittelschweren Depressionen eingesetzt. Hirnschrittmacher Forscher experimentieren auch mit Eingriffen ins Gehirn, zum Beispiel mit der sogenannten Tiefenhirnstimulation: Dabei pflanzen Chirurgen eine Elektrode in eine bestimmte Hirnregion. Sie gehört zu einem Netzwerk von Hirnzentren, das bei Depressiven angeblich fehlgesteuert ist. Die Elektrode ist über ein Kabel mit einem Schrittmacher verbunden. Das Kabel verläuft unter der Haut bis hin zum Brustmuskel, wo der Schrittmacher sitzt. Er kann durch den Arzt mit Fernsteuerung auf verschiedene Frequenzen und Spannungen eingestellt werden. Aufgrund der geringen Patientenzahl ist die Wirksamkeit noch nicht ausreichend erforscht. Informationen dazu finden sich auf der Homepage der Universität Bonn: http://www.ukb.unibonn.de/42256BC8002AF3E7/vwWebPagesByID/77BD38424F568105C12578290049FFA6 ARD-MORGENMAGAZIN – SERVICE 09.10.2013 -4- Psychotherapie Sie kann als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden. Im jeweils gewählten Therapieverfahren geht der Therapeut auf die Psyche des Patienten ein. Eine ganz wichtige Grundlage dafür ist natürlich die vertrauensvolle und wertschätzende Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Hier den richtigen "Ansprechpartner" zu finden ist nicht immer leicht. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für Psychotherapie im Rahmen des sogenannten "Richtlinienverfahren". Hierzu zählen die Verhaltenstherapie und psychoanalytisch begründeten Verfahren. Ihre Wirksamkeit gilt insbesondere bei leichten und mittelgradigen Depressionen als belegt. Sie können unter Umständen auch mit Antidepressiva kombiniert eingesetzt werden. So ist z. B. bei schwergradigen Depressionen in der Regel eine medikamentöse Begleittherapie erforderlich. Verhaltenstherapie (VT) Die VT will die Symptome der Depressionen lindern, anstatt die tieferen Ursachen zu erforschen. Negative Denkmuster und Verhaltensweisen sollen geändert werden. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TP) Die TP fokussiert einen bestimmten, unter der depressiven Problematik liegenden Konflikt. Dieser besteht oft darin, dass man eng mit Menschen verbunden, aber auch selbstständig sein möchte – das macht es z. B. so schwer "nein" zu sagen. Die TP will den Zusammenhang zwischen heutigen und früheren Gefühlen und Erfahrungen aufspüren. Psychoanalyse (PA) Bei der PA soll der Patient frei seine Gedanken, Fantasien, Gefühle und Empfindungen ohne Rücksicht auf Logik, Bedeutung und Moral äußern. Der Therapeut hat hier eine deutlich passive Position. Die Entwicklung der Therapie führt über Rückschritte in alte Gefühle und Erinnerungen zur Veränderung. Die PA ist sehr zeitintensiv (drei bis fünf Sitzungen pro Woche) mit einer Gesamtdauer von bis zu mehreren Hundert Stunden über drei bis fünf Jahre hinweg. Allerdings gibt es nur wenige Studien, die eine bessere Wirksamkeit als andere Verfahren belegen. Ziel ist auch nicht unbedingt die Heilung bestimmter Symptome, sondern die grundsätzliche Einsicht, Persönlichkeitsveränderung und die persönliche Reifung. Informationen Deutsche Gesellschaft für psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM): www.dgpm.de Stiftung Deutsche Depressionshilfe: www.deutsche-depressionshilfe.de Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde: www.dgppn.de Literatur Fuljahn, Heide: Kalt erwischt, Diana Verlag ISBN 978-3-453-29115-7