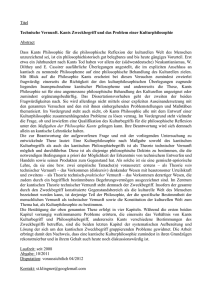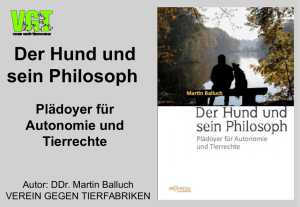Freiheit und Zweck
Werbung

Freiheit und Zweck Kants Grundlegung der Ethik in zwei phasen Dissertation der Universität Wien 1996 Daisuke Shimizu Neue, verbesserte Ausgabe: Version 0.1 Kobe 2014 Vorbemerkung. 1. Danksagung. Ich danke Herrn Dr. Cornelius Zehetner herzlichst für seine gewissenhafte sprachliche Korrektur dieser Arbeit. Mein Dank gilt auch meiner Frau Michiko Shimizu, die aus meiner Sammlung das Literaturverzeichnis für die vorliegende Arbeit hergestellt hat. Am meisten bin ich Herrn Prof. Dr. Michael Benedikt zu Dank verpflichtet für seine langjährige freundliche Betreuung meines Studienaufenthaltes in Wien. 2. Zitierungsweise. Ich zitiere nach der Akademie-Ausgabe. Dabei bezeichnen die römischen Ziffern die Band-, die arabischen die Seitenzahl der betreffenden Stelle. Wenn es nötig ist, wird auch die Zeilenzahl hinzugefügt. Bei den Hauptwerken wird zusätzlich auch die Originalpaginierung angegeben. 3. Abkürzungen. Optim. Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus. (1759) Beweisgrund Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes. (abgefaßt: 1762) Deutlichkeit Untersuchungen über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral. (abgefaßt: 1762) Beobachtungen Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. (1764) Bemerkungen Bemerkungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. (1764/65) Träume Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik. (1766) i Inaugural-Dissertation De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. (1770) Ethik Menzer Menzer, P. [Hrsg.], Eine Vorlesung Kants über Ethik. (1775–80?) Met.L/1 Metaphysik L(1) (Pölitz), Vorl., in: AA Bd. 28. (1775–80?) KrV Kritik der reinen Vernunft. (1 1781, 2 1787) Prol. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik. (1783) Religionslehre Pölitz Philosophische Religionslehre nach Pölitz, Vorl., in: AA Bd. 28. (WS 1783/84?) GMS Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. (1785) MAN Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. (1786) Was heißt: S.i.D.or.? Was heißt: Sich im Denken orientieren? (1786) KpV Kritik der praktischen Vernunft. (1788) EE Erste Einleitung in die KU. (abgefaßt: 1788/89?) KU Kritik der Urteilskraft. (1790) Rel. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. (1793) Gemeinspruch Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. (1793) MS Vigilantius Metaphysik der Sitten Vigilantius, Vorl., in: AA Bd. 27. (WS 1793/94) Fortschritte Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik. (abgefaßt: 1793– 97??) Ende a.D. Das Ende aller Dinge. (1794) V.e.vorn.Ton Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie. (1796) Fried. i.d.Ph. Verkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie. (1796) MS Die Metaphysik der Sitten. (1797) Str.d.Fak. Der Streit der Fakultäten. (1798) Anthr. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. (1798) Log. Logik, hrsg. v. G. B. Jäsche. ii Die sonstigen Schriften Kants werden unter ausreichender Nennung des Titels angegeben. AA Akademie-Ausgabe Kants. A 1. Auflage. B 2. Auflage. H Handschrift. Z Zeile. ND Nachdruck. [ ] hinzugefügt v. Verf. iii iv Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung. 1. Danksagung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zitierungsweise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Abkürzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i i i i Einleitung. 1 (a) Exposition des Themas und allgemeine Bemerkungen zu dieser Arbeit. 1 (b) Analytisch-regressives und synthetisch-progressives Verfahren in der Grundlegung der Ethik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (c) Abgrenzung von der Interpretation M. Laupichlers. . . . . . . . . . 13 1. Die kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik als Exposition des Gesetzes und als Deduktion der Freiheit im Grundsätze-Kapitel der KpV. 23 1.1 Die propositionale kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik in den §§ 2–4 des Grundsätze-Kapitels der KpV. . . . . . . . . . . . 23 1.1.1 Der Spielraum der propositionalen kognitiv-formalistischen Grundlegung der Ethik: Maximen. . . . . . . . . . . . . . 23 1.1.2 Die Struktur der kognitiv-formalistischen Argumentation in den §§ 2–4 des Grundsätze-Kapitels der KpV. . . . . . . . 25 1.2 Die psychologische, mithin subjektive kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik in den §§ 2–4 des Grundsätze-Kapitels der KpV. 30 1.2.0 Vorwort zur psychologischen kognitiv-formalistischen Grundlegung der Ethik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.2.1 Die negative Untersuchungsbasis, von der die subjektive kognitivformalistische Grundlegung der Ethik ausgeht: Es ist apriorisch nicht bestimmbar, in welchem Ausmaß die pathologischpraktische Lust durch Gegenstandsvorstellungen ausgelöst wird. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1.2.2 Abhängigkeit von Gegenständen. . . . . . . . . . . . . . . . 37 v 1.2.3 Die Distanzierung von der Abhängigkeit der Lust von Gegenstandsvorstellungen (vor allem der Vollkommenheit einer Objektvorstellung) und die Einräumung der gesetzgebenden reinen für sich praktischen Vernunft in Anmerkung I zu §§ 2 und 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4 Die Untauglichkeit des Prinzips der Glückseligkeit und dessen pragmatischer Imperative zur praktisch-objektiven unbedingten Gesetzgebung der Moralität in Anmerkung II zu §§ 2 und 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Die kognitive formalistische Grundlegung der Ethik als Exposition des Gesetzes und als Deduktion der Freiheit im Grundsätze-Kapitel der KpV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Die kognitive Deduktion der Freiheit aus dem Gesetz im § 5 und die essentielle Deduktion des Gesetzes aus der Freiheit im § 6 des Grundsätze-Kapitels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Kants positive Verwendung des Begriffs der Vollkommenheit: der Übergang zur essentiellen, ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Die innere Bewegung und Struktur der moralphilosophischen Reflexionen in den siebziger und achtziger Jahren. 2.1 Einleitung zur Untersuchung der moralphilosophischen Reflexionen in den siebziger und achtziger Jahren. . . . . . . . . . . . . . . . A. Der Gedanke der Zusammenstimmung und das Moralprinzip. . . . . 2.2 Die Zusammenstimmung mit sich selbst, mit den Gesetzen und mit den Zwecken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Allgemeine Erläuterung zum Begriff der Zusammenstimmung. 2.2.2 In den siebziger und achtziger Jahren werden Gesetz und Willensfreiheit aus der Perspektive der moralischen Zwecksetzung her weiter in Betracht gezogen. . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Das Konzept der Zusammenstimmung des Willens mit sich selbst in den Jahren 1769–70. . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst und die Moralität. 2.3.1 Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst als Rückgang zum Fundament der Ethik (kognitiv-formalistische Grundlegung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Die Zusammenstimmung mit sich selbst und das principium diiudicationis moralis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Glückseligkeit als Zielvorstellung der Moralität aus Freiheit. . . . . . 2.4 Drei Arten der Glückseligkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Zusammenstimmung und Selbstzufriedenheit. . . . . . . . . 2.4.2 Die zweifache Glückseligkeit (Refl. 6907). . . . . . . . . . . 2.4.3 Zwei Gründe des Wohlgefallens (Refl. 7049). . . . . . . . . vi 40 52 55 58 63 71 71 74 74 74 76 78 80 80 87 92 92 92 93 95 2.4.4 Die Autokratie der Freiheit in Ansehung der Glückseligkeit bzw. die Epigenesis der Glückseligkeit nach allgemeinen Gesetzen der Freiheit (Refl. 6867). . . . . . . . . . . . . . 96 2.5 Selbstzufriedenheit, intellektuelle Lust und geistiges Leben. . . . . . 99 2.5.1 Die Selbstzufriedenheit ist eine intellektuelle Lust. . . . . . 99 2.5.2 Beständigkeit und Sicherheit zum Wohlgefallen im Gefühl eines endlichen Vernunftwesens. . . . . . . . . . . . . . . 101 2.5.3 Exkurs: Geistiges Leben und intellektuelle Lust. . . . . . . . 103 C. Die relative Gewichtsverlagerung bei der moralischen Triebfeder. . . 106 2.6 Ist die Selbstzufriedenheit als moralische Triebfeder tauglich? . . . 106 2.6.1 Selbstzufriedenheit erhebt die Seele (Refl. 6892). . . . . . . 106 2.6.2 Die Selbstzufriedenheit als Hauptstuhl für Glückseligkeit (Refl. 7202). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2.6.3 Die Selbstzufriedenheit ist zur moralischen Triebfeder nicht fähig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2.6.4 Die Unterscheidung der moralischen Triebfeder vom moralischen Gefühl (Refl. 6864). . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 2.7 Die relative Verlagerung der moralischen Triebfeder ins Gesetz. . . 121 2.7.1 Moralisches Gefühl als contradictio und seine bewegende Kraft.121 2.7.2 Die relative Gewichtsverlagerung beim Begriff der Triebfeder in der intellektuellen Ausdehnung vom freien Willen zum Reich Gottes: Die ,moralisch-teleologische‘ Grundrichtung, vom freien Willen auszugehen, setzt sich durch. . 125 2.7.3 Die Verlagerung der moralischen Triebfeder und die motiva moralia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 2.7.4 Der Sinn der Verlagerung der moralischen Triebfeder im System der Kantischen Grundlegung der Ethik. . . . . . . . 135 D. Die intelligible Welt als bloßer Standpunkt außer der Sinnenwelt. . . 136 2.8 Der Explikationsversuch des Prinzips der Exekution für die Verpflichtung der Gesetze aus der transzendental-subjektiv verinnerlichten intelligiblen Welt im 3. Abschnitt der GMS. . . . . . . . . 136 3. Der Übergang von der Theorie des ,Gegenstands der reinen praktischen Vernunft‘ zur Lehre vom höchsten Gut. 143 3.1 Vorbegriffe zur ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3.1.1 Die Relevanz der moralisch-praktischen Zwecksetzung des freien Willens gegenüber dem bloß logischen Vernunftprinzip der Moralität: Moralische Gesetze entspringen nicht der Vernunft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3.1.2 Die intelligible Welt in der essentiellen, ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik. . . . . . . . . . . . . . 151 vii 3.2 Die Theorie vom Gegenstand der reinen praktischen Vernunft verknüpft das Fundament der Moral (Gesetz und Freiheit) mit der Lehre vom höchsten Gut; dadurch wird eine Struktur der moralischpraktischen Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik gebildet. . . . . . . . . . . . . . . . . 156 3.2.0 Vorwort zur dreistufigen Struktur der Theorie der moralischpraktischen Zwecksetzung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 3.2.1 Die Distanzierung von der Zwecksetzung der Willkür. . . . . 158 3.2.2 Die Genese des Guten als Gegenstand der reinen praktischen Vernunft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3.2.3 Die theoretische Schwierigkeit der obigen Lehre von der Genese des Guten: die Genese des Guten bei den vollkommenen, engeren, unnachlaßlichen Pflichten und bei den unvollkommenen, weiteren, verdienstlichen Pflichten. . . . . 168 3.2.4 Der Begriff des Guten als Zweck. . . . . . . . . . . . . . . . 176 3.3 Die Hauptstufe der Theorie der moralisch-praktischen Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik: Die reine praktische Vernunft macht sich das höchste Gut zum Gegenstand; oder: Der reine Wille strebt den Endzweck an. . 180 3.3.1 Über die Notwendigkeit der Annahme des höchsten Guts bzw. des Endzwecks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 3.3.2 Über die Notwendigkeit der Annahme der Tugend und Glückseligkeit als Momente des höchsten Guts. . . . . . . . . . 188 3.3.3 Die ethische Geisteslage als die intellektuelle intentionale Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens zum Endzweck: Zur Lösung des Problems des höchsten Guts als des Bestimmungsgrunds des Willens. . . . . . . . . . . . . . . . 191 3.3.4 Das höchste Gut als das Reich Gottes. . . . . . . . . . . . . 198 3.4 Die Postulatenlehre ergänzt die Lehre vom höchsten Gut in der Theorie der moralisch-praktischen Zwecksetzung. . . . . . . . . . . . 199 3.4.0 Die Erweiterung der reinen intellektuellen Aktualität des moralischen Gesetzes auf das höchste Gut und dessen Postulate.199 3.4.1 Der kontinuierliche unendliche Progressus zur Realisierbarkeit der Idee der moralischen Vollkommenheit als des Elements des höchsten Guts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 3.4.2 Die Realisierbarkeit des vollendeten höchsten Guts durch das Streben nach der moralischen Vollkommenheit im unendlichen Progressus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 3.5 Die moralische Glückseligkeit beim kontinuierlichen Progressus zur moralischen Vollkommenheit und die physische Glückseligkeit im Begriff des höchsten Guts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Literaturverzeichnis. 219 I. Quellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 viii II. Hilfsmittel (Lexika, Konkordanz und Übersetzungen). . . . . . . . . 219 III. Sekundärliteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 ix x Einleitung. (a) Exposition des Themas und allgemeine Bemerkungen zu dieser Arbeit. 1. Über die ethischen Grundbegriffe, die hinsichtlich ihrer Begründbarkeit und Wirksamkeit expliziert werden sollen, scheint Kant auf den ersten Blick immer wieder widersprüchliche Aussagen zu machen. (1) Während einerseits zur Herausstellung des moralischen Gesetzes die Abhängigkeit von Gegenstandsvorstellungen als Bestimmungsgründen des Willens abgelegt werden soll (cf. 1.2.2, 1.2.3), wird auf der anderen Seite ein Gegenstand als derjenige der reinen praktischen Vernunft wieder eingeräumt (cf. 3.2.2). Es scheint, daß jene Negierung der Gegenstände mit dieser Wiedereinräumung eines Gegenstandes nicht vereint werden kann. (2) Ebenso werden einerseits zur Exposition des Gesetzes materiale Zwecke abgelehnt (cf. 3.2.1), andererseits aber werden moralische Zwecke wieder eingeführt (cf. 3.2.4). (3) Auf der Ebene des Gefühls werden empirische Triebfedern von der moralischen Willensbestimmung entfernt, während eine moralische Triebfeder zu derselben wieder nötig wird (cf. 2.6, 2.7). (4) Auch Gesetze werden in physische und moralische eingeteilt; die ersteren werden als zur moralischen Bestimmung des Willens untauglich abgewiesen, obgleich sie auch Gesetze sind, und nur den letzteren wird diese Tauglichkeit zuerkannt (cf. 1.2.4). (5) Kants Ethik ist angeblich Tugend- und nicht Glückseligkeitsethik. Denn die Willensbestimmung durch das moralische Gesetz muß vom Moment der Glückseligkeit freigehalten werden (cf. 1.2.4). Andererseits aber wird von Kant die Glückseligkeit in seiner Ethik nicht nur konzediert (cf. 2.2, 2.4, 2.6.2, 3.5), sondern er scheint sogar manchmal aus ihr die Moralprinzipien zu deduzieren (cf. 3.1.1.b). (6) Die Existenz Gottes wird als primärer moralischer Bestimmungsgrund des Willens abgelehnt (cf. 1.2.3.a), weil erstens ihr Begriff keine theoretisch-objektive Realität hat und weil zweitens, wenn er solche hätte, er als theonomischer Bestimmungsgrund bloß Heteronomie des Willens verursachen würde. Zur Verwirklichung des höchsten Guts wird sie jedoch positiv postuliert (cf. 3.4). (7) Auch die Freiheit wird in negative und positive differenziert (cf. 1.3). Für jeden der aufgezählten ethischen Grundbegriffe Kants gilt also sowohl Negation als auch Affirmation. Man spürt, daß sich in Kants Grundlegung der Ethik notwendigerweise zwei gegensätzliche Gedanken bewegen. Auf der einen Seite 1 werden empirische Gegenstände, materiale Zwecke, empirische Triebfedern, physische Gesetze und Glückseligkeit vom moralischen Bestimmungsgrund des Willens ausgeschaltet, d. h. es wird von der Materie der Willensbestimmung überhaupt abstrahiert, um das moralische Gesetz als solches zu exponieren; bei dieser Ausschaltung bzw. Abstrahierung handelt es sich um nichts anderes als um die Rückführung auf die negative Freiheit als Unabhängigkeit von materialen Bestimmungsgründen der Willkür. Von dieser negativen Freiheit ausgehend entfalten sich nun aber auf der anderen Seite durch positive Freiheit (Freiheitskausalität) hindurch moralische Gesetze, der Gegenstand der reinen praktischen Vernunft, moralische Zwecke, die moralische Triebfeder, Glückseligkeit (sowohl moralische wie physische) und die Postulierung der Existenz Gottes; die affirmative Bildung dieser Begriffe wird in der Aussicht auf die moralische, intelligible Welt (das Reich Gottes) vollzogen. Es lassen sich also in der Kantischen Grundlegung der Ethik zwei Phasen feststellen. Die erstere Phase umfaßt den Rückgang vom Materialen der Sinnenwelt zur Freiheit, die zugleich die intelligible Welt eröffnet; die letztere das Wiederaufsteigen aus dieser Freiheit zur Sinnenwelt, das aber nur indirekt durch den Aufbau jenes intellektuellen Begriffsinhalts der moralischen, intelligiblen Welt erfolgt, dessen Komponenten die obengenannten intellektuellen Begriffe in der affirmativen Bildung sind, mit Ausnahme der moralischen Triebfeder, die zur Sinnenwelt gehört; bei diesem Aufbau wird das Materiale wieder eingeräumt. 2. Diese zunächst einander unvereinbar gegenüberstehenden zwei Phasen, die in der Kantischen Grundlegung der Ethik vergleichsweise mühelos entdeckt werden können, lassen sich jedoch nur schwer benennen. Unterdessen sind sie in der Interpretationsgeschichte der Kantischen Philosophie als Gegensatz zwischen ethischem Formalismus und materialen Moralprinzipien bekannt.1 Der Formalismus der Kantischen Ethik besteht aus zwei Momenten. (1) Er gründet alle Einzelpflichten und sittlichen Handlungen auf ein einziges apriorisches Prinzip und macht sich anheischig, jene aus diesem monistisch abzuleiten. 1 Zum Thema des Gegensatzes zwischen ethischem Formalismus und materialen Moralprinzipien können folgende Arbeiten genannt werden: Anderson, G., Die „Materie“ in Kants Tugendlehre und der Formalismus der kritischen Ethik, in: Kant-Studien, Bd.26, 1921; ders., Kants Metaphysik der Sitten - ihre Idee und ihr Verhältnis zur Ethik der Wolffschen Schule, in: Kant-Studien, Bd.28, 1923; Laupichler, M., Die Grundzüge der materialen Ethik Kants, Berlin 1931; Diemer, A., Zum Problem des Materialen in der Ethik Kants, in: Kant-Studien, Bd.45, 1953/54; Schmucker, J., Der Formalismus und die materialen Zweckprinzipien in der Ethik Kants, in: Lotz, J. B. [Hrsg.], Kant und die Scholastik heute, Pullach b. München 1955; Klein, H.-D., Formale und materiale Prinzipien in Kants Ethik, in: Kant-Studien, Bd.60, 1969. G. Andersons Interpretation, die Tugendlehre der MS als eine nachträgliche Ergänzung der Grundlegungsschriften in der weiteren Entwicklung des ethischen Systemsgedankens Kants aufzufassen, ist aus heutiger Sicht - seit der Publikation der „Ethik Menzer“ im Jahre 1924 - ziemlich überholt. Das zeigt auch der 2. Teil der vorliegenden Arbeit, der sich mit den moralphilosophischen Reflexionen Kants befaßt. M. Laupichlers Interpretation wird unten in extenso untersucht. Die Arbeit von J. Schmucker korrigiert teilweise Laupichlers Fehler. Dem Aufsatz von A. Diemer fehlt sachliche Textanalyse; er scheint bloß einen Plan darbieten zu wollen. H.-D. Klein meint mit seinen ,materialen Prinzipien‘ die empirischen Bedingungen, die durch das formale Sittengesetz bestimmt werden. Seine Arbeit betrifft daher die Problematik der Typik und geht, ohne auf die intellektuellen Zweckprinzipien einzugehen, sogleich zur geschichtlichen Weiterentwickling im Deutschen Idealismus über. 2 (2) Dieses einzige Prinzip soll formal sein, d. h. es muß von allem Inhalt bzw. aller Materie abstrahieren.2 Obwohl das erste Moment zum Formalismus zu zählen ist, betrifft es doch die oben umrissene zweite Phase der Grundlegung der Ethik, die auch materiale Bedingungen berücksichtigt; das zweite Moment hingegen geht die erste Phase an. Das erste Moment der monistischen Ableitung enthält in sich nicht nur das formalistische, sondern auch das moralisch-teleologische Element der ,materialen‘ Ethik. Denn (1) in der Ableitung der Einzelpflichten aus dem einzigen apriorischen Prinzip, dem Formalgesetz, ist bereits vorausgesetzt, daß dieses in der intelligiblen, zweckmäßigen Seinsordnung eingebettet ist, die auch materiale bzw. gegenständliche Elemente aufweist; (2) eine Gruppe der Pflichten, die unvollkommenen Pflichten, können sicher nicht allein von diesem formalen Prinzip abgeleitet werden (cf. 3.2.3.b). Daraus erhellt, daß nur das zweite Moment des Formalismus, die Abstrahierung von der Materie bzw. Rückführung auf die Freiheit als Unabhängigkeit von materialen Bestimmungsgründen der Willkür, rein formalistisch ist. Dies auch deshalb, weil in diesem Verfahren des Formalismus jene teleologische Weltordnung noch nicht antizipiert werden muß, die in sich Gegenständliches und Materiales enthält. An und für sich besteht der Gedanke des ethischen Formalismus darin, daß in der Moral die gesetzgebende Form den Willen bestimmt und daß die Materie (Gegenstandsvorstellungen) als moralischer Bestimmungsgrund des Willens ausscheidet. Der Formalismus beruht von daher in nuce auf der Abstrahierung des Bestimmungsgrunds des Willens von sämtlichem Materialen und Empirischen und ist sonach in der negativen Freiheit verankert. Erwägt man also diese Konstellation des ethischen Formalismus im ganzen, so resultiert daraus, daß allein die erste Phase der Grundlegung, Exposition des Formalgesetzes und Deduktion der Freiheit, sich als formalistisch auszeichnen läßt, während die zweite Phase, in die auch die Ableitung der Pflichten gehört, schwerlich so zu bezeichnen ist. Da jedoch mit dem ethischen Formalismus nicht allein die Ausscheidung der Materie gemeint ist, ließe sich die erste Phase der Grundlegung, in Nachahmung der Kantischen Dichotomie von ratio cognoscendi und essendi, kognitiv-formalistisch nennen, während die zweite, wenn das Wort formalistisch noch verwendet werden soll, als essentiell-formalistisch bezeichnet werden kann. Denn die Exposition des Gesetzes und die Deduktion der Freiheit in der ersten Phase weisen kognitiven Charakter auf, während die zweite Phase sich in bezug auf die intelligible Seinsordnung entwickelt und demnach in essentiellen Zusammenhängen steht. Da wir aber für die zweite Phase eine andere Bezeichnung haben können (siehe unten), so benutzen wir den Ausdruck ,essentiell-formalistiche Phase‘ nur selten und nennen die erste Phase der Grundlegung öfters auch bloß ,formalistisch‘. 3. Die Grundlegung der Ethik, die durch die Negation der empirischen Gegenständlichkeit zur Freiheit als Ursprung des Gesetzes vorgedrungen ist - wobei zu beachten ist, daß bereits der Begriff der Freiheit die intelligible Welt als bloßen 2 Vgl. dazu etwa Laupichler, M., op. cit., S.9. 3 Standpunkt außer der empirischen Gegenständlichkeit eröffnet, ohne sie jedoch innerlich und gegenständlich zu bestimmen, und daß der menschliche Wille dadurch schon in der intellektuellen Geisteslage steht -, wendet sich um und steigt von dieser wieder zur intellektuellen Gegenständlichkeit auf. M. a. W.: Das reine sitt- liche Denken aus Freiheit muß sich wieder auf irgendeine Gegenständlichkeit und etwas Materiales beziehen; es muß zur Welt zurückkehren. Diese zweite Phase der Grundlegung entfaltet sich architektonisch in der Linie: Freiheit - moralisches Gesetz - Gegenstand der reinen praktischen Vernunft (das Gute) - Endzweck (das höchste Gut; die intelligible Welt). Sie könnte daher vielleicht die Phase des Aufbaus genannt werden; die erste Phase würde dementsprechend die der Läuterung heißen. Der Aufbau oder der Aufstieg zur intellektuellen Gegenständlichkeit nach der ebengenannten Linie vollzieht sich durch die moralisch-praktische Zwecksetzung der reinen praktischen Vernunft. Denn ebenso wie beim höchsten Gut vom praktischen Endzweck die Rede ist, ebenso hat man es beim Gegenstand der reinen praktischen Venunft (dem moralisch-Guten) mit einem Zweckbegriff zu tun (cf. 3.2.4); die Grundlegung ist also in dieser Phase mit den materialen, intellektuellen Zweckprinzipien beschäftigt. Die zweite Phase kann daher auch moralisch-teleologisch im erweiterten Sinn genannt werden. Das Wort ,moralische Teleologie‘ kann auf die Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung überhaupt angewendet werden durch die Erweiterung seines ursprünglichen Gebrauchs bei Kant, in dem es von diesem nur im Zusammenhang mit der physischen Teleologie verwendet wird (cf. 3.3.1.c). Kants Ethik besteht nicht bloß in der kognitiv-formalistischen Phase der ethischen Grundlegung, sondern auch darin, daß der Mensch als endliches Vernunftwesen von der Freiheit seines Willens ausgehend moralisch-teleologisch nach dem höchsten Gut als Endzweck (dem Reich Gottes) trachtet, nämlich in der moralisch-teleologischen Phase derselben. In der systematischen Entfaltung der moralisch-praktischen Zwecksetzung von der Freiheit bis zum Endzweck kann nun das moralische Gesetz entweder von der Freiheit her als Formalgesetz (cf. 1.3) oder vom Endzweck (Reich Gottes) her als Gottes Gebot (cf. 3.1.1.d) expliziert werden. Ebenso kann in dieser Phase an die Stelle der moralischen Triebfeder entweder das moralische Gesetz aus Freiheit oder die Idee vom Reich Gottes treten (cf. 2.7). In der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung zeigen sich also wiederum zwei Gedankenbewegungen, eine unter dem Aspekt des Fundaments der Ethik als Freiheit und Gesetz, die andere unter dem der intelligiblen Seinsordnung, welche auch in Unterscheidung von der ,moralisch-teleologischen‘ Phase als eine dritte betrachtet werden kann. 4. Die vorliegende Arbeit versucht also, die genannten zwei Phasen und den Übergang von der ersten zur zweiten Phase in der Grundlegung der Ethik bei Kant herauszuarbeiten und dadurch auch auf die Wichtigkeit sowohl des Begriffs der Freiheit als Wohin der ersten Phase und als Wendepunkt von der ersten zur zweiten Phase wie auch der Idee der intelligiblen Welt (Reich Gottes) als latenter Hintergrund der ganzen Gedankenbewegungen der Grundlegung und als Endzweck der zweiten Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung in der praktischen Philosophie Kants hinzuweisen. Jener Begriff der Freiheit und diese Idee vom Reich 4 Gottes gehören zwar beide zur intelligiblen Dimension, stehen aber in ge- gensätzlichem Verhältnis. Der Mensch, dessen Wesen in Freiheit besteht, und Gott, der in der intelligiblen Welt waltet, sind zwei gegensätzliche Pole, die Kants ethische und religionsphilosophische Gedanken ständig sowohl explizit wie implizit bis zum „Opus postumum“ bewegen. In der zweiten Phase der Grundlegung könnte ohne Freiheit das höchste Gut nicht angesetzt, mithin auch das Dasein Gottes nicht postuliert werden. Außer den beiden Phasen der Grundlegung der Ethik läßt sich noch eine synthetisch-progressive Phase, die Begründung der Moral aus der ontotheologischen, intelligiblen Weltordnung oder die Fundierung der ethischen Bedingungen in der Transzendentalphilosophie, annehmen, wie sie etwa von M. Laupichler versucht worden ist (cf. Einl., c). Die Richtung dieser deduktiven Begründung der Ethik aus der intelligiblen Seinsordnung setzt sich gerade der Richtung der zweiten Phase der Grundlegung der Ethik entgegen, welche sich von der Freiheitskausalität aus auf die intelligible Seinsordnung hin - und dies im zweifachen Sinn: vor dem Hintergrund derselben und im Ausblick auf sie - vollzieht, obwohl jene deduktive Begründung und diese zweite Phase sich dieselbe Sache zum Gegenstand machen. Die mögliche synthetische Phase der deduktiven Begründung aber gehört nicht unmittelbar zur Grundlegung der Ethik, weil die Ethik bzw. Moral den menschlichen Willen mit seinen empirischen Bedingungen wie Gefühl der Lust und Unlust, Begierden, Neigungen usw. behandelt und von diesem Willen Bestimmungsgründe ausschalten muß, die bloß gegenständlich und material sind, während die Transzendentalphilosophie lediglich mit reinen Erkenntnissen a priori zu tun hat und eine Weltweisheit der reinen, bloß spekulativen Vernunft ist, die sich auch auf Gegenständlichkeit bezieht. Darüber hinaus wird selbst die transzendentale Theologie im „Opus postumum“ hauptsächlich gemäß der zweiten Phase der Grundlegung der Ethik von moralischem Gesetz und reiner praktischer Vernunft, d. h. vom Fundament der Ethik her begründet. Allerdings ließe sich bei Kant annehmen, daß die zweite Phase der Grundlegung (von Freiheit her auf Gott hin) schon latent die dritte, synthetische Phase (von Gott her auf Freiheit hin) antizipiert. 5. Die Durchführung des Themas läßt sich entsprechend der Zwei-PhasenStruktur der Grundlegung der Ethik und den Gedankenentwicklungen Kants in ihr in drei Teile gliedern. (α) Der 1. Teil erörtert die kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik, d. h. die Exposition des Formalgesetzes (der allgemeinen Formel des kategorischen Imperativs) und der reinen praktischen Vernunft sowie die Deduktion der Freiheit aus diesem Gesetz. Diese drei ethischen Grundbegriffe werden der Moralität zugrundegelegt. Sie wären daher Fundament der Ethik zu nennen. Dabei ist das Augenmerk darauf zu richten, daß Gegenstandsvorstellungen, seien sie von den Sinnen, seien sie von Vernunft, nicht als moralischer Bestimmungsgrund des Willens taugen. Infolgedessen kann auch die Wolffsche Idee der Vollkommenheit, die in der Gegenständlichkeit von Gegenständen besteht, nicht zur moralischen Bestimmung des Willens tauglich ist (cf. 1.2.3). Aufgrund dieser Untauglichkeit von Gegenstandsvorstellungen überhaupt zur moralischen Willensbestimmung wird die 5 Rückführung von der Gegenständlichkeit auf die Freiheit von derselben (d. h. die Abstrahierung von der ganzen Materie) erfordert. (β) Der 2. Teil der vorliegenden Arbeit befaßt sich mit den moralphilosophischen Reflexionen Kants in den siebziger und achtziger Jahren, in denen er unterschiedliche Denkversuche für die ,moralisch-teleologischen‘ Grundlegung der Ethik angestellt hat. Vielleicht könnte die Analyse dieser Reflexionen in diesem Teil der Interpretationsgeschichte der praktischen Philosophie Kants etwas Neues bringen und dazu beitragen, ein richtiges Gesamtbild der Kantischen Morallehre zu gestalten. Die Versuche Kants in ihnen, die Moral unter teleologischem Gesichtspunkt zu explizieren, gehen stets von dem Fundament der Ethik, nämlich Gesetz, reine praktische Vernunft und Freiheit, aus und richten sich von ihm her auf die intelligible Welt (Reich Gottes) als Endzweck; dabei reflektiert er über das erstere zugleich auch von der letzteren her. Kants Analyse und Erörterung der Moral vollzieht sich demnach in der Spannung zwischen der Freiheit und der Idee vom Reich Gottes. Von früh an hat Kant eine teleologische Ordnung im Ausblick und versucht, die Moral auch in dieser Bezogenheit zu theoretisieren (cf. 2.2.3). (1) Dabei wird ein Begriff der Harmonie, die Zusammenstimmung bzw. Übereinstimmung, die in der theoretischen Philosophie als Reflexionsbegriff nur zweitrangige Bedeutung hat, zum Kriterium der Moralität gemacht (cf. 2.3). Das Konsistenzprinzip als Beurteilungsprinzip der Pflichten (principium diiudicationis moralis) beruht nämlich auf der formalen Einheit des freien Willens, die im Prinzip der Zusammenstimmung des freien Willens mit sich selbst verankert ist. Diese ist aber als Zusammenstimmung mit den Gesetzen und mit den Zwecken letzten Endes in der teleologischen Seinsordnung, der Einheit der Zwecke, eingebettet. Die „Reflexionen“ zeigen also, daß Kants Beurteilungsprinzip der Moralität mit dem Begriff der teleologischen Weltordnung eng zusammenhängt. Im moralphilosophischen Gedanken der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst, mit den Gesetzen und mit den Zwecken ist aber zu beachten, daß der Ausgangspunkt doch Freiheit ist. (2) Die Gedankenentwicklungen über Glückseligkeit in den „Reflexionen“ tragen zur Gestaltung der Lehre vom höchsten Gut als Teil der gesamten Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung durch Freiheit wesentlich bei. Das Prinzip der Autokratie der Freiheit nämlich, das mit demjenigen der Autonomie verwandt ist, wird in bezug auf Glückseligkeit entwickelt (cf. 2.4.4), die sich auf die intelligible Welt als Reich Gottes bezieht. Dabei ist wiederum zu beachten, daß die Autokratie der Freiheit Glückseligkeit hervorbringt und nicht diese jene primär bestimmt. (3) Darüber hinaus sucht Kant nicht nur dem moralischen Gesetz, sondern auch der Idee vom Reich Gottes die Rolle der moralischen Triebfeder einzuräumen (cf. 2.7). Dieser Versuch aber mündet nach langen Überlegungen darin, daß sie nominell ausschließlich dem ersteren, nämlich dem Gesetz, zugeschrieben wird. Daraus läßt sich auch ersehen, daß das Prinzip des Ausgangs vom Fundament der Ethik für die Grundlegung der Ethik auch in den moralphilosophischen Reflexionen der siebziger und der achtziger Jahre aufrechterhalten ist. (γ) Die Denkversuche dieser moralphilosophischen Reflexionen werden in der ,kritischen‘ bzw. ,klassischen‘ Endfassung zusammengefaßt, die in den ethischen 6 und religionsphilosophischen Druckschriften in den achtziger und neunziger Jahren veröffentlicht wird. Diese wird im letzten, 3. Teil der vorliegenden Arbeit als die Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung strukturell herausgearbeitet. Mit der Lehre vom Faktum der Vernunft allein kann nicht expliziert werden, warum Kant in den „Reflexionen“ das Gesetz und die Freiheit so beharrlich in bezug auf die Glückseligkeit, den Endzweck und die intelligible Welt zu erörtern versucht hat. Diese Seite der Überlegungen der Kantischen Grundlegung der Ethik darf nicht außer acht gelassen werden. Sie kann erst mit der Annahme der Phase der moralischpraktischen Zwecksetzung zur Klarheit gebracht werden. Die Strukturierung nun dieser ganzen Phase, die von der Freiheit ausgehend über Gesetz zum Endzweck gelangt, steht und fällt mit einer gelungenen Verbindung der Theorie des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft mit der Lehre vom höchsten Gut (cf. 3.2.0). Der in der kognitiv-formalistischen Phase abgelehnte Begriff der Vollkommenheit kann zuletzt in dieser ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung durch den Selbstentwurf der reinen praktischen Vernunft (bzw. die Selbstobjektivierung des reinen sittlichen Denkens) als eine vollkommene moralische, intelligible Welt wieder eingeräumt werden; diese wird nämlich durch den guten Willen (cf. 1.5), der an und für sich vollkommen ist, objektiviert und gebildet. 6. Zuletzt seien einige Beschränkungen der vorliegenden Arbeit erwähnt. (α) Für die Interpretation der Kantischen Grundlegung der Ethik überhaupt gibt es außer dem Weg, den diese Arbeit geht, noch mehrere andere. Zwei davon sind hier zum Vergleich vorzubringen. (1) Die Interpretation kann von der Auflösung der Dritten Antinomie der KrV zum Bereich des moralisch-Praktischen übergehen. Eine solche transzendentale Begründung der Ethik geht von der transzendentalen Freiheit in der theoretischen Philosophie aus.3 Da aber bei Kant die Realität der Freiheit sowohl sachlich als auch entwicklungsgeschichtlich früher ist als die Idealität von Raum und Zeit, worauf die ganze kritische theoretische Philosophie Kants basiert, können wir unsere Interpretation ohne Umwege direkt mit moralischem Gesetz und Freiheit beginnen. (2) Die Interpretation kann sich auf die Analyse der Imperative und der Vier Beispiele in den ethischen Druckschriften konzentrieren, was aber bisher ausreichend ausgeführt worden ist. Unsere Interpretation muß nicht wieder auf eine solche eingehen. (β) Die vorliegende Arbeit zieht die Schriften in den fünfziger Jahren und das Alters- und Nachlaßwerk „Opus postumum“ (1796-1803) nicht in Betracht, sondern beschränkt sich auf die Werke (Druckschriften, Reflexionen und Vorlesungen) von den sechziger bis zu den neunziger Jahren außer dem ebengenannten Nachlaßwerk. Sie kann aber die Grundlage für weitere Forschung sowohl über die früheste Ethik Kants4 als auch über die spätesten ethischen und religionsphilosophischen Gedanken Kants im Alters- und Nachlaßwerk5 schaffen. 3 Ein neuliches Beispiel solcher Zugangsart zur Kantischen Grundlegung der Ethik findet man in der Dissertation von B. Sob, Kants transzendentale Begründung von Ethik, Wien 1985. 4 Zur frühesten Ethik Kants vgl. Henrich, D., Über Kants früheste Ethik, in: Kant-Studien, Bd.54, 1963. 5 Zu Kants ethischen und religionsphilosophischen Gedanken im „Opus postumum“ vgl. Wimmer, 7 (γ) Eine nähere Analyse der Verhältnisse zwischen Freiheit und moralischem Gesetz, insbesondere der Genese des Gesetzes als des reinen Denkens aus der Freiheit, fehlt der vorliegenden Arbeit. Es wäre aber vielleicht sinnvoller, diese Verhältnisse nicht allein in den zu diesem Problem nur dürftige Ergebnisse einbringenden ethischen und religionsphilosophischen Gedanken Kants, sondern in weiteren Zusammenhängen und Aussichten zu erörtern. Die christliche Tradition, zu der auch die Kantische Ethik gehört, bietet einer solchen Problematik etwa die paulinische Erlösungslehre und die lutherische Rechtfertigungslehre an. (δ) Ein Ausblick auf die Möglichkeit, die voneinander getrennten zwei Phasen der ethischen Gundlegung wieder in der ethischen Geisteslage eines Menschen zu einer höheren, reinen Einheit zu bringen, der Einheit der Geisteslage, in der etwa nach Heraklit „der Weg hinauf hinab einer und derselbe“6 ist, ist in der vorliegenden Arbeit nicht eröffnet. Es handelt sich dabei um einen tiefen Sinn des Begriffs der Freiheit als des Wendepunktes von der ersten Läuterungsphase zur zweiten Aufbauphase. (b) Analytisch-regressives und synthetisch-progressives Verfahren in der Grundlegung der Ethik. In Frage käme auch, die Phase der kognitiven formalistischen Grundlegung (Exposition des Gesetzes und Deduktion der Freiheit) und die Phase der moralischpraktischen Zwecksetzung (die sich aus der Theorie des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft und der Lehre von dem höchsten Gut und dessen Postulaten rekrutiert) gemäß der Kantischen wissenschaftlichen Methode je analytischregressiv und synthetisch-progressiv7 zu nennen. 1. Unter der analytisch-regressiven und der synthetisch-progressiven Methode versteht man in erster Linie die wissenschaftliche Forschungs- bzw. Darstellungsmethode, wobei die Synthese sich meistens als Komplementärverfahren der Analyse nachvollzieht, die wesentlich wissenschaftliche Untersuchung leitet und trägt. Analytische Methode wird in der Überlieferung erstmals von Aristoteles als R., Kants kritische Religionsphilosophie, Berlin 1990, Dritter Teil, S.219ff. 6 Heraklit, Fragm. 60, in: Kranz, W., Vorsokratische Denker, o. O. 4 1974, S.71. 7 Zu analytischer und synthetischer Methode bei Kant vgl. Prol., § 5 Anm., IV 276: Analytische Methode bedeutet, „daß man von dem, was gesucht wird, als ob es gegeben ist, ausgeht und zu den Bedingungen aufsteigt, unter denen es allein möglich“ ist; „sie könnte besser die regressive Lehrart zum Unterschiede von der synthetischen oder progressiven heißen“; Log., §117, IX 149: „Die analytische Methode ist der synthetischen entgegengesetzt. Jene fängt von dem Bedingten und Begründeten an und geht zu den Prinzipien fort (a principiatis ad principia), diese hingegen geht von den Prinzipien zu den Folgen oder vom Einfachen zum Zusammengesetzten. Die erstere könnte man auch die regressive, sowie die letztere die progressive nennen“; XVI 786-9 (Refl.3340-3344 zu Meiers Kompendium §§422-425); XXIV 291 (Logik Blomberg), 481 (Logik Philippi), 683 (Logik Busolt), 779 (Logik Dohna-Wundlacken = Kowalewski, A., Die philosophischen Hauptvorlesungen Immanuel Kants, München 1924, II. Logik, S.499); Inaugural-Dissertation, Sectio I, §1, II 387f; Refl.3890, XVII 329 Z14, Θ (1766-68); Fortschritte, XX 295; etc. 8 damals schon bekannt vorgestellt.8 Bei der Lösung geometrischer Konstruktionsaufgaben verfährt man ihm zufolge analytisch, d. h. man geht von einer schon vollständig konstruierten Figur als Zweck aus, überlegt die ihr nächste Voraussetzung (das nächste Mittel) und wiederum deren Voraussetzung, bis man die letzte Voraussetzung erlangt, mit der man die wirkliche Konstruktion dieser Figur anfangen kann. Das Letzte in dieser regressiven Analyse ist das Erste in der progressiven Verwirklichung. Mit dieser Lösungsmethode der Konstruktionsaufgabe in der Nikomachischen Ethik ist die Analyse als Rückführung einer gegebenen Sache auf ihre ersten Bedingungen bzw. Prinzipien exemplifiziert. In der Neuzeit befaßt sich Descartes mit diesem methodologischen Thema. In der Antwort auf die zweiten Einwände gegen die „Meditationes“ teilt er die Beweisarten in Analysis (Auflösung) und Synthesis (Zusammensetzung) ein. Die erstere „zeigt den wahren Weg, auf dem eine Sache methodisch und gleichsam a priori gefunden“ wird; die letztere hingegen „geht den entgegengesetzten Weg und beweist gleichsam a posteriori ... den Schlußsatz“. Während sich die euklidische Geometrie in ihren Schriften allein der Synthesis bedient, geht Descartes selber in den „Meditationes“ „ausschließlich den Weg der Analysis“.9 Auch für Leibniz stellen Analysis und Synthesis Grundbegriffe seiner philosophischen Methodologie dar.10 Es ließe sich nun annehmen, daß in G. F. Meiers „Vernunftlehre“ und „Auszug aus der Vernunftlehre“ unter dem Einfluß von Leibniz auch der eben dargestellte kartesische allgemeine Begriff von Analysis und Synthesis de facto überliefert ist.11 Da bei der unmittelbaren Quelle des Kantischen Begriffs von analytisch-regressiver und synthetisch-progressiver Methode, der in seinen Druckschriften, Vorlesungen und Reflexionen auftritt, von keinem anderen als G. F. Meier die Rede ist, so beschränkt sich der tatsächliche Gebrauch dieses Begriffspaars bei Kant auf die allgemeine wissenschaftliche Methodologie. Im Sinne dieser allgemeinen wissenschaftlichen Forschungsmethode sagt Kant - auch parallel zu Descartes -: „Die Methode der Philosophie, aber besonders der reinen Philosophie, ist analytisch.“12 Dementsprechend versucht er auch im Gegensatz zu Rousseau vom gesit8 Vgl. dazu Aristoteles, Nikomachische Ethik, III, 5, 1112b, in der Übersetzung von F. Dirlmeier, Stuttgart 1990, S.63. 9 Descartes, R., Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen, übersetzt von A. Buchenau, ND Hamburg 1994 (Leipzig 1 1915), S.140f. 10 Diese Begriffe erscheinen an verschiedenen Stellen der Schriften von Leibniz, der auch einen eigenen Aufsatz zu diesem Thema verfaßte. Vgl. hierzu Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, hrsg. von C. J. Gerhardt, ND Hildesheim 1960-61, 1978, VII, 292-98 (dt.: Die Methoden der universellen Synthesis und Analysis, in: G. W. Leibniz, Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Bd.1, übersetzt von A. Buchenau, Hamburg 3 1966 (1 1904), S.39-50; engl.: Of universal Synthesis and Analysis, in: Leibniz, Philosophical Writings, ed. G. H. R. Parkinson, London 1973, S.10-17). 11 Vgl. Meier, G. F., Auszug aus der Vernunftlehre, Halle 1752, §§422-426 (wiederabgedruckt: Kant, AA, XVI 786-789; auch der §464 der „Vernunftlehre“, in dem die analytische und die synthetische Methode erörtert sind, ist in AA, XVI 786f abgedruckt). 12 Logik Philippi, XXIV 481. 9 teten Menschen als faktisch Gegebenem anzufangen und analytisch zu verfahren.13 Die ganze Grundlegung der Ethik verfährt grundsätzlich analytisch-regressiv im Sinne der allgemeinen wissenschaftlichen Forschungsmethode, und das synthetischprogressive Verfahren wird nur ab und zu als rückläufige Zusammenfassung von durch Analyse gewonnenen Ergebnissen komplementär vorgenommen.14 Dabei ist die Beurteilung dessen, ob ein Teil einer ganzen Ausführung analytisch oder synthetisch ist, nicht a priori zu bestimmen, sondern hängt davon ab, was als das zu analysierende gesamte Phänomen gewählt wird, und zu welchen ersten Prinzipien dieses durch die Analyse geführt wird; er kann daher je nach seinen Umständen als analytisch oder als synthetisch ausgelegt werden. Daß Kant nun die ersten zwei Abschnitte der GMS analytisch und den letzten, dritten synthetisch nennt,15 rührt grundsätzlich von dem allgemeinen wissenschaftlich-methodologischen Gebrauch des Begriffspaars her, obwohl diese Benennung von bestimmten Umständen abhängt. Denn der letzte Abschnitt verwendet für die Erklärung der Verbindlichkeit des kategorischen Imperativs systematisch und architektonisch die Ergebnisse der ihm vorangehenden, analytisch geführten zwei Abschnitte, obgleich auch er gemäß der analytischen Untersuchungsmethode ausgeführt wird. Daß die KrV „durchaus nach synthetischer Lehrart abgefaßt sein mußte“,16 besagt lediglich, daß, obwohl die Untersuchtung selbst analytisch durchgeführt worden ist, ihre gesamten Ergebnisse systematisch und architektonisch eingeordnet und dargestellt werden müssen. Jene Interpretation von M. Laupichler, die Moral und ihre Komponenten überhaupt aus der teleologischen Seinsordnung zu deduzieren, welche unten in Betracht gezogen wird, läßt sich schließlich dahingehend verstehen, daß sie die von Kant durch die analytische Methode erworbenen Ergebnisse vom ersten Prinzip einer intelligiblen Welt her erneut synthetisch-progressiv zusammenzufassen versucht. (Sie kann aber nicht für synthetisch-progressiv im sogleich unten dargelegten, besonderen Sinn genommen werden. Denn in Kants Ethik gilt die unbedingte Gesetzlichkeit aus Freiheit als unmittelbarer moralischer Bestimmungsgrund des Willens und wird für den primären Grund der Ethik genommen werden, und der Endzweck und die teleologische Seinsordnung können erst durch die Erweiterung dieser Gesetzlichkeit aus Freiheit ihre sekundäre Gültigkeit erhalten, obwohl sie latent das ganze ethische Denken Kants geleitet und reguliert haben mögen.) Also lassen sich unter dem Aspekt der allgemeinen wissenschaftlichen Forschungs- und Darstel13 Vgl. Bemerkungen, XX 14: „Rousseau verfährt synthetisch und fängt vom natürlichen Menschen an, ich verfahre analytisch und fange vom gesitteten an.“ 14 Die „synthetische Wiederkehr“, in der alle Teile, die vorher analytisch gegeben worden sind, in ihrer wechselseitigen Beziehung aufeinander aus der Idee des Ganzen architektonisch und durch die innigste Bekanntschaft mit dem System ins Auge gefaßt werden (KpV, V 10 <A18f>), ließe sich allgemein-methodologisch als rückläufige Zusammenfassung der analytisch erworbenen Ergebnisse verstehen. 15 GMS, IV 392 <BXVI>, 445 <B96>. 16 Prol., IV 263. Übrigens handelt es sich in der Formulierung, daß die Analysis die Synthesis voraussetzt (KrV, III 107 <B130>, 91 <B103>), bei der letzteren nicht um die wissenschaftliche synthetische Methode, sondern um die Verstandessynthesis, wodurch die Gegenstände allererst gegeben werden, mit welchen die erstere sich beschäftigen kann. 10 lungsmethode sowohl die Phase der kognitiven formalistischen Grundlegung als auch die Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung als ein Anwendungsfall der analytisch-regressiven Methode verstehen. Diese analytisch-regressive Grundhaltung Kants zur philosophischen Forschung zeigt sich auch in seinem erkenntniskritischen Motiv überhaupt, welches mit dem Rückgang vom πρότερον πρὸς ἡμᾶς zum πρότερον τῆͺ ϕύσει17 bei Aristoteles vergleichbar wäre. Die ganze Bewegung der ethischen Untersuchung Kants vom Gesetz zur Freiheit und von dieser übers Gesetz zur intelligiblen Welt als Endzweck ist durch diesen Geist der analytischen Regression zum der Natur nach Früheren im allgemeinen wissenschaftlichmethodologischen Sinn geleitet. 2. Nun werden in den “‘Meditationes“ von Descartes bekanntlich Gegenstände der cogitatio durch die Methode des Zweifels auf die intuitive Gewißheit des Seins des cogito zurückgeführt, das wegen seiner Endlichkeit auch das Dasein Gottes deduzieren läßt. Von der Gewißheit der res cogitans und des Daseins Gottes aus können nun aber wieder die in der Rückführung geleugneten Gegenstände, etwa materiale Dinge, konstitutiv eingeräumt werden. Diesen beiden einander entgegengesetzten Richtungen der Untersuchungen der „Meditationes“ entsprechen die Rückführung der verwickelten und dunklen propositiones auf einfachere, und letzten Endes auf die allereinfachsten, und das stufenweise Hinaufsteigen von der Intuition der letzteren zur Erkenntnis aller anderen in Regel 5 der „Regulae“.18 In den „Meditationes“ also, in denen Descartes ausschließlich den Weg der Analyse geht, lassen sich wiederum ein analytisch-regressives und ein synthetisch-progressives Verfahren erkennen. Ebenso sehen Kant-Interpreten in der sogenannten Kantischen „transzendentalen Methode“ beides Verfahren.19 Nach diesem von Kant selbst nicht ausdrücklich gemachten besonderen Gebrauch des methodologischen Begriffspaars von ,analytisch‘ und ,synthetisch‘, in dem der Wendepunkt von der analytischen Rückführung zum synthetischen Wiederaufsteigen als transzendental-subjektives erstes Prinzip gebildet wird, ließe sich die Phase der kognitiven formalistischen Grundlegung (Exposition des Gesetzes sowie der reinen praktischen Vernunft und Deduktion der Freiheit; Kritik der praktischen Vernunft) als analytisch-regressiv, die Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung (Deduktion des Gesetzes aus Freiheit, der Einzelpflichten aus Gesetz und 17 Vgl. dazu Arist., Top., Z, 4; Phys., A, 1; Anal. pr., B, 23; Anal. post., A, 2. Vgl. Descartes, R., Regulae ad directionem ingenii, Lat.-Dt., kritisch revidiert, übersetzt und herausgegeben von H. Springmeyer, L. Gäbe und H. G. Zekl, Hamburg 1973, S.28f (in der Ausgabe von Adam und Tannery, X, 379). Beide Verfahren in Regel5 der „Regulae“ zeigen sich auch in Regel2 und 3 des 2. Kapitels des „Discours“. 19 Vgl. dazu etwa Kaulbach, F., Immanuel Kant, Berlin 2 1982, S.320f: „Man hat von der ,transzendentalen Methode‘ bei Kant gesprochen. Diese kann man grob so charakterisieren: Zunächst ,isoliert‘ Kant die reine Vernunft in verschiedenen Richtungen: als theoretische und als praktische Vernunft. Er stellt sie auf den Stand ihrer eigenen Spontaneität und reinigt sie von allen empirischen Beimischungen. Ist dieser Schritt geschehen, welcher etwa der traditionellen ,analytischen Methode‘ entspricht, dann folgt eine Umwendung des philosophischen Gedankens: die reine Vernunft muß ihren Weg wieder zur Unmittelbarkeit der Empfindung des Wahrnehmens und sinnlichen Anschauens zurückfinden. Das ist dem Verfahren der ,synthetischen Methode‘ analog.“ 18 11 Konstitution des höchsten Guts als Endzweck) als synthetisch-progressiv bezeichnen, obgleich beide Phasen im allgemeinen wissenschaftlich-methodologischen Sinne insgesamt analytisch-regressiv sind. Den Wendepunkt von der analytischregressiven zur synthetisch-progressiven Phase bildet die negative Freiheit, die als transzendental-subjektives erstes Prinzip eingesetzt ist. J. Schmuckers Verwendung des methodologischen Begriffspaars auf beide Phasen der Grundlegung der Ethik hinsichtlich des Zweckbegriffs kann nur in diesem besonderen, transzendentalen Gebrauch desselben gerechtfertigt werden. Er deutet nämlich zunächst darauf hin, daß in den Grundlegungsschriften die unvollkommenen Pflichten aus dem Gesetz auf materiale Zwecke hin abgeleitet oder selber für solche gehalten werden können und daß man in diesem Punkt eine Verbindungslinie zwischen jenen Schriften und der MS finden kann, und bemerkt dazu, der Gedanke der materialen Zwecke in unvollkommenen Pflichten scheine doch der These zu widersprechen, daß der Zweck-an-sich-selbst im kategorischen Imperativ von allen materialen Zwecken durchaus zu abstrahieren sei.20 Ihm zufolge handelt es sich dabei jedoch „nicht so sehr um einen Widerspruch als vielmehr um die unvermeidliche Überkreuzungen zweier notwendiger Gedankenbewegungen“: Bei der ersten Gedankenbewegung sei von der Ausschaltung der materialen Zwecke von der Begründung des obersten Prinzip der Moralität die Rede, bei der zweiten von der Ableitung der Pflichten der spezifisch menschlichen Art sowie der dabei notwendigen Berücksichtigung der materialen Zwecke. Er nennt jene analytisches, diese synthetisches Verfahren.21 Da aber diese Wortverwendung Schmuckers nicht strikt Kantisch ist - bei Kant gilt lediglich der allgemeine wissenschaftlich-methodologische Gebrauch -, bezeichnet die vorliegende Arbeit versuchsweise das analytische Verfahren der Grundlegung als die Phase der kognitiven formalistischen Grundlegung und das synthetische als die der moralisch-praktischen Zwecksetzung; diese Bezeichnung, die die offensichtliche Differenzierung der Kantischen Grundlegung der Ethik nicht sehr treffend zum Ausdruck bringt, ist auch eine Übergangslösung. Wird die ethische Eigentümlichkeit berücksichtigt und bedenkt man dabei auch, daß Kants Ethik Gesinnungsethik ist, so ließen sich vielleicht beide Phasen als Läuterungs- und Aufbauphase auszeichnen. Im 2. Abschnitt der GMS, der von Kant überhaupt als analytisch im allgemeinen Sinn bezeichnet ist, liegen nun also wieder - mit den Worten von Schmucker - ein analytisches und ein synthetisches Verfahren im besonderen Sinn beschlossen, welches letztere die Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung darstellt. 20 Vgl. Schmucker, J., Der Formalismus und die materialen Zweckprinzipien in der Ethik Kants, in: Lotz, J. B. [Hrsg.], Kant und die Scholastik heute, Pullach b. München 1955, S.190-192. 21 Vgl. ibid., S.193. 12 (c) Abgrenzung von der Interpretation M. Laupichlers. M. Laupichlers Arbeit,22 die den Zusammenhang zwischen Formalismus und intelligibel-materialem Teil in der Kantischen Ethik unter dem Primat des letzteren erörtert, stellt einen Meilenstein in der Interpretationsgeschichte der Kantischen Moralphilosophie dar, indem sie die bis dahin vorherrschende einseitige formalistische Auffassung der Kantischen Ethik ins Prüfungsstadium gebracht hat; sie läßt sich deshalb heute als ein Klassiker in diesem Problembereich ansehen. Seine Argumentation ist kühn und verwegen auf eine einzige Hauptthese hin durchgeführt, jedoch auch systematisch dicht und umfassend, und vor allem konsequent durchdacht, so daß man heute noch dieser Arbeit aufschlußreiche Hinweise entnehmen kann. Die modernen Interpretationen der Kantischen Philosophie können mit wenigen Ausnahmen hinsichtlich der Gesamtperspektive sowie hinsichtlich der Kreativität und Aufrichtigkeit der Interpretation diese Arbeit kaum übertreffen, obwohl sie in Einzelheiten korrekter und ausführlicher, im ganzen aber vorsichtiger und zurückhaltender ausgearbeitet sind. Auch die vorliegende Arbeit zählt sich zu solchen Interpretationen. Laupichler hat nun seine Arbeit zwar vor dem Erscheinen des Bd.XIX der Akademie-Ausgabe veröffentlicht, konnte aber dafür schon Menzers Ethik-Vorlesung („Ethik Menzer“) und Reickes „Lose Blätter“ benutzen und war dadurch in der Lage, auch von den moralphilosophischen Reflexionen Kants im Umriß Kenntnis zu nehmen. Da seine Arbeit bereits teilweise zu einem ähnlichen Ergebnis der Untersuchung der moralphilosophischen Reflexionen Kants wie die vorliegende Arbeit gelangt ist, ist es erforderlich, vorerst die Unterschiede zwischen beiden Arbeiten klar zu machen.23 1. Obwohl Laupichlers Arbeit eine Streitschrift ist, die angesichts der Kritik M. Schelers am Formalismus der Kantischen Ethik nicht unmittelbar für diesen plädiert, sondern im Gegenteil die materialen Grundzüge derselben hervorhebt, um damit die Voraussetzung jener Formalismus-Kritik zu Fall zu bringen und diese zu vereiteln, so gesteht er doch zu, daß in beiden Grundlegungsschriften, der GMS und der KpV, der Formalismus vorherrscht. Er nimmt aber nicht den gesamten formalen Teil der Kantischen Ethik in Schutz, sondern nur eine Schicht desselben, d. h. er differenziert ihn in subjektiv-formale und objektiv-formale Schicht. Die erstere betrifft die Bildung der moralischen Handlung durch die Grundhaltung des handelnden Subjekts, die in der Unbedingtheit der Gesetze und somit in der Freiheit des Willens fundiert ist, und umfaßt dementsprechend den guten Willen, Verbindlichkeit, Pflicht, Nötigung, Freiheit usw. Die letztere Schicht bilden die dem obersten Formalprinzip (der allgemeinen Formel des kategorischen Imperativs) gewidmeten Partien. Nach Laupichler ist jene subjektiv-formale Schicht der Grundlegung bei weitem wichtiger als diese objektiv-formale; formalistische Inter22 Laupichler, M., Die Grundzüge der materialen Ethik Kants, Berlin 1931. Auf die Unterschiede zwischen beiden Arbeiten in bezug auf die „Fundamentalprinzipien der materialen Ethik Kants“ wie Glückseligkeit, Vervollkommnung, Zweck-an-sich-selbst und systematische Ordnung (ibid., S.36-86) können wir uns nicht einlassen, weil die Ausführung ihrer Analyse in allen Details diese Einleitung zu lange machen würde. 23 13 pretationen, die die erstere, wichtigere subjektive Schicht dem Formalprinzip der objektiv-formalen Schicht unterordnen, seien daher falsch. Denn Kants Lehre von der Moralität beziehe sich primär nicht auf das Moment einer allgemeinen Gesetzgebung im Formalprinzip, sondern basiere unmittelbar auf den subjektiv-formalen Prinzipien: Unbedingtheit der Gesetze und Freiheit des Willens.24 Aus dieser Position Laupichlers aber folgt u. E. auch, daß Moralität, die im subjektiv-formalen Teil der Ethik zu fundieren ist, nicht auf den empirisch dargestellten ,materialen‘ Gesetzen, sondern auf der Befreiung vom Empirischen (Freiheit) durch die Unbedingtheit der Gesetze beruht; diesen mag andererseits freilich die Möglichkeit nicht zu nehmen sein, als Gesetze des Seins in der intelligiblen Seinsordung zu gelten. Bei Laupichlers Betonung des subjektiv-formalen Teils handelt es sich also darum, hervorzuheben, daß Moralität auf der Freiheit basiert, zu deren Sicherung die Materialität überhaupt einmal auszuschalten ist. Diese Differenzierung nun des formalen Teils der Kantischen Ethik und die Betonung der subjektiv-formalen Schicht werden auch in der vorliegenden Arbeit vorgenommen: Die propositional-objektive kognitiv-formalistische Grundlegung beruht auf der psychologisch-subjektiven Grundlegung, und die letztere ist bei weitem wichtiger (cf. 1.1 und 1.2). Denn Moralität muß sich primär auf die Unbedingtheit des reinen sittlichen Denkens und die Freiheit des Willens, mit einem Wort auf die Realität der Freiheitskausalität, gründen. Jedoch beschränkt Laupichler bei der Gewichtlegung auf den subjektiv-formalen Teil die Geltungskompetenz des Formalprinzips auf dessen wörtlichen, oberflächlichen Sinn: Das im Formalprinzip zum Ausdruck gebrachte Moment der Allgemeinheit bzw. allgemeinen Gesetzgebung scheide nur die legalen (pflichtmäßigen) Handlungen von den illegalen; erst der freie, aus dem innersten Kern der Person quellende Akt der willentlichen Stellungnahme für das Gesetz bloß aus Achtung, der im subjektiv-formalen Teil thematisiert wird, mache aus der legalen Handlung eine moralische.25 Diese Beschränkung der Funktion des kategorischen Imperativs durch Laupichler kann aber nicht gerechtfertigt werden. Der kategorische Imperativ liefert in der Tat das Kriterium der Moralität und nicht der Legalität. Denn er ist keine logizistische Formel der Allgemeinheit, sondern impliziert auch schon das von Laupichler betonte Subjektive, nämlich die Unbedingtheit des moralischen Gesetzes und die Freiheit des Willens, sofern er, obwohl er im Satz bloß die Allgemeinheit ausdrückt, auf jener Distanzierung von materialen Bestimmungsgründen des Willens, demnach dem Freisein und Unbedingtsein vom Empirischen, basiert, die in der psychologisch-subjektiven formalistischen Grundlegung nachgewiesen wird. Während Laupichler das Formalprinzip, wie sogleich dargestellt wird, reduktionistisch aus den ,materialen‘ Gesetzen der intelligiblen Seinsordnung zu deduzieren versucht, so daß es seine subjektiven Charakteristiken der Unbedingtheit und Freiheit verliert, verankern wir es zunächst unter erkenntniskritischem Gesichtspunkt fest im anthropologisch-subjektiv betrachteten Faktum der Vernunft als Sichaufdrängen der moralischen, unbeding24 25 Vgl. ibid., S.98-103. Vgl. ibid., S.102. 14 ten Gesetzlichkeit aus Freiheit. Unter dem essentiellen, moralisch-teleologischen Gesichtspunkt aber kann die formale Gesetzlichkeit aus der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst als mit den Zwecken deduziert werden, welche sich auf die teleologische Seinsordnung beziehen. Nun grenzt Laupichler die ,materialen‘ Gesetze gegen das Formalprinzip als Beurteilungsprinzip ab. Jene sind ihm zufolge in der intelligiblen Seinsordnung beheimatet, und dieses sei nichts als ihr subjektiv-formaler Repräsentant, auf den sie reduziert werden, um mit der Grundhaltung des handelnden Subjekts verbunden zu werden. Daß das Formalprinzip aus den ,materialen‘ Gesetzen deduziert werden soll, liege in der Absicht Kants, den subjektiv-formalen und den objektivmaterialen Teil der Ethik miteinander zu verbinden, welcher etwa in der Tugendlehre der MS und der Ethik Menzer (der von P. Menzer edierten Ethik-Vorlesung Kants) präsentiert ist und ,materiale‘ Gesetze thematisiert. Diese Deduktion stellt demnach die Begründung der Moralität als des kognitiv Vorgegebenen aus der intelligiblen Seinsordnung als dem essentiellen Grund dar und kann eben als ein Anwendungsfall der synthetisch-progressiven Lehrart verstanden werden. In der reduktionistischen Deduktion des Formalprinzips aus den ,materialen‘ Gesetzen zum Zwecke der Verbindung des objektiv-materialen mit dem subjektiv-formalen Teil der Ethik wollte Kant, so Laupichler, jeden Hinblick auf einen objektiven Sinn der Moral, wie etwa das Weltbeste, ausschalten, um damit die Motivation des Willens durch Gesetze, wobei es auf die Reinheit desselben ankommt, zu ermöglichen. Die Subjektivierung der Gesetze führt also deren Formalisierung mit sich. Somit sei der Bestimmungsgrund des Willens in die formale Allgemeinheitsformel des Formalprinzips verlegt worden.26 Mit dieser Deduktion des Formalgesetzes aus ,materialen‘ Gesetzen aber müßte Laupichler u. E. zugeben, daß zur Einräumung der reinen Moralität die Abstrahierung von aller Materie, mithin auch von „Materie2 “ (siehe unten), unabdingbar ist. Ohne diese Abstrahierung nämlich könnten die Reinheit des Willens und mithin das Formalprinzip nicht zustandegebracht werden. Sie impliziert, daß auch die Materialität der ,materialen‘ Gesetze ausgeschaltet werden soll. Die Materialität der ,materialen‘ Gesetze in der intelligiblen Seinsordnung ist aber für Laupichler die unerläßliche konstitutive Bedingung dieser Gesetze, weil diese in der Seinsordnung ihre qualitative Vielheit beibehalten müssen. Die Materie könne nicht ausschließlich der empirischen Sphäre zugerechnet werden. Denn andernfalls könnten die ,materialen‘ Gesetze nicht für alle vernünftigen Wesen überhaupt und mithin auch nicht für Gott gelten. Damit also die Materialität in den ,materialen‘ Gesetzen, die in der teleologischen Seinsordnung beheimatet sind, gesichert werden kann, unterscheidet Laupichler zwischen der Materie, die von der Moralität ausgeschaltet werden soll, und der Materie, die in den ,materialen‘ Gesetzen aufbewahrt bleiben soll. Die erstere heißt „Materie1 “, die empirische Handlungen, Gegenstände und Absichten (empirisch-subjektive Zwecke) umfaßt, welche zu erwarten, zu bewirken und zu verwirklichen sind. Das Abzielen auf solche Ma26 Vgl. ibid., S.105. 15 terie läuft auf die eudämonistische Erfolgsethik hinaus. Materie1 müsse demnach aus der Ethik der ,materialen‘ Gesetze ausgeschaltet werden, und schon hier zeigt sich u. E. gewissermaßen der formalistische Grundzug in Laupichlers Interpretation. Gegen Materie1 grenzt sich nach Laupichler die letztere Materie, „Materie2 “, ab, worunter die Handlung an sich selbst, in der die Gesetze sich manifestieren, die qualitative Bestimmung der Maxime selbst im Gegensatz zu ihrem außerhalb ihrer liegenden Objekt (Materie1 ) und die objektiven Zwecke entgegen allem zu bewirkenden Zweck (Materie1 ) in der Tugendlehre der MS zu verstehen sind.27 Um also unter dem Aspekt des erkenntniskritischen Rückführungsmotivs vom pathologisch bedingten Willen zum reinen Willen zurückzugehen, oder damit die ,materialen‘ Gesetze in der intelligiblen Seinsordnung unter dem Aspekt der umgekehrten, synthetisch-progressiven Richtung sich durch ihre Subjektivierung mit dem reinen Willen verbinden können, werden das Formalprinzip und die Abstrahierung von der Materie benötigt. Diese Notwendigkeit wird auch von Laupichler nicht bestritten. Unter dem letzteren Aspekt muß u. E. auch er die gesamte Materie ausschalten. Unter dem ersten Aspekt aber, nämlich dem der kognitiven Rückführung auf die Freiheit, erkennt er zunächst lediglich Materie1 als Gegenstand der Ausschaltung an und weist scharf darauf hin, daß Kant zur Deduktion des Formalprinzips (u. E. somit auch des reinen Willens) nur Materie1 ausdrücklich ausschaltet und diese dann unvermittelt durch den Inbegriff der Materie, „Materie3 “ („Materie3 = Materie1 + Materie2 .“), ersetzt.28 Diese Ersetzung ist u. E. bei Kant unvermeidlich, weil sonst weder der reine Wille noch das Formalprinzip eingeräumt werden könnten. Sie ist aber für Laupichler verdächtig, weil er Materie2 zugunsten seiner ,materialen‘ Gesetze sicherstellen muß. Nun beruht bei Kant die Unvermeidlichkeit der Ausschaltung der gesamten Materie in der Deduktion des Formalgesetzes und der Willensfreiheit darauf, daß der materiale Bestimmungsgrund überhaupt den Willen nicht moralisch, d. h. unbedingt, zu bestimmen vermag, sondern bloß Heteronomie des Willens herbeiführt;29 die moralische Bestimmung des Willens kann nur aus der Freiheit des Willens (Laupichler nennt sie „metaphysische Freiheit“), d. h. aus der Sphäre, die durch die Abstrahierung von aller Materie zu eröffnen ist, durch reine praktische Vernunft getroffen werden; selbst die ,materialen‘ Gesetze der intelligiblen Seinsordnung in ihrer Einzelheit würden, wenn sie empirisch hypostasiert würden, um den Willen unmittelbar bestimmen zu können - ohne solche empirische Hypostasierung können sie als materiale Bestimmungsgründe den Willen nicht primär und unmittelbar bestimmen -, den Willen seiner Autonomie berauben und ihn empirisch und totalitär unterdrücken; dazu aber fehlt ihnen die theoretisch-objektive Realität (sie erhalten praktische Realität erst durch die Erweiterung des Formelgesetzes aus Freiheit, das praktische Realität an sich hat); sollten sie ihn moralisch, d. h. aus seiner Freiheit bestimmen - als Idee bestimmen sie ihn ja tatsächlich -, müssen 27 Vgl. ibid., S.20-23. Vgl. ibid., S.21. 29 Vgl. dazu zunächst KpV, V 39-41 <A68-71>; GMS, IV 441-444 <B88-95>. 28 16 sie, wie oben nach Laupichler dargetan wurde, zuerst subjektiviert und formalisiert werden und ihre Materialität in ihrem Repräsentanten, nämlich dem Formalgesetz, aufheben, das praktische Realität hat, so daß es den freien Willen bestimmen kann; erst dadurch kann der Wille aus seiner Freiheit autonom einzelne moralische (,materiale‘) Gesetze bilden, die ihn demnach ohne autoritäre Herrschaft bestimmen, wobei nicht auszuschließen ist, daß die Idee der Gesetze des Seins in der intelligiblen Ordnung als Richtlinie der moralischen Bestimmung des freien Willens dienen kann, weil die Gesetze des Seins ja der Ordnung der Dinge nach a priori dem kognitiven Formalgesetz vorgeordnet (dies mag wohl die eigentliche Absicht von Laupichler sein, materiale Grundzüge der Kantischen Ethik hervorzuheben). Daher muß die Grundlegung der Ethik einmal formalistisch durch das Verfahren der Abstrahierung von aller Materie in die negative Freiheit zurückgehen, wozu die psychologisch-subjektive formalistische Grundlegung der Ethik als Rückführung auf die Freiheit im „subjektiv-formalen Teil der Kantischen Ethik“ erfordert wird. Laupichler erachtet diese Bedeutung der „metaphysichen Freiheit“ nicht genug als für die Kantische Grundlegung der Ethik entscheidend, obschon er sie genau zur Kenntnis nimmt.30 Daher läßt er auch bei der Darstellung der Differenz zwischen Willen und Willkür31 den Begriff der ursprünglichen Freiheit der intelligiblen Willkür in der Religionsschrift von 1793, nämlich das moralische Gesetz als das gute Prinzip anzunehmen, außer acht, der erst in einer tieferen Schicht angetroffen werden könnte als in der von ihm vorgestellten teleologischen Seinsordnung. Daß also der ethische Formalismus und der Begriff der Freiheit bei Kant als philosophiegeschichtliche Errungenschaft eingeschätzt werden können, ist nicht ohne Grund allgemein anerkannt, auch wenn sie lediglich eine Phase der Kantischen Grundlegung der Ethik darstellen. Da für Kant zur Aufstellung des moralischen Bestimmungsgrunds des Willens die Abstrahierung von aller Materie unerläßlich ist, ist es für ihn folgerichtig, auch in der Deduktion des Formalprinzips im 1. Abschnitt der GMS von der Vorstellung des Gesetzes, das nach Laupichler ,material‘ ist, zur allgemeinen Gesetzmäßigkeit, die formal ist, kontinuierlich überzugehen. Der Übergang stellt daher weder das ,Herausspringen‘ noch den ,Bruch der Deduktion des Formalprinzips‘ dar, wie Laupichler behauptet.32 Freilich mag der Deduktion des Formalprinzips als der allgemeinen Gesetzgebung latent die intelligible Seinsordnung zugrundeliegen. Daß aber jene diese voraussetzt, kommt bei Kant nicht im vermeintlichen ,Bruch der Deduktion‘ zwischen Gesetz und Formalprinzip zum Ausdruck, sondern im Sprung über die Kluft zwischen negativer Freiheit (Unabhängigkeit von allen materialen Bestimmungsgründen des Willens) und Formalprinzip (allgemeiner Gesetzgebung) in der „Willensmetaphysik“ von Laupichler. Dieser Sprung, der 30 Vgl. dazu Laupichler, M., op. cit., S.106: „Nur geringes Gewicht legte er [sc. Kant] auf die materiale Ethik auch deshalb, weil er keine Möglichkeit sah, von dem je besonderen Gehalt der praktischen Gesetze aus die Realität der Freiheit, dieses Drehpunktes seiner gesamten Philosophie, zu sichern.“ 31 Vgl. ibid., S.91-93. 32 Vgl. ibid., S.103-105. 17 erst unter der Voraussetzung einer intelligiblen Seinsordnung möglich ist, zeigt sich schon im ebendemselben Abschnitt der GMS in der Formulierung, daß der freie Wille irgendwodurch bestimmt werden muß.33 Der Grund, warum Laupichler diese Textstelle nicht ins Auge faßt, sondern nach einer Stelle greift, die in der GMS um ein paar Seiten später kommt, liegt darin, daß er die Freiheit stets und sofort von der teleologischen Seinsordnung her ,totalitär‘ (im Sinne von ,die Gesamtheit umfassend‘) betrachtet und die umgekehrte Richtung, in der moralisch-praktischen Zwecksetzung von der Freiheit zur Seinsordung konstruktiv überzugehen, nicht ernst nimmt, d. h. darin, daß er der Bedeutung der Freiheit als Ausgangspunkt der Kantischen Grundlegung der Ethik kaum Gewicht beimißt. Nun folgert man vielleicht aus den Ausführungen des 2. Abschnitts der GMS, daß eine gewisse Materialität doch auch im Formalprinzip als Allgemeinheitsformel impliziert sein kann: das Reich der Zwecke als teleologische Struktur (systematische Verbindung) einer intelligiblen Gemeinschaft der Zwecke an sich selbst, welche das intelligible Substratum einer solchen Welt konstituieren. Die Formel des Zwecks an sich selbst und die des Reichs der Zwecke lassen sich in dieser Hinsicht als materiale Prinzipien bezeichnen,34 welche sich auf die Materialität der intelligiblen Welt beziehen, wenn sie auch von Kant noch formal genannt werden. Insofern sind sie vom Formalprinzip als Allgemeinheitsformel des kategorischen Imperativs unterschieden, das in der KpV unmittelbar auf dem Faktum der reinen praktischen Vernunft als Sichaufdrängen der Einheit und Universalität des reinen sittlichen Denkens aus Freiheit basieren kann. Kant sagt jedoch, daß diese drei Arten, das Prinzip der Sittlichkeit vorzustellen, im Grunde nur soviele Formeln ebendesselben Gesetzes sind, woraus man folgern kann, daß auch das Formalprinzip als eine Formel desselben Gesetzes jene Materialität der intelligiblen Seinsordnung latent impliziert, die in den anderen zwei Formeln gemeint ist. Unter diesen beiden Formeln aber ist das Prinzip eines Zwecks an sich selbst (ohne Bezugnahme auf die konkrete Bedingung der Menschheit) wohl noch unmittelbar durch das formalistische Verfahren (Abstrahierung) und aus dem Faktum der Vernunft anzunehmen. Allerdings kann die Idee eines Reichs der Zwecke als einer moralischen, intelligiblen Welt (des Reichs Gottes) hingegen erst durch jene Selbstobjektivierung des im Formalprinzip artikulierten, den Begriff von Einheit und Universalität 33 GMS, IV 400 <B14>: „[D]enn der Wille ist mitten inne zwischen seinem Prinzip a priori, welches formell ist, und zwischen seiner Triebfeder a posteriori, welche materiell ist, gleichsam auf einem Scheidewege, und da er doch irgendwodurch muß bestimmt werden, so wird er durch das formelle Prinzip des Wollens überhaupt bestimmt werden müssen, wenn eine Handlung aus Pflicht geschieht, da ihm alles materielle Prinzip entzogen worden.“ Gerade auf diesem „Scheidewege“ verläßt er alle materialen Bestimmungsgründe, nimmt aber noch nicht das Formalprinzip an; er befindet sich in der negativen Freiheit. Die Annahme des Formalprinzips aber erfolgt erst unter der Voraussetzung jener Notwendigkeit des Bestimmtwerdens des Willens durch irgendetwas, welche ohne antizipierte apriorische Seinsordnung nicht anzunehmen wäre. Auch Laupichler erkennt diese Notwendigkeit, wenn er sieht, daß der Schluß vom Sollen auf das Können, nämlich die positive Freiheit, eine zweckmäßige Ordnung voraussetzt und teleologisch vermittelt ist. Vgl. hierzu Laupichler, M., op. cit., S.28. 34 Vgl. dazu Schmucker, J., Der Formalismus und die materialen Zweckprinzipien in der Ethik Kants, in: Lotz, J. B. [Hrsg.], Kant und die Scholastik heute, Pullach b. München 1955, S.176f. 18 darbietenden reinen sittlichen Denkens aus Freiheit konkretisiert werden, durch welche dieses sich mit Materialität verbinden kann. Daß die drei Formeln die Arten sind, das einzige sittliche Gesetz vorzustellen, und daß „deren die eine die anderen zwei von selbst in sich vereinigt“,35 kann eigentlich erst nach dieser expliziten Aufstellung der intelligiblen Welt durch die Selbstobjektivierung des reinen sittlichen Denkens bzw. die moralisch-praktische Zwecksetzung der reinen praktischen Vernunft konstatiert werden. Die Deduktion der moralischen, intelligiblen Welt ist daher nicht so einfach, wie sie in der GMS als Deduktion des Reichs der Zwecke erscheint. Das Formalprinzip mag also wohl der Ordnung der Dinge nach (synthetisch-progressiv) die Materialität der intelligiblen Welt latent implizieren, darf aber der Ordnung der Erkenntnis nach (analytisch-regressiv) dieselbe in ihrer Konkretheit und Einzelheit nicht enthalten. Ihre konkrete Vorstellung muß erst durch die moralisch-praktische Zwecksetzung der reinen praktischen Vernunft aus der praktischen Realität der Freiheitskausalität mittels der Anwendung des Formalgesetzes geschaffen werden. Das Formalprinzip fungiert nicht nur als Beurteilungsprinzip für Moralität, sondern auch als Ableitungsprinzip, d. h. als konstitutive Bedingung für die Gestaltung von Einzelpflichten in der Konfrontation des freien Willens mit der empririschen Realität. Mag bei Kant die Idee einer teleologischen, intelligiblen Seinsordnung latent vorausgesetzt sein, die konkreten Einzelpflichten (Typen, objektivnotwendige Zwecke), die in der empirischen Dimension die ,materialen‘ Gesetze der Seinsordnung widerspiegeln könnten, können doch erst in dieser Konfrontation durch die Anwendung des Formalprinzips zustandegebracht werden. Wenn Laupichler zwischen das Formalgesetz und die konkreten Handlungen „die Schicht der allgemeingültigen, objektiv-notwendigen moralischen Gesetze“ legt,36 so lassen sich diese Gesetze nicht sofort als die ,materialen‘ Gesetze in der intelligiblen Seinsordnung, sondern vielmehr zunächst als die konkreten Einzelpflichten begreifen, die durchs moralische Gesetz bestimmt und eingeleitet werden. Bei „Materie2 “ hat man es demnach nicht ohne weiteres mit den ,materialen‘ Gesetzen in der Seinsordnung zu tun, sondern zunächst mit den Einzelpflichten, den objektiv-notwendigen, intellektuellen Zwecken und den moralischen Handlungen selbst. Materie2 (die ,materialen‘, moralischen Zwecke als Pflichten), die in der kognitiven formalistischen Rückführungsphase der Grundlegung auszuklammern ist, wird als Gegenstand der reinen praktischen Vernunft (das Gute) durch die Selbstobjektivierung bzw. die moralisch-praktische Zwecksetzung des reinen sittlichen Denkens aus Freiheit konstituiert und somit rehabilitiert. Ebenso mag das Sollen des Formalprinzips der Ordnung der Dinge nach von den Werten als den in der intelligiblen Welt eingebetteten ,materialen‘ Gesetzen abgeleitet sein;37 Kant selbst aber deduziert die konkreten moralischen Gesetze, die Einzelpflichten (Typen, moralische Zwecke), aus der Synthese zwischen dem Formalprinzip des kategorischen ImpeGMS, IV 436 <B79>. Laupichler, M., op. cit., S.17. 37 Vgl. ibid., S.87f. 35 36 19 rativs und der empirischen Objektivität, d. h. er leitet in der Phase der moralischpraktischen Zwecksetzung doch die Werte vom Sollen ab. Die Betrachtungsweise gemäß der Ordnung der Dinge, nach der herausgestellt wird, daß etwa Kant bei der Ableitung der unvollkommenen Pflichten mit der Aussage: „Allein er kann unmöglich wollen, daß dieses ein allgemeines Naturgesetz werde etc.“ „zu schon vorausgesetzten materialen Prinzipien [sc. den Gesetzen in der Seinsordnung] Zuflucht genommen“ hat und daß daher das Formalgesetz bei der Ableitung bloß als heuristisches Prinzip dienen kann,38 ist wohl durchaus annehmbar. Aber selbst die Pflichten dieser Art können erkenntniskritisch in der Phase der moralischpraktischen Zwecksetzung als Synthese aus Formalgesetz und empirischer Realität expliziert werden (cf. 3.2.3.b.α) . Laupichler läßt absichtlich diese Phase überhaupt in der Kantischen Ethik außer acht; seine Interpretation ist daher in diesem Punkt sehr einseitig. 2. Laupichlers Orientierung an der „moralischen Teleologie“, d. h. bei ihm der Fundierung der Ethik in jener teleologischen Seins- bzw. Weltordnung, deren Gedanke u. E. bei Kant als Ontotheologie oder Transzendentalphilosophie vor allem in den metaphyischen Reflexionen des Bd.XVIII der Akademie-Ausgabe und im „Opus postumum“ entwickelt ist und sich auch im Kanon-Kapitel der KrV niederschlägt, auf welches Laupichler sich häufig beruft,39 ist zum Zweck der Erklärung des Hintergrunds der Kantischen Grundlegung der Ethik sicher berechtigt. Kant selbst aber begründet in seinen tatsächlichen Ausführungen die Ethik nicht unmittelbar von der teleologischen Weltordnung (der moralischen, intelligiblen Welt bzw. dem Reich Gottes) her, sondern erkenntniskritisch, d. h. gemäß der Ordnung der Erkenntnis, von Freiheit und Gesetz her. Obgleich diese letzten Endes in der teleologischen Seinsordnung beheimatet sein mögen, beruft sich Kants Grundlegung zuerst in der kognitiven formalistischen Phase der Grundlegung auf den Begriff der Freiheit und begründet die Ethik erst von dieser aus durch das Verfahren einer Erweiterung der praktischen Realität der Gesetzlichkeit in der Phase der moralischpraktischen Zwecksetzung, um zuletzt die moralische, intelligible Welt vor Augen führen zu können. Die theoretische Philosophie muß nun bei Kant sowohl hinsichtlich des Bedürfnisses und der Zufriedenheit der theoretischen Vernunft als auch bezüglich des letzten Interesses des spekulativen Gebrauchs der Vernunft zur praktischen Philosophie übergehen. Laupichler zufolge steht im Hintergrund der Notwendigkeit dieses systematischen Übergangs zum Praktischen die „Absicht der weislich uns vorsorgenden Natur“, d. h. eine objektive Zweckordnung der Welt.40 Dabei übersieht er aber, daß bei Kant die Realität des Praktischen, genauer des Moralischen, a limine gesichert ist (um diese auch theoretisch zu bewahren, ist das Konzept einer Idealität von Raum und Zeit als Voraussetzung der theoretischen Philosophie 38 Vgl. ibid., S.95. Dabei aber sollte man sein Augenmerk auch darauf richten, daß Kant selber die Ethik gegen die Transzendentalphilosophie abgrenzt. Vgl. dazu KrV, III 45 <B28f>, 520 Anm. <B829>. 40 Vgl. Laupichler, M., op. cit., S.25-27. Der zitierte Ausdruck stammt aus Kant (KrV, III 520 <B829>). 39 20 eingeführt worden; man erinnere sich auch an das bekannte Wort Kants: „das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“41 ); erst die praktische Realität der Freiheitskausalität steht für die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes ein und sichert dadurch die praktische Gültigkeit einer teleologischen Weltordnung. Laupichler hingegen betont beim Beweis der Realität dieser drei Ideen je die teleologische Begründung aus der verborgenen Zweckordnung.42 Für ihn ist die Moral nur „auf der Grundlage einer auf sie und ihren Endzweck abgezielten zweckvollen Ordnung der Welt“ möglich.43 Seine teleologische Betrachtungsweise der Grundlegung der Ethik kann freilich der Ordnung der Dinge nach als synthetisch-progressive Lehrart legitimiert werden. Sie ist aber von Kant nur peripher aufgenommen und ausgeführt. In der überwiegend erkenntniskritischen Betrachtungsweise unseres Philosophen garantiert erst die Moral die praktisch-reale Gültigkeit der zweckmäßigen Ordnung, und das ist eben der Sinn seiner „moralischen Teleologie“ (cf. 3.3.1.c). Laupichlers Bezeichnung der Kantischen Ethik als „moralische Teleologie“44 stimmt als solche nominell wohl auch mit der Ansicht unserer Interpretation voll überein, nur verwendet er dabei dieses Wort nicht im Kantischen Sinn. Er merkt freilich die „kritischen Beschränkungen“; er irrt sich aber, wenn er sagt: „In der Urt. [sc. der KU] drückt er [sc. Kant] schließlich auch die teleologische Betrachtungsweise überhaupt, auf der ja der gemeinsame nervus probandi der moralischen Beweise [jener drei Ideen als Postulate] beruht, zu einem nur regulativen Prinzip der reflektierenden Urteilskraft herab.“ Denn der nervus probandi der moralischen Beweise der Postulate besteht bei Kant vielmehr primär in der praktischen Realität der Freiheitskausalität, und erst die Moral, die auf dieser beruht, verleiht der physischen Teleologie, die an sich nur regulativ gilt, durch den Begriff des praktischen Endzwecks praktisch-reale Gültigkeit und nicht umgekehrt. Laupichler spricht zwar von der „vom Praktischen her erschlossenen Weltteleologie“,45 geht aber der Frage nicht nach, wie bei Kant diese Erschließung der Weltteleologie durch das Praktische ausgeführt wird. Bei dieser Ausführung hat man es eben mit der moralisch-praktischen Zwecksetzung zu tun, deren Teil durch die Lehre vom höchsten Gut und dessen Postulaten gebildet wird. Bei ihr handelt es sich um das erkenntniskritische Verfahren, von der Subjektivität der Freiheit her in eine zweckmäßige Welt, d. i. eine intelligible Seinsordnung, hineinzudenken; diese nämlich läßt sich der Ordnung der Erkenntnis nach nur von der Freiheit her praktisch-real konstituieren. Laupichler übersieht nicht nur dieses Verfahren bzw. die Phase der Zwecksetzung der reinen praktischen Vernunft aus Freiheit, sondern zugleich auch Kants Ablehnung der Gegenständlichkeit der anschauenden Erkenntnis in der Wolffschen dogmatischen Philosophie als des moralischen Bestimmungsgrunds des freien Willens (weil die intellektuelle Anschauung der Vollkommenheit eines Gegenstandes bei Kant nicht eingeräumt wird); in dieser KrV, III 19 <BXXX>. Vgl. Laupichler, M., op. cit., S.27-31. 43 Vgl. ibid., S.31-35. 44 Vgl. ibid., S.24. 45 Ibid., S.34. 41 42 21 Ablehnung sind der Kantische Begriff der Freiheit und die dadurch zu eröffnende intelligible Seinsordnung verankert, die transzendental ist; bei unserem Philosophen wird diese streng von der Ebene der empirischen Objektivität unterschieden, und dazu spielt die praktische Rückführung auf die Freiheit die entscheidende Rolle (cf. 1.2.3). Laupichlers Unterstreichung der teleologischen Seinsordnung geht an diesem wichtigsten Punkt, nämlich der Differenz zwischen zwei Positionen bzw. Welten, vorbei; er behandelt die Seinsordnung wie eine empirische Welt. 22 1. Die kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik als Exposition des Gesetzes und als Deduktion der Freiheit im Grundsätze-Kapitel der KpV. 1.1 Die propositionale kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik in den §§ 2–4 des Grundsätze-Kapitels der KpV. Bei der Kritik der praktischen Vernunft46 handelt es sich um den Übergang von der empirisch bedingten zur reinen praktischen Vernunft, d.h. um die Grundlegung der Ethik als Annahme des moralischen Gesetzes und als Distanzierung von der Abhängigkeit von empirischen Bestimmungsgründen der Willkür, kurz um das Zurückgehen auf Gesetz und Freiheit als Fundament der Grundlegung. Diese kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik, die deren Fundament in Gesetz und Freiheit setzt, wird im Grundsätze-Kapitel der KpV zunächst im Rahmen der Maximen als subjektiver Grundsätze ausgeführt, weshalb diese Ausführung sich als propositional (den Satz betreffend) kennzeichnen ließe. 1.1.1 Der Spielraum der propositionalen kognitiv-formalistischen Grundlegung der Ethik: Maximen. Der Spielraum, in dem die propositionale kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik in den §§ 2–4 des Grundsätze-Kapitels47 durchgeführt wird, sind die Maximen, die bereits im Definitionsparagraphen, § 1, und der Anmerkung dazu er46 Vgl. zur „Kritik der praktischen Vernunft“ Refl. 7201, XIX 275, ψ (1780–89): „Die Kritik der praktischen Vernunft legt die Unterscheidung der empirisch-bedingten praktischen Vernunft von der reinen und gleichwohl doch praktischen Vernunft zum Grunde und frägt: ob es eine solche, als die letzte ist, gebe“; KpV, V 3 Z2–13 <A3>; 15 Z18 – 16 Z6 <A30f>; 45 Z15–22 <A78>. Zur empirischbedingten praktischen Vernunft cf. 2.3.1.c. 47 KpV, V 19–57 <A35–100>. 23 läutert sind. Daß „praktische Prinzipien“ in Lehrsatz I des § 2 primär subjektiv die Maximen betreffen, zumal die kognitiv-formalistische Grundlegung auch hier auf dem Weg der empirisch-psychologischen, mithin subjektiven, Analyse vorgeht, das wird auch durch das explizite Auftreten dieses Wortes als des Spielraums der kognitiv-formalistischen Grundlegung in Lehrsatz III des § 4 bestätigt. Maximen sind subjektive Geltungsbasis aller praktischen Prinzipien bei einem endlichen Vernunftwesen, in der die letzteren durch den Willen aktualisiert werden, der in den ersteren manifest ist. Ob ein praktischer Grundsatz (ein praktisches Prinzip) Maxime oder praktisches Gesetz ist, hängt allein davon ab, ob er subjektiv oder objektiv ist, wobei es nicht darauf ankommt, ob er bedingt oder unbedingt ist; unbedingtes Gesetz kann auch subjektiv Maxime sein. Objektive praktische Prinzipien einerseits, seien sie praktische Vorschriften (hypothetische Imperative) oder Gesetze (kategorische Imperative), können wieder subjektiviert und, indem sie so subjektiv auf den Willen zurückgeführt werden, sozusagen bloß subjektiv individualisiert werden – sie heißen dann Maximen –, während es andererseits doch noch Maximen gibt, die zum Status der objektiven praktischen Gesetze nicht taugen.48 Daß der Spielraum der praktisch-objektiven kognitiv-formalistischen Grundlegung der Ethik in §§ 2–4 die subjektive Maxime ist, das deutet auf ihren Versuch hin, in der Subjektivität etwas praktisch-Objektives, etwas Allgemeines, zu erkennen, welcher Versuch zur Annahme einer transzendental-subjektiven Willensbestimmung von Handlungen führt. In der kognitiv-formalistischen Grundlegung der Ethik geht Kant nicht unmittelbar von der einzelnen Dijudikation zur Handlung (von dem Partikularen) aus, sondern von den Maximen als subjektiven Prinzipien zur Handlung, welche die Möglichkeit haben, gegebenenfalls auch objektiv mit praktischen Gesetzen übereinzustimmen, folglich gemeinhin von praktischen Prinzipien überhaupt. „Es kommt bei der Ethik nicht auf die Handlungen, die ich tun soll, sondern das principium an, woraus ich sie tun soll. Maxime.“49 Dieser strategische Ansatz, nämlich daß die Maxime als Ausdruck des andauernden Habitus ihnen gegenüber bereits Beharrliches und Formales, ja Allgemeines in sich faßt, welches man an ,praktischen Regeln‘50 sehen kann, die durch die praktische Vernunft als Vermögen der Prinzipien gebildet werden, gewährleistet einerseits der Ethik schon den Charakter der Wissenschaft des Ethos. Hier wird sie gegen zufällige Naturverläufe in der Sinnenwelt (das Partikulare), die durch die Verstandessynthesis des sinnlichen Mannigfaltigen entstehen, abgegrenzt. M.a.W., beim Kantischen Begriff der Praxis hat man es mit dem wissentlich-willentlichen Verhalten des Menschen zu tun, das etwas Vernünftiges voraussetzt.51 Ein solches 48 Vgl. z.B. KpV, V 27 Z15–17 <A49>: „Also kann ein vernünfitges Wesen sich seine subjektivpraktische Prinzipien, d.i. Maximen, ... gar nicht zugleich als allgemeine Gesetze denken“. 49 Refl. 7078, XIX 244, ϕ (1776–78). 50 KpV, V 19 Z7f <A35>: „Praktische Grundsätze sind Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten, die mehrere praktische Regeln unter sich hat.“ 51 Vgl. dazu Höffe, O., Transzendentale oder vernunftkritische Ethik (Kant)?, in Dialectica, Bd. 35 (1981), S. 202: „Unter ,Praxis‘ verstehen wir nicht jedes Verhalten des Menschen, sondern allein ein Verhalten, das – im Unterschied zu physiologischen Prozessen, zu Reflexen und zu einem Tun oder Lassen aus äußerem Zwang – wissentlich-willentlich geschieht, dem Menschen daher zugerechnet 24 Verhalten muß Regelmäßigkeit an sich haben. Daher ist es vorprogrammiert, daß bei Kant – und dies nicht nur bei ihm, sondern bei jeder Theoretisierung einer rationalen Ethik – sich eine allgemeine Ethik entwickelt, aber eine Philosophie der einzelnen Handlung des Menschen, in der es unmittelbar und schlechthin auf diese ankommt und in der sie mit dem einzelnen Geschehen der Welt von Grund aus zusammenstimmen und harmonieren kann, aufgrund der Voraussetzung der Differenz zwischen dem intellektuell-Allgemeinen und dem empirisch-Besonderen, die mit der Annahme der Maxime als Prinzip zusammengeht, kaum möglich ist, was sein Ansatz a limine anzeigt. Auf der anderen Seite aber zeigt die Strategie, mit den Maximen als subjektiven Prinzipien den Anfang zu machen, auch entgegen der Universalität der praktischen Gesetze eine gewisse Partikularität an. Eine subjektiv und individuell von mir gewollte Maxime ist der Handlung als dem Partikularen und Konkreten näher als das objektive allgemeine Gesetz. Die Maxime, die nicht subjektivierte Vorschrift, sondern subjektiviertes Gesetz ist, kann also als ein vermittelnder Begriff zwischen realen Handlungen (dem Partikularen) und praktischem Gesetz (dem Universalen) fungieren. Sie kann diese Rolle der Vermittlung spielen, weil sie auf der allgemeinheitsbezogenen Subjektivität des Willens basiert, die transzendental vom Allgemeinen (dem Unbedingten) aus auf das Einzelne gehen kann.52 1.1.2 Die Struktur der kognitiv-formalistischen Argumentation in den §§ 2–4 des Grundsätze-Kapitels der KpV. Die propositionale (mithin gegenüber der empirisch-psychologischen Analyse verhältnismäßig objektiv erscheinende) kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik im Spielraum von Maximen, wodurch der Bestimmungsgrund des Willens mit dem Leitfaden der praktischen Notwendigkeit aus Gegenstandsvorstellungen in ihnen (Materie derselben) in die ihnen innewohnende allgemeingültige apriorische Strukwerden und das gelingen (gut und richtig) oder aber mißlingen (schlecht, falsch oder böse sein) kann.“ 52 In einem kleinen, aber wegen seiner Klarheit ausgezeichneten Aufsatz (Bittner, R., Maximen, in: Funke, G. [Hrsg.], Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses, Teil II Sektionen, Berlin 1974, S. 485ff) demonstriert R. Bittner 1., daß mit der Subjektivität der Maxime nicht bloß eine Teilmenge gemeint ist, in die die Menge aller gültigen Prinzipien des Wollens und Handelns für jedes Subjekt zerlegt wird, sondern daß es sich bei ihr fundamental um eine selbst gewollte Regel je meines Tuns handelt. 2. zeigt er, daß Maximen allgemeiner sind als bloße Vorsätze, genauer daß die Maxime ein wesentlich subjektiv vorgestelltes Gesetz ist. 3. ist ihm zufolge Wille eben dies, nach Maximen zu handeln, wobei Maxime und Handlung die einander zugehörige relative Allgemeinheit und Einzelheit des Wollens bilden. Mit dem Willen als dem Vermögen, von der Allgemeinheit der Maxime als eines praktischen Prinzips aus auf das Besondere der Handlung zu gehen, habe man es also mit praktischer Vernunft zu tun. Diese Bestimmungen der Maxime durch Bittner, daß sie zugleich subjektives und relativ allgemeines praktisches Prinzip ist, das als solches wesentlich auf die Funktion des Willens (als praktischer Vernunft) bezogen ist, unterstützen auch unsere Auffassung, daß sie als ein vermittelnder Begriff zwischen Partikularität von realen einzelnen Handlungen und Universalität der praktischen Gesetzlichkeit fungieren kann und daß sie, wenn sie subjektiviertes Gesetz ist, zusammen mit dem Willen den transzendental-subjektiven Grundzug aufweist, nach dem allein das praktisch-Allgemeine zum praktisch-Besonderen gelangen kann. 25 tur (Form derselben) verlegt wird, wird im Haupttext der §§ 2–4 (im ersten Absatz jedes Paragraphen) ausgeführt. Demgegenüber wird die ihr zugrundeliegende und ihr Vorschub leistende subjektive, empirisch-psychologische (d.h. anthropologische) kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik in die dem Haupttext folgenden Erläuterungen und Anmerkungen eingebracht. Sie bildet die Grundlage für jene propositional-objektive kognitiv-formalistische Grundlegung, weil Kants Ethik Gesinnungsethik ist. (a) Der Zusammenhang zwischen propositional-objektiver und psychologischsubjektiver kognitiv-formalistischer Grundlegung der Ethik in § 2. Der Haupttext des § 2 lautet: „Lehrsatz I: Alle praktischen Prinzipien, die ein Objekt (Materie) des Begehrungsvermögens als Bestimmungsgrund des Willens voraussetzen, sind insgesamt empirisch und können keine praktischen Gesetze abgeben.“53 Der Grund, warum Lehrsatz I bestehen kann, d.h. warum die Maximen, die die Vorstellung eines Gegenstandes (ihre Materie), der immerhin unter der Gesetzlichkeit der sinnlichen Natur steht, zum Bestimmungsgrund des Willens voraussetzen – was impliziert, daß ihre mögliche formale Struktur, die Unbedingtheit aufweisen und nichtempirisch sein kann, jetzt nicht in Frage kommt –, nur subjektive Maximen sind und keine objektive praktische unbedingte Gesetzlichkeit zeigen, somit keine praktischen Gesetze sein können, liegt, wie die dem Haupttext folgende, empirisch-psychologische Erläuterung aufklärt, in der subjektiven Eigentümlichkeit der Willkür, daß das Gefühl der Lust und Unlust als die subjektive Bedingung der Möglichkeit der Willkürbestimmung, wenn es an der Wirklichkeit eines Gegenstandes haftet,54 demnach durch die Gegenstandsvorstellung als materialen Bestimmungsgrund geweckt wird, nur empirisch, mithin zufällig ist; dieses Lustgefühl gilt nur für das Subjekt, dem es, als die subjektive Empfänglichkeit einer Lust oder Unlust, innewohnt – was mit der Definition der Maximen zusammenhängt –, und kann nicht unbedingt-notwendig, mithin praktisch-gesetzlich sein. Dazu lassen sich zwei Argumente nennen, welche unten vorgebracht werden (cf. 1.2.1.c). Wie die Argumentation aufweisen wird, liegt den Aussagen der propositionalobjektiven kognitiv-formalistischen Grundlegung im Rahmen der Maximen stets die empirisch-psychologische, mithin subjektive kognitiv-formalistische Grundlegung zugrunde. KpV, V 21 <A38>. Die pathologisch-praktische Lust an der Wirklichkeit eines Gegenstandes ließe sich als ein empirischer Anwendungsfall des Gefühls der Lust und Unlust als „Mittelglied zwischen dem Erkenntnisvermögen und Begehrungsvermögen“ (KU, V 168 <BV>) begreifen, der auf keinem Prinzip a priori gründet. 53 54 26 (b) Der Zusammenhang zwischen propositional-objektiver und psychologischsubjektiver kognitiv-formalistischer Grundlegung der Ethik in § 3 und die Rolle von Lehrsatz II für den ganzen Argumentationsgang. Mit Lehrsatz I sind also bereits die Richtlinien für die kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik, d.h. hier die Rückführung zum formalistischen Fundament der Ethik (moralisches Gesetz, reine praktische Vernunft und negative Freiheit), festgelegt. Diese gelangen aber dann im § 3 mittels der Einführung des Prinzips der Selbstliebe, dem alle materialen Bestimmungsgründe (Gegenstandsvorstellungen) und deren subjektive Bedingung der Möglichkeit der Willkürbestimmung (das pathologisch-praktische Gefühl der Lust und Unlust) einheitlich unterstellt werden, radikal und rigoros zur Durchsetzung. Sein Haupttext lautet: „Lehrsatz II: Alle materialen praktischen Prinzipien sind, als solche, insgesamt von einer und derselben Art und gehören unter das allgemeine Prinzip der Selbstliebe oder eigenen Glückseligkeit.“55 Das Selbst der Selbstliebe, die, „als Prinzip aller unserer Maximen angenommen, gerade die Quelle alles Bösen ist“,56 ist nicht unser ganzes Selbst bzw. das eigentliche Selbst, wobei es um das intellektuelle Selbst geht, sondern „unser pathologisch bestimmbares Selbst“.57 Dies hat den Hang (Selbstliebe), seine eigene Glückseligkeit in das pathologisch-praktische Gefühl der Lust und Unlust an Gegenstandsvorstellungen, d.h. die Abhängigkeit von ihnen, zu setzen, und seine Ansprüche darauf „vorher und als die ersten und ursprünglichen geltend zu machen“ (Verkehrtheit des Herzens); somit ist freie Willkür durch Gegenstandsvorstellungen mittels des pathologisch-praktischen Gefühls der Lust und Unlust an ihnen zu bestimmen, aus dem sich dann Glückseligkeit rekrutiert. Das Prinzip der Selbstliebe beruht also auf der pathologisch-praktischen Lust an Gegenstandsvorstellungen, der Abhängigkeit von denselben, aus der der Anspruch der eigenen physischen Glückseligkeit resultiert. Maximen, die unter dem Prinzip der Selbstliebe als ,pragmatische Anratungen‘ stehen,58 sind daher insofern insgesamt von ein und derselben Art, sie werden denjenigen entgegengestellt, die auf dem moralischen Gesetz als Prinzip des Guten beruhen. Lehrsatz II will diese Gleichartigkeit der ersteren Maximen feststellen: Alle praktischen Prinzipien, die das Gefühl der Lust und Unlust als subjektive Bedingung der Möglichkeit der Dijudikation, vermittels dessen die Vorstellung eines Objekts als Grund der Dijudikation die Willkür bestimmt, und mithin, wie aus dem Gesagten erhellt, das Prinzip der Selbstliebe voraussetzen, sind als solche „insgeV 22 <A40>. Rel., VI 45 <B51>. Kant stellt außer dem hier in Betracht gezogenen Sinn der Selbstliebe als Prinzip des Bösen noch die „vernünftige Selbstliebe“, die das Prinzip der auf andere erweiterten Glückseligkeit zu sein scheint (KpV, V 73 <A129>), und die „Selbstliebe des unbedingten Wohlgefallens an sich selbst“ vor, die als das innere Prinzip einer moralischen Selbstzufriedenheit verstanden wird („Vernunftliebe seiner selbst“) (Rel., VI 45f Anm. <B50–52>). 57 KpV, V 74 <A131>. Das Selbst der Selbstliebe als Prinzip des Bösen bei Kant ist pathologisch und nicht intellektuell; bei ihm ist vom Selbst der Selbsterhaltung der reinen Vernunft keine Rede. 58 Vgl. dazu z.B. KpV, V 36 <A64>: „Die Maxime der Selbstliebe (Klugheit) rät bloß an“. 55 56 27 samt von einer und derselben Art“, ob die Vorstellung in den Sinnen oder dem Verstande, oder sogar der Vernunft, wo immer, ihren Ursprung habe.59 Denn sie haben ihren Ursprung in der Einheit des Prinzips der Selbstliebe, welches impliziert, daß seine Einheit fähig ist, möglicherweise auch alle Erscheinungen in der Sinnenwelt unter seinen Aspekt zu stellen; als solches ist es Prinzip des Bösen. Erst aufgrund dieser radikalen Erklärung der Totalität aller empirischen Bestimmungsgründe des Willens in Maximen aus der Homogenität derselben unter dem einheitlichen Prinzip vermag die auf Lehrsatz II folgende kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik (Folgerung, beide Anmerkungen, Lehrsatz III usw.) dem instrumentell im Gefühl der Lust und Unlust an Gegenstandsvorstellungen als subjektiver Bedingung der Willkürbestimmung verankerten Prinzip der Selbstliebe Abbruch zu tun. Damit sind auch alle durch dieses Prinzip als Zwecke eingebrachten Gegenstandsvorstellungen in der Sinnenwelt, die zum Lustgefühl führen, als Bestimmungsgründe des Willens beiseitezulassen und auszuklammern.60 Die Radikalität dieser kognitiv-formalistischen Ausklammerung als strikter Abstrahierung von objektiven Zielvorstellungen als materialen Bestimmungsgründen des Willens kann in ihrer Bedeutung gar nicht zuviel beachtet werden, weil sie auf die Möglichkeit einer totalen Transzendenz über die Sinnenwelt verweist (§ 5 des Grundsätze-Kapitels; cf. 1.4), wiewohl allerdings davon nur im Gebiet des menschlichen Willens die Rede sein kann. (c) Die propositionale kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik in § 4. Im § 4 vollzieht sich die propositionale kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik im Rahmen der Maxime, die Verlagerung des Bestimmungsgrunds des Willens von Gegenstandsvorstellungen (Materie) in die Form der Maxime zugunsten der moralisch-praktischen Gesetzlichkeit, und zwar unterstützt durch die beiden Vgl. KpV, V 23f <A41–44>, aber auch KU, V 206 <B8>: „Eindrücke der Sinne, welche die Neigung, oder Grundsätze der Vernunft, welche den Willen, oder bloße reflektierte Formen der Anschauung, welche die Urteilskraft bestimmen, [sind,] was die Wirkung auf das Gefühl der Lust betrifft, gänzlich einerlei.“ 60 D. Henrich sagt: „[I]n der Kritik der praktischen Vernunft läßt sich der Gang des Gedankens von Lehrsatz I unmittelbar zu Lehrsatz III führen. Es ist nicht notwendig, die eine Lehre, daß alle materialen Bestimmungsgründe empirisch sind, durch die andere zu stützen, daß empirische Bestimmungsgründe immer auf dem Glücksverlangen beruhen.“ (Henrich, D., Über Kants früheste Ethik, in: Kant-Studien, Bd. 54, 1963, S. 423.) Aber näherhin gesehen sagt Lehrsatz I in § 2 nur, daß alle materialen (folglich empirischen) Bestimmungsgründe in praktischen Prinzipien keine unbedingte praktische Gesetzlichkeit abgeben können, ohne dabei zu explizieren, warum der wirkliche Geltungsumfang des Satzes auf die Allheit der empirischen praktischen Prinzipien gehen muß. Der § 3 klärt dieses Problem empirisch-psychologisch, d.i. anthropologisch. Durch Lehrsatz II wird nämlich aus der Einheit des Prinzips der Selbstliebe die Homogenität und Geschlossenheit aller empirischen Bestimmungsgründe, mithin auch aller empirischen praktischen Prinzipien, logisch erklärt, aus der allein die Radikalität und Totalität der Ausklammerung der letzteren in der propositionalen kognitivformalistischen Grundlegung der Ethik gesichert werden kann. Lehrsatz II hat also in der Argumentation der §§ 2–4 doch Relevanz, obwohl er propositional-logisch entbehrlich sein mag. Denn auch hier gründet sich das propositionale Verfahren der kognitiv-formalistischen Grundlegung der Ethik auf anthropologische Erwägungen. 59 28 vorhergehenden Lehrsätze. Sein Haupttext lautet: „Lehrsatz III: Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als praktische allgemeine Gesetze denken soll, so kann es sich dieselben nur als solche Prinzipien denken, die nicht der Materie, sondern bloß der Form nach den Bestimmungsgrund des Willens enthalten.“61 Denn die Gegenstandsvorstellungen als materiale Bestimmungsgründe des Willens können gemäß Lehrsatz I keine unbedingte praktische Gesetzlichkeit herbeiführen. Sie sind alle von ein und derselben Art (Lehrsatz II) und müssen darum gänzlich von der Maxime, die zum praktischen Gesetz taugt, abgesondert werden,62 von welcher dann dadurch nichts übrigbleibt als „die bloße Form einer allgemeinen Gesetzgebung“.63 Dieses Verfahren der Herauskristallisierung einer allgemeinen Form der Maximen unterstellt, daß unter ihnen hier nicht pragmatische Klugheitsregeln, sondern moralisch-praktische allgemeine Gesetze verstanden werden sollen. Die Argumentation beweist demnach nicht, daß es moralisch-praktische allgemeine Gesetze gibt, sondern zeigt lediglich, daß, wenn solche angenommen werden sollen, ihre Artikulation nicht in der Materie der Maximen (Gegenstandsvorstellungen der Willkür), sondern in deren Form allein zu suchen ist. Die ganze kognitivformalistische Grundlegung der §§ 2–4 antizipiert den Begriff und somit auch latent das Dasein der moralisch-praktischen Gesetze, deren Merkmal als unbedingte Notwendigkeit ihr zum Leitfaden dient. Denn das moralische Gesetz selbst läßt sich ohne irgendeinen Daseinsbeweis nur als Faktum annehmen. Lehrsatz III meint lediglich, daß ein solches Gesetz, wenn es als Maxime existieren soll, sich nur in ihrer Form artikulieren kann.64 Es läßt sich erst auf dieses Ergebnis hin als die KpV, V 27 <A48>. Vgl. V 27 Z12–14 <A48>. 63 V 27 Z14 <A49>. 64 Wenn R. Bittner im obengenannten Aufsatz den Satz Kants: „Nun bleibt von einem Gesetz, wenn man alle Materie, d.i. jeden Gegenstand des Willens, (als Bestimmungsgrund) davon absondert, nichts übrig, als die bloße Form einer allgemeinen Gesetzgebung“ (KpV, V 27 Z12–14 <A48>) unter Berufung auf H. J. Paton kritisiert und sagt: „Sondern wir von der Maxime alle Materie ab, so bleibt allerdings eine bloße Form allgemeiner Gesetzlichkeit, die aber nichts als eben die Allgemeinheit der Maxime als solcher ist und trivialerweise jeder Maxime, ob moralisch oder nicht, zukommt“ (Bittner, R., op.cit., S. 495), so mißversteht er den Zusammenhang der formalistischen Grundlegung der Ethik von § 4, in dem der Satz Kants steht. Kant nimmt hier die Maxime als zum moralisch-praktischen Gesetz qualifiziert an; die Universalität des Gesetzes ist in der Maxime bei der Absonderung aller Materie von derselben schon unterstellt. Die Unterstellung läßt sich erst durch die Lehre vom Faktum der Vernunft legitimieren. Da erst unter ihr in der Maxime nach der Absonderung nichts übrigbleibt als die bloße Form allgemeiner Gesetzgebung, so muß nicht erneut ein Übergang zur moralisch-praktischen Universalität des Gesetzes unternommen werden. Bittners empirische Interpretationstendenz gegenüber der moralischen Gesetzlichkeit der reinen praktischen Vernunft bei Kant – die auch schon in seinem Satz bemerkbar ist: „... moralische Gründe – aber deren Einfluß wird erst verständlich, wenn man weiß, was Maximen sind“ (ibid., S. 488) – zeigt sich darin, daß er die Sittlichkeit des Willens bzw. Autonomie desselben als Selbstbezug desjenigen Willens auf sich selbst begreift, der das Vermögen einer Allgemeinheit ist, in seiner „natürlichen Autonomie“ (ibid., S. 494–496) von der Allgemeinheit der Maxime her auf das Besondere der Handlung hin zu gehen, d.h. daß er die reine praktische Vernunft als das Vermögen der Moralität aus der empirisch bedingten praktischen Vernunft, die sich auf pragmatische Klugheitsregeln für Glückseligkeit bezieht, zu deduzieren versucht. Der Versuch selber ist wohl nicht unmöglich; allerdings ist dabei nicht zu ver61 62 29 formale Struktur einer Maxime formulieren, die sich im Grundgesetz65 der reinen praktischen Vernunft des § 7, d.i. in der allgemeinen Formel des kategorischen Imperativs ausdrückt. 1.2 Die psychologische, mithin subjektive kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik in den §§ 2–4 des Grundsätze-Kapitels der KpV. 1.2.0 Vorwort zur psychologischen kognitiv-formalistischen Grundlegung der Ethik. (a) Die Untersuchungsbasis für die subjektive kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik: Kants empirisch-psychologische (faktisch-anthropologische) Betrachtungen. Der propositional-objektiven kognitiv-formalistischen Grundlegung der Ethik liegen, wie oben aufgewiesen, psychologisch-subjektive Erläuterungen zugrunde, in denen wieder ein kognitiv-formalistisches Verfahren (Abstrahierung von der Materie) in Gang gebracht wird. Sie sind Betrachtungen in bezug auf das Gefühl der Lust und Unlust und die Willkür (arbitrium), welche die negative Untersuchungsbasis für die psychologisch-subjektive kognitiv-formalistische Grundlegung ausmachen. Kant selber hat es nicht für nötig gehalten, Elemente dieser negativen Basis in den von ihm veröffentlichten ethischen Schriften in extenso darzustellen.66 (b) Allgemeine Charakteristiken des Entwicklungsgangs der ethischen Gedanken bei Kant. Für unsere diesbezügliche Analyse verwenden wir auch noch Reflexionen aus dem Nachlaß und Vorlesungsnachschriften, die beide nach den Kompendien des Wolffianers A. Baumgarten entstanden sind, solange sie zur Erläuterung der veröffentlichten Hauptschriften dienen können. Im folgenden sind für die Untersuchung des Nachlaßwerkes und der Vorlesungen in bezug nicht nur auf die Phase der kognitivformalistischen Grundlegung wie hier, sondern auch auf die architektonische Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung (cf. 2. und 3.) – aus beiden Phasen zusammen besteht die ganze Grundlegung der Ethik bei Kant – kurz allgemeine Anmerkungen abzugeben. gessen, daß die Funktion der empirisch bedingten praktischen Vernunft, die in der Dunkelheit ihrer Abhängigkeit vom Empirischen tätig ist, sich erst im Lichte der hellen moralischen Gesetzlichkeit der reinen praktischen Vernunft auch als eine Spontaneität und Allgemeinheit herausstellen kann, die mit denjenigen der moralischen Gesetzlichkeit gemeinsam ist, und nicht umgekehrt. In diesem Punkt hat die Hervorhebung der Kantischen Lehre vom Faktum der Vernunft durch D. Henrich mehr Berechtigung. 65 KpV, V 30 Z37–39 <A54>. 66 Vgl. z.E. KpV V 9 Anm. <A16>: „...weil man diese Erklärung, als in der Psychologie gegeben, billig sollte voraussetzen können.“ 30 Kants Ethik wurde, wenn ihre Entstehungsgeschichte gesichtet wird, nicht nur bekanntlich durch Hutcheson, Crusius und Rousseau inspiriert, sondern überraschenderweise auch stets und wesentlich durch die Terminologie der Wolffschen Schulphilosophie beeinflußt und mittels ihrer aufgebaut. Das besagt aber freilich nicht, daß er das Wolffsche Gedankengut kritiklos und unverändert übernommen hätte, zumal er von Anfang an oder spätestens bis zur ersten Hälfte der sechziger Jahre andere Ideen für die Grundlegung der Ethik als die Wolffianischen gehabt hat; seine Vorlesungen etwa gaben nicht sosehr den Inhalt der Lehrbücher treu wieder, als sie vielmehr schon eine freie Präsentation seiner eigenen Gedanken mit Hilfe des Wolffschen Begriffsvorrats waren. Die Wolffsche Schulphilosophie war für ihn sowohl der Nährboden des Denkens als auch Gegenstand der schärfsten Kritik.67 Die Wolffschen Konzepte und Begriffe Kants in den Reflexionen treten zwar in der GMS (1785) und der KpV (1788) nicht umfangreich auf, aber zuletzt im Spätwerk, der MS (1797), wieder in den Vordergrund.68 Der Versuch, wesentliche Umwandlungen in der chronologischen Entwicklung des Kantischen Denkens über Ethik herauszuarbeiten, ist, wenn es ihm an der Bereitschaft zu einer gewissen Kühnheit und Gewaltsamkeit der Interpretation fehlt, ein sehr schwieriges Unternehmen. Kant verwirft das, was er einmal durchgedacht und formuliert hat, nur selten wieder; er pflegt ihm vielmehr in einem späteren System je eine angemessene Stelle zu verschaffen. Das vermochte er zumeist deshalb zu leisten, weil seine Begriffe prinzipiell fähig sind, auch für ein neu konzipiertes System wieder verwendet zu werden; denn er hat seine philosophischen Phänomene stets nur sachlich, so wie sie sind, betrachtet und analysiert, ohne sie von Beginn an in eine vorher ausgedachte Systematik zu integrieren. Vor allem in der praktischen Philosophie haben sich seine Gedanken grundsätzlich kaum geändert, weil sie aus seiner bleibenden Persönlichkeit selbst hervorgegangen sind.69 Daß er nun das, was von ihm mit Hilfe des Wolffschen Begriffsvorrats Jahrelang überlegt wurde, aber in der GMS und der KpV doch nur beiläufig und unscheinbar auftritt, wie erwähnt, in der MS nachgeholt hat, kommt von dem ebengenannten allgemeinen Grund her. Es ist aber zugleich auch durch den besonderen Zweck bedingt, daß er in den beiden Grundlegungsschriften nur Argumente für die kritische Begründung der Ethik vorzubringen trachtet: Gründe, die so sicher wie möglich die Probe selbst der hartnäckigsten Empiristen bestehen können. Erst nach dem Abschluß der Arbeit der Grundlegung wurde dieses Beschränkungsprinzip gelockert, um das doktrinale System der Ethik auszuführen, wie es dann die MS zeigt.70 Seine Grundgedanken zum Fundament der Ethik (Gesetz und Freiheit) wurden bereits in der ersten Hälfte der sechziger Jahre festgelegt; die späteren Reflexionen wurden außer der Präzisierung der Analyse der Grundgedanken Zur Position Kants gegen Wolffs „philosophia practica universalis“ vgl. GMS, IV 390f <BXIff>. Vgl. dazu Anderson, G., Kants Metaphysik der Sitten – ihre Idee und ihr Verhältnis zur Ethik der Wolffschen Schule, in: Kant-Studien, Bd. 28, 1923, S. 41, 55–61. 69 Zu Kants Persönlichkeit vgl. die Arbeiten von E. Adickes, B. Bauch, A. Gehlen, J. Heller und P. Menzer (cf. das Literaturverzeichnis). 70 Vgl. Anderson, G., op.cit., S. 60. 67 68 31 oder sogar der bloßen Wiederholungen von Erwägungen vorwiegend der Entwicklung der Versuche einer transzendentalen Begründung der Ethik nach dem Jahre des großen Lichtes (1769) und einer moralischen Teleologie als architektonischer Entfaltung der ethischen Fundamente gewidmet, deren Entwicklung sich etwa aus dem Kanon-Kapitel der KrV ersehen läßt. Der Entwicklungsgang des ethischen Denkens bei Kant wird nicht sosehr durch das einlineare chronologische Entwicklungsschema von Gelingen und Scheitern von Denkversuchen, als vielmehr durch die in der intellektuellen Bewußtseinstiefe, d.i. in Kants Persönlichkeit selbst verwurzelten, konstanten intelligiblen Konzepte bestimmt; gerade dies wird seine Interpreten, die sich für jenes Schema einsetzen wollen, in Verlegenheit bringen. (c) Moralische Gesetzlichkeit: faktische Überzeugung Kants. Es ist nun wiederum zu betonen, daß für Kant die moralisch-praktische Gesetzlichkeit objektiv Faktum ist und daß seine praktisch-theoretische kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik – Exposition des moralischen Gesetzes (mithin auch der reinen praktischen Vernunft) und Deduktion der Freiheit – von dieser festen Überzeugung ausgeht. Dieser zufolge kann die Gesetzlichkeit der sinnlichen Natur der praktischen Gesetzlichkeit von vornherein keineswegs als moralischer Bestimmungsgrund des Willens gewachsen sein. Das von Kant vorgestellte objektive Gesetz für menschliche Praxis ist so souverän, daß es weit über Naturgesetze hinausgeht, welche in der Ethik doch lediglich für empirisch subjektive Willkürbestimmungen als deren materiale Bedingungen Geltung haben können. (Bei näherem Zusehen aber ergibt sich, daß moralische Gesetze erst in Bezogenheit auf unsere Erfahrungswelt und somit auch auf die sinnliche Natur ihre Bedeutung erhalten.) Bei solcher unbedingten praktischen Gesetzlichkeit hat man es mit Kants gewissermaßen religiöser Überzeugung zu tun. Er bringt durch seine Ethik etwas Absolutes in den stets schwankenden Ablauf unseres unsicheren empirischen Lebens ein. Aufgrund dieser Überzeugung führt er seine praktischen, aber theoretischen formalistischen Erörterungen zur praktischen Gesetzlichkeit aus, deren sachliches Verfahren uns aber mehr als bloße Überzeugungen zeigt. Die faktische Vorgegebenheit des moralischen Gesetzes vor philosophischer Analyse (das Faktum der Vernunft) schon in der gemeinen Menschenvernunft71 Vgl. dazu KpV, V 155 <A277>: „... in der gemeinen Menschenvernunft ist sie [sc.: die Frage, was die reine Sittlichkeit ist], zwar nicht durch abgezogene allgemeine Formeln, aber doch durch den gewöhnlichen Gebrauch, gleichsam als der Unterschied zwischen der rechten und linken Hand, längst entschieden.“. Daher erwidert Kant auf den Vorwurf Tittels, daß in der GMS „kein neues Prinzip der Moralität, sondern nur eine neue Formel aufgestellt worden“ sei, mit der Gegenfrage: „Wer sollte aber auch einen neuen Grundsatz aller Sittlichkeit einführen und diese gleichsam zuerst erfinden? gleich als ob vor ihm die Welt in dem, was Pflicht sei, unwissend oder in durchgängigem Irrtume gewesen wäre“. Zur „gemeinen Menschenvernunft“ vgl. auch V 27 Z22 („der gemeinste Verstand“), V 35 Z15 („der gemeinste Mensch“), V 36 Z4f („das gemeinste Auge“), V 36 Z8 („die gemeine Menschenvernunft“), V 36 Z38 („der gemeinste und ungeübteste Verstand“), V 43 Z36 („die gemeinste Aufmerksamkeit“), V 70 Z2 („der gemeinste Verstand“), V 91 („der gemeinste praktische 71 32 wird von Kant durch die Metapher eines chemischen Experiments72 expliziert und zeigt sich darüber hinaus in der pädagogischen Wirksamkeit von reinen Darstellungen bzw. Beispielen73 der Moralität. In der Entwicklungsgeschichte seiner Ethik hat Kant die grundlegenden Gedanken über die Moral erstmals in der Preisschrift (entstanden im Jahre 1762) präsentiert. Aus ihnen sind zwei positive Hauptmomente für weitere Entwicklungen zu ersehen: Das eine ist das offensichtlich unter dem Einfluß von Crusius74 entstandene Konzept eines absoluten Sollens („necessitas legalis“75 ), das aber anders als bei diesem nicht mehr theonomisch, sondern im Zusammenhang eines „an sich notwendigen Zwecks“ teleologisch erläutert wird; das andere Moment betrifft das moralische Gefühl, das den britischen Moralisten entstammt und das materialiter, d.i. im einzelnen Falle, jenes absolute Sollen darbieten kann. Beide werden von Kant schlechthin als für die Moral grundlegender Tatbestand eingeführt und für unerweislich76 gehalten. Das absolute Sollen wird hier als die das Wesen aller moralischen Phänomene ausmachende unbedingte Notwendigkeit und somit als unerschütterliche faktische Vorgegebenheit vor der Analyse festgestellt. Es zeigt sich in der ganzen Entwicklungsgeschichte der Kantischen Ethik stets als selbstverständliche Grundposition der Moral (cf. 2.3.1.i), wird aber erst später in der KpV als Faktum der reinen praktischen Vernunft ausdrücklich formuliert. Vernunftgebrauch“) etc...; „... zu ihrem Prinzip [sc.: zum allgemeinen Gesetz], welches sie [sc.: die gemeine Menschenvernunft] sich zwar freilich nicht so in einer allgemeinen Form abgesondert denkt, aber doch jederzeit wirklich vor Augen hat und zum Richtmaße ihrer Beurteilung braucht. Es wäre hier leicht zu zeigen, wie sie mit diesem Kompasse in der Hand in allen vorkommenden Fällen sehr gut Bescheid wisse, zu unterscheiden, was gut, was böse, pflichtmäßig, oder pflichtwidrig sei, ...“ (GMS, IV 403f <B20>). Eben in diesem Respekt vor der „gemeinen Menschenvernunft“ besteht die praktisch-philosophische Grunderfahrung Kants: „... und ich verachtete den Pöbel, der von nichts weiß. Rousseau hat mich zurecht gebracht. ... ich lerne die Menschen ehren ...“ („Bemerkungen“, XX 44). Das Erfließen des reinen sittlichen Denkens aus der negativen Freiheit als der Unabhängigkeit von allen materialen Bestimmungsgründen des Willens findet nach Kants Überzeugung bei jedem „gemeinen“, d.h. durchschnittlichen Menschen statt. 72 Zum chemischen „Experiment mit jedes Menschen praktischer Vernunft“ vgl. KpV, V 92f <A165f>. 73 Zur Erforderlichkeit von reinen Darstellungen bzw. Beispielen der moralischen Grundsätze vgl. GMS, IV 411 Anm. <B33f>; KpV, V 156 Z21–36 <A278f>; Refl. 6898, XIX 200 Z6–14, ϕ (1776– 78); Refl. 6976, XIX 218 Z14–18, υ? (1776–78?). 74 Vgl. dazu Schmucker, J., Die Ursprünge der Ethik Kants in seinen vorkritischen Schriften und Reflexionen, Meisenheim a. G. 1961, S. 85–87; Henrich, D., Über Kants früheste Ethik, in: KantStudien, Bd. 54, 1963, S. 415; Forschner, M., Gesetz und Freiheit, München 1974, S. 69 Anm. 52. 75 Deutlichkeit, II 298. 76 II 299 Z2 u. Z31. 33 1.2.1 Die negative Untersuchungsbasis, von der die subjektive kognitivformalistische Grundlegung der Ethik ausgeht: Es ist apriorisch nicht bestimmbar, in welchem Ausmaß die pathologisch-praktische Lust durch Gegenstandsvorstellungen ausgelöst wird. (a) Die apriorische Unbestimmbarkeit der Einflößung der Lust durch Gegenstandsvorstellungen. Objektvorstellungen der Sinnenwelt als Bestimmungsgründe der Willkür können, auch wenn sie durch Naturgesetze gegeben werden, nicht die unbedingte Gesetzlichkeit für Praxis abgeben, schon deshalb, weil das sich auf das Begehrungsvermögen beziehende Gefühl der Lust und Unlust (subjektive Bedingung der Willkür) durch sie als materiale Bestimmungsgründe der Willkür nur empirisch und keineswegs a priori bestimmt werden kann. „Es kann aber von keiner Vorstellung irgendeines Gegenstandes, welche sie auch sei, a priori erkannt werden, ob sie mit Lust oder Unlust verbunden, oder indifferent sein werde.“77 Die Auswirkung von Objektvorstellungen auf das Begehrungsvermögen erfolgt nun aber nicht durch das Gefühl der Lust und Unlust im allgemeinen, sondern schon spezifisch durch die pathologisch-praktische Lust, die als Prototyp bzw. Urgestalt für andere Unterarten der Lust erachtet wird. Kant ist klar, daß im formalistischen Verfahren der ethischen Grundlegung lediglich diese Lust, d.h. die „Lust aus der Vorstellung der Existenz einer Sache, sofern sie ein Bestimmungsgrund des Begehrens dieser Sache sein soll“,78 bestritten werden soll, wobei nicht vom Gefühl der Lust und Unlust die Rede ist, das vom moralischen Gesetz, welches das Begehren unmittelbar bestimmt, beiläufig hervorgerufen wird. (b) Lust ist dreifach. Die Lust im allgemeinen wird nämlich eingeteilt in eine sinnliche und eine intellektuelle, die erstere wiederum in die durch den Sinn (Vergnügen) und die durch die Einbildungskraft (Geschmack).79 Lust ist also dreifach80 : pathologisch-praktisch, kontemplativ und intellektuell,81 und nur der kontemplativen Lust fehlt das InKpV, V 21 <A39>. Von der apriorisch nicht bestimmbaren Verknüpfung der Gegenstandserkenntnis mit dem Gefühl der Lust und Unlust, das das Begehrungsvermögen bestimmt, erwähnt Kant auch hinsichtlich der System-Gedanken, die er sich über die menschlichen Gemütsvermögen in seiner Philosophie überhaupt macht, folgendes: „Die Verknüpfung zwischen dem Erkenntnis eines Gegenstandes und dem Gefühl der Lust und Unlust an der Existenz desselben, oder die Bestimmung des Begehrungsvermögens, ihn hervorzubringen, ist zwar empirisch kennbar genug; aber, da dieser Zusammenhang auf keinem Prinzip a priori gegründet ist, so machen sofern die Gemütskräfte nur ein Aggregat und kein System aus“ (EE, XX 206 <H11>). Vgl. auch KU, V 291 <B153>; KpV, V 58 Z14f <A102>, V 63 Z11–18 <A111>. 78 KpV, V 22 Z9f <A40>. 79 Anthr., VII 230; Met.L/1 (Pölitz), XXVIII 252f. 80 In Periode λ (1769–70) ist die „dreierlei Lust“ noch nicht reif zur späteren Dreiteilung (Refl. 697, XV 310). 81 MS, VI 212. Kant bezeichnet hier die erste Unterart lediglich als praktisch. Da sie aber dadurch leicht mit der dritten verwechselt werden kann (C. Chr. E. Schmid läßt systematisch pathologische 77 34 teresse an der Wirklichkeit eines Gegenstandes; sie ist nicht praktisch und bestimmt nicht das Begehrungsvermögen, das auf das Sich-Befassen mit Sachen selbst in empirisch-objektiver Dimension geht. Das Gefühl der Lust und Unlust nämlich wird (1), wenn es vom moralischen Gesetz eingeflößt wird, moralisches Gefühl genannt, das auch moralische Lust oder weniger deutlich intellektuelle Lust heißt; es heißt (2), von der Beurteilung im Geschmacksurteil (d.h. dem freien Spiel von Einbildungskraft und Verstand) hervorgerufen, kontemplative Lust; (3) wird es, von der Abhängigkeit von Erscheinungen als materialen Bestimmungsgründen der Willkür ohne den Vorrang des aus Freiheit erfließenden Gesetzes ausgelöst, pathologisch-praktische Lust genannt. Zu der dritten werden Vergnügen und Schmerz, sofern sie das Begehren bestimmen, gezählt. Selbst ein reines Vergnügen (pura voluptas82 ), wie rein es auch sein mag, würde, solange es Vergnügen ist, pathologisch-praktisch sein.83 Die Dreiteilung der Lust entspricht dem dreifachen Wohlgefallen am Angenehmen, Schönen und Guten.84 (c) Lust ist subjektive Empfindung und gibt kein apriorisches Kriterium für Willensbestimmungen ab. Pathologisch-praktische Lust und Unlust sind an sich nur subjektive Begleitempfindungen, die die Erkenntnis eines Objekts in einem Subjekt mit hervorbringt, indem die Vorstellung des ersteren das letztere so affiziert, daß es sich selbst fühlt. Die Empfindung überhaupt nämlich wird eingeteilt in die objektive, die auf Objekte geht und ein ,Erkenntnisstück‘ wird, und die subjektive, die als Gefühl der Lust und Unlust aufs Subjekt geht und insofern noch keine Erkenntnis ist.85 und moralische Lust als Unterarten zu einer Oberart, der praktischen Lust, gehören: Vgl. dazu ders., Wörterbuch zum leichtern Gebrauch der Kantischen Schriften, 2. Auflage der 4. Ausgabe Jena 1798, Darmstadt 1980, S. 358. Auch L. W. Beck versteht die „praktische Lust“ in der MS, VI 212 zu Recht im pathologischen Sinne; vgl. dazu ders., A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, Chicago 1960, S. 92f), nennen wir sie enger definiert „pathologisch-praktische Lust“, was zu seinem Gedanken präziser passen könnte. Ebenso könnte sie nach dem Ausdruck in der EE, XX 231f <H37>auch „ästhetisch-pathologisch oder ästhetisch-praktisch“ genannt werden. Die endgültige Formulierung und Begründung der Differenzierung der praktischen Lust in die pathologische und die moralische, die der Unterscheidung zwischen pathologisch-praktischer und intellektueller Lust gleichkommt, findet sich in Refl. 7320 (cf. Fußnote 310 in 2.4.3). 82 Baumgarten, A. G.; Metaphysica, § 661 (in: AA, XV 44); dt: § 487. 83 Gleichwohl hat Kant den Versuch angestellt, auch das Wort Vergnügen mit der intellektuellen Lust zu verbinden, welcher jedoch in den Druckschriften zur Ethik nicht in systematischen Zusammenhängen auftritt. Vgl. dazu z.B. Refl. 6881, XIX 190f, ϕ? 1776–78? (intellektuelles bzw. freies Vergnügen); Refl. 7255, XIX 295, ψ 1780–89 („ein reines und unbedingtes Vergnügen“). 84 In der Met.L/1 wird entsprechend dem dreifachen Leben, dem tierischen, dem menschlichen und dem geistigen, auch die Lust dreigeteilt (XXVIII 248f). Vgl. dazu auch Refl. 567, 823. 85 Z.B.: „Die grüne Farbe der Wiesen gehört zur objektiven Empfindung, als Wahrnehmung eines Gegenstandes des Sinnes; die Annehmlichkeit derselben [sc. die Lust daran] aber zur subjektiven Empfindung, wodurch kein Gegenstand vorgestellt wird: d.i. zum Gefühl, wodurch der Gegenstand [sc.: die grüne Farbe der Wiesen] als Objekt des Wohlgefallens (welches kein Erkenntnis desselben ist) betrachtet wird“ (KU § 3, V 206 <B9>). Eine ausführliche Erläuterung zu dieser Unterscheidung gibt Kant kurz nach der Veröffentlichung der KU, in die auch das obige Zitat gehört, in der Anthropologie-Vorlesung 1791/92 (Anthropologie Dohna-Wundlacken). Vgl. dazu Kowalewski, A. 35 Das pathologisch-praktische Lustgefühl nun gehört zwar zur Sinnlichkeit, jedoch nicht zum inneren Sinn (sensus internus) als Wahrnehmungsvermögen, obzwar es durch ihn bestimmt wird, sondern zum „inwendigen Sinn (sensus interior)“,86 welcher aber auch manchmal mit dem ersteren identifiziert wird.87 Denkt man nun dieses Konzept folgerichtig, so muß man zu dem Resultat kommen, daß nicht nur das pathologisch-praktische Lustgefühl, sondern das Gefühl der Lust und Unlust im allgemeinen, dessen Prototyp das erstere sein mag, sei es sinnliche Lust, sei es intellektuelle Lust, als ästhetische Empfänglichkeit des Subjekts überhaupt – d.h. solange es letzten Endes für sinnlich gehalten werden soll –, seinen Sitz in diesem inwendigen Sinn hat. Folglich wird das Gefühl der Lust und Unlust im allgemeinen als das des Lebens, das seinen Sitz im letzteren hat, nur dann pathologisch-praktisch, wenn ihm weder das moralische Gesetz noch eine Beurteilung im Geschmacksurteil, sondern nur die Abhängigkeit der freien Willkür von der Wirklichkeit der Gegenstandsvorstellung – d.h. ihr Verhaftetsein mit derselben, das das Wesen des Prinzips der Selbstliebe ausmacht – vorhergeht; wenn das Gesetz der Abhängigkeit von Gegenstandsvorstellungen (mithin auch dem dadurch ausgelösten pathologisch-praktischen Gefühl der Lust und Unlust) vorangeht, so wird das Gefühl der Lust und Unlust moralisch; sein Sitz wird jedenfalls nicht geändert. Die pathologisch-praktische Lust ist also gleichsam als Wirkungskanal von Objekten zur Willkür (1) an sich bloße Empfindung (Materie einer Erkenntnis) und deshalb noch keine Erkenntnis, als welcher ihr möglicherweise objektive Gesetzlichkeit würde zukommen können. Bei diesem Verhältnis von Objekt, Lust und Willkür wird die Willkür durch die subjektive Begleitempfindung einer Objekterkenntnis bestimmt, und nicht unmittelbar durch diese Erkenntnis selbst. Erkenntnisse, die aus subjektiven Begleitempfindungen einer Erkenntnis – entweder im Zusammenhang mit sonstigen in den Naturverlauf integrierten Objektsvorstellun[Hrsg.], Die philosophischen Hauptvorlesungen Immanuel Kants, München 1924, Anthropologie Dohna-Wundlacken, S. 173f. Diese Erläuterung ist von Kant wohl zum Gefühl der Lust und Unlust im allgemeinen dargeboten worden, gilt jedoch inhaltlich nur für die pathologisch-praktische Lust, die aber immerhin als Prototyp des ersteren erachtet werden mag. Vgl. außerdem MS, VI 211f Anm.; Refl. 227, XV 86f, ω (1790–1804); EE, XX 206 Z16 <H10>, 222 <H27>, 224f <H30f>, 232 <H37>. 86 Anthr. § 15, VII 153; Refl. 605, XV 260, ϕ? (1776–78?). 87 Vgl. dazu KpV, V 23 Z9 <A41>, 58 Z19 <A102>; MS, VI 399 Z24 etc. Die Stelle KpV, V 80 Z9 <A142>aber läßt sich so verstehen, daß das pathologisch-praktische Lustgefühl, seinen Sitz wohl nicht im inneren Sinn hat, jedoch durch ihn bestimmt wird. Der Gedanke, daß das Gefühl der Lust und Unlust überhaupt, dem die pathologisch-praktische Lust zugehört, im inwendigen Sinne sitzt, der von jenem inneren Sinne zu unterscheiden ist, dessen Empfindungen primär für die Gegenstandserkenntnis angewendet werden, scheint sich auch in der KpV de facto unscheinbar durchzusetzen, wenn Kant erklärt, daß Gegenstandsvorstellungen, seien sie vom Sinn oder vom Verstand, wenn sie als materiale Gründe die Willkür bestimmen sollen, sie unausbleiblich durch die pathologischpraktische Lust und Unlust (Vergnügen und Schmerz) bestimmen. Denn diese sind dem für die Gegenstandserkenntnis (in der bestimmt wird, ob eine Gegenstandsvorstellung ihren Ursprung im Sinne oder im Verstande hat) nicht konstitutiven ,inneren Sinn‘ zuzuschreiben, der genauer als inwendiger Sinn bezeichnet werden sollte, und sind deshalb von einerlei Art; d.h. es ist ihnen gleichgültig, ob die Gegenstandsvorstellungen vom Sinn oder vom Verstand sind. Vgl. dazu KpV, V 22–24 <A41–44>. 36 gen als Gründen der Willensbestimmung oder ohne den Zusammenhang mit denselben88 – aufs neue durch die Anwendung der reinen Verstandesbegriffe, die ihrereseits immerhin apriorisch sind, konstituiert werden können,89 bilden zwar einen empirischen Naturmechanismus. Dieser jedoch weist, verglichen mit der fürs Prinzip der moralisch richtigen Praxis erforderlichen absoluten Notwendigkeit (wie sie aus dem Faktum der Vernunft erhellt), da die Empfindung keineswegs im ganzen durch die reinen Verstandesbegriffe in perfekte Gesetzlichkeit hineingebracht werden kann, auch noch Zufälligkeit auf.90 Zudem bleibt die pathologisch-praktische Lust (2) in ihrer Verbindungsrolle zwischen Objekten und Willkür als Empfindung bloß empirisch-subjektiv. Ihre Objektivierung und Vergegenständlichung ist zwar möglich, aber wegen ihrer empirischen Subjektivität sehr beschränkt. Daraus ergibt sich, 1. daß diese Lust eben nur solche Privatempfindung ist, daß man daraus kaum intersubjektive Allgemeingültigkeit und Mitteilbarkeit erwarten kann,91 und 2. daß auch Kant die Möglichkeit einer „empirischen Seelenlehre“ als Wissenschaft eben pessimistisch beurteilt.92 Solange also die Lust, aufgrund deren die Willkür bestimmt werden soll, doch bloß subjektive Empfindung bleibt, kann sie kein objektiv-gesetzliches, geschweige denn apriorisches reines Kriterium für die Willensbestimmung aufstellen. 1.2.2 Abhängigkeit von Gegenständen. (a) Der Grund der Untauglichkeit der pathologisch-praktischen Lust zur apriorischen Gesetzlichkeit: ihre Abhängigkeit von Gegenständen. Der zentrale Grund, warum das Gefühl der Lust und Unlust, das hier sinngemäß pathologisch-praktisch sein muß, der Willkür keine apriorische Gesetzlichkeit abgeben kann, besteht darin, daß es als ,Lust an etwas‘93 ohne ein vorhergehendes moralisches Gesetz in der Empfänglichkeit des Subjekts und Abhängigkeit vom Dasein eines Gegenstandes verankert ist, m.a.W., sich an Gegenstände anlehnt und ihnen anhaftet bzw. mit ihnen verhaftet ist94 : Die pathologisch-praktische Lust 88 Vgl. z.B. Anthr., VII 231 Z5–10. Das Gefühl der Lust, das als solches keine objektive Erkenntnis ist, kann doch durch eine neue Vertandessynthesis empirisch erkannt werden. Vgl. z.B. neben derselben Seite aus Anthr. in der vorigen Fußnote KpV, V 21 Z34 <A39>, 23 Z16 <A42>etc. 90 Zur Zufälligkeit des empirischen Naturmechanismus vgl. KU, V 360 <B268f>, 370 <B284f>, 406 <B346f>; außerdem vgl. Bauer-Drevermann, I., Der Begriff der Zufälligkeit in der Kritik der Urteilskraft, in: Kant-Studien Bd. 56, 1965, S. 502. Auch unser Grundsätze-Kapitel der KpV bietet dazu ein Beispiel an: „das Gähnen, wenn wir andere gähnen sehen“ (V 26 Z18 <A47>). 91 KpV, V 21f <A39>; KU § 39, V 291 <B153>, etc. 92 Vgl. dazu MAN, IV 471. Vgl. auch Kowalewski, A., op.cit., Metaphysik Dohna-Wundlacken, S. 602. 93 Vgl. KpV, V 21 Z25 <A39>: „die Lust an der Wirklichkeit eines Gegenstandes“. 94 Der Begriff des ,Haftens‘, der die Abhängigkeit der Lust und mithin der Willkür von Gegenstandsvorstellungen bzw. Gegenständen ausdrückt, wird von Kant in unscheinbarer Weise verwendet. Vgl. z.B. KU, V 432 Z5ff <B392>: „... Befreiung des Willens von dem Despotismus der Begierden, wodurch wir, an gewisse Naturdinge geheftet, unfähig gemacht werden, selbst zu wählen“; KpV, V 137 Z14f <A247>: „... daß sein Wille immer mit einer Abhängigkeit der Zufriedenheit von der 89 37 „gründet sich auf der Empfänglichkeit des Subjekts, weil sie von dem Dasein eines Gegenstandes abhängt“.95 Die Willkür, die durch diese Lust bestimmt wird, wird wegen der Abhängigkeit der letzteren von Gegenständen, die gegenüber der zur moralischen Handlung erforderlichen unbedingten praktischen Gesetzlichkeit nur so angesehen werden, daß sie in ihrer Sukzession eher zufällig und widersprüchlich auftreten, stets nur von ihnen beherrscht und gleichsam ruhelos herumgetrieben. Die Gebundenheit des Lustgefühls an das Empirische läßt keine apriorische Gesetzlichkeit für den menschlichen freien Willen zu. (b) Abhängigkeit der Begierde, der Neigung und des Hangs von Gegenständen. Ist nun das Wesen des Lustgefühls die Abhängigkeit von Gegenständen, so besteht der Wesenszug der Begierde nach etwas sowie der Neigung zu etwas auch in derselben. Denn Begierde ist die Bestimmung des Begehrungsvermögens, vor welcher das Lustgefühl als Ursache notwendig vorhergehen muß, und die habituelle Begierde heißt Neigung.96 Ebenso wie die beiden muß das Wesen des Hanges zu etwas auch diese Abhängigkeit implizieren, weil bei ihm vom „subjektiven Grund der Möglichkeit einer Neigung“97 die Rede ist. Daher ist der Grundzug des Bösen als Hang nichts anderes als die Abhängigkeit des subjektiven Gefühls der Lust (Empfindung) von Gegenständen, durch das diese als Vorstellungen die Wilkür bestimmen und aus dem sich die Glückseligkeit rekrutiert. (c) Die Entscheidung der freien Willkür für oder gegen die Abhängigkeit von Gegenständen wird auf intelligibler Ebene getroffen. Bei der Grundtendenz einer Abhängigkeit des Lustgefühls von Gegenständen, die als Hang zum Bösen anzusehen ist, wird der Ursprung derselben als des Bösen nicht dem Sosein von einzelnen Gegenständen, aus deren Erkenntnis die subjektive Empfindung der Lust und Unlust entspringt, zugeschrieben, weil das sukzessive Entstehen von Gegenstandserkenntnissen bzw. Gegenständen für sich weder gut noch böse, sondern bloß neutral ist. Nicht gut ist aber jene Abhängigkeit der pathologisch-praktischen Lust vom Empirischen selbst, die auf dem Prinzip der Maximierung der eigenen pathologischen Lust (Vergnügen) gründet, welches das Prinzip der Selbstliebe bzw. der Glückseligkeit98 genannt wird. Obwohl dieses als ,Ideal der Einbildungskraft‘99 bezeichnet wird, weil die pathologische Lust nicht intellektuell ist und die Idee ihrer Maximierung durch die Einbildungskraft gebildet Existenz seines Gegenstandes behaftet ist“ (kursiv v. Verf.). 95 KpV, V 22 <A40>. 96 Vgl. MS, VI 212 Z20–23; Anthr., VII 251. Vgl. auch KpV, V 72f <A128f>: „Denn alle Neigung ... ist auf Gefühl gegründet“. Vgl. auch GMS, IV 413 Anm. <B38>. 97 Rel., VI 28 <B20f>. Auch Selbstliebe ist ein Hang. Vgl. dazu KpV, V 74 <A131>. 98 KpV, V 22 Z6–8, Z21–25. Die hier gemeinte Glückseligkeit ist nicht moralisch, sondern nur physisch. 99 GMS, IV 418 <B47>. 38 wird, ist es doch als ein ethisches Grundprinzip intelligibel, so daß seine Aufnahme in die Grundmaxime der Gesinnung als „intelligibele Tat“100 auf der intelligiblen Ebene erfolgt. Daher hat auch die Abhängigkeit des Lustgefühls vom Empirischen ihren Grund zuletzt nicht in der empirischen, sondern in der intelligiblen Ebene. (d) Die Unabdingbarkeit der Distanzierung von der Abhängigkeit von Gegenständen und die Aufgabe der formalistischen Grundlegung der Ethik. Obgleich nun die Abhängigkeit des Lustgefühls von Gegenständen, worauf Begierde, Neigung und Hang auch gegründet sind, beim Menschen wohl von Natur und in diesem Sinne etwas Apriorisches ist, so kann sich seine freie Willkür nicht dauernd darin aufhalten. Denn (1) sie muß sonst, vom Empirischen herumgetrieben, ständig in ruhelosen materialen Bedürfnissen bleiben, die der Mensch immer als „ein noch größeres Leeres“101 empfindet, – im Leben überwiegen die Schmerzen Kants pessimistischer Ansicht zufolge letzten Endes die Vergnügen;102 (2) die unter der Dominanz der pragmatisch-praktischen Vernunft stehende Willkür, die durch die pathologisch-praktische Lust vom Empirischen abhängig ist, wird in äußerste Widersprüche, Gegensätze und Widerstreite verwickelt, die dem Harmonie-Gedanken Kants in der Ethik entgegenstehen (cf. 2.3.1). Im Festhalten an der unbedingten Gesetzlichkeit für die Praxis gelingt es der freien Willkür, beide negativen Zustände, die sie nur belasten, zu überwinden und innere Zufriedenheit des Herzens zu erlangen. Denn mit ihr hält man sich von der Abhängigkeit von Gegenständen fern.103 Dieses reale Fernhalten von Abhängigkeit im Ethos eines Menschen findet auch in der praktisch-theoretischen formalistischen Grundlegung der Ethik, die es auf Rel., VI 31 Z32 <B26>, 39 Anm. Z26 <B39>. Wenn diese ursprüngliche Freiheit auf intelligibler Ebene als die praktische Vernunft interpretiert werden kann, so kommt es bei der Prinzipienwahl der freien Willkür auf derselben Ebene auf die Entscheidung der praktischen Vernunft an, die als intellektuelles Vermögen entweder empirisch bedingt oder rein sein kann. 101 KpV, V 118 <A212>: „Denn die Neigungen wechseln, wachsen mit der Begünstigung, die man ihnen widerfahren läßt, und lassen immer ein noch größeres Leeres übrig, als man auszufüllen gedacht hat. Daher sind sie einem vernünftigen Wesen jederzeit lästig, und wenn es sie gleich nicht abzulegen vermag, so nötigen sie ihm doch den Wunsch ab, ihrer entledigt zu sein.“ Vgl. dazu auch Refl. 7202, XIX 277 Z17–27, ψ (1780–89). 102 Vgl. Anthropologie Dohna-Wundlacken, in: Kowalewski, A., op.cit., S. 178; Anthr., VII 231f. 103 Das hier eingeführte Wort ,Fernhalten‘ bzw. ,Distanzierung‘, das im menschlichen Herzen zur inneren Zufriedenheit unabdingbar ist, will Inbegriff von Wörtern sein wie ,Entledigen‘ (im Zitat V 118 von Fußnote 101), ,Befreien‘, ,Erleichtern‘, ,Losmachen‘ und „Unabhängigkeit von Neigungen“ in folgenden Belegen: „Das Herz wird doch von einer Last, die es jederzeit insgeheim drückt, befreit und erleichtert, wenn an reinen moralischen Entschließungen ... dem Menschen ein inneres ... Vermögen, die innere Freiheit, aufgedeckt wird, sich von der ungestümen Zudringlichkeit der Neigungen ... loszumachen.“ (KpV, V 161 <A287>); „Freiheit und das Bewußtsein derselben als eines Vermögens, mit überwiegender Gesinnung das moralische Gesetz zu befolgen, ist Unabhängigkeit von Neigungen, wenigstens als bestimmenden (wenngleich nicht als affizierenden) Bewegursachen unseres Begehrens, und sofern als ich mir derselben in der Befolgung meiner moralischen Maximen bewußt bin, der einzige Quell einer notwendig damit verbundenen, auf keinem besonderen Gefühle beruhenden, unveränderlichen Zufriedenheit, und diese kann intellektuell heißen“ (KpV, V 117 <A212>). Es bezieht sich demnach im allgemeinen auf die negative Freiheit. 100 39 die gesetzgebende Form und die Abstrahierung von der Materie (Gegenständen) absieht, ihren Niederschlag. Es bezieht sich nämlich auf die negative Freiheit. 1.2.3 Die Distanzierung von der Abhängigkeit der Lust von Gegenstandsvorstellungen (vor allem der Vollkommenheit einer Objektvorstellung) und die Einräumung der gesetzgebenden reinen für sich praktischen Vernunft in Anmerkung I zu §§ 2 und 3. (a) Die Absicht von Anmerkung I zu §§ 2 und 3. Anmerkung I zu §§ 2 und 3104 stellt zusammen mit dem ihr vorangegangenen Haupttext der beiden Paragraphen das erste fundamentale Stadium der formalistischen Grundlegung der Ethik dar, in dem die Grundtendenz des Lustgefühls als Abhängigkeit vom empirischen Seienden, vor allem aber latent von der Vollkommenheit desselben, die auf dem Prinzip des Konsensus in der Gegenständlichkeit beruht, überwunden wird. Dem Begehrungsvermögen (facultas appetitiva), das nur durch die Lust an den Gegenstandsvorstellungen von diesen abhängt – sie mögen Sinnes- oder sogar Vernunftvorstellungen sein –, kann keine unbedingte praktische Gesetzlichkeit zugewiesen werden. Selbst die Vorstellung des moralischen Gesetzes, wenn sie für empirisch gehalten wird und als materialer Grund über die pathologisch-praktische Lust den Willen bestimmt, kann diesem gar keine unbedingte praktische Gesetzlichkeit verleihen,105 ebensowenig wie die Vorstellung des Willens Gottes. Damit wird fundamental im Zusammenhang mit dem Gefühl der Lust und Unlust die radikale Distanzierung von dem in der Sinnenwelt Seienden überhaupt – dies gleichwohl nur zum Zweck der Feststellung und Grundlegung der apriorischen Gesetzlichkeit und Freiheit für die Praxis – vollzogen, die in folgenden Regressionsstadien dem weiteren Versuch der formalistischen Grundlegung KpV, V 22–25 <A41–45>. Vgl. dazu KpV, V 25 <A45>: „Die Vernunft bestimmt in einem praktischen Gesetze unmittelbar den Willen, nicht vermittelst eines dazwischen kommenden Gefühls der Lust und Unlust, selbst nicht an diesem Gesetze“. Vgl. auch V 64 <A113>: „Nun mochten sie [sc. die Philosophen] diesen Gegenstand der Lust, der den obersten Begriff des Guten abgeben sollte, in der Glückseligkeit, in der Vollkommenheit, im moralischen Gesetze [!], oder im Willen Gottes setzen, so war ihr Grundsatz allemal Heteronomie, sie mußten unvermeidlich auf empirische Bedingungen zu einem moralischen Gesetze stoßen: weil sie ihren Gegenstand, als unmittelbaren Bestimmungsgrund des Willens, nur nach seinem unmittelbaren Verhalten zum Gefühl [der Lust], welches allemal empirisch ist, gut oder böse nennen konnten.“ Obwohl das Wort „Gesetze“, wie Hartenstein vorschlägt, in Anpassung an die Tafel in V 40 <A69>durch „Gefühl“ mag ersetzt werden, so kann der Satz doch auch ohne die Korrektur logisch verstanden werden. Auch H. Cohen korrigiert das Wort nicht (Cohen, H., Kants Begründung der Ethik, Berlin 2 1910, S. 346). Daß nun in der kognitiven formalistischen Grundlegung der Ethik die Distanzierung des Willens von der Abhängigkeit von Gegenstandsvorstellungen als materialen Bestimmungsgründen desselben (die negative Freiheit) auch von der für empirisch gehaltenen Vorstellung von Gesetz und Gottes Willen gilt, ist von großer Bedeutung. Denn sie macht das Wesen der Autonomie des Willens (der positiven Freiheit) aus, aus der sich in der essentiellen, architektonischen Phase der Grundlegung der Ethik rein intellektuell – ohne die Abhängigkeit von allerlei Gegenstandsvorstellungen durch die pathologische Lust – durch das reine Denken die Idee der intelligiblen Welt als des Reiches Gottes entwickelt. 104 105 40 für Gesetz und Freiheit als Grundkonzept und -kriterium dienen kann. Anmerkung I zu §§ 2 und 3 selber, die genauer an die „Folgerung“106 aus §§ 2 und 3 angehängt ist, thematisiert sowohl die Aberkennung der Superiorität einer absoluten praktischen Gesetzgebung vom Begehrungsvermögen, das auf der pathologisch-praktischen Lust an Gegenstandsvorstellungen beruht, als auch die Zuerkennung derselben zur reinen für sich praktischen Vernunft, die für sich selbst unmittelbar den Willen bestimmt, indem sie sich von der Abhängigkeit von Gegenständen überhaupt distanziert. Denn die Vorstellungen der Gegenstände, seien sie Sinnes-, Verstandes- oder Vernunftvorstellungen, müssen durchaus bloß empirische Bestimmungsgründe der Willkür sein; das will sagen, daß der moralische apriorische Bestimmungsgrund des Willens nicht in der Gegenständlichkeit von Gegenständen liegt, die, wenn sie die Willkür bestimmen sollen, unvermeidlich durch das pathologische Gefühl der Lust und Unlust als Begleitempfindung der objektiven Erkenntnis, durch die sie zuwegegebracht werden, vermittelt werden müssen, sondern in der transzendental-subjektiven Gesetzlichkeit der reinen praktischen Vernunft in uns. Der Grund der Notwendigkeit der Ab- und Zuerkennung der absoluten Gesetzgebung in Anmerkung I besteht demnach in der Grundeinsicht, daß die pathologisch-praktische Lust an Vernunftvorstellungen, insbesondere an der Vollkommenheit einer Sache, mit derjenigen an Sinnesvorstellungen – entgegen der Ansicht der „sonst scharfsinnige[n] Männer“,107 d.i. der Wolffianer – so gleichartig ist, daß sie ebensowenig wie diese die erforderliche unbedingte praktische Gesetzlichkeit herbeiführen kann. Diese Grundeinsicht Kants ist aus seinen Auseinandersetzungen mit der schulphilosophischen Theorie über appetitus und perfectio in der Phase seiner formalistischen Grundlegung der Moralität hervorgegangen, deren Ergebnis diese Anmerkung ist. Sie haben aber auch seinen eigenen Begriff einer transzendental-subjektiven Vollkommenheit aktualisiert und sind demnach von der Bildung der Theorie einer spontanen (d.h. selbsttätigen) moralischen Subjektivität der Bonität (cf. 1.5) begleitet. Ihnen ist im folgenden nachzugehen, und zwar in dem Maße, wie Kant die Wolffsche Vollkommenheit seinerseits verstanden hat. (b) Das Begehrungsvermögen nach Vollkommenheit hat keine Kompetenz der absoluten Gesetzgebung. Kant spricht in dieser Anmerkung dem Begehrungsvermögen, das sich nach der Vernunftvorstellung eines Objekts richtet, bei der es sich Wolffianisch um die Vollkommenheit der Vorstellung desselben handelt,108 die Superiorität, die Kompetenz V 22 Z26–31 <A41>. V 22 Z32 <A41>. 108 Vgl. dazu zunächst Messer, A., Kommentar zu Kants ethischen und religionsphilosophischen Hauptschriften, Leipzig 1929, S. 59: „eine Vernunftvorstellung (wie z.B. Vollkommenheit)“. Vgl. auch Beck, L. W., A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, Chicago 1960, S. 94f: „In Wolff’s doctrine, desire has as its condition the knowledge of a perfection. If this knowledge ist obscure or confused, corresponding to the lower faculty of sense, the desire can mislead us into erroneous or bad conduct; if it is clear and distinct, coming from the higher cognitive faculty of 106 107 41 der absoluten Gesetzgebung für sich, ab, sofern die Lust in ihm, durch welche die Vernunftvorstellung eines Objekts der Grund der Willkürbestimmung sein kann, ebenso wie die Lust an Objektvorstellungen überhaupt, von dieser Vorstellung als Objektvorstellung abhängig, folglich pathologisch-praktisch (Vergnügen, voluptas) ist. Ein oberes Begehrungsvermögen, dem praktische Gesetzgebung beizulegen ist, kann also durch die Differenzierung der objektiven Zielvorstellungen des Begehrens in Vernunft- und Sinnesvorstellungen nicht eingeräumt werden. (c) Der Begriff der Vollkommenheit. Baumgarten gibt dem Begriff der Vollkommenheit im allgemeinen Sinne folgende Definition: „Wenn viele Sachen zusammengenommen den hinreichenden Grund von Einem enthalten, so stimmen sie zu diesem Einen zusammen (consentiunt). Die Zusammenstimmung (consensus) selbst ist die Vollkommenheit (perfectio), und das Eine, zu welchem sie zusammenstimmen, ist der Bestimmungsgrund der Vollkommenheit (ratio perfectionis determinans, focus perfectionis).“109 Eine gleichartige Erklärung gibt auch Kant: „Die Vollkommenheit im respektiven Verstande ist die Zusammenstimmung des Mannigfaltigen zu einer gewissen Regel, diese mag sein, welche sie wolle.“110 Die formale Struktur der Implikation des Begriffes rekrutiert sich demnach aus zwei Strukturelementen: Zusammenstimmung (consensus) und das Eine als Grund derselben (unum, in quod consentitur; ratio perfectionis determinans). Konsens zu Einem, dieses sei, was es wolle, ist Form der Vollkommenheit,111 während das Eine als Zweck (Gegenstand) Materie derselben heißt.112 Während einerseits der Consensus als Form der Vollkommenheit in den „Reflexionen“ als Gefüge für harmonische Zusammenhänge der Freiheit mit Gesetzen, mithin auch für die Zufriedenheit mit sich selbst verwendet (cf. 2.2, 2.3, 2.4) und zuletzt in der KU als subjektive Zweckmäßigkeit ohne Zweck, die kontemplative Lust herbeischaffen kann, für die Analyse des Schönen eingesetzt wird,113 so understanding, the will is rightly guided to choose a real perfection. Hence the work of reason or understanding in morals, as elswhere in the rationalistic philosophy, is to bring our ideas to clearness and distinctness, for the difference between a sensuous and a rational concept is a difference only in clarity and not in kind.“ 109 Baumgarten, A. G., Metaphysica, lat., § 94 (AA XVII 46), dt., § 73. 110 Optim., II 30 Anm. Vgl. auch EE, XX 227 <H33f>: „... wenn die Zusammenstimmung des Mannigfaltigen zu Einem Vollkommenheit heißen soll ...“ Vgl. auch Refl. 403, XV 161f, α? β? (1753–55?, 1752–59?). 111 Refl. 5245, XVIII 130, υ? 1776–78?: „Die Qualität in dem, was vollkommen ist, ist der consensus zu einem. Das ist aber nur die Form der Vollkommenheit.“ 112 Metaphysik Dohna-Wundlacken, in: Kowalewski, A., op.cit., S. 542f: „Unser Autor [sc. Baumgarten] definiert sie [sc. die Vollkommenheit]: consensus (variorum) ad unum. ... In dieser Zusammenstimmung besteht die formale Vollkommenheit, die materiale aber in dem Einen, zu welchem jenes Mannigfaltige zusammenstimmt. Man nennt dies auch die Absicht.“ 113 KU, V 227 <B45f>: „Das Formale in der Vorstellung eines Dinges, d.i. die Zusammenstimmung des Mannigfaltigen zu Einem (unbestimmt was es sein solle), gibt für sich ganz und gar keine objektive Zweckmäßigkeit zu erkennen: weil, da von diesem Einen als Zweck (was das Ding sein solle) abstrahiert wird, nichts als die subjektive Zweckmäßigkeit der Vorstellungen im Gemüte des Anschauenden übrig bleibt, welche wohl eine gewisse Zweckmäßigkeit des Vorstellungszustandes 42 muß die Vollkommenheit in materialer Hinsicht auf der anderen Seite (die durch das unum, in quod consentitur, bestimmt wird), wenn sie praktisch ein Grund der Willensbestimmung sein soll114 und sofern das Eine als Grund der Zusammenstimmung objektiv ist, im Gegensatz zur Wolffschen Ableitung der Lust aus der Vollkommenheit das Gefühl der Lust und Unlust am Objekt voraussetzen.115 Hier in unserer praktischen Hinsicht kann von der Vollkommenheit in theoretischer bzw. transzendentalphilosophischer Bedeutung (quantitative Vollkommenheit: transzendentale116 und metaphysische) nicht die Rede sein, sondern nur von derjenigen in teleologischer (qualitative bzw. formale Vollkommenheit) und hypothetisch-praktischer Bedeutung.117 Sie heißt teleologisch „die Zusammenstimmung der Beschaffenheiten eines Dinges zu einem Zwecke“.118 Die formale Struktur des Begriffs der Vollkommenheit im allgemeinen Sinne, die aus consensus und unum, in quod consentitur, besteht, trägt hier deutlich teleologisches Gepräge, das bereits in ihrer allgemeinen Definition impliziert ist. Bei unserer jetzigen praktischen Problematik kommt es auf die teleologisch gedeutete Vollkommenheit in materialer Hinsicht, die objektive Zweckmäßigkeit auf empirischer Ebene, die auf die Willensbestimmung gehen soll, an.119 Diese Vollkommenheit, deren Materie, der Grund der Zusammenstimmung als Zweck, objektiv und vorher gegeben ist, heißt in hypothetisch-praktischer Bedeutung „die Tauglichkeit oder Zulänglichkeit eines Dinges zu allerlei Zwecken“,120 welche als Beschaffenheit des Menschen insbeim Subjekt und in diesem eine Behaglichkeit desselben, eine gegebene Form in die Einbildungskraft aufzufassen, aber keine Vollkommenheit irgendeines Objekts, das hier durch keinen Begriff eines Zwecks gedacht wird, angibt.“ 114 Die Vollkommenheit in materialer Hinsicht als objektive Zweckmäßigkeit muß nicht immer praktisch-zweckmäßig sein, sondern kann auch bloß physisch-teleologisch zur realen Technik der Natur gehören, wobei sie mit dem Gefühl der Lust nichts zu tun hat. Vgl. dazu EE, XX 228 <H35>. 115 Refl. 746, XV 328, ν–ξ? (1771–72?) ρ–τ? (1773–76?): „Es ist zu merken, daß die Lust und Unlust nicht Vorstellungen der Vollkommenheit sein, sondern diese jene voraussetze; daher, weil wir an einer Übereinstimmung eine Lust haben, ist sie für uns eine Vollkommenheit; aber nicht jede Lust bedeutet eine Vollkommenheit, sondern nur die durch den Verstand.“ Refl. 6488, XIX 25f, δ–η (1762–68): „Suche die Vollkommenheit um des Gefühls der Lust an der Handlung halber. / Ungewißheit, ohne moralisch Gefühl auszumachen, wo die größeste Vollkommenheit sei“. Oder vgl. auch Refl. 7229, in der die Vollkommenheit dem Kontext nach doch in materialer Hinsicht vorgestellt ist. 116 Baumgarten, Metaphysica, lat., § 98. 117 KU, V 227 <B45>; MS, VI 386; Refl. 5245; Refl. 5753. 118 MS, VI 386. Vgl. auch KU, V 311 <B188>: „... da die Zusammenstimmung des Mannigfaltigen in einem Dinge zu einer innern Bestimmung desselben als Zweck die Vollkommenheit des Dinges ist, ...“; KrV, III 456 <B722>: „Vollständige zweckmäßige Einheit ist Vollkommenheit (schlechthin betrachtet).“ 119 Vgl. auch Refl. 7238, XIX 292, ψ (1780–89): „Der Begriff der Vollkommenheit, der vor dem der Zweckmäßigkeit vorhergeht, ist theoretisch und bedeutet den der Vollständigkeit in der Verbindung des Mannigfaltigen zu Einem. Allein der Begriff der Vollkommenheit, der praktisch sein soll, muß den Begriff eines Zwecks voraussetzen, folglich den Begriff eines Guten, weil der Imperativ, daß etwas getan werden soll, sagt, daß eine durch mich möglich Handlung gut sein würde.“ 120 KpV, V 41 <A70>. Diese Vollkommenheit, die wohl zunächst problematisch-praktisch ist, jedoch zugleich auch im Hinblick auf die Glückseligkeit pragmatisch-praktisch sein kann, ist vorsichtig als ,Vollkommenheit in hypothetisch-praktischer Bedeutung‘ zu bezeichnen. 43 sondere nichts anderes als Talent und Geschicklichkeit ist. Nun läßt sich objektive Zweckmäßigkeit auch intellektuell vom praktischen Endzweck des freien Willens her bilden. Dieses Geschäft aber kann erst in der Problematik der ,moralischen Teleologie‘ begonnen werden (cf. 3.). (d) Die Wolffianische Ableitung der appetitio aus der cognitio perfectionis. Der Zusammenhang zwischen Vollkommenheit, Lust, Begierde, Willkür und dem oberen Begehrungsvermögen läßt sich Wolffianisch aufgrund der Grundpotenz einer vis repraesentativa universi wie folgt darstellen: (1) Die Lust entspringt aus der anschauenden Erkenntnis einer Vollkommenheit in der ontologischen Struktur der Gegenstände als Harmonie, (2) aus ihr besteht die Begierde (appetitio) und mithin auch die Willkür (arbitrium), und (3) das Begehrungsvermögen (facultas appetitiva), das vom Begriff der Begierde (appetitio) her gedacht ist und das auf die Gegenstandsvorstellung der Vollkommenheit geht, die in der Eindimensionalität von Vorstellungen überhaupt (repraesentatio) klar und deutlich erkannt wird und deswegen Vernunftvorstellung heißt, rangiert an oberter Stelle (facultas appetitiva superior, voluntas).121 Kant sagt zu dieser Wolffianischen Ableitung des Begehrungsvermögens: „Wolff wollte alles aus dem Erkenntnisvermögen ableiten und definierte Lust und Unlust als actus des Erkenntnisvermögens. Auch das Begehrungsvermögen nannte er ein Spiel der Vorstellungen, also ebenfalls Modifikation des Erkenntnisvermögens. Hier glaubt man nun Einheit des Prinzips zu haben (...). – Diese ist aber hier unmöglich.“122 Ist das Begehrungsvermögen Modifikation des Erkenntnisvermögens, so heißt das die Ableitung des Begehrungs- aus dem Erkenntnisvermögen, in welcher zwei Übergangsstufen sich unterscheiden lassen: Übergang (1) von theoretischer Erkenntnis zu Lust und (2) von dieser zu Begierde. Unter ihnen aber fechtet Kant nur die erste Übergangsstufe an. Die zweite hingegen geht mit seiner Erläuterung zur im Grunde von den Wolffianern übernommenen Willkürtheorie zunächst ziemlich konform.123 Zu Stufe (1): Wolff erklärt: „Die Lust (voluptas) ist die Anschauung oder anschauliche Erkenntnis irgendeiner Vollkommenheit (cognitio intuitiva perfectionis cuiuscunque), sei es einer wahren oder einer falschen.“124 Unter voluptas, ob121 Wolff selbst aber, der von den Wolffianern zu unterscheiden ist, denkt, daß die Begierde nach Vollkommenheit nicht sosehr auf der dadurch erworbenen Lust als vielmehr auf der Bonität der Vollkommenbeit beruht. Vgl. dazu etwa Beck, L. W., op.cit., S. 94 Anm. 15: „But Wolff is not, at least by his own profession, a hedonist, for the perfection ist desired because it is good and not because its achievement gives pleasure (...). Many of Wolff’s Followers did not observe this nice distinction, ..., and were easy targets for Kant’s criticism here.“ 122 Metaphysik Dohna-Wundlacken, in: Kowalewski, op.cit., S. 596. 123 Vgl. z.B. MS, VI 399: „Alle Bestimmung der Willkür aber geht von der Vorstellung der möglichen Handlung durch das Gefühl der Lust und Unlust, an ihr oder ihrer Wirkung ein Interesse zu nehmen, zur Tat“. Das Wort Willkür kann per definitionem durch die ,tätige Begierde‘ ersetzt werden, um den Satz in bezug auf die Begierde zu verstehen. 124 Wolff, Chr., Psychologia empirica, § 511, in: ders., Gesammelte Werke, hrsg. v. J. Ecole u.a., II Abteilung, Bd. 5, psychologia empirica, Hildesheim 1968, S. 389. 44 wohl sie sich auf eine Vollkommenheit bezieht, ist hier Kantisch die pathologischpraktische Lust zu verstehen, die, da sie keine unbedingte Gesetzlichkeit herbeischaffen kann, keineswegs zum reinen System der Moral gehören kann. Die eigentliche reine Lust, die moralische, hingegen hat einen anderen Ursprung als in rezeptiven Erkenntnissen der Gegenstände, sie entspringt nämlich aus der Zusammenstimmung mit der transzendental-subjektiven Aktualität von Gesetz und Vernunft. Würde nun der theoretischen Erkenntnis eines vollkommenen Gegenstandes eine intellektuelle Anschauung eingeräumt, so könnte von der ersteren möglicherweise die voluptas qua pura abgeleitet werden, die sich zur reinen Moralität entfalten kann. Aber bei Kant sind für die theoretische Erkenntnis nur sinnliche Anschauungen bzw. Empfindungen gegeben, die nicht dazu fähig sind, der Lust zur Handlung die für Moralität erforderliche unbedingte Gesetzlichkeit zu verleihen. Zu Stufe (2): Ist unter dem Leben „die Kausalität der Vorstellungskraft in Ansehung der Wirklichkeit ihrer Gegenstände“ (causalitas repraesentativa respectu obiecti) zu verstehen, so ist im Lustgefühl primär „die Beziehung der Vorstellung aufs Subjekt als Bestimmung ihrer Kausalität“ zu sehen, während bei der Begierde eher von der „Beziehung der Lebenskraft aufs Objekt als causatum“ die Rede sein soll.125 Außer dieser geringen Differenz lassen sich jedoch zwischen dem Wohlgefallen an der Wirklichkeit der Objekte (complacentia actualitatis obiecti), wozu das Wohlgefallen am Schönen nicht gehört, und der Begierde (appetitio) überhaupt – letztlich darum, weil beide die Abhängigkeit von Objekten als ihr Grundcharakteristikum aufweisen – sowenig Unterschiede wahrnehmen,126 daß die Lust als Vermögen der Tätigkeit schon mit der Begierde zusammenfällt.127 Der Wolffianische kontinuierliche Übergang von complacentia zu appetitio wird auch bei Kant für die sinnliche Willkürbestimmung aus der empirischen, pathologisch-praktischen Lust eingeräumt, welche aber mit der moralischen Willensbestimmung aus absoluter praktischer Gesetzlichkeit nichts zu tun hat, so daß die Wolffianische Ableitung der Begierde aus der Harmonie von Gegenständen für die Moralitätsuntersuchung Kants ein uneigentlicher Weg ist, auf dem nur das untere Begehrungsvermögen zugelassen werden kann. Der enge Zusammenhang zwischen complacentia und appetitio wird allerdings auch der intellektuellen moralischen Lust in der architektonischen Phase der Grundlegung der Ethik, in der es um die Realisierung einer Handlung als guter aus dem Ursprung der Moralität in der Sinnenwelt geht, eingeräumt; dieser Lust müssen aber moralisches Gesetz und Refl. 1050, XV 469, ψ3 ? (1785–88?). Vgl. auch Refl. 1034, 1048, 1021. Refl. 1049, XV 469, ψ3−4 (1785–89): „Complacentia actualitatis obiecti est appetitio.“ Vgl. auch Refl. 1015, 1019, 1023, 1028. 127 Met.L/1 (Pölitz), XXVIII 253f: „Das Vermögen der Lust und Unlust war das Verhältnis des Gegenstandes auf unser Gefühl der Tätigkeit, entweder der Beförderung, oder der Behinderung des Lebens. Inwiefern aber das Vermögen der Lust und Unlust ein Vermögen ist von gewissen Tätigkeiten und Handlungen, die demselben gemäß sind; in so fern ist es eine Begierde.“ Hiermit wird unterdessen auch der Übergang vom zweiten zum dritten der drei Grundvermögen des Menschen, Erkenntnisvermögen, Gefühl der Lust und Unlust und Begehrungsvermögen (ibid., XXVIII 228; Anthr., VII 123f; Kowalewski, op.cit., S. 75; EE Abschnitt III, XX 205–208 <H10–12>), vollzogen. 125 126 45 Freiheit vorhergehen.128 Dabei ist jedoch nicht außer acht zu lassen, daß bei Kant das moralische Gesetz unmittelbar den Willen bestimmt. D. Henrich bezeichnet diese kontinuierliche Ableitung der appetitio aus theoretischer Erkenntnis harmonischer Gegenständlichkeit bei Wolff als Benutzung des „Doppelsinn[s] im Begriff der Lust“: „Wohlgefallen als ,Lust an etwas‘ ist nicht dasselbe wie die praktische Lust des ,Begehrens von etwas‘.“129 Dieser Einwurf einer Äguivokation besteht darin, daß das „Wohlgefallen als Lust an etwas“ aus der anschauenden Erkenntnis einer gegenständlich gedachten Vollkommenheit als rezeptiv-theoretischer Erkenntnis entspringt, während „die praktische Lust des Begehrens von etwas“ spontan auf den Gegenstand einer Vorstellung wirkt. Die Kantische Kritik an der Schulphilosophie aber richtet sich nicht sosehr gegen jenen kontinuierlichen Übergang von Lust zu Begierde (Übergangsstufe 2), wie die Formulierung Henrichs uns zunächst nahelegen mag, als vielmehr gegen die Verbundenheit der anschauenden Erkenntnis mit der Lust und mithin mit der Begierde, d.i., wie er auch nachher erwähnt, gegen die vis repraesentativa universi als repraesentatio und appetitio in einem,130 m.a.W. gegen die Abhängigkeit des eigentlich freien menschlichen Willens von der Gegenständlichkeit der Gegenständen. (e) Kants Widerlegung des Wolffianischen Prinzips der Vollkommenheit für Praxis. Die Wolffianische Vollkommenheit als praktisches Prinzip kann, auch wenn sie theoretisch klar und deutlich erkannt werden mag, in der Kantischen Perspektive, die keineswegs die intellektuelle Anschauung im theoretischen Bereich131 gestattet, gar nicht als Vernunftprinzip der reinen Sittlichkeit taugen. Sie ist bloß einer der praktischen materialen Bestimmungsgründe des Willens.132 Denn die Vollkommenheit, die praktisch der Bestimmungsgrund des Willens sein soll, ist, wie oben erläutert (cf. 1.2.3.c), die Vollkommenheit in materialer Hinsicht und stellt demnach nichts als objektive Zweckmäßigkeit dar, und ihre Materie, der bestimmende Grund der Zusammenstimmung (ratio perfectionis determinans) müssen Zwecke sein, die objektiv und vorher gegeben, sonach, weil nur sinnliche Anschauungen erlaubt sind, empirisch sein müssen (dementsprechend muß auch die objektive Zweckmäßigkeit, als welche die Wolffianische Vollkommenheit herausgestellt Vgl. dazu z.B. Refl. 1044, XV 467, ψ1−2 (1780–84): „... die [appetitiones] simpliciter intellectuales stehen unter moralischen Imperativen vom absoluten Gut. Es ist aber alles bloß relativ gut, außer die Übereinstimmung der Freiheit mit sich selbst nach allgemeinen Gesetzen; der korrespondiert complacentia intellectualis pura.“ Cf. 2.5.1. Vgl. auch Refl. 1049. Vgl. auch MS, VI 399 (cf. Fußnote 123 von oben). 129 Henrich, D., Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, in: Prauss, G. [Hrsg.]; Kant, Köln 1973, S. 237. 130 Vgl. ibid., S. 252, Anm. 19. 131 Die intellektuelle Selbstaufdrängung der moralischen Gesetzlichkeit als Faktum wird von Kant eine gewisse Zeit lang als intellektuale Anschauung bezeichnet (cf. Fußnote 565 in 3.2.0). Er war nahe daran, im praktischen Bereich diesen Terminus einzuräumen. 132 Vgl. dazu die Tafel in KpV, V 40 <A69>. 128 46 wird, bloß empirisch sein; sie kann nicht so intellektuell sein wie in der ,moralischteleologischen‘ Phase der Grundlegung, weil sie nicht aus dem praktischen Endzweck, den die reine praktische Vernunft von der Freiheit, d.h. Unabhängigkeit von empirischen Gegenständen her moralisch-praktisch entwirft, sondern aus der theoretischen, mithin empirischen Erkenntnis zustandekommen soll); bei solchen vorgegebenen empirischen Objekten als Zwecken indessen gilt behufs der Willkürbestimmung nur die pathologisch-praktische Lust; der Wolffianische Begriff der Vollkommenheit setzt also in Wahrheit die pathologisch-praktische Lust voraus,133 die wegen ihrer empirischen rezeptiven Bedingtheit (cf. 1.2.1.c) der Willkür keineswegs unbedingte praktische Gesetzlichkeit verleihen kann; folglich kann er als praktisches Prinzip gar nicht die reine Moralität, die die unbedingte praktische Gesetzlichkeit aufweisen soll, herbeischaffen und taugt also nicht als Vernunftprinzip der reinen Moralität. Die Lust an der Vollkommenheit als Vernunftvorstellung eines Objekts ist eine Abhängigkeit von Objekten und kann daher kein reines Prinzip des freien Willens schaffen. So sagt Kant, daß „uns Zwecke vorher gegeben werden müssen, in Beziehung auf welche der Begriff der Vollkommenheit (...) allein Bestimmungsgrund des Willens werden kann, ein Zweck aber als Objekt, welches vor der Willensbestimmung durch eine praktische Regel vorhergehen und den Grund der Möglichkeit einer solchen enthalten muß, mithin die Materie des Willens, als Bestimmungsgrund desselben genommen, jederzeit empirisch ist, mithin ... niemals ... zum reinen Vernunftprinzip der Sittenlehre und der Pflicht dienen kann“.134 In der EE formuliert Kant seine Widerlegung des Wolffianischen Prinzips der Vollkommenheit, obzwar hauptsächlich nur im Blick auf kontemplative Lust, doch gültig auch für die pathologisch-praktische Lust, lapidar: „Vollkommenheit ist eine Bestimmung, die einen Begriff vom Gegenstande voraussetzt“, und sagt weiter, „daß vom Erkenntnis zum Gefühl der Lust und Unlust kein Übergang durch Begriffe von Gegenständen (...) stattfinde“.135 Das Vermögen des Begehrens einer Vernunftvorstellung von einem Gegenstand, vor allem der Vollkommenheit, das sich auf die Begierde beruft, die aus der pathologisch-praktischen Lust an der Materie der Vollkommenheit folgt, wird demnach nur als das untere bezeichnet; es fehlt daher eben noch ein oberes Begehrungsvermögen.136 Kurzum, kein Moralprinzip, das irgendwie rezeptiv von der Existenz der Gegenstände abhängt, sei es empirisch, sei es rational, ist imstande, die von Kant geforderte Unbedingtheit der reinen Moralität aus Freiheit zu stiften. Der Begriff der Zusammenstimmung, bei dem es sich um die wesentliche Kom133 Refl. 6624, XIX 116, κ–λ? (1769–70?): „Wolff [hat] den Begriff der Vollkommenheit ... angenommen. Allein der allgemeine Begriff der Vollkommenheit ist nicht durch sich selbst begreiflich, und von ihm wird keine praktische Beurteilung abgeleitet, sondern er ist vielmehr selbst ein abgeleiteter Begriff, indem das, was in besonderen Fällen gefällt, mit dem allgemeinem Namen vollkommen belegt wird.“ Vgl. auch Refl. 746. 134 KpV, V 41 <A70>. Um die Argumentation über dieses Zitat zu ergänzen, vgl. noch Lehrsatz I und die darauf folgende Erläuterung des § 2 des Grundsätze-Kapitels (KpV, V 21f <A38–40>). 135 EE, XX 226 <H33>und 229 <H36>. 136 Vgl. KpV, V 22 <A41>. 47 ponente des Begriffs der Vollkommenheit handelt, dessen Anwendung auf die Gegenständlichkeit der sinnlichen Natur zur moralischen Willensbestimmung, wie gesehen, bestritten worden ist, wird aber für die Explikation des moralischen Gesetzes als principium diiudicationis moralis, die durchs reine sittliche Denken ohne Bezug auf die sinnliche Gegenständlichkeit vorgenommen wird, doch mit voller Geltung verwendet (cf. 2.3.2). (f) Das arbitrium liberum sensitivum und intellectuale. Der Gegensatz zwischen dem unteren und dem oberen Begehrungsvermögen (facultas appetitiva inferior und superior) – das erstere beruht auf der pathologischpraktischen Lust an Gegenstandsvorstellungen (stimuli) als Abhängigkeit von ihnen, das letztere auf der reinen praktischen Vernunft – kommt auch paradigmatisch in demjenigen zwischen arbitrium inferius und superius137 zum Ausdruck, ist aber mit ihm nicht identisch. Beim arbitrium inferius als necessitatio per stimulos handelt es sich um das arbitrium brutum, das von den stimuli nezessitiert bzw. unmittelbar determiniert und deshalb dem Tier attribuiert wird.138 Von dem letzteren ist das arbitrium liberum sensitivum, das dem Menschen beizulegen ist, nur darin unterschieden, daß dieses von den stimuli nicht ohne Bewußtsein nezessitiert bzw. unmittelbar determiniert, sondern – was die Freiheit des Menschen anzeigt139 – nur affiziert bzw. impelliert wird.140 Der Gegensatz zwischen dem unteren und dem oberen Begehrungsvermögen hat also seinen konzeptionellen Ursprung in der Unterscheidung zwischen Tierheit und Vernünftigkeit am Menschen,141 entspricht aber genauer bei diesem selbst demjenigen zwischen arbitrium liberum sensitivum und intellectuale.142 Dem unteren Begehrungsvermögen, das auf der pathologischpraktischen Lust beruht, entspricht das arbitrium liberum sensitivum. Geht man demzufolge formalistisch vom unteren zum oberen Begehrungsvermögen als Ursprung der moralischen Handlungen zurück, so findet auch ein Übergang vom arbiVgl. Refl. 1027, XV 459, υ (1776–78): „Necessitatio per stimulos est arbitrium inferius. Independentia a coactione per stimulos libertas. Vis omnes actus arbitrio libero submittendi est arbitrium superius.“ 138 Vgl. dazu z.B. Refl. 1020, XV 456, ρ? σ? υ? (1773–75? 1775–77? 1776–78?): „Das arbitrium immediate determinatum per stimulos ist brutum.“ Vgl. auch Met.L/1, XXVIII 255. 139 Vgl. dazu Refl. 6938, XIX 210, ϕ (1776–78): „Die pathologische Nezessitation findet nicht statt, weil der Mensch frei ist“; Met.L/1, XXVIII 256: „Die Tiere können stricte per stimulos nezessitiert werden, die Menschen aber nur comparative“; ibid., 257: „Diese praktische Freiheit beruht auf der independentia arbitrii a necessitatione per stimulos“. 140 Zur Unterscheidung zwischen arbitrium liberum sensitivum und arbtrium brutum vgl. Met.L/1, XXVIII 255: „Das arbitrium sensitivum liberum wird nur von den stimulis affiziert oder impelliert; aber das brutum wird nezessitiert.“ Refl. 4226, XVII 465, λ? (1769–70?): „Das arbitrium sensitivum ohne Bewußtsein ist brutum.“ Vgl. auch Refl. 3715, XVII 254, δ? η?. 141 Vgl. z.B. Refl. 3872, XVII 320, η? (1764–68?): „Wir müssen an dem Menschen unterscheiden das Tier, d.i. ihn nach den Gesetzen der Sinnlichkeit, und den Geist: nach Gesetzen der Vernunft. Seine Willkür als Tier wird wirklich immer bestimmt durch stimulos; aber sein Wille ist doch frei, sofern seine Vernunft vermögend ist, diese Bestimmungen der Willkür zu ändern.“ 142 Zur Zusammenfassung der drei Arten des arbitrium vgl. Refl. 1026, XV 459, υ (1776–78). Vgl. auch Refl. 1021, XV 457, σ2 –χ2 , Z21–26. 137 48 trium liberum sensitivum zum intellectuale statt. Bei der ethischen formalistischen Grundlegung nun, die sich im Übergang von der Abhängigkeit vom Empirischen auf das Befreitsein von demselben hin artikuliert, sind bei Kant in der dargestellten Weise stets ihre Zielalternativen – wie etwa oberes Begehrungsvermögen, arbitrium liberum intellectuale, reine praktische Vernunft etc. – vorweggenommen und vorbereitet, die aus der Wolffianischen Psychologie geschöpft sind. Allerdings ist das arbitrium liberum intellectuale oder transcendentale, worin auch reine praktische Vernunft sich findet, eigentlich keine empirisch-psychologische Freiheit;143 Kant sieht den Grund und Ursprung dieser freien vernünftigen Willkür und des oberen Begehrungsvermögens nicht in der empirischen Psychologie, sondern setzt ihn weit höher – oder tiefer – in einen anderen Standpunkt jenseits der Erfahrungswelt an. Reine praktische Vernunft ist kein psychologisches Vermögen der menschlichen Seele, das wir innerlich empirisch empfinden können, sondern transzendentales Vermögen im Menschen, dessen Kausalität außer der Sinnenwelt zu suchen ist. Daher besteht zwischen sinnlicher und vernünftiger Willkür (arbitrium liberum sensitivum und intellectuale), anders als bei der Wolffianischen Seelenlehre, eine kontinuierlich nicht zu überbrückende Kluft der transzendentalen Differenz. Nun ist die oben am Anfang von (d) genannte dritte und letzte Stufe jener Ableitungsfolge zu erläutern, welche von der cognitio perfectionis an bis zur facultas appetitiva fortgesetzt wird. In Kants Verständnis hat der Wolffianische Übergang von Begierde zu Willkür in der dritten Stufe nur für die sinnliche Willkür (arbitrium liberum sensitivum) Geltung, die von Gegenstandsvorstellungen (stimuli) durch die pathologisch-praktische Lust an ihnen hindurch affiziert wird. Er ist kontinuierlich und ganz einfach: Begierde wird in die untätige (Wunsch und Sehnsucht) und die tätige eingeteilt, welche letztere einfach Willkür genannt wird.144 „Das Vermögen tätig zu begehren ist die Willkür.“145 Bei der tätigen Begierde, der Willkür, hat man es damit zu tun, zu begehren, was in unserer Gewalt ist.146 Wenn diese Willkür von einer Vernunftvorstellung wie einer Vollkommenheit determiniert wird, so entspricht sie in der Wolffianischen Ableitung dem oberen Begehrungsvermögen, während sie doch bei Kant auf jeden Fall sinnlich ist. In die 143 Vgl. dazu zunächst Met.L/1, XXVIII 255: „Die freie Willkür, sofern sie nach Motiven des Verstandes handelt,“ d.h. das arbitrium liberum intellectuale, „ist die Freiheit, die in aller Absicht gut ist. Dieses ist die libertas absoluta, welches die moralische Freiheit ist“; 257: „Diejenige Freiheit, die aber ganz und gar unabhängig von allen stimulis ist, ist die transszendentale Freiheit, wovon in der psychologia rationali geredet wird“; 267: „Nun folgt aber der transzendentale Begriff der Freiheit; dieser bedeutet die absolute Spontaneität, und ist die Selbsttätigkeit aus dem innern Prinzip nach der freien Willkür“; 269: „Nun bin ich mir aber bewußt, daß ich sagen kann: Ich tue; folglich bin ich mir keiner Determination bewußt, und also handele ich absolut frei.“ Zur psychologischen Freiheit vgl. KpV, V 94–97 <A168–174>. 144 Vgl. Met.L/1, XXVIII 254; Refl. 1028. Zu einer gleichartigen Unterscheidung Refl. 1021, XV 457, σ–χ (1775–79): „Alle Begierde ist entweder praktisch, die den Grund der Existenz des Objekts enthalten kann, oder müßig, die erstere ist Willkür.“ Zur Unterscheidung qzwischen Willkür und Wunsch vgl. auch MS, VI 213 Z17–19. 145 Refl. 1028, XV 460, υ (1776–78). 146 Refl. 1008, Nachtrag, XV 450, (1780–89): „appetitio eorum, quae sunt in potestate mea, est arbitrium.“ Vgl. auch Refl. 1021, 1059. 49 dargelegte Systematik der Ableitungsfolge von psychologischen Grundbegriffen: cognitio perfectionis, complacentia bzw. voluptas, appetitio und arbitrium, die die Schulphilosophie sowohl für sinnliche als auch für intellektuelle Vermögen gleicherweise eindimensional-kontinuierlich und ohne wesentliche Eigentümlichkeitsunterschiede gelten läßt, greift doch Kants scharfe Differenz zwischen Sinnen- und Verstandeswelt, m.a.W., die Differenz zwischen empirisch-objektiver rezeptiver Gegenständlichkeit und transzendental- subjektiver Aktualität des reinen sittlichen Denkens des menschlichen freien Willens entscheidend ein, welche letztere zuerst im Sittengesetz als Faktum erkannt wird, mithin anderer Herkunft ist und darum nicht von der ersteren abgeleitet werden kann. Das „liberum arbitrium intellectuale oder transcendentale“147 läßt sich nicht aus der Wolffianischen Ableitungslinie von ,theoretische Erkenntnis – Lust – Begierde – Willkür‘ schließen, sondern faktisch als transzendentales Vernunftvermögen im Menschen schlechterdings anerkennen, das aus einem anderen Standpunkt außer der theoretisch erkennbaren Sinnenwelt kommt. Um diese vernünftige Willkür in der begrifflichen Systematik einräumen zu können, gründet nun Kant den Begriff von Willkür im allgemeinen nicht sosehr auf den von Lust und Begierde, als vielmehr auf den von Belieben (lubitus). (g) Der Begriff vom Belieben (lubitus) als Wesen der Willkür. Daß das Wesen der freien Willkür des Menschen im Belieben (lubitus) liegt, ist bei Kant von früh an festgehalten: „Aus freier Willkür handelt sie [sc. die Substanz, die äußerlich nicht determiniert etwas hervorbringt, was vorher nicht war], sofern die Kausalität der Handlung in dem Belieben steckt, was nicht passiv ist.“148 Durch die innere Funktion des Beliebens, das ohne alle Notwendigkeit einer wirkenden Ursache begehrt und das darum, wenn es sich nach der Bonität richtet, als reines doch notwendig sein kann und von Neigungen frei ist,149 ist auch die Willkür von empirischen stimuli frei. „Der actus der Freiheit geschieht nach Belieben, der tierischen Willkür nach Instinkt.“150 Die Funktion des Beliebens zeigt sich zunächst darin, daß das Gegenteil einer Zielvorstellung, auf die meine Willkür es wirklich absieht, in meinem Belieben steht, sofern ich mir vorstelle, daß es auch in meiner Gewalt steht; dazu darf das Belieben nicht passiv genötigt werden und der Mensch muß „transzendental frei“ sein.151 Die intellektuelle Nezessitation, die auf aktive 147 Met.L/1, XXVIII 255. Refl. 3857, XVII 314, η? (1764–68?). Vgl. zum Begriff des lubitus Baumgarten, Metaphysica, § 712 (Kant, AA, XVII 134; dt. § 525): „Lubitus est cognitio, qua substantia pollet, ex qua secundum leges appetitionis aversationisque cognosci potest, cur sic non aliter se determinet circa actionem liberam ratione exsecutionis.“ „Multa appeto, multa aversor pro lubito meo. Ergo habeo facultatem appetendi et aversandi pro lubito meo, i.e. arbitrium.“ 149 (Vgl. Refl. 3864, XVII 317, η–κ (1764–1769). 150 Refl. 1028, XV 460, υ (1776–78). Vgl. dazu auch Refl. 1029, XV 461 Z11f. 151 Vgl. Refl. 1035, XV 466, ψ1−2 (1780–84): „Ich handle pro arbitrio, sofern ich mir vorstelle, daß das Objekt in meiner Gewalt sei; aber dieser actus geschieht pro lubitu, sofern ich mir vorstelle, daß auch das Gegenteil in meiner Gewalt sei; dieses würde eine bloße Täuschung sein, wäre der Mensch nicht transszendental frei“; Refl. 4226, XVII 465, λ? (1769–70?). 148 50 Bedingungen gegründet ist, ist nicht der Freiheit entgegen, weil diese ein unabhängiges, selbst gemachtes Belieben ist.152 Aber das freie Belieben kann sich andererseits auch in der Weise verhalten, daß motiva es nicht notwendig antreiben.153 Der Sinn der inneren Funktion des Beliebens als Wesen der menschlichen freien Willkür besteht also darin, daß es von beiden Nezessitationen, sowohl der pathologischen wie der intellektuellen, die aus Motiven kommt, frei ist. Folglich muß auch die menschliche Willkür an sich weder per stimulos noch per motiva nezessitiert werden.154 Aufgrund dieser langjährigen Überlegungen definiert Kant in der MS von 1797 die Willkür als das Begehrungsvermögen, nach Belieben zu tun oder zu lassen, das zur Hervorbringung des Objekts verbunden ist (wenn es dazu nicht verbunden ist, heißt es Wunsch).155 Erst unter dieser Definition der Willkür kann die Vernunft überhaupt, d.h. nicht nur die empirisch bedingte Vernunft, die sich auf das arbitrium liberum sensitivum bezieht, sondern gerade die reine praktische Vernunft in der Willkür bzw. im Begehrungsvermögen ihren Platz einnehmen, indem das Belieben sie in seine Funktionsstelle als innerer Bestimmungsgrund der Willkür, der weder per stimulos noch per motiva nezessitiert wird, aufnehmen kann. Daher versteht Kant unter dem Willen das Begehrungsvermögen, dessen „Belieben in der Vernunft des Subjekts angetroffen wird“,156 die entweder empirisch-bedingt oder rein ist. Er kann somit praktische Vernunft selbst sein.157 Also kann mittels der Einführung des Begriffs des Beliebens (lubitus) in den der Willkür als deren innerer Bestimmungsgrund, und nicht mittels der kontinuierlichen Ableitung derselben von der Begierde, die auf der pathologisch-praktischen Lust an Gegenstandsvorstellungen beruht, das arbitrium liberum intellectuale eingeräumt werden, in dem sich reine praktische Vernunft als das obere Begehrungsvermögen findet, das die unbedingte moralische Gesetzlichkeit transzendental liefert. Vgl. Refl. 4224, XVII 463f, λ? (1769?). Vgl. Refl. 7159, XIX 260 Z6–8, υ (1776–78): „Wir sind frei in Ansehung aller ethischen Verbindlichkeit; nämlich es sind motiva, welche nicht notwendig antreiben. Also tun wir die Handlung aus freiem Belieben“. 154 Vgl. dazu etwa Met.L/1, XXVIII 255; Refl. 1021, XV 457 Z24–26, 458 Z12–14, σ–χ (1775–79). 155 Vgl. MS, VI 213 Z14–19. 156 Loc.cit. Z20–22. Natürlich erfüllt das Belieben auch beim Übergang vom Wohlgefallen an Gegenständen zur Willkür seine Funktion. Vgl. hierzu Refl. 1059, XV 471, ψ3−4 (1785–89): „Das Belieben ist das Verhältnis des Wohlgefallens zur Willkür.“ 157 MS, VI 213 Z22–26. Einer anderen Begründung zufolge ist der Wille deshalb praktische Vernunft selbst, weil er einerseits das Vermögen ist, nach der Vorstellung der Gesetze zu handeln, und andererseits Vernunft das Vermögen ist, vom Allgemeinen (Gesetze) das Besondere (Handlungen) abzuleiten. Vgl. hierzu GMS, IV 412 Z26–30 <B36>, Refl. 7204, XIX 283 Z12, ψ? υ? ϕ? (1780–89? 1776–78?). 152 153 51 1.2.4 Die Untauglichkeit des Prinzips der Glückseligkeit und dessen pragmatischer Imperative zur praktisch-objektiven unbedingten Gesetzgebung der Moralität in Anmerkung II zu §§ 2 und 3. Anmerkung II158 zu den §§ 2 und 3 des Grundsätze-Kapitels der KpV will sagen: Das Prinzip der Glückseligkeit, das ja notwendig Verlangen und Aufgabe jedes endlichen Vernunftwesens und demnach „ein unvermeidlicher Bestimmungsgrund seines Begehrungsvermögens“ ist, kann doch nicht als praktisches, d.h. hier moralisches, Gesetz betrachtet werden; denn das Prinzip ist „doch nur der allgemeine Titel der subjektiven Bestimmungsgründe und bestimmt nichts spezifisch, darum [sc. um die spezifische Bestimmung der Bestimmungsgründe] es doch in dieser praktischen Aufgabe [der Glückseligkeit] allein zu tun ist, und ohne welche Bestimmung sie [sc. die Aufgabe der Glückseligkeit] gar nicht aufgelöst werden kann“.159 d.h. beim Prinzip der Glückseligkeit handelt es sich um den bloßen Pauschalzweck jedes endlichen Vernunftwesens, mit dem es keine Einzelzwecke apriorisch spezifizieren kann, zu denen durch Vernunft jeweils Mittel (Handlungen auf Glückseligkeit hin) bestimmt würden. Einzelzwecke für Glückseligkeit, worauf es bei diesem Prinzip ankommt, werden vielmehr nur empirisch nach subjektiven Empfindungen des Gefühls der Lust und Unlust des einzelnen empirischen Subjekts an Gegenstandsvorstellungen bemessen und dadurch unter diesen ausgewählt. Physische Gesetze können bei der Willkürbestimmung eines Menschen – anders als bei der tierischen Willkür – zwar subjektiv notwendige Gesetze sein, aber die Willkür nicht unmittelbar und vollständig determinieren, d.h. praktisch-objektiv zufällige Gesetze sein; denn sie wirken sich nicht auf die Form, sondern lediglich auf die Materie des Begehrungsvermögens aus, auf die es ja beim Prinzip der Glückseligkeit bzw. der Selbstliebe ankommt,160 die aber ausschließlich durch das variable pathologisch-praktische Gefühl der Lust und Unlust jedes besonderen Subjekts empirisch, demnach zufällig bestimmt werden kann. Wenngleich physische Gesetze sowohl Objekte, denen das apriorisch nicht bestimmbare pathologischpraktische Gefühl der Lust und Unlust materiale Werte verleiht und die dann der Wille sich zum Zweck setzt, als auch Mittel (Handlungen), die durch Vernunft aus diesen Objekten als Zwecken deduziert werden, um diese zu erreichen, einhellig zu bestimmen scheinen mögen, so ergibt das Prinzip der Glückseligkeit bzw. der Selbtliebe, unter dem die physichen Gesetze ihre Funktion der Willkürbestimmung ausüben, doch kein apriorisches praktisches Gesetz. Denn die menschliche Willkür ist schließlich a priori in der Verfassung, nicht notwendig durch physische Gesetze, nämlich nach physischer Notwendigkeit, sondern erst nach der praktischen Notwendigkeit bestimmt zu werden, d.h. aus Gründen a priori, die praktisch sind und die sich in der Form des Begehrungsvermögens artikulieren. Solche physische Einhelligkeit von Handlungen – aber auch von Zwecken – zur Glückseligkeit stellt sich gegenüber diesem Erfordernis der Apriorität für die moralische reine Verfassung KpV, V 25f <A45–48>. V 25 <A46>. 160 Vgl. V 25 Z29–37 <A46>. 158 159 52 der menschlichen Willkür als zufällig und ebenso nur „unausbleiblich abgenötigt“ heraus, wie „das Gähnen, wenn wir andere gähnen sehen“.161 Physische Gesetze, die in der auf der Rezeptivität der Erkenntnis basierenden Gegenständlichkeit von Gegenständen bestehen, können wohl die Auswahl der Einzelzwecke induktiv regulieren, die durch die Zusammenarbeit des pathologisch-praktischen Gefühls der Lust und Unlust mit der empirisch bedingten Vernunft getroffen wird, sie können sie aber nicht apriorisch, d.h. von einem intellektuellen ersten Prinzip her deduktiv, determinieren. (Cf. 2.6.2.a). Daher sind pragmatische Imperative zur Glückseligkeit, hier „Prinzipien der Selbstliebe“162 oder „praktische Vorschriften“163 genannt, der Allgemeinheit eines moralischen Gesetzes bzw. eines kategorischen Imperativs nicht fähig. Problematische Imperative der Geschicklichkeit, die in ihnen enthalten sind und die zu Einzelzwecken der Glückseligkeit Mittel bestimmen können, beruhen wohl auf theoretischen Prinzipien, die sich aus physischen Gesetzen rekrutieren, und zeigen deshalb eine gewisse Gesetzlichkeit; aber jene pragmatischen Imperative der Klugheit können ihre Einzelzwecke, aufgrund deren auch Mittel erst determiniert werden können – d.h. die problematischen Imperative funktionieren können –, nicht apriorisch spezifizieren, weil die Einzelzwecke als materiale Bestimmungsgründe des Begehrungsvermögens erst durch die Größe der pathologisch-praktischen Lust und Unlust, bei deren Taxierung Vernunft fungiert, jeweils empirisch und zufällig determiniert werden müssen.164 Die scheinbare Einhelligkeit um diese Imperative ist, wie aus dem Erwähnten erhellt, so zufällig, daß sie nicht in den Rang praktischer Gesetze erhoben, sondern lediglich als Anratungen bezeichnet werden können.165 In Anmerkung II zu §§ 2 und 3 also findet ein formalistischer Übergang vom pragmatischen Imperativ der Klugheit (der dem Prinzip der Glückseligkeit untersteht und durch die empirisch bedingte praktische Vernunft geformt und vollzogen wird) zum moralischen Imperativ der Sittlichkeit statt, der durch die reine praktische Vernunft geformt und vollzogen wird. Dabei dienen als Leitfaden und Kriterium des Übergangs praktisch-objektive Notwendigkeit und Allgemeinheit166 (mit einem Wort, Apriorität), auf denen die Spezifizierbarkeit der Bestimmungsgründe (Einzelzwecke) des Begehrungsvermögens beruht, und angesichts deren sowohl das Prinzip der Glückseligkeit als auch die darunter stehenden pragmatischen Imperative der Klugheit als Lieferanten der moralischen unbedingten Gesetzlichkeit ausscheiden müssen. Die ganze Argumentation dieses formalistischen Übergangs beruht auf dem fundamentalen Argument, daß das pathologisch-praktische Gefühl der Lust und Unlust an Gegenstandsvorstellungen, das zur empirischen SpezifiVgl. V 26 Z7–18 <A47>. V 25 Z37f <A46>. 163 V 26 Z3 <A47>. 164 Vgl. V 25 Z37 – 26 Z6 <A46f>. 165 (Vgl. V 26 Z18–23. 166 Vgl. dazu V 25 Z23 („objektiv in allen Fällen und für alle vernünftige Wesen“), Z33; 26 Z3 u. 5 („niemals allgemein“), Z14 u. 16 („Notwendigkeit“) <A46f>. 161 162 53 zierung der Bestimmungsgründe des Begehrungsvermögens dient, wegen der Abhängigkeit von den Gegenstandsvorstellungen und mithin auch die empirisch bedingte Vernunft, die auf ihm beruht und daher von denselben abhängig ist, keine unbedingte Gesetzlichkeit ergeben können (cf. 1.2.1 u. 1.2.2). Der propositionalformalistische Übergang zum kategorischen Imperativ als Form des Gesetzes durch den psychologischen Aufweis der Untauglichkeit des durch die empirisch bedingte Vernunft im pathologisch-praktischen Gefühl der Lust und Unlust fundierten pragmatischen Imperativs zur apriorischen Gesetzgebung weist demnach darauf hin, daß der Wille von Gegenstandsvorstellungen als seinen materialen Bestimmungsgründen, von denen er abhängig ist, befreit werden und somit einen anderen Standpunkt außer der Sinnenwelt als Gesamtheit der Gegenstandsvorstellungen einnehmen soll, damit ein Mensch durch seinen reinen Willen dem moralischen Gesetz gemäß richtig handeln und leben kann. Zur weiteren Erörterung cf. 2.3.1. Auch eine systematische Analyse über den formalistischen Übergang von den hypothetischen Imperativen (den problematischen und den pragmatischen) zum kategorischen Imperativ als Kritik der praktischen Vernunft167 – d.h. der Übergang der letzteren von der empirischen Bedingtheit zur Reinheit – anhand der moralphilosophischen Reflexionen wird zeigen, daß dieser Übergang auch die Distanzierung von der Abhängigkeit von Gegenstandsvorstellungen mit sich führt.168 Der Übergang vom hypothetischen zum kategorischen Imperativ bedeutet das Befreitwerden der empirisch bedingten praktischen Vernunft von ihrer Abhängigkeit von Gegenstandsvorstellungen als materialen Bestimmungsgründen der Willkür bzw. ihrem Verhaftetsein mit ihnen und nicht etwa bloß die Freiheit von der Sinnlichkeit oder den sinnlichen Neigungen.169 167 Vgl. dazu Refl. 7201, XIX 275 Z8–24 (cf. Fußnote 46 in 1.1). Die Forschungen über die drei Imperative – vor allem den kategorischen – ohne eingehende sytematische Analyse des Nachlaßwerkes sind zahlreich; darunter sind die Arbeiten von A. Buchenau, M. Moritz, H. J. Paton, G. Patzig, K. Cramer, J. Ebbinghaus, M. Fleischer, L. H. Wilde, O. Schwemmer usw. zu nennen (cf. das Literaturverzeichnis). Die technischen und pragmatischen Imperative, die in der Phase der formalistischen Grundlegung negiert werden, fungieren in der Phase der moralischpraktischen Zwecksetzung unter dem kategorischen Imperativ wieder positiv. Vgl. hierzu Refl. 7058, XIX 237, ϕ (1776–78): „Der allgemeine Zweck der Menschen ist Glückseligkeit; was sie praktisch dazu vorbereitet, ist Geschicklichkeit; was die Geschicklichkeit dirigiert, ist Klugheit; was endlich die Klugheit restringiert und dirigiert, ist Sittlichkeit“; Refl. 7200, XIX 274 Z22–28, ψ? (1780–89?); Refl. 6946, XIX 211, ϕ (1776–78); Refl. 6894, XIX 197, Nachtrag ϕ: „Die Sittlichkeit, die zugleich Klugheit ist, heißt Weisheit“; etc. 169 Dieser Übergang ließe sich kurz auch wie folgt interpretieren. Pragmatische Imperative können dadurch zuwegegebracht werden, (1) daß – der Vereinfachung halber seien hier nur zwei Alternativen in Betracht gezogen – die empirisch bedingte praktische Vernunft die pathologische Lust und Unlust (Vergnügen oder Schmerz; subjektive Empfindung), die eine objektive Erkenntnis begleitet und demnach empirisch und zufällig ist, mit derjenigen, die eine andere objektive Erkenntnis begleitet, vergleicht und die quantitative Differenz zwischen beiden taxiert (vgl. dazu, daß es bei Vegnügen und Schmerzen auf ihre Differenzen in der Zeitfolge ankommt, Anthr., § 60, VII 231) und (2) daß sie aufgrund dieser Taxierung gemäß dem Prinzip der Maximierung der gesamten Glückseligkeit als Pauschalzweck unter den zwei Alternativen des Einzelzwecks, die auf den von Lust und Unlust begleiteten objektiven Erkenntnissen basieren, die größere Lust einbringende wählt. Nun entstehen beide objektiven Erkenntnisse, die von pathologischer Lust und Unlust begleitet werden, durch die 168 54 1.3 Die kognitive formalistische Grundlegung der Ethik als Exposition des Gesetzes und als Deduktion der Freiheit im Grundsätze-Kapitel der KpV. Die propositionale formalistische Grundlegung der Ethik im Grundsätze-Kapitel der KpV hat gezeigt, daß die Maximen als subjektivierte praktische allgemeine Gesetze bloß der Form nach den Bestimmungsgrund des Willens enthalten (cf. 1.1). Die ihr beigelegte, sie unterstützende anthropologische formalistische Grundlegung im selben Kapitel hat aber aufgewiesen, daß die Setzung der moralischen Gesetzlichkeit in die Form der Maximen bei der propositionalen formalistischen Grundlegung zugleich anthropologisch in der menschlichen Willkür die Einräumung der reinen praktischen Vernunft als oberes Begehrungsvermögen und die Distanzierung von der Abhängigkeit von der Nezessitation der sinnlichen Gegenständlichkeit erfordert (cf. 1.2). Bei jener propositionalen formalistischen Grundlegung handelt es sich um die Exposition des moralischen Gesetzes, bei dieser anthropologischen hingegen hinsichtlich der Distanzierung von der Abhängigkeit von gegenständlicher Nezessitation um die Deduktion der Freiheit aus der moralischen Gesetzlichkeit.170 Jene Exposition des Gesetzes hat diese Deduktion der Freiheit unvermeidlich zur Folge. Da Freiheit an sich unbegreiflich und unerklärbar ist – dazu fehlt dem Menschen eine intellektuelle Anschauung171 –, beweist Kant ihre notwendige Annahme von der Gesetzgebung der reinen praktischen Vernunft her analytisch-regressiv.172 Die deduzierte Freiheit weist darum nur die von Verstandessynthesis in der Zeitfolge nach der Naturkausalität. Daher sind pragmatische Imperative und die empirisch bedingte praktische Vernunft wesentlich in den zeitlichen Folgezusammenhängen von Erscheinungen überhaupt verankert und demnach von denselben abhängig. Der Übergang von den pragmatischen zu den kategorischen Imperativen, mithin auch von der empirisch bedingten zur reinen praktischen Vernunft, findet deswegen darin statt, daß der Wille sich zu seiner unbedingten Bestimmung in eine besondere Lage versetzt, von der jene zeitlichen Folgezusammenhänge abgeschnitten werden; denn bei der Abhängigkeit von Gegenständen bzw. dem Verhaftetsein mit denselben handelt es sich, näherhin betrachtet, um die Abhängigkeit von der Zeitfolge derselben bzw. das Verhaftetsein mit den zeitlichen Folgezusammenhängen derselben, in denen jene quantitative Differenz der pathologischen Lust und Unlust taxiert wird. Diese von den zeitlichen Folgezusammenhängen abgeschnittene Lage wäre in nichts anderem möglich als allein in absoluter Gegenwart (Augenblick), die mit der Intellektualität eng verflochten ist. Der Übergang beruht also darauf, daß das erste Prinzip der Willensbestimmung in die absolute Gegenwart gesetzt wird. Daraus erhellt, daß das Wesen der negativen Freiheit (Unabhängigkeit von Gegenstandsvorstellungen als materialen Bestimmungsgründen der Willkür) in der Positionierung des Willens in der absoluten Gegenwart („hier und jetzt“) bestehen müßte, die zeitlich sowohl vom unmittelbar Früheren als auch vom unmittelbar Späteren abgeschnitten ist und demnach in der Zeitfolge bloß ein Zeitpunkt ist, die aber unter intellektuellem Aspekt Ausdehnung hat. 170 Vgl. zur Exposition des Gesetzes KpV, V 46 Z16–36 <A80f>, zur Deduktion der Freiheit aus dem Gesetz KpV, V 47 Z21–37 <A82>, V 4 Anm. <A5>(die Freiheit als ratio essendi des Gesetzes und das Gesetz als ratio cognoscendi der Freiheit), V 29 Z33 – 30 Z3 <A53>, KU, V 468 Z24–28 <B457>, Rel., VI 49 Anm. Z22–32 <B58>, MS, VI 225 Z25f. Die „Folgerung“ zu § 7 (KpV, V 31 Z35–37 <A56>) ließe sich als ,Exposition der reinen praktischen Vernunft‘ erachten. 171 Vgl. dazu etwa KpV, V 31 Z28–31 <A56>. 172 Vgl. dazu Refl. 6641, XIX 122, κ? (1769?): „Die Methode der Moral muß nicht so geführt werden, daß sie von dem ersten principio der Freiheit anfängt und von den einfachsten Begriffen, auch 55 der Moralität her betrachteten Eigenschaften auf. Die Form jeder Maxime als subjektivierten praktischen Gesetzes, die moralisch, demnach notwendig und allgemein, den Willen bestimmt, ist in der allgemeinen Formel des kategorischen Imperativs bzw. des Grundgesetzes der reinen praktischen Vernunft (dem formalen moralischen Gesetz als Singular) artikuliert: „Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“173 Bei der aus dem Gesetz deduzierten Freiheit hat man es zunächst mit der negativen Freiheit zu tun (weil sie aus ihm als etwas grundsätzlich von ihm Unterschiedenes zu deduzieren ist). Das Bewußtsein der Aktualität des Gesetzes bzw. das der reinen praktischen Vernunft als des oberen Begehrungsvermögens aber, dem die negative Freiheit als Unabhängigkeit von der Nezessitation der sinnlichen Gegenständlichkeit der Gegenstände, die der Willkür zum materialen Bestimmungsgrund dienen, zugrundeliegt und das mithin das Prinzip der Autonomie des Willens bildet, heißt positive Freiheit.174 Dieses Bewußtsein der unbedingten praktischen Gesetzlichkeit in uns, das aus den drei Komponenten: Gesetz, reine praktische Vernunft und positive Freiheit besteht,175 bezeichnet Kant als ,Faktum der reinen praktischen Vernunft‘176 (cf. 1.2.0.c). Bei diesem Faktum des Bewußtseins handelt es sich um die „Form eines reinen Willens“,177 d.h. nicht von einzelnen Erfahrungen, sondern aus einer gewissen Mitte von den allgemeinen Gesetzen, die wir in concreto beobachten.“ 173 KpV, V 30 <A54>. Vgl. zu den Varianten dieser allgemeinen Formel des kategorischen Imperativs Schwemmer, O., Philosophie der Praxis, Frankfurt/M. 1980, S. 132–135. 174 Zur negativen und positiven Freiheit vgl. KpV, V 33 <A58f>: „In der Unabhängigkeit nämlich von aller Materie des Gesetzes (nämlich einem begehrten Objekte) und zugleich doch Bestimmung der Willkür durch die bloße allgemeine gesetzgebende Form, deren eine Maxime fähig sein muß, besteht das alleinige Prinzip der Sittlichkeit. Jene Unabhängigkeit aber ist Freiheit im negativen, diese eigene Gesetzgebung aber der reinen und als solche praktischen Vernunft ist Freiheit im positiven Verstande“; V 29 Z27 u. 31 <A52f>; GMS, IV 446f <B97ff>, 458 <B119>; MS, VI 213; KrV, III 375 <B581f>; Refl. 3857, XVII 314f, η? (1764–68?): „Die Schwierigkeiten treffen nur die erste Idee der Freiheit, und sie ist unbegreiflich beim notwendigen Wesen sowohl als zufälligen. ... / Also ist das Negative eigentlich unbegreiflich, das Positive der Motiven ist begreiflich“; Refl. 6076, XVIII 443, ψ3 (1785–88); MS Vigilantius, XXVII 494; Refl. 1043, XV 467, ψ1−2 (1780–84). 175 Vgl. KpV, V 29 Z25–28 <A52>. 176 Zum „Faktum der Vernunft“ vgl. KpV, V 31f <A55f>; als Ausgangspunkt („erste Data“) zur moralischen Dogmatik, KpV, V 6 <A9>, 42 <A72>, 43 <A74>, 47 <A81>, 55 <A96>, 91 <A163>, 104 <A187>, MS, VI 225, 252; als eine wichtige Stelle, Rel., VI 26 Anm. <B15f>; zur Unerklärlichkeit dieses Faktums, KpV, V 46 <A79f>, 72 <A128>, 86 <A154>, GMS, IV 458f <B120>, 461 <B125>, Rel., VI 59 Anm. <B71>, 62 <B77>, 138 <B209>, 174 <B267>; außerdem KrV, III 376f <B585>, 524 Z8–17 <B835>; Refl. 6849 u. 6850, XIX 178, υ (1776–78). Zu diesem Thema vgl. Henrich, D., Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, in: G. Prauss [Hrsg.], Kant, Köln 1973, S. 223–254; Forschner, M., Gesetz und Freiheit, München 1974, S. 250; Krüger, G., Philosophie und Moral in der Kantischen Kritik, Tübingen 2 1967, S. 68; Beck, L. W., Das Faktum der Vernunft, in: Kant-Studien Bd. 52, 1960/61, S. 271–282; Kadowaki, T., Das Faktum der reinen praktischen Vernunft, in: Kant-Studien Bd. 56, 1965, S. 385–395; Konhardt, K., Faktum der Vernunft?, in: G. Prauss [Hrsg.], Handlungstheorie und Transzendentalphilosophie, Frankfurt/M. 1986, S. 160–184; Schwemmer, O., Das „Faktum der Vernunft“ und die Realität des Handelns, in: Prauss, G. [Hrsg.], Handlungstheorie und Transzendentalphilosophie, S. 271–302. 177 KpV, V 66 <A116>. 56 die „formale Einheit im Gebrauch unserer Freiheit“,178 die unter dem essentiellen, ,moralisch-teleologischen‘ Gesichtspunkt in der „Einheit aller Zwecke“, nämlich in der intelligiblen, moralischen Welt verwurzelt ist. Diese formale Einheit des ethischen Bewußtseins kann nun durch die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst zustandegebracht werden; diese findet aber zugleich mit derjenigen mit den Zwecken statt, welche jene intelligible Ordnung, nämlich die ontotheologische Einheit aller Zwecke (die intelligible Welt) antizipiert. Aus dem unter dem essentiellen Aspekt so zustandezubringenden, kognitiven Faktum der Einheit des ethischen Bewußtseins werden nun der Begriff der Universalität und mithin auch der Gesetzlichkeit deduziert. Das Wesentliche dieses Bewußtseins der reinen Aktualität des Gesetzes kann auch die reine sittliche Einsicht der reinen praktischen Vernunft genannt werden, die von Kant zuletzt nicht als intellektuelle Anschauung, sondern als reines sittliches Denken aufgefaßt wird. Die transzendental-subjektive Gesetzgebung als Spontaneität der Vernunft, die sich selbst uns unmittelbar als Faktum aufdrängt,179 artikuliert sich propositional in der gesetzgebenden Form der Maxime und somit zuletzt in der allgemeinen Formel des kategorischen Imperativs. Die gesamte Ausführung der kognitiv-formalistischen Grundlegung der Ethik im Grundsätze-Kapitel der KpV ist in diesem Bewußtsein der unbedingten praktischen Gesetzlichkeit als Faktum der Vernunft eingebettet. Denn der Leitfaden, der diese Grundlegung, d.i. Exposition des Gesetzes und Deduktion der Freiheit, führt, ist das Achthaben auf die Notwendigkeit, womit uns die reine praktische Vernunft Gesetze vorschreibt: „Wie ist aber auch das Bewußtsein jenes moralischen Gesetzes möglich? Wir können uns reiner praktischer Gesetze bewußt werden, ..., indem wir auf die Notwendigkeit, womit sie uns die Vernunft vorschreibt, und auf Absonderung aller empirischen Bedingungen, dazu uns jene hinweist, achthaben.“180 Wir haben oben gesehen, daß in der gesamten kognitiven formalistischen Grundlegung der Ethik stets das Kriterium der Notwendigkeit und Allgemeinheit des Gesetzes, mit einem Wort, der Apriorität desselben, die Exposition des Gesetzes und die Deduktion der Freiheit voranbringt. Im 1. Abschnitt der GMS dient als dieses Kriterium des formalistischen, analytisch-regressiven Verfahrens der Begriff der Pflicht, im 2. Abschnitt der Begriff der Unbedingtheit (Absolutheit) der Gesetzlichkeit.181 Die Verwendung dieses Kriteriums für die kognitive formalistische Grundlegung kann durch das Faktum der Vernunft gerechtfertigt werden. Daß man sich nun der Tatsache der Freiheit bewußt werden kann, indem man auf die Notwendigkeit der Gesetzgebung achthat, um damit das Gesetz zu exponieren, klingt zunächst einfach und selbstverständlich, läßt aber, wenn man darüber genau nachdenkt, vermuten, daß in dieser Sache noch eine schwer zu erörterende Struktur stecken muß (cf. Einl.a.6.γ). Mit der Lehre vom Faktum der Vernunft schließt nun Kant die kognitive formaRefl. 7204, XIX 283, ψ? υ? ϕ?. Cf. 2.3.1.g. Zum Ausdruck ,sich aufdrängen‘ (bei Kant genauer ,sich aufdringen‘) vgl. KpV, V 31 Z27 <A56>; Rel., VI 36 Z3f <B33>. 180 KpV, V 30 <A53>. 181 Vgl. dazu GMS, IV 397 Z6 <B8>, 420 Z9 <B50>, 428 Z4 <B64>, etc. 178 179 57 listische Grundlegung der Ethik, die deren Fundament in Gesetz und Freiheit setzt, ab, auch wenn sie als Abstrahierung von aller Materie im Gegenstand-Kapitel wiederholt wird (cf. 3.2.1). Die Aufgabe der Grundlegung der Ethik geht sodann zur essentiellen, ,moralisch-teleologischen‘ Phase über, in der das Gesetz im Ausblick auf den Zweck Thema wird und in der das eigentliche Ethos der Kantischen Ethik besteht. Kant hat in der formalistischen Rückführung auf die negative Freiheit die Bedeutung der letzteren nicht besonders erörtert, sondern ihren Ort ohne weiteres mit der intelligiblen, moralischen Welt (dem Reich Gottes, der ontotheologischen, teleologischen Seinsordnung) identifiziert, ohne dabei diese innerlich und konkret bestimmen zu können. Denn für ihn ist das formalistische Verfahren (Abstrahierung von der Materie) als Rückgang auf die Freiheit a limine bloß zur Eröffnung der intelligiblen Welt erforderlich gewesen. Er hat aber diese nicht sofort als moralischen Bestimmungsgrund des Willens angeben können – ihre unmittelbare Hypostasierung zur Willensbestimmung würde Heteronomie des Willens verursachen –, sondern sich anheischig machen müssen, sie erst durch die Selbstobjektivierung des reinen sittlichen Denkens aus negativer Freiheit (d.h. aber in essentieller Hinsicht aus ihr selbst, nur verborgen) innerlich und konkret zu determinieren. Kurz: Sie wird konkretisiert durch die Selbstobjektivierung des Verborgenen, das sie selbst ist. Kant hat nun die formalistische Grundlegung, die die kognitive Phase der gesamten Grundlegung der Ethik darstellt, erst spät im ersten Kapitel seiner zweiten Grundlegungsschrift, nämlich derjenigen über die Kritik der praktischen Vernunft als Überwindung der empirischen Bedingtheit derselben, als Lehre vom Faktum der Vernunft ausdrücklich formuliert. Ihre Gedanken selbst aber sind bei ihm bereits früher (vermutlich bis zur ersten Hälfte der sechziger Jahre) ausgebildet und treten auch sporadisch hier und da in den moralphilosophischen Reflexionen auf (cf. 2.3.1.c). In ihr spiegelt sich seine persönliche ethische Grunderfahrung (moralische Umkehrung), nämlich die Vorgegebenheit des moralischen Gesetzes im Bewußtsein, selbst in der gemeinsten Menschenvernunft. Diese Grunderfahrung wird in der Religionsschrift und den anderen Schriften des späten Kant als Revolution in der Gesinnung tiefer erörtert (cf. 3.4.1.a). 1.4 Die kognitive Deduktion der Freiheit aus dem Gesetz im § 5 und die essentielle Deduktion des Gesetzes aus der Freiheit im § 6 des Grundsätze-Kapitels. (a) Ich schicke der Erläuterung der Deduktion der Freiheit in § 5 eine kleine Bemerkung voraus, um einer möglichen Mißdeutung des Geltungsumfangs der Willensfreiheit vorzubeugen: Der Wille ist frei nicht nur von ,sinnlichen‘, sondern auch von empirischen Gegenstandsvorstellungen überhaupt, sofern diese ihn durch die pathologisch-praktische Lust und Unlust bestimmen. Dabei liegt Kants Einsicht darin, daß jede empirische Gegenstandsvorstellung, die materialiter die Willkür 58 bestimmen soll, diese durch die praktische Lust und Unlust hindurch erreichen muß, die ,pathologisch‘ sind. Der moralische Wille soll nicht aus der empirischen Gegenständlichkeit von Gegenständen bestimmt werden, sondern aus dem Ort, der über sie hinausgeht, d.h. aus der Freiheit. Zu den empirischen Gegenstandsvorstellungen werden auch die vermeintlichen ,intellektuellen‘ Gegenstandsvorstellungen gezählt, die etwa durch den regulativen Gebrauch der Vernunftideen mittels der reflektierenden Urteilskraft zweckmäßig zustandekommen. Sie bestimmen als solche die Willkür durch die pathologisch-praktische Lust und Unlust. Die moralischen Zwecke, die von der reinen praktischen Vernunft, die von materialen Bestimmungsgründen der Wilkür unabhängig ist, intellektuell kreiert werden und demnach intellektuelle Gegenstände heißen, treten in der kognitiven formalistischen Phase der Grundlegung noch nicht auf; sie sind hier ausgeklammert. Sollten sie aber auch unter dem Prinzip der Abhängigkeit von Gegenständen durch die pathologisch-praktische Lust und Unlust den Willen bestimmen, so müssen sie in dieser Phase als moralische Bestimmungsgründe ausscheiden. Sie werden aber in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung voll rehabilitiert, in der vorausgesetzt wird, daß praktische Vernunft die Distanzierung von der Abhängigkeit von Gegenständen vollzogen hat. Daß nun der menschliche Wille nicht nur von ,sinnlichen‘, sondern von sämtlichen empirischen Objektvorstellungen frei sein soll, hängt damit zusammen, daß die Kritik der praktischen Vernunft nicht die der Sinnlichkeit, sondern die der empirisch bedingten praktischen Vernunft ist und daß es sich bei ihr um den Übergang von den auf empirische Objektvorstellungen bezogenen pragmatischen Klugheitsregeln zum reinen kategorischen Imperativ der Sittlichkeit handelt, der gar nicht aus dem Empirischen stammt. Eben diese Kritik hat eine ethische Transzendenz über die Erscheinungen überhaupt zur Folge. Aus einer bloßen Kritik der Sinnlichkeit kann sich wohl eine Abkehr von der Tierheit im Menschen ergeben, aber keineswegs eine von der Bösartigkeit in seiner Gesinnung, mit der zu kämpfen jedoch der Ethik auferlegt ist. Die Sinnlichkeit selbst ist moralisch weder gut noch böse. (b) Nun versucht Kant im § 5182 dieses Kapitels zusammenfassend noch einmal die Deduktion der Freiheit aus dem Gesetz. Sie wird hier formell dem bisherigen Rahmen der formalistischen Grundlegung gemäß als Übergang von der propositionalen bloßen gesetzgebenden Form der Maximen zum psychologischen freien Willen ausgeführt. Die Verwendung des Wortes ,Erscheinungen‘ zeigt aber an, daß die Deduktion hier in Wahrheit kosmologisch vorgeht; es wird die Transzendenz über die Erscheinungen der Sinnenwelt überhaupt vorgenommen. Die erlangte „Freiheit im strengsten, d.i. transzendentalen, Verstande“183 ist daher die negative Freiheit als Unabhängigkeit vom Naturgesetz der Erscheinungen, d.h. der ,andere Standpunkt außer der Sinnenwelt‘184 . Soll aus dem Gesetz Freiheit, als etwas Anderes denn dieses, deduziert werden, so muß sie negative Freiheit sein. Denn moralische KpV, V 28f <A51f>. V 29 Z6f <A51>. 184 Vgl. GMS, IV 458 Z19 <B119>, 450 Z32 <B105>; vgl. dazu auch Träume, II 336. 182 183 59 Gesetzlichkeit und positive Freiheit sind miteinander Wechselbegriffe; eine Deduktion der letzteren aus der ersteren wäre beinahe tautologisch und mithin sinnlos. Bei der „Freiheit im strengsten, d.i. transzendentalen Verstande“ hat man es demnach nicht unmittelbar mit der „transzendentalen Freiheit“ zu tun, die mit der positiven Freiheit in Parallele zu setzen ist. Das Wort ,transzendental‘ in der ersteren Freiheit bezieht sich eher auf die Transzendenz über die Erscheinungen überhaupt und zeigt demnach die Richtung von der Sinnenwelt her auf den anderen Standpunkt außer dieser hin, während dasselbe Wort in der letzteren Freiheit auf die umgekehrte Richtung, nämlich die Auswirkung der Freiheitskausalität aus dem anderen Standpunkt her auf die naturkausalen Erscheinungen der Sinnenwelt hinweist. Jene Freiheit läßt sich auch nicht mit der „praktischen Freiheit“ identifizieren, die wohl Unabhängigkeit von der Nezessitation der sinnlichen Natur bedeutet, die aber aus dem empirisch-psychologischen Begriff vom arbitrium liberum stammt und demzufolge empirisch ist.185 Mit ihr ist vielmehr kosmologisch-transzendental ein über die Sinnenwelt hinausgehender Standpunkt gemeint; sie deutet demnach die intelligible Welt an.186 Bei Kant ist die negative Freiheit ursprünglicher als die positive. Denn die ursprüngliche Freiheit, das moralische Gesetz als das gute Prinzip in die Gesinnung aufzunehmen, ist auch sinngemäß negativ. Die negative Freiheit ist aber grundsätzlich unbegreiflich.187 Das Wesen der Freiheit ist unbegreiflich, sofern sie von der Moralität (der Gesetzgebung der reinen praktischen Vernunft) her negativ betrachtet wird. Kant hat daher in den moralphilosophischen Reflexionen den Sinn der negativen Freiheit kaum erörtert. Sein theoretisches Interesse lag vielmehr darin, ob und wie die an sich unbegreifliche Freiheit sich auf die Erscheinungen der Sinnenwelt auswirken kann, d.h. in der positiven, transzendentalen Freiheit. Jener Begriff der ursprünglichen Freiheit der Willkür auf intelligibler Ebene in der Religionsschrift ist erst in den späten Jahren aus seiner Auseinandersetzung mit den Werken der pietistischen Theologen hervorgegangen.188 185 Die Herkunft des Kantischen Begriffs der praktischen Freiheit liegt in der schulphilosophischen empirischen Psychologie, genauer im Begriff des arbitrium liberum (cf. 1.2.3.f; vgl. vor allem Refl. 4548, XVII 589, ξ–ρ? 1772–75; vgl. auch Cohen, H., Kants Begründung der Ethik, Berlin 2 1910, S. 239). Daher kann er sich auch empirisch als Freiheit der empirisch-bedingten praktischen Vernunft zeigen (vgl. z.B. KrV, III 521 Z14–21 <B830>), da er sich auch schon im arbitrium liberum sensitivum findet. Der Begriff der transzendentalen Freiheit hingegen gehört im Rahmen der Wolffianischen Psychologie zur rationalen (cf. die Fußnote 143 in 1.2.3.f). Zur praktischen Freiheit vgl. Funke, G., Kants Satz über die praktische Freiheit, in: Philosophia Naturalis, Bd. 19, 1982, S. 40–52. 186 Vgl. z.B. KpV, V 42 Z18f <A72>: „... denn daß Freiheit, wenn sie uns beigelegt wird, uns in eine intelligibele Ordnung der Dinge versetze, ist anderwärts [sc. im 3. Abschnitt der GMS; cf. Fußnote 184] hinreichend bewiesen worden“; V 94 Z16f <A168>: „die [herrliche] Eröffnung einer intelligibelen Welt durch Realisierung des sonst transzendenten Begriffs der Freiheit“. 187 (Vgl. etwa Refl. 3857; cf. Fußnote 174 in 1.3. 188 Cf. Fußnote 711 in 3.4.1. Eine systematische Erörterung des Kantischen Begriffs der Freiheit anhand des Nachlaßwerkes und der späten Schriften wie der Religionsschrift und der MS kann in der vorliegenden Arbeit nicht durchgeführt werden. Die Aufgabe wird aber in einer meiner künftigen Arbeiten erfüllt werden. Vgl. zum Problem der Freiheit auch Konhardt, K., Die Unbegreiflichkeit der Freiheit, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 42, 1988. Zu Kants Auseinandersetzung 60 Obwohl nun der Begriff der Freiheit die intelligible Welt andeutet und essentiell in ihr beheimatet ist, kann die letztere in der praktischen Philosophie doch nicht unmittelbar und sofort aus dem ersteren, der subjektiv und zudem im Grunde unbegreiflich ist, deduziert werden. Die Idee der intelligiblen Welt als der systematischen Einheit aller Zwecke ist zwar latent und essentiell dem Gesetz und der Freiheit vorausgesetzt; sie kann aber nicht wie eine empirische Welt konstitutiv und empirisch-konkret zum Vorschein treten, wobei sie durch die pathologischpraktische Lust hindurch zur unmittelbaren Bestimmung des Willens dienen würde. Dazu fehlt ihr die theoretisch-objektive Realität. Sie läßt sich annehmen und konstituieren erst durch die Erweiterung des Gesetzes auf den Endzweck. Das Gesetz aus Freiheit, dem praktische Realität zukommt, verleiht ihr durch seine Erweiterung ebendiese Realität. Die Theorie des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft und die Lehre vom höchsten Gut, die auf dem Prinzip der moralischen Gesetzlichkeit als Kausalität aus Freiheit basieren, konkretisieren sie auf der objektivierten Ebene (cf. 3.).189 (c) Kant versucht nun anschließend an die Deduktion von Freiheit aus Gesetz in § 5 im § 6190 eine Deduktion in der umgekehrten Richtung, nämlich diejenige des Gesetzes aus der Freiheit, gemäß dem Rahmen der Darlegung des GrundsätzeKapitels in der Beziehung zwischen freiem Willen und gesetzgebender Form. Das bereits als Faktum festgehaltene Gesetz wird hier unter einem anderen Aspekt der Grundlegung nachgewiesen. Der Versuch ist einzigartig; er ist auch in den moralphilosophischen Reflexionen kaum so ausdrücklich und prägnant wie in diesem Paragraphen angestellt und formuliert worden. Er ist die Deduktion der ratio cognoscendi aus der ratio essendi und gehört demnach nicht zu der im GrundsätzeKapitel dominanten, kognitiven formalistischen Grundlegung der Ethik. Die Deduktion ist die Gesetzeskonstitution aus der Freiheit als der ratio essendi und dementsprechend vielleicht als konstitutive bzw. essentielle formalistische Grundlegung zu bezeichnen.191 Der Engpaß dieser Beweisführung liegt in der innerhalb der kognitiven formalistischen Grundlegung nie begründbaren Prämisse, daß die oben in § 5 deduzierte und hier als Startpunkt der Deduktion vorausgesetzte negative mit den Werken der pietistischen Theologen vgl. Delekat, F., Immanuel Kant, Heidelberg 2 1966, S. 357f Anm. 10; Bohatec, J., Die Religionsphilosophie Kants in der „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“, Hamburg 1938, S. 19–32, S. 61ff. 189 Die ,positive Bestimmung‘ der reinen Verstandeswelt in KpV, V 43 <A74f>vollzieht sich bloß in Bezug auf die Sinnenwelt und liefert noch nicht die inneren Bestimmungen der ersteren. Diese bleibt hier noch der bloße Standpunkt außer der Sinnenwelt, um die Autonomie des freien Willens bzw. der reinen praktischen Vernunft in der Sinnenwelt zu sichern. Cf. 3.1.2.c. 190 KpV, V 29 <A52>. 191 Die von L. W. Beck vorgeschlagene Interpretationsidee einer Unterscheidung zwischen metaphysischer und transzendentaler Deduktion des Prinzips der reinen praktischen Vernunft (vgl. ders., A Commentary on Kant’s Critique of practical Reason, Chicago 1960, S. 109–111, 170–175) kann wohl als Unterscheidung zwischen kognitiver und essentieller Deduktion in den §§ 5 und 6 des Grundsätze-Kapitels gerechtfertigt werden, obgleich ein gravierender Übersetzungsfehler (ibid., S. 174: „This kind of credential for the moral law“ für die Textstelle KpV, V 48 Z1 <A83>; kurs. v. Verf.) in seiner Argumentation über die transzendentale Deduktion steckt. Er ahnt doch, daß in der Kantischen Grundlegung der Ethik zwei Phasen zu unterscheiden sind. 61 Freiheit „dennoch bestimmbar sein muß“.192 Durch diese Prämisse aber kann die negative Freiheit in die positive des moralischen Willens transformiert werden, die begrifflich moralische Gesetzlichkeit impliziert. Denn Freiheit kann nur nach der sinnlichen Natur als gesetzlos bzw. ungebunden betrachtet werden.193 Daß, wenn Freiheit vorausgesetzt wird, auch das Gesetz in logischer Konsequenz aus ihr deduziert werden kann, ist die fundamentale These Kants in der essentiellen Phase der ethischen Grundlegung, die auch im 3. Abschnitt der GMS verwendet wird.194 Die Bestimmbarkeit der negativen Freiheit, die als solche nicht unmittelbar bewiesen werden kann, ist auf die in der kognitiven formalistischen Grundlegung latente Annahme der intelligiblen Welt angewiesen, die den unerläßlichen Hintergrund für die essentielle Grundlegung der Ethik darstellt. Die Gültigkeit des Gesetzes wird bewiesen, indem es in einem System gezeigt wird, daß das Gesetz sich von Freiheit aus auf den praktischen Endzweck erweitern und somit ,moralischteleologisch‘ nach einer Idee die intelligible Welt konstituieren kann. Dieser Art der Grundlegung gehen wir im 2. und 3. Teil der vorliegenden Arbeit nach. Der § 6 des Grundsätze-Kapitels weist auf die Versuche Kants in den moralphilosophischen Reflexionen hin, das Gesetz essentiell in der intelligiblen Ordnung zwischen Freiheit und Endzweck zu explizieren (cf. 3.1.1.b–d). (d) Das moralische Gesetz, das kognitiv als Faktum der Vernunft angesetzt worden ist, muß, wenn es aus der Freiheit, die aus ihm als Faktum deduziert wird, in der umgekehrten Richtung deduziert werden soll, aufgrund einer intelligiblen Ordnung, die durch den Begriff der Freiheit zu eröffnen ist, moralisch-teleologisch expliziert werden. Die Deduktion des Gesetzes aus Freiheit gehört daher, näherhin betrachtet, nicht der kognitiven formalistischen Grundlegung zu, sondern schon der essentiellen, ,moralisch-teleologischen‘ Grundlegung. Wenn also die beiden Phasen der Grundlegung der Ethik – ungeachtet der urphänomenalen Einheitlichkeit von Gesetz, reiner praktischer Vernunft und Freiheit als Faktum – präzis unterschieden werden sollen: so betrifft die formalistische Phase der Grundlegung nur die Exposition des Gesetzes (sowie der reinen praktischen Vernunft) und die Deduktion der Freiheit (die erkenntniskritische Rückführung auf die Freiheit als Ursprung der Moralität), und die ,moralisch-teleologische‘ Phase beginnt bereits mit der Deduktion des Gesetzes aus Freiheit, d.h. sie soll von der Freiheit als Ursprung der Moralität – über die Gesetze nach dem Endzweck – ausgehen. Kants Grundlegung der Ethik besteht also aus dem Rückgang zur Freiheit und dem Fortgang aus derselben, wobei sich eine Umwendung vom ersteren zum letzteren annehmen ließe; die besteht zwischen dem § 5 und dem § 6 des Grundsätze-Kapitels der KpV. Die Freiheit als Wendepunkt ist an sich unbegreiflich, hat aber so große Bedeutung, KpV, V 29 Z17 <A52>. Vgl. auch GMS, IV 400 Z13 <B14>, 446 Z19 <B98>; Was heißt: S.i.D.or.?, VIII 145, etc. 193 Zur Gesetzlosigkeit bzw. Ungebundenheit der Freiheit vgl. Refl. 6962, XIX 215 υ? (1776–78?), Refl. 6960, XIX 214 υ (1776–78), Refl. 6802, XIX 166f, ρ? ξ? (1773–75? 1772?), Refl. 7202, XIX 280, 281, ψ (1780–89), Refl. 7220, XIX 289, ψ? (1780–89?); vgl. auch Refl. 4226, 4337, 6723, 6767, 6795, 6802, 6948, 6949, 6952, etc.; vgl. außerdem Log., § 94, IX 139 (dazu Refl. 3323, XVI 780). 194 Vgl. GMS, IV 447 Z8–10 <B98>. 192 62 daß sie nicht nur den wichtigsten Grundbegriff der Moralphilosophie, sondern auch den Schlußstein der ganzen Philosophie Kants bildet. Der Rückgang zur Freiheit ist kognitiv-formalistisch, der Fortgang aus ihr ist moralisch-teleologisch im erweiterten Sinn. Die Ableitung nun der Pflichten aus dem Gesetz kann wohl noch als formalistisch gekennzeichnet werden, sofern sie allein durch das Gesetz vollzogen wird; sie ist aber moralisch-teleologisch im weiteren Sinn, sofern sie auf den Beistand des Zweckbegriffs angewiesen ist (dies heißt aber auch, daß die Phase der moralischpraktischen Zwecksetzung doch die formalistische Bestimmung durchs Gesetz als ihr Fundament in sich enthält). Die Ableitung überhaupt muß jedoch auf jeden Fall in der Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung betrachtet werden, falls bereits das Gesetz selbst, aus dem die Pflichten abgeleitet werden, in derselben Phase hinsichtlich seines essentiellen Grundes zur Frage gestellt wird. Noch einmal: Der Formalismus der Kantischen Ethik besteht aus zwei Momenten. Das eine Moment ist die Unabhängigkeit von der Materie und artikuliert sich in Exposition des Gesetzes und Deduktion der Freiheit. Das andere besteht in der monistischen Ableitung der Einzelpflichten allein aus dem Gesetz. Dieses zweite Moment des Formalismus hat aber nur beschränkte Geltung, weil die Ableitung der unvollkommenen Pflichten auch den Zweckbegriff in Anspruch nimmt und weil auch das Gesetz, aus dem die Einzelpflichten abgeleitet werden sollen, essentiell betrachtet, in der intelligiblen, teleologischen Ordnung fundiert ist. Daher hat man es beim Formalismus der Kantischen Grundlegung der Ethik eigentlich und wesentlich nur mit dem ersten Moment zu tun, der in der Rückführung auf die Freiheit besteht, obgleich auch dieses, aus dem ebengenannten zweiten Grund, nicht auf den reinen Formalismus beschränkt werden kann. Die eigentliche formalistische Phase der Grundlegung der Ethik ist also, streng genommen, nicht sehr umfangreich, obgleich sie für Kants Ethik entscheidend und charakteristisch ist. Sie scheint bereits bis zur ersten Hälfte der sechziger Jahre ausgebildet zu sein. Kants moralphilosophische Bemühung in den siebziger und achtziger Jahren ist alsdann der moralisch-teleologischen Phase der Grundlegung gewidmet (cf. 2.). 1.5 Kants positive Verwendung des Begriffs der Vollkommenheit: der Übergang zur essentiellen, ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik. Es ist in der formalistischen Grundlegung der Ethik nicht möglich, Gegenstandsvorstellungen, denen der Begriff der Vollkommenheit beigelegt ist, zum moralischen Bestimmungsgrund des freien Willens zu machen. Der Begriff der Vollkommenheit als praktischer materialer Bestimmungsgrund des Willens kann kein Prinzip der reinen Sittlichkeit sein. Kant verwendet aber diesen einerseits in der formalistischen Phase der Grundlegung negierten Kriteriumsbegriff andererseits im Übergang zur essentiellen, architektonischen Phase für die ideale Aktualität der handelnden Subjektivität der reinen Sittlichkeit, nämlich den guten Willen, doch 63 positiv. (a) Der vielfältige Gebrauch des Begriffs der Vollkommenheit in der Grundlegung der Ethik; die Subjektivierung des Begriffs der Vollkommenheit im Übergang von der kognitiv-formalistischen Phase zur Phase der moralischpraktischen Zwecksetzung. Schon früh war Kant der Ansicht, daß „der Ausdruck der Vollkommenheit eine Beziehung auf ein Wesen, welches Erkenntnis und Begierde hat, voraussetze“.195 Aufgrund dieser Einsicht hat er den Begriff der Vollkommenheit, der, da er an sich leer ist, erst in Bezogenheit auf den Inhalt irgendeiner Sache seine Bedeutung zu gewinnen vermag,196 im ethischen Bereich vielfältig verwendet. Der Begriff hat in der Kantischen Grundlegung zur Ethik, vom besonderen Gebrauch wie beim Gottesbegriff197 abgesehen, hauptsächlich vier Bezugspunkte: (1) im Gegensatz zur Wolffschen These soll die zu begehrende Vollkommenheit sich nicht an anschauender Erkenntnis, sondern an Lust und Unlust bemessen, die entweder pathologischpraktisch oder intellektuell-moralisch sein kann; (2) bei der Vollkommenheit der moralischen Bonität handelt es sich um den guten Willen, der freie Subjektivität ist; (3) jene Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst als mit den Gesetzen und mit den Zwecken, welche die Bedingung der Gesetzlichkeit, der Zufriedenheit und des Systems der Zwecke als Pflichten ausmacht, sowie die daraus zu konstituierende moralische, intelligible Welt als systematische Einheit aller Zwecke sind ohne den Begriff der Form der Vollkommenheit (consensus) nicht denkbar; (4) zu Zwecken als Pflichten, die der gute Wille (die Vollkommenheit der moralischen Bonität), dem Gesetz folgend, systematisch (der Form der Vollkommenheit gemäß) entwirft, wird die eigene Vollkommenheit gezählt, die sich in die physische Vollkommenheit, oben (cf. 1.2.3.c) als Vollkommenheit in hypothetisch-praktischer Bedeutung (Vermögen bzw. Naturanlage des Menschen, wie etwa Verstand, Geschicklichkeit und Talent) bezeichnet, und die innere moralisch-praktische Vollkommenheit differenziert, welche die moralische Glückseligkeit (Zufriedenheit mit sich selbst) zur Folge hat. Die Grundzüge dieser Kantischen Anwendungen des Begriffs der Vollkommenheit, der in der Schulphilosophie doch bloß auf rezeptiver theoretischer Erkenntnis der harmonischen Struktur der Natur-Gegenständlichkeit beruht, bestehen darin, daß er in die intellektuell-spontane Aktualität der den Willen betimmenden denkenden Subjektivität verlagert wird, d.h. sie bestehen in der subjektiven AktuaBeweisgrund (abgefaßt: 1762), II 90. Vgl. auch Refl. 693, XV 308, κ–λ (1769–70): „Die vernünftigen Wesen haben den Beziehungspunkt der Vollkommenheit in sich.“ 196 Refl. 6800, XIX 164f, ρ? ξ? (1773–75? 1772?): „Mit dem leeren Begriff der Vollkommenheit ist es nicht ausgemacht. Wenn allererst bekannt ist, was gut sei, so ist Vollkommenheit die Fülle des Guten“. 197 In der KrV z.B. wird die Idee einer Intelligenz, „in welcher der moralisch vollkommenste Wille ... die Ursache aller Glückseligkeit ist“, als Ideal von Gott gedacht (III 526 <B838>). Vgl. auch GMS, IV 414 <B39>. Dazu auch Refl. 7202, XIX 282 Z14–16, ψ (1780–89), etc. 195 64 lisierung bzw. Subjektivierung198 desselben. Kant sieht von Anfang an Vollkommenheit nicht in der rezeptiven Gegenständlichkeit, sondern im apriorischen intellektuellen Aktvollzug der Willensbestimmung eines handelnden Subjekts; vollkommen ist zuerst die daraus idealistisch gedachte reine moralische Subjektivität des Subjekts selber (der gute Wille) und erst danach auch die moralische, intelligible Welt. Die „kopernikanische Wende“199 in der praktischen Philosophie hat Kant sehr früh vollzogen. Da Punkt (1), soweit er die formalistische Phase der Grundlegung der Ethik anbelangt, bereits oben hinreichend geklärt worden ist, und da Punkt (3) und (4) später im 2. und 3. Kapitel für die essentielle, ,moralisch-teleologische‘ Phase derselben erörtert werden, ist hier nur auf Punkt (2) einzugehen. (b) Die absolute Vollkommenheit in der ethischen Subjektivität als moralische Bonität: der gute Wille. Die absolute Vollkommenheit in der ethischen Subjektivität als moralische Bonität: der gute Wille. 1. Die „Bemerkungen“ von 1764/65. Bereits in den „Bemerkungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen“ (1764/65) formuliert Kant den freien Willen in bezug auf die Vollkommenheit wie folgt: „Der Wille ist vollkommen, insofern er nach den Gesetzen der Freiheit der größte Grund des Guten überhaupt ist. Das moralische Gefühl ist das Gefühl von der Vollkommenheit des Willens.“200 „Der freie Wille (eines Vernünftigen) ist für sich gut, wenn er alles will, was zu seiner Vollkommenheit (Vergnügen) beiträgt, und fürs Ganze [gut], wenn er zugleich aller Vollkommenheit begehrt. So unvermögend auch der Mensch sein mag, der diesen Willen hat, so ist doch der Wille gut. Andre Sachen mögen nützlich sein; andre Menschen mögen durch einen geringen Grad Willen und viel Macht viel Gutes in einer gewissen Handlung tun, so ist der Grund, das Gute zu wollen, doch einzig und allein moralisch.“201 „Wir haben Vergnügen an gewissen von unseren Vollkommenheiten, aber weit mehr, wenn wir selbst die Ursache sind. Am allermeisten, wenn wir die frei wirkende Ursache sind. Der freien Willkür alles zu subordinieren, ist die größeste Vollkommenheit. Und die Vollkommenheit der freien Willkür als einer Ursache der Möglichkeit ist weit größer als alle anderen Ursachen des Guten, wenn sie [sc. alle anderen Ursachen] gleich die Wirklichkeit hervorbrächten.“202 „Omnis bonitas conditionalis actionis est vel sub conditione possibili (uti problemata) vel actuali (uti regulae prudentiae, quilibet vult sanus esse), sed in bonitate mediata vel conditionali το velle absolute non est bonum, nisi adsint vires et 198 Vgl. Forschner, M., Gesetz und Freiheit, S. 62. Vgl. Henrich, D., Ethik der Autonomie, in: Selbstverhältnisse, Stuttgart 1982, S. 16. 200 Bemerkungen, XX 136f. 201 Ibid., XX 138. Der hier verwendete Begriff von Vollkommenheit läßt sich aus seiner ursprünglichen Definition als Zusammenstimmung mit etwas verstehen. 202 Ibid., XX 144f. 199 65 circumstantiae temporis loci. Et in tantum, quatenus voluntas est efficiens, est bonum, sed poterit haec bonitas etiam qua voluntatem solam spectari. Si desint vires, tamen est laudanda voluntas [Ovid, Ex Ponto III 4, 79] – in magnis voluisse sat est [Properz, Elegien II 10, 6]203 – et perfectio haec absoluta, quatenus utrum aliquid inde actuatur nec, eo est indeterminatum, dicitur moralis.“204 Soviel läßt sich aus diesen Formulierungen im Blick auf spätere Entwicklungen ersehen: Der Ursprung der größten Vollkommenheit ist der zur Subordination von allem unter sich fähige freie Wille des vernünftigen Wesens, solange er die Gesetze der Freiheit (unter der necessitas categorica) befolgt, obgleich es unbestimmt ist, ob er etwas in der Tat verwirklicht oder nicht; er ist demnach allein die durch Ergebnisse der Handlungen nicht bestimmbare, folglich in diesem Sinn unbedingte Vollkommenheit und heißt moralisch; der Wille hingegen zur mittelbaren, bedingten Bonität unter der necessitas problematica oder necessitas prudentiae205 ist nicht unbedingt gut, indem es von seinen Vermögen und anderen empirisch bedingten Umgebungen abhängt; aus jener absoluten Vollkommenheit des guten Willens entspringen nun auch das moralische Gefühl (der moral sense der britischen Moralisten) und das Vergnügen (voluptas), das sich im Kontext der Formulierung für rein erachten läßt, das folglich auf das hinauslaufen muß, was später Selbstzufriedenheit (innere moralisch-praktische Vollkommenheit) genannt wird; indem er jede Vollkommenheit sucht, ist er nicht nur für sich, sondern auch für das Ganze gut; er ist als die größte Vollkommenheit sozusagen das selbsttätige Zentrum des Aggregats aller Ursachen des Guten mitsamt anderen Vollkommenheiten in hypothetisch-praktischer Bedeutung, unter dem sie subordiniert werden sollen. Die Hauptgedanken der späteren Jahre um den Begriff der Vollkommenheit in positiver Verwendung sind, wie gesehen, bereits hier in den „Bemerkungen“ versammelt. Nur orientiert sich der freie Wille am psychologischen Begriff des arbitrium liberum (der freien Willkür) in der Psychologie der Metaphysica Baumgartens – auch Rousseaus Einfluß in dieser Zeit, der zusammen mit der Psychologisierung der Sache stattfindet, ist unübersehbar. Er kann daher noch leicht mit der psychologischen Freiheit verwechselt werden, obwohl der auch zu dieser Zeit zutagetre203 Beide Quellenangaben nach D. Henrich. Vgl. ders., Ethik der Autonomie, S. 54, Anm. 6 u. 7. Bemerkungen, XX 148. 205 Bemerkungen, XX 149f: „Bonitas actionis liberae objectiva (in Deo simul est subjectiva) vel quod idem est necessitas objectiva est vel conditionalis vel categorica; prior est bonitas actionis tanquam medii, posterior tanquam finis, illa igitur mediata, haec immediata, illa continet necessitatem practicam problematicam“. XX 155: „Necessitas actionum objectiva (bonitatis) vel est conditionalis (sub conditione alicuius boni appetiti) vel categorica, prior est problematica, et si appetitiones, quae spectantur tamquam conditiones necessariae actionis, non solum ut possibiles sed ut actuales spectantur, est necessitas prudentiae.“ Vgl. auch XX 162. Die Trichotomie von necessitas categorica, problematica und prudentiae in „Bemerkungen“, XX 155, die in derjenigen der necessitatio practica in Met.L/1 (XXVIII 257: necessitatio problematica, pragmatica und moralis) und in derjenigen des Imperativs in Ethik Menzer (S. 18f: problematischer, pragmatischer und moralischer Imperativus) wiedergegeben und zuletzt in jener der Imperative in der GMS von 1785 (IV 414f <B40>; 416f <B43f>) festgestellt wird, stellt die entwickelte Konfiguration der Dichotomie derselben in der Preisschrift von 1762 (Deutlichkeit, II 298: necessitas problematica und legalis) und Refl. 6463 (XIX 13, ϵ bis 1764): „Necessitatio objectiva est vel categorica vel conditionalis.“) dar. 204 66 tende Gedanke einer „voluntas communis“206 noch zu berücksichtigen ist. Kants damalige Grundeinstellung aber zur Freiheit des menschlichen Willens ist nun sein Leben lang nie mehr erschüttert worden, obwohl er versucht hat, den Schwerpunkt ihrer Implikation im moralphilosophischen Bereich nach und nach vernunftkritisch in Richtung auf die transzendentale Bedeutung zu verlegen – was aber auch zugleich die Rolle des moralischen Gesetzes als intelligibles Faktum relevanter macht, allerdings damit um so mehr den Anschein eines moralisch-rigoristischen Kants verstärkt – und ihre Beziehung auf das Gefühl der Lust und Unlust vorsichtiger und präziser darzulegen; durch diese Entpsychologisierung aber haben seine Aussagen über die menschliche Freiheit allmählich die ursprüngliche imponierende Frische und Lebendigkeit207 verloren. Das Fundament für die Kantische Grundlegung der Ethik ist bis zur ersten Hälfte der sechziger Jahre festgelegt worden. 2. Reflexionen um 1769. Daher beruht für Kant Vollkommenheit, anders als bei der Wolffianischen schulphilosophischen Gleichsetzung der objektiven Vollkommenheit mit der Bonität208 , auf der Bonität des Menschen: „Die Bonität ist der Grund der Vollkommenheit [eines Dinges], unum ad quod consentitur. / Die Bonität der Menschen ist die moralische. Die relative Bonität ist, die nur ein Mittel zu etwas anderem ist, was gefällt.“209 Bonität ist demnach ratio perfectionis determinans bezüglich der Vollkommenheit der Dinge überhaupt. Sie entspringt aus der freien Willkür; von dieser als Zentrum des Systems der Zwecke aus läßt sich die Bonität der Dinge auch bestimmen. Der freien Willkür, die Dingen Bonität verleiht, kommt ihrerseits „die Vollkommenheit des Subjekts“ zu, die darin besteht, nicht seine Freiheit der Neigung zu unterwerfen, sondern seinen Zustand der Freiheit zu subordinieren; aufgrund dieser ihr zugehörigen Vollkommenheit aus Freiheit wird aus ihr, wenn sie sich auch unter allgemeine Gesetze der Freiheit stellt, „die allgemeingültige Vollkommenheit“, nämlich die absolute Vollkommenheit des guten Willens.210 206 Bemerkungen, XX 161. Eine imponierende und berührende Aussage über die Freiheit mit Bezug auf das Gefühl der Lust und Unlust, typisch für den noch-nicht-alten Kant, ist: „Die Freiheit ist der größte Grad der Tätigkeit und des Lebens. Das tierische Leben hat keine Spontaneität. Fühle ich nun, daß etwas mit dem höchsten Grade der Freiheit, also mit dem geistigen Leben übereinstimmt; so gefällt es mir. Diese Lust ist die intellektuelle Lust. Man hat bei ihr ein Wohlgefallen, ohne daß es vergnügt. Solche intellektuelle Lust ist in der Moral. Woher hat aber die Moral solche Lust? Alle Moralität ist die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst. Z.E. wer da lügt, stimmt nicht mit seiner Freiheit überein, weil er durch die Lüge gebunden ist. Was aber mit der Freiheit zusammenstimmt; das stimmt mit dem ganzen Leben überein. Was aber mit dem ganzen Leben übereinstimmt, das gefällt. Dieses ist jedoch nur eine reflektierende Lust; wir finden hier kein Vergnügen, sondern billigen es durch Reflexion. Die Tugend hat also kein Vergnügen, aber dafür Beifall: denn der Mensch fühlt sein geistiges Leben und den höchsten Grad seiner Freiheit“ (Met.L/1, XXVIII 249f). 208 Baumgarten, Metaphysica, lat., § 100, AA XVII 47: „Bonum est, quo posito ponitur perfectio.“ 209 Refl. 4028, XVII 390, κ (1769). Vgl. auch Refl. 3887, XVII 327, θ? κ? (1766–68? 1769?): „Vollkommenheiten schlechthin sind, was zu dem innern Wert der Dinge zusammenstimmt. ... Der Wert selber ist die Bonität, kommt auf die Materie der Vollkommenheit an.“ 210 Refl. 6605, XIX 105f, κ–λ? (1769–70?). 207 67 M.a.W.: Die freie Willkür, die den bestimmenden Grund der objektiven Vollkommenheit von Dingen bildet, ist erst dann unbedingt gut (absolut vollkommen) und moralisch, d.h. schlechthin guter Wille, wenn sie mit sich selbst, andern und der Natur zusammenstimmt, indem sie Gesetze aus sich selbst beobachtet (cf. 2.2.3). Relativ und mittelbar gut hingegen sind Mittel als durch Sinnlichkeit empirisch gegebene Zwecke, unter denen die Vollkommenheit in problematisch-praktischer Bedeutung (Vermögen, Geschicklichkeit, Talent und andere Tauglichkeiten) verstanden wird. Es soll daher primär die absolute Bonität des freien Willens als absolute Vollkommenheit, und es darf erst im Gefolge davon nur sekundär auch die relative Bonität gesucht werden, aber keinesfalls die bloße Annehmlichkeit. „Suche die Vollkommenheit (Bonität), nicht die Annehmlichkeit. Die Vollkommenheit (in sensu absoluto) wird durch den Verstand erkannt, und zwar nicht bloß mittelbare, wo der Zweck durch Sinnlichkeit gegeben wird, sondern die unmittelbare.“211 Mit der absoluten Vollkommenheit wirkt das reine Denken (hier der Verstand) unmittelbar,212 d.h. die erstere ist unmittelbar intellektuell-spontan, anders als die bloß mittelbare Vollkommenheit, die auf dem Weg der Mittel-Zweck-Beziehung durch die Sinnlichkeit bestimmt wird. Zu dieser um 1769 vorgenommene Differenzierung der Vollkommenheit in die unmittelbare absolute und die mittelbare sinnlichbedingte findet Kant später eine klarere Formulierung: „Oder sie [sc. Vollkommenheit] bedeutet in praktischem Verstande das Gute, und da entweder das, was an sich selbst gut ist (guter Wille), oder was als Mittel zu allen Zwecken gut ist, die Tauglichkeit zu allen Zwecken“.213 3. Die Ethik-Vorlesung in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre. Während bei der Vollkommenheit in theoretischer Bedeutung einerseits die der Dinge als Vollständigkeit (transzendentale und metaphysische Vollkommenheit) vorliegt, wird sie im praktischen Bereich andererseits in die moralische des guten Willens und in die teleologisch mittelbar bestimmte des empirisch-bedingten Willens eingeteilt. Kant faßt diese dreifache Differenzierung des Begriffs der Vollkommenheit in der von P. Menzer herausgegebenen, in die Jahre 1775–80 datierbaren Ethik-Vorlesung214 als Vollkommenheit der Sache, des Menschen215 und des Willens zusammen.216 Die Differenzen des Begriffs der Vollkommenheit werden so zusammengefaßt und eingeordnet, um die moralische Vollkommenheit des gu211 Refl. 6655, XIX 125, κ? (1769?). Vgl. auch Refl. 6590, XIX 98, η? κ? (1764–68? 1769?): „Die Vollkommenheit besteht nicht im akzidentellen Guten, z.E. Wissenschaft, Zierlichkeit etc., sondern im wesentlichen.“ 212 Vgl. auch Refl. 746; Anthr., VII 144: „Die innere Vollkommenheit des Menschen besteht darin: daß er den Gebrauch aller seiner Vermögen in seiner Gewalt habe, um ihn seiner freien Willkür zu unterwerfen. Dazu aber wird erfordert, daß der Verstand herrsche“. 213 Refl. 5753, XVIII 344, ψ3−4 (1785–89). 214 Man vermutet, daß Kant auch noch in der ersten Hälfte der achtziger Jahre über die Moralphilosophie eine Vorlesung gleichen Inhalts wie die „Ethik Menzer“ gehalten hat, weil die Vorlesungsnachschrift von „Moralphilosophie Collins“ (AA XXVII 237ff) das Datum WS 1784/85 trägt. 215 Anders als in der Ethik-Vorlesung scheint die der „Vollkommenheit des Zustandes“ gegenübergestellte „Vollkommenheit des Menschen“ in Reflexion 6656 (XIX 125, κ? 1769?) eher auf die Vollkommenheit des guten Willens zurückgeführt zu werden. 216 Ethik Menzer (Menzer, P. [Hrsg.]; Eine Vorlesung Kants über Ethik, Berlin 1924), S. 32: „Was ist 68 ten, freien Willens hervorzuheben, von der aus dann andere Vollkommenheiten als Zwecke des guten Willens entworfen und organisiert werden sollen: „Allein zu einem guten Willen ist nötig die Vollständigkeit und das Vermögen aller Kräfte, alles das zu vollführen, was der Wille will. Also können wir sagen, daß die Vollkommenheit [des Menschen] indirekt nur insofern zur Moralität gehöre.“ Soll daher unter der perfectio im Wolffianischen Satz „quaere perfectionem“ die Vollkommenheit in hypothetisch-praktischer Bedeutung („Vollkommenheit des Menschen“) verstanden werden, so ergibt sich: „Der Satz des Autors [sc. Baumgartens] als der Grund der Obligation: quaere perfectionem, quantum potes, ist doch wenigstens bestimmter ausgedrückt, hier ist doch nicht eine totale Tautologie [wie im Satz: Fac bonum et omitte malum]; also hat er einen Grad der Brauchbarkeit.“ „Also ist der Satz indirekt moralisch.“217 4. Nachwirkungen der Erwägungen in den achtziger Jahren. Die hervorgehobene moralische, unmittelbare Vollkommenheit des guten Willens wird etwa zur gleichen Zeit in einer Reflexion dargelegt und gepriesen,218 welche alsdann in gehobenem Stil an den später so berühmten Anfang des ersten Abschnitts der GMS (1785) gesetzt wird.219 Sie schlägt sich somit auch in der Idee des Zwecks-an-sich-selbst220 nieder. Auch in den achtziger Jahren reflektiert Kant über den guten Willen noch mit Bezug auf den Begriff der Vollkommenheit.221 Die intellektuelle Vollkommenheit der Moralität des freien Willens, die von sinnlichen Bedingungen frei ist, liegt nicht Wolffisch in der Gegenständlichkeit,222 sondern denn vollkommen? Die Vollkommenheit der Sache und des Menschen sind unterschieden. Die Vollkommenheit der Sache ist die Hinlänglichkeit aller requisitorum, um die Sache zu konstituieren. Also generaliter bedeutet es die Vollständigkeit. Aber die Vollkommenheit des Menschen bedeutet noch nicht Moralität. Die Vollkommenheit [des Menschen] und moralische Bonität sind unterschieden. Die Vollkommenheit [des Menschen] ist die Vollständigkeit des Menschen in Ansehung seiner Kräfte, Vermögen und Fertigkeit, alle beliebige Zwecke auszuführen. Die Vollkommenheit kann größer und kleiner sein. Einer kann vollkommener sein als der andere. Die Bonität ist aber die Eigenschaft, sich aller dieser Vollkommenheiten gut und wohl zu bedienen. Also besteht die moralische Bonität in der Vollkommenheit des Willens und nicht des Vermögens.“ 217 Loc.cit. Zu Kants Deutung des Satzes „quaere perfectionem“ hinsichtlich der Tautologie vgl. auch Refl. 6487, XIX 24f, ρ–ϕ (1773–78): „imperativus tautologicus. Haben doch den Nutzen, daß sie die pragmatische Imperative und die stimulos ausschließen. Sei gut, und würdig, glücklich zu sein.“ Vgl. auch Refl. 6972, XIX 217, ϕ? (1776–78?). 218 (Refl. 6890, XIX 194f, υ (1776–78): „Es kann überall nichts schlechthin Gutes sein als ein guter Wille. Das übrige ist entweder mittelbar gut oder ...“. Vgl. aber auch Refl. 5444, XVIII 183f, ϕ (1776–78). 219 GMS, IV 393 <B1>. Zum absoluten Wert des guten Willens vgl. auch KU, V 442f <B410–412>. 220 Vgl. GMS, IV 427–431 <B63–70>. Refl. 7305, XIX 307, ψ (1780–89): „... er [sc. der Mensch] ist nur Zweck an sich selbst, sofern er ein Wesen ist, das sich selbst Zwecke setzen kann.“ 221 Vgl. außer Refl. 5753 z.B. Refl. 7254, XIX 295, ψ (1780–89): „Der Satz ,perfice te‘ ist tautologisch. Man will wissen, worin die Vollkommenheit bestehe, die das Objekt des kategorischen Imperativs ist. Die moralische Vollkommenheit ist die Bedingung, unter der alle andere allein Vollkommenheit heißen kann. Nun will ich wissen, worin die besteht. Sie ist eine Vollkommenheit des Willens; aber worin? Der keinen guten Willen hat, ist des Verstandes nicht wert.“ 222 Wohl aber wird in der moralisch-praktischen Zwecksetzung das höchste Gut als intellektueller Gegenstand der reinen praktischen Vernunft gebildet und hingestellt, zu welchem auch die Vollkommenheit als Zweck gehört. In der essentiellen ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der 69 im selbsttätig denkenden Subjekt der Willensbestimmung aufgrund der negativen Freiheit, in der reinen praktischen Vernunft, die nichts anderes gewesen ist als ein Ziel der Beweisführung von Anmerkung I zu §§ 2 und 3 des Grundsätze-Kapitels der KpV (cf. 1.2.3). Die Ursache des menschlichen Übels liegt in der Abhängigkeit vom Passiven in der Sinnlichkeit; die innere Vollkommenheit des Menschen hingegen besteht in der Herrschaft des Verstandes, genauer der reinen praktischen Vernunft als intellektueller Spontaneität in der Praxis, den Gebrauch aller seiner Vermögen seiner freien Willkür zu unterwerfen.223 Kants intellektueller Voluntarismus artikuliert sich ausdrücklich in seiner Lehre über die absolute Vollkommenheit des guten Willens. Ethik wird also die in der formalistischen Phase derselben negierte Gegenständlichkeit wieder intellektuell hergestellt. Die wiederhergestellte objektive Vollkommenheit aber wird der subjektiven Vollkommenheit des guten freien Willens untergeordnet. 223 Vgl. dazu Anthr., VII 144. 70 2. Die innere Bewegung und Struktur der moralphilosophischen Reflexionen in den siebziger und achtziger Jahren. 2.1 Einleitung zur Untersuchung der moralphilosophischen Reflexionen in den siebziger und achtziger Jahren. Die moralphilosophischen Reflexionen Kants sind zum großen Teil in der ersten Hälfte des Bd. XIX der Akademie-Ausgabe (AA), herausgegeben von E. Adickes und F. Berger, gesammelt, aber man findet sie auch im letzten Teil desselben Bands (Reflexionen zur Religionsphilosophie) und sporadisch in dem Band für Anthropologie (Bd. XV) und den Bänden für Metaphysik (Bd. XVII und XVIII). Unter ihnen ist die Produktivität in Periode υ/ϕ (1776–78) auffallend. Zu einer Erforschung des moralphilosophischen Entwicklungsgangs Kants in den siebziger und achtziger Jahren sind darüber hinaus sowohl seine Vorlesungen wie etwa „Ethik Menzer“ und „Met.L/1 (Pölitz)“ als auch das Kanon-Kapitel224 der KrV zu berücksichtigen, das aus einer Zusammenfassung der Reflexionen der siebziger Jahre, unter anderen derjenigen in der ebengenannten produktiven Periode υ/ϕ (1776–78), zustandegekommen zu sein scheint, und aus dem sich alsdann die moralisch-teleologischen Gedanken in der KpV, der KU und der Religionsschrift weiter entwickelt haben.225 Das Kanon-Kapitel der KrV befindet sich in III 517ff <B823ff>. A. Schweitzer bezeichnet das Kanon-Kapitel der KrV als „religionsphilosophische Skizze“ und nimmt das Dasein einer moralisch-theologischen Abhandlung Kants an, die ihm entspricht (vgl. dazu Schweitzer, A., Die Religionsphilosophie Kant’s von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Freiburg i.B. 1899, S. 4 Anm. und S. 67). Diese Abhandlung müßten in Wirklichkeit die moralphilosophischen Reflexionen der siebziger Jahre, insbesondere diejenigen aus Periode υ/ϕ, sein. Bei der Betrachtung nun des Übergangs vom Kanon-Kapitel in die KpV ist es wichtig zu beachten, daß Kant in der 2. Auflage der KrV, d.h. ein Jahr vor dem Erscheinen der KpV, den Inhalt des Kapitels nicht revidieren wollte (die Vorrede der KrV zur 2. Auflage ist unterzeichnet im April 1787. Doch war die KpV bereits am 25. Juni desselben Jahres nahezu druckfertig. 224 225 71 Außerdem muß auch auf das Besondere des 3. Abschnitts der GMS Bedacht genommen werden. Unsere Aufgabe liegt jetzt darin, die Reflexionen sowie die Darstellungen der Vorlesungsnachschriften in den siebziger und achtziger Jahren zusammenzustellen, einzuordnen und ihre innere Bewegung und Struktur zu enthüllen.226 Die Rekonstruktionsarbeit dieser Art wurde bereits von M. Forschner in seiner Antrittsvorlesung begonnen.227 Diese trägt zu einer umfassenden, eingehenden Untersuchung der moralphilosophischen Reflexionen bei, die große Mühe und Geduld, ja Opferbereitschaft fordert, die aber zur Gestaltung eines Gesamtbilds der Kantischen Grundlegung der Ethik nicht entbehrt werden kann, welche der bisherigen Interpretation derselben unter den von H. Cohen festgelegten Leitlinien nicht vollauf gelungen zu sein scheint. Auch die vorliegende Arbeit bietet lediglich einen ersten bescheidenen Schritt zu jener Untersuchung dar. Kant betrachtet nun in den „Reflexionen“ das Grundphänomen ,Moralität‘ als eine Ganzheit von Freiheit, Gesetz und Zweck, bei deren Grundlegung eine Richtung von Freiheit über Gesetz zu Zweck besteht, die ,moralisch-teleologisch‘ und architektonisch (aufbauend) genannt werden kann, während die umgekehrte Richtung von Zweck über Gesetz zu Freiheit, die als kognitiv-formalistisch (analytischregressiv) zu bezeichnen ist, in ihnen relativ wenig beachtet und erst in der Analytik der KpV zwecks Fundamentsetzung zur ,moralisch-teleologischen‘ Grundlegung der Ethik voll formuliert wird. Wenn aber die Grundlegung der Ethik aus dem ganzen Grundphänomen von Freiheit, Gesetz und Zweck her vorgenommen werden soll – dies wird tatsächlich in den „Reflexionen“ durchgeführt – und wenn dabei Gesetz und Freiheit, und nicht der Zweck, das Fundament abgeben sollen, so ist zu einer vollständigen Grundlegung der Ethik ein Rückgang ins Gesetz und dann in die Freiheit als dessen ratio essendi, wie er am Anfang der KpV ausgeführt wird, unentbehrlich. Wer also die Entwicklung der Grundlegung der Ethik bei Kant derart sieht, daß die sogenannten Deduktionen des Gesetzes in den „Reflexionen“, bei denen man es eigentlich mit der ,moralisch-teleologischen‘ Grundlegung der Moralität als des Zusammenhangs von Freiheit, Gesetz und Zweck zu tun hat, zu überwinden sind und aus ihrem Fehlschlag die Lehre vom Faktum der Vernunft in der KpV unvermeidlich auftaucht, muß eingesehen haben, daß der Kern der GrundVgl. hierzu P. Natorps Einleitung zur KpV, AA V 497f). Die Hypothese einer moralphilosophischen Umkippung Kants zwischen der GMS und der KpV ist schon damit fraglich. 226 Die moralphilosophischen Reflexionen sind einmal durch R. Bittner und K. Cramer nach den begrenzten Themen zusammengestellt und eingeordnet worden (vgl. dazu Bittner, R., und Cramer, K., Materialien zu ,Kants Kritik der praktischen Vernunft‘, Frankfurt/M. 1975, S. 31–136). Diese Zusammenstellung beabsichtigt freilich nicht, innere Zusammenhänge und Bewegungen, die die Reflexionen selbst aufweisen, zutagezubringen. 227 Forschner, M., Moralität und Glückseligkeit in Kants Reflexionen, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 42, 1988. Auch K. Düsing hat diese Aufgabe teilweise in Angriff genommen. Vgl. dazu ders., Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer Philosophie, in: Kant-Studien Bd. 62, 1971. Ebenso ist auch O. Schwemmer im Rahmen seiner Interpretationssystematik teilweise auf die moralphilosophischen Reflexionen eingegangen. Vgl. hierzu ders., Philosophie der Praxis, Frankfurt/M. 1980, S. 98–102, 164–175. 72 legung auch deshalb im Rückgang zum Fundament der Ethik bestehen muß, weil die ,moralisch-teleologische‘ Grundlegung in den „Reflexionen“ nicht das Ganze der Grundlegung umfassen kann oder seiner Ansicht zufolge sogar gescheitert ist. Wenn dem so ist, dann erweist sich daraus jedenfalls, daß ohne die Unterscheidung der Grundlegung der Ethik in die ,moralisch-teleologische‘ und die kognitivformalistische die Entwicklung der Gedanken der Reflexionen zur Analytik der KpV nicht so verstanden werden kann, wie sie tatsächlich verlaufen ist. Einen eigenartigen Charakter nun der moralphilosophischen Reflexionen Kants kann man an den in ihnen befindlichen hartnäckigen Wiederholungen der gleichartigen Gedanken und Thesen sehen, die auf die Frage, wie sich das festgehaltene Fundament der Ethik auswirkt, demnach hauptsächlich auf die ,moralische Teleologie‘ im erweiterten Sinn, bezogen sind. Dieser auf den ersten Blick negative Charakter der Reflexionen aber weist nur darauf hin, daß Kants Interesse an der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der ethischen Grundlegung sehr groß gewesen ist, und in welcher Weise ein philosophisches Denken, das sich mit einem es so interessierenden Thema befaßt, eigentlich vor sich gehen muß – es darf nur Wesentliches schlicht und lapidar zum Ausdruck bringen und dieses von allen Seiten und Blickpunkten aus überprüfen; erst dadurch kann das Gerüst eines festen Denkgebäudes entstehen. Dieses Verfahren hat in Notizen der Werkstatt des Denkens das Erscheinungsbild beinahe monotoner Wiederholungen zur Folge. Den permanenten Nährboden nun der moralphilosophischen Reflexionen überhaupt und insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren kann man, statt Hutscheson und Rousseau zu nennen, die die Fundamentlegung der Ethik bis zum Jahre 1765 entscheidend beeinflußt haben, in der Wolffschen Schule und der geistigen Atmosphäre des Pietismus finden.228 Kant gehört offensichtlich zum mitteleuropäischen Geistesraum des achtzehnten Jahrhunderts, sosehr deutsche Interpreten der Kantischen Philosophie westliche Einflüsse unterstrichen haben mögen, um damit den paneuropäischen Charakter derselben aufzuweisen. Eine Ursache der rapiden Rezeption und Verbreitung der Kantischen Philosophie im deutschen Kulturraum liegt in Kants kritischer Aufnahme der Wolffschen Terminologie und des Geistes des Pietismus. Nun kann die innere Bewegung und Struktur der moralphilosophischen Refle228 Kant hat für die Konzeptionsbasis seiner Reflexionen die Wolffianischen Lehrbücher verwendet. Die Wolffsche Terminologie ist der Begriffsvorrat für sein Denken. Auf den dogmatischen Einfluß des Pietismus auf sein moralphilosophisches Denken ist in der vorliegenden Arbeit nicht einzugehen. Der Pietismus war doch die Religion seiner Familie, und seine ethische Atmosphäre scheint das Ethos Kants lebenslang bestimmt zu haben. Zur pietistischen Atmosphäre der Kantischen Moralphilosophie vgl. Delekat, F., Immanuel Kant, Heidelberg 2 1966, S. 314: „Kant hat in einer Zeit, in welcher der Pietismus abgewirtschaftet hatte und die Gebildeten – von ihm enttäuscht – aus der Kirche überhaupt hinausstrebten, die Motive der reformatorischen Rechtfertigungslehre wieder zur Geltung gebracht, wenngleich nur im Rahmen der Ethik. Seine Zeitgenossen haben durchaus empfunden, woher der Geist wehte, und der Eindruck war tief.“ Daß die pietistische Atmosphäre und die Wolffsche Schule der Nährboden seiner Moralphilosophie gewesen sind, dafür kann man sich symbolisch daran erinnern, daß sein Mentor der Pietist und zugleich Wolffianer Franz Albert Schultz gewesen ist. 73 xionen in den siebziger und den achtziger Jahren unter folgenden drei Rubriken betrachtet werden: A. Der Gedanke der Zusammenstimmung und das Moralprinzip, B. Glückseligkeit als Zielvorstellung der Moralität aus Freiheit, C. Die relative Gewichtsverlagerung bei der moralischen Triebfeder. Zuletzt aber beleuchten wir den Zusammenhang zwischen der Idee der intelligiblen Welt und der moralischen Gesetzlichkeit im 3. Abschnitt der GMS als ein Resultat aus dem in den „Reflexionen“ Gedachten unter Restriktion der Kritik der reinen praktischen Vernunft: D. Die intelligible Welt als bloßer Standpunkt außer der Sinnenwelt. A. Der Gedanke der Zusammenstimmung und das Moralprinzip. 2.2 Die Zusammenstimmung mit sich selbst, mit den Gesetzen und mit den Zwecken. Einer der Grundgedanken in den fragmentarischen moralphilosophischen Reflexionen Kants in den siebziger und achtziger Jahren ist, mit einem Stichwort ausgedrückt, die Zusammenstimmung (bzw. Übereinstimmung) der Freiheit mit sich selbst als mit den Gesetzen und mit den Zwecken. Bei ihr hat man es mit dem Begriff einer Harmonie zu tun, deren Gefüge drei ethische Grundbegriffe, Freiheit, moralisches Gesetz und Zweck (Glückseligkeit) miteinander zusammenstimmend verbindet. Der mit diesem Begriff präsentierte Grundgedanke, der in den „Reflexionen“ gar nicht systematisch dargestellt ist, der sich aber auch in den Vorlesungsnachschriften dieser Zeit, wie etwa der „Ethik Menzer“ und der „Met.L/1 (Pölitz)“, und im Kanon-Kapitel der KrV niederschlägt, läßt sich zuletzt auch in der GMS, der KpV, der MS und den anderen ethischen Schriften als unscheinbare Selbstverständlichkeit finden. Er soll im folgenden rekonstruiert werden. 2.2.1 Allgemeine Erläuterung zum Begriff der Zusammenstimmung. Das Wort Zusammenstimmung bzw. Einstimmung, das Bedeutungen wie Harmonie, Vollkommenheit und Sammlung auf Einheit impliziert, weist bei seinem Gebrauch in der Kantischen Ethik eine dreifache objektive Bezugnahme des Subjekts der Zusammenstimmung, der freien Willkür, auf. Zuerst nämlich soll diese mit sich selbst zusammenstimmen. Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst kennt aber nun zwei Entfaltungen: Einerseits kann die Freiheit mit sich selbst zusammenstimmen, indem sie mit allgemeinen Gesetzen zusammenstimmt; in der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst andererseits liegt die Möglichkeit der Zusammenstimmung derselben mit den ihr wesentlichen Zwecken. Die dreifache Bezugnahme der Zusammenstimmung der freien Willkür heißt also: (1) mit sich selbst, (2) mit den Gesetzen und (3) mit den Zwecken. 74 Um zu erklären, woher der Kantische Begriff der Zusammenstimmung philosophiegeschichtlich kommt, dazu wäre eine historische Detailforschung nötig. Hier werden aber bloß die mit ihm verwandten Begriffe aufgezählt: (1) Vollkommenheit (Wolff-Baumgarten), (2) Einstimmung und Widerstreit (Leibniz) und (3) übereinstimmendes Leben (die Stoa). (1) Daß dem Begriff der Zusammenstimmung mit etwas derjenige der Vollkommenheit zugrundeliegt, das ersieht man sowohl aus dem Wort ,Zusammenstimmung‘ (consensus) selbst229 als auch aus öfters von Kant gemachten Aussagen, in denen das Wort auftritt, wie etwa dieser: „Je einstimmiger mit sich selbst, je einstimmiger mit fremden Willen seiner Natur nach die Willkür ist, je mehr sie ein Grund ist, andrer Willkür mit unsrer zu vereinigen: desto mehr stimmt es [sc. das vollständige Leben] mit den allgemeinen Prinzipien des Lebens, desto weniger Hindernis auch, desto größerer Einfluß auf die Verhältnisse und freie Willkür anderer.“230 Beim ,vollständigen Leben‘ in bezug auf das Gute kommt es nun auf die Zusammenstimmung mit den Vernunftgesetzen an, wobei das ,sich selbst‘ der Zusammenstimmung mit sich selbst als Glied der intelligiblen Welt angesehen wird.231 Kant verwendet in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik den Begriff der Vollkommenheit beinahe uneingeschränkt, weil die Sache und der Vorgang in dieser Phase intelligibel sind. In der kognitiv-formalistischen Phase aber wird sein Gebrauch, wie oben dargelegt (cf. 1.2.3), abgelehnt, weil er in sich die Abhängigkeit von der Gegenständlichkeit impliziert. Ebensowenig wie der Begriff der Vollkommenheit kann der Begriff der Zusammenstimmung, der dem ersteren als dessen Komponente zugehört, das erste, fundamentale Prinzip bzw. der Ursprung der Moralität sein, sondern sie reguliert lediglich als Kriterium der Moralität den Prozeß der Moralisierung der freien Willkür aus dem Ursprung der Moralität in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase. (2) Dem Begriffspaar von Einstimmung und Widerstreit, das in der Grundlegung der Ethik eine große Rolle spielt, wird kein Gebrauch bei der Gegenstandskonstitution der Verstandessynthesis in der theoretischen Philosophie eingeräumt. Kant setzt sich mit dem theoretischen Gebrauch dieser Begriffe als Reflexionsbegriffe im Amphibolie-Kapitel der KrV auseinander.232 (3) Sachlich betrachtet, entspricht dem Kantischen Moralprinzip der Zusammenstimmung der freien Willkür mit sich selbst Zenons ὁμολογουμένως ζῆν (das übereinstimmende Leben), worunter der Gründer der Stoa ,ein Leben in Übereinstimmung mit dem Logos‘ verstand, da das griechische Wort ὁμολογουμένως in sich das Wort ,Logos‘ enthält.233 Seine Nachfolger, Kleanthes und Chrysipp, 229 Cf. 1.2.3.c (Baumgarten, Metaphysica, lat. § 94, dt. § 73). Refl. 567, XV 246, υ (1776–78). 231 Vgl. dazu Refl. 712, XV 316, ν? (1771?): „... was mit mir als einem Glied der intellektualen Welt zusammenstimmt, ist gut“. 232 Vgl. dazu KrV, III 217 <B320f>, 222 <B328f>. 233 Vgl. zum stoischen Moralprinzip Zenons: Pohlenz, M., Stoa und Stoiker, Bd. 1: Die Gründer, Panaitios, Poseidonios, Zürich 1950, S. 109f; Schink, W., Kant und die stoische Ethik, in: KantStudien, Bd. 18, 1913, S. 426f. 230 75 wollten diese Bedeutung klar machen und formulierten sie so: ὁμολογουμένως τῆͺ ϕύσει ζῆν (ein Leben in Übereinstimmung mit der Natur),234 wobei mit der Natur Vernunft (ὀρθὸς λόγος) gemeint ist. Also hat sich die Zusammenstimmung mit sich selbst im übereinstimmenden Leben zu derjenigen mit der Vernunft und ihren Gesetzen entwickelt. Nun ist bei Zenon dieses Moralprinzip das Lebensziel (τὸ δὲ τέλος τὸ ὁμολογουμένως ζῆν). Es bringt der Stoa zufolge dem Menschen unmittelbar den inneren Frieden und die Eudämonie (das höchste Gut), während bei Kant doch diese Unmittelbarkeit zur Erlangung des höchsten Guts durch Moralität fehlt. Es handelt sich nämlich bei der stoischen Zusammenstimmung mit sich selbst als mit den Gesetzen um diejenige mit dem Lebenszweck. Aus dem angestellten Vergleich also ergibt sich, daß die dreifache Zusammenstimmung in der Kantischen Ethik mit der Struktur des stoischen Moralprinzips in Parallele gesetzt werden kann. 2.2.2 In den siebziger und achtziger Jahren werden Gesetz und Willensfreiheit aus der Perspektive der moralischen Zwecksetzung her weiter in Betracht gezogen. Der Moralphilosoph Kant, der bereits in der ersten Hälfte der sechziger Jahre das Fundament der Ethik gelegt hat, denkt weiterhin darüber nach, wie dieses Fundament sich auswirkt und in welchen ethischen Zusammenhängen es steht. Demnach erwägt er das moralische Gesetz und die Freiheit des Willens von unseren wesentlichen Zwecken her. M.a.W.: Die Zusammenstimmung der freien Willkür mit sich selbst als mit den Gesetzen wird unter dem Aspekt der Zusammenstimmung derselben mit den wesentlichen Zwecken in Betracht gezogen; die Einheit aller Zwecke bestimmt die formale Einheit im Gebrauch der Freiheit. Unter diesem Gesichtspunkt kann der Zweck auch die moralische Triebfeder (vis movens zur Ausübung der Moralität) abgeben. In den moralphilosophischen „Reflexionen“ in den siebziger und achtziger Jahren werden also Gesetz und Freiheit als Fundament der Kantischen Ethik überwiegend in bezug auf die moralische Zwecksetzung weiter überlegt. Mit den sogenannten Deduktionen des Gesetzes in den „Reflexionen“, wie sie durch D. Henrich in seinem Aufsatz „Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft“235 aufgewiesen werden, wird von Kant nur in dieser Konstellation, d.i. in der ,moralisch-teleologischen‘, architektonischen Problematik, wie sich das Fundament der Ethik, Willensfreiheit und Gesetz, weiter auswirkt, experimentiert; manche jener Reflexionen, die Henrich dafür zitiert, können daher auch nach der KpV, d.h. nach der ausdrücklichen Festhaltung der Lehre vom Gesetz als Faktum der Vernunft, essentiell gelten, nämlich als Sätze, die zur ,moralisch-teleologischen‘ Phase gehören. Henrich richtet sein Augenmerk nicht 234 Cf. dazu auch Fußnote 396 in 2.6.2. In: Henrich, D., Schultz, W. und Volkmann-Schluck, K.-H. [Hrsg.], Die Gegenwart der Griechen im neueren Denken. Festschrift für H.-G. Gadamer, Tübingen 1960; wiederabgedruckt in: Prauss, G. [Hrsg.], Kant, Köln 1973. 235 76 darauf, wie das Fundament der Ethik mit der moralischen Teleologie zusammenhängt. Die Konzeption vom Faktum der Vernunft andererseits als faktische Vorgegebenheit des moralischen Gesetzes (des Sollens) erscheint nicht zum erstenmal in der KpV, sondern ist bereits bis zur ersten Hälfte der sechziger Jahre de facto vorbereitet und in den Reflexionen der siebziger und achtziger Jahre weiter erhalten. Der von Henrich aufgestellte Entwicklungsgang der Kantischen Grundlegung der Ethik ist zwar sehr imponierend, reflektiert aber nicht den eigentlichen Grundzug der moralphilosophischen Reflexionen Kants. Jeder, der diese durchgelesen hat, merkt gleich, daß sich das eigentliche Bild ihrer Hauptgedankengänge ziemlich unterscheidet von dem Eindruck, den Henrichs Aufsatz ihm macht. In diesem fehlt noch ein richtiges Verständnis für die ,moralisch-teleologische‘ Phase der Grundlegung und die Triebfeder-Problematik sowie für den Zusammenhang zwischen beiden. Ferner besteht die Eigenart seiner Interpretation darin, daß er den Begriff der Spontaneität (Selbsttätigkeit) stets von der theoretischen Vernunft her zu denken versucht und daß er die Selbstheit des Subjekts der moralischen Entscheidung (Billigung und Mißbilligung) mehr oder weniger ins Gefühl setzt. Somit wird der reinen praktischen Vernunft Kants auf ihren beiden Seiten – auf der einen Seite durch die theoretische Vernunft, auf der anderen Seite durch das Gefühl der Lust und Unlust – ihre Eigentümlichkeit weggenommen.236 Die Untersuchung der moralphilosophischen Reflexionen in diesem Aufsatz stellt aber so etwas wie eine Detektivarbeit dar, die in der Masse von Reflexionen einen roten Faden verfolgt, und sein sachlicher Formulierungsstil ist philosophisch sehr attraktiv.237 Zur Orientierung über diese „Reflexionen“ ist nun kurz auf ein paar Grundgedanken in ihnen hinzuweisen. In einer zweckmäßigen Welt wie der moralischen Welt enthält der Zweck des Ganzen in sich die Bedingung der Zwecke der Teile. Dieses System der Zwecke verweist darauf, daß jedermann sich als den Gesetzen unterworfen ansehen muß. Erst dadurch können wir mit dieser Welt hinsichtlich der Glückseligkeit zusammentreffen.238 Die Zusammenstimmung der Freiheit mit dem Zweck des Ganzen239 bestimmt also diejenige mit den Gesetzen der Moralität. Das Ganze ist hier bestimmend.240 So wird denn gesagt: „Die Vernunft zeigt, daß die durchgängige Einheit aller Zwecke eines vernünftigen Wesens sowohl in Ansehung seiner selbst als andrer, mithin die formale Einheit im Gebrauche unserer Freiheit, d.i. die Mo236 Cf. Fußnote 495 in 2.8. Der Verfasser hat von D. Henrichs Arbeiten sehr viel gelernt, wofür er ihm sehr dankt. 238 Vgl. Refl. 6899, XIX 200 Z16–22, υ? κ? η? (1776–78? 1769? 1764–68?). 239 Vgl. dazu z.B. Refl. 6139, XVIII 467 Z8–10, ψ2 (1783–84). 240 Vgl. dazu z.B. Refl. 6981, XIX 219, ϕ (1776–78): „Es gibt viel Vollkommenheit als Mittel, aber nur eine Vollkommenheit als ganzer Zweck.“ Der Satz stellt ein Gespräch mit dem Wolffschen Prinzip „quaere perfectionem“ dar, und der ganze Zweck bezieht sich vermutlich auf das höchste Gut. Vgl. auch Refl. 7027, XIX 230, υ? µ? ρ? (1776–78? 1770–71? 1773–75?): „Die empirischen Gründe unserer Wahl haben keine Gewißheit, weil sie keine allgemeine Richtschnur haben und also untereinander Widersprüche geben können. Die Regel ihrer Zusammenstimmung: Einheit in einem Ganzen ist die oberste.“ Vgl. auch Refl. 6711, XIX 138 Z18–20, ξ–ρ? (1772–75?), Refl. 6712, XIX 138 Z22–27, ξ–ρ? (1772–75?). 237 77 ralität, wenn sie von jedermann ausgeübt würde, die Glückseligkeit durch Freiheit hervorbringen ... würde und daß umgekehrt, wenn die allgemeine Willkür jede besondere bestimmen sollte, sie nach keinen andern als moralischen Prinzipien verfahren könnte“.241 Die Moralität besteht also in der Zusammenstimmung der Freiheit mit den Zwecken. „Moralität ist die Übereinstimmung der freien Willkür mit dem Zwecke der Menschheit und der Menschen überhaupt, nämlich mit notwendigen Bedingungen der allgemeinen Zwecke der Menschheit und der Menschen.“242 Moralische Gesetze bringen einzig und allein die Glückseligkeit auf die Ursache der Freiheit (sie sind sozusagen die Bindeglieder zwischen Autokratie der Freiheit und Epigenesis der Glückseligkeit; cf. 2.4.4) und führen somit die Würdigkeit glücklich zu sein mit sich.243 D.h. die Zusammenstimmung der Freiheit mit den Gesetzen verbindet diejenige mit sich selbst mit derjenigen mit den Zwecken und ist demnach die Würdigkeit glücklich zu sein. Die Moralität gründet auf der Beziehung der Vernunftwesen auf die ursprünglichen Zwecken derselben, durch die allein ihr Dasein möglich ist.244 Diese Zweckbeziehung ist demnach für sie wesenseigen und essentiell. Der Moralität als Bindeglied zwischen Freiheit und Endzweck wird unten in extenso nachgegangen (cf. 2.3.2 und 3.1.1). Die drei Bezüge der Zusammenstimmung der Freiheit können nun ganz kurz so formuliert werden: Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst bezieht sich auf die Autonomie des Willens, die Freiheit; diejenige mit den Gesetzen auf die Sittlichkeit; diejenige mit den Zwecken auf die ,moralische Teleologie‘, die teleologische Seinsordnung. 2.2.3 Das Konzept der Zusammenstimmung des Willens mit sich selbst in den Jahren 1769–70. Die Grundidee einer Zusammenstimmung mit sich selbst kann bereits in den Jahren 1769–70 (Periode κ–λ) in ausdrücklicher Gestalt angetroffen werden. Eine Reflexion, die vermutlich aus dieser Periode stammt, lautet: „Allein es war nötig, daß unser Verstand zugleich allgemeine Regeln entwarf, nach denen wir die Bestrebungen zu unserer Glückseligkeit zu ordnen, einzuschränken und übereinstimmig zu machen hätten, damit unsere blinden Triebe uns nicht auf bloßes Glück bald hier, bald dahin trieben. Da diese sich gewöhnlichermaßen widerstreiten, so war ein Urteil nötig, welches in Ansehung ihrer aller unparteiisch und also abgesondert von aller Neigung bloß durch den reinen Willen die Refl. 7204, XIX 283, ψ? υ? ϕ? (1780–89? 1776–78?); kursiv v. Verf. Cf. 2.3.1.g. Refl. 4611, XVII 609, ξ–o (1772–75). Vgl. dazu auch Refl. 6950, XIX 212 Z9–16, ϕ (1776–78), Refl. 6795, XIX 163 Z18–23, ρ? (1773–75?), Refl. 7209, XIX 285 Z29 – 286 Z5, ψ? ϕ? (1780–89? 1776–78?). 243 Vgl. Refl. 6910, XIX 203 Z18–23, υ (1776–78), Refl. 6876, XIX 189 Z10f, υ (1776–78). 244 Vgl. Refl. 6977, XIX 218, υ? (1776–78): „Der moralische Grund ist der Bewegungsgrund der Handlungen aus den ursprünglichen Zwecken vernünftiger Wesen, d.i. denen Zwecken, durch die allein ihr Dasein möglich ist. Alles, was dem widerstreitet, widerstreitet ihnen selbst, weil es dem principio essendi derselben entgegen ist.“ 241 242 78 Regeln entwarf, die, für alle Handlungen und für alle Menschen gültig, die größte Harmonie eines Menschen mit sich selbst und mit andern hervorbrächten.“245 D.h.: Da unsere blinden Triebe aus sinnlichen Bedürfnissen der Natur, die, solange wir bloß den letzteren unterworfen sind, uns nur „auf bloßes Glück bald hier, bald dahin“ treiben, „sich gewöhnlichermaßen widerstreiten“: so müssen „allgemeine Regeln“, nach denen „die Bestre- bungen zu unserer Glückseligkeit“ nach Ordnung und Übereinstimmung reguliert werden können, in bezug auf die uns so herumschleppenden Antriebe „unparteiisch“ und somit „abgesondert von aller Neigung“ bloß durch reine praktische Vernunft und mithin durch den reinen Willen, der deren Kausalität ist, entworfen werden; als solche müssen sie „für alle Handlungen und für alle Menschen“ allgemeingültig sein und dadurch „die größte Harmonie eines Menschen mit sich selbst und mit andern“ hervorbringen, um den Widerstreit durch sinnliche Bewegursachen aus der zufälligen Empirie der sinnlichen Natur zu vermeiden und somit die wahre, beständige Glückseligkeit erlangen zu können. Die „größte Harmonie eines Menschen mit sich selbst und mit andern“, d.i. die Zusammenstimmung der Freiheit, die das Wesen der menschlichen Handlung ausmacht, mit sich selbst, welche auch diejenige mit der Freiheit anderer involvieren kann, muß durch die allgemeinen Regeln der Vernunft doch deshalb gegründet werden, weil dadurch der Zweck der allgemeinen Glückseligkeit überhaupt, ohne im Widerstreit „auf bloßes Glück bald hier, bald dahin“ getrieben zu werden, wesentlich angestrebt werden kann. Denn die Glückseligkeit überhaupt als Inbegriff aller Zwecke ist für alle Menschen gemeingültig. Wenn daher sein freier Wille mit Zwecken der allgemeinen Glückseligkeit zusammenstimmt, so heißt das, daß er eigentlich mit sich selbst übereinstimmt. Bei der Abzielung nämlich auf Zwecke der allgemeinen Glückseligkeit handelt es sich demnach um die Zusammenstimmung des freien Willens mit sich selbst, in deren Einheit auch allgemeine Regeln der Vernunft anzutreffen sind. Auf dieser Übereinstimmung des freien Willens mit den „wesentlichen Zwecken“ des Menschen beruht nun auch die Bonität. So wird in einer anderen Reflexion aus derselben Periode festgestellt: „Man kann annehmen, daß der Mensch die Zwecke alle wolle, dazu seine Natur abzielt, und daß diese Abzielung selber nicht der Zweck eines Fremden sei, mit welchem sein Wille übereinstimmt, sondern sein eigener Zweck sei; wenn denn sein Wille mit diesen Zwecken zusammenstimmt, so stimmt er eigentlich mit sich selbst. Es ist aber objektiv notwendig, dasjenige zu wollen, was man will; folglich ist die Übereinstimmung seines Willens mit seinen wesentlichen Zwecken gut.“246 Daß diese Abzielung der eigene Zweck des freien, guten Willens ist, bedeutet die moralische Zwecksetzung aus der Autonomie des Willens. Die Formulierung: Wenn der freie Wille mit den wesentlichen Zwecken der allgemeinen Glückseligkeit zusammenstimmt, so stimmt er eigentlich mit sich selbst, heißt auch: Wenn er schon mit sich zusammenstimmt, ist er auch fähig, auch mit ihnen zusammenstimmen; und dies besagt wiederum, die Zusammenstimmung desselben mit sich selbst 245 246 Refl. 6621, XIX 114f, κ–λ? (1769–70?). Refl. 679, XV 301, κ–λ (1769–1770). 79 nach allgemeinen Gesetzen stehe im weiteren Zusammenhang mit der Zwecksetzung desselben, dem Ausgerichtetsein auf die wesentlichen Zwecke der allgemeinen Glückseligkeit. Die Zusammenstimmung mit sich selbst und diejenige mit den wesentlichen Zwecken erfolgen zusammen. Der Zusammenhang aber antizipiert in diesem Zitat doch einen vollkommen zweckmäßigen Hintergrund. Beide erwähnten Reflexionen aus der Periode κ–λ (1769–70) zeigen an, daß die Zusammenstimmung mit dem Zweck der allgemeinen sicheren Glückseligkeit diejenige des freien Willens mit sich selbst und mit den Gesetzen der Vernunft fordert. 2.3 Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst und die Moralität. 2.3.1 Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst als Rückgang zum Fundament der Ethik (kognitiv-formalistische Grundlegung). (a) Der Zusammenstimmung mit sich selbst geht der Zwiespalt mit sich selbst voraus. Die Zusammenstimmung der Freiheit (arbitrium liberum) mit sich selbst setzt eine ihr vorausgehende Gegebenheit, die Selbstzerspaltenheit (Zwiespalt mit sich selbst), d.i. Nichtidentifizierbarkeit derselben mit sich selbst, voraus, die sich daraus ergibt, daß die Freiheit als freie Willkür unter dem Prinzip der Selbstliebe durch Bewegursachen der sinnlichen Natur (Antriebe) nur herumgetrieben wird und sich infolgedessen widerstreiten muß. Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst hingegen führt zur Selbstidentität. (b) Die Zusammenstimmung kann nicht aus der sinnlichen Natur zustandegebracht werden. Sinnliche Natur kann der freien Willkür nur zufällige, empirische Bewegursachen und Zwecke geben, die die Willkür mit sich selbst in Widerstreit bringen. „Die empirischen Gründe unserer Wahl haben keine Gewißheit, weil sie keine allgemeine Richtschnur haben und also untereinander Widersprüche geben können.“247 „Die blinde Natur aber hat keine sichere Übereinstimmung.“248 Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst kann demnach nicht aus der sinnlichen Natur, aber auch nicht aus einer gegenständlichen Zweckmäßigkeit derselben deduziert werden (im Gegenteil: Sie entwirft selbst eine eigene Teleologie aus der Freiheit), sondern liegt in der übersinnlichen Natur begründet. 247 248 (247) Refl. 7027, XIX 230, υ? µ? ρ? (1776–78? 1770–71? 1773–75?). Refl. 6913, XIX 204, υ? κ? (1776–78? 1769?). 80 (c) Der Widerstreit mit sich selbst wird durch die empirisch bedingte Vernunft verursacht. Indessen beruht die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst auch nicht auf der empirisch bedingten Vernunft unter dem hypothetischen Imperativ. Da nämlich das humanum arbitrium sensitivum vom arbitrium brutum der Art nach unterschieden ist,249 so entsteht der Widerstreit bei einem endlichen Vernunftwesen, dem es eignet, nicht durch den Instinkt, sondern eben durch die empirisch bedingte Vernunft. „Wir sind durch die Vernunft, wenn sie bloß den Dienst der Sinne versieht, nämlich ihre Forderungen auszuführen, in einen größeren Widerspruch mit uns selbst und mit andern gesetzt als selbst die Tiere, die durch Instinkt regiert werden, der mit den Bedürfnissen derselben einstimmig ist, antatt daß Vernunft sich gewisse Objekte wählt und nicht nach der Summe der Empfindungen, sondern nach dem durch willkürliche Phantasie erhöhten Wahne.“250 Das Zitat will sagen: Die empirische Bedingtheit der Vernunft bringt dem menschlichen Willen im Grunde nicht die Zusammenstimmung, demnach Einheit und Konsistenz, sondern vielmehr durch ihren „Wahn“ einen größeren Widerstreit als bei den Tieren, die durch Instinkt regiert werden, wo man doch von der Vernunft im Gegenteil das Vermögen der Einheit und Allgemeinheit erwartet. Denn Reflexionen der Vernunft bzw. des Verstandes mischen sich dergestalt unter die Triebfedern ein, daß, während „der Instinkt, wo er allein herrscht, Regeln (ebenso auch der Verstand, wenn er allein herrscht) hat, der Verstand aber, der sich selbst nicht Regeln vorschreibt, wenn er den Mangel des Instinkts ausfüllt, alles unregelmäßig macht.“251 Die Regelmäßigkeit ist hier streng gedacht; damit ist beinahe absolute Allgemeinheit und Notwendigkeit gemeint. Die Unregelmäßigkeit hingegen wird aus der von empirischen – der Willkür nie notwendige und konstante Entscheidungskriterien verleihenden – Empfindungen (Lust und Unlust) abhängigen Verwendung der Vernunft252 als des Beurteilungsvermögens der Mittel-Zweck-Verhältnisse unter dem hypothetischen Imperativ, genauer unter den Klugheitsregeln (pragmatische Imprerative) für die sinnliche Glückseligkeit, die auf jenen empirischen Empfindungen Vgl. dazu z.B. Refl. 1029, XV 461 υ? (1776–78?). Cf. 1.2.3.f. Refl. 6958, XIX 213f, υ? (1776–78?). 251 Refl. 6859, XIX 182, ϕ? ψ? (1776–78? 1780–89?). Aus diesem Konzept eines Vorzugs des Instinkts gegenüber der empirisch bedingten Vernunft hinsichtlich der Regelmäßigkeit der Willkürbestimmung in der sinnlichen Natur entwickelt sich bei Kant auch unter dem Einfluß Rousseaus die pessimistische Ansicht über die überwiegend auf dieser Vernunft aufgebaute menschliche Zivilisation, in der nun aber die Reinheit der praktischen Vernunft zurückgeholt und mithin bei jedem Menschen ein Charakter gegründet werden soll, d.h. das Rückgangsmotiv der kognitiv-formalistischen Phase erfordert wird. Vgl. dazu GMS, IV 395f <B4–6>: „... alle Handlungen, die es [sc. das Vernunftwesen] in dieser Absicht [sc. seiner Erhaltung und seines Wohlergehens] auszuüben hat, und die ganze Regel seines Verhaltens würden ihm weit genauer durch Instinkt vorgezeichnet und jener Zweck [würde] weit sicherer dadurch haben erhalten werden können, als es jemals durch Vernunft geschehen kann, ... In der Tat finden wir auch, daß ... eine gewisser Grad von Misologie, d.i. Haß der Vernunft, entspringt,“ etc. Vgl. hierzu auch KpV, V 61f <A107f>. 252 Zur empirisch bedingten praktischen Vernunft als Beurteilungsvermögen für das Verhältnis von Mitteln zu Zwecken vgl. z.B. KpV, V 58 Z31 – 59 Z11 <A103f>(cf. 1.2.4). 249 250 81 beruht und durch die Naturkausalität der sinnlichen Natur zufällig eingebracht werden kann, generiert und macht die Willkürbestimmung nur ungenau, unsicher und mühselig, so daß „ich keinen sicheren Grund habe, auf mich selbst zu rechnen“.253 Der Widerstreit der Freiheit mit sich selbst wird nicht unmittelbar durch sinnliche Empfindungen allein (cf. 3.3.2.a), sondern durch die Einmischung der empirisch bedingten Vernunft in dieselben unter dem Prinzip der Selbstliebe verursacht. Cf. 1.2.4. (d) Die Zusammenstimmung mit sich selbst als Rückgang zum Fundament der Ethik. Von diesem Widerstreit mit sich selbst durch die empirisch bedingte Vernunft ist nun die freie Willkür, mithin auch das menschliche Herz überhaupt, durch Zusammenstimmung mit sich selbst zu befreien, die ihr absolute Selbstidentität und Sicherheit, demnach auch innere Ruhe, verschaffen kann (cf. 1.2.2.d). Im Konzept einer Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst als mit den Gesetzen hält sich von vornherein die Rückgangsproblematik (der Rückgang zum Fundament der Ethik) der kognitiv-formalistischen Phase versteckt. „Das erste, was der Mensch tun muß, ist, daß er die Freiheit unter Gesetze der Einheit bringt; denn ohne dieses ist sein Tun und Lassen lauter Verwirrung.“254 „Der auf kein Objekt eingeschränkte, mithin reine Wille muß [sc. darf] zuerst sich selbst nicht widerstreiten, und die Freiheit als die dynamische Bedingung der intellektuellen Welt und ihres commercii muß Einheit haben.“255 „Die Freiheit nach Prinzipien empirischer Zwecke hat keine durchgängige Einstimmung mit sich selbst; ich kann mir daraus nichts Zuverlässiges in Ansehung meiner selbst vorstellen. Es ist keine Einheit meines Willens. Daher sind restringierende Bedingungen des Gebrauchs derselben absolut notwendig. Moralität aus dem principio der Einheit.“256 Bei dieser Einheit ist von der formalen bzw. „transzendentalen Einheit im Gebrauch der Freiheit“, d.i. der „Identität meines Wollens“ die Rede. Das ,principium der Einheit‘ bedeutet demnach durchgängige Einstimmung mit sich selbst. Die Befreiung vom durch empirische Zwecke verursachten Widerstreit fordert die Zusammenstimmung mit einer intelligiblen Ordnung nach den Gesetzen als den restringierenden Bedingungen. Dadurch geht die Vernunft auf die Unabhängigkeit von empirischen Bestimmungsgründen des Willens zurück. Bei der Zusammenstimmung als Befreiung handelt es sich darum, Gebundenheit zugunsten der Freiheit aufzulösen. „Alle Moralität ist die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst. Z. E. wer da lügt, stimmt nicht mit seiner Freiheit überein, weil er durch die Lüge gebunden ist.“257 Gebunden ist die Freiheit an empirische Bestimmungsgründe der Willkür unter dem Prinzip der Selbstliebe. Die Zusammenstimmung mit sich selbst verRefl. 7202 (Duisburger Fragment 6), XIX 281, ψ (1780–89). Refl. 7202, XIX 280. 255 Refl. 6850, XIX 178, υ (1776–78). 256 Refl. 7204, XIX 284. 257 Met.L/1, XXVIII 249f. 253 254 82 schafft ihr die Unabhängigkeit von ihnen, d.i. den Antrieben. So „muß der freie Wille mit sich selbst in Ansehung der innern und äußern Unabhängigkeit von Antrieben zusammenstimmen.“258 In der Zusammenstimmung mit sich selbst findet demnach der Rückgang zum Fundament der Ethik statt, in dem die freie Willkür und mithin die menschliche Vernunft über die empirische Bedingtheit hinausgehen. Legt nun die Vernunft die empirische Bedingtheit ab, d.h. ist sie vom Prinzip der Selbstliebe unabhängig, so heißt sie reine praktische Vernunft; diese kann die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst zuwegebringen. Der Übergang der praktischen Vernunft vom ihrer empirischen Bedingtheit zu ihrer Reinheit macht den Sinn ihrer „Kritik“ aus (cf. 1.2.4). (e) Der Zusammenstimmung liegt eine intellektuelle Ausdehnung zugrunde, die als ein intelligibles Gefüge aufgefaßt wird. Die Zusammenstimmung von Etwas A(0) mit einem zunächst diesem A(0) fremden Etwas A(1) , welche darauf abzielt, A(0) als mit A(1) ursprünglich identisch herauszustellen, antizipiert als ihre Grundlage eine schon vorgegebene, ihnen gemeinsame, innere Ordnung der Identität, die der Selbstzerspaltenheit von A noch verborgen ist. Diese innere Identitätsordnung aber, die der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst zugrundeliegt und die ihr Beständigkeit und Zuverlässigkeit verheißt, kann, wenn sie nicht aus einem sinnlichen Zusammenhang hergenommen werden kann (cf. 2.3.1.b), nichts anderes sein als eine intellektuelle, dem Zerspaltenen zunächst fremde, aber im Grunde auch ihm zugehörige gemeinsame Ausdehnung, ja eine objektiv-gültige Geisteslage der freien Willkür. Diese intellektuelle Ausdehnung wird allerdings von Kant ohne weiteres als Idee eines intelligiblen Gefüges, einer systematischen Einheit aller Zwecke, aufgefaßt. Auf diese Idee hin kann die reine Vernunft als das Grundvermögen der Einstimmung in der systematischen Einheit der Zwecke, demnach auch als das Vermögen der Einheit und Allgemeinheit in der Praxis, nämlich als „die oberste Kraft“, die „sich selbst“ sowenig „widerstreitet“ wie „im logischen“ Gebrauche,259 allgemeine Gesetze als Bedingungen der Zusammenstimmung mit sich selbst schaffen, da die Freiheit sonst in einer empirischen Ordnung bloß sich selbst widerstreiten müßte, die durch die von der reinen Vernunft zu unterscheidende sinnliche Rezeptivität bedingt ist. (f) Die Zusammenstimmung mit sich selbst ist mit der Gesetzgebung der Vernunft möglich. Die Befreiung vom Widerstreit erfordert die Regelmäßigkeit in der freien Willkür, d.h. die formale Einheit im Gebrauch der Freiheit, welche nur dadurch möglich ist, daß die Vernunft die Freiheit unter Bedingungen stellt, die sie mit sich selbst einstimmig machen. „Freiheit also vom Instinkt erfordert Regelmäßigkeit im praktischen Gebrauch des Verstandes. Wir stellen uns also die Regelmäßigkeit 258 259 Refl. 6961, XIX 215, υ? (1776–78?). Refl. 6853, XIX 179, υ? χ? (1776–78? 1778–79?). 83 und Einheit im Gebrauch unserer Willkür bloß dadurch als möglich vor, daß unser Verstand solche [sc. unsere Willkür] an Bedingungen knüpfe, welche sie mit sich selbst einstimmig machen.“260 „[E]s wird a priori ein Gesetz als notwendig erkannt werden müssen, nach welchem die Freiheit auf die Bedingungen restringiert wird, unter denen der Wille mit sich selbst zusammenstimmt.“261 Dieses Prinzip der Zusammenstimmung mit sich selbst auf die formale Einheit im Gebrauch der Freiheit hin ist „das principium a priori der allgemeinen Einstimmung mit sich selbst“262 . Dabei können die „Gesetze der Einstimmung der Willkür mit sich selbst“ „nur aus der Vernunft kommen“,263 „welche allein praktische Einheit des Willens“, d.i. die formale Einheit im Gebrauch der Freiheit, „nach Prinzipien festsetzen kann.“264 Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst antizipiert also die die Freiheit (die freie Willkür) zur Einheit bringende Gesetzgebung der Vernunft, wobei die Übereinstimmung der Willensbestimmung die Befreiung vom Widerstreit, demnach Sicherheit, Beständigkeit und Zuverlässigkeit verleiht. „Die reine ... Vernunft hat in Ansehung der Freiheit überhaupt gesetzgebende Gewalt“. Es würde daher umgekehrt „ohne Bedingungen der allgemeinen Einstimmung“ des freien Menschen „mit sich selbst in Ansehung seiner selbst und anderer gar kein Gebrauch der Vernunft in Ansehung ihrer [sc. der Freiheit] stattfinden“.265 Das „principium der allgemeinen Einstimmung derselben [sc. der Freiheit] mit sich selbst“ ist kein anderes als das „principium der allgemeinen praktischen Gesetzgebung der reinen Vernunft in Ansehung der Freiheit überhaupt“.266 Die Reinheit der Vernunft, die Gesetze gibt, d.i. ihre Abgesondertheit von allen sinnlichen Triebfedern, fügt sich mit der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst zusammen, und diese Zusammenfügung gelangt zu jener inneren Identitätsordnung, die der Willkür Sicherheit, Beständigkeit und Zuverlässigkeit zuträgt. (Cf. 2.3.2.) (g) Die formale Einheit im Gebrauch der Freiheit. Die so von der reinen Vernunft geformte innere Identitätsordnung, die objektiv zur Idee einer intelligiblen Welt führt, ist subjektiv die formale bzw. transzendentale Einheit im Gebrauch der Freiheit, die „Identität meines Wollens“. Da sie mit Prinzipien a priori (allgemeinen Gesetzen) konstituiert wird, sagt Kant: „Ich kann nur, wenn ich nach Prinzipien a priori handle, immer eben derselbe in der Art meiner Zwecke sein, innerlich und äußerlich. Empirische Bedingungen machen 260 Refl. 6859, XIX 182. „Unsere Willkür“ ist hier als arbitrium liberum mit jener „Freiheit“ im Ausdruck „die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst“ bzw. „die formale Einheit im Gebrauch der Freiheit“ identisch, die nicht transzendental, sondern eben noch praktisch ist. 261 Refl. 7202 (Duisburger Fragment 6), XIX 281, ψ. Vgl. auch den oben zitierten Satz aus Refl. 7204: „Dabei sind restringierende Bedingungen des Gebrauchs derselben absolut notwendig.“ 262 Refl. 7204, XIX 284. 263 Refl. 6859, XIX 182. 264 Refl. 7202, XIX 281. 265 Refl. 6853, XIX 179. 266 Refl. 6864, XIX 184, υ (1776–78). 84 Verschiedenheiten.“267 Nach den allgemeinen Gesetzen stimmt der freie Wille mit sich selbst im Hinblick auf eine formale Einheit zusammen. Aus der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst entsteht die formale bzw. transzendentale Einheit im Gebrauch der Freiheit als die Identiät des reinen Wollens. Die moralische Gesetzlichkeit liegt subjektiv in dieser Selbstidentität der Freiheit. Die intellektuelle Ausdehnung, die dem Aktus der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst zugrundeliegt, stellt sich als diese Identität des Wollens heraus. Von der Vernunft her betrachtet, beruht das Interesse der freien Willkür am Grundaktus der Zusammenstimmung mit sich selbst als mit den Gesetzen auf der Selbsterhaltung der formalen Selbstidentität der reinen Vernunft, die den Widerstreit mit sich selbst ausschließt. (h) Zwei Gedankenzüge der Zusammenstimmung mit sich selbst: die Befreiung von der Gebundenheit und die Willensidentität nach Gesetzen aus Freiheit. Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst hat daher die zweifache Bedeutung: (1) Befreiung von der Gebundenheit an die empirischen Bestimmungsgründe des Willens und an das Prinzip der Selbstliebe, d.i. an das der sinnlichen Glückseligkeit und (2) Zusammenstimmung nach allgemeinen Gesetzen – als Bedingungen einer intelligiblen Welt – auf die formale Einheit hin. In ihr sind der Übergang von der empirischen Bedingtheit zu Freiheit und Gesetzen und zugleich der Übergang von der Freiheit zu Gesetzen und Zwecken in der intelligiblen Ordnung mit impliziert. Zu ihrem Begriff nämlich gehören der Gedankenzug der Befreiung von der Gebundenheit und der Gedankenzug der Genese der Willensidentität nach Gesetzen aus dieser Befreiung zugleich. Beim ersteren aber ist zu beachten: „Die Unabhängigkeit der Freiheit von der Sinnlichkeit setzt eine Abhängigkeit derselben von der allgemeinen Bedingung, mit sich selbst zu stimmen, voraus.“268 Moralisches Gesetz als „das erste Sollen“ (Faktum der Vernunft) ist die Bedingung, unter der sich negative Freiheit (Unabhängigkeit von der Sinnlichkeit) durch die Zusammenstimmung mit sich selbst im zweiten Zug mit ihrer formalen Einheit identifizieren (positive Freiheit) und dadurch mit der Einheit aller Zwecke (der intelligiblen Welt) verknüpfen kann. Bei Kant setzt die negative Freiheit essentiell das Gesetz voraus. Der Kantische Rückgang auf das Fundament der Ethik (kognitiv-formalistische Grundlegung) ist nur möglich, wenn bereits essentiell eine intelligible Ordnung und ihre Gesetze vorausgesetzt sind. In der Zusammenstimmung mit sich selbst findet also ein faktischer Sprung in die intelligible Ordnung und ihre Gesetze statt, der unter dem Aspekt der beiden Gedankenzüge in Betracht gezogen werden kann. 267 Refl. 7204, XIX 283. Cf. das Zitat im Haupttext, auf das sich Fußnote 241 in 2.2.2 bezieht. Die formale Einheit im Gebrauch der Freiheit kann sich in der KpV auf die „Form eines reinen Willens“ in der Vernunft (KpV, V 66 <A116>) beziehen. 268 Refl. 6850, XIX 178. 85 (i) Die Faktizität des moralischen Grundphänomens in den „Reflexionen“. Kant scheint diesen Sprung in die intelligible Ordnung spätestens in der ersten Hälfte der sechziger Jahre vollzogen zu haben. Danach ist ihm im Bereich der praktischen Philosophie nur die Aufgabe geblieben, transzendentale Zusammenhänge zwischen dem Willen und dieser Ordnung, d.h. zwischen Freiheit, Gesetzen und Zwecken, systematisch und architektonisch zu theoretisieren. Er hat sie mit Hilfe eines Begriffs der Vollkommenheit, nämlich desjenigen der Zusammenstimmung mit der Idee eines Grundes, durchgeführt. Das Ergebnis dieses Versuches ist in den späten Veröffentlichungen präsentiert, wobei das Wort Zusammenstimmung wie eine Reminiszenz, aber in der Tat mit der Wichtigkeit einer unscheinbaren Selbstverständlichkeit auftritt. Es ist nun an mehreren Stellen der Reflexionen ersichtlich, daß für Kant das aus Freiheit, Gesetzen (Vernunft) und Zwecken zusammengesetzte Grundphänomen der Moralität, das sich aus jenem Sprung ergibt und das, mit den Worten des späteren Werkes, das Selbstbewußtsein einer reinen praktischen Vernunft ist, wozu Gesetz und positive Freiheit gehören,269 auch schon in den Reflexionen der siebziger und achtziger Jahre Faktum der Ethik war, das nicht weiter hinterfragt werden kann. Z.B. sagt er: „Woher aber dieser Gebrauch des Verstandes“, d.h. der praktische Gebrauch der Vernunft, die Willkür an die Gesetze der Übereinstimmung derselben mit sich selbst (an die moralischen Gesetzen) zu knüpfen, „wirklich werde, ..., ist keine praktische Frage“, d.h. keine Frage für die Praxis, also ein praktisches Faktum. „Genug: Gesetze der Einstimmung der Willkür mit sich selbst, ..., haben allein diese Wirkung“.270 Ohne die Überzeugung von der Faktizität des moralisch-praktischen Gebrauchs der Vernunft aus der Spontaneität derselben hätte auch die Dritte Antinomie der KrV nicht konzipiert werden können. „Daß der Verstand durch objektive Gesetze den Einfluß einer wirkenden Ursache auf Erscheinungen habe, ist das paradoxon, welches Natur (Summe der Erscheinungen) und Freiheit unterschieden macht, indem unsere Handlungen nicht durch Naturursachen (als bloße Erscheinungen) bestimmt sind. Die Selbsttätigkeit des Verstandes ist eine andere Gattung von Ursachen.“271 Oder er sagt auch kurz und knapp: „Das erste Sollen (ursprünglich = absolute oder die allgemeine Idee der Pflicht) ist nicht zu begreifen“,272 d.h. die exekutive Auswirkung der moralischen Gesetzlichkeit auf den menschlichen Willen ist nicht hinterfragbar, sondern Faktum für die Praxis (cf. 1.2.0.c, 1.3). Vgl. dazu z.B. KpV, V 29 Z24–28 <A52>. Cf. 1.3. Refl. 6859, XIX 182. 271 Loc.cit. 272 Refl. 6849, XIX 178, υ (1776–78). 269 270 86 2.3.2 Die Zusammenstimmung mit sich selbst und das principium diiudicationis moralis. Auf die formale, transzendentale Einheit des Willens im Freiheitsgebrauch gründet sich die vom Empirischen nicht bedingte moralische Bonität. Diese kann demnach „nur durch Vernunft erkannt werden und betrifft nur die Form der Freiheit“, d.i. die formale Einheit im Gebrauch der Freiheit, „nämlich ihre durchgängige Zusammenstimmung mit sich selbst“.273 Sie beruht also auf der letzteren, nämlich der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst. Die Bedingungen dieser Zusammenstimmung, d.i. die, unter denen allein die Freiheit mit sich selbst zusammenstimmen kann, bzw. die Bedingungen der allgemeinen Einstimmung derselben mit sich selbst274 – die durch Abstrahieren von aller Neigung übriggelassen werden – sind z.B. wie folgt konkretisiert: „1. daß der Gebrauch derselben mit der Bestimmung seiner eigenen Natur, 2. mit andrer Zwecken, sofern sie im Ganzen harmonieren, 3. mit anderer Freiheit überhaupt unter einer allgemeingültigen Bedingung zusammenstimme.“275 Dementsprechend werden nun bei reiner Vernunft Gesetze angenommen, die solche konkreten Bedingungen der Zusammenstimmung enthalten; sie sind als Gesetze der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst schlechthin „Gesetze der Freiheit überhaupt“, „Bedingungen der Einheit im Gebrauche der Freiheit überhaupt“.276 Diese „Vernunftgesetze“ haben „absolute praktische Notwendigkeit“ („Das Gesetz aber bestimmt unbedingt die Freiheit.“)277 , die ohne jene Grundfunktion der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst nicht bestehen könnte. Solche sind moralische Gesetze. Die Rezeption der moralischen Gesetzlichkeit durch Freiheit und ihre Zusammenstimmung mit sich selbst finden also zusammen statt. Dabei ist die Freiheit durch ihre Zusammenstimmung mit sich selbst „sich selbst ein Gesetz“. „Die Moralität ist die innere Gesetzmäßigkeit der Freiheit, sofern sie nämlich sich selbst ein Gesetz ist.“278 Woher kommt es aber, daß die Freiheit sich selbst ein Gesetz ist? Die Antwort, die zwar in den „Reflexionen“ noch nicht deutlich artikuliert, aber als ein möglicher Gedanke im Begriff vom arbitrium Refl. 1045, XV 468, ψ1−3 ? (1780–88?). Der Terminus „Bedingungen“ der Zusammenstimmung findet sich etwa in Refl. 6853, XIX 179 Z24, Refl. 6859, XIX Z12, Refl. 7202, XIX 281 Z18f, Refl. 7250, XIX 294 Z17f usw. 275 Refl. 7197, XIX 270f, ψ? ρ–σ? ϕ–χ? (1780–89? 1773–77? 1776–1779?). 276 Refl. 7063, XIX 240, ϕ (1776–78): „Gesetze der Freiheit überhaupt sind die, welche die Bedingungen enthalten, unter denen es allein möglich ist, daß sie [sc. die Freiheit] mit sich selbst zusammenstimmt*: Bedingungen der Einheit im Gebrauche der Freiheit überhaupt. Sie sind also Vernunftgesetze und nicht empirisch oder willkürlich, sondern enthalten absolute praktische Notwendigkeit.“ (* Im Original: zusammenstimmen). Vgl. auch Refl. 6767, XIX 155, ξ? κ? η? (1772? 1769? 1764–68?): „Gesetz ist die Einschränkung der Freiheit durch allgemeine Bedingungen der Einstimmung derselben mit sich selbst.“ (Die Reflexion, die E. Adickes spätestens in den Anfang der siebziger Jahre datiert, könnte in die zweite Hälfte derselben Jahre nachverlegt werden.) Vgl. auch Refl. 7250, XIX 294 Z17f, ψ (1780–89). 277 Refl. 7063, XIX 240. 278 Refl. 7197, XIX 270. Vgl. zum Ausdruck „sich selbst ein Gesetz sein“ auch Refl. 6854, XIX 180 Z24. Er kommt aus der Bibel (Röm 2, 14). 273 274 87 liberum verborgen ist, lautet: Aus der negativen Freiheit. Diese stellt sich sodann in der Phase des Aufsteigens aus ihr als reine Spontaneität heraus und vollzieht als solche die Zusammenstimmung mit sich selbst, die somit auf die Zusammenstimmung mit den Gesetzen hinausläuft, d.h. darauf, daß die Freiheit (der freie Wille) sich selbst ein Gesetz sei. Diese Formel der Freiheit, sie sei sich selbst ein Gesetz, bedeutet nun aber in der GMS nichts anderes als die Autonomie des Willens.279 Aus dieser kann auch die Formel des kategorischen Imperativs und das Prinzip der Sittlichkeit abgeleitet werden.280 Das moralische Gesetz basiert also auf der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst, die sich in der Formel, „diese sei sich selbst Gesetz“, artikuliert. In der GMS jedoch geht die Argumentation von der Voraussetzung aus, daß die Freiheit wohl nicht gesetzlos, aber doch als negative unabhängig von der Naturkausalität sei. Diese Unabhängigkeit führt zum Begriff einer Verstandeswelt, d.i. zu einem anderen Standpunkt außer der Sinnenwelt, dessen essentielle Determinierungen aber offen bleiben (cf. 1.4.b, 2.8). Mit der Idee der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst, mit den Gesetzen und mit den Zwecken in den „Reflexionen“ werden aber eben diese Determinierungen, somit der Hintergrund dieser Voraussetzung der Nichtgesetzlosigkeit der Freiheit, erörtert (cf. 3.1.2). Für die Annahme nämlich einer intelligiblen Welt wird die Zusammenstimmung der Freiheit mit wesentlichen Zwecken erfordert, die zum Inbegriff der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst gehört. Moralisches Gesetz kann sich also ohne die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst nicht mit Freiheit verbinden (cf. 2.3.1.f). Die Moralität bzw. Sittlichkeit – die Bonität des guten Willens – beruht daher auf der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst, dem konsistenten Rationalismus der Freiheit, nach dem das Vernunfturteil, sei es Billigung, sei es Mißbilligung, apodiktisch gebildet wird: „Das System [der Sittlichkeit] ist also ein rationales System der mit sich selbst allgemein einstimmigen Freiheit“, die „ohne Regel als allgemeine Befugnis genommen sich selbst“281 widerstreiten würde. Von dieser Verankerung der Moralität in der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst (d.i. in der Formel, die Freiheit sei sich selbst ein Gesetz), die sich auf die formale Einheit im Freiheitsgebrauch gründet, wird, wenn von der intelligiblen Ordnung, worauf die formale Einheit im Freiheitsgebrauch essentiell beruht, abstrahiert und abgesehen wird, der dijudikative282 Maßstab der allgemeinen WiVgl. dazu GMS, IV 447 <B98>: „... Autonomie, d.i. die Eigenschaft des Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein“. 280 Vgl. GMS, IV 447 <B98>: „Der Satz aber: der Wille ist in allen Handlungen sich selbst ein Gesetz, bezeichnet nur das Prinzip, nach keiner anderen Maxime zu handeln, als die sich selbst auch als ein allgemeines Gesetz zum Gegenstande haben kann. Dies ist aber gerade die Formel des kategorischen Imperativs und das Prinzip der Sittlichkeit: also ist ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei.“ 281 Refl. 7217, XIX 288, ψ? ϕ ? (1780–89? 1776–78?). 282 Vgl. zu Dijudikation (Beurteilung) und Exekution (Ausübung) bzw. principium diiudicationis sive executionis Ethik Menzer, S. 44: „VOM OBERSTEN PRINCIPIO DER MORALITAET / Wir haben hier zuerst auf zwei Stück zu sehen: auf das Principium der Dijudikation der Verbindlichkeit 279 88 derspruchslosigkeit bzw. des Nicht-Widerstreitens für die Moralität (cf. 2.3.1.c–f) abgeleitet, der etwa so formuliert wird: „Die Handlung, deren Intention, als allgemeine Regel betrachtet, sich selbst und andrer ihrer notwendig widerstreiten würde, ist moralisch unmöglich.“283 Er ist das logische Konsistenzprinzip der Moralität, das aus der Einheit und Allgemeinheit des reinen sittlichen Denkens besteht. Das dijudikative Moralprinzip des Nicht-Widerstreitens in den „Reflexionen“ tritt auch in den späteren Druckschriften auf. Der GMS zufolge besteht die Bonität des guten Willens im Nicht-Widerstreiten: „Der Wille ist schlechterdings gut, der nicht böse sein, mithin dessen Maxime, wenn sie zu einem allgemeinen Gesetze gemacht wird, sich selbst niemals widerstreiten kann.“284 Der kategorische Imperativ als dijudikatives Prinzip läßt sich aus diesem Prinzip des Nicht-Widerstreitens, oder sagen wir, der ,Widerstreitslosigkeit‘, deduzieren.285 Vor allem kann mit dem letzteren Prinzip vollständig beurteilt werden, ob eine Maxime als engere, unnachlaßliche (vollkommene) Pflicht gilt oder nicht; das Prinzip konstituiert wesentlich die Pflichten dieser Art wie etwa das Suizidverbot286 und die Wahrhaftigkeit287 . und auf das Principium der Exekution oder Leistung der Verbindlichkeit. Richtschnur und Triebfeder ist hier zu unterscheiden. Richtschnur ist das Principium der Dijudikation und Triebfeder der Ausübung der Verbindlichkeit, ... Wenn die Frage ist: was ist sittlich gut oder nicht?, so ist das das Principium der Dijudikation, nach welchem ich die Bonität der Handlung beurteile. Wenn aber die Frage ist: was bewegt mich, diesen Gesetzen gemäß zu leben, so ist das das Principium der Triebfeder. Die Billigkeit der Handlung ist der objektive Grund, aber noch nicht der subjektive Grund“; Refl. 7097, XIX 248, υ? (1776–78?): „Die moralischen Gesetze haben an sich selbst keine vim obligatoriam, sondern enthalten nur die Norm. Sie enthalten die objektiven Bedingungen der Beurteilung, aber nicht die subjektiven der Ausübung. Die letzten bestehen in der Übereinstimmung mit unserem Verlangen zur Glückseligkeit.“ Vgl. auch Refl. 6608 (praktische Philosophie und Dijudikation vs. Exekution), Refl. 6619 (Exekution und Dijudikation mit Bezug auf Epikur und Zeno), Refl. 6628 (principia prima diiudicationis moralis und vis movens), Refl. 6631 (Beurteilung und Triebfeder), Refl. 6717 (principia diiudicandi et imputandi), Refl. 6760 (Das principium der moralischen Dijudikation ist ... Vernunft), Refl. 6864 (1. das principium des moralischen Urteils, 2. der Grund des moralischen Gefühls, 3. die Triebfeder des moralischen Verhaltens), Refl. 6915 (Dijudikation und Exekution), Refl. 6988 (Beurteilung und Ausübung), KrV, III 527 Z18–20 <B840>(Beurteilung nach Ideen und Befolgung nach Maximen). 283 Refl. 6765, XIX 154f, ξ? ϕ? (1772? 1776–78?). Das Prinzip der Zusammenstimmung mit sich selbst im Sinne des Nicht-Widerstreitens wird in den Druckschriften auch für die Unterscheidung des praktischen Gesetzes von der Maxime verwendet. Vgl. dazu KpV, V 19 Z19–23 <A36>. 284 GMS, IV 437 <B81>. 285 Vgl. die eben zitierte Stelle: „Dieses Prinzip [des Nicht-Widerstreitens einer Maxime des guten Willens] ist also auch sein oberstes Gesetz: handle jederzeit nach derjenigen Maxime, deren Allgemeinheit als Gesetzes du zugleich wollen kannst; dieses ist die einzige Bedingung, unter der ein Wille niemals mit sich selbst im Widerstreite sein kann, und ein solcher Imperativ ist kategorisch.“ Vgl. auch Fried. i.d.Ph., VIII 421 Z3. 286 Vgl. GMS, IV 422 <B53f>: „Da sieht man aber bald, daß eine Natur, deren Gesetz es wäre, durch dieselbe Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Beförderung des Lebens anzutreiben, das Leben selbst zu zerstören, ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur bestehen würde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden könne und folglich dem obersten Prinzip aller Pflicht gänzlich widerstreite.“ Die teleologische Interpretation der engeren, unnachlaßlichen Pflichten durch H. J. Paton ist von M. Fleischer korrigiert worden. Vgl. hierzu M. Fleischer, Die Formeln des kategorischen Imperativs in Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, in: Archiv für Geschichte der Philosophie, Bd. 46, 1964, S. 210f. 287 Vgl. GMS, IV 403 <B19>: „... denn nach einem solchen [allgemeinen Gesetz zu lügen] würde 89 Dieser negative Maßstab der Moralität wird auch als das „regulative Prinzip der Freiheit“ bezeichnet; er kann zwar etwa zum Zweck der allgemeinen Glückseligkeit (Menschenliebe) nur regulativ und formal dienen, aber, als regulatives Prinzip, doch für sich alleine die engeren, unnachlaßlichen Pflichten beurteilen und konstituieren. Wenn aber der Maßstab des Nicht-Widerstreitens bzw. der ,Widerstreitslosigkeit‘ sich erweitert und sich mit der Intentionalität auf den Zweck der Glückseligkeit verbindet, so heißt das erweiterte Prinzip der Freiheit „das konstitutive“,288 (das in sich auch das Nicht-Widerstreiten bzw. die ,Widerstreitslosigkeit‘ als regulatives Prinzip enthält,) weil es sich auf die empirische Dimension erstreckt, um darin etwas in bezug auf das Empirische praktisch zu konstituieren. Die Förderung der allgemeinen Glückseligkeit, zu der es sich erweitert, gehört zu den weiteren, verdienstlichen (unvollkommenen) Pflichten. Die Moralität (Gesetze der Freiheit), die durch die Zusammenstimmung der Freiheit als tätigen Prinzips mit sich selbst zustandegebracht wird und somit in der reinen absoluten Gegenwart Selbstzufriedenheit auslösen kann (cf. 2.4.1, 2.6.3, 3.5.1), d.i. das reine Prinzip der allgemeinen Konsistenz a priori für die Dijudikation, gilt in der Aussicht auf die Glückseligkeit nur regulativ. Über das bloße dijudikative Moralitätsprinzip des Nicht-Widerstreitens bzw. der ,Widerstreitslosigkeit‘ hinaus erweitert sich der Problembereich der ,moralisch-teleologischen‘ Exekution: Zwecksetzung des endlichen Willens, Triebfeder, moralisches Gefühl, das höchste Gut und dessen Postulate. Der negative Maßstab des Nicht-Widerstreitens für die Moralität, der die engeren, unnachlaßlichen Pflichten angeht und die bewegende Kraft zur Ausübung derselben hat und der das principium diiudicationis moralis ausmacht, determiniert für sich alleine keinen Zweck; er dient aber als Form aller moralischen Beurteilungen auch denjenigen, die auf Zwecke bezogen sind.289 Die umfassende Bedingung der Beurteilung für die weiteren, verdienstlichen Pflichten, die auf dem notwendigen Bezug des endlichen Willens zu Zwecken beruhen, ist die Zusammenstimmung der Freiheit mit den wesentlichen Zwecken, in die auch die Zusammenstimmung mit den Gesetzen, woraus der Maßstab des Nicht-Widerstreitens als Moralitätsprinzip es eigentlich gar kein Versprechen geben, weil ... meine Maxime, sobald sie zum allgemeinen Gesetze gemacht würde, sich selbst zerstören müsse“; IV 422 <B54f>: „Da sehe ich nun sogleich, daß sie [sc. meine Maxime, im Notfall etwas versprechen zu können, ohne den Vorsatz, es einzuhalten] niemals als allgemeines Naturgesetz gelten und mit sich selbst zusammenstimmen könne, sondern sich notwendig widersprechen müsse“; KpV, V 27 <A49>: „Ich werde sofort gewahr, daß ein solches Prinzip, [daß jedermann ein Depositum ableugnen dürfe, dessen Niederlegung ihm niemand beweisen kann,] als Gesetz, sich selbst vernichten würde“. Vgl. auch Ethik Menzer, S. 53. 288 Refl. 7251, XIX 294, ψ (1780–89): „Das regulative Prinzip der Freiheit: daß sie sich nur nicht widerstreite; das konstitutive: daß sie sich wechselseitig befördere, nämlich den Zweck: die Glückseligkeit.“ Vgl. auch Refl. 7249, XIX 294 Z13–15, ψ (1780–89); Refl. 7202, XIX 279 Z21–25. Vgl. auch KU, V 453 Z8–16 <B429>. Refl. 7049 (XIX 235, υ 1776–78) formuliert beide Prinzipien anders. 289 Vgl. dazu Refl. 6633, XIX 120, κ–λ? (1769–70?): „Die obersten Prinzipien diiudicationis moralis sind zwar rational, aber nur principia formalia. Sie determinieren keinen Zweck, sondern nur die moralische Form jedes Zwecks; daher nach dieser Form in concreto principia prima materialia vorkommen.“ 90 zustandekommt, als ihre erforderliche Bedingung einbezogen ist. Die Beurteilung der Pflichten dieser Art kann erst in der Ausdehnung des logischen Konsistenzprinzips der Moralität, d.i. der Einheit und Allgemeinheit des reinen sittlichen Denkens, auf die Zwecke vollzogen werden. Das bedeutet, daß das dijudikative Moralprinzip des Nicht-Widerstreitens bzw. der ,Widerstreitslosigkeit‘ sich wieder in die intelligible Ordnung als systematische Einheit der Zwecke einfügt, von der aus es zustandegekommen ist, indem von ihr abstrahiert und abgesehen worden ist. Mit dem Prinzip der moralischen Dijudikation können, wenn es auf Zwecke erweitert wird, auch diese Pflichten beurteilt werden, obwohl es dazu nicht hinreicht. Die Triebfeder zur Handlung nun aus diesen Pflichten findet sich somit nicht ausschließlich im logischen Konsistenzprinzip, wie es bei den engeren, unnachlaßlichen Pflichten von Suizidverbot und Wahrhaftigkeit der Fall ist, sondern auch sekundär in den Zwecken (cf. 2.7.2.5). M.a.W.: Der Verstand als logisches Vermögen enthält in sich wohl das rein intellektuelle Prinzip der Konsistenz als allgemeine Form der Moralität, aber an sich gar keinen Zweck der Handlung;290 aus dem bloß-logischen Dijudikationsprinzip des Nicht-Widerstreitens bzw. der ,Widerstreitslosigkeit‘, das sich aus den Reflexionsbegriffen von Einstimmung (Zusammenstimmung) und Widerstreit rekrutiert, will Kant keinen realen Zweck machen.291 Obwohl der Verstand als Vermögen der Beurteilung durch ein solches rein intellektuelles Prinzip, solange es rein bleibt, auch schon eine gewisse bewegende Kraft zur Ausübung der moralischen Handlung hat,292 so ist diese Kraft zur Exekution der weiteren, verdienstlichen Pflichten doch nicht stark genug,293 weil er als menschlicher Verstand endlich ist. Der menschliche endliche Verstand ist zur Ausübung seiner Gesetze (dijudika290 Vgl. Ethik Menzer, S. 53: „Der Verstand enthält auch gar nicht den Zweck der Handlung, sondern die Moralität besteht in der allgemeinen Form des Verstandes (die pur intellektuell ist)“. 291 Vgl. dazu Refl. 6916, XIX 206, υ (1776–78): „Der aus bloßen Reflexionsbegriffen die Sittlichkeit ableiten will, der bringt formas substantiales hervor und macht aus dem Allgemeinen der Zusammenstimmung die Realität des Zwecks.“ Zu den Reflexionsbegriffen gehören auch Einstimmung und Widerstreit. vgl. dazu KrV, III 217 <B320f>, 222 <B328–30>. Cf. 2.2.1. 292 Vgl. Ethik Menzer, S. 54: „Der Verstand nimmt alle Gegenstände auf, die mit dem Gebrauch seiner Regel übereinstimmen, er widersetzt sich aber alledem, was der Regel zuwider ist. Da nun die unsittlichen Handlungen wider die Regel sind, indem sie nicht zur allgemeinen Regel können gemacht werden, so widersetzt sich der Verstand denselben, weil sie wider den Gebrauch seiner Regel laufen, Also steckt doch im Verstande vermöge seiner Natur eine bewegende Kraft“; Refl. 6765, XIX 154f, ξ? ϕ ? (1772? 1776–78?): „Die treibende Kraft des Verstandes beruht darauf, daß er sich an sich selbst allen principiis der Handlungen widersetzt, die den Gebrauch der Regeln unmöglich machen“; Refl. 6920, XIX 207, ϕ (1776–78): „Causae subiective moventes sind elateres. Auch der Verstand hat elateres, die den motivis intellectualibus recht angemessen sein“. Zur Reinheitserfordernis vgl. Refl. 6898, XIX 200, ϕ (1776–78): „Die bewegende Kraft des sittlichen Begriffs liegt in dessen Reinigkeit und Unterscheidung von allen anderen Antrieben. Das ursprünglich intellectuale fällt dadurch nur auf, daß es mit anderen analogischen Bewegungsgründen der Ehre, der Glückseligkeit, der Wechselliebe, der Ruhe des Gemüts verglichen wird und sich in der Vergleichung über alle erhebt“ (Hierzu vgl. auch GMS, IV 411 Anm. <B33f>; KpV, V 156 <A278f>; etc.). 293 Vgl. Ethik Menzer, S. 54: „Wenn ich durch den Verstand urteile, daß die Handlung sittlich gut ist, so fehlt noch sehr viel, daß ich diese Handlung tue, von der ich so geurteilt habe“; S. 55: „Der Verstand hat keine elateres animi, ob er gleich bewegende Kraft und motiva hat“. Vgl. auch KpV, V 120 Z5–10 <A216>. 91 tive Prinzipien) (1) bei beiden Pflichtentypen in seiner notwendigen Bezogenheit zur Sinnlichkeit auf die Kooperation mit dem moralischen Gefühl (elater animi) angewiesen (cf. 2.7.1) und muß sich darüber hinaus (2) bei den weiteren, verdienstlichen Pflichten einen Zweck setzen (cf. 3.1.1.a); für die engeren, unnachlaßlichen Pflichten ist die Zwecksetzung zwar möglich (Selbstzweck), aber er muß es nicht notwendig tun. Bei jenem Pflichtentyp muß sich die Zusammenstimmung mit sich selbst als mit den Gesetzen, die alleine nur dijudikative Moralprinzipien verschaffen kann, mit der Zusammenstimmung mit den Zwecken verbinden. Bei diesem Pflichtentyp muß sich die reine Vernunft nicht außer sich einen Zweck setzen, sie hat ihn bereits in sich als Selbstzweck; hier stellt die Zusammenstimmung mit sich selbst ohne weiteres diejenige mit den Zwecken dar (cf. 3.2.3). Kants Explikation zu Dijudikation und Exekution ist nicht eben durchsichtig, weil er in sie nicht ausdrücklich die Unterscheidung zwichen den Fällen, in denen die Zwecksetzung notwendig ist, und solchen, in denen sie nicht unbedingt notwendig ist, – in beiden Fällen ist allerdings zur Exekution ein moralisches Gefühl unentbehrlich – eingeführt hat. Er stellt sich aber dabei in erster Linie die weiteren, verdienstlichen Pflichten vor, zu deren Exekution das moralische Gefühl und die Zwecksetzung zugleich benötigt werden. Aus der Verflechtung der beiden Bedingungen miteinander ergibt sich die Problematik einer Verlagerung der Triebfeder (cf. 2.7.2). B. Glückseligkeit als Zielvorstellung der Moralität aus Freiheit. 2.4 Drei Arten der Glückseligkeit. Die Gedankengänge über Glückseligkeit in den „Reflexionen“ bilden die konzeptionelle Grundlage für jene Lehre vom höchsten Gut in den späteren ethischen Druckschriften, die den Teil der Theorie der moralisch-praktischen Zwecksetzung des freien Willens ausmacht, und für den Begriff einer moralischen Glückseligkeit beim Wohlverhalten eines Rechtschaffenen in den späten Jahren. 2.4.1 Zusammenstimmung und Selbstzufriedenheit. Jede Zusammenstimmung einer Funktion mit sich selbst in einem Menschen verschafft ihm als Rückkehr zu sich selbst gefühlsmäßig, genauer auf dem Gebiet des Gefühls der Lust und Unlust,294 Zufriedenheit mit sich selbst. Ebenso führt auch 294 Der Begriff einer Zusammenstimmung impliziert sprachlich schon den Bezug auf das Gefühl. Vielleicht bezeugt MS, VI 376 Z13–22 (der Probierstein des Volkslehrers) diesen sprachlichen Bezug. Die Implikation dürfte wohl auch darin verankert sein, daß der Begriff der Zusammenstimmung sich wörtlich auf die Stimmung bezieht. Grimms Wörterbuch liefert folgende Beispiele, in denen das Wort mit dem Gefühl zusammenhängt: „es ist kein schoener musik, dann so der mensch von innen wol zusamen ist gestimpt“ <Seb. Franck, sprüchw. (1545) 1, 54(b)>, „wenn nun die seele in ihr selbst eine grosze zusammenstimmung ... fühlet“ <Leibnitz, dtsche schr. 1, 423>(Grimm, Deutsches 92 bei der Willensbestimmung die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst als Selbstbilligung295 der Vernunft im Grundvermögen des Gefühls der Lust und Unlust Selbstzufriedenheit herbei. Sie ist nun, indem sie auf die formale Einheit im Gebrauch der Freiheit geht, zugleich die Zusammenstimmung derselben mit den Gesetzen. Folglich entspringt auch aus der letzteren Zusammenstimmung die Selbstzufriedenheit. So wird gesagt: Die „Übereinstimmung mit allgemeingültigen Gesetzen der Willkür ist nach der Vernunft ein notwendiger Grund unserer Selbstbilligung und Zufriedenheit mit uns selbst“.296 Die „Selbstzufriedenheit“ als „Hauptstuhl von Zufriedenheit“, „ohne welchen keine Glückseligkeit möglich ist“, muß „in der Freiheit bestehen nach Gesetzen, einer durchgängigen Zusammenstimmung mit sich selbst“.297 Die Einstimmung der Freiheit – demnach die formale Einheit des freien Willens nach den Gesetzen – ergibt im Bereich des Grundvermögens eines Gefühls der Lust und Unlust unmittelbar die Selbstzufriedenheit. Da sie die Moralität ausmacht, ist die Selbstzufriedenheit ein mit der Selbstbilligung der Vernunft eng verbundenes moralisches Gefühl. 2.4.2 Die zweifache Glückseligkeit (Refl. 6907). Der jetzt eingeführte Begriff der Selbstzufriedenheit bezieht sich wesentlich auf die Glückseligkeit: „Glückseligkeit ist eigentlich nicht die größte Summe des Vergnügens, sondern die Lust aus dem Bewußtsein, seiner Selbstmacht zufrieden zu sein“.298 Darüber hinaus aber läßt sich Glückseligkeit auch „zwiefach“ auffassen (Refl. 6907): Einmal entspringt sie aus der Übereinstimmung der Freiheit mit den Gesetzen, sie ist „eine Wirkung der freien Willkür vernünftiger Wesen an sich selbst“;299 zum anderen ist sie die ebengenannte größte Summe des sinnlichen VerWörterbuch, Bd. 32 <Bd. 16>, S. 771f). 295 Zur „Selbstbilligung“ vgl. z.B. den gleich unten zitierten Satz aus Refl. 6892; sowie Refl. 6864, Anm. ****, XIX 185, υ und ϕ (1776–78): „Wie kann Vernunft eine Triebfeder abgeben, da sie sonst jederzeit nur eine Richtschnur ist und die Neigung treibt, der Verstand nur die Mittel vorschreibt? Zusammenstimmung mit sich selbst. Selbstbilligung und Zutrauen.“ „Selbstbilligung und Zutrauen“ sind hier die Zusammenstimmung der freien Willkür mit sich selbst. Die Billigung und Mißbilligung nun, auf der die Selbstbilligung gründet, läßt sich ursprünglich als ein Akt der Vernunft auffassen. Vgl. hierzu z.B. Refl. 7217, Anm. *, XIX 288 ψ? ϕ? (1780–89? 1776–78?): „Diese Mißbilligung ist keine Unruhe, sondern Tadel und geschieht vermittelst des Urteils aus allgemeiner Willkür. Sie geschieht ohne Beziehung auf einen Privat-Endzweck, also bloß durch Vernunft. Hier ist also die Vernunft das principium konstitutiver oder objektiver Grundsätze. Und was nicht mit den Vernunftgrundsätzen der Freiheit zusammenstimmt, ist objektiv (praktisch) unmöglich. Sonst haben Vernunftgrundsätze nur subjektive Gültigkeit. Ursache: weil Freiheit ein Vermögen a priori ist zu handeln.“ Vgl. auch Refl. 6636 und Refl. 6760 (XIX 152 Z6–12). Dies gegen D. Henrichs Interpretationsrichtung, die dem gefühlsmäßigen Dasein des Menschen Gewicht beimißt. Cf. Fußnote 495 in 2.8. 296 Refl. 6892, XIX 195f, υ (1776–78). 297 Refl. 7202 (Duisburg 6), XIX 278, ψ (1780–89). 298 Refl. 7202, XIX 276. 299 Refl. 6907, XIX 202, υ (1776–78). 93 gnügens,300 d.i. „eine zufällige und äußerlich von der Natur abhängende Wirkung“. Die erstere Glückseligkeit ist „die wahre Glückseligkeit“, die durch Handlungen vernünftiger Wesen erreicht werden soll, und „die von allem in der [sinnlichen] Natur unabhängig ist“.301 Mit ihr wird hervorgehoben, daß der Wille selbsttätig Glückseligkeit herbeiführen kann, was auf die „Autokratie der Freiheit in Ansehung aller Glückseligleit“302 hinweist. Diese Glückseligkeit ist es, „die bloß auf dem Willen beruht“, sofern er mit sich selbst (mit den Gesetzen) zusammenstimmt, demnach an sich selbst gut ist. Da die Zusammenstimmung als consensus zu Einem Vollkommenheit darstellt (cf. 1.2.3.c), so muß der Wille, auf dem die wahre, „so große Glückseligkeit“ beruht, moralisch vollkommen sein. Nun ist die Glückseligkeit, die die „Natur“, die sich hier als die ganze verstehen läßt, durch Handlungen der Vernunftwesen nach dem guten selbsttätigen Willen „liefert“, „die eigentliche Glückseligkeit“, „die Glückseligkeit der Verstandeswelt“. Also strebt die menschliche Willkür nach der „Vorstellung der moralischen Vollkommenheit“, d.i. der Idee der Heiligkeit, folglich nach dem „Muster der Vollkommenheit in einer möglichen guten Welt“, indem sie in die Glückseligkeit der Verstandeswelt hinaussieht, die durch den guten selbsttätigen Willen geschaffen werden soll.303 Bei diesem Muster der moralischen Vollkommenheit in einer möglichen guten Welt dürfte es sich um die Idee eines Gott wohlgefälligen Menschen, Jesus Christus, handeln. Die letztere Glückseligkeit hingegen in dieser Reflexion läßt sich so begreifen, daß sie von der sinnlichen Natur abhängig und demnach sinnlich ist und mit den Worten von Refl. 7202 die „Materie der Glückseligkeit“304 darstellt. Beide Arten der Glückseligkeit aber dürften einander nicht unbedingt ausschließen, sondern die erstere könnte womöglich auch inhaltlich entweder die letztere oder einen Ersatz für sie, abgesehen von der Zufälligkeit derselben, als ihre Komponente enthalten. Dabei könnte die Selbstzufriedenheit die formale Bedingung der ersteren sein. Auch dürfte die wahre Glückseligkeit nicht auf meine eigene beschränkt, sondern müßte die „Glückseligkeit des Ganzen“305 sein. Dem Gesagten zufolge haben wir drei Arten der Glückseligkeit: (1) Selbstzufriedenheit, (2) die wahre Glückseligkeit als Glückseligkeit der Verstandeswelt und (3) sinnliche, zufällig bewirkte Glückseligkeit. In der KpV heißt die erste Analogon der Glückseligkeit, die zweite: Glückseligkeit als Element des höchsten Guts; in der Religionsschrift sowie der MS die erste: moralische Glückseligkeit, die dritte: physische Glückseligkeit, bei der zweiten dürfte eine sublimierte Form der letzteren vorliegen.306 In der moralisch-praktischen Zwecksetzung des freien Willens auf das höchste Gut hin in der Dialektik der KpV begleitet ihn die erste (SelbstzuVgl. auch KrV, III 523 <B834>: „Glückseligkeit ist die Befriedigung aller unserer Neigungen“. Refl. 6907, XIX 202. 302 Refl. 6867, XIX 186, υ (1776–78). 303 Refl. 6907. 304 Refl. 7202, XIX 276 Z18. 305 Refl. 6965, XIX 215, υ? (1776–78?). 306 Vgl. zu moralischer und physicher Glückseligkeit Rel., VI 67 <B86>, 75 Anm. <B100>; MS, VI 377, 387. Cf. 3.5. 300 301 94 friedenheit) unmittelbar, während die zweite (Glückseligkeit der Verstandeswelt) als das höchste Gut Zielvorstellung jener Zwecksetzung ist. Die Lehre vom höchsten Gut wird von den Überlegungen über Glückseligkeit in den „Reflexionen“ vorbereitet. 2.4.3 Zwei Gründe des Wohlgefallens (Refl. 7049). Die Differenzierung der Glückseligkeit kann auch hinsichtlich des Wohlgefallens und dessen Grundes vorgenommen werden. In Refl. 7049 werden „zwei Gründe des Wohlgefallens der Handlungen“ genannt: „1. die Übereinstimmung mit dem Objekte der Begierde; 2. die Übereinstimmung der freien Handlungen mit einer Regel des Wohlgefallens überhaupt, d.i. mit einem allgemeingültigen Grunde“.307 Die erste Übereinstimmung löst nur pathologisch-praktische Lust aus; ihre Bestimmungsgründe der Willkür sind bloß „empirisch“308 , und „der Gebrauch der Freiheit stimmt nicht untereinander“. Diese Übereinstimmung soll darum in der kognitivformalistischen Grundlegung als Rückgang zum universalen Bestimmungsgrund des Willens negiert werden. Die zweite Übereinstimmung ist hingegen das Prinzip der Moralität und bringt „das Wohlgefallen an der Regelmäßigkeit in allen unsern Handlungen“309 hervor. Die Unterscheidung der beiden Gründe des Wohlgefallens läuft daher zuletzt darauf hinaus, ob freie Willkür immer noch von sinnlichen Objekten abhängig ist, oder von dieser Abhängigkeit bereits derart befreit ist, daß sie mit den Gesetzen zusammenstimmt. Das Wohlgefallen aus der ersten Übereinstimmung bezieht sich auf die materiale Glückseligkeit bzw. die Materie der Grückseligkeit, dasjenige aus der zweiten ist die Selbstzufriedenheit, die auch die formale Bedingung der wahren Glückseligkeit sein kann. In der späten Periode wird jenes pathologische, dieses moralische Lust genannt.310 Die „Würdigkeit, glücklich zu sein“311 nun, die in dieser Reflexion außer zwei Arten des Wohlgefallens erwähnt wird, beruht offensichtlich auf dem zweiten Grund des Wohlgefallens als dem der Selbstzufriedenheit, nämlich auf der Übereinstimmung der Freiheit mit den Gesetzen. Dies kann darauf hinweisen, daß die Übereinstimmung der Freiheit mit sich selbst als mit den Gesetzen subjektiv Selbstzufriedenheit auslöst, objektiv aber die Würdigkeit, glücklich zu sein, ausmacht. Aus der letzteren ergibt sich, wie in der KpV klar wird, die wahre Glückseligkeit als Element des höchsten Guts. Refl. 7049, XIX 235, υ (1776–78). XIX 235 Z7. 309 XIX 235. 310 Vgl. zur pathologischen und moralischen Lust MS, VI 378, 391; aber auch V.e.vorn.Ton, VIII 395 Anm.; Refl. 7320, XIX 316, ω5 (1800): „Geht in Bestimmung der Willkür die Lust vor dem Gesetz voraus, so ist die Lust pathologisch –. Geht aber in dieser Bestimmung das Gesetz vor der Lust voraus und ein Bestimmungsgrund der letzteren, so ist die Lust moralisch.“ Vgl. hierzu auch Fortschritte, XX 351 Z4f. 311 XIX 235 Z10. 307 308 95 2.4.4 Die Autokratie der Freiheit in Ansehung der Glückseligkeit bzw. die Epigenesis der Glückseligkeit nach allgemeinen Gesetzen der Freiheit (Refl. 6867). Der Freiheit als tätigem Prinzip ist an sich eine Anlage zur Vollkommenheit hinsichtlich der Bonität wesenseigen (cf. 1.5.b);312 nur muß die Vollkommenheit, was den Rückgang in die negative Freiheit betrifft, darauf beruhen, daß die Freiheit „der Neigung nicht unterworfen werde oder überhaupt gar keiner fremden Ursache unterworfen sei“;313 die Vollkommenheit der Freiheit bleibt allein übrig, „wenn die Gegenstände unsrer jetzigen Neigung uns alle gleichgültig werden geworden sein.“314 Kraft dieser Grundanlage aber der Freiheit zur Vollkommenheit konnte ihre Zusammenstimmung mit sich selbst sich ohne weiteres als diejenige mit den Gesetzen herausstellen. Denn die Freiheit ist sich selbst ein Gesetz.315 Sie hat ihre innere Gesetzlichkeit. Demzufolge ist der freie Wille ein schlechthin guter Wille,316 der Wille, der sich wesentlich auf den Begriff von Vollkommenheit bezieht – damit gehen wir aber in die positive Freiheit und die Phase der Deduktion des Gesetzes aus Freiheit über. Die Freiheit ist dabei als reine Willkür (arbitrium purum, liberum intellectuale) „conditio sine qua non“,317 „die Bedingung der Möglichkeit der Handlungen aus allgemeingültigen Prinzipien, folglich des Gebrauchs der Vernunft“, die allein „allgemeine Regeln des Gebrauchs der Freiheit geben“ kann, und zwar „in Ansehung der Zwecke“,318 die sich auf die Glückseligkeit beziehen werden. Die „Vollkommenheit der Freiheit“ nun, die durch die Zusammenstimmung derselben mit allgemeinen Gesetzen zu sich selbst gelangt, ist aber nicht derart omnipotent, daß unter ihr gleich analytisch die wahre Glückseligkeit verstanden werden könnte, sondern eben nur die Würdigkeit, glücklich zu sein,319 d.i. die Moralität, die sich als „das Gute aus Prinzipien der Spontaneität“320 der Freiheit begreifen läßt. Die Freiheit als die Bedingung der Möglichkeit der Moralität ist aber doch eine notwendige Bedingung der Möglichkeit der Glückseligkeit für die 312 (312) Vgl. z.B. Refl. 6605, XIX 106,κ–λ? (1769–70?): „... gleichwie die Vollkommenheit eines Subjekts nicht darauf beruht, daß es glückselig sei, sondern daß sein Zustand der Freiheit subordinert sei: so auch die allgemeingültige Vollkommenheit, daß die Handlungen unter allgemeinen Gesetzen der Freiheit stehen“; Refl. 7210, XIX 286, χ? ϕ? ω? (1778–79? 1776–78? 1790–1804?): „Die größte Vollkommenheit ist die freie Willkür, und daraus kann auch das größte Gut entspringen“. 313 Refl. 6605, XIX 105f. 314 Refl. 7197, XIX 270f, ψ? ρ–σ? ϕ–χ? (1780–89? 1773–77? 1776–1779?). 315 Cf. 2.3.2 und Fußnote 278, 279 und 280. 316 Vgl. Refl. 7063, XIX 240, ϕ (1776–78): „Der freie Wille, der mit sich selbst nach allgemeinen Gesetzen der Freiheit zusammenstimmt, ist ein schlechthin guter Wille.“ 317 Refl. 6948, XIX 211, ϕ (1776–78). Vgl. auch Refl. 7202, XIX 276 Z29. 318 Refl. 6948, XIX 211. 319 Vgl. Refl. 7197, XIX 270f: „Diese Vollkommenheit der Freiheit ist die Bedingung, unter der alles andre, Vollkommenheit und Glückseligkeit, eines vernünftigen Wesens allgemein wohlgefallen muß (Würdigkeit)“; Refl. 7200, XIX 274, ψ? (1780–89?): „Würdigkeit glücklich zu sein. / Prinzipien der Sittlichkeit aus der Einstimmung der Freiheit mit den notwendigen Bedingungen der Glückseligkeit überhaupt, d.i. aus dem allgemeinen selbsttätigen principio der Glückseligkeit.“ Vgl. auch Refl. 6892, XIX 195. 320 Refl. 6820, XIX 172, υ? (1776–78?). 96 freien Vernunftwesen321 und hängt selber nicht umgekehrt dergestalt von ihr als dem Zwecke ab,322 daß man an der Glückseligkeit teleologisch die Triebfeder für Freiheit sehen müßte. „Die Glückseligkeit a priori kann in keinem andern Grunde gesetzt werden als in der Regel der Einstimmung der freien Willkür“,323 und der Gründungszusammenhang ist in umgekehrter Folge nicht möglich. In Refl. 6867 kommt diese Perspektive einer Gründung von Glückseligkeit auf der Einstimmung der freien Willkür als „Autokratie der Freiheit in Ansehung aller Glückseligkeit oder die Epigenesis der Glückseligkeit nach allgemeinen Gesetzen der Freiheit“ zum Ausdruck.324 Der Begriff wird als das „principium der Moral“325 bezeichnet, und zwar ausgezeichneterweise, weil er die ganze Sache, die Kant langjährig in „Reflexionen“, Vorlesungen und Druckschriften über Moralphilosophie durchgedacht hat, deckt und ihr Prinzip mit einem einzigen Ausdruck resümiert. Nun handelt es sich bei der „Autokratie der Freiheit in Ansehung aller Glückseligkeit“, wenn man nur von ihrem Bezug auf die Glückseligkeit absieht, um nichts anderes als die „Autonomie des Willens“ in den beiden Grundlegungsschriften.326 Ein Moralprinzip, das sich auf Glückseligkeit bezieht, muß zwar, wie in den beiden Grundlegungsschriften dargetan wurde, zunächst ohne dieselbe begründet werden. Das erst einmal begründete Moralprinzip, das der Freiheit, muß aber dann ohne weiteres auf Zusammenhänge mit der Glückseligkeit angewendet werden können. Denn es ist doch a limine an ihr orientiert. Dies ist vornehmlich aus den moralphilosophischen Reflexionen ersichtlich. Ihre systematische Untersuchung kann aufweisen, wie eigenwillig und einseitig jene Interpretationsrichtung ist, die die Kantische Lehre über das höchste Gut, die es auf die Glückseligkeit absieht, von der Problematik der Grundlegung der Ethik ausschalten will. Mit der Autokratie der Freiheit in Ansehung aller Glückseligkeit haben wir schlechterdings einen der Ausdrücke für das oberste Prinzip der Moral, d.i. das Prinzip der positiven Freiheit, zu denen noch die Begriffe von Vollkommenheit des Willens, Autonomie des 321 Vgl. z.B. Refl. 7200, XIX 274: „... die Freiheit unangesehen des Zustandes, darin das freie Wesen sich befindet, mithin unabhängig von empirischen Bedingungen (der Antriebe) soll eine notwendige Ursache der Glückseligkeit sein“. Dieser Gedanke, der später die Lehre vom höchsten Gut ausmacht, findet sich auch schon in den sechziger Jahren. Vgl. hierzu Refl. 6589, XIX 97 η? κ? (1764–68? 1769?): „... aber die Bonität besteht in der Beziehung auf den Willen, bis endlich die absolute Bonität in der Übereinstimmung der Glückseligkeit mit dem Willen besteht.“ Er ist das Ergebnis der Betrachtung Kants in den „Bemerkungen“, daß das Gute auf dem Willen beruht. 322 Refl. 7202, XIX 277: „Das [sc. die Einheit a priori, nämlich die Freiheit unter allgemeinen Gesetzen der Willkür, d.i. Moralität] macht die Glückseligkeit als solche möglich und hängt nicht von ihr als dem Zwecke ab“. 323 Refl. 6911, XIX 203f, υ (1776–78). 324 Refl. 6867, XIX 186, υ (1776–78). Das Wort ,Autokratie‘ findet sich in der MS wieder, jedoch nicht in bezug auf die Glückseligkeit. Vgl. hierzu MS, VI 383 Z24. Der Gedanke des Prinzips der Autokratie/Epigenesis ist nicht neu, sondern steht bei Kant schon früher fest. Vgl. z.B. Bemerkungen, XX 31: „Wie die Freiheit im eigentlichen Verstande (die moralische nicht die metaphysische) das oberste principium aller Tugend sei und auch aller Glückseligkeit.“ 325 XIX 186 Z4. 326 Vgl. zur Autonomie des Willens GMS, IV 433 <B74>, 440 <B87>; KpV, V 33 <A58>, 132 <A237>. 97 Willens, „principium libertatis nomotheticae“327 und „Eleutheronomie“328 gezählt werden. Alle Prinzipien müssen zwar ohne die Eudämonie begründet werden – sonst würde eine Euthanasie aller Moral ausgelöst –, implizieren aber die Entwicklungsmöglichkeit auf Glückseligkeitsbezüge, was der Ausdruck des Moralprinzips in dieser Reflexion unverkennbar zeigt. Das Moralprinzip der Autokratie/Epigenesis gehört in den „Reflexionen“ zum Umkreis des Grundprinzips der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst, mit den Gesetzen und mit den Zwecken. Dabei determiniert ,moralisch-teleologisch‘ und exekutiv die Zusammenstimmung mit den Gesetzen primär diejenige mit den Zwecken, und nicht umgekehrt. Nach dem Moralprinzip der Autokratie/Epigenesis ist subjektiv im Gefühl der Lust und Unlust Zufriedenheit mit sich selbst herbeizuführen, objektiv aber dem Handlungssubjekt als Person die Würdigkeit, glücklich zu sein, zu verschaffen; das Prinzip hat also zwei Wirkungen, eine subjektive und eine objektive. Zur letzteren, objektiven Wirkung des Moralprinzips: Aus der „Selbständigkeit und Zusammenstimmung“ der Freiheit entspringt Glückseligkeit. Sie ist „das Selbstgeschöpf der guten oder regelmäßigen Willkür“.329 Die „Würdigkeit glücklich zu sein“ ist „die Übereinstimmung zum höchsten Gute“ durch „die Ergänzung des Vermögens der freien Willkür, sofern sie [sc. die freie Willkür] nach allgemeinen Regeln zur Glückseligkeit im ganzen zusammenstimmt.“330 Mit den Formulierungen ist hauptsächlich gemeint, daß die Würdigkeit, glücklich zu sein, mithin auch Glückseligkeit, sich aus der Zusammenstimmung der Freiheit mit den Gesetzen, die auch diejenige mit dem Zwecke des höchsten Guts ist, (d.i. aus der „Form der Glückseligkeit“) ergibt. Solcher Glückseligkeit nun, die auf dem durch „einen absoluten Bestand“ ausgezeichneten „Wohlverhalten“, d.i. „Gebrauch der Freiheit“ nach Gesetzen beruht, wird „die zufällige Glückseligkeit“, der als „Naturoder Glücksgabe“ kein selbständiger „Wert“ beizulegen ist und die offenkundig mit der obengenannten sinnlichen, zufällig gewirkten Glückseligkeit identifiziert wird, auch in dieser Reflexion selbstverständlich entgegengesetzt. Es läßt sich daher vermuten, daß auch die aus der Autokratie der Freiheit nachgenerierte Glückseligkeit als „die wahre Glückseligkeit“ in die „Glückseligkeit der Verstandeswelt“331 (Glückseligkeit als Element des höchsten Guts) münden wird. So wird ihr denn auch neben dem guten Gebrauch der Freiheit vorausgesetzt, „daß ursprünglich ein freier Wille, der allgemeingültig ist, die Ursache der Ordnung der Natur und aller Schicksale sei“, was deutlich auf das Postulat der Existenz Gottes verweist. Zur ersteren, subjektiven Wirkung des Moralprinzips: „Das moralische Gefühl Refl. 7269, XIX 299 Z11f, ψ? υ? (1780–89? 1776–78?); vgl. auch KU, V 448 Z8 <B420>. MS, VI 378 Z16. 329 Zum „Selbstgeschöpf“ vgl. Refl. 6864, XIX 184 Anm. *** (cf. Fußnote 333). 330 Zur gleichartigen Erläuterung der „Würdigkeit glücklich zu sein“ vgl. z.B. Refl. 7200 (cf. Fußnote 319). Das Wort „Ergänzung“ nun ist hier noch zweideutig. Es kann entweder die Selbstergänzung des Vermögens der freien Willkür oder die Ergänzung derselben durch eine oberste Weltursache bedeuten. 331 Vgl. Refl. 6907. 327 328 98 geht hier auf die Einheit des Grundes und den Selbstbesitz der Quellen der Glückseligkeit in vernünftigen Geschöpfen“, d.h., es bezieht sich wesentlich auf das Moralprinzip der Autokratie/Epigenesis, das endliche Vernunftwesen als Quelle der Glückseligkeit in sich selbst besitzen. Da der „gute Gebrauch der Freiheit“ nach den Gesetzen, das Wohlverhalten, durch den die Glückseligkeit herbeizuführen ist, einen absoluten Bestand hat und demnach „mehr wert als die zufällige Glückseligkeit“ ist, und da die Freiheit selbst „einen notwendigen innern Wert“ hat, d.h. kurzum weil der Sichwohlverhaltende „in sich (soviel an ihm ist) das principium der epigenesis der Glückseligkeit“ hat,332 so wird gesagt: „Daher besitzt der Tugendhafte in sich selbst die Glückseligkeit (in receptivitate), so schlimm auch die Umstände sein mögen.“ Die „Glückseligkeit (in receptivitate)“ läßt sich im Kontext nicht als die vom guten Gebrauch der Freiheit als Selbstgeschöpf des Willens aktiv hervorzubringende Glückseligkeit, sondern als die Selbstzufriedenheit des durch den beständigen Gebrauch der wertvollen Freiheit und die feste Aussicht auf die Glückseligkeit (denn diese ist das Selbstgeschöpf des Willens) psychologisch gesicherten Willens des endlichen Vernunftwesens (ein real gegenwärtiges moralisches Gefühl desselben) begreifen,333 welche in der KpV „Analogon der Glückseligkeit, welches das Bewußtsein der Tugend notwendig begleiten muß“ genannt wird.334 So kann der Ausdruck „so schlimm auch die Umstände sein mögen“ an das Wort „alle Leiden und Übel des Lebens überhaupt“ in der Religionsschrift erinnern, das mit der „Zufriedenheit“ bzw. der „moralischen Glückseligkeit“ in Zusammenhang steht.335 Also bringt das Moralprinzip der Freiheit nicht die zufällige Glückseligkeit, sondern objektiv die wahre Glückseligkeit und subjektiv die Selbstzufriedenheit. 2.5 Selbstzufriedenheit, intellektuelle Lust und geistiges Leben. 2.5.1 Die Selbstzufriedenheit ist eine intellektuelle Lust. Die Selbstzufriedenheit, die aus der Zusammenstimmung der Freiheit mit den Gesetzen hervorgerufen wird, ist ein intellektuelles Wohlgefallen bzw. eine intellek332 Der Satz (XIX 186 Z21f) läßt sich dahingehend verstehen, daß die Glückseligkeit in receptivitate als moralisches Gefühl im Moralprinzip der Autokratie/Epigenesis fundiert ist, nach dem die Freiheit zu gebrauchen absoluten Bestand hat. Der Ausdruck „soviel an ihm ist“ läßt sich so deuten, daß er sich ohne Rücksicht darauf, ob andere ebenso wie er tun, nach seinen inneren moralischen Gesetzen recht verhält (vgl. hierzu beispielsweise Refl. 7204, XIX 283 Z14–17, ψ? υ? ϕ? 1780–89? 1776–78?). 333 Vgl. dazu, daß der Grund des moralischen Gefühls das Moralprinzip der Autokratie/Epigenesis ist, auch Refl. 6864, XIX 184 Anm. ***, υ (1776–78): „Die Epigenesis der Glückseligkeit (Selbstgeschöpf) aus der Freiheit, die durch die Bedingungen der Allgemeingültigkeit eingeschränkt wird, ist der Grund des moralischen Gefühls.“ Vgl. aber auch Refl. 7204, den 2. Absatz. 334 KpV, V 117, <A211f>. Das ,welches‘ ist ein Verbesserungsvorschlag von J. Kopper. Vgl. Kant, I. [Hrsg. von J. Kopper], Kritik der praktischen Vernunft (Reclam-Ausgabe), Stuttgart o.J., ND: 1976, S. 188. 335 Vgl. Rel., VI 75 Anm. <B100>. 99 tuelle Lust im Unterschied zur pathologisch-praktischen und kontemplativen Lust (cf. 1.2.1.b). Das soll hier zunächst nur vorläufig erläutert werden. (1) Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst als mit den Gesetzen ruft ein notwendiges Wohlgefallen hervor. M.a.W.: Die „Gesetze, welche die Freiheit der Wahl“, nämlich das arbitrium liberum (die freie Willkür), „mit sich selbst in Einstimmung bringen, enthalten ... den Grund eines notwendigen Wohlgefallens“,336 d.i. des Wohlgefallens am Guten. Bei diesem Wohlgefallen aber, das von der Zusammenstimmung der freien Willkür mit sich selbst ausgelöst wird, handelt es sich hier (Refl. 7202) um die Selbstzufriedenheit, bei der nicht von der Lust am Zustand seiner selbst, sondern von der „Lust an sich selbst“337 die Rede ist. (2) Nun ist aber dieses Wohlgefallen intellektuell: „Das Wohlgefallen an der Regelmäßigkeit der Freiheit ist intellektuell.“338 Denn die Regelmäßigkeit der Freiheit besteht in deren Gesetzen, die in der Vernunft verankert und demnach von nicht sinnlicher, sondern intellektueller Herkunft sind. (3) Zusammengefaßt also „korrespondiert“ der „Übereinstimmung der Freiheit mit sich selbst nach allgemeinen Gesetzen“, die nicht bloß relativ, sondern absolut gut ist, die „complacentia intellectualis pura“,339 mit der das reine intellektuelle Wohlgefallen, die intellektuelle Lust, gemeint ist und in der man eben die Selbstzufriedenheit zu sehen hat. (4) Von daher läßt sich die Selbstzufriedenheit zunächst so auffassen, daß sie ein Wohlgefallen ist, das durch die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst dem ihm vorhergehenden Gesetz derselben folgt und demnach eine intellektuelle Lust ist.340 Sie wird dementsprechend in der späten Periode als „moralische Lust“341 bezeichnet, indem sie ihre Relevanz als formale Bedingung der wahren Glückseligkeit abschwächt. Ebensowie die Selbstzufriedenheit ist auch die Achtung (reverentia) ein moralisches Gefühl. Beim moralischen Gefühl ist negativ in bezug auf die Glückseligkeit von der ersteren, positiv aber hinsichtlich der Triebfeder von der letzteren die Refl. 7202, XIX 276. Vgl. auch Refl. 7022, XIX 229, υ? µ–ρ? (1776–78? 1770–75?). Refl. 6116, XVIII 460, ψ2−3 (1783–88). Vgl. auch Refl. 6632, XIX 120, κ–λ? (1769–70?). 338 Refl. 6881, XIX 190, ϕ? (1776–78?). Vgl. zum „intellektuellen Wohlgefallen“ auch Refl. 3860, XVII 316, η? (1764–68?): „Weil alles, was geschieht, nach Gesetzen des Begehrungsvermögens ein Wohlgefallen voraussetzt, so muß die complacentia, welche independent ist von der subjektiven Nezessitation, intellektuell sein“. 339 Refl. 1044, XV 467, ψ1−2 (1780–84) (cf. Fußnote 128 in 1.2.3). Vgl. auch Refl. 7022. 340 Vgl. dazu Bohatec, J., Die Religionsphilosophie Kants in der „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“, Hamburg 1938, S. 141: „Das Gefühl der Selbstzufriedenheit ist daher im Grunde ein intellektuelles Gefühl, die ,Lust der Form nach‘, also dasjenige, was Kant sonst ,intellektuelle Lust‘ nennt.“ Vgl. zur „intellektuellen Lust“ auch Met.L/1, XXVIII 253: „Die intellektuelle Lust ist, was allgemein gefällt, aber nicht nach den allgemeinen Gesetzen der Sinnlichkeit, sondern nach den allgemeinen Gesetzen des Verstandes. Der Gegenstand der intellektuellen Lust ist gut. ... Das Gute ist unabhängig von der Art, wie der Gegenstand den Sinnen erscheint; es muß so genommen werden, wie es an und für sich selbst ist; z.E. die Wahrhaftigkeit.“ Der Terminus, der, obwohl er an sich eine contradictio in adiecto ist, doch in der früheren Periode von der Wolffschen Psychologie erzwungen scheint, tritt in beiden Grundlegungsschriften (GMS und KpV) in den Hintergrund, wird aber auf der späten Periode im System der Ethik als Metaphysik der Sitten, wobei das Grundlegungsmotiv sich zurückzieht und der ursprüngliche Wolffsche Einfluß wieder offenbar wird, rehabilitiert. Vgl. hierzu MS, VI 212. 341 Zur „moralischen Lust“ cf. Fußnote 310 in 2.4.3. 336 337 100 Rede. Der Begriff der Achtung ist wohl bereits früh konzipiert worden,342 übernimmt jedoch die bedeutende systematische Rolle als gefühlsmäßiges Medium der moralischen Triebfeder erst in der Periode der beiden Grundlegungsschriften,343 und zwar erst nachdem die Notwendigkeit der Unterscheidung der Triebfeder als „Macht der Vernunft in Ansehung der Freiheit“ von dem negativen moralischen Gefühl, worunter die Zufriedenheit mit sich selbst als bloßes Wohlgefallen verstanden wird, spätestens in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre erblickt worden ist.344 Dementsprechend tritt die Selbstzufriedenheit als Bestimmungsbedingung der Willkür eher zurück und spielt im System der Grundlegung der Ethik, weil sie als bloße Folge der Befolgung der Gesetze im Gefühl determiniert wird, eine wohl subjektiv-fundamentale Rolle als Gefühl der Einheit ohne Widerstreit, das dem sich wohlverhaltenden endlichen Vernunftwesen jeweils real gegenwärtig ist, aber gegenüber der Vormacht der Triebfeder der Vernunftgesetze eine passive Nebenrolle als Analogon der Glückseligkeit. 2.5.2 Beständigkeit und Sicherheit zum Wohlgefallen im Gefühl eines endlichen Vernunftwesens. Was in der Gesetzgebung der reinen praktischen Vernunft, d.i. in deren reiner Spontaneität, die den Begriff einer Allgemeinheit abgibt, dem Gefühl der Lust und Unlust intellektuell gefällt, ist Regelmäßigkeit, Ordnung, Form, und das, was Beständigkeit und Sicherheit hervorruft. „Das Wohlgefallen an der Regelmäßigkeit der Freiheit ist intellektuell.“345 „Das Wohlgefallen an der Regelmäßigkeit ist eigentlich ein Wohlgefallen an dem Grunde der Beständigkeit und Sicherheit“.346 „Daß diese Betrachtung des Wohlgefallens a priori oder im allgemeinen den VorVgl. z.B. Refl. 6601, XIX 104, κ–λ? (1769–70?): „Alles, was an sich selbst gut ist, achten wir hoch; was respective auf uns gut ist, lieben wir. Beides sind Empfindungen. Jene ist vorzüglich in der Idee der Billigung, diese ist mehr ein Grund der Neigung. ... Wir haben einen größeren Trieb, geachtet als geliebt zu werden, – aber einen größeren zur Liebe gegen andere als zur Achtung. Denn in der Liebe gegen andere empfindet er seinen eignen Vorzug, in der Achtung vor andere schränkt er diesen ein.“ 343 Vgl. dazu Henrich, D., Ethik der Autonomie, in: ders., Selbstverhältnisse, Stuttgart 1982, S. 34: „Kant hat zwar zu früherer Zeit schon gelehrt, daß die Freiheit unerkennbar ist, und auch gelegentlich von dem sittlichen Phänomen ,Achtung‘ gesprochen. Jene Lehre und dieser Begriff wurden aber erst zu Grundlagen seiner Ethik, als er die Versuche einer Deduktion des Sittengesetzes aufgab und als er daraus, daß sie gescheitert waren, maßgebliche Konsequenzen für den Aufbau der Ethik zog.“ Hierbei aber handelt es sich auch um die Revidierung und Ergänzung seines früheren Satzes: „Es mag verwunderlich erscheinen, daß dieser Begriff [der ,Achtung fürs Gesetz‘], der für Kants Ethik ebenso wie für seine Persönlichkeit ursprünglich charakteristisch scheint, das späteste Ergebnis seiner philosophischen Entwicklung war“ (ders., Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, in: Prauss, G., Kant, Köln 1973, S. 249). 344 Vgl. dazu Refl. 6864, XIX 184, υ (1776–78). Cf. 2.6.4. 345 Refl. 6881, XIX 190, ϕ? (1776–78?). 346 Refl. 5620, XVIII 258f, χ? (1778–79?). Vgl. auch Refl. 6710, XIX 138, ξ–ρ? (1772–75?): „Wir halten alles hoch, was dem Guten Sicherheit und bestimmte Gewißheit verschafft, daher alles, was einer Regel des Guten gemäß ist. Das Gute, welches aber die Regel unsicher macht, mißfällt. Dies ist der Quell der Moralität. Man ist des Guten nur wert, sofern man den Regeln folgt.“ 342 101 zug hat, beruht darauf, weil das principium der Ordnung und Form wesentlich notwendig ist und vorhergeht, ohne welches unter meinen Privatvergnügen, imgleichen denen mit anderer ihren, kein Zusammenhang ist. Das Regulativ geht vorher, und nichts muß [sc. darf] ihm widerstreiten; sonst ist unter dem Mannigfaltigen kein Zusammenhang, keine Sicherheit. Es ist alles tumultuarisch.“347 Das Wohlgefallen an diesen intelligiblen Eigenschaften, das intellektuell und frei ist,348 hängt mit dem Interesse am Prinzip a priori der Zusammenstimmung (Übereinstimmng, Einstimmung) der Freiheit mit sich selbst349 zusammen, das in der Zuverlässigkeit der formalen Einheit des Wollens liegt,350 die in der systematischen Einheit aller Zwecke beheimatet ist.351 347 Refl. 7029, XIX 230, υ? µ? ρ? (1776–78? 1770–71? 1773–75?). Auf die Redewendungen in der zitierten Reflexion könnte sich jene Kritik Adornos „Angst vor Anarchie“ beziehen. „Kant, wie die Idealisten nach ihm, kann Freiheit ohne Zwang nicht ertragen; ihm schon bereitet ihre unverbogene Konzeption jene Angst vor der Anarchie, die später dem bürgerlichen Bewußtsein die Liquidation seiner eigenen Freiheit empfahl“ (Adorno, Th. W.; Negative Dialektik, 3. Aufl., Frankfurt/M. 1982, S. 231). „Noch Freiheit konstruiert er als Spezialfall von Kausalität. Ihm geht es um die ,beständigen Gesetze‘. Sein bürgerlich verzagter Abscheu vor Anarchie ist nicht geringer als sein bürgerlich selbstbewußter Widerwille gegen Bevormundung“ (ibid., S. 248). Allein Regelmäßigkeit und Ordnung, die auf der positiven Freiheit beruhen, entspringen nicht aus der Angst vor Anarchie. Positive Freiheit gilt als Wiederübernahme der Verantwortung in der Gesellschaft. 348 Refl. 6881, XIX 191. 349 Vgl. dazu etwa Refl. 1044, XV 467. 350 Vgl. Refl. 7204 Anm. *, XIX 284. Cf. 2.3.1.g. 351 Die Zusammenstimmung der Freiheit mit den Gesetzen liefert dem Gefühl der Lust und Unlust solche intellektuelle Eigenschaften wie Ordnung, Form, Beständigkeit, Sicherheit usw. als Bedingungen des Wohlgefallens a priori, der intellektuellen Lust. (Der Sachverhalt darf nicht dahingehend verstanden werden, daß die Freiheit mit den Gesetzen zusammenstimmen müsse, damit das Wohlgefallen a priori an diesen Eigenschaften entstehen und bleiben könne. Gesetz soll dem Gefühl vorhergehen, welches nie Zweck der Annahme des Gesetzes sein kann.) Die Eigenschaften lassen sich nicht in empirischen Gegenständen der Sinnenwelt antreffen, weil sonst die Willkürbestimmung aus ihnen als stimuli unter Verwaltung der empirisch bedingten Vernunft mittels der pathologischpraktischer Lust und Unlust nur mit Widerstreit, d.i. ohne Einstimmung und Harmonie vollzogen würde. Sie müssen daher im Gegenteil in der formalen Einheit der transzendentalen Subjektivität, der reinen Spontaneität, liegen, und demnach zuletzt in der Verstandeswelt. / Bei diesen Eigenschaften nun, die intellektuell sind, hat man mit so etwas wie Abbildern nichts zu tun, die etwa dadurch in der Gedankenwelt zustandegebracht werden, daß empirische Regelmäßigkeit und Ordnung, die aus zur Sinnenwelt gehörenden, sinnlichen Gegenständen zusammengesetzt werden, durch den Wunsch nach ihrer Erhaltung und Erweiterung, auf die Gedankenwelt projiziert werden. / Der Grund, warum sie nicht derartige Abbilder sind, ließe sich erst aus jener Darlegung der zweiten Grundlegungsschrift für die Ethik, der KpV, explizieren, deren Inhalt auch beim früheren Kant – so können wir annehmen – immer latent vorausgesetzt ist, die aber erst durch den Versuch der systematischen transzendentalen Grundlegung der Ethik in den Vordergrund getreten ist, nämlich aus der Darlegung jenes Rückgangs in die negative Freiheit (Rückführung auf dieselbe), aufgrund deren allein auch die ,moralisch-teleologische‘ Architektonik und mithin die Einräumung der obigen intellektuellen Eigenschaften als hintergründige Bedingungen des Spielraums der menschlichen Willkür möglich sind. / D.h.: Die Freiheitskausalität, die diese Eigenschaften formt, ist die Kausalität, die sich einmal von sinnlichen Gegenständen vollständig distanziert hat (eine Abstrahierung, bei der aber von einer induktiven Abstraktion keine Rede ist), um sich dann erneut, diesmal aber aus einer völlig anderen Position her, von deren Welt, die keine Abschattung der Sinnenwelt ist, theoretische Vernunft mittels ihrer Verstandessynthesis nichts weiß, auf dieselben richten zu können; für menschliche Willkür kann im Bewußtsein positive Freiheit sich erst dann auf sinnliche Gegenstände auswirken, wenn der Rück- 102 2.5.3 Exkurs: Geistiges Leben und intellektuelle Lust. Zu diesem Thema hat Kant selber seine Gedanken nie zusammenfassend formuliert, sondern in Reflexionen, Vorlesungen und Druckschriften lediglich sporadisch notiert. Hier wird nur versucht, sie einmal zusammenzustellen. Die Zusammenstellung beabsichtigt, der eher abstrakten Grundlegung der Ethik eine breite anthropologische Perspektive zu geben und sie damit zu ergänzen. Die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst entfaltet sich zu derjenigen mit den Gesetzen, die die Möglichkeit der Übereinstimmung mit dem Ganzen, die wahre Glückseligkeit herbeizuschaffen, in der Hoffnung involviert. Das tätige Subjekt, das mit den allgemeinen Gesetzen zusammenstimmen soll, ist die Freiheit bzw. die freie Willkür, deren Wesen in der reinen Spontaneität der Vernunft fundiert ist. Die Möglichkeit der Erlangung des Ganzen liegt beim Menschen als einem endlichen Vernunftwesen in dieser Freiheit als Selbsttätigkeit, weil diese durch ihre Zusammenstimmung mit den Gesetzen auch mit dem Ganzen übereinzustimmen hoffen kann, was etwa das Moralprinzip einer Autokratie der Freiheit ausdrückt. Nun gründet das Leben, auf das doch alles zuletzt ankommt,352 zwar primär und prinzipiell auf dem Begehrungsvermögen,353 ist aber auch subjektiv, d.h. zunächst und unmittelbar, mit dem Gefühl der Lust und Unlust eng verbunden.354 Leben ist im Gefühl der Lust und Unlust unmittelbar beheimatet. Da dieses nun im inwendigen Sinn (sensus interior) sitzt,355 so ist auch jenes subjektiv auf denselben bezogen. Das Leben, das durch Freiheit und Vernunft, oder mit einem Wort durch reine Spontaneität, geführt wird, ist das geistige Leben.356 Die Vernunft kann in ihm, wie gang einmal in die negative Freiheit hinausgelaufen ist, wo empirische Bedingungen abgeschnitten sind. Eben darum sind die intellektuelle Regelmäßigkeit und Ordnung als Woran des Wohlgefallens a priori nicht in den sinnlichen Gegenständen verwurzelt. Sie lassen sich als derivative Konzepte des moralischen Gesetzes (der Einheit des reinen Denkens im Sittlichen) erst dann annehmen, wenn reine praktische Vernunft von dem Nichts des Empirischen, d.i. von der Unabhängigkeit von materialen Bestimmungsgründen der Willkür als stimulis, ausgehend sich wieder auf das Empirische richtet. Sie sind folglich keine Abbilder desselben durch die Projektion aus der Sinnenwelt her. / Sie beziehen sich nun auf die Selbsterhaltung der Vernunft. Auf dieses Problem aber ist hier nicht einzugehen (cf. 3.2.3.a.β, 3.4.1.d). 352 Vgl. Refl. 6862, XIX 183. 353 Vgl. KpV, V 9 Anm. <A16>: „Leben ist das Vermögen eines Wesens, nach Gesetzen des Begehrungsvermögens zu handeln. Das Begehrungsvermögen ist das Vermögen desselben, durch seine Vorstellungen Ursache von der Wirklichkeit der Gegenstände dieser Vorstellungen zu sein.“ Vgl. auch MAN, IV 544; MS, VI 211. 354 Vgl. z.B. Refl. 4857, XVIII 11, υ? (1776–78?): „Lust und Unlust machen allein das Absolute aus, weil sie das Leben selbst sind.“ Vgl. auch Met.L/1, XXVIII 247. 355 Vgl. Anthr., VII 153. Cf. Fußnote 86 in 1.2.1.c. 356 Vgl. z.B. Fried. i.d.Ph., VIII 417: „Vermittelst der Vernunft ist der Seele des Menschen ein Geist (Mens, νους) beigegeben, damit er nicht ein bloß dem Mechanismus der Natur und ihren technischpraktischen, sondern auch ein der Spontaneität der Freiheit und ihren moralisch-praktischen Gesetzen angemessenes Leben führe“; Met.L/1, XXVIII 249: „die Freiheit ist der größte Grad der Tätigkeit und des Lebens. Das tierische Leben hat keine Spontaneität.“ Zur Dreiteilung des Lebens vgl. zunächst Met.L/1, XXVIII 248; Refl. 567, XV 246; Refl. 823, XV 367. Das Wort „Geist“ indessen hat 103 oben festgestellt, durch die Zusammenstimmung als Moralitätsprinzip auch auf das Erreichen des Ganzen als der wahren Glückseligkeit hoffen. Ohne ein geistiges Leben wären die Menschen so etwas wie die Figuren eines Marionettenspiels im bloßen Mechanismus.357 Nun müßte ebenso wie das Leben im allgemeinen auch das geistige Leben per definitionem zunächst und unmittelbar auf den inwendigen Sinn bezogen sein.358 Das Wesentliche des geistigen Lebens aber besteht in der „Spontaneität der Freiheit“,359 die als Begehrungsvermögen sein inneres Prinzip ausmacht und die demnach darauf geht, mit moralischen Gesetzen zusammenzustimmen. Der Wert des Lebens liegt daher gar nicht in dem, „was man genießt“, sondern in dem, „was man tut“, und zwar „so unabhängig von der Natur zweckmäßig“, „daß selbst die Existenz der Natur nur unter dieser Bedingung Zweck sein kann“,360 weil das Ganze, dessen Erlangung durch Freiheit man erhofft, nicht die sinnliche mechanische Natur sein kann (ein solches Ganze wäre ohnehin prinzipiell nicht erreichbar), sondern nach einer Idee als die Einheit aller Zwecke anzusprechen ist. Die intellektuelle Lust kommt aus dem, was man tut. „In Ansehung unsrer Selbst haben wir eine sinnliche Lust in Ansehung dessen, was wir leiden, und eine intellektuelle in Ansehung dessen, was wir (aber nicht um einer Neigung willen) tun“.361 Sie kommt folglich dem geistigen Leben zu. Das Wohlgefallen und Mißfallen überhaupt als Gefühl der Lust und Unlust ist nun das Gefühl der Beförderung oder Behinderung des Lebens.362 Auch Vergnügen und Schmerz, wobei es sich um die vom Empirischen abhängige, pathologischpraktische Lust und Unlust handelt, als welche das Gefühl noch nicht dem moralischen Gesetz entspricht und darum auch nicht die kognitiv-formalistische Grundlegung als Rückführung auf die Freiheit absolviert hat, sind als Unterarten des Wohlgefallens und Mißfallens im allgemeinen, das Gefühl der Beförderung oder Behinderung des Lebens.363 Das Leben nämlich beschränkt sich nicht auf Vergnügen und Schmerz, die empirischen Dingen anhaften; ebenso wie sie kann die intellektuelle Lust (Wohlgefallen a priori), die durch die geistige Lebensführung auch bei Kant weitgehende Bedeutung. Vgl. hierzu beispielsweise Refl. 817, 819, 831, 841, 844 etc. 357 Vgl. dazu KpV, V 147 <A265>. 358 Vgl. z.B. Refl. 6865. „Was das Gefühl betrifft (...), so fühlen wir ... nur durch die Sinne“. Das Prinzip des Sitzes des Gefühls der Lust und Unlust im inwendigen Sinne scheint im Grunde epikureisch. Vgl. hierzu beispielsweise Refl. 823, XV 367, υ?: „Epikur sagt: Alles Vergnügen kommt nur durch Mitwirkung vom Körper, ob es zwar seine erste Ursache im Geiste hat.“ Vgl. auch KpV, V 24 Z15–25 <A43f>. 359 Fried. i.d.Ph., VIII 417. 360 KU, V 434 Anm. <B395f>(cf. 3.3.1.c). Vgl. auch Anthr., VII 239: „... daß das Leben überhaupt, was den Genuß desselben betrifft, der von Glücksumständen abhängt, gar keinen eigenen Wert und nur, was den Gebrauch desselben anlangt, zu welchen Zwecken es gerichtet ist, einen Wert habe, ...“. Vgl. hierzu auch VII 144. Auch die Welt ist nur dann gut, wenn sie von vernünftigen Wesen gebraucht wird. Vgl. dazu Refl. 6908, XIX 203, υ (1776–78). 361 Refl. 6974, XIX 218, υ? (1776–78?). 362 Vgl. Refl. 823, XV 367, υ?: „Das Gefühl also von der Beförderung oder Hindernis des Lebens ist Wohlgefallen und Mißfallen.“ 363 Vgl. Anthr., VII 231. 104 ausgelöst wird,364 auch zum Gefühl der Beförderung des Lebens gezählt werden. Sie sitzt auch im inwendigen Sinn, obgleich sie aus der Vernunft, demnach aus einem anderen Standpunkt, entsteht.365 Die Zusammenstimmung der Freiheit (als des tätigen Fundaments) mit sich selbst, mithin mit den Gesetzen, bildet das geistige Leben und befördert es; diese Beförderung bringt im inwendigen Sinne das Wohlgefallen a priori als intellektuelle Lust hervor. Die intellektuelle Lust wird durch jene Zusammenstimmung der Freiheit bzw. der freien Willkür mit den Gesetzen als Bedingung des geistigen Lebens hervorgerufen, welche die Möglichkeit der Erreichung des Ganzen in der Hoffnung voraussieht. „Je einstimmiger mit sich selbst, je einstimmiger mit fremden Willen seiner Natur nach die Willkür ist, je mehr sie ein Grund ist, andrer Willkür mit unsrer zu vereinigen: desto mehr stimmt es mit den allgemeinen Prinzipien des Lebens, desto weniger Hindernis auch, desto größerer Einfluß auf die Verhältnisse und freie Willkür anderer.“366 Solche Einstimmigkeiten der Willkür mit dem Ganzen, die das vollständige Leben formen, es dadurch befördern und somit Wohlgefallen a priori auslösen,367 haben die Zusammenstimmung derselben mit den allgemeinen Gesetzen nötig. Und diese Allgemeinheit der Gesetze in der Zusammenstimmung garantiert der Freiheit bzw. der freien Willkür, die, indem sie das tätige Subjekt der Zusammenstimmung sowie das Begehrungsvermögen als inneres Prinzip des Lebens ist, den Ursprung des geistigen Lebens darstellt,368 intellektuelle Lust. So wird gesagt: „Freiheit ist das ursprüngliche Leben und in ihrem Zusammenhang die Bedingung der Übereinstimmung alles Lebens; daher das, was das Gefühl allgemeinen Lebens befördert, oder das Gefühl von der Beförderung des allgemeinen Lebens eine Lust verursacht. Fühlen wir uns aber wohl im allgemeinen Leben? Die Allgemeinheit macht, daß alle unsere Gefühle zusammenstimmen, obzwar für diese Allgemeinheit keine besondere Art von Empfindung ist. Es ist die Form des consensus.“369 Unter Berücksichtigung des gesamten Zusammenhangs ließe sich 364 Vgl. Met.L/1, XXVIII 249f: „Fühle ich nun, daß etwas mit dem höchsten Grade der Freiheit, also mit dem geistigen Leben übereinstimmt; so gefällt es mir. Diese Lust ist die intellektuelle Lust. Man hat bei ihr ein Wohlgefallen, ohne daß es vergnügt.“ 365 Vgl. Refl. 6865, XIX 185, υ. 366 Refl. 567, XV 246, υ (1776–78). Vgl. auch Refl. 824, XV 368, υ? (1776–78?): „Das Gefühl des geistigen Lebens geht auf Verstand und Freiheit, da man in sich selbst die Gründe der Erkenntnis und der Wahl hat. Alles, was damit zusammenstimmt, heißt gut. Dies Urteil ist unabhängig von der Privatbeschaffenheit des Subjekts. Es geht auf die Möglichkeit der Sachen durch uns und besteht in der Allgemeingültigkeit für jede Willkür; denn sonst ist eine andre widerstreitende Willkür die größte Hindernis des Lebens.“ 367 Vgl. Met.L/1, XXVIII, 250: „Was aber mit der Freiheit zusammenstimmt; das stimmt mit dem ganzen Leben überein. Was aber mit dem ganzen Leben übereinstimmt, das gefällt“ (cf. Fußnote 207 in 1.5). 368 Vgl. auch Refl. 823, XV 367, υ? (1776–78?): „Intellektuelle Wesen sind also foci und niemals bloße Mittel. Der Wert des Wohlgefallens und Mißfallens beziehen sich auf mögliche Wahl, d.i. auf Willkür, folglich auf das principium des Lebens.“ 369 Refl. 6862, XIX 183, ϕ? ψ? (1776–78?, 1780–89?). Diese Allgemeinheit läßt sich selbstverständlich auch als Regelmäßigkeit aus Vernunft begreifen, die das Gefühl der Lust und Unlust einflößt: „Es ist nur ein Prinzip des Lebens und also nur ein principium des Gefühls von Lust und Unlust, dieses [sc. das Gefühl von Lust und Unlust] kann nun auch durch die Vernunft (durch Regelmäßig- 105 daraus entnehmen: Drei Faktoren in der Moralitätsformel der Zusammenstimmung der Freiheit mit den allgemeinen Gesetzen: Freiheit, Zusammenstimmung (consensus) und Allgemeinheit der Gesetze seien alle Bedingungen der Beförderung des geistigen Lebens und generierten demnach zusammen das Wohlgefallen a priori an ihm, mithin die intellektuelle Lust, wobei der erste Faktor das tätige Fundament bzw. die ursprüngliche Bedingung, der zweite das in Zusammenhänge bringende Medium bzw. die formale Bedingung, der dritte die Regel bzw. die materiale Bedingung der Beförderung des geistigen Lebens mit Wohlgefallen bilde. Da Selbstzufriedenheit eine intellektuelle Lust ist, könnte sie sich auch auf ihre oben mit Bezug aufs geistige Leben dargestellten Charakteristiken beziehen. So besteht denn auch das geistige Leben gefühlsmäßig in der moralischen Glückseligkeit als Zufriedenheit mit sich selbst, dementsprechend auch mit dem, was man tut, und nicht was man genießt, und trachtet in ihr nach der wahren Glückseligkeit. C. Die relative Gewichtsverlagerung bei der moralischen Triebfeder. 2.6 Ist die Selbstzufriedenheit als moralische Triebfeder tauglich? 2.6.1 Selbstzufriedenheit erhebt die Seele (Refl. 6892). In der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Kantischen Grundlegung der Ethik läßt sich Sittlichkeit, die subjektive Konfiguration der moralischen Gesetzlichkeit, in der Aussicht auf wesentliche Zwecke endlicher Vernunftwesen, Glückseligkeit, thematisieren. Sie kann aber von der letzteren als Zwecken nicht abhängen, sondern diese muß umgekehrt aufgrund jener in irgendeiner Weise hervorgebracht werden. Daß es unmöglich ist, von sinnlicher, zufälliger Glückseligkeit ausgehend moralische Willensentscheidungen und Handlungen zu gestalten, ist in der kognitiv-formalistischen Phase der Grundlegung hinreichend nachgewiesen worden. Daher sagt Refl. 6892 zuerst: „Der Begriff der Sittlichkeit besteht in der Würdigkeit glücklich zu sein“, welche aber „auf der Übereinstimmung mit den Gesetzen“ „beruht“.370 Für die ,moralisch-teleologische‘ Phase der Grundlegung der Ethik gelten fundamental die Gleichungen: Sittlichkeit gleich Zusammenstimmung mit den Gesetzen gleich Würdigkeit glücklich zu sein. Die Sittlichkeit, die Zusammenstimmung mit den Gesetzen der freien Willkür, ist die Zusammenstimmung der freien Willkür mit sich selbst; bei ihr ist es demnach um die Selbstbilligung der freien Willkür zu tun, deren Aktussubjekt in der keit oder Regellosigkeit der Freiheit) rege gemacht werden“ (Refl. 6871, XIX 187, υ? ϕ?). Vgl. zur Zusammenfassung Refl. 6870, XIX 187, υ? ϕ? (1776–78?): „Gefühl ist die Empfindung des Lebens. Der vollständige Gebrauch des Lebens ist Freiheit. Die formale Bedingung der Freiheit als eines mit dem Leben durchgängig einstimmigen Gebrauchs ist Regelmäßigkeit.“ 370 Refl. 6892, XIX 195, υ (1776–78). 106 Willkür aber Vernunft ist, und sie löst demzufolge als solche im Gefühl der Lust und Unlust als Empfänglichkeit des Gemüts Zufriedenheit mit sich selbst (moralische Lust) aus, ungeachtet, daß andere sich auch nicht sittlich, d.i. nicht mit den Gesetzen übereinstimmend, verhalten mögen. Dementsprechend heißt es in dieser Reflexion: „Diese Übereinstimmung mit allgemeingültigen Gesetzen der Willkür ist nach der Vernunft ein notwendiger Grund unserer Selbstbilligung und Zufriedenheit mit uns selbst, was auch andre tun mögen.“371 (Cf. 2.4.1.) Nun besteht hinsichtlich des inneren Beifalls, nämlich der Selbstbilligung, „der größte Bewegungsgrund der Vernunft, unabhängig von Sinnen die Glückseligkeit zu einem Produkt der Spontaneität zu machen“, was auch immer in äußeren Verhältnissen geschehen mag; m.a.W., bei ihm kann es sich um das größte Motiv zur moralischen Nezessitation handeln, nach der das Prinzip der Autokratie der Freiheit sive der Epigenesis der Glückseligkeit ausgeführt wird. Denn 1. kann er „ein hinreichender Bewegungsgrund, uns zu nezessitieren“ sein, wenn wir „viel Vergnügen der Sinne oder Stillungen ihrer Bedürfnisse“ entbehren können, um glücklich zu sein, und 2. wird uns diese Entbehrlichkeit tatsächlich durch die Selbstzufriedenheit, die aus der Zusammenstimmung mit den Gesetzen im Gefühl der Lust und Unlust entsteht, eingeräumt, indem diese positiv „die Seele erhebt und sie wegen vieler sinnlichen Belustigungen ... schadlos hält“.372 Somit scheint in dieser Reflexion eine positive Funktion der Selbstzufriedenheit (eines moralischen Gefühls) einmal als Triebfeder (elater) zur moralischen Handlung im Ausblick auf die wahre Glückseligkeit festgestellt zu sein, was nun dem Umstand nicht widerspricht, daß sie auch einmal experimentell als die formale Bedingung aller notwendigen Glückseligkeit erwogen wird (Refl. 7202). Die Selbstzufriedenheit, die die formale Einheit der freien Willkür nach der Zusammenstimmung mit den Gesetzen gefühlsmäßig ausdrückt, kann möglicherweise als die exekutive Grundbedingung für die Ausführbarkeit des Prinzips der Epigenesis der Glückseligkeit aus der Autokratie der Freiheit fungieren; ihre Wirkung als Erhebung der Seele kann dahingehend verstanden werden, daß sie sich als Triebfeder (elater) zur Exekution des Moralprinzips zur Verfügung stellen kann. Allein, näher gesehen, Kant sagt nirgends in dieser Reflexion, die Selbstzufriedenheit sei die Triebfeder zur Befolgung der Gesetze bzw. zu moralischen Handlungen. Er erwähnt lediglich, beim inneren Beifall bestehe der größte Bewegungsgrund der Vernunft, unabhängig von den Sinnen die wahre Glückseligkeit durch die Freiheit hervorzubringen, weil die Selbstzufriedenheit durch ihre Erhebung der Seele diese wegen vieler sinnlicher Belustigungen schadlos hält. Der innere Beifall bezieht sich unmittelbar auf die moralische Dijudikation und kann demnach unmittelbar nach dem Gesetz als Bewegungsgrund zur moralischen Handlung fungieren, während die Selbstzufriedenheit in dieser Reflexion nur dazu dient, Bedürfnisse der Sinne zu kompensieren. Nun bleibt zwar immerhin in den „Reflexionen“ zu dieser Zeit noch die Möglichkeit bestehen, daß die 371 XIX 195f. XIX 196. Vgl. dazu auch Refl. 7202, XIX 278 Z18–20: „das Vermögen auch ohne LebensAnnehmlichkeiten zufrieden zu sein und glücklich zu machen“; Refl. 7204, XIX 283 ψ? υ? ϕ? (1780– 89? 1776–78?): „Die Selbstzufriedenheit der Vernunft vergilt auch die Verluste der Sinne.“ 372 107 Erhebung der Seele durch Selbstzufriedenheit sich zur Triebfeder entfaltet. Später wird jedoch mit dem Auftreten des Gefühls der Achtung als des zentralen moralischen Gefühls, das direkt aus dem Gesetz entspringt, auch diese Erhebung im Gefühl, wofür in Refl. 6892 die Selbstzufriedenheit zuständig ist, in das Gefühl der Achtung versetzt,373 welches dadurch die Rolle der Triebfeder übernimmt, und die Selbstzufriedenheit zieht sich dadurch auf eine passive Rolle zurück. Ihre Untauglichkeit als moralische Triebfeder hat ihren Grund, dem unten noch nachgegangen werden wird. Da nun jener innere Beifall, obzwar er der größte Bewegungsgrund ist, für die Realisierung des Prinzips der Autokratie/Epigenesis nicht zulänglich ist, um „ohne Einstimmung des Schicksals glücklich zu werden“, so „gibt die Idee von der Möglichkeit eines heiligen und gütigen Wesens ... das Komplement“,374 d.h. es ist notwendig, als Komplement der Autokratie der Freiheit in bezug auf die Glückseligkeit und mithin auch des Bewegungsgrunds eines inneren Beifalls (einschließlich der Selbstzufriedenheit) zur Hervorbringung der wahren Glückseligkeit das Dasein Gottes zu postulieren. 2.6.2 Die Selbstzufriedenheit als Hauptstuhl für Glückseligkeit (Refl. 7202). Eine Grundlegung der Ethik muß sich mit dem Begriff der Glückseligkeit befassen, die Kantische aber operiert, wie oben dargelegt, mit deren drei Arten: (1) die sinnliche, zufällig gewirkte, (2) die wahre Glückseligkeit (die Glückseligkeit der Verstandeswelt), die durch das Prinzip der Autokratie/Epigenesis hervorgebracht werden soll, die aber in diesem Leben nicht realisierbar scheint, und (3) die reale Selbstzufriedenheit im jetzigen moralischen Lebenswandel. Die erste wird aber von der Kantischen Ethik ausgeschlossen, so daß in ihr nur die beiden letzteren, insbesondere aber der Zusammenhang zwischen ihnen, in Frage kommen. Da beide je in der Einstimmung der Freiheit (der freien Willkür) mit sich selbst als mit den Gesetzen fundiert sind, so muß hier nach Zusammenhängen zwischen diesen drei Begriffen, d.i. der wahren Glückseligkeit, der Selbstzufriedenheit und der formalen Einheit der freien Willkür nach den Gesetzen (Moralität), gefragt werden. Die Erörterungen von Refl. 7202 drehen sich vor allem um den Zusammenhang zwischen den beiden letzteren. Es steht bei Kant zur Zeit dieser Reflexion bereits fest, daß die Moralität, die Zusammenstimmung der Freiheit mit den Gesetzen, die wahre Glückseligkeit hervorbringen muß (das Prinzip der Autokratie/Epigenesis). Der Gedanke, daß die Zufriedenheit mit sich selbst, die aus dieser Zusammenstimmung hervorgeht, das strukturelle Fundament aller wahren Glückseligkeit ausmachen muß (Selbstzufriedenheit als „Hauptstuhl“), erscheint ihm auch sicher und wird in dieser Reflexion ebenfalls festgelegt. In was für eine Weise und in welVgl. dazu KpV, V 80 <A143>: „Dagegen aber, da dieser Zwang bloß durch Gesetzgebung der eigenen Vernunft ausgeübt wird, enthält es [sc. das Gefühl, das aus dem Bewußtsein der Nötigung entspringt] auch Erhebung“. 374 Refl. 6892, XIX 196. 373 108 chem Ausmaß sie es aber sein kann, hängt davon ab, wie nahe und in was für einer Zusammenfügung sie zu der formalen Einheit der freien Willkür steht, die aus jener Zusammenstimmung derselben mit den Gesetzen formiert wird. Die Kantische Analyse der Reflexion bewegt sich im Grunde um diese Nähe und Zusammenfügung. Durch sie stellt sich zwar heraus, daß die Selbstzufriedenheit das aller Glückseligkeit strukturell gemeinsame Fundament, deren Empfänglichkeit, sein kann, jedoch weder, daß sie Ursache der Hervorbringung der Glückseligkeit sei, noch, daß sie der Bewegungsgrund zur moralischen Willkürbestimmung oder der exekutive Grund zur Befolgung der Gesetze sei.375 Refl. 7202 (Duisburg 6),376 worin man einen Gipfel der Reflexionen Kants über Moralphilosophie zu sehen hat, setzt sich aus zwei Teilen zusammen.377 Der erste Teil thematisiert jene Zusammenhänge zwischen Einstimmung der Freiheit mit den Gesetzen (Moralität), Selbstzufriedenheit und wahrer Glückseligkeit, der zweite stellt eine summarische Überlegung Kants über die Grundlegung der Moralität überhaupt sowohl in ihrer kognitiv-formalistischen als auch ,moralisch-teleologischen‘ Phase, allerdings ohne die Umwendungsphase, dar, in die auch das Ergebnis der Analyse des ersten Teils eingegliedert wird.378 Unser Interesse liegt jetzt nur im ersten Teil. Wie es mit ihm bestellt ist, das versuchen wir nun intensiv zu analysieren, weil Kants Gedankenstränge hier, große Möglichkeiten austragend, ziemlich verschlungen sind.379 Erst dadurch können wir zu einem sicheren Ergebnis kom375 Dies gegen die Interpretation von L. W. Beck über Refl. 7202. Mit „Mißbilligung“ und „innerem Abscheu“ (Refl. 7202, XIX 280 Z31f), die in dieser Reflexion zu einem anderen Kontext gehören, wird an dieser Stelle sicher nicht eine Unzufriedenheit mit sich selbst gemeint. Vgl. dazu Beck, L. W., A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, Chicago 1960, S. 215f. Der Satz „The inner applaus is a sufficient motiv“ ist der Selbstzufriedenheit in dieser Reflexion fremd. Refl. 6892 würde zu seiner Interpretationsabsicht zwar besser passen, ist aber leider von Adickes in die Phase υ (1776–78) datiert.) 376 Refl. 7202, XIX 276–282, ψ (1780–89). Beck datiert diese Reflexion zu Recht in die Zeit zwischen 1781 und 1784. Vgl. dazu Beck, L.W., op.cit., S. 11 (cf. Fußnote 401). P. Menzer glaubt, „daß das Fragment vor der Kritik der reinen Vernunft anzusetzen ist“. Vgl. dazu: derselbe, Der Entwicklungsgang der Kantischen Ethik in den Jahren 1760–1785, Zweiter Abschnitt, in: Kant-Studien, Bd. 3, 1899, S. 70f. Auch die Datierungen der anderen Interpretatoren bis zu ihm faßt er an dieser Stelle zusammen. 377 Der eine bezieht sich nach der Akademie-Ausgabe auf XIX 276 Z5 – 279 Z25 und S. 280 Z17–26, wobei die letztere, gesondert abgedruckte und in einen anderen Kontext eingeschobene kurze Stelle, ein gleichzeitiger Zusatz Kants auf dem Blattrand des Manuskripts, schlechterdings das Schlußergebnis der Analyse des ganzen ersten Teils darstellt („Der Lehrbegriff der Moralität aus dem Prinzip der reinen Willkür. / Dies ist das Prinzip der Selbstzufriedenheit a priori als der formalen Bedingung aller Glückseligkeit (pararell mit der Apperzeption)“, XIX 280 Z17–20), und der andere Teil auf XIX 279 Z26 – 280 Z16 und S. 280 Z27 – 282 Z20; dieser ist ohne jenen Einschub des Schlußergebnisses des ersten Teils durchgehend zu verstehen. Auch K. Schmidt analysiert das Fragment durch die Zweiteilung desselben. Vgl. ders., Beiträge zur Entwicklung der Kant’schen Ethik, Marburg 1900, S. 96–105. Damit warnt er davor, „daß, wo man bei Kant Auseinandersetzungen über das Verhältnis der Moralgesetze zur Glückseligkeit findet, man sofort bereit sei, ihn zu einem individualistischen Eudämonisten zu stempeln“ (S. 96f) und kritisiert beide eudämonistischen Interpretationen des Fragments von Fr. W. Förster (cf. Fußnote 379) und H. Höffding (S. 95). Ihm zufolge soll schon H. Cohen beide Teile desselben getrennt von einander abgehandelt haben. 378 Vgl. Refl. 7202, XIX 281 Z28–33. 379 Zu Refl. 7202 gibt Fr. W. Förster als einer der Pioniere ausführliche Erläuterungen. Vgl. dazu 109 men. (a) Die zwei Arten der Glückseligkeit: Glückseligkeit der Annehmlichkeiten und Glückseligkeit aus Freiheit. „Seinen Zustand angenehm zu finden, beruht auf dem Glück“, und so können „die Annehmlichkeiten dieses Zustandes“ „als Glückseligkeit“ betrachtet werden, und man kann sich über sie erfreuen.380 Da aber diese Glückseligkeit in der Befriedigung von Bedürfnissen der Sinne gründet, so ist sie weder gewiß noch allgemein und kann niemals befriedigt werden. Denn ihre inneren Bedingungen, die Bedürfnisse der Sinne, sind variabel; „sie steigen immer in der Forderung“. Sie ist aber auch deshalb zufällig und unsicher, weil sie äußerlich empirisch durch Veränderlichkeit des Glücks und Zufälligkeit günstiger Umstände bestimmt wird, und weil außerdem das Leben kurz ist.381 Sie bezieht sich demnach auf die oben genannte sinnliche, zufällig gewirkte Glückseligkeit. M.a.W.: Das „Wohlgefallen an Dingen, die unsere Sinne rühren“, auf dem die sinnliche, zufällige Glückseligkeit von Annehmlichkeiten beruht, ist „nicht im Objekte“ (das dürfte heißen, nicht in der objektiven Ordnung wie etwa einer intelligiblen Welt), sondern „in der individuellen oder auch spezifischen Beschaffenheit unseres Subjekts“ verankert und demnach „nicht notwendig und allgemeingültig“.382 Diese Glückseligkeit wird für das Handlungssubjekt nur empirisch, demnach nur passiv und leidend hervorgebracht und ist daher niemals gewiß. Auf sie kann nicht Wert gelegt werden. Die Ableugnung der sinnlichen, von außen zufällig gewirkten Glückseligkeit wird damit kognitiv-formalistisch durch den Rekurs auf die Unsicherheit und Zufälligkeit der empirischen Abläufe der Sinnenwelt, die sowohl innerliche als auch äußerliche Bedingungen derselben ausmachen, vollzogen. Zum Vergleich mit den späteren Schriften: Diese Art der Glückseligkeit besteht, genauer besehen, nicht unmittelbar in den „Sinnen“, sondern in dem in der „Anthropologie“ erwähnten „inwendigen Sinn“ (sensus interior), in dem das Gefühl der Lust und Unlust sitzt. Dieses tritt nun in dieser Reflexion als das Wohlgefallen an den die Sinne rührenden Dingen auf, bei dem, weil es durch empirische Bestimmungsgründe der Willkür bzw. deren Vorstellungen ausgelöst wird, nur von der pathologisch-praktischen Lust und Unlust in der KpV und KU bzw. von dem Wohlgefallen am Angenehmen im Unterschied zu demjenigen am Schönen und am Foerster, Fr. W., Der Entwicklungsgang der Kantischen Ethik bis zur Kritik der reinen Vernunft, Berlin 1893, S. 39–75. Auch J. Bohatec gibt ihr einen Kommentar, der ihren äußeren Zusammenhängen mit anderen Reflexionen sowie den Einflüssen einiger Autoren auf sie nachgeht, ohne jedoch zugleich ihre innere Struktur genau zu rekonstruieren. Vgl. dazu Bohatec, J., Die Religionsphilosophie Kants ..., S. 132–146. P. Menzers Erläuterungen zu der Reflexion finden sich in: Menzer, P., op.cit., S. 70–76. Neulich hat M. Forschner das Fragment in der Absicht der Rekonstruktion von Relexionen der siebziger und achtziger Jahre behandelt. Vgl. ders., Moralität und Glückseligkeit in Kants Reflexionen, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 42, 1988. 380 Refl. 7202, XIX 277 Z12f. 381 XIX 277 Z17–23. Vgl. dazu auch KpV, V 118 <A212f>. 382 Refl. 7202, XIX 276 Z5–10. 110 an sich Guten in der KU die Rede ist. In dieser Art der Glückseligkeit, die das Ideal der Einbildungskraft in der GMS ist, ist das Glückseligkeitsprinzip der KpV, das mit dem Prinzip der Selbstliebe identifiziert wird, beheimatet. Der eben dargestellten Glückseligkeit von Lebensannehmlichkeiten, die nur sinnlich ist und zufällig bewirkt wird, wird nun aber von Kant eine andere Art der Glückseligkeit, die „reine Glückseligkeit“,383 oder, mit dem Ausdruck von Refl. 6907, die wahre Glückseligkeit, entgegengesetzt, um die es in Refl. 7202 eigentlich geht. Sie „muß von einem Grunde a priori, den die Vernunft billigt, herkommen“384 und „besteht eben im Wohlbefinden, sofern es nicht äußerlich zufällig ist, auch nicht empirisch abhängend, sondern auf unsrer eignen Wahl beruht“, welche spontan (selbsttätig) „bestimmen“ muß und „nicht von der Naturbestimmung abhängen“ darf. Mit solcher freien Wahl, aus der dem Gesagten zufolge das intellektuelle Wohlbefinden, folglich auch die wahre Glückseligkeit entspringen soll, ist die Wahlfreiheit unter den Gesetzen, das arbitrium liberum intellectuale (cf. 1.2.3.f), gemeint, welches hier auch „die wohlgeordnete Freiheit“ genannt wird.385 Diese reine bzw. wahre Glückseligkeit ist die Idee der Vernunft, die dem Ideal der Einbildungskraft entgegenzustellen ist, als das in der GMS Glückseligkeit bezeichnet wird. Daher wird auch gesagt: „Die [reine bzw. wahre] Glückseligkeit ist nicht etwas Empfundenes sondern Gedachtes. Es ist auch kein Gedanke, der aus der Erfahrung genommen werden kann, sondern der sie allererst möglich macht.“386 Sie ist die Idee eines „vollständigen Guts“,387 das zum höchsten Gut zu zählen ist. Dem Gesagten zufolge wäre sie auch als Glückseligkeit der Verstandeswelt zu erachten. Gleichwohl ist ihre „Materie“ „sinnlich“ und dürfte demnach womöglich inhaltlich mit der sinnlichen zufälligen Glückseligkeit gleichzusetzen sein, während ihre „Form“ „intellektuell“ ist und in der Freiheit unter Gesetzen a priori besteht.388 Kurzum, nachdem die sinnliche, zufällige Glückseligkeit oben kognitiv-formalistisch zurückgewiesen worden ist, wird eine andere Art der Glückseligkeit ,moralisch-teleologisch‘ und architektonisch im Ausblick auf das höchste Gut (Endzweck) als Vernunftidee wieder wahrgenommen; sie involviert aber somit wieder sinnliche Materie. (b) Die äußerliche Argumentation zur Freiheit unter allgemeinen Gesetzen als der notwendigen Bedingung der Möglichkeit der Glückseligkeit. Die durch die Vernunft belehrte Gesinnung oder die freie Willkür unter allgemeinen Gesetzen, die sich aller der Materialien zum Wohlbefinden, demnach zur Glückseligkeit, wohl und einstimmig bedient, ist a priori gewiß, vollständig erkennbar und dem Handlungssubjekt eigen.389 Gewißheit und allgemeine Notwen383 Refl. 7202, XIX 281 Z27f. XIX 277 Z14f. 385 XIX 276 Z22–26. 386 XIX 278f. 387 XIX 281 Z27. Vgl. dazu z.B. KrV, III 527 Z33 – 528 Z12 <B841f>. 388 XIX 276 Z18–20. 389 Vgl. Refl. 7202, XIX 277 Z23–26. 384 111 digkeit in der Gestaltung der Glückseligkeit sind ihr zuzuschreiben, während Bedürfnisse der Sinne und äußere empirische Naturverläufe diese Kriterien der wahren, reinen Glückseligkeit nicht erfüllen können. Der Mensch ist durch sie Urheber der Glückseligkeit ungeachtet der empirischen Bedingungen, und darin besteht ihr hoher Wert, wobei sie Tugend genannt wird.390 Da sie sich also zur wahren Glückseligkeit aller Materialien einstimmig bedient und sie dadurch notwendig und allgemein, demnach auch gewiß hervorbringt, so hat man an ihr die „Funktion der Einheit a priori aller Elemente der Glückseligkeit“ zu sehen. Die Freiheit nämlich unter allgemeinen Gesetzen (Moralität) ist diese Einheit a priori und „die notwendige Bedingung der Möglichkeit und das Wesen derselben [sc. der Glückseligkeit]“. Sie macht die Glückseligkeit als solche möglich.391 D.h.: Durch die Moralität, die auf Selbsttätigkeit und Zuverlässigkeit der Freiheit unter den Gesetzen beruht, kann die wahre Glückseligkeit als Einheit zusammengesetzt und dadurch auch hervorgebracht werden. (c) Die innerliche Argumentation zur Freiheit unter allgemeinen Gesetzen als Form der Glückseligkeit. Die Gesetze, die die Wahlfreiheit, d.i. das arbitrium liberum, mit sich selbst in Einstimmung bringen, enthalten den Grund eines notwendigen Wohlgefallens, während das Wohlgefallen an den die Sinne rührenden Dingen nicht notwendig und allgemeingültig ausgelöst wird.392 Nun besteht Glückseligkeit in einem Wohlbefinden. Die wahre bzw. reine Glückseligkeit besteht in dem Wohlbefinden, das auf der Freiheit unter allgemeinen Gesetzen, die für die Hervorbringung derselben selbsttätig und zuverlässig wirkt, beruht.393 Sie ist demnach in der Notwendigkeit des Wohlgefallens bzw. des in diesem bestehenden Wohlbefindens aus der Freiheit unter den Gesetzen fundiert. Damit ist nun also anzunehmen, daß ihre Form die Freiheit unter den Gesetzen (Moralität) ist.394 Das notwendige Wohlgefallen als Element der wahren Glückseligkeit verbindet diese innerlich mit dem Begriff der Freiheit nach den Gesetzen, und die Verbindung findet sich begrifflich in der Form der Glückseligkeit. Die Genese des Begriffs einer Form der Glückseligkeit ist hier im notwendigen Wohlgefallen verankert. (d) Die erste Determination der Selbstzufriedenheit: ,den datis der Natur nicht zuwider sein‘. Die Selbstzufriedenheit wird in dieser Reflexion daraus konzipiert, daß der Gebrauch der freien Willkür eines Vernunftwesens nicht den ,Data‘ zur Glückseligkeit, die ihm Natur gibt, zuwider sein soll.395 Damit nähert sich Kant unbewußt 390 Vgl. XIX 277 Z29–34. XIX 277 Z3–7. 392 Vgl. Refl. 7202, XIX 276 Z10–14. 393 Vgl. XIX 276 Z22–26. 394 Zur „Form der Glückseligkeit“ vgl. XIX 276 Z18, 277 Z8. 395 Refl. 7202, XIX 276 Z27f. 391 112 dem stoischen Moralprinzip: Vive convenienter naturae.396 Dieses ,Nicht zuwider‘ als Eigenschaft der freien Willkür soll „die conditio sine qua non der Glückseligkeit“ sein.397 Die erwähnte erste Determination der Selbstzufriedenheit ließe sich wie folgt erläutern: Mit der Bedingung ,den datis der Natur nicht zuwider sein‘, die zunächst ohne den direkten Bezug auf einen Gefühlszustand, Wohlgefallen, eingeführt wird, ist auf der Gefühlsebene nicht etwa der Anspruch einer völligen Befriedigung von Bedürfnissen der Sinne gemeint, sondern im Gegenteil die Enthaltsamkeit in denselben; das Nicht-zuwider bedeutet: ohne von ihnen herumgetrieben zu werden, mit der Selbstmacht seiner Freiheit zufrieden zu sein, so klein diese auch sein mag; die Einschränkung auf sich selbst zeigt sich demnach als ,der Natur nicht zuwider‘. Daher heißt es: „Glückseligkeit ist eigentlich nicht die größte Summe des Vergnügens, sondern die Lust aus dem Bewußtsein, seiner Selbstmacht zufrieden zu sein“.398 Bei der Verbindung von Nicht-zuwider und Zufriedenheit mit der Selbstmacht seiner Freiheit, die den Begriff der Selbstzufriedenheit bildet, müßte es zuletzt auf den Begriff einer Freiheit ankommen, die mit den Gesetzen zusammenstimmt. Dementsprechend wird die Selbstzufriedenheit für „die wesentliche formale Bedingung der Glückseligkeit“399 genommen. (e) Die Selbstzufriedenheit als formale Bedingung der wahren Glückseligkeit (Hauptstuhl von Zufriedenheit). Aus der Aufstellung des Begriffs einer Form der Glückseligkeit als Verbindung der Freiheit unter Gesetzen mit der Glückseligkeit durchs notwendige Wohlgefallen in (c) wird nun aber auch die Möglichkeit eröffnet, daß die in (d) eingeführte Selbstzufriedenheit, als ein notwendiges Wohlgefallen, aus dem die Glückseligkeit wesentlich besteht, den Status einer formalen Bedingung der Glückseligkeit bekommt. Die Selbstzufriedenheit spielt zwischen Freiheit und Glückseligkeit eine vermittelnde Rolle. Denn als Folgen daraus lassen sich ansehen: (1) Bei der „ursprüngliche[n] Form der Glückseligkeit, bei welcher man der Annehmlichkeiten gar wohl entbehren und dagegen viel Übel des Lebens ... übernehmen kann“, wird die Zufriedenheit doch nicht nur nicht vermindert, sondern sogar ,erhoben‘, d.h. gesteigert.400 Denn das notwendige Gefallen kann durch den angesichts der Übel des Lebens verstärkten Gebrauch der Freiheit unter den Gesetzen gesteigert werden. (2) Die „Tugend“, die durch die Vernunft belehrte Gesinnung, die in der Frei396 Vgl. zu diesem Moralprinzip Ethik Menzer S. 33f, Refl. 6658, XIX 125f, Refl. 6984–86, XIX 219f; Baumgarten, A., Initia philosophiae practicae § 45–47, in: AA, XIX 25f. Für Kant scheidet dieses Prinzip als Moralgesetz aus, weil für ihn die Natur, die in ihm enthalten ist, im Gegensatz zur Freiheit steht. Es taugt nur zu einer Regel der Klugheit und zwar zu einer nicht ausgezeichneten. Gleichwohl übernimmt er mit dem Begriff der Selbstzufriedenheit de facto seinen Geist. Zu diesem stoischen Moralprinzip cf. 2.2.1.(3). Unterdessen verwendet er es in der MS für die negativen Pflichten gegen sich selbst, welche auf die moralische Selbsterhaltung gehen, ohne die Stoiker namhaft zu machen (MS, VI 419). 397 Refl. 7202, XIX 276 Z29f. 398 XIX 276 Z30–32. 399 XIX 276f. 400 Refl. 7202, XIX 277 Z8–11. 113 heit unter Gesetzen verankert ist und dadurch „die größte Wohlfahrt zuwegebringen“ können soll und mit welcher Vernunftwesen „unangesehen der empirischen Bedingungen“ „Urheber“ derselben sein können, führt somit „Selbstzufriedenheit“ bei sich. Die Selbstzufriedenheit macht dementsprechend die formale Bedingung, d.i. das innere strukturelle Fundament der wahren Glückseligkeit aus, die auf der Freiheit unter allgemeinen Gesetzen beruht, und ist demnach „Hauptstuhl von Zufriedenheit“, „ohne welchen keine [wahre bzw. reine] Glückseligkeit möglich ist, das Übrige sind Akzidenzien“.401 Eine Schwäche dieser Auslegung mag nun aber daran liegen, daß Kant selber nirgends in dieser Reflexion ausdrücklich äußert, die Selbstzufriedenheit sei ein notwendiges Wohlgefallen aus Freiheit. Solches aber läßt sich, wie oben ausgeführt (cf. 2.5.1), aus dem ganzen Zusammenhang der „Reflexionen“ wohl feststellen. Wie denn die Selbstzufriedenheit als „Hauptstuhl“ für wahre Glückseligkeit auf der Freiheit nach Gesetzen beruhen muß, wird von Kant auch formal in bezug auf ,unsere wesentlichen Zwecke‘ expliziert. Da nämlich die „Zufriedenheit“, womit das wesentliche Element der wahren Glückseligkeit gemeint sein dürfte, mithin auch die Selbstzufriedenheit als „Hauptstuhl“ für dieselbe, mit „unseren wesentlichen und höchsten Zwecken“, bei denen von den Zwecken in einer systematischen Einheit und der dazu gehörenden wahren Glückseligkeit die Rede sein dürfte, „zusammenhängen“ muß, und da Naturgeschenk, Glück und Zufall nicht zu diesen Zwecken zusammenstimmen können und „keine noch höheren Bewegungsgründe und ein höheres Gut gegeben worden“ sind, so muß der „Hauptstuhl“ für Glückseligkeit (die Selbstzufriedenheit) auf nichts anderem als der Freiheit nach Gesetzen beruhen, „damit wir uns ihn selbst nach der Idee des höchsten Guts machen können“.402 Die Argumentation beruht offensichtlich auf der Aussicht, daß auch die Selbstzufriedenheit, die jene vermittelnde Rolle spielt, sich als wesentliches Element der Glückseligkeit auf die wahre Glückseligkeit bzw. die Glückseligkeit der Verstandeswelt bezieht, die in der geistigen Ausdehnung von der Freiheit zu ihr vom Prinzip der Autokratie/Epigenesis zu realisieren ist. Die Selbstzufriedenheit als die formale Bedingung der Glückseligkeit, d.h. „der Hauptstuhl von Zufriedenheit“, bei dem es nicht auf die Bedingung der Möglichkeit der Hervorbringung derselben, sondern auf ihre fundamentale Struktur ankommt, besteht also „in der Freiheit ... nach Gesetzen, einer durchgängigen Zusammenstimmung mit sich selbst“.403 Man kann demzufolge auch kurz so formulieren: Die formale Bedingung der Glückseligkeit beruht auf der Form der Glückseligkeit. Dabei ist aber zu beachten, daß die Freiheit nach Gesetzen, die Moralität, die wohl real die Selbstzufriedenheit als „Hauptstuhl“ für Glückseligkeit verschaffen kann, dem Menschen von solcher moralischen Gesinnung doch nur die Würdigkeit glücklich zu sein verleiht. Sie ist bloß „regulatives Prinzip der Glückseligkeit 401 XIX 278 Z1–4. Zum „Hauptstuhl von Zufriedenheit“ vgl. auch Refl. 1511, XV 831 Z18, ψ1−2 (1780–84). Die Datierung für diese Reflexion von Adickes läßt vermuten, daß Becks Datierung für Refl. 7202 (cf. Fußnote 376) wahrscheinlich ist. 402 XIX 278 Z5–15. 403 XIX 278 Z14f. 114 a priori“. Sie „verspricht“ „das Empirische der Glückseligkeit“ nicht; „sie enthält ... an sich keine [empirischen] Triebfedern“. Das Wohlgefallen an ihr wird nur „aus einem allgemeinen Gesichtspunkte a priori, d.i. vor der Vernunft“ hervorgerufen.404 Diese apriorische Allgemeinheit ohne empirische Triebfedern charakterisiert eben das Wohlgefallen an ihr, nämlich die Selbstzufriedenheit als „Hauptstuhl“ für wahre Glückseligkeit. Nun entwickelt Kant aufgrund der erlangten Grundthese vom „Hauptstuhl“ für Glückseligkeit ein paar Terme: (1) Der freie Mensch, d.i. das mit Freiheit versehene endliche Vernunftwesen, hat im Bewußtsein das Vermögen der Selbstzufriedenheit, d.i. des „Hauptstuhls“ („die Empfänglichkeit“), in dem alle Glückseligkeit aufzunehmen ist: „das Vermögen, auch ohne Lebensannehmlichkeiten zufrieden zu sein und glücklich zu machen“. „Dieses ist das Intellektuelle der Glückseligkeit.“405 Denn die Freiheit nach Gesetzen (arbitrium liberum intellectuale) ist der Vernunft und deren Ordnung untergeordnet und demnach intellektuell. Die wahre Glückseligkeit beruht wesentlich auf dem Intellektuellen, das sich am notwendigen Wohlgefallen (der intellektuellen Lust), der Selbstzufriedenheit, zeigt. (2) Der „Hauptstuhl“, der auf der Freiheit nach Gesetzen gründet, rekrutiert sich nicht aus etwas Realem, d.i. hier Vergnügen oder der Materie der Glückseligkeit, sondern sein Begriff enthält „die formale Bedingung der Einheit“ für die Glückseligkeit, welche auch „Spontaneität des Wohlbefindens“ zu nennen ist und in der auch der „Wert der Person“ verankert ist.406 Die Spontaneität des Wohlbefindens könnte mit dem obengenannten Intellektuellen der Glückseligkeit identisch sein. Daß hinsichtlich des „Hauptstuhls“ die formale Bedingung der Einheit der Glückseligkeit, die Spontaneität des Wohlbefindens, besteht, basiert vermutlich darauf, daß der „Hauptstuhl von Zufriedenheit“ in der formalen Einheit der freien Willkür („Identität meines Wollens“407 ) liegt. Diese wird durch die Zusammenstimmung der letzteren mit allgemeinen Gesetzen gebildet, und in ihr ist eigentlich der Wert der Person zu erkennen. Wie diese das Subjekt der Spontaneität ist, so involviert der „Hauptstuhl“, der auf der formalen Einheit des freien Willens in ihr beruht, auch das Element der Spontaneität. Kants eben dargestellte Analyse der Selbstzufriedenheit als „Hauptstuhl“ für Glückseligkeit stellt heraus, daß es ihr um den Zusammenhang zwischen Freiheit nach Gesetzen (Moralität) und formaler ästhetischer Empfänglichkeit für wahre Glückseligkeit (Selbstzufriedenheit als „Hauptstuhl“) geht; in dieser Reflexion handelt es sich bei der Selbstzufriedenheit, einem moralischen Gefühl, nicht etwa um eine psychologische Ursache für die Hervorbringung der wahren Glückseligkeit (moralische Triebfeder), sondern vielmehr um diejenige Wirkung aus der Freiheit nach Gesetzen, die die innere Basisstruktur der wahren Glückseligkeit a priori 404 XIX 279 Z9–25. Zu „keine Triebfedern“: Es kann bei Kant stattfinden, daß ein Ausdruck „kein ...“ sich lediglich auf das Empirische bezieht und nicht das Moralische betrifft. Vgl. dazu z.B. GMS, IV 449 Z14 <B102>: „kein Interesse“. 405 XIX 278 Z17–20. 406 XIX 278 Z21–25. 407 Refl. 7204, XIX 284 Z1f, ψ? υ? ϕ? (1780–89? 1776–78?). 115 ausmacht. Kants Denken über die Selbstzufriedenheit geht aber in dieser Reflexion noch auf ein weiteres Ziel. Glückseligkeit wird nämlich hinsichtlich ihres Existenzmodus der Kantischen Zweiweltenlehre gemäß zweifach differenziert, „entweder wie sie erscheint, oder wie sie ist“. Es könnte dem ersteren die sinnliche zufällige, dem letzteren die wahre Glückseligkeit zugewiesen werden. Die letztere nun soll durch „moralische Kategorien“ konstituiert werden, die an sich selbst die „Form der Freiheit“ vorstellen.408 Behält man darüber hinaus im Auge, daß die Selbstzufriedenheit als „Hauptstuhl“ für Glückseligkeit zu einer Apperzeption („apperceptio iucunda primitiva“) erhoben wird,409 und berücksichtigt man zugleich die hier verwendete Terminologie wie etwa Form und Materie der Glückseligkeit, formale Bedingung der Einheit, das Intellektuelle, Spontaneität etc., so muß man zur Vermutung kommen, daß Kant hier mit der Möglichkeit einer Synthesis der Glückseligkeit durch Freiheitskategorien410 nach dem Modell der transzendentalen Deduktion in der KrV experimentiert. Die Selbstzufriedenheit also ist in Refl. 7202 nicht in Hinsicht auf die exekutive Kraft zur moralischen Handlung (Triebfeder), mithin auf eine eudämonistische Ethik, sondern im praktisch-theoretischen Interesse an der Möglichkeit der Konstitution einer wahren Glückseligkeit durch Freiheit thematisiert. Es kann allerdings die Möglichkeit nicht vollauf ausgeschlossen werden, daß die „Spontaneität des Wohlbefindens“ doch in Richtung auf die Triebfeder verstanden werden könnte. 2.6.3 Die Selbstzufriedenheit ist zur moralischen Triebfeder nicht fähig. Es kann nun zunächst angenommen werden, daß Kant vor der KpV auch die Selbstzufriedenheit für die Triebfeder zur moralischen Willkürbestimmung hält. Denn bei der ersteren handelt es sich um das wesentliche Element der Seligkeit, die ein Begriff ist, der zum Begriff vom Reiche Gottes gehört. Dieser Begriff wird nun, wie unten gezeigt wird (cf. 2.7.2), von Kant bis zur KrV ausdrücklich als die Triebfeder bezeichnet. Also sei die Selbstzufriedenheit die moralische Triebfeder. Die Begriffe von Selbstzufriedenheit und Seligkeit erscheinen schon in der früheren Periode miteinander verbunden: „Die Selbstzufriedenheit, zu der die Welt keinen äußeren Zusatz enthält, Seligkeit.“411 Sie ist von himmlischer Herkunft: „Diese Wollust [sc. die Selbstzufriedenheit] ist vom Himmel genommen und das ambrosia der Götter.“412 Ihre Unterscheidung von der sinnlichen, zufälligen Glückseligkeit wird auch dadurch vollzogen, daß sie dem Begriff der Seligkeit analogisch gedacht wird. Die göttliche Seligkeit, die Selbstgenugsamkeit, sei zwar von der Glückseligkeit unterschieden, die auf äußeren Dingen beruht, aber „Analogon 408 Refl. 7202, XIX 278 Z26–32. XIX 278 Z4f. 410 (Zu Kants Versuchen zu den Freiheitskategorien vgl. z.B. Refl. 6888, XIX 192f, υ? ϕ? (1776– 78). Ein Ergebnis aus ihnen hat er in der KpV angezeigt, ohne jedoch Bezug auf die Glückseligkeit zu nehmen. Vgl. dazu KpV, V 66 <A117>. 411 Refl. 6616, XIX 111, κ–λ? (1769–70?). 412 Refl. 6915, XIX 205, υ (1776–78). 409 116 der Selbstzufriedenheit, nichts Äußeres zu bedürfen“.413 In einer Vorlesungsnachschrift sagt Kant: „Erstreckt sich diese Selbstzufriedenheit auf unsere ganze Existenz; so heißt sie Seligkeit“; diese sei der höchste Grad der Selbstzufriedenheit.414 Die Nähe beider Begriffe zueinander ist auch in der KpV unverändert: Der Genuß aus der Freiheit (Zufriedenheit mit seiner Person) sei der Seligkeit ähnlich und wenigstens seinem Ursprung nach der Selbstgenugsamkeit Gottes analogisch.415 Obwohl Kant es mittels der Idee der Seligkeit für möglich zu halten scheint, daß die Selbstzufriedenheit die moralische Triebfeder sei, läßt sich dies in den konkreten Analysen über sie, wie sie etwa in Refl. 6892 und Refl. 7202 angestellt sind, wie oben dargelegt (cf. 2.6.1 und 2.6.2), nicht überzeugend beweisen. Denn sie wird in menschlicher Wirklichkeit nicht von der Idee der Seligkeit abgeleitet, sondern muß erst durch die Freiheit unter allgemeinen Gesetzen (und mithin die formale Einheit des Wollens im Gebrauch der Freiheit) erlangt werden, in der auch eine moralische Triebfeder ursprünglich liegen muß. Sie ist diesseitig-real (cf. 3.5.a), wird aber in Wirklichkeit mit der Idee der Seligkeit nicht so sicher verknüpft, daß sie auch durch ihre Potenz zur Seligkeit die Rolle einer moralischen Triebfeder spielen könnte. Denn einerseits kann sie während des Lebens gewiß nicht vollständig erreicht werden,416 auf der anderen Seite hält man die Idee der Seligkeit wegen ihrer objektiven Irrealität für unverständlich.417 Die mit der Seligkeit in Zusammenhang gebrachte Selbstzufriedenheit liefert daher ursprünglich wenig reale Kraft zur moralischen Motivation. Da es indessen bei einer Triebfeder auf eine reale verbindende Kraft ankommt, muß auch die moralische in einer realen faktischen Kausalität der Moralität unmittelbar fundiert sein, während die Selbstzufriedenheit zwar real, jedoch eigentlich vielmehr erst eine Wirkung dieser Kausalität ist. Die Selbstzufriedenheit, die der Idee der Seligkeit analog gedacht wird, bewährt sich also nicht als moralische Triebfeder. Nun führt K. Düsing zwei Reflexionen als Belege dafür ein, daß die Selbstzufriedenheit moralische Triebfeder sei.418 Sie sind aber als Belege ganz schwach. (1) In der einen wird die Triebfeder nicht unmittelbar mit der Macht der Selbstzufriedenheit, sondern genauer mit der Macht des Moralischen derselben gleichgesetzt, welche sich auf die Moralität selbst, mithin möglicherweise auch auf das Gesetz beziehen kann.419 Daraus kann man allenfalls folgern, daß sie als Triebfeder nur seRefl. 5631, XVIII 262, χ–ψ? (1778–1789?). Religionslehre Pölitz (WS 1783/84?), XXVIII 1089f. 415 Vgl. KpV, V 118 Z24–37 <A213f>. 416 Vgl. Anthr., VII 234f: „Wie steht es aber mit der Zufriedenheit (acquiescentia) während dem Leben? – Sie ist dem Menschen unerreichbar: weder in moralischer (mit sich selbst im Wohlverhalten zufrieden zu sein) noch in pragmatischer Hinsicht (mit seinem Wohlbefinden, was er sich durch Geschicklichkeit und Klugheit zu verschaffen denkt).“ Vgl. dazu auch KpV, V 25 Z12–17 <A45>. 417 Refl. 6883, XIX 191, υ? (1776–78?): „Von der bloß moralischen Gückseligkeit oder der Seligkeit verstehen wir nichts.“ 418 Vgl. Düsing, K., Das Problem des höchsten Gutes ..., S. 26. 419 Vgl. Refl. 7237, XIX 292, ψ? (1780–89?): „... Worin das Moralische der Selbstzufriedenheit bestehe und die Macht desselben als Triebfeder, die sehr groß werden kann“. Die Reflexion könnte inhaltlich gut mit Refl. 6892 zusammenhängen. 413 414 117 kundär gelten kann. (2) In der anderen wird die treibende Kraft, die Triebfeder, mit dem Gefühl des Wohlgefallens, das auf sich selbst und die Selbstschätzung angewandt wird, in Zusammenhang gebracht.420 Freilich ist es richtig, daß die treibende Kraft im Gefühl der Lust und Unlust sitzt. Allerdings muß dieses Gefühl des Wohlgefallens nicht unbedingt die Selbstzufriedenheit sein. Es kann diese, aber auch ein anderes moralisches Gefühl sein, und eben das Gefühl der Achtung geht auf sich selbst und ist Selbstschätzung.421 In dieser Reflexion kommt jedenfalls das Wort ,Selbstzufriedenheit‘ nicht vor. In beiden Reflexionen wird darüber hinaus keine konkrete Analyse der Realität der Selbstzufriedenheit angestellt; eine solche Analyse würde vielmehr zu dem Ergebnis führen müssen, daß sie nicht als primäre moralische Triebfeder tauglich ist. 2.6.4 Die Unterscheidung der moralischen Triebfeder vom moralischen Gefühl (Refl. 6864). Obwohl Kant schon früh auf seinem moralphilosophischen Denkweg zu der Erkenntnis gekommen ist, daß das moralische Gefühl nicht der erste Grund der Moralität ist, sofern dieser von uns erkannt werden kann, so ist er sich doch auch darüber im klaren, daß es in ihrer Ausübung immer noch eine ziemlich gewichtige Rolle spielt. Es muß also spezifiziert werden, was für ein moralisches Gefühl und in Beziehung auf welchen Grund der Moralität es diese Rolle spielt. Seitdem ihm nun einerseits schon bis zu Periode η, genauer den „Bemerkungen“ (1764/65), die Gründung seiner rationalen Gesinnungsethik gelungen ist, ist es beinahe immer die Ausgangsbasis seines ethischen Denkens, daß das Gesetz als principium diiudicationis moralis den von uns erkennbaren ersten Grund der Moralität ausmacht, obwohl noch über seine Zusammenhänge mit anderen möglichen elementaren Begriffen der Moralität weiter zu reflektieren ist. Auf der anderen Seite scheint ihm das Prinzip der Beurteilung allein nicht mächtig genug zu sein für den exekutiven Grund zur wirklichen moralischen Handlung, weil das Gefühl sicher zur Exekution der moralischen Handlungen durch ein endliches Vernunftwesen beiträgt und weil in Wirklichkeit auch eine Zweckidee wie etwa die Idee vom Reich Gottes für dieses Vernunftwesen als bewegende Kraft zur moralischen Handlung wirkt. Von da her sehen manche Interpretatoren im Gefühl der Zufriedenheit mit sich selbst, die sich schließlich als wesentliches Element der Seligkeit im Reich Gottes vollauf realisieren soll, die bewegende Kraft zur moralischen Exekution; diese Ansicht (religiösen Eudämonismus) soll Kant bis Mitte der achtziger Jahre vertreten haben. Allein die reale Selbstzufriedenheit, die er tatsächlich analysiert, läßt sich, wie dargelegt, nur durch die Freiheit unter den Gesetzen, d.i. durch das Prinzip ihrer Zusammenstimmung mit sich selbst, auslösen und ist demnach Wirkung aus dem dieser Freiheit gemäßen Wohlverhalten, keineswegs Ursache desselben. Sie mag nämlich wohl als solche noch die Handlung zur Moralität bewegen, jedoch wirkt solche bewegende Vgl. Refl. 6866, XIX 185f, υ (1776–78). Vgl. dazu MS, VI 399 Z7: „die Achtung für sich selbst (Selbstschätzung)“; KpV, V 161 Z18 <A287>. 420 421 118 Kraft erst sekundär. Man muß also noch nach einem moralischen Gefühl suchen, das unmittelbar aus der Freiheit nach Gesetzen entsteht und ohne weiteres den Willen moralisch bestimmen kann. Dabei hilft eine klare funktionale Unterscheidung der moralischen Triebfeder, die den Willen unmittelbar bestimmt und im Umkreis der Freiheit nach Gesetzen gesucht werden muß, von dem moralischen Gefühl, das in der Tat zum Gefühl der Selbstzufriedenheit tendiert. Diese Unterscheidung wird von Kant spätestens bis zu Periode υ (1776–78) ausdrücklich vollzogen. In Refl. 6864 nämlich gibt er drei kardinale Elemente der Moralität an. (1) Das erste Grundprinzip der Moralität ist das principium diiudicationis moralis, das im Prinzip der Zusammenstimmung („Einstimmung“) der Freiheit mit sich selbst als mit den Gesetzen besteht (cf. 2.3.2). Es ist aber „das principium der Vernunftmäßigkeit der Freiheit überhaupt“ bzw. das „principium der allgemeinen praktischen Gesetzgebung der reinen Vernunft in Ansehung der Freiheit überhaupt“,422 weil darin die Vernunft als Grundvermögen der allgemeinen Gesetzgebung die moralische Dijudikation determiniert (cf. 2.3.1.f), welche mit den Worten anderer Schriften ,Urteil der Vernunft‘ heißen wird. Denn die Beurteilung als Zusammenstimmung erfolgt im arbitrium purum, demnach auf der Ebene der Vernunft. (2) Aus diesem ersten Grundprinzip (Zusammenstimmung mit sich selbst als allgemeiner praktischer Gesetzgebung der reinen Vernunft) entspringt nun aber das Wohlgefallen an demselben, d.i. das moralische Gefühl. Dieses gründet auf der Notwendigkeit des Wohlgefallens, die in allgemeinen Gesetzen fundiert ist. Da in dieser Periode das Gefühl der Achtung noch nicht in den Vordergrund tritt, muß beim moralischen Gefühl als Wohlgefallen hauptsächlich von der Selbstzufriedenheit die Rede sein. Erst von da her läßt sich auch der Satz verstehen: „Die Epigenesis der Glückseligkeit (Selbstgeschöpf) aus der Freiheit, die durch die Bedingungen der Allgemeingültigkeit eingeschränkt wird, ist der Grund des moralischen Gefühls.“423 Das moralische Gefühl der Selbstzufriedenheit gründet nämlich auf der Sicherheit der formalen Einheit im Gebrauch der Freiheit, die durch jene Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst als mit den Gesetzen gebildet wird, aus der nach dem Prinzip von Autokratie/Epigenesis auch die wahre Glückseligkeit, die Glückseligkeit der Verstandeswelt, hervorgebracht werden kann. Die durch den Glauben gesicherte Aussicht auf künftige wahre Glückseligkeit, die durch jene Zusammenstimmung (die Würdigkeit glücklich zu sein) zu erlangen ist, trägt auch zur Bildung der Selbstzufriedenheit bei.424 Das Gefühl der Achtung hingegen als das Medium der moralischen Triebfeder aus Gesetz kann nicht direkt durch die gesicherte Aussicht auf die Epigenesis der Glückseligkeit ausgelöst werden. (3) Nun ist aber von dem moralischen Gefühl, das sich auf die Selbstzufriedenheit bezieht, die moralische Triebfeder terminologisch zu unterscheiden. „Die Triebfeder des moralischen Verhaltens ist wiederum davon [sc. vom moralischen Gefühl] unterschieden“. Sie kann nicht sekundär aus dem Wolffisch als Lust genommenen Gefühl Refl. 6864, XIX 184, υ (1776–78). Auch der Nachtrag zu dieser Reflexion stammt aus derselben Zeit. 423 Refl. 6864, XIX 185. 424 Vgl. dazu beispielsweise Religionslehre Pölitz, XXVIII 1090 Z14–20. 422 119 folgen, das zuerst durch das erste Grundprinzip (principium diiudicationis) der Vernunft hervorgerufen wird, sondern muß unmittelbar durch dieses selbst ausgelöst werden, d.h. auf demselben beruhen. Sie „beruht“ “‘auf der Macht der Vernunft in Ansehung der Freiheit“, welche hier auch mit der „Macht der Pflicht“425 in Zusammenhang gebracht wird. Diese Auslösung der Triebfeder durch die Macht der Dijudikation der Vernunft aber könnte unter einem anderen Aspekt darauf hindeuten, daß das praktische Urteil der Vernunft nicht theoretischer Herkunft ist, sondern auf die Spontaneität der Freiheit rekurrieren muß.426 Da nun diese Macht der Vernunft mit den Worten der Religionsschrift erst durch die Revolution in der Gesinnung („eine einzige unwandelbare Entschließung“427 ), d.i. die intelligible Tat einer Annehmung des moralischen Gesetzes in die Grundmaxime der Gesinnung durch Vernunft, zuwegegebracht wird (cf. 3.4.1.a), so wird hier auch davon gesprochen, daß die moralische Triebfeder „auf der Entschlossenheit, einem einmal genommenen Vorsatz (einer allgemeinen Maxime) gemäß zu handeln“ beruht.428 Auf diese Entschlossenheit der Vernunft hin ist sie unmittelbar im Prinzip der Dijudikation durch Vernunft als Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst fundiert. Erhebt sich demzufolge die Frage: „Wie kann Vernunft eine Triebfeder abgeben, da sie sonst jederzeit nur eine Richtschnur ist ...?“, so wird darauf geantwortet: durch „Zusammenstimmung mit sich selbst“, „Selbstbilligung und Zutrauen“, durch welche die Vernunft im Gegensatz zur Triebfeder aus Neigung oder äußerem Zwang, die niemals an die Stelle der Pflicht gesetzt werden kann, unmittelbar die moralische Triebfeder abgeben kann.429 D.h. die Zusammenstimmung mit sich selbst funktioniert nicht nur dijudikativ und gefühlsmäßig, sondern auch exekutiv. Dabei bestimmt die Macht der Vernunft die Exekution. Die Vernunft bestimmt die freie Willkür zur Handlung unmittelbar, indem die Funktion der Zusammenstimmung mit sich selbst sich auch als exekutiv erweist. Obwohl es in dieser Periode nicht vollständig festgelegt ist, daß sich die Macht der Vernunft ausdrücklich nur auf das moralische Gesetz bezieht430 (der Zusammenhang der Macht der Vernunft mit der der Pflicht aber bestätigt doch diese Entwicklungsrichtung), so wird doch mit dem eben Dargelegten immerhin der Weg geebnet, auf dem das durch Vernunft vorgeschriebene Gesetz unmittelbar den Willen bestimmen kann; es kann nämlich selbst die Triebfeder sein.431 Und dadurch wird auch vorbereitet, für den endlichen Willen praktisch-theoretisch (im Sinne einer praktischen Theorie) das Gefühl der Achtung als moralische Triebfeder im Gefühl der Lust und Unlust (genauer als Medium der moralischen Triebfeder, weil diese das Gesetz selbst ist) anzunehmen. Selbstbilligung und Zutrauen mögen nun freilich auf der anderen Seite 425 Refl. 6864 XIX 184 und 185. Vgl. dazu GMS, IV 448 <B101>. Dies gegen die Interpretaionsrichtung von H. J. Paton und D. Henrich. Cf. dazu Fußnote 495 in 2.8. 427 Rel., VI 47f <B55>. 428 Refl. 6864, XIX 184. 429 Refl. 6864 XIX 185. 430 Refl. 7204 (XIX 283f, ψ? υ? ϕ? 1780–89? 1776–78?) scheint zu zeigen, daß sich „die bloße Idee der Einheit der Vernunft im Gebrauche der Freiheit“ auf den Endzweck beziehen kann. 431 Vgl. dazu KpV, V 71f <A126f>. 426 120 wiederum Selbstzufriedenheit hervorrufen können; diese kann aber in diesem Zusammenhang prinzipiell nicht als eine primäre moralische Triebfeder taugen, die unmittelbar, durch die Macht der Vernunft ausgelöst, den Willen bestimmt, sondern ist nichts als die letzte Folge im Gefühl der Lust und Unlust aus der Willensbestimmung, die ohne die Triebfeder doch nicht getroffen werden kann. 2.7 Die relative Verlagerung der moralischen Triebfeder ins Gesetz. 2.7.1 Moralisches Gefühl als contradictio und seine bewegende Kraft. „Ein vernünftig Vergnügen“, das als intellektuelles Wohlgefallen entspringt, „ist eine contradictio in adiecto“,432 womit gemeint ist, daß zwei unvereinbare Begriffe in einem Ausdruck verbunden sind. Ebenso kann auch die intellektuelle Lust contradictio in adiecto genannt werden. Das moralische Gefühl überhaupt, das real entweder moralische Handlungen bewirkt oder zusammen mit ihnen ausgelöst wird, hat die Struktur dieses Widerspruchs.433 Er soll jetzt erläutert werden. Seine Unvermeidlichkeit bezieht sich auf die besondere Konstellation, in der das Handlungssubjekt steht, das durch die Triebfeder (elater animi) zur Ausübung der moralischen Handlung bewegt wird und das durch die Befolgung des Gesetzes ausgelöste moralische Gefühl empfängt. Die Vernunft als Beurteilungsvermögen (facultas diiudicationis) in der reinen Willkür (arbitrium purum) hat an sich wohl eine gewisse unsittlichen Antrieben und Neigungen widerstehende Kraft, die aus der Reinheit der von ihr geformten Idee des Gesetzes entspringt, das negativ auf dem Prinzip des Nicht-Widerstreitens bzw. der ,Widerstreitslosigkeit‘ beruht;434 sie kann aber ohne Hilfe eines anderen Grundvermögens nicht genug die bewegende Kraft ausüben, moralische Handlungen der endlichen Vernunftwesen, die in der Sinnenwelt operieren, hervorzubringen (cf. 2.3.2).435 Diese bewegende Kraft zur Handlung in der Sinnenwelt, die Triebfeder, trägt das moralische Gefühl als ihr Medium.436 „Man soll das Gute Refl. 547, XV 239, υ (1776–78). Vgl. dazu KpV, V 117 <A210>: „... denn ein intellektuelles [Gefühl] wäre ein Widerspruch“. 434 Vgl. Refl. 6898, XIX 200, ϕ (1776–78) (hierzu vgl. auch GMS, IV 411 Anm. <B33f>; KpV, V 156 <A278f>; etc.); Ethik Menzer, S. 54; Refl. 6765, XIX 154f, ξ? ϕ? (1772? 1776–78?) (cf. Fußnote 292 in 2.3.2). 435 Vgl. dazu Refl. 1028, XV 460, υ (1776–8): „Bei den Menschen haben die Bewegungsgründe der reinen Willkür zwar eine Kraft: den Wunsch, aber nicht: die Handlung hervorzubringen“; Met.L/1, XXVIII 258: „Das ist ein Unglück fürs menschliche Geschlecht, daß die moralischen Gesetze, die da objektiv nezessitieren, nicht auch zugleich subjektiv nezessitieren.“ 436 Vgl. Ethik Menzer, S. 54: „... das subjektive Principium, die Triebfeder der Handlung ist das moralische Gefühl, ... Das moralische Gefühl ist eine Fähigkeit durch ein moralisches Urteil affiziert zu werden. Wenn ich durch den Verstand urteile, daß die Handlung sittlich gut ist, so fehlt noch sehr viel, daß ich diese Handlung tue, von der ich so geurteilt habe. Bewegt mich aber dieses Urteil, die Handlung zu tun, so ist das das moralische Gefühl“. Dieses sollte nun aber exakter als Medium (Träger) der Triebfeder bezeichnet werden, weil die Triebfeder selber entweder bis zur KrV sowohl Vernunft und mithin auch Gesetz als auch intelligible Welt und Gott (das höchste Gut) oder in der 432 433 121 durch den Verstand erkennen, und doch davon ein Gefühl haben. ... Ich soll ein Gefühl davon haben, was kein Gegenstand des Gefühls ist, sondern welches ich durch den Verstand erkenne.“ Der Sachverhalt versteht sich nicht von selbst, denn „das Gute kann gar nicht unsere Sinne affizieren“, weil es nicht das Angenehme ist. „Es steckt hierin also immer eine Contradiction.“437 Aber ungeachtet der Unverständlichkeit des kontradiktorischen Sachverhaltes, die auch in der GMS nur konstatiert wird,438 ließe sich dieser immerhin so darstellen: Im Vorgang der Zusammenstimmung mit sich selbst löst die Macht der Vernunft, die in der Entschlossenheit der Freiheit enthalten ist, im sinnlichen Teil der freien Willkür (sensus interior) das moralische Gefühl aus, das die bewegende Kraft zur Handlung im sinnlichen Selbst trägt; die Vernunft, die an sich das Vermögen von Ideen ist, ergibt aus sich in der Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst, demnach durch Selbstbilligung und Zutrauen der reinen Willkür, die Triebfeder zum moralischen Verhalten, das sich in der Sinnenwelt abspielt,439 was bedeutet, daß sie somit der freien Willkür im Grundvermögen des Gefühls der Lust und Unlust das die bewegende Kraft tragende moralische Gefühl einflößt. Ohne dieses „bringen die Motive der reinen Willkür nur Wünsche, d.i. untätige Begierden, hervor“,440 denen die Tätigkeit derjenigen Willkür (als tätiger Begierde) nicht zukommt (cf. 1.2.3.f), der die Triebfeder (elater animi) wesenseigen ist.441 Somit gewinnen auch moralische Vernunftideen die Bestimmungskraft der Willkür. Der Grund, warum die Reinheit der Vernunftgesetze nicht für sich und allein die hinreichende Bestimmungskraft des arbitrium liberum abgeben kann, sondern das durch die Selbstbilligung entstehende moralische Gefühl in die Motivationsbedingungen desselben mit einbeziehen muß, liegt darin, daß das arbitrium liberum des Menschen zwar intellectuale, jedoch zugleich sensitivum ist. Er muß sich in der Sinnenwelt wohl aus der Gesetzgebung der Vernunft, jedoch zugleich auch durch die sinnliche freie Willkür betätigen. Die Kontradiktion des Sachverhaltes zwischen Vernunft und Gefühl, die sich pointiert im Ausdruck etwa eines ,intelspäteren, durchs Grundlegungsmotiv determinierten Auffassung Kants (seit der KpV) lediglich das moralische Gesetz ist. Das moralische Gefühl wird hier, anders als etwa in Refl. 6864, XIX 184, Punkt 2 (cf. 2.6.4), als dasjenige Gefühl der Lust und Unlust vorgestellt, das von Vernunft und Gesetz unmittelbar bestimmt wird und wieder unmittelbar die moralische Handlung zuwegebringen kann. Es ist demnach mit dem Medium der Triebfeder identisch und wird sich sodann als das Gefühl der Achtung herausstellen. 437 Met.L/1, XXVIII 258. 438 Vgl. dazu GMS, IV 459 Z32 – 460 Z24 <B121–123>. 439 Vgl. Refl. 6864, Anm. ****, XIX 184, Nachtrag υ ϕ (1776–78) (cf. den auf Fußnote 429 bezogenen Haupttext in 2.6.4). 440 Refl. 1028, XV 460. In dieser Reflexion wird das, was dem moralischen Gefühl entspricht, durchaus als „praktisches Gefühl“ bezeichnet, das aber im Unterschied zum ersteren auch ein Gefühl des Klugheitsimperativs umfassen kann, ohne das seine Anratungen, obzwar Vernunft sie billigt, ohne Kraft sind. 441 Vgl. dazu Refl. 1008, XV 449, θ? (1766–68?): „Beweis, daß wir ein arbitrium liberum haben. vis subiective movens. Elateres animi. / Beweis, daß wir ein arbitrium liberum intellectuale haben. vis obiective movens.“ Elater ist das Wesen des arbitrium (als tätiger Begierde), das von der müßigen Begierde wie bloßem Wunsch unterschieden ist. Vgl. dazu auch Refl. 1021, 1031, 1052. 122 lektuellen Gefühls‘ artikuliert, beruht also auf dem fundamentalen Widerspruch in der Struktur des humanum arbitrium liberum. Der Widerspruch beim moralischen Gefühl bzw. der moralischen Triebfeder läßt sich demnach auch hinsichtlich der Differenzierung der causae impulsivae in stimuli und motiva bei der freien Willkür präzisieren: Causae impulsivae (Gegenstandsvorstellungen nach Wohlgefallen und Mißfallen) sind entweder sensitiv (pathologisch) oder intellektuell. Bei den ersteren handelt es sich um stimuli (Bewegursachen, Antriebe), bei den letzteren um motiva (Bewegungsgründe).442 Während nun causae impulsivae, sowohl stimuli wie motiva, ursprünglich im Objekt sind, so sind elateres animi, die das Wesen der Willkür ausmachen, doch zunächst und an sich nur die subjektive Rezeptivität, zum Begehren bewegt zu werden.443 Nun nezessitieren stimuli sensitiv und subjektiv und sind demnach causae sensitive et subiective moventes (d. i. sie sind Gegenstandsvorstellungen als materiale Bestimmungsgründe, die nach der pathologisch-praktischen Lust gebildet werden); sie können also ohne weiteres elateres sein. Motiva hingegen nezessitieren nur objektiv und heißen causae obiective moventes;444 es scheint demnach, daß sie per definitionem nicht sofort causae subiective moventes, d.i. elateres sein können. Nun sind sie entweder pragmatica oder moralia.445 Bei dem moralischen Gefühl bzw. der moralischen Triebfeder aber kommt es nur auf die letzteren an. Diese sollen und können doch elateres animi sein; pure intellectualia motiva können elateres animi werden, indem die subjektive Rezeptivität durch den bloßen Geist bewegt wird.446 „Die moralischen Motive sollen nicht bloß vim obiective necessitantem haben zur Überzeugung des Verstandes, sondern vim subiective necessitantem, d.i. sie sollen elateres sein.“447 Sie können elateres sein, d.i. die vis subiective necessitans haben, indem sie auf moralische Gesetze rekurrieren („Bei moralischen [Bewegungsgründen] habe ich die Regel nötig.“448 ), die transzendental-subjektiv aus der Gesinnung wirken. Daß reine praktische Vernunft und moralisches Gesetz, die in der freien Willkür transzendental-subjektiv ihren Sitz haben, sich auf die Ebene 442 Vgl. dazu beispielsweise Met.L/1, XXVIII 254. Vgl. Refl. 1055, XV 470, ψ3 (1785–88): „Causae impulsivae sind im Objekt. Elateres sind sie, sofern im Subjekt die Fähigkeit ist, bestimmt zu werden“; Refl. 1021, XV 457 Z10f, σ–χ (1775–79): „Elater ist die subjektive Rezeptivität, zum Begehren bewegt zu werden.“ 444 Vgl. Refl. 6918, XIX 206, υ? (1776–78?): „Die Gründe der objektiven Notwendigkeit: motiva, der subjektiven Nezessitation: stimuli. Jene intellectualiter, diese pathologice“; Refl. 6919, XIX 207, ϕ (1776–78): „Die necessitatio obiectiva ist das Sollen“; Refl. 6920, XIX 207, ϕ? (1776–78?): „Causae sensitive moventes sind stimuli. (Der Mensch ist nicht nezessitiert durch stimulos und also frei, auch nicht durch motiva.) Causae subiective moventes sind elateres. Auch der Verstand hat elateres, die den motivis intellectualibus recht angemessen sein“; Refl. 6934, XIX 209, ϕ (1776–78): „obiective impellentia sunt motiva, subiective elateres“; Refl. 6929, XIX 208 Z23–29, υ? (1776–78?). 445 Vgl. z.B. Refl. 6929; Met.L/1, XXVIII 258. 446 Vgl. dazu Refl. 1010, XV 451, κ? (1769?). 447 Refl. 5448, XVIII 185, ϕ (1776–78). Vgl. auch Refl. 1018, XV 454, ρ? (1773–75): „Quaeritur: utrum motiva intellectus habeant vim subiective moventem et possint esse elateres animi? nam elateres sunt causae impulsivae subiective moventes. / Respondetur: non habent in homine per se, sed quatenus sunt causae moventes elaterum animi ea ratione, ut intellectum ad horum excitationem urgeant.“ 448 Refl. 7019, XIX υ? µ? (1776–78? 1770–71?). 443 123 der empirischen Objektivität, zu der auch das Gefühl gehört, auswirken und in der letzteren objektive Nezessitation, objektive Kriterien der Handlung, ergeben können, kurz, daß der bloße Geist die subjektive Rezeptivität bewegt, darin liegt der Widerspruch. Dies ist aber nur faktisch so und nicht hinterfragbar. Sowohl der Begriff der moralischen Triebfeder als auch der des moralisches Gefühls haben diese faktische Struktur von Widerspruch. Der Sinn ist nämlich an sich Rezeptivität; sensus moralis jedoch, auf den die moralische Triebfeder sich bezieht, ist nicht mehr bloß rezeptiv, sondern „ein Vermögen“, das wohl auf reiner Spontaneität beruht, demzufolge „in sensu proprio ein Unding“. Denn Sinn und Gefühl sind ihrer Herkunft nach pathologisch, während motiva moralia in objektiver Nezessitation sich auf positive Freiheit (Freiheitskausalität) beziehen, die intellektuell ist; sensus moralis ist „nur per analogiam so genannt“.449 Bei der Doppelstruktur der Willkür aber „geht“ moralisches Gefühl, so notwendig sein Einsatz in der Sinnenwelt auch sei, doch „nicht vor der Vernunfterkenntnis vorher“.450 Vernunft bestimmt das Gefühl.451 Es ist Kants schon früh errungene und bis zu den späten Jahren erhaltene Grundposition, daß das Gesetz dem moralischen Gefühl, sei dieses Achtung oder Selbstzufriedenheit, vorausgeht. Gesetz und moralisches Gefühl aber sind, wenn auch kontradiktorisch, jedoch so eng miteinander verbunden, daß, wie etwa bei Epikur, der „Fehler des Erschleichens (vitium subreptionis)“,452 leicht vorkommt, den transzendental-subjektiven Grund der intellektuellen Bestimmbarkeit des Willens für etwas Ästhetisches zu halten. Die Struktur des Widerspruchs in der intellektuellen Lust oder im moralischen Gefühl überhaupt kann nun auf die Doppelstruktur der Position, die ein Mensch als endliches Vernunftwesen in der Welt einnimmt, verlegt werden, nämlich darauf, daß das Gefühl der Lust und Unlust als solches, folglich selbst das moralische Gefühl, zwar in der Sinnlichkeit (im sensus interior) sitzt,453 daß aber der Mensch ungeachtet dieses Sitzes des Gefühls in der Sinnenwelt seinen „Standpunkt“ doch in der Vernunft, demnach in der intelligiblen Welt nehmen kann.454 Diese verdop449 Vgl. Refl. 5448. Refl. 1028. XV 461. 451 Refl. 5620, XVIII 258f, χ? (1778–79?): „Gleichwie die Vernunft nicht durch die Sinne, aber doch in Beziehung auf dieselben nach den allgemeinen Bedingungen einer Erkenntnis überhaupt urteilt: so [urteilt] auch eben dieselbe [sc. die Vernunft] nicht durch das Gefühl, aber doch in Beziehung auf dasselbe nach den Bedingungen der Allgemeingültigkeit des Urteils über das Wohlgefallen und Mißfallen.“ Vgl. auch Refl. 541, XV 237, µ? (1770–71?). Die These, „Vernunft bestimmt das Gefühl“, wird unverändert durch die erste Grundlegungsschrift, die GMS, übernommen. Vgl. hierzu GMS, IV 460 <B122f>. 452 KpV, V 116 <A209>. 453 Vgl. z.B. KpV, V 116 <A210>: „Da diese Bestimmung [sc. die intellektuelle Bestimmung des Willens unmittelbar durch die Vernunft bzw. durchs Gesetz] nun innerlich gerade dieselbe Wirkung eines Antriebs zur Tätigkeit tut, als ein Gefühl der Annehmlichkeit, die aus der begehrten Handlung erwartet wird, würde getan haben, ...“. 454 Refl. 6865, XIX 185, υ (1776–78): „Was das Gefühl betrifft (Nachtrag ϕ: Es kann auch bloß zur Beurteilung verwandt werden), so fühlen wir zwar nur durch die Sinne; aber den Standpunkt, worin wir uns gegen den Gegenstand setzen, können wir nehmen, wie wir wollen. Hier nehmen wir ihn in der Vernunft und empfinden im allgemeinen Standpunkte. (Nachtrag ϕ: Selbstschöpfer der allgemei450 124 pelte Weltzugehörigkeit beruht auf der ursprünglichen Annehmung des reinen sittlichen Denkens (der sittlichen Einsicht der reinen praktischen Vernunft) als gänzliche Unabhängigkeit von dem Naturgesetz der Erscheinungen (negative Freiheit). Sie beruht nämlich auf der prinzipiellen Dichotomie zwischen reinem sittlichen Denken und sinnlicher Natur; dabei entspringt das erstere der negativen Freiheit, dem Unbegreiflichen. Diese Dichotomie läßt sich überall im System der Kantischen Ethik als ein Widerspruch erblicken, der stets nur als Faktum konstatiert werden kann. Aber eben aus dieser faktischen contradictio, die sich zugleich als enge Verbindungsfunktion erweist, kommt die moralische Triebfeder zur Handlung, mithin unsere moralische Handlung zustande, als kontradiktorische Einheit von reinem sittlichen Denken und sinnlicher Natur, von intelligibler und Sinnenwelt, und zwar auf unverständliche Weise. Auch der deutliche Widerspruch des Ausdrucks einer „intellektuellen Lust“ rührt also davon her, daß sie der Begriff ist, der beide Bürgerschaften des Menschen als endlichen Vernunftwesens in der Sinnen- und intelligiblen Welt von der letzteren aus miteinander verkoppeln will. Kant hat ihn aber wahrscheinlich wegen dieser wohl notwendigen, jedoch ungeschickten Ausdrucksart in seinen Druckschriften, außer durch den Zwang der Erfordernis eines kompletten Systems,455 nicht verwendet; er bevorzugte weniger widersprüchlich klingende Ausdrücke wie moralisches Gefühl, moralische Lust und moralische Glückseligkeit. 2.7.2 Die relative Gewichtsverlagerung beim Begriff der Triebfeder in der intellektuellen Ausdehnung vom freien Willen zum Reich Gottes: Die ,moralisch-teleologische‘ Grundrichtung, vom freien Willen auszugehen, setzt sich durch. 1. Die Triebfeder-Lehre in Periode υ/ϕ (1776–78): Für den Kant bis zur ersten Hälfte der achtziger Jahre hat das moralische Gesetz, wie dargelegt (cf. 2.3.2 und 2.7.1), an sich selbst nicht genug real bindende Kraft zur moralischen Handlung, obwohl es als logisches Dijudikationsprinzip der Konsistenz immerhin regulative und normative Kraft zu ihr hat. Zur realen, subjektiven Exekution der moralischen Gesetze durch ein endliches Vernunftwesen muß ein Endzweck, auf den das Wohlverhalten ausgeht, der Zweck des vollständigen Guts (die wahre Glückseligkeit), in Anspruch genommen werden, aber damit werden auch die Idee einer intelligiblen Welt und der Begriff eines allgemeingültigen Willens, der zugleich allvermögend ist, als Triebfedern benötigt.456 So heißt es auch: „Das Reich Gottes auf Erden nen Glückseligkeit.)“ Vgl. auch KpV, V 117 Z20f <A211>. Der Standpunkt in der Vernunft kann bei Kant mit demjenigen in der Verstandeswelt gleichbedeutend sein. Vgl. zum letzteren Standpunkt GMS, IV 458; Träume, II 336 Z19. 455 Vgl. z.B. Anthr., VII 230. 456 Vgl. z.B. Refl. 7097, XIX 248, υ? (1776–78?): „Die moralischen Gesetze haben an sich selbst keine vim obligatoriam, sondern enthalten nur die Norm. Sie enthalten die objektiven Bedingungen der Beurteilung, aber nicht die subjektiven der Ausübung. Die letzten bestehen in der Übereinstimmung mit unserem Verlangen zur Glückseligkeit. Die moralischen Gesetze bedürfen einen Gesetzgeber, dessen Willen ein guter Wille (ein heiliger), aber auch ein allvermögender Wille sei.“ 125 ist ein Ideal, welches in dem Verstande desjenigen eine bewegende Kraft hat, der sittlich gut sein will.“457 Oder: „Ohne Religion würde die Moral keine Triebfedern haben, die alle von der Glückseligkeit müssen hergenommen sein.“458 Die bewegende Kraft bzw. die Triebfeder ist hier religiös-teleologisch vom Endzweck als dem vollständigen Gut her gedacht. Dieser Gedanke der „Triebfeder aus der andern Welt“ bei Kant ist weder etwa epikureisch noch stoisch, sondern stammt offensichtlich aus der christlichen Lehre: „Nur Christus gibt ihr [sc. der Tugend] den innern Wert und auch die Triebfeder.“459 Mit Christus ist hier nicht gerade das Ideal der Heiligkeit, sondern eher lediglich der Lehrer des Evangeliums gemeint, der hinsichtlich der Lehre vom höchsten Gut neben Epikur und Zenon steht. Bei der Triebfeder für die Tugend handelt es sich um die intelligible Welt als die andere Welt, in der die wahre Glückseligkeit erlangt wird, indem sie mit der Sittlichkeit übereinstimmt. Der vom freien Willen vergegenständlichte Endzweck bildet für ihn hier die Triebfeder zur moralischen Handlung, indem er ihn von empirischen Bestimmungsgründen distanziert.460 (Zur Aufrechterhaltung der ,moralisch-teleologischen‘ Grundrichtung, von der Freiheit auf den Endzweck auszugehen, in Periode υ/ϕ (1776–78): Es ist nun zu beachten, daß Kant in derselben Periode auch schon davor warnt, die Moral auf Religion zu gründen. „Unter allen Abweichungen von der natürlichen Beurteilung und bewegenden Kraft der Sitten ist die schädlichste, da man die Lehre der Sitten in eine Lehre der Religion verwandelt oder auf Religion gründet. Denn da verläßt der Mensch die wahre moralische Gesinnungen, sucht die göttliche Gunst zu gewinnen, abzudienen oder zu erschleichen und läßt allen Keim des Guten unter den Maximen der Furcht ersterben.“461 Ungeachtet der Triebfeder aus Religion richtet sich also der Wille ,moralisch-teleologisch‘, d.h. in der moralisch-praktischen Zwecksetzung, erst von der Freiheit als der Unabhängigkeit von allen seinen empirischen Bestimmungsgründen (negative Freiheit), demnach von der Autonomie des Willens, ausgehend, den Gesetzen gemäß auf Religion. Denn sonst würde er den empirischen Bestimmungsgründen, die sogar verabsolutiert sein können, anheimfallen, welches in seine Heteronomie (den Verlust der Freiheit) und Unfähigkeit, das unbedingt Gute zu entwerfen, münden würde. Aus der Moral geht doch ein Zweck hervor, und die Moral führt unumgänglich zu Religion.462 Die zitierte Reflexion deutet darauf hin, daß die ,moralisch-teleologische‘ Grundrichtung des freien Willens auch in Periode υ (1776–78) prinzipiell beibehalten ist. Auch das Prinzip von Autokratie/Epigenesis in derselben Periode ist, wie dargelegt (cf. 2.4.4), eben dieser ,moralisch-teleologischen‘ Grundrichtung gemäß gebildet.) Refl. 6904, XIX 201, υ (1776–78). Refl. 6858, XIX 181, υ? ϕ? (1776–78). Vgl. auch Met.L/1, XXVIII 289: „Er [sc. der moralische Beweis zu einem künftigen Zustand (als einer künftigen Welt), d.i. der Glaube an denselben] ist die Triebfeder zur Tugend, und wer das Gegenteil einführen wollte, der hebt alle moralische Gesetze und alle Triebfedern zur Tugend auf; dann sind die moralischen Grundsätze nur Chimären.“ 459 Refl. 6838, XIX 176, ϕ (1776–78). Vgl. auch Ethik Menzer, S. 13. 460 Zu Refl. 6838. 461 Refl. 6903, XIX 201, υ (1776–78). Vgl. hierzu auch GMS, IV 443 Z10–19 <B92>. 462 Vgl. Rel., VI 5 Z1f, 6 Z8, 8 Z37. 457 458 126 2. Von Periode υ (1776–78) an spricht nun Kant häufiger als bis dahin über die christliche Morallehre.463 Er erwähnt sogar Demut und Gnaden: „Gegen Gott haben wir kein Verdienst, sondern lauter Schuldigkeit. Dieses ist die Ursache der Demut, aber nicht eine Absprechung der Hoffnung, weil dazu nur die Würdigkeit gehört (nicht unwürdig), um aus Gnaden Glückseligkeit, die man nicht verdient, zu erlangen.“464 Diese Grundgesinnung wird auch der Lehre über das höchte Gut in der KpV, wohl in den Formulierungen rationalisiert, aber inhaltlich unverändert, zugrundeliegen.465 Nun sind aber der freie Wille (bzw. die Vernunft) als Ursprungsort der Moralität und das moralische Gesetz in ihm moralphilosophische Grundprinzipien (Fundament der Ethik), die von Kant bereits in der ersten Hälfte der sechziger Jahre gegründet sind und weiter beibehalten werden. Zu diesem Fundament der Moralität ist nunmehr die eben genannte christliche Gnaden- bzw. Erlösungslehre, die seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in Kants Denken als überwiegendes Element eingedrungen ist, hinzugetreten. Seither ist es seine Aufgabe geworden, jenes Fundament mit dieser Lehre zusammenzuschließen. Daraus wurden, wohl ein wenig monotone, aber immerhin umfangreiche Versuche angestellt, für die eben das Moralprinzip von Autokratie/Epigenesis repräsentativ ist, und aus denen sich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre und der ersten Hälfte der achtziger Jahre die Lehre über das höchste Gut entwickelt, die als die Dialektik der KpV veröffentlicht wird. Auch die oben erwähnte Triebfeder-Problematik trat in Periode υ/ϕ (1776–78) in den Vordergrund, veranlaßt von der christlichen Gnadenlehre, weil ein überzeugter Christ in seinem realen Leben nicht allein von der Idee der Autonomie (Freiheit und Gesetz) zum Wohlverhalten bewegt, sondern gewiß von der Idee vom Reich Gottes ermutigt wird. Es ist nun aber für Kant seit der frühen Gründung seiner Ethik ein bereits vorprogrammierter Grundgedanke gewesen, daß Vernunft und Gesetz objektiv der Bestimmungsgrund des Willens sind und daß sie demzufolge auch seine Triebfeder zur moralischen Handlung sein müssen. Er mußte sich Vgl. z.B. Refl. 7060, XIX 238f, υ (1776–78), Refl. 7312, XIX 309, ψ (1780–89). Vgl. auch Refl. 6832, 6836, 6840, 6872, 6878, 6882, 6894, 7093, 7094, etc. 464 Refl. 7166, XIX 262, υ (1776–78). 465 Geläufiger Ansicht zufolge soll Kant neben Fichte die christliche Erlösungslehre abgelehnt haben. Näher gesehen aber hat er sich lediglich gegen denjenigen gewendet, der „diese Art der Erlösung des Menschen vom Bösen [sc. wie das, was er hofft, zugehe] durchaus wissen will,“ und zwar, „um sich (...) aus dem Glauben, der Annahme, dem Bekenntnisse und der Hochpräzisung alles dieses Offenbarten einen Gottesdienst machen zu können, der ihm die Gunst des Himmels vor allem Aufwande seiner eigenen Kräfte zu einem guten Lebenswandel, also ganz umsonst erwerben, den letzteren wohl gar übernatürlicher Weise hervorbringen, oder, wo ihm etwa zuwider gehandelt würde, wenigstens die Übertretung vergüten könne“ (Rel., VI 172 <B263>). Kant ist also als praktischer Pietist nur gegen den Religionswahn. Seine rationalisierte Erlösungslehre zeigt sich etwa darin, „daß, wer in einer wahrhaften der Pflicht ergebenen Gesinnung so viel, als in seinem Vermögen steht, tut, um (wenigstens in einer beständigen Annäherung zur vollständigen Angemessenheit mit dem Gesetze) seiner Verbindlichkeit ein Genüge zu leisten, hoffen dürfe, was nicht in seinem Vermögen steht, das werde von der höchsten Weisheit auf irgendeine Weise (...) ergänzt werden, ohne daß sie [sc. die Vernunft] sich doch anmaßt, die Art zu bestimmen und zu wissen, worin sie bestehe“ (Rel., VI 171 <B262>). Dabei aber bleibt die Frage offen, ob derartige rationalisierte Erlösungslehre das Wesen einer religiösen Erlösung treffen kann. 463 127 also unter dem Einfluß der christlichen Gnaden- bzw. Erlösungslehre den exekutiven Grund der moralischen Handlung neu überlegen. Die Überlegung dauerte bis zur Zeit der Niederschrift der KpV. Die alten Leitlinien aber bestimmten stärker ihr Ergebnis, daß nämlich die Idee vom Reich Gottes nur sekundär den Willen bestimmen und insofern auch sekundär so etwas wie eine Triebfeder sein kann. Daraufhin wird der Name der Triebfeder, wie sogleich unten aufgewiesen wird, ausschließlich dem moralischen Gesetz zugewiesen. Bei dem Konzept, die Idee vom Reich Gottes sei die moralische Triebfeder, hat man es also nicht mit einer „älteren Triebfeder-Lehre“ zu tun, noch ist der Gedanke, das moralische Gesetz selbst sei Triebfeder, neu.466 Entwicklungsgeschichtlich betrachtet ist der letztere de facto älter als das erstere, welches demnach angemessener bloß als Übergangslehre von der moralischen Triebfeder bezeichnet werden müßte. Gesetz und Reich Gottes stehen beide in der Lehre über das höchste Gut und dessen Postulate selbst in KpV und Religionsschrift als Betimmungsgründe des Willens, obwohl das letztere nur ein sekundärer ist, beisammen (cf. 3.3.3 und 3.4.2.b). Lediglich der Name der Triebfeder wird ins Gesetz verlagert. 3. Die Triebfeder-Lehre in der Zeit der KrV: Aber zurück zu der Übergangslehre von der moralischen Triebfeder. Kant behält diese, nämlich daß die Idee der Moralität wohl Dijudikationsprinzip, demnach Gegenstand des Beifalls sein könne, aber an sich selbst nicht genug die treibende Kraft zur subjektiven Ausübung der Moralität besitze und daß die reale Triebfeder vielmehr dem höchsten Wesen und der intelligiblen Welt, mit einem Wort dem Reich Gottes, zugeschrieben werden solle, auch noch in der KrV ausdrücklich bei: „Ohne also einen Gott und eine für uns jetzt nicht sichtbare, aber gehoffte Welt sind die herrlichen Ideen der Sittlichkeit zwar Gegenstände des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebfeder des Vorsatzes und der Ausübung, weil sie nicht den ganzen Zweck, der einem jeden vernünftigen Wesen natürlich und durch eben dieselbe reine Vernunft a priori bestimmt und notwendig ist, erfüllen.“467 Der Satz steht aber damit in engem Zusammenhang, daß moralische Gesetze ohne die Postulate für „leere Hirngespinste“ gehalten würden (cf. 3.4.2.b), und bestätigt daher auch die Relevanz der intentionalen intellektuellen Ausdehnung der Gesetzlichkeit des freien Willens zum Endzweck, dessen Realisierbarkeit einen Gott und eine gehoffte Welt postuliert. Er verträgt sich demzufolge als solcher doch auch mit dem praktisch-theoretischen Umkreis der neu formulierten Triebfeder-Lehre in der KpV. In der Periode der KrV aber wird das Gewicht des Endzwecks sowie seiner Postulate als Triebfedern nur stärker als in der KpV vorgestellt. (Zur Aufrechterhaltung der ,moralisch-teleologischen‘ Grundrichtung in der Zeit der KrV: Allerdings warnt Kant auch in der KrV davor, die moralischen Ge466 Dies im Unterschied zu M. Albrecht. Vgl. seine philologisch umfangreiche Dissertation, Kants Antinomie der praktischen Vernunft, Hildesheim 1978, S. 153 Anm. 472, S. 93 Anm. 293 und S. 136. 467 KrV, III 527 <B841>. Vgl. auch Religionslehre Pölitz, XXVIII 1073: „Die Pflichten der Moral sind also apodiktisch gewiß, weil sie mir von meiner eigenen Vernunft aufgegeben werden; aber es würden ihnen alle Triebfedern fehlen, die mich bewegen könnten, ihnen gemäß, als vernünftiger Mensch zu handeln, wofern kein Gott, und keine zukünftige Welt wäre.“ 128 setzen vom Begriff eines Urwesens abzuleiten, und sagt: „Denn diese [sc. die moralischen Gesetze] waren es eben, deren innere praktische Notwendigkeit uns zu der Voraussetzung einer selbstständigen Ursache oder eines weisen Weltregierers führte, um jenen Gesetzen Effekt zu geben“.468 Die ,moralisch-teleologische‘ Grundrichtung, von der Freiheit mit den Gesetzen auszugehen und dann auf den Endzweck zu gehen, ist auch hier unverändert; nur kann das Postulat eines höchsten Wesens den Gesetzen „Effekt“, d.i. die für uns verbindende Kraft, geben. Auch Duisburg-Fragment 6 (Refl. 7202), das zur Zeit der KrV gehört, hat es, wie dargetan (cf. 2.6.2), nicht auf den religiösen Eudämonismus abgesehen.) 4. Noch in der GMS, wo auch der Gedanke, das moralische Gesetz allein sei die Triebfeder, sich weiter ausbildet, bleibt der intelligiblen Welt der Name der Triebfeder erhalten: „[E]s müßte denn diese Idee einer intelligibelen Welt selbst die Triebfeder oder dasjenige sein, woran die Vernunft urspünglich ein Interesse nähme“.469 Die intelligible Welt wird aber im 3. Abschnitt der GMS in erster Linie transzendental-subjektiv als Grund der Sinnenwelt, und nicht ausdrücklich als vergegenständlichter Endzweck vorgestellt (cf. 2.8). 5. Aber schon in „Was heißt: S.i.D.or.?“ (1786) passiert es, daß die Triebfeder zur Befolgung der Gesetze von der Seite des höchsten Wesens auf die der Gesetze selber hin verschoben wird.470 Danach weist erst die KpV den Namen der Triebfeder ausschließlich dem moralischen Gesetz selbst zu: Es wird nämlich in ihr deklariert, daß „die Triebfeder des menschlichen Willens aber (...) niemals etwas anderes als das moralische Gesetz sein könne, mithin der objektive Bestimmungsgrund jederzeit und ganz allein zugleich der subjektiv hinreichende Bestimmungsgrund der Handlung sein müsse“.471 Damit setzt sich allererst der anfängliche Leitgedanke über die Bewegkraft des obersten Grunds der Moralität vollauf durch.472 In eins damit wird auch die christliche Morallehre hinsichtlich der Triebfeder in modifizierter Form dargestellt; ihr Prinzip sei nunmehr ausdrücklich die Autonomie der Vernunft, die die Triebfeder allein in die Vorstellung der Pflicht setzt.473 Während KrV, III 530f <B846>. GMS, IV 462 <B126>. 470 Vgl. dazu Was heißt: S.i.D.or.?, VIII 139 Z22–28. 471 KpV, V 72 <A127>. Vgl. auch V 75 Z20–26 <A133>, 117 Z13f <A211>. In den späten Schriften vgl. z.B. V.e.vorn.Ton, VIII 397 Z29f. 472 Vgl. Kants Brief an M. Herz (gegen Ende 1773): „Der oberste Grund der Moralität muß nicht bloß auf das Wohlgefallen schließen lassen, er muß selbst im höchsten Grade wohlgefallen, denn er ist keine bloß spekulative Vorstellung, sondern muß Bewegkraft haben und daher, ob er zwar intellektual ist, so muß er doch eine gerade Beziehung auf die ersten Triebfedern des Willens haben.“ (In: Kant, I., Briefwechsel, Auswahl und Anmerkungen von O. Schöndörffer, Hamburg 2 1972, S. 114f.) 473 Vgl. dazu KpV, V 129 <A232>: „Diesem ungeachtet ist das christliche Prinzip der Moral selbst doch nicht theologisch (mithin Heteronomie), sondern Autonomie der reinen praktischen Vernunft für sich selbst, weil sie [darunter möchte ich nicht sosehr die reine praktische Vernunft, sondern vielmehr die christliche Moral verstehen; statt ,sie‘ wäre vielleicht ,es‘ besser] die Erkenntnis Gottes und seines Willens nicht zum Grunde dieser Gesetze, sondern nur der Gelangung zum höchsten Gute unter der Bedingung der Befolgung derselben macht und selbst die eigentliche Triebfeder zu Befolgung der ersteren [sc. der Gesetze] nicht in den gewünschten Folgen derselben [sc. der Befolgung], sondern in der Vorstellung der Pflicht allein setzt, als in deren treuer Beobachtung die Würdigkeit 468 469 129 in der GMS die intelligible Welt noch für den Grund der moralischen Triebfeder (als des Interesses am Gesetze), transzendental-subjektiv verinnerlicht, verwendet wird (cf. 2.8), ist sie in der KpV nichts als der bloß nach einer Idee angenommene, demnach menschliche Willkür nur essentiell bestimmende Grund.474 Demzufolge hat man es in der KpV bei der Idee der intelligiblen Welt nicht mit der unmittelbaren Triebfeder zur Handlung zu tun, sondern sozusagen lediglich mit der Triebfeder aus der Hoffnung im Vernunftglauben. Daß nun die intelligible Welt als der Endzweck der wahren Glückseligkeit (das Reich Gottes) nicht länger primär die Rolle der Triebfeder zur Befolgung des moralischen Gesetzes spielt und daß demzufolge dieses selbst sich als Triebfeder dient, ist eigentlich objektiv darin verankert, daß moralische Gesetze, selbst wenn sie sich auf den Zweck der Glückseligkeit beziehen und somit eben den Begriff der unvollkommenen Pflicht betreffen, auch ohne die Voraussetzung eines Begriffs von der intelligiblen Welt als einem vergegenständlichten Zweck sowie von Gott, der die Natur mit dem Zweck des freien Willens übereinstimmend zu machen vermag, für sich selbst bestehen und den Willen für sich alleine vollständig moralisch bestimmen können müssen und daß folglich der Endzweck der wahren Glückseligkeit, das höchste Gut, nicht primär der Bestimmungsgrund des freien Willens, sondern vielmehr bloß das von diesem Willen vergegenständlichte, demnach von ihm zu erstrebende Objekt (finis in consequentiam veniens) sein muß. Damit setzt sich auch die ,moralisch-teleologische‘ Grundrichtung vollauf durch, in der die Freiheit durch Gesetze den Endzweck bestimmt. Kant war sich über dieses Resultat spätestens zur Zeit der Niederschrift der KpV im klaren und hat es auch in einer Reflexion ausdrücklich und prägnant notiert: „1. Die Moral besteht für sich selbst (ihrem Prinzip nach) ohne Voraussetzung einer Gottheit. / 2. Das höchste Gut ist nicht der Bestimmungsgrund, sondern das Objekt eines durchs moralische Gesetz bestimmten Willens“.475 Diese Zunahme der Gewichtigkeit der moralischen Gesetze verändert jedoch nicht die formale Struktur der intellektuellen Ausdehnung zwischen dem freien Willen und seinem Endzweck vor dem Hintergrund einer intelligiblen Ordnung – mit den Worten der „Reflexionen“ zwischen Autokratie der Freiheit und Epigenesis der Glückseligkeit –, in die ja auch die moralischen Gesetze zweckmäßig eingefügt sind; nur der exekutive Schwerpunkt ist mehr in den Ursprung der intellektuellen Ausdehnung, nämlich in den freien Willen verlagert, d.i. bei den Grundlegungsschriften in die Autonomie des Willens, indem erneut und ausdrücklich festgestellt wird, daß die Bestimmungsrichtung der intellektuellen Ausdehnung durch und durch vom freien Willen aus auf seinen Endzweck hin geht. Die Verlagerung des Namens Triebfeder in das moralische Gesetz hindert aber das höchste Gut bzw. seine Momente nicht daran, de facto die sekundären Triebfedern zu sein. Nur wird dabei nicht mehr der Name Triebfeder verwendet. Wenn es des Erwerbs der letzteren [sc. der gewünschten Folgen] allein besteht.“ 474 Vgl. dazu KpV, V 42–45 <A72–78>. 475 Refl. 6107, XVIII 455, ψ3−4 (1785–89). Vgl. auch Refl. 8097, XIX 641, ω2 (1792–94). 130 z.B. heißt: Das Ideal der Heiligkeit gibt uns Kraft, uns zu ihm zu erheben,476 so ist damit in Wirklichkeit eine sekundäre moralische Triebfeder gemeint. 2.7.3 Die Verlagerung der moralischen Triebfeder und die motiva moralia. Eine Triebfeder, die dem Begriff eines moralischen Motivs als Gegenstandsvorstellung entspricht, muß unvermeidlich auch in der Idee vom Reich Gottes angesetzt werden. Der Grund, warum in der Übergangslehre die moralische Triebfeder in die Idee vom Reich Gottes, d.i. den Endzweck, gesetzt werden muß, liegt zum Teil darin, daß sie vom Begriff eines moralischen Motivs aus konzipiert ist, bei dem es sich, da er schulphilosophischer Herkunft ist, nicht sosehr um das Gesetz selbst als die formale Bedingung der Moralität in der Gesinnung, als vielmehr um eine Gegenstands-, demnach Zweckvorstellung handelt, die erst aus dem Gesetz hervorgeht. Die moralischen Motive als solche Zwecke beziehen sich auf beide Bestandstücke des höchsten Guts (d.i. des Endzwecks), Sittlichkeit und Glückseligkeit, welche aber erst im Reich Gottes realisiert werden sollen. Folglich muß die moralische Triebfeder, die konzeptionell mit dem Begriff eines Motivs einhergeht, unvermeidlich in den Endzweck vom Reich Gottes gelegt werden. Kant selbst aber setzt das moralische Motiv mit dem Gesetz gleich, was der Sache nach der Verlagerung der moralischen Triebfeder in dasselbe entsprechen kann. Dies ist nun in extenso zu explizieren. (a) Motive können sowohl Gegenstandsvorstellungen des Guten und Bösen als auch das Gesetz selbst sein. Causae impulsivae als Gegenstandsvorstellungen nach Wohlgefallen und Mißfallen, die das arbitrium bestimmen, sind stimuli, wenn sie „von der Art abhängen, wie wir von den Gegenständen affiziert werden“. Wenn sie aber „abhängen von der Art, wie wir die Gegenstände durch Begriffe, durch den Verstand; so sind das Motive.“477 Diese beziehen sich also prinzipiell als eine Unterart von causae impulsivae ebenso auf Gegenstände, die durch Begriffe bzw. den Verstand (Vernunft) erkannt werden, wie jene auf ihre Gegenstände. M.a.W.: Auf die Freiheit als „independentiam a necessitatione per stimulos“ wird „das Vermögen, nach Motiven zu handeln“ gegründet, welches damit gleichbedeutend ist, „nach der Dijudikation des Guten und Bösen“ zu handeln. Motive sind demzufolge Gegenstandsvorstellungen des Guten und Bösen im Urteil der Vernunft, auf die die positive Freiheit, von der Unabhängigkeit von Gegenstandsvorstellungen abgewendet, sich wieder 476 Vgl. dazu Rel., VI 61 Z3–7, Z13 <B74>. Freilich ist auch in der Religionsschrift die moralische Triebfeder das moralische Gesetz. Vgl. hierzu beispielsweise die dem ebengenannten Beleg folgende Stelle, VI 62 Z22 <B77>. 477 Met.L/1, XXVIII 254. Zu stimuli und motiva vgl. Baumgarten, Metaphysica, lat., § 677 u. 690 (AA XV 49 u. 51; dt.: § 500 u. 511). 131 richtet. Sowohl stimuli als auch motiva beziehen sich also auf Gegenstände, und auch elateres als subjektive causae impulsivae sind demnach gegenstandsbezogen; dementsprechend „ist nur Vergnügen oder Tugend das, was vim elateris hat“, während „Geschmack“ doch „nicht vim elateris“ „hat“,478 weil er nicht auf Gegenstände bezogen (interesselos) ist. Kurz: „motiva sunt repraesentationes boni vel mali“.479 Motivum ist also ein bonum. Wenn das letztere absolutum ist, so heißen die Motive motiva moralia; wenn es comparativum ist, so motiva pragmatica.480 Da die moralischen Motive Gegenstandsvorstellungen des Guten und Bösen sind, gilt für sie alles, was im Gegenstand-Kapitel der KpV negativ gesagt wird (cf. 3.2.1.f– h); sie können aber nicht das Gesetz selbst sein, sofern sie repraesentationes boni vel mali sind. Kant war sich dessen von früh an bewußt, daß die motiva nur Gegenstände, die mit den Gesetzen harmonieren, und nicht ohne weiteres die Gesetze selbst sind, die sich im gleichsam isolierten freien Willen – weil nichts Äußeres (stimuli oder Gottheit) ihn bestimmt – zeigen und ihn actualiter als subjektive Gründe nezessitieren; das Gute – mithin auch das Motiv – ist nämlich die Wirkung, die nach Gesetzen des Willens möglich ist.481 Das Gesetz ist der „allgemeine Grund der moralischen Verknüpfung der freien Willkür mit ihrem Gegenstand“,482 der auch motivum sein kann. M.a.W.: Das Gesetz ist „die transzendentale Nezessitation von mir“, die „nicht wahrgenommen werden“ kann, und das, was gar nicht wahrgenommen werden kann, ist praktisch doch nichts, weil solches „nicht in Anschlag der Bewegungsgründe“, mithin auch nicht in Anschlag der motiva, „kommt“.483 Das Gesetz kann nämlich nicht als Bewegungsgrund (motivum) der Willkür bezeichnet werden, solange dieser ein wahrgenommener Gegenstand sein soll. Die Motive werden vielmehr erst durch den Akt der Freiheit, die Spontaneität der Kausalität des Wollens, die die Aktualität des Gesetzes bedeutet, hervorgebracht.484 Das Gesetz und die Motive sind daher voneinander unterschieden. Dementsprechend muß die moralische Triebfeder, die als causa subiective movens objektiv dem Motiv entspricht, nicht sosehr auf der transzendental-subjektiven Seite des Gesetzes als vielmehr auf der verobjektivierten Seite von Gegenstandsvorstellungen gesetzt Refl. 1043, XV 467, ψ1−2 (1780–84). Refl. 1008, XV 449, Nachtrag aus den 70er Jahren. 480 Vgl. dazu Met.L/1, XXVIII 258. 481 Ref.3872, XVII 319, η? (1764–68?): „Der freie Wille ist gleichsam isoliert. Nichts Äußeres bestimmt ihn; er ist tätig, ohne zu leiden. Die motiva sind nur Gegenstände, die mit dem innern Gesetze seiner Tätigkeit harmonieren.* [* Nachtrag aus einer späteren Zeit: Nicht die objektiven, sondern subjektiven Gründe nezessitieren actualiter.] Das Gute bewegt nur einen guten Willen, d.i. es [sc. das Gute] ist nur die Wirkung, die nach Gesetzen desselben möglich ist. Er mag nun von Bewegursachen [sc. stimuli] oder von causis efficientibus (der Gottheit) bestimmt sein, so ist das Subjekt an eine fremde Ursache vermittelst einer Kette gehängt, und seine Handlungen sind nur abgeleitet das Gute sowohl als das Böse.“ 482 Refl. 6473, XIX 18, ζ? η? κ? (1764–69?). 483 Refl. 4223, XVII 463, λ (1769–70). 484 Vgl. dazu Refl. 5438, XVIII 182, υ? (1776–78?): „Das Vermögen, die Motiven des Wollens schlechthin selbst hervorzubringen, ist die Freiheit. Dieser actus beruht nicht selbst auf dem Wollen, sondern ist die Spontaneität der Kausalität des Wollens.“ 478 479 132 werden. Wenn also Kant in seiner späten Schrift von 1793 deklariert: die Motive sind „nicht gewisse vorgesetzte, aufs physische Gefühl bezogene Objekte als Zwecke“ d.h. materiale Zwecke, „sondern nichts als das unbedingte Gesetz selbst“,485 so stellt diese Erklärung eine Abweichung von grundsätzlichen Erläuterungen dar, die er normalerweise dem Begriff der Motive gegeben hat, und weist darauf hin, daß er hier den Sachverhalt vereinfacht und ganz und gar mit dem Wolffianischen Begriffsrahmen des motivum gebrochen hat, um seine Lehre von der transzendentalsubjektiven Aktualität des Gesetzes aus Freiheit vollständig durchzusetzen, die den Willen nezessitiert. Der Gedanke, daß moralische Motive das Gesetz selbst seien, ist aber schon in der Überlegung vorbereitet, daß sie in formale und materiale differenziert werden, und daß die ersteren als motiva moralia obligantia bezeichnet werden, die sich auf das Gesetz beziehen können.486 Der Begriff vom moralischen Motiv bei Kant steht innerhalb der Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens auf Gegenstände und drückt als solcher dessen Bewegungskraft überhaupt in dieser Ausdehnung aus, obwohl er ursprünglich gegenständliche Bewegungskraft bedeutet. Die vereinfachte Identifizierung des Motivs mit dem Gesetz steht der Sache nach mit der Verlegung der Triebfeder ins Gesetz in Parallele. Meistens aber hat Kant seine Definition des Motivs entweder nicht vollauf vom Wolffianischen Begriffsrahmen getrennt oder demselben treu angegeben, wonach die motiva zu den causae impulsivae als Gegenstandsvorstellungen der Willkür gehören. (b) Motiva moralia und Endzweck (Sittlichkeit und Glückseligkeit). Aus dem zu (a) Gesagten erhellt auch, daß der Begriff eines Motivs als einer Gegenstandsvorstellung der Willkür auf den eines Zwecks verweist.487 Denn der Begriff vom Bonum, dessen Vorstellung auch motivum ist, deutet auch klar auf den Zweck hin (cf. 3.2.4). Der Begriff des Motivs läßt sich Zwecken beilegen. Da die moralischen Motive als Gegenstandsvorstellungen der Willkür auch die von der reinen praktischen Vernunft vergegenständlichten Zwecke (das Gute überhaupt) begrifflich umfassen können, so müssen sie sich auch auf den Endzweck 485 Gemeinspruch, VIII 283. (Vgl. auch Ethik Menzer, S. 18.) In der „MS Vigilantius“ (Vorlesung 1793/94) führt Kant wieder vorsichtig aus und erklärt die Identität des motivum mit dem Gesetz nicht so direkt wie im „Gemeinspruch“. Vgl. dazu MS Vigilantius, XXVII 493f. Nun aber kann das moralische Gesetz freilich doch sekundär motivum sein, wenn es im vergegenständlichten höchsten Gut angetroffen wird. 486 Vgl. dazu Refl. 6720 und 6721, XIX 140f, ξ? (1772?). 487 Vgl. dazu auch GMS, IV 427 <B63f>: „Nun ist das, was dem Willen zum objektiven Grunde seiner Selbstbestimmung dient, der Zweck“. „Der subjektive Grund des Begehrens ist die Triebfeder, der objektive des Wollens der Bewegungsgrund [sc. das Motiv]; daher der Unterschied zwischen subjektiven Zwecken, die auf Triebfedern beruhen, und objektiven, die auf Bewegungsgründe ankommen, welche für jedes vernünftige Wesen gelten.“ An der Idee des Zwecks an sich selbst aber wird dieser objektive Zweck, der aufs Motiv ankommt, transzendental subjektiviert. Wenn das Motiv ihm beizulegen ist, so muß es auch subjektiviert und in der transzendental-subjektiven Aktualität des Gesetzes aus Freiheit gesetzt werden. Damit kann die Verlagerung der moralischen Triebfeder ins Gesetz zusammengehen. 133 (das höchste Gut) beziehen. So wird gesagt: „Die motiva moralia sind rational und auf Ideen gegründet, deren Gegenstand, die allgemeine Einstimmung der Freiheit und daraus die Glückseligkeit, in concreto nicht möglich ist.“488 Bei der allgemeinen Einstimmung der Freiheit mit sich selbst als mit den Gesetzen handelt es sich um die eigene moralische Vollkommenheit, mithin auch die Heiligkeit, die aber beim endlichen Vernunftwesen nur als subjektivierte Sittlichkeit bzw. Tugend realisierbar ist. In dieser ist die Würdigkeit, glücklich zu sein, verankert, wodurch die wahre Glückseligkeit herbeizuschaffen ist. Beide aber, Heiligkeit und wahre Glückseligkeit, die in der Idee vom Reich Gottes vorzustellen sind, sind als Zwecke (Gegenstand der Ideen) in diesem Leben in concreto gar nicht möglich. Sie stehen aber immerhin im Umkreis der motiva moralia (causae obiective moventes) und können demnach auch subjektiv elateres (causae subiective moventes) sein. Daraus kann also der Gedanke entstehen, daß die Idee vom Reich Gottes als das maximierte moralische Motiv (der Endzweck) die moralische Triebfeder zur Handlung sein kann. (c) Die Verlagerung der primären moralischen Triebfeder ins Gesetz. Es ist für Kant von früh an klar, daß intellektuell die Willkür durch das Gesetz (den kategorischen Imperativ) gänzlich zu bestimmen ist. Allein, sie ist, als dem endlichen Vernunftwesen gehörend, auch sinnlich und folgt demnach nicht immer der objektiven Nezessitation. Kant versucht daher, diese Schwäche der menschlichen Willkür im Rahmen der wegen deren Endlichkeit notwendigen Zwecksetzung, die in der Verarbeitung der aus der Sinnlichkeit stammenden empirischen Materie durchs Gesetz ausgeführt wird, zu überwinden, und spricht demzufolge dem Endzweck die moralische Triebfeder zu; denn auch vom Zweck her soll die sinnliche Willkür bestimmt werden können. Indessen verlegt er später in der Zeit der Niederschrift der KpV die moralische Triebfeder aus dem Endzweck, der erst aus dem Gesetz notwendig abgeleitet und entworfen wird, ins Gesetz selbst, während der Begriff der Triebfeder (elater) überhaupt sich immer noch auf die Gegenstandsvorstellung nach Wohlgefallen und Mißfallen bezieht, da die empirischen Triebfedern Gegenstandsvorstellungen des Angenehmen sind.489 Die Idee vom Reich Gottes, der das moralische Motiv beizulegen ist, kann demnach erst als Korrelat des Gesetzes in der intelligiblen Ordnung als Erweiterung der moralischen Gesetzlichkeit eine sekundäre Triebfeder sein. Das schließt aber nicht aus, daß das Gesetz selbst erst in Bezogenheit auf die motiva moralia, zu deren Machtumkreis die Idee vom Reich Gottes gehört, die primäre Triebfeder sein kann. Refl. 1044, XV 468, ψ1−2 (1780–84). Vgl. dazu Refl. 1056, XV 470f, ψ3 (1785–88): „Die Möglichkeit einer Vorstellung, causa impulsiva zu sein, ist elater animi; wie etwas elater animi sein könne, ist nicht immer einzusehen, außer bei dem Angenehmen. Wie das Gesetz elater sein könne.“ 488 489 134 2.7.4 Der Sinn der Verlagerung der moralischen Triebfeder im System der Kantischen Grundlegung der Ethik. Die Verlagerung der moralischen Triebfeder ins Gesetz bedeutet, daß die primären Bestimmungsgründe des Willens, seien sie objektiv, seien sie subjektiv, nunmehr keinesfalls in den Endzweck, d. h. in die religiöse Teleologie gesetzt werden, wobei die Gefahr droht, daß die intellektuellen Zwecke in empirische Bestimmungsgründe des Willens transformiert würden,490 sondern gänzlich in das moralische Gesetz selbst (Faktum der reinen praktischen Vernunft) und somit in die positive Freiheit eines Handlungssubjekts, welche nun, wenn ihr Ursprung gesucht werden soll, transzendental-subjektiv auf der negativen Freiheit desselben als Unabhängigkeit von allen empirischen Bestimmungsgründen des Willens beruhen muß, weil sie sich nicht im geringsten von Anfang an auf eine transzendente Ordnung und Gesetzgebung der intelligiblen Welt als ihren realen Grund, sei dieser auch nur als Triebfeder erfordert, berufen kann; diese intelligible Welt wird erst in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase in der Erweiterung bzw. Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens aus negativer Freiheit auf den Endzweck als dessen Hintergrund angenommen und demnach auch als Endzweck angesetzt; sie darf nämlich nicht den primären Effekt auf die Willkür ausüben, weil man sonst Gefahr laufen würde, die Zwecke wieder in empirische Bestimmungsgründe des Willens umzuwandeln. Das Gesetz als Faktum, das der Willkür auch die moralische Triebfeder verleiht, und mithin auch die Freiheit als dessen ratio essendi sind allein der einzige Bestimmungsgrund der Willkür, der von allem Empirischen zu unterscheiden ist und sich keineswegs auf eine transzendent hypostasierte Ordnung als seinen realen Grund berufen darf. Der Ursprung der faktischen Autonomie der Vernunft im Handlungssubjekt findet sich, wenn er aufgesucht und zu diesem Zweck einmal von allen realen Bestimmungsgründen des Willens distanziert werden soll, kognitiv bloß in der negativen Freiheit, die nicht weiter real hinterfragt werden kann, obwohl er weiterhin essentiell und lediglich nach einer Idee substantiell angenommen werden mag. Die Sphäre der negativen Freiheit (der andere Standpunkt außer der Sinnenwelt) wird durch die radikale Distanzierung sowohl von allen Gegenstandsvorstellungen, Motiven und Triebfedern als auch von dem Prinzip der Selbstliebe, der pathologisch-praktischen Lust, sinnlichen Begierden und Neigungen und zuletzt von einer eminenten Angewiesenheit auf die religiöse Teleologie eröffnet. In ihr wird auch die Revolution in der Gesinnung als Gründung eines intelligiblen Charakters vollzogen. Sie ist aber der Ort, der für Kant schlechterdings unerklärbar und unerforschlich ist, weil darauf die Naturkausalität nicht angewendet werden kann, um sie zu erklären, und kann lediglich als intelligibel begriffen werden. D. Die intelligible Welt als bloßer Standpunkt außer der Sinnenwelt. 490 Vgl. dazu beispielsweise Refl. 6903, XIX 201; GMS IV 443 <B92>. 135 D. Die intelligible Welt als bloßer Standpunkt außer der Sinnenwelt. 2.8 Der Explikationsversuch des Prinzips der Exekution für die Verpflichtung der Gesetze aus der transzendental-subjektiv verinnerlichten intelligiblen Welt im 3. Abschnitt der GMS. Im 3. Abschnitt der GMS, der entgegen dem 2. Abschnitt, der den kategorischen Imperativ hinsichtlich seiner Formulierbarkeit, d.h. dijudikativ und begriffsanalytisch darstellt, die Exekutionsproblematik überhaupt thematisiert, werden das Interesse, das der Mensch an moralischen Gesetzen nehmen kann, und mithin auch die Triebfeder zu ihrer Befolgung, auf der ja auch das Interesse beruht, erörtert. Bei der Frage nach dem Interesse an moralischen Gesetzen bzw. der Triebfeder zu ihrer Befolgung hat man es zu tun mit der Frage nach der Möglichkeit der positiven Freiheit oder der Möglichkeit, wie reine Vernunft praktisch sein kann (d.i. wie die Allgemeingültigkeit der Form der Maxime, die zunächst nur dijudikativ ist, die Triebfeder ergeben und somit Interesse bewirken kann), welche Möglichkeit aber hinsichtlich ihrer theoretischen Begründbarkeit eigentlich nicht real einzusehen bzw. zu erklären ist.491 Die Begründung der exekutiven Realität der notwendigen Auswirkung des Begriffs der Einheit von Selbsttätigkeit (von sich aus tätig) und Gesetzlichkeit,492 die die erstere unvermeidlich mit sich führt, ist Kant zufolge vom menschlichen Verstande nie zu leisten, obwohl – bzw. gerade weil – diese Einheit, d.i. das reine sittliche Denken aus Freiheit, doch den Kern der Grundlage der Kantischen Grundlegung der Ethik bildet. Gleichwohl kann doch die Konstellation, in die die an sich unbegründbare Realität der Notwendigkeit der exekutiven Auswirkung dieser Einheit gesetzt ist, essentiell, d.h. nach Ideen, erörtert werden. Das Interesse nämlich, das der Mensch als Vernunftwesen an moralischen Gesetzen nimmt, kann, vom Begriff einer dem Vernunfwesen beigelegten reinen praktischen Vernunft ausgehend, wie folgt expliziert werden: Die reine praktische Vernunft verweist auf die Idee der Freiheit („Deduktion des Begriffs der Freiheit aus der reinen praktischen Vernunft“493 ), welche sodann die Idee einer intelligiblen Welt für den menschlichen Willen annehmbar macht; alsdann läßt sich aufgrund ihrer Annehmbarkeit gegenüber der Sinnenwelt auch das Interesse an moralischen Gesetzen hinsichtlich seiner zwischen beiden Welten befindlichen funkVgl. dazu GMS, IV 461 <B124f>. Zur Einheit von Selbsttätigkeit und Gesetzlichkeit Vgl. im 3. Abschnitt der GMS etwa IV 446 Z24 – 447 Z7 <B98>; sie artikuliert sich an dieser Stelle prägnant und eindrucksvoll, obwohl der Name Selbsttätigkeit fehlt. 493 GMS, IV 447 <B99>. Die Freiheit wird nicht im mindesten aus der theoretischen reinen Vernunft – wie D. Henrich diese Möglichkeit andeutet –, sondern wie hier ausdrücklich formuliert ist, aus der reinen praktischen Vernunft deduziert. 491 492 136 tionellen Position essentiell explizieren. Durch die Verwendung nun des Begriffs einer transzendental-subjektiv dem menschlichen Gemüte zugrundeliegenden reinen praktischen Vernunft im Rahmen der für die Grundlegung der Ethik wesentlich konstitutiven Triebfederproblematik wird die Idee der intelligiblen Welt nicht als ein vergegenständlichter Endzweck hingestellt – dies ist bei der Gedankenlinie Kants in der Phase der ,moralischen Teleologie‘ der Fall –, sondern sie wirkt sich hier im 3. Abschnitt der GMS als eine Idee durch reine praktische Vernunft hindurch vernunftkausal, sozusagen von innen her aus. Sie läßt sich bei der Erörterung der exekutiven Bestimmungsgründe zur moralischen Handlung in diesem Abschnitt transzendental-subjektiv verinnerlichen.494 Die transzendental-subjektive Verinnerlichung der intelligiblen Welt, und zwar als Grund der Freiheitskausalität des Willens, verstärkt doch die Grundposition der die ,moralische Teleologie‘ begründenden und mithin vollziehenden Autonomie des Willens in der Grundlegung der Ethik überhaupt. Es handelt sich bei ihr nämlich um die entwicklungsgeschichtliche Voraussetzung dafür, daß in der KpV endlich ausdrücklich das Gewicht der moralischen Triebfeder angemessen ins moralische Gesetz als kognitives Faktum verlagert wird, welches aber essentiell in der intelligiblen Welt beheimatet ist. Der Argumentationsgang des 3. Abschnitts der GMS weist öfters nicht eben eindeutige Richtung auf, und wiederholt kommen gleichartige Denkversuche und Formulierungen vor, weil Kant hier seine schon erworbenen Argumente noch unter diversen Aspekten prüft. Doch können aus diesen Denkversuchen und Formulierungen einige Hauptzüge des Argumentationsgangs entnommen werden. 1. Bei der reinen praktischen Vernunft hat man die „Urheberin ihrer Prinzipien“, unabhängig von fremden Einflüssen, vor sich; sie muß demnach „von ihr selbst als frei angesehen werden“.495 Die Freiheit der reinen praktischen Vernunft ist für 494 Bei der Exegese einer Stelle des Neuen Testaments aber ist Kant in dieser Richtung auf die Verinnerlichung der intelligiblen Welt doch nicht so weit gegangen wie im 3. Abschnitt der GMS. Das „Reich Gottes inwendig in euch“ (Lk 17, 21) nämlich, das philosophisch der verinnerlichten, intelligiblen Welt entsprechen könnte, besagt ihm zufolge lediglich, „uns jederzeit wirklich als berufene Bürger eines göttlichen (ethischen) Staats anzusehen“, und ist noch nicht so weit gedeutet, daß es ausdrücklich auf das Reich Gottes (und somit das Wirken Gottes) im Innern des Menschen hinweise. Vgl. dazu Rel., VI 136 <B205f>. 495 GMS, IV 448 <B101>, Kant erläutert hier das Vermögen der Vernunft in ihrer Urteilsfunktion (IV 448 Z13–16 <B101>). Darauf gestützt, wollen H. J. Paton und D. Henrich sie als auf die theoretische Vernunft bezogen verstanden wissen. Vgl. hierzu Paton, H. J.: Der kategorische Imperativ, Berlin 1962, S. 270 und Henrich, D.: Die Deduktion des Sittengesetzes, in: Schwan, A.: Denken im Schatten des Nihilismus, Darmstadt 1975, S. 64–69. In welchen funktionalen Zusammenhängen aber praktische Vernunft auch stehen mag, es läßt sich wenigstens konstatieren, daß sie als solche urteile: Vgl. dazu folgende Belege: „... so ist es doch immer nur eine und dieselbe Vernunft, die, es sei in theoretischer oder praktischer Absicht, nach Prinzipien a priori urteilt“ (KpV, V 121 Z4–6 <A218>); „im Urteile dieser gemeinen Vernunft“, die offensichtlich praktisch gemeint ist (KpV, V 91 Z25 <A163>); „im Urteile der Vernunft“ (KpV, V 75 Z14, 76 Z3f; Rel., VI 24 Z6); „alle Urteile über Handlungen“ (GMS, IV 455 Z12); „der praktischen [Urteile]“ (KrV, III 520 Anm. Z35 <B520>) etc. Sollte praktische Vernunft nicht urteilen können, so wäre auch die reine praktische Urteilskraft (KpV, V 67f <A119f>) ein Unding. Immerhin ist es doch wenigstens nicht fraglich, daß man es bei der Vernunft, von der hier in der GMS die Rede ist, zuletzt mit der reinen praktischen zu tun hat. So müßte dann auch mit F. Kaulbach gesagt werden können, daß „sich jeder 137 diese real, wohl aber für theoretische Vernunft eine bloße Idee. Die bloße Idee der Freiheit für theoretische Vernunft aber genügt doch der reinen praktischen Venunft, damit das Vernunftwesen in praktischer Hinsicht wirklich frei sein kann. Auf diese Weise wird in der Auseinandersetzung des 3. Abschnitts der GMS mit der Exekutionsproblematik die Freiheit durch den Begriff der Vernunft eingeräumt.496 2. Die Idee der Freiheit des Willens nun, die zunächst nichts als jene negatiAnspruch auf Beweis dieser Wirklichkeit [der Freiheit] durch theoretische Vernunft als ungerechtfertigt und als hinfällig erweist“ (Kaulbach, F.: Immanuel Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, Darmstadt 1988, S. 126). Dabei kann man sich auch daran erinnern, daß die Festsetzung der moralischen Gesetzlichkeit und mithin der Realität der Freiheit (bis in die erste Hälfte der sechziger Jahre) der Konzeption der Idealität von Raum und Zeit (im Jahre 1769 des großen Lichtes) vorausgeht, aufgrund derer sich die Lehre der theoretischen Erkenntnis der Erscheinungen in ihnen durch die transzendentale Apperzeption entwickelt. Auch der späte Kant spielt bei der Differenzierung der Selbsterkenntnis in zwei Modi, d.i. in die Erkenntnis der Erscheinungen von sich durch den Verstand als Vermögen der Spontaneität und „das Bewußtsein der reinen Spontaneität (den Freiheitsbegriff)“, gar nicht darauf an, daß die reine Spontaneität als Freiheit, die „durch den kategorischen Pflichtimperativ, also nur durch den höchsten praktischen,“ angekündigt wird, doch aus der Spontaneität des theoretischen Verstandes deduziert werden sollte. Vgl. dazu Anthr., Ergänzung aus Handschrift, VII 397–399. Daß nun die reine Vernunft vor dem Eintritt des moralischen Gefühls praktisch von sich selbst aus urteilt, ist festes Bestandstück der moralphilosophischen Gedanken Kants von früh an. In der Exekutionsproblematik nämlich beruht moralisches Gefühl auf dem Urteil, d.i. der Billigung der reinen praktischen Vernunft; die Exekutionskraft, die auch durch den Begriff der Freiheit getragen werden soll, und um die es sich ja beim 3. Abschnitt der GMS handelt, muß im Grundvermögen der reinen Vernunft im Menschen gesucht werden. Der Gedanke dieser Funktion des Urteils der reinen praktischen Vernunft in der Exekutionsproblematik tritt schon früh auf: „Das subjektive principium der Moral ist die Unterordnung aller Zwecke unter das Urteil (Billigung) der reinen Vernunft“ (Refl. 6636, XIX 121, κ–λ? 1769–70?). Er läßt sich aber auch wie folgt erklären: „Das moralische Urteil der Billigung und Mißbilligung geschieht durch den Verstand, die moralische Empfindung des Vergnügens und Abscheus durchs moralische Gefühl, doch so, daß nicht das moralische Urteil aus dem Gefühl, sondern dieses aus jenem entspringt. Alles moralische Gefühl setzt ein sittliches Urteil durch den Verstand voraus“ (Refl. 6760, XIX 152, ξ? 1772?). Die Quintessenz dieses Gedankens wird nun so artikuliert: „Es muß vom moralischen Gefühl niemals die Rede sein beim Urteil (es ist kein Sinn, sondern Wahl)“ (Refl. 7042, XIX 233 υ 1776–78). Dieses Urteil der Vernunft als „Wahl“ (das Wort erinnert an die Wahlfreiheit der Willkür, die praktisch ist), das exekutiv mit dem moralischen Gefühl eng verbunden ist, muß nicht unbedingt als theoretisches interpretiert werden; viel plausibler ist es, es bloß für praktisch zu halten. Auch aus diesen Belegen übrigens liegt es auf der Hand, daß die Billigung primär durch die Vernunft durchgeführt wird, und nicht durch das Gefühl. Die Billigung und Mißbilligung ist die Dijudikation (Beurteilung), die durch die Vernunft vollzogen werden soll (cf. 2.3.2). Vgl. dazu Refl. 6988, XIX 220, ϕ? (1776–78?): „Lehren der moralischen Beurteilung, zu erkennen, was gut und böse sei, was verabscheuenswürdig sei, und also Gründe der Billigung und Mißbilligung“. Selbst die „Selbstbilligung“ in der KpV (V 81 Z2 <A143>), wobei von der subjektiven Wirkung aufs Gefühl die Rede ist, ist doch eine Wirkung aus Vernunft als Zusammenstimmung mit sich selbst als mit den Vernunftgesetzen (vgl. Refl. 6892, XIX 195f). (Zur Selbstbilligung cf. Fußnote 295 in 2.4.1.) Dies gegen D. Henrich, der die Billigung bzw. Zustimmung mit complacentia gleichsetzt. Vgl. hierzu ders., Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, in: Prauss, G., Köln 1973, S. 230 (vgl. diesbezüglich auch S. 246: „Deshalb ist auch nur die sittliche Einsicht des Guten ursprünglich mit einem emotionalen Akt verbunden. Nur in ihm sind Billigung [!], Wohlgefallen und Achtung unwegdenkbare Elemente“); ders., Ethik der Autonomie, in: ders., Selbstverhältnisse, Stuttgart 1983, S. 30. Zu complacentia cf. 2.5.1. Die intellektuelle Ethik Kants aber muß vor jeder ästhetischen Interpretationstendenz bewahrt werden. 496 Vgl. dazu auch GMS, IV 459 Z9f <B120>: „Sie [sc. (die Idee der) Freiheit] gilt nur als notwendige Voraussetzung der Vernunft in einem Wesen, das sich eines Willens ... bewußt sein zu glaubt.“ 138 ve Freiheit, die „Unabhängigkeit von bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt“,497 ist, welche einräumt, lediglich einen anderen Standpunkt498 als den in der Sinnenwelt einzunehmen, ebnet jedoch dem Menschen den Weg in die Zugehörigkeit zur Intelligiblen Welt.499 Das Vermögen der Vernunft in ihm als „reine Selbsttätigkeit“ also führt unvermeidlich zu seiner Mitgliedschaft in der intelligiblen Welt.500 Dieser Verweis auf die intelligible Welt ist möglich, weil in der Idee der letzteren schon das Begriffselement der Selbsttätigkeit, die nicht etwa erst durch die diskursive Vergegenständlichung zustandekommt, vorbereitet ist.501 Bei diesem Verweis ist zudem zu bemerken, daß (1) bei der Funktion der Vernunft primär von reiner Spontaneität (Selbsttätigkeit) und nicht zuerst von Allgemeingültigkeit die Rede ist, und (2) daß bezüglich dieser selbsttätigen Kausalität der Vernunft der Zweckbegriff noch nicht eingeführt ist. Das, was der Freiheit essentiell und unerforschlich zugrundeliegt, und worauf die Idee einer transzendental-subjektiv verinnerlichten intelligiblen Welt hinweisen will, wäre für Kant ein noch nicht diskursiv vergegenständlichtes, demnach noch nicht für einen entworfenen Zweck zu nehmendes Ganzes, aus dem aber die reine Spontaneität der reinen praktischen Vernunft als Kausalität derselben annehmbar wird. Kant faßt nun die dargelegte zweistufige Deduktion (1) der Freiheit des Willens im negativen Verstande aus der Vernunft als reiner Spontaneität und (2) der Zugehörigkeit des Menschen als Intelligenz zur intelligiblen Welt aus dieser negativen Freiheit wie folgt zusammen: „Der Rechtsanspruch aber selbst der gemeinen Menschenvernunft auf Freiheit des Willens gründet sich auf das Bewußtsein und die zugestandene Voraussetzung der Unabhängigkeit der Vernunft von bloß subjektivbestimmenden Ursachen, die insgesamt das ausmachen, was bloß zur Empfindung, mithin unter die allgemeine Benennung der Sinnlichkeit gehört. Der Mensch, der sich auf solche Weise als Intelligenz betrachtet, setzt sich dadurch in eine andere Ordnung der Dinge und in ein Verhältnis zu bestimmenden Gründen von ganz anderer Art“.502 Dieser zweistufige deduktive Verweis von der Vernunft auf die Freiheit und von dieser auf die intelligible Welt als einen anderen Standpunkt stellt die kognitivGMS, IV 455 Z2f <B113>. IV 450 Z32 <B105>; 458 Z19 <B119>. Zum „Standpunkt in der Vernunft“ vgl. Refl. 6865, XIX 185, υ (1776–78) (cf. Fußnote 454 in 2.7.1). Der im Titel des 3. Abschnitts der GMS enthaltene Ausdruck „Kritik der reinen praktischen Vernunft“ (IV 446 <B97>) zeigt an, daß dieser andere Standpunkt „nur ein Etwas, das da übrigbleibt“ und das ich nicht weiter kenne, ist (IV 462 <B125f>). 499 Vgl. GMS, IV 454 Z6f <B111>: „... daß die Idee der Freiheit mich zu einem Gliede einer intelligiblen Welt macht“. 500 Vgl. dazu IV 452 Z7–23 <B107>. Das Wort „Selbsttätigkeit“ übrigens ist Übersetzung aus dem lateinischen „spontaneitas“. Vgl. hierzu beispielsweise Baumgarten, A. G., Metaphysica (lat.) § 706, AA XVII 131f, Metaphysik (dt.) § 521, S. 260. 501 Vgl. dazu IV 451 Z11f <B106>: „... von denen [sc. den Vorstellungen], die wir lediglich aus uns selbst hervorbringen, und dabei wir unsere Tätigkeit beweisen ...“; Z33–36 <B107>: „... in Ansehung dessen aber, was in ihm [sc. dem Menschen] reine Tätigkeit sein mag, (dessen, was gar nicht durch Affizierung der Sinne, sondern unmittelbar zum Bewußtsein gelangt) ...“ 502 IV 457 <B117>. 497 498 139 formalistische Grundlegung der Ethik dar, die im 1. Teil der vorliegenden Arbeit dargelegt worden ist. Daß der durch diese Grundlegung erlangte andere Standpunkt nur ein Etwas ist, das ich nicht weiter kenne, hängt mit der Absicht der Kritik der reinen praktischen Vernunft zusammen. In der nun von der intelligiblen Welt als bloßem Standpunkt ausgehenden Deduktion der moralischen Gesetzlichkeit aus Freiheit als einem Teil der essentiellen, ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung wird festgestellt, daß die negative Freiheit in Wahrheit mit der positiven Vernunftkausalität als dem reinen Willen verbunden ist und daß demzufolge das Gesetz, d.i. – was das Dijudikationsprinzip betrifft – das Vernunftprinzip der Allgemeingültigkeit (Form der Maxime als Gesetzes), aus dieser Vernunftkausalität als reiner Spontaneität abgeleitet werden kann.503 Die Ableitung der Allgemeingültigkeit als Dijudikationsprinzip aus der Vernunftkausalität müßte zuletzt in dem für Kant selbstverständlichen, demnach nicht ausdrücklich artikulierten Gedanken verankert sein, daß die Allgemeinheit (universalitas) auf der Einheit der Selbsttätigkeit des reinen Denkens aus Freiheit beruhe. Was nun das Exekutionsprinzip anlangt, wickelt sich die Deduktion der moralischen Gesetzlichkeit diesbezüglich in folgender Weise ab: (1) die intelligible Welt enthält den Grund der Sinnenwelt, mithin auch den der Gesetze derselben – daß der Satz sich hier ohne Beweise a priori ansetzen läßt, deutet darauf hin, daß der Begriff einer intelligiblen Welt u. E. von vornherein in der essentiellen Phase von der Freiheit zum Endzweck mit Bezug auf die Sinnenwelt, um diese zu gründen, analogisch mit derselben angenommen ist (cf. 3.1.2) –; (2) sie muß daher für den reinen Willen des zu beiden Welten gehörenden Menschen als gesetzgebend gedacht werden; (3) das Gesetz nun, das durch die intelligible Welt gegeben wird, ist das der Vernunft im Menschen, die in ihrer Beschaffenheit als Freiheit, d.i. der reinen Spontaneität, dieses Gesetz bewahrt; (4) Folglich erkennt der Mensch sich bei der Bestimmung seines auch durch sinnliche Begierden affizierten Willens als dem Gesetz der Vernunft, demnach der Autonomie des Willens, bei dem es sich um die Kausalität der praktischen Vernunft handelt, unterworfen; (5) er muß also die Gesetze der intelligiblen Welt für seinen affizierbaren Willen als Imperative ansehen.504 Mit dieser Ausführung der essentiellen Deduktion der Gesetze aus der intelligiblen Welt ist sowohl die exekutive Kraft des kategorischen Imperativs deduziert, als zugleich das Woher der praktisch-objektiven Verbindlichkeit des moralischen Gesetzes505 angezeigt worden;506 Diese (Verbindlichkeit) und mithin jene (exekutive Kraft) stammen aus der Gründungsbefugnis der intelligiblen Welt für die Sinnenwelt, die mittels der in uns befindlichen reinen praktischen Vernunft ausgeübt werden kann. Das moralische Interesse am Gesetz nämlich, in dem auch die Vgl. IV 458 Z6–16 <B118f>. Vgl. IV 453 Z31 – 454 Z5 <B111>. Vgl. auch den Argumentationsgang in IV 452 Z31 – 453 Z2 <B109>, der dieselbe essentielle Grundlegung zeigt. Zum ersten Satz vgl. auch IV 461 Z4–6 <B123>. 505 Vgl. dazu IV 450 Z16 <B104>. 506 Vgl. dazu auch IV 454 Z6–15 <B111f>. 503 504 140 Triebfeder zur Befolgung desselben mitenthalten ist und dessen Grundlage in uns moralisches Gefühl genannt wird,507 mithin der exekutive Grund zu Befolgung des Gesetzes, läßt sich auf diese Weise mit Hilfe des menschlichen Grundvermögens der Vernunft als reiner Spontaneität aus der Idee der intelligiblen Welt, wohl nicht real, jedoch allemal nach einer Idee, explizieren.508 Und dadurch wird auch die ausdrückliche Verlagerung der moralischen Triebfeder vom Endzweck zum Gesetz selbst in der KpV vorbereitet, weil die Verbindlichkeit bzw. exekutive Kraft nach der dargelegten Ausführung des 3. Abschnitts der GMS auf der hier für ein Faktum gehaltenen reinen Spontaneität der reinen praktischen Vernunft beruht, obwohl sie sich essentiell weiter auf die Gründungsbefugnis der Idee der intelligiblen Welt beruft. Da aber der reale Gründungsmechanismus von der intelligiblen Welt zur Sinnenwelt nicht erklärbar ist und da der bloße Verweis auf die erstere nicht die mindeste Kenntnis darüber bringt, so wird letztlich die gesamte Unerklärbarkeit der realen exekutiven Möglichkeit von (1) Freiheit, (2) reiner praktischen Vernunft und (3) moralischem Interesse angegeben.509 Erkenntniskritisch gesehen beruht sie auf der Unerklärbarkeit der Beziehung der Vernunft auf das Gefühl der Lust und Unlust.510 Der Grund der Freiheit ist unerforschlich und heißt als solcher in der religiösen Dimension Geheimnis.511 Der Lösungsversuch nun der Exekutionsproblematik mit Hilfe der Idee der durch den Begriff einer in uns befindlichen Vernunft hindurch angesetzten, transzendental-subjektiv verinnerlichten intelligiblen Welt als des Grundes der Sinnenwelt im 3. Abschnitt der GMS steht mit der Auflösung der Dritten Antinomie der KrV im Zusammenhang. Denn er hat seine Wurzel noch früher in den langjährigen Denkversuchen der Reflexionen über arbitrium liberum und libertas,512 aus denen auch die letztere hervorgegangen ist. Er bezieht sich damit auf die eigentliche, transzendental-subjektive Problematik der kritischen Philosophie Kants, in deren Zentrum sich die Dritte Antinomie der KrV befindet, während sich die Gedankenlinie von der intelligiblen Welt als dem vergegenständlichten Endzweck, die für sich auch als sekundäre Triebfeder der moralischen Handlung fungieren kann, als rein ethisches, demnach intelligibles und essentielles Problem, auf den Vgl. IV 460 Z2f <B122>. Vgl. dazu IV 449 Z15–23 <B102f>, 453 Z14f <B110>(dieser Beleg stellt den Schlußsatz und somit das Resultat des Abschnitts über das Interesse dar), 462 Z18f <B126>. 509 Vgl. dazu IV 458–462 <B120–126>. Vgl. auch Rel., VI 170 Anm. <B259f>. 510 Vgl. dazu IV 460 <B122f>. 511 Vgl. dazu Rel., VI 138 Z19f <B209>: „... der uns unerforschliche Grund dieser Eigenschaft [sc. der Freiheit] aber ist ein Geheimnis, weil er uns zur Erkenntnis nicht gegeben ist.“ Unter dem „Geheimnis“ wird R. Wimmer zufolge „die Notwendigkeit und gleichzeitige Unmöglichkeit, menschliche Freiheit und göttliche Mitwirkung zusammenzudenken“, verstanden. Vgl. hierzu Wimmer, R., Kants kritische Religionsphilosophie, Berlin 1990, S. 184f. 512 Vgl. dazu die diesbezüglichen Reflexionen in Bd. XVII und XVIII der AA: XVII 313–320, 462– 467, 508–511, 548, 587–591, 688f; XVIII 181–185, 252–259. H. Heimsoeth behandelt in seinem Aufsatz: Freiheit und Charakter, in: Prauss, G. [Hrsg.], Kant, Köln 1973, S. 292–309, einen Auflösungsversuch der Dritten Antinomie, die Charakter-Lehre, indem er diese Reflexionen in Periode χ (1778–79) analysiert. 507 508 141 Bereich des Vernunftglaubens bezieht. Die transzendentale Problematik, die zunächst in der Kantischen Zweiweltenlehre liegt und die demnach auch durch die theoretische Philosophie erörtert worden ist, hat in der praktischen die relative Verlagerung der moralischen Triebfeder ins Gesetz beeinflußt. Man kann aber nicht feststellen, daß Kant sich in der GMS der Differenzierung der Funktion der Idee der intelligiblen Welt in den vergegenständlichten Endzweck einerseits und den Grund der positiven Freiheit als Vernunftkausalität andererseits klar und deutlich bewußt gewesen sei. Die dargestellte essentielle Deduktion der moralischen Gesetzlichkeit aus der Idee der intelligiblen Welt kann die in der Einleitung genannte synthetisch-progressive Lehrart sein; die Idee der intelligiblen Welt ist nicht nur transzendental-subjektiv aus der reinen Vernunft deduziert worden, sondern sie könnte auch in der GMS – ebenso wie in den „Reflexionen“ – transzendental-objektiv vorgestellt sein. Die Idee der intelligiblen Welt ist für Kant schon vor dieser Differenzierung in der essentiellen Phase von der Freiheit zum Endzweck überhaupt als Welt- bzw. Ortsbegriff grundlegend, ob sie nun in der Freiheit oder im Endzweck placiert wird. Kant scheint im Grunde eine undifferenzierte Idee von ihr zu hegen. Eine transzendental-subjektive Idee kann zugleich tranzendental-objektiv sein. Die Bedrohung jedoch, daß die Idee der intelligiblen Welt als Endzweck, wenn man sie als erstes Moralprinzip fungieren ließe, die Autonomie der Vernunft untergraben würde, mußte abgewendet werden. Dabei hat man es wohl mit dem Sinn der Kritik der reinen praktischen Vernunft zu tun. Wenn Kant die Argumentation über das moralische Interesse abschließt und im Übergang zum Vernunftglauben die Rolle der Idee einer intelligiblen Welt als Triebfeder bzw. als das Woran des Interesses noch einmal konstatiert, stellt er diese Idee noch als bloßen Ursprung und exekutiven Grund der Verbindlichkeit des moralischen Gesetzes, der an sich unerforschlich ist, vor, ohne den Namen eines Endzwecks ausdrücklich auszusprechen. Sie dürfte jedoch implizit als solcher gedacht sein.513 In diesem Zusammenhang ist Refl. 7204 große Bedeutung beizumessen. 513 Vgl. IV 462 Z18–20 <B126>: „... es müßte denn diese Idee einer intelligibelen Welt selbst die Triebfeder oder dasjenige sein, woran die Vernunft ursprünglich ein Interesse nähme; ...“ Noch im nächsten Absatz (462 Z22 – 463 Z2 <B126f>) wird erstmals auf eine Funktion der Idee der intelligiblen Welt im Rahmen des Vernunftglaubens hingewiesen, in dem sie als Endzweck vorgestellt werden müßte. 142 3. Der Übergang von der Theorie des ,Gegenstands der reinen praktischen Vernunft‘ zur Lehre vom höchsten Gut. Die Grundlegung der Ethik wird in die kognitiv-formalistische und die essentielle, ,moralisch-teleologische‘ Phase eingeteilt. Die Analyse der moralphilosophischen Reflexionen im 2. Teil der vorliegenden Arbeit hat gezeigt, daß die letztere Phase in den Denkversuchen Kants besteht, die Moralität im Blick auf die intelligible Welt (das Reich Gottes), wo die wahre Glückseligkeit angetroffen wird, sozusagen in der Beleuchtung durch das Licht zu explizieren, das die Idee der intelligiblen Welt reflektiert und dessen Ursprung selbst doch in Freiheit und reiner praktischer Vernunft liegt. In den Schriften der achtziger und neunziger Jahre, vor allem in der KpV, hat Kant diese Denkversuche zusammengefaßt. In der zusammengefaßten Lehre von der ,moralisch-teleologischen‘ Phase, d.h. der Phase der moralischpraktischen Zwecksetzung, geht er erkenntniskritisch vom Fundament der Ethik bzw. der Moral aus und richtet sich ,moralisch-teleologisch‘ auf die intelligible Welt als praktischen Endzweck (das höchste Gut).514 Aber auch hier denkt er die Moralität zugleich essentiell von der Idee der letzteren her. Er sucht die Moral im Äguilibrium eines Systems zwischen dem Fundament der Ethik bzw. der Moral (Freiheit, Gesetz und reine praktische Vernunft) und der Idee vom Reich Gottes zu konstruieren. Dieser zusammengefaßten Lehre ist jetzt nachzugehen. 514 O. Kohlschmidt hebt in seiner Dissertation, Kants Stellung zur Teleologie und Physicotheologie, Jena 1894, die Relevanz der moralisch-teleologischen Elemente in bezug auf die physiche Teleologie und die Theologie hervor. In letzter Zeit hat sich auch D. Lenfers mit dem Versuch befaßt, die Teleologie in der KU zu analysieren und von ihr zur Theologie überzugehen, und aus diesem Anlaß auch die moralische Teleologie gestreift. Seine Arbeit aber beabsichtigt nicht, diese vom Fundament der Moral her architektonisch zu rekonstruieren. Vgl. dazu ders., Kants Weg von der Teleologie zur Theologie, Köln 1965, S. 94–103. 143 3.1 Vorbegriffe zur ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik. Zuerst sind einige Begiffe, die für diese Phase grundlegend sind, zu erläutern. 3.1.1 Die Relevanz der moralisch-praktischen Zwecksetzung des freien Willens gegenüber dem bloß logischen Vernunftprinzip der Moralität: Moralische Gesetze entspringen nicht der Vernunft. Hier wird die Relevanz jener moralisch-praktischen Zwecksetzung in Betracht gezogen, die in den „Reflexionen“ essentiell aus dem zweckmäßigen Ganzen her erwogen wird. In ihrem Hintergrund liegt die intelligible Welt mit einem allgemeingültigen Willen. Die Erwägungen werden in der KpV von dem Gesichtspunkt des Gesetzes als Faktum der Vernunft her in systematischer Klarheit und Eindeutigkeit neu eingeordnet. (a) Die praktische Setzung eines Ganzen als Zweck durch endliche Vernunft und die Glückseligkeit als Endzweck. Sowohl die Autokratie der Freiheit und Epigenesis der Glückseligkeit in den „Reflexionen“ als auch die umgestaltete Theorie des höchsten Guts in der KpV basieren auf der Setzung des Zweckes als Glückseligkeit durch den freien Willen des endlichen Vernunftwesens. Kant hat aber die apriorische innere Struktur einer praktischen Zwecksetzung überhaupt nicht thematisch erörtert, die für verschiedene Zwecksetzungen gemeinsam gilt. Sie war für ihn eine selbstverständliche Voraussetzung, die nicht besonders erläutert werden muß. Doch jene Erörterung, die er der Grundlegung der Möglichkeit einer Teleologie für Organismen gibt, liefert gewisse Hinweise auf das Wesen der praktischen Zwecksetzung. Ihr zufolge ist der Verstand des endlichen Vernunftwesens nicht derart „intuitiv“, daß er „vom Synthetisch-Allgemeinen (der Anschauung eines Ganzen als eines solchen) zum Besonderen“ gehen und demnach „das Ganze den Grund der Möglichkeit der Verknüpfung der Teile“ enthalten könnte, sondern er hat keine andere als die „diskursive“ Eigentümlichkeit, nach der nur „die Vorstellung eines Ganzen den Grund der Möglichkeit der Form desselben und der dazu gehörigen Verknüpfug der Teile enthalte“; „das Produkt aber einer Ursache, deren Bestimmungsgrund bloß die Vorstellung ihrer Wirkung ist“, heiße „ein Zweck“.515 Der diskursive Verstand kann sich also das Ganze, wovon die Teile ihrer Beschaffenheit und Bedingung nach abhängen, nur als Zweck vorstellen. Er vergegenständlicht somit nach einer Idee das Ganze als Zweck. Die Grundzüge dieser Endlichkeit nun, die für die physisch-teleologische Zwecksetzung eigentümlich ist, gelten auch für die praktische Zwecksetzung. Im Grunde genommen läßt sich aber das Verhältnis zwischen physischer Teleologie und praktischer Zwecksetzung umkehren: Die ursprünglich 515 Vgl. KU, V 407f <B349f>. 144 wegen der Endlichkeit der menschlichen Vernunft als Instrument für Handlungen eingerichtete praktische Zwecksetzung kann auch auf die Teleologisierung der sinnlichen Natur erst angewendet werden. Gerade die praktische Vernunft entwirft im Rahmen ihrer Endlichkeit das noch nicht Realisierte als eine zu realisierende Vorstellung, die als Zweck bezeichnet wird.516 Die endliche Vernunft des Menschen vermag nämlich nicht – durch einen intuitiven Verstand – ein Ganzes auf einmal zustandezubringen, sondern sich lediglich praktisch eine Vorstellung desselben als den formalen Grund für seine Herstellungsmöglichkeit zu machen; eine solche Vorstellung wird Zweck genannt. Nun ist eine der praktischen Zwecksetzungen die moralisch-praktische. Sie befaßt sich nicht nur mit einzelnen Zwecken als dem Guten, sondern geht auf den Endzweck als das höchste Gut hinaus. Bei ihr wirkt sich von der ursprünglichen Freiheit aus die apriorische Notwendigkeit der Freiheitskausalität als des Gesetzes auf den Endzweck aus. Dadurch dehnt sich von der Freiheit bis zum Endzweck hin ein intellektuelles Geistesfeld aus, in dem auch das Prinzip von Autokratie/Epigenesis in Kraft tritt, eine apriorische Struktur der Geisteslage des endlichen Vernunftwesens für seinen unendlichen Progressus auf den Endzweck. Nun ist Glückseligkeit der allgemeingültige Zweck (Vorstellung bzw. Idee des Ganzen) seines freien Willens.517 Sie wird dabei auch essentiell und strukturell vom Ganzen her als möglich betrachtet (cf. 3.1.2): „Die Glückseligkeit ... ist nur möglich in einem Ganzen nach einer Idee.“518 Der Setzung der Glückseligkeit als Zweck liegt also ein Ganzes nach einer Idee zugrunde, mit dem die Freiheit, um sie zu erreichen, zusammenstimmen soll. Die endliche praktische Vernunft kann dabei das Ganze, mit dem zusammenzustimmen die wahre Glückseligkeit erbringt, nicht ursprünglich anschauen, sondern sich nur als eine Idee denken oder als einen Zweck vergegenständlichen und setzen. Bei diesem Ganzen ist aber eben von der intelligiblen Welt die Rede; bei dem als Endzweck vergegenständlichten Ganzen handelt es sich daher um das Reich Gottes als eine christliche Konfiguration der intelligiblen, moralischen Welt, in der auch Glückseligkeit erlangt wird. (b) Moralische Gesetze als Bindeglieder zwischen Freiheit und Glückseligkeit als Endzweck vor dem Hintergrund der intelligiblen Welt. Zur Epigenesis nun der als das Ganze und mithin als Endzweck begriffenen Glückseligkeit aus dem Prinzip der Autokratie der endlichen tätigen Freiheit hat nur die 516 Daher wird auch gesagt: „Die vernünftige Natur nimmt sich dadurch vor den übrigen aus, daß sie ihr selbst einen Zweck setzt“ (GMS, IV 437 <B82>). 517 Vgl. Refl. 6875, XIX 188, υ? κ?: „Der Zweck, der notwendig allgemein ist, ist: daß alle ihre Zwecke erreicht werden, d.i. Glückseligkeit.“ Refl. 7058, XIX 237, ϕ : „Der allgemeine Zweck der Menschen ist Glückseligkeit.“ Refl. 6889, XIX 194, υ? χ?: „Der wirkliche Zweck ist: glücklich zu sein. Bedingungen sind Sittlichkeit und Geschicklichkeit.“ Refl. 7310, XIX 308, ψ? τ?: „Der Zweck der Menschen ist Glückseligkeit.“ Ebenso meint Refl. 7205 (XIX 284, ψ? ϕ?), die Einheit aller möglichen Zwecke vernünftiger Wesen sei rational aus dem Begriff der Glückseligkeit, solange sie bloß eine Wirkung der Freiheit ist, bestimmt. 518 Refl. 6971, XIX 216, υ? (1776–78?). 145 Sittlichkeit bzw. Moralität Tauglichkeit und Wirksamkeit. Daher heißt es, daß „die Sittlichkeit sich auf die Idee der allgemeinen Glückseligkeit aus freiem Verhalten gründet“;519 die Zusammenstimmung der freien Willkür mit dem Ganzen als Zwecke erfordert Gesetzlichkeit. Dieses Erfordernis läßt sich unter dem Aspekt der essentiellen, ,moralisch-teleologischen‘ Grundlegung der Ethik so sehen, als ob moralische Gesetze aus der intellektuellen Ausdehnung, die aus beiden Polen, Freiheit und Glückseligkeit, gebildet wird, generiert würden; sie zeigen sich nämlich in dieser Ausdehnung als Bindeglieder zwischen beiden. Im Hintergrund dieser Ausdehnung wird aber, wie man sogleich unten sehen wird (cf. 3.1.2), essentiell die Idee der intelligiblen Welt als Einheit der Zwecke angenommen. Moralische Gesetze müssen, wenn sie expliziert werden sollen, grundsätzlich aus dem Begriff der Freiheit deduziert werden können, jedoch nicht kognitiv-real, sondern nur essentiell, weil diese, als das von ihnen zu Unterscheidende, jene negative Freiheit ist, die an und für sich kognitiv und erkenntnistheoretisch unerklärbar und unerforschlich ist. Es wird auch ausgeschlossen, Gesetze aus der positiven Freiheit her zu erklären, weil ein solcher Erklärungsversuch beinahe bloß tautologisch ist. Sie können aber aus dem Begriff der negativen Freiheit essentiell deduziert werden erst in bezug auf den Endzweck, d.h. sie können von einer intelligiblen Ordnung aus, worauf die negative Freiheit hinweist und worin der Endzweck der Glückseligkeit realisiert werden kann, ,moralisch-teleologisch‘ expliziert werden. Es ist auch eine oft zu verwendende wissenschaftliche Methode, unter Voraussetzung des Äguilibriums eines gesamten Systems einen kognitiv früheren Faktor in demselben aus den übrigen Faktoren, die mit ihm im Gleichgewicht desselben korrelieren und essentiell früher sind, zu deduzieren. Freilich lehrt später die KpV eindeutig, daß man real und demnach erkenntnistheoretisch vom moralischen Gesetz als ratio cognoscendi ausgehen muß und nicht vom Endzweck seinen Ausgang nehmen darf. (Die Freiheit, die erst aus dem Gesetz deduziert wird, wird dann doch auch als Tatsache verstanden und gilt als Ausgangspunkt der moralisch-praktischen Zwecksetzung.) Aber die in den „Reflexionen“ vorgenommene Funktionsanalyse der moralischen Gesetze in bezug auf das gesamte System einer intelligiblen Ordnung verliert trotzdem ihren Sinn nicht, sondern ihre essentiellen Ergebnisse sind auch in der KpV latent vorausgesetzt; erst unter dieser Voraussetzung wird der Weg, der vom moralischen Gesetz als Faktum ausgeht, in zwei Richtungen – in der Refl. 6958, XIX 214, υ? (1776–78?). Vgl. auch Refl. 7199, XIX 273, ψ? (1780–89?): „Die Moralität besteht in den Gesetzen der Erzeugung der wahren Glückseligkeit aus Freiheit überhaupt“; Refl. 7202, XIX 279, ψ (1780–89): „Moralität ist die Idee der Freiheit als eines Prinzip der Glückseligkeit (regulatives Prinzip der Glückseligkeit a priori)“; Refl. 6924, XIX 208, ϕ (1776–78): „Die Moralität besteht in der Unterordnung eines jeden Willens unter die Regel allgemeingültiger Zwecke. Die Regel muß sein, daß die Handlung den allgemeingültigen Zweck zur Bedingung habe“; Refl. 6910, XIX 203, υ (1776–78): „Die notwendigen Gesetze (die a priori feststehen) der allgemeinen Glückseligkeit sind moralische Gesetze. Sie sind Gesetze der freien Willkür überhaupt, und die Regeln derselben nezessitieren intellectualiter; mithin, weil sie einzig und allein die Glückseligkeit auf die Ursache der Freiheit bringen und also die Würdigkeit glücklich zu sein bei sich führen“; Refl. 6823, XIX 172f, υ–ψ (1776–89): „[Moralisch ist alles, was weise macht. Dies betrifft] die Idee der Einheit der Einstimmung dieser Zwecke [sc. der Glückseligkeit] mit sich selbst.“ 519 146 einen auf die Freiheit und in der anderen auf den Endzweck – gebahnt. Daß in den „Reflexionen“ das Gesetz in bezug auf den Endzweck expliziert wird, deutet darauf hin, daß Gesetz und Freiheit allein der Kantischen Grundlegung der Ethik nicht genügen und daß diese sich unabdingbar auf den Zweck beziehen muß. Das Gesetz ist nicht wie ein empirisches Ding substantiell zu hypostasieren, sondern funktionell aufzufassen. Es erweitert sich in der Grundlegung der Ethik auf den Endzweck bzw. das höchste Gut. Die Explizierbarkeit des Gesetzes aus dem Endzweck besteht in dieser Erweiterung als Ausdehnung und hängt damit zusammen, daß der Endzweck sekundär der Bestimmungsgrund des Willens sein kann. (c) Moralische Gesetze entspringen nicht der Vernunft, sondern lassen sich erst in Aussicht auf den allgemeingültigen Zweck denken. (1) Von der intelligiblen Ordnung her betrachtet, in der der allgemeingültige Zweck gegenüber der Freiheit des Willens gesetzt wird, entspringen die moralischen Gesetze nicht aus der Vernunft, sofern diese nicht als Vermögen der Zwecksetzung, sondern bloß als das logische Vermögen verstanden wird, sondern vielmehr aus dem allgemeingültigen Zweck. Sie werden nämlich nicht ohne die Zwecksetzung generiert, sondern erst dann, wenn der allgemeingültige Zweck zum Grund der Handlungen gemacht wird; sie sind die vom allgemeingültigen Zweck her, d.h. vom Ganzen her, gestellten Bedingungen, freie Handlungen nach Vernunftregeln, nämlich auch mit Hilfe des logischen Vermögens der Vernunft, zu bestimmen. Der Gedankengang wird aber von Kant sehr vorsichtig formuliert: „Die moralischen Gesetze entspringen nicht aus der Vernunft, sondern sind dasjenige, was die Bedingungen enthält, wodurch es allein möglich ist, daß freie Handlungen nach den Regeln der Vernunft können bestimmt und erkannt werden. Dieses geschieht aber, wenn wir den allgemeingültigen Zweck zum Grunde der Handlungen machen.“520 (2) Dabei kann die Vernunft, selbst als bloß logisches Vermögen, vom Allgemeinen zum Besonderen zu gehen, Zwecke einschränken und unter ihre allgemeinen Regeln bringen, obwohl sie dieselben für sich nicht materiell schaffen kann. „Logisch ist die Vernunft der Grund der Regel. Was im Allgemeinen gilt, gilt auch im Besonderen, was darunter enthalten ist.“521 „Die Vernunft allein kann keinen Zweck geben, auch keine Triebfeder; sie ist es aber, die alle Zwecke ohne Unterschied so einschränkt, daß sie unter einer einzigen gemeinschaftlichen Regel stehen. Sie allein bestimmt die Bedingungen, unter denen die freie Willkür unter einer selbstständigen Regel steht.“522 Sie kann den Willen, der partikular ist, durch die Refl. 5445, XVIII 184, υ (1776–78). Refl. 6796, XIX 164, ρ? ξ? (1773–75? 1772?). Vgl. auch Refl. 6802, XIX 167 Z2–5, ρ? ξ? (1773–75? 1772?). 522 Refl. 7029, XIX 230, υ? µ? ρ? (1776–78? 1770–71? 1773–75?). Das logische Vermögen der Vernunft geht auf die Zusammenstimmung der Freiheit mit sich selbst, während die Zwecksetzung der Vernunft mit dem Vernunftinteresse zusammenhängt, das in die Erweiterungsproblematik gehört. Vgl. dazu KpV, V 120 <A216>: „Das, was zur Möglichkeit eines Vernunftgebrauchs überhaupt erforderlich ist, nämlich daß die Prinzipien und Behauptungen derselben [sc. der Vernunft] einander 520 521 147 Bedingungen der Allgemeingültigkeit einschränken und somit formal das Sollen vorschreiben. „Nur Vernunft kann das Sollen vorschreiben. Die Einschränkung des besonderen Willens durch die Bedingungen der Allgemeingültigkeit ist ein Prinzip der Vernunft des Praktischen. Weil sonst unter Handlungen keine unbedingte Einheit sein würde.“523 Moralische Gesetze entspringen also zwar nicht aus der Vernunft als dem bloß logischen Vermögen, sondern aus dem Ganzen hinsichtlich der Zwecksetzung, die auch materielle Bedingungen involviert, aber sie entspringen nicht ohne die Vernunft. Diese Unentbehrlichkeit führt nun aber zur Erweiterung der Funktion der Vernunft: Sie läßt sich nicht nur als jenes logische Vermögen, sondern, wie in der GMS hervorgehoben wird (cf. 2.8), auch als reine Spontaneität begreifen, die essentiell und nach einer Idee in der intelligiblen Welt verankert ist. Dadurch läßt sie sich als Instrument der Vermittlung zwischen dem zweckmäßigen Ganzen und dem real sich aufdrängenden Gesetz auffassen. Unter dem Aspekt der Vermittlung zwischen den beiden läßt sie sich demnach so betrachten, daß sie für sich moralisch-praktische Gesetze, verschieden von pragmatischen Gesetzen, produzieren kann.524 Zu dieser Leistung der reinen praktischen Vernunft, die aus ihrer reinen Spontaneität auch den Begriff der absoluten Einheit darbietet, wird auch das Prinzip der Konsistenz gezählt, das jene moralischen Gesetze betrifft, die die vollkommenen Pflichten zwar nur regulativ aber vollauf determinieren können (cf. 3.2.3.a). Also lassen sich moralische Gesetze auch so betrachten, daß sie doch aus der Vernunft entspringen. „... dieses [sc. das moralische Gesetz] entspringt gänzlich aus der Vernunft.“525 Wird aber die ganze Konstellation berücksichtigt, in der die menschliche Vernunft mit dem Gesetz im Zusammenhang steht, so muß sie sich, wie unten betrachtet wird, so ansehen, daß sie es, im Grunde genommen, nur aufnimmt. Wenn aber Kant erwägt, moralische Gesetze entsprängen nicht der Vernunft, so denkt er mit der oben erwähnten Methode der Funktionsanalyse im Äguilibrium des Systems der durch die Zwecksetzung gebildeten intellektuellen Ausdehnung, die sich als beinahe mit der intelligiblen Welt nach einer Idee identisch herausstellt. Auf der Struktur dieser essentiellen Analyse, die man bloße Spekulation nennen mag, basieren aber auch die ,kritischen‘, vom Gesetz als Faktum ausgehenden Darlegungen der KpV. nicht widersprechen müssen, macht keinen Teil ihres Interesse aus, sondern ist die Bedingung überhaupt Vernunft zu haben; nur die Erweiterung, nicht die bloße Zusammenstimmung mit sich selbst wird zum Interesse derselben gezählt.“ 523 Vgl. Refl. 7253, XIX 295, ψ (1780–89). 524 Vgl. dazu z.B. KrV, III 520 <B828>: „Dagegen [sc. gegen die pragmatischen Gesetze] würden reine praktische Gesetze ... Produkte der reinen Vernunft sein“. 525 Was heißt: S.i.D.or.?, VIII 140 Anm. Vgl. auch Gemeinspruch, VIII 278f: „... des ihm [sc. dem Menschen] durch die Vernunft vorgeschriebenen Gesetzes“; KpV, V 31 <A55>: „Denn reine, an sich praktische Vernunft ist hier unmittelbar gesetzgebend“; etc. 148 (d) Moralische Gesetze als göttliche Gebote. Nun aber kann durch die Moralität allein doch lediglich die Würdigkeit glücklich zu sein erlangt werden,526 welche daher zur Erreichung der wahren Glückseligkeit als Endzweck noch eine dritte Bedingung in Anspruch nimmt, die noch näher das Ganze repräsentieren kann (ein kurzer moralischer Gottesbeweis). Daher wird gesagt: „Da nun die Sittlichkeit sich auf die Idee der allgemeinen Glückseligkeit aus freiem Verhalten gründet, so werden wir genötigt, selbst die Ursache und Regierung der Welt nach einer Idee, nämlich demjenigen, was alles einstimmig macht oder durch einstimmige Bestrebung zur Glückseligkeit auch diese selbst besorgt, zu gedenken; denn sonst hätte die moralische Idee keine Realität in der Erwartung und wäre ein bloß vernünftelnder Begriff.“527 Die Moralität hätte nämlich ohne dieses Dritte keine Realität in der ganzen Struktur der Zwecksetzung des endlichen Willens und wäre ein bloßes formal-logisches Prinzip der Konsistenz. Um folglich den Endzweck der Glückseligkeit erreichen zu können, müssen moralische Gesetze für Regeln (Gebote) eines allgemeingültigen Willens gehalten werden,528 der als Ursache und Regierung der Welt für die Glückseligkeit desjenigen zu sorgen imstande ist, der das Ganze wohl nicht regieren, aber doch mit den Gesetzen als Regeln jenes Willens zusammenzustimmen streben kann. Ohne ein drittes Wesen, das man wohl zur bloßen Beurteilung der Moralität nicht braucht, wären moralische Gesetze in der realen Welt, wo nach den Zwecken der Glückseligkeit getrachtet wird, zu ihrer Ausübung doch leer und effektlos.529 „Der allgemeine Wille gibt darum das 526 Vgl. z.B. Refl. 6892; Refl. 7202, XIX 279 Z9–11. Refl. 6958, XIX 214. Vgl. auch folgende Reflexionen: Refl. 6971, XIX 217: „... folglich wird ein allgemeingültiger Wille nur den Grund der Versicherung der Glückseligkeit abgeben können; also können wir entweder gar nicht hoffen glücklich zu sein, oder wir müssen unsere Handlungen zur Einstimmung mit dem allgemeingültigen Willen bringen. Denn alsdenn sind wir nach der Idee, d.i. der Vorstellung des Ganzen, allein der Glückseligkeit fähig, und weil diese Fähigkeit eine Folge unsres freien Willens ist, derselben würdig. Der Umfang unsrer Glückseligkeit beruht auf dem Ganzen, und unser Wille als [derivativus*] wird dem originario subordiniert** werden müssen.“ (* ergänzt v. Verf.; im Original ist nach ,als‘ kein Wort gegeben. ** nach der Erwartung des Herausgebers; i.O. „substituiert“.) Refl. 6969, XIX 216, υ?: „Weil unsre Glückseligkeit nur möglich ist durch die Einstimmung des Ganzen mit unserm natürlichen allgemeinen Willen und wir das Ganze nicht regieren können, so werden wir das Ganze als untergeordnet einem allgemeingültigen Willen, der alle unter sich begreift, ansehen“. Refl. 5446, XVIII 184, υ(1776–78): „Moralische Gesetze sind die, welche die Bedingungen enthalten, durch welche freie Handlungen mit dem allgemeingültigen Zwecke einstimmig werden, also der Privatwille mit dem ursprünglichen und obersten Willen. Entweder mit dem allgemeinen Zwecke der Natur oder frei handelnder Wesen. Es wird also der Wille betrachtet nach der Einheit des Grundes, sofern nämlich aller Wille liegt in einem Willen: dem, der die Ursache der Natur ist und jeden andern.“ Vgl. auch Refl. 7202, XIX 282 Z14–16; Refl. 6867, XIX 186 Z21–26, υ (1776–78). 528 Vgl. Refl. 6894, XIX 198, Nachtrag ϕ (1776–78): „das moralische Gesetz der Form (Reinigkeit) nach als ein göttlich Gesetz, d.i. als ein Gesetz des vollkommensten Willens.“ Vgl. auch Refl. 7257, XIX 296, ψ (1780–89): „Daß die moralischen Gesetze göttliche Gebote (praecepta) sind, ...“ Vgl. auch Refl. 7258. 529 Vgl. Ethik Menzer, S. 48f: „... alle moralischen Gesetze können richtig sein, ohne ein drittes Wesen, aber in der Ausübung wären sie leer, wenn kein drittes Wesen uns dazu nötigen möchte; man hat also mit Recht eingesehen, daß ohne einen obersten Richter alle moralischen Gesetze ohne Effekt 527 149 Gesetz, weil ohne ihn die Freiheit im ganzen genommen eine Gesetzlosigkeit und also ohne Regel ist, mithin die Vernunft im Handeln nichts bestimmen kann.“530 Man muß also die moralischen Gesetze, die man exekutiv befolgen soll, als göttliche Gebote erachten, um sich dessen zu versichern, daß man durch ihre Befolgung die wahre Glückseligkeit erlangen kann. Die Versicherung darf aber nicht als empirisch-willkürlich angestellt verstanden werden, sondern ist notwendig und besteht in der intellektuellen Ausdehnung zwischen Freiheit des Willens und Endzweck, der die intelligiblen Ordnung unmittelbar zugrundeliegt und in der die Exekution ihre Kraft bekommt. Indem die Gesetze in dieser Ordnung durch einen allgemeingültigen Willen solche Realität bekommen und nicht zu ihrer Ausübung leer und effektlos sind, gerät die freie Wilkür exekutiv nicht in Gesetzlosigkeit. Auch die These, die moralischen Gesetze entsprängen nicht aus der Vernunft, ist letztlich essentiell in dem Gedanken verankert, sie seien göttliche Gesetze. Der Gedanke der moralischen Gesetze bzw. Pflichten als göttliche Gebote tritt alsdann in der KpV und der Religionsschrift ausdrücklich auf.531 Auch die Lehre des moralischen Gesetzes als Faktum der Vernunft532 gründet sich essentiell d.h. nach einer Idee auf ihn: Die Vernunft verschafft sich nicht von sich selbst aus die Gesetze, sondern bei ihr sind sie schon real da; unter dem intelligiblen Aspekt bei Kant, aber auch der Sache nach, hat sie sie in der ursprünglichen Freiheit der intelligiblen Willkür lediglich aufgenommen; erst danach erschließt sich der Sachverhalt auch derart, daß das Gesetz der Vernunft entspringt, und daß diese gesetzgebend ist. Dieser intelligible, tiefe Sinn des Faktums der Vernunft wird aber innerhalb der Druckschriften erst in der Religionsschrift offengelegt.533 (e) Die moralisch-praktische Setzung des Endzwecks und die exekutive Kraft. Das moralische Gesetz bleibt in seiner Aktualität nicht bei sich, sondern vergegenständlicht sich notwendig und kommt dadurch zur „Erweiterung“534 ; d.h. die reine praktische Vernunft als der reine Wille setzt sich den Endzweck, die Autonomie der Vernunft bezieht sich notwendig auf ihn. In dieser Erweiterung gelangt das moralische Gesetz in seine exekutive Kraft und wird Triebfeder, die durchs wären; alsdann wäre keine Triebfeder, keine Belohnung und keine Bestrafung. Also die Erkenntnis Gottes ist in Ansehung der Ausübung des moralischen Gesetzes notwendig.“ Aber bei Kant kann der göttliche Wille doch erst aus dem moralischen Gesetz erkannt werden. Hier findet sich der gleiche Kreislauf zwischen ratio cognoscendi und essendi wie bei Gesetz und Freiheit. „Wie erkennen wir den göttlichen Willen? Es fühlt keiner den göttlichen Willen in seinem Herzen und wir können auch aus keiner Offenbarung das moralische Gesetz erkennen, ... Wir erkennen also den göttlichen Willen durch unsere Vernunft. ... Also erkennen wir die Vollkommenheit des göttlichen Willens aus dem moralischen Gesetze.“ 530 Refl. 7040, XIX 233, ϕ? (1776–78?). 531 (531) Vgl. z.B. KpV, V 129 <A233>: „Erkenntnis aller Pflichten als göttlicher Gebote“; Rel., VI 42 <B44>: „des moralischen Gesetzes als göttlichen Gebots“, KU, V 481 Z13f <B477>, etc. 532 KpV, V 31 <A56>(cf. 1.3). 533 Rel., VI 26 Anm. <B16>(cf. Fußnote 712 in 3.4.1). Vgl. auch V.e.vorn.Ton, VIII 397 Z38–41. 534 KpV, V 120 Z8f. Vgl. auch Gemeinspruch, VIII 280 Anm. Z21; Rel., VI 7 Anm. Z29 <BXII>. Cf. 3.4.0. 150 moralische Gefühl aufgenommen wird. Wenn Kant die Gesetze als göttliche Gebote interpretiert, denkt er sie von der Zwecksetzung her, d.h. in der Erweiterung des Gesetzes auf den Endzweck, in der die Triebfeder real wird und die Exekution dadurch tatsächlich zustandekommen kann. Dabei dient aber auch der Endzweck zur sekundären Triebfeder. Wenn man sein Interpretationsanliegen auf das Gesetz und dessen Freiheit einschränkt und die notwendige Zwecksetzung durch die reine praktische Vernunft sowie die Erweiterung des Gesetzes auf den Endzweck nicht berücksichtigt, so kann man den Stellenwert der Lehre Kants über das höchste Gut als Bestimmungsgrund des Willens nie richtig einschätzen. Kants Ethik besteht nicht allein aus der Autonomie der Vernunft, sondern auch aus der Zwecksetzung derselben bzw. der Erweiterung des Gesetzes auf den Endzweck, in der Gesetz und Endzweck zugleich Triebfedern werden, die die Willkür in der Tat zur Handlung unter Gegenständen der Sinnenwelt bewegen. Sie ist die Ethik vom endlichen menschlichen Vernunftwesens, das in der Sinnenwelt unendlich und ununterbrochen nach dem Ideal der moralischen Vollkommenheit trachtet, während es zugleich auf die wahre Glückseligkeit hofft. Man kann fast sagen, gerade zur Begründung dieses Trachtens nach dem höchsten Gut als Endzweck wird auch die Lehre von der Autonomie der Vernunft benötigt. Kants moralphilosophisches Denken in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre und der ersten Hälfte der achtziger Jahre widmet sich der Theoretisierung dieser Zwecksetzung und der dadurch ermöglichten Triebfeder, deren Ergebnis sich im Kanon-Kapitel der KrV und in der Dialektik der KpV niederschlägt, aber auch vom Gegenstand- und Triebfedern-Kapitel der Analytik der letzteren reflektiert wird, während das Prinzip der moralischen Gesetzlichkeit, das er bereits in der ersten Hälfte der sechziger Jahre gegründet hat, zusammen mit seiner ausführlichen begriffsanalytischen Begründung erst in der GMS und dem Grundsätze-Kapitel der Analytik der KpV präsentiert wird. Es rührt von den von H. Cohen festgelegten Leitlinien der Interpretation her, daß in der modernen Interpretationsgeschichte bis zur von J. R. Silber ausgelösten Kontroverse die Phase der Zwecksetzung in der Kantischen Ethik eher gering geschätzt535 und Kants Mühe in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in den „Reflexionen“ ungeachtet ihres reichen Umfangs beinahe ignoriert wurde. 3.1.2 Die intelligible Welt in der essentiellen, ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik. (a) Zur Erreichbarkeit nun des Endzwecks der moralischen Vollkommenheit sowie der wahren Glückseligkeit durch den freien Willen unter der Regierung des allgemeingültigen Willens wird aber auch ein systematischer Hintergrund der Ganzheit nach einer Idee, in den der freie einzelne und der allgemeingültige Wille essentiell zusammengehören, eine wahre selbständige Welt, nach der Analogie mit der Natur beansprucht und angenommen. Somit gewinnt das, was vom Gesetz als Faktum 535 Vgl. zu diesem historischen Zusammenhang beispielsweise Krämling, G., Das höchste Gut als mögliche Welt, in: Kant-Studien Bd. 77, 1986, S. 273–276: Schwartländer, J., Der Mensch ist Person, Stuttgart 1968, S. 200 u. 208. 151 her bzw. von der reinen praktischen Vernunft her bloß als ein anderer Standpunkt angenommen wird, gewisse Gestalt und wird essentiell hypostasiert. Dieser Hintergrund heißt Verstandes- bzw. intelligible Welt.536 „Das Prinzipium der Einheit der Freiheit unter Gesetzen stiftet ein analogon mit dem, was wir Natur nennen, und auch einen innern Quell der Glückseligkeit,537 den Natur nicht geben kann und wovon wir selbst Urheber sein. Wir befinden uns alsdenn in einer Verstandeswelt nach besonderen Gesetzen, die moralisch sind, verbunden.“538 D.h. die intelligible Welt läßt sich vom Prinzip der Zusammenstimmung der Freiheit mit den Gesetzen her, demnach auch von der Autokratie der Freiheit her, in Aussicht auf die wahre Glückseligkeit, nach der Analogie der Natur im allgemeinen gedanklich stiften; sie wird der intellektuellen Ausdehnung der Gesetzlichkeit, die sich so von der Freiheit über Gesetze zum Endzweck erweitert, zugrundegelegt, damit der Entwurf des freien Willens (1) von der Freiheit zu den Gesetzen, (2) von der Freiheit über die Gesetze zum Endzweck übergehen kann. Der Begriff einer intelligiblen Welt wird also erst in der Richtung auf den Endzweck – diese intellektuelle Richtungsnahme auf den Entzweck ist notwendig, damit man sich von der Freiheit ausgehend wieder auf Gegenstände in unserer Erfahrungswelt befassen kann – ,moralischteleologisch‘ angenommen, wobei die Freiheit des Willens als Ausgangspunkt der Richtungsnahme vorausgesetzt ist. Man begegnet ihr inhaltlich nicht im Vorgang der kognitiv-formalistischen Grundlegung der Ethik. Eine solche Welt wird, da die Zusammenstimmung der Freiheit mit den Gesetzen diejenige mit den Zwecken ist, durch die Vernunft des endlichen Vernunftwesens, die mit dem Gebrauch des Zweckbegriffs auf der Ebene von Ideen denkt, dergestalt systematisiert begriffen, daß in ihr „alle Zwecke vom Allgemeinen (Ganzen) zum Besonderen herabgehn und also der Zweck des Ganzen539 die Bedingung der Zwecke der Teile in sich enthalte“, und daß sie „im ganzen zweckmäßig ist“.540 In der Idee einer intelligiblen Welt als einer solchen zweckmäßigen sieht man also eine notwendige ,Hypothese‘541 der endlichen Menschenvernunft als des freien Willens, ein zweckmäßiges System der Gesetze anzunehmen, in dem das Besondere vom Ganzen her zweckmäßig bestimmt werden kann und das ihr somit Sicherheit (cf. 2.5.2) verschafft. Erst auf diese „systematische Einheit der Zwecke“542 der intelligiblen Welt hin, die aber auch zugleich subjektiviert als diejenige „eines vernünftigen Wesens“ 536 Kant faßt die Charakteristiken der intelligiblen Welt in Refl. 5086, XVIII 83, ϕ (1776–78) folgendermaßen zusammen: „In der Verstandeswelt ist das substratum: Intelligenz, die Handlung und Ursache: Freiheit, die Gemeinschaft: Glückseligkeit aus Freiheit, das Urwesen: eine Intelligenz durch Idee, die Form: Moralität, der nexus: ein nexus der Zwecke. Diese Verstandeswelt liegt schon jetzt der Sinnenwelt zum Grunde und ist das wahre Selbstständige.“ Vgl. auch Refl. 5103. 537 Vgl. die Stelle aus Refl. 7202 in Fußnote 527, in dem der Quell der Glückseligkeit Gott ist, während er hier in Refl. 7260 auf die Verstandeswelt zu verweisen scheint. 538 Refl. 7260, XIX 296, ψ? υ? ϕ? (1780–89? 1776–78?). 539 Zum ,Zweck des Ganzen‘ vgl. etwa Refl. 5445, VIII 184 Z13, υ (1776–78). 540 Refl. 6899, XIX 200, υ? κ? η? (1776–78? 1769? 1764–68?). 541 Kant nennt es „eine notwendige Hypothesis des theoretischen und praktischen Gebrauchs der Vernunft“, „daß eine intelligible Welt der sensiblen zugrundeliege“ (Refl. 5109, XVIII 91, ψ1−2 1780– 84). 542 Vgl. KrV, III 528 Z18 <B842>, 529 Z9 <B843>, 524 <B835f>. 152 verstanden wird, in der mithin auch „die formale Einheit im Gebrauch der Freiheit“ (Moralität)543 verankert ist, hat auch die wahre Glückseligkeit essentiell die Möglichkeit ihrer Verwirklichung. Denn: „Aus der Idee des Ganzen wird hier die Glückseligkeit jedes Teils bestimmt“,544 oder genauer essentiell vorbestimmt. Nun ist die Moralität die essentielle Form der systematischen Einheit aller Zwecke,545 die vom Allgemeinen zum Besonderen herabgehen; ein allgemeingültiger Wille nämlich bestimmt jeden besonderen in der Weise, daß das Besondere aus dem Allgemeinen abgeleitet wird, welches aber besagt, er verfahre nach keinen anderen als moralischen Prinzipien:546 „Nur aus dem Ganzen und dem obersten Grunde läßt sich dasjenige ableiten, was nach allgemeinen Gesetzen [zu tun sei]“.547 Hier besteht daher die Möglichkeit der Übereinstimmung zwischen Glückseligkeit und Moralität nach der systematischen Einheit aller Zwecke. Wer also seine freien Handlungen auf die Zusammenstimmung mit dem zweckmäßigen Ganzen und dem obersten Grund, d.h. auf die Moralität richtet, der ist würdig, glücklich zu sein.548 Die wahre Glückseligkeit selbst aber wird ihm, so kann er hoffen, in der Proportion zu seiner Würdigkeit glücklich zu sein erst durch diesen obersten Grund, d.i. den allgemeingültigen Willen und zugleich die oberste Ursache gewährt, die auch das Ganze der Natur regieren kann, weil die Moralität in der sinnlichen Natur nicht von jedermann ausgeübt wird.549 Die Idee der intelligiblen Welt, die transzendental-subjektiv der Verbindlichkeit des Gesetzes zugrundegelegt wird, ist ein bloßer Standpunkt ohne erkennbare Eigenschaften (cf. 2.8). Sie wird aber in der essentiellen, ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung von der Freiheit über Gesetze zum Endzweck, und zwar in der Richtungsnahme auf unsere Erfahrungswelt, als Ort der Moralität und als Grund der Glückseligkeit nach der Analogie mit der Natur im allgemeinen verobjektiviert. Dadurch werden ihr Eigenschaften als ihr Inhalt praktisch-theoretisch, d.h. moralisch-dogmatisch, beigelegt. (b) Wenn nun die Idee der intelligiblen Welt aus der Analogie mit dem allgeRefl. 7204, XIX 283, ψ? υ? ϕ? (1780–89? 1776–78?). Cf. 1.3 (Fußnote 178), 2.2.2 (Fußnote 241). 2.3.1.g (Fußnote 267). 544 Refl. 7058, XIX 237, ϕ (1776–78). 545 Vgl. auch Religionslehre Pölitz, XXVIII 1099: „Ein System aller Zwecke durch Freiheit wird nach den Grundsätzen der Moral errichtet, und ist die moralische Vollkommenheit der Welt.“ Vgl. auch Refl. 5086 (cf. Fußnote 536). Daß die Sittlichkeit in der intelligiblen Welt fundiert ist, wird später in der KpV als Schlüssel für die Auflösung der Antinomie der praktischen Vernunft verwendet. Vgl. dazu KpV, V 114f <A206f>. 546 Vgl. Refl. 7204, XIX 283: „[W]enn die allgemeine Willkür jede besondere bestimmen sollte, [könnte] sie nach keinen andern als moralischen Prinzipien verfahren“. Vgl. auch Refl. 6853, XIX 179, υ? χ? (1776–78? 1778–79?): „Die Unterwerfung der Freiheit unter die Gesetzgebung der reinen Vernunft. (Aus den allgemeinen Bedingungen der Zwecke überhaupt zu den besonderen zu gehen.)“ 547 Refl. 5445, XVIII 184. Vgl. auch Refl. 6802, XIX 167, ρ? ξ? (1773–75? 1772?): „Die Handlungen sind nicht richtig, die Freiheit ist regellos, wenn sie nicht unter solcher Einschränkung aus der Idee des Ganzen steht.“ 548 Vgl. Refl. 7058, XIX 237: „Der ist würdig der Glückseligkeit, dessen freie Handlungen auf die Einstimmung mit dem allgemeinen Grunde derselben gerichtet sind“. 549 Ein anderer Grund ist, wie oben gesehen (cf. 2.7.2), daß wir gegen Gott lauter Schuldigkeit haben und nur aus Gnade Glückseligkeit erlangen können. 543 153 meinen Begriff der Natur, der als Oberbegriff auch die sinnliche umfaßt, konzipiert wird, so heißt das umgekehrt, daß die Natur wie eine Idee, Urbild oder Norm, angesehen wird: „Die Natur muß wie eine Idee angesehen werden, welche im Schöpfer das Urbild, bei uns aber die Norm ist.“550 In ihr als einer normativen Idee muß die Freiheit „nicht mit den Naturgesetzen, sondern bloß der allgemeinen Gesetzmäßigkeit der Natur [übereinstimmen], so daß die Maxime unserer Handlungen mit unserem Willen ein allgemeines Naturgesetz sein könne.“551 Der Gedanke einer Natur nach der Analogie mit der intelligiblen Welt artikuliert sich dann in der Naturgesetze-Formel des kategorischen Imperativs552 sowie in der Erwägung des „Reich[s] der Zwecke“ (der intelligiblen Welt) als „Reich der Natur“553 und kristallisiert sich zuletzt als „Typik der reinen praktischen Vernunft“.554 Die Erwägung meint noch nicht, daß die Sinnenwelt, die bereits vorhanden ist, physischteleologisch expliziert werden soll, sondern daß die intelligible Welt für diejenige Natur gehalten werden soll, durch die als Norm die sinnliche Natur soll sozusagen direkt überdeckt werden können. Aus dieser Erwägung einer Methexis in der moralischen Teleologie, bei der es sich um die ,moralisch-teleologische‘ Grundbewegung des Selbstentwurfs der menschlichen Freiheit auf den Endzweck nach der Idee der intelligiblen Welt handelt, läßt sich nun doch auch eine physische gestalten, und dadurch wird bei Kant auch an einer Vereinigung der praktischen Vernunft mit der spekulativen experimentiert.555 Die Idee der intelligiblen Welt als Analogon der Natur und die der Natur als Typus der intelligiblen Welt stehen in engem Zusammenhang,556 weil beide zueinander analogischen Beziehungen genetisch in der Frage nach dem Zusammenhang zwischen moralischer Freiheit und Glückseligkeit (Problematik der Realisierbarkeit des Endzwecks) und zwischen Gesetz und Natur (Anwendungsproblematik), die beide auf die einzige fundamentale Frage nach dem Zusammenhang zwischen reinem sittlichen Denken und sinnlicher Natur hinauslaufen, praktisch erfordert und eingesetzt worden sind.557 Die ursprüngliche Differenzierung zwischen reiRefl. 6958, XIX 214, υ? (1776–78?). Refl. 7269, XIX 299, ψ? υ? (1780–89? 1776–78?). 552 Vgl. GMS, IV 421 Z18–20 <B52>, 437 <B81>: „Weil die Gültigkeit des Willens, als eines allgemeinen Gesetzes für mögliche Handlungen, mit der allgemeinen Verknüpfung des Daseins der Dinge nach allgemeinen Gesetzen, die das Formale der Natur überhaupt ist, Analogie [!] hat, so kann der kategorische Imperativ auch so ausgedrückt werden: Handle nach Maximen, die sich selbst zugleich als allgemeine Natgurgesetze zum Gegenstande haben können.“ 553 Vgl. GMS, IV 436 Anm. <B80>: „Die Teleologie erwägt die Natur als ein Reich der Zwecke, die Moral ein mögliches Reich der Zwecke als ein Reich der Natur. Dort ist das Reich der Zwecke eine theoretische Idee zu Erklärung dessen, was da ist. Hier ist es eine praktische Idee, um das, was nicht da ist, aber durch unser Tun und Lassen wirklich werden kann, und zwar eben dieser Idee gemäß, zustandezubringen.“ Vgl. auch 3.2.3 und Fußnote 615. 554 Vgl. KpV, V 67–70 <A119–124>. 555 Vgl. dazu den ganzen zweiten Teil der KU; KrV, III 529 <B843f>; GMS, IV 391 <BXIV>; KpV, V 91 <A162>, 121 <A218f>; Fortschritte, etc. Zum Problem der Einheit der Vernunft sollen die Arbeiten von K. Konhardt und G. Prauss genannt sein (cf. das Literaturverzeichnis). 556 So hat das denn auch später wiederum gesagt werden können: „Ein Reich der Zwecke ist also nur möglich nach der Analogie mit einem Reiche der Natur“ (GMS, IV 438 <B84>). 557 Dieser enge Zusammenhang stellt eben den Standpunkt und Charakter des Kantischen Ratio550 551 154 nem sittlichen Denken und sinnlicher Natur bei jener kognitiven Exposition des Gesetzes als Faktum der Vernunft (cf. 1.3) erfordert zur Wiederherstellung ihrer Beziehung den Begriff einer in Analogie mit der Natur gedachten intelligiblen Welt und zugleich einer durch die Analogie mit der intelligiblen Welt zu bestimmenden Natur. (c) Die gedankliche Genese der intelligiblen Welt als Analogon der Natur, in der moralische Gesetze essentiell beheimatet sind, im Selbstentwurf der autonomen Freiheit, steht dafür ein, daß im § 6 der KpV die Bestimmbarkeit des freien Willens durch moralische Gesetzlichkeit in der essentiellen Deduktion der gesetzgebenden Form der Maxime aus der negativen Freiheit ohne Bedenken sofort eingesetzt werden konnte (cf. 1.4),558 sowie daß im 3. Abschnitt der GMS die negative Freiheit ohne weiteres mit der Redewendung „darum doch nicht gar gesetzlos“ abgetan werden konnte.559 Im Hintergrund dieser raschen Umwendung ohne weitere Überlegungen in beiden Grundlegungsschriften hält sich die Idee der intelligiblen Welt, eine intellektuelle Ordnung der Gesetzlichkeit, versteckt, in der moralische Gesetze auch für göttlich erachtet werden können; durch die gedankliche Annahme dieser Welt nämlich bleibt die Freiheit nicht mehr negativ, sondern kann sich sofort in die positive umwandeln.560 Diese nämlich läßt sich essentiell unter der Idee der intelligiblen Welt wieder annehmen; beide Begriffe werden in der intellektuellen Richtungsnahme auf unsere Erfahrungswelt eingeräumt. Nun ist aber die Annahme der intelligiblen Welt als hintergründige Garantie der moralischen Gesetzlichkeit bereits eben in den „Reflexionen“ derart durchgedacht worden, daß sie exekutiv in nichts anderem als dem ,moralisch-teleologischen‘ Entwurf der Freiheit auf Glückseligkeit notwendig ist. Die Erkenntnis von Eigenschaften des Gesetzes und die Annahme der intelligiblen Welt finden in der essentiellen, ,moralischteleologischen‘ Phase der Grundlegung zusammen statt. Nun ließe sich der tatsächliche entwicklungsgeschichtliche Ausgangspunkt des Denkens Kants zur Idee einer intelligiblen Welt und mithin seine Zweiweltenlehre mit den Worten des späteren Werkes wohl dergestalt darstellen, daß eben das moralische Gesetz „ein schlechterdings aus allen Datis der Sinnenwelt und dem ganzen Umfange unseres theoretischen Vernunftgebrauchs unerklärliches Faktum“ an die Hand gibt, das „auf eine reine Verstandeswelt Anzeige gibt, ja diese sogar positiv nalismus der praktischen Urteilskraft dar. Vgl. hierzu KpV, V 71 <A125>: „Dem Gebrauche der moralischen Begriffe ist bloß der Rationalismus der Urteilskraft angemessen, der von der sinnlichen Natur nichts weiter nimmt, als was auch reine Vernunft für sich denken kann, d.i. die Gesetzmäßigkeit, und in die übersinnliche [Natur] nichts hineinträgt, als was umgekehrt sich durch Handlungen in der Sinnenwelt nach der formalen Regel eines Naturgesetzes überhaupt wirklich darstellen läßt.“ 558 Vgl. KpV, V 29 <A52>. 559 Vgl. GMS, IV 446 <B98>. Vgl. auch IV 400 <B14>(cf. Fußnote 33 in der Einleitung). 560 Vgl. dazu GMS, IV 458 <B118f>: „Jenes [sc. das Sich-Hineindenken in eine Verstandeswelt] ist nur ein negativer Gedanke in Ansehung der Sinnenwelt, die der Vernunft in Bestimmung des Willens keine Gesetze gibt, und nur in diesem einzigen Punkte positiv, daß jene Freiheit als negative Bestimmung zugleich mit einem (positiven) Vermögen und sogar mit einer Kausalität der Vernunft verbunden sei, welche wir einen Willen nennen“. 155 bestimmt“.561 Dies dürfte in der Tat auf seinem Denkweg ungefähr in der Zeit der Gründung der moralischen Gesetzlichkeit bis zur ersten Hälfte der sechziger Jahre geschehen sein, aus der dann die Theorie der ,moralisch-teleologischen‘ Struktur für den Progressus eines endlichen Vernunftwesens, der durch die moralischen Triebfedern in Gang gehalten wird, entwickelt wurde und dessen Bewegung durch die Idee der intelligiblen Welt als ihren essentiellen Hintergrund gesichert wird. Die inzwischen unter solchen ,moralisch-teleologischen‘ Erwägungen in Kants Denken selbstverständlich gewordene Annahme der intelligiblen Welt – in die die Freiheit auch gehören muß – gibt aber dann neben dem ursprünglichen Ausgangspunkt, daß das Gesetz kognitives Faktum ist, den moralisch-dogmatischen Grund ab, warum er in beiden Grundlegungsschriften bei der Umwendung der negativen Freiheit ohne weiteres und ohne Bedenken die Gesetzlichkeit zugestanden hat. Kurz: Die Theorie der intelligiblen Welt untermauert Kants von Anfang an unerschütterliche Überzeugung, daß moralische Gesetzlichkeit, genauer das Bewußtsein derselben, faktisch vorgegeben ist. Unter diesen Umständen aber wird bei ihm die Frage nicht einmal erhoben, in welcher Weise sich die negative Freiheit, die an sich unbegreiflich ist, eigentlich zeigt, auf deren Begriff die moralische Gesetzlichkeit sich notwendig bezieht. 3.2 Die Theorie vom Gegenstand der reinen praktischen Vernunft verknüpft das Fundament der Moral (Gesetz und Freiheit) mit der Lehre vom höchsten Gut; dadurch wird eine Struktur der moralisch-praktischen Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik gebildet. Moralisches Gesetz, reine praktische Vernunft und Freiheit sind der erkenntniskritisch eingesetzte transzendental-subjektive Grund der Moral. Dieser Grund liegt nun aber essentiell (ontotheologisch) in einer intelligiblen Ordnung beschlossen – oder er eröffnet diese Ordnung –, die ein Weltbegriff ist und für transzendentalobjektiv gehalten wird. Sie läßt sich erkenntniskritisch (unter der Kritik der reinen praktischen Vernunft) in keiner empirischen Theorie charakterisieren, sondern lediglich als ein anderer Standpunkt außer der Sinnenwelt annehmen. Die Charakterisierung und konkrete Bestimmung dieser theoretisch nicht erkennbaren transzendental-objektiven intelligiblen Ordnung (das doktrinale Geschäft der eigentlichen Metaphysik Kants, die durch die moralische Teleologie ermöglicht wird) erfolgt auf dem Weg der moralisch-praktischen Zwecksetzung aus Freiheit als der Selbstobjektivierung jenes transzendental-subjektiven Grundes in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik. Die Struktur der moralischpraktischen Zwecksetzung kann aber erst durch die Verknüpfung der Theorie vom 561 KpV, V 43 <A74>. Cf. Fußnote 189 in 1.4. 156 Gegenstand der reinen praktischen Vernunft mit der Lehre vom höchsten Gut freigelegt werden. Dazu muß der erstere als moralischer Zweck interpretiert werden, weil das letztere der praktische Endzweck ist. Dieses Kapitel (3.2) versucht diese Interpretation und wird dementsprechend in folgende vier Abschnitte eingeteilt: (1) die Notwendigkeit des formalistischen Verfahrens in der Theorie der Zwecksetzung (Abstrahierung von materialen Zwecken), um einen moralischen Zweck anzunehmen (3.2.1), (2) die Aufstellung der Hypothese, daß der Gegenstand der reinen praktischen Vernunft der moralische Zweck ist (3.2.2), (3) die Argumentation über diese Hypothese hinsichtlich der vollkommenen und der unvollkommenen Pflichten (3.2.3) und (4) die Bestätigung derselben mit Bezug auf den Begriff des Endzwecks (3.2.4). Aber vorerst sollen einige allgemeine Hinweise in bezug auf die Struktur der moralisch-praktischen Zwecksetzung überhaupt gegeben werden (3.2.0). 3.2.0 Vorwort zur dreistufigen Struktur der Theorie der moralischpraktischen Zwecksetzung. Das Konzept der Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung in der Grundlegung der Ethik besteht in der notwendigen Verknüpfung des Gegenstand-Kapitels der KpV mit der Dialektik derselben. Die Verknüpfung wurde von Kant selbst nicht ausdrücklich und systematisch durchgeführt. Denn auf der einen Seite ist die Dreiteilung der Analytik in Grundsätze-, Gegenstand- und Triebfedern-Kapitel die schon früh festgehaltene leitende Idee des ethischen Untersuchungsrahmens;562 andererseits entwickelt sich, unabhängig davon, die in der Dialektik dargestellte Lehre vom summum bonum durch die Auseinandersetzung mit der Stoa, dem Epikureismus und der christlichen Morallehre. Wir haben die im ersten Kapitel der Analytik der KpV dargelegte kognitiv-formalistische Grundlegung der Ethik bereits im 1. Teil der vorliegenden Arbeit erörtert und haben auch im 2. Teil und im vorigen Kapitel (cf. 3.1) ihren notwendigen Zusammenhang mit der Lehre vom höchsten Gut gesehen: Die in der ersteren kognitiv und formalistisch nachgewiesenen moralischen Gesetze können in der letzteren, in der Lehre vom höchsten Gut, essentiell und ,moralisch-teleologisch‘ in bezug auf den Endzweck begriffen und als Gottes Gebote angesehen werden. Wir haben dann im 2. Teil der vorliegenden Arbeit den ,moralisch-teleologischen‘ Zusammenhang der Triebfeder-Lehre, die im dritten Kapitel der Analytik der KpV ihre endgültige Formulierung findet, mit der Lehre vom höchsten Gut untersucht. Die Möglichkeit nun der ,moralischteleologischen‘ Verknüpfung der Theorie des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft im zweiten Kapitel der Analytik mit derselben Lehre in der Dialektik wird Vgl. dazu Refl. 6628, XIX 117, κ–λ? (1769–70?): „Die erste Untersuchung ist: Welches sind die principia prima diiudicationis moralis [Nachtrag: theoretische Regeln der Dijudikation], d.i. welches sind die obersten Maximen der Sittlichkeit, und welches ist ihr oberstes Gesetz. / 2. Welches ist die Regel der Anwendung [Nachtrag: praktische der dijudizierenden Applikation] auf ein Objekt der Dijudikation. (...) 3. Wodurch werden die sittliche Bedingungen motiva, d.i. worauf beruht ihre vis movens und also ihre Anwendung aufs Subjekt? Die letzteren sind erstlich das mit der Moralität wesentlich verbundene motivum, nämlich die Würdigkeit, glücklich zu sein.“ 562 157 von Kant angedeutet, indem er im ersteren auf diese Lehre hinweist563 und auch in der Dialektik feststellt, daß das höchste Gut der ganze Gegenstand der reinen praktischen Vernunft ist.564 Die Durchführung dieser Verknüpfung ist darum jetzt unsere Aufgabe. Dementsprechend besteht die formale Struktur der moralisch-praktischen Zwecksetzung, in der der unendliche Progressus der Tugend, d.i. der moralischen Gesinnung im Kampfe, stattfindet, aus drei Strukturstufen: (1) die Stufe des Guten als des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft, d.i. die Grundstufe einer Selbstobjektivierung des reinen Denkens im Sittlichen (cf. 3.2), (2) die Stufe des höchsten Guts, bzw. des Endzwecks, d.i. die Hauptstufe der moralisch-praktischen Zwecksetzung (cf. 3.3) und (3) die Stufe der Postulate als Voraussetzungen der Ausführbarkeit des höchsten Guts (cf. 3.4). Der Ausdruck ,moralisches Gesetz‘ stellt eher die objektive für die Dijudikation substantivierte Formel der Aktualität der aus der Freiheit transzendentalsubjektiv erfließenden inneren kategorialen Auswirkung der Moralität in den Vordergrund. Statt seiner wird in der vorliegenden Arbeit häufig der Ausdruck ,reines Denken im Sittlichen‘, manchmal auch ,reine Noesis im Sittlichen‘, verwendet, der direkt auf diese Aktualität selbst verweisen will. Unter diesem Ausdruck ist nämlich jene sittliche Einsicht der reinen praktischen Vernunft zu verstehen, die den Kern der Moralität ausmacht und in der kognitiven Phase der Grundlegung als Faktum der Vernunft auftritt. Sie wird von Kant in den „Reflexionen“ auch ,intellektuelles Anschauen‘565 genannt, zuletzt aber dem Denken zugewiesen. Dieses reine sittliche Denken bzw. die reine sittliche ,Noesis‘ wird von ihm auch als ,Weisheit‘ bezeichnet;566 diese Bezeichnung aber erhält innerhalb der veröffentlichten Grundlegung der Ethik keine zentrale Funktion. Auch der Terminus ,reine praktische Vernunft‘ kann wohl auf dieselbe Aktualität hinweisen, bezeichnet jedoch eher ihre Funktion und Potenz bzw. das intellektuelle Organ für sie. 3.2.1 Die Distanzierung von der Zwecksetzung der Willkür. Der Gegenstand der reinen praktischen Vernunft (das an sich moralisch Gute) wird über die Intentionalität des reinen sittlichen Denkens als des reinen Willlens hergestellt und impliziert demnach den Zweckbegriff. Obwohl im GegenstandKapitel der KpV nur aus äußeren Gründen nicht explizit als Zweck bezeichnet, steht er doch in großen Zusammenhängen der moralisch-praktischen ZwecksetVgl. dazu KpV, V 64 Z25–34 <A113f>. Vgl. dazu KpV, V 109 Z21f <A196>. Vgl. auch V 119 Z11f <A214>. 565 Vgl. dazu Refl. 4336, XVII 509, µ? κ? (1770–71? 1769?): „durch unser intellektuelles inneres Anschauen (nicht den inneren Sinn)“; Refl. 4228, XVII 467, λ? (1769–70?): „unsere intellektualen Anschauungen vom freien Willen“. Vgl. auch Refl. 4334, XVII 509, µ? (1770–71?): „eine Anschauung der Selbsttätigkeit“. Der Grund, warum Kant später das Wort ,Anschauung‘ für die Aktualität des reinen sittlichen Denkens nicht verwendet, könnte vielleicht darin liegen, daß bei unserem Philosophen die erstere, sei sie sinnlich oder intellektuell, grundsätzlich auf Materialität und mithin Objekte bezogen ist, während die letztere an sich auch ohne diese bestehen kann. 566 Cf. Fußnote 641 in 3.3.1. 563 564 158 zung. Um nun die objektiv-notwendigen, moralischen Zwecke hervorbringen zu können, müssen im voraus das Fundament der Ethik (moralisches Gesetz, reine praktische Vernunft und Freiheit) und die Autonomie der Vernunft (einschließlich des Begriffs des Zwecks-an-sich-selbst) feststehen. Dafür ist zuerst die Abstrahierung von allen Zwecken, wie sie etwa im 2. Abschnitt der GMS ausgeführt wird, als formalistisches Verfahren (Abstrahierung von der Materie) notwendig. Dementsprechend wird auch im Gegenstand-Kapitel der KpV das formalistische Verfahren, das bereits im Grundsätze-Kapitel durchgeführt worden ist, wiederholt. Dabei hat der Paradoxon-Grundsatz vom Guten (siehe unten) entscheidende Bedeutung in der kritischen Grundlegung der Ethik. (a) Die intellektuelle Erstreckung des ethischen reinen Denkens auf ein Objekt. Unter der Theorie des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft als der ersten Strukturstufe der konstitutiven moralisch-praktischen Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Grundlegung verstehe ich die intellektuelle Ausdehnung bzw. Erstreckung des aus der transzendentalen Subjektivität entspringenden sittlichen reinen Denkens auf sein Objekt als das Gute (cf. 3.4.0). Das reine sittliche Denken vergegenständlicht sich selbst durch die Verbindung mit der Materie in der Maxime des Willens und bildet dadurch das Gute als sein Objekt. Seine Auswirkung nun, die in der durch die Vergegenständlichung entstandenen Ausdehnung zwischen Willen (Subjekt) und dem Guten (Objekt) vom ersteren zum letzteren verläuft, ist als ethische Intentionalität des Willens zu bezeichnen; bei der ersten Strukturstufe der konstitutiven moralisch-praktischen Zwecksetzung handelt es sich eben um diese fundamentale Intentionalität des reinen sittlichen Denkens. Ferner verstehe ich unter der Selbstobjektivierung bzw. Selbstvergegenständlichung des reinen Denkens im Sittlichen eine Grundfunktion der reinen praktischen Vernunft, das moralisch an sich Gute hervorzubringen. Der Gebrauch des von Kant selbst nicht verwendeten Wortes ist dadurch zu rechtfertigen, daß es schlechthin das, was er meint, nur treffend ausdrückt: Wenn die Selbstvergegenständlichung des reinen Denkens im Sittlichen nicht zu vollziehen wäre, so hieße es gerade, der ,Gegenstand der reinen praktischen Vernunft‘ könne nicht einmal hervorgebracht werden. Dieser Ausdruck hat nur dann seinen Sinn, wenn die reine praktische Vernunft auch das transzendental-subjektive Vermögen ist, etwas intellektuell zu vergegenständlichen. Welches der Erkenntnisvermögen und wie es diese Selbstobjektivierung des reinen Denkens im Sittlichen, somit den Gegenstand der reinen praktischen Vernunft bewerkstelligt, wird in der Kantischen Moralphilosophie nicht eingehend erörtert. Wahrscheinlich dürfte aber dabei das Vermögen mitwirken, das diskursiver Verstand genannt wird, welcher von dem ursprünglichen Vermögen der reinen praktischen Vernunft, das reine sittliche Denken hervorzubringen, zu unterscheiden ist. Jedoch ist dasjenige, was sich ausdehnt und sich etwas intellektuell zum Gegenstand macht, das reine sittliche Denken der reinen praktischen Vernunft selbst. 159 (b) Das Gegenstand-Kapitel der KpV und der Begriff eines Zwecks. Den Begriff eines Zwecks hat Kant ins Argumentationsfeld des Begriffs des Guten als des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft im Gegenstand-Kapitel567 der Analytik der KpV nicht explizit eingeführt. Er tritt allerdings an anderen Stellen des gesamten Gefüges seiner Ethik in jeweils besonderer Bedeutung auf: (1) als Zweck an sich selbst in der Autonomie des Willens, (2) als Zweck, der vorausgesehene Folge aus moralischen Handlungen ist, und (3) als materiale Zwecke in der formalistischen Grundlegung. Normalerweise sieht man etwas als gut an, weil man es als Zweck seines Willens versteht; beim Begriff des Guten hat man es prinzipiell mit dem des Zwecks zu tun. Kant hat jedoch die Anwendung des Begriffs eines Zwecks auf den Gegenstand der reinen praktischen Vernunft sorgfältig vermieden, weil das Gute (hier der Gegenstand der reinen praktischen Vernunft) nicht von der empirischen Objektivität her, sondern vom moralischen Gesetz her, d.h. vom reinen sittlichen Denken aus Freiheit her, abgeleitet werden, und die Triebfeder als die bewegende Kraft, das Gute zu exekutieren, demnach nicht in empirischen Objekten als Zwecken, sondern im moralischen Gesetz selbst, d.h. in dem reinen sittlichen Denken aus Freiheit, bestehen soll; ein dem Begriff des Guten beigelegter Zweckbegriff würde die Auffassung nahelegen, daß das Gute als Zweck in der empirischen Objektivität verankert wäre, aus der auch ein moralisches Grundprinzip deduziert werden können sollte, und daß demnach die Triebfeder zur Befolgung dieses Grundprinzips im Guten als einem Zweck liegen sollte (cf. 3.2.4). Ungeachtet dieses Bedenkens aber verliert der Begriff des Guten, sachlich betrachtet, das Charakteristikum eines Zwecks nicht. Der Mensch als ein endliches Vernunftwesen setzt sich in der Tat stets das Gute zum Zweck (cf. 3.2.1.e). Nur folgt der Zweck Kants Ansicht zufolge dem Begriff des Guten nach; er begründet weder das Gesetz, noch enthält er in sich die moralische Triebfeder. Kant hat später diese Eigenschaft des moralisch-praktischen Zwecks in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung mit dem Wort „finis in consequentiam veniens“568 zum Ausdruck gebracht. Der Begriff des Guten ist also hinsichtlich des Begriffs des Zwecks ambivalent: Die eine Seite zeigt sich darin, daß er erst durch die Selbstobjektivierung des sittlichen reinen Denkens zuwegegebracht wird und demnach selber keine Triebfeder besitzt. Die andere Seite aber besteht darin, daß nach ihm sehr wohl eine moralische Zwecksetzung erfolgt und das Gute alsdann unter diesem Aspekt Zweck wird: Die Selbstobjektivierung des reinen sittlichen Denkens selber stellt sich als Zwecksetzung heraus. Im Gegenstand-Kapitel der KpV hat Kant wohl die erstere Seite des Begriffs des Guten allein thematisiert und verfolgt. Das Kapitel ist aber sozusagen latent an seinen beiden Toren vom Begriff eines Zwecks belagert. D.h., um für die konstitutive moralisch-praktische Zwecksetzung erst einmal die Grundstufe einer ethischen Vergegenständlichung des reinen Denkens durch sich selbst installieren zu können, muß zunächst die Souveränität des moralischen KpV, V 57ff <A100ff>. Rel., VI 4 Z21 <BVI>. Obwohl dieser Begriff sich auf den Endzweck bezieht, wäre es doch auch gestattet, ihn in der eben determinierten Bedeutung auf den Begriff des Guten zurückzubeziehen. 567 568 160 Gesetzes gegründet, hierzu jedoch beim Eingangstor die materiale bzw. empirische Zwecksetzung (oder „Zwecke der Natur“) durch das formalistische Verfahren der „Kritik der praktischen Vernunft“ beiseitegedrängt werden. Beim Ausgangstor aber wird der reine Wille, der schließlich in die empirisch-objektive Dimension doch wieder hinausgehen muß, den Begriff eines Zwecks (Zwecke „der Freiheit“569 ) erneut aufnehmen müssen. (c) Die faktisch-fundamentale Vorstufe einer indifferenten Zwecksetzung des Willens. Daß der menschliche Wille jedenfalls auf Zwecke bezogen ist, hängt von der elementaren Grundstruktur des menschlichen Aktus ab, die die allererste Voraussetzung des gesamten Argumentationsgangs über die Strukturstufen der ,moralischen Teleologie‘ in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung ausmacht. Es geht nämlich der ersten Strukturstufe derselben noch eine faktische Vorstufe der indifferenten Zwecksetzung voraus. Das menschliche Handlungssubjekt als freie Willkür macht sich unabdingbar etwas zum Zweck. Die Zwecksetzung des Willens als faktisch-fundamentale Funktion, die nicht nur auf das Moralische, sondern an sich indifferent auch auf etwas Nicht-Moralisches gehen kann, beruht auf dem Sich-befassen-mit-den-Sachen als Grundverfassung des menschlichen Aktus; der Mensch muß in seiner Tätigkeit unter Verwendung von ihm eigentümlichen Vermögen auf die Sachen selbst gehen. Alles Wollen muß sich auf irgendein Objekt beziehen. „Nun ist freilich unleugbar, daß alles Wollen auch einen Gegenstand, mithin eine Materie haben müsse“.570 Das Objekt des Wollens wird üblicherweise Zweck genannt. Es ist nämlich die fundamentale Funktion der mit Vernunft versehenen freien menschlichen Willkür, daß sie in äußeren Verhältnissen vor sich einen Zweck aufstellt.571 Die Zwecksetzung wird durch die Vernunft vollzogen. Die ethische Analyse der formalen Struktur der moralisch-praktischen Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der ethischen Grundlegung geht demnach ebenso wie die Analyse der formalistischen Grundlegung der Ethik von der Zwecksetzung der Willkür bzw. des Willens aus. Cf. 3.1.1.a. (d) Die Differenzierung des Begriffs des Guten sowie der faktisch-fundamentalen Funktion der praktischen Vernunft. Die praktische Vernunft aber, die mit Hilfe ihres Begriffs vom Zweck-Mittel-Verhältnis die Zwecksetzung überhaupt vollzieht, wird zunächst durch die pathologisch-praktische Lust gelenkt und stellt dabei als empirisch bedingte Vernunft der Willkür nur das 569 Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien, VIII 182. KpV, V 34 <A60>. Selbst der strenge ethische Formalismus der reinen praktischen Vernunft hat nur dann seine Bedeutung, wenn ihre formale Gesetzgebung sich auf die Materie bezieht. Vgl. hierzu Refl. 6883 (cf. Fußnote 761 in 3.5). 571 Vgl. z.B. Refl. 1052, XV 470, ψ3 ? (1785–88?), wo die Willkür bzw. der Wille mit dem Zweck in Zusammenhang gebracht ist. Vgl. auch MS, VI 381 Z4–6, 384 Z33f. 570 161 mittelbar Gute (das Nützliche) als hypothetisches Mittel zum als Zweck genommenen Angenehmen bereit (cf. 2.3.1.c). Um nun das unmittelbar moralisch Gute, d.i. einen Gegenstand der reinen praktischen Vernunft herauszustellen, ist es daher erforderlich, durch ein formalistisches Verfahren sowohl von den durch jene Lust bestimmten empirischen Zwecken Abstand zu nehmen als auch auf diese Weise die praktische Vernunft zu purifiziern, d. i. sie von ihrer empirischen Bedingtheit zu befreien und in die reine praktische Vernunft umzuwandeln, die nur dem Unbedingten nachgeht. Das ist die ursprüngliche Aufgabe der Kritik der praktischen Vernunft572 und wird bereits im Grundsätze-Kapitel der KpV als kognitive formalistische Grundlegung vollzogen. (e) Der Ausschluß der Bösartigkeit aus der moralischen Dogmatik. Die freie Willkür des Menschen begehrt das Gute und verabscheut das Böse.573 Das Böse zu begehren, ist bei Kant wohl am Anfang der Analyse der formalistischen Grundlegung einzuräumen, kommt jedoch in der der ,moralisch-teleologischen‘ außer den vom Prinzip der Moralität nur abweichenden Fällen von Gebrechlichkeit und Unlauterkeit grundsätzlich nicht in Frage. Das Begehren des Bösen und das Verabscheuen des Guten nämlich können im Begriff einer allgemeinen Zweckbeziehung der Willkür mit enthalten sein, werden jedoch von der moralischen Dogmatik der ,moralischen Teleologie‘ ausgeschlossen. Denn in ihr wird ihre Voraussetzung, die Revolution der Denkungsart in der ursprünglichen Freiheit der Willkür, aufgrund deren das Bewußtsein des reinen sittlichen Denkens sich uns als Faktum der reinen praktischen Vernunft aufdrängt, für bereits vollzogen gehalten, obwohl noch bezüglich der Gebrechlichkeit und Unlauterkeit als Nachwirkung der früheren Gewohnheit auf empirischer Ebene die allmähliche Reform der empirischen Gesinnung vor sich gehen muß. (f) Die Abstrahierung von allen Zwecken in der formalistischen Phase der Grundlegung der Ethik. Die Objekt- bzw. Zwecksetzung durch die menschliche Willkür im allgemeinen Sinn ist die Voraussetzung sowohl für die moralisch-praktische Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase als auch schon für die formalistische Phase der Grundlegung. Die formalistische Grundlegung, d.i. die Abstrahierung von empirischen Zwecken als Bestimmungsgründen des Willens (dem Angenehmen), ist ja nur möglich, wenn diese Zwecke zunächst für den Willen vorausgesetzt werden. Im zweiten Anlauf574 der formalistischen Grundlegung des 2. Abschnitts der GMS z.B. wird der Wille, wobei es sich ebenso um die mit Vernunft versehene freie Willkür des Menschen handelt wie im ersten Anlauf575 derselben (die AusVgl. dazu Refl. 7201, XIX 275 Z21–23, ψ (1780–89) (cf. Fußnote 46 in 1.1). Vgl. KpV, V 58 Z6–9 <A101>. 574 GMS, IV 427 Z19 – 428 Z2 <B63f>. 575 GMS, IV 412 Z26 – 413 Z8 <B36f>. 572 573 162 gangsbasis beider formalistischen Ausführungen ist das arbitrium liberum), mit dem Zweckbegriff verbunden eingeführt. Es wird von den materialen Zwecken abstrahiert, um den intellektuellen Zweck an sich selbst herauszustellen, der auf der reinen, transzendentalen Subjektivität der Willensbestimmung beruht. Wenn empirische Zwecke, die durch die pathologisch-praktische Lust die Willkür bestimmen können, durch das formalistische Verfahren eliminiert werden, bleibt im Ursprung des Willens nur das reine Denken (die Selbstgesetzgebung durch Vernunft, d.i. die Autonomie des Willens bzw. der Zweck an sich selbst) als Bestimmungsgrund des Willens übrig. Man kann nun aber dieses Verfahren auch modifiziert ausführen: Wenn bereits das ethische reine Denken durch das formalistische Verfahren enthüllt ist, d.h. in den Maximen die bloße Form der allgemeinen Gesetzmäßigkeit als oberster, selbst unbedingter, Bedingung aller Zwecke explizit etabliert ist, so läßt sich die Eliminierung aller materialen Zwecke auch nachträglich so erklären, daß die Moral aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit für die Erkenntnis und Ausübung der Pflicht „gar keines materialen Bestimmungsgrundes der freien Willkür, d.i. keines Zwecks“ bedarf, sondern „von allen Zwecken abstrahieren“ kann und soll.576 (g) Die Notwendigkeit der Wiederholung des formalistischen Verfahrens im Gegenstand-Kapitel. So wird auch im Gegenstand-Kapitel der KpV die Analyse der formalistischen Phase der Grundlegung, die bereits im Grundsätze-Kapitel vollzogen worden ist, wiederholt.577 Dies ist vonnöten, weil erst einmal aufgewiesen werden soll, daß die Idee eines Gegenstands der reinen praktischen Vernunft im ,moralisch-teleologischen‘ Entwurf von der Freiheit her auf die empirische Objektivität hin, aufgrund deren auch ein neues Konzept der Zwecksetzung eingeräumt wird, vom Begriff eines aus dem pathologisch-praktischen Gefühl der Lust und Unlust mit Hilfe der empirisch bedingten praktischen Vernunft gesetzten, materialen Zwecks (des Angenehmen) als eines dem Gesetz vorhergehenden Bestimmungsgrundes der Willkür prinzipiell zu unterscheiden ist. Der materiale Zweck steht deswegen am Anfang einer formalistischen Grundlegung als der durch sie zu negierende Begriff. (h) Das methodische Paradoxon der Kantischen Ethik: die Beiseitesetzung der Gegenständlichkeit von Gegenständen überhaupt vor dem moralischen Gesetz. Daß nun dieser „Begriff des Guten und Bösen nicht vor dem moralischen Gesetze (...), sondern nur (...) nach demselben und durch dasselbe bestimmt werden müsse“,578 ist „das Paradoxon der Methode“ der kritischen Ethik. Dabei hat man es Vgl. Rel., VI 3f <BIVf>. KpV, V 58 Z10 – 65 Z4 <A101–114>. 578 KpV, V 62f <A110>. Dieser Gedanke – demnach auch das Motiv des Formalismus – tritt bei Kant sehr früh auf. Z.B. Ref.3872, XVII 319f, η? (1764–68?): „... es [sc. das Gute] ist nur die Wirkung, die nach Gesetzen desselben möglich ist.“ 576 577 163 mit dem Ergebnis der kognitiven formalistischen Grundlegung zu tun, welche erstmals herausgestellt hat, daß die dem Willen heteronome Gegenständlichkeit von Erscheinungen überhaupt, die durch die Verstandessynthesis zuwegegebracht werden und zu der auch der Begriff des Guten und Bösen im Paradoxon-Grundsatz gehört, keine Voraussetzung zur apriorischen Bestimmung des freien Willens bilden kann, weil das Gefühl der Lust und Unlust, dem sie zur Willkürbestimmung unterzogen wird, kein selbständiges unbedingtes Kriterium für die moralische Willensbestimmung sein kann, sondern daß erst die Autonomie des Willens, oder das transzendental-subjektive reine Denken im Sittlichen, die über jene Gegenständlichkeit von Erscheinungen überhaupt und mithin auch den Begriff des Guten und Bösen als Gegenstandsvorstellung hinausgeht, den Willen a priori bestimmen kann. Wenn nicht die Gegenständlichkeit als Inbegriff von Gegenständen überhaupt, sondern nur ein Teil der Gegenstände der Sinnenwelt als für den Grund der apriorischen Willensbestimmung ungeeignet zurückgewiesen werden sollte, so könnte der Fall eintreten, daß hinsichtlich der Willensbestimmung ein Gegenstand als das Gute dem Gesetz vorhergehe, welcher Fall aber dem obigen Paradoxon-Grundsatz Kants zuwider läuft. Dieser Verstoß aber bleibt aus, wenn die Gegenstände überhaupt als apriorische Bestimmungsgründe des Willens im Bereich der Ethik formalistisch negiert werden. Demzufolge müßten auch die ,intellektuellen‘ Vorstellungen im gewöhnlichen Sinn, die aus den primären Gegenständen im Naturverlauf durch den regulativen Gebrauch der Vernunftideen mittels der reflektierenden Urteilskraft zweckmäßig zustandekommen und demnach im Grunde empirisch sind, als moralische Bestimmungsgründe des Willens ausscheiden. Das will sagen, sowohl die Gegenständlichkeit von Gegenständen, die die Willkür nur über das Gefühl der Lust und Unlust bestimmen können, welches man, solange man nur in der Sinnenwelt ein Kriterium für die Willkürbestimmung auffinden will, als einziges Kriterium akzeptieren muß, als auch mithin die Sinnenwelt überhaupt sollten um der moralischen Willensbestimmung willen einmal überwunden werden, damit das transzendental-subjektive reine sittliche Denken, das keineswegs aus Gegenständen entspringt, sondern wenn es sich auf dieselben beziehen soll, umgekehrt nur als konstitutive Bedingung ihrer Möglichkeit auftritt, ohne die Behinderung durch empirische Bestimmungsgründe als Gesetz unmittelbar den Willen a priori und demnach moralisch bestimmen kann. Die Gegenständlichkeit von Gegenständen, die auf der Gegenstandskonstitution der Verstandessynthesis beruht, ist daher für die apriorische Willensbestimmung durchaus sekundär und steht hinsichtlich derselben prinzipiell der intellektuellen Gesetzmäßigkeit des moralischen Gesetzes nach. Unter diesem Gesichtspunkt kann selbst das Gute als ein Gegenstand, mag es aus der Sinnlichkeit oder sogar aus der reinen praktischen Vernunft hervorgehen, grundsätzlich gar nicht der Grund der moralischen Willensbestimmung sein, sondern ist nur Folge derselben. Das Gesetz also determiniert das Gute; dieses aber jenes nicht. Kurzum: Das transzendental-subjektive reine Denken als Vernunft- bzw. Freiheitskausalität bestimmt den freien Willen a priori und mithin moralisch; das Gute aber, so gut es auch immer erscheinen mag, vermag es paradoxerweise nicht, weil ihm die Gegenständlichkeit der in der Sinnenwelt angetroffenen Gegenstände 164 attribuiert ist.579 Das Paradoxon ist also darin verankert, daß die von Raum und Zeit determinierte Gegenständlichkeit von Gegenständen als die formale Gesamtstruktur der Sinnenwelt überhaupt für die Schaffung eines primären Grundes der moralischen, demnach apriorischen Willensbestimmung ungeeignet ist. Aus ihrer Untauglichkeit zur Moralität ergibt sich in der Grundlegung der Ethik eine gewisse Beiseitelegung der für sie konstitutiven mit der transzendentalen Einbildungskraft (als Vermögen der transzendentalen Schemata) verbundenen transzendentalen Apperzeption; die hat Kant zwar stillschweigend vollzogen, sich aber auf eine Erörterung ihrer Bedeutung nicht eigens eingelassen. Aus dem Paradoxon-Grundsatz über die Gegenstände der reinen praktischen Vernunft also, wenn man ihn nur folgerichtig durchdenkt und dabei auf die ihm zugrundeliegende kognitive Deduktion der Freiheit in § 5 der Analytik der KpV Rücksicht nimmt (cf. 1.4), läßt sich nach aller oben ausgeführten Argumentation auch sagen, daß keine Bestimmungsgründe in der Idealität von Raum und Zeit, sondern erst die Gesetze a priori in der vom Gesetz als Faktum aus deduzierten Realität der Freiheit den Willen moralisch bestimmen können, damit wir richtig leben können.580 Diese Konsequenz ist bei Kant auch entwicklungsgeschichtlich schon vorprogrammiert. Denn erst auf die Realität von Gesetz und Freiheit in seiner moralischen Grunderfahrung hin, die auch zur Annahme der intelligiblen Welt führt und an der er spätestens seit Mitte der sechziger Jahre festhält, ist vermutlich im Jahre 1769 vom großen Licht auch die Idealität von Raum und Zeit konzipiert worden,581 ohne die jene für empirisch bedingt gehalten werden müßte, und danach konnten die Versuche der Auflösung der Dritten Antinomie folgen. Kurz: Die Idealität von Raum und Zeit beruht konzeptionell auf der Realität von Gesetz und Freiheit. Entwicklungsgeschichtlich also a limine zu rechtfertigen ist die Distanzierung von der Gegenständlichkeit von Gegenständen um der moralischen Willensbestimmung willen in der KpV, d.h. daß die reine praktische Vernunft bzw. der reine Wille eines Menschen sich von jenem transzendentalen System der Konstitution der Gegenständlichkeit von Gegenständen entfernen muß, für das die Idealität von Raum und Zeit wesentlich ist und dessen Schlußstein eben die mit der transzendentalen Einbildungskraft verbundene transzendentale Apperzeption ist. In dieser moralisch-praktischen Distanzierung wird demnach das ganze transzendentale System von theoretischer Erkenntnis unter den intelligiblen Aspekt gestellt und als Vgl. dazu Refl. 6983, XIX 219, ϕ? (1776–8?): „Sei für das Gute, nicht bloß vom Guten affiziert, d.i. als Täter, nicht bloß als Zuschauer.“ 580 Zu Idealität von Raum und Zeit und Realität der Freiheit vgl. exemplarisch Refl. 7316, XIX 314, ω4 (1796–98): „Wir haben aber auch noch ein Sollen a priori (das absolute) in uns vermöge der Idee der Freiheit, welches ohne einen in unserem Willen vorhandenen kategorischen Imperativ nicht möglich wäre. – Ohne die zum Grunde gelegte Idealität des Raumes und der Zeit, mithin der Gegenstände als Erscheinungen, würden wir die Realität der Freiheit uns gar nicht praktisch denken können, weil sonst das Sollen immer empirisch bedingt sein würde.“ Vgl. auch Fortschritte, XX 311 Z10–24; Refl. 6344, XVIII 669 Z3f, ω4 (1797), Refl. 6349, XVIII 672–675, ω4 (1797), Refl. 6353, XVIII 679f, ω4 (1797). 581 Vgl. dazu Schmucker, J., Die Ursprünge der Ethik Kants in seinen vorkritischen Schriften und Reflexionen, Meisenheim a. Gl. 1961, S. 388. 579 165 ideal, mithin nicht-real, angesehen. Daraus erhellt auch, warum Kant die Dinge in der Sinnenwelt bloß als Erscheinungen bezeichnet. Die die kritische Ethik kognitiv begründende Radikalisierung des formalistischen Verfahrens in der KpV, die auf der subjektiven Seite der Begründung der Moralität mit der Verlagerung der moralischen Triebfeder ins Gesetz zusammengeht, vollzieht sich auf der objektiven Seite derselben durch die ausdrückliche Fernhaltung des Bestimmungsgrundes des Willens von der Gegenständlichkeit von Gegenständen überhaupt. Sowohl die Genese des moralisch Guten durch die Selbstobjektivierung des reinen Denkens im Sittlichen als auch die dadurch eingeräumte neue intellektuelle Zwecksetzung ist aufgrund der formalistischen Distanzierung von der Gegenständlichkeit von Gegenständen, nämlich aufgrund der intellektuellen Freiheit allein möglich. Erst durch die radikale formalistische Rückführung auf die Freiheit als Autonomie der Vernunft ist für Kant jener Weg des Progressus eines Menschen, nicht durch Zwecke den Willen zu bestimmen, sondern erst von diesem aus jene ohne Verwendung des empirisch bedingten Zweck-Mittel-Verhältnisses intellektuell zu entwerfen, d.h. der Weg zu einer Teleologie der menschlichen Vernunft aus Freiheit des Willens, freigelegt worden. 3.2.2 Die Genese des Guten als Gegenstand der reinen praktischen Vernunft. Der freie Wille soll also nicht durch das Objekt bzw. dessen Vorstellung als primären Grund bestimmt werden, sondern ist ein Vermögen in der umgekehrten Richtung aus der Autonomie der Vernunft, sich eine Regel der Vernunft zum Bewegungsgrund einer Handlung zu machen, durch die ein Objekt verwirklicht wird; d.h. er wird durchs Vernunftgesetz dazu bestimmt, etwas zu seinem Objekt zu machen.582 In dieser Richtung von der Autonomie der Vernunft her auf das zu verwirklichende Objekt hin wird nun der Begriff des Guten als eine übersinnliche Idee hergestellt durch die Projektion des Gesetzes auf die durch Handlungen empirische Objekte tangierenden Maximen des Willens, d.i. durch die Selbstobjektivierung des sich auf die empirisch-objektive Dimension erstreckenden reinen sittlichen Denkens bzw. durch die Ableitung vom vorhergehenden Gesetz.583 Wie unten gezeigt wird (3.2.3, 3.2.4), ist er denotativ mit dem eines Zwecks wohl nicht vollkommen identisch, deckt sich aber mit ihm funktionell ziemlich gut. (a) In der Richtung auf Objekte der Sinnenwelt erstreckt584 sich das ethische reine Denken von der Autonomie der Vernunft auf die Dimension der Objektivität von Objekten; m.a.W., die reine praktische Vernunft macht sich etwas intellektuell zum Objekt. Dadurch entsteht in der Dimension der Objektivität der Begriff Vgl. KpV, V 60 Z13–19 <A105>. Vgl. zur ,Ableitung‘ KpV, V 58 Z10f <A101>. 584 Diese Erstreckung des reinen Willens auf die Dimension der Objektivität bei der Genese des Guten stellt noch nicht genau die „Erweiterung“ (KpV, V 134 Z8–13 <A241>; Rel., VI 7 Anm. Z28– 30 <BXII>; Gemeinspruch, VIII 280 Anm. Z17–21; cf. 3.4.0.6) in der Kantischen Wortverwendung dar, die sich auf die Setzung des Endzwecks bezieht. 582 583 166 des Guten (der Gegenstand der reinen praktischen Vernunft), der aber nicht mit einem realen Objekt gleich,585 sondern lediglich eine übersinnliche Idee586 in der Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens ist. Da er in dieser Weise von der Autonomie der Vernunft durch die Freiheitskausalität gesetzt wird, so wird er als „die Vorstellung eines Objekts als einer möglichen Wirkung durch Freiheit“587 bezeichnet. (b) Mit dem Guten als Objekt sind konkret hauptsächlich Maxime, Handlung und Person gemeint. (α) Das reine sittliche Denken vergegenständlicht sich, indem es in der Maxime als Form der Allgemeinheit die Materie derselben bestimmt. Gut ist dabei, näher gesehen, die Form der Maxime allein, in die die Aktualität des reinen sittlichen Denkens verlegt ist, doch kann auch eine solche Maxime im ganzen gut heißen. (β) Aufgrund einer solchen Maxime vollzieht sich durch den Willen eine moralische Handlung, in der sich demzufolge die Aktualität des reinen sittlichen Denkens kundgibt.588 Das Gute als der Gegenstand der reinen praktischen Vernunft zeigt sich daher in der „Beziehung des Willens auf die Handlung“,589 und gut ist demnach die in der Autonomie der Vernunft gewollte moralische Handlung selbst. Über diese Grenze einer moralischen Handlung hinaus kann sich in der Sinnenwelt das reine sittliche Denken in seiner Reinheit nicht unmittelbar auswirken und ausdehnen und demzufolge etwas Gutes nicht alleine schaffen. Ob nämlich durch diese Handlung ein Objekt, das ebenso gut wie sie sein soll, realisiert werden kann oder nicht (die physische Mögichkeit desselben), das entscheidet nicht die Freiheitskausalität des reinen Denkens im Sittlichen, sondern die Naturkausalität aus sinnlicher Erfahrung. (γ) Da also auch die Person, die als Sitz der Autonomie des Willens und des Subjekts des moralischen Gesetzes durch dieses unmittelbar bestimmt und demnach gut ist, auch als Gegenstand betrachtet werden kann, so zählen zum Begriff des moralisch Guten als Gegenstand der reinen praktischen Vernunft „nur die Handlungsart, die Maxime des Willens und mithin die handelnde Person selbst“590 und keine außer dem Umkreis des guten freien Willens befindlichen empirischen Objekte selber, die ihn in umgekehrter Richtung empirisch und demnach nicht aus Pflicht bestimmen würden. (δ) Nun wird in der vorliegenden Arbeit auch der BeVgl. KpV, V 65 <A114>: „... so beziehen sie [sc. die Begriffe des Guten und Bösen] sich ursprünglich nicht (...) auf Objekte“. Der Satz „Die Begriffe des Guten und Bösen bestimmen dem Willen zuerst ein Objekt“ (KpV, V 67 <A119>) besagt nicht die Identität des Guten mit einem realen Objekt, sondern daß der Begriff des Guten in der Richtung auf ein Objekt operiert. 586 Vgl. KpV, V 68 Z9 u. Z19 <A120>. 587 KpV, V 57 <A100>. 588 Die Handlung, woran die Vernunft unmittelbares Interesse nimmt, ohne an Gegenständen als Bestimmungsgründen des Willens interessiert zu sein (GMS, IV 413f Anm. <B38>, 459f Anm. <B122>), wäre mit den Erläuterungen des Aristoteles zur ἐνέργεια (lat.: actualitas) einmal zu vergleichen: „... bei dem aber, bei welchem es nicht neben der wirklichen Tätigkeit ein Werk gibt, ist die wirkliche Tätigkeit in ihm selbst, z.B. das Sehen in dem Sehenden, das Denken in dem Denkenden, das Leben in der Seele ...“ (Arist., Met., Θ. 8. 1050 a, in: Aristoteles’ Metaphysik, griech.-dt., in der Übers. v. Hermann Bonitz, neu bearb., mit Einl. u. Kommentar hersg. v. Horst Seidl, Halbbd. 2, Hamburg 1980, S. 127). 589 KpV, V 57 <A100>. 590 KpV, V 60 <A106>. 585 167 griff der einzelnen Pflicht, welche Maximen und Handlungen bestimmt und für sie die repräsentative Rolle der Bonität spielt, wegen dieser Rolle als zum Begriff des Guten gehörend behandelt. Es gibt jedoch aus ebendemselben Grund nur gute Pflichten. Alle diese Begriffe nun können gegenüber dem einzigen höchsten Gut als das einzelne Gute bezeichnet werden. (c) Die Vergegenständlichung des reinen Denkens im Sittlichen als Ausdehnung desselben kann auch unter dem Aspekt der praktischen Realität des Verstandesbegriffs einer Kausalität aus Freiheit betrachtet werden. Die Betrachtung wird in der theoretischen Vernunft der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe entsprechen können. Während der Begriff eines empirischen Objekts, das durch die sinnlich affizierte Willkür gewünscht oder ersehnt wird, damit noch keine objektive Realität hat, so hat der Begriff des an sich Guten als des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft für die apriorische Willensbestimmung und mithin die moralische Handlung doch praktisch-objektive Realität und Bedeutung, weil das moralische Gesetz, indem es das Verhältnis des Verstandes zum Willen a priori bestimmt, dem Begriff dieses Verhältnisses objektive Realität verschafft.591 Der reine Verstandesbegriff einer Kausalität der Freiheit (dessen modi die Begriffe des Guten und Bösen als Folgen der Willensbestimmung a priori sind), der auf die Bestimmung der freien Willkür geht und darum keine ihr korrespondierende Anschauung zur theoretischen Erkenntnis benötigt, hat statt der Form der Anschauung die „Form eines reinen Willens“ in der Vernunft zu Grunde liegen, so daß die praktischen Begriffe a priori die Willensgesinnung selbst hervorbringen können; er ist befugt, sich auf diese Weise in der moralischen Gesinnung praktisch-real durchzusetzen.592 Das reine sittliche Denken, das aus der Autonomie der Vernunft hervorgeht, gibt demzufolge dem von ihm gemachten Objekt praktisch-objektive Realität und Bedeutung, indem es sich selbst im Willen ohne irgendwelche Anschauung unmittelbar vergegenständlichen kann, um dadurch ein Objekt hervorzubringen. (Cf. 3.4.0.5). 3.2.3 Die theoretische Schwierigkeit der obigen Lehre von der Genese des Guten: die Genese des Guten bei den vollkommenen, engeren, unnachlaßlichen Pflichten und bei den unvollkommenen, weiteren, verdienstlichen Pflichten. Mit der obigen Lehre von der Genese des bis zur aktualen Handlung gültigen intellektuellen Guten durch die Selbstobjektivierung des reinen sittlichen Denkens (auf der ersten Stufe der moralisch-praktischen Zwecksetzung in der ,moralischVgl. dazu KpV, V 138 Z6–11 <A249>. Dies gilt, wie unten betrachtet wird, freilich vollständig von dem Guten, das die engeren, unnachlaßlichen Pflichten angeht, prinzipiell aber auch von dem Guten, das die weiteren, verdienstlichen Pflichten anbelangt und sich demnach ausdrücklich auf den Begriff eines Zwecks bezieht, weil immerhin das Gesetz auch für das letztere Gut ausschlaggebend wirkt. 592 Vgl. dazu KpV, V 65 Z5 – 66 Z15 <A114–116>. Die „Form eines reinen Willens“ wird in Refl. 7204 „die formale Einheit im Gebrauche unserer Freiheit“ oder „die Identität meines Wollens“ genannt, die in theoretischer Erkenntnis der „Identität der Apperzeption“ entspricht (XIX 283f). 591 168 teleologischen‘ Phase der Grundlegung) hat Kant, zusammen mit der neu festgelegten Triebfeder-Lehre im Triebfedern-Kapitel der Analytik der KpV, die Souveränität sowohl des moralischen Gesetzes als auch der menschlichen Freiheit nach einem wohl mit der Deduktion der KrV vergleichbaren, jedoch wegen der unmittelbaren Selbstobjektivierung des reinen sittlichen Denkens viel einfacheren Deduktionsverfahren in einer eindeutigen vektorartigen Richtungsbestimmung nachgewiesen. Somit war die architektonische ,moralisch-teleologische‘ Grundlage für die zwar formalistisch von der Autonomie der Vernunft transzendental-subjektiv ausgehende, jedoch essentiell in der Erweiterung auf den Endzweck verankerte Kantische Moral geschaffen. Eine Schwierigkeit aber dieser Theorie über die Genese des Guten befindet sich im von der Seite der Intellektualität her gesetzten Berührungspunkt des reinen sittlichen Denkens als Freiheitskausalität mit empirischen Objekten in der Naturkausalität, wie etwa im Vorgang des reinen sittlichen Denkens, in dem es in der Maxime als die Form derselben die Materie derselben bestimmt. (a) Die Genese des Guten und die engeren, unnachlaßlichen Pflichten. Bei den vollkommenen, d.i. engeren, unnachlaßlichen Pflichten wie Suizidverbot und Wahrhaftigkeit können Maxime und Handlung, die gut heißen, schlechterdings durch die Ausdehnung bzw. Selbstobjektivierung des reinen sittlichen Denkens allein gestaltet bzw. ausgeführt werden. Es wird dabei im Grunde keine materiale Bedingung benötigt. Denn bei der Materie derartiger Pflichten handelt es sich letzten Endes um die reine praktische Vernunft selber, die zugleich Subjekt dieser Maximen und Handlungen ist, m.a.W., um die Aktualität des reinen Denkens im Sittlichen selber, und erst im Gefolge davon werden um des Schutzes des Bestehens derselben vor jeder empirischen Ver- und Behinderung willen auch materiale Bedingungen berücksichtigt. So erfordert der Anspruch auf die Erhaltung der schon existierenden reinen praktischen Vernunft bzw. des reinen sittlichen Denkens durch sich selbst beim Selbstmordverbot die Fortsetzung des Daseins der Person als ihres Sitzes und beim Lügeverbot, das Pflicht sowohl gegen sich selbst593 als auch gegen andere sein kann, die Offenheit der aus ihr fließenden Tätigkeit, ohne die diese behindert würde. (α) Wenn es also bei jener Materie der Maxime, die durchs Gesetz bestimmt werden soll bzw. auf die das sittliche reine Denkens sich projizieren will, um die reine praktische Vernunft als Gesetzeslieferant bzw. das reine Denken im Sittlichen selber zu tun ist, so heißt es, daß das Woraufhin der Anwendung des Gesetzes, d.i. das Woraufhin der Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens nichts anderes ist als dieses reine sittliche Denken selbst bzw. die reine praktische Vernunft. Die Identität von Subjekt (die bestimmende Vernunft) und Objekt (die zu bestimmende Materie) in bezug auf die Gestaltung der Maxime aber führt zur vollständigen Regentschaft des formal-logischen Konsistenzprinzips in derselben. M.a.W.: Eine notwendige 593 Vgl. MS, VI 428–431. 169 Folgerung, in der etwas nur seine eigene Erhaltung zum Resultat haben soll, muß jeden Widerstreit und Widerspruch von sich ausschließen. Daher kann bei diesen Pflichten für ihre Formung und Beurteilung das negative Prinzip des moralischen Gesetzes, das formal-logische Konsistenzprinzip, auf ihre Materie vollauf angewendet werden, ohne sonstige materiale Prinzipien mitwirken zu lassen.594 Das Gute kann hier, um Ausdrücke der „Reflexionen“ zu verwenden, rein aus der ,Zusammenstimmung mit sich selbst als mit dem Gesetze‘ hergestellt werden. (β) Aus dieser allgemeinen Feststellung erhellt, daß es bei den Pflichten dieser Art um eine Art des Selbstzwecks, die „Selbsterhaltung der Vernunft“595 geht. Daher ist für diese Pflichten das Prinzip des Zwecks-an-sich-selbst unmittelbar anwendbar.596 Das Gute in ihnen wird demnach aus dem moralischen Selbstzweck einer Selbsterhaltung der reinen praktischen Vernunft durch die Selbstidentität desselben hergeleitet. Es ist nun aber zu bemerken, daß zu dieser Genese des Guten eine von reflektierender Urteilskraft angenommene zweckmäßige Ordnung nicht benötigt wird.597 In dieser Genese bestimmt die reine praktische Vernunft unvermeidlich sich selbst nur dazu, sich selbst als das Gute zu ihrem Gegenstand zu machen. Ein ihr fremdes Bestimmungselement kann in die Formung dieser Pflichten nicht hineingemengt werden, weil es sich bei der Materie ihrer Maximen um nichts anderes als um die reine praktische Vernunft bzw. das reine Denken im Sittlichen selber handelt. Die Genese des Guten bei diesen Pflichten wird daher auch keinesfalls von einem gewöhnlichen Zweck der Handlung, einem Ziel als dem Wohin derselben, inhaltlich determiniert, der auch mit dem Begriff des Zwecks-an-sich-selbst zunächst nichts zu tun hat. (b) Die Genese des Guten und die weiteren, verdienstlichen Pflichten. Bei der Genese des Guten aber, das die unvollkommenen, d.i. weiteren, verdienstlichen Pflichten, wie etwa Talententwicklung, Kultur der Tugendgesinnung598 oder 594 Vgl. dazu GMS, IV 421 Z24 – 422 Z36 <B53–55>. Im vorliegenden Kapitel wird der zweite Abschnitt der GMS nur in Hinsicht auf die Zwecksetzung aus der reinen praktischen Vernunft in Betracht gezogen. Obwohl er von Kant zusammen mit dem ersten als analytisch bezeichnet wird und hauptsächlich die formalistische Grundlegung beabsichtigt, stellt die Ableitung der Pflichten aus dem Gesetz in ihm neben dem Begriff des Zwecks-an-sich-selbst, der sich auf die Idee des Reichs der Zwecke bezieht, die ,moralisch-teleologische‘ Phase der Grundlegung der Ethik dar. Zu dieser Ableitungsproblematik vgl. die didaktisch ausgezeichnete Standardarbeit von J. Ebbinghaus, Die Formeln des kategorischen Imperativs und die Ableitung inhaltlich bestimmter Pflichten, in: G. Prauss [Hrsg.], Kant, Köln 1973, S. 274–291. 595 Vgl. dazu Was heißt: S.i.D.or.?, VIII 147 Anm. An dieser Stelle aber verwendet Kant das Wort lediglich in bezug auf Selbstdenken und Aufklärung. Vgl. aber auch Refl. 1509, XV 823, ψ1−2 (1780– 84): „Grundsatz der Vernunft: ihre Selbsterhaltung.“ Vgl. zu dieser Thematik Sommer, M., Selbsterhaltung als rationales Prinzip, in: ders., Identität im Übergang: Kant, Frankfurt/M. 1988, S. 90–116. Cf. 3.4.1.d und Fußnote 351 in 2.5.2. 596 Vgl. dazu GMS, IV 429 Z15 – 430 Z9 <B67f>. 597 Vgl. dazu H. J. Paton und M. Fleischer (cf. Fußnote 286 in 2.3.2). 598 Die Kultur der Tugendgesinnung, die auch als Erhöhung der eigenen moralischen Vollkommenheit bezeichnet wird und die moralische Asketik darstellt, ist dem Grade nach und zuletzt, im ganzen 170 Beförderung der Glückseligkeit anbelangt, geht es anders zu: Bei den Pflichten dieser Art bezieht sich die reine praktische Vernunft nicht bloß auf sich selbst, sondern auf eine ihr fremde Materie. Sie muß bei ihnen zur Herstellung des Guten, bzw. zur Beurteilung der moralisch richtigen Maxime als Wille über die Anwendung des von der Einheit und Allgemeinheit des reinen sittlichen Denkens abgeleiteten und die Beurteilung des Guten der engeren, unnachlaßlichen Pflichten für sich alleine bestimmenden logischen Konsistenzprinzips auf das reine sittliche Denken selbst hinaus um einen Schritt weiter in die Dimension der empirischen Objektivität rücken und hier in äußeren Verhältnissen, in denen gerade Mangel waltet, die materialen Bedingungen überhaupt, mithin auch das heraussuchen und auffinden, was tatsächlich aus den von der in einer gewählten Maxime fundierten Willensbestimmung geleiteten Handlungen folgt, welches aber dann als vorausgesehene Folge (als das erste) von dem Willen auch Zweck genannt werden kann. Ohne sich nämlich in der empirisch-objektiven Dimension nach der Folge der Handlungen aus der Willlensbestimmung, die auf einer gewählten Maxime basiert, umzusehen und darin etwas aufzufinden, was die moralische Richtigkeit dieser Maxime bestätigen kann, kann sie diese Pflichten gar nicht hinsichtlich ihrer Richtigkeit beurteilen, d.h. das Gute in ihnen herstellen. (α) Für die Feststellung der weiteren, verdienstlichen Pflichten muß der reine Wille einen Schritt weiter in die empirische Objektivität hineinrücken. Zur Erörterung dienen die Darlegungen der Naturgesetz-Formel des kategorischen Imperativs in der GMS und der Typik der reinen praktischen Urteilskraft in der KpV. Es kann mit der Anwendung des formal-logischen Konsistenzprinzips des Gesetzes (des Prinzips des Nicht-Widerstreitens) etwa auf das reine sittliche Denken als Materie alleine nicht entschieden werden, ob die Maxime der Verwahrlosung der Naturgaben und die der Teilnahmslosigkeit an der Not anderer mit dem Begriff einer Pflicht konform sein und somit gut heißen können oder nicht.599 Die Naturbedingungen erheben hier ihren Anspruch. Von seiten der Natur, der, vom absolut apriorischen, d.i. moralischen Aspekt her betrachtet, gewisse Kontingenz einzuräumen ist, ist es durchaus möglich, daß beide Maximen doch als allgemeine Naturgesetze gelten.600 Denn die sogenannten „Südsee-Einwohner“601 mögen ein Paradigma derer sein, die nach einem allgemeinen Naturgesetz der Verwahrlosung der Talente leben, und es könnte auch ein allgemeines Naturgesetz sein, daß, „wenn er [sc. ein jeder] unbemerkt lieblos ist, nicht sofort jedermann auch gegen ihn es sein würde“,602 oder daß jeder angesichts der Not anderer indifferent lebe.603 Die Materie (Gegenstände) des reinen Willens ist bei den weiteren, verdienstlichen gesehen, eine der unvollkommenen Pflichten. Vgl. dazu MS, § 22 der Tugendlehre, VI 446f. 599 Vgl. GMS, IV 422 Z37 – 423 Z35 <B55–57>. 600 Im Gefolge davon sagt Kant: „... daher ist diese Vergleichung der Maxime seiner Handlungen mit einem allgemeinen Naturgesetze auch nicht der Bestimmungsgrund seines Willens“ (KpV V 69 Z33 <A123>). 601 GMS, IV 423 Z9 <B55>. Das Beispiel läßt sich heute als sozial-diskriminierend ansehen. 602 KpV, V 69 Z32f <A123>. 603 Vgl. GMS, IV 423 Z23 <B56>. 171 Pflichten so fremd und variabel, daß er nicht mit dem logischen Konsistenzprinzip allein passiv entscheiden kann, welche der Alternativen, d.i. welches der allgemeinen Naturgesetze als Typus des Sittengesetzes für moralisch richtige Maxime und Handlung aufgenommen werden soll. Daher muß er auf der Ebene der empirischen Objektivität, in die er, um sein spontanes Allgemeinheitsprinzip auf empirische Objekte anzuwenden, m.a.W., seine Form („Form eines reinen Willens“) in diese einzuprägen, tiefer hineinrückt, einmal sehen, was aus seinen beiden Maximen empirisch folgt. Dann stellt sich heraus, daß er beide Maximen, Verwahrlosung der Naturgaben und Teilnahmslosigkeit, als seine allgemeinen Naturgesetze (Typen) unmöglich wollen kann,604 sofern dieses Wollen mit dem Allgemeinheitsprinzip verbunden, demnach das reine sittliche Denken ist. Denn wenn die Naturbedingungen, die ihren Anspruch erheben, näher betrachtet werden, so ist es eine empirisch-objektive Tatsache, sei sie theoretisch-konstitutiv und direkt naturkausal oder theoretisch-regulativ entstanden – sie muß nicht unbedingt teleologisch sein –, daß alle Vermögen im Vernunftwesen zur Entwicklung bestimmt sind605 und der Fall eintritt, daß ein Mensch anderer Liebe und Teilnehmung bedarf.606 Der Wille umfaßt und bearbeitet mit seinem spontanen Universalitätsprinzip positiv – d.h. er befaßt sich nicht bloß mit sich selbst passiv unter dem negativen Konsistenzprinzip – diese materialen Bedingungen,607 gestaltet dadurch intellektuell und selbständig seine allgemeinen Naturgesetze (Typen), um sie in die Natur einzuprägen, und verläßt somit notwendig jene beiden Maximen. Er kann sie als allgemeine Naturgesetze unmöglich wollen. Diese Erörterung wiederholt Kant auch später in seiner Vorlesung über die Metaphysik der Sitten: „Ganz anders ist es mit den sogenannten unvollkommenen Pflichten. Hier hebt sich die Handlung durch das ihr widersprechende Gesetz nicht geradezu von selbst auf; – sie beruhen auf bedingten Maximen; – nur es kann nie der Wille des Menschen werden, daß die Handlung ein allgemeines Gesetz werde, z. E. die Pflicht der Menschenliebe durch Wohltätigkeit gegen Leidende: wollte man nach einer Maxime handeln, die Gleichgültigkeit gegen anderer Menschen Not und Bedürfnisse zum Grund hätte, so kann man nicht sagen, daß ein solches Gesetz der moralischen Freiheit des Menschen widerspräche. Der Mensch könnte alle Absichten erreichen, nur nicht auf die Teilnehmung anderer Ansprüche machen. Dies Letztere ist aber, da jedes Subjekt in eine gleich bedürftige Lage kommen kann, der Grund, daß niemand wird diese Maxime zum allgemeinen Gesetz machen wollen.“608 Noch einmal: Der Wille kann die beiden Maximen unmöglich wollen – und er will die gegenteiligen Maximen annehmen, weil sein reines Denken als Spontaneität zusammen mit dem aus ihm stammenden Universalitätsprinzip sich in der GMS, IV 423 Z11f und Z30 <B55 u. 56>. IV 423 Z14f <B56>. 606 IV 423 Z32f <B56>. 607 Zur Bestimmung der Materie durch das bloß gesetzgebende Form vgl. z.B. KpV, V 34 <A61>: „Also die bloße Form eines Gesetzes, welches die Materie einschränkt, muß zugleich ein Grund sein, diese Materie zum Willen hinzufügen“. 608 MS Vigilantius, XXVII 496f. Vgl. auch MS Tugendlehre § 30, VI 453. 604 605 172 empirischen Objektivität, d. i. in äußeren Verhältnissen umsieht, um etwas, was sein Universalitätsprinzip in ihnen noch verarbeiten kann, aufzufinden, welches alsdann als das Gute, der Gegenstand der reinen praktischen Vernunft, zustandekommt, im vorliegenden Fall die Pflichten von Talententwicklung und Beförderung der Glückseligkeit anderer. Die Konstellation also, in der bei den weiteren, verdienstlichen Pflichten die Genese des Guten als Gegenstand der reinen praktischen Vernunft vor sich geht, ist mit derjenigen, in der in Kants Überlegungen zum höchsten Gut der moralische Zweck entsteht, beinahe identisch: Auch bei der Genese des letzteren, der sich gleich zum Endzweck maximiert, sieht der reine Wille sich in äußeren Verhältnissen um, um etwas zu finden, „was zum Zweck für ihn dienen und auch die Reinigkeit der Absicht beweisen könnte“,609 d.h. er muß in die Ebene der empirischen Objektivität tiefer hineinrücken und sich dort umsehen, um etwas zu finden, in dem sein Universalitätsprinzip noch positiv und total gelten kann. Die Intentionalität des reinen Willens kommt bei beiden Konstellationen mit der empirischen Objektivität, auch wenn noch in der Domäne des Denkens bleibend, gleichsam in Berührung und verschafft sich dadurch übersinnliche Ideen von Moralität, Pflicht oder Zweck, die alsdann als allgemeine Naturgesetze in die Natur eingeprägt werden. Auch die Genese des einzelnen Guten nimmt nämlich auf dasjenige Rücksicht, aus dem der Begriff vom Endzweck entspringt. Folglich lassen sich unvollkommene Pflichten wie Talententwicklung und Glückseligkeit anderer für Zwecke halten. Nur sind bei der Genese des moralisch-praktischen Endzwecks bei Kant sowohl alle einzelnen Pflichten als auch die moralische Gesinnung als ihr subjektiver Grund schon komplett parat, so daß reine praktische Vernunft nur darauf sehen muß, worauf unser Rechthandeln sich auswirkt, das auf ihnen beruht. Wegen der faktischen Gleichheit nun der Konstellation und der Vorgangsweise der reinen praktischen Vernunft bei beiden Genesen handelt es sich bei jenen beiden Momenten des höchsten Guts (Tugend und Glückseligkeit),610 den Inhaltselementen des praktischen Endzwecks, doch gerade um die unvollkommenen, weiteren, verdienstlichen Pflichten. Dabei vermehrt jedoch die Idee des Endzwecks die Anzahl aller Pflichten nicht, sondern holt nur ihre nötigen Pflichten aus dem Vorrat sämtlicher schon komplett paraten Pflichten, und dies muß so sein, weil die Bedingungen der intrinsischen Genese beider Zweckarten – einzelne unvollkommene Pflichten und Endzweck – faktisch gleich sind, obwohl die Bedingungen ihrer Anwendung voneinaner verschieden sind. Eine ausdrückliche Identifizierung der weiteren, verdienstlichen Pflichten mit dem Begriff eines Zwecks wird von Kant erst in der Einleitung zur Tugendlehre der MS vorgenommen.611 Nun ist aber dabei zu beachten, daß der Entwurf des Guten als Formung der Pflichten, selbst der weiteren, verdienstlichen, durch reine praktische Vernunft und deren Prinzip (Gesetz) als Aktualität ihrer reinen Auswirkung vollzogen und nicht primär durch empirische Objekte bedingt wird; sie hält sich zwar in der empirischRel., VI 7 Anm. Z23f <BXII>. Vgl. dazu zunächst KpV, V 110f <A198f>. Cf. 3.3.2.a. 611 Vgl. MS, VI 382ff. 609 610 173 objektiven Dimension auf, jedoch nur, um sich darin umzusehen und sich für die moralisch richtige Alternative (den Typus als ein allgemeines Gesetz) selbständig zu entscheiden, in der sich das Universalitätsprinzip noch überwiegend durchsetzen kann. Sie prägt ihre Gesetze in die empirische Objektivität ein und nicht umgekehrt. Sollte nun daher eine zweckmäßige Ordnung, die durch reflektierende Urteilskraft aus der empirischen Objektivität theoretisch-regulativ anzunehmen ist, bei der Formung der weiteren, verdienstlichen Pflichten den Willen primär bestimmen, so würden die geformten Pflichten bloß zu hypothetischen, d.h. technischoder pragmatisch-praktischen, degradiert werden müssen, und der Geltungsbereich der Autonomie der Vernunft und mithin der auf der empirisch-objektiven Ebene aufzuzeigenden moralisch-praktischen Realität ihres reinen Denkens, d.i. substantiell des Gesetzes, würde demzufolge möglicherweise nur auf die engeren, unnachlaßlichen Pflichten eingeschränkt werden. Es ist nämlich um die rein moralischpraktische Zwecksetzung nicht derart bestellt, daß der diskursive Verstand ein Synthetisch-Ganzes theoretisch als Idee (Vorstellung) vergegenständlichte und es danach für die Praxis verwendete. In diesem Fall würde auch die Triebfeder zur moralischen Handlung sicher nicht im moralischen Gesetz, sondern im vergegenständlichten theoretischen Zweck bestehen, und es würde darum in bezug auf die pathologisch-praktische Lust auch zu fragen sein, ob hinsichtlich eines Zwecks der Gegenstand seiner Vorstellung vorhergeht oder umgekehrt.612 Die moralischpraktische Zwecksetzung ist die reine unmittelbare Selbstäußerung des reinen sittlichen Denkens, d.i. des moralischen Gesetzes. Dieses bestimmt unmittelbar den Willen bei seiner Zwecksetzung. Ausschlaggebend für die Herstellung des Guten als Gegenstand der reinen praktischen Vernunft ist daher jene Richtung ihres souverän bestimmenden reinen sittlichen Denkens von ihrer Autonomie (Freiheit) auf die empirisch-objektive Ebene hin, welche ja den Sinn des Progressus eines Rechtschaffenen überhaupt als Selbstentwurf der Freiheit auf den Endzweck ausmacht. Die Naturgesetz-Formel613 des kategorischen Imperativs in der GMS besagt demnach nicht, daß die Maxime des Willens allgemeine Naturgesetze der sinnlichen Natur befolgen soll, sondern daß der freie Wille durch sein eigenes intellektuelles Prinzip ein moralisch richtiges allgemeines Naturgesetz als seine Maxime zur moralischen Handlung selbständig hervorbringen soll; d.h. die Freiheitskausalität soll die Naturkausalität bestimmen und dabei zur Vermittlung beider Kausalitäten ein allgemeines Naturgesetz als Typus des moralischen Gesetzes für sich selbst spezifizieren; die sinnliche Natur soll durch menschliche Handlungen lediglich dem von der reinen praktischen Vernunft vorgeschriebenen allgemeinen Naturgesetz adaptiert werden. Diese wesentliche Implikation der Naturgesetz-Formel der GMS artikuliert sich ausdrücklicher in der dieser Formel entsprechenden Typus- 612 Zu dieser Frage, was früher ist, der Gegenstand oder seine Vorstellung, die beinahe wie eine Frage von ,Henne oder Ei¿ scheint, vgl. z.B. Reiner, H., Kants Beweis zur Widerlegung des Eudämonismus und das Apriori der Sittlichkeit, in: Kant-Studien, Bd. 54, 1963. 613 GMS, IV 421 <B52>: „... handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.“ 174 Formel614 in der KpV. Die vektorartige Richtung der Bestimmung als Progression ist nun auch der Sinn davon, daß „die Moral ein mögliches Reich der Zwecke als ein Reich der Natur“ erwägt,615 d.h. daß in der moralischen Teleologie das erstere das letztere bestimmt, obgleich es als die intelligible Welt ursprünglich „nach der Analogie mit“616 dem letzteren eingeräumt sein mag. Nun muß allerdings in der Konsequenz der Theorie der Naturgesetz-Formel auch angenommen werden, daß weitere, verdienstliche Pflichten, falls eine bisher unbekannte neue empirischobjektive Tatsache auftaucht, inhaltlich verändert werden könnten. Dies stellt wohl eine Schwierigkeit der Kantischen Theorie über die Genese des apriorisch Guten dar, wird jedoch daran nichts ändern, daß das reine Denken der reinen praktischen Vernunft als reiner Wille durch den Typus (das allgemeine Naturgesetz) des Sittengesetzes selbst, sei er auch inhaltlich verändert, formal die sinnliche Natur bestimmt. (β) Die Genese des Guten aus Freiheit als die Vergegenständlichung der Aktualität des Aktus der reinen praktischen Vernunft vollzieht sich nicht nur in der objektiven Phase der Pflicht-Gestaltung durch das Prinzip der Allgemeinheit bzw. des Nicht-Widerstreitens dieser Vernunft, sondern auch in der subjektiven Phase derselben durch das Prinzip des Zwecks-an-sich-selbst als des Sitzes dieser Vernunft. Die letztere Phase der Pflicht-Gestaltung kündigt an, daß hinsichtlich des Begriffs des Guten als des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft a limine der Begriff eines moralischen Zwecks besteht. Der Begriff des Zwecks-an-sichselbst wird durch die Zurückweisung aller unter dem hypothetischen Imperativ stehenden materialen Zwecke mittels des Kriteriums des absoluten Werts formalistisch gebildet.617 Als Zweck an sich selbst nun existiert der Mensch (sowie überhaupt jedes vernünftige Wesen), weil er vermöge der Autonomie seiner Freiheit, auf die sich das heilige moralische Gesetz gründet, „das Subjekt des moralischen Gesetzes“ ist.618 Der Begriff des Zwecks an sich selbst, der auf der Autonomie des Willens beruht und demnach ursprünglich – d.h. kognitiv und formalistisch – transzendental-subjektiv ist,619 wird dann in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung als eine zu realisierende Idee der Humanität in Richtung auf die Ebene der empirischen Objektivität intellektuell objektiviert – er könnte wohl somit in dieser Phase als moralischer Zweck auch dieselbe Funktion übernehmen, wie sie der Begriff des praktischen Endzwecks in der objektiven Phase der ,moralisch-teleologischen‘ Zwecksetzung bekleidet: Damit können weitere, verdienstliche Pflichten als das Gute durch die positive Zusammenstimmung zu diesem Humanitätsprinzip des Zwecks-an-sich-selbst, d.i. der Idee der Menschheit 614 Vgl. KpV, V 69 <A122>: „Frage dich selbst, ob die Handlung, die du vorhast, wenn sie nach einem Gesetze der Natur, von der du selbst ein Teil wärest, geschehen sollte, sie du wohl als durch deinen Willen möglich ansehen könntest.“ 615 GMS, IV 436 Anm. <B80>(cf. Fußnote 553 in 3.1.2). Vgl. auch IV 438 Z16 – 439 Z3 <B83f>. 616 GMS, IV 438 Z23f <B84>. 617 Vgl. GMS, IV 427 Z32 – 428 Z6 <B64>. 618 Vgl. KpV, V 87 Z18–21 <A155f>, 131 Z20 – 132 Z5 <A237>. 619 Vgl. dazu GMS, IV 431 <B70>: „... das Subjekt aller Zwecke aber ist jedes vernünftige Wesen, als Zweck an sich selbst“. 175 in der Person, und nicht bloß durch das formal-logische negative Prinzip der Widerspruchslosigkeit bzw. des Nicht-Widerstreitens, angenommen werden.620 Kant hätte nämlich in dem vom Typik-Abschnitt ergänzten Gegenstand-Kapitel der KpV auch nach dem Begriff des Zwecks an sich selbst die Genese des Guten ausführen können. Er hat es aber unterlassen – denn es würde das Gefüge der KpV sprengen – und ihn seiner subjektiven Herkunft gemäß erst im Triebfedern-Kapitel der KpV beiläufig eingeführt.621 Der Begriff nun des Endzwecks und der des Zwecks an sich selbst sind zwar ursprünglich voneinander unterschieden: Während der erstere moralisch erst in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase als Objekt des reinen Willens eingeräumt und zugleich auch auf die physische Teleologie bezogen wird, ist im letzteren, der in der Argumentation der GMS formalistisch und transzendentalsubjektiv eingeführt wird, der allererste Ausgangspunkt der ,moralisch-teleologischen‘ Zwecksetzung zu sehen. Aber beide Begriffe haben auch eine gemeinsame Implikation: Sie werden nämlich durch das Kriterium des absoluten Werts eingeführt, und es wird erfordert, zu ihnen als Zwecken positiv zusammenzustimmen.622 Ein verobjektivierter Begriff des Zwecks an sich selbst könnte wohl mit dem Begriff des Endzwecks funktionell identisch sein. So braucht denn auch die Zahl der Pflichten, die sich bereits entweder in der objektiven Phase durch die NaturgesetzFormel oder in der subjektiven Phase durch die Zweck-an-sich-selbst-Formel vollständig ergeben können, nicht noch einmal durch Anwendung des Begriffs des Endzwecks vermehrt zu werden.623 Die Erwägung dieser möglichen Verwandtschaft zwischen Zweck-an-sich-selbst und Endzweck führt zu der Annahme, daß bei Kant der erstere konzeptionell in einer aus dem letzteren moralisch-teleologisch zu entfaltenden, transzendental-objektiven intelligiblen Ordnung – nämlich der systematischen Einheit aller Zwecke – beheimatet ist. 3.2.4 Der Begriff des Guten als Zweck. Das Gegenstand-Kapitel der KpV aber hat den Gegenstand der reinen praktischen Vernunft nicht als Zweck bezeichnet. Dafür ließen sich zunächst zwei Gründe anführen. Der eine Grund ist bereits genannt worden (cf. 3.2.1.b): Der Zweckbegriff ist im System der Kantischen Grundlegung der Ethik bereits anderen Bauelementen desselben als jenem Gegenstand der reinen praktischen Vernunft zugewiesen: zum einen transzendental-subjektiv dem Begriff des Zwecks an sich selbst als Subjekt des moralischen Gesetzes, zum anderen empirisch und pragmatisch-praktisch durch die sinnlich bedingte praktische Vernunft dem Angenehmen, dessen Mittel dann mittelbar-gut heißt. Ein Begriff des an sich und unbedingten Guten als eines Zwecks wäre in diesem Kapitel zuviel und würde nur Verwirrung heraufbeschwören. Denn es kann das Mißverständnis eintreten, daß er aus der empirischen Objektivität abgeleitet werden sollte. Der andere Grund: Kant scheint in diesem Vgl. GMS, IV 430 Z10–27 <B68f>. Vgl. KpV, V 87 Z19 <A156>. 622 Vgl. dazu GMS, IV 430 Z12f <B69>, Rel., VI 5 Z6f <BVII>, Z23 <BVIII>. 623 Vgl. Rel., VI 5 Z23f <BVIII>. 620 621 176 Kapitel zu glauben, daß der Begriff des Guten in der Tat bloß durch die Ableitung aus dem Gesetz selbst, oder sagen wir, durch die reine Vergegenständlichung des reinen sittlichen Denkens formal hergestellt werden soll und kann, demnach ohne materiale Bedingungen, die aus dem Mangel in äußeren Verhältnissen entspringen und die deshalb auch den Begriff eines Zwecks erfordern. Die Einführung eines Zweckbegriffs in die Genese des Guten hingegen wäre eher heikel, weil sie den Eindruck erwecken würde, als ob das Gute erst von der empirischen Objektivität abgeleitet werden könnte. Darüber hinaus scheint Kant zu denken, der Rechtschaffene bemühe sich bloß, die Gesetze zu befolgen und seine Pflichten zu erfüllen, ohne sich dabei um einzelne Resultate seiner Handlungen Sorgen zu machen, die als Zwecke vorgesehen würden, wobei er sich zwar auf der intellektuellen Bahn des Progressus zum Endzweck (der wahren Glückseligkeit im Jenseits) befindet, welcher aber in diesem Leben kaum erlangbar scheint (cf. 3.3.1.e). Die Perspektive für die Genese des Guten, worin der zweite Grund verankert ist, mag wohl für das Gute, das die engeren, unnachlaßlichen Pflichten anbelangt, richtig sein, trifft aber jenes Gute nicht, das die weiteren, verdienstlichen Pflichten angeht (cf. 3.2.3.b), die doch ebenfalls in der auf den Begriff des Guten bezogenen Kategorien-Tafel624 stehen. Für die Herstellung nämlich des Guten der letzteren Art sind sowohl die materialen Bedingungen auf der Ebene der empirischen Objektivität als auch die weitere Erstreckung der intellektuellen Intentionalität des reinen Willens auf diese Ebene unentbehrlich, die die materialen Bedingungen verarbeitet und dadurch Zwecke herstellt. Daher ist dem Begriff des Guten dieser Art der eines Zwecks im Sinne von finis in consequentiam veniens beizulegen; denn etwas Gutes positiv zu wollen625 heißt, es sich zum Zweck zu machen, was aber beim Guten der ersten Art zunächst nicht unbedingt der Fall sein muß (denn der Selbstzweck wird nur formal als Zweck bezeichnet und muß im Grunde nicht unbedingt der Zweck im engeren Sinn sein). Der Begriff des Guten der zweiten Art impliziert in sich einen Zweckbegriff. Der Rechtschaffene macht sich wohl nicht so sehr um das Verwirklichtsein von Zwecken Sorgen, kümmert sich aber doch im Progressus um die Verwirklichung des einzelnen Guten als Erfüllung der Pflichten, was den Zweckbegriff bereits impliziert. Daher sollte eigentlich erst dadurch, daß dem Begriff des Guten der zweiten Art der Zweckbegriff ausdrücklich zugeschrieben wird, auch dem des höchsten Guts, der als unbedingte Totalität des Guten überhaupt eingesetzt wird und dessen Momente sich aus dem Guten der zweiten Art rekrutieren, ein Zweckbegriff, sei es der Endzweck oder ein anderer, beigefügt werden können. Da Kant das letztere vorgenommen hat, so hätte auch das erstere geschehen müssen. Nur ist er darauf nicht eigens eingegangen. Das Gegenstand-Kapitel der KpV antizipiert also in seiner Konsequenz einen neuen Zweckbegriff, ohne ihn aber ausdrücklich zu nennen. Auch Kant selbst sagt: „Gut ist, was die Vernunft als Gegenstand des Willens erkennt. Die Übereinstimmung mit einem Zwecke der Vernunft.“626 Bei dem Guten als Gegenstand des Willens hat man es demnach mit Vgl. KpV, V 66 Z36 <A117>. Cf. 3.2.3.b.α und Fußnote 604. 626 Refl. 5246, XVIII 130, υ? (1776–78?). Vgl. auch Über den Gebrauch teleologischer Prinzipi624 625 177 dem Vernunftzweck zu tun. Diese fundamentale Wiederherstellung eines Zweck-Begriffs in der Phase der moralisch-praktischen Zwecksetzung soll noch gemäß Kants Analyse des Endzwecks expliziert werden. In seinen Argumentationsgängen zur Annahme des Endzwecks (des höchsten Guts) springt Kant immer wieder von der Entbehrlichkeit einer Zweckvorstellung beim Gesetz selbst direkt auf die Notwendigkeit der Annahme des Endzwecks über. Es wird im vorliegenden Absatz versucht, durch sorgfältige Verwendung der Textstellen, die ursprünglich von Kant für den Begriff des Endzwecks vorgebracht sind, einmal zwischen Gesetz und Endzweck ein Übergangsstadium für die Möglichkeit und Notwendigkeit einer intellektuellen Zwecksetzung aus Freiheit überhaupt zu installieren. Die Zwecksetzung aus der Vernunftkausalität ist notwendig, weil es dem mit Vernunft versehenen Willen, der wohl schon von den empirischen Bestimmungsgründen (Zwecken) befreit ist, doch unmöglich gleichgültig sein kann, was dann aus seiner Handlung herauskommt und auf was für einen Zweck als Idee er sie richten kann, auch wenn ihm kaum die Fähigkeit zu dessen Verwirklichung zuzusprechen ist.627 Ohne einen solchen Zweck kann die freie Willkür „zwar wie sie, aber nicht wohin sie zu wirken habe, angewiesen, sich selbst nicht Genüge tun“.628 Denn die reine praktische Vernunft bzw. die Aktualität der Wirkung des Gesetzes muß unvermeidlich dem Empirischen in der Welt und mithin „den unvermeidlichen Einschränkungen des Menschen“ begegnen, „sich bei allen Handlungen nach dem Erfolg [sc. der Folge] aus denselben umzusehen“.629 Sie muß und will in die Welt hinausgehen und sich dort positiv betätigen; zu solcher Betätigung gehört auch das Sich-Umsehen nach den Folgen der Handlungen. Der freie Wille muß sich nämlich in faktischen äußeren Verhältnissen mit den Gegenständen selbst befassen. Dabei ist das von Willen und Vernunft entworfene Wohin der moralischen Handlung als Gegenstand der Aktualität des reinen sittlichen Denkens „in der Ausübung (nexu effectivo) zwar das letzte, in der Vorstellung aber und der Absicht (nexu finali) das erste“,630 indem es intellektualisiert wird. Diese Vorstellung nun, die dadurch entsteht, daß nach der Eliminierung der empirischen Bestimmungsgründe der Willkür das transzendental-subjektive reine Denken in seiner Aktualität sich etwas intellektuell zum Gegenstand macht, indem es der Materie Form gibt und dadurch eine Maxime herstellt, und die demnach in en, VIII 182: „[D]ie Kritik der praktischen Vernunft zeigt, daß es reine praktische Prinzipien gebe, wodurch die Vernunft a priori bestimmt wird, und die also a priori den Zweck derselben angeben.“ Damit wird der Begriff von den „Zwecken der Freiheit“ gegenüber den „Zwecke[n] der Natur“ eingeführt, welcher „eine reine praktische Teleologie, d.i. eine Moral“ ermöglicht, die bestimmt ist, „ihre Zwecke in der Welt wirklich zu machen“ (VIII 182f). Er bezieht sich zwar zunächst nur auf das höchste Gut (VIII 159 Z15), könnte aber auf den Vernunftzweck überhaupt als das Gute erweitert werden. 627 Vgl. Rel., VI 5 Z1–7 <BVIf>. 628 Rel., VI 4 <BVI>. Das „wie“ im Satz ist in unserer Rekonstruktion eines moralischen Zwecks überhaupt von ,nach den Pflichten‘ her in ,gemäß dem Gesetz‘ umzudeuten. Ebenso soll das Wohin der Wirkung nicht sofort Endzweck, sondern zunächst ein moralischer Zweck sein. 629 Rel., VI 7 Anm. <BXII>. Cf. 3.3.1.e. 630 Rel., VI 7 Anm. <BXII>. 178 der Teleologie der Freiheit intellektuell das erste sein können soll, obwohl sie in der sinnlichen Naturkausalität das letzte werden muß, ergibt dann allererst den Begriff eines Zwecks („finis in consequentiam veniens“) für die konstitutive moralischpraktische Zwecksetzung der reinen praktischen Vernunft. So wird also gesagt: „[O]hne allen Zweck kann kein Wille sein“;631 „ohne alle Zweckbeziehung kann gar keine Willensbestimmung im Menschen stattfinden“.632 Dieser durch Vernunft vergegenständlichte, intellektuelle Zweck (d.i. das durch den Willen erneut entworfene Objekt als Folge des reinen Denkens im Sittlichen), der auch von dem Begriff eines Naturzwecks für die physische Teleologie zu unterscheiden ist, bestimmt wesentlich den Begriff des Guten in der moralisch-praktischen Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung, was durch die Bestimmung der Aktualität des reinen sittlichen Denkens sowohl in Maximen als auch zuletzt in intellektuellen Vorstellungen von moralischen Handlungen spezifisch ausgedrückt wird. In der Richtung von der transzendental-subjektiven Autonomie der Vernunft zur Dimension der empirischen Objektivität hin läßt sich das Gute der weiteren, verdienstlichen Pflichten als Gegenstand der reinen praktischen Vernunft, mit den auch in den Druckschriften weiter verwendeten633 Worten der „Reflexionen“ ausgedrückt: aus der ,Zusammenstimmung mit sich selbst als mit wesentlichen Zwecken‘ herstellen. Es wird als Zweck tiefer als das Gute der engeren, unnachlaßlichen Pflichten in die empirisch-objektive Dimension gesetzt, obwohl es noch eine übersinnliche Idee ist. Die Konstitution nämlich der moralisch-praktischen Zwecksetzung drängt sich der empirischen Objektivität sozusagen ,auf den Leib‘, während es der bloßen Regulation bei den engeren, unnachlaßlichen Pflichten doch nur um den Selbstzweck der reinen praktischen Vernunft geht.634 Das Gute als moralischer Zweck bei den weiteren, verdienstlichen Pflichten zeigt sich alsdann einerseits in beiden Momenten des höchsten Guts als Endzwecks, deren Verbindung die Postulatenlehre erfordert, und entwickelt sich auf der anderen Seite in der Einleitung zur Tugendlehre der MS als „Zweck, der zugleich Pflicht ist“ weiter.635 Der Be631 Gemeinspruch, VIII 279 Anm. Rel., VI 4 Z11–21 <BVf>. Vgl. auch Rel., VI 7 Anm. <BXII>: „... die Natureigenschaft des Menschen, sich zu allen Handlungen noch außer dem Gesetz noch einen Zweck denken zu müssen“. Vgl. hierzu auch VI 7 Anm. Z20–24 <BXII>, 5 Z2–7 <BVII>. 633 Vgl. z.B. GMS, IV 430 Z12f, Rel., VI 5 Z7 etc. 634 Der Begriff des Guten in der regulativen Anwendung des Gesetzes läßt sich annehmen, ohne daß dabei der Wille sich etwas mit ihm nicht Identisches zum Zweck setzen muß, d.h. ohne daß das als Zweck gewollt werden muß. Denn das Gute wird in der Regulation durch den Selbstzweck der reinen praktischen Vernunft hervorgebracht. 635 Während L. W. Beck den Zusammenhang des höchsten Guts mit dem Konzept vom ,Zweck, der zugleich Pflicht ist‘ bestreitet (Beck, L. W., A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, Chicago 1960, S. 244: „In the Metaphysics of Morals, ..., the highest good, ..., is not among the ,ends which are also duties‘.“), macht J. R. Silber eine Aussage, die den Zusammenhang andeutet: Vgl. ders., Immanenz und Transzendenz des höchsten Gutes bei Kant, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 18 1964 (Orig.: 1959), S. 386: „Der Wille ... wird jetzt mit Hilfe der Idee des höchsten Gutes dahin gelenkt, seine eigene moralische Vollendung und die Glückseligkeit der Anderen als kategorisch verpflichtende Zwecke zu erstreben.“ Diese beiden Zwecke entsprechen eher den 632 179 griff des Guten als Gegenstand der reinen praktischen Vernunft impliziert de facto, wenigstens bei den weiteren, verdienstlichen Pflichten, den Begriff eines Zwecks. Nachdem materiale Zwecke als Bestimmungsgründe des Willens in der formalistischen Phase der ethischen Grundlegung eliminiert worden sind, um das ethische reine Denken als den einzigen Grund der moralischen Willensbestimmung festzulegen, werden in der moralisch-teleologischen Phase intellektuelle Zwecke als Folge aus dem moralischen Gesetz wieder hergestellt. Wie nun oben betrachtet (cf. 3.1.1.b), setzt die Bedeutsamkeit des Gesetzes den Endzweck voraus. Dies ist auch darin verankert, daß in der intellektuellen Zwecksetzung überhaupt bereits die Geltungsmöglichkeit des Gesetzes mitenthalten ist. Das reine Denken des Gesetzes dehnt sich auf den Zweck aus. Ohne die Genese des Guten überhaupt ist demnach das Gesetz bedeutungslos. Das Gesetz ist mit dem von ihm gesetzten intellektuellen Zweck korrelativ. 3.3 Die Hauptstufe der Theorie der moralisch-praktischen Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik: Die reine praktische Vernunft macht sich das höchste Gut zum Gegenstand; oder: Der reine Wille strebt den Endzweck an. Erst nach der Bestätigung des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft als des moralischen Zwecks in der Grundstufe der Theorie der moralisch-praktischen Zwecksetzung kann deren Hauptstufe, die Stufe der Setzung des höchsten Guts bzw. des praktischen Endzwecks als Maximierung des ersteren, eingeführt werden. Die Möglichkeit und Notwendigkeit des höchsten Guts läßt sich in zwei Stadien differenziert thematisieren: (1) seine Annehmbarkeit636 und (2) seine Ausführbarkeit (Realisierbarkeit). Bei der ersteren handelt es sich um die Analyse der Konstitution des höchsten Guts, bei der letzteren um die Deduktion der Postulate für dasselbe, der Unsterblichkeit der Seele und des Daseins Gottes. Jene betrifft die zweite, diese die dritte Stufe der ,moralischen Teleologie in der ,moralischteleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik. In diesem Kapitel (3.3) aber wird allein die erstere behandelt, die letztere dagegen erst im nächsten (3.4). In diesem Kapitel (3.3) wird erstens als Fortsetzung des letzten Kapitels die moralisch-praktische Zwecksetzung bis zum höchsten Gut vorangetrieben (3.3.1). Sodann werden seine zwei Bestandstücke, Tugend (Sittlichkeit) und Glückseligkeit, erläutert (3.3.2). Zum dritten wird Kants kontradiktorische Aussage erörtert, Ausdrücken der Zwecke in der MS, die zugleich Pflichten sind, als denen der beiden Momente des höchsten Guts in der KpV. 636 Statt der Annehmbarkeit des höchsten Guts kann wohl auch der Ausdruck „Denkbarkeit“ gestattet werden; doch verwendet ihn Kant auch schon für die Ausführbarkeit des höchsten Guts. Vgl. hierzu KpV, V 119 Z5 <A214>: „als möglich denken“; V 126 Z4 <A227>: „denkbar“. Das Wort Ausführbarkeit in der hier determinierten Bedeutung verwendet auch er in der KU manchmal, z.B. V 455 Z7f <B432>, V 457 Z16 <B436>. 180 daß das höchste Gut auf der einen Seite kein Bestimmungsgrund des Willens ist, andererseits aber doch ihn gewissermaßen bestimmen kann. Zur Lösung dieses Widerspruchs schlägt die Interpretation notgezwungen den noch erkenntniskritischen Begriff einer intellektuellen Ausdehnung der moralischen Gesetzlichkeit zwischen Freiheit und Endzweck vor, welcher Ausdehnung metaphysisch eine intelligible Ordnung unmittelbar zugrundeliegt. Jene Ausdehnung ist essentiell diese Ordnung selbst, jedoch erkenntniskritisch vom Subjekt des Gesetzes her konstituiert (3.3.3). Zum Schluß des Kapitels wird sichergestellt, daß es sich beim Begriff des höchsten Guts (summum bonum derivativum) um nichts anderes handelt als um die Idee vom Reich Gottes, philosophisch die ebengenannte intelligible Ordnung (3.3.4). Die Idee der intelligiblen Welt wird der Freiheit und Vernunft des Handlungssubjekts transzendental-subjektiv zugrundegelegt und zugleich auch von derselben als das höchste Gut bzw. Endzweck objektiviert und hingestellt. Das letzte Ziel der moralisch-praktischen Zwecksetzung sind ihre Annehmbarkeit im Jenseits und ihre Realisierung in der Sinnenwelt, und dazu muß und kann sie objektiv konkretisiert und charakterisiert werden, ohne auf den erkenntniskritischen ,bloßen Standpunkt außer der Sinnenwelt‘ beschränkt zu sein. 3.3.1 Über die Notwendigkeit der Annahme des höchsten Guts bzw. des Endzwecks. In diesem Abschnitt (3.3.1) wird zuerst die Notwendigkeit der Annahme des höchsten Guts bzw. des Endzwecks diskutiert, weil sie auf den ersten Blick nicht eben zwingend erscheint (a–d). Zweitens wird die Verbindung des höchsten Guts mit dem Endzweck aller Dinge gestreift, aus der sich die moralische Teleologie entwickelt (c). Nach einer kurzen Erläuterung der gleichzeitigen Annahme der moralisch-praktischen Zwecksetzung überhaupt und des praktischen Endzwecks bei Kant (e) wird der Grundzug der moralisch-praktischen Zwecksetzung und mithin der Setzung des höchsten Guts, d.i. der Versuch einer Überwindung der Diskrepanz zwischen Moral und Natur, dargestellt (f). (a) Die Annahme des höchsten Guts durch die unendliche Maximierung des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft. Durch die unendliche Maximierung, d.i. Verallgemeinerung und Purifizierung des Begriffs des Guten als des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft läßt sich der Begriff des höchsten Guts herstellen, wodurch auch die systematische Vereinheitlichung des einzelnen Guten (cf. 3.2.2.b) vollzogen wird. In der ersten, nicht eben einleuchtenden Erläuterung637 dieses Begriffs in der KpV setzt Kant ihm zunächst einmal den Begriff eines auf Neigungen und Naturbedürfnis beruhenden, praktisch Bedingten als Gegenpol entgegen, bei dem als einem Gegenpol sicher nicht vom Begriff des Guten die Rede ist, da dieses schon durchs Gesetz, und nicht 637 Vgl. KpV, V 108 Z7–9 <A194>: „Sie sucht als reine praktische Vernunft zu dem praktischen Bedingten (was auf Neigungen und Naturbedürfnis beruht) ebenfalls das Unbedingte“. 181 mehr primär durch Neigungen und Naturbedürfnisse bestimmt ist. Gegenüber diesem negativ angenommenen Antipol eines Bedingten läßt sich alsdann durch die Negation dieser Beschränkung, d.i. durch die Abstrahierung von Neigungen und Naturbedürfnis, die andere unendliche, äußerste Grenze eines begrifflichen Kontinuums, der Pol eines Unbedingten ansetzen, welches nun das höchste Gut heißt. Der Begriff des einzelnen Guten müßte sich in dieser Erläuterung wohl zwischen die beiden Pole plazieren. Erst durch diese Plazierung kann man annehmen: Er wird unendlich maximiert, d.i. purifiziert und verallgemeinert, und dadurch wird das höchste Gut als das purifizierte verallgemeinerte Maximum des Guten (eine Vernunftidee), d.i. „die unbedingte Totalität des Gegenstandes der reinen praktischen Vernunft“638 hergestellt. Diese Totalität entpuppt sich, wie unten gezeigt wird (cf. 3.3.4), als eine Welt. (b) Philosophische Begründung der Notwendigkeit der Annahme des höchsten Guts. Kant scheint für die Notwendigkeit der Annahme des höchsten Guts gegenüber dem einzelnen Guten, das, wie oben gezeigt (cf. 3.2), aus der Autonomie der Vernunft ,moralisch-teleologisch‘ angenommen worden ist, kaum ausdrücklich eine philosophische Begründung abgegeben zu haben; diese Annahme dürfte ihm selbstverständlich vorgekommen sein, weil bereits historisch sowohl die Antiken639 als auch die Christen, aber auch in der Neuzeit vor allem Leibniz (als die beste aller Welten), diesen Begriff aufgestellt haben. Er selbst vergleicht diese Notwendigkeit als moralisches Bedürfnis wohl theologisch mit der Nicht-Verschlossenheit der Allgenugsamkeit der Gottheit.640 Eine philosophische Begründung ließe sich aber nach Kant in zwei Punkten, nämlich hinsichtlich der reinen moralischen Intentionalität und des Ursprungs der Radikalität ihrer Reinheit und Spontaneität (Selbständigkeit) wie folgt angeben. (1) Das reine sittliche Denken bringt zwangsläufig das reine unbedingte Gute als sein Objekt hervor: Denn gesetzt, das Gesetz (das reine spontane Denken), das, so wie es im zweiten Punkt aufgewiesen wird, an und für sich sowohl a priori rein und allgemein als auch spontan ist, habe an sich den intentionalen Grundzug der reinen formalen Objektsetzung aus Spontaneität als Selbstvergegenständlichung in äußeren Verhältnissen (cf. 3.2.1.a, 3.2.2.a), d.i. gesetzt, es solle sich selbst durch die Spontaneität in äußeren Verhältnissen maximal-rein vergegenständlichen und dabei sein Allgemeinheitsprinzip durchsetzen: so muß der dadurch hervorzubringende Gegenstand desselben als das Gute auch maximal rein und allgemein sein können, und der heißt hier das höchste Gut. Folglich soll der reine Wille sich intentional nicht lediglich auf das einzelne Gute, sondern auch auf die Idee eines höchsten Guts erstrecken und mithin danach streben. Das reine Denken im Sittlichen hat also die Kompetenz und Nezessität, sich die Idee eines KpV, V 108 Z11f <A194>. Vgl. dazu Refl. 6584, XIX 94–96, η (1764–68), die Kants frühe Überzeugung des höchsten Guts mit Bezug auf die griechischen Schulen zeigt. 640 Vgl. Gemeinspruch, VIII 280 Anm. 638 639 182 höchsten Guts zum Ziel zu setzen. (2) Die Reinheit und Spontaneität des Denkens im Sittlichen ist radikal: Ein reines Denken, das nur das einzelne Gute in seinem Gesichtskreis erfaßt und das höchste außer acht läßt, ist für die Moralität nicht rein und spontan genug. Denn das radikal reine und spontane Denken, das vor sich das höchste Gut aufstellt, ist exekutiv erst nach der formalistischen Distanzierung von allen empirischen Bestimmungsgründen der Willkür, durch die Umkehr zu äußeren Verhältnissen der Sinnenwelt, als reine Weisheit641 , die demnach durch das Nichts des Empirischen hindurchgegangen ist, in der Gesinnung festgehalten worden. Daher ist es so rein, allgemein und spontan, daß es, solange es sich durch seine Spontaneität auf äußere Verhältnisse der Sinnenwelt wendet, nicht umhinkann, sich ein unbeschränktes umfassendes Gut zum Ziel seiner Intentionalität und Tätigkeit zu setzen. Die reine praktische Vernunft also, die formalistisch auf der Fernhaltung vom Empirischen basiert, bildet durch die Selbstvergegenständlichung eine reine intellektuelle Ausdehnung auf das höchste Gut. Mit der Objektivierung der Radikalität der Reinheit des sittlichen Denkens als Einräumung der praktisch-objektiven 641 (641) Der Begriff der Weisheit bezieht sich bei Kant auf die Moralität und den Endzweck, die allererst durch „die Wegräumung der inneren Hindernisse“ möglich werden, im Unterschied zu Geschicklichkeit und Klugheit, die in der Abhängigkeit vom Empirischen verankert sind. Sie ist demnach ein anderer Name des reinen Denkens im Sittlichen. Vgl. dazu Refl. 3643, XVII 172, κ? (1769?): „Die Erkenntnis des Guten, dessen, was im ganzen gut ist (in aller wirklichen Beziehung), aus der Idee des Ganzen als ein Grund der Wahl ist Weisheit“; Refl. 3644, XVII 172, µ–υ (1770–78): „Die Weisheit geht auf das Gute. / Klugheit aufs Nützliche“; Refl. 3645, XVII 173, µ–υ (1770–78): „Das Vermögen, das Verhältnis aller Dinge* zum höchsten Gute** zu erkennen, ist die Weisheit; zum Guten in der Erscheinung, Partikularen: die Klugheit (nicht von Gott). / [Nachtrag υ:] Die Angemessenheit der Erkenntnis zum höchsten Gut und dessen Möglichkeit ist entweder bloß theoretisch – Wissenschaft, oder moralisch: Weisheit. / * [Nachtrag ϕ–χ:] Das Vermögen der Erkenntnis der besten Mittel zu demselben ist Kunstweisheit; das Vermögen der Erkenntnis des Zwecks zugleich mit dem Willen desselben: die moralische Weisheit. / ** [Nachtrag υ:] Entweder ihm selbst oder dem abgeleiteten höchsten Gut. Jenes ist der Grund zu diesem, aber nur in dem göttlichen Verstande“ (vgl. hierzu Theodizee, VIII 263f); Refl. 3646, XVII 173, ξ? (1772?): „Weisheit überhaupt ist die Vollkommenheit der Erkenntnis, sofern sie dem Ganzen aller Zwecke (entweder dem physischen oder moralischen Ganzen) angemessen ist“; Refl. 3647, XVII 173, υ (1776–78): „Weisheit ist das subjektive principium der Einheit aller Zwecke nach der Vernunft, folglich Glückseligkeit mit Sittlichkeit vereinigt“ (vgl. hierzu KrV, III 254 Z34f <B385>); Refl. 3651, XVII 175, υ–χ?; Refl. 1482, XV 659, σ? (1775–77?): „Dreierlei Lehren, 1. die geschickt, 2. die klug, 3. die weise machen: scholastische, pragmatische und moralische Kenntnis“; Refl. 1502a, XV 800, ω1 (1790–91): „Der Mensch wird durch die Schule kultiviert (Geschicklichkeit), zivilisiert (Sitten), moralisiert (Tugend). (geschick – klug – weise.)“ (in der MS wird Tugend als praktische Weisheit bezeichnet; vgl. dazu VI 405 Z28f); Refl. 1508, XV 820, ψ1−2 (1780–84): „Geschicklichkeit besteht im Wissen und Können. / Klugheit in der Art, Geschicklichkeit an den Mann zu bringen. / Weisheit* in der Endabsicht, wozu alle Klugheit zuletzt hinausläuft. * den wahren Wert der Dinge zu schätzen“ (vgl. zu dieser Trichotomie auch Anthr., VII 201); Fried. i.d.Phi., VIII 418: „Weisheit aber ist die Zusammenstimmung des Willens zum Endzweck (dem höchsten Gut); ... Weisheit für den Menschen [wird] nichts anders als das innere Prinzip des Willens der Befolgung moralischer Gesetze sein“; MS Tugendlehre § 14, VI 441: „Das moralische Selbsterkenntnis, das in die schwerer zu ergründenden Tiefen (Abgrund) des Herzens zu dringen verlangt, ist aller menschlichen Weisheit Anfang. Denn die letztere, welche in der Zusammenstimmung des Willens eines Wesens zum Endzweck besteht, bedarf beim Menschen zu allererst die Wegräumung der inneren Hindernisse (eines bösen in ihm genistelten Willens) und dann die Entwickelung der nie verlierbaren ursprünglichen Anlage eines guten Willens in ihm“; etc. 183 Realität des höchsten Guts nimmt aber die Kantische Überlegung eine objektivierte Thematisierung der religiösen Dimension vor. Bei der notwendigen Annahme der Idee des höchsten Guts, die aus dem Begriff des Guten durch die unendliche Maximierung entwickelt worden ist, handelt es sich nämlich um eine unerläßliche Postulierung der Idee vom Reiche Gottes. Dieser Versuch einer philosophischen Begründung für die Notwendigkeit der Annahme des höchsten Guts stellt nur den ersten, ohnehin schon ungenügenden Ansatz zum Versuch einer Lösung zu der Fragestellung etwa von K. Düsing dar: Kant „zeigt eigentlich nicht, warum denn der endliche Wille, der nur bestimmte sittliche Zwecke realisieren kann und also nur die Möglichkeit solcher Zwecke überhaupt erwarten muß, notwendig die Möglichkeit bzw. objektive Realität des höchsten Gutes insgesamt, d.h. des besten Weltganzen postuliert.“642 Dem Problem der Möglichkeit der objektiven Realität des höchsten Guts und der Postulate aufgrund der reinen intellektuellen Ausdehnung des moralischen Gesetzes ist unten weiter nachzugehen (cf. 3.3.1.d und 3.4.0). Düsing zweifelt an der Notwendigkeit der Annahme des höchsten Guts, weil er nicht zugleich die Relevanz des Formalismus für die Problemlage des höchsten Guts vor Augen hat, nämlich daß das moralische Gesetz erst dadurch subjektiv und exekutiv in der Gesinnung (Kants Ethik ist im Grunde transzendental-subjektive Gesinnungsethik), demzufolge aber auch praktisch-objektiv, festgehalten wird, daß praktische Vernunft durch das Nichts des Empirischen (die Unabhängigkeit vom Empirischen, d.i. die negative Freiheit, die an sich unbegreiflich ist) hindurchgegangen ist. Die radikale Negation mündet sodann in die totale Position. Diese ist aber aus Wahrheit643 zustandezubringen, bei Kant aus der moralischen Gesetzlichkeit. Denn das bloß Empirische (Naturgeschenk, Glück und Zufall) kann zu dieser Totalität nicht zusammenstimmen. Der durchs Gesetz bestimmte gute Wille, der die Abhängigkeit vom Empirischen radikal abgelegt hat und demzufolge frei ist, erlegt sich, der Wahrheit des Gesetzes gemäß, notwendig den maximal möglichen allgemeinen Zweck als sein Objekt auf, indem er als reine praktische Vernunft die reine intellektuelle Ausdehnung zu diesem bildet. Das tut er auch deshalb, weil er sonst seine einzelnen Zwecke nicht insgesamt für moralisch-richtig halten könnte; denn die reine Vernunft als Vermögen des Unbedingten verlangt auch im praktischen Bereich für ihre Gegenstände eine unbedingte Totalität, um sie damit in der reinen intellektuellen Ausdehnung dieser Totalität zu systematisieren und dadurch aufgrund dieser Ausdehnung insgesamt für moralisch-richtig halten zu können; ohne die Totalität der reinen intellektuellen Ausdehnung auf das höchste Gut würde das einzelne Gute seinen vollen Sinn verlieren. Allerdings muß zugegeben werden, daß bei Kant sowohl der gute Wille als 642 Düsing, K., Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer Philosophie, in: Kant-Studien, Bd. 62, 1971, S. 41. 643 Kant verwendet in der Moralphilosophie das Wort ,Wahrheit‘ nur selten und beiläufig. Vgl. dazu beispielsweise Refl. 7204, XIX 284 Anm.: „Aus dem Prinzip der Wahrheit“; Refl. 1020, XV 456 ρ? σ? υ? (1773–75? 1775–77? 1776–78?): „praktische Wahrheit“. Vgl. auch Refl. 6642, XIX 122f, κ? (1769?), Refl. 6637, 6719. 184 auch das höchste Gut idealistischen Charakter aufweisen. Das hängt wohl damit zusammen, daß die ursprüngliche Freiheit bei Kant, die negative, an sich unbegreifliche, von der der Entwurf des reinen sittlichen Denkens auf den Endzweck, mithin die moralisch-praktische Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase, ausgeht, in ihren Bedeutungen und Zusammenhängen nicht realiter erörtert ist und daß das Gesetz, von realen Zusammenhängen ferngehalten und mithin in einer besonderen Konfiguration formalisiert, a limine als kognitives Faktum der Vernunft angesetzt werden muß.644 (c) Die Verbindung des Begriffs des höchsten Guts mit dem des Endzwecks. Kant denkt nun bei der Explikation des höchsten Guts den Begriff eines moralischen Endzwecks stets mit und verwendet beide Begriffe, den moralischen Endzweck und das höchste Gut, voneinander untrennbar und austauschbar. Denn der Begriff eines höchsten Guts läßt sich freilich auch aus dem Konzept eines Zwecks definieren, weil ja bereits der Begriff eines Gegenstands der reinen praktischen Vernunft, d.i. des Guten, aus dem er sich entwickelt, wie sich oben ergeben hat (cf. 3.2), eben in der Perspektive der Zwecksetzung des Willens, der ethischen Intentionalität desselben, zu determinieren ist. Das höchste Gut ist der maximal verallgemeinerte und formalisierte, demnach unbedingte Zweck des Willens, der alle einzelnen Zwecke desselben umfaßt.645 Diesen unbedingten moralischen Zweck als eine objektivierte Vollkommenheit nun kann sich der durchs Gesetz bestimmte gute Wille als absolute Vollkommenheit (cf. 1.5), durch den nämlich allein das Dasein des Menschen absoluten Wert haben kann,646 in seinem autonomen ,moralisch-teleologischen‘ Entwurf durch das reine spontane sittliche Denken der reinen praktischen Vernunft setzen, auf dem ja jener absolute Wert des menschlichen Daseins letztlich gründet. Er setzt sich nun aus der Freiheit eines Begehrungsvermögens den absoluten moralischen Zweck, während er als Mensch zugleich „nicht bloß genießt“, sondern, in eins damit, daß sein Dasein absoluten Wert hat, „so unabhängig von der Natur zweckmäßig“ ,tut‘, „daß selbst die Existenz der Natur nur unter dieser Bedingung Zweck sein kann“.647 Daher verbindet sich der Begriff des höchsten Guts als des absoluten moralischen Zwecks,648 der auf jenem sittlichen reinen Denken, das den absoluten Wert verleiht, beruht und von dem aus die moralische Zweckmäßigkeit systematisiert werden kann, unabwendbar auch mit dem eines Endzwecks aller Dinge, der sich auf die physische Teleologie bezieht.649 Den „Begriff von einem Endzweck, 644 Cf. 1.3 & 1.4. Vgl. z.B. KpV, V 115 <A207>: „[D]as höchste Gut [ist] der notwendige höchste Zweck eines moralisch bestimmten Willens“. 646 Vgl. dazu KU, V 443 Z10–13 <B412>. 647 KU, V 434 Anm. Z34–36 <B395>. Cf. Fußnote 360 in 2.5.3. 648 Das Wesentliche des Begriffs des „praktischen Endzwecks“ im Gegensatz zur „Zweckmäßigkeit in der Natur“ (Refl. 8097, XIX 641 Z24, ω2 1792–94) liegt in diesem absoluten moralischen Zweck. 649 Als einen treffenden Satz über die Gleichsetzung des höchsten Guts mit dem Endzweck vgl. z.B. Fortschritte, XX 204 Z20f: „Dieser Endzweck der reinen praktischen Vernunft ist das höchste 645 185 d.i. dem Unbedingten in der Reihe der Zwecke“ können nämlich „die physischteleologischen Lehren“ selber nicht „an die Hand geben“, sondern er „gilt“ ja erst „in moralisch-praktischer Rücksicht als unumgänglich“.650 Denn die Moral allein ist imstande, den erforderlichen absoluten Zweck mitsamt seiner (praktisch-)objektiven Realität zu liefern. Aus dem so festgestellten Endzweck und den ihm untergeordneten, subalternen Zwecken als Mittel zu ihm651 kann dann die ganze systematische Einheit aller wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft aufgebaut werden, wobei der Endzweck aller Dinge „ein besonderer Beziehungspunkt der Vereinigung aller Zwecke“652 ist und das Ganze aller Zwecke unter einem Prinzip befaßt653 . So wird die moralische Teleologie gebildet,654 die a limine mit der physischen zusammenhängt. Der Begriff ,Endzweck‘ ist also primär in der Moralität verankert und impliziert zugleich die Perspektive auf die physische Teleologie. (d) Die notwendige Annahme des höchsten Guts (d.i. des Endzwecks) als Gebot des Gesetzes und die Beförderung desselben als Pflicht aus Gesetz. Mit den bisherigen Darstellungen im letzten (cf. 3.2) und in diesem Kapitel ist die Notwendigkeit der Annahme des Endzwecks bzw. des höchsten Guts in zwei Argumentationsstufen, nämlich (1) der Stufe der Notwendigkeit der moralisch-praktischen Zwecksetzung überhaupt und (2) der Stufe der Notwendigkeit der unendlichen Maximierung des moralischen Zwecks bzw. des Guten, stringent bewiesen worden. Die Notwendigkeit der Annahme des höchsten Guts als eines Gegenstands des reinen Denkens im Sittlichen ist demnach das Gebot des moralischen Gesetzes, in dem auch die Pflicht, das höchste Gut zu befördern, verankert ist.655 Sofern Gut, sofern es in der Welt möglich ist“; aber auch KU, V 450 <B423>: „[E]s [sc. das moralische Gesetz] bestimmt uns doch auch und zwar a priori einen Endzweck, welchem nachzustreben es uns verbindlich macht: und dieser ist das höchste durch Freiheit mögliche Gut in der Welt.“ Es erhellt freilich aus der jeweiligen Umgebung, in der diese Formulierungen stehen, daß der Endzweck sich auch auf die physische Teleologie bezieht. 650 Fortschritte, XX 294 Z10–19. Vgl. dazu z.E. auch KU, V 454 <B430f>: „Nun finden wir aber in der Welt zwar Zwecke: und die physische Teleologie stellt sie in solchem Maße dar, daß, wenn wir der Vernunft gemäß urteilen, wir zum Prinzip der Nachforschung der Natur zuletzt anzunehmen Grund haben, daß in der Natur gar nichts ohne Zweck sei; allein den Endzweck der Natur suchen wir in ihr selbst vergeblich. Dieser kann und muß daher, so wie die Idee davon nur in der Vernunft liegt, selbst seiner objektiven Möglichkeit nach nur in vernünftigen Wesen gesucht werden. Die praktische Vernunft der letzteren aber gibt diesen Endzweck nicht allein an, sondern bestimmt auch diesen Begriff in Ansehung der Bedingungen, unter welchen ein Endzweck der Schöpfung allein von uns gedacht werden kann.“ Vgl. auch KU, V 447 Z27–32 <B419>. 651 Vgl. z.B. KrV, III 543 <B868>. 652 Rel., VI 5 Z24f <BVIII>. 653 Vgl. Gemeinspruch, VIII 280 Z17f. 654 Zur moralischen Teleologie vgl. zunächst KU, V 444 <B414>, 447f <B419f>, 480f <B476>; Fortschritte XX 307. Sie und ihr Zusammenhang mit der physischen Teleologie können in der vorliegenden Arbeit nicht weiter erörtert werden. 655 Vgl. KpV, V 129 Z30–32 <A238>: „Das moralische Gesetz gebietet, das höchste mögliche Gut in einer Welt mir zum letzten Gegenstand alles Verhaltens zu machen“. Vgl. auch V 134 Z17f <A242>; 125 Z25 <A226>; 122 Z4f <A219>; vgl. auch V 64 Z30–34 <A113f>; 142 Z18–21, Z25–27; 124 Z17–19 <A224>. 186 das moralische Gesetz praktisch-objektiv gilt, insofern hat auch das höchste Gut objektive Realität. (Cf. 3.4.0.) (e) Die gleichzeitige Annahme des Begriffs einer moralisch-praktischen Zwecksetzung und eines Endzwecks. Kant argumentiert für die Notwendigkeit der moralisch-praktischen Zwecksetzung und die der Annahme des Endzwecks gleichzeitig in einem Zug.656 Die Argumentation für den Endzweck wird ausgeführt, ohne dem Gegenstand der reinen praktischen Vernunft ausdrücklich einen Zweckbegriff einzuräumen. Der Grund dafür besteht vermutlich darin, daß es dem Rechtschaffenen ein besonderes Anliegen ist, was aus seinem Rechthandeln endgültig herauskommt, während für ihn die jeweilige Erfüllung der partikularen Pflichten als der einzelnen Zwecke in seinem reinen Bewußtsein irgendwie eine selbstverständliche Sache ist; der Zweckbegriff in den Pflichten scheint ihm dementsprechend bei ihrer Erfüllung nicht extra bewußt zu sein (cf. den 1. Absatz von 3.2.4). (f) Der Einsatz des höchsten Guts bzw. des Endzwecks als Überwindungsversuch der Diskrepanz zwischen Moral und Natur. Der Einsatz des höchsten Guts als Endzweck hängt mit dem Versuch zusammen, die wesentliche Diskrepanz zwischen dem reinen sittlichen Denken und der sinnlichen Natur zu überwinden. Der Überwindungsversuch, der bereits bei der Genese des Guten als Pflichten angesetzt hat, war so unzureichend, daß Kant ihn wieder und diesmal endgültig mit Hilfe einer unendlichen Idee des Endzwecks bzw. des höchsten Guts, die noch die oberste Weltursache notwendig postulieren muß, zur Vollendung zu bringen versucht, wenn diese auch nur in der Hoffnung gesichert werden mag. Die Eigentümlichkeit des Kantischen Lösungsversuchs der Diskrepanz zwischen sinnlicher Natur und reinem sittlichem Denken besteht darin, daß er nicht am Ursprung der Moralität (negative Freiheit bzw. das Nichts des Empirischen) ansetzt, aus dem das letztere, das reine sittliche Denken, von der Naturkausalität getrennt entsteht – ohne dabei explizit einen neuen Natur- bzw. Weltbegriff zu gründen, der die Genese desselben erklären könnte –, sondern erst in der Folge der Moralität auf der objektivierten Dimension nach einer Idee teleologisch unternommen wird. Denn der Ursprung ist für Kant unerforschlich; folglich läßt sich in der Realität die Diskrepanz prinzipiell nicht auflösen. Bei den Menschen bleibt nur der unendliche Fortschritt zu einer idealistisch vorgestellten Einheit von Denken und Natur übrig. (Cf. 3.4.2.c). 656 Vgl. Rel., VI 5 <BVII>, 7 Anm. <BXII>. Cf. den 3. Absatz von 3.2.4. 187 3.3.2 Über die Notwendigkeit der Annahme der Tugend und Glückseligkeit als Momente des höchsten Guts. (a) Die beiden Momente des höchsten Guts: Tugend und Glückseligkeit. Kant gibt als die konstitutiven Momente des formal eingeräumten höchsten Guts nur Tugend (moralische Gesinnung, subjektive Sittlichkeit) und Glückseligkeit an.657 Es versteht sich wohl von selbst, daß die Tugend zum Element des höchsten Guts als des Endzwecks des Willens eines endlichen menschlichen Vernunftwesens qualifiziert ist, weil dieses sich angesichts seiner realen „Seelenschwäche“658 , d.h. des menschlichen Hangs zu Übertretung des Gesetzes, Unlauterkeit und Gebrechlichkeit, dazu veranlaßt sieht, das reine Denken im Sittlichen, die Aktualität des moralischen Gesetzes, in seiner Gesinnung uneingeschränkt durchzusetzen. Die Qualifizierung der Tugend zum Element des höchsten Guts ist darin fundiert, daß der formale Selbstentwurf des reinen sittlichen Denkens auf die teleologisch objektivierte Dimension (das höchste Gut) dazu bestimmt ist, dieses Denken real und materialiter in der subjektiven Gesinnung des auch sinnlich affizierten Willens eines endlichen Vernunftwesens zu verwirklichen, selbst wenn diese Verwirklichung erst durch endlose Anstrengung möglich sein mag (cf. 3.4.1.a). Warum aber das Moment der Glückseligkeit als des Zustandes eines Vernunftwesens in der Sinnnenwelt, dem „alles nach Wunsch und Willen geht“,659 für den Begriff des moralisch höchsten Guts unentbehrlich sein soll, ist im Vergleich mit dem Moment der Tugend nicht sofort klar. Ihre Unentbehrlichkeit geht nicht unmittelbar aus dem formalen Prinzip der Moralität hervor. Der Anspruch der Glückseligkeit, ein konstitutives Moment fürs höchste Gut zu sein, beruht auf der ausbalancierten Einsicht Kants in die menschliche Realität, nämlich darauf, daß er im Gegensatz zur Stoa die menschliche Schwäche an sinnlichen Bedingungen, die Stimme der eigenen Natur des Menschen, als für den realen Vollzug der Moralität unignorierbar ansieht.660 Wenngleich nämlich die formale Sittlichkeit, die sich nur formalistisch durch Abstrahieren von materialen Bestimmungsgründen des Willens nachweisen läßt, im Zuge dieser formalistischen Grundlegung zunächst den materialen Neigungen der Sinnlichkeit, somit auch der Glückseligkeit, entgegenVgl. dazu beispielsweise Refl. 6584, XIX 95, η (1764–68): „Die Glückseligkeit und das Gute, Sittlichkeit, machen zusammen summum bonum aus.“ Auch die Reflexion über das höchste Gut gehört bei Kant schon zur früheren Periode. 658 KpV, V 127 Anm. Z26 <A229>. 659 Vgl. KpV, V 124 Z21–23 <A224>. 660 Vgl. dazu KpV, V 127 Z13–16 <A229>: „[I]ndem sie [sc. die Stoiker] es [sc. das zweite Element des höchsten Guts, eigene Glückseligkeit] bloß im Handeln und der Zufriedenheit mit seinem persönlichen Werte setzten und also im Bewußtsein der sittlichen Denkungsart mit einschlossen, worin sie aber durch die Stimme ihrer eigenen Natur hinreichend hätten widerlegt werden können.“ (Kant räumt aber diese analytische Genese der Glückseligkeit aus Tugend als Selbstzufriedenheit bei der Stoa, wie unten betrachtet wird, wohl nicht als das Ziel des Willens, jedoch im jeweiligen Progressus der menschlichen Handlung als Analogon der Glückseligkeit bzw. moralische Glückseligkeit ein.) Vgl. auch KpV, V 25 Z12–15 <A45>, 110 Z27–31 <A199>; KU, V 449 Anm. Z25–29 <B422>, V 452 Z22–30 <B428>; Rel., VI 135 Z2–4 <B203>: „... weil eine gänzliche Verzichtung auf das Physische der Glückseligkeit dem Menschen, solange er existiert, nicht zugemutet werden kann“. 657 188 gesetzt wird, so schließt sie doch in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase, in der sie in Richtung auf die Sinnenwelt thematisiert wird, die Glückseligkeit der endlichen Vernunftwesen überhaupt, die zwar nicht eigennützig ist, die aber auch die Erfüllung der Bedürfnisse der Neigungen involviert, von ihrem Endzweck nicht aus;661 die Glückseligkeit im allgemeinen ist das vom Begriff der Pflicht Bedingte aller Zwecke, und ihre Förderung dementsprechend eine Pflicht. Selbst die Maxime, für die eigene Glückseligkeit zu sorgen, ist unter einem gewissen Aspekt sogar indirekt Pflicht, weil einerseits ihr Mangel den Willen zur Übertretung der Pflichten verführen, ihre Vorhandenheit auf der anderen Seite ihm zur Erfüllung derselben verhelfen kann.662 Daher läßt sich annehmen, daß die je eigene Glückseligkeit auch im höchsten Gut mitenthalten sein muß,663 obwohl sie freilich durchs Gesetz streng eingeschränkt664 bzw. zugleich auch auf die Glückseligkeit anderer erweitert sein665 soll. Diese Anerkennung der Glückseligkeit als sittliches Element basiert aber letztlich auf der religiösen Einsicht, daß Neigungen, an sich selbst betrachtet, gut, d.i. nicht verwerflich sind, und daß das Sittlich-Böse und mithin die ethische Gefahr vielmehr in der menschlichen Gesinnung selbst liegen.666 Daher muß der Hang zum Bösen in der Gesinnung ständig bekämpft werden, und die Sittlichkeit als Moment des höchsten Guts muß demnach die Tugend, d.i. die Gesinnung im Kampfe sein; die Glückseligkeit aber ist einzuräumen, solange die Gesinnung gut ist. Die Glückseligkeit im höchsten Gut ist nicht die im Naturverlauf zufällig bewirkte, sondern die durch Sittlichkeit zuwegezubringende, wahre (cf. 2.4.2 u. 2.6.2.a). Sie darf bei Kant nicht zufällig, sondern muß notwendig hervorgebracht werden; sonst wäre sie nicht wahr. (b) Heiligkeit und Seligkeit als christliche, superlative Bestandstücke des höchsten Guts. Die beiden Momente des höchsten Guts, Tugend (Sittlichkeit) und Glückseligkeit, wenn sie gemäß dessen Grundbestimmung unendlich maximiert werden, heißen 661 Die allgemeine Glückseligkeit kann wohl der Gegenstand der reinen praktischen Vernunft sein, jedoch nicht einmal zum Gesetz der Moralität befördert werden. Vgl. dazu KpV, V 36 <A63>: „Das Prinzip der Glückseligkeit kann zwar Maximen, aber niemals solche abgeben, die zu Gesetzen des Willens tauglich wären, selbst wenn man sich die allgemeine Glückseligkeit zum Objekt machte.“ Kant denkt hier übrigens hauptsächlich in der kognitiv-formalistischen Phase der Grundlegung und noch nicht unter der Dominanz der ,moralisch-teleologischen‘. Der Satz kann also nicht für das Argument gegen das höchste Gut als den Bestimmungsgrund des Willens (Vgl. KpV, V 109f) verwendet werden. Die Differenzierung der Kantischen Grundlegung der Ethik in die formalistische und die ,moralisch-teleologische‘ Phase dient auch hier zum klaren Verständnis des Textes. 662 Vgl. dazu KpV, V 93 Z11–21 <A166f>, GMS, IV 399 Z3–26 <B11–13>, MS, VI 386 Z1–7, 388 Z17–30, Rel., VI 6 Anm. Z32f <BXI>. 663 Vgl. KpV, V 130 Z1 <A234>. 664 Vgl. KpV, V 130 Z2f <A234>. 665 Vgl. KpV, V 34f <A61>. 666 Vgl. dazu z.B. Rel., VI 57 Z18 – 58 Z8 <B68–70>, 58 Anm. Z26–31 <B69>, 34 Z18 – 35 Z9 <B31>. 189 Heiligkeit und Seligkeit,667 aus denen es in seinem äußersten Grad zusammengesetzt wird. Die Heiligkeit als das eine äußerste Bestandstück des höchsten Guts ist in der Religionsschrift die Idee von Jesus Christus als Inbegriff der moralischen Vollkommenheit. Die Annehmbarkeit („Realität“) dieser Idee ist „in unserer moralisch gesetzgebenden Vernunft“ verankert. Wir müssen ihr gemäß sein können, weil wir es sein sollen. Denn das Gesetz gebietet unbedingt. Wenn ihre Möglichkeit bezweifelt würde, so würde auch das Gesetz selbst Bedenken unterliegen.668 Die Explikation in der Religionsschrift stimmt mit der Erläuterung zur Tugend als einem Element des höchsten Guts in der KpV zusammen. Während nun Heiligkeit, die dem endlichen Vernunftwesen zu Richtschnur und Urbild seines Verhaltens in diesem Leben dient, ihm als solche stets präsent ist, ist Seligkeit ein unerreichbarer indirekter Gegenstand der Hoffnung in der Ferne.669 Sie ist für das endliche Vernunftwesen zu fern, zumal sie erst durch eine auch an sich schon schwierige Erlangung der Heiligkeit mittelbar zu realisieren ist. Im realen Progressus des endlichen Vernunftwesens, bei dem es ihm in erster Linie um Konsolidierung und Verbesserung (allmähliche Reform) seiner moralischen Gesinnung (Tugend) geht, ist diesseitige Glückseligkeit kein vordringliches Anliegen, und auch die Glückseligkeit im Jenseits, die sich sozusagen nur als ein Begleiteffekt der erlangten Tugendgesinnung einstellt, wird nicht uneingeschränkt erwartet. So wird das höchste Gut, das nach seiner Grunddeterminierung als unendliches Maximum aus Heiligkeit und Seligkeit bestehen soll, doch in endliche Form relativiert und nur als dasjenige Ganze charakterisiert, „worin die größte Glückseligkeit mit dem größten Maße sittlicher (in Geschöpfen möglicher) Vollkommenheit als in der genausten Proportion verbunden vorgestellt wird“670 . (c) Die Glückseligkeit als Bestandteil des höchsten Guts bezieht sich auf die physische Zufriedenheit. Wie man unten sehen wird (cf. 3.5), bezieht sich die Glückseligkeit als Element des höchsten Guts auf die physische Zufriedenheit des Menschen; diese soll als Element des höchsten Guts durch die Tugendgesinnung notwendig hervorgebracht werden, kann aber nicht in diesem Leben, sondern erst im Jenseits, im Reich Gottes, als Aussicht auch des kummervollsten Lebens in die Zukunft, erwartet werden. Das aber, was im Jenseits der diesseitigen Glückseligkeit entspricht – es mag Seligkeit genannt werden –, könnte doch für sich nicht mehr physisch sein. Im Diesseits nun nimmt die moralische Gesinnung eines endlichen Vernunftwesens bloß alle Leiden und Übel des Lebens auf sich; sie trachtet nur nach der Heiligkeit, ohne Zu Heiligkeit und Seligkeit vgl. zunächst KpV, V 122 Z9–12 <A220>, V 123 Anm. Z35–39 <A222>. 668 Rel., VI 62 Z12–25 <B76f>. Zum letzten Satz cf. 3.4.2.b. 669 Vgl. KpV, V 128 Z25 – 129 Z7 <A232>. Vgl. auch KpV, V 25 <A45>: „eine Seligkeit, welche ein Bewußtsein seiner [sc. des vernünftigen aber endlichen Wesens] unabhängigen Selbstgenugsamkeit voraussetzen würde“. 670 KpV, V 129 Z35–37 <A233f>. 667 190 dabei besonders die physische Glückseligkeit in diesem Leben zu erwarten. Doch schon im ununterbrochenen, bloßen Vorwärtsgehen, das Leiden und Übel erträgt, steckt noch eine andere Art der Glückseligkeit, die Selbstzufriedenheit der Gesinnung, die aus den dem Gesetz angemessenen moralischen Handlungen entsteht; diese moralische Glückseligkeit im Diesseits (cf. 3.5.a) aber hat Kant in der KpV als Analogon der Glückseligkeit gekennzeichnet und nicht zum höchsten Gut gezählt. 3.3.3 Die ethische Geisteslage als die intellektuelle intentionale Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens zum Endzweck: Zur Lösung des Problems des höchsten Guts als des Bestimmungsgrunds des Willens. Als Bestimmungsgrund des reinen Willens gilt allein das moralische Gesetz, und nicht das höchste Gut, das erst durch seine Erweiterung zustandegebracht wird. Kant sagt aber, daß auch das letztere ihn bestimmen kann. Wie kann man diesen Widerspruch auflösen? Die Erweiterung des Gesetzes, wodurch das höchste Gut zuwegegebracht wird, setzt stillschweigend eine intelligible Ordnung voraus, in der mit den Worten der „Reflexionen“ die Zusammenstimmung des freien Willens mit den Gesetzen als mit Zwecken stattfinden kann. Sie umfaßt als Weltbegriff den reinen Willen und kann demzufolge als fähig gelten, für das ihn bestimmende, exekutive Prinzip der Moral zu sorgen. Sowohl das Gesetz als auch das höchste Gut gehören in diese intelligible Ordnung als systematische Einheit aller Zwecke. Daher kann auch das letztere die Kraft haben, den Willen zu bestimmen. Jedoch vermag das erkenntniskritische Verfahren der beiden Grundlegungsschriften, das vom Begriff der Pflicht bzw. vom Gesetz als Faktum der Vernunft ausgeht, nicht sofort und explizit diese essentielle intelligible Ordnung zu antizipieren, die erst aufgrund des praktischen Endzwecks durch die moralische Teleologie zu konstituieren ist. Eine Lösung dieser Schwierigkeit könnte sich darin finden, die Erweiterung des Gesetzes zum Endzweck als eine homogene Ausdehnung der Gesetzlichkeit zwischen beiden, m.a.W., als die feldtheoretische Geisteslage eines Handlungssubjekts auszulegen, die noch vom Gesetz her betrachtet wird, der aber die intelligible Ordnung unmittelbar zugrundeliegt, und ihr als Ausdehnung die exekutive Kompetenz zu geben, den Willen zu bestimmen. (a) Das höchste Gut ist kein Bestimmungsgrund des Willens. Das höchste Gut, das als die Spitze der Zielhierarchie des reinen Willens im System des Guten im allgemeinen durch zwei Verfahren hergestellt wird, nämlich (1) durch die Vergegenständlichung des reinen Denkens im Sittlichen, d.i. der Aktualität des moralischen Gesetzes, und (2) durch die unendliche Maximierung des durch das erste Verfahren zustandegebrachten Guten im allgemeinen, ist demnach „der ganze Gegenstand einer reinen praktischen Vernunft, d.i. eines reinen Willens“, und nicht der „Bestimmungsgrund desselben [sc. des reinen Willens]“; „das moralische Gesetz muß allein als der Grund angesehen werden, jenes [sc. das höchste 191 Gut] und dessen Bewirkung oder Beförderung sich zum Objekte zu machen.“671 Denn es würde unvermeidlich nur „Heteronomie herbeibringen“ und das eigentliche moralische Prinzip verdrängen, nicht nur das höchste Gut, sondern auch schon das Gute im allgemeinen als Gegenstand der reinen praktischen Vernunft zum Bestimmungsgrund des Willens zu machen und daraus das oberste praktische Prinzip abzuleiten; was bereits in der Analytik der KpV hinreichend nachgewiesen worden ist.672 Aus diesem Verweis Kants auf die Analytik erhellt nun auch in umgekehrter Weise, daß das höchste Gut nichts als ein unter dem Aspekt des Endzwecks des reinen Willens betrachteter Sonderfall des Guten im allgemeinen als des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft ist, das sich in Maximen und Handlungen, oder in konkreten Pflichten artikuliert und das lediglich Folge aus der Intentionalität des reinen Willens aufgrund des moralischen Gesetzes bzw. des Begriffs der Pflicht ist.673 Es ist in der Analytik hinreichend begründet worden, daß der Begriff des Guten und Bösen nicht der Bestimmungsgrund des Willens sein kann. Also kann auch der Endzweck bzw. das höchste Gut nicht der Grund der Pflicht sein,674 und die „Idee [eines höchsten Guts] geht aus der Moral hervor und ist nicht die Grundlage derselben; [sondern] ein Zweck, welchen sich zu machen, schon sittliche Grundsätze voraussetzt.“675 Folglich kann „die Lehre vom höchsten Gut“ „bei der Frage vom Prinzip der Moral“ „(als episodisch) ganz übergangen und beiseitegesetzt werden“.676 Der Satz aber enunciert nur: Bei der Konstatierung des Moralprinzips als des formalen Gesetzes in der formalistischen Phase der Grundlegung der Ethik läßt sich die ,moralisch-teleologische‘ architektonische Problematik, nämlich die Frage nach dem höchsten Gut, noch nicht stellen. Für H. Cohen aber legt dieser Satz Kants „die Ablehnung des ganzen Gedankens vom höchsten Gut als Konsequenz der Kantischen Ethik“ nahe.677 Die Auslegung Cohens, die mit Hilfe dieses von ihm mißverstandenen Satzes Kants Gedanken über das höchste Gut bestreiten will, ergibt sich daraus, daß er die Ethik Kants vorwiegend auf den Formalismus und das diesen ermöglichende formalistische Verfahren beschränkt und ihre andere Hälfte, die moralisch-praktische Zwecksetzung, als die ,moralisch-teleologische‘ architektonische Phase ihrer Grundlegung, nicht ernsthaft in Betracht zieht, sondern beide Phasen derselben nur als Widerspruch begreift. Daß Formalismus und formalistisches Verfahren erst zu jener KpV, V 109 Z21–25 <A196>. Vgl. KpV, V 109 Z28–33 <A197>. Bei der diesbezüglichen Textstelle in der Analytik der KpV handelt es sich um die Argumentation über das methodische Paradoxon der Kritik der praktischen Vernunft (vgl. V 63–65 <A110–114>). Das Wort ,Heteronomie‘ findet sich hier in V 64 Z18 <A113>. 673 Daher wird auch im Gegenstand-Kapitel auf das höchste Gut und den Dialektik-Teil hingewiesen. Vgl. dazu KpV, V 64 25–34 <A113f>. Cf. 3.2.0 (Fußnote 563). 674 Vgl. KU, V 471 Anm. Z9–12 <B461>. 675 Rel., VI 5 Z19–21 <BVIII>. 676 Gemeinspruch, VIII 280 Z5–8. 677 Cohen, H., Kants Begründung der Ethik, Berlin 2 1910, S. 352: „Es ist demnach nun Behauptung und Festhaltung von Kants Grundgedanken, wenn hier die Ablehnung des ganzen Gedankens vom höchsten Gut als Konsequenz der Kantischen Ethik vertreten wird.“ 671 672 192 ,moralisch-teleologischen‘ Systembildung der Ethik in bezug auf den Endzweck, die Kants Hauptanliegen in seiner langjährigen moralphilosophischen Entwicklung ausmacht, benötigt werden und daß die ausdrückliche Einführung des formalistischen Verfahrens in die Begründung des zur ,moralisch-teleologischen‘ Phase angesetzten Formalismus eher zur späten Phase der ethischen Überlegungen Kants gehört (und erst im Grundsätze-Kapitel der Analytik der KpV ausdrücklich und zusammenfassend formuliert wird), läßt sich leicht aus der Übersicht der gesamten Entwicklung seiner ethischen Überlegungen ersehen; eine solche aber kann erst durch die Untersuchung der zur Zeit Cohens nicht zugänglichen moralphilosophischen „Reflexionen“ erworben werden. Darüber hinaus ist der ethische Formalismus, der für die moralische Willensbestimmung jede Materie (Objekte) außer Kraft setzt, in der Geschichte der Philosophie sicher die Errungenschaft und Eigenart der Kantischen Ethik. Wohl aus beiden Gründen beschränkt sich Cohen auf den Formalismus, der sich auf das formalistische Verfahren einer Abstrahierung von der Materie gründet, und schätzt die eigentümliche Bedeutung der moralischpraktische Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ architektonischen Phase der Grundlegung der Ethik relativ niedrig ein, in der der Wille vom festgehaltenen formalen Moralprinzip ausgehend sich auf die Materie (intellektuelle Objekte) richtet, um somit für Ethik konstitutive Zwecke zu bilden. Er konnte daher Differenz und Zusammenbestehen von formalistischer und ,moralisch-teleologischer‘ Phase der Kantischen Ethik, die für diese wesentlich sind, nicht zum Prinzip seiner Auslegung machen. (Cf. 3.4.2.b). (b) Das höchste Gut ist doch der Bestimmungsgrund des Willens: die intentionale Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens zum Endzweck. Nun kann aber das höchste Gut auch der Bestimmungsgrund des reinen Willens sein.678 Diese Erwägung relativiert die obige primäre Determination, wonach es ein bloßer Gegenstand des Willens sei. Der Grund, warum es trotz dieser Determination auch als den Willen bestimmend zu verstehen ist, liegt darin, daß in ihm „das moralische Gesetz als oberste Bedingung schon mit eingeschlossen ist“.679 Die Involvierung des moralischen Gesetzes im höchsten Gut als dessen oberste Bedingung, demnach als Tugend, welche allgemeine Glückseligkeit möglich machen kann, resultiert aus der Selbstvergegenständlichung des reinen Denkens im Sittlichen angesichts der strukturellen Endlichkeit des menschlichen Daseins, nach der der menschliche Wille auf irgendeine Objektivität gehen muß, und bezeugt damit auch als die durch den Grundakt der Selbstvergegenständlichung geformte Teilstruktur diesen Grundakt der reinen praktischen Vernunft selbst. Der ganze Zusammenhang ließe sich durch folgende Interpretationsversuche explizieren: (1) Die Setzung eines Zwecks als finis in consequentiam veniens durch reine Vgl. KpV, V 109f <A197>: „... daß ... das höchste Gut nicht bloß Objekt, sondern auch sein Begriff und die Vorstellung der durch unsere praktische Vernunft möglichen Existenz desselben zugleich der Bestimmungsgrund des reinen Willens sei“. 679 KpV, V 109 Z34–36 <A197>. 678 193 praktische Vernunft heißt, daß das reine sittliche Denken sich selbst vergegenständlicht, was den elementaren Entwurf zur moralischen Teleologie ausmacht. Zugleich mit dieser Selbstvergegenständlichung des Denkens wird nun zwischen dem diesen Akt ausübenden reinen Willen als Kausalität aus Vernunft und dem dadurch hingestellten Objekt, dem höchsten Gut, intentional eine intellektuelle homogene Ausdehnung des Bewußtseins (eine Geisteslage) gebildet, in der, weil sie aus homogener reiner Gesetzlichkeit besteht, überall, demnach auch sowohl beim Willen als auch beim höchsten Gut, dasselbe moralische Gesetz als Formel dieser Gesetzlichkeit angetroffen werden kann. D.h.: Die Form des Gesetzes überspannt und bestimmt intellektuell die ganze Materie der Willensbestimmung in der menschlichen Praxis und bildet dadurch eine intellektuelle Ausdehnung über die ganze Materie. Einen moralischen Zweck realisieren heißt in dieser Geisteslage eine Pflicht aufgrund des Gesetzes erfüllen, wobei dieses als Form auch in jenem enthalten ist. Ohne diese intellektuelle Ausdehnung könnte der menschliche Wille keinerlei konstitutiv orientierten Schritt zu moralischen Handlungen tun, weil sie sein Spielraum für diese ist. Sie wird aber von Kant entweder bloß formelhaft als Gesetz bezeichnet, weil damals keine Idee der Feldtheorie wie heute680 entwickelt war, oder, der Wolffschen Tradition gemäß psychologisiert und als „das Selbstbewußtsein einer reinen praktischen Vernunft“ genannt, das mit dem Gesetz und zugleich auch mit dem Bewußtsein einer positiven Freiheit identisch ist.681 (2) Die Notwendigkeit der Selbstvergegenständlichung des reinen sittlichen Denkens (des Gesetzes) in der maximierten Form, der Setzung des höchsten Guts (hier der Heiligkeit) als Endzweck des Willens, rührt zunächst daher, daß dadurch der Mensch es im voraus darauf absehen kann, was durch seine moralischen Handlungen erreicht werden soll; er sucht die letzte Einheit der Folgen aus allen seinen moralischen Handlungen zur Sinngebung für sein endliches Leben, und sie ist für ihn primär die Idee der moralischen Vollkommenheit. Das bedeutet aber, daß jene Notwendigkeit in der Endlichkeit des arbitrium liberum humanum verankert ist, das auch sinnlich affiziert wird und demnach nicht vollauf dem heiligen moralischen Gesetz folgen kann; der auch sinnlich affizierbare reine Wille des endlichen Vernunftwesens stellt sein ausdrückliches Strebungsziel in der Idee der vollständigen Angemessenheit mit dem Gesetz, der Heiligkeit (moralische Vollkommenheit), 680 Die Feldtheorie in der theoretischen Physik ist allgemein bekannt. Auch die Markt-Theorie in der Micro Economic Theory läßt sich als eine Feldtheorie ansehen. Ebenso wird im philosophischen Bereich verschiedentlich eine Feldtheorie versucht. Dazu trägt in europäischen Wissenschaften der Fortschritt der Psychologie wesentlich bei, die sich zur Zeit Kants noch in primitivem Zustand befand. Bei der intellektuellen Ausdehnung des Gesetzes, die hier in die Interpretation der Kantischen Ethik eingeführt wird, handelt es sich um einen Zustand des moralischen Geistes, eine moralische Geisteslage, die aber nicht im subjektiven Bewußtsein verkapselt ist. Ebenso wie bei der Feldtheorie in Physik und Wirtschaftswissenschaft das Feld durch mathematische Formeln dargestellt werden kann, ebenso kann sich das ethische Feld auch durch moralische Grundsätze und deren Formeln artikulieren. 681 Vgl. KpV, V 29 Z25–28 <A52>. Beim „Selbstbewußtsein einer reinen praktischen Vernunft“ hat man es zunächst mit der Aktualität des moralischen Gesetzes, des reinen Denkens im Sittlichen, zu tun; dieses Bewußtsein wird in unseren Interpretationsversuchen als Ausdehnung des sittlichen Geistes begriffen. 194 auf, welche als Endzweck objektiviert und hingestellt wird. Diese Notwendigkeit der Objektivierung des reinen sittlichen Denkens ist nun aber ein anderer Name für die intellektuelle Ausdehnung zwischen freiem Willen und Endzweck, deren Medium dieses selbst ist. Das Ethos der Kantischen Ethik liegt in dieser Ausdehnung der Freiheit zum Endzweck. Dieser praktisch-realen Ausdehnung der reinen Gesetzlichkeit in der moralischpraktischen Zwecksetzung als der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung wird die Idee einer intelligiblen Welt unmittelbar zugrundegelegt, die aus der ontotheologischen Überlieferung stammt und dementsprechend an sich transzendental-objektiv ist, die aber in Kants ethischen Überlegungen stets latent unterstellt wird. Sie wird zuerst in der kognitiv-formalistischen Phase durch negative Freiheit bloß als ein anderer Standpunkt außer der Sinnenwelt angenommen, dann aber in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase praktisch-real entworfen und durch mehrere Eigenschaften charakterisiert. Aus ihr geht nach der immer noch in gewisser Hinsicht gültigen Übergangslehre von der Triebfeder (cf. 2.7.2) auch die Triebfeder zur moralischen Handlung hervor; jene wird aber in der Postulatenlehre, die mit der in der KpV neu determinierten Triebfeder-Lehre zusammengeht, objektiviert und stellt sich als das höchsten Gut vor. (3) Während nun diese Ausdehnung (Geisteslage) selber, in der und durch die der menschliche Wille sich vorwärts bewegt und nach dem höchsten Gut strebt und die an sich über die zwingende Kraft für die Bestimmung dieses Willens verfügt, unscheinbar ist, ist das zu ihr gehörende höchste Gut, das als Zweck objektivierte reine sittliche Denken, wie eben erläutert, für den endlichen Willen ein deutlich zu erkennendes Anstrebungsziel, ebenso wie das moralische Gesetz als Formel desselben Denkens in der Ausdehnung das kognitiv Frühere, demnach auch leicht erkennbar ist. Sofern also die Ausdehnung des Gesetzes (die Geisteslage) an und für sich den Willen bestimmt und sofern das Gesetz als Faktum der Vernunft sowie das Gesetz im höchsten Gut sozusagen seine Exponate sind, insofern kann das Gesetz im höchsten Gut und mithin dieses selbst ebenso der Bestimmungsgrund des Willens sein, nach welchem er als Richtschnur streben kann, wie das Gesetz als Ursprung der moralischen Intentionalität unmittelbar den Willen bestimmt. (4) Wenn man aber das Kantische Gesetz unbedacht als die substantialisierte Formel, die irgendwo in einem abstrakten Denkraum schwebt, d. h. als Buchstaben nimmt (und nicht als Geist begreift) und nur darin den Bestimmungsgrund des Willens sieht (da es aber beim formalen Gesetz darauf ankommt, daß es nicht materiell ist, d.h. nicht zu den empirischen Gründen gezählt wird, so darf es in seiner Aktualität nie wie ein empirischer Grund substantialisiert werden; Kant denkt das Gesetz meistens in seiner Aktualität, d.h. in Verbindung mit der positiven Freiheit, und räumt der letzteren in bezug auf die Begriffe des Guten und Bösen, wobei es sich um das reine sittliche Denken, die Aktualität des Gesetzes, in ihrer Objektivierungsmöglichkeit handelt, die Kategorie der Kausalität ein und nicht die der Substanz682 ), d.h. wenn man nicht innewird, daß das, was Kant mit dem morali682 Vgl. dazu KpV, V 65–67 <A114–119>. 195 schen Gesetz als synthetischem Satz a priori meint, nicht nur das principium diiudicationis, sondern auch das principium executionis moralis, nämlich ursprünglich die Aktualität des Gesetzes (das reine Denken im Sittlichen) ist und daß es in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung um die vektorartige Intentionalität dieses reinen sittlichen Denkens geht, die jene intellektuelle Ausdehnung (die Geisteslage) bildet, die an sich und direkt für die Willensbestimmung zuständig ist, so kann man niemals verstehen, warum das höchste Gut, dessen Synonym der Endzweck ist und das erst aus dem Moment einer Folge der Willensbestimmung geformt wird, doch auch der Bestimmungsgrund des Willens sein kann. Sollten die formelhaften Buchstaben alleine den Willen bestimmen, so würde kein lebendiger Geist des Gesetzes (die intellektuelle Ausdehnung als Geisteslage, der die intelligible Welt als Idee des Orts der moralischen Handlungen zugrundeliegt), geschweige denn das höchste Gut in dieser Geisteslage, ihn bestimmen können. (5) Beim Gesetz handelt es sich um die reine Aktualität des sittlichen Denkens, die sich von jenem anderen Standort aus auf die Sinnenwelt auswirkt und die dadurch die intellektuelle Ausdehnung für den Willen bildet. Sie wird in der Ausdehnung der Intentionalität des reinen sittlichen Denkens angesichts der Endlichkeit des menschlichen Willens vergegenständlicht und wird somit zum Endzweck. Das höchste Gut, in dem das Gesetz situiert ist, ist die wegen dieser Endlichkeit in der Geisteslage vergegenständlichte, zum Zweck gewordene Aktualität des Gesetzes aus der Autonomie der Vernunft. Erst als solches verstanden, kann es ein Bestimmungsgrund des Willens sein. (6) Das höchste Gut hat allerdings nur sekundär diese Funktion inne. Das Gesetz im höchsten Gut kann nämlich nur insofern der Bestimmungsgrund des Willens sein, als die Aktualität des Gesetzes in der Autonomie der Vernunft als der Grund, sich das höchste Gut überhaupt erst einmal zum Objekt zu machen, sich in demselben vergegenständlicht. (7) Wie oben demonstriert wurde, schwankt die Position der moralischen Triebfeder zwischen Gesetz und Endzweck; es scheint zudem nicht bestimmt, wo die Idee der intelligiblen Welt sich findet, im Ursprung der reinen praktischen Vernunft oder in deren maximierten Gegenstand. Angesichts dieser schwierigen Unentschiedenheit, die gewiß aus der Sache selbst kommt, muß der Begriff einer intellektuellen Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens als Geisteslage des Rechtschaffenen aufgestellt werden, die diese grundsätzliche Unbestimmtheit einräumen kann. Er ist moralisch-teleologisch und bezieht sich auf die Idee der intelligiblen Welt als Orts- bzw. Weltbegriff. (c) Die negative Reaktion von L. W. Beck auf das höchste Gut als den Bestimmungsgrund des Willens. L. W. Beck reagiert auf den Satz Kants, der Begriff des höchsten Guts sei der Bestimmungsgrund des reinen Willens, in Anlehnung an die traditionelle Interpre196 tation seit H. Cohen, ziemlich negativ.683 Im Zuge seiner Fragestellung, ob das höchste Gut der Bestimmungsgrund des moralischen Willens ist, sagt er: „Kant simply cannot have it both ways. He cannot say that the highest good is a motive for the pure will, and then say that it is so only under the human limitation that man must have an object which is not exclusively moral“.684 Er befürchtet, daß die Anerkennung des höchsten Guts als Bestimmungsgrund des Willens die Autonomie der Vernunft, die auf der Unabhängigkeit (Freiheit) von allen materialen Bestimmungsgründen der Willkür (empirischen Objekten) beruht, zunichte machen würde.685 Daher kann er nicht gern einräumen, daß das höchste Gut, selbst unter der menschlichen Beschränkung, das Motiv für den Willen sein kann. Er will die Bedeutung der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Kantischen Ethik, also der moralisch-praktischen Zwecksetzung, nicht positiv billigen, daß nämlich das formale Moralprinzip sich in seiner Richtungsnahme von der Freiheit hin zur äußeren Objektivität vergegenständlicht und daß das dadurch hergestellte intellektuelle Objekt, das höchste Gut, welches das Gesetz involviert, die Fähigkeit zur Bestimmung des Willens, obzwar im sekundären Sinne,686 erhält. Diese Bedeutung und mithin Kants obiger Satz aber sind unverständlich, wenn man die intellektuelle Ausdehnung des sich nicht bloß auf die Formel des Gesetzes beschränkenden reinen sittlichen Denkens auf die Gegenständlichkeit, der die intelligible Welt als moralisch-teleologischer Ort zugrundeliegt, nicht im Auge behält und nicht die Tatsache sieht, daß das vergegenständlichte Gesetz im höchsten Gut als Teil dieser Ausdehnung auch Gesetz ist und demnach für das endliche Vernunftwesen eine gewisse Kraft zur Willensbestimmung haben kann. Traditionelles Mißverständnis nun und daraus folgender Widerstand gegen den Satz Kants sind jedoch zu korrigieren, wenn man die „Reflexionen“ zur Moralphilosophie, das Kanon-Kapitel der KrV und die Dialektik der KpV in eben dieser Reihenfolge systematisch und entwicklungsgeschichtlich untersucht und dadurch den eigentümlichen Stellenwert jener moralisch-praktischen Zwecksetzung des reinen sittlichen Denkens687 in der 683 Vgl. Beck, L.W., A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, Chicago 1960, S. 245: „The two questions (p.242) must therefore be answered in the negative.“ Mit den beiden Fragen meint er: „(1) Is it [sc. summum bonum interpreted as bonum consummatum] the determining ground of the moral will? (2) Is there a moral necessity (duty) to seek and to promote it?“ 684 Ibid., S. 244. Der Bestimmungsgrund des Willens kann übrigens unter allgemeinen Umständen wohl, wie Beck es tut, mit dem Begriff vom Motiv (Bewegungsgrund) für denselben beinahe gleichgesetzt werden; der aber ist vom Begriff einer Triebfeder (elater) zu unterscheiden. Zu dieser Unterscheidung vgl. z.B. Refl. 6934, XIX 209, ϕ (1776–78): „obiective impellentia sunt motiva, subiective elateres.“ 685 Vgl. die eben zitierte Seite: „The theory of the Analytic requires him [sc. Kant] to deny that the concept of the highest good provides an autonomous motive.“ 686 Die Zweitrangigkeit des höchsten Guts als des Bestimmungsgrundes des Willens wird auch von Beck hervorgehoben. Er behauptet aber gegen Kant, daß dieser sie nicht gern in ihrer vollen Kraft konkludiert hat. Dabei behält Beck vor allem den eminenten Vorrang von Autonomie und Formalismus im Sinn. Vgl. dazu ibid., S. 243. 687 Beck sammelt die wichtigen Belege für die moralisch-praktische Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung in Fußnote 13 von S. 243 seines Kommentars, ohne sie jedoch systematisch zu bewerten. 197 ,moralisch-teleologischen‘ architektonischen Phase der Grundlegung der Ethik mit Bezug auf die moralische Teleologie selber, um derentwillen das formalistische Grundlegungsverfahren und die Grundbegriffe von Autonomie und Formalismus erforderlich wurden, richtig einschätzen kann. 3.3.4 Das höchste Gut als das Reich Gottes. Bei dem Begriff des höchsten Guts (genauer: des höchsten abgeleiteten Guts) hat man es nun mit dem einer idealen Welt zu tun. Tugend und Glückseligkeit machen zusammen einmal individuell den „Besitz des höchsten Guts in einer Person“ aus,688 sodann aber auch durch die Verteilung der Glückseligkeit in ganz genauer Proportion der Sittlichkeit „das höchste Gut einer möglichen Welt“,689 bei dem von dem Ganzen, dem vollendeten Guten, die Rede ist. Der Name „das höchste Gut“ tritt häufig in Kombination mit dem Ausdruck „in einer Welt“ auf,690 was zumindest anzeigt, daß es ein mit der Welt eng verbundener, gemeinschaftlicher Begriff ist. Das „höchste auch durch unsere Mitwirkung mögliche Gut“ wird tatsächlich mit einer „Welt“ identifiziert und ist als solche der Endzweck.691 Daß das höchste Gut ein Weltbegriff ist, deutet darauf hin, daß Kants Ethik im Grunde als eine Orts- bzw. Feldtheorie verstanden werden kann. Daher haben wir oben gerade versucht, eine fundamentale Feldtheorie der moralischen Geisteslage zu entwerfen, die auf der Freiheit beruht, deren Ursprung aber negativ und unbegreiflich ist; aufgrund dieser Feldtheorie kann eine Welttheorie der intelligiblen Welt konstituiert werden. Das höchste Gut als Weltbegriff (die beste Welt) bei Kant rührt unterdessen vom Christentum her und verweist konkret auf das Reich Gottes.692 Kants Lehre KpV, V 110 Z32 <A199>. Auch bei diesem Ausdruck ist die Terminologie Kants nicht konstant. Hier rekrutiert sich „das höchste Gut in einer Person“ aus Tugend und Glückseligkeit, während „das höchste Gut im Menschen“ in V 157 Z32f <A281>die Tugend allein zu bedeuten scheint. 689 KpV, V 110 Z35 <A199>. Vgl. auch KrV, III 528 Z14f <B842>: „das höchste Gut einer Welt“. 690 Z.B.: „Bewirkung des höchsten Guts in der Welt“ (KpV, V 122 Z4f <A219>); „das höchste mögliche Gut in einer Welt“ (V 129 Z31 <A233>); „die Existenz des höchsten in einer Welt möglichen Guts“ (V 134 Z18 <A242>); „das höchste durch Freiheit mögliche Gut in der Welt“ (KU, V 450 Z8f <B423>); „das höchste in der Welt mögliche Gut“ (Rel., VI 7 Anm. <BXII>); „ein höchstes auch durch unsere Mitwirkung mögliches Gut in der Welt“ (Gemeinspruch, VIII 279 Anm. Z30f). 691 Vgl. Gemeinspruch, VIII 280 Anm. Z17–19: „das Bedürfnis eines ... Endzwecks (eine Welt als das höchste auch durch unsere Mitwirkung mögliche Gut)“. Vgl. auch Refl. 6827, XIX 173, ϕ (1776–78): „Summum bonum ist das Ideal der Vollkommenheit der Welt.“ 692 Vgl. KpV, V 127f <A230f>: „Die Lehre des Christentums ... gibt ... einen Begriff des höchsten Guts (des Reichs Gottes)“; V 130 Z23f <A235>: „der sich auf ein Gesetz gründende moralische Wunsch, das höchste Gut zu befördern (das Reich Gottes zu uns zu bringen)“. Während die intelligible, moralische Welt, das Reich Gottes, als das höchste abgeleitete Gut bezeichnet wird, wird mit dem höchsten ursprünglichen Gut das Ideal von Gott gemeint. Vgl. hierzu KpV, V 125 Z22–25 <A226>; KrV, III 526 Z19–22 <B838f>; Was heißt: S.i.D.or.?, VIII 139; KpV, V 128 Z24 <A232>, 131 Z6 <A236>; Refl. 7202, XIX 282 Z14–16, ψ (1780–89); Refl. 6113, XVIII 459, ψ2 (1783–84); Refl. 6132, XVIII 464, ψ2−4 ? (1783–89?); Fortschritte, XX 307. Kant warnt vor einem Mystizismus, der ein unsichtbares Reich Gottes wirklich und nicht-sinnlich anschauen und das, was nur zum Symbol dient, zum Schema machen würde. Vgl. dazu KpV, V 70f <A125>. 688 198 vom höchsten Gut ist nach seinem Begriff der Moral des Christentums zugeschnitten. Eben darum kritisiert er von der Position der letzteren her sowohl die Stoa als auch den Epikureismus hinsichtlich der Lehre des höchsten Guts.693 Die Annehmbarkeit des Begriffs des höchsten Guts antizipiert von Anfang an seine Ausführbarkeit durch das christliche Gedankengut; er ist ohne dieses nicht konzipierbar; er ist von vornherein von ihm historisch geprägt. 3.4 Die Postulatenlehre ergänzt die Lehre vom höchsten Gut in der Theorie der moralisch-praktischen Zwecksetzung. In diesem Kapitel (3.4) wird die dritte Stufe der moralisch-praktischen Zwecksetzung in der ,moralisch-teleologischen‘ Phase der Grundlegung der Ethik, die Postulatenlehre, die die Hauptlehre vom höchsten Gut ergänzt und vollendet, insoweit in Betracht gezogen, als sie die Übersicht über diese Phase vervollständigt. Dabei ist unser Gesichtspunkt jener Entwurf des freien Willens auf den Endzweck in der intellektuellen Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens a priori vor dem Hintergrund der intelligiblen Welt, der die Grundlage der Kantischen moralischen Teleologie ausmacht. Er vollzieht sich als unendlicher Progressus zur Idee der moralischen Vollkommenheit. Dementsprechend werden in diesem Kapitel (1) der unendliche Progressus zur Idee der moralischen Vollkommenheit mitsamt dem Postulat der Unsterblichkeit der Seele (3.4.1) und (2) das vollendete höchste Gut mit Bezug auf den moralischen Gottesbeweis (3.4.2) dargestellt. Zuerst aber soll unsere Interpretationsthese einer intellektuellen Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens auf den Endzweck in der Tragweite bis zur Postulatenlehre textgemäß belegt werden (3.4.0). 3.4.0 Die Erweiterung der reinen intellektuellen Aktualität des moralischen Gesetzes auf das höchste Gut und dessen Postulate. Die Untersuchung des Begriffs der moralischen Triefeder in den moralphilosophischen Reflexionen und des Begriffs des Gegenstands der reinen praktischen Vernunft im Gegenstand-Kapitel der KpV sowie des Endzwecks (des höchsten Guts) in der Dialektik der KpV, der Ethikotheologie in der KU und der Religionsschrift führt unvermeidlich zur Annahme bzw. Hervorhebung einer intellektuellen Erweiterung bzw. Ausdehnung, die sich von der Freiheit über Gesetze auf den Endzweck erstreckt. Diese Erweiterung bzw. Ausdehnung von Freiheit zum Endzweck, die auch subjektiv als Geisteslage eines Handlungssubjekts verstanden werden kann, besteht aus der reinen Aktualität des Gesetzes als Faktum der Vernunft und weist auf den ontotheologischen Begriff einer intelligiblen Welt hin. Anlaß zu dieser An693 Vgl. dazu KpV, V 111 Z18 – 112 Z26 <A200–202>, V 126 Z14 – 127 Z16 <A227–229>, V 126f Anm. <A229f>. 199 nahme bzw. Hervorhebung ist neben den Schwankungen der Position der moralischen Triebfeder (auch in der ,kritischen‘ Ethik kann das Gesetz im höchsten Gut der Bestimmungsgrund des Willens sein), daß Kant sich in der GMS die Idee der intelligiblen Welt, die er transzendental-subjektiv der Verbindlichkeit des Gesetzes zugrundelegt, zugleich transzendental-objektiv vorzustellen und als Endzweck hinzustellen scheint. Der gesamten sich von Freiheit zum Endzweck ausdehnenden Geisteslage eines Rechtschaffenen, der nach der Idee der moralischen Vollkommenheit seiner selbst trachtet, liegt immer diese Idee der intelligiblen Welt zugrunde. Das Ethos der Kantischen Ethik beschränkt sich nicht auf Freiheit und Gesetz, sondern liegt in der sich von Freiheit auf den Endzweck erweiternden intellektuellen Geisteslage des Rechtschaffenen mitsamt der von ihm stets gehegten Idee der intelligiblen Welt als des Reichs Gottes.694 Der Begriff einer intentionalen Ausdehnung bzw. Erweiterung der reinen intellektuellen Aktualität des sittlichen Gesetzes auf das höchste Gut und dessen Postulate, der auch praktische Realität hat, ist für Kant so selbstverständlich, daß er für ihn nur verschiedene gewöhnliche Ausdrücke verwendet, ohne einen besonderen hervorstechenden Terminus festzulegen. Mehrere Beispiele dafür sind anzuführen. (1) ,führen zu ...‘: „Das moralische Gesetz führte ... zur praktischen Aufgabe, ... nämlich der notwendigen Vollständigkeit ... der Sittlichkeit, und ... zum Postulat der Unsterblichkeit. Eben dieses Gesetz muß auch zur Möglichkeit der jener Sittlichkeit angemessenen Glückseligkeit, ... nämlich auf die Voraussetzung des Daseins einer dieser Wirkung adquaten Ursache führen“.695 Dieses ,das Gesetz führt zu ...‘ besagt eben die Ausdehnung der reinen intellektuellen Aktualität des moralischen Gesetzes auf das höchste Gut (Sittlichkeit und Glückseligkeit) und dessen Postulate (Unsterblichkeit und Existenz Gottes), in der der ,moralischteleologische‘ Entwurf des freien Willens im unendlichen Progressus stattfindet. (2) ,notwendig verbunden‘: „... (welches Objekt unseres Willens [sc. das höchste Gut] mit der moralischen Gesetzgebung der reinen Vernunft notwendig verbunden ist)“.696 Bei der „moralischen Gesetzgebung der reinen Vernunft“ handelt es sich um das reine Denken im Sittlichen, d. i. die reine intellektuelle Aktualität des moralischen Gesetzes aus der reinen praktischen Vernunft. Der Beleg will sagen, die Intentionalität des Willens auf das höchste Gut als sein Objekt gehöre zur Ausdehnung bzw. Erstreckung des reinen sittlichen Denkens, und heißt konkret, das Gesetz gebiete die Bewirkung des höchsten Guts. (3) ,sich auf ... gründen‘: „Diese Pflicht [sc. die Pflicht, etwas (das höchste Gut) zum Gegenstande meines Willens zu machen, wobei Gott, Freiheit und Unsterblichkeit vorausgesetzt werden müssen,] gründet sich auf einem ... für sich selbst apodiktisch gewissen, nämlich dem moralischen Gesetz“.697 Bei der Pflicht des ,zum-Gegenstand-Machens‘, d.h. der Vergegenständlichung, des höchsten Guts 694 Kant sagt z.B., die Moral sei die Philosophie über die ganze Bestimmung des Menschen, d.h. den Endzweck. Vgl. dazu KrV, III 543 Z10–12 <B868>. 695 KpV, V 124 <A223f>. 696 KpV, V 124 Z17–19 <A224>. 697 KpV, V 142 <A257>. 200 mitsamt den Postulaten hat man es mit dem „Bedürfnis der reinen praktischen Vernunft“ zu tun. Jene und mithin auch dieses gründen sich, so heißt es, auf das moralische Gesetz. Auch dieses ,sich auf das Gesetz gründen‘ drückt eben die Ausdehnung der reinen intellektuellen Aktualität des moralischen Gesetzes auf das höchste Gut und dessen Postulate aus, in der auch die Vergegenständlichung und das Bedürfnis als Beziehungen auf dieselben zustandekommen können. (4) ,auf ... gerichtet sein‘: Die fundamental-strukturelle Beziehung der reinen praktischen Vernunft auf ihr Objekt, daß der Gebrauch derselben „auf die Existenz von Etwas, als Folge der Vernunft, gerichtet ist“, und daß sie demnach „von dem obersten Prinzip ihres reinen praktischen Gebrauchs“, d.i. vom moralischen Gesetz, „ausgehend ihr Objekt bestimmt“,698 heißt m.a.W., daß die reine intellektuelle Aktualität des moralischen Gesetzes aus der reinen praktischen Vernunft, d.i. die reine intellektuelle Selbsttätigkeit, die sich als Allgemeingültigkeit artikuliert, sich auf Etwas als ihr Objekt richtet und somit dieses bestimmt. Dabei ist von der fundamental-strukturellen Beziehung des reinen sittlichen Denkens, d.i. der Aktualität des Gesetzes, auf die Welt der Objektivität die Rede. Das Etwas als Objekt der reinen intellektuellen Aktualität des Gesetzes ist zunächst das Gute, läuft aber zuletzt auf das höchste ursprüngliche Gut, Gott, hinaus. Die Notwendigkeit der Annahme desselben zeigt sich in „der notwendigen Richtung des Willens auf das höchste Gut“. Was also auf theoretischem Weg nicht geleistet werden kann,699 das ist im praktischen Bereich möglich, weil die praktische Realität eines Objekts (hier das Dasein Gottes) durch die reine intellektuelle Aktualität des moralischen Gesetzes gesichert werden kann. Die Sicherung der praktischen Realität bzw. Gültigkeit aber kann nur dann dem Objekt zugesprochen werden, wenn die Aktualität des Gesetzes sich auf dasselbe erweitert und somit bis zu ihm eine reine intellektuelle Ausdehnung der praktischen Realität als Identität des reinen Willens bildet. (5) ,Verhältnis des Verstandes zum Willen‘: Wenn das Verhältnis des Verstandes zum Willen, das durch das moralische Gesetz a priori bestimmt wird, eben durch diese apriorische Bestimmung auch praktisch-objektive Realität erhält, so wird auch dem Begriff des Objekts eines durch dieses Gesetz bestimmten Willens, mithin auch dem vom höchsten Gut und dessen Postulaten dieselbe Realität verliehen.700 D.h., die reine intellektuelle Aktualität des Gesetzes erweitert sich durch ihre Bestimmung des Willens a priori auf das Objekt desselben, mithin auch auf das höchste Gut und dessen Postulate, und gibt dadurch dem Woraufhin ihrer Erweiterung praktisch-objektive Realität, die sie an und für sich besitzt. Die Freiheitskausalität, die in der Analytik der KpV „Bedeutung“ bekommt,701 gibt hier in der Dialektik durch ihre Erweiterung dem höchsten Gut und dessen Postulaten praktisch-objektive Gültigkeit. (Cf. 3.2.2.c). (6) ,erweitern‘: Der reine uneigennützige Wille erweitert sich noch über die Beobachtung des formalen Gesetzes hinaus zur Hervorbringung eines Objekts (des Vgl. KpV, V 139 Z10–17 <A250f>. Loc.cit., Z2–10 <A250>. 700 Vgl. KpV, V 138 Z6–15 <A249>. Vgl. auch V 137 Z6–8 <A246f>. 701 KpV, V 65f <A114–116>. 698 699 201 höchsten Guts),702 indem eine Absicht, d.i. ein Zweck als Objekt des Willens a priori gegeben wird, d.h., indem das Objekt des Willens durch das diesen unmittelbar bestimmende Gesetz praktisch-notwendig vorgestellt wird.703 M.a.W., „das Gesetz ... erweitert sich ... zu Aufnehmung des moralischen Endzwecks der Vernunft unter seine Bestimmungsgründe“.704 Auch diese Erweiterungen wollen besagen, daß die reine intellektuelle Aktualität des moralischen Gesetzes in der fundamental-strukturellen Beziehung des durch sie bestimmten Willens auf sein Objekt sich auf das höchste Gut ausdehnt. (7) Auch der Begriff eines Interesses und der eines Bedürfnisses werden verwendet, um die Erweiterung bzw. Ausdehnung des reinen Denkens im Sittlichen auf das höchste Gut und dessen Postulate auszudrücken.705 Vor allem zeigt die Entgegensetzung des Vernunftbedürfnisses zum Bedürfnis der Neigung deutlich, daß die reine intellektuelle Aktualität des Gesetzes sich auf das höchste Gut und dessen Postulate erweitern bzw. ausdehnen und dadurch aus dem Bedürfnis der intellektuellen Notwendigkeit die letzteren postulieren darf, d.h. ihnen praktischobjektive Realität geben kann, während ein Verliebter seine Idee von Schönheit durch das Bedürfnis, das auf der Neigung beruht, doch nicht als theoretisch-real zu postulieren vermag.706 Das Ethos der Kantischen Ethik liegt in dieser Erweiterung bzw. Ausdehnung der reinen intellektuellen, aus der Freiheit erfließenden Aktualität des moralischen Gesetzes auf das höchste Gut als Endzweck mitsamt dessen Postulaten. Es findet sich nicht im substantialisierten Gesetz, sondern in der realen Wirkung (actualitas) des Gesetzes. In dieser Ausdehnung als Geisteslage findet jeder Schritt des unendlichen kontinuierlichen Progressus eines endlichen Vernunftwesens in Richtung der Verwirklichung der Idee vom Reiche Gottes statt. 3.4.1 Der kontinuierliche unendliche Progressus zur Realisierbarkeit der Idee der moralischen Vollkommenheit als des Elements des höchsten Guts. (a) Die Progression zur moralischen Vollkommenheit als allmähliche Reform setzt die Revolution in der Gesinnung voraus. Der unendliche Progressus der Gesinnung eines endlichen Vernunftwesens als die allmähliche Reform der verkehrten Denkungsart im Sittlichen setzt die Revolution in der Gesinnung desselben (die Aufnahme des moralischen Gesetzes als Triebfeder in ihre Grundmaxime durch die unerforschliche ursprüngliche Freiheit der Vgl. Gemeinspruch, VIII 280 Anm. Z17–21. Vgl. auch KpV, V 120 Z3–10 <A216>. Vgl. KpV, V 134 Z8–13 <A241>. 704 Rel., VI 7 Anm. <BXII>. 705 In der KpV vgl. zum ,Interesse‘ V 120 Z1–4 <A216>, 145 Z37 <A262>; zum ,Bedürfnis‘ V 142 Z5f <A255f>, 142 Z18 – 143 Z31 <A257–259>, 140 Z34f <A253>, 4 Z26f <A6>, 125 Z26–28 <A226>, 126 Z6–10 <A227>. 706 Vgl. KpV, V 144 Anm. <A259>. Vgl. auch V 142 Anm. <A256>. 702 703 202 Willkür707 ) voraus. Der Fortschritt seiner Gesinnung nämlich, der empirisch als seine Tat ununterbrochen weitergeht, gründet darauf, daß jene Revolution in der Gesinnung708 als Übergang zur Moralität (Sinnes- oder Herzensänderung, Gründung eines intelligiblen Charakters), durch die das moralische Gesetz als das gute Prinzip in die Grundmaxime der Gesinnung aufgenommen wird, auf der intelligiblen Ebene bereits stattgefunden hat. Dementsprechend wird in dieser Progression als allmählicher Reform die Idee einer moralischen Vollkommenheit709 (der völligen Angemessenheit zum Gesetz, d.i. der Heiligkeit) als Endzweck angenommen. Wie diese dem Progressus als Reform vorausgesetze Revolution in der Gesinnung möglich ist, wäre mittels der Verknüpfung der formalistischen Grundlegung der Ethik im Grundsätze-Kapitel der KpV mit der Lehre vom radikal Bösen im ersten Stück der Religionsschrift wie folgt zu erläutern: Zur Revolution in der Gesinnung als der Aufnahme des Gesetzes in ihre Grundmaxime müßte die Loslösung der reinen praktischen Vernunft von dem Prinzip der Selbstliebe, das sie empirisch bedingt, folglich von der ihm dienenden pathologisch-praktischen Lust als Bestimmungsbedingung des Willens gehören, durch welche die Erscheinungen überhaupt in der Sinnenwelt als materiale Bestimmungsgründe des Willens überstiegen werden (die Rückführung auf die „Freiheit im strengsten, d.i. transzendentalen Verstande“710 , nämlich auf die negative Freiheit als einen anderen Standpunkt außer der Sinnenwelt); zugleich aber müßte sich – nicht dogmatisch, sondern sachlich betrachtet – in dieser Freiheit, wo keine materialen Hindernisse dem Antritt eines nichtempirischen, rein intellektuellen Prinzips der Willensbestimmung in den Weg gelegt sind, das reine sittliche Denken bzw. die transzendental-subjektive moralische Gesetzlichkeit (die positive Freiheit des Willens) bekunden,711 was sich als die Aufnahme des Gesetzes in der übersinnlichen Gesinnung begreifen läßt, insbesondere wenn jenes reine sittliche Denken in der philosophischen Religions707 708 Vgl. dazu zunächst Rel., VI 21 <B6–8>, 23f <B12>, 25 <B14>, 44 <B48>, etc. Zur Revolution in der Gesinnung vgl. Rel., VI 47f <B53–56>; Str.d.Fak., VII 57, 59; Anthr., VII 294. 709 Zur moralischen Vollkommenheit vgl. KpV, V 123 Z7 <A221>; Rel., VI 3 Anm. <BIV>, 61f <B74f>, 97 <B136>, 145 <B220>; MS VI 387, 392, 446. 710 KpV, V 29 <A51>. Cf. 1.4.b. 711 Die ursprüngliche Freiheit in der Tiefe des Herzens, die die Wahlfreiheit der intelligibel verstandenen freien Willkür betrifft, ob diese das gute Prinzip aufnimmt oder nicht (dabei wird das arbitrium liberum zwiefach aufgefaßt: phänomenal und intelligibel, und nur die Wahl des ersteren ist empirisch erkennbar), ist nach Kant intelligibel und unerforschlich (vgl. hierzu Rel., VI 21 <B6–8>, 21 Anm. <B7>, 25 <B14>, 41 <B42>, 43 <B46>, 44 <B48f>, 51 <B61>, 59 <B71>, 63 <B78>, 138 <B209>, 170 Anm. <B259f>; MS, VI 380 Anm., 392, 441 (§ 14); Anthr., VII 396f), während die negative und die positive Freiheit etwa in der KpV nur mit Bezug auf die moralische Gesetzlichkeit betrachtet werden. Nicht dabei auszuschließen ist aber die Interpretationsmöglichkeit, daß die negative Freiheit in der KpV als Unabhängigkeit von materialen Bestimmungsgründen des Willens sich auf die ursprüngliche Freiheit in der Tiefe des Herzens bezieht, die auch sinngemäß negativ ist. Positive Freiheit hingegen, die Freiheitskausalität des Willens aus Vernunft, wird in der späten Phase des Denkens Kants dahingehend verstanden, daß der Wille, der Freiheit der Willkür entgegengesetzt, an sich weder frei noch unfrei ist (vgl. hierzu MS, VI 226f, Vorarbeiten zu die Metaphysik der Sitten, XXIII 248f, 256). Cf. Fußnote 188 in 1.4. 203 lehre als Gottes Gebot substantialisiert wird; somit ist nunmehr die Vernunft des endlichen Vernunftwesens selbst gesetzgebend.712 Von daher kann konstatiert werden: Es handelt sich bei der Revolution in der Gesinnung als Umwandlung der Denkungsart im Sittlichen um eine Umwendung in der formalistischen Phase der Grundlegung, d.h. um die Umwendung von der Abstraktion von empirischen Bestimmungsgründen der Willkür bzw. von der Ablegung der empirischen Bedingtheit der praktischen Vernunft als Kritik derselben zur moralischen Gesetzgebung der reinen praktischen Vernunft, die Umwendung der Freiheit. Obwohl sie sich als solche und im ganzen nur auf der intelligiblen Ebene vollzieht, läßt sie sich doch auch zeitlich als ein neuer Vorsatz, obzwar nicht vollauf empirisch feststellbar, gewahren.713 Zusammen mit ihrem Eintritt, d. i. mit der ,einzigen unwandelbaren Entschließung‘714 in der ursprünglichen Freiheit, das Gesetz in die Grundmaxime aufzunehmen und somit den obersten Grund der Maximen umzukehren (Gründung eines intelligiblen Charakters715 ), und in und mit der durch sie eröffneten intellektuellen Geisteslage beginnt nun auch auf der empirischen Ebene die allmähliche Reform der bis dahin verkehrten Denkungsart, die sich als kontinuierlicher unendlicher Progressus zum Endzweck vollzieht. Zum moralischen Wohlverhalten eines Menschen als diesem Progressus zur moralischen Vollkommenheit seiner selbst ist also eine Umwendung als einzige unwandelbare Entschließung, die Revolution in der Gesinnung, erforderlich, die Kants ethische Grunderfahrung darstellt und die sich auch in der praktisch-theoretischen Grundlegung des Grundsätze-Kapitels der KpV niederschlägt (cf. 1.2, 1.3, 1.4). Wir gehen nun der Postulatenlehre in bezug auf die moralische Vollkommenheit nach und erläutern einige ihrer Grundzüge: (1) die latente Postulierung der Existenz Gottes in der Forderung der moralischen Vollkommenheit unter der Idee vom Reich Gottes, (2) die Vorreligiosität des Postulats der Unsterblichkeit und (3) dieses Postulat als Bedingung der Selbsterhaltung der Vernunft. Daraus ergibt sich, daß Kants Theorie der moralisch-praktischen Zwecksetzung in der ,moralischteleologischen‘ Phase der Grundlegung durchaus von der Idee vom Reich Gottes geprägt ist und daß sie von der Moralität auf der Basis reinen Denkens durchwaltet ist. 712 Die Vernunft des endlichen Vernunftwesens kann das Gesetz für sich selbst nicht schaffen, sondern es wird ihr zuerst gegeben. Das ist der tiefste Sinn vom ,Faktum der Vernunft‘. Vgl. dazu Rel., VI 26 Anm. <B16>: „Wäre dieses Gesetz nicht in uns gegeben, wir würden es als ein solches durch keine Vernunft herausklügeln, oder der Willkür anschwatzen“. Vgl. dazu auch Krüger, G., Philosophie und Moral in der Kantischen Kritik, Tübingen 2 1967, S. 68. Cf. 3.1.1.d. 713 Das ist zwar von Kant nicht ausdrücklich deklariert (denn grundsätzlich kann etwas Intelligibles nicht zeitlich und empirisch erkannt werden), muß aber angenommen werden. Vgl. z.B. Rel., VI 68 <B87f>; Anthr., VII 294: „Vielleicht werden nur wenige sein, die diese Revolution vor dem 30sten Jahre versucht, und noch wenigere, die sie vor dem 40sten fest gegründet haben“ (vgl. hierzu Refl. 1518, XV 873 Z24, ψ). 714 Rel., VI 47f <B55>. 715 Zur ,Gründung eines Charakters‘ vgl. zunächst Rel., VI 48 <B55f>; Anthr., VII 294f; KpV, V 152 Z26f <A271>; Idee zu einer allgemeinen Geschichte, VIII 21 Z14 („einer Denkungsart“); GMS, IV 396 Z33 <B7>(„eines guten Willens“); Pädagogik IX 487; etc. 204 (b) Das Dasein Gottes wird implizit auch der Realisierbarkeit der moralischen Vollkommenheit als des einen Elements des höchsten Guts ohne Bezug auf die Glückseligkeit vorausgesetzt. Ist nun die Heiligkeit nur „in einer einzigen intellektuellen Anschauung“ „ganz anzutreffen“716 und demnach der Tat nach auf der empirischen Ebene nicht ganz zu erlangen, so heißt das, daß sie, d.i. „die völlige Angemessenheit der Gesinnungen zum moralischen Gesetze“717 , nicht auf empirischer, sondern allein auf intelligibler Ebene festzustellen ist. Daher wird ein Drittes, d.i. ein „Herzenskündiger“, erfordert, der den Progressus zur Angemessenheit mit dem Gesetz „in seiner intellektuellen Anschauung als ein vollendetes Ganze auch der Tat (dem Lebenswandel) nach“ beurteilen kann.718 Dieser Formulierung in der Religionsschrift entspricht der Satz in der KpV: „Der Unendliche, dem die Zeitbedingung nichts ist, sieht in dieser für uns endlosen Reihe das Ganze der Angemessenheit mit dem moralischen Gesetze“.719 Dieses „Ganze“ in der KpV wird in der Religionsschrift ausdrücklich als ,die übersinnliche Gesinnung720 im Zustande der Änderung721 ‘ aufgefaßt. Dadurch tritt die Diskrepanz zwischen übersinnlicher Gesinnung (einem neuen Menschen vor Gott) und empirischer mangelhafter Tat (kontinuierlichem Fortschritt, bloßem Werden) deutlich in den Vordergrund, somit aber erst recht auch das Bedürfnis einer Relation zwischen den beiden. Erst unter der dieses Bedürfnis erfüllenden Voraussetzung eines Dritten, das die empirische Tat auf die intelligible Ebene übertragen kann, kann auch die notwendige Bedingung (conditio sine qua non) zur Realisierbarkeit der Idee der Heiligkeit als des einen Bestandstückes des höchsten Guts postuliert werden, nämlich die Bedingung, daß der kontinuierliche Progressus auf empirischer Ebene sich keinesfalls in diesem Leben abschließen kann, sondern ins Unendliche gehen muß. Ohne die Voraussetzung einer intellektuellen Anschauung von Gott kann nämlich die „Unsterblichkeit der Seele“722 nicht postuliert werden. Die erwähnte Argumentation will also sagen, das Moment der Sittlichkeit setze für sich allein auch schon das Dasein Gottes, das in der KpV erst von dem ganzen höchsten Gut deduziert werden soll, als des Herzenskündigers hinsichtlich dessen Allwissenheit723 implizit voraus,724 obwohl auf den ersten Blick das Anstreben KpV, V 123 Z11–13 <A221f>. KpV, V 122 Z6f <A219>. 718 Rel., VI 67 Z12–14 <B85>. Diese Stelle in der Religionsschrift befindet sich im Unterabschnitt „c) Schwierigkeiten gegen die Realität dieser Idee [eines Gott wohlgefälligen Menschen] und Auflösung derselben“ (VI 66ff <B84ff>), der die Realisierbarkeit der Idee der Heiligkeit thematisiert, während der vorige Unterabschnitt „b) objektive Realität dieser Idee“ (VI 62ff <B76ff>) ihre Annehmbarkeit erörtert. 719 KpV, V 123 Z7–9 <A221>, Vgl. auch V 123 Anm. Z34 <A222>. 720 Rel., VI 67 Z11 <B85>. Vgl. auch Ende a.D., VIII 334 Z16–25. 721 Rel., VI 73 Z19 <B96>. 722 KpV, V 122 Z19 <A220>. 723 Zur Allwissenheit Gottes vgl. KrV, III 529 <B843>, KU, V 444 <B414>, etc. 724 Auch L. W. Beck setzt in der von ihm neu formulierten Beweisführung für das Postulat der Unsterblichkeit das Dasein Gottes voraus. Vgl. dazu Beck, L. W., op.cit., S. 269. 716 717 205 der moralischen Vervollkommnung und mithin die moralische Bildung eines Menschen als Person zunächst ohne dieses Dasein durchführbar scheinen. Diese in die Postulierung der Unsterblichkeit der menschlichen Seele eingebrachte Argumentation für das Postulat der Existenz Gottes als Herzenskündiger beruht auf dem Grundgedanken: Damit die Unendlichkeit des Progressus auf empirischer Ebene bestehen kann, muß der Begriff eines realen Ganzen auf intelligibler Ebene angenommen werden, welches jener entsprechen soll. Eben diese Annahme einer intelligiblen Realität mündet doch in die implizite Voraussetzung des Dasein Gottes. Die praktisch-dogmatische Lösung des Problems der rationalen Psychologie, der Unsterblichkeit der Seele, antizipiert also die Lösung des Problems im anderen Bereich der metaphysica specialis, des Problems des Daseins Gottes in der Theologie. Die Einschleusung des Daseins Gottes in die Argumentation zum Streben nach moralischer Vollkommenheit und zum Postulat der Unsterblichkeit rührt aber zuletzt davon her, daß der Begriff des höchsten Guts überhaupt durch die christliche Idee eines Reichs Gottes geprägt ist, auf das das Streben sich richtet. So ist der unendliche Progressus nach der Heiligkeit denn auch nichts anderes als „das beständige ,Trachten nach dem Reiche Gottes‘“.725 Daß nun aber das Postulat der Existenz Gottes möglicherweise ohne das Moment der Glückseligkeit im höchsten Gut nur durch die Forderung des Strebens nach moralischer Vollkommenheit angesetzt werden kann, hängt damit zusammen, daß in der Ethik Kants das erstere, das Moment der Glückseligkeit, nur zweitrangige Bedeutung hat und daß ihr Ethos vielmehr im letzteren, im Erstreben der moralischen Vollkommenheit, liegt und die Glückseligkeit in diesem Leben lediglich als Zufriedenheit mit sich selbst (cf. 2.4.1) gestattet, die aus diesem Streben im unendlichen kontinuierlichen Progressus entsteht. (c) Kants Vorstellung der Unsterblichkeit der Seele ist vorreligiös. Daß nun Kants Vorstellung der Unsterblichkeit der Seele nur vorreligiös ist, beruht darauf, daß er in der Dimension der Moralität verharrt; dies hängt damit zusammen, daß bei ihm die Genese des moralischen Gesetzes nicht aus der Freiheit selber erklärt werden kann (sondern erst in bezug auf den Endzweck und die intelligible Welt; cf. 1.4.c, 3.1.1.b–d) und daß die ursprüngliche Freiheit der Willkür, nur von der Moralität her betrachtet, unerforschlich ist. Kants Beweis der Unsterblichkeit der Seele in der KpV ist nicht christlich.726 Ihre Vorstellung läßt sich vielmehr quasi als eine ewige zeitliche Wanderung über dieses Leben hinaus verstehen, in der der Rechtschaffene mit der Idee einer intel725 Rel., VI 67 Z25f <B86>, Vgl. dazu Mt 6, 33 und Lk 12, 31. Vgl. auch Refl. 6876, XIX 197 Z20, υ? (1776–78?). 726 Vgl. dazu Delekat, F., Immanuel Kant, Heidelberg 2 1966, S. 308: „Die Unsterblichkeit der Seele ist somit eine Fortsetzung der irdischen Existenz unter anderen Bedingungen. Der Vervollkommnungsprozeß der Persönlichkeit geht im Jenseits weiter. Das ist nicht christlich.“ 206 ligiblen Welt, die ihm im Herzen gegenwärtig ist, stetig fortschreitet.727 Sie kann somit zwar eine Vorbedingung der Religiosität, aber nicht diese selbst ausmachen und demnach als vorreligiös bezeichnet werden. Die Zeitlichkeit der unbegrenzten Existenz des Menschen steht mit der Idee einer künftigen Welt als einer intelligiblen, moralischen Welt im Widerspruch. Ein Grund dafür könnte darin liegen, daß Kant die Sache der Religion vom Standpunkt der Moralität aus betrachtet; von der Position der Religion selbst her gesehen würde sich selbst einem Menschen, der sich so sündhaft weiß, daß er sieht, er könne auf Erden ungeachtet seines Strebens kaum einen Progressus nach der Angemessenheit mit dem moralischen Gesetz leisten, eben wegen dieses tiefen Schuldbewußtseins ohne den Erfolg eines Progressus der Weg auf eine Errettung durch das Absolute eröffnen.728 Kant aber hält die eigene Kraftanwendung, die sich an das reine Denken der Moralität hält, für aktuell vorrangig gegenüber solcher Gnadenwirkung. Gerade diese Grundhaltung ermöglicht seine eigentümliche Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele. Das reine Denken im Sittlichen fordert von der empirischen Gesinnung deren ewige Anstrengung. Daß er bei der Begründung der gesamten Ethik mitsamt der Theologie überhaupt in der Dimension der Moralität verharrt, entspricht seiner Lehre vom Faktum der Vernunft, derzufolge das moralische Gesetz und sein Bewußtsein nicht weiter deduzierbar und hinterfragbar sind. Die Nicht-Hinterfragbarkeit des Gesetzes aber, wenn die dogmatische Betrachtungsweise vermieden werden soll, beruht darauf, daß er beim formalistischen Verfahren bereits mit dem Leitfaden des Begriffs der Notwendigkeit operiert und dadurch die Gesetzlichkeit de facto vorwegnimmt; die Vorwegnahme der Gesetzlichkeit hält den Versuch für unnötig, nach dem Sinn der aus dem Gesetz deduzierten negativen Freiheit in ihrer transzendental-subjektiven Sphäre weiter zu fragen, in der doch die Möglichkeit besteht, daß sowohl der Be727 R. Wimmer hebt den Vorrang der Realisierbarkeit des Ideals des vollendeten höchsten Guts vor der des Ideals der moralischen Vollkommenheit hervor und schlägt aus diesem Gesichtspunkt vor, die Postulierung der Unsterblichkeit der Seele durch die Explikation „von einem ,neuen‘ Leben des ganzen Menschen“ (Wimmer, R., Kants kritische Religionsphilosophie, Berlin 1990, S. 70) zu ersetzen. „Kant hätte, statt die Unsterblichkeit der menschlichen Seele zu postulieren, die in seinem Begriff vom höchsten Gut angelegten Momente der Leiblichkeit und der Gesellschaftlichkeit des ,neuen‘ Menschen lediglich zu explizieren brauchen“ (ibid., S. 71). Der Vorschlag, der mit dem, was Kant mit einer künftigen Welt meint, konform sein mag, läßt aber die Relevanz des realen Strebens der menschlichen Gesinnung nach moralischer Vollkommenheit im wirklichen Progressus in diesem Leben außer acht, aus der ja das Postulat der zeitlich unbegrenzten Existenz des Menschen notwendig abgeleitet wird. Die Hauptsache für einen Rechtschaffenen ist nicht die Glückseligkeit im Jenseits, sondern die moralische Vollkommenheit im Diesseits. Kant sagt: „Allgemein führen wir noch an: daß es ganz und gar nicht hier unserer Bestimmung gemäß ist, uns um die künftige Welt viel zu kümmern; sondern wir müssen den Kreis, zu dem wir hier bestimmt sind, vollenden, und abwarten, wie es in Ansehung der künftigen Welt sein wird. Die Hauptsache ist: daß wir uns auf diesem Posten rechtschaffen und sittlich gut verhalten, und uns des künftigen Glücks würdig zu machen suchen“ (Met.L/1, XXVIII 300f). 728 Zum Unterschied des Gnadenbegriffs Kants vom christlichen vgl. Noack, H., Die Religionsphilosophie im Gesamtwerk Kants, in: Kant, I., Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Hamburg 8 1978, S. XLIV–XLVI. Vgl. auch Delekat, F., op.cit., S. 258–261. Kant scheint die Position des ,praktischen Pietismus‘ (S. 261) eingenommen zu haben. 207 griff einer Gnade Gottes wie der Zusammenhang des Gesetzes (des reinen sittlichen Denkens) mit der Natur ursprünglicher erörtert werden könnten. Der Ausfall einer solchen Erörterung in der Umwendung der Freiheit bestimmt wesentlich die Kantische ,moralisch-teleologische‘ Architektonik der Ethik überhaupt, folglich auch seine moralische Teleologie und Ethikotheologie, welche durchaus in der Dimension der intellektuellen Moralität bestehen, so auch das Postulat der Unsterblichkeit. (d) Das Postulat der Unsterblichkeit der Seele und die unnachlaßliche Pflicht des Suizidverbots sind die Bedingung der Möglichkeit der Selbsterhaltung der reinen Vernunft sowie ihrer intellektuellen Ausdehnung. Beim Postulat der Unsterblichkeit nun beansprucht die Annahme des Daseins eines neuen Menschen auf intelligibler Ebene ein ewiges Leben desselben Menschen über dieses Leben hinaus, ebenso wie bei der Pflicht des Selbstmordverbots das Dasein des Menschen auf intelligibler Ebene die Fortsetzung seines Lebens in der Sinnenwelt fordert. Sowohl jenes Postulat als auch diese unnachlaßliche Pflicht stellen in der Sinnenwelt die Konditionen dafür dar, daß reine Vernunft sich selbst und ihre intellektuelle reine Ausdehnung der Moralität erhalten kann, während die Genese des Guten überhaupt zusammen mit der Annehmbarkeit des höchsten Guts als Selbstobjektivierung des reinen sittlichen Denkens und die unnachlaßliche Pflicht der Wahrhaftigkeit als Offenheit desselben Denkens die Struktur der zu erhaltenden intellektuellen Ausdehnung aus Vernunft charakterisieren, in der jede Willensbestimmung im Blick auf den Endzweck vollzogen wird. In der Selbsterhaltung der reinen Vernunft aber könnte man ein Prinzip der rationalisierten Selbstliebe sehen, die verhüllt ist und demnach die letzte, größte Hürde für die Ethik darstellen dürfte (cf. 3.2.3.a.β & 2.5.2); zu der Einsicht jedoch dieser möglichen Konsequenz aus seiner Theorie ist Kants Grundlegung der Ethik niemals gelangt. 3.4.2 Die Realisierbarkeit des vollendeten höchsten Guts durch das Streben nach der moralischen Vollkommenheit im unendlichen Progressus. Die bisher in der Lehre vom höchsten Gut festgestellten Grundzüge jener moralischpraktischen Zwecksetzung, auf der die moralische Teleologie beruht, finden in der kompletten Postulatenlehre, die jetzt auch das Postulat der Existenz Gottes inkludiert, ihre abermalige Bestätigung: (1) die Relevanz der Erweiterung des Gesetzes zum Endzweck als Geisteslage eines Rechtschaffenen; (2) die moralisch-praktische Zwecksetzung als der Versuch, die Trennung zwischen sinnlicher Natur und reinem sittlichen Denken praktisch-objektiv zu überwinden; (3) die Idee der intelligiblen Welt (des Reichs Gottes) als Grundlage für die moralisch-praktische Zwecksetzung und deren moralische Teleologie. 208 (a) Die Realisierbarkeit des ganzen, vollendeten höchsten Guts. In der moralischen Geisteslage bestimmt das Gesetz (das reine sittliche Denken) die gesamte Materie der Willensbestimmung. Daher nimmt es, mit Rücksicht auf die Realität der materiell durch sinnliche Natur mitbedingten Willkür eines endlichen Vernunftwesens, auch dessen Glückseligkeit als Materie seiner allgemeinen Bestimmung auf und stellt sie im Rahmen seiner unmittelbaren Selbstobjektivierung (Tugend) als Endzweck hin. Folglich wird die Realisierbarkeit des Begriffs der Glückseligkeit, als des Pauschalzwecks des Willens, a priori auf die Realisierbarkeit der Idee der Sittlichkeit bzw. der Heiligkeit als des obersten Guts verwiesen, die durch die Selbstobjektivierung des reinen sittlichen Denkens unmittelbar zum Zweck gemacht wird. Dadurch wird das ganze, vollendete höchste Gut als Gegenstand der sich intellektuell erweiternden reinen praktischen Vernunft entworfen.729 Bei der Realisierung dieses ganzen vollendeten höchsten Guts wird die Möglichkeit, daß die Begierde nach Glückseligkeit die Maxime der Tugend bestimme, a limine ausgeschlossen.730 Dieser Ausschluß ist bereits mit jener Annahme der beiden Momente des höchsten Guts vollzogen, die ja die Bestimmung der Glückseligkeit durch Sittlichkeit voraussetzt. Er findet aber auch schon ursprünglich in der formalistischen Grundlegung der Ethik (cf. 1.) statt, die nachgewiesen hat, daß die Begierde nach Glückseligkeit, die auf der pathologisch-praktischen Lust beruht, wohl eine Klugheitsregel, jedoch keine objektiv-gültige Gesetzlichkeit a priori für die Moralität und mithin für die Maxime der Tugend liefern kann. (b) Kants Ansicht, daß die Unausführbarkeit des höchsten Guts die Falschheit des Gesetzes beweisen würde, und daß moralische Gesetze ohne die Postulate leere Hirngespinste wären, bestätigt die Relevanz der intentionalen Erweiterung des Gesetzes zum Endzweck; Cohens Ablehnung. Da nun das Gesetz gebietet, das höchste Gut zu fördern, d.h. da die Förderung desselben in der intentionalen Erweiterung des Gesetzes (cf. 3.4.0.6) „ein a priori notwendiges Objekt unseres Willens“ ist, so würde die Unausführbarkeit (Unrealisierbarkeit) des höchsten Guts auch die „Falschheit“ des Gesetzes beweisen müssen; dieses würde in diesem Fall „phantastisch und auf leere eingebildete Zwecke gestellt, mithin an sich falsch sein“ müssen.731 In der Erweiterung des moralischen Gesetzes, der die aus diesem als reinem sittlichen Denken rekrutierte praktische Realität zukommt, versteht sich von selbst, daß das höchste Gut, das zur Erweiterung des Gesetzes gehört, so unbedingt ausführbar sein muß, daß andernfalls dieses Gesetz, das sich in seiner praktischen Realität zum höchsten Gut notwendig erweitert, für falsch genommen werden müßte. Diese Erweiterung des Gesetzes kann als 729 Vgl. zum obersten (supremum) und vollendeten (consummatum) Gut KpV, V 110 Z12 – 111 Z5 <A198f>. 730 Vgl. KpV, V 113 Z26–29 <A204>(„wie in der Analytik bewiesen worden“), 114 Z27–29 <A206>. 731 KpV, V 114 Z1–9 <A205>. Kant ist dieser Ansicht nicht nur in der KpV, sondern auch in anderen Schriften. Vgl. dazu z.B. Rel., VI 62 Z15–20 <B76f>. 209 Geisteslage eines Rechtschaffenen zum Endzweck, d.h. als Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens zwischen Freiheit und Endzweck, genommen werden, der die aus dem Gesetz rekrutierte praktische Realität zukommt. In dieser Ausdehnung der praktischen Realität können weder das Gesetz noch der Endzweck falsch sein. Sie müssen deshalb praktisch durchführbar sein. Die Geisteslage des Rechtschaffenen, erstreckt zum Endzweck, stellt das Ethos der ganzen Kantischen Ethik dar. Ohne die Weltbezogenheit, in der auch das höchste Gut zur Realisierung bestimmt wird, wäre moralisches Gesetz ein Unding. Die Leugnung der Realisierbarkeit – und nicht des Realisiertseins – des höchsten Guts würde das Ethos der Kantischen Ethik, die Geisteslage zum Endzweck bzw. die Erweiterung des faktischen Gesetzes zum höchsten Gut und die darin geltende praktische Realität des Gesetzes in Frage stellen müssen. H. Cohen aber, der sein Augenmerk auf den Ursprung der Moralität richtet und ihre Folge, d.i. die andere Hälfte der Kantischen Moralphilosophie weitestgehend außer acht läßt, stellt diese der letzteren wesentliche Ansicht in Abrede: „Das ist die Schädigung, mit welcher die selbständige Gewißheit des Sittengesetzes durch die Komplikation mit dem höchsten Gute beeinträchtigt wird.“732 Nun werden aus der unbedingt notwendigen Realisierbarkeit des höchsten Guts die Existenz Gottes und das Leben in einer künftigen Welt intellektuell abgeleitet und ihretwegen postuliert. Würde diese Postulierung als unmöglich ausgeschlossen, so müßte die Vernunft auch „die moralischen Gesetze als leere Hirngespinste“733 , könnte sie also auch nicht als moralische Triebfedern (cf. 2.7.2) ansehen, weil ohne diese Postulierung das in der Erweiterung aus den Gesetzen entworfene und demnach sie in sich enthaltende höchste Gut unmöglich werden müßte. Auch Kants Ausdruck „leere Hirngespinste“ weist Cohen aus seiner Sicht konsequent als „mit den Grundgedanken durchaus unvereinbare Wendung“ zurück.734 Seine Ablehnung aber hat ihren Grund. Denn die Formulierung, die Unausführbarkeit des höchsten Guts und mithin die Unmöglichkeit der Postulate müßten die Falschheit des Gesetzes beweisen, kann leicht auf den vereinfachten Ausdruck: „ohne Gott kein Gesetz“ hinauslaufen. Um dieses Mißverständnis zu verhüten, ist deshalb stets auf die Differenzierung der Grundlegung der Ethik in zwei Phasen hinsichtlich des Gesetzes zu achten, in der es unter kognitivem Aspekt an seinem Ursprung zunächst nur die negative Freiheit zugrundeliegen hat, unter essentiellem Aspekt aber für seine Folge als den ausführbaren Endzweck notwendig das Dasein Gottes als die oberste Weltursache postuliert. Nur sofern unter dem ersteren Aspekt das Gesetz aus der negativen Freiheit, die unerforschlich ist, als Faktum angenommen wird, insofern kann und muß es auch unter dem letzteren Aspekt das Dasein Gottes postulieren und dabei auch sich selbst als Gottes Gebot verstehen. Dabei wird als Grundlage seiner Erweiterung (Ausdehnung) zum Endzweck auch die Idee der intelligiblen Welt bzw. des Reichs Gottes angenommen. Erst diese aus732 Cohen, H., Kants Begründung der Ethik, S. 354f. KrV, III 526 Z36f <B839>. Vgl. auch Refl. 6958, XIX 214, υ? (1776–78?): „[D]enn sonst hätte die moralische Idee keine Realität in der Erwartung und wäre ein bloß vernünftelnder Begriff.“ 734 Cohen, H., op.cit., S. 355. 733 210 gewogene Auffassung, die beide Phasen in der Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens als feldtheoretischer Struktur zusammenfaßt und die nicht dem Gesetz allein, sondern seiner Erweiterung im ganzen, d.i. dieser Ausdehnung, Gewicht beilegt, macht den Cohenschen Einwurf gegen Kant unnötig. (Cf. 3.3.2.a–b). (c) Die Postulatenlehre steht für den Versuch ein, die Trennung zwischen sinnlicher Natur und reinem sittlichen Denken, die bei der kognitiven, formalistischen Phase der Grundlegung der Ethik entsteht, in der ,moralisch-teleologischen‘ architektonischen Phase derselben praktisch-objektiv zu überwinden. Die spezifizierende Differenzierung des höchsten Guts in Sittlichkeit und Glückseligkeit basiert auf der Trennung von sinnlicher Natur und reinem sittlichen Denken (Moralgesetz). Diese Trennung ist schon da, wenn das Gesetz kognitiv als Faktum der Vernunft angenommen wird. Dementsprechend bietet die Postulatenlehre, die sich um das Dasein Gottes dreht, d.h. um die Realisierbarkeit (Ausführbarkeit) des vollendeten höchsten Guts als synthetische Verbindung seiner unterschiedenen Momente, nämlich der Sittlichkeit und Glückseligkeit (weil eine analytische Ableitung der einen aus der anderen bei Kant für nicht ausführbar gehalten wird735 ), die letztmögliche Chance, diese Trennung zwischen Natur und Denken auf dem Wege der moralisch-praktischen Zwecksetzung mittels des unendlichen Strebens des menschlichen Willens nach dem ersteren Moment des höchsten Guts, nämlich der Idee der moralischen Vollkommenheit der Gesinnung, die vom Gesetz unmittelbar als vorrangiges Ziel gefordert wird, aufzuheben und somit auch theoretische und praktische Vernunft, die nur hinsichtlich ihres Gebrauchs voneinander verschieden sind, unter dem Primat der letzteren wieder zu vereinheitlichen, indem die Postulate als praktisch objektivierte Garanten für die Realisierbarkeit des vollendeten höchsten Guts einstehen. Die Möglichkeit der Aufhebung der Trennung findet sich bei Kant erst in der objektivierten Dimension des reinen sittlichen Denkens, und nicht im durch die kognitiv-formalistischen Grundlegung erörterten Ursprung desselben, der als ein bloßer Standpunkt außer der Sinnenwelt erkenntniskritisch unerklärbar ist. (Cf. 3.3.1.f). (d) Die notwendigen Bedingungen der Realisierbarkeit des vollendeten Guts: übersinnliche Tugendgesinnung und Gott; das vollendete Gut als die objektivierte intelligible Welt (das Reich Gottes). Zur Realisierbarkeit nun der Idee des vollendeten Guts, d.i. zur notwendigen Hervorbringung der wahren Glückseligkeit durch die Tugendgesinnung, werden zwei Hilfsbedingungen erfordert. (1) Sollte die Tugendgesinnung als die bloße Form der empirischen Kausalität in der Sinnenwelt betrachtet werden, so würde sie die Glückseligkeit als Zustand der physischen Zufriedenheit eines endlichen Vernunftwesens in der Welt wohl zufällig, aber nicht notwendig hervorbringen können. Sie 735 Vgl. dazu sowie zu seiner diesbezüglichen Auseinandersetzung mit Stoa und Epikureismus KpV, V 111–113 <A199–204>. 211 ist aber, wie oben gesehen (cf. 3.4.1.b), als übersinnlich und zugleich auch derart anzunehmen, daß ihr als solcher die empirische Tat des nach moralischer Verbesserung strebenden Menschen in der Sinnenwelt, dem sie als übersinnliche innewohnt, genau entsprechen kann. Durch die Annahme der Übersinnlichkeit der Tugendgesinnung wird die Möglichkeit eröffnet, daß sie in ihrem intelligiblen Status eine notwendige, zumindest mittelbare, kausale Beziehung apriori auf die Glückseligkeit auf empirischer Ebene736 haben kann.737 (2) Da das moralische Gesetz, wie in der formalistischen Grundlegung des Grundsätze-Kapitels der KpV erwiesen, als ein Gesetz der Freiheit von der negativen Freiheit als Unabhängigkeit von Naturursachen herrührt, so kann die intelligible Tugendgesinnung als Angemessenheit mit ihm nicht unmittelbar und alleine die zum Naturverlauf gehörende Glückseligkeit auf empirischer Ebene hervorbringen.738 Das Gesetz indes gebietet, das vollendete Gut zu realisieren.739 Gesetz und Natur sind voneinander getrennt, und es muß eine Brücke vom ersteren zur letzteren geschlagen werden. Also wird unvermeidlich das Dasein einer obersten Weltursache postuliert, die die übersinnliche Tugendgesinnung, die für sich allein keine Glückseligkeit auf der empirischen Ebene hervorbringen kann, mit derselben kausal zu verbinden vermag.740 Der fundamentale Dualismus von Gesetz und Natur in der Kantischen Moralphilosophie kann erst in der ,moralisch-teleologischen‘ architektonischen Grundlegung durch die Einführung des Daseins Gottes überwunden werden. Da nun sowohl die übersinnliche Tugendgesinnung als auch das Dasein Gotauf der intelligiblen Ebene eingeräumt werden, so kann mit der Festhaltung beider Bedingungen für die Realisierbarkeit des vollendeten Guts auch die Annahme der intelligiblen Welt (Reich Gottes) gerechtfertigt werden.742 Sie ist ohnehin schon so gedacht, daß sie dem moralischen Gesetz als exekutiver Grund seiner Verbindlichkeit zugrundeliegt,743 und ist bereits – aber latent – als Hintergrund der reites741 736 Im Hinblick auf die Realisierbarkeit des höchsten Guts als Verbindung von Sittlichkeit mit Glückseligkeit macht Kant hauptsächlich die letztere auf der empirischen Ebene bzw. in der Sinnenwelt zum Gegenstand seiner Analyse. Die Glückseligkeit im Jenseits nämlich kann nicht Gegenstand einer sachlichen Analyse sein. Im Begriff des höchsten Guts ist bei Kant demzufolge immer das sinnliche Element berücksichtigt. Vgl. hierzu Refl. 6876, XIX 189 Z5–7, υ (1776–78). 737 Vgl. KpV, V 114 Z29 – 115 Z8 <A206f>. 738 Vgl. KpV, V 124 Z25 – 125 Z1 <A224f>. 739 Vgl. KpV, V 125 Z1–4 <A225>. Vgl. auch z.B. KpV, V 129 Z30–32 <A238>, 122 Z4f <A219>, V 124 Z17–19 <A224>, 134 Z17f <A242>, 142 Z18–21, Z25–27 <A257>etc. 740 Vgl. KpV, V 125 Z4–22 <A225f>; V 115 Z4 <A207>: „vermittelst eines intelligibelen Urhebers der Natur“. Kant versucht das Postulat des Daseins Gottes auch aus dem gemeinschaftlichen Grund zu deduzieren. Dabei ist die Leitidee der Deduktion wiederum die Idee vom Reich Gottes. Vgl. dazu Rel., VI 97 Z17 – 98 Z12 <B135f>. 741 Vgl. dazu KpV, V 132 Z26–29 <A239>. 742 Der Begriff der intelligiblen Welt wird durch die Forderung der Realisierbarkeit des höchsten Guts in Form der Aufhebung der Antinomie der praktischen Vernunft, ebenso wie der Möglichkeit der Auflösung der Dritten Antinomie der KrV, notwendig eingeführt. Vgl. dazu KpV, V 115 Z21 <A207>, 114 Z35 <A206>, aber auch V 107f <A193>. 743 Vgl. dazu den 3. Abschnitt der GMS (cf. 2.8), aber auch KpV, V 46 Z5–12 <A79>, 94 Z14–19 <A168>. 212 nen intellektuellen Erweiterung des moralischen Gesetzes regulativ antizipiert.744 Diese Rechtfertigung aber bedeutet: Neben den Ideen von Gott und Unsterblichkeit erlangt auch die Idee der intelligiblen Welt statt der Idee der Freiheit, deren Realität bereits durch die formalistische Deduktion in der Analytik der KpV erwiesen ist und die schon die intelligible Welt eröffnet hat, den Status jener drei Vernunftideen, die in bezug auf das höchste Gut praktische Realität für sich gewinnen, wobei sie mit dem Reich Gottes identifiziert wird.745 Daher läßt sich die ganze Argumentation für die Annehmbarkeit des höchsten Guts, die oben (cf. 3.3) ausgeführt wurde, auch als Beweisführung zur praktischen Realität der Idee einer intelligiblen Welt als des Reichs Gottes begreifen. Kants Grundlegung der Ethik läßt sich demnach als eine Orts- bzw. Welttheorie interpretieren, der die negative Freiheit zugrundeliegt und deren konstitutive Bedingungen die übersinnliche Tugendgesinnung des einzelnen Vernunftwesens und das Dasein Gottes sind. 3.5 Die moralische Glückseligkeit beim kontinuierlichen Progressus zur moralischen Vollkommenheit und die physische Glückseligkeit im Begriff des höchsten Guts. In den Spätwerken der Kantischen Ethik treten zwei Arten der Glückseligkeit auf, nämlich die moralische und die physische.746 Kants Ethik, die zwar nicht Glückseligkeitsethik ist, ist gleichwohl, wie oben betrachtet, wesentlich auch durch den Anspruch des Menschen auf Glückseligkeit bestimmt. (a) Die moralische Glückseligkeit als Selbstzufriedenheit ist für den Progressus zur moralischen Vollkommenheit in diesem Leben real. Bei der moralischen Glückseligkeit handelt es sich um die Zufriedenheit mit der eigenen Person und ihrem sittlichen Verhalten, demnach mit dem, was man tut, die im immerwährenden Fortschritt der Gesinnung eines Rechtschaffenen durch die Steigerung der eigenen moralischen Vollkommenheit generiert wird, mit einem Wort um die Zufriedenheit mit sich selbst (cf. 2.5 und 2.6); sie ist Tugendlohn und Seelenruhe (nicht mehr durch Neigungen belästigt und herumgetrieben) trotz aller Leiden und Übel des Lebens und wird als moralische Lust neben dem Gefühl der Achtung zum moralischen Gefühl gezählt; sie kann aber nicht die primäre moralische Triebfeder sein, weil sie nur auf die Vorstellung des Gesetzes folgt.747 744 Vgl. als darauf hinweisende Stellen, KpV, V 50 Z18–29 <A87f>, 86 Z34 – 87 Z12 <A154f>, 105 Z19 <A188>. 745 Vgl. KpV, V 137 Z1f <A246>. 746 Vgl. zu beiden Arten der Glückseligkeit Rel., VI 67 <B86>, 75 Anm. <B100>; MS, VI 387. 747 Zur moralischen Glückseligkeit vgl. Rel., VI 67 <B86>, 75 Anm. <B100>; V.e.vorn.Ton, VIII 395 Anm.; MS, VI 377f, 387, 399 Z25–27; Refl. 7311, XIX 309, ψ? ϕ? τ? (1780–89? 1776–78? 1775–76?): „Glückseligkeit ist das Bewußtsein einer immerwährenden Zufriedenheit mit seinem Zustand. Nun kann man durch die Tugend an sich glückselig sein, wenn man das physische seines Zustandes für gleichgültig hält und im Bewußtsein seines moralischen Zustandes, sofern er ein 213 Der neue Mensch, der durch ,eine einzige unwandelbare Entschließung‘ (Wiedergeburt) sich intelligibel im Zustand der Sinnesänderung (Revolution in der Gesinnung) und empirisch im kontinuierlichen Werden zum Ideal der moralischen Vollkommenheit (allmähliche Reform) befindet, nimmt alle Leiden und Übel des Lebens „als so viel Anlässe der Prüfung und Übung seiner Gesinnung zum Guten willig auf“; aus dieser Grundhaltung des neuen Menschen zum Leben entspringt die Zufriedenheit, d.i. die moralische Glückseligkeit, „welche im Bewußtsein seines Fortschritts im Guten (...) besteht“.748 Das Fundiertsein des Progressus des Rechtschaffenen in der beständigen Ausdehnung des reinen sittlichen Denkens aus der Freiheit auf den Endzweck als die moralische Vollkommenheit und die aus dieser zu erhoffende Glückseligkeit im Jenseits bringt ihm Zufriedenheit mit sich selbst und Seelenruhe (Trost und Hoffnung) bei allen empirischen Lebensschwierigkeiten und selbst bei kummervollstem Leben (die intellektuelle Versicherung).749 Empirisch aber kann das Vertrauen zu diesem Fundiertsein „aus der Vergleichung seines bisher geführten Lebenswandels mit seinem gefaßtem Vorsatze“750 bestätigt werden (die empirische Versicherung). Unter der moralischen Glückseligkeit wird diese intellektuelle und zugleich empirische Versicherung „von der Wirklichkeit und Beharrlichkeit einer im Guten immer fortrückenden (nie daraus fallenden) Gesinnung“751 verstanden. Diese für den kontinuierlichen Progressus der Gesinnung eines Rechtschaffenen in diesem Leben reale moralische Glückseligkeit als Selbstzufriedenheit bei allem Leid und Übel wird in der KpV lediglich als „Analogon der Glückseligkeit“ bezeichnet, weil der Name Glückseligkeit bereits für die physische Glückseligkeit und somit für eines der beiden Elemente des höchsten Guts verwendet ist. Sie ist jedoch darum nicht, wie K. Düsing meint, „systematisch bedeutungslos“,752 sondern in der Systematik der ,moralischteleologischen‘ Progression des realen Progressus bei allen Lebensschwierigkeiten einzigartig relevant. Der reale unendliche Progressus der Gesinnung eines endlichen Vernunftwesens nach dem Ideal der moralischen Vollkommenheit stellt einen der zentralen Begriffe im Ethos der Kantischen Ethik dar. Er würde, sachlich gesehen, in der theoretischen Philosophie Kants dem Fortgang der Verstandessynthesis immerwährender Fortschritt zum bessern ist, den ganzen Wert seines Daseins setzt.“ 748 Rel., VI 75 Anm. <B100>. 749 Vgl. dazu Religionslehre Pölitz, XXVIII 1090: „Das menschliche Glück ist nicht Besitz, sondern Fortschritt zur Glückseligkeit. Aber volle Selbstzufriedenheit, trostvolles Bewußtsein der Rechtschaffenheit ist ein Gut, das uns nie geraubt werden kann, mag gleich unser äußerer Zustand von einer Beschaffenheit sein, von welcher er immer wolle. Und in der Tat wird doch alles Erdenglück bei weitem durch den Gedanken überwogen, daß wir, als moralisch gute Menschen, uns einer künftigen ununterbrochenen Glückseligkeit würdig gemacht haben! Zwar wird uns diese innere Lust an unserer eigenen Person [sc. die Selbstzufriedenheit] nie den Verlust eines äußern glücklichen Zustandes ersetzen, aber doch mit der Aussicht in die Zukunft, selbst bei dem kummervollsten Leben, aufrichten können.“ 750 Rel., VI 68 <B87>. 751 Rel., VI 67 <B86>. 752 Düsing, K., Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer Philosophie, in: Kant-Studien Bd. 62, 1971, S. 26. 214 in der Zeit753 entsprechen. Er ist der Sache nach Fortgang in absoluter Gegenwart754 schlechthin, aus dem das Gefühl der Zufriedenheit des Rechtschaffenen mit sich selbst entspringt. (b) Die physische Glückseligkeit ist für einen Rechtschaffenen erst in einer künftigen Welt zu erwarten. Unter der physischen Glückseligkeit, die sich aus der pathologischen Lust755 rekrutiert, wird „die Versicherung eines immerwährenden Besitzes der Zufriedenheit mit seinem physischen Zustand (Befreiung von Übeln und Genuß immer wachsender Vergnügen)“756 bzw. die Zufriedenheit „mit dem, was die Natur beschert, mithin was man als fremde Gabe genießt“,757 verstanden. Wenn Glückseligkeit als „die Lust an unserem gesamten Zustand“ gegenüber der „Lust an seiner eigenen Person“ bzw. „an seiner Freiheit“758 oder als „die Befriedigung aller unserer Neigungen“759 definiert wird, so hat man es dabei mit der physischen Glückseligkeit zu tun, die der geistigen Zufriedenheit mit sich selbst entgegengesetzt wird. Sie bezieht sich zunächst auf die obengenannte sinnliche, zufällige Glückseligkeit in Refl. 6907 (cf. 2.4.2), die dem Naturverlauf untergeordnet wird. Zuerst nämlich gelangt das pathologisch-praktische Gefühl der Lust und Unlust als Wesenselement solcher Glückseligkeit unter dem Prinzip der Selbstliebe zum Status der primären Bestimmungsbedingung der Willkür, worunter dann Erscheinungen, die gemäß der Naturkausalität entstehen, als empirische materiale Bestimmungsgründe jeweils die Willkür bestimmen. Der Begriff der Epigenesis der Glückseligkeit aus der Autokratie der Freiheit in Refl. 6867 (cf. 2.4.4) und mithin der des höchsten Guts besteht in der Absicht, die physische Glückseligkeit, die an sich wohl zufällig, aber nicht böse ist, durchs moralische Verhalten sicher und beständig, ja notwendig zu machen und somit in die wahre zu transformieren, wozu, ebenso wie bei der moralischen Glückseligkeit, die Überwindung der Selbstliebe, dementsprechend auf der Ebene der ethischen Grunderfahrung die Revolution in der Gesinnung (Gründung eines Charakters), auf der Ebene der ethischen Theorie aber die formalistische Grundlegung (Fundierung der Ethik in Gesetz und Freiheit) erfordert wird. Wegen dieser Herkunft aus der physischen Glückseligkeit sieht man an der Glückseligkeit im höchsten vollendeten Gut immer dasjenige, „was dem, der sie besitzt, zwar angenehm, aber Zum „Fortgang in der Zeit“ vgl. KrV, III 179 Z35 und 37 <B255>, 154 Z24f <B211>. Cf. Fußnote 169 in 1.2.4. 755 Zur pathologischen Lust vgl. V.e.vorn.Ton, VIII 395 Anm.; MS, VI 378: „Die Lust nämlich, welche vor der Befolgung des Gesetzes hergehen muß, damit diesem gemäß gehandelt werde, ist pathologisch, und das Verhalten folgt der Naturordnung“. Vgl. auch Refl. 7320 (cf. Fußnote 310 in 2.4.3). 756 Rel., VI 67 <B86>. 757 MS, VI 387. 758 Religionslehre Pölitz, XXVIII 1089. 759 KrV, III 523 <B834>. 753 754 215 nicht für sich allein schlechterdings und in aller Rücksicht gut ist“.760 Auch die Definition der Glückseligkeit761 in der Dialektik der KpV wird im Zusammenhang mit der moralisch-teleologischen Progression zum höchsten Gut angegeben, das in sich die physische Glückseligkeit impliziert. Daher wird bei der Analyse der Realisierbarkeit des vollendeten Guts als Verbindung der Sittlichkeit mit der Glückseligkeit in der Dialektik der KpV die in der Sinnenwelt angetroffene Glückseligkeit zu ihrem Gegenstand gemacht. Im Begriff der Seligkeit nun aber, an der man das unbedingt maximierte Bestandstück des höchsten Guts zu sehen hat, wird sowohl das Element der physischen Glückseligkeit762 als auch das der Selbstzufriedenheit berücksichtigt.763 Der physischen Glückseligkeit, die in der Sinnenwelt an sich nur zufällig und nicht sicher und beständig ist, kann der Rechtschaffene in diesem Erdenleben kaum teilhaftig werden, zumal er sie durch sein moralisches Verhalten und seine Rechtschaffenheit aufopfern muß, sondern er kann sie als das höchste Gut, d.h. als die Belohnung für seine Sittlichkeit, erst in einer künftigen Welt (im Reiche Gottes) erhoffen, während er doch die moralische Glückseligkeit als Zufriedenheit mit sich selbst aus seinem Wohlverhalten, obwohl sie nur negativ ist, schon in seinem kontinuierlichen Progressus zur moralischen Vollkommenheit im Erdenleben real erhalten kann.764 „Was aber die Glückseligkeit betrifft, die den andern Teil der unvermeidlichen menschlichen Wünsche ausmacht, so sagte er ihnen voraus: daß sie auf diese [sc. die Glückseligkeit] sich in ihrem Erdenleben keine Rechnung machen möchten. Er bereitete sie vielmehr vor, auf die größten Trübsale und Aufopferungen gefaßt zu sein; doch setzt er (weil eine gänzliche Verzichtung auf das Physische der Glückseligkeit dem Menschen, solange er existiert, nicht zugemutet werden kann) hinzu; ,Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl vergolten werden‘.“765 Dieser Ansicht nach Mt 5, 11f entspricht auch die 760 KpV, V 111 <A199>. Vgl. auch Refl. 6876, XIX 189, υ (1776–78): „Das höchste Gut enthält ein pathologisches (unmittelbar angenehm, aber nicht immer gut) und ein praktisch Gut.“ Cf. 3.3.2.a. 761 Vgl. KpV, V 124 Z21–25 <A224>. Kant steht auch einmal der moralischen Glückseligkeit und der Seligkeit erkenntnistheoretisch skeptisch gegenüber: „Von der bloß moralischen Glückseligkeit oder der Seligkeit verstehen wir nichts. Wenn alle Materialien, die die Sinne unserem Willen liefern, aufgehoben werden: wo bleiben da Rechtschaffenheit, Gütigkeit, Selbstbeherrschung, welche nur Formen sind, um alle diese Materialien in sich zu ordnen?“ (Refl. 6883, XIX 191, υ? 1776–78?). Die gute Gesinnung nämlich und ihre Eigenschaften als bloße Formen brauchen ihre Materie. Auch daraus ist ersichtlich, daß Kant einen theoretischen Grund hat, die physische Glückseligkeit nicht außer acht lassen zu können. 762 Vgl. dazu z.B. KpV, V 25 Z12–20. 763 (763) Vgl. dazu z.B. Religionslehre Pölitz, XXVIII 1089: “‘Erstreckt sich diese Selbstzufriedenheit auf unsere ganze Existenz; so heißt sie Seligkeit.“ 764 Vgl. dazu Bohatec, J., Die Religionsphilosophie Kants in der „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“, Hamburg 1938, S. 487: „Kann man daher die moralische Glückseligkeit schon in dieser Welt besitzen, wie man das Ideal des Gottesreiches vorwegnehmen darf als jenen innerlichen Besitz in diesem Äon, so ist die physische Glückseligkeit als Befreiung von den Übeln Gegenstand der Hoffnung und nur im Jenseits zu erwarten.“ Vgl. auch S. 479 und Anm. 73. 765 Rel., VI 134 <B203>. Vgl. auch Rel., VI 161 <B243>: „Was nun die dem Menschen sehr natürliche Erwartung eines dem sittlichen Verhalten des Menschen angemessenen Loses in Ansehung der Glückseligkeit betrifft, vornehmlich bei so manchen Aufopferungen der letzteren, die des ersteren 216 Exegese Kants zu Mt 6, 33 (Lk 12, 31), derzufolge „das beständige Trachten nach dem Reiche Gottes“ sich auf die moralische Glückseligkeit bezieht, während es die physische Glückseligkeit in einer künftigen Welt betrifft, „daß ihm das Übrige alles zufallen werde“.766 [sc. des sittlichen Verhaltens] wegen haben übernommen werden müssen, so verheißt er [sc. der Lehrer, der Stifter der ersten wahren Kirche] ([Matth.] V, 11. 12) dafür Belohnung einer künftigen Welt“; Met.L/1, XXVIII 289: „Da ich nun aber sehe, daß ich dieser Glückseligkeit, der ich mich würdig gemacht habe, in dieser Welt gar nicht teilhaftig werden kann, sondern sehr oft durch mein moralisches Verhalten und durch meine Rechtschaffenheit vieles meiner zeitlichen Glückseligkeit habe aufopfern müssen: so muß eine andere Welt sein, oder ein Zustand, wo das Wohlbefinden des Geschöpfs dem Wohlverhalten desselben adquat sein wird.“ 766 Rel., VI 67f <B86f>. 217 218 Literaturverzeichnis. I. Quellen. Kant, Immanuel: Kants Werke. Akademie-Textausgabe. Unveränderter photomechanischer Abdruck des Textes der von der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1902 begonnenen Ausgabe von Kants gesammelten Schriften. [Die erste Abteilung der AA: Druckschriften]. 9 Bde. mit 2 Anm.-Bänden. Berlin 1968/77. – : Briefwechsel. Auswahl und Anmerkungen von O. Schöndörffer. Mit einer Einleitung von R. Malter und J. Kopper und einem Nachtrag. Hamburg 2. Aufl. 1972. – : Kant’s gesammelte Schriften. Hrsg. v. der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (später: v. der Deutschen Akademie der Wissenschaften). [AA]. 3. Abteilung: Handschriftlicher Nachlaß; 4. Abteilung: Vorlesungen. Berlin 1911 ff. – : Eine Vorlesung über Ethik. Hrsg. v. Paul Menzer. Berlin 1924. – : Die philosophischen Hauptvorlesungen. Hrsg. v. Arnold Kowalewski. München 1924. – : Werke in sechs Bänden. Hrsg. v. Wilhelm Weischedel. Wiesbaden 1956. ND: Darmstadt 1983. – : Einzelausgaben bei Reclam und in der Philosophischen Bibliothek Meiner. – : Critik der practischen Vernunft. Riga 1788. – : Critik der Urtheilskraft. Berlin 2. Aufl. 1793. II. Hilfsmittel (Lexika, Konkordanz und Übersetzungen). Abbott, Thomas Kingsmill [Übers.]: Kant, I.: The Critique of Practical Reason. In: Great Books of the Western World. Bd. 42, Chicago 26 1984. 219 Amano, Teiyu [Übers.]: Kant, I.: Junsui-Risei-Hihan (jap.: Kritik der reinen Vernunft), Tokyo 1921/1931 (2 Bde.), 2. Aufl. 1933–37 (3 Bde.), Nachdruck Tokyo 1979 (4 Bde.). Eisler, Rudolf: Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften / Briefen und handschriftlichem Nachlaß. 2. Nachdruck Hildesheim 1969 (Orig.: Berlin 1930). Ellington, James W. [Übers.]: Kant, I.: Ethical Philosophy. The complete text of Grounding for the Metaphysical of Morals and Metaphysical Principles of Virtue (Part II of The Metaphysics of Morals). Indianapolis 1983. Greene, Theodore M. & Hudson, Hoyt H. [Übers.]: Kant, I.: Religion Within the Limits of Reason Alone. New York 1960 (früher Illinois 1934). Gregor, Mary [Übers.]: Kant, I.: The Metaphysics of Morals. Cambridge 1991. Hinske, Norbert u. Weischedel, Wilhelm [Hrsg.]: Kant-Seitenkonkordanz. Darmstadt 1970. Meredith, James Creed [Übers.]: Kant, I.: The Critique of Judgement. London 1980, 1. Aufl. 1928. Ratke, Heinrich: Systematisches Handlexikon zur Kritik der reinen Vernunft. Nachdruck Hamburg 1972, 1. Aufl. 1929. Schmid, Carl Christian Erhard: Wörterbuch zum leichtern Gebrauch der Kantischen Schriften. Darmstadt Nachdruck 1984, 2. Aufl. 1980, 1976, (Orig. Jena 4. Aufl. 1798). Utsunomiya, Yoshiaki [Übers.]: Kant, I.: Yakuchu Kanto „Dotoku-Keijijogaku no Kisozuke“ (Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“. Übersetzung ins Japanische mit laufendem Kommentar). Tokyo 1989. – : Kant, I.: Yakuchu Kanto „Jissen-Risei-Hihan“ (Kants „Kritik der praktischen Vernunft“. Übersetzung ins Japanische mit laufendem Kommentar). Tokyo 1990. III. Sekundärliteratur. Ackermann, Otto: Kant im Urteil Nietzsches. Tübingen 1939. Adickes, Erich: Korrekturen und Konjekturen zu Kants ethischen Schriften. In: Kant-Studien 5 (1901), S. 207–214. – : Kant als Mensch. Zu Kants hundertjährigem Todestag (12. Februar 1904): In: Deutsche Rundschau 118 (1904), S. 195–221. 220 – : Auf wem ruht Kants Geist? In: Archiv für Philosophie, II. Abteilung: Archiv für systematische Philosophie, Neue Folge X (1904), S. 1–19. – : Kant und das Ding an sich. Berlin 1924. – : Kants Geschichtsphilosophie. In: ders.: Kant als Naturforscher, Bd. II, Berlin 1925, S. 459–466. – : Kants Teleologie in der Kritik der Urteilskraft. In: ders.: Kant als Naturforscher, Bd. II, Berlin 1925, S. 466–482. – : Kants Lehre von der doppelten Affektion unseres Ich als Schlüssel zu seiner Erkenntnistheorie. Tübingen 1929. Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik. Frankfurt/M. 3. Aufl. 1982, 1. Aufl. 1975. Albrecht, Michael.: Kants Antinomie der praktischen Vernunft. Hildesheim 1978. Allison, Henry E.: Kant’s Concept of the Transcendental Object. In: KantStudien 59 (1968), S. 165–186. – : Practical and Transcendental Freedom in the Critique of Pure Reason. In: Kant-Studien 73 (1982), S. 271–290. Altmann, Amandus: Freiheit im Spiegel des rationalen Gesetzes bei Kant. Berlin 1982. Anderson, Georg: Die „Materie“ in Kants Tugendlehre und der Formalismus der kritischen Ethik. In: Kant-Studien 26 (1921), S. 289–311. – : Kants Metaphysik der Sitten – ihre Idee und ihr Verhältnis zur Ethik der Wolffschen Schule. In: Kant-Studien 28 (1923), S. 41–61. Angehrn, Emil: Der Begriff des Glücks und die Frage der Ethik. In: Philosophisches Jahrbuch, 92 (1985), S. 35–52. Antweiler, Anton: Der Zweck in Religion und Moral. Zu Kants „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“. In: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 4 (1957), S. 273–316. Aristoteles: Nikomachische Ethik. Übersetzt von F. Dirlmeier. Stuttgart 1990 (1.Aufl. 1969). – : Metaphysik. Griech.-dt., in der neubearb. Übers. von Hermann Bonitz, mit Einl. u. Kommentar hrsg. von Horst Seidl, griech. Text in der Ed. von Wilhelm Christ, Hamburg 1978 (Halbbd.1), 1980 (Halbbd.2). 221 Bartuschat, Wolfgang: Das Problem einer Formulierung des kategorischen Imperativs bei Kant. In: Gadamer, H.-G. [Hrsg.]: Das Problem der Sprache. München 1967, S. 229–235. Bauch, Bruno: Luther und Kant. Berlin 1904. – : Die Persönlichkeit Kants. In: Kant-Studien 9 (1904), S. 196–210. – : Schiller und die Idee der Freiheit. In: H. Vaihinger u. B. Bauch [Hrsg.]: Schiller als Philosoph und seine Beziehungen zu Kant. Festgabe der „Kantstudien“. Berlin 1905, S. 98–124. Bauer-Drevermann, Ingrid: Der Begriff der Zufälligkeit in der Kritik der Urteilskraft. In: Kant-Studien 56 (1965) S. 497–504. Baum, Manfred: Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie. Untersuchungen zur Kritik der reinen Vernunft. Königstein/Ts. 1986. Baumann, Julius: Wolffsche Begriffsbestimmungen. Ein Hilfsbüchlein beim Studium Kants. Leipzig 1910. Baumgarten, Alexander Gottlieb: Metaphysica. lat. Halle 1739, 4. Aufl. 1757 (Abgedruckt in Bd. XV u. Bd. XVII der AA). Deutsche Übersetzung (Metaphysik) von G. F. Meier, Halle 2. Aufl. 1783 besorgt von J. A. Eberhard. – : Initia Philosophiae Practicae Primae. Halle 1760 (Abgedruckt in Bd. XIX der AA). Baumgartner, Hans Michael: Kants „Kritik der reinen Vernunft“. Freiburg/München 1985. Beck, Lewis White: Das Faktum der Vernunft: Zur Rechtfertigungsproblematik in der Ethik. In: Kant-Studien 52 (1960/61), S. 271–282. – : A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason. Chicago 1960, 2. Aufl. 1966, (dt. übersetzt von K.-H. Ilting, Kants „Kritik der praktischen Vernunft“. Ein Kommentar. München 1974). – : Über die Regelmäßigkeit der Natur bei Kant. In: Dialectica 35 (1981), S. 43–56. Benedikt, Michael: Der philosophische Empirismus. Theorie. Wien 1977. – : Bestimmende und reflektierende Urteilskraft. Wien 1981. – : Kant und die materiale Wertethik im 20. Jahrhundert. In: Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich [Hrsg.]: Objektivationen des Geistigen. Beiträge zur Kulturphilosophie, in Gedanken an Walther Schmied-Kowarzik. Berlin 1985, S. 247– 268. 222 – : Naturtechnik und technische Urteilskraft. Zusammenverfaßt mit R. Kaspar. (Privatdruck). Wien 1986. Bittner, Rüdiger: Maximen. In: Funke, G. [Hrsg.]: Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses, Teil II Sektionen. Berlin 1974, S. 485–498. – : Kausalität aus Freiheit und kategorischer Imperativ. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 32 (1978), S. 265–274. Bittner, Rüdiger und Cramer, Konrad [Hrsg.]: Materialien zu Kants „Kritik der praktischen Vernunft“. Frankfurt/M. 1975. Blumenberg, Hans: Ist eine philosophische Ethik gegenwärtig möglich? In: Studium Generale 6 (1953), S. 174–184. Böckerstette, Heinrich: Aporien der Freiheit und ihre Aufklärung durch Kant. Stuttgart–Bad Cannstatt 1982. Bohatec, Josef: Die Religionsphilosophie Kants in der „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“. Hamburg 1938 (Nachdruck: Hildesheim 1966). Böhme, Gernot: Kants Theorie der Gegenstandskonstitution. In: Kant-Studien 73 (1982), S. 130–156, (Englische Fassung unter dem Titel „Towards a Reconstruction of Kant’s Epistemology and Theory ofScience“. In: The Philosophical Forum XIII, 1981, S. 75–102). Bollnow, Otto Friedrich: „ ... als allein ein guter Wille“. Zum Anfang der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Ritzel, W. [Hrsg.]: Rationalität – Phänomenalität – Individualität. Festgabe für Hermann und Marie Glockner. Bonn 1966, S. 165–174. Bommersheim, Paul: Der vierfache Sinn der inneren Zweckmäßigkeit in Kants Philosophie des Organischen. In: Kant-Studien 32 (1927), S. 290–309. Böversen, Fritz: Die Idee der Freiheit in der Philosophie Kants. Diss. Heidelberg 1962. Broecken, Renate: Das Amphiboliekapitel der „Kritik der reinen Vernunft“. Der Übergang der Reflexion von der Ontologie zur Transzendentalphilosophie. Köln 1970. Brugger, Walter: Kant und das höchste Gut. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 18 (1964), S. 50–61. Brunner, August: Kant und die Wirklichkeit des Geistigen. Eine Kritik der transzendentalen Methode. München 1978. 223 Bubner, Rüdiger: Zur Struktur eines transzendentalen Arguments. In: Funke, G. [Hrsg.]: Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses (1974), Teil I. Kant-Studien, Sonderheft (1974), S. 15–27. Buchdahl, Gerd: Transcendental Reduction: A concept for the interpretation of Kant’s critical method. In: Funke, G. [Hrsg.]: Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses (1974), Teil I. Kant-Studien, Sonderheft (1974), S. 28–44. Buchenau, Artur: Kants Lehre vom kategorischen Imperativ. Leipzig 1913. Cassirer, Ernst: Kants Leben und Lehre. Darmstadt 1977 (Orig. Berlin 1918, 2. Aufl. 1921). Cohen, Hermann: Kants Theorie der Erfahrung. Berlin 3. Aufl. 1918, 4. Aufl. 1924 (1. Aufl. 1871). – : Kants Begründung der Ethik nebst ihren Anwendungen auf Recht, Religion und Geschichte. Berlin 2. Aufl. 1910 (1. Aufl. 1877). Cramer, Konrad: Hypothetische Imperative? In: Riedel, M. [Hrsg.]: Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Bd. I. Freiburg/Br. 1972, S. 159–212. Delekat, Friedrich.: Das Verhältnis von Sitte und Recht in Kants großer „Metaphysik der Sitten“ (1797). In: Zeitschrift für philosophische Forschung 12 (1958), S. 59–86. – : Immanuel Kant. Historisch-kritische Interpretation der Hauptschriften. Heidelberg 2. Aufl. 1966 3. Aufl. 1969. Delius, Harald: Kategorischer Imperativ und individülles Gesetz. Bemerkungen zu G. Simmels Kritik der Kantischen Ethik. In: Argumentationen, Festschrift für J. König, Göttingen (1964), S. 67–74. Derbolav, J.: Freiheit und Naturordnung im Rahmen der Aristotelischen Ethik. Mit einem Ausblick auf Kant. In: Kant-Studien 57 (1966), S. 32–60. Descartes, René : Regulae ad directionem ingenii. Lat.-Dt., kritisch revidiert, übersetzt und herausgegeben von H. Springmeyer, L. Gäbe und H. G. Zekl. Hamburg 1973 (Nachdruck 1993). – : Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen. Nachdruck Hamburg 1994, Leipzig 1915, (lat./dt.: auf Grund d. Ausg. von Artur Buchenau neu hrsg. von Lüder Gäbe. Durchges. von Hans Günter Zekl. Hamburg 2. Aufl. 1977). Diemer, Alwin: Zum Problem des Materialen in der Ethik Kants. In: KantStudien 45 (1953/54), S. 21–32. 224 Döring, August: Kants Lehre vom höchsten Gut. In: Kant-Studien 4 (1900), S. 94–101. Dorner : Kants Kritik der Urteilskraft in ihrer Beziehung zu den beiden anderen Kritiken und zu den nachkantischen Systemen. In: Kant-Studien 4 (1900), S. 248–285. Driesch, Hans: Kant und das Ganze. In: Kant-Studien 29 (1924), S. 365–376. Düsing, Klaus.: Die Teleologie in Kants Weltbegriff. Bonn 1968. – : Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer Philosophie. In: Kant-Studien 62 (1971), S. 5–42. – : Objektive und subjektive Zeit. Untersuchungen zu Kants Zeittheorie und zu ihrer modernen kritischen Rezeption. In: Kant-Studien 71 (1980), S. 1– 34. Ebbinghaus, Julius: Kantinterpretation und Kantkritik. In: Deutsche Vierteljahrsschrift 2 (1924) S. 80–115. – : Kants Lehre von der Anschauung a priori. In: G. Prauss [Hrsg.]: Kant. Köln 1973, S. 44–61, (zuerst in: Zeitschrift für deutsche Kulturphilosophie 10, 1944, S. 169–186). – : Deutung und Mißdeutung des kategorischen Imperativs. In: Studium Generale 1 (1947/48) S. 411–419, (jetzt in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 1. Bonn 1986). – : Der Begriff des Rechtes und die naturrechtliche Tradition. In: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 1: Praktische Philosophie 1929–1954, Bonn 1968, S. 337–348, (zuerst in: Studium Generale 4, 1951) – : Kant und das 20. Jahrhundert. In: Studium Generale 7 (1954), S. 513– 524. – : Kant’s Ableitung des Verbotes der Lüge aus dem Rechte der Menschheit. In: Geismann, G. u. Oberer, H. [Hrsg.]: Kant und das Recht der Lüge. Würzburg 1986, S. 75–84, (zuerst in: Revue Internationale de Philosophie 30, 1954, S. 409–422). – : Die Formeln des kategorischen Imperativs und die Ableitung inhaltlich bestimmter Pflichten. In: G. Prauss [Hrsg.]: Kant, Köln 1973, S. 274–291, (zuerst in: Studie e Ricerche di Storia della Filosofia 32, 1959). – : Kants Rechtslehre und die Rechtsphilosophie des Neukantianismus. In: G. Prauss [Hrsg.]: Kant. Köln 1973, S. 322–336, (zuerst in: Erkenntnis und Verantwortung. Festschrift für Theodor Litt. Düsseldorf 1960, S. 317–334). 225 Ebert, Theodor: Kants kategorischer Imperativ und die Kriterien gebotener, verbotener und freigestellter Handlungen. In: Kant-Studien 67 (1976), S. 570–583. Elsigan, Alfred: Zum Rigorismusproblem in der Kantischen Tugendlehre. In: Wiener Jahrbuch für Philosophie 10 (1977), S. 208–225. Fichte, Johann Gottlieb: Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftlehre (1798). Mit Einleitung von H. Verweyen. Hamburg 1995. Fischer, Norbert: Tugend und Glückseligkeit. Zu ihrem Verhältnis bei Aristoteles und Kant. In: Kant-Studien 74 (1983), S. 1–21. Fleischer, Margot: Das Problem der Begründung des kategorischen Imperativs bei Kant. In: Engelhardt, P. [Hrsg]: Sein und Ethos. Mainz 1963, S. 387– 404. – : Die Formeln des kategorischen Imperativs in Kants. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Archiv für Geschichte der Philosophie 46 (1964), S. 201–226. Foerster, Friedrich Wilhelm: Der Entwicklungsgang der Kantischen Ethik bis zur Kritik der reinen Vernunft. Diss. Berlin 1893. 75 S. – : Der Entwicklungsgang der Kantsichen Ethik bis zur Kritik der reinen Vernunft. Berlin 1893. 106 S. Forschner, Maximilian: Gesetz und Freiheit. Zum Problem der Autonomie bei I. Kant. München 1974. – : Kants Dilemma einer Metaphysik des Willens. In: Philosophische Rundschau 21 (1975), S. 117–129. – : Reine Morallehre und Anthropologie. Kritische Überlegungen zum Begriff eines a priori gültigen allgemeinen praktischen Gesetzes bei Kant. In: Kants Ethik heute (Neue Hefte für Philosophie 22, Göttingen 1983), S. 25– 44. – : Moralität und Glückseligkeit in Kants Reflexionen. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 42 (1988), S. 251–370. Frost, Walter: Kants Teleologie. In: Kant-Studien 11 (1906), S. 297–347. Funke, Gerhard: Von der Aktualität Kants. Bonn 1979. – : Kants Satz über die praktische Freiheit. In: Philosophia Naturalis 19 (1982), S. 40–52. Gehlen, Arnold: Über Kants Persönlichkeit. In: ders.: Theorie der Willensfreiheit und frühe philosophische Schriften. Neuwied 1965, S. 304–311. 226 Geismann, Georg u. Oberer, Hariolf [Hrsg.]: Kant und das Recht der Lüge. Würzburg 1986. Gerhardt, Volker: Handlung als Verhältnis von Ursache und Wirkung. Zur Entwicklung des Handlungsbegriffs bei Kant. In: Prauss, G. [Hrsg.]: Handlungstheorie und Transzendentalphilosophie. Frankfurt 1986, S. 98–131. Glasenapp, Helmuth von: Kant und die Religionen des Ostens. Mit 8 Abbildungen nach Kupferstichen aus zeitgenössischen Reisebeschreibungen. Kitzingen–Main 1954. Gross, Felix [Hrsg.]: Immanuel Kant. Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen. Die Biographien von L. E. Borowski, R. B. Jachmann und A. Ch. Wasianski. Nachdruck: Darmstadt 1980 (Orig. Berlin 1912). Guroult, Martial: Vom Kanon der Kritik der reinen Vernunft zur Kritik der praktischen Vernunft. In: Kant-Studien 54 (1963), S. 432–444. Gulyga, Arsenij: Immanuel Kant. Frankfurt/M. 1981 (russ. Moskau 1977). Halder, Alois: Immanuel Kant: Religion im Verhältnis von Grund und Abgrund. In: Halder, A., Kienzler, K. u. Möller, J. [Hrsg.]: Sein und Schein der Religion. Düsseldorf 1983, S. 16–38. Hartmann, Nicolai: Diesseits von Idealismus und Realismus. Ein Beitrag zur Scheidung des Geschichtlichen und Übegeschichtlichen in der kantischen Philosophie. In: ders.: Kleinere Schriften, Bd. 2. Berlin 1957, S. 278–322. Hegel, G. W. F: Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschaften. In: Jenaer Schriften 1801–1807, Bd. 2 der Werke, auf der Grundlage der Werke von 1832–1845, neu edierte Ausgabe von Eva Moldenhaür und Karl Markus Michel. Frankfurt/M. 1986, S. 434– 530, (früher: Theorie-Werkausgabe. Frankfurt/M. 1969–1971). – : Phänomenologie des Geistes. Hamburg 6. Aufl. 1952. – : Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 3 Bde. In: ders., Werke Bd. 18–20, Frankfurt/M. 1986, (früher: Theorie-Werkausgabe. Frankfurt/M. 1969–1971). Hegler, Alfred: Die Psychologie in Kants Ethik. Freiburg i. Br. 1891. Heidemann, Ingeborg: Spontaneität und Zeitlichkeit. Ein Problem der Kritik der reinen Vernunft. Köln 1958. – : Das Problem der Allgemeingültigkeit in der Ethik. In: Kant-Studien 52 (1960/61), S. 33–42, (Antrittsvorlesung an die Universität Bonn 1958). 227 Heimsoeth, Heinz: Studien zur Philosophie Immanuel Kants. Bd. 1: Köln 1956, Bonn 2. Aufl. 1971, Bd. 2: Bonn 1970. – : Kant und Platon. In: Kant-Studien 56 (1965), S. 349–372. – : Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. 4 Teile. Berlin 1966–71. – : Freiheit und Charakter. Nach den Kant-Reflexionen Nr. 5611 bis 5620. In: Prauss, G. [Hrsg.]: Kant. Köln 1973, S. 292–309, (zuerst in: Tradition und Kritik. Festschrift für Rudolf Zocher. Stuttgart-Bad Cannstatt 1967, S. 123– 144). Heine, Heinrich: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. In: ders.: Beiträge zur deutschen Ideologie. Frankfurt/M. u. a. 1971, S. 1–111. Heinrichs, Jürgen: Das Problem der Zeit in der praktischen Philosophie Kants. Bonn 1968. Heintel, Erich: Naturzweck und Wesensbegriff. In: ders.: Gesammelte Abhandlungen, Bd. 2. Zur Fundamentalphilosophie II. Stuttgart 1988, S. 67– 88. Heller, Josef: Kants Persönlichkeit und Leben. Versuch einer Charakteristik. Berlin 1924. Henrich, Dieter: Das Prinzip der Kantischen Ethik. In: Philosophische Rundschau 2 (1954/55), S. 20–38. – : Über die Einheit der Subjektivität. In: Philosophische Rundschau 3 (1955), S. 28–69. – : Hutcheson und Kant. In: Kant-Studien 49 (1957/58), S. 49–69. – : Ethik der Autonomie. In: ders.: Selbstverhältnisse. Stuttgart 1982, S. 1– 56, (früher: Das Problem der Grundlegung der Ethik bei Kant und im spekulativen Idealismus. In: Engelhardt, P. [Hrsg.]: Sein und Ethos, Mainz 1963, S. 350–386). – : Über Kants früheste Ethik. In: Kant-Studien 54 (1963), S. 404–431. – : Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft. In: G. Prauss [Hrsg.], Kant, Köln 1973, S. 223–254, (früher in: Die Gegenwart der Griechen im neüren Denken. Festschrift für Hans-Georg Gadamer. Tübingen 1960, S. 77–115). – : Die Beweisstruktur von Kants transzendentaler Deduktion. In: G. Prauss [Hrsg.], Kant. Köln 1973, S. 90–104. 228 – : Die Deduktion des Sittengesetzes. Über die Gründe der Dunkelheit des letzten Abschnittes von Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“. In: Denken im Schatten des Nihilismus, Festschrift für W. Weischedel. Darmstadt 1975, S. 55–112. – : Identität und Objektivität. Eine Untersuchung über Kants transzendentale Deduktion. Heidelberg 1976. Herrigel, Eugen: Die metaphysische Form. Eine Auseinandersetzung mit Kant. Tübingen 1929. Heubült, Willem: Die Gewissenslehre Kants in ihrer Endform von 1797. Bonn 1980. – : Gewissen bei Kant. In: Kant-Studien 71 (1980), S. 445–454. Hinske, Norbert: Kants Begriff der Antinomie und die Etappen seiner Ausarbeitung. In: Kant-Studien 56 (1965), S. 485–496. – : Die historischen Vorlagen der Kantischen Transzendentalphilosophie. In: Archiv für Begriffsgeschichte 12 (1968), S. 86–113. – : Artikel „Kant, Immanuel“. In: Neue Deutsche Biographie, Bd. 11, Berlin 1977, S. 110–125. – : Kant als Herausforderung an die Gegenwart. Freiburg/München 1980. Höffding, Harald: Rousseaus Einfluß auf die definitive Form der Kantischen Ethik. In: Kant-Studien 2 (1898), S. 11–21. Höffe, Otfried: Kants kategorischer Imperativ als Kriterium des Sittlichen. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 31 (1977), S. 354–384. – : Transzendentale oder Vernunftkritische Ethik (Kant)? Zur Methodenkomplexität einer sachgerechten Moralphilosophie. In: Dialectica 35 (1981), S. 195–221. – : Immanuel Kant. München 1983. Horkheimer, Max: Über Kants „Kritik der Urteilskraft“ als Bindeglied zwischen theoretischer und praktischer Philosophie (1925). In: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 2. Frankfurt/M. 1987, S. 75–146. Ilting, Karl-Heinz: Der naturalistische Fehlschluß bei Kant. In: M. Riedel [Hrsg.]: Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Bd. I. Freiburg i. Br. 1972, S. 113–130. Jansen, Bemhard: Die Religionsphilosophie Kants. Geschichtlich dargestellt und kritisch-systematisch gewürdigt. Berlin 1929. 229 Jaspers, Karl: Das Radikal Böse bei Kant. In: Über Bedingungen und Möglichkeiten eines neuen Humanismus. Stuttgart 1970, S. 53–81. – : Kant. Leben, Werk, Wirkung. München 2. Aufl. 1983, 1975, (auch in: ders.: Die großen Philosophen, Bd. 1. München 1981, S. 397–616). Kadowaki, Takuji: Das Faktum der reinen praktischen Vernunft. In: KantStudien 56 (1965), S. 385–395. Kaftan, Julius: Kant. Der Philosoph des Protestantismus, Rede (gehalten bei der vom Berliner Zweigverein des evangelischen Bundes veranstalteten Gedächtnisfeier am 12. Februar 1904), Berlin 1904. Kaulbach, Friedrich: Der Zusammenhang zwischen Naturphilosophie und Geschichtsphilosophie bei Kant. In: Kant-Studien 56 (1965), S. 430–451. – : Immanuel Kant. Berlin 2. Aufl. 1982,1969. – : Theorie und Praxis in der Philosophie Kants. In: Philosophische Perspektiven 2 (1970), S. 168–185. – : Der Begriff der Freiheit in Kants Rechtsphilosophie. In: Philosophische Perspektiven 5 (1973), S. 78–91. – :Der Herrschaftsanspruch der Vernunft in Recht und Moral bei Kant. In: Kant-Studien 67 (1976), S. 390–408. – : Die Dialektik von Vernunft und Natur bei Kant. In: Wiener Jahrbuch für Philosophie 10 (1977), S. 51–72. – : Das Prinzip Handlung in der Philosophie Kants. Berlin 1978. – : Immanuel Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“. Interpretation und Kommentar. Darmstadt 1988. Kersting, Wolfgang: Neuere Interpretationen der Kantischen Rechtsphilosophie. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 37 (1983), S. 282–298. – : Der kategorische Imperativ, die vollkommenen und die unvollkommenen Pflichten. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 37 (1983), S. 404– 421. Kim, Chin-Tai: Kant’s „Supreme Principle of Morality“. In: Kant-Studien 59 (1968), S. 296–308. Klein, Hans-Dieter: Formale und materiale Prinzipien in Kants Ethik. In: Kant-Studien 60 (1969), S. 183–197. Knittermeyer, Hinrich: Immanuel Kant. Bremen 1939. 230 Kohlschmidt, Otto: Kants Stellung zur Teleologie und Physicotheologie. Diss. Jena 1894. Konhardt, Klaus: Die Einheit der Vernunft. Zum Verhältnis von theoretischer und praktischer Vernunft in der Philosophie Immanuel Kants. Königstein/Ts. 1979. – : Faktum der Vernunft?. Zu Kants Frage nach dem „eigentlichen Selbst“ des Menschen, in: G. Prauss [Hrsg.]: Handlungstheorie und Transzendentalphilosophie. Frankfurt/M. 1986, S. 160–184. – : Die Unbegreiflichkeit der Freiheit. Überlegungen zu Kants Lehre vom Bösen. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 42 (1988), S. 397–416. Kopper, Joachim: Transzendentales und dialektisches Denken. Köln 1961 (Kantstudien Ergänzungshefte 80). Kopper, Joachim und Malter, Rudolf [Hrsg.]: Materialien zu Kants „Kritik der reinen Vernunft“. Frankfurt/M. 1975, 2. Aufl. 1980. Koppers, Rita: Zum Begriff des Bösen bei Kant. Pfaffenweiler 1986. Krämling, Gerhart: Das höchste Gut als mögliche Welt. Zum Zusammenhang von Kulturphilosophie und systematischer Architektonik bei I. Kant. In: Kant-Studien 77 (1986), S. 273–288. Kranz, Walther: Vorsokratische Denker. Auswahl aus dem Überlieferten, griechisch/deutsch. o. O. 4. Aufl. 1974 (1. Aufl. 1939). Krausser, P.: Über eine unvermerkte Doppelrolle des kategorischen Imperativs in Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Kant-Studien 59 (1968), S. 318–332. Krüger, Gerhard.: Philosophie und Moral in der Kantischen Kritik. Tübingen 1931, 2. Aufl. 1967. Kulenkampff, Jens [Hrsg.]: Materialien zu Kants „Kritik der Urteilskraft“. Frankfurt/M. 1974. Langthaler, Rudolf: Kants Ethik als „System der Zwecke“. Perspektiven einer modifizierten Idee der „moralischen Teleologie“ und Ethikotheologie. Berlin 1991. Lauener, Henri: Der systematische Stellenwert des Gefühls der Achtung in Kants Ethik. In: Dialectica 35 (1981), S. 243–264. Laupichler, Max: Die Grundzüge der materialen Ethik Kants. Berlin 1931. Lehmann, Gerhard: Beiträge zur Geschichte und Interpretation der Philosophie Kants. Berlin 1969. 231 Leibniz, Gottfried Wilhelm: Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie. Bd. 1. Übersetzt von A. Buchenau. Hamburg 3. Aufl. 1966 (1. Aufl. 1904). Lenfers, Dietmar: Kants Weg von der Teleologie zur Theologie. Interpretationen zu Kants Kritik der Urteilskraft. Köln1965. Lenk, Hans: Zu Kants Begriffen des transzendentalen und normativen Handelns. In: Prauss, G. [Hrsg.]: Handlungstheorie und Transzendentalphilosophie. Frankfurt 1986, S. 185–203. Levin, Michael E.: Kant’s Derivation of the Formula of Universal Law as an Ontological Argument. In: Kant-Studien 65 (1974), S. 50–66. Liebmann, Otto: Geist der Transscendentalphilosophie. In: ders.: Gedanken und Tatsachen. Bd. 2. Strassburg 1904, S. 1–90. Lindau, H.: Kant kein Deutscher? In: Kant-Studien 20 (1915), S. 447–448. Lippmann, Edmund O. von: Zu: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neür und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, ... der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.“. In: Kant-Studien 34 (1929), S. 258–261, u. 35 (1930), S. 409–410. Lotz, Johannes B.: Die transzendentale Methode in Kants „Kritik der reinen Vernunft“ und in der Scholastik. In: ders. [Hrsg.]: Kant und die Scholastik heute. Pullach b. München 1955, S. 35–108. – [Hrsg.]: Kant und die Scholastik heute. Pullach b. München 1955, S. 1–34. Lübbe, Hermann: Dezisionismus in der Moraltheorie Kants. In: ders.: Theorie und Entscheidung. Studien zum Primat der praktischen Vernunft. Freiburg 1971, S. 144–158. Luf, Gerhard: Die „Typik der reinen praktischen Urteilskraft“ und ihre Anwendung auf Kants Rechtslehre. In: Wiener Jahrbuch für Philosophie 8 (1975), S. 54–71. Lütterfelds, Wilhelm: Kants Dialektik der Erfahrung. Zur antinomischen Struktur der endlichen Erkenntnis. Meisenheim am Glan 1977. Mahnke, Dietrich: Die Rationalisierung der Mystik bei Leibniz und Kant. In: Blätter für Deutsche Philosophie 13 (1939/40), S. 1–73. Maier, Anneliese: Kants Qualitätskategorien. Berlin 1930. Malcher, Martin: Der Logos und die Zeit. Das Grundproblem der transzendentalen Reflexion. In: Kant-Studien 73 (1982), S. 208–237. 232 Malter, Rudolf: Reflexionsbegriffe. Gedanken zu einer schwierigen Begriffsgattung und zu einem unausgeführten Lehrstück der Kritik der reinen Vernunft. In: Philosophia Naturalis 19 (1982), S. 125–150. Marc-Wogau, Konrad: Vier Studien zu Kants Kritik der Urteilskraft. Upsala/Leipzig 1938. Marcus, Ernst: Der kategorische Imperativ. Eine gemeinverständliche Einführung in Kants Sittenlehre. In: ders.: Ausgewählte Schriften, Bd. II. Bonn 1981 (Orig. München 2. Aufl. 1921; die erste Auflage erschien unter dem Titel „Das Gesetz der Vernunft und die ethischen Strömungen der Gegenwart“. Herford 1907). Martin, Gottfried: Probleme der Prinzipienlehre in der Philosophie Kants. In: Kant-Studien 52 (1960/61), S. 173–184. – : Gesammelte Abhandlungen. Bd. I. Köln 1961. McFarland, J. D.: Kant’s Concept of Teleology. Edinburgh 1970. Menzer, Paul: Der Entwicklungsgang der Kantischen Ethik in den Jahren 1760 bis 1785. In: Kant-Studien 2 (1898), S. 290–322, u. 3 (1899), S. 41– 104. – : Kants Persönlichkeit. In: Kant-Studien 29 (1924), S. 1–20. Mertens, Helga: Kommentar zur Ersten Einleitung in Kants Kritik der Urteilskraft. München 1973. Messer, August: Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Stuttgart 1922. – : Kommentar zu Kants ethischen und religionsphilosophischen Hauptschriften. Leipzig 1929. Mittelstraß, Jürgen: Spontaneität. Ein Beitrag im Blick auf Kant. In: Prauss, G. [Hrsg.]: Kant. Köln 1973, S. 62–72. Moore, George Edward: Principia Ethica, übersetzt von B. Wisser. Stuttgart 1970, Nachdruck 1977. Moritz, Manfred: Kants Einteilung der Imperative. Lund/Kopenhagen 1960. – : Pflicht und Moralität. Eine Antinomie in Kants Ethik. In: Kant-Studien 56 (1965), S. 412–429. – : Über einige formale Strukturen des kategorischen Imperativs. In: Funke, G. [Hrsg.]: Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses (1974), Teil I, S. 201–208. 233 Noack, Hermann: Die Religionsphilosophie im Gesamtwerk Kants. In: I. Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Hamburg 8. Aufl. 1978 (6. Aufl. 1956). Paton, Herbert J.: Kant’s Metaphysics of Experience. A Commentary on the first half of the „Kritik der reinen Vernunft“. 2 Bde. London 5. Aufl. 1970 (1. Aufl. 1936). – : The Categorial Imperative. A Study in Kant’s Moral Philosophy, London 1947, (dt. Der kategorische Imperativ. Übertragen von Karen Schenck. Berlin 1962). – : An Alleged Right to Lie. A Problem in Kantian Ethics. In: Geismann, G. u. Oberer, H. [Hrsg.]: Kant und das Recht der Lüge. Würzburg 1986, S. 46–60, (zuerst in: Kant-Studien 45, 1953/54, S. 190–203). Patzig, Günther: Der Gedanke eines kategorischen Imperativs. In: Archiv für Philosophie 6 (1956), S. 82–96. – : Ethik ohne Metaphysik. Göttingen 1971, 2. Aufl. 1983. – : Die logischen Formen praktischer Sätze in Kants Ethik. In: Prauss, G. [Hrsg.]: Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln. Köln 1973, S. 207–222, (zuerst in: ders.: Ethik ohne Metaphysik. Göttingen 1971, S. 101–127). Paulsen, Friedrich: Kant der Philosoph des Protestantismus. In: Kant-Studien 4 (1900) S. 1–31. Pfannkuche, A.: Der Zweckbegriff bei Kant. In: Kant-Studien 5 (1901), S. 51– 72. Pichler, Hans: Über den Sinn des kategorischen Imperativs. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 14 (1960), S. 626–629. Pieper, Annemarie: Ethik als Verhältnis von Moralphilosophie und Anthropologie. Kants Entwurf einer Transzendentalpragmatik und ihre Transformation durch Apel. In: Kant-Studien 69 (1978) S. 314–329. Plessner, Helmuth: Ein Newton des Grashalms? In: Argumentationen, Fs. f. J. König. Göttingen 1964, S. 192–207. Pohlenz, Max: Stoa und Stoiker. Bd. I: Die Gründer, Panaitios, Poseidonios. Zürich 1950. Prauss, Gerold: [Hrsg.]: Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln. Köln 1973. – : Kant und das Problem der Dinge an sich. Bonn 1974. 234 – : Kants Problem der Einheit theoretischer und praktischer Vernunft. In: Kant-Studien 72 (1981), S. 286–303. – : Kant über Freiheit als Autonomie. Frankfurt/M. 1983. Rademacher, Hans: Zum Problem der transzendentalen Apperzeption bei Kant. In: Zeitschrift f. philosophische Forschung 24 (1970), S. 28–49. Reich, Klaus: Kant und die Ethik der Griechen. Tübingen 1935. – : Rousseau und Kant. Tübingen 1936. – : Die Tugend in der Idee. Zur Genese von Kants Ideenlehre. In: Argumentationen, Festschrift für J. König. Göttingen 1964, S. 208–215. Reiner, Hans: Kants Beweis zur Widerlegung des Eudämonismus und das Apriori der Sittlichkeit. In: Kant-Studien 54 (1963), S. 129–165. Richli, Urs: Transzendentale Reflexion und sittliche Entscheidung. Bonn 1967. Riehl, Alois: Der philosophische Kritizismus. Bd. 1. Leipzig 2. Aufl. 1908. Röh, Wolfgang: Kants Annahme einer Kausalität aus Freiheit und die Idee einer transzendentalen Ethik. In: Dialectica 35 (1981), S. 223–241. Röttges, Heinz: Kants Auflösung der Freiheitsantinomie. In: Kant-Studien 65 (1974), S. 33–49. – : Dialektik als Grund der Kritik. Königstein/Ts. 1981. Rousseau, Jean-Jacques: Emil oder Über die Erziehung. Besorgt von L. Schmidts. Paderborn 8. Aufl. 1987 (1. Aufl. 1971). Sachta, Peter: Die Theorie der Kausalität in Kants „Kritik der reinen Vernunft“. Meisenheim am Glan 1975. Sala, Giovanni B.: Kant und die Frage nach Gott. Gottesbeweise und Gottesbeweiskritik in den Schriften Kants. Berlin 1990. Schink, Willi: Kant und die stoische Ethik. In: Kant-Studien 18 (1913), S. 419–475. Schmalenbach, Herman: Kants Religion. Berlin 1929. Schmid, Friedrich Alfred: Kant im Spiegel seiner Briefe. In: Kant-Studien 9 (1904), S. 307–320. Schmidt, Karl: Beiträge zur Entwicklung der Kant’schen Ethik. Marburg 1900. 235 Schmidt-Sauerhöfer, Paul: Wahrhaftigkeit und Handeln aus Freiheit. Zum Theorie-Praxis-Problem der Ethik Immanuel Kants. Bonn 1978. Schmucker, Josef: Der Formalismus und die materialen Zweckprinzipien in der Ethik Kants. In: Lotz, J. B. [Hrsg.]: Kant und die Scholastik heute, Pullach b. München 1955, S. 155–205. – : Die Ursprünge der Ethik Kants in seinen vorkritischen Schriften und Reflexionen. Meisenheim a. Gl. 1961. – : Die Gottesbeweise beim vorkritischen Kant. In: Kant-Studien 54 (1963), S. 445–463. – : Zur entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung der Inauguraldissertation von 1770. In: Funke G. u. Kopper J. [Hrsg.]: Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses, Teil I Symposion. Berlin 1974, S. 263–282. – : Was entzündete in Kant das große Licht von 1769?. In: Archiv für Geschichte der Philosophie 58 (1976), S. 393–434. Schultz, Uwe: Immanuel Kant mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbeck 1965, Nachdruck 1987. Schulze, Martin: Kants Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Königsberg 1927. Schwartländer, Johannes: Der Mensch ist Person. Kants Lehre vom Menschen. Stuttgart 1968. – : Sittliche Autonomie als Idee der endlichen Freiheit. Bemerkungen zum Prinzip der Autonomie im kritischen Idealismus Kants. In: Theologische Quartalschrift 161 (1981), S. 20–33. Schwarz, H.: Der Rationalismus und der Rigorismus in Kants Ethik. In: Kant-Studien 2 (1898), S. 50–68. Schweitzer, Albert: Die Religionsphilosophie Kant’s von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Freiburg 1899 (Nachdruck: Hildesheim 1974). – : Selbstdarstellung. Leipzig 1929. Schwemmer, Oswald: Vernunft und Moral. Versuch einer kritischen Rekonstruktion des kategorischen Imperativs bei Kant. In: Prauss, G. [Hrsg.]: Kant. Köln 1973, S. 255–273. – : Philosophie der Praxis. Versuch zur Grundlegung einer Lehre vom moralischen Argumentieren in Verbindung mit einer Interpretation der praktischen Philosophie Kants. Frankfurt/M. 1980. 236 – : Die praktische Ohnmacht der reinen Vernunft. Bemerkungen zum kategorischen Imperativ Kants. In: Kants Ethik heute (Neue Hefte für Philosophie 22), Göttingen 1983, S. 1–24. – : Das „Faktum der Vernunft“ und die Realität des Handelns. In: Prauss, G. [Hrsg.]: Handlungstheorie undTranszendentalphilosophie. Frankfurt/M. 1986, S. 271–302. Silber, John R.: Immanenz und Transzendenz des höchsten Gutes bei Kant. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 18 (1964), S. 386–407, (Orig. Kant’s Conception of the Highest Good as Immanent and Transcendent. Philosophical Review 68, 1959). – : Der Schematismus der praktischen Vernunft. In: Kant-Studien 56 (1965), S. 253–273. – : Die methaphysische Bedeutung des höchsten Gutes als Kanon der reinen Vernunft in Kants Philosophie. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 23 (1969), S. 538–549. – : Verfahrensformalismus in Kants Ethik. In: Funke, G. [Hrsg.]: Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses, Teil III, Berlin 1975, S. 149–185. Sob, Brigitte: Kants transzendentale Begründung von Ethik. Zur Problematik einer a priorischen Moraltheorie. Diss. Wien 1985. Sommer, Manfred: Identität im Übergang:Kant. Frankfurt/M. 1988. Spaemann, Robert: Artikel „Freiheit“. In: Ritter, J. u. Gründer, K. [Hrsg.]: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 2. Basel1972, S. 1064–1097. – : Über die Unmöglichkeit einer universalteleologischen Ethik. In: Philosophisches Jahrbuch 88 (1981), S. 70–89. Stockhammer, Morris: Kants Zurechnungsidee und Freiheitsantinomie. Köln 1961. Storr, Gottlob Christian: Bemerkungen über Kant’s philosophische Religionslehre. Tübingen 1794. Strawson, Peter F.: Die Grenzen des Sinns. Ein Kommentar zu Kants „Kritik der reinen Vernunft“. Aus dem Englischen von Ernst M. Lange. Königstein/Ts. 1981. Takeda, Sueo: Kant und das Problem der Analogie. den Haag 1969. Teichner, Wilhelm: Die intelligible Welt. Ein Problem der theoretischen und praktischen Philosophie I. Kants. Meisenheim am Glan1967. 237 Tillich, Paul: Das religiöse Fundament des moralischen Handelns (in Auswahl), 1963. In: Tillich-Auswahl. Bd. 2. Stuttgart 1980, S. 247–287. – : Das religiöse Fundament des moralischen Handelns (Kap. IVu. V). In: ders.: Gesammelte Werke. Bd. III. Stuttgart 1965, S. 56–83. Tonelli, Giorgio: Von den verschiedenen Bedeutungen des Wortes Zweckmäßigkeit in der Kritik der Urteilskraft. In: Kant-Studien 49 (1957/58), S. 154– 166. – : Die Umwälzung von 1769 bei Kant. In: Kant-Studien 54 (1963), S. 369– 375. – : Das Wiederaufleben der deutsch-aristotelischen Terminologie bei Kant während der Entstehung der „Kritik der reinen Vernunft“. In: Archiv für Begriffsgeschichte 9 (1964), S. 233–242. Trede, Johann Heinrich: Ästhetik und Logik. Zum systematischen Problem in Kants Kritik der Urteilskraft. In: Gadamer, H.-G. [Hrsg.]: Das Problem der Sprache. München 1967, S. 169–182. Troeltsch, E.: Das Historische in Kants Religionsphilosophie. Zugleich ein Beitrag zu den Untersuchungen über Kants Philosophie der Geschichte. In: Kant-Studien 9 (1904), S. 21–154. Vleeschauwer, Herman-J. de: The Development of Kantian Thought. Übersetzt von Duncan, A. R. C. London 1962. – : Wie ich jetzt die Kritik der reinen Vernunft entwicklungsgeschichtlich lese. In: Kant-Studien 54 (1963), S. 351–368. Wagner Hans: Zur Kantinterpretation der Gegenwart. Rudolf Zocher und Heinz Heimsoeth. In: Kant-Studien 53 (1961/62), S. 235–254. – : Über Kants Satz, das Dasein sei kein Prädikat. In: Archiv für Geschichte der Philosophie 53 (1971), S. 183–186. – : Moralität und Religion bei Kant. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 29 (1975), S. 507–520. – : Der Argumentationsgang in Kants Deduktion der Kategorien. In: KantStudien 71 (1980), S. 352–366. Wilde, Leo Henri: Hypothetische und kategorische Imperative. Eine Interpretation zu Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“. Bonn1975. Wimmer, Reiner: Die Doppelfunktion des Kategorischen Imperativs in Kants Ethik. In: Kant-Studien 73 (1982), S. 291–320. 238 – : Kants kritische Religionsphilosophie. Berlin 1990. Wolff, Christian: Psychologia Empirica. In: ders.: Gesammelte Werke, II. Abteilung Lateinische Schriften. Bd. 5. Hildesheim 1968. – : Philosophia Practica Universalis. In: ders.: Gesammelte Werke, II. Abteilung Lateinische Schriften. Bd. 10. Hildesheim 1971. Wundt, Max: Kant als Metaphysiker. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Philosophie im 18. Jahrhundert. Stuttgart 1924. Zocher, Rudolf: Kants transzendentale Deduktion der Kategorien. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 8 (1954), S. 161–194. – : Zu Kants transzendentaler Deduktion der Ideen der reinen Vernunft. In: Zeitschrift für philosophische Forschung, 12 (1958), S. 43–58. – : Kants Grundlehre. Ihr Sinn, ihre Problematik, ihre Aktualität. Erlangen 1959. – : Der Doppelsinn des Kantischen Apriori. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 17 (1963), S. 66–74. Zwingelberg, Hans Willi: Kants Ethik und das Problem der Einheit von Freiheit und Gesetz. Bonn 1969. 239