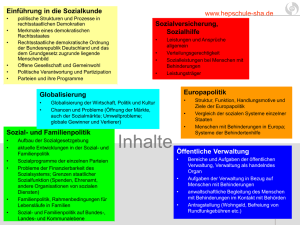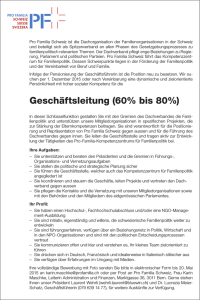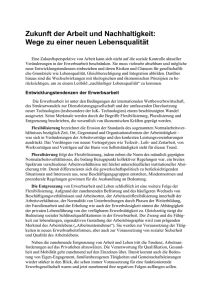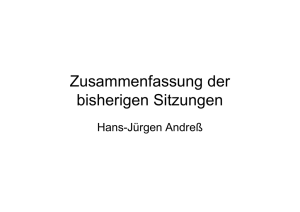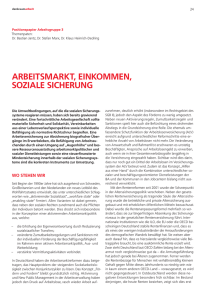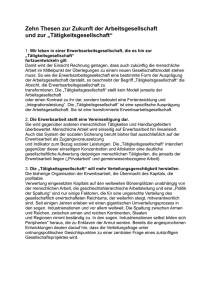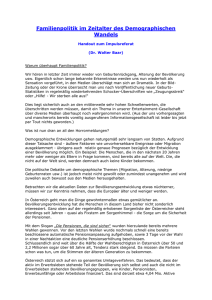Dokumentation - Friedrich-Ebert
Werbung
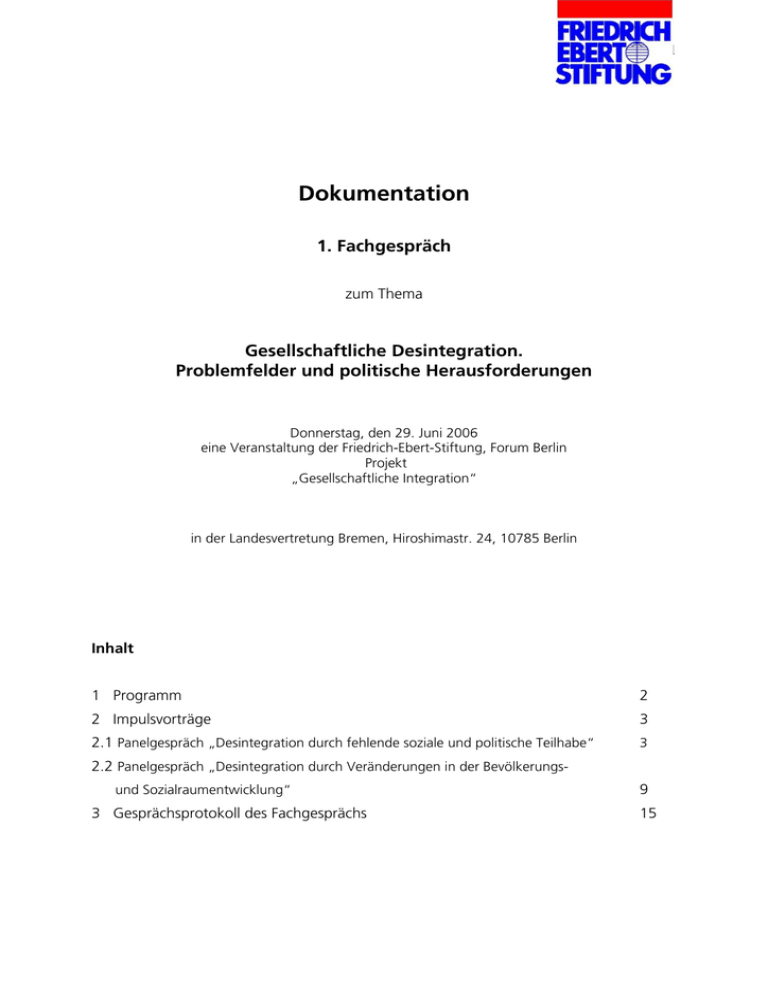
1 Dokumentation 1. Fachgespräch zum Thema Gesellschaftliche Desintegration. Problemfelder und politische Herausforderungen = Donnerstag, den 29. Juni 2006 eine Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Berlin Projekt „Gesellschaftliche Integration“ in der Landesvertretung Bremen, Hiroshimastr. 24, 10785 Berlin Inhalt 1 Programm 2 2 Impulsvorträge 3 2.1 Panelgespräch „Desintegration durch fehlende soziale und politische Teilhabe“ 3 2.2 Panelgespräch „Desintegration durch Veränderungen in der Bevölkerungsund Sozialraumentwicklung“ 3 Gesprächsprotokoll des Fachgesprächs 9 15 2 1 Programm 1. Fachgespräch Gesellschaftliche Desintegration. Problemfelder und politische Herausforderungen Moderation: Dr. Ursula Weidenfeld Stellvertr. Chefredakteurin Der Tagespiegel 10.00 Uhr Begrüßung Franziska Richter Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Berlin 10.15 Uhr Panelgespräch Desintegration durch fehlende soziale und politische Teilhabe Dr. Uwe Bittlingmayer Universität Bielefeld _áäÇìåÖ=ìåÇ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí== = = = = = == Dr. Berthold Vogel Hamburger Institut für Sozialforschung aÉëáåíÉÖê~íáçå=ÇìêÅÜ=^êÄÉáí=J=fåíÉÖê~íáçå=ÇìêÅÜ=^êÄÉáíëã~êâíéçäáíáâ\= Dr. Ansgar Klein Geschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE) in Berlin dÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=ìåÇ=éçäáíáëÅÜÉ=qÉáäÜ~ÄÉ=ÇìêÅÜ=ÄΩêÖÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜÉë== båÖ~ÖÉãÉåí=J=ÉáåÉ=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=oÉÑçêãéçäáíáâ 12.00 Uhr Mittagspause 13.15 Uhr Panelgespräch Desintegration durch Veränderungen in der Bevölkerungs- und Sozialraumentwicklung == = Prof. Dr. Charlotte Höhn Leiterin des Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) beim Statistischen Bundesamt, Wiesbaden rêë~ÅÜÉå=ìåÇ=hçåëÉèìÉåòÉå=ÇÉê=~äíÉêåÇÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= dÉåÉê~íáçåÉåÖÉêÉÅÜíáÖâÉáí Dr. Gisela Notz Wissenschaftliche Referentin im Historischen Forschungszentrum für Zeitgeschichte der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn dÉÄìêíÉåê~íÉ=ìåÇ=c~ãáäáÉåéçäáíáâ=áã=t~åÇÉä=ÇÉê=wÉáí== = = = 16.00 Uhr Prof. Dr. Hartmut Häußermann Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin, Sprecher des Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung bÑÑÉâíÉ=ê®ìãäáÅÜÉê=pÉÖêÉÖ~íáçå= Ausklang, Zeit für Gespräche und Begegnungen 3 2 Impulsvorträge 2.1 Panelgespräch „Desintegration durch fehlende soziale und politische Teilhabe“ Bildung und Gesellschaft Dr. Uwe Bittlingmayer „Bildung“ und „Gesellschaft“ sind zwei sehr unscharfe Begriffe. Je nachdem welche Gesellschaftsdefinitionen- bzw. Interpretationen vorliegen – wie beispielsweise die „Individualisierte Gesellschaft (Beck 1986)“, die „Multioptionsgesellschaft (Gross 1994)“, die „Erlebnisgesellschaft (Schulze 1992)“ oder die „Wissensgesellschaft (u.a. Stehr 2001)“ existieren unterschiedliche Vorstellungen vom Bildungssystem. Auch davon, was es bewirken soll und wie das Verhältnis von Bildung und sozialer Ungleichheit beschaffen sein sollte. Ich gehe hier von der Gegenwartsgesellschaft als pluralisierter Klassengesellschaft aus (siehe Vester et al. 2001; Vester 2006, Milieulandkarte). Das Bildungsverständnis hängt von der Milieuzugehörigkeit ab. Milieus sind Sozialisationsräume mit unterschiedlichen Handlungs- und Präferenzstrukturen. Dieser Vortrag konzentriert sich auf die Fragestellung, inwiefern das deutsche Schulsystem Ungleichheit produziert. Meine diesbezügliche These würden lauten, dass alle bisherigen Schulsysteme der westlichen Industrieländer mit sozialer Ungleichheit einhergehen. Im Schulsystem vollzieht sich eine Produktion und Reproduktion von Herkunftseffekten. Ursachen dafür sind die Standardisierung von akzeptierten Wissensformen (durch Noten), sowie die Standardisierung von akzeptierten Verhaltensweisen. Die Bewertungen finden weniger auf der Grundlage kognitiver Kenntnisse statt, sondern richten sich häufig vorrangig nach dem Verhalten der SchülerInnen. (siehe Schumacher 2002). Das Bildungssystem produziert soziale Demarkationslinien (Pierre Bourdieu), ergo eine Sozialstruktur. Das sieht man auch an den Festsetzungen sozialer Grenzziehungen durch die Schulabschlüsse. So schließen 30% der SchülerInnen ihre Schulausbildung mit Abitur ab und 70% dagegen ohne diesen Abschluss. Wer wird besonders benachteiligt im deutschen Bildungssystem? Durch die Standardisierungen bilden sich strukturell benachteiligte Gruppen heraus. Bei diesen Gruppen spreche ich von Milieus unterhalb der Grenze der Respektabilität – also von so genannten Unterschichtmilieus. Hierzu zählen vor allen Dingen Kinder mit Migrationshintergrund, wobei Kinder mit italienischem, türkischem oder russischem Hintergrund weitaus schlechter abschneiden, als Kinder mit vietnamesischem oder persischem Hintergrund, wie die PISA-Studie ergeben hat. Dies zeigt, dass es sich bei den Kindern mit Migrationshintergrund keineswegs um eine homogene Gruppe handelt. Vielmehr stehen die unterschiedlichen Bildungserfolge mit der Milieu- und Schichtzugehörigkeit und der jeweiligen Migrationsgeschichte in engem Zusammenhang. Verallgemeinerungen, dass alle Migranten benachteiligt wären, sind daher irreführend, denn es gibt auch positiv selektierte Migrantengruppen im Bildungssystem (siehe Kronig 2003). Kulturelle Zuschreibungen bei Migrantengruppen führen hier auch nicht weiter, da das Beispiel der iranischen SchülerInnen ganz klar zeigt, dass nicht alle Moslems in der Schule schlecht abschneiden, sondern dass vielmehr der Bildungserfolg von der jeweiligen Milieu- und Schichtzugehörigkeit abhängt. Daher stellt es ein starkes Defizit bei der Sozialstrukturanalyse einer Milieuperspektive dar, dass die „Ethnizität“ noch nicht in diese Perspektive eingebaut ist. 4 Einige reformorientierte Gegenstrategien für die Verringerung der im internationalen Vergleich massiven Bildungsungleichheiten in Deutschland wären z.B. die Abschaffung des „Hängenbleibens“, der Ausbau von Förderunterricht im Rahmen von Ganztagsbeschulung und die Aufwertung berufsbezogener Ausbildungsgänge zu akademischen Berufszweigen. Zum Punkt „radikale Gegenstrategien“, die einen nachhaltigeren Effekt auf die Reduzierung sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem mit sich ziehen würden: Dazu gehören zum einen die Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems sowie die Abschaffung von Noten denn Standardisierung führt immer zu Ungleichheit. Die Einbeziehung einer sozialstrukturanalytischen Perspektive in die Lehramtsausbildung im Sinne einer Sozioanalyse (Bourdieu) des Lernens und Lehrens zählt dabei ebenfalls dazu. Selbst wenn man reformorientierte oder radikale Gegenstrategien einführen sollte – sie sind keine Wunderwaffen. Denn Standardisierungsformen und Herkunftseffekte bleiben weiterhin bestehen. Dies ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Finnland und Island zu beobachten. Es ist naiv zu denken, dass Reformen in der Bildungspolitik losgelöst von Arbeitsmarktpolitik angedacht und durchgeführt werden können. Zentral ist vielmehr eine Perspektive, die nicht bei der Bildungspolitik stehen bleibt. Bedeutsam ist eine ungleichheitssensible Verknüpfung von Bildungspolitik, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, Rentenpolitik, Migrationspolitik usw. nach dem Motto: Keine Bildungsreform ohne Gesellschaftsreform! (siehe Bauer/Bittlingmayer 2005) iáíÉê~íìêW= Bauer, Ulrich/Uwe H. Bittlingmayer, 2005, Egalitär und Emanzipativ: Leitlinien der Bildungsreform, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B12/2005, 14-20. Beck, Ulrich, 1986, Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt/Main: Suhrkamp. Gross, Peter, 1994, Die Multioptionsgesellschaft, Frankfurt/Main: Suhrkamp. Kronig, Kronig, W., 2003, Das Konstrukt des leistungsschwachen Immigrantenkindes. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 6 (1), 126-143. Schulze, Gerhard, 1992, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/Main, New York: Campus. Schumacher, Eva, 2002, Die soziale Ungleichheit der Lehrer/innen – oder: Gibt es eine Milieuspezifität pädagogischen Handelns, in: Mädgefrau, Jutta/Dies. (Hrsg.), Pädagogik und soziale Ungleichheit. Aktuelle Beiträge – Neue Herausforderungen, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 253-270. Stehr, Nico, 2001, Moderne Wissensgesellschaften, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 36/2001, 7-14. Vester, Michael, 2006, Die gefesselte Wissensgesellschaft, in: Bittlingmayer, Uwe H./Ullrich Bauer (Hrsg.), Die „Wissensgesellschaft“. Mythos, Ideologie oder Realität?, Wiesbaden: VS, 173219. Vester, Michael/Peter von Oertzen/Heiko Geiling/Thomas Herrmann/Dagmar Müller, 2001, Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung, Frankfurt/Main: Suhrkamp.= 5 Desintegration durch Arbeit? Integration durch Arbeitsmarktpolitik? Berthold Vogel Ich möchte Ihnen in meinem kurzen Referat nur einen Gedanken nahe bringen. Dieser Gedanke lautet: Wir haben immer weniger gute Gründe, davon auszugehen, dass die bêïÉêÄë~êÄÉáí, die q~íë~ÅÜÉI= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= òì= ëÉáå bzw. einer ÄÉêìÑäáÅÜÉå= q®íáÖâÉáí= å~ÅÜòìÖÉÜÉå, eine universale sozialintegrative Wirkung hat. Die Erwerbsarbeit funktioniert nicht mehr als das zentrale Integrationsprinzip. Sie schützt immer weniger vor prekären Lebenslagen und Armutsrisiken, ja sie wird häufig selbst zu einem Abstiegsrisiko. Noch bis vor wenigen Jahren hatten wir bei Diskussionen um Desintegration, um soziale Unsicherheit und Instabilität, ein klares Bild vor Augen: Wenn wir über die Ursachen und Verläufe der Desintegration sprachen, dann dachten wir zuerst an den Verlust der Arbeit, an Arbeitslosigkeit. Zu Recht. Und das Integrationsrezept, das wir dann schnell auszustellen wussten, lautete entweder auf Erwerbsarbeit oder nolens volens auf Arbeitsmarktpolitik. Der Ruf nach Arbeit und nochmals Arbeit bzw. der Appell an eine aktive Arbeitsmarktpolitik, an den Aufbau zweiter und dritter Arbeitsmärkte war immer mit spezifischen Hoffnungen verknüpft: beispielsweise mit Hoffnungen auf soziale Einbindung, auf materielle Sicherung, auf berufliche Befriedigung und auf normative Orientierung. Mit, in und durch Erwerbsarbeit bekamen àìåÖÉ=iÉìíÉ eine Perspektive für die Zukunft, die cê~ìÉå=waren von „Heim und Herd“ „befreit“ und die j®ååÉê waren bei der Arbeit dort, wo sie nach eigener Meinung und auch nach Meinung ihrer Frauen sowieso hingehören: nämlich in den Betrieb oder ins Büro. Erwerbsarbeit war zumindest für die Arbeiterschaft und für weite Teile der Mittelschichten eine große, vom Wohlfahrtsstaat gestützte und in Betrieb gehaltene Integrationsmaschine. Die Erwerbsarbeit war die Lösung und das Patentrezept. Und heute? Lassen Sie mich kurz drei Punkte ansprechen: 1. Die ^êÄÉáíëäçëáÖâÉáí= áëí= Éáå= mêçÄäÉã= ÖÉÄäáÉÄÉå. Noch mehr – die Arbeitslosigkeit ist sozial grenzenloser geworden, denn der faktische oder der drohende Verlust der Erwerbsarbeit erreicht in immer stärkerem Maße qualifiziertere und beruffachlich geschulte Gruppen am Arbeitsmarkt. Neue Formen der Arbeitsplatz- und Beschäftigungsunsicherheit erreichen immer häufiger einst als krisensicher angesehene Branchen, beispielsweise den Bankensektor, die Versicherungswirtschaft, den Automobilbau oder die öffentlichen Dienste. 2. Die ^êÄÉáíëã~êâíéçäáíáâ= Ü~í= ëáÅÜ= ëìÄëí~åíáÉää= îÉê®åÇÉêí. Als integrativ steuerndes Instrumentarium wurde sie politisch in den vergangenen Jahren faktisch abgeschafft – zumindest in ihrem alten AFG-Verständnis (dessen politisches Hochamt im übrigen während der deutschen Vereinigung gefeiert wurde). An die Stelle einer auf Integration und Statussicherung zielenden Arbeitsmarktpolitik ist nun die mehr oder weniger diffuse Steuerung der Beschäftigungsfähigkeit (employability und agency) getreten. Die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik ist auf diese Weise selektiver, partikularer, projektorientierter geworden. Sie hat ihren universalistischen Anspruch aufgegeben, eine Statusverbesserungs- und Statussicherungsapparatur zu sein. 3. Die ëçòá~äÉ= ìåÇ= êÉÅÜíäáÅÜÉ= dÉëí~äí= ÇÉê= bêïÉêÄë~êÄÉáí= áëí= îáÉäÉêçêíë= EåáÅÜí= ΩÄÉê~ääF= ÇáÑÑìë= ìåÇ= éêÉâ®ê, sie hat ihre soziale und berufliche Stabilität verloren. Die Erwerbsarbeit ist in vielen Sektoren und Branchen zu einer Welt auf Wiederruf geworden, ja zu einem sozialen Niemandsland der Gelegenheitsbeschäftigung, der Zeitarbeit, der befristeten Verträge, der Praktika und Ein-Eurojobs, der Fortbildung und der Mehrfachbeschäftigung. Kurzum, die Beteiligung am Erwerbsleben erfüllt für immer weniger Menschen wohlstandssichernde bzw. 6 wohlstandsgewährende Funktionen, und die Erwerbsarbeit bietet immer seltener Aufstiegsperspektiven, während soziale und berufliche Abstiegssorgen im Arbeitsalltag in deutlichem Maße zugenommen haben. Nicht nur die Arbeitslosigkeit, auch die Erwerbsarbeit und die Arbeitsmarktpolitik entfalten mittlerweile desintegrative Kräfte. Wo liegen nun die politischen Herausforderungen? Gestatten Sie mir hierzu abschließend nur zwei knappe Bemerkungen. Die erste Bemerkung: Eine Quelle politischer Inspiration könnten die arbeitsgesellschaftlichen Debatten der 80er Jahre sein. Die zentrale Frage lautete damals: Wie kommen wir zu einer politischen und kulturellen Neubewertung der Erwerbsarbeit? Und wer könnten die sozialen Trägerschichten dieser Neubewertung sein? Diese Fragen sollten Bestandteil der politischen und wissenschaftlichen Debatte heute sein. Die zweite Bemerkung: Wir benötigen neue politische und rechtliche Instrumentarien zur Gestaltung und Einhegung sozialer und beruflicher Unsicherheit; Instrumentarien, die sich flexibel genug zeigen, um auf die Veränderungen in der Arbeitwelt reagieren zu können. Die Konzepte der „Flexicurity“ (der arbeitsrechtlichen und beschäftigungspolitischen Verbindung von „flexibility“ und „security“) und der „Übergangsmärkte“ (der Organisation erwerbsbiographischer Passagen zwischen Ausbildung und Beruf, zwischen Familie und Erwerbsarbeit, zwischen unterschiedlichen Beschäftigungsformen) können in diesem Zusammenhang wichtige und wertvolle Hinweise liefern. In jedem Fall gilt: Soziale und berufliche Integration durch Erwerbsarbeit und Arbeitsmarktpolitik sieht sich neuen Herausforderungen gegenüber, aber sie ist auch künftig gestaltbar bzw. auf neue politische Gestaltungskraft angewiesen. Gesellschaftliche und politische Teilhabe durch bürgerschaftliches Engagement - eine Herausforderung für die Reformpolitik Dr. Ansgar Klein Fragen der Integrationspotentiale bürgerschaftlichen Engagements stellen nach wie vor ein Randthema in der öffentlichen Debatte dar. Der Integrationsbegriff beinhaltet zwei Dimensionen - zum einen die Dimension sozialer Integration, zum anderen die der politischen Integration. Der Begriff der sozialen Integration lehnt sich dabei eng an die Debatten um soziales Kapital (Bourdieu vs. Putnam) an. Politische Integration ist von sozialer Integration zu differenzieren. So unterscheidet sich das Engagement der neuen sozialen Bewegungen und der Bürgerbewegung in Deutschland vom Ehrenamt und der Selbsthilfe. Während erstere eher politisches Engagement bedeuten, werden letztere tendenziell als soziale Tätigkeiten bezeichnet. In Deutschland engagieren sich laut dem Freiwilligen-Survey zwischen 22 und 24 Millionen Menschen. Hier stellt sich die Frage: Wer engagiert sich und wie sind die Ungleichheitsfelder zu verorten? Engagement braucht Ressourcen (wie Einkommen, Familie, Bildung). Immer häufiger wird in der öffentlichen Diskussion der Vorwurf erhoben, dass es sich bei bürgerschaftlichem Engagement um eine „Mittelschichtsveranstaltung“ handelt. Überlegt sollte werden: Wie können noch andere Schichten zum Engagement angeregt werden? Ein Weg wäre sicherlich eine reformpolitische Agenda, die sich der Förderung der Möglichkeiten des Engagements in der Gesellschaft verschreibt. Diese reformpolitische Agenda unterscheidet sich in ihren Eckpunkten einer notwendigen Förderung von Rahmenbedingungen, Strukturen und Infrastruktureinrichtungen der Engagementförderung deutlich von einer neoliberalen Sichtweise, in der Forderungen nach mehr Entbürokratisierung und Deregulierung sich ohne weitere Vermittlungsschritte mit Forderungen nach mehr Bürgergesellschaft verbinden. Vielmehr sei eine ernsthafte Staatsleitbilddebatte mit einer entsprechenden Reformpraxis zu verbinden: hier geht es um intelligente Kombinationen von „aktivierendem Staat“, „ermöglichendem Staat“ und „gewährleistendem Staat“. Es ist jedoch notwendig, auf den verschiedenen Ebenen der Staatlichkeit zu differenzieren. Auf kommunaler Ebene hieße das, die Debatte um die Bürgerkommune zu intensivieren. So werden 7 beispielweise im Programm „Soziale Stadt“ die gesellschaftlichen Akteure für Stadtteilentwicklung zusammengebracht und mobilisiert. Die kommunale Ebene ist sehr wichtig, denn hier finden 80% des bürgerschaftlichen Engagements statt. Des Weiteren müssen auf Landes- und Bundesebene Debatten über die Aktivierung und die Ermöglichung bürgerschaftlichen Engagements stattfinden. Engagierte halten die Aktivierungspolitik für eine paternalistische Zumutung; die ermöglichende Politik nehmen sie jedoch als Chance für die Verbesserung der Rahmenbedingungen ihres bürgerschaftlichen Engagements wahr. Die Gruppen, die sich aufgrund von Ressourcenschwäche (Bildung, Einkommen) wenig oder gar nicht engagieren, könnten hingegen aktiviert werden. Doch dann ist eine Debatte notwendig, was „Aktivierung“ in einem wohlverstandenen engagementpolitischen Sinne wirklich bedeuten sollte. wìã=qÜÉã~=jáÖê~íáçåK= Das Thema der Selbstorganisation von MigrantInnen, ihre Entwicklung, ihre Trägereigenschaften und ihre Förderfähigkeit kommt in deutschen Reformdebatten so gut wie gar nicht vor. Vielmehr wird Engagement von MigrantInnen in ethnischen Vereinigungen vorschnell mit der Bildung von Parallelgesellschaften assoziiert. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass gelungene Integration ein Aufgehen von MigrantInnen in deutschen Organisationen bedeutet. Hier ist ein großes Defizit zu verzeichnen, da die Integrationskraft von MigrantenSelbstorganisationen damit unterschätzt wird. Es gibt zwar ein paar wenige Studien zu diesem Fragekomplex, aber sie sind nicht flächendeckend und offenbar noch nicht in der politischen Debatte angekommen. wìã=qÜÉã~=_áäÇìåÖ=ìåÇ=pÅÜìäÉK== Es sollte mehr Gewicht auf informelles Lernen und die entsprechende Kompetenzgewinnung gelegt werden. Informelles Lernen in Engagementzusammenhängen sollte verstärkt zeugnisund anerkennungsfähig gemacht werden, was besonders wichtig ist für die Ausbildungs- und Berufsbewerbung. wìã=qÜÉã~=båÖ~ÖÉãÉåí=ìåÇ=bêïÉêÄë~êÄÉáíK= Im Hinblick auf die zunehmende Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen werden immer mehr Menschen durch arbeitsmarktpolitische Instrumente gezwungen, sich gemeinnützig zu beschäftigen. Wer dies nicht tun möchte, wird mit erheblichen Leistungsminderungen, gar mit einer möglichen kompletten Einstellung von Sozialleistungen sanktioniert. In der Arbeitsmarktpolitik ist die Diskussion „fördern und fordern“ zwar rhetorisch wirksam, hat sich aber oftmals auf den Aspekt des Forderns konzentriert: Pflicht statt Freiwilligkeit, die Drohung mit dem Abbau von Grundsicherung und der Vorrang sanktionsbewährter Instrumente stehen in Spannung zu einer Aktivierungspolitik, die eine Kultur der Freiwilligkeit und des motivierten Engagements fördern möchte. Soziale Rechte scheinen in der aktuellen Sozialpolitik immer mehr unter Druck zu geraten; der Pflichtdiskurs in Kombination mit der Rede von Sozialmissbrauch ignoriert und schwächt die weithin unausgeschöpften Potentiale und Möglichkeiten einer auf Freiwilligkeit basierenden Engagementförderung wie auch einer noch kaum im Diskurs profilierten „Beschäftigungspolitik in der Tätigkeitsgesellschaft“ . Es gibt unterschätze Möglichkeiten, über Engagement Erwerbsarbeit zu generieren. Und es gibt einen – übrigens längst auch durch Förderinstrumente, über die allerdings kaum gesprochen wird, realisierten Bedarf –, Kompetenzen von Menschen für die Gesellschaft mit Mitteln der Beschäftigungspolitik auch jenseits der Erwerbsarbeit fruchtbar zu machen. Hier fehlt eine mutige offene Debatte über die Tätigkeitsgesellschaft – ein Konzept, das die drei Säulen der familienbezogenen Arbeit, der Erwerbsarbeit und des Engagements im Zusammenhang sieht. Zwischen Erwerbsarbeit und bürgerschaftlichem Engagement existieren zahlreiche Übergangsstufen, denen wir mit glasklaren und eindeutigen Definitionen nicht nahe kommen. Definitionen müssen im Lichte sozialer Entwicklungen immer wieder geprüft werden. Wenn bürgerschaftliches Engagement ausschließlich als freiwillig und unentgeltlich definiert ist (was auch ich nach wie vor für das Herzstück des bürgerschaftlichen Engagements und als Ausdruck 8 seines Eigensinns positiv unterstütze), wird es freilich verstärkt als ein „Mittelschichtsphänomen“ kultiviert und schließt dann zunehmend diejenigen aus, die aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Bildungsferne die für das Engagement erforderlichen Voraussetzungen nicht mitbringen. So werden wichtige Integrationspotentiale des bürgerschaftlichen Engagements nicht abgerufen. Reformpolitisch haben wir das Problem, dass Politiker bei leeren Kassen der öffentlichen Hand das Engagement zunehmend als Lückenbüßer entdecken. Engagement ist keine Sache für Nulltarife, sondern für effiziente Strukturentwicklung. Die Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ hat Perspektiven für eine gesellschaftliche Demokratisierung der Einrichtungen von Kindergärten, Schulen, Altenheimen und Krankenhäusern entwickelt. Zugleich ist eine Organisationsentwicklung der großen Verbände der Bürgergesellschaft notwendig, damit diese künftig weiterhin als Trägerstrukturen für Engagement funktionieren können. In der Wirtschaft gibt es interessante Diskussionen um corporate citizenship, corporate social responsibility. Die Zukunft der Reformpolitik hinsichtlich sozialer und politischer Integration liegt daher in trisektoralen Verbünden zwischen Staat, Wirtschaft und Bürgergesellschaft. Wir brauchen Leitbilddebatten, die daran anknüpfen. Stimmungskampagnen, in denen an Verantwortung appelliert wird - wie beispielsweise die Kampagne „Du bist Deutschland“ - können hier durchaus Missverständnisse provozieren: Denn der Aufruf zur Verantwortung ist leicht getan, er sollte die Politik jedoch nicht von ihren Handlungsverantwortungen entlasten. Daher ist bsw. eine Frage wie „In welcher Gesellschaft möchtest Du leben?“ sehr viel produktiver, da sie soziale Verantwortung nicht von strukturellen Voraussetzungen abkoppelt. Jeder Verantwortungsdiskurs bleibt an Fragen der Anerkennung und auch der Gerechtigkeit rückgebunden, wenn er die Herausforderungen der Integration nicht von oben herab behandeln will. Dann würde er selber den sozialen Ausschluss nur subtil reproduzieren, gegen den sich der Integrationsdiskurs ja eigentlich richten sollte. 9 2.2 Panelgespräch „Desintegration durch Bevölkerungs- und Sozialraumentwicklung“ Veränderungen in der Ursachen und Konsequenzen der alternden Gesellschaft, Generationengerechtigkeit Prof. Dr. Charlotte Höhn In dem ersten Teil meines Vortrages werde ich auf die Ursachen und Konsequenzen der alternden Gesellschaft eingehen. Im zweiten Teil diskutiere ich Fragen der Generationengerechtigkeit und Bewertungen des Lebens im Alter aus der Sicht der jüngeren Generation versus der Vorruhestandsgeneration. Die Entwicklung des Alteraufbaus der Bevölkerung ist dadurch charakterisiert, dass sie im Jahre 1910 noch einen pyramidenförmigen Altersaufbau aufwies, der auf ein weiteres Wachstum der Bevölkerung hindeutete. Um 2000 und heute haben wir nun einen Altersaufbau, der mittlerweile schon bei den über 30-Jährigen durch einen sehr geringen Sockel an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen geprägt ist. Das führt zu einer bestimmten Bevölkerungsentwicklung: die Generationen altern. Unter den Annahmen eines anhaltenden niedrigen Geburtenniveaus (1,4 Geburten pro Frau), einer steigenden Lebenserwartung und jährlicher Zuwanderung von 200.000 Personen wird sich diese Entwicklung fortsetzen. Wir werden für das Jahr 2050 mit einem Altersaufbau rechnen müssen, in dem die am stärksten besetzte Gruppe die der 60-Jährigen darstellt. Gleichzeitig gibt es einen hohen Frauenüberschuss, da Frauen eine längere Lebensdauer als Männer haben. Die demographische Alterung ist unaufhaltsam aufgrund der ungünstigen Altersstruktur, die bereits erwähnt wurde, der sicherlich steigenden Lebenserwartung und dem niedrigen Kinderwunsch. Meine Schlussfolgerung: Politik, Gesellschaft und Wirtschaft müssen sich den Konsequenzen der demographischen Alterung anpassen, da sie nicht ausschließlich auf= demographischem Weg veränderbar ist (eine starke Zunahme der Familien mit mehr als 3 Kindern ist unwahrscheinlich; stärkere Zuwanderung erhöht das Arbeitskräftepotential, vermindert aber kaum die Alterung). t~ë=ëáåÇ=ÇáÉ=ïáêíëÅÜ~ÑíëéçäáíáëÅÜÉå=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå\= Eine Voraussetzung ist der Abbau der Arbeitslosigkeit. Anfang der 80er Jahre wurde angenommen, dass die Jugendarbeitslosigkeit in den 90er Jahren gleich Null sein müsste – was sich aber als Irrtum erwiesen hat. Das hat keine demographischen Gründe - im Gegenteil. Die Arbeitslosigkeit älterer Arbeitsnehmer hat mit der demographischen Entwicklung wenig zu tun. Gründe sind vielmehr darin zu sehen, dass das Frühverrentungssystem zu viele Vorteile und Anreize bietet. Das Ziel des Abbaus der Arbeitslosigkeit besteht darin, wieder zu mehr Beitragszahlungen zu kommen. Etwa ab 2010 muss mit einem abnehmenden Erwerbspotential der jüngeren Personen gerechnet werden. Hier existieren eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten: wie z.B. eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit und eine höhere Frauenerwerbstätigkeit. Wenn man dabei allerdings nicht an Familienpolitik denkt, besteht das Risiko, dass das Geburtenniveau weiter sinkt als bisher angenommen. Starkes Wirtschaftswachstum könnte bei der Erhöhung der Produktivität helfen. Zuwanderung könnte den Arbeitsmarkt entlasten, hält jedoch nicht die Alterung auf. Zuwanderer altern nämlich auch und erwerben Ansprüche an die sozialen Sicherungssysteme. Hinsichtlich des Bildungssektors kommt es darauf an, zu Schul- und Studienabschlüssen zu kommen. Die wachsende Anzahl der Menschen ohne entsprechende Abschlüsse ist für die Erhöhung der Produktivität ein Nachteil. Technischer Fortschritt und Globalisierung machen des Weiteren lebenslanges Lernen und Fortbildung notwendig, auch Universitäten haben hierbei eine bedeutende Aufgabe. 10 aáÉ=ÉáÖÉåíäáÅÜÉå=ïáêâäáÅÜÉå=mêçÄäÉãÉ=ëáåÇ=ÇáÉ=ëçòá~äéçäáíáëÅÜÉå=eÉê~ìÑçêÇÉêìåÖÉåW= Erstens: Die Rentenversicherungen: Hier sind wir bereits in den Debatten, wie der Mix aus der gesetzlichen und privaten Vorsorge aussehen sollte. Der Königsweg ist die längere Lebensarbeitszeit, weil sie zu längeren Beitragszahlungen führt. Zweitens: Die Krankenversicherung: Der medizinische Fortschritt hat auch Anteil an der Kostensteigerung. Es handelt sich um altersspezifische Krankheitsbilder, die die Kosten in einer alternden Gesellschaft bestimmen. Eine Kombination von Eigenvorsorge und gesetzlicher Versicherung ist auch hier wünschenswert und wahrscheinlich. Drittens: Die Frage der Pflegeversicherung: Wer pflegt die Alten? Familien leisten immer noch Ungeheures - eine Arbeit, die allerdings nicht bezahlt wird. Die zukünftigen Alten werden mehr und mehr ohne Partner und / oder kinderlos sein. Daraus entstehen neue Herausforderungen, wie die teurere professionelle Pflege bezahlt werden soll. wìê=cê~ÖÉ=ÇÉê=dÉåÉê~íáçåÉåÄÉòáÉÜìåÖÉåW= Mehrheitlich wird in unserer Befragung (PPA 2003) die Meinung vertreten, dass auf die Älteren zugegangen werden sollte. Die Annahme, dass Ältere eine Bereicherung sind, wird ebenfalls bestätigt. Nur eine Minderheit empfindet ältere Menschen als Last. Was ist zu tun, wenn ältere Menschen nicht mehr mit dem Alltag zurecht kommen? Die Gesellschaft muss angemessene Institutionen schaffen. Hier ist der Ruf nach dem Staat sehr ausgeprägt, was allerdings nicht ohne Kosten möglich ist. Die Forderung, dass Angehörige und Kinder sich um Ältere privat kümmern sollten, wird größtenteils unterstützt. Wie steht die Bevölkerung zu den aktuell diskutierten Reformvorschlägen? Der Abschaffung der Frühverrentungsprogrammen wird eher von Älteren als von Jüngeren zugestimmt. Die Einführung eines höheren Renteneintrittsalter findet dagegen eher bei Jüngeren Billigung. Immer mehr Unterstützung findet die Forderung, dass Renten von der Zahl der Kinder abhängig gemacht werden sollten. 10% der Befragten sind bereit, höhere Beiträge zu zahlen. Verringerungen der Renten sind hingegen weniger populär. Geburtenrate und Familienpolitik im Wandel der Zeit Dr. Gisela Notz Es gibt kaum einen gesellschaftlichen Bereich, der so von Bildern, Idealen und emotionalen Bewertungen umstellt und verstellt ist, wie Familienpolitik. Der Wunsch nach gesellschaftlicher Integration und nach einem „erfüllten Leben“ ist eng mit dem Wunsch nach Familie, bzw. nach einer Gemeinschaft, in der die Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, Sorge tragen und Zuwendung schenken und erfahren, verbunden. Die Klagen um die „Krise der Familie“ und den Geburtenrückgang reichen weit zurück. Schon Frauen der ersten Frauenbewegung erklärten, dass alleine die Frau das Recht habe, über ihren Körper und die Zahl ihrer Geburten zu bestimmen. Die Ideologie des Nationalsozialismus verwies auf den Stellenwert der bürgerlichen Familie, der in der Weimarer Republik zu kurz gekommen sei, weil Frauen ihre Aufgaben und Pflichten als Mütter vernachlässigt hätten, um mit den Männern um politische Macht, Berufe und Geld zu konkurrieren. Die Zweigenerationenfamilie mit Vater, Mutter und einem oder mehreren (eigenen) Kindern wurde – trotz des „Frauenüberschusses“ von über sieben Millionen und trotz der 40 % Mütter die ihre Kinder alleine erzogen und trotz des Satzes „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, der 1949 ins Grundgesetz eingeschrieben wurde - zum Leitbild der Nachkriegsgeneration. Die 1950er Jahre waren Hochzeiten der konservativen Familienpolitik. Die „gewünschte Ordnung“ schrieb vor, dass Frauen für den Haushalt und die Kinder zuständig seien und nicht für den Beruf. Obgleich die gelebte Realität viele andere Lebensformen zeigte. Spätestens mit CDU-Familienminister Franz-Joseph Würmeling, der 1953 das neue Ministerium übernahm, wurde die Hausfrauen- und Mutterrolle systematisch finanziell gefördert und in hohem Maße ideologisiert. Es ging um eine Familienpolitik, die die „Normalfamilie“ mit 11 „Haupternährer“ und „Hausfrau“ restaurieren wollte. Die geburtensteigernde Intention der familienpolitischen Maßnahmen war nicht zu übersehen. Es war ein weiter Weg, bis die Freiheiten, die wir heute – wenn auch immer noch in eingeschränktem Maße – haben, erreicht waren. Es waren die „68er“, die forderten, dass Frauen selbst bestimmen sollten, wie sie zusammen leben und ob und wann sie (eigene) Kinder haben wollten. Seit 1970 sinken die Geburtenziffern, sie pendelten sich im Westen um den Wert von 1,4 ein. In den neuen Bundesländern ging sie nach der Wende auf 0,9 und stieg dann wieder auf 1,3 an. 1970 waren es noch durchschnittlich 2,92 Geburten in Westdeutschland und 2,19 in der DDR. Seit 1991 - mit Ausnahme der Jahre 1996/1997 – sind die Geburtenzahlen in Deutschland durchwegs rückläufig. Wieder wird die Krise der Familie beklagt und es werden Ängste geschürt, dass das „deutsche Volk“ aussterben müsse, wenn es nicht gelänge, gegenzusteuern. Im Schnitt müsste jede Frau angeblich 2,1 Kinder zur Welt bringen, um „die Nation“ auf ihren Einwohnerniveau zu halten. Zuletzt hat diese Menge der Jahrgang der 1935 geborenen Frauen – knapp – geschafft. Weltweit bekommen Frauen mehr als drei Kinder durchschnittlich. Die Weltbevölkerung wird also weiter steigen. tÉäÅÜÉ=cê~ìÉå=ÄäÉáÄÉå=âáåÇÉêäçë\= Heute geht es um „bevölkerungsorientierte Familienpolitik“, weil das Schreckgespenst umgeht, dass 40 Prozent der Akademikerinnen in Deutschland keine Kinder bekommen. Bevölkerungswissenschaftler fanden heraus, dass sich Kinderlosigkeit auffallend häufig mit einer bestimmten Bildungsbiografie koppelt. Diesbezügliche Daten differieren allerdings stark. Auch ein Mangel an schulischer Bildung ist der Mutterschaft abträglich. 35 bis 39-jährige ohne jeden Schulabschluss bilden mit 30,6 % die zweitgrößte Gruppe der „Kinderlosen“. 19 % der Hauptschulabsolventen bleiben ohne Nachwuchs. Experten verweisen darauf, dass die mit einem Kind verbundenen Einkommenseinbußen beide Gruppen davon abhalten, sich für Kinder zu entscheiden. Für viele Akademikerinnen sei die Konsequenz, dass der Kinderwunsch bis hinter die biologischen Grenzen verschoben wird. Frauenpolitik wurde schon seit einiger Zeit mit Familienpolitik gleichgesetzt; und Familienpolitik wird mit Fragen der Bevölkerungspolitik überlagert und bisweilen von ihr instrumentalisiert. Ebenso wird Migrationspolitik der Bevölkerungsplanung untergeordnet. Angenommen wird, dass MigrantInnen mehr Kinder bekommen als Deutsche; zunehmend ist aber auch eine Annäherung an die durchschnittliche Geburtenrate in Deutschland zu beobachten. t~ë=ëáåÇ=ÇáÉ=dêΩåÇÉ=ÑΩê=ÇáÉ=ëáåâÉåÇÉå=dÉÄìêíÉåê~íÉå\== Im Allgemeinen liegt die Geburtenrate in den Städten niedriger als auf dem Land. Angezogen werden junge Menschen und Immigranten vor allem von wirtschaftlich dynamischen Regionen. Damit hängt auch die demographische Entwicklung mehr denn je von den ökonomischen Perspektiven der Regionen ab. Konservative Politiker bringen Geburtenrückgang oft mit Schwangerschaftsabbruch in Zusammenhang. Tagesschausprecherin Eva Herman, macht „die Emanzipation“ für die Kinderlosigkeit verantwortlich. Familiensoziologen suchen die Ursache darin, dass Beziehungen in den letzten Jahrzehnten zwar nicht seltener geworden seien, sondern instabiler. Gerade beruflich qualifizierte Frauen zögerten nicht lange, den Trennstrich unter eine Beziehung zu ziehen. Auch selbst (und von anderen) gestellte Ansprüche an das perfekte Kind und die perfekte Familie, die man glaubt, nicht einlösen zu können, mögen Entscheidungen beeinflussen. „Biologisch ausgetrocknet“, sagt Meinhard Miegel, der Leiter des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft in Bonn, in seinem Buch „Die deformierte Gesellschaft“, seien die Deutschen abhängig „von der Fruchtbarkeit, dem Migrationswillen und den Qualifikationen“ anderer Völker. Migrationspolitik sollte unabhängig von Bevölkerungspolitik diskutiert werden. mÉêëéÉâíáîÉå= Frauen und Männer entscheiden heute selbst, ob und wann sie ein (eigenes) Kind bekommen wollen. Männer und Frauen wählen selbstbestimmt ihre Lebensform. Frauen und Paare bekommen keine Kinder, weil sie die Renten kommender Generationen sichern wollen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass der Entscheidungsprozess, der letztlich zur Konzeption des Kindes geführt hat, selten ein rationaler, sondern fast immer ein emotionaler und oft von 12 Zufall geprägt ist. Höhere Geburtenraten alleine können ohnehin weder kurz- noch langfristig Mittel zur Lösung des Rentenproblems sein. Kinder können nur dann in die Rentenversicherung einbezahlen, wenn sie im Jugendlichen- und Erwachsenenalter entsprechende Ausbildungen und darauf folgende Erwerbsmöglichkeiten vorfinden, die ihnen das ermöglichen. Ist das nicht der Fall, werden sie dem Sozialstaat, dem das Geld bereits jetzt auszugehen droht, zur "Last" fallen. Erwerbslosigkeit, steigender Niedriglohnsektor und immer weniger sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse sind Ursachen für die Löcher in den Sozialkassen. Für die Zukunft sollte es darum gehen, dass junge Menschen, die Kinderwünsche haben, diese auch verwirklichen können und dass Kinder ohne Armut aufwachsen können. Denn Kinderarmut ist ein großes Problem. Höchste Zeit wäre es, dass sich Familienpolitik vom Leitbild des Haupternährers und der Zuverdienerin löst. Schließlich sollten Menschen aller Lebensalter, egal für welche Lebensform sie sich entschieden haben, in unserer Gesellschaft das vorfinden, was sie zum „guten Leben“ brauchen, dazu gehören vor allem Wohnung, Gesundheit und Bildung, soziale, kulturelle und politische Teilhabe, sinnvolle existenzsichernde Arbeit und ausreichende Alterssicherung. Effekte räumlicher Segregation Prof. Dr. Hartmut Häußermann Segregation ist ein Begriff, der verschiedene Dimensionen beinhaltet. Zum einem existiert die Begrifflichkeit ëçòá~äÉ=pÉÖêÉÖ~íáçå. Sie generiert sich aus den jeweiligen Differenzen im Einkommen bzw. allgemeiner: im sozioökonomischen Status, nach dem die Bevölkerung geschichtet ist. Zum anderen gibt es den Begriff der âìäíìêÉääÉå= pÉÖêÉÖ~íáçå, der sich nach Lebensstilen definiert. Drittens unterscheidet man die ÉíÜåáëÅÜÉ= pÉÖêÉÖ~íáçå, die eine Mischung aus freiwilliger Wahl und erzwungener Segregation aufgrund von Diskriminierung in bestimmten Stadtteilen darstellt. Dabei müssen wir zwischen Effekten freiwilliger und erzwungener Segregation differenzieren. Segregation kann aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Segregierte Gebiete schaffen einerseits interne Homogenität und Binnenintegration. Die dort lebenden Menschen verfügen in der Regel über enge soziale Kontakte, Beziehungen und Unterstützungsnetzwerke. Andererseits kann die Binnenintegration aber auch ein Hindernis für die Integration einer Minderheit in die Mehrheitsgesellschaft sein – und deshalb wird die Segregation dann kritisiert. Diese verschiedenen Blickpunkte eröffnen unterschiedliche Bewertungsmöglichkeiten dieses Phänomens. Die Binnenintegration wird entweder als eine Ursache für mangelnde gesellschaftliche Integration oder als Reaktion auf eine nicht gelungene Integration betrachtet. In Deutschland hat sich seit zwei, drei Jahren in der Diskussion ein Paradigmenwechsel vollzogen. Früher wurde die Segregation als ein Zeichen für nicht gelungene gesellschaftliche Integration, also für Benachteiligung betrachtet. Heutzutage wird sie in der politischen Öffentlichkeit eher als mangelnder Wille der Bewohner zur gesellschaftlichen Integration angesehen. In diesem Vortrag rede ich hauptsächlich über ÉíÜåáëÅÜÉ= pÉÖêÉÖ~íáçå. Anhand der ethnischen Segregation kann man alle Themen, die mit der Segregation verbunden sind, exemplifizieren. Im Programm „Soziale Stadt“ geht es um die Wahrnehmung, dass Quartiere, in denen eine hohe Konzentration von Bewohnern mit vielen sozialen Problemen vorzufinden sind, als benachteiligte Quartiere zu qualifizieren sind. Aus der Konzentration von Benachteiligung geht, so die Annahme, eine zusätzliche Form von Benachteiligung hervor. Segregierte Quartiere sind in diesem Sinn benachteiligende Quartiere. Dort vollziehen sich Exklusionsprozesse. Die Bevölkerung und die Quartiere selber werden im Entwicklungsprozess der Stadt residualisiert. Die räumliche Konzentration von ethnischen Minderheiten wird unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten kritisch diskutiert: Erstens: als Beeinträchtigung von Lebenschancen. Die räumliche Konzentration von ethnischen Minderheiten wirke sich negativ auf die Partizipation 13 an den Errungenschaften dieser Gesellschaft aus. Zweitens: als politische Gefahr. Die räumliche Konzentration von ethnischen Minderheiten wird als eine Gefahr für die soziale Kohäsion der Gesellschaft gesehen. Im ersten Fall geht es um Exklusion. Im zweiten Fall handelt es sich um Fragen der Desintegration. Diese Begrifflichkeiten wurden im Rahmen des Fachgesprächs noch nicht geklärt. tÉäÅÜÉ=bÑÑÉâíÉ=îÉêãìíÉí=ã~å=ÄÉá=ÇÉê=ÉíÜåáëÅÜÉå=pÉÖêÉÖ~íáçå\= Hierbei handelt es sich um Thesen, die aus der amerikanischen Forschung stammen. Erstens: Soziale Effekte: Jugendliche, die in segregierten Gebieten aufwachsen, in denen bestimmte Verhaltensweisen als normal gelten, welche außerhalb als abweichend oder kriminell gebrandmarkt sind. Es fehlen Vorbilder und Rollenmodelle, an denen sie sich orientieren können. Das führt zu kultureller Separation, zu einer Abgrenzung, zu einer Isolation vom Mainstream der Gesellschaft. Zweitens: Der soziale Kontext des Alltags kann in der Muttersprache des Herkunftslandes organisiert werden. Dadurch werden kulturelle Fremdheit oder kulturelle Distanz aufrechterhalten. Die Konzentration hat den Effekt, eine vorhandene Distanz zu perpetuieren. Dadurch entstehen sogenannte Parallelgesellschaften. Über den Begriff kann man viel diskutieren. Ich benutze ihn jetzt deskriptiv, da er in der politischen Diskussion so eine große Rolle spielt – obwohl ich denke, dass es so etwas bei uns nicht gibt. Die Bildung von Parallelgesellschaften kann als das Ergebnis einer Negativspirale betrachtet werden. Wenn man in einem ethnisch konzentrierten Gebiet lebt, das segregiert vom Rest der Gesellschaft ist, hat man keine Anreize für eine kulturelle Anpassung. Dies ist insbesondere für den Spracherwerb nachgewiesen. Die Folgen des mangelhaften Spracherwerbs sind Misserfolge in der Schule und geringe Arbeitsmarktchancen. Dadurch entsteht eine Netzwerkarmut, da die Netzwerke, die durchaus in dem ethnisch konzentrierten Gebiet funktionieren, nicht produktiv sind – sie enthalten zu wenig Ressourcen. Die Netzwerke funktionieren, aber sie sind arm. Die Leute dort verfügen nicht über Informationen oder Ressourcen, die sie an andere weiter geben können. Die ethnische Ökonomie bietet sich insofern im ethnisch konzentrierten Gebiet als Ausweg an aber sie stellt - was die Wege in den Arbeitsmarkt angeht - doch eine Sackgasse dar. D.h. die ethnische Ökonomie wird nicht als Ressource betrachtet, sondern als Falle. Durch die kulturelle Fremdheit und auch durch die Sackgassen im Integrationsprozess in die Mehrheitsgesellschaft ergibt sich daraus eine Dominanz von Eliten, die regressive Theorien vertreten; oft fundamentalistische Orientierungen, die die kulturelle Distanz idealisieren bzw. glorifizieren und Abgrenzung statt Integration predigen. Auf diesem Weg können die geringen Lebenschancen, die der Ausgangspunkt der Spirale sind, in Desintegrationsprozesse umschlagen. Die Nachbarschaftseffekte, die in segregierten Gebieten beobachtet werden, sind dabei ambivalent. Es existieren negative Effekte, wie die Beeinträchtigung der Lebenschancen, geringere Chancen in Bildung und in beruflicher Ausbildung, auf dem Arbeitsmarkt – mit der Konsequenz geringer oder ganz fehlender Einkommen. So werden Anreize für abweichende oder informelle Tätigkeiten der Geldbeschaffung, die von der Mehrheitsgesellschaft nicht geduldet oder nicht geschätzt werden, geschaffen. Positiv an segregierten Gebieten ist die soziale Einbettung, die Binnenintegration, die soziale Unterstützung, die gewährt wird und die damit die ethnische Ökonomie, die kulturelle Vertrautheit und die Aufrechterhaltung von Identität möglich macht. Es sind also immer ambivalente Effekte der Segregation im Auge zu behalten. Darüber hinaus muss gefragt werden: Wirkt ein segregiertes Gebiet – oder die sozialen Beziehungen oder die Kultur innerhalb des segregierten Gebietes - als Restriktion für die Lebenschancen oder als Unterstützung beim Weg in die Gesellschaft oder auch für die Kompensation von verpassten oder nicht gewährten Lebenschancen? 14 Nicht für alle ethnischen Minderheiten gilt, dass sie segregiert leben und dass sie auf den Gebieten Bildung und Arbeitsmarkt schlechte Erfolge haben. Es gibt auch innerhalb der ethnischen Minderheiten erhebliche Unterschiede. Effekte der Segregation sind vor allen Dingen für jugendliche Mitglieder einer Minderheit, die über geringe Ressourcen verfügen, problematisch. Das ist dadurch zu erklären, dass vor allem die Teile von Minderheiten, die über geringe Ressourcen verfügen, stark segregiert leben. Nur für diese sind die Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen auf den lokalen Kontext beschränkt. Je geringer der Bildungsgrad und der soziale Status sind, desto mehr sind die Verkehrs- und Kommunikationskreise lokal konzentriert. Diejenigen, die über geringe Ressourcen verfügen, sind auf die lokale Community angewiesen, aber gerade ihnen bietet die lokale Gemeinschaft wenig. Hier sehen wir einen Kreislauf von „Angewiesensein-Auf“ – und „Nicht-Herauskönnen“ aus einem lokalen Kreis, der für andere, die über mehr Ressourcen verfügen und in dem selben Gebiet leben, keine Restriktion darstellt. Sie verfügen über andere kulturelle Orientierungen und Kommunikationsbeziehungen. Zusammenfassend kann man sagen, dass es unmöglich ist, Nachbarschaftseffekte von Effekten der sozialen Zugehörigkeit zu isolieren. Es ist unabdingbar, nach Ressourcen, nach verschiedenen Gruppen, nach verschiedenen Minderheiten und auch nach Gebieten zu unterscheiden. Man kann nicht über ÇáÉ Nachbarschaftseffekte reden. Allgemeine, universell beobachtbare Effekte von Segregation gibt es nicht. Dabei darf die Unterscheidung zwischen freiwilliger und die erzwungener Segregation nicht vergessen werden. Die am schärfsten segregierten Gruppen sind die mit dem höchsten Einkommen. Die Segregationsbewegungen gehen von der Mittelschicht aus. Die aktiven Segregierer sind die, die über die Ressourcen verfügen und Wahlmöglichkeiten haben. Die Übrigen werden segregiert. Es besteht eine anhaltende und große Diskrepanz zwischen dem, was man über Effekte der Segregation weiß, und dem was in der Politik geglaubt wird oder man glauben möchte. Aussagen wie „Parallelgesellschaften sind eine Gefahr“ und „man muss soziale Mischung herstellen“, können falsch sein. Niemand weiß, ob es überhaupt in Deutschland segregierte Gebiete gibt, in denen stabil und auf Dauer bestimmte Personen leben – was die Voraussetzung für die Existenz von Parallelgesellschaften wäre - oder ob es nur Durchgangsstationen sind. Wir wissen nicht, ob die ethnischen Kolonien ähnlich wie Flüchtlingsheime mit ständig wechselnden Bewohnern funktionieren. Wir verfügen über unglaublich wenig Kenntnisse und es existiert noch wenig Forschung über diesen wichtigen Teil unserer Gesellschaft. c~òáí= Ethnische Segregation kann zu einem Problem werden, vor allem bei den Unterschichten. Das sind in der Regel auch diejenigen, die ethnisch segregiert sind. Beeinträchtigungen sind vor allen Dingen für die individuellen Lebenschancen zu befürchten - aber nicht allein wegen der Tatsache, dass es segregierte Gebiete gibt. Aus Forschungen aus Amerika kann man entnehmen, dass „Parallelgesellschaften“ bzw. ethnische Kolonien sich nach und nach auflösen durch Übergange von Individuen in die Mehrheitsgesellschaft - wenn die Chancen dafür gegeben sind. Deswegen ist die Entscheidung darüber, ob ethnische Kolonien desintegrativ wirken oder nicht, eine Entscheidung der Gesellschaft, inwiefern sie offen für MigrantInnen ist oder nicht. 15 3 Gesprächsprotokoll des Fachgespräches In der Diskussion im Anschluss an den Vortrag von Dr. Uwe Bittlingmayer („Bildung und Gesellschaft“) und an das erste Panelgespräch wurde eingehend erörtert, inwiefern die Reproduktion sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem verhindert werden könne. Als mögliche Lösungsmodelle wurden die Veränderung der Haltung zur Bildung, des Integrationsmodells in der Schule, der Normen der Lehrerausbildung sowie der Erwerb von Schlüsselqualifikationen diskutiert. Im Bezug auf den Vortrag von Dr. Berthold Vogel („Desintegration durch Arbeit - Integration durch Arbeitsmarktpolitik?“) wurde seine Anregung, eine kulturelle Neubewertung der Arbeit vorzunehmen, aufgenommen und dafür plädiert, die sinnstiftende normative Seite der Erwerbsarbeit und die materielle Seite der Existenzsicherung zusammenzudenken. Der Vortrag „Gesellschaftliche und politische Teilhabe durch bürgerschaftliches Engagement eine Herausforderung für die Reformpolitik“ von Dr. Ansgar Klein stimulierte eine Diskussion darüber, inwiefern die Frage, wie Migrantenorganisationen mehr zur gesellschaftlichen Integration beitragen können, stärker in den Fokus der politischen Debatte gerückt werden müsste. Auch sollte verstärkt an die Öffentlichkeit gebracht werden, was konkret diese Organisationen schon bezüglich der gesellschaftlichen Integration leisteten. Im Anschluss an Dr. Gisela Notz’ Vortrag „Geburtenrate und Familienpolitik im Wandel der Zeit“ wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern die Familie noch die Funktion einer integrativen Instanz in der Gesellschaft inne hat. Die Frage nach der integrativen Wirkung von Familienstrukturen blieb offen und wird Anknüpfungspunkt für weitere Veranstaltungen des Projekts „Gesellschaftliche Integration“ der Friedrich-Ebert-Stiftung sein. In der abschließenden Diskussion wurde vor allen Dingen deutlich, dass ressort- und politikfelderübergreifende Strategien entwickelt werden müssen, um Desintegrationsprozessen entgegenzusteuern. Es wurde angeregt, dass die Frage, welche eigentlich die gesellschaftliche Zielvorstellung von einer Integrationspolitik in den verschiedenen Politikfeldern ist, diskutiert und beantwortet werden muss. Einig war man sich, dass die unterschiedlichen Integrationsbereiche (u.a. Familienpolitik, Jugendpolitik, Stadtpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik) miteinander verzahnt werden müssen und eine politikfeldübergreifende Leitvorstellung zu entwickeln wäre. Am Beispiel der Evaluation des Programms „Soziale Stadt“ verdeutlichte Prof. Dr. Hartmut Häußermann, dass interdisziplinäres, ressortübergreifendes, horizontales und vertikales Arbeiten notwendig sei, um den Effekten der Segregation und den Desintegrationsprozessen entgegenzuwirken. Die Effekte der Segregation z.B. im Bildungssektor zeigten, dass (Aus-) Bildungs-, Jugend- und Familienpolitik miteinander verknüpft werden müssen. Übereinstimmung herrschte, dass Debatten um Integration, Chancengleichheit, Verteilungskonflikte und Beteiligungsgerechtigkeit besonders in den Bereichen Bildung, Ausbildung sowie Arbeit und Beschäftigung geführt werden müssen. Auch sei es dringend notwendig, den demographischen Wandel und seine Konsequenzen für die Politik ernst zu nehmen, wie Prof. Dr. Charlotte Höhn mehrmals in ihrem Vortrag betonte. Dabei wurde unterstrichen, dass sich auch im Rahmen der Diskussion von sozialer Ungleichheit auf die subjektive Wahrnehmung von prekären Lebensverhältnissen, sozialer Unsicherheit und Orientierungslosigkeit konzentriert werden müsse. 16 Kontrovers behandelt wurden Fragen bezüglich der Selbstorganisation von MigrantInnen. Es wurde diskutiert, inwiefern die Tendenz bestehen würde, MigrantInnen gemäß der Kategorien der Mehrheitsgesellschaft integrieren zu wollen. Darauf verwiesen wurde, dass sich Migrantenorganisationen durch Interesse an Kooperation und Integration definieren würden. Die Frage, inwiefern Migrantenorganisationen konkret Desintegrationstendenzen entgegen arbeiten können, blieb noch offen und wird Thema für weitere Veranstaltungen des Projektes „Gesellschaftliche Integration“ sein. Eine weitere Debatte entstand um die Frage der Begrifflichkeiten: Von welcher Art von Integration sprechen wir? Wohin soll integriert werden? Und welche Begrifflichkeiten sollten im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs für Menschen mit Migrationshintergrund verwendet werden? Festgestellt wurde dabei, dass Begrifflichkeiten Zuschreibungen, Vorurteile und Stigmatisierungen transportieren, die möglicherweise Ausgrenzungen provozieren bzw. verstärken sowie Dialog- und Diskussionsbereitschaft behindern würden. Offen blieb, ob überhaupt adäquate Begrifflichkeiten entwickelt werden können, da sich Migrationsprozesse und die Bildung von Identitäten in ständigem Wandel befinden. Im Rahmen der Diskussion wurde deutlich, dass die Begrifflichkeit „Integration“ oft unmittelbar mit der Integration von MigrantInnen in die Mehrheitsgesellschaft in Verbindung gebracht wird. „Integration“ umfasst jedoch noch weitere gesellschaftliche Dimensionen - nicht nur entlang des Migrationshintergrundes, sondern auch entlang der sozialen, ökonomischen und kulturellen Bruchstellen der Gesellschaft. Diese Frage nach den Begrifflichkeiten und Definitionen von „Integration“ und „Desintegration“ wird in dem 2. Fachgespräch unter dem Titel „(Des)-Integration. Begriffsbestimmung und Konzepte“ Vertiefung finden.