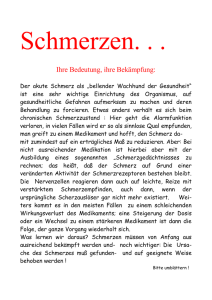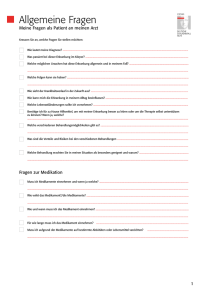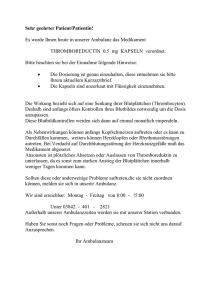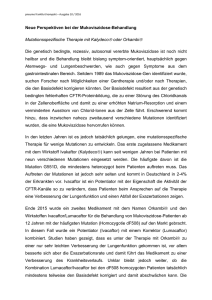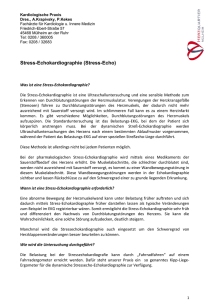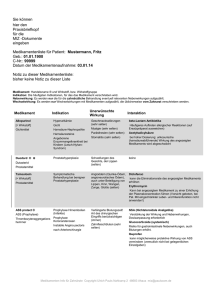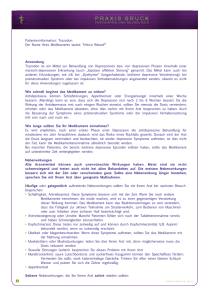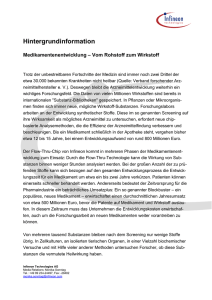Das Wort des Arztes ist eine Macht
Werbung

Das Wort des Arztes ist eine Macht Placeboforschung: Es geht nicht darum, Patienten heimlich wirkungslose Mittel unterzujubeln Deutsche Wissenschaftler beschäftigen sich intensiv mit dem Placeboeffekt. Die Frage ist unter anderem: Warum treten positive Wirkungen ohne erkennbaren medizinischen Grund auf? Von Christiane Löll (dpa) Giftgrüne Erdbeermilch mit leichtem Lavendelgeschmack – was sich nach einer harten Prüfung für die Sinne anhört, ist Bestandteil der Forschung zum Placeboeffekt. Das eigens entwickelte Getränk kam am Universitätsklinikum Essen zum Einsatz. Das Team in Essen ist Teil der bundesweiten Medikament oder frei von Wirkstoffen: Forscher sind verschiedenen Effekten von Placebos auf der Spur. Foto: Gina Sanders/Fotolia Forschergruppe 1328 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Sie will klären, welche Faktoren in welchem Ausmaß zum Placeboeffekt beitragen. Zwei Gründe treiben die Forscher an: Zum einen geht es darum, Erkenntnisse aus der Placeboforschung in den klinischen Alltag einzubauen. Die Bundesärztekammer hatte Anfang März eine Schrift veröffentlicht, in der sie den Status quo der Forschung zusammenfasst. Der zweite Grund: Bei der evidenzbasierten Medizin gehören placebokontrollierte Studien zum Standard. Neue Medikamente werden mit einem Placebo (einem wirkstofflosen Scheinpräparat) verglichen, um die Wirksamkeit des Präparates zu prüfen. Aber es mehren sich Stimmen, die die Aussagekraft solcher Studien infragestellen. Oder zumindest die Art und Weise, wie der Placebo-Effekt "herausgerechnet" wird, wie die Experten sagen. Drei Faktoren "Placeboeffekte beruhen auf drei grundlegenden Mechanismen", sagt Professor Manfred Schedlowski vom Universitätsklinikum Essen. Dazu gehören die Erwartungshaltung, bewusste oder unbewusste Lernprozesse, sowie die Qualität der Beziehung zwischen Arzt und Patient. "Alle diese drei Faktoren hängen zusammen, aber wir haben noch nicht herausgefiltert, was welchen Anteil hat", sagt der Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie. Schedlowskis Versuche mit der grünen Erdbeer-Lavendelmilch begannen bereits vor einigen Jahren. Das Team wollte – und will – den Aspekt der Lernprozesse auf den Placebo-Effekt untersuchen, im Rahmen einer klassischen Konditionierung, entsprechend den berühmten Versuchen mit den Pawlowschen Hunden. Denen wurde das Futter zunächst immer zusammen mit einem Glockenton gereicht, so dass die Hunde irgendwann allein beim Hören der Glocke zu sabbern anfingen. Solch einen Sinnesreiz wollten die Essener Forscher setzen – und kreierten ihre Erdbeermilch. "Reihen von Medizinstudenten tranken verschiedene Getränke und wählten dann diese Milch als besonders einzigartig und neu im Geschmack heraus", berichtet Schedlowski. Sinn und Zweck der Sache: Mit diesem Getränk spülten gesunde Probanden vier Mal in zwei Tagen das starke Immunsupressivum Ciclosporin A herunter. Dieses erhalten beispielsweise Patienten nach einer Organtransplantation, um die Abstoßung des fremden Organs zu verhindern. Das Blut der Studienteilnehmer wurde untersucht. Die Forscher warteten dann einige Tage ab, bis Ciclosporin A wieder aus dem Körper der Probanden heraus war – und ließen die Studienteilnehmer noch einmal die Milch trinken – diesmal aber ohne das Medikament. "Es zeigte sich, dass dennoch eine Wirkung am Immunsystem zu sehen war, zwar nicht ganz so stark wie beim Medikament, aber allein durch den Geschmacksreiz hatte sich der Körper offensichtlich darauf eingestellt", sagt Schedlowski. Ein weiterer Versuch mit dem grünem Drink: 30 Hausstauballergiker erhielten fünf Mal ein Antihistaminikum zur Verminderung der Allergie zusammen mit dem Getränk. Nach einer Pause von zehn Tagen wurden drei Gruppen gebildet, die folgendes erhielten: Wasser plus Medikament, Erdbeermilch plus Placebo, Wasser plus Placebo. Anhand von Hauttests stellten die Forscher fest, dass bei allen nach dieser Gabe eine schwächere Reaktion auftrat, doch auf der Ebene von Blutzellentests hatte vor allem die Gruppe reagiert, die erneut die Erdbeermilch erhalten hatte – und kein Medikament. Würde das also bedeuten, dass Mediziner einfach weniger "echte" Pillen verschreiben können? Könnten sie vielleicht jeden zweiten Tag eine Attrappe geben, die Wirkung tritt trotzdem ein, aber Kosten und Nebenwirkungen sinken, wie angedacht? "Theoretisch wohl schon, ethisch ist das aber ein Problem und verletzt das Vertrauen zwischen Patienten und Arzt", sagt der Hamburger Neurowissenschaftler Professor Christian Büchel. Als eines der höchsten Güter der Arzt-Patient-Beziehung gilt die vollständige Aufklärung und die Einwilligung des Patienten – doch wie soll man seinem Patienten klar machen, dass man ihm unter Umständen keine "echte" Medizin geben will? "Das ist gar nicht das Ziel, sondern wir möchten die Effekte von positiver Erwartung bei Behandlungen nutzen", sagt Büchel. Die britische Royal Society hat der Placebo-Forschung in ihren "Philosophical Transactions" kürzlich ein ganzes Heft gewidmet. Dieses hat die Münchner Medizinerin Karin Meissner zusammen mit zwei Kollegen herausgegeben. Am Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Uni München erkundet sie, wie auch innere Organe über das vegetative bzw. autonome Nervensystem von der Erwartungshaltung beeinflusst werden können. In einer Studie erhielten Probanden drei Mal Tabletten: Pillen, die die Magen-Aktivität steigern, senken oder gar nicht beeinflussen sollten. In Wahrheit hatten sie alle keine Wirkung. Mit Elektroden über der Bauchdecke wurden die Kontraktionen des Verdauungsorgans überwacht – und einmal mal mehr zeigte sich: Die Aktivität des Magens war am stärksten, wenn es sich um eine anregende Pille handeln sollte. "Für uns bedeutet das, dass verbale Äußerungen über Repräsentationen unserer Organe im Gehirn das Nervensystem beeinflussen können. Das heißt, dass das Wort des Arztes eine Macht hat – und diese sollte richtig eingesetzt werden." Wirksamkeit belegen Die Rolle des Placebo-Effekts bei Medikamentenstudien hat der Tübinger Psychologe Paul Enck für die Royal Society zusammengefasst. "Bei einem traditionellen Design wird die Wirksamkeit von Medikamenten in Studien mit zwei ,Armen‘ untersucht", sagt Enck. Der eine Teil bekommt das zu prüfende Medikament, der andere Teil ein Placebo, und wer was bekommt, ist weder dem Studienleiter noch den Patienten bekannt. In beiden Armen hat die Einnahme der Medikation einen Einfluss. "Er muss beim Medikament größer sein als in der Placebo-Gruppe, um die Wirksamkeit zu belegen." Daher wird der Placebo-Effekt von der Wirkung des Medikaments subtrahiert und so die Wirksamkeit errechnet. "Die Frage ist aber nun: Ist der Placebo-Anteil auf Seite des Medikaments wirklich genauso hoch wie in der Kontrollgruppe?" Enck sieht darin keine rein akademische Frage, möglicherweise könnte die Wirkung der zu prüfenden Medikamente über- oder unterschätzt werden. Eine Alternative bieten Studien, in denen neue Medikamente mit vergleichbaren Wirkstoffen verglichen werden. "Doch wie groß ist denn da der Placebo-Anteil, wenn gar kein Placebo gegeben wird, sondern die Patienten auf jeden Fall einen Wirkstoff erhalten? Hier lässt sich nur mit vielen Studienteilnehmern herausfiltern, ob das neue Medikament über- oder unterlegen ist."