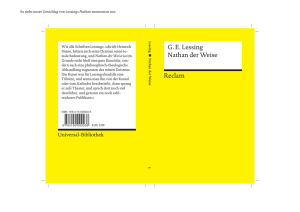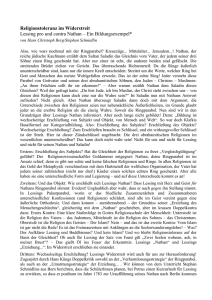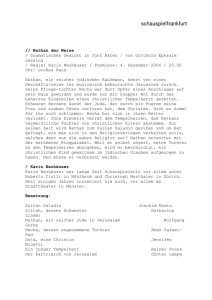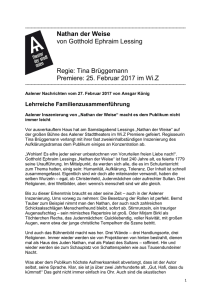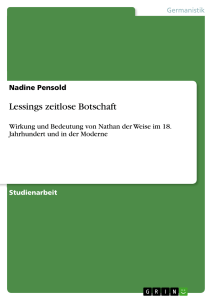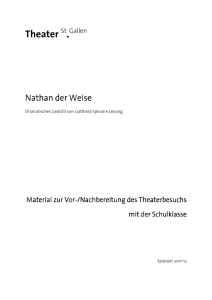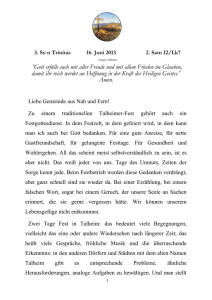GESCHICHTEN GEGEN DEN TOD
Werbung

GESCHICHTEN GEGEN DEN TOD ... Gedanken zu Lessings „Nathan der Weise“ Lessing stimmt mit seinem dramatischen Gedicht „Nathan der Weise“ einen Lobgesang auf den Menschen an. In jeder Szene demonstriert er exemplarisch wie Vernunft und Toleranz gegen ungebremste Leidenschaften siegen. Sein Stück wirkt wie ein Handbuch zur angewandten Menschlichkeit. Fanatikern sei es zur Bettlektüre empfohlen. Aber damit macht es uns Lessing heute nicht leicht. Sein Optimismus macht skeptisch, provoziert Widerspruch. Ist Lessing, der als Menschen- und Judenfreund in die Literaturgeschichte eingegangen ist, ein Träumer? Und ist sein Menschenbild viel brüchiger als es auf den ersten Blick scheinen mag? Wie alle politischen Dichter, hat Lessing gegen das Blut und den Tod geschrieben. „Nathan der Weise“, 1779 fertiggestellt, war Lessings Antwort auf ein Schreibverbot. Er durfte sich in Fragen der Religion nicht mehr öffentlich äußern. So nutzt er das Theater für einen poetischen Generalangriff gegen die unheilige Allianz von christlicher Dogmatik und der Willkür seines Braunschweiger Herzogs, gegen Antisemitismus und Intoleranz. Im „Nathan“ drückt sich Lessings persönliches Ringen um Aufklärung und die Freiheit des Denkens aus. Das ist das Herz des Stückes. Er nutzt das Theater als Boten für einen Brief an die Mächtigen in Religion und Politik, einen Brief, der es bis heute verdient hat, überstellt und gelesen zu werden. Wie sein Nathan in Jerusalem, so erzählt Lessing mit seinem Theaterstück eine (Ring-)Parabel für seine Zeit und entwirft Gedanken und Utopien, deren Radikalität heute kaum zu ermessen ist. Doch auch biographisch gesehen war „Nathan“ ein Stück gegen das Blut und den Tod. Noch während Lessing am Nathan arbeitete, starb sein nur wenige Stunden alter Sohn und wenige Tage später folgte dessen Mutter, Lessings große Liebe, die Schauspielerin Eva König, ihm in den Tod. Lessing war danach ein gebrochener Mann. Mit der Trauer über diesen Verlust in den Knochen vollendet er sein „Dramatisches Gedicht“. „Nathan“ ist sein theatrales Vermächtnis. Lessings persönliche Erfahrungen sind so sehr in sein letztes Theaterstück eingeflossen, dass man den Autor immer wieder aus „Nathan“ sprechen hört. Die Erfahrung von Repression und Willkür und das private Unglück fließen da zusammen. Er selbst hat übrigens keine Aufführung mehr erlebt. Lessing starb 1781, zwei Jahre vor der Uraufführung in Berlin. Das Paradies in der Hölle Woher kommt bei Lessing dieser fast unheimliche Glaube an den Menschen? Vielleicht muss man sich die Hölle als Paradies vorstellen, um sie zu ertragen. Bei Lessing fließen keine neuen Blutströme. Die Familie, von der er in „Nathan der Weise“ erzählt, wird beschützt. Sie wird vor dem Unheil, das in Jerusalem hinter jedem Stein lauert, durch einen Geschichtenerzähler bewahrt. Nathans Weisheit macht Staunen und zerreißt eine Kette von Gewalt, zumindest für den Augenblick. Lessings „Nathan“ spielt im Jerusalem der Kreuzzüge des 12. Jahr-hunderts, der vielleicht düstersten Epoche des Christentums. Europa zog in einen „heiligen Krieg“. Jerusalem, die heilige Stadt, wurde nach der Eroberung durch die Christen zu einer Totenstadt, die Gemetzel an Juden und Moslems waren von unvorstellbarer Grausamkeit. Hinein in diesen symbolischen Ort des Glaubens und des Todes pflanzt Lessing seine Familiengeschichte. Es ist eine optimistische Geschichte, die die Abgründe von Fanatismus und Krieg hell überstrahlt. Saladin, der Sultan von Jerusalem und Adressat der Ringparabel, zeigt im besten Sinne Schwäche und rettet den Tempelherren, einen Feind, von dem man später erfährt, dass er der Sohn von Saladins Bruder Assad ist. Der vom Hass auf die Juden und Moslems fanatisierte Tempelherr rettet das angebliche Judenmädchen Recha, in das er sich verliebt und das sich schließlich als seine Schwester herausstellt. „We are familiy!“, sie gehören alle zusammen, Christen, Juden und Moslems. Sie bilden alle eine Schicksalsgemeinschaft. Man muss auf die Geschichten hören, dann kann das Blutvergießen vielleicht enden, „unter stummer Wiederholung allseitiger Umarmungen fällt der Vorhang“, lautet Lessings letzte Regieanweisung. Nathan war der Regisseur, er hat sie alle zusammen geführt. Doch er fällt nicht mit ein in die Umarmungen. Wer ist dieser Nathan? Lessing formuliert in seinem Stück „Nathan der Weise“ zweifelsohne Fragen, die uns bis heute beschäftigen. Vielleicht ist der Text auch weiterhin so faszinierend für das Theater, weil er sich einer völligen Entschlüsselung entzieht. Jeder guten Geschichte bleibt ihr Geheimnis. Die Figur des Nathan ist dabei das größte Rätsel. Was steckt hinter dieser Figur? Lessing schickt seinen Nathan in einen Hexenkessel des Fanatismus. Er rettet ein paar Menschen und sich selbst aus der Hölle, die einen Namen hat, Jerusalem, und entwirft eine Vision von einer friedlichen Koexistenz der drei Weltreligionen. Wer ist dieser Nathan, der so schillernd ist, wie der Opal auf dem Ring, von dem es heißt, „er spiele hundert schöne Farben“ und habe eine „geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen.“ Steckt in Nathan noch der Melchisidech, aus Boccaccios „Decamerone“, aus dem Lessing die Ringparabel kannte, ist er ein Märchenerzähler aus 1001 Nacht, ist er ein Heiliger, ein Prophet, ein Gegen-Shylock, eine Antwort auf Shakespeares Juden im „Kaufmann von Venedig“? Ein Engel des Guten? Spricht aus ihm die Lebens- und Leidenserfahrung von Lessing? Wer ist dieser gute Jude von dem Saladin Wahrheit fordert, nicht mehr und nicht weniger? Es war einmal ... Es war einmal ein palästinensischer Vater, der verlor im Kugelhagel der Israelischen Armee sein Kind. Die Organe des toten Kindes spendete er an kranke israelische Kinder. Fortan lebte eine palästinensische Niere, Leber und Lunge in israelischen Kindern weiter. Eine andere Geschichte geht so: Es war einmal ein Jude, der verlor seine sieben Söhne und seine Frau in einem Massaker, das Christen den Juden zufügten. In der Asche der toten Familie überreicht ihm ein Fremder ein kleines Kind. Sie ist die Tochter eines Christen. Der Jude überwindet seinen Hass und seinen Schmerz mittels der Liebe, die er zu diesem Kind entdeckt und zieht es mit größter Sorgfalt und Hingabe auf. Die erste Geschichte ist eine wahre Geschichte aus dem heutigen Palästina. Sie wird (so ähnlich) in dem Dokumentarfilm „Das Herz von Jenin“ (2005) erzählt, die zweite Geschichte ist ein Motiv aus dem „Nathan“. Diese ungeheuerliche Geschichte ist Nathans Geschichte. Er behält sie für sich, sie bleibt lange ganz sein Geheimnis, nur der Klosterbruder wird sie von Nathan erfahren, und wir Zuschauer – da haben wir die Ringparabel längst gehört. „Der aus Büchern erworbene Reichtum fremder Erfahrung heißt Gelehrsamkeit. Die eigene Erfahrung ist Weisheit. Das kleinste Kapitel von dieser ist mehr wert als Millionen von jener.“ (Lessing, Erziehung des Menschengeschlechts) Gezähmt durch Poesie Manche Geschichten (Bücher) wirken wie ein Schlüssel zu fremden Sälen des eigenen Schlosses, hat Franz Kafka notiert. Lessings „Nathans“ ist so eine Geschichte. Am Ende landet man bei Nathan, bei Lessing und hoffentlich bei sich selbst. Der schweigende Nathan steht am Rand. Sein Schweigen erzählt von der extremen Zerbrechlichkeit der Konstruktion, die Lessing für sein ganzes Stück aufwendet. Die komplizierte Familiengeschichte ist, wie das ganze Aufklärungs- und Zivilisationsprojekt der Menschheit, immer gefährdet. Nathan spielt die Karte an den Zuschauer weiter. „Es eifre jeder seiner unbestochnen von Vorurteilen freien Liebe nach! Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen ...“ Seine Aufforderung an jeden einzelnen Menschen ist durchdrungen von einem Wissen um die Abgründe, die in uns allen lauern. Lessing hat mit sich selbst gerungen. Seinen Hass und seine Wut auf seine Epoche durfte er nicht mehr herausschreien. Er hat sich gezähmt durch Poesie. Er hat sich in die Kunst gerettet. Sein dramatisches Gedicht hat ihn selbst besänftigt, bevor es den ersten Zuschauer im Theater mit den Tugenden seines Helden Nathan konfrontierte. Lessing wusste um den Menschen. Der schweigende Nathan am Ende, der mundtote Lessing, sie scheinen uns das mitteilen zu wollen: Auf uns selbst kommt es an. Wir haben es in der Hand. Lasst uns Geschichten erzählen gegen das Blut und den Tod, immer und immer wieder ... Frank Behnke LEBEN.LIEBEN.GLAUBEN Fragen an den „Nathan-Regisseur“ Georg Schmiedleitner Wir haben im Zuge der Proben viel über das „Geschichtenerzählen“ nachgedacht. Wie erzählst Du Lessings dramatisches Gedicht? Krieg, Feuer, Zerstörung: Das ist die Ausgangssituation, daraus entwickelt sich die Geschichte. Das ist das Szenario einer vergangenen aber auch heute präsenten und nahen Wirklichkeit. Die Menschen haben Heimweh, Hunger und Angst, haben Sehnsüchte und Albträume, flüchten sich in Wunderglauben und Depression. Nathan kommt von einer Geschäftsreise zurück nach Jerusalem und findet in seinem Hause diese zerstörte Welt und eine verängstigte Familie vor. Doch er lässt sich nicht mitreißen von den Gefühlen und Verletzungen, die ihm begegnen und fordert von Beginn an menschliche Geisteskraft und Vernunft ein. Mit Nathan betritt ein großer Gedanke die Bühne. Zu groß scheint es, unerfüllbar in seinen Forderungen. Er bleibt kalt, obwohl ihn eine tiefe Sorge und Liebe leiten. Er erscheint unmenschlich, obwohl er das Menschliche über alles stellt. Seine Ideen und Ansprüche scheinen das Menschlich-Weltliche verloren zu haben, sind wie aus einem Labor des Humanen, scheinen ein theoretisches und abstraktes Konstrukt eines von Toleranz getriebenen Hirnes zu sein. Was heißt diese Sicht auf Nathan für die anderen Figuren? Nathan bleibt unerreichbar für alle, nicht greifbar für die Menschen um ihn herum. Sie alle erscheinen wie Probanden in einem wissenschaftlichen Human-Experiment. Doch die Menschen wollen sich so schnell nicht beugen: sie wollen leben, lieben, glauben. LEBEN.LIEBEN.GLAUBEN. Sie wollen für das Leben etwas wagen, für den Glauben kämpfen und verraten, für die Liebe sündigen. Sie wollen toben und zürnen, hassen und ausgrenzen. Sie wollen Grenzen kennen lernen und Leidenschaften erfahren. Nathan führt einen schonungslosen „Wahlkampf“ für seine Ideen und scheint ihn immer wieder zu verlieren. Hat er in seinem bedingungslosen Toleranzkampf den Blick für die Wirklichkeit verloren? Seine Gedanken und Forderungen werden immer unwirklicher und dadurch monströser. Recha fühlt sich gefangen und missbraucht, der liebende Tempelherr getäuscht und in die Irre geführt. Saladin, der Sultan, durchschaut und in den „Staub“ geworfen. Fast scheint es so, als würden die Toleranzideen und -forderungen Nathans das Gegenteil bewirken. In der beginnenden Harmonie keimt plötzlich Rache und Aggression, entstehen panische Fluchtgedanken und drängt religiöser Fanatismus wieder an die Oberfläche. Indem Nathan den Abbau von Feindschaften, von Grenzen und von zerstörenden Ideologien fordert, erkennen die übrigen Menschen ihr Ausgeliefertsein. Das schafft Ängste und Panik. Gerade im zweiten Teil des Stückes kehren die Figuren zu ihren alten Mustern zurück, ja sie befördern und radikalisieren diese sogar noch. Bleibt der Toleranzgedanke des Nathan doch eher konstruierte Idee, theoretische Vision, beginnt das Theater in den übrigen Figuren immer mehr Raum zu gewinnen. Ihr vital menschlicher Individualismus, ihre begeisterte Gier nach Leben und Liebe tobt sich gegen die unverstandene Toleranzidee aus. Nathans Forderung nach menschlich geprägter Vernunft bleibt unerreicht. Nathan ist übermächtig, allgegenwärtig und doch nicht vorhanden. Wie kann man eine Figur spielen, die reines Ideenkonstrukt ist? In unserer Inszenierung ist Nathan keine Einzelfigur, sondern wird von allen Schauspielern gespielt. Aus diesem „Chor“ entwickeln sich auch die übrigen Figuren. Mal sind es mehr, mal weniger Nathans. Immer aber ist Nathan ein Team. Das Forscherteam eines humanen Experiments, Architekten des Toleranzgedankens, Richter der Menschlichkeit. Das schafft zwei Welten und Spielbereiche, das schafft aber auch Konflikte und Reibungen. Vor allem aber vermeidet es falsche und zu enge Assoziationen zum Juden Nathan. Die Idee bleibt Utopie, unerreichbar in ihrer Radikalität, unerhört in ihrer Komplexität. Aber einmal in dieser Konsequenz gelebt und ausgesprochen bleibt sie im Raum real und damit auch die Illusion und Vision für die das Theater steht. Die anderen Figuren sind die, von denen das Theater lebt, mit denen wir uns identifizieren und mit denen wir mitfühlen, mithassen, mitweinen und mitlieben.