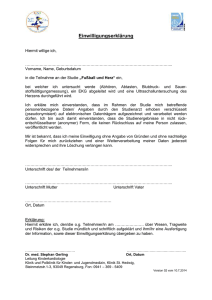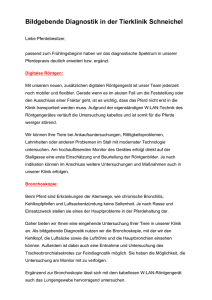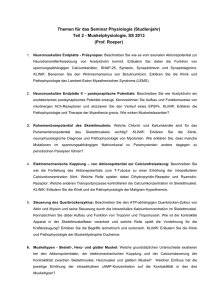PDF - Psychiatrie
Werbung

150 Jahre Psychiatrische Klinik St. Pirminsberg 150 Jahre Psychiatrische Klinik St. Pirminsberg 1847–1997 150 Jahre Psychiatrische Klinik St. Pirminsberg 1847–1997 Kantonale Psychiatrische Dienste – Sektor Süd Klinik St. Pirminsberg, 7312 Pfäfers, © 1997 INHALT Festschrift Vorwort 4 Von den Anfängen der Klinik Die Gründung der Klinik und das politische und soziale Umfeld Das Wartpersonal Hygiene in der Anstalt im 19. Jahrhundert Historische Daten 6 8 10 12 Persönlichkeiten Heinrich Ellinger – Der erste Chefarzt der Klinik St. Pirminsberg 16 Constantin von Monakow 22 Erinnerungen an Manfred Bleuler 28 August Zinn – klar, wohlwollend, stark 34 Chefärzte, Verwalter, Oberpfleger 40 Bilder der Festivitäten, 15. – 17. August 1997 42 Eine moderne Klinik stellt sich vor Soziale und politische Einbindung der Klinik 46 Die Klinik in Zahlen 48 Behandlungsangebot und Berufsgruppen 50 Die Aufgaben der Pflege 60 Die Klinikseelsorge 64 Die Klinik als Unternehmen 66 Zukunft der Psychiatrischen Klinik 68 Quellennachweise 74 Literatur Autoren Bilder 2 Gönner und Sponsoren der 150-Jahr-Feier 76 Impressum 78 3 VORWORT 4 Vorwort Regierungsrat Anton Grüninger, Vorsteher des Gesundheitsdepartements, Kanton St. Gallen «Wenn Du sehr alt werden willst, musst Du beizeiten anfangen.» Im Sinn dieses Sprichworts entstand vor 150 Jahren mit der Kantonalen Psychiatrischen Klinik St. Pirminsberg die erste öffentliche Institution im St. Gallischen Gesundheitswesen. Bis zur Eröffnung der Kantonalen Psychiatrischen Klinik Wil im Jahre 1892 war die jubilierende Klinik die einzige Institution für stationäre Betreuung psychisch Kranker im ganzen Kantonsgebiet. Die vorliegende aussagekräftige Festschrift schildert die Entwicklung der Klinik von diesen ersten Tagen bis in unser aktuelles Computer-Zeitalter. Die Schrift geht ein auf die Anforderungen, die an die Spitalverantwortlichen, im ärztlichen wie im nichtärztlichen Bereich, gestellt wurden. Der Leser erlebt eine bewegte Geschichte. Er erfährt, dass spezielle Herausforderungen nicht ein besonderes Zeichen unserer Zeit sind. Dennoch glauben wir, am Ende des 20. Jahrhunderts, an einem eigentlichen Wendepunkt im eidgenössischen und kantonalen Gesundheitswesen zu stehen. Zahlreiche Massnahmen sind darauf ausgerichtet, die Qualität zu verbessern und gleichzeitig das belastende Wachstum der Gesundheitskosten zu bremsen. Die St. Galler Regierung hat diese Zielrichtung in mehreren Erlassen aufgenommen, so im Leitbild Gesundheit 1992 oder in der zurzeit laufenden Umsetzung der Spitalplanung 1995. Die Klinik St. Pirminsberg ist nun Zentrum der Kantonalen Psychiatrischen Dienste des Sektors Süd, der die Bezirke Oberrheintal, Werdenberg, Sargans, Gaster und See sowie einige Unterrheintaler Gemeinden umfasst. In Heerbrugg, Sargans und Uznach werden Beratungsstellen geführt. Mit der Sektorisierung werden in fachlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht Verbesserungen erzielt. Sie ermöglicht eine bereichsübergreifende Planung, Führung und Zusammenarbeit und schafft klare Kompetenzen und Verantwortungen. Ein Leistungsauftrag und klare fachliche Leitlinien für die gesamte Behandlungskette ermöglichen eine patienten- und prozessorientierte Ausrichtung der Organisation. Mit der flexiblen Ausgestaltung der bestehenden Angebote kann besser auf Veränderungen im Umfeld reagiert werden, gleichzeitig erhöht sie den unternehmerischen Spielraum der Sektorleitung und ermöglicht optimalen Mitteleinsatz. Wir brauchen auch in der Zukunft eine starke stationäre Psychiatrie und sind dafür im Kanton St. Gallen auf zwei Kliniken angewiesen. Durch die zunehmende Überalterung der Bevölkerung wird sich der Bereich Gerontopsychiatrie noch vergrössern. Einen wesentlichen Teil des Auftrags bildet zudem die Behandlung von Suchtpatienten. Ich bin überzeugt, dass sich die Kantonale Psychiatrische Klinik St. Pirminsberg den neuen Aufgaben offen, dynamisch und flexibel stellen wird. Trotz allem technischen Fortschritt gehört die Krankheit zum Los des Menschen. Es ist daher doch immer wieder der Mensch, der mit seiner Liebe, Fürsorge und Zuwendung dem Kranken Heilung, zumindest Linderung bringt. Dies gilt in ganz besonderem Masse für die Belange der Psychiatrie. In diesem Sinn wünsche ich der jubilierenden Klinik für die Zukunft weiterhin solche engagierten, fürsorgenden und pflegenden Menschen, wie dies seit 150 Jahren der Fall ist. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diesen verantwortungsvollen, aber auch dankbaren Einsatz im Dienst des kranken Mitmenschen. Vorwort 5 VON DEN ANFÄNGEN DER KLINIK 6 Die Gründung der Klinik und das politische und soziale Umfeld Vladimir Sibalic In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entschloss sich die Regierung des Kantons St. Gallen, eine öffentliche Institution für die Geisteskranken zu errichten. Sie hatte als eine der ersten in der Schweiz die Unzulänglichkeiten im Umgang und in der Behandlung der psychisch kranken Menschen erkannt. Nur allzu oft wurden diese unglücklichen Menschen als Hexen oder Hexenmeister verdammt und verfolgt. Ihre Mitbürger verhielten sich unmenschlich, brutal und grausam ihnen gegenüber. Die Wahnsinnigen sperrten sie gefesselt mit Westen und Riemen in dunkle Keller. Je nach Lust und Laune wurden anschliessend sogar Familienmitglieder gefoltert oder misshandelt. Es existierten zwar bereits private Anstalten für Geisteskranke in Wattwil, Wittenbach und St. Leonhard. Sie beherbergten aber lediglich wohlhabende Kranke. Um die Armen kümmerte sich niemand, weil der Fond zur Unterstützung der Siechenhäuser vergeudet und von vielen Gemeinden in Anspruch genommen worden war. Dr. Stoll, Bezirksarzt von Untertoggenburg und Oberuzwil, forderte im Jahre 1836 die Errichtung einer Irrenanstalt. Er kritisierte diejenigen Ärzte, die sich ohne seriöse Ausbildung leichterhands mit der Psychiatrie beschäftigten. Es soll sogar vorgekommen sein, dass sich Nichthumanmediziner anmassten, in der Irrenpflege kundig zu sein. Nachdem im Kanton St. Gallen 526 Geisteskranke statistisch ermittelt worden waren, schien eine öffentliche Institution unumgänglich zu sein. Der Architekt Kübli und Dr. Rheiner aus St. Gallen empfahlen nach Besichtigung von ausländischen Anstalten die Errichtung einer solchen nach deutschem Modell. Hierfür hätte man einen Neubau errichten oder ein anderweitig genutztes Gebäude umfunktionieren sollen. Das Plateau von Abtwil, der Rorschacherberg, die Region Wil, Werdenberg, Mels oder Sargans boten sich als geeignete Orte für einen Neubau an. Für die Alternative stellten die zwei Herren die Statthalterei bei Rorschach und das säkularisierte Kloster in Pfäfers zur Diskussion. Eine Dreierkommission, bestehend aus Dr. Rheiner, Dr. Näff und Dr. Curti, sprach sich kurze Zeit später für das ehemalige Kloster St. Pirminsberg aus. Die Nutzung eines bestehenden Baues schien bedeutend kostengünstiger zu sein. Obwohl die Angelegenheit in wirtschaftlicher Hinsicht geklärt war, konnte sie sich auf politischer Ebene nicht durchsetzen. Herr Landammann Baumgartner, Herr Regierungsrat Näf, die Kantonsrichter Lutz und Dr. Wild und der Altbezirksammann Herr Good bildeten eine weitere Kommission und stellten sich gegen diesen Vorschlag. Im Jahre 1844 empfahlen sie der Regierung, die erste Begutachtung zu verwerfen. Sie stellten sogar die Notwendigkeit einer St. Pirminsberg – barocke Kulisse, einst geschaffen zur Anbetung der Ewigen. Von den Anfängen der Klinik «Irrenanstalt» in Frage, weil sie der Zählung der Geisteskranken nicht vertrauten. Zudem befürchteten sie, dass die grosse Distanz zur Staatsverwaltung in St. Gallen zu hohen Kosten führen würde. Die kalten und düsteren Mauern des Klostergebäudes wollten sie den Geisteskranken auch nicht zumuten. Die Nähe zu den Thermalbädern Bad Pfäfers und Bad Ragaz empfanden sie als unpassend. Empört reichte Dr. Curti, ein Bürger von Rapperswil, eine Petition ein, worin er den Grossen Rat auf seine humanitäre Pflicht hinwies, den armen und unglücklichen Geisteskranken beizustehen. Die Gemeinde Pfäfers reichte ihrerseits auch ein Begehren an die Regierung ein. Sie befürwortete die Errichtung der Anstalt. Sie würde viele Arbeitsplätze bieten, das Überleben von Familien sichern und somit der schlechten Wirtschaftslage entgegensteuern. Komfort von vorgestern Diese treffenden Argumente und der hartnäckige Einsatz überzeugten zwei Mitglieder der Kommission. Dank ihrer Unterstützung beschloss der Grosse Rat 1845 die Errichtung der Heil- und Pflegeanstalt St. Pirminsberg. Es stellte sich nun die Frage, ob die Aufsicht der Anstalt einer ständigen Kommission, einem Inspektor oder dem Anstaltsdirektor übergeben werden sollte. Einigkeit bestand darin, dass es eine Person sein musste, die organisatorische und ärztliche Kenntnisse hatte und in der Lage war, die Hausordnung zu überwachen. Schon kurze Zeit später erwies sich die Wahl des Inspektors als die beste Lösung. Um die ärztliche Tätigkeit in den Vordergrund zu stellen, erhielt der Direktor entsprechend viel Einfluss über die ihm untergeordnete Verwaltung. Nur im Krankheitsfalle war die Wahl eines Assistenzarztes als sein Stellvertreter vorgesehen. Der Oberwärter musste Fähigkeiten in der niederen Chirurgie besitzen, die Oberwärterin die Lingerie besorgen. Zusätzlich waren noch sechs Wärterinnen, sechs Wärter und viele Mägde einzustellen. Nach der Wahl von Dr. Heinrich Ellinger zum ersten Direktor stand der Eröffnung der Heil- und Pflegeanstalt St. Pirminsberg nichts mehr im Wege. Aus Kostengründen war der Umbau des alten Klosters in Etappen vorgesehen, was zwar die ärztliche Tätigkeit in den ersten Jahren erheblich beeinträchtigte, aber um so bewundernswerter machte. 7 Das Wartpersonal Theresa Kühne – Evort Meyer Seit der Gründung der Klinik spielte die Betreuung der Patienten im Alltag eine entscheidende Rolle. Wenngleich die Körperpflege und ein geregelter Tagesablauf inhaltlich mit eigentlichen Pflegeaufgaben, wie man sie auch heute noch kennt, vergleichbar waren, so spielten die Beaufsichtigung und die Überwachung zur Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Disziplin eine entscheidende Rolle. Darum wurden die ersten Betreuungspersonen Wärterinnen und Wärter genannt. Das Wartpersonal hatte keine Ausbildung in Pflege. Anfangs waren es eher gescheiterte Existenzen, die zu jedem anderen Geschäft untauglich waren. Unter den ersten Wärtern gab es etliche Söldner aus den neapolitanischen Kriegen, weshalb in St. Pirminsberg die Wärter anfänglich «Napolitaner» genannt wurden. Es bestand ein Mangel an Bewerbern durch die in der Bevölkerung bestehenden Vorurteile gegenüber der Irrenpflege. Der Lohn war niedrig. Viele betrachteten den Wartberuf als Durchgangsbeschäftigung, z. B. im Winter, bis es bessere Arbeit gab. Wenn sich jemand für diese Tätigkeit entschlossen hatte, bedeutete das eine grosse persönliche Einschränkung und Verzicht. Die Wärterinnen und Wärter teilten ihren Alltag mit den Patienten. Nachts mussten sie zusammen mit den Kranken im gleichen Zimmer schlafen. Dieser Zustand hatte Bestand bis in die Mitte dieses Jahrhunderts und trug entsprechend zum negativen Image bei. Schnell war im Volksmund klar, dass man so etwas nicht lange Zeit tun kann, ohne selbst verrückt zu werden. 1854 schrieb ein Zeitgenosse zu diesem Thema: «Nicht leicht und angePatientenzimmer nehm ist es, stets in Gemeinschaft mit Geisteskranken zu leben, die, oft Anfangs 20. Jahrhundert von heftigsten Leidenschaften beherrscht, reizbar und eigensinnig sind, sich widerspenstig betragen und erfüllt von Menschenhass, erwiesene Gefälligkeiten zurückwiesen. Der Wärter muss deshalb Selbstbeherrschung besitzen, um so manchen Verdruss, der sich immer wieder erneuert, geduldig aufnehmen und beleidigendes Geräusch (Beschimpfungen) ruhig anhören zu können. Es muss derselbe gesund, kräftig und gewandt sein, um die Mühen des Dienstes zu ertragen. (...) Ebenso notwendige Eigenschaften desselben seien Mut und schnelle Entschlossenheit, um im Augenblick der Gefahr nicht die Gegenwart des Geistes zu verlieren». Zudem waren alle Angestellten dem Direktor und Arzt zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet. Andererseits war das Personal auch körperlichen Krankheiten wie Epidemien gewissermassen schutzlos ausgeliefert. Nicht selten erkrankten Wärterinnen und Wärter an Tuberkulose. Diese war besonders gefürchtet, da es im vorigen Jahrhundert keine Behandlungsmöglichkeit gab. Die Beziehung zwischen der Gemeinde Pfäfers und der Anstalt, die als «Eindringling» empfunden wurde, war mit Verständigungsproblemen beladen. Erst mit der Zeit wählten einige Leute vom Dorf die Anstalt als Arbeitsplatz. So berichtete Direktor Ellinger, dass sich trotz des tiefen Lohnes einige junge Männer aus der Gemeinde Pfäfers für eine Wartstelle bewarben. Das bewies, dass die Bürger endlich die Scheu vor den Kranken abgelegt hatten. Die Anstaltsleitung bemühte sich, ein möglichst angenehmes Klima zu schaffen. Das gelang mehr oder weniger. Grenzkonflikte mussten gelöst werden. Die Einwohner der Gemeinde durften auf keinen Fall verärgert werden, da man auf sie als Arbeitskräfte zählen wollte. Die Anforderungen an den Oberwärter waren hoch. Er musste das Wartpersonal auf der Männerabteilung beaufsichtigen. Er sollte sogar die niedere Chirurgie beherrschen. Die Auswahl qualifizierter Personen, die alle Bedingungen erfüllten, war im kleinen Kanton St. Gallen eher bescheiden. Es gab immer wieder Schwierigkeiten mit dem Wartpersonal. So musste Oberwärter Meier wegen schlechten Verhaltens entlassen werden. Eine Oberwärterin zeigte sich einige Male taktlos, konnte jedoch wegen ihres Eifers 8 Von den Anfängen der Klinik dennoch bleiben. Der Alt-Gemeindeammann Bislin von Pfäfers übernahm damals die Stelle des entlassenen Oberwärters Meier. Die Angestellten mussten häufig ihren Arbeitsplatz untereinander tauschen. Mangel an Verständnis oder fachliches und menschliches Versagen führten oft zu Kündigungen. Leidtragende dieser personellen Probleme waren die Kranken, weil sie einerseits direkt betroffen waren, andererseits als bevormundete Menschen machtlos und auch hilflos waren. Das Wartpersonal wurde vom Direktor zur Pflege angeleitet und erhielt 1856 erstmals fachlichen Unterricht mit gutem Erfolg. Der Grundstein für den eigentlichen Umschwung hin zum Pflegeberuf, wie wir ihn heute kennen, wurde 1940 gelegt, als Wartpersonal um die Jahrhundertwende in der Klinik die ersten Diplomkurse in psychiatrischer Krankenpflege durchgeführt wurden. Die St. Pirminsberger Krankenpflegeschüler absolvierten ihre Ausbildung während einigen Jahren zusammen mit Schülern der Bündner Kliniken Waldhaus und Beverin. 1970 wurde dann die St. Gallische Schule für Psychiatrische Krankenpflege in Wil eröffnet. Bis 1995 erhielten die Schwestern und Pfleger die theoretische Ausbildung an dieser Schule. Den regionalen Ausbildungsbedürfnissen entsprechend, konnte in Sargans 1995 ein modernes Ausbildungszentrum für Berufe in Gesundheits- und Krankenpflege eröffnet werden. Den hohen Grad an beruflicher Eigenständigkeit und Professionalität verdankt die heutige Pflege zu einem entscheidenden Teil der Entwicklung im Ausbildungsbereich. Frisch Diplomierte (1948), gereift für den Beruf 9 Hygiene in der Anstalt im 19. Jahrhundert Theresa Kühne Das Wartpersonal und die Ärzte hatten mit verschiedenen Problemen bezüglich Hygiene und schweren Krankheiten im 19. Jahrhundert zu kämpfen. Besonders das Wartpersonal hatte damals – wenn überhaupt – nur wenig Kenntnis bezüglich Hygiene. Im Gründungsjahr der Anstalt konnte in Wien der ungarische Arzt Dr. Semmelweis nachweisen, dass durch die Händedesinfektion in der Geburtshilfe die hohe Sterblichkeit bei Kindbettfieber um die Hälfte sank. Bis in Pfäfers bessere hygienische Bedingungen herrschten, vergingen noch Jahre. Der bauliche Zustand der Anstalt war so schlecht, dass die Abfälle der sogenannt «Unreinlichen» durch die Zimmerböden hindurch in die unteren Zimmer drangen. Die Situation verschlimmerte sich, da vermehrt unreinliche Patienten aufgenommen werden mussten. Im Winter war es oft so kalt, dass die Kranken den ganzen Tag im Bett verbringen mussten, um in den ungeheizten Zellen nicht zu erfrieren. 1849 stattete der Vorsitzende des Baudepartementes der Anstalt einen Besuch ab, um für bessere bauliche Verhältnisse zu sorgen. Leider hatte auch er keinen konkreten Plan zur Lösung des Problems. Die Anstalt wurde schon in den Anfangsjahren von Epidemien heimgesucht. Dr. Ellinger schrieb in seinem Bericht, dass jeden Monat einige Patienten an Typhus erkrankten. Das Wartpersonal blieb ebenfalls nicht verschont. Die Krankheit griff auch auf das Küchenpersonal und den Oberknecht über. Insgesamt erkrankten sechs Pflegebefohlene und elf Dienstboten. Der Typhus forderte fünf Tote. In der Gemeinde waren weitere Fälle bekannt. Auch der Gemeindeammann von Pfäfers erlag dem Leiden. Dr. Weller (1879 – 1889) legte grossen Wert auf Hygiene. Trotzdem hatte die Anstalt auch unter seiner Leitung mit Epidemien zu kämpfen. 1884 brach eine Blatternepidemie aus. Der Sohn eines Pfäferser Lehrers hatte sich in Feldkirch infiziert und die Krankheit auf die Schwester übertragen. Wegen Mangel an Evakuationslokalen waren Neuerkrankungen unvermeidlich. Die Anstaltsleitung bestellte beim Impfinstitut in Lancy genügend Impfstoff. Schon vier Tage nach Ausbruch der Krankheit waren alle Anstaltsinsassen vakziniert. Die Impfung war in 80% der Fälle erfolgreich. Erneut traten Fälle von Typhus in Erscheinung. Dr. Weller war der Ausbruch dieser Krankheit unerklärlich. Vielleicht war die Latrine schuld? Es handelte sich um ein Grubensystem mit eingebauter Spülung. Das Loch muss wohl zu klein gewesen sein, da es wiederholt verstopfte. Bei jeder Entleerung verbreitete sich ein übler Geruch. Im Jahre 1888 verstarben unerwartet viele Patienten an Tuberkulose. Vermutlich waren sie schon vor ihrer Einlieferung in die Anstalt krank. Die günstigen klimatischen (alpinen) Verhältnisse in Pfäfers beeinflussten den Krankheitsverlauf positv. 10 Von den Anfängen der Klinik Bildnis einer Geisteskranken Selbstmordmelancholie 11 HISTORISCHE DATEN Historische Daten Vladimir Sibalic 1845 Beschluss des Regierungsrates in St. Gallen über die Weiterverwendung der Gebäude des ehemaligen Klosters als kantonale Irrenanstalt. 1847 Eröffnung der Klinik mit dem Neubau für Tobsüchtige und «unreinliche» Frauen und Männer. 11. August: Die ersten zwei Patienten treffen ein. Es sind zwei Frauen aus Hagenwil. Der Umbau ist aber noch alles andere als fertig. 1848 14. Januar: Der Neubau für die «Tobsüchtigen und Unreinlichen» brennt ab. Danach hat die Leitung der Irrenanstalt Mühe mit der Unterbringung der Tobsüchtigen. Um 1850 1856 ca. 1870 12 Ellinger beschreibt die Therapiemöglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Er umreisst die diagnostischen Möglichkeiten und die Behandlungsarten. Diverse Heilmittel stehen zur Verfügung (versch. Öle, wie Rizinusöl, verschiedene Heilpflaster, China und Opium und Eisenmittel, Calomel, Calihydriot, Digital, kalte Rückenduschen, teilweise Kopfwaschungen). Eine sinnvolle Beschäftigung wird erkannt als erzieherisches Mittel. Das Chloralhydrat wird eingeführt. Die Medikamente Morphin und Athropin, sowie das Chloroform finden Eingang in die Behandlung. Auf dem St. Margrethenberg entsteht eine Wohnkolonie für Patienten. Diese werden dort im Rahmen eines therapeutisch geführten Landwirtschaftsbetriebes betreut. Diese Einrichtung erlangt wegen des grossen Erfolgs weit über die Landesgrenzen hinweg Beachtung und findet zahlreiche Nachahmer. Erstmals ist das Salicylsäure-Salz im Gebrauch, das leider starke Nebenwirkungen in Form von Brechreiz verursacht. Historische Daten 1867 Natrium salicylum wird eingeführt. Es wird bedeutend besser vertragen als die Salicylsäure-Salze. 1898 Die Klinik ist völlig überfüllt. Das Asyl in Wil wird eröffnet und übernimmt einige der Kranken. Bromsalze gegen Epilepsie wird angewandt. Die Deckelbäder kommen auf. 1907 – 1909 Die beiden Pavillons für unruhige Patienten werden gebaut und eröffnet. Ab 1933 Die Schlafkur mit Dial wird eingeführt sowie die Insulinkuren. Die Cardiazol-Schlafkur und Malariakur werden eingesetzt. Auch der Elektroschock und Hypnose sind Mittel der Wahl. Auch die psychokathardisch-analytische Methode hat Einzug gehalten. 1950 Es wird das erste Mal bei einem Patienten von St. Pirminsberg eine Leukotomie gemacht. Balophen wird für Schlaf- und Dämmerkuren eingesetzt. 1951 Amozan wird eingeführt. 1953 Das Largactil als erstes Neuroleptikum lässt grosse Hoffnungen aufkommen. 1954 Serpasil kommt auf den Markt. 1957 Das erste Antidepressivum Tofranil wird eingesetzt. 1958 Melleril und Pacatalkur kommen zur Anwendung. 1960 Der erste Tranquilizer Pertranquil und das Neuroleptikum Trilafon kommen zum Einsatz. 13 ab 1960 14 Die Forschung entwickelt eine Vielzahl von psychoaktiven Substanzen, die für die Behandlung psychisch Kranker eingesetzt werden. Viele dieser neuen Medikamente werden in der Klinik geprüft, und es werden auch Berichte in Fachzeitschriften veröffentlicht. Damit wird eine neue Epoche der Psychiatrie eingeleitet. 1964 Erste klinische Psychologin wird als Aushilfe angestellt. Man hat gute Erfahrungen damit gemacht. 1966 Findet die erste Gruppentherapie unter fachlicher Leitung statt. 1973 Beim Regierungsrat in St. Gallen wird ein Antrag gestellt für einen Neubau. 1977 Es wird erstmals eine Stelle für Psychologie eingerichtet. Die Stelle konnte aber lange nicht besetzt werden. Ebenso die Stelle der Ergotherapie, die ebenfalls neu geschaffen wurde. 1980 Eröffnung des Neubaus. 1981 Die Therapien werden ausgebaut. Es finden Gruppentherapien statt. Und es wird eine Maltherapiestelle geschaffen. Ebenso wird die Arbeitstherapie um eine Stelle aufgestockt. Es werden auch ganzheitliche Therapieformen eingeführt und eine Jugendstation eröffnet. In dieser Zeit wird die Klinik auch in die Foederatio Medicorum Helveticorum aufgenommen als erstrangige Ausbildungsstätte für Assistenzärzte. 1985 Die therapeutischen Konzepte der medizinischen und pflegerischen Fachgruppen werden überarbeitet und moderne Therapie- und Betreuungskonzepte finden Eingang. Historische Daten Patientengebäude vor dem Abbruch 1977 Ehemaliger Verwaltungsbau 1976 15 PERSÖNLICHKEITEN Heinrich Ellinger Hans König Heinrich Ellinger (1817 – 1873) – Der erste Chefarzt der Klinik St. Pirminsberg Die Geschichte des erfolgreichen Schweizer Seelenarztes, der als Gaildorfer Bäckerssohn geboren wurde. Lehre und Studium Als ältester Sohn des Bäckermeisters Johann Wilhelm Ellinger und seiner Ehefrau Maria Dorothea Karolina Hänle in der Kirchgasse, gegenüber der Stadtkirche, wurde am 18. Januar 1817 in Gaildorf Heinrich Friedrich David Ellinger geboren. Sein Grossvater war Stabsschultheiss in Unterrot. Die Ellinger lassen sich in Unterrot bis auf einen Jörg Ellinger, geboren um 1550, zurückverfolgen. Seine Mutter war eine Gaildorfer Bäckermeisterstochter. Zum Bäckerhandwerk hatte er wohl keine Neigung, sein jüngerer Bruder Friedrich wurde dafür Bäcker. Nach der Konfirmation im Jahr 1831 beginnt der 14-jährige Heinrich eine, wie man heute sagen würde, zweigleisige Ausbildung: Er nimmt bei Stadtarzt Dr. Werfer theoretischen Unterricht, und Oberamtsarzt Dr. Karl Koch erteilt ihm gleichzeitig praktische Unterweisungen. Erst danach, von 1834 bis September 1835, besucht er die Lateinschule in Schwäbisch Hall und wird dann chirurgischer Assistent am Katharinenhospital in Stuttgart. 1837 wird er zur akademischen Vorprüfung zugelassen und kann dann in Tübingen Medizin studieren. Am 3. November 1840 besteht er die erste Staatsprüfung und erhält 7-mal sehr gut und 3-mal gut. Sein praktisches Jahr, um die innere Heilkunst kennenzulernen, beginnt er in seiner Heimatstadt Gaildorf beim damaligen Waldeckschen Hofmedikus und Oberamtsarzt Dr. Heinrich Mössner. Auslandsstipendium Nach einem halben Jahr beantragt Ellinger, ihm die zweite Hälfte des praktischen Jahres zu erlassen und ihm den Besuch des Auslandes zur Weiterbildung zu ermöglichen. Mössner schreibt in seiner Beurteilung u.a.: «Bei dem glänzenden Erfolg seiner ersten Prüfung, welche mit Recht zu der Hoffnung berechtigt, dass Ellinger dereinst ein tüchtiger Arzt werden würde, ist sehr zu wünschen, dass er grössere Krankenanstalten des Auslandes besucht.» Doch da waren noch die Kosten. Sein Vater war 1835 verstorben und sein kleines väterliches Erbe längst erschöpft. «Von meiner Mutter mit vier weiteren unversorgten, jüngeren Söhnen werden Anstrengungen gefordert, die ihr nicht mehr eine fernere Unterstützung erlauben», begründete Ellinger seinen zweimaligen Antrag auf ein Stipendium. Mit einem bewilligten Reisegeld von 200 Gulden tritt Ellinger im April 1841 seine Reise an. Über München, Wien, Prag, Dresden, Leipzig, Berlin geht Ellinger in Halle endgültig das Geld aus. Mit einem 50-seitigen Reisebericht reicht er ein neues Gesuch ein und erhält nochmals 225 Gulden, um seine Reise über Heidelberg und Würzburg fortzusetzen. Ende 1841 besteht er seine zweite Staatsprüfung mit sehr gut. 16 Assistenzarzt in Winnental Unter sechs Bewerbern wird Ellinger zum Assistenzarzt des ersten Direktors Albert Zeller, der seit 1834 bestehenden Königlichen Heil- und Pflegeanstalt Winnental gewählt und beginnt am 8. Januar 1842 seinen Dienst. Der Direktor und sein Assistent waren die einzigen Fachkräfte im medizinischen Bereich und hatten bis zu 112 Kranke zu betreuen. Trotz der starken Beanspruchung findet Ellinger noch Zeit für wissenschaftliche Arbeiten. 1844 schreibt er einen Aufsatz zum Thema «Über die Benützung der Irrenanstalten zu klinischen Zwecken mit einem Blick auf Württemberg». Dargestellt wird das praktische Studium der Psychiatrie, für Mediziner notwendig, für Theologen und Juristen wünschenswert, wie Ellinger meint. «Möge diese kleine Arbeit nicht als Ausfluss Heinrich Ellinger einer mässigen Phantasiespielerei angesehen werden, denn dazu ist mein Beruf zu ernst, mein Geschäft zu gross, meine Zeit zu karg, die Lust zu klein, sondern als Ausdruck des reinen Interesses für die Sache.» 1845 folgt ein Aufsatz; «Der Einfluss der Selbstbefleckung auf die Erzeugung eines Zustandes» und 1846 eine kleine Schrift; «Über die anthropologischen Momente der Zurechnungsfähigkeit». Irrenärzte ohne Chancen Nachdem Bewerbungen Ellingers um eine Unteramtsarztstelle in Murrhardt und anschliessend in Löwenstein jeweils von den Amtsversammlungen abgelehnt wurden, trägt Direktor Zeller dem König vor, dass die Leistungen in der Anstalt Winnental offensichtlich draussen nicht anerkannt werden. Als Anerkennung der Arbeit Ellingers gewährt der König 1844 eine Gratifikation von 150 Gulden und sagt seine Unterstützung bei weiteren Bewerbungen zu. Das war nicht mehr notwendig, denn Ellinger verzichtete auf weitere Bewerbungen in Württemberg. Ellinger geht ins Ausland Am 23. September 1846 bewirbt sich Ellinger um die Stelle des Direktors der neu zu errichtenden Heil- und Pflegeanstalt des Kantons St. Gallen. Direktor Zeller an den Kleinen Rat des Kantons St. Gallen: «Dr. med. Heinrich Ellinger hat sich nicht allein als ein Mann von sehr umfassender ärztlicher Bildung, regen wissenschaftlichen Strebens nach immer höherer Vollendung, sondern auch als ausgezeichneter praktischer Arzt und als ein sehr treuer, redlicher, reiner und menschenfreundlicher Charakter bewährt und in seinem speziellen Beruf, sich durch die gewissenhafte Hingebung für das leibliche und geistige Wohl der Kranken und durch unablässiges Streben immer tiefer in die dunklen Gebiete der Seelenstörungen einzudringen, sich eine solch reiche und klare Erfahrung und Tüchtigkeit für den Beruf eines Seelenarztes erworben ... seinen früheren oder späteren Weggang muss man als einen wahren Verlust von unserer Seite beklagen.» Welche Wertschätzung Ellinger genoss, kommt auch darin zum Ausdruck, dass er trotz einer Anstellung in der Schweiz das Württembergische Staatsbürgerrecht behalten durfte und «ihm die Aussicht auf tunliche Berücksichtigung seiner späteren Bewerbungen um öffentliche Anstellungen in Württemberg zugesagt» wurden. 17 Mit 30 Jahren Direktor Als 1836 zwei Mordtaten Geisteskranker die Bevölkerung des Kantons St. Gallen in Schrecken versetzten, begann die Regierung, das Irrenwesen zu überprüfen. Nachdem man 1838 526 Geisteskranke, darunter 70 Tobsüchtige und 94 Wahnsinnige im Kanton ermittelte und dazu eine große Dunkelziffer vermutete, schickte man Experten nach Deutschland, um die vorzüglichsten Heil- und Pflegeanstalten, wozu sie auch Winnental zählten, zu besuchen. Am 14. November 1845 beschloss der Grosse Rat in St. Gallen, im früheren Kloster Pfäfers eine kantonale Irrenanstalt für 108 Kranke einzurichten. Am 2. August 1847 wird die Anstalt unter dem Namen «Heil- und Pflegeanstalt St. Pirminsberg» – Pirmin war der Erbauer und Stifter des Klosters – eröffnet. Zweck der Anstalt sollte nicht nur Versorgung, Bewahrung und Pflege, sondern auch Heilung von Geisteskranken sein. Den Namen «Heil- und Pflegeanstalt» hatte man bewusst gewählt, weil Benennungen wie «Narren- und Tollhaus» oder «Irrenanstalt» auf empfindsame und teilnehmende Geisteskranke und ihre Verwandten einen weit schlimmeren Eindruck machen, als man es sich gewöhnlich vorstellt. Schon am 27. Januar 1847 war Ellinger unter 13 Bewerbern zum ersten Direktor der Anstalt gewählt worden. Am 5. Dezember des gleichen Jahres hat er Emilia Verena Müller geb. Braunschwyler, Witwe des Kaufmanns Müller aus Wil, geheiratet. Schlechte Bedingungen Als Ellinger in St. Pirminsberg als einziger Arzt begann, waren noch nicht alle Abteilungen erstellt. Dass gerade die Abteilung für die Unruhigen noch nicht fertig war, gestaltete den Betrieb schwierig. Dies steigerte sich noch im zweiten Betriebsjahr, weil am 14. Januar 1848 der Neubau, der für die Unruhigen bestimmt war, durch die Unachtsamkeit eines Arbeiters abbrannte. Hinzu kamen weitere Unzulänglichkeiten, Bäder ohne ausreichendes Wasser, alte ausgediente Soldaten als ungebildetes Wärterpersonal und Wärterinnen, die nicht schreiben konnten. Von Ellinger wurde geradezu übermenschliche Arbeit erwartet: Kein Mikroskop, kein Sektionsbesteck, keine Bücherei, kein Assistent, so dass er ständig anwesend sein musste. Es waren nur geringe finanzielle Mittel vorhanden; die Kranken mussten auf Laubsäcken schlafen. 18 Heinrich Ellinger Ausgezeichneter Ruf Der erste Anstaltsdirektor Ellinger genoss schon bald den Ruf eines ausgezeichneten, weitsichtigen und nur um das Wohl seiner Kranken besorgten Psychiaters. Schon 1850 wurde es eng in der Anstalt, so dass für die Tobsüchtigen, so nannte man damals die Unruhigen, auf dem Flur notdürftig Zellen eingerichtet wurden. In einer späteren Beurteilung heisst es: «Aus den Jahresberichten Ellingers spricht trotz der grossen Schwierigkeiten eine alles überwindende Arbeitsfreudigkeit und eine Genugtuung über die erreichten Erfolge, dass wir nur die grösste Hochachtung vor einer solchen Pflichttreue haben können.» Nachsorge für Kranke Wie weitsichtig Ellinger schon damals war, geht aus seinem ersten Jahresbericht hervor: «Wir haben bereits eine Anzahl von Kranken, die der Genesung entgegengehen und bald entlassen werden können, aber durch die Verhältnisse, in die sie zurückkehren müssen, der Gefahr des Rückfalls ausgesetzt sind. Die Gemeinden können nicht immer die notwendige Fürsorge treffen, auch wenn sie wollten. Bei weitem mehr könnte geleistet werden durch freie Mitglieder eines Vereines, der sich zur Aufgabe machen würde, den mit Urlaub oder Entlassung aus der Anstalt Ausgetretenen, wenn es nötig ist, mit Rat und Tat an die Hand zu gehen und Patron zu sein. Wir möchten diesen Punkt besonderer Beherzigung empfehlen.» Es hat noch 20 Jahre gedauert, bis ein solcher Hilfsverein gegründet wurde. Im übrigen eine Idee, die heute noch Gültigkeit hat. Ellinger geht 1851 wird endlich zur Entlastung Ellingers ein Assistenzarzt angestellt, dessen Frau aber zur Verbesserung des geringen Einkommens in der Anstalt als Wäschebeschliesserin mitarbeiten muss. In den 50er Jahren muss das Medizinalwesen im Kanton St. Gallen tief abgesunken sein, die finanziellen Mittel immer bescheidener und die politische Unterstützung geringer geworden sein, denn nur so ist zu erklären, dass Ellinger im Oktober 1856 seine Entlassung auf Ende 1856 beantragt. Alle Bemühungen, ihn zu halten, waren gescheitert. Noch 1852 legte er einen umfassenden Bericht über das Irrenwesen in der Schweiz mit Vorschlägen für eine neue Irrengesetzgebung vor: «Vor allem wünschte ich, Arbeitskolonnen in der Landwirtschaft, unterteilt in Männerund Frauenkolonnen 19 unseren gesetzgebenden Vätern die brennende Überzeugung beibringen zu können, dass im kantonalen Irrenwesen noch vieles zu tun sei und mit gutem Willen auch wirklich getan werden könne.» Privatanstalt in Wil Nach seinem Ausscheiden als Direktor in St. Pirminsberg gründet Ellinger in Wil im Kanton St. Gallen eine private Heilanstalt. In Wil überarbeitete Ellinger sein Buch «Die athropologischen Momente der Zurechnungsfähigkeit» völlig neu. Das Werk widmet er dem Leibarzt des württembergischen Königs, Staatsrat von Ludwig und seinem früheren Chef, Direktor Albert Zeller in Winnental. Mit seinem Buch leistete Ellinger einen wichtigen Beitrag zu Fragen der Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit in Strafprozessen «zur Auffüllung der Kluft, welche zwischen den Ansichten der Richter und Ärzte zwischen den abstrakten und konkreten Anschauungen des Seelenlebens besteht.» Ellinger weiter in seinem Vorwort: «Wir zweifeln nicht daran, dass die Zeit noch kommen werde, wo man die Verbrecher nicht bloss züchtet, sondern auch heilt, wo man das Verbrechen nicht bloss ahndet, sondern ihm auch vorbeugt, wo die Spitzen der Gesellschaft einsehen werden, dass sie mit dem Beispiel des Guten und Wahren vorangehen müssen, wenn die unteren Schichten die Krone des Glaubens haben und behalten sollen, und dass politische Schlechtigkeit und Kriegsrecht nichts anderes als Ermunterungs- und Förderungsmittel des Bösen sind.» Das Buch ist 1861 in St. Gallen erschienen. Am 6. Dezember 1873 stirbt Ellinger im Alter von erst 56 Jahren in Wil an einem Darmverschluss. 20 21 Constantin von Monakow Jürg Kesselring Constantin von Monakow (1853 – 1930), der erste Professor für Neurologie an der Universität Zürich, Mitgründer der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft und erster Herausgeber des Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie verbrachte sieben Jahre (1878 – 1885) als Sekundärarzt in der Kantonalen Irrenanstalt St. Pirminsberg in Pfäfers. Geboren am 4. November 1853 aus einem adligen russischen Geschlecht auf dem Gute Bobrezewo im Bezirk Wologda kam von Monakow 1866 nach Zürich, wo er das Gymnasium besuchte und (gegen den Willen seines Vaters) Medizin studierte. Schon während des Studiums war er als stellvertretender Assistent am Burghölzli tätig, das von Eduard Hitzig (1838 – 1907) geleitet wurde, und dort erwachte sein «inniges Interesse für Probleme der Gehirnpathologie und Psychiatrie» (Minkowski 1931, S. 7). Als er von einer Reise, die ihn als Schiffsarzt auf einem Reichspostdampfer nach Brasilien und Argentinien geführt hatte, nach Hamburg zurückkehrte, fand er die Depesche vor, dass er als Assistenzarzt in St. Pirminsberg gewählt sei. Einige seiner Freunde aus dem Burghölzli hatten sich während seiner Abwesenheit von Europa um diesen Posten für ihn bemüht. In diesen Jahren in St. Pirminsberg, «die mit zu den schönsten und erfolgreichsten seines durchwegs so fruchtbaren Lebens gehören sollten» (Minkowski 1931, S. 9), führte von Monakow entscheidende Experimente durch, die er in angesehenen Zeitschriften publizieren konnte und welPfäfers mit zwei Friedhöfen – einen für die Dorfbewohner und einen che die Grundlage für seine spätere Habilitation in Zürich für die Klinikpatienten. und seinen weltweiten Ruf als Hirnforscher bildeten. Durch frühere Arbeiten am Burghölzli angeregt, versuchte er von Anfang an, «sich über klinische Fälle an Hand von Sektionsmaterial hirnpathologisch zu orientieren und die so gewonnene Grundlage mit Bezug auf Fragen der anatomischen und physiologischen Lokalisation durch Experimente an Tieren zu ergänzen und zu erweitern. Ein kurz vorher von der Anstalt angeschafftes «nagelneues, bisher unbenutztes» (von Monakow 1970, S. 15 2) Gudden’sches Mikrotom kam ihm dabei sehr zu statten» (Minkowski, S. 9), war er doch kurz zuvor auf einer Reise nach Deutschland in der Kreisirrenanstalt Griesing bei München durch deren Direktor Bernhard von Gudden (1824 – 1886) persönlich «aufs liebenswürdigste empfangen und in einer stundenlangen Besprechung in seine wissenschaftlichen Untersuchungen eingeweiht worden» (Minkowski 1931, S. 9). Von Monakow führte seine experimentellen Arbeiten alleine an Katzen und Kaninchen durch, bei deren Aufzucht und Haltung ihm zunächst ein tierfreundlicher Psychiatriewärter und nach seiner Heirat 1880 seine Ehefrau Mathilde, geb. Rudio, behilflich waren: Als einer der ersten untersuchte er die Ausbildung und Verknüpfung von Bahnen im Zentralen Nervensystem mittels Ablationsexperimenten an Jungtieren. Bereits im Sommer 1879 hatte er bei zwei neugeborenen Kaninchen den Okzipitallappen abgetragen und liess die Tiere während eines Jahres am Leben. Eines Tages verlor er aber doch die Geduld (wie er selbst schreibt – von Monakow 1970, S. 168), legte «mit freier Hand und Rasiermesser» einen «Probefrontalschnitt» an und «konstatierte mit Überraschung und Jubel mit freiem Auge und mit Lupe eine nahezu radikale und sogar isolierte sekundäre Degeneration des linken Corpus geniculatum externum bei makroskopischer Intaktheit des übrigen Thalamus opticus. Dieses Resultat ... übertraf meine kühnsten Erwartungen und Berechnungen zur Zeit des operativen Eingriffes» (von Monakow 1970, S. 168). Er wusste sogleich, dass ihm eine grosse Entdeckung gelungen ist und wurde von einer «solch glücklichen Verfassung erfasst, verbunden mit einer Art Inspiration», dass er in einem euphorischen Rauschzustand durch 22 Constantin von Monakow das Taminatal wanderte und weiterführende Experimente plante, in denen er die Basis für eine Einsicht in die funktionellen Zusammenhänge von Thalamus und Kortex legte. «Die Tragweite dieser Entdeckung ... wird erst deutlich, begreift man sie im Kontext der damaligen wissenschaftlichen Diskussion um die Gliederung und Vernetzung der früher als Entität begriffenen Hirnrinde. Hierbei ging es letztlich um die Frage der Einordnung des Kortex innerhalb des Gesamtgeschehens der Hirnfunktionen .... von Monakow sollte in seinem Alterswerk die Problematik eines durch die Naturwissenschaft erzwungenen neuen Menschenbildes aufnehmen und in einem ungewöhnlichen Versuch der fächerübergreifenden Betrachtung bearbeiten» (Jagella et al 1994, S. 20, Kesselring 1994). «Diese zuerst am Kaninchen eruierten Verhältnisse konnten in der Folge (1883, 1885, 1889) auch an der Katze und an menschlichen Gehirnen mit verschiedenen Herden im Okzipitallappen nachgeprüft und mutatis mutandis bestätigt werden, wobei die anatomischen Details noch viel feiner und gründlicher studiert wurden. Der gesamte Aufbau der optischen Bahnen wurde schliesslich in einem Schema niedergelegt, das auch heute im wesentlichen seine volle Gültigkeit hat. Über seine allgemeinen Untersuchungsergebnisse auf diesem Gebiet berichtete von Monakow in einem Jungfernvortrag in der Medizinischen Sektion der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in Freiburg (1883) und lenkte dadurch die Aufmerksamkeit einiger prominenter Gelehrten der damaligen Zeit (Kölliker, His, Horner, Kocher) auf sich» (Minkowski 1931, S. 13). Von Monakow selbst berichtete seiner Frau «Liebstes Trullchen!» in einem Brief vom 23. September 1883 von dieser «hübschen Geschichte», fand aber, dass «der Umstand, dass zu viele Leute anwesend waren, der Gemütlichkeit etwas hindernd in den Weg getreten...» sei (von Monakow 1970, S. 180). Wer heute die theoretischen Grundlagen der Neurorehabilitation und damit die Plastizität im zentralen Nervensystem studiert, kommt um den Begriff der «Diaschisis» nicht herum. Grundlage dafür ist der fundamentale Unterschied von der geometrischen Lokalisation von Symptomen (z.B. Paralyse, Aphasie) und der chronogenen Lokalisation von Symptomen (Lokomotion, Sprache), sowie die Vorstellung einer wechselseitigen Innervation verschiedener Hirnareale. Dieses Konzept kommt den heutigen Vorstellungen von neuronalen Netzwerken viel näher als die strenge Zuordnung einer Funktion zu einzelnen Strukturen im Gehirn. Diaschisis («Abspaltung») ist das vorübergehende 23 Versagen ganzer funktionell zusammenhängender Neuronenverbände nach plötzlichem Entzug eines wichtigen kooperierenden Gliedes, bzw. einer ständigen Erregungsquelle des ganzen Verbandes. Die neuronalen Grenz-, Berührungs- und zugleich Trennungsflächen, an denen die Diaschisis zur Wirksamkeit gelangt, entsprechen zugleich vielfach entwicklungsgeschichtlichen Etappen eines sukzessiven Aufbaus der Funktion in ihrem ontogenetischen Werdegang (Kesselring 1992). Der genetische Aufbau der Funktion erlangt somit eine grundlegende Bedeutung für das Verständnis ihres Abbaus in der Krankheit (Kesselring 1994). Dieses Konzept, das erst dank neuerer Ergebnisse der Grundlagenforschung und mittels bildgebender Verfahren zunehmend besser verifiziert werden kann, wurde von Constantin von Monakow in seinem Monumentalwerk «Gehirnpathologie» (Wien Erste Auflage 1897, Zweite Auflage 1905 als 1000 Seiten starker Band von Nothnagels Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie) weiterentwickelt, nachdem er es schon in früheren Arbeiten aus seiner «St. Pirminsbergerzeit» ansatzweise diskutiert hatte. Die wissenschaftlichen Arbeiten verfasste von Monakow neben seiner klinischen Tätigkeit: In der Anstalt befanden sich 1878 etwa 240 Patienten (mit etwa 100 Neuaufnahmen im Jahr). «Nur die ruhigen Abteilungen waren einigermassen ordentlich gehalten und ärztlich in ausreichender Weise versorgt. Die Abteilungen der Unruhigen und Unreinen aber befanden sich in einem bedenklichen Zustand: Alle Zellen waren besetzt, manche seit Jahren von den nämlichen Kranken; viele Patienten waren verwahrlost, einzelne trugen Zwangsjacken. Die Korridore waren nachts belegt mit auf Strohsäcken schlafenden, häufig lärmenden und unreinen Kranken ... Die medikamentöse Behandlung lärmender Patienten bestand hauptsächlich in Deckelbädern und in Verabreichung von Opium und von Chlorallösungen» (von Monakow 1970, S. 149). Schon zu Beginn seiner Tätigkeit in Pfäfers kam es zwischen dem «Neuling in der Psychiatrie» und dem Anstaltsdirektor Hugo Henne (1833 – 1867) bald zu «unliebsamen Auseinandersetzungen», weil er sich «oft nicht enthalten konnte, meine Bedenken gegen manche Massnahmen und Verordnungen des Chefs, die meines Erachtens dem gesunden Menschenverstand widerspra- Gehirnschnitt eines Kaninchens: Monakow gelang damit eine grosse Entdeckung 24 Titelblatt seiner Dissertation Constantin von Monakow chen (Disziplinierung und Zankworte dementen Aufgeregten gegenüber) auszusprechen.» (von Monakow 1970, S. 149). Aber schon bei der ersten Begegnung machte Henne auf von Monakow «einen bedenklichen Eindruck: ein kleines kahlköpfiges Männchen, fünfundvierzig Jahre alt, mit Adlernase und schwarzen Augen, mit etwas stechendem Blick, äusserlich freundlich, aber in seinem ganzen Wesen, als Arzt und Mensch, sehr unbedeutend, etwas bäurisch, obwohl er als mein zukünftiger Vorgesetzter mir etwas überlegen zu sein versuchte.» (von Monakow 1970, S. 148). In einem sehr schwungvoll geschriebenen Brief vom 4. Februar 1878, der sich noch heute in der Klinik findet, drückte dieser Direktor Henne seine Wertschätzung des jungen Kollegen gegenüber dem zuständigen Polizeidepartement des Kantons St. Gallen aus, indem er schrieb: «...mit einer Besoldung von 2000 fr. und freier Station. Ich schlage Ihnen nun vor, bei Herrn Monakow mindestens ebensolches zu geben, da er ein sehr tüchtiger junger Mann zu sein scheint, den wir der Anstalt zu erhalten trachten sollten.» Als Hilfsarzt erhielt er dann «aber eine Familienwohnung (fünf geräumige Zimmer) bei einer Barbesoldung von 2600 Franken nebst 200 Franken Gemüseentschädigung» (von Monakow 1970, S. 147). Die berufliche Situation veränderte sich für von Monakow, als Dr. Henne im Frühling 1879 seine Entlassung einreichte, um ein privates Sanatorium zu leiten. Dr. Jakob Laurenz Sonderegger (1825 – 1896), Inspektor der St. Gallischen Krankenanstalten (und Präsident der Schweizerischen Ärztekommission Patienten beim Eisbrechen seit 1874), animierte von Monakow, sich um die Direktionsstelle zu bewerben. Dieser «hatte indessen gute Gründe, mich gegenüber einer eventuellen Wahl, sosehr sie meiner Eitelkeit geschmeichelt haben würde, ablehnend zu verhalten: Meiner ganzen Anlage nach eignete ich mich wenig für die vorwiegend praktisch organisierende und administrative Tätigkeit und betrachtete eine Beförderung zum Anstaltsdirektor als eine Bürde, die meiner wissenschaftlichen Entwicklung und der Forschung notwendigerweise bald ein Ende bereitet haben würde. Ich fürchtete, auf dem Land oder im monotonen Anstaltsleben zu versauern» (von Monakow 1970, S. 162). Er ermunterte seinen Freund aus der Burghölzli-Zeit, Dr. Otto Weller (1843 – 1889), «ein selten tüchtiger Arzt und vorzüglicher Mensch ... gerade für die Anstaltsdirektion besonders befähigter, weitsichtiger Mann», sich zu bewerben. Dieser schrieb ihm aus Wien, wo er sich zur Weiterbildung befand: «Und ich glaube, wir könnten zusammen ganz Gehöriges leisten und den Ruf der Anstalt sowohl mit Bezug auf ärztliche Behandlung als auch in bezug auf die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Ärzte bedeutend heben. Die St. Galler Behörden haben einen idealen Zug. Zwei Ärzte, die harmonisch wirken und von gleichen Interessen begeistert arbeiten, können mehr leisten als vier, die sich ihrer Aufgabe nur teilweise bewusst sind» (von Monakow 1970, S. 164). Im Oktober 1879 trat Weller seinen Posten an. «Es herrschte grosse Befriedigung in der Anstalt, aber auch bei der bäuerlichen Bevölkerung in Pfäfers». Von Monakow «selbst war hocherfreut. Meine Freundschaft und Bewunderung für diesen Prachtskollegen minderten sich im Laufe der Jahre bis zu meinem Weggang nicht um ein Haar» (von Monakow 1970, S. 165), zwischen beiden bestand «ein ungetrübtes und inniges freundschaftliches Verhältnis, das so weit ging, dass Weller ihn in selbstlosester Weise zu entlasten suchte, um ihm jede nur denkbare Möglichkeit zu wissenschaftlicher Arbeit zu verschaffen.» (Minkowski 1931, S. 11) Neben der Tätigkeit in der Klinik hatte der Assistenzarzt der Anstalt «auch die Verpflichtung, die allerdings sehr kleine Dorfpraxis in Pfäfers und Umgebung zu besorgen» (von Monakow 1970, S. 148). Diese Praxis «gab mir aber Gelegenheit, mich au25 todidaktisch auf dem ganzen Gebiete der Medizin weiter auszubilden, feste medizinische Erfahrungen... zu sammeln und eine gewisse Sicherheit zu gewinnen... Die Praxis machte mich aber auch bekannt mit dem Leben und der Mentalität des Dorfbewohners. Sie gewährte mir einen reichen Einblick in die sozialen Verhältnisse im St. Galler Oberland. Vor allem aber lernte ich dabei die Schwierigkeiten, ärztliche Kunst auf dem Lande zu treiben, und andere Nöte des Landarztes, wie zum Beispiel den Kampf gegen Vorurteile und Aberglauben, kennen. Es war dies eine prächtige Erziehung für mich selber, und ich habe später... dankbar an diese meine medizinischen Lehrjahre in Pfäfers gedacht. Viel eingebracht hat mir die Dorfpraxis nicht. Für einen Dorfbesuch berechnete man damals einen Franken und für eine Ordination mit einem Medikament («Gütterli») Fr. 1.20. Aber sie verbesserte doch mein Einkommen und setzte mich nach und nach instand, mir eine Familie zu gründen» (von Monakow 1970, S. 157f.). Je mehr sich die wissenschaftlichen Leistungen von Monakows mehrten und ihm Anerkennung und sogar Bewunderung durch besuchende auswärtige Kollegen brachten, um so mehr empfand er «seine äussere Constantin von Monakow Position in St. Pirminsberg als eine untergeordnete, fast demütigende verbrachte sieben Jahre und strebte nach Selbständigkeit und nach einer ganz befriedigenden (1878 – 1885) als Sekundärarzt in St. Pirminsberg grösseren Wirkensstätte» (von Monakow 1970, S. 184). Einen dreimonatigen Urlaub, der ihm im Winter 1884/85 von der St. Galler Regierung gewährt worden war, verbrachte er in Berlin, wo er in verschiedenen neurologischen und psychiatrischen Kliniken und Polikliniken hospitierte und in gelehrten Gesellschaften viel beachtete Vorträge hielt. «Wie klein und eng mir nach der Rückkehr aus der Weltstadt meine alte Wirkenssphäre erschien und welche Mühe ich hatte, mich an die ländliche Abgeschiedenheit wieder zu gewöhnen, brauche ich nicht zu schildern... Es hielt mich nunmehr in Pfäfers nicht länger, und ehe ein Vierteljahr verging, reichte ich in der festen Absicht, mich bald in Zürich niederzulassen, mein Entlassungsgesuch ein... Im September 1885 verliess ich mit ausdrücklichem Dank seitens der Regierung von St. Gallen und unter warmem Abschiedsgesang des Anstaltschores und lebhaftem Bedauern seitens der Anstaltsbeamten, der Patienten, auch der Dorfbewohner, aber auch von meiner Seite den mir schliesslich trotz der Abgeschiedenheit liebgewonnen Wirkungskreis – ich hatte später während langer Zeit in Zürich Heimweh nach St. Pirminsberg – und siedelte nach Zürich über.» (von Monakow 1970, S. 191ff). «Je älter ich werde, desto häufiger und lieber denke ich an jene Zeit zurück, die ich in der kleinen St. Galler Irrenanstalt St. Pirminsberg als Assistenzarzt zugebracht habe (Januar 1878 bis 1885)» (von Monakow, S. 147). An seinem fünfzigsten Hochzeitstag, am 21. September 1930, begab sich Monakow nach Ragaz und Pfäfers, wohin er einst als Assistent von St. Pirminsberg seine junge Frau heimgeführt und wo er seine ersten glücklichen Ehejahre verbracht hatte. Wehmütig trank er im «Adler» in Pfäfers aus seinem Hochzeitsbecher der Verstorbenen zu, sah auf der Strasse noch eine Menge ehemaliger Patienten und kehrte dann «mit einem Gefühl inneren Friedens und der Befriedigung» heim. Wenige Wochen später, am 19. Oktober 1930, ist er in einer urämischen Krise in seinem Hause «Aurora» friedlich verstorben (von Monakow 1970, S. 285: Anmerkung der Herausgeber). «Der grüne Tannenzweig, den Monakow sich kurz zuvor von seiner Reise nach St. Pirminsberg mitgebracht hatte, wurde ihm in den Sarg gelegt» (von Pusirewsky 1953, S. 113). 26 Constantin von Monakow 27 Erinnerungen an Manfred Bleuler Hans Jörg Keel 28 Es ist schwierig zu sagen, wann ich Professor Manfred Bleuler zum ersten Mal sah. Es dürfte im Wintersemester 1954/55 gewesen sein, als ich nach bestandenem, zweiten medizinischen Propädeutikum erstmals im Hörsaal der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, im Burghölzli, sass und dem Arzt, Psychiater und Lehrer aufmerksam zuhörte. Es waren die Vorlesungen über medizinische Psychologie und später dann die klinischen Vorstellungen der Patienten der Psychiatrischen Klinik, denen wir Studenten mit Begeisterung folgten. Ich frage mich heute, weshalb wir uns so sehr auf diese Vorlesung und die Vorstellung der Patienten am späten Freitagnachmittag im Burghölzli freuten. Einige Studenten haben sich für die Psychiatrie interessiert, weil sie meinten, aus dem Zerfall der geistigen Fähigkeiten bei Geisteskranken etwas über die Prof. Manfred Bleuler Struktur der Psyche erfahren zu können. Wie man ein rätselhaftes Ding gern zerlegt oder die Bruchstücke untersucht, wenn es zerbrochen ist. Für andere Mitstudenten und vor allem auch für mich war es die Persönlichkeit von Manfred Bleuler, die uns ansprach, sein Mitfühlen mit den Patienten, sein Einsatz für seine Kranken, seine Mitmenschlichkeit, seine Herzlichkeit und Liebe seinen Patienten gegenüber. «Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe». Diese von Paracelsus formulierte Aussage spürten wir Studenten in den Gesprächen und Vorlesungen unseres geschätzten und verehrten Lehrers. Dies war auch der Grund, dass mein erstes klinisches Lehrbuch, das ich als Medizinstudent gekauft habe, dasjenige der Psychiatrie war. Das von seinem Vater Eugen Bleuler verfasste Lehrbuch der Psychiatrie übernahm Manfred Bleuler mit der Neubearbeitung der 7. bis 15. Auflage (1983). Es war das Standardwerk für alle Studenten, Assistenten und Kliniker und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Mein «Bleuler» in der neunten Auflage von 1955 lag damals als «Dauerbrenner» auf meinem Studiertisch und steht heute noch mit Notizen, farbigen Unterstreichungen und Einlageblättern in meinem Büchergestell. Dieses Lehrbuch hat mich begleitet während meiner Ausbildung von Spital zu Spital und hat alle Räumungen überstanden, auch meine letzte aus dem Spital nach Hause. Nach meinem Staatsexamen begann ich 1958 mit meiner Ausbildung an der Medizinischen Universitätspoliklinik Zürich bei Professor Robert Hegglin. Damals war ich unsicher, ob ich Internist oder doch Psychiater werden möchte. Während meiner weiteren Ausbildung verlor ich ein wenig die Verbindung zur Psychiatrie und zu meinem früheren Lehrer. Dies änderte sich schlagartig, als ich am l. April 1970 meine Stelle als Chefarzt für Innere Medizin am Kantonalen Spital Walenstadt antrat. Patienten aus dem Sarganserland, vor allem aus dem Taminatal und von Quinten kamen in meine Klinik und erzählten mir von Doktor Manfred Bleuler, dem ehemaligen Sekundärarzt oder Oberarzt der Heil- und Pflegeanstalt St. Pirminsberg in Pfäfers, wie damals die Psychiatrische Klinik genannt wurde. Bald folgten Anrufe von Professor Manfred Bleuler. Er habe gehört, dass ein ehemaliger Patient und lieber Freund von ihm im Spital Walenstadt liege. Er erkundigte sich nach seinem Gesundheitszustand, übermittelte beste Genesungswünsche und viele liebe Grüsse. So vertiefte sich unser Kontakt. Es kam zu gegenseitigen Briefen. Ich durfte Professor Manfred Bleuler und seine liebe Frau Monica im schönen Haus an der Bahnhofstrasse 49 in Zollikon mehrmals besuchen. Eine besondere Freude für ihn war der Besuch am 25. November 1988, als der frühere und der amtierende Chefarzt von Pfäfers Czeslaw Bielinski und Hans-Peter Wengle und ich die Jubiläumsschrift «125 Jahre Ärzteverein Werdenberg-Sargans» mit Widmung überreichen durften. In seinem Schreiben vom gleichen Tag dankt Professor Manfred Bleuler dem Ärzteverein aus vollem Herzen. Er schreibt: «Meinem Gefühl nach bedeutet mir die allgemein-ärztliche Tätigkeit in Pfäfers das Erfüllendste und Glücklichste der ärztlichen Tätigkeit in meinem langen Leben, auch wenn sie nur als Nebenberuf (d.h. neben meinen Aufgaben in St. Pirminsberg) vor sich ging. Diese Tätigkeit hatte ich unter bedenklichen Umständen begonnen: nämlich in der Rekonvales- Manfred Bleuler zenz nach einem schweren Bergunfall mit Halswirbelsäulenfraktur, Rückenmarksblutung und völliger Lähmung. Als mich Herr Verwalter Hidber in der Kutsche am Bahnhof Ragaz zum Antritt meiner Stelle in St. Pirminsberg abholte, war ich noch unsicher, ob ich mich in der Folgezeit trotz motorischer Schwäche aus dem Kloster auf die Strasse begeben könnte. Dann erholte ich mich rasch und wenige Wochen später machte ich zu Fuss Visiten auf dem St. Margrethenberg. – Sie können sich sicher denken, was für warme Erinnerungen Ihr grosses Geschenk in mir weckt.» Wir wollen versuchen, auf Grund von persönlichen Gesprächen und Briefen mit und von Manfred Bleuler und ehemaligen Patienten und Mitarbeitern sowie der eher dürftigen Jahresberichte jener Zeit eine kurze Biographie und Darstellung seines Wirkens in St. Pirminsberg aufzuzeichnen. Meine Zeilen der Erinnerung sind Zeugen einer persönlichen, kollegialen und väterlich-freundschaftlichen Erfahrung. Manfred Bleuler ist am 4. Januar 1903 in der Amtswohnung des Burghölzli als Sohn des damaligen Direktors und Psychiaters Eugen Bleuler und seiner Mutter Hedwig, geborene Waser, Dr. phil., Literatin und Kämpferin gegen den Alkoholismus, geboren. Seine Jugendzeit verlebte er in der Direktionswohnung im Burghölzli in besonders enger Beziehung zur Psychiatrie. Sein Vater hat die Zürcher Psychiatrische Universitätsklinik weltberühmt gemacht, vor allem durch seine grundlegenden Forschungen über die Schizophrenie. Primarschule, Gymnasium und Medizinstudium absolvierte er in Zürich. Nach dem Staatsexamen 1928 in Zürich folgten Assistentenjahre in Liestal, Zürich und Boston, White Plains (NY) in den Vereinigten Staaten. In der Folge war er Sekundärarzt oder Oberarzt in der Heilund Pflegeanstalt St. Pirminsberg Pfäfers, wo er gleichzeitig als Talarzt im Taminatal wirkte. Aus jener Zeit stammen seine reichen Erfahrungen in der Allgemeinmedizin und sein reges Interesse für psychotherapeutische Möglichkeiten der körperlichen Medizin. Von 1936 bis 1942 arbeitete Manfred Bleuler als Oberarzt an der Basler Psychiatrischen Universitätsklinik, wo er sich auch habilitierte. 1942 berief ihn die Medizinische Fakultät der Universität Zürich als Direktor und Professor für Psychiatrie. Nach seiner Pensionierung im Jahre 1969 widmete er sich weiterhin seinen Patienten und der Forschung. Am 4. November 1994 durfte Professor Manfred Bleuler in seinem Heim in Zollikon nach schwerer, geduldig ertragener Krankheit im 92. Altersjahr sterben. Am 15. November fand in der reformierten Kirche in Zollikon die Abdankung statt. Czeslaw Bielinski und ich waren beeindruckt, wie viele Freunde und Kollegen sich einfanden, um von einem lieben Menschen, guten Freund und Arzt, grossen Lehrer, Psychiater und Wissenschafter Abschied zu nehmen. Es ist nicht die Aufgabe dieses Beitrages von einem Nichtpsychiater, die wissenschaftlich-psychiatrische Leistung von Professor Manfred Bleuler darzulegen. Statt dessen folgen nun Erinnerungen an das Wirken von Manfred Bleuler in St. Pirminsberg, welche uns die Persönlichkeit des Menschen und Arztes aufschliessen. Sie beruhen auf mündlichen und schriftlichen Angaben von ihm selbst und von ehemaligen Mitarbeitern von der Klinik in Pfäfers. Wertvolle Unterlagen hat uns Frau Monica Bleuler vermittelt. Über die Dauer der Tätigkeit von Manfred Bleuler in Pfäfers gehen die Angaben bereits auseinander. Übereinstimmung herrscht mit dem Beginn im Jahre 1933. Nach mündlichen Angaben und nach verschiedenen biographischen Berichten blieb Manfred Bleuler bis 1936, 1937 oder 1938 in Pfäfers. Am sichersten scheinen uns die Angaben in den sonst eher knapp gehaltenen Jahresberichten. Im 76. Jahresbericht (1933) der 29 Heil- und Pflegeanstalt St. Pirminsberg, verfasst vom damaligen Direktor Dr. Otto Wirth am 24. März 1934, können wir lesen: «Zum Sekundärarzt wurde ernannt Herr Dr. med. M. Bleuler. Er trat seine Stelle an im März 1933». Im 79. Jahresbericht (1936) steht unter dem Abschnitt Beamtenstand: «Ende Dezember verliess uns, ebenfalls zum Bedauern aller, unser Sekundärarzt, Herr Dr. Bleuler, der zum Oberarzt der psychiatrischen Klinik in Basel gewählt wurde». Nach diesen Angaben war Dr. Manfred Bleuler rund 3 Jahre in Pfäfers tätig. Der ärztliche Dienst wurde in jenen Jahren durch Chefarzt Dr. Otto Wirth, Sekundärarzt Dr. Manfred Bleuler und durch einen Assistenten versehen. Der Gesamtbestand an Patienten hat im Jahre 1936 seinen Höhepunkt mit 339 Patienten am 25. Januar und seinen tiefsten Stand mit 307 Kranken am 1. Juni erreicht. Die Aufnahmen im Jahre 1936 betrugen 114 (58 Männer und 56 Frauen) und die Zahl der hospitalisierten Patienten war 450 (235 Männer und 215 Frauen). Während seiner Tätigkeit als Oberarzt in der Klinik St. Pirminsberg, Pfäfers, übte Manfred Bleuler zusätzlich eine allgemeinärztliche Tätigkeit aus. In einem Brief vom 28. September 1984 schrieb uns Manfred Bleuler: «Enge und schöne Beziehungen mit Ihrem Spital (WalenDas landwirtschaftliche Gut der Klinik auf dem stadt) hatte ich in den Jahren 1933 – 1936, als ich St. Margrethenberg auch Talarzt im Taminatal war. Dr. Beck war mir damals eine ausgezeichnete Hilfe...» Am 17. Juni 1996 erzählte mir Fritz Grob im Altersheim Bad Ragaz einen Nachmittag lang über seinen früheren Chef und lieb gewordenen Freund Manfred Bleuler. Es war wirklich spannend, zuzuhören und Notizen zu machen. Fritz Grob, geboren 1914, war zuerst in der väterlichen Metzgerei und Landwirtschaft tätig. Später, während 8 Jahren, hat er für die Psychiatrische Klinik, vor allem in der Landwirtschaft, zusammen mit Patienten gearbeitet. Auf dem Gutsbetrieb in St. Margrethenberg mit 50 ha, mit Haus und Kapelle betreute er zusammen mit seiner Frau als Köchin etwa 8 Patienten. Die Köchin erhielt damals einen Monatslohn von 100 Franken, während der Landwirt und Therapeut 80 Franken bekam. Später übernahm er mit seinem Bruder den «Baschärhof» in Bad Ragaz, wo er von Manfred Bleuler und seiner Frau immer wieder besucht wurde. Der Vater Eugen Bleuler war von bäuerlicher Herkunft aus Zollikon. Dies hat sich offenbar auf den Sohn vererbt, indem Manfred Bleuler eine grosse Verbundenheit mit der Natur, dem Bergbauerntum und der Landwirtschaft zeigte. Verbundenheit bedeutete für ihn auf allen Gebieten auch Verantwortung. Der sterbende Wald, die Überbauung in unserem Land, die Gefährdung der Naturreservate bei der Uneinsichtigkeit von Mitbürgern und Behörden in der Verfolgung ökonomischer Interessen bekümmerten ihn ausserordentlich. Er versuchte, sich für ökologische Probleme einzusetzen, und dies zu einer Zeit, als diese Probleme noch nicht wie heute als dringend und wichtig empfunden wurden. Mit dem Bauerntum seiner Vorfahren wurde er durch den Beruf und die Heirat seiner Tochter erneut verbunden. Familiäre Bande und Zukunft der Bergbauern und der Landwirtschaft bedeuteten ihm nicht weniger als Wissenschaft und Psychiatrie. Fritz Grob sagte mir: «Doktor Bleuler war ein menschlicher Doktor, der den ärmlichen Leuten eher ein Päckchen gebracht als eine Rechnung geschickt hat». Die Familie Grob hatte zwei Pferde, einen «Eidgenossen» irländischen Ursprungs, namens «Film», einen im Jahre 1933 etwa vierjährigen Hengst, daneben einen «Einsiedler». «Film» war der Liebling von Manfred Bleuler. Das Pferd wurde von Fritz Grob gerüstet und gesattelt, wenn Manfred Bleuler einmal pro Woche auf Hausbesuche nach Vättis und einmal pro 30 Manfred Bleuler Woche nach St. Margrethenberg und ab und zu nach Valens ritt. Für Ross und Futter für den Gang nach Vättis erhielt Fritz Grob von seinem Chef den fürstlichen Lohn von Fr. 3.– und für den Ritt nach St. Margrethenberg Fr. 2.50. Fritz Grob hat mir seine persönlichen Briefe, die er von Manfred Bleuler während all dieser Jahre erhalten hat, zum Lesen zur Verfügung gestellt. Es sind Zeilen der tiefen Verbundenheit mit einem guten Freund und ehemaligen Mitarbeiter. Immer wieder stehen Gedanken der tiefen Dankbarkeit und der schönen Erinnerungen an das Taminatal im Vordergrund. Im Brief vom 21. Oktober 1990 schreibt Manfred Bleuler an Fritz Grob: «...vor einigen Tagen besuchte uns eine heute 60-jährige Frau und dankte mir im Namen ihrer Mutter, dass ich auf Telefonanruf der Mutter zu ihr nach Vättis gekommen sei, um bei der Geburt zu helfen. Meine Antwort in meinem Herzen: dafür ist weniger mir als Fritz Grob zu danken, der mir so bereitwillig sein Pferd zur Verfügung stellte». Die Klinik St. Pirminsberg hatte damals nur einen kleinen Saurer-Lastwagen, erst viel später einen Personenwagen. Die Familie Grob erhielt 1932 das erste Auto (Chevrolet), die Fahrprüfung wurde von Fritz Grob im Jahre 1933 absolviert. Für Hausbesuche durch Manfred Bleuler war das Pferd ideal, da die schlechten Wege zu den Bauernhöfen im Taminatal nicht besonders geeignet waren für das Auto. Als Redaktor der bereits erwähnten Jubiläumsschrift aus Anlass von 125 Jahren Ärzteverein Werdenberg-Sargans bat ich Professor Manfred Bleuler um einen kleinen Beitrag. Er lehnte bescheiden ab und schrieb:» … ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich nicht getraue, aus meinen ganz kleinen und sehr persönlichen Erinnerungen, die ich Ihnen ganz persönlich in nachdenklicher, fast wehmütiger Stimmung erwähnte, einen Artikel in einer grossen Festschrift einer grossen Klinik zu machen. Ein solcher Versuch erschiene mir ein aussichtsloses Unternehmen. Ich bin sicher, dass Sie mich verstehen können». Dies war am 3. Oktober 1984. Am 21. Januar 1990 schrieb Professor Manfred Bleuler: «Sie wünschen Erinnerungen aus meinem Leben im Sarganserland. Die Aufgabe, Ihnen mehr über Erfahrungen im Sarganserland zu berichten, macht mir etwas Mühe: Einmal sind diese Erinnerungen persönlich und sodann: Zum Schlimmsten im Alter gehört mir, dass ich nur noch zu einem kleinen Teil das tun kann, was ich tun sollte und möchte. Aus beiden Gründen stand ich vor dem Entscheid: Soll ich an Ihrem Wunsche einfach vorbeigehen oder soll ich ihn erfüllen? Von Ihnen habe ich so viel Gutes erfahren, so anlässlich Ihrer Behandlung des armen ..., und so viel unverdiente Freundschaft, dass es mir nicht möglich ist, an Ihrem Wunsche einfach vorbeizugehen. Andererseits ist es mir der Sache nach und meiner Zeit nach unmöglich, einen längeren druckreifen Bericht zu schicken. So tippe ich einfach drauflos, was mir in den Sinn kommt. Ich weiss: Sie werden es mit Takt korrekt verwenden...» Fritz Grob mit «Film», dem Lieblingspferd von Manfred Bleuler. 31 «Erinnerungen an das Sarganserland aus Kindheit und Jugend» (zusammengestellt von Manfred Bleuler auf Wunsch von Hans Jörg Keel) «Meine Geschwister und ich wurden im Burghölzli, dessen Direktor mein Vater war, in Zürich geboren und auferzogen. Meine Mutter, die eine der ersten Zürcherinnen war, die in Zürich in Sprache und Geschichte studierte, hatte sich hart gegen das Verbot ihres Vormundes durchzusetzen, als Frau Universitätsbildung zu suchen. Im Zusammenhang damit gründete sie später die «Frauenbildungskurse», in denen Frauen viel vorgetragen wurde, was ihnen sonst verborgen geblieben war. Bei einem Vortrag darüber in Chur lud sie eine Frau aus Murg zum Besuch nach Quinten ein. Sie war beglückt von dem kleinen Dörfchen und der Berglandschaft, und zufällig bot ihr eine Bauernfrau ein leerstehendes Bauernhäuschen in Quinten als Ferienhaus an. Dorthin nahmen unsere Eltern uns Kinder in fast allen Ferien 1916 – 1927 mit. Quinten wurde zu unseren eindrucksvollsten Erlebnissen in der Kinderzeit. In einfachen Verhältnissen waren wir glücklich. Wasser musste am Brunnen über dem Hause geholt werden, Milch holten wir im benachbarten Stall, Licht nur mit Petrollampen und Kerzen. Die Quintener waren gleichzeitig Weinbauern und Bergbauern. Ihre harte Arbeit bewunderten wir, so wenn sie mehrmals im Tage von Quinten in die Laubegg stiegen, einen grossen Schlitten mitschleppend und den Schlitten mit Heu schwer beladen wieder nach Quinten hinunterzogen – alles von Hand. Mein Vater nahm seine Schreibmaschine nach Quinten mit, stellte sie auf eine Kiste und schrieb dort die wichtigsten seiner Werke (im Burghölzli hatte er keine Zeit dazu). Patientenausflug Zu meinen Aufgaben gehörte es, alle paar Tage mit seiner Post (z. B. seinen Manuskripten für Springer Verlag) über den See nach Murg zu rudern – es war mir eine Ehre. Aber er wurde mir bald ein Vorbild von Tapferkeit: Eines Abends nach dem Nachtessen schrie mein jüngstes Brüderchen (damals noch Wickelkind) furchtbar. Die Eltern zogen es aus und stellten eine beginnende Phlegmone fest. Trotz Wind und Regen ruderte mein Vater in dunkler Nacht allein und sofort nach Walenstadt und holte dort Ichthyollösung. Er kam noch in der Nacht zurück und sagte dankbar, wie lieb man ihn im Spital empfangen hätte. Unter dem Ichthyol heilte die Phlegmone erstaunlich rasch. Ich könnte endlos weiterschreiben, aber das kann und darf ich nicht. Unter ganz anderen Verhältnissen war ich von 1933 an etwa 3 Jahre im Sarganserland: gleichzeitig als Oberarzt in St. Pirminsberg und Dorfarzt in Pfäfers. Auch über diese Zeit könnte ich Seite um Seite schreiben – ich will mich aber auf zwei Erlebnisse beschränken: Das erste ist ein sozial-psychiatrisches. Schon in den Zeiten des Klosters hatten sich die Mönche in St. Pirminsberg vieler Geisteskranker angenommen. Als St. Pirminsberg Psychiatrisches Spital wurde, blieb eine Verbundenheit der Bevölkerung von Pfäfers mit der Klinik und deren Wirken für die Kranken erhalten. Die Felder, die dem Kloster gehört hatten, wurden von der Klinik aus weitergepflegt. Es entstand eine Zusammenarbeit zwischen Kranken, Pflegern und Ansässigen, eine soziale Arbeitstherapie, wie man sie sich nicht besser vorstellen kann. In manch anderer Beziehung noch tat den Kranken die Verbundenheit mit den Gesunden im Dorf wohl. So nahmen an Chören, die der Dorflehrer leitete, Gesunde und Kranke gemeinsam teil. Kurz: Auf ganz natürliche Weise hat sich dort eine Gemeinschafts- und Arbeitstherapie gebildet, wie sie heute mit vielen künstlichen Mitteln angestrebt wird. Natürlich hat etwas so Grosses auch Schattenseiten: So denke ich an die Arbeitszeit von Schwestern und Pflegern, z. B. an diejenige des Pflegers, der über den Sommer mit einer Gruppe von Kranken die Landwirtschaft auf dem St. Margrethenberg besorgte: Tag und Nacht war er bei der Gruppe, von Freizeit und Freitagen keine Rede... Eine 32 Manfred Bleuler rührende Erinnerung: Fühlte ich mich in ganz schwierigen medizinischen Fällen nicht mehr ganz sicher: Wissen Sie, wer mir zwei oder drei Mal sofort zu Hilfe kam? Der verehrte Chefarzt aus Walenstadt: Dr. Beck – er kam, als ob es selbstverständlich wäre, nach Pfäfers hinauf zu vereinzelten Konsultationen – mit gutem Erfolg. Und etwas ganz anderes: Es war zu Beginn der 30-er-Jahre, als sich in Deutschland die Hitlerherrschaft festigte. Eines Abends sprach in Mels der damalige Bundesrat Minger über die Notwendigkeit, in dieser gefährlichen Lage die Ausbildung unserer Armee zu fördern. Der Verwalter der Klinik führte einige Pfäferser und mich in einem Pferdewagen zu diesem Vortrag. Alle waren tief ergriffen und voll und ganz dafür, dass man alles tun müsse, um unsere Armee schlagfertig zu halten. Niemand zweifelte an dieser Notwendigkeit – und wir wurden vom Kriege verschont dank der Schlagkraft der Armee». Nach Erhalt dieser persönlichen Erinnerungen aus dem Sarganserland schrieb ich Professor Manfred Bleuler einige Gedanken aus meiner Studienzeit und Erinnerungen aus dem alten Hörsaal im Burghölzli, von meiner Prüfung in Psychiatrie am Staatsexamen 1958 im altehrwürdigen Büro des Chefs, als ich auf der Couch sitzen durfte und von meinem «Examenspatienten» berichtete und nach einer Stunde Dialog glücklich die Note 6 erhielt. In seiner Antwort schrieb mir Professor Manfred Bleuler: «Aus bewegtem Herzen möchte ich Ihnen ganz herzlich danken: einmal für Ihre geistige Fürsorge für Frau ... und dann für Ihre lieben Erinnerungen aus Ihrer Studienzeit! Ein Echo aus früheren Jahrzehnten, aus längst vergangener Tätigkeit, wie Sie es mich lauschen lassen, empfindet man warm im Alter, wirklich mit bewegtem Herzen»! Manfred Bleuler behandelte seine Patienten, aber auch jeden Gesprächspartner mit einer lebensnahen tiefen Menschlichkeit, welche ihm oft ihr inneres Erleben, ihr Denken und Fühlen eröffnete. Diese Herzlichkeit und Mitmenschlichkeit im Gespräch mit dem Kranken und Mitmenschen hat mich und viele Mitstudenten und Kollegen zu tief angesprochen. Manfred Bleuler lebte nicht nur für den Kranken, sondern mit dem Kranken. Sein menschliches Handeln wurde zum Vorbild für viele. Sein ärztliches Credo, wir Ärzte müssen uns auf unsere grösste und schönste Aufgabe besinnen, «am Kranken zu bleiben, seine Sprache zu reden und ihm ein Partner zu sein», dürfte zeitlos gültig sein. Die GeWachsaal 1933 fahr in der heutigen Zeit droht, dass die Kranken vereinsamen und jenen Trost und jene Hilfe entbehren, die nur auf Grund eines persönlichen Verhältnisses zum Arzt möglich sind. Das Credo von Manfred Bleuler ist in unserer heutigen technisch orientierten Spital- und Spezialistenmedizin von grosser Bedeutung: «Bleiben wir am Kranken!» 33 August Zinn – klar, wohlwollend, stark Wilhelm M. Zinn August Zinn wurde am 20. August 1825 in Ilbesheim in der Pfalz, unweit Kaiserslautern, als 14. Kind des reformierten Pfarrers Johann Christian Zinn geboren, der in zweiter Ehe mit der Pfarrerstochter Henriette Karoline Pixis verheiratet war. Die Familie Pixis besass eine starke musikalische Begabung und brachte mehrere zu ihrer Zeit weitgereiste und bekannte Komponisten und Konzertmusiker hervor. Vater Johann Christian Zinn starb schon 1838, als sein Sohn August erst 13 Jahre alt war. Es war für seine Witwe nicht leicht, mit ihrer kleinen Witwenpension die mindestens 11 überlebenden Kinder aufzuziehen. Noch vor seinem Tode hatte der Vater wohl aus finanziellen Gründen den Wunsch geäussert, August solle Forstmann werden. Nach der Matura verzichtete August schweren Herzens auf seine AbDr. August Zinn sicht, Medizin zu studieren und ging auf die Forstakademie nach Aschaffenburg. Diese Ausbildung war damals viel kürzer als die der Ärzte und wurde weitgehend vom Staat finanziert. Nach Beendigung des Studiums der Forstwissenschaften trat er im Jahre 1846 eine Stelle im staatlichen Forstdienst in der Nähe von Kaiserslautern an. Schon während der Schulzeit wurde Zinn vom revolutionären Geist, der damals in der Pfalz herrschte, angesteckt. Sein älterer Bruder Christian Zinn redigierte eine Lokalzeitung in Kaiserslautern und hetzte darin weidlich gegen München. Viele andere Verwandte und Freunde der Familie Zinn waren aktive Revolutionäre. August selbst war ganz durchdrungen von den liberalen Zielsetzungen dieser Kreise. Er setzte sich aktiv und ungestüm für die Verwirklichung derselben ein. Seine eigentliche Arbeit musste dabei ganz zurückstehen. Die Motive der Freiheitskämpfer waren zwar klar und logisch, doch fehlte ihnen jede politische Erfahrung und der Sinn für das tatsächlich Machbare. Als der pfälzische Aufstand im Juni 1849 zusammenbrach, flüchtete August Zinn nach Zürich. 34 Zürich Da er sich nun frei von allen Bindungen fühlte, beschloss er, seinem brennenden Wunsch nachgebend, Medizin zu studieren. Er wurde von verschiedenen in der Schweiz und in Bayern lebenden Verwandten und Bekannten unterstützt, musste aber auch manche Bettelbriefe schreiben und verdiente sich den Lebensunterhalt soweit wie möglich mit Nachhilfestunden für Kantonsschüler, hauptsächlich in Mathematik. Bereits im Jahre 1853 absolvierte er das medizinische Staatsexamen und promovierte mit einer rasch niedergeschriebenen Arbeit über die Prädisposition zu Leistenhernien. Nach dem Staatsexamen ging er sofort in die Psychiatrie und war von 1854 – 1856 unter Bach Assistent an der alten Irrenanstalt und am alten Spital in Zürich. Leider habe ich aus dieser Zeit kaum Briefe und andere handschriftliche oder gedruckte Zeugnisse finden können. Aus den wenigen vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass Zinn während dieser Zeit mit sehr grossen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und sehr darunter litt. Er konnte aber auf verschiedenen Auslandsreisen zahlreiche führende psychiatrische Kliniken und Anstalten besuchen und studierte genauestens ihre Arbeitsweise und Organisation. Längere Zeit arbeitete er dann bei Roller in Illenau, und grossen Eindruck machte ihm das Pionierzentrum Gheel in Belgien. Bei diesen Studienaufenthalten und während seiner Ausbildungszeit gingen ihm die Möglichkeiten der Arbeitstherapie, der Wiedereingliederung vieler Anstaltspatienten in das Familienleben, die Notwendigkeit des engen Kontaktes mit den Patienten, ihren Angehörigen und dem Pflegepersonal auf. Er begriff die für den leitenden Arzt unausweichliche Notwendigkeit, als Beispiel zu wirken und erkannte früh, dass auch die Verwaltung einer psychiatrischen Anstalt der ärztlichen Direktion unterstellt sein muss, wenn Unzuträglichkeiten vermieden werden sollen. Im Jahre 1863 hat er vor der endlich vom Grossen Rat in Zürich zur Untersuchung der Verhältnisse an den kantonalen Krankenanstalten eingesetzten Kommissi- August Zinn on klar und geschickt über die Missstände, die damals an der alten Irrenanstalt und im alten Spital herrschten, berichtet. Diese Mitteilungen hat er nachher in einer Schrift über «Die öffentliche Irrenpflege im Kanton Zürich und die Notwendigkeit ihrer Reform» publiziert. Er rühmt darin, was der Kanton Zürich für die Behandlung und Pflege der somatisch Kranken geleistet habe. In Bezug auf die Behandlung psychischer Krankheiten sei er aber weit, sehr weit hinter anderen Kantonen und Ländern zurückgeblieben, obwohl frühere und eigene Zählungen ergeben hatten, dass dieser Kanton eine viel höhere Zahl von Geisteskranken aufweise als bisher zugegeben. Da ihm noch keine zuverlässigen standesamtlichen Unterlagen zur Verfügung standen, hatte er zuvor bereits selbst, gemeinsam mit einem Pfarrer, der ihm seine Einwohnerkartei überliess und ihm den Zugang zu den Einwohnern erleichterte, in zwei Gemeinden des Kantons Zürich nach von ihm vorgängig erarbeiteten und klar festgelegten Kriterien eine eingehende Bevölkerungsuntersuchung durchgeführt. Diese grundlegende und mit grösster Sorgfalt betriebene Studie war eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Leistungen des Autors. In der Folge mussten die anderswo gefundenen Zahlen seinen Daten entsprechend korrigiert und angepasst werden, denn eine der wesentlichen Schlussfolgerungen war, dass die psychischen Krankheiten in allen Ortschaften, Bevölkerungsgruppen, Regionen und Ländern Zentraleuropas etwa gleich häufig waren. Zinn und seine in anderen Ortschaften und Regionen ebenfalls in dieser Richtung arbeitenden Kollegen dürften ganz allgemein die Grösse des Problems in der menschlichen Gesellschaft klar erfasst und dem Tabu entrissen haben. Der Fachwelt, den Gesundheits- und Sozialbehörden wurden damit eindeutige Vorgaben zur bestmöglichen Bewältigung und Lösung des Problems psychisch kranker Mitbürger an die Hand gegeben. Ausführlich prangert Zinn in seiner Schrift die damaligen Missstände in der Behandlung und Betreuung psychisch kranker Mitmenschen an. Die Psychiatrie wurde zu seiner Zeit an der Zürcher Universität weder theoretisch noch praktisch gelehrt, auch nicht im medizinischen Staatsexamen geprüft. Daher habe nur ein kleiner Teil der Ärzte überhaupt eine Ahnung davon. Zinn gibt dann sehr klare und umfassende Richtlinien für den notwendigen Neubau der kantonalen psychiatrischen Klinik und die unerlässliche ärztliche und gesetzliche Neuordnung der Behandlung und Sozialbetreuung Geisteskranker. Durch seine Forderungen darf er auch mit zu denen gezählt werden, die schliesslich den Anstoss gaben zur Schaffung des Burghölzli. Regierungsrat Dr. Zehnder, der damalige Chef des Kantonalen Zürcher Gesundheitsdepartements, wohl einer der bedeutendsten Inhaber dieses Amtes, nahm Zinns Anregungen aufgeschlossen und dankbar entgegen und reagierte rasch. Noch im gleichen Jahr 1863 wurde die Leitung des ärztlichen Dienstes der beiden Zürcher Abteilungen für Irrenpflege dem damaligen Direktor der medizinischen Universitätsklinik, Wilhelm Griesinger, übertragen. Griesinger hatte sich früh mit der Psychiatrie befasst, und 1861 war bereits die 2. Auflage seines berühmten Lehrbuches der Psychiatrie erschienen. Er war meines Wissens der erste wirklich bedeutende Kliniker, der in Zürich (von 1862 bis zu seinem Weggang 1865 nach Berlin) eine psychiatrische Klinik leitete. Er darf auch zu den Ersten gezählt werden, welche die Psychiatrie, so wie wir sie heute verstehen, tatkräftig förderten. Durch seine bisherige Arbeit, seinen inzwischen entwickelten Sinn für das Machbare und seine Ausführungen vor der grossrätlichen Kommission leistete Zinn in Zürich, neben vielen anderen einflussreichen Persönlichkeiten, einen wesentlichen Beitrag dazu, dass sich die Verhältnisse bald änderten. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen für das spätere Wirken so bedeutender Männer wie August Forel und Eugen Bleuler, die der Zürcher Schule ihren führenden Platz verschafften. Zinn war bereits im Jahre 1856 von der Spitaltätigkeit zurückgetreten. Er tat es nicht nur wegen der traurigen Zustände, sondern auch wegen seiner eigenen misslichen finanziellen Lage. Nach mancherlei Überlegungen eröffnete er noch im gleichen Jahr eine Praxis in Thalwil und heiratete anno 1858 seine ihm schon lange verbundene 35 Braut Anna Haas. Das Paar bezieht das Haus «Zum Morgenthal» in Thalwil. Es ist sehr günstig gelegen und so geräumig, dass eine Anzahl psychiatrischer Patienten auch stationär aufgenommen werden kann. Neben der Allgemeinpraxis widmet sich Zinn auf diese Weise weiter auch der ambulanten praktischen Psychiatrie, während er andererseits nichts unterlässt, um sich auf Reisen und später durch den Besuch der Vorlesungen Griesingers u. a. wissenschaftlich weiterzubilden. Er reihte sich damit ein in die Gruppe derjenigen Arztkollegen, die in der Schweiz früh Psychiatrie im modernen Sinn praktizierten. Durch seine geschickten und konstruktiven, jede Polemik vermeidenden Ausführungen vor der grossrätlichen Kommission in Zürich war Zinn allmählich in der ganzen Schweiz und teilweise darüber hinaus bekannt geworden. Auch im damals sehr aufgeschlossenen Kanton St. Gallen war man auf ihn aufmerksam geworden, und es war für den dortigen Regierungsrat ein leichter Entschluss, Zinn im Jahre 1864 zum Direktor der kantonalen psychiatrischen Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers zu berufen. 36 St. Pirminsberg / Pfäfers Als Zinn die «Anstalt», wie man damals sagte, übernahm, war dieselbe überfüllt, und zu einer wirklichen Entlastung kam es auch erst 1892 mit der Erstellung des Asyls Wil. Als gut geschulter Facharzt und überzeugter Anhänger des No-Restraint schaffte er alle Zwangsmittel ab und räumte den Kranken grösstmögliche Freiheit ein. «Mit dem Segen der Freiheit ist auch ein fröhlicher Geist in die Anstalt eingezogen», schrieb der Anstaltsinspektor Dr. Sonderegger, mit dem sich bald eine enge, das ganze Leben hindurch bewahrte Freundschaft entwickelte. «Das Zusammenarbeiten dieser beiden idealgesinnten, von Arbeitseifer sprühenden Geister konnte sich für die Anstalt nur zum grössten Vorteile auswirken», fügt Herensberger, der Chronist der Anstalt, bei. Bereits im Juni 1866 bewilligte der Grosse Rat 200 000 Franken für den Ausbau der Anstalt. Dieser erstreckte sich bis in das Jahr 1869 und erforderte total die für damalige Verhältnisse gewaltige Summe von 720 000 Franken, wodurch allerdings die Erstellung des lange geplanten Asyls Wil erheblich verzögert wurde. Zinn sah in der öffentlichen Meinung einen der Schwerpunkte der gesamten praktischen Irrenheilkunde. Daher standen für ihn Information und Kampf um tatkräftige und allseitige Unterstützung derselben durch die Bevölkerung bei seiner ganzen Arbeit an erster Stelle. Er hatte erkannt, dass nur die Bevölkerung als Ganzes die Voraussetzungen für ein wissenschaftlich und menschlich einwandfreies Wirken der Psychiatrie schaffen konnte. Sein zweitwichtigstes Ziel sah er in der Schaffung von Wiedereingliederungsmöglichkeiten geheilter und gebesserter Geisteskranker in ein möglichst normales Leben. Zur Erreichung beider Ziele gründete er, wohl angeregt durch das Beispiel Pinels in Paris, im Jahre 1866 zusammen mit Sonderegger den kantonalen Hilfsverein für genesende Gemütskranke, und zwar zuerst im Rahmen des Ärztevereins des Kantons St. Gallen. Wie aus Erklärungen Constantin Monakows (1879) und anderen Zeugnissen hervorgeht, war dies der erste derartige Verein im deutschen Sprachgebiet. Dem erfolgreichen Beispiel folgend wurden dann rasch auch in den anderen Kantonen und im deutschsprachigen Ausland zahlreiche ähnliche Vereine gegründet. Zinn knüpfte in seinen hiermit verbundenen Reden und Vorträgen vielfach an Pinel an. «Irresein ist Krankheit», ruft er aus, und der Kampf um die Anerkennung dieser Tatsache erfüllt sein Leben. Es gelingt ihm mit Hilfe des Hilfsvereins, zahlreiche seiner entlassenen Patienten in sorgfältig ausgesuchten Familien unterzubringen und auch beruflich einzugliedern. Manche Psychiater jener Zeit dachten und handelten ähnlich. Nach diesem Vorbild entwickelte sich allmählich auch in Europa unser heutiges multidisziplinäres Konzept umfassender praktischer Rehabilitation. August Zinn lebte ganz in der Anstalt und relativ eng mit seinen Patienten zusammen. Er machte täglich morgens und abends Visite, war unerbittlich in der Durchsetzung moderner Hygiene, Sauberkeit und einwandfreier Pflege, denn ein grosser August Zinn Teil der Aktivität der Anstaltsärzte war noch immer der Bekämpfung interkurrenter, vor allem ansteckender somatischer Krankheiten gewidmet. Mit grossem Einsatz wurde die Fortbildung der Pfleger und Schwestern an die Hand genommen, doch gelang es ihm nicht, die angestrebte interkantonale Ausbildungsstätte für das Pflegepersonal aufzubauen. Täglich fand in Pirminsberg morgens früh ein Rapport statt mit den Ärzten, dem Verwalter, Oberschwester, Oberpfleger, Hausmeistern, Gärtnern, usf. Die Verwaltung unterstand von Anfang an der ärztlichen Direktion, so dass in dieser Beziehung keine wesentlichen Schwierigkeiten auftauchten. Körperliche Tätigkeit und Training fand Zinn für seine Patienten nützlich. So beschäftigte er etwa 20 – 30 Männer mit Feldarbeit in der Kolonie St. Margrethenberg. Auch der Freizeitgestaltung und der Strukturierung des Alltags seiner Patienten schenkte er die gebührende Aufmerksamkeit. Er bildete Chöre, veranstaltete Tanzanlässe und Konzerte, teilweise unter Beizug auswärtiger Künstler. Da er sich in der Zeit vor Kräpelin über Ursachenforschung, Definition und Abgrenzung einzelner Krankheitsbilder keinen Illusionen hingibt, legt er den allergrössten Wert auf die Beobachtung und Dokumentation der Symptome seiner Patienten. Dadurch sind die damaligen Krankengeschichten zeitbedingter und wechselnder InTheateraufführung von terpretation entzogen. Der Leser ist immer direkt Patientinnen und Patienten der Klinik am Symptom. Manfred Bleuler betont, dass die Pirminsberger Krankengeschichten aus jener Zeit in dieser Beziehung vorbildlich geführt waren und heute noch brauchbar sind. Dass Zinn dem Symptom und seiner Registrierung ausschlaggebende Bedeutung beimass, darin sieht Manfred Bleuler, der von 1933 – 1936 selbst als Sekundärarzt und stellvertretender Direktor in Pirminsberg tätig war, seinen zweitwichtigsten wissenschaftlichen Beitrag. Schon sehr früh wurden Zinn zahlreiche Zeichen der Anerkennung zuteil, so bereits 1866 im Grossen Rat durch Bewilligung des Ausbaus der Anstalt und eine bedeutende Gehaltserhöhung, 1866 durch Verleihung des Bürgerrechts und 1868 durch Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt St. Gallen, und schliesslich durch den Ruf zum Direktor der grossen Psychiatrischen Klinik in Eberswalde bei Berlin und zum Landesmedizinaldirektor der Provinz Brandenburg, dem er nicht leichten Herzens im Jahre 1872 Folge leistete. Schwer trennte August Zinn sich von seinem Arbeitsfeld, seinen Kollegen und Freunden, unter denen hier nur Lehmann, Sonderegger, Henne genannt seien, und seinem geliebten Taminatal, in welchem er und später auch seine Oberärzte neben der klinischen Arbeit die gesamte somatisch-praktische ärztliche Primärversorgung zu versehen hatten. Diese Verbindung und Verankerung der ärztlichen Arbeit der Psychiater, insbesondere der Anstaltsärzte, in und mit der Bevölkerung war für ihn von zentraler Bedeutung. Eberswalde Die Anstalt Eberswalde, 40 km nördlich von Berlin gelegen, entwickelte sich unter Zinns Leitung (1872 – 1895) schnell, und die Haupterweiterungsbauten und Reorganisationen erfolgten während seiner Direktionsepoche. Die Baupläne waren bereits in enger Zusammenarbeit des Vorgängers von Zinn als Leitender Arzt, Dr. Sponholz, mit dem damaligen Berliner Stadtbaumeister Martin Gropius, dem Onkel des weltberühmten Architekten Walter Gropius, erarbeitet. Sie werden im Archiv der Bibliothek der jetzigen Klinik in Eberswalde aufbewahrt. Bereits im Jahre 1873 gründete Zinn den Brandenburgischen Hilfsverein für Geisteskranke, der bald eine segensreiche Tätigkeit entfalten sollte. Bekannt 37 wurde Zinn damals auch in Deutschland rasch durch die Einführung der Arbeitstherapie und Familienpflege. Erstere wurde natürlich bereits im Rahmen der Klinik durchgeführt. Sobald aber der Patient dafür geeignet war, wurde er zu zuverlässigen Familien in Pflege gegeben, und zwar in der näheren und weiteren Umgebung der Anstalt. Als Landesmedizinalrat hatte Zinn auch die Oberaufsicht über alle psychiatrischen Anstalten der Provinz Brandenburg und Gross-Berlins. Davon ausgenommen waren nur die Berliner Universitätskliniken. Auch sämtliche private Nervenheilanstalten – und davon gab es in Berlin nicht wenige – fielen hierunter. Er galt als grosser Organisator und hatte alle baulichen Erweiterungen sämtlicher Anstalten der Provinz zu begutachten. Auch zahlreiche Neugründungen psychiatrischer Institutionen gehen auf ihn zurück. Grosse Anstrengungen wurden der Ausbildung des Pflegepersonals gewidmet. Er tat alles, um ein bodenständiges Pflegepersonal aus der Region Eberswalde heranzuziehen. Hier konnte nun eine grosse Ausbildungsstätte in der Klinik selbst aufgebaut werden, sowohl für männliches wie für weibliches Pflegepersonal. Der Werbung für und der Aufklärung über den Beruf wurde viel Zeit und Arbeit gewidmet. In Eberswalde nahm Zinn auch seine politische Tätigkeit wieder auf, war doch die Schaffung freiheitlicher Institutionen und die Förderung der sozialen Einrichtungen, ganz besonders auf dem Gebiet der Gesundheitspflege, speziell der Irrenpflege, sein dringendstes Anliegen. Er wurde 1874 in das deutsche Parlament, den Reichstag, gewählt als Vertreter des Wahlkreises seiner alten Heimat Kaiserslautern. Zunächst schloss er sich der Fortschrittspartei (Liberale) an. Später nahm er in der Gruppe Löwe – Zinn eine vermittelnde Stellung zwischen den Nationalliberalen und der Fortschrittspartei ein. In einem Nachruf wird er zu den bedeutendsten Männern gezählt, die der Reichstag damals in seiner Mitte hatte. Im Rahmen dieser Festschrift würde es viel zu weit führen, seine ärztlichen, politischen und sozialpsychiatrischen Aktivitäten, Vorträge und zahlreichen Publikationen während seiner Tätigkeit in Eberswalde und als Mitglied des Reichstags im Einzelnen zu diskutieren. Es gelang Zinn immerhin, viele in der Schweiz bereits durchgesetzte Forderungen auf den Gebieten des Gesundheitswesens ganz allgemein, der Forschung und Rechtsprechung sowie der praktischen Psychiatrie weithin publik zu machen und vieles davon durch hartnäckige Überzeugungsarbeit auch im grösseren Rahmen des deutschen Reichs der Realisierung näherzubringen. Dank der Einsicht und der Unterstützung zahlreicher einflussreicher Persönlichkeiten konnten die ihm wichtigsten parlamentarischen Initiativen und Anträge dann auch noch zu seinen Lebzeiten in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Zinn erkrankte im Sommer 1896 an einer malignen Struma. Er hatte ein langes und schweres Leiden durchzustehen bis er im November 1897, ein Jahr nach seinem bis zuletzt eng mit ihm verbundenen Freund Jakob Laurenz Sonderegger, durch einen sanften Tod erlöst wurde. Am besten wurde er wohl durch die drei Worte charakterisiert, die der Kanton St. Gallen auf einen Silberpokal eingravieren liess, der ihm durch die Regierung noch in den 1860-er-Jahren überreicht wurde: klar, wohlwollend, stark. 38 39 CHEFÄRZTE, VERWALTER, OBERPFLEGER 40 1847 – 1856 1857 – 1864 1864 – 1872 1872 – 1879 1879 – 1889 1889 – 1898 1898 – 1931 1931 – 1933 1933 – 1949 1949 – 1960 1960 – 1981 1982 – 1986 1986 – 1996 1996 – Chefärzte der Klinik St. Pirminsberg Herr Dr. Ellinger Heinrich, Gaildorf BRD Herr Dr. Stucki Josef, St. Gallenkappel Herr Dr. Zinn August, Kaiserslautern BRD Herr Dr. Henne Hugo, Sargans Herr Dr. Weller Otto, Augst Herr Dr. Laufer Ernst, Kloten Herr Dr. Häberlin Viktor, Bürgeln Herr Dr. Würth Otto, Lichtensteig Herr Dr. Wirth Otto, Zürich Herr Dr. Wehrle Hans, Basel Herr Dr. Bielinski Cěslav, Wil (Polen) Herr Dr. Ausländer Joseph, Israel Herr Dr. Wengle Hans-Peter, Kreuzlingen Herr Dr. Meier Thomas, Oberbussnang 1847 – 1859 1859 – 1864 1864 – 1868 1868 – 1869 1869 – 1870 1870 – 1874 1874 – 1878 1878 – 1888 1888 – 1919 1919 – 1927 1928 – 1931 1931 – 1935 1935 – 1943 1943 – 1953 1953 – 1962 1963 – 1968 1968 – 1971 1971 – 1977 1977 – 1986 1986 – Oberschwestern* der Klinik St. Pirminsberg Frau Mader Maurita, Pfäfers Frau Huber Josefa, Tablat Frau Welte Katharina, Mels Frau Künzler Katharina Provisorisch besetzt Frau Good, Mels Frau Jäger Johanna, Pfäfers Frau Probst- Hürsch Frau Bader - Jäger Joh., Pfäfers; zum zweiten Mal Frau Lipp Anna Frau Burger Marie, Says Frau Thum Ines Frau Bonderer Agnes, Vättis Frau Schlegel Alice, Wartau Frau Meyer Frieda, Stäfa Frau Winkler Ursula, Mastrils Frau Meyer Frieda, Stäfa, zum zweiten Mal Frau Göpfert Ida, Pfäfers Frau Bigger Irene, Vilters Frau Nadig Jolanda, Flums Chefärzte, Verwalter, Oberpfleger Oberpfleger* der Klinik St. Pirminsberg 1847 – 1849 1849 – 1851 1851 – 1852 1852 – 1857 1857 – 1861 1861 – 1868 1868 – 1874 1874 – 1879 1879 – 1907 1907 – 1936 1936 – 1958 1958 – 1963 1963 – 1981 1981 – 1990 1990 – Herr Mayer Samuel, Wildhaus Herr Bislin, Pfäfers Herr Wäspi Phillip, Ernetschwil Herr Koch Johann, Wildhaus Herr Albrecht Franz A., Mels Herr Künzler Samuel, Kappel Herr Bader Gottlieb, Mümliswil Herr Bader Franz, Bruder d. Vorgängers Herr Egli Dominik, Schänis Herr Oswald Albert Herr Stieger Karl, Oberriet Herr Jud Josef, Rieden Herr Schwitter Christian, Pfäfers Herr Sulser Matthäus, Oberschan Herr Kühne Niklaus, Vasön 1981 – 1989 1989 – 1991 1991 – 1992 1992 – Ab 1981 wurde der gesamte Bereich Pflege einem Pflegedienstleiter unterstellt Herr Schwitter Christian, Pfäfers Sr. Frast Marlies ASC, Österreich a.i. Nadig Jolanda, Flums Meyer Evort, Wohlenschwil 1847 – 1862 1862 – 1885 1885 – 1904 1904 – 1934 1934 – 1970 1970 – 1995 1995 – Verwalter der Klinik St. Pirminsberg Herr Jäger Johann Paul, Pfäfers Herr Wäspi Phillip, Ernetschwil Herr Wäspi Phillip, Sohn des Vorgängers Herr Hidber Albert, Mels Herr Hidber Albert, Sohn des Vorgängers Herr Good Walter, Mels Herr Eicher Christoph, Goldingen SG * Bis 1960 wurde die Bezeichung «Oberwärter» bzw. «Oberwärterin» verwendet 41 45 EINE MODERNE KLINIK STELLT SICH VOR 46 Soziale und politische Einbindung der Klinik Hans Werner Widrig Der Sektor Drei Handel / Dienstleistungen ist im Bezirk Sargans mit ca. 59% überdurchschnittlich stark. Das ist durch den Tourismus begründet. Dagegen ist der Sektor Zwei Industrie / Gewerbe im vergangenen Jahr mit 34% erstmals tiefer als der Dienstleistungsbereich. Es entstehen zwar neue zukunftsträchtige Klein- und Mittelunternehmen, welche aber den Rückgang der «klassischen» Textilbetriebe (Stoffel Mels, Weberei Walenstadt, Spinnerei Murg, als Beispiele) nicht ganz aufzufangen vermögen. Der Landwirtschaftsanteil (Sektor Eins) ist stabil bei 7%. Die Arbeitslosenrate liegt mit 3,7% unter dem Kantonsmittel. Auch die Steuerkraft je Einwohner liegt mit 14% etwas unter dem kantonalen Mittel. Hauptgrund ist u.a. die Tatsache, dass bei uns lediglich 43% der Einwohnerschaft im Erwerbsleben stehen, während im Kanton St. Gallen 49% der Einwohner erwerbstätig sind. Oder ausgedeutscht: Wir haben weniger Zweitverdiener, was sich auf Einkommen und Steuerkraft auswirkt. Man darf sich in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung einer Region nicht auf kurzfristige Segmente fixieren sondern muss grössere Zeitabschnitte als Ganzes beachten. Zur insgesamt erfreulichen Entwicklung im Sarganserland seit dem zweiten Weltkrieg hat das Gesundheitswesen stark beigetragen. Wir haben mit den über die Region ausstrahlenden drei grossen Kliniken St. Pirminsberg Pfäfers, Rheuma- und Rehabilitationszentrum Valens und Rehabilitationsklinik Walenstadtberg eine starke Position. Sie wird durch zahlreiche weitere private Betriebe und öffentliche Unternehmen (z. B. Pflegeheime u.a.) ergänzt. Die Arbeitsplätze im Gesundheitswesen sind um so wertvoller, als der Bezirk Sargans weit weg vom öffentlichen Verwaltungszentrum St. Gallen liegt. Dezentra- Eine moderne Klinik stellt sich vor lisation der Verwaltung hat ihre Tücken. Hier im Gesundheitswesen lässt es sich ohne Nachteile durchführen. Das hängt auch mit den Ausbildungsmöglichkeiten zusammen. Die psychiatrische Klinik St. Pirminsberg leistet einen grossen Beitrag an die Berufsbildung. Entsprechend haben ihre Arbeitsplätze einen qualitativ hohen Stand. Bei Gross-Investitionen der baulichen Erneuerung wird immer wieder die grundsätzliche Standortfrage aufgeworfen. Das ist richtig und gilt auch für jedes andere private und öffentlich-rechtliche Unternehmen. In Pfäfers wurde diese Frage letztmals bei der baulichen Gesamterneuerung anfangs der 70-er-Jahre gestellt. Diese Frage wurde mit einem einhelligen Ja beantwortet. Die psychiatrische Klinik St. Pirminsberg gehört in diese Region und wird von Bevölkerung und Behörden getragen. Sie ist sozial in die Region eingebunden. Die Zusammenarbeit mit anderen Betrieben der Region ist partnerschaftlich. Damit wurden von 1970 bis 1978 in Pfäfers Investitionen getätigt, womit das Unternehmen für die Zukunft gerüstet ist. Die betriebliche Ver- und Entsorgung, Patienten- und Pflegeräume, betriebliche Einrichtungen und andere Hausaufgaben sind in den vergangenen 20 Jahren gemacht worden. Sowohl wirtschaftlich wie auch im sozialen Bereich spielt die Klinik über die Region hinaus eine grosse Rolle. Die Bevölkerung ist in der Lage, genügend qualifizierte Arbeitskräfte zu stellen. Für die Standortgemeinde Pfäfers trifft dies speziell zu. Das Unternehmen Klinik St. Pirminsberg ist einer der tragenden Pfeiler. Zahlreiche gewerbliche Klein- und Mittelunternehmen profitieren als Zulieferer, sei es bei baulichen Unterhaltsarbeiten oder bei Warenlieferungen. Dazu gebührt Dank. Ich danke all jenen, die für das Wirken der Klinik St. Pirminsberg beigetragen haben und in Zukunft beitragen werden. 47 Die Klinik in Zahlen Allgemeine Beschreibung (Berichtsjahr 1996) Typ Trägerschaft Einzugsgebiet Bettenzahl Auftrag Aufgaben 48 Kantonale Psychiatrische Klinik Kanton St. Gallen Südteil des Kantons St. Gallen mit St. Galler Rheintal, Sargans/ Werdenberg, Gaster/See, Fürstentum Liechtenstein (insgesamt ca. 170 000 Einwohner) 157, davon 32 Akut-Aufnahme, 11 Akut-GerontoAufnahme, 24 Akut-Rehabilitation, 27 LangzeitRehabilitation, 63 Geronto Die Kantonale Psychiatrische Klinik St. Pirminsberg ist zuständig für die stationäre psychiatrische Grundversorgung der Menschen ihres Einzugsgebietes. Sie untersucht, behandelt und pflegt psychisch akut und chronisch Kranke sowie Alterskranke, die einer psychiatrischen Behandlung bedürfen – sie ist Intensivstation für Akut- und Schwerstpsychischkranke – sie betreibt biopsychosoziale Diagnostik – sie steht für Kriseninterventionen zur Verfügung – sie gewährleistet individualisierte Therapie- und Rehabilitationsprogramme – sie gibt ein Zuhause für Dauerpatienten – sie bietet geschlossene Behandlungsmöglichkeiten für selbst- oder fremdgefährdete Risikopatienten – sie pflegt gerontopsychiatrisch Schwerkranke und bietet Sterbebegleitung – sie rehabilitiert Patienten aller Altersstufen, auch gerontopsychiatrische Patienten – sie unterstützt Familien in der Heimpflege Die Klinik in Zahlen Frequenzstatistik Patientinnen /Patienten 1996 Eintritte: 624 Austritte: 622 Krankentage: 51 264 Aufenthaltsdauer: durchschnittlich 82.42 Tage, Akut- und Rehabilitationspatienten: 34.5 Tage Bettenbelegung: 87.78% Finanzkennzahlen 1996 Gesamtausgaben: 18.7 Mio. Franken Personalaufwand: 14.4 Mio. Franken Sachaufwand: 4.3 Mio. Franken Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 1996 Personen: 210 Planstellen: 159 Mitglieder Gesamtleitung Evort Meyer, Leiter Pflegedienst, Vorsitzender Dr. med. Thomas Meier, Chefarzt Christoph Eicher, lic. rer. publ., Verwaltungsleiter 49 Behandlungsangebot und Berufsgruppen Thomas Meier Aus dem Klinikleitbild Seelisch kranke Menschen aus dem Südteil des Kantons St. Gallen und dem Fürstentum Liechtenstein finden in der Kantonalen Psychiatrischen Klinik St. Pirminsberg jederzeit stationäre sowie in beschränktem Masse auch halbstationäre und ambulante Behandlungsmöglichkeiten vor. Diese stehen allen Patienten praktisch ohne Vorbedingungen zur Verfügung (tiefe Aufnahmeschwelle). Der Behandlungsprozess stellt ein zielorientiertes, stets den jeweiligen Zuständen der Patienten angepasstes Vorgehen dar. In einer ersten Phase der Behandlung versuchen wir mit den uns anvertrauten Menschen eine Beziehung herzustellen, um gemeinsam einen Behandlungsauftrag formulieren zu können. Dabei orientieren wir uns in erster Linie an den Bedürfnissen der Patienten, denen wir ein hohes Mass an Selbstverantwortung zugestehen. Da wir alle auch Teil eines Beziehungsgeflechts sind, lassen wir Überlegungen der zuweisenden Instanzen sowie der Angehörigen mit in unsere Behandlungen einfliessen (systemisches Menschenbild). In einer zweiten, von der Beziehungsaufnahme kaum zu trennenden Phase, geht es darum, die Leiden der Patienten einer umfassenden, alle Aspekte des menschlichen Seins berücksichtigenden (bio-psycho-soziales Modell) diagnostischen Klärung zu unterziehen. Die erhobenen Befunde und daraus gezogenen Schlüsse werden mit den Patienten offen diskutiert. Gemeinsam wird das weitere Vorgehen geplant. In einer dritten Behandlungsphase, die fliessend aus der Beziehungsaufnahme und der diagnostischen Klärung hervorgeht, wird unter Leitung des Arztes die eigentliche Therapie durchgeführt. Sie stellt eine gemeinsame Leistung des therapeutischen Teams unter möglichst aktiver Beteiligung der Patienten dar. Global wird das Ziel angestrebt, die unsere Hilfe aufsuchenden Menschen zu optimaler Selbständigkeit hinzuführen. Individuell auf die Patienten abgestimmt, suchen wir in steter Anpassung an die jeweils vorliegenden Gegebenheiten drei bis vier Hauptziele, wie Beheben von Symptomen, Wiedergewinnen der Beziehungsfähigkeit, Krankheitsprophylaxe etc., zu vereinbaren. Diese sind für jedes Mitglied des therapeutischen Teams richtungsweisend für das Ausarbeiten verhaltensbezogener, kurzfristig zu erreichender Teilziele wie selbständiges Verrichten der täglichen Körperpflege, eine Stunde tägliches Mitmachen in der Kunsttherapie etc. Im Einverständnis mit den Patienten pflegen wir während des ganzen therapeutischen Prozesses Kontakt zu den Angehörigen mit dem Ziel, sie zu entlasten, das familiäre Milieu zu beruhigen und damit indirekt stabilisierend auf den Gesundheitszustand der Patienten einzuwirken. Bereits vom Aufnahmetag an soll der Austritt der Patienten aus der Klinik gut vorbereitet werden. Die Patienten sollen lernen, längerfristig wiederauftretende Krankheitsphasen frühzeitig zu erkennen und wenn immer möglich neue Erkrankungen oder Chronifizierungen durch richtiges Verhalten zu verhindern (Präventiver Auftrag). Viele psychiatrische Erkrankungen beeinträchtigen in erheblichem Masse die Urteilsfähigkeit der Patienten, so dass etwa 15% der in unserer Klinik behandelten Menschen gegen ihren Willen im fürsorgerischen Freiheitsentzug eingewiesen und zu einem kleinen Teil in den ersten Hospitalisationstagen auch zwangsbehandelt werden müssen. Wir sind uns bewusst, dass derartige Massnahmen eine erhebliche Verletzung der Persönlichkeitssphäre der Patienten darstellen. Sie erfordern unter anderem ein sorgfältiges Gegeneinander-Abwägen des zu erwartenden Nutzen und Schaden, gute Absprache im therapeutischen Team, saubere Dokumentation sowie ein Aufarbeiten der Eingriffe mit den Patienten, sobald deren Zustand es zulässt. 50 Behandlungsangebot und Berufsgruppen Die Aufgaben des Arztes Der Arzt begleitet den Patienten von seinem Eintritt in die Klinik St. Pirminsberg bis zu seiner Entlassung. Als unmittelbar Verantwortlichem für den therapeutischen Prozess fällt dem Arzt die Aufgabe zu, sämtliche Bemühungen des therapeutischen Teams zu koordinieren und den Mitarbeitern der verschiedenen Dienste Weisungen zu erteilen. Der Arzt sammelt Beobachtungen verschiedener Mitarbeiter und lässt sie mit eigenen Untersuchungsbefunden zu einer medizinischen Diagnose zusammenfliessen. Der Arzt ist für die laufende Risikobeurteilung veranwortlich, und er legt zusammen mit dem therapeutischen Team Rahmenbedingungen für die Behandlung fest. Er nimmt die Anliegen der Patienten auf, leitet gemeinsame Besprechungen der mit den Patienten arbeitenden Therapeuten zur Formulierung von Hauptbehandlungszielen. Neben seiner Koordinationsaufgabe gibt sich der Arzt als Psychiater und Psychotherapeut mehr oder weniger intensiv aktiv in die Behandlung der Patienten ein. Dabei leistet er vor allem Beziehungsarbeit, verwendet in angemessener Weise psychotherapeutische Techniken und verordnet nach Bedarf Medikamente. Bereits zu Beginn der Hospitalisation der Patienten plant der Arzt die Entlassung sowie die darüber hinausgehende ambulante Weiterbetreuung, informiert Vorund Nachbehandelnde, erstellt Zeugnisse zuhanden der Versicherer oft weit über die Beendigung der Hospitalisation hinaus. Der Arzt berät an den umliegenden Spitälern sowie in Privatpraxen tätige Kollegen bei Fragestellungen aus dem psychiatrischen Fachgebiet. Im Auftrag der Behörden erstellt der Arzt Gutachten zivil- und strafrechtlicher Art. Nicht zuletzt beteiligt er sich auch an Öffentlichkeitsarbeit, die der Entstigmatisierung der Psychiatrie sowie der allgemeinen Prävention seelischer Leiden dient. Bei all seinem Tun orientiert sich der Arzt am medizinischen Krankheitsmodell und bezieht neueste Ergebnisse aus der Forschung in seine Überlegungen ein. 51 Der Psychologische Dienst Der Arbeitsauftrag der Klinischen Psychologen ergibt sich einerseits aus dem offiziellen Behandlungsauftrag, wie er im Klinikleitbild formuliert ist, andererseits aus spezifischen Bedürfnissen der Patienten. Im Rahmen der psychiatrischen Kliniken üben Psychologen ganz unterschiedliche Aufgaben aus. Aufgrund ihrer Ausbildungen sind sie am Erleben und Verhalten des gesunden und kranken Menschen und an seinen Beziehungen zur Umwelt interessiert. Die Psychologen tragen mit ihrer Tätigkeit zur Intensivierung, Vertiefung, Differenzierung und Anreicherung des Behandlungsangebots bei. Psychologen sind in allen Aufnahme-, Kurz- und Langzeitrehabilitations-Stationen tätig. Sie leiten Gruppengespräche und führen Einzel-, Paar- und Familiengespräche im Auftrag und in Absprache mit den behandelnden Ärzten oder auf Wunsch der Patienten durch. Die Gruppengespräche dienen der Unterstützung der Patienten in ihrer Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den Gründen, die zu ihrer Hospitalisation führten, dem Zusammenleben in Gruppen und der Näheund Distanzregulierung. Die Patienten werden zu Meinungsäusserungen, zur Artikulation eigener Bedürfnisse und zu Selbstbeobachtungen angeregt. Verlaufsbeobachtungen, welche die Psychopathologie der Patienten erfassen, fliessen als Beiträge zur Erstellung und fortlaufender Neuanpassung der individuellen Behandlungspläne in die Diskussion des interdisziplinären Teams ein. Auf offenen Stationen werden themenzentrierte Gruppentherapien, bei denen das Training sozialer Kompetenz, die Verbalisation eigener Bedürfnisse und die Selbstaktualisierung im Zentrum stehen, durchgeführt. Bei Patienten mit Suchtverhalten geht es um die Auseinandersetzung mit der eigenen Abhängigkeit, der Rückfallprophylaxe, dem Wissenszuwachs und die Einübung sozialer Fertigkeiten. In den Gruppengesprächen mit Patienten und Patientinnen, die sowohl eine psychiatrische Grunderkrankung als auch ein Suchtverhalten zeigen, steht die Wahrnehmung und Einsichtsförderung in die Zusammenhänge zwischen Grundkrankheit und Suchtverhalten im Zentrum. Je nach definiertem Behandlungsziel finden begleitende, stützende, konfrontierende, problemlösende oder prozessorientierte Gespräche statt. Diese Gespräche werden dokumentiert. Das interdisziplinäre Team wird stichwortartig über Zielsetzung, Verlauf und Inhalt informiert. Zur Aufgabe der Psychologen gehört auch die testpsychologische Abklärung. Bei der Psychodiagnostik werden die Intelligenz, die Leistungsfähigkeit, die Konzentrations- und Durchhaltefähigkeit, die Persönlichkeit, die Berufsneigungen und die hirnorganischen Funktionen beurteilt. 52 Behandlungsangebot und Berufsgruppen Kunsttherapie In der Kunsttherapie wird gemalt, gezeichnet sowie mit Ton, Holz und Stein gearbeitet, d.h. verschiedenste künstlerisch-handwerkliche Techniken werden angewendet. Die Kunsttherapie versucht mit Hilfe von künstlerischen Mitteln seelische Prozesse zu initiieren, zu begleiten, zu fördern und sichtbar zu machen. Äussere Bilder und Werke entsprechen inneren, seelischen Zuständen. Beim Malen und Formen gibt man ein Bild von sich, äussert sich, teilt sich selbst mit. Unsere Beobachtungen richten sich dabei vor allem auf das, was sichtbar/erfahrbar ist und was die Patienten selbst über ihre Arbeit sagen, nicht auf theoriegestützte Interpretationen. Das Bild, das sich so für uns vom Patienten ergibt und sich manchmal von den Beobachtungen der anderen Behandler unterscheidet, kann ein wichtiger Beitrag zum diagnostischen Prozess sein. Umgekehrt wirkt die Arbeit am äusseren Werk und das Werk selbst mit Farbe, Linie, Form auf seelische Zustände der Patienten zurück und kann so gezielt therapeutisch eingesetzt werden. «Schöne Ergebnisse» können die Motivation sehr fördern. Ziel ist aber nicht, Kunstwerke zu produzieren, sondern Techniken, Materialien und Arbeitsweisen der bildenden Kunst zu nutzen, um damit therapeutisch zu arbeiten. Die Aufgabenstellungen und das Vorgehen richten sich jeweils nach den Persönlichkeiten, den Fähigkeiten, Einschränkungen und den Krankheiten der Patienten, das heisst es kann auch ohne Vorkenntnisse mit Arbeiten begonnen werden. Die Aufgaben werden so gewählt, dass sie auf allgemeine Behandlungsziele der Patienten ausgerichtet sind, andererseits aber auch einen persönlichen Freiraum für die Patienten schaffen. Die Kunsttherapie bildet mit ihrem handlungsorientierten Vorgehen einen Gegenpol zu den anderen kognitiven, gesprächsorientierten Therapien der Klinik, so dass die Patienten bei uns mehr ihre seelisch-emotionalen, kreativen Seiten erfahren können. Trotzdem spielen auch die begleitenden Gespräche eine wichtige Rolle. Kunstwerke und künstlerische Arbeit kennt man in enormer Vielfalt. Die Materialien, Techniken, Arbeitsweisen und Phänomene der Kunst bieten uns entsprechend auch für die Therapie ein immenses Spektrum an Möglichkeiten: von sehr einfachen bis zu sehr komplexen Aufgabenstellungen von stark strukturiertem bis zu sehr gelöstem freiem Arbeiten von ausdauerndem Üben bis zu schnellem spontanem Ausdruck von der Hinwendung zu einer objektiven Aussenwelt bis zur Erfahrung und dem Ausdrücken der eigenen Innenwelt von zielgerichtetem, ergebnisorientiertem Arbeiten bis zu völlig ergebnisoffenen Prozessen mit dem Schwergewicht auf dem inneren Erlebnis 53 Aktivierungstherapie In die Aktivierungstherapie werden psychisch und geistig behinderte, vorwiegend ältere Menschen aufgenommen (Gerontopsychiatrie). Es werden Gruppen- und Einzeltherapien angeboten, wobei in den Gruppen höchstens bis zu sechs Personen beschäftigt werden können. Schwerpunkt der Aktivierungstherapie ist, den kranken oder behinderten Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen und Passivität, Resignation, Interesselosigkeit oder auch erschwerter Kommunikation mit der damit verbundenen Abkapselung entgegenzuwirken. Es gilt, auf die Fähigkeiten der Patienten zurückzugreifen, das heisst, die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Die Lebensgeschichte jedes einzelnen ist dabei behilflich und ergänzt die Beobachtungen der Therapeutin. Wir konzentrieren uns auf die gesunde Seite des betreffenden Menschen und leiten von dieser her ab, welche Aktivität gerade gut tut. Wichtig ist auch, das Alter des Patienten mit all den Beschwerden, die es oft mit sich bringt, zu akzeptieren und in die Therapie miteinzubeziehen. Der Wert aller Aktivitäten liegt darin, dem Menschen das Erleben von Freude und Sinn zu vermitteln. Therapeutische Mittel der Aktivierungstherapie: Ziel, Bereich: Mittel, Idee: Beweglichkeit erhalten und fördern Schwimmen, Turnen, Spaziergänge, Ausflüge unternehmen Körperbewusstsein fördern gestalterisches Arbeiten, z. B. mit Ton, Farben, Kleister, Holz Wahrnehmung, Konzentration, Reaktion fördern und erhalten (Geistige Aktivierung) Konzentrations- und Reaktionsspiele, aktuelle Themen durchgehen, Texte lesen und darüber sprechen Realität erleben, im Jetzt sein Ausflüge durchführen, gestaltend arbeiten, Zeitung lesen resp. vorlesen, Umgebung erleben, kommunizieren Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sowie Eigenbestimmung fördern Erfolgserlebnis, durch Selberherstellen von Gegenständen, Einkaufengehen; Ideen, Wünsche aufnehmen und nach Möglichkeit verwirklichen Emotionalität erleben, akzeptieren, ausdrücken malen, zeichnen, musizieren, handwerkliche Tätigkeiten Dem Altzeitgedächtnis Raum geben, das Älterwerden verarbeiten Erzählen, Erinnerungen austauschen, Ausflüge in bekannte Umgebung, kochen, backen, singen 54 Behandlungsangebot und Berufsgruppen Arbeitstherapie Die Bedeutung von Arbeit weiss oft erst zu schätzen, wer keine mehr hat. Arbeit und Beschäftigung sind grundlegende Bedürfnisse jedes Menschen. Sie sind Herausforderungen, an denen man Fähigkeiten und Kräfte entwickeln und erproben kann. Menschen, die psychisch krank werden, verlieren oft ihre Arbeitsfähigkeit und damit den Arbeitsplatz, der aber eine wichtige Voraussetzung für psychische Stabilisierung ist. Arbeitstherapie kann viele der notwendigen Fähigkeiten fördern und trainieren wie • Einhalten eines Zeitrahmens • Ausdauer • Konzentration • Sorgfalt • Übernahme von Verantwortung • Einfügen in einen sozialen Organismus Mit der Vorbereitung auf einen «normalen» Arbeitsplatz kann psychiatrische Arbeitstherapie eine wichtige Brücke schlagen zur Rückkehr in das soziale und gesellschaftliche Netz, das wir alle für unsere Gesundheit brauchen. Das Angebot der Arbeitstherapie umfasst • Industriearbeiten • Kartonage • Bürobereich • Holzwerkstatt/Bazar • Landwirtschaft • Wäscherei/Lingerie • Rüstküche 55 Bewegungs- und Tanztherapie Die Behandlung seelischer Beeinträchtigungen wird in der Bewegungs- und Tanztherapie von der Körperseite her vollzogen. Ausgehend von der Körper/Geist/Seele-Einheit des Menschen versucht diese Therapie einen Gesundungsprozess über die Bewegung in Gang zu setzen. Grundlegende Bewegungselemente aus Gymnastik und Tanz werden genützt, um zu einer Integration von Leib und Seele, von Gefühl und Körperlichkeit zu gelangen. Ausgangspunkt ist das aktuelle Bewegungsmuster der Patienten. Dabei kann bei den gesunden Anteilen und Fähigkeiten angesetzt und aufgebaut werden. Die Aufmerksamkeit der Therapeutin kann sich aber auch zuerst auf die schwachen, noch entwicklungsfähigen Seiten richten. Das Erleben oder das Wiederentdecken von eigenen Fähigkeiten, das Gespür für natürliche und harmonische Bewegung, aber auch das Erlernen und Aufbauen von Kraft, Kondition und Ausdauer kann zu mehr persönlicher Sicherheit, Selbstvertrauen und einem besseren Identitätsgefühl beitragen. In der Bewegungs- und Tanztherapie wird viel mit Musik verschiedenster Stilrichtungen gearbeitet. Wohlvertraute Klänge und Rhythmen, eventuell vom Patienten selber ausgewählt, können den Einstieg in die Bewegung erleichtern und helfen, spezifischen Gefühlsqualitäten und Stimmungen Ausdruck zu verleihen. Je nach Introspektionsfähigkeit und Belastbarkeit der Patienten kann das Erlebte dann auch an- und ausgesprochen werden. Angebote: - Entspannungsübungen - Atemübungen - Lockerungs- und Kräftigungsübungen - rhythmische Übungen - Ausdrucksübungen - Körperwahrnehmungsübungen - Tanzen, Ballspiele, Schwimmen - Rücken- /Nackenmassagen - Fussreflexzonenmassagen 56 Ziele: - körperliches Wohlbefinden - Spannungsausgleich - Kondition und Ausdauer - Freude an Bewegung, Tanz und Spiel - Stärken der Ausdrucksfähigkeit - Fördern der Gruppenfähigkeit - Kommunikation und Kontakt durch Bewegung Behandlungsangebot und Berufsgruppen Behandlung Drogenabhängiger Seit den 70-er-Jahren behandelt die Klinik St. Pirminsberg Drogenpatienten. Die Zahl der Patienten nahm während der 80-er-Jahre kontinuierlich zu. Der Schwerpunkt der Behandlung lag auf dem körperlichen Entzug von verschiedenen Suchtmitteln. In den Jahren 1992 und 1993 häuften sich die unfreiwilligen Einweisungen von Drogenpatienten durch unterschiedliche Instanzen. Die Folge war, dass die Patienten wenig Einsicht und Motivation hinsichtlich eines drogenfreien Lebens zeigten. Für die Aufnahmestationen ergaben sich hieraus oftmals sehr belastende Situationen. Als Konsequenz aus den Erfahrungen und auf Grund eines gestiegenen Behandlungsbedürfnisses für Drogenpatienten wurde ein neues Konzept entwickelt. Angesiedelt im Gebiet zwischen Überlebenshilfe und Therapie bietet das «Behandlungskonzept Horizont» eine zeitgemässe Möglichkeit, aus dem Drogenelend auszusteigen. Neben der Entgiftung sollen sich die Kranken körperlich und psychisch stabilisieren können. Bei sozialen, psychischen und körperlichen Problemen erhalten sie professionelle Beratung. In einer persönlichen Standortbestimmung sollen sie zu einer längerfristigen Drogentherapie motiviert werden. Um Lebensperspektiven ohne Drogen zu entwickeln, sollen die Drogenabhängigen bei uns lernen, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen. Sie sollen Eigeninitiative und Selbstverantwortung übernehmen. Durch Erkennen von Belastungssituationen und Ermutigen zur Konfliktbereitschaft soll die Frustrationstoleranz erhöht werden. Schliesslich sollen auch Bewältigungsstrategien erarbeitet werden. Das Angebot umfasst körperliche Untersuchungen und ärztliche Behandlung sowie Milieutherapie auf der Station einerseits, psychotherapeutische Einzelund Gruppengespräche (Motivation, Stützung, Konfrontation, Bewältigung), Kunst- und Arbeitstherapie, Bewegungstherapie und Sport andererseits. Daneben werden auch spezielle Freizeitaktivitäten gepflegt. 57 Der Sozialdienst sucht tragbare Lösungen für alle Seiten Dem Sozialdienst der Klinik geht es in erster Linie um die Wiedereingliederung der Patienten in die Gesellschaft. Dies soll sowohl auf beruflicher wie auch sozialer und persönlicher Ebene geschehen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen absolute Voraussetzung. Häufig sind Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit der Frage konfrontiert, welche Möglichkeiten den Patienten offenstehen, um während und nach dem Klinikaufenthalt in der Gesellschaft wieder Fuss zu fassen. Zusammen mit den Patienten, den Angehörigen, anderen Bezugspersonen, sozialen Institutionen und Behörden suchen sie nach einem Weg, der für alle Beteiligten tragbare Lösungen bringt. Dass dies gerade in der heutigen Zeit nicht immer von einem Tag auf den anderen möglich ist, liegt auf der Hand und verlangt manchmal viel Geduld. Primär ist wichtig, dass die Stressoren erfasst werden, welche zur Krise oder zur Krankheit geführt haben. Da auch kranke Menschen über verschiedene Fähigkeiten (Ressourcen) verfügen, versucht der Sozialdienst diese richtig einzusetzen. Wichtig sind regelmässige Gespräche mit den Patienten. Auch die Angehörigen wünschen in der Regel Kontakt mit dem Sozialdienst. Soziale Begleitung und entsprechende Beratungsgespräche bilden somit einen wesentlichen Teil der Sozialarbeit. Dabei werden die Patienten in ihrer Selbstbestimmung unterstützt, damit sie soweit wie möglich ihre Eigenverantwortung wahrnehmen können. Ob es um eine Heimplazierung, um Arbeitssuche oder um Beschäftigungsmöglichkeiten geht, Veränderungen sind für die Betroffenen immer mit Verlusten verbunden. Zur Überwindung dieser Verluste braucht es viel Motivation. Der Sozialdienst sieht dabei seine Funktion als Brücke zwischen den Betroffenen, ihrem sozialen Umfeld und der Gesellschaft. 58 Behandlungsangebot und Berufsgruppen Berufsgruppe Medizinisches Sekretariat Das Medizinische Sekretariat spielt eine entscheidende Rolle im gesamten medizinischen und therapeutischen Behandlungsprozess. Vier Sekretärinnen, davon drei zu 100% und eine zu 50%, sind für die gesamte administrative Bearbeitung der medizinisch relevanten Abläufe und die entsprechende Dokumentation verantwortlich. Die beim Eintritt einer Patientin oder eines Patienten in die Klinik erfassten Daten werden in die elektronische Krankengeschichte aufgenommen und bilden die Grundlage für sämtliche weitere ärztliche und therapeutische Dokumente. Somit sind die von den Ärzten und Psychologinnen diktierten Befunde und Verlaufsberichte stets aktualisiert und für die Behandler rasch abrufbar. Das gesamte Beziehungsnetz des Medizinischen Dienstes innerhalb und ausserhalb der Klinik verlangt sehr viel Informations- und Datenaustausch, für welchen das Sekretariat eine eigentliche Drehscheibe darstellt. Eintrittsund Austrittsberichte, Zusammenfassungen, Gutachten, Konsilien , IVund Versicherungsberichte sind einige der verlangten schriftlichen Kommunikationsinstrumente, welche das Sekretariat für 12 Ärzte, vier Psychologinnen und den Leiter der Therapien täglich erstellt. Weitere wichtige Aufgaben der Sekretärinnen ist die Erfassung und Abrechnung aller ambulanten medizinischen und therapeutischen Leistungen sowie das Erstellen der H쎵-Statistik (vormals VESKA-Statistik). Diese von der Vereinigung der Schweizer Krankenhäuser erhobene Statistik verlangt das jährliche Erfassen aller stationären Patientinnen und Patienten nach einem bestimmten Schema, welches sowohl Angaben zur Person wie auch medizinische Daten beinhaltet. Klinik St. Pirminsberg spielt Vorreiterrolle bezüglich elektronischer Krankengeschichte Das Gesundheitswesen verändert sich in einem rasanten Tempo. Von allen Seiten werden an dessen Institutionen höhere Anforderungen gestellt (z.B. KVG, Qualität, Kostendruck, usw.). Dadurch entsteht ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen den eigentlichen Leistungsaufgaben am Patienten und den wachsenden administrativen Ansprüchen bei gleichbleibenden personellen Ressourcen. Diese enormen Anforderungen verlangen nach spitalweiten Informationssystemen. Die Klinik St. Pirminsberg hatte schon sehr früh die Zeichen der Zeit erkannt und unter der Leitung des damaligen Chefarztes Dr. Hanspeter Wengle eine Lösung bezüglich elektronischer Krankengeschichte gesucht. Nach einer vierjährigen Entwicklungsphase konnte 1994 das klinische Informationssystem KLIPS in Betrieb genommen werden, eine massgeschneiderte EDV-Lösung für den medizinischen und pflegerischen Bereich der Klinik St. Pirminsberg. Das System hat jedoch seine Schwächen, gerade weil es eine Einzellösung ist und mit anderen Kliniken und Spitälern nicht kompatibel ist. Das Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen hat Ende 1995 eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, ein Leitbild und Konzept des Kantons für medizinische und pflegerische Informatiklösungen zu verfassen, LEIKO genannt. Die Klinik St. Pirminsberg war ebenfalls in dieser Gruppe vertreten und konnte dank ihrer Erfahrung mit dem eigenen System wesentliche Grundlagen und Verbesserungsvorschläge für zukünftige Systeme liefern. 1996 wurden die Resultate der LEIKO-Gruppe veröffentlicht. Das Anforderungsprofil für eine neue, integrierte EDV-Lösung soll auf bereichsübergreifenden, prozessorientierten Sichten aufbauen. Es soll der Grundsatz gelten, die Daten möglichst dort zu erfassen, wo sie entstehen. Patienteninformationen sind hochsensible Daten. Dem Datenschutz und der Datenintegrität müssen deshalb höchste Priorität eingeräumt werden. Die angestrebten Lösungen müssen deshalb aus qualitativer, technischer und gesetzlicher Sicht hohen Sicherheitsanforderungen genügen und eine langfristige Informationsverfügbarkeit garantieren. Die Klinik St. Pirminsberg realisiert auf dieser Basis eine wegweisende Informatiklösung, welche die Patientendokumentation aller medizinischen und pflegerischen Berufsgruppen in einer bereichsübergreifenden Krankengeschichte verknüpft. 59 Die Aufgaben der Pflege Evort Meyer Die Berufsgruppe der psychiatrischen Krankenpflege oder wie die neue Bezeichnung lautet, der «Gesundheits- und Krankenpflege» in der Psychiatrie, bildet zahlenmässig die grösste Berufsgruppe in der Klinik. Die Pflege zu umschreiben und deren Aufgaben darzustellen, ist auf Grund der Vielseitigkeit der Tätigkeiten nicht ganz einfach. Wie bereits im Namen angetönt, sieht die Pflege ihren Schwerpunkt in der Förderung, der Erhaltung und dem Wiederaufbau von Gesundem. Gesundheitsförderung einerseits bedeutet Förderung und Unterstützung der Alltagsfertigkeiten, Hilfe zur Selbstpflege und Selbstsorge. Krankheitspflege andererseits bedeutet die stellvertretende Übernahme von Aktivitäten des täglichen Lebens, dort wo dies die Patienten vorübergehend oder dauernd nicht mehr selbst imstande sind. Am Anfang steht die Beziehung Ganz am Anfang steht die Frage der Beziehung zwischen Pflegenden und Patienten. Wie weit kann der Patient die Nähe der Bezugsperson annehmen? Die Pflegenden müssen sich über die eigene Rolle klar werden und fähig sein, sich auf Beziehungen einzulassen und gleichzeitig eigene und fachliche Grenzen erkennen. Um den ausserordentlichen Herausforderungen, welche die tagtägliche Begleitung und Betreuung in der Psychiatrie darstellt, gerecht zu werden und individuell auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen zu können, helfen den Pflegenden Konzepte und Pflegemodelle. Das Pflegemodell Das pflegerische Modell betrachtet in erster Linie, wie ein Mensch mit seinen Gesundheitsproblemen umgeht, welche Ressourcen er trotz Krankheit zur Verfügung hat und wie er sie einsetzen kann, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Es findet heraus, welche Reaktionen eines Patienten auf Ereignisse und Stress ihm nützen oder schaden, wo seine Empfindlichkeiten liegen und trägt dazu bei, dass der Betroffene lernt, sie in sein Leben zu integrieren. Im Verlauf der Ausbildung haben die angehenden Pflegenden in der Theorie und in der praktischen Umsetzung gelernt, wie Modellvorstellungen im Einzelfall helfen, sich ein klares Bild davon machen zu können, wie weit ein Patient zum Beispiel in einer Lebensaktivität unabhängig bzw. abhängig von Hilfe und Unterstützung ist. Lebensaktivitäten werden durch verschiedene Einflussfaktoren wie z.B. körperliche, psychologische, soziokulturelle, umgebungsabhängige und auch politisch-ökonomische Faktoren beeinflusst. Abhängig vom Lebensalter und den Lebensumständen eines Patienten spielen die einzelnen Lebensaktivitäten eine mehr oder weniger wichtige Rolle. 60 Ein praktisches Beispiel Als Beispiel zur Veranschaulichung, was die Pflege unter Lebensaktivität versteht und wie sie mit diesem Thema in der täglichen Arbeit umgeht, sei die Aktivität Essen und Trinken herausgegriffen. Essen und Trinken entspricht einem menschlichen Grundbedürfnis. Um dieses Grundbedürfnis zu befriedigen, braucht ein Mensch ganz verschiedene Fähigkeiten. Er muss Hunger oder Durst spüren, planen, eine Auswahl treffen und einkaufen, mit Geld umgehen können, mit Geräten und dem Herd hantieren, gutes und verdorbenes Essen unterscheiden können und vieles andere mehr. Nebst dem, dass Essen und Trinken das Überleben sichern, ist damit auch ein sozialer und kommunikativer Aspekt verbunden. So bilden z. B. die Mahlzeiten in der Familie einen wichtigen und prägenden Ort des Austausches. Jeder Mensch hat sich beim Essen und Trinken im Verlauf seines Lebens, sei- Die Aufgaben der Pflege ner Sozialisation, individuelle Gewohnheiten erworben. Er hat Vorlieben oder Abneigungen entwickelt, empfindet möglicherweise gemeinsame Mahlzeiten als Zwang oder er fühlt auf Grund seiner Erziehung den Druck, den Teller leer essen zu müssen. Je nach Persönlichkeit und Gefühlslage sind die Gewohnheiten Schwankungen unterworfen. Dem einen verschlägt die Aufregung den Appetit, jemand kann ohne Kaffee nicht einschlafen u.v.m. Psychische Störungen haben einen Einfluss auf die Lebensaktivität Oft kommen psychisch kranke Menschen zur stationären Behandlung, weil sie ihre alltäglichen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können oder weil sie diese nicht mehr wahrnehmen. Um beim Essen und Trinken zu bleiben, wieder ein paar Beispiele. Ein Patient befürchtet, sein Essen sei vergiftet und er könne darum nicht essen. Ein depressiver Mensch verbietet sich das Essen, weil er sich dessen nicht wert fühlt. Ein Mensch, der schon in jungen Jahren krank geworden ist, bleibt in der Abhängigkeit seiner Eltern und lernt darum nicht, sich selbst zu versorgen. Ein manischer Patient stopft wahllos alles Greifbare in den Mund, oder er vergisst vor lauter neuer Vorhaben zu essen. Diese Liste liesse sich noch durch zahlreiche Beispiele ergänzen. Auch die sozialen und kulturellen Faktoren spielen eine Rolle. Ein Patient hat in seiner Familie keine Tischmanieren gelernt und stösst darum in der Gruppe auf Ablehnung. Ein anderer ist schon lange so vereinsamt, dass er es verlernt hat, sich bei Tisch zu unterhalten. Ein Patient aus Indien kann es schwer aushalten, mit Frauen zum Essen an einem Tisch zu sitzen. Ein moslemischer Patient befürchtet, in der Klinik ohne sein Wissen Schweinefleisch zu bekommen u.s.w. Die Pflege versucht, zu dieser Lebensaktivität Informationen zusammenzutragen, und die Ziele der Pflege in Bezug auf Essen und Trinken individuell mit dem Patienten zu bestimmen. Die Individualität des Patienten In der aktuellen Situation stellt sich die Frage, welche Fähigkeiten hat ein Patient, seinem Bedürfnis nach Essen und Trinken nachzukommen? Wo liegen die Einschränkungen? Welche Bedeutung hat die Einschränkung für den Patienten? Wie hat der Patient bisher sein Bedürfnis nach Essen und Trinken befriedigt? Welche Bedingungen müssen hergestellt werden, damit der Patient seine Gewohnheiten beibehalten/ändern kann? Aus pflegerischer Sicht stellt sich zusätzlich die Frage, welchen Stellenwert Essen und Trinken für den Patienten hat. Was weiss er über gesunde Ernährung? Welche beratenden und/oder unterstützenden Hilfen können – vom aktuellen Stand ausgehend – zur Verbesserung der Lebensaktivität für den Patienten gegeben werden? Dabei wird darauf geachtet, dass das Bedürfnis im Grundsatz befriedigt werden kann. Dazu wird versucht, über dieses Bedürfnis die Kontaktmöglichkeiten zu verbessern und die Selbstwahrnehmung zu fördern. Die genannten Beispiele vermögen lediglich einen kleinen Einblick zu vermitteln. In Tat und Wahrheit hat es die Pflege mit sehr unterschiedlichen und vom einzelnen Individuum geprägten Komplex von Fragen zu tun. 61 Von der Informationssammlung zur Pflegeplanung Die gesammelten Informationen und die geplanten und durchgeführten Aktivitäten werden in der pflegerischen Dokumentation festgehalten. Anhand dieser Informationssammlung erstellt die Pflege zusammen mit dem Patienten einen Pflegeplan. Darin werden die zusammengetragenen Informationen mit dem Patienten zusammen aufgearbeitet und die Ziele definiert, die angestrebt werden sollen. Die Pflegeprobleme und die pflegerische Planung werden auch im interdisziplinären Behandlungsteam besprochen und in die Behandlungsplanung eingebracht. Pflegeproblem Ressourcen Herr W. kann sich kaum konzentrieren, weil ihm zu viele Gedanken durch den Kopf gehen. Pflegeziele Pflegebehandlung Herr W. kann sich schrittweise besser auf andere Dinge als seine Gedanken konzentrieren. Herr W. nimmt mit Hilfe seiner Bezugsperson seinen Küchendienst wahr. Mit Konversationsthemen wird versucht, ihn von seinen Gedanken abzulenken. Er spielt gerne Schach, wenn es ihm gut geht. Ihm werden zunächst, bis er sich besser konzentrieren kann, einfache Brettspiele angeboten. Hinweise für SuizidaEs ist anzunehmen, Er kann seine Angst, dass Herr W. latent sui- sich selber etwas anzu- lität werden frühzeitig erkannt. zidal ist. tun, äussern. Im Kontakt mit Herrn W. wird auf versteckte Hinweise für Suizidalität geachtet. Wenn konkrete Vermutungen bestehen, wird er direkt gefragt. Beispiel eines einfachen Pflegeplanes 62 Die Aufgaben der Pflege Die Berufsgruppe der Pflege ist Teil eines Ganzen Immer mehr hat sich die pflegerische Berufsgruppe spezielles Fachwissen angeeignet. Die Ergebnisse der internationalen Pflegeforschung gewinnen für die Pflegepraxis einen zunehmend höheren Stellenwert. Das hat der Pflege – dies gilt in ganz besonderem Masse für die Pflege in der Psychiatrie – einen hohen Grad an Selbständigkeit und Eigenverantwortung eingebracht und zu einem neuen Rollenverständnis geführt. Keine Berufsgruppe wird für sich jedoch in Anspruch nehmen können und dürfen, allein der bestimmende Behandlungsfaktor zu sein. Eine ganz besondere Bedeutung kommt der Erkenntnis zu, dass im psychiatrischen Fachgebiet dann die grössten Erfolge erzielt werden können, wenn ganz verschiedene Mosaiksteine der Behandlungsangebote zu einem ganzheitlichen Behandlungsplan zusammengefügt werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Ärzten, den Psychologen und den Therapeuten entsteht in Bezug auf die Behandlung und Pflege des Patienten ein geschlossenes Ganzes, mit definierten Aufgaben für die einzelnen Berufsgruppen. Interdisziplinärer Rapport mit Ärzten, Pflegenden, Psychologen und Therapeuten. 63 Die Klinikseelsorge Hans Grämiger, Urs Steinemann In der 1100-jährigen Geschichte des Klosters St. Pirminsberg ist mit einer Vorgeschichte der Seelsorge in der nun 150-jährigen Klinik zu rechnen, denn ganz gewiss haben die Mönche, die sich seit der Entdeckung der Heilquelle in der wilden Taminaschlucht um die Heilung ihrer Badegäste bemühten, auch an deren Heil gedacht, mit ihnen vom Glauben gesprochen und selbstverständlich auch mit ihnen Gottesdienste gefeiert. Die seelsorgerliche Betreuung der Patienten in der Klinik erfolgte während langer Zeit nebenamtlich durch den katholischen Pfarrer von Pfäfers und später auch durch den evangelischen Pfarrer von Bad Ragaz-Pfäfers (seit es einen solchen gibt). 1959 wurde als Vollamt ein evangelisches Pfarramt für die «Heilstätten» (ein veralteter, aber an sich schöner Ausdruck!) des Sarganserlandes geschaffen. Seit 1992 besteht ein Halbamt für die Seelsorge an den katholischen Patienten in Pfäfers und Valens. Beide Seelsorger arbeiten eng zusammen. So sind die Andachten in der Klinik seit mehr als 15 Jahren grundsätzlich ökumenisch und seit kurzem ist auch die Betreuung der Aufnahmestationen nicht mehr konfessionell getrennt. Die Hauptaufgabe der Seelsorge ist, neben dem Abhalten von Andachten und Gottesdiensten, die Patienten auf den Stationen unter der Woche zu besuchen. Der Zweck ist zunächst ganz schlicht, die Patienten anzuhören, ohne Druck auf therapeutische Erfolge. Daraus kann eine vertiefte Aussprache werden und bei längerem Aufenthalt die Begleitung auf einer schwierigen und doch oft hoffnungsvollen Etappe des Lebensweges. Seelsorge will nicht Therapie sein, aber sie kann durchaus einen therapeutischen Effekt haben. «Das Ziel einer Psychotherapie ist in der Regel, eine psychische Krankheit zu heilen, über Einblick in lebensgeschichtliche, psychische Zusammenhänge Heilung zu erfahren. Anders beim Seelsorger: Auch hier mag es den Wunsch geben, durch den Kontakt mit ihm Heilung zu erfahren – und doch immer nur mit dem Erwartungshintergrund, dass hier Heilung eingebettet ist in ein übergreifend zugesagtes Heil. Dieser religiöse Zusammenhang ist da, wie auch immer er im Konkreten die Beziehung bestimmen wird.» (Jürgen Blattner). Die Klinikseelsorge dürfte in der Zukunft an Bedeutung gewinnen. Die Patienten sind zumeist nicht mehr durch eine kirchliche Tradition gehalten; sie leben ihre private Frömmigkeit oder gar keine. In der Krankheit oder in schweren Lebenskrisen, die sie in die Klinik führen, sind sie oft neu auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens und Arbeitens. Die unterstützende, unaufdringliche Begleitung durch den Seelsorger ist öfter erwünscht, als man vielleicht denken würde. Damit sie gelingt, sind die Seelsorger auf den Kontakt zu Ärzten, Pflegepersonal und Therapeuten angewiesen. Dieser hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt und wird sich noch weiter verstärken. 64 Die Aufgaben der Pflege 65 Die Klinik als Unternehmen Christoph Eicher Verwaltung und Ökonomie Weniger spektakulär, jedoch nicht weniger wesentlich, sind die Verwaltungs- und Dienstbetriebe der Klinik. Neben den Bereichen Medizin und Pflege bildet die Verwaltung/Ökonomie den dritten Teil des Drei-Säulen-Modells, auf welchem die Führungsstruktur der Klinik St. Pirminsberg aufgebaut ist. Ziel aller Bereiche ist es, den Patientinnen und Patienten den Klinikaufenthalt so erfolgreich und so angenehm wie möglich zu gestalten. In diesem Sinn arbeitet auch das Personal in der Verwaltung, in der Ökonomie und im Technischen Dienst direkt und indirekt für die Patientinnen und Patienten. Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Handwerker, Techniker, kaufmännische Angestellte und Spitalköche, sorgen mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen für einen reibungslosen Ablauf des Klinikalltages, meist hinter den Kulissen und ohne grosses Aufsehen. Schon der Unterhalt der Infrastruktur ist mit einem enormen Aufwand verbunden. Über tausend Räume, Kammern, Verbindungsgänge und Keller umfassen die gesamten Gebäulichkeiten des ehemaligen Benediktinerklosters, des Klinikneubaus und der verschiedenen Dienstleistungs- und Landwirtschaftsgebäude rund um die Klinik, im Taminatal und auf dem St. Margrethenberg. Die darin untergebrachten verschiedensten technischen Einrichtungen und Anlagen bedürfen der fachgerechten und kontinuierlichen Pflege. Die Ökonomiebetriebe ihrerseits haben sich den laufend verändernden Ansprüchen zu stellen. Betrachtet man die Klinik St. Pirminsberg als zukunftsgerichtetes Unternehmen, welches einen klaren Leistungsauftrag nach fachlichen, menschlichen und ökonomischen Kriterien erfüllen muss, so werden die Verwaltungs- und Dienstbetriebe zunehmend gefordert. Qualitäts- und Kostenbewusstsein stehen heute an vorderster Stelle. Althergebrachte Strukturen und Traditionen müssen überdacht und in neue Formen der Organisation und Arbeit übergeführt werden. Verantwortung für das Wohl der Patientinnen und Patienten übernehmen, soll einerseits ein qualitativ hochstehendes Medizin- und Pflegeangebot, andererseits 66 Klinik als Unternehmen aber auch eine effiziente und zielgerichtete Verwaltung. Gemeinsame Visionen, Leitgedanken und Werte bilden dabei die Basis für das Unternehmen «Klinik». Darüberhinaus ist entscheidend, dass die vorhandenen personellen und materiellen Ressourcen optimal genutzt werden. In diesem Sinn wird von allen Klinikbereichen eine Betriebskultur angestrebt, welche ein bereichsübergreifendes Denken fördert und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mündigen, kreativen und entscheidungsfreudigen Mitwirkenden eines Gesamtunternehmens wachsen lässt. Die verschiedenen Verwaltungsbereiche kommen so in die Rolle eines Vermittlers und Beraters, welche die primären Kerngeschäfte der Patientenbehandlung und -betreuung mit den infrastrukturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verknüpft. Ziel des gemeinsamen Handelns ist eine Qualitätssteigerung mit gleichzeitiger Kostenstabilisierung. Um dies zu erreichen bedarf es einer gezielten Personalpflege. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in die Veränderungsprozesse miteinzubeziehen, ihnen ist die Möglichkeit zu geben, an ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten. Angesprochen ist damit die Fort- und Weiterbildung des Personals, die intensive Auseinandersetzung mit den sich laufend verändernden Anforderungen an den Klinikbetrieb, das Herausarbeiten von konkreten Lösungen und Massnahmen. Dahingehend sind im Interesse einer langfristigen Erfolgssicherung zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen. Neben der steten Verbesserung der betrieblichen Leistungen geht es in vermehrtem Mass auch um die Optimierung der Beziehungen zu den vor- und nachgelagerten Stellen, zu den Institutionen der Primärversorgung, den Haus- bzw. Fachärztinnen und -ärzten, den Therapeutinnen und Therapeuten, den Spitex-Organisationen sowie zu den verschiedenen Trägerschaften von Wohn- und Arbeitsangeboten. Die Unternehmung «Klinik» muss sich als Teil eines Versorgungsnetzes verstehen, welches sich bedarfs- und bedürfnisgerecht, effizient und effektiv in den Dienst der psychisch kranken Patientinnen und Patienten und deren Genesung stellt. 67 ZUKUNFT DER PSYCHIATRISCHEN KLINIK 68 Zukunft der Psychiatrischen Klinik Hanspeter Wengle Am Beispiel der Bettenzahl lässt sich ableiten, wie dynamisch die Entwicklung der psychiatrischen Kliniken in der Schweiz in den letzten 30 Jahren verlaufen ist. Die psychiatrischen Kliniken im Kanton St. Gallen machen hier keine Ausnahme. 1960 wies die Klinik St. Pirminsberg über 300, die Klinik Wil über 1000 Betten auf. Heute sind es noch 150 und 320. Die Spitalplanung ‘95 sieht eine weitere Reduktion auf insgesamt ca. 400 Betten im ganzen Kanton vor, Alterspsychiatriebetten inklusive. Ein kurzer Blick zurück Der Bettenabbau steht im engen Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwicklung der psychiatrischen Krankenhäuser in den letzten 150 Jahren. Aus Zucht- und Tollhäusern, in denen Bettler, Verbrecher, Prostituierte und psychisch Kranke gehalten wurden, entstanden Heil- und Pflegeanstalten. Epilepsiekranke, neurologische Patienten und Alkoholiker wurden aus den Heil- und Pflegeanstalten ausgegliedert und in speziellen Kliniken behandelt. Schwachsinnige wurden in Heimen untergebracht. Es entstanden spezielle gerontopsychiatrische Kliniken, Spezialeinrichtungen für Psychosomatik, für Rehabilitation, Kriseninterventionsstationen und psychiatrische Abteilungen an allgemeinen Krankenhäusern. Das Angebot an ambulanten Therapien und teilstationären Einrichtungen wuchs. Die Drogenarbeit wurde mit Ausnahme der Entgiftungsbehandlung aus der Psychiatrie in pädagogische und soziale Einrichtungen verlagert. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielschichtig. Der medizinische Fortschritt spielte dabei in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Rolle. Verbesserte Diagnostik und Therapiemethoden führten zu spezialisierten Behandlungen für bestimmte Patientengruppen. Diese Gruppen wurden in speziellen Abteilungen oder Kliniken zusammengefasst und verliessen zum Teil die psychiatrische Klinik. Der medizinische Fortschritt verkürzte die Behandlungen. Die durchschnittliche Hospitalisationsdauer liegt im Akutbereich der psychiatrischen Kliniken noch bei 3 – 5 Wochen. Die verbesserte Behandlung verhinderte zunehmend die Chronifizierung psychischer Krankheiten in vielen Fällen, sodass die Zahl der Patienten, die auf Dauer hospitalisiert bleiben müssen, heute weniger als 2% der Neuerkrankungen beträgt. All diese Faktoren haben zur Entstehung eines Bettenüberhangs beigetragen, der auch durch stark steigende Aufnahmezahlen in den Kliniken nicht kompensiert wurde. Beschränkte sich vorerst der Bettenabbau auf die Erwachsenenpsychiatrie, so wurden in den letzten 20 Jahren die psychiatrischen Kliniken zunehmend von ihrer Alterspflegefunktion entlastet. Diese Entwicklung ist heute in den St. Galler Kliniken noch nicht abgeschlossen. Missstände in Grosskliniken, vor allem in den angelsächsischen Ländern, und die Dynamik des Abbaus von Bettenkapazitäten in den Kliniken kombinierte sich in den 60-er- und 70-er-Jahren mit der Diskussion, ob nicht die psychiatrische Klinik die Krankheiten, die sie behandeln will, selbst hervorruft. Die Sozialpsychiatrie lenkte die Aufmerksamkeit vermehrt auf die soziale Dimension des Psychisch-Krankseins und schuf Alternativen zur stationären Behandlung, die stärker auf den Lebensbezug und die Gemeindenähe ausgerichtet waren. Die Erkenntnis, dass vor allem die soziale Behinderung, die mit fast allen psychischen Krankheiten einhergeht, klinikextern behandelt werden kann, führte zur Schaffung von Beratungsstellen, Tages-, Nachtkliniken und Wohnheimen. Die Frage stellte sich, ob es psychiatrische Kliniken überhaupt noch brauche. Heute ist diese Diskussion weitgehend abgeschlossen. Die Behandlung der sozialen Defizite des Psychisch-Krankseins gehört in den Behandlungsplan jedes psychiatrischen Patienten. Stationäre und sozialpsychiatrische Behandlungen haben sich 69 nicht alternativ, sondern komplementär entwickelt. Das psychiatrische Versorgungssystem ist in überschaubare Räume gegliedert und macht regional allgemein psychiatrische Behandlungsangebote, ergänzt durch spezialisierte Angebote in den Zentren. Eine Versorgungskette mit gemeindenahen ambulanten, teilstationären und zentralen stationären Behandlungen wurde aufgebaut und ihr Behandlungsangebot entsprechend vor allem den sozialen Fähigkeiten oder Behinderung des psychisch Kranken gegliedert. Die Rolle der Klinik hat sich in den letzten 20 Jahren gewandelt. Die alte Klinik behandelte vorwiegend chronisch psychisch kranke Menschen, die moderne und redimensionierte Klinik vor allem akut psychisch Kranke. Wegen der Konzentration von Fachleuten an einem Ort dient sie darüber hinaus als Weiterbildungszentrum. Bei allem Fortschritt der Medizin hat aber auch die heutige, moderne Klinik noch eine Asylfunktion für die wenigen Patienten, die schwerst und chronisch krank sind und für die bis heute keine geeigneten Behandlungsmethoden entwickelt werden konnten. Was bringt die Zukunft? Um auf halbwegs sicherem Boden zu bleiben, soll das Bild der Zukunft anhand von aktuellen Fragen und Problemen entworfen werden, die heute schon anstehen und in den nächsten Jahren zu lösen sein werden. Jede Klinik wird dabei ihre eigene Geschichte schreiben, je nachdem, wie flexibel und innovativ sie ihre Zukunftsprobleme anpackt. Die wesentlichen Motoren der Entwicklung werden einerseits der medizinische Fortschritt und andererseits das veränderte ökonomische Umfeld der Kliniken sein, bzw. die Interaktion zwischen den beiden. Spezialisierung Der medizinische Fortschritt führt auch in der Psychiatrie zu einer weiteren Spezialisierung. Die klinische Therapieforschung hat gezeigt, dass bestimmte schwere Krankheitsformen, wie z. B. zu Chronifizierung neigende Schizophrenieformen durch speziell ausgebildete Teams, die über ein spezifisches Fachwissen verfügen, erfolgreicher therapiert werden können als durch eine sogenannte Standardbehandlung auf einer gemischt belegten Station. Es werden sich deshalb noch spezialisiertere stationäre Behandlungsangebote ausbilden müssen, die aus wirtschaftlichen Gründen auf grosse bis sehr grosse Einzugsgebiete angewiesen sind. Um dennoch die Lebens- und Gemeindenähe sowie die Überschaubarkeit der Behandlung zu gewährleisten, braucht es eine optimale Mischung verschiedener Angebote, die auf die je spezifische Versorgungsregion zugeschnitten sein muss. Kleinere ländliche Kliniken können sich wegen der geringen Bevölkerungsdichte und den weiten Wegen in ihrer Versorgungsregion nur beschränkt spezialisieren. Für sie stellt sich die Frage, wie sie den Anschluss an die medizinische Entwicklung halten. Spezialisierung heisst in der Regel auch kürzere Aufenthaltsdauern und damit sinkende Bettenbelegung. Der medizinische Erfolg könnte so für kleinere ländliche Kliniken zu einer Bedrohung der eigenen ökonomischen Existenz werden. Konsolidierung In den letzten Jahrzehnten haben private und staatliche Intitiativen viele ambulante, teilstationäre und stationäre Behandlungs- und Betreuungsangebote geschaffen. Nach einer zwanzigjährigen Aufbauphase drängt sich aus Gründen der fachlichen und ökonomischen Effizienz eine Konsolidierung des weit gestreuten Angebotes auf. Die Angebotspalette muss transparenter gemacht und besser aufeinander abgestimmt werden. Die zunehmende Konkurrenz der Träger untereinander, die durch die neuen Marktverhältnisse noch akzentuiert wird, wird diese Entwicklung nicht erleichtern. 70 Zukunft der Psychiatrischen Klinik Gefährdete integrierte psychiatrische Behandlung Die moderne psychiatrische Behandlung ist biopsychosozial angelegt. Psychiatrische Krankheiten gehen nicht nur mit biologischen und psychischen, sondern vor allem und immer auch mit sozialen Störungen einher. Die soziale Rehabilitation ist ein wesentliches, wenn nicht das wichtigste Schlüsselelement für den Erfolg der modernen Psychiatrie. Gerade in diesem Bereich droht ein schleichender Leistungsabbau zu Lasten des psychisch kranken Menschen und seiner Angehörigen. In den Abgrenzungskämpfen zwischen verschiedenen Versicherern, Versicherern und staatlichen Defizitträgern sowie staatlichem Gesundheits- und Sozialwesen fällt die soziale Komponente der psychiatrischen Behandlung leicht durch die Maschen. Eine Ausgrenzung ganzer Patientengruppen von – je nach Krankheitsphase und Kostenträger – entweder medizinischen oder sozialen Leistungen zeichnet sich ab. Besonders gefährdet ist heute die kleine Gruppe psychisch schwerst und chronisch Kranker, für die wir noch keine Behandlungskonzepte besitzen und die deshalb die Klinik als Schutz- und Lebensraum brauchen. Der Qualitätsbegriff wird immer wichtiger Unter den steigenden Kosten bzw. dem Spardruck erhält der Qualitätsbegriff im neuen Gesundheitssystem eine zentrale Bedeutung. Qualitätsmessung und -förderung sollen dafür sorgen, dass die Kostenbegrenzung der Gesundheitsleistungen nicht über einen qualitativen Leistungsabbau erfolgt. Wie allerdings das Qualitätsmanagement in der Psychiatrie praktisch durchgeführt werden soll, ist zur Zeit Gegenstand von Diskussionen. Die Beschreibung der Qualität therapeutischer Leistungen ist nicht einfach. Die therapeutische Leistung in der Psychiatrie besteht vorwiegend im Herstellen adäquater menschlicher Beziehungen zu Patienten, die gerade wegen ihrer Krankheit mindestens in den akuten Krankheitsphasen nur beschränkt kooperieren können. Der Behandlungsprozess ist sehr komplex. Das Behandlungsresultat in seiner Vielschichtigkeit schwierig zu beurteilen. Vorläufig behilft sich die Praxis mit Indikatoren wie Personalausstattung oder Patientenzufriedenheit, die aber in ihrer Aussagekraft umstritten sind. Im Moment herrscht eine gewisse Verunsicherung, welche Qualitätskonzepte eingeführt werden sollen und was sie kosten dürfen. Am sinnvollsten scheint die Beurteilung der Behandlungsqualität durch ein externes Gremium zu sein, kombiniert mit Methoden, die das Qualitätsbewusstsein in der Klinik fördern. Die Frage ist, ob die Qualitätskosten – wie von den Ökonomen behauptet – durch Effizienzsteigerungen aufgefangen werden können und wieweit Effizienzgewinne anderweitig abgeschöpft werden. Verändertes politisches und ökonomisches Umfeld: Das neue Krankenversicherungsgesetz Bestimmend für die Entwicklung der psychiatrischen Klinik der nächsten 5 – 10 Jahre sind ohne Zweifel die Veränderungen in der ökonomischen Umwelt der Kliniken. Steigende Gesundheitskosten bei abnehmendem Steueraufkommen haben in den letzten Jahren zu einer Verknappung der Mittel geführt. Mit der Einführung des neuen Krankenversicherungsgesetzes am 1. Januar 1996 soll die Kostenentwicklung gebremst werden. Das neue Krankenversicherungsgesetz soll mehr Marktwirtschaft bringen, durch Spitalplanung Überkapazitäten abbauen helfen und durch Kostenumlagerungen beim Patienten mehr Kostenbewusstsein wecken. Fragen der Mittelverteilung, des Kosten-/Nutzenverhältnisses und der Mengenausweitung rücken in den Vordergrund. Als Folge müssen Ärzte mehr Kostenverantwortung übernehmen. Betriebswirtschaftliche Überlegungen spielen in der therapeutischen Willensbildung eine immer wichtigere Rolle. Die Forderung nach mehr Effizienz bzw. tieferen Kosten bei womöglich höherer Qualität als heute steht im Raum. Ein verändertes wirtschaftliches Anreizsystem, Wettbewerbsmechanismen und moderne Führungsinstrumente wie Leistungsauftrag, Globalbudget und verfeinerte Kostenrech- 71 nungssysteme sollen zu Einsparungen führen. Ein Qualitätsmess- und Förderungssystem will, dass diese Entwicklung nicht zu Lasten der Behandlungsqualität und damit zu Lasten der Patienten geht. Gleichzeitig soll diese Entwicklung sozial verträglich sein und allen, unabhängig vom Einkommen, den Zugang zu medizinischen Grundleistungen in gleicher Weise und in gleicher Qualität gestatten. Wesentliche Probleme des Gesundheitswesens geht das Krankenversicherungsgesetz nicht an. Es bleibt bei den verschiedenen Finanzierungssystemen für die Deckung von Heilungs- bzw. Invaliditätskosten. Es gibt nach wie vor 26 verschiedene kantonale Gesundheitssysteme. Die Kantone bleiben in unlösbaren Rollenkonflikten gefangen, z. B. in den Rollen als Betreiber von Kliniken und gleichzeitig kantonalen Spitalplanern, als Tarifpartner und gleichzeitig als Tarifschiedsrichter. Das Fehlen von bundesweit wirksamen, beweglich einsetzbaren Lenkungsgremien – bzw. -instrumenten führt dazu, dass systemimmanente Zielkonflikte zu spät oder gar nicht politisch ausdiskutiert werden können und damit die übergeordnete Strategie fehlt. An sich notwendige, grundsätzliche Weichenstellungen werden nicht vorgenommen. Die geschilderten Veränderungen im politischen und ökonomischen Umfeld zeitigen unter Umständen einschneidende Folgen für psychisch Kranke, ihre Angehörigen und nicht zuletzt für die psychiatrischen Kliniken. Die negativen Auswirkungen auf die integrierte psychiatrische Behandlung und vor allem deren soziale Komponente wurde bereits dargelegt. Ein anderes Beispiel sind die geschilderten Rollenkonflikte des Kantons und als Folge davon eine ambivalente Haltung als Spitalträger, der gleichzeitig marktwirtschaftliches Verhalten der Kliniken verlangt und ihnen aus planwirtschaftlichen Gründen die notwendigen Instrumente dazu verweigert. Ein weiteres Beispiel sind untaugliche Anreizsysteme. Arbeitet eine Klinik effizient und schliesst Langzeit- bzw. Pflegebetten, was medizinisch und volkswirtschaftlich sinnvoll sein kann, so erwirtschaftet sie weniger Einnahmen und muss den Staat als Träger der Institution um einen erhöhten Deckungsbeitrag angehen. Insgesamt eröffnet das neue KVG den psychiatrischen Kliniken vermehrt Chancen, mit mehr Eigenverantwortung und Dynamik die Zukunftsprobleme anzugehen und dem schwer psychisch Kranken wirksame Hilfe in einem humanen Umfeld zu geben. 72 73 QUELLENNACHWEISE Quellennachweise Literatur Die Gründung der Klinik ... Sibalic, Vladimir, Die Geschichte der Psychiatrischen Klinik St. Pirminsberg, in: Zürcher Medizingeschichtliche Abhandlungen, Nr. 266, Juris Druck und Verlag Dietikon, 1996 Constantin von Monakow Jagella C, Isler H, Hess K. Constantin von Monakow (1853 bis 1930). Hirnforscher. Neurologe. Psychiater. Denker Schweiz Arch Psychiat 1994; 145: Suppl. I: 1 – 61 Katzenstein-Sutro E. Bemerkungen zu C. von Monakows biologischen Theorien Schweiz Arch Neurol Psychiat 1955; 74: 95 – 102 Kesselring J. Eine Neurologie des Verhaltens als Grundlage der Neurorehabilitation Schweiz Med Wschr 1992; 122: 1197 – 1205 Kesselring J. Die Entwicklung der Neurologie vom 19. zum 20. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung einiger Beiträge aus der Schweiz Schweiz Rundschau Med (PRAXIS) 1994; 83: 491 – 496 Kesselring J. Constantin von Monakow in Pfäfers Schweiz Arch Neurol Psychiat 1997; 93: (im Druck) Minkowski M. Constantin von Monakow 1853 – 1930 Schweiz Arch Neurol Psychiat 1931; 27: 1 – 63 von Monakow C. Vita mea – mein Leben Hrsg. Gubser AW, Ackerknecht EH Verlag Hans Huber Bern 1970 von Pusirewsky M. Monakow als Arzt und Erzieher Orell Füssli Verlag, Zürich 1953 Dr. August Zinn Haffter, Elias, Dr. Sonderegger in seiner Selbstbiographie und seinen Briefen, Frauenfeld 1898 (S. 62 und 312 ff). Ich danke Herrn Dr. med. C. Bielinski, ehemaligem Direktor der Klinik St. Pirminsberg, für die freundliche Überlassung einiger Krankengeschichten aus Zinns Zeit. Die deutschen Hilfsvereine für Geisteskranke, ihre Entstehung und ihr gegenwärtiger Stand (Hrsg.: C. Ackermann, M. Fischer, J. Herting, H. Roemer), Berlin und Leipzig 1930 (vgl. die Beiträge von J. Herting und K. Zinn). Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Berlin 1844 ff. , 1885, S. 139 (Bd. 41). Ibid., 1898, S. 1112-1127 (Bd. 54). Dieser mit «L.» gezeichnete Nekrolog dürfte von Heinrich Laehr stammen. Ibid., 1878, S. 81 (Bd. 34). Ibid., 1879, S. 527 (Bd.35). Ibid., 1883, S. 639 (Bd.39). Ibid., 1885, S. 139 (Bd.41). Ibid., 1892, S. 461 und 535 (Bd. 48). Ibid., 1894, S. 333 (Bd. 50). Ibid., 1896, S. 818 (Bd. 52). Zinn, Karl, Statistische Mitteilungen über die Krankenbewegung der Brandenburgschen Landes-Irrenanstalt zu Eberswalde in den Jahren 1877–1892. Allg. Zschr. f. Psych. 50 (1894) 997. Walser, H.H., Die «deutsche Periode» (etwa 1850–1880) in der Geschichte der Schweizer Psychiatrie und die moderne Sozialpsychiatrie. Gesnerus 28 (1971) 47. Meyer, Alexander, August Zinn, in: Biographisches Jahrbuch und deutscher Nekrolog, Berlin 1898. Zinn, Karl, August Zinn, in: Deutsche Irrenärzte, hrsg. von Th. Kirchhoff, Berlin 1924 (II, S. 65). Walser, H. H. und Zinn, W.M.; August Zinn (1825–1897), ein Begründer der praktischen Psychiatrie in der Schweiz. Gesnerus 32 (1975) 271–282. 28. Gropius, Martin: Die Provinzial-Irren-Anstalt zu Neustadt Eberswalde, Verlag Von Ernst & Korn, Berlin, 1869. Was bringt die Zukunft Ackerknecht Erwin H.: Kurze Geschichte der Psychiatrie, Enke Verlag Stuttgart, 1985 Brenner H.-D.: Stand der Diskussion zur Kosten-Effektivitätsfrage in der Gemeindepsychiatrie und Klinikpsychiatrie. Schweiz Arch Neurol Psychiatr 146(1): 24–32, 1995 Hasse, K. E., Erinnerungen aus meinem Leben, Braunschweig 1893 (S. 169 ff). Böker W.: Die Zukunft der klinischen Psychiatrie im Lichte ökonomischer und gemeindepsychiatrischer Entwicklungen. Vortragsmanuskript 1996 (unveröffentlicht) Milt, B., Geschichte des Zürcher Spitals, in: Zürcher Spitalgeschichte, Zürich 1951 (I, S. 65). Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 Zinn, August, Die öffentliche Irrenpflege im Kanton Zürich und die Notwendigkeit ihrer Reform, Zürich 1863. Die Schrift ist den Freunden Chr. E. Bach und Friedrich Lehmann gewidmet, die beide für die Medizin in Zürich wichtig waren, aber unterschätzt werden, weil sie nicht publizierten. Über Lehmann s. die Autobiographie seines Sohnes: K. B. Lehmann, Frohe Lebensarbeit, München 1933. Die richtigste Würdigung von Zinns Beitrag stammt wohl von J. Strohl: «Die Schrift Aug. Zinns ... scheint die zuständigen Behörden unbehaglich berührt und zur endlichen Verwirklichung des Burghölzli-Planes beigetragen zu haben» (Die Universität Zürich 1833–1933..., Zürich 1938, S. 941). Ciompi L.: Grundsätze einer modernen patientenzentrierten psychiatrischen Versorgung. SÄZ 8: 302–6, 1993 Bleuler, M., Geschichte des Burghölzli und der psychiatrischen Universitätsklinik, in: Zürcher Spitalgeschichte, Zürich 1951 (II, S. 377). Hofmann, M., Die Irrenfürsorge im alten Spital und Irrenhaus Zürichs..., Zürich 1922. Walser, H. H., Der Entschluss zum Bau der Heilanstalt Burghölzli, in: Kant. psychiatrische Universitätsklinik Burghölzli 1870–1970, Zürich o. J. Hungerbühler, J. M., Über das öffentliche Irrenwesen in der Schweiz, St. Gallen und Bern 1846. Herensperger, H., Geschichte der Heil- und Pflegeanstalt St. Pirminsberg, in: Jahresbericht des St. Gallischen Hilfsvereins für Gemütskranke 1954 und 1955. 74 Geduldig, C., Die Behandlung der Geisteskranken ohne physischen Zwang, Diss.med. Zürich 1975. Walser, H. H., Hundert Jahre Klinik Rheinau 1867–1967, Aarau 1970. Dauwalder J.-P.; Ciompi L.: Cost-effectiveness over 10 years. A study of community-based social psychiatric care in the 1980s. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 30(4): 171–84, 1995 Gaebel W. (Hrsg.): Qualitätssicherung im psychiatrischen Krankenhaus, Springer-Verlag Wien New York, 1995 Goldstein J., Horgan C.: Inpatient and outpatient psychiatric services: Substitutes or complements? Hosp Community Psychiatry 39: 632–6, 1988 Häfner H., Klug J., Gebhardt H.: Brauchen wir noch Betten für psychisch Kranke bei hinreichender Vor- und Nachsorge? Ergebnisse der Versorgungsforschung in Mannheim, in: Siedov H. (Hrsg.): Standorte der Psychiatrie, Band 3: Auflösung der psychiatrischen Grosskrankenhäuser? Urban & Schwarzenberg München, 1983 Haug H.-J. & Stieglitz R.D.: Qualitätssicherung in der Psychiatrie, Enke Verlag Stuttgart, 1995 Leff J., Thornicroft G., Coxhead N., Crawford C.: The TAPS Project. 22: A five-year follow-up of long-stay psychiatric patients discharged to the community. Br J Psychiatry Suppl Nov(25): 13–7, 1994 Wolfersdorf M.: Depressionsstationen - Spezialisierung in der stationären Depressionsbehandlung. Psycho 20: 14-20, 1994 Autoren (Die Reihenfolge entspricht der Chronologie der Beiträge in der Festschrift) Anton Grüninger, lic. iur., Regierungsrat, Vorsteher des Gesundheitsdepartementes des Kantons St. Gallen Dr. med. Vladimir Sibalic, St. Gallen Theresa Kühne, Ausbildungsverantwortliche Pflege, Kantonale Psychiatrische Dienste – Sektor Süd, Pfäfers Evort Meyer, Leiter Pflegedienst, Kantonale Psychiatrische Dienste – Sektor Süd, Pfäfers Hans König, Bürgermeister a. D., Gaildorf, Deutschland Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, Chefarzt Neurologie, Klinik Valens Dr. med. Hans Jörg Keel, ehem. Chefarzt, Walenstadt Dr. med. Wilhelm M. Zinn, ehem. Chefarzt, Bad Ragaz Bilder Balz Rigendinger, Fotograf, Zürich Seiten: 1, 3, 5, 21, 27, 39, 53, 54, 56, 61, 64, 65, 67, 69, 73 Staatsarchiv St. Gallen Seiten: 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 32, 37 Privatbesitz Dr. W. M. Zinn Seite: 34 Archiv Kant. Psych. Dienste – Sektor Nord, Wil Seiten: 8, 9 Archiv Kant. Psych. Dienste – Sektor Süd, Pfäfers Seiten: 29, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 63, 66 Heidiland Tourismus, Sargans Seiten: 46, 47 Privatbesitz Sr. Ida Göpfert Seiten: 9, 15, 33 Hans Werner Widrig, dipl. Ing. HTL, Nationalrat , Bad Ragaz Privatbesitz Fritz Grob jr. Seite: 31 Dr. med. Thomas Meier, Chefarzt, Kantonale Psychiatrische Dienste – Sektor Süd, Pfäfers Neurologische Universitätsklinik, Zürich Seiten: 22, 24, 26 Hans Grämiger, kath. Seelsorger, Klinik St. Pirminsberg A. Burrows, I. Schumacher; Doktor Diamonds Bildnisse von Geisteskranken, Syndikat Seite: 11 Urs Steinemann, ref. Seelsorger, Klinik St. Pirminsberg Christoph Eicher, lic. rer. publ., Verwaltungsleiter, Kantonale Psychiatrische Dienste – Sektor Süd, Pfäfers Dr. med. Hanspeter Wengle, Chefarzt, Kantonale Psychiatrische Dienste – Sektor Nord, Wil 75 Gönner und Sponsoren der 150-Jahr-Feier Folgende Personen, Firmen und Institutionen haben die 150-Jahr-Feierlichkeiten der Klinik St.Pirminsberg mit namhaften Beträgen unterstützt: AG EW, Bad Ragaz Agrola, St. Gallen A. Käppeli's Söhne, Chur Bristol-Myers Squipp AG, Baar Cerberus AG, Gossau Elektro-Sanitär, St. Gallen Embru-Werke AG, Rüti / ZH Flawa AG, Flawil Gebr. Heeb, Azmoos GNS Global Network Sys., Winterthur GFZ Wachter, Mels ISS Hospital, Oberentfelden Janssen-Cilag AG, Baar Kaiser J. AG, Eschen Karl Mayer Stiftung, Vaduz Keller Aldo, Pfäfers Kohler Anian, Vättis Kuster A., Schmerikon Lundbeck (Schweiz) AG, Opfikon-Glattbrugg Luxram Licht AG, Goldau Micom Medicare AG, Ittigen Nigg AG, Pfäfers Novartis Schweiz AG, Bern Organon AG, Pfäffikon SZ Parke-Davies & Co., Baar Pfeiffer AG, Chur Pfizer AG, Zürich Philips Business Elec., Zürich Politische Gemeinde Pfäfers Raiffeisenbank Bad Ragaz-Vorderes Taminatal Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Thalwil SCA Mölnycke AG, Regensdorf Schneider AG, Pfäfers Schwitter + Speck, Pfäfers Schwitter Urs, Pfäfers Solvay Pharma AG, Bern Steinmetz Wilm, Marsberg, Deutschland St. Gallische Kantonalbank Bad Ragaz Stieger Peter, Bad Ragaz Unisys (Schweiz) AG, Bern Volg, Landquart Volg Weinkellereien, Winterthur Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar Wyeth-Lederle, Zug 76 77 Impressum Auflage: 2 000 Konzept & Idee: Gesamtleitung Kant. Psych. Dienste – Sektor Süd Redaktion: Urs Sloksnath, Informationsbeauftragter Kant. Psych. Dienste – Sektor Süd Satz & Gestaltung: Gonzen Druck AG, Bad Ragaz Druck: Gonzen Druck AG, Bad Ragaz Ein besonderer Dank gilt dem Kanton St. Gallen für die grosszügige Unterstützung dieser Festschrift aus dem Lotteriefonds. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Bewilligung der Autoren erlaubt. © 1997 Alle Rechte vorbehalten. 78 150 Jahre Psychiatrische Klinik St. Pirminsberg 150 Jahre Psychiatrische Klinik St. Pirminsberg 1847–1997