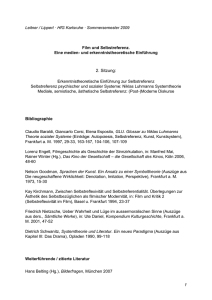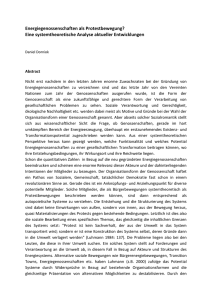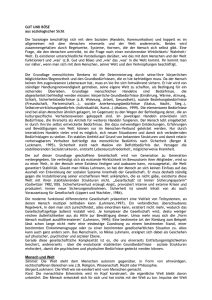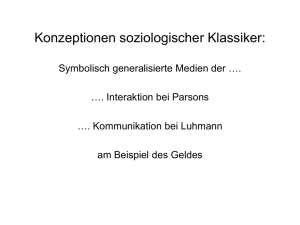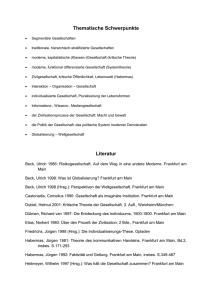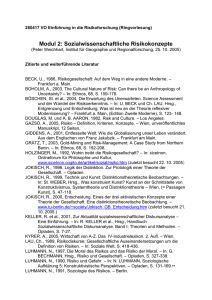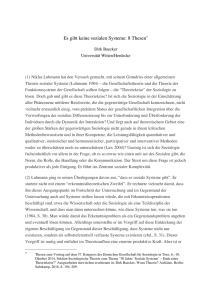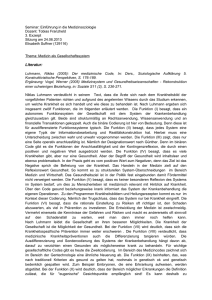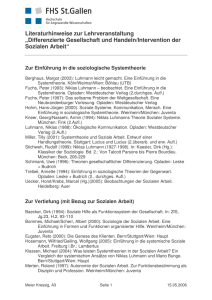Dissertation 29.08.2010
Werbung

Reziprozität Ein sozialintegrativer Mechanismus der Gesellschaft? Darstellung des Wandels historischer Ordnungsvorstellungen am Beispiel des Bettlers Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern vorgelegt von Jens Hofmann aus Trier (Deutschland) Eingereicht am: 23.01.2008 Erstgutachterin: Prof. Dr. Cornelia Bohn Zweitgutachter: Prof. Dr. Alois Hahn 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung – Die Krise der modernen Gesellschaft ..............................................................5 1. Zur allgemeinen Theorie sozialer Systeme ................................................................... 16 1.1 Einführende Bemerkungen zum soziologischen Systembegriff ...................................... 16 1.2 Die Autokatalyse sozialer Systeme ................................................................................. 20 1.2.1 Das Problem der doppelten Kontingenz .............................................................. 20 1.2.2 Die Emergenz sozialer Systeme ............................................................................ 22 1.2.3 Soziale Systeme als Kommunikationssysteme ....................................................... 27 1.2.3.1 Die Selbstreferenz von Kommunikationen ..................................................... 27 1.2.3.2 Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation und ihre Überwindung durch Kommunikationsmedien ...................................................................... 31 1.2.3.3 Die Bedeutung von Semantiken für den Aufbau sozialer Strukturen............... 38 1.3 Zur Korrelation von Semantik und Sozialstruktur ......................................................... 44 2. Reziprozität – Ein sozialintegrativer Mechanismus der Gesellschaft? ........................ 51 2.1 Vorbemerkungen zur gesellschaftstheoretischen Verankerung des Verhaltensprinzips der Reziprozität ............................................................................... 51 2.2 Zur klassischen Soziologie der Reziprozität ................................................................... 55 2.2.1 Die Sozialanthropologie Marcel Mauss’ ................................................................ 55 2.2.2 Der Strukturalismus Claude Lévi-Strauss’ ............................................................. 58 2.2.3 Dankbarkeit als Form der Vergesellschaftung bei Georg Simmel .......................... 61 2.2.4 Die amerikanischen Austauschtheorien ................................................................ 64 2.2.5 Der praxeologische Ansatz bei Pierre Bourdieu .................................................... 68 2.3 Das Verhaltensprinzip der Reziprozität in der Systemtheorie......................................... 72 2.3.1 Interaktion und Gesellschaft ................................................................................. 72 2.3.2 Die Norm der Reziprozität bei Niklas Luhmann .................................................. 80 3. Die Ordnung der Gesellschaft ...................................................................................... 90 3.1 Das Problem der Ordnung ............................................................................................ 90 3.2 Die Ordnungsdimensionen der Gesellschaft .................................................................. 95 3.2.1 Die Sozialdimension sozialer Ordnung ................................................................. 95 3.2.2 Die Zeitdimension sozialer Ordnung .................................................................. 102 3 3.3 Die gesellschaftliche Ordnung und ihre Individuen ..................................................... 112 3.3.1 Die Inklusionsindividualität des vormodernen Individuums ............................... 112 3.3.2 Die Exklusionsindividualität des modernen Individuums ................................... 122 3.4 Reziprozität als kulturhistorisches Phänomen – Von der Freundschaft zum Interesse .............................................................................................................. 129 3.4.1 Die sozialintegrative Funktion der Freundschaft................................................. 129 3.4.2 Die sozialintegrative Funktion des Eigeninteresses ............................................. 141 3.4.3 Von der Tausch- zur Geldwirtschaft ................................................................... 150 4. Das Interaktionssystem der personalen Hilfe ............................................................ 156 4.1 Der Bettler in der soziologischen und historischen Forschung .................................... 156 4.2 Die Stellung des Bettlers in der Gesellschaft ................................................................ 164 4.2.1 Der Bettler als Gegenstand evolutionstheoretischer Überlegungen ..................... 164 4.2.2 Die Interaktionsschematismen der personalen Hilfe ........................................... 170 4.2.2.1 Arbeit ........................................................................................................... 170 4.2.2.1.1 Die Beobachtbarkeit von Arbeit ............................................................ 170 4.2.2.1.2 Die Arbeit im historischen Wandel ........................................................ 176 4.2.2.2 Sittlichkeit..................................................................................................... 186 4.2.2.3 Bedürftigkeit ................................................................................................. 198 4.3 Die Ausdifferenzierung des Interaktionssystems der personalen Hilfe ......................... 209 4.3.2 Die Person des Bettlers....................................................................................... 209 4.3.3 Die Paradoxie der personalen Hilfe .................................................................... 215 4.3.4 Die Funktion des Almosens ............................................................................... 223 4.4 Der Bettler und das politische System.......................................................................... 233 4.4.1 Der Bettler im Fokus politischen Kalküls ........................................................... 233 4.4.2 Die gemeinwohlschädigenden Folgen des Bettelns ............................................. 237 4.4.2.1 Der Bettler als Problem ständischer Differenzierung .................................... 237 4.4.2.2 Der Bettler als volkswirtschaftliches Problem ............................................... 242 5. Schlussbetrachtung – Der Fremdheitstypus des Peripheren ..................................... 247 Literaturliste ...................................................................................................................... 257 4 Einleitung – Die Krise der modernen Gesellschaft Schenkt man den gegenwärtig in der Politik und den Massenmedien gebräuchlichen Gesellschaftsanalysen Glauben, befinden wir uns in einer Zeit des fundamentalen Umbruchs. Der Blick richtet sich dabei vornehmlich auf die durch Globalisierungsprozesse ausgelösten Veränderungen des sozioökonomischen Faktors Arbeit, der neben dem Staat als der zentrale Integrationsmechanismus der Gesellschaft aufgefasst wird. Auch die Sozialwissenschaften haben sich im Rahmen der soziologischen Armutsforschung und der soziologischen Analyse sozialer Ungleichheit an dieser Argumentationslogik beteiligt. Bereits in den 80er Jahren kursierten hier Schlagworte wie „Krise der Arbeitsgesellschaft“1 und „Neuen Armut“2, um den wahrgenommenen Umstrukturierungen der Arbeitswelt und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Konsequenzen einen griffigen Namen zu geben. Seit den 90er Jahren wird jedoch mit dem zunächst in Frankreich prominent gewordenen sozialpolitischen Topos der Exklusion ein weitaus bedrohlicheres Szenario entworfen, in dessen Mittelpunkt die Diagnose einer zunehmenden Innen-Außen-Spaltung der Gesellschaft steht.3 Der These liegen empirische Studien zugrunde, die auf das verstärkte Wirken kumulativer Exklusionsprozesse hinweisen, in deren Folge eine immer größer werdende Anzahl von Menschen vollständig von den gesellschaftlichen Berufs- und Statuspositionen ausgeschlossen werden. Dieses Schreckgespinst der vollständigen gesellschaftlichen Exklusion von Niedrigqualifizierten, Alten, Migranten etc. wirft seinen düsteren Schatten allerdings nicht nur auf diejenigen, die der „Underclass“4 bzw. der Gruppe von „Überflüssigen“5, „Überzähligen“6, „Ent- 1 2 3 4 5 6 Vgl. die Beiträge in MATTHES, Joachim (Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982. Frankfurt (Main) / New York 1982. Zu den Veränderungen des Armutsdiskurses im Nachkriegsdeutschland vgl. LEISERING, Lutz: Zwischen Verdrängung und Dramatisierung. Zur Wissenssoziologie der Armut in der bundesrepublikanischen Gesellschaft. In: Soziale Welt 44 (1993), S. 486-511. Vgl. KRONAUER, Martin / NEEF, Reiner: ‚Exklusion’ und ‚soziale Ausgrenzung’. Neue soziale Spaltung in Frankreich und Deutschland. In: Deutsch-Franzöisches Institut (Hg.): Frankreich-Jahrbuch 1996. Opladen 1997, S. 35-58. Einen informativen Einblick in die französische Debatte liefert MARTIN, Claude: French Review Article. The debate in France over ‚Social Exclusion’. In: Social Policy & Administration 30 (1996), S. 382-392. Einen länderübergreifenden Überblick über die theoretischen Implikationen des Begriffs der Exklusion leistet LEISERING, Lutz: ‚Exklusion’ - Elemente einer soziologischen Rekonstruktion. In: BÜCHEL, Felix et al. (Hg.): Zwischen drinnen und draußen. Arbeitsmarktchancen und soziale Ausgrenzungen in Deutschland. Opladen 1999, S. 11-22. Zur Underclass-Debatte in den USA und Europa vgl. den umfassenden Überblick von ANDERSEN, John / LARSEN, Jørgen Elm: The Underclass Debate – a Spreading Disease? In: MORTENSEN, Nils (Hg.): Social Integration and Marginalisation. Frederiksberg 1995, S. 147-182. Vgl. BUDE, Heinz: Die Überflüssigen als transversale Kategorie. In: BERGER, Peter A. / VESTER, Michael (Hg.): Alte Ungleichheiten - neue Spannungen. Opladen 1989, S. 363-383. Zur kritischen Diskussion der gesellschaftstheoretischen Implikationen, die der Kategorie der ‚Überflüssigen’ zugrunde liegen, vgl. BAECKER, Dirk / BUDE, Heinz / HONNETH, Axel / WIESENTHAL, Helmut: ‚Die Überflüssigen’. Ein Gespräch. In: Mittelweg 36 (1998), S. 65-81. Vgl. HERKOMMER, Sebastian: Deklassiert, ausgeschlossen, chancenlos – die Überzähligen im globalisierten Kapitalismus. In: HERKOMMER, Sebastian (Hg.): Soziale Ausgrenzungen. Gesichter des neuen Kapitalismus. Hamburg 1999, S. 7-34. 5 behrlichen“7, Exkludierten bereits angehören und die an ihren eingeschränkten sozialen Teilhabechancen die Wertlosigkeit ihrer Existenz erfahren. Jenseits dieser marginalisierten sozialen Gruppen zieht es verstärkt auch die Inkludierten in seinen Bann, bei denen sich eine Angst breit macht, schon morgen ein ähnliches Schicksal wie jene zu erleiden. Vulnerabilität und Prekarität prägen den Alltag des modernen Menschen, dessen Traum einer kontinuierlichen Verbesserung seines sozialen Status dem Albtraum des Absackens ins soziale Nirgendwo gewichen ist.8 Zeitgleich mit dieser Desillusionierung des an Aufstiegskarrieren orientierten modernen Lebensplans mehren sich die Anzeichen einer gesellschaftlichen Desintegration und eines Brüchigwerdens des sozialstaatlichen Fundaments, auf dem die Gesellschaften der Nachkriegszeit ruhten.9 Aktive Abgrenzungsbemühungen auf der Seite der Inkludierten, Fatalität und Apathie auf der Seite der Exkludierten lassen ein Klima der sozialen Kälte entstehen, in dem egoistische Belange zum alleinigen Fixpunkt der Lebensgestaltung hypostasieren. Soweit der Befund, der zurzeit länderübergreifend unter dem Namen der Exklusion weite Teile der sozialwissenschaftlichen Debatte beherrscht. Das theoretisch-begriffliche Gerüst, auf dem die gegenwärtige Exklusionsdebatte ihre zentralen Thesen entwickelt, bleibt weitestgehend an marxistischen Klassentheorien und Theorien sozialer Schließung bzw. Schichttheorien orientiert, obgleich Versuche unternommen werden, Unterschiede und Weiterentwicklungen hervorzuheben. Alles in allem erweckt dies aber eher den Eindruck, als würde hier Altbewährtes neu aufpoliert und in einem zeitgemäßen, neue Forschungen rechtfertigenden Gewand verkauft, denn weitere Erkenntnisgewinne zu erwarten. Weite Teile der Exklusionsforschung lassen sich dabei von der Frage leiten, wie unter den Bedingungen der Krise der modernen Gesellschaft eine richtige im Gegensatz zu einer falschen Sozialpolitik auszusehen habe. Die Gegenüberstellung solcher Alternativen impliziert, dass sich Fehlentwicklungen der Moderne von ihren Errungenschaften isolieren und dank dieser Extraktionsleistung mit lokal wirksamen Gegenmaßnahmen bekämpfen lassen. Die derzeit geführten Diskussionen um den Zustand unserer Gesellschaft vermitteln entsprechend den Eindruck, es handele sich dabei um die medizinische Sezierung eines pathologischen Körpers. Gewiss, bei der Frage, welches Organ denn von Krankheit befallen und inwieweit der Organismus in Mitleidenschaft gezogen sei, herrscht keine Einigkeit, Konsens jedoch über den Tatbestand des Befalls. Und so entbrennt der Streit um den Krankheitszustand des Patienten ‚Gesellschaft’ und einer seinem Krankheitsstadium angemessenen Therapiewahl. Mit jedem Befund – denn darin liegt der funktionale Kern einer medizinischen Diagnostik begründet – eröffnet sich die Hoffnung auf Heilung und damit 7 8 9 Vgl. LENSKI, Gerhard: Macht und Privileg. Eine Theorie sozialer Schichtung. Frankfurt (Main) 1973. Vgl. CASTEL, Robert: Die Fallstricke des Exklusionsbegriffs. In: Mittelweg 36 (2000), S. 11-25; CASTEL, Robert: Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit. Konstanz 2000. Vgl. dazu die Beiträge in HEITMEYER, Wilhelm (Hg.): Was treibt die Gesellschaft auseinander? Frankfurt (Main) 1997. 6 die Plausibilität der Beobachtung selbst. So wie eine Krankheit auf die Möglichkeit der Gesundung verweist, so scheinen sich in der Krise der modernen Gesellschaft bereits ihre Lösungen vorgezeichnet zu finden. Auffallend bei dieser Herangehensweise ist jedoch, dass die allermeisten aktuellen Forschungsvorhaben die historische Dimension des Exklusionsbegriffs fast gänzlich unterbelichtet belassen.10 Ein Schwund an Theorie und eine Stärkung der Empirie sind die logischen Konsequenzen dieser Gegenwartsbefangenheit. Innerhalb der Soziologie gilt es allerdings eine die Gesellschaft beschreibende, primär Soziallagen wie Armut, Arbeitslosigkeit, Randständigkeit etc. problematisierende von einer das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft analysierende Begriffsverwendung zu unterscheiden.11 In diesen beiden methodischen Zugängen spiegeln sich die makrosoziologischen Theorietraditionen der Ungleichheitstheorie auf der einen und der Differenzierungstheorie auf der anderen Seite wider.12 Vertreter der Ungleichheitstheorie legen ihr Hauptaugenmerk auf die Lebenslage von Personen, die sich jenseits der geschichteten Ordnung einer Gesellschaft bewegen. Von diesem Befund ausgehend formulieren sie die Frage, welche ordnungsstabilisierenden Gegenmaßnahmen für die Verwirklichung der kompletten Inklusion aller Gesellschaftsmitglieder zu ergreifen sind. Vertreter der Differenzierungstheorie drehen diese Argumentationslogik schlicht um. Ausgangspunkt bildet hier die Analyse der Inklusion, also der Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit Individuen als Personen überhaupt für die Gesellschaft relevant werden können. Exklusion erscheint aus diesem Blickwinkel als ein unumgänglicher struktureller Effekt der Inklusion, dem als solcher jedoch noch keine pejorative Bedeutung zufällt. Wer also etwas über die Exklusionen einer Gesellschaft in Erfahrung bringen will, hat sich zunächst über ihre Inklusionsbedingungen zu informieren. Mit der differenztheoretischen Verwendung des Begriffspaars wird das soziologische Forschungsinteresse von der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit des Erhalts einer 10 11 12 Der in Trier gegründete SFB 600 Fremdheit und Armut. Wandel von Inklusions- und Exklusionsformen von der Antike bis zur Gegenwart hat sich dementsprechend zum Ziel gesetzt, dieses Forschungsdesiderat zu schließen. Vgl. dazu die Beiträge in GESTRICH, Andreas / LUTZ, Raphael (Hg.): Inklusion / Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt (Main) 2004. Zu dieser Unterscheidung vgl. LEISERING, Lutz: Desillusionierung des modernen Fortschrittglaubens. ‚Soziale Exklusion’ als gesellschaftliche Selbstbeschreibung und soziologisches Konzept. In: SCHWINN, Thomas (Hg.): Differenzierung und soziale Ungleichheit. Die zwei Soziologien und ihre Verknüpfung. Frankfurt (Main) 2004, S. 238-268. Eine ähnliche Begriffsunterscheidung verwendet auch NASSEHI, Armin: Exklusion als soziologischer und sozialpolitischer Begriff? In: Mittelweg 36 (2000), S. 18-25. Instruktive Überblicke über die verschiedenen soziologischen Theorietraditionen, in denen der Exklusionsbegriffs steht, verschaffen SILVER, Hilary: Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. In: International Labour Review 133 (1994), S. 531-578; HAHN, Alois: Theoretische Ansätze zu Inklusion und Exklusion. In: BOHN, Cornelia / HAHN, Alois (Hg.): Annali di Sociologia / Soziologisches Jahrbuch. Bd. 16. 2002/03. Berlin 2006, S. 67-88. Als Vertreter der differenzierungstheoretischen Begriffsverwendung seien hier exemplarisch folgende Autoren genannt: LUHMANN, Niklas: Inklusion und Exklusion. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. Opladen 1995, S. 237-265; STICHWEH, Rudolf: Inklusion und Exklusion. Studien zur Gesellschaftstheorie. Bielefeld 2005. Eine besonderen Akzent auf die historische Anwendbarkeit des Begriffspaars legen BOHN, Cornelia: Inklusion, Exklusion und die Person. Konstanz 2006; BOHN, Cornelia / HAHN, Alois: Patterns of Inclusion and Exclusion. Property, Nation and Religion. In: Soziale Systeme 8 (2002), S. 8-26; FUCHS, Peter: Weder Herd noch Heimstatt – Weder Fall noch Nichtfall. Die doppelte Differenz im Mittelalter und in der Moderne. In: Soziale Systeme 3 (1997), S. 413-437. 7 sozialen Ordnung auf die nach den Bedingungen der Möglichkeit ihres Zustandekommens gelenkt. Im Zuge dieses Perspektivenwechsels tritt ein Sachverhalt zutage, der mit den modernen Prämissen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit im unmittelbaren Widerstreit zu stehen scheint: Ohne die Exklusion des Menschen wäre die Inklusion der Person in die Gesellschaft undenkbar. Die Dissertation folgt im Weiteren dieser differenztheoretischen Perspektive. Ihr geht es dementsprechend nicht darum, in den Kanon der Kritik an der momentan nur defizitären Verwirklichung der modernen Gesellschaft einzustimmen. Vielmehr sollen Exklusionsphänomene mittels der systemtheoretischen Differenzierungstheorie interpretiert und durch die Untersuchung eines vergangenen fundamentalen Umbruchs sozialer Strukturen historisch kontextualisiert werden. Niklas Luhmann bezeichnet diese Brüche als evolutionär unwahrscheinliche Umstellungen der gesellschaftlichen Differenzierungsform, oder etwas dramatischer formuliert: als alle Lebenssphären des Menschen durchdringende Katastrophen.13 Es gilt also der Frage nachzugehen, ob und inwiefern vieles von dem, was gegenwärtig als Anzeichen eines Strukturwandels gedeutet wird (Innen-Außen-Spaltung, Kontingenz von Lebensläufen, Verräumlichung sozialer Ausgrenzung, Mehrdimensionalität und kumulative Effekte von Exklusion), schon im Übergang von stratifikatorisch zu funktional differenzierten Gesellschaften sich dokumentieren lässt. Der Dissertation liegt dabei die These zugrunde, dass solche Krisenbefunde lediglich daran teilhaben, jene Bedingungen der Möglichkeit zu konkretisieren, auf deren Grundlage Gesellschaften ihre Sozialordnung konstituieren. So ist für eine soziologische Herangehensweise, der es allein um die Analyse des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft geht, am Befund steigender Arbeitslosenzahlen auch weniger die Bestimmung ihrer konkreten Ursachen, als vielmehr das sich mit ihm verbindende Krisenbewusstsein, weniger die Erfolgsaussichten etwaiger Gegenmaßnahmen, als vielmehr das mit ihnen verfolgte Ziel erklärungsbedürftig. Denn jede Forderung nach Gegenmaßnahmen setzt die Vorstellung einer idealen Gesellschaftsordnung voraus, in der sich unter optimalen Voraussetzungen das dem Menschen gemäße Leben in Freiheit und Würde – das gute Leben, wie es noch in den Gesellschaftstheorien der antiken Philosophie hieß – verwirklicht. Und so mag derzeit zwischen den Experten bei der Frage nach den wirtschaftspolitisch notwendigen Konzepten durchaus Uneinigkeit herrschen. Aber ob man nun durch kreditfinanzierte Staatsausgaben eine mangelnde Nachfrage zu kompensieren oder durch Beschränkung der Staatsausgaben, Deregulierung und Eigenverantwortung freie Wirtschaftsräume zu ermöglichen sucht, in beiden Fällen besteht ein grundsätzliches Einvernehmen darüber, dass hohe Arbeitslosigkeit die Gefahr in sich birgt, das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Solidarität der Gesellschaftsmitglieder zu unterminieren. Die Botschaft einer solchen Aussage ist so einfach wie plausibel: Arbeitslosigkeit 13 Vgl. LUHMANN, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bde. Frankfurt (Main) 1997, S. 655. 8 hat nicht nur Auswirkungen auf denjenigen, der unmittelbar von ihr betroffen ist, sondern auf die Gesellschaft als Ganzes. Krisenbefunde informieren also weniger über Einzelschicksale, obschon sich der ein oder andere durchaus in ihnen wieder zu erkennen vermag, sie benennen vielmehr die Bedingungen, die innerhalb einer Gesellschaft für den Erhalt ihrer sozialen Ordnung als unerlässlich erachtet werden. Allein der Verweis auf ein Arbeitslosenniveau, das im Vergleich zu Messungen vergangener Jahrzehnte gegenwärtig einen beispielslosen Spitzenwert erzielt, reicht noch nicht aus, um der Moderne zwingend eine Krise attestieren zu können. Für sich genommen bleibt das OhneArbeit-Sein solange unproblematisch, wie es nicht in Relation zu einer sozialen Ordnungsvorstellung gebracht wird, die in dem Zusammenwirken der Kräfte und Interessen wie auch der Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit durch Arbeit die Grundbedingungen sozialen Zusammenlebens erblickt. Soziale Krisen sind demnach nicht einfach objektiv messbar, sie werden vielmehr durch diskursive Praktiken erzeugt, die sich über den Umweg der Bezeichnung einer Anomalie dem Wunschbild einer idealen Gesellschaft nähern. Sie finden allerdings nur dort Gehör, wo die Gewissheiten des Alltags selbst zu verblassen beginnen, wo also ein Bedarf entstanden ist, die unversehens vor Augen tretenden Risiken der Zukunft zu minimieren. Um die Abhängigkeit gesellschaftlicher Entwicklungen von politischen Entscheidungen symbolisieren zu können, greifen Krisenbefunde auf Unterscheidungen zurück, denen ein Zeitbezug inhärent ist. Indem die eine Seite der Unterscheidung die Abweichung von der anderen Seite zum Ausdruck bringt, lässt sich die Möglichkeit der Transformation von Unordnung in Ordnung, d.h. die Herstellung von bzw. die Rückkehr zur gesellschaftlichen Einheit, in Aussicht stellen. In der Kontrastierung von Unordnung und Ordnung bestätigt sich die Letztere in ihrer Bedeutung für den Erhalt der Sozialität. Und so muss jeder Krisenbefund geradezu zwangsläufig in einem Appell münden: Seht her, was passiert, wenn wir nicht die Bedingungen jener Ordnung, in der wir leben, pflegen und hegen! Der Kunstgriff, der hier vollzogen wird, um einer Ordnungsvorstellung Plausibilität einzuverleiben, besteht darin, das Problem wohlweislich nicht als eigentliche Ursache, sondern als Symptom einer Störung auszuweisen. Denn wäre es ihre Ursache, bliebe noch die Frage zu klären, inwieweit die Ordnung nicht selbst daran beteiligt war, ihre eigenen Probleme hervorzubringen. In dem Moment, in dem man die Ordnung selbst als Grund eines Problems wahrnimmt, käme jeder Versuch der Problembehebung einer Revolution gleich. Wer aber von Krisen redet, der hat gerade nicht die Substitution der alten durch eine neue Ordnung im Sinn, der vertraut vielmehr auf die Errungenschaften des Bestehenden, die es lediglich im vollen Umfang auszuschöpfen und gegebenenfalls veränderten Umweltbedingungen anzupassen gilt. Erst dadurch, dass man das Problem zum Symptom einer Störung degradiert, eröffnen sich Möglichkeiten, es durch die Eliminierung von Fehlerquellen, also durch die Annäherung an das Ideal einer sozialen Ordnung, 9 mehr oder minder zu lösen. Nichts könnte dann näher liegen, als die Lösung des Arbeitslosenproblems der Arbeit selbst zukommen zu lassen: Was Arbeit schafft, ist sozial! Krisenbefunde enthüllen demnach nur vordergründig die innerhalb einer Gesellschaft bestehenden Probleme. Betrachtet man sich die sozialen Formen, anhand derer Krisen festgestellt werden, lässt sich erkennen, dass sie bereits ihre Lösungen anbieten. Krisenmanagement über Arbeit zu organisieren, ist keineswegs eine Erfindung unserer Zeit. Gerade der Blick in die Vergangenheit offenbart die lange Tradition, welche die Arbeit aufzuweisen hat, wenn es darum geht, Antworten auf soziale Krisen zu geben. Fast könnte man geneigt sein zu sagen, die Geschichte der Arbeit ist eine Geschichte ihrer Kompetenz, gesellschaftliche Krisen zu bewältigen bzw. ihnen zuvorzukommen. Bereits der biblische Mythos des Sündenfalls verortet die Arbeit in einem solchen Kontext. Seit seiner Vertreibung aus dem Paradies steht der Mensch vor der Aufgabe, in der irdischen Welt für seine Subsistenz selbst Sorge zu tragen und somit den Weg zurück zu Gott unter der Mühsal und dem Schmerz seiner Arbeit zu beschreiten (Gen. 3,17-19). Im ausgehenden Mittelalter wird die Verordnung von Arbeit zum Bestandteil einer Sanktionsgewalt, mit der sich die Obrigkeit Mittel an die Hand zu geben hofft, den im Überhandnehmen des Bettler- und Vagabundentums zum Ausdruck kommenden Auflösungstendenzen der ständischen Gesellschaftsordnung Einhalt zu gebieten. Der Müßiggang erscheint hier als das Sinnbild eines sittlichen Versagens jener Menschen, die sich von ihrer Berufung durch Gott abgewendet haben und die der Arbeit bedürfen, um wieder auf den Pfad der Tugend zurückzukehren. Im 17. und 18. Jahrhundert wird das Arbeitsgebot schließlich allein auf den Nutzen für den Staat bezogen. Einem Staat, dessen Mitglieder nicht zu arbeiten gewillt sind, kann es nicht anders als schlecht gehen. Um zukünftiges Unheil abzuwenden und die Wohlfahrt zu sichern bzw. zu mehren, wird diesem entsprechend die Autorität zugesprochen, prospektiv in das soziale Zusammenleben der Menschen einzugreifen. Bekanntlich waren es vor allem die Forderungen nach Arbeits- und Zuchthäusern, die zu jener Zeit als die geeigneten Mittel betrachtet wurden, um den unnutzen Personengruppen einer Gesellschaft Herr zu werden. Die Liste an historischen Fallbeispielen, in denen die Arbeit als Mittel des Krisenmanagements und der Müßiggang als das Übel in Erscheinung tritt, dessen sich eine Gesellschaft zu erwehren hat, ließe sich an dieser Stelle beliebig weiterführen. Immerzu sehen sich dabei die Müßiggänger dem Vorwurf ausgesetzt, ein Leben auf Kosten der Allgemeinheit zu führen und somit den moralischen Minimalkonsens einer Gesellschaft zu unterlaufen. Denn dieser scheint eben zu besagen: Jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich und darf nur in den Fällen auf die Solidarität der Gemeinschaft hoffen, in denen er von einem Schicksalsschlag heimgesucht wird, dem er sich nicht durch sein eigenes Handeln und freies Entscheiden zu entziehen vermag. Aber lässt sich aus dem Umstand der permanenten Wiederkehr bestimmter Argumentationsmuster zwangs10 läufig auch schließen, dass sich über den Zeitverlauf hinweg bei der Bewertung von Arbeit und Müßiggang wenig getan hat, dass sich die Geschichte ihres Verhältnisses zueinander als Wiederholung einer gleich bleibenden Perspektive darstellt, die lediglich im Lichte ihrer jeweiligen Zeit eine neue Schattierung erhält? Und wenn dies der Fall ist, lässt sich dann nicht im Umkehrschluss folgern, dass keine Gesellschaft ohne die Arbeit ihrer Mitglieder von Bestand sein kann, es dementsprechend durchaus berechtigt erscheint, Arbeit als den entscheidenden Integrationsmechanismus der Gesellschaft und – mit Karl Marx, Max Weber und Émile Durkheim – als die soziologische Schlüsselkategorie schlechthin zu begreifen? Eine Beantwortung dieser Fragen setzt zunächst ein genaueres Verständnis von dem voraus, was gemeint ist, wenn wir von Gesellschaft sprechen. Der Selbstverständlichkeit, mit der wir Tag für Tag auf den Begriff zurückgreifen, steht zumeist nur eine vage Vorstellung gegenüber, auf welche Weise wir an ihr teilhaben, um sie durch unser Verhalten am ‚Leben’ zu erhalten. Dass der Arbeit hierbei eine entscheidende Rolle zufällt, diese Vorstellung scheint gegenwärtig über jeden Zweifel erhaben zu sein. Aber auch hier ist es lohnend, sich vergangener Gesellschaftsbeschreibungen zu erinnern. So hätte die moderne Wertschätzung der Arbeit als sozialer Integrationsmechanismus bei den antiken Philosophen allenfalls ein ungläubiges Kopfschütteln ausgelöst, war man sich doch weitestgehend darüber einig, dass nicht das arbeitende, produktive Volk, nicht die Banausen, wie Aristoteles diese Personengruppe bezeichnete, sondern nur die Tugendhaften, von den Mühen und Qualen der Arbeit Entledigten sich für ein Leben in der societas civilis – der Gemeinschaft freier und gleicher Bürger – eigneten. Denn nur die Bürger, so lautete das Argument, befanden sich in einer Lage, die es ihnen erlaubte, ihr Handeln befreit von allen körperlichen Bedürfnissen in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.14 Freilich hat der Gesellschaftsbegriff, der hier zur Verwendung kommt, mit unserem heutigen nicht mehr all zu viel gemein. Aber gerade dieser Umstand lässt die Frage virulent werden, auf welche Weise sich das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft verändern musste, damit sich unsere moderne Gleichsetzung von Arbeit und Tugend auszubilden vermochte? Wie kann es sein, dass wir uns heute eine Gesellschaft, die nicht auf der Arbeitsteilung ihrer Mitglieder gründet, kaum mehr vorstellen können? Und weshalb erscheint uns Arbeit für den Erhalt einer Gesellschaft als unerlässlich? Allein wegen ihres Beitrages, die Bedürfnisse der Gesellschaftsmitglieder – der allgemeinen Ressourcenknappheit zum Trotze – zu befriedigen; allein also wegen ihrer Wirtschaftlichkeit und Produktivität? Und bedeutet diese Fokussierung auf Arbeit nicht auch, dass Verhaltensweisen, die nicht mit dem Prädikat der Arbeit versehen werden können, jenseits oder doch wenigstens am Rande der Gesellschaft stattfinden, also in Negation zur antiken Auffassung im eigentlichen Sinne gar nicht sozial sind? Was bleibt, ist dann das Problem: Was sind sie sonst? Sind sie tatsächlich lediglich 14 Vgl. ARISTOTELES: Politik. Zürich / München 2006, 1278 a7-a10. 11 Ausdruck eines Individualismus, der sich gegen das Gemeinwohl und die Interessen der Gesellschaft wendet? Wie dem auch sei, für die Soziologie jedenfalls stellt sich an diesem Punkt die entscheidende Frage, ob es ihren theoretischen Ansprüchen genügen kann, einem aus den besonderen historischen Konstellationen des 18. Jahrhunderts sich erklärenden ökonomischen Gesellschaftsbegriff zu folgen und sich damit in dem Spannungsverhältnis von Kollektivismus und Individualismus zu verorten; oder ob sie nicht vielmehr versuchen sollte, ihre Gesellschaftstheorie auf die Grundlage eines metahistorischen Begriffsapparats zu stellen, mit dem sich das Auftauchen verschiedener Formen der Gesellschaftsbeschreibung als historische Phänomene begreifen lässt, die selbst einem Wandel der Gesellschaftsstrukturen und der damit einhergehenden sozialen Teilhabemöglichkeiten geschuldet sind. Die Dissertation nimmt ihren Ausgang eben bei einem solchen theoretischen Anspruch. In Kapitel 1 – Zur allgemeinen Theorie sozialer Systeme sollen zunächst die begrifflichen Grundlagen einer systemtheoretisch argumentierenden Gesellschaftstheorie dargelegt werden. Die Systemtheorie Luhmann’scher Provenienz nimmt ihren Ausgang an der Frage, wie in Situationen der doppelten Kontingenz, in denen die an einer Interaktion beteiligten Bewusstseine wechselseitig nicht voneinander wissen, welches Verhalten von ihnen erwartet wird, Erwartungssicherheiten entstehen können. In diesem grundsätzlichen Problem einer jeden Interaktion erblickt Luhmann die Keimzelle der Autokatalyse sozialer Systeme. Soziale Systeme sind emergente Ordnungsgefüge, die unabhängig von den Wünschen, Hoffnungen und Zielen der einzelnen Akteure die Abfolge ihrer Operationen zu beschränken imstande sind. Dem systemtheoretischen Ansatz liegt dabei ein Gesellschaftsverständnis zugrunde, welches nicht in den Menschen und ihren Handlungen, sondern in den Kommunikationen und ihren rekursiven Vernetzungen die basalen Elemente des Sozialen erkennt. Aus dieser kommunikationstheoretischen Herangehensweise ergeben sich für die Fragestellungen der Dissertation folgende Konsequenzen: Erstens lässt sich der Mensch nicht mehr als das ursprüngliche Subjekt der Geschichte begreifen. Vielmehr gilt es die evolutionären Errungenschaften – Luhmann spricht in diesem Zusammenhang von Medien – herauszuarbeiten, auf die Kommunikationen zurückgreifen, um die Unwahrscheinlichkeit ihres Zustandekommens zu überwinden. Daraus resultiert zweitens, dass der Sinnzusammenhang, in dem etwas an einem bestimmten historischen Zeitpunkt wahrgenommen, interpretiert und als Realität erschaffen wird, als Selbst- und Fremdbeschreibung sozialer Systeme auszulegen ist. Das systemtheoretische Interesse an Geschichte erschöpft sich insofern nicht in der Rekonstruktion historischer Fakten und ihrer Implementierung in ein kulturelles Ganzes. Demgegenüber werden als bewahrenswert ausgezeichnete, zum wiederholten Gebrauch verwendbare Semantiken auf ihre Funktion hin befragt, die sie bei der Ausdifferenzierung sozialer Systeme übernehmen. Damit einher geht drittens ein Geschichtsverständnis, dass sich von der Vorstellung eines Kausalzusammenhangs suk12 zessiv fortschreitender Einzelereignisse verabschiedet. Geschichte wird vielmehr als ein Prozess soziokultureller Evolution verstanden, der von einer segmentär über eine stratifikatorisch hin zu einer funktional differenzierten Gesellschaft verläuft. In einem nächsten Schritt gilt es der Frage nachzugehen, ob sich mit dem Wandel der Gesellschaftsstrukturen auch die Modi verändern, über die Personen inkludiert bzw. exkludiert werden. Niklas Luhmann zufolge regulieren stratifizierte Gesellschaften Exklusion über ihre ökonomischen Haushalte.15 In solchen ‚Überlebensgemeinschaften’ wissen sich die ihm zugehörigen Personen über wechselseitige Rechte und Pflichten aneinander gebunden. Exklusion erfolgt also dort, wo es zu einer Unterbrechung des Verhaltensprinzips der Reziprozität kommt. Die Dissertation greift diese These Luhmanns auf und unterwirft sie einer näheren Analyse. Kapitel 2 – Reziprozität. Ein sozialintegrativer Mechanismus der Gesellschaft? erörtert dementsprechend, welche gesellschaftsstabilisierenden Wirkungen der Norm der Reziprozität in der Soziologie im Allgemeinen und bei Niklas Luhmann im Speziellen zugeschrieben werden. Während weite Teile der soziologischen Theorie in der Reziprozität ein universalhistorisches Verhaltensprinzip erblicken, das sich für die Ausdifferenzierung sozialer Strukturen und interpersonaler Beziehungen verantwortlich zeichnet, stellt es sich bei Luhmann als ein historischer Sonderfall der Lösung des Problems der doppelten Kontingenz dar, der im Übergang zu funktional differenzierten Gesellschaften an Bedeutung verliert. Entgegen einer allen Teilsystemen immanenten Grundsymbolik der Religion und Moral, wie sie insbesondere in dem mittelalterlichen Ordo-Gedanke fundiert war, beginnen sich Sozialsysteme auszudifferenzieren, welche die Teilhabe an ihren systeminternen Operationen über komplementäre Leistungs- und Publikumsrollen organisieren. Nahezu zeitgleich mit diesem Wandel der Gesellschaftsstrukturen findet sich in den zeitgenössischen Gesellschaftsbeschreibungen immer häufiger das Problem thematisiert, worauf Erwartungen im wechselseitigen Miteinander überhaupt noch zu gründen vermögen, wenn sie ihren Ausgang unabweislich in der Subjektivität der Akteure nehmen. Eins scheint zu diesem Zeitpunkt sozialer Evolution gewiss: Die Gesellschaft ist viel zu komplex geworden, um die Konditionen der Sozialordnung in einem Codex moralischer und religiöser Gebote festzuschreiben, deren Kontrolle man den Interaktionen zwischen den Haushaltsangehörigen überlassen könnte. Historisch betrachtet hat sich das Problem, wie soziale Ordnung möglich ist, an zwei zentralen Fragestellungen entzündet, nämliche erstens: Wie lässt sich ein Konsens zwischen Personen garantieren, obwohl diese je für sich als Individuen existieren? Und zweitens: Inwiefern können dem Individuum in seinem Verhalten Freiheiten zugestanden werden, wenn die Ordnung zeitlich von Bestand sein soll? Diese beiden seit jeher aktuellen Probleme sozialer Ordnung haben in der Soziologie zu einer Kontroverse zwischen zwei vermeintlich diametral gegenüberstehenden La15 Vgl. LUHMANN, Inklusion und Exklusion (wie Anm. 12), S. 243. 13 gern geführt. Der Streitpunkt scheint dabei in der Frage zu liegen, ob sich das Verhaltensprinzip der Reziprozität auf kulturell tradierten, ordnungskonformes Verhalten prädisponierenden Strukturen gründet oder ob es sich der Vernunftbegabung der Individuen verdankt, die in der Wechselseitigkeit von Leistungen eine Möglichkeit erkennen, aus der Interaktion einen Nutzen für sich selbst zu ziehen, ohne dabei Gefahr zu laufen, einen Konflikt heraufzubeschwören. Kapitel 3 – Die Ordnung der Gesellschaft zielt nun keineswegs darauf ab, das Pro und Contra subjektivistischer und objektivistischer Gesellschaftstheorien abzuwägen und Stellung für die eine oder andere Seite zu beziehen. Es nimmt vielmehr eine historische Perspektive ein, die den Zusammenhang zwischen der soziokulturellen Evolution der Gesellschaft und dem Wandel von Reziprozitätssemantiken nachzuzeichnen versucht. Bleibt die Art und Weise, wie eine Gesellschaft ihre Inklusion und Exklusion organisiert, unverändert, je nachdem ob ein Individuum als Person an dem Strukturzusammenhang einer natürlich-korporativen Einheit oder an einem zweckmäßigen Zusammenschluss teilhat? Und was bedeutet es für das Verständnis sozialer Ordnung, wenn man die interpersonalen Beziehungen nicht mehr durch Liebe und Freundschaft, sondern durch Interessen strukturiert begreift? Das anschließende Kapitel 4 – Das Interaktionssystem der personalen Hilfe nimmt jene Menschen in den Blick, die sich außerstande sehen, dem Verhaltensprinzip der Reziprozität gerecht zu werden. Gehören sie überhaupt noch zur Gesellschaft? Und wenn ja, auf welche Weise werden sie in die Gesellschaft inkludiert? Um diese Fragen beantworten zu können, lässt sich die Dissertation auf das Vorhaben ein, den Bettler als Gegenstand soziologischen Fragens neu zu erschließen. Im Zentrum steht dabei die These, dass wir es bei der sozialen Beziehung zwischen dem Bettler und Almosengeber mit einem auf Interaktionen basierenden sozialen System zu tun haben. Die theoretischen Referenzen soziales System auf der einen und Interaktionen auf der anderen Seite sollen als Ansatzpunkte dienen, um die historischen Wandlungsprozesse in der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Bettlers zu rekonstruieren. Soziologisch aufschlussreich ist das Interaktionssystem der personalen Hilfe insbesondere deshalb, weil sich in ihm Rollenmuster angelegt finden, die den Geber und Nehmer des Almosens in ihrer Komplementarität erfassen. Es zeigt damit das auch anders Mögliche einer an reziproken Rechten und Pflichten orientierten Gesellschaftsordnung an, in der jeder als Angehöriger einer Schicht dem anderen das Seinige schuldet. Gerade durch diese rechtlichen Leerstellen, die der Bettler in der ständischen Sozialordnung besetzte, fielen dem politischen System Möglichkeiten zu, sich positiv in Abgrenzung zu den Herrschaftsverhältnissen der ökonomischen Hausgemeinschaften in seiner Funktion kollektiv bindender Entscheidungen zu beschreiben und Ämter mit der Aufgabe zu betrauen, ihre Durchsetzung zu gewährleisten. Aus dieser Perspektive heraus betrachtet hat der Bettler eine nicht unbedeutende 14 Rolle bei der Ausdifferenzierung und funktionalen Diversifikation des politischen Systems im Übergang zur modernen Gesellschaft gespielt. Kapitel 5 – Der Fremdheitstypus des Peripheren fasst die Grundthesen der Dissertation noch einmal zusammen und versucht sie für eine Fremdheitstypologie der Frühen Neuzeit fruchtbar zu machen. Zu diesem Zweck greift die Dissertation auf die von Rudolf Stichweh in den wissenschaftlichen Diskurs eingebrachte Figur des ‚Peripheren’ zurück, mit der Personengruppen ins Blickfeld geraten, die durch einen Verlust ihres ursprünglichen Sozialstatus gekennzeichnet sind.16 16 Vgl. STICHWEH, Rudolf: Fremde im Europa der frühen Neuzeit. In: BOHN, Cornelia / WILLEMS, Herbert (Hg.): Sinngeneratoren. Fremdund Selbstthematisierung in soziologisch-historischer Perspektive. Konstanz 2001, S. 17-33. 15 1. Zur allgemeinen Theorie sozialer Systeme 1.1 Einführende Bemerkungen zum soziologischen Systembegriff Der Systembegriff freilich ist keine Schöpfung der Gesellschaftstheorie Luhmann’scher Provenienz. Wurde der Terminus in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts fast ausschließlich von Biologen und Ökologen verwendet, so lässt sich in seiner Entwicklung seit den 1950er Jahren bis heute beobachten, wie er schließlich in fast allen Wissenschaftsdisziplinen (Physik, Psychologie, Pädagogik, Kybernetik, Medizin etc.) in mehr oder minder abgewandelter Form Eingang gefunden hat. Unter System wird dabei ganz allgemein zumeist ein zusammengesetztes Ganzes verstanden, das die Summe seiner Teile umfasst und diese gleichzeitig zu einer höherstufigen, emergenten Einheit integriert. Der Systembegriff rekurriert somit auf eine Ganzheit, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Die Wurzeln dieses Bedeutungsinhaltes reichen bis in die antike Philosophie und ihrem Gebrauch des Wortes systema (‚das Zusammengesetzte’) zurück.17 Im Gemeinschaftsverständnis der antiken Philosophie, insbesondere der koinonía politike, finden sich mithin auch die ersten Ansätze, das Soziale als ein System wechselseitig aufeinander abgestimmter Verhaltensweisen gleicher und freier Bürger zu begreifen. Im Verlaufe seiner Genese hat der Begriff dabei ganz unterschiedliche Konnotationen angenommen, die mal mehr die Geschlossenheit, mal mehr die Offenheit des Systems gegenüber seiner Umwelt betonen. Diese analytische Differenzierung offener und geschlossener Systeme wurde explizit von dem Biologen Ludwig von Bertalanffy ins Leben gerufen. Er wies darauf hin, dass im Gegensatz zu geschlossenen Systemen, die ihre Strukturen allein über die Wechselwirkungen ihrer Elemente aufrecht erhalten, offene Systeme auf einen energetischen Austauschprozess mit ihrer Umwelt angewiesen sind. Offene Systeme zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, ihre Strukturen dynamisch systemexternen Veränderungen anzupassen, um auf diese Weise einen Zustand der Homöostase mit ihrer Umwelt zu erreichen. Seit dem 17. Jahrhundert finden sich solche Vorstellungen vor allem im Kontext einer europäischen Außenpolitik akzentuiert, die auf eine Machtbalance und einen Interessenausgleich zwischen den einzelnen Staaten baut. Eine sehr beliebte Metapher, die zur Beschreibung geschlossener Systemzusammenhänge seit alters her herangezogen wird, ist dahingegen die des Organismus, der seiner einzelnen Organe mit ihren jeweiligen Funktionen bedarf, um sich am Leben zu erhalten. 17 Zur allgemeinen Geschichte des Systembegriffs vgl. RIEDEL, Manfred: System, Struktur. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 6. Stuttgart 1990, S. 285-322; STEIN, Alois von der: Der Systembegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung. In: DIEMER, Alwin (Hg.): System und Klassifikation in Wissenschaft und Dokumentation. Meisenheim am Glan 1968, S. 1-13. 16 Der Systembegriff weist folglich eine Tradition auf, welche die Grenzen der soziologischen Disziplin auf vielerlei Ebenen überschreitet. Innerhalb der Soziologie nimmt er den Rang eines Grundbegriffs ein, der „zur Analyse der Wechselwirkungen aufeinander bezogenen (interdependenten) Handelns mehrer Individuen, Gruppen oder Organisationen“18 verwendet wird. Nun scheint es aber gerade in der Natur von soziologischen Grundbegriffen zu liegen, dass sich zwar eine Reihe von Autoren ihrer häufig bedienen, dass aber allein die Häufigkeit ihres Auftretens keineswegs auch einen Konsens darüber indiziert, was sich mit ihnen bezeichnen lässt.19 Gerade in der Vieldeutigkeit, die dem Begriff des sozialen Systems innewohnt, kommt dies nachdrücklich zum Ausdruck. Seine Prominenz in der Soziologie verdankt er insbesondere Talcott Parsons. Unter System verstand dieser generell, „erstens einen Komplex von Interdependenzen zwischen Teilen, Komponenten und Prozessen mit erkennbaren regelmäßigen Beziehungen, und zweitens eine entsprechende Interdependenz zwischen einem solchen Komplex und seiner Umgebung.“20 Nach Parsons hat eine Theorie sozialer Systeme somit zum einen zu klären, welche Austauschbeziehungen innerhalb einer Interaktion daran beteiligt sind, Strukturen relativ stabilen Rollenverhaltens hervorzubringen. Die Aufgabe, die aus diesem Vorhaben erwuchs, bestand darin, den Wechselwirkungen zwischen dem intentionalen Handeln der Akteure einerseits und ihren überindividuellen normativen Orientierungen andererseits nachzugehen.21 Zum anderen stand die Frage nach der Funktion im Raum, die das soziale System als Ganzes für seine Umwelt erfüllt. Parsons geht dabei von der These aus, dass ein System aufgrund seiner Offenheit gegenüber den Interpenetrationen anderer Systeme, von deren Leistungen es abhängt oder deren Störungen es erfährt, mit diesen ein stabiles Gleichgewichtsverhältnis aufbauen kann. Soziale Systeme stehen insofern immer auch in einer Beziehung zum organischen System mit seinen körperlichen Bedürfnissen und Trieben, zum personalen System mit seinen individuellen Aspirationen und schließlich zum kulturellen System mit seinen Wertmustern. Auf beiden Beschreibungsebenen, die Parsons heranzieht, um das soziale System näher zu explizieren, geht es letztlich also um die Frage, unter welchen Bedingungen es seine Strukturen zu reproduzieren vermag. Auf dieses 18 19 20 21 HILLMANN, Karl-Heinz Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart 1994, S. 857. Bereits der französische Soziologe Émile Durkheim hat dabei auf den Emergenzcharakter solcher Wechselwirkungen hingewiesen. Nach Durkheim ist die Gesellschaft „nicht bloß eine Summe von Individuen, sondern das durch deren Verbindung gebildete System stellt eine spezifische Realität dar, die einen eigenen Charakter hat.“ DURKHEIM, Émile: Die Regeln der soziologischen Methode. Frankfurt (Main) 1984, S. 187. In Anlehnung an Thomas S. Kuhn könnte man fast behaupten, die Soziologie befinde sich in einer dauerhaften ‚Krise’, auf der steten Suche nach jenem ‚Paradigma’, das sich für die Beschreibung des Sozialen am Besten eignet. Vgl. KUHN, Thomas S.: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt (Main) 1981. PARSONS, Talcott: Zur Theorie sozialer Systeme. Opladen 1976, S. 275. In einem ähnlichen Verwendungskontext hat Rolf Sprandel versucht, den Begriff des sozialen Systems insbesondere im Hinblick auf den Wandel von Mentalitäten für die Geschichtswissenschaft fruchtbar zu machen. So heißt es bei ihm: „Ein soziales System bildet [...] eine Reihe von Normen menschlichen Verhaltens und Vorstellens, die eine Gesamtheit bilden, welche insofern notwendig ist, als ohne diese Gesamtheit keine der Normen existent wäre. Es folgt aus dieser Definition, daß es kein System gibt, ohne Menschen, die zu ihm gehören und die es tragen.“ SPRANDEL, Rolf: Mentalitäten und Systeme. Neue Zugänge zur mittelalterlichen Geschichte. Stuttgart 1972, S. 113. 17 Grundproblem sozialer Ordnung hat Parsons bekanntlich mit der Ausarbeitung seines berühmten AGIL-Schemas reagiert, mit dem er jene obligatorischen Grundfunktionen benennt, die in einem Handlungssystem verwirklicht sein müssen, damit es von Bestand sein kann.22 Die spezifische Fassung, die Niklas Luhmann dem Begriff des sozialen Systems verleiht, versteht sich als bewusste Kritik und Weiterentwicklung der Systemtheorie Talcott Parsons. Luhmann distanziert sich dabei ausdrücklich von der Vorstellung, bei dem Gesellschaftssystem handele es sich um eine Agglomeration der mehr oder weniger offenen, über Austauschbeziehungen miteinander verbundenen sozialen Systeme ‚societal community’, ‚Kultur’‚ ‚Politik’ und ‚Wirtschaft’.23 Insbesondere lehnt er die auf der Grundlage eines solchen Modells entwickelte pyramidal aufgebaute ‚Integrationshierarchie’ ab, die in jenem obersten System gipfelt, das über die Kapazität verfügt, alle Subsysteme zu einem homogenen Ganzen zusammenzufügen. Gegenüber diesem holistischen Systemverständnis vertritt Luhmann eine strikt differenztheoretische Perspektive, die in der System/Umwelt-Differenz die konstitutive Bedingung der Ausdifferenzierung sozialer Systeme erblickt.24 Als Ausgangspunkt dient ihm nicht eine Einheit, die sich analytisch in verschiedene Elemente und Funktionen zerlegen lässt, sondern eine Differenz, die – wie auch immer man versucht, sie zu dekomponieren – stets auf die Gleichzeitigkeit von System und Umwelt verweist. Die Frage, welche Funktionen innerhalb eines Systems erfüllt sein müssen, damit es seine Stabilität bewahren kann, wird somit durch die konstruktivistische Problemstellung abgelöst, über welche Operationen es ihm gelingt, seine eigene Identität in Differenz zu seiner Umwelt zu produzieren und zu reproduzieren. Luhmann spricht der Systemtheorie damit nicht nur eine rein analytische Relevanz zu, ihre eigentliche Aufgabe sieht er vielmehr darin, eine soziale Realität zu beschreiben, in der Systeme tatsächlich vorzufinden sind.25 Systemtheoretische Betrachtungsweisen, die in einem ersten Schritt die beiden Seiten der System/Umwelt-Differenz analytisch je für sich als distinkte Untersuchungsobjekte in den Blick nehmen, um in einem zweiten Schritt jene Wechselwirkungsbeziehungen offen zu legen, die das System und die Umwelt (bzw. ein System 22 23 24 25 Jene Grundfunktionen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Ein System muss erstens zur Anpassung (‚Adaption’) an seine Umwelt imstande sein, es muss zweitens ein Ziel formulieren, dem seine Handlungselemente verpflichtet sind (‚Goal-Attainment’), drittens bedarf es einer wechselseitigen Abstimmung seiner Systemelemente (‚Integration’), und viertens muss es schließlich über Institutionen und Ordnungsmuster verfügen, die der inneren Strukturerhaltung dienen (‚Latent Pattern Maintenance’). Zur Kritik am AGIL-Schema vgl. LUHMANN, Niklas: Warum AGIL? In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 40 (1988), S. 127-139. So heißt es bei Parsons: „Eine Gesellschaft muss eine gesellschaftliche Gemeinschaft konstituieren, welche sich durch ein adäquates Maß an Integration oder Solidarität und einen besonderen Mitglieds-Status auszeichnet. [...] Diese Gemeinschaft muss der ‚Träger’ eines kulturellen Systems sein, das ausreichend verallgemeinert und integriert ist, um die normative Ordnung zu legitimieren. [...] Hinsichtlich der Mitglieder als Individuen erfordert die gesellschaftliche Selbständigkeit [...] eine adäquate Kontrolle über die Motivationen. [...] Und schließlich impliziert die Selbständigkeit die adäquate Kontrolle über den ökonomisch-technologischen Komplex, so dass das physische Milieu zweckvoll und ausgeglichen als Quelle von Ressourcen genutzt werden kann.“ PARSONS, Talcott: Gesellschaften. Evolutionäre und komparative Perspektiven. Frankfurt (Main) 1986, S. 32 f. Vgl. dazu vor allem LUHMANN, Niklas: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt (Main) 1984, S. 34 ff. Vgl. ebd., S. 30. 18 der Umwelt) voneinander abhängig machen, verfehlen somit ihren eigentlichen Gegenstand. Denn, wie er es einmal in einer für ihn typisch paradoxen Manier formuliert hat: „Ein System ‚ist’ die Differenz zwischen System und Umwelt.“26 Dem Was (ein System ist) wird hier ein Wie (es sich konstituiert), der Frage nach dem Wesen des Systems die nach seinem Modus Operandi gegenübergestellt. Systembildung erfolgt über die Etablierung und Stabilisierung einer Differenz von Innen und Außen, deren Verhältnis zueinander durch ein Komplexitätsgefälle gekennzeichnet ist, insofern sich das Außen stets komplexer als das Innen darstellt. Systeme stehen also unentwegt vor der Aufgabe, durch die Reduzierung dessen, was an Ereignissen innerhalb ihrer Grenzen vorzukommen vermag, eine Eigenkomplexität aufzubauen, die sich gegenüber dem indifferent verhält, was ansonsten noch in der Welt möglich ist. Dabei bilden sowohl psychische als auch soziale Systeme „ihre Operationen als beobachtende Operationen aus, die es ermöglichen, das System selbst von seiner Umwelt zu unterscheiden – und dies obwohl (und wir müssen hinzufügen: weil) die Operation nur im System stattfinden kann. Sie unterscheiden, anders gesagt, Selbstreferenz und Fremdreferenz. Für sie sind Grenzen daher keine materiellen Artefakte, sondern Formen mit zwei Seiten. Abstrakt gesehen handelt es sich dabei um einen ‚re-entry’ einer Unterscheidung in das durch sie Unterschiedene. Die Differenz System/Umwelt kommt zweimal vor: als durch das System produzierter Unterschied und als im System beobachteter Unterschied.“27 Mit dieser differenztheoretischen Herangehensweise entgeht Luhmann zum einen dem theoretischen Problem Parsons, als außenstehender Beobachter den Zeitpunkt diagnostizieren zu müssen, ab wann Veränderungen der Umwelt das System dazu veranlassen, seine Strukturen neu auszurichten. Diese Frage nach dem Wandel der Systemidentität überlässt er stattdessen den Selbstbeschreibungen des Systems. Indem Luhmann zum anderen Systeme als rekursive Vernetzungen aufeinander Bezug nehmender Operationen begreift, verlagert er die genuin systemtheoretische Problemstellung, unter welchen Bedingungen Systeme ihren Bestand erhalten können, auf die Frage, auf welche Weise sie sich in die Lage versetzen, ihre Anschlussmöglichkeiten zu reduzieren und damit eine Differenz zur Umwelt zu konstituieren. Mit diesem Paradigmenwechsel gewinnt er die Möglichkeit, dem permanenten Zerfall der Systemelemente – von Gedanken und Kommunikationen – wie auch ihrer unaufhörlichen Reproduktion begrifflich gerecht zu werden. Die Theorie sozialer Systeme, die Luhmann im Sinn hat, ist demnach eine Theorie selbstreferentieller, autopoietischer Systeme. Im Weiteren soll nun genauer gezeigt werden, wie es sozialen Systemen gelingt, emergente Ordnungsniveaus hervorzubringen, die sich nicht aus den Leistungen ihrer Umwelt heraus erklären lassen. Im weitaus stärkeren Maße als Parsons betont Luhmann dabei die un- 26 27 LUHMANN, Niklas: Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg 2004, S. 66. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 45. 19 überbrückbare Differenz des Sozialen vom Psychischen und Lebendigen, was sich in seiner theoretischen Nomenklatur widerspiegelt, die fast gänzlich auf Begrifflichkeiten wie Handlungsziele, Bedürfnisse und Triebe etc. verzichtet. 1.2 Die Autokatalyse sozialer Systeme 1.2.1 Das Problem der doppelten Kontingenz Die Ausdifferenzierung sozialer Systeme setzt als Ausgangslage eine Situation der doppelten Kontingenz voraus. Eine solche Situation ist immer dort gegeben, wo sich mindestens zwei Bewusstseinssysteme als ‚Ego’ und ‚Alter’ gegenüberstehen. Diese Unterscheidung von Ego und Alter meint mehr als eine reine raumzeitliche Kopräsenz. Sie umschreibt das Resultat von Zuschreibungsprozessen, innerhalb derer sich die Interaktionspartner Erwartungen unterstellen und damit wechselseitig als handlungsrelevant wahrnehmen. Ursprünglich geht der Terminus der doppelten Kontingenz auf Talcott Parsons zurück, der ihn zum Zwecke der Analyse von Interaktionssystemen einführte. „The crucial reference points for analyzing interaction are two: (1) that each actor is both acting agent and object of orientation both to himself and to the others; and (2) that, as acting agent, he orients to himself and to others and, as object, has meaning to himself and to others, in all of the primary modes or aspects. [...] From these premises derives the fundamental proposition of the double contingency of interaction. Not only, as for isolated behaving units, animal or human, is a goal outcome contingent on sucessfull cognition and manipulation of environmental objects by the actors, but since the most important objects involved in interaction act too, it is also contingent on their action or intervention in the course of events.“28 Nach Parsons gründet der Erfolg einer Interaktion, in der Ego wie auch Alter den Vollzug seiner Handlungen von den Handlungen des jeweils Anderen abhängig macht, auf der Komplementarität von Erwartungshaltungen und Verhaltensweisen. Nur dann, wenn sowohl Egos Erwartungen und Bedürfnisse sich in den Verhaltensweisen Alters als auch gleichzeitig Alters Erwartungen und Bedürfnisse sich in den Verhaltensweisen Egos realisiert finden, nur dann also, wenn eine Sequenz sich komplementierender Verhaltensweisen vorliegt, sind die Voraussetzungen für den Aufbau eines relativ stabilen Ordnungsgefüges, eines sozialen Systems, gegeben. Damit alle Seiten mit einiger Sicherheit erwarten können, wie der Andere handelt und was bezüglich der eigenen Handlungen erwartet wird, ist es Parsons zufolge unerlässlich, dass die an der Interaktion beteiligten Personen über intersubjektiv geteilte Werte verfügen, die sie in ihrem Handeln und Wollen normativ bin28 PARSONS, Talcott: Social Interaction. In: SILLS, David L. (Hg.): International Encyclopedia of the Social Sciences. Bd. 7. New York 1968, S. 429-441, hier S. 436. 20 den.29 Es ist also nicht das soziale System an sich, sondern dieser im Persönlichkeitssystem der jeweiligen Interaktionspartner durch Erziehung und Sozialisation implementierte Werte- und Normenkonsens, über den sich das Problem der doppelten Kontingenz bei Parsons löst. Niklas Luhmann schließt sich zwar der von Parsons diagnostizierten Instabilität sozialer Interaktionen an, seine eigene Interpretation entfaltet er jedoch entlang zweier Kritikpunkte: (1) der Verwendung des Begriffs ‚contingency’ als ‚Abhängigkeit von’, und (2) der vorgesehenen Möglichkeit, das Problem der doppelten Kontingenz durch normative Bindungen im Subjekt selbst zu lösen.30 Im Weiteren gilt es zunächst kurz zu erläutern, welche Bedeutung Luhmann dem Begriff der Kontingenz beimisst, um dann im nächsten Abschnitt dieses Kapitels ausführlicher auf die zweite Frage einzugehen, weshalb erst die Ausdifferenzierung sozialer Systeme einen Umgang mit Kontingenz erlauben. Luhmann leitet das Problem der doppelten Kontingenz aus der operativen Geschlossenheit psychischer Systeme ab. Auf Grund ihrer Unmöglichkeit, die Gedanken des jeweils anderen Bewusstseins zu denken, bleiben die Interaktionspartner prinzipiell füreinander intransparent. Weder sind sie in der Lage, in die Gedankenwelt eines anderen Bewusstseins vorzudringen, noch das ihnen zugemutete Verhalten zu prognostizieren, geschweige denn das Verhalten ihres Gegenübers durch eigenes Handeln zu kontrollieren. In einer solchen Konstellation, in der die jeweils eine Seite von der anderen weiß, dass sie nicht wissen kann, welches Verhalten von ihr erwartet wird, in der sich psychische Systeme also wechselseitig als ‚black-boxes’ wahrnehmen, setzen Techniken ein, die auf eine Reduzierung der Unbestimmtheit des eigenen Handelns und Erlebens abzielen. Der Ausgangspunkt dieses Vorgangs liegt in einem Perspektivenwechsel, der sich zwischen Ego und Alter einstellt: Ego macht das (wenngleich nur imaginierte) Erleben Alters zur Grundlage seines eigenen Handelns und nimmt gleichzeitig Alter als ein alter Ego wahr, das auf ähnliche Weise versucht, Erwartungsunsicherheit im wechselseitigen Umgang zu absorbieren. Die Antizipation des Erlebens des Anderen im Sinne des Mead’schen taking the role of the other lässt dabei aber nicht nur das Verhalten des Gegenübers, sondern auch das eigene Verhalten als kontingent erscheinen. „Kontingent ist etwas“, so Niklas Luhmann, „was weder notwendig noch unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist. Der Begriff bezeichnet mithin Gegebenes (Erfahrenes, Erwartetes, Gedachtes, Phantasiertes) im Hinblick auf mögliches Anderssein; er bezeichnet Gegenstände im Horizont möglicher Abwandlungen. Er setzt die gegebene Welt voraus, bezeichnet also nicht das Mögliche überhaupt, son29 30 Vgl. ebd., S. 437. Vgl. LUHMANN, Niklas: Vorbemerkungen zu einer Theorie sozialer Systeme. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen 1981, S. 11-24, hier S. 13 f. Einen Vergleich der theoretischen Implikationen des Begriffs bei Parsons und Luhmann leistet der Aufsatz von VANDERSTRAETEN, Raf: Parsons, Luhmann and the Theorem of Double Contingency. In: Journal of Classical Sociology 2 (2002), S. 77-92. 21 dern das, was von der Realität aus gesehen anders möglich ist.“31 Kontingenz darf an dieser Stelle also keineswegs mit Zufälligkeit oder Beliebigkeit übersetzt werden. Verhaltensweisen werden als kontingent wahrgenommen, wenn Ego erkennt, dass einerseits Alters Handeln sich an dem Versuch orientiert, Egos Erwartungen gerecht zu werden, und andererseits seine eigenen Handlungen ihren eigentlichen Sinn erst im Lichte des Erwartens Alters eingeschrieben bekommen. Unter solchen Bedingungen tritt offenkundig zum Vorschein, dass jeder sich auch anders hätte verhalten können, als er es tat. Bei der Luhmann’schen Betrachtungsweise des Problems der doppelten Kontingenz stehen demnach nicht so sehr die wechselseitigen Leistungen im Vordergrund, die sich Alter und Ego erbringen müssen, um ihre Erwartungen zu erfüllen und das soziale System in seinem Bestand zu bewahren. Ihm geht es mehr darum, zu zeigen, wie im Nacheinander so-oderanders-möglicher Verhaltensweisen überhaupt erst soziale Erwartungen kondensieren können, die ihrerseits an der Reduzierung und dem Aufbau einer systeminternen Komplexität beteiligt sind. Um die unbestimmte Komplexität einer Situation der doppelten Kontingenz, die sich in dem zirkulären Verhältnis von „Ich tue, was du willst, wenn du tust, was ich will“32 äußert, in eine strukturierte Komplexität mit bestimmbaren Verhaltensanschlüssen zu transformieren, müssen in der Interaktion soziale Adressen sichtbar sein, über die Respezifikationen des Verhaltens Egos und Alters – und zwar unabhängig von den beteiligten psychischen Systemen – abgewickelt werden können. Die Ausdifferenzierung sozialer Systeme hängt also davon ab, inwieweit es diesen gelingt, durch den Ausschluss bestimmter Verhaltensmöglichkeiten vorgesehene Anschlüsse innerhalb des Systems kenntlich zu machen. 1.2.2 Die Emergenz sozialer Systeme Das Problem der doppelten Kontingenz stellt sich auf der Ebene psychischer Systeme. In ihrem wechselseitigen Wahrnehmen erleben sie nicht nur ihr eigenes Verhalten, sondern auch das ihrer Interaktionspartner als kontingent. Luhmann geht nun davon aus, dass sich diese doppelte Unbestimmtheit des Verhaltens durch die psychischen Systeme selbst nicht lösen lässt. Handlungstheoretische Erklärungsversuche bleiben seines Erachtens dem grundsätzlichen Problem verhaftet, darlegen zu müssen, wie Ego und Alter gemeinsam allein über den Rückbezug auf ihre eigenen Erfahrungen zu aufeinander abgestimmten Urteilen über die Welt des jeweils Anderen kommen können. In dieser für die soziologische Theorie grundlegenden Frage nach den Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit Verhaltensweisen erwartet werden können, beschreitet Luhmann 31 32 LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 152. Ebd., S. 166. 22 nun einen Weg, der nicht vom einzelnen Handlungssubjekt ausgeht. Die Lösung des Problems der doppelten Kontingenz erfolgt Luhmann zufolge vielmehr über die Konstituierung eines Systems eigenen Typs, dessen Emergenz sich nicht vom Psychischen her begreifen lässt. Während Parsons noch die Möglichkeit vorsieht, dass die Erwartungen der psychischen Systeme in die Interaktion einfließen, diese strukturieren, um sich letztlich dort wechselseitig zu befriedigen, geht Luhmann von einer unüberbrückbaren Differenz zwischen dem Sozialen und dem Psychischen aus. Welche Erwartungen die psychischen Systeme auch immer in die Interaktion investieren, diese sind strikt von jenen zu unterscheiden, die in den sozialen Systemen kondensieren. Der Erwartungsbegriff wird hier also nicht exklusiv zur Beschreibung individueller Motivationen herangezogen. Auch soziale Systeme müssen Erwartungen ausbilden, um eine Verhaltenskoordination ermöglichen zu können. Aber wie sind sie dazu imstande, ohne dabei die Leistungen des Individuums in Anspruch zu nehmen? Und worin liegt eigentlich der analytische Gewinn des Begriffs selbst begründet? Was ist mit ihm gemeint? Erwartungen sind von Grund auf fragil, da sie immer schon die Aussicht auf Enttäuschungen beinhalten. Dort, wo sie sich bemerkbar machen, sind sie bereits mit der Notwendigkeit belastet, Erwartungsenttäuschungen mit einzuplanen. Aber in dieser Brisanz des Erwartens wurzelt zugleich auch ihr analytisches Potential. Denn gerade weil sie offen sind für Ereignisse, die sich nicht wie angenommen einstellen, gerade weil sie sich stets aufs Neue bewähren müssen, weisen sie einen außergewöhnlichen Grad an Reflexivität auf. Bei jeder Erwartung schwingt immer auch die Frage mit, auf welche Grundlage eine spezifische Annahme gestellt werden kann und ab wann sie Gefahr läuft, zu kurz zu greifen. Lässt sich von einem Stein, den man in der Hand mit sich herumträgt, ohne Ausnahme erwarten, dass er zu Boden fällt, sobald man ihn loslässt? Und wenn dies nicht der Fall ist, unter welchen Voraussetzungen kann sich eine solche Erwartung erfüllen? Was bedeutet es aber dann, wenn eben diese Voraussetzungen nicht gegeben sind? Erwartungen generalisieren Erfahrungen, indem sie ein Wissen, das sich aus vergangenen Situationen speist, in die Zukunft projizieren. Sie koordinieren und beschränken die Ungewissheit der Zukunft im Hinblick auf eine zurückliegende, aber als vertraut erachtete Vergangenheit. Sie eröffnen ganz spezifische, selektive Sichtweisen der Welt, die gerade das zu eliminieren versuchen, was der Erwartung in ihrem Anspruch, die Zukunft in die Gegenwart einzuholen, zuwiderlaufen könnte. Oder positiv gewendet: Erwartungen sind in einer Welt des auch anders Möglichen Garanten für Konstanz und Kontinuität. Ihnen kommt dementsprechend eine Doppelfunktion zu: Sie beschränken den Raum des Möglichen, indem sie das Erwartbare von dem auch sonst noch Denkbaren abgrenzen, und sie verhelfen zu einem Analogismus, über den sich sachliche, zeitliche und soziale Diskontinuitäten überbrücken lassen.33 Aufgrund ihrer Gravitation kann man auf der Erde im 33 Vgl. ebd., S. 140. 23 Gegensatz zum Weltraum damit rechnen, dass ein Stein unabhängig von seiner jeweiligen Beschaffenheit, dem Zeitpunkt und der Person, aus dessen Händen er gleitet, zu Boden fällt. Sobald man nun beginnt, das Erwarten nicht an Dingen, sondern an Personen zu orientieren, die ihren Zugang zur Welt selbst über Erwartungen strukturieren, nimmt es eine besondere Qualität an. Es geht dann darum, dass ein Erwarten „sich selbst als erwartend erwartet weiß. Nur so kann das Erwarten ein soziales Feld mit mehr als einem Teilnehmer ordnen. Ego muß erwarten können, was Alter von ihm erwartet, um sein eigenes Erwarten und Verhalten mit den Erwartungen des anderen abstimmen zu können. Wenn Reflexivität des Erwartens gesichert ist, und nur dann, kann auch Selbstkontrolle sich ihrer bedienen.“34 Respezifikationen des Verhaltens in der Interaktion setzen also voraus, dass einerseits Ego nicht nur ein Verhalten von Alter, sondern darüber hinaus auch dessen Erwartungen erwarten kann, und dass andererseits die gleichen Erwartungsstrukturen für Alter gelten. Erwartungserwartungen offerieren Orientierungshilfen, welche die an der Interaktion beteiligten Personen von dem Erfordernis entbinden, bei der Abstimmung ihres Verhaltens immer wieder bei Null anfangen zu müssen. Es sind soziale Muster, an denen man sein eigenes Erwarten zu orientieren hat, will man mit seinem Verhalten Erfolg haben. Wer nicht weiß, was der andere von einem erwartet, der wird auch kaum darauf hoffen können, dass die eigenen Erwartungen von dem Interaktionspartner erfüllt werden. Woher kann man nun aber wissen, was der andere erwartet? Und wie kann man sich diesen Vorgang der Generierung von Erwartungserwartungen vorstellen, der an der Überwindung der Unbestimmtheit des Verhaltens beteiligt ist und mit dem sich ein soziales System erst in die Lage versetzt, durch die Beschränkung dessen, was innerhalb seiner Grenzen möglich erscheint, das Problem der doppelten Kontingenz zu bearbeiten? Um diese Fragen beantworten zu können, gilt es sich zunächst einmal in einem ersten Schritt der systemtheoretischen Verwendung des Sinnbegriffs zu nähern. Eine zentrale Grundannahme der Systemtheorie Luhmann’scher Provenienz besagt, dass psychische wie auch soziale Systeme ihre jeweilige systeminterne Ordnung über die Kopplung von stets nur für den Moment existenten, im Medium Sinn operierenden Ereignissen organisieren.35 Mit dem Medium Sinn ist ein Ordnungsmodus benannt, der sich für die operative Schließung beider Systemtypen verantwortlich zeichnet, der sich allerdings im Bereich des Psychischen anders konfiguriert als in dem des Sozialen. Während psychische Systeme sinnhaft erleben, indem sie dem Verweilen bei einem Bewusstseinsinhalt die Unruhe des Fortschreitenmüssens zum nächsten Bewusstseinsinhalt entgegensetzen, reproduzieren soziale Systeme Sinn durch den Anschluss aufeinander Bezug nehmender Kommunikationen. Über Bewusstsein auf der einen und 34 35 Ebd., S. 412. Zum Sinnbegriff der neueren Systemtheorie vgl. LUHMANN, Niklas: Sinn als Grundbegriff der Soziologie. In: HABERMAS, Jürgen / LUHMANN, Niklas: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Frankfurt (Main) 1982, S. 25-100; LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 92 ff. 24 Kommunikationen auf der anderen Seite formieren sich also das Psychische und das Soziale zu in sich geschlossenen Systemen, die nur solange, wie sie ihre Systemelemente kontinuieren, von Bestand sein können.36 Identifiziert man auf diese Weise Systeme über die Abfolge ihrer spezifischen Operationen, so bleibt die Möglichkeit, dass sich einzelne Bewusstseinsanteile in die Kommunikation einschleichen oder aber die Kommunikation das Bewusstsein kontrolliert, theoretisch undenkbar. Aufgrund der operativen Geschlossenheit psychischer und sozialer Systeme sind demnach Erwartungen, die in dem einen System auftreten, nicht so ohne weiteres imstande, in das andere zu diffundieren. In der Systemtheorie wird der Sinnbegriff dabei als eine inhaltsleere Modalkategorie verwendet, anhand derer sich die Anschlussfähigkeit von systeminternen Operationen erklären lässt.37 Luhmann definiert diese Modalkategorie als „eine unnegierbare, eine differenzlose Kategorie“38, die von vornherein das Vorhandensein von Sinnlosigkeit – etwa in Form von Unvernunft und Anomie – ausschließt. Ein jedes Denken oder Kommunizieren nimmt schon deswegen einen Sinngehalt an, weil es sich in einem unentwegten Strom vorangegangener bzw. nachfolgender Bewusstseinsinhalte oder Kommunikationen befindet. Im Gegensatz zur soziologischen Kategorie der Handlung, die sich zu einem isolierten Einzelereignis verdichten lässt, bei dem Anfang und Ende zusammenfällt, transzendiert alles im Medium Sinn sich Ereignende das Punktuelle, indem es immer schon auf andere Bewusstseinsinhalte und Kommunikationen verweist. Kurzum: Weder Gedanken noch Kommunikationen können sinnlos sein, weil sie über das hinausreichen, was sie im Moment ihres Erscheinens aktualisieren.39 Einem jeden sinnhaften Erleben und Kommunizieren haftet demnach ein Überschuss an Verweisungen an, und damit verbunden, ein Zwang zur erneuten Selektion, zum permanenten Re-Aktualisieren von Sinn. Und gerade weil dieser Zwang zur erneuten Selektion durch den rekursiven Verweis auf vorausgehende Sinnselektionen innerhalb des Systems erfolgen muss, verläuft der Anschluss von Operation an Operation kontingent, aber keineswegs beliebig. „Sinn ist laufendes Aktualisieren von Möglichkeiten“40, so heißt es bei Niklas Luhmann. Ein solches in Ereignissen ablaufendes, Zukunft mit einbeziehendes Sinngeschehen lässt sich auch detaillierter als ein Prozessieren nach 36 37 38 39 40 Zum Verhältnis von psychischen und sozialen Systemen vgl. LUHMANN, Niklas: Die operative Geschlossenheit psychischer und sozialer Systeme. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. Opladen 1995, S. 25-36; BAECKER, Dirk: Die Unterscheidung zwischen Kommunikation und Bewußtsein. In: KROHN, Wolfgang / KÜPPERS, Günter: Emergenz. Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung. Frankfurt (Main) 1999, S. 217-268. Der systemtheoretische Sinnbegriff beschreibt also weder das ‚Warum’ des Lebens bzw. der Geschichte noch das ‚Wie’ des Subjekts, sich die Welt in ihrem Wesen anzueignen bzw. diese durch sein Handeln zu gestalten. Zur Bedeutung des Sinnbegriffs in der Soziologie vgl. SCHÜLEIN, Johann: Zur Konzeptualisierung des Sinnbegriffs. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 34 (1982), S. 649-664. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 96. Was natürlich nicht ausschließt, dass ein Bewusstseinsinhalt oder eine Kommunikation sich selbst als ‚sinnlos’ beschreiben kann, wobei dann jedoch die Selbstbeschreibung auf der Ebene ihrer Operation durchaus wiederum sinnhaft erfolgt. Vgl. dazu HAHN, Alois: Sinn und Sinnlosigkeit. In: HAFERKAMP, Hans / SCHMID, Michael (Hg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt (Main) 1987, S. 155-164. Vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 100. 25 Maßgabe von Differenzen, und zwar als ein Prozessieren nach Maßgabe der Differenz von Aktualität und Potentialität fassen. Ein aktueller Sinngehalt schließt also immer auch Möglichkeiten mit ein, ihn auf eine andere Weise zu bezeichnen. Aber die Aktualisierung dieser Möglichkeiten setzt seinerseits wiederum weitere Operationen voraus. Gegenüber einer seit Durkheim in der Soziologie weit verbreiteten Auffassung, nach der eine jede soziale Ordnung auf geteilten Normen und Werten, also einem Konsens der Gesellschaftsmitglieder basiert, betont Luhmann die Möglichkeitshorizonte einschränkende Wirkung solcher im Medium Sinn ablaufenden zeitlichen Prozesse. „Alter bestimmt in einer noch unklaren Situation sein Verhalten versuchsweise zuerst. Er beginnt mit einem freundlichen Blick, einer Geste, einem Geschenk – und wartet ab, ob und wie Ego die vorgeschlagene Situationsdefinition annimmt. Jeder darauf folgende Schritt ist dann im Lichte dieses Anfangs eine Handlung mit kontingenzreduzierendem, bestimmendem Effekt – sei es nun positiv oder negativ.“41 Der in die Interaktion eingebrachte Sinnvorschlag legt zunächst eine Situationsdefinition fest und initialisiert auf diese Weise eine Aufmerksamkeit für mögliche Reaktionen. Ein Gruß etwa kann erwidert oder ignoriert, er kann mit einem wohlwollenden Lächeln oder mit ernster Miene quittiert werden. Immer aber bleiben die Reaktionen an dem orientiert, was sie in der Interaktion als Verhaltensselektion bzw. Kommunikation beobachten können. Innerhalb dieses emergenten Prozesses der laufenden Aktualisierung von Möglichkeiten, in dem Alter auf Ego, Ego auf Alter und dieser wiederum in modifizierter Weise auf Ego reagiert, kristallisieren sich Erwartungserwartungen heraus, welche die Interaktion durch ihre eigenen Operationen erzeugt und ständig erneuert bzw. durch andere ersetzt. Ihre Konturen gewinnen die Erwartungserwartungen über Sinnkondensierungen, über Wiederholungen von Sinnselektionen innerhalb eines durch die Situation jeweils begrenzten Möglichkeitshorizonts. In einer Auswahl von Möglichkeiten, Sinn zu selektieren, wird wiederholt dieselbe Sinnselektion getroffen und damit dem Ereignis durch die Bildung von Redundanzen sein Informationswert entzogen. Situationen lassen sich dann danach unterscheiden, ob sich in ihnen der Anschluss einer bestimmten Verhaltensweise als eher wahrscheinlich oder als eher unwahrscheinlich darstellt. Von einem Arbeitskollegen lässt sich etwa erwarten, dass er – aus welchen subjektiven Antrieben auch immer – die Erwartung hegt, gegrüßt zu werden. Bei einem wildfremden Menschen gestaltet sich die Situation weitaus offener, so dass bei jeder weiteren zufälligen Begegnung darüber entschieden werden muss, ob man grüsst oder nicht – solange jedenfalls, bis sich die beteiligten Personen wechselseitig eine Bekanntheit unterstellen. Erwartungserwartungen spalten insofern das, was ein soziales System mit einer bestimmten Situation an Erwartungen verbindet, von dem ab, was die Grenzen des Erwartbaren überschreitet. Sie lassen im Falle von Erwartungsenttäuschungen damit aber auch zugleich die Möglichkeit zu, die Um41 Ebd., S. 150. 26 welt im System als Irritationsfaktor zu beobachten. Ein ausbleibender Gruß unter Arbeitskollegen kann beispielsweise in der nächsten Begegnung dazu führen, dass man den Gruß mit der Vorstellung der eigenen Person kombiniert, um auf diese Weise bei seinem Interaktionspartner den Status des Fremden abzulegen. Soziale Systeme verhalten sich gegenüber ihrer Umwelt somit durchaus offen, weil sie ihre internen Erwartungsstrukturen lediglich über Informationen modifizieren können, die nicht den eigenen Operationen zurechenbar sind. Nicht alles muss innerhalb ihrer Grenzen immer auch so eintreffen, wie es von den psychischen Systemen erwartet wurde. Bei Luhmann erscheint das Problem der doppelten Kontingenz damit keineswegs endgültig lösbar. Vielmehr erkennt er in ihm die sich selbst unaufhörlich regenerierende Keimzelle der Autokatalyse sozialer Systeme.42 1.2.3 Soziale Systeme als Kommunikationssysteme 1.2.3.1 Die Selbstreferenz von Kommunikationen Der Terminus soziales System wird in der Soziologie zumeist als eine analytische Kategorie verwendet, mit der sich Gegenstandsbereiche sozialen Handelns voneinander abgrenzen lassen. Luhmann dahingegen versteht unter sozialen Systemen Kommunikationssysteme, deren selbstreferentielle Operationen eine Grenze zwischen Innen und Außen kondensieren. Mit der Hinwendung von der Handlung zur Kommunikation ist also nicht nur ein Wechsel des Etiketts verbunden, über das eine Spezifizierung der Letztelemente eines sozialen Systems erfolgt. Die entscheidende Neuerung vollzieht sich vielmehr am Systembegriff selbst, der von Einheit auf Differenz umgestellt wird. Besonders deutlich treten die Divergenzen zwischen den beiden unterschiedlichen methodischen Zugängen an der Stelle hervor, wo es darum geht, die jedem Ereignis innewohnende Unsicherheit der Zukunft, also die Bedingungen der Möglichkeit des Anschlusses von Verhaltensweisen, über den Erwartungsbegriff in die Theorie zu inkorporieren. Die Handlung an sich ist als ein abgeschlossenes, zeitpunktfixiertes Ereignis zunächst einmal blind gegenüber den Erwartungen, die sich seitens eines Interaktionspartners mit ihr verbinden lassen. Man kann zwar beobachten, wie jemand eine Treppe hinaufgeht, für einen Laib Brot Geld bezahlt oder auch sich am Kopf kratzt, aber warum dies alles so geschieht, wie es geschieht, ist aus der Handlung selbst nicht ersichtlich. Ihre fehlende Sensibilität für das, was über ihren schieren Vollzug hinausgeht, hat die Handlungstheorie über den Akteur zu kompensieren versucht, der die Handlung mit einem subjektiven Sinn belegt. Erst über diesen subjektiven Sinn, dem sich ein 42 Vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 169 ff. 27 Beobachter aufgrund seines im Umgang mit der Welt erworbenen Wissens verstehend annähern kann, wird die Handlung zu einem Scharnier, das den Anschlusshandlungen eine hinreichende Bestimmtheit verleiht. Der Erfolg einer Handlung hängt dann davon ab, inwieweit es ihr in der Interaktion gelingt, eine Reaktion hervorzubringen, durch die alle beteiligten Akteure ihre Erwartungen erfüllt sehen. Um nun erklären zu können, wie eine solche Ordnung von aufeinander Bezug nehmenden Einzelhandlungen überhaupt möglich ist, muss die Handlungstheorie den Akteur in ein allgemeingültiges Werte- und Normenkorsett schnüren, das ihn in seinen möglichen Zielen und Mitteln, diese durchzusetzen, einschränkt. Wer sich diesem Werte- und Normenkorsett entzieht, der verhält sich abweichend zu dem, was sich im Konsens zwischen den Gesellschaftsmitgliedern festgelegt findet. Nun gewinnt der Begriff der Kommunikation seine Eigentümlichkeit gerade daraus, dass er gegenüber dem der Handlung die Erwartung nicht mehr in den Akteur verlagern muss, sondern zu einem Bestandteil der Kommunikation selbst erhebt. Die Emergenz des Sozialen wird hier nicht mehr auf eine Ordnung zurückgeführt, die den zulässigen Verhaltensweisen des Individuums enge Grenzen setzt, sie verweist vielmehr auf eine zeitliche Abfolge von Systemereignissen, die sich über den Ausschluss dessen, was in der Umwelt sonst noch möglich ist, immer wieder selbst reproduzieren. Mit der Ausbildung von Erwartungsstrukturen schaffen sich also soziale Systeme die Voraussetzung, um Anschlussmöglichkeiten voneinander zu unterscheiden, die entweder zur Fortsetzung oder aber zum Abbruch der Kommunikation führen. Seinen sinntheoretischen Grundannahmen folgend weist Niklas Luhmann die Selbstreferenz von Kommunikationen als den entscheidenden Mechanismus aus, über den Verhaltenserwartungen in der Kommunikation kondensieren können. Der systemtheoretische Zugang tritt dabei bewusst in kritischer Distanz zu einer unser Alltagsverständnis prägenden Vorstellung, Kommunikation sei eine Technik, auf die der Mensch zurückgreift, um die Wahrnehmungen, Gefühle und Handlungen eines anderen Menschen im Sinne der eigenen Bedürfnisse und Erwartungen zu beeinflussen, wenn nicht gar zu steuern. „Nicht der Mensch kann kommunizieren“, so heißt es dahingegen provokant bei Niklas Luhmann, „sondern nur die Kommunikation kann kommunizieren.“43 Diese antihumanistische Fundierung steht nicht nur im schroffen Widerspruch zu unserem Alltagsverständnis, sie begreift sich zugleich auch als Alternative zu einer Kommunikationstheorie, die anhand eines Sender/Empfänger-Modells darzulegen versucht, wie ein Verstehen von Kommunikation möglich ist.44 Nach diesem am Subjekt/Objekt-Schema orientierten Modell begreift Alter eine von Ego mitgeteilte Nachricht als Objekt seiner subjektiven Wahrnehmung. Die zwi43 44 LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 105. Eine typische Anwendungen dieses Sender/Empfänger-Modells findet sich in der kommunikationspsychologischen Theorie von SCHULZ VON THUN, Friedemann: Miteinander Reden 1. Störungen und Klärungen. Hamburg 1981. 28 schen Ego und Alter bestehende Differenz bringt es also mit sich, dass sich die Information einer Nachricht im Zuge ihrer Kommunikation dupliziert, insofern sie nicht nur mitgeteilt, sondern auch als Botschaft verstanden werden muss. Da nun der Kommunikation das Ziel der Übertragung einer Information immanent ist, besteht das Gebot ihres Gelingens darin, alle etwaigen Störquellen, die einem Missverstehen zugrunde liegen können, zu eliminieren. Nur auf diese Weise lässt sich der Kommunikationspartner in die Lage versetzen, die als Mitteilung chiffrierte Information mit Hilfe seiner über Lern- und Sozialisationsprozesse angeeigneten Kommunikationskompetenzen zu dechiffrieren und in ihrer Einheit zu bewahren. Kommunikationstheorien derartigen Zuschnitts sehen sich somit mit dem grundsätzlichen Problem konfrontiert, erklären zu müssen, wie sich die Information gegenüber der Bedrohung, sich ins Differente zu verzweigen, immunisiert; oder genauer: wie sich der Transfer von Erwartungen, Gefühlen und Absichten vollziehen lässt, ohne dabei auf dem Wege von A nach B mit einem neuen subjektiven Sinn befrachtet zu werden. Gegenüber dem Sender/Empfänger-Modell, das die Möglichkeit der intersubjektiven Übertragung feststehender Informationen generell nicht in Abrede stellt, geht der kommunikationstheoretische Ansatz, den Niklas Luhmann verfolgt, von der Unmöglichkeit aus, über Kommunikation die operative Geschlossenheit der an ihr beteiligten psychischen Systeme zu überwinden. Die Differenz ist nicht etwas der Kommunikation Akzidentielles, die lediglich dort auftritt, wo die Kommunikation misslingt, mit ihr ist vielmehr jene notwendige Konstitutionsbedingung benannt, auf deren Basis sich erst eine emergente soziale Ordnung auszudifferenzieren vermag. Um eine solche das Psychische vom Sozialen strikt trennende Ordnung denken zu können, durchbricht Luhmann die scheinbar wie selbstverständlich gegebene Linearität der Kommunikation. Nach seiner Auffassung verlaufen Kommunikationen nicht von Ego, der eine Information mitteilt, hin zu Alter, der sie versteht. Vielmehr setzen sie sich aus verschiedenen Zuschreibungsakten zusammen, in denen Alter eine Information (Inhalt/Thema) selektiert, diese einer Mitteilung (Handlung) Egos zurechnet und schließlich voraussetzt, dass Ego ihm ein Verstehen der Differenz von Information und Mitteilung unterstellt.45 Das Verstehen schließt ein kommunikatives Ereignis ab und fungiert gleichzeitig als jener Bezugspunkt, der über die Wahl der Anschlusskommunikationen entscheidet. Die besondere Finesse dieses kommunikationstheoretischen Ansatzes besteht darin, dass er den dreistelligen Selektionsprozess, innerhalb dessen die jeweilige Selektion von Information und Mitteilung im Verstehen zu einer Synthese gebracht 45 Zum Kommunikationsbegriff der Systemtheorie vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 191 ff. Eine kurze einführende Problemskizze leistet LUHMANN, Niklas: Was ist Kommunikation? In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. Opladen 1995, S. 113-124. Zur Notwendigkeit der Kommunikationstheorie Niklas Luhmanns, Verstehen als eine ‚Unterstellung’ zu begreifen vgl. HAHN, Alois: Verstehen bei Dilthey und Luhmann. In: Annali di Sociologia / Soziologisches Jahrbuch 8 (1992), S. 421-430, hier S. 427 f. 29 werden muss, keineswegs im Subjekt, sondern in der Kommunikation selbst stattfinden lässt.46 Dementsprechend sind mit Alter und Ego auch keine psychischen Systeme gemeint, es sind „Adressen“,47 Zuschreibungsartefakte, die in der Kommunikation selbst artikuliert werden. Einem Ego wird zugerechnet, dass er eine Information auf eine bestimmte Art und Weise mitteilt, indem Alter an diese Mitteilung durch eine Kommunikation anschließt, die ihrerseits wiederum durch eine darauf folgende Kommunikation entweder mehr an der Information oder mehr an der mitteilenden Person orientiert beobachtet werden kann. Im Medium Sinn ablaufende Kommunikationen beobachten folglich ihre eigenen Operationen. Als Ereignisse sind sie Prozesse und Strukturen zugleich. Sie verweisen auf voraus liegende, bereits vollzogene Kommunikationen, um über die Unterscheidung von Mitteilung und Information ihren weiteren Verlauf zu begrenzen. Während sich über die Mitteilung eine Erwartung individuell attribuieren lässt, gibt die Information an, wodurch die Erwartung veranlasst wurde. Im Verstehen wird letztlich in Rechnung gestellt, dass sich die mitgeteilte Information an den Erwartungen des Kommunikationspartners orientiert. Jedes Verstehen provoziert auf diese Weise unausweichlich eine Reaktion. Denn wenn Alter davon ausgeht, dass Ego seine Mitteilungshandlung auf die möglichen Erwartungen Alters abgestimmt hat, weil Ego seinerseits erwarten kann, dass Alter aufgrund der Information, die ihm mitgeteilt wird, ein bestimmtes Verhalten von Ego erwartet, dann wird jede Verhaltensweise Alters, selbst das Schweigen, zu einem kommunikativen Akt, der über den Erfolg (der Annahme oder Ablehnung) einer Kommunikation entscheidet. Abstrakt gesehen kommen Kommunikationen demnach durch Konditionierungen zustande: Eine Mitteilung, deren Selektion sich in einem situativen Kontext unter der Voraussetzung auch anderer Möglichkeiten ereignet, wird zur Bedingung dessen, was im weiteren Verlauf der Kommunikation zu erwarten ist. Der Kommunikation selbst bleiben dabei die Gedanken, die sich die psychischen Systeme tatsächlich machen, verborgen. 46 47 Vgl. dazu die Kontroverse zwischen Wil Martens und Niklas Luhmann. MARTENS, Wil: Die Autopoiesis sozialer Systeme. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 43 (1991), S. 625-646; LUHMANN, Niklas: Wer kennt Wil Martens? Eine Anmerkung zum Problem der Emergenz sozialer Systeme. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 44 (1992), S. 139-142. Zum Begriff der „Adresse“ vgl. FUCHS, Peter: Adressabilität als Grundbegriff der soziologischen Systemtheorie. In: Soziale Systeme 3 (1997), S. 57-79. 30 1.2.3.2 Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation und ihre Überwindung durch Kommunikationsmedien Während das Sender-Empfänger-Modell am Phänomen der Kommunikation ansetzt und insofern immer schon voraussetzt, dass Kommunikationen stattfinden, entwickelt Luhmann seine Argumentation am Problem ihrer Unwahrscheinlichkeit. Der problemorientierte Zugang Luhmanns schärft den Blick für jene Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit in Situationen der doppelten Kontingenz Kommunikationen überhaupt zustande kommen können. Die Beobachtbarkeit einer Kommunikation hängt also davon ab, dass sie bereits die Schwelle ihrer Unwahrscheinlichkeit überschritten hat. Und es stellt sich dann die Frage, wie ihr dies gelingen konnte? Kurzum: Jede Kommunikation ist Problemlösung. Sie sieht sich dabei mit drei verschiedenen Unwahrscheinlichkeiten konfrontiert: erstens der Unwahrscheinlichkeit des Verstehens dessen, was gesagt wurde; zweitens der Unwahrscheinlichkeit der raum-zeitlichen Adressierbarkeit von Mitteilungen; und drittens der Unwahrscheinlichkeit ihres Erfolges, insofern jede Kommunikation zugleich auch die Möglichkeit der Negation ihres Inhalts mit sich führt.48 Niklas Luhmann geht nun davon aus, dass sich im historischen Zeitverlauf evolutionäre Errungenschaften ausgebildet haben, „die genau an jenen Bruchstellen der Kommunikation ansetzen und funktionsgenau dazu dienen, Unwahrscheinliches in Wahrscheinliches zu transformieren [...].“49 Diese evolutionären Errungenschaften bezeichnet er als Medien.50 Darunter fallen die Sprache, Verbreitungsmedien wie Schrift und Buchdruck und schließlich symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien wie Geld, Macht, Wahrheit und Glauben. Die verschiedenen Medien nehmen allesamt Sinn in Anspruch, um der prinzipiell unendlichen Fülle der Rekombinationsmöglichkeiten ihrer Elemente (Laute, Schriftzeichen, Anschlusskommunikationen) eine spezifische Form zu verleihen und damit Kommunikation wahrscheinlich zu machen. Sie bauen chronologisch aufeinander auf und bedingen sich dabei wechselseitig. Während symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien die Existenz von Verbreitungsmedien in der Gesellschaft voraussetzen, sind Letztere ihrerseits an das Vorhandensein von Sprache gebunden. Diese rückbezügliche Abstufung der Medien darf allerdings keineswegs als ein kontinuierlicher, durch die Entfaltung der menschlichen Vernunft vorangetriebener Forschrittsprozess missgedeutet werden, in dessen Verlauf sich die Kommunikation perfektioniert und ihre Unwahrscheinlichkeit bezwingt. Vielmehr werden mit jeder medialen Beherrschung unwahrscheinlicher Kommunikationen neue Kommunikationsprobleme initialisiert bzw. verstärkt, die nach innovativeren Lösungen verlangen. Letztlich lässt sich also die 48 49 50 Vgl. LUHMANN, Niklas: Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen 1981, S. 25-34, hier S. 26 f.; LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 216 ff. Ebd., S. 220. Für eine ausführlichere Darstellung der Medienkonzepte vgl. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 190 ff.; BOHN, Cornelia: Die Medien der Gesellschaft. In: JÄCKEL, Michael (Hg.): Mediensoziologie. Grundfragen und Forschungsfelder. Wiesbaden 2005, S. 365-374. 31 Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation nicht aus der Welt schaffen, allenfalls ist sie durch die Verwendung von Medien ein wenig besser zu handhaben. Um kommunizieren zu können, bedarf jede Kommunikation, dies scheint zunächst einmal eine banale Einsicht zu sein, der Sprache. Zwar lassen sich mimische und gestische Kommunikationsformen denken, die scheinbar jenseits des Mediums operieren und dennoch die Möglichkeit eröffnen, Mitteilung und Information voneinander zu scheiden. So etwa, wenn Alter Egos Runzeln der Stirnfalten als eine mitgeteilte Information versteht, nach der jener seinen Aussagen skeptisch gegenübersteht. Damit aber die Bedeutung von Skepsis überhaupt verstanden werden kann, ist Sprache unerlässlich. Über Sprache lässt sich das Dieses vom Anderen trennen, weil sie in der Form von Worten kompakte und isolierbare Sinneinheiten anbietet, deren Muster zum wiederholten Gebrauch zur Verfügung stehen. Während etwa eine isolierte Zeigehandlung niemals die Gewissheit vermitteln kann, ob das, worauf sie deutet, von Alter und Ego auf dieselbe Weise wahrgenommen wird, erzeugt Sprache eben solche soziale Redundanzen, die ungeachtet der operativen Geschlossenheit der psychischen Systeme das Identischbleiben von Informationen suggerieren. Sprache reproduziert sich dabei über die Verwendung von Zeichen. Dabei bezeichnen Zeichen nicht einfach etwas, was außerhalb ihrer selbst liegt, sie sind keine Repräsentationen einer wie auch immer gearteten Realität. Sie verdanken sich vielmehr der Konstruktion eines Beobachters, der einen Beobachter beobachtet, wie dieser einen bestimmten Wortlaut mit einem Sinngehalt verbindet und in dem Moment, in dem er dies tut, sich der Beobachtbarkeit seines Zeichengebrauchs aussetzt. Sprache kommt also erst durch ihren beobachtbaren Gebrauch zustande, weil sie das Bezeichnende (Wortlaut) von dem Bezeichneten (Bedeutungsgehalt) unterscheidet und damit zugleich bei demjenigen, der dies wahrnimmt, die Frage aufwirft, warum dies in einer bestimmten Situation geschieht. Diese Beobachtung zweiter Ordnung kann zum einen im psychischen System erfolgen, das über die Reflexion sich wiederholender Zuordnungen von Bezeichnendem und Bezeichnetem ein relativ stabiles Wissen kondensiert, wann etwas wie bezeichnet wird. Sie kommt zum anderen aber vor allem auf der Ebene des Sozialen zur Anwendung, welche die Differenz von Mitteilung (Bezeichnenden) und Information (Bezeichnetem) als Ausgangspunkt für den Anschluss von Kommunikationen nutzt. Sprache übernimmt somit eine Doppelfunktion und vermag auf diese Weise psychische und soziale Systeme strukturell zu koppeln.51 Die Kommunikation kann dann als gewiss unterstellen, dass die beteiligten psychischen Systeme 51 Der systemtheoretische Terminus der ‚strukturellen Kopplung’ beschreibt eine selektive Beziehung zwischen einem System und seiner Umwelt, auf deren Grundlage sich das System ausdifferenzieren kann. Das System setzt die Erbringung bestimmter Leistungen in seiner Umwelt voraus, ohne sich allerdings durch diese Leistungen unmittelbar in seinen Operationen determinieren zu lassen. So wäre z.B. keine Kommunikation ohne die Wahrnehmungsleistungen des Bewusstseins möglich. Alles, was sich im Rahmen dieser punktuellen Beziehung in der Umwelt ereignet, verfügt dann auch über das Potential, die autopoietische Reproduktion des Systems zu irritieren. Zur strukturellen Kopplung von Bewusstsein und Kommunikation über Sprache vgl. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 108 ff. 32 das Verstehen einer Information leisten. Ihre Überzeugungskraft verlieren solchen Unterstellungen erst in dem Augenblick, in dem Widersprüche in der Kommunikation offenkundig zutage treten. Solange aber auf der Grundlage eines gemeinsamen Erfahrungshorizonts angenommen wird, dass ein anderer weiß, worauf sich eine mitgeteilte Information bezieht, lässt sich auf etwas verweisen bzw. über etwas sprechen, ohne dass dieses etwas zum Gegenstand weiterer Kommunikationen gemacht werden muss.52 Diese Ausgangslage von Kommunikationen verändert sich, wenn ein solcher gemeinsamer Erfahrungshorizont nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Es ist leicht einzusehen, dass zwei Menschen unterschiedlicher Kulturen, die ins Gespräch miteinander kommen, aufgrund der lokalen Begrenztheit ihrer Sprache eher Probleme haben werden, die Einheit von Bezeichnenden und Bezeichnetem eindeutig mit einer bestimmten Situation in Verbindung zu bringen. An eben dieser Unwahrscheinlichkeit des Erreichens auch abwesender Adressaten setzen Verbreitungsmedien wie die Schrift und der Buchdruck an, indem sie dem im Moment seiner Verlautbarung sich verflüchtigenden Wort zeitbeständige Symbole entgegensetzen. Verbreitungsmedien steigern die Chance der Adressierbarkeit, eben weil sie den raum-zeitlichen Kontext ihrer Entstehung überdauern. Sie lösen sich von der Voraussetzung der Anwesenheit der Sprechenden und ermöglichen damit, Kommunikationssysteme zu etablieren, die nicht mehr ausnahmslos auf Interaktionen angewiesen sind. Die Funktion von Verbreitungsmedien besteht dementsprechend darin, die „Reichweite sozialer Redundanz“53 zu erhöhen. Verbreitungsmedien sehen sich somit mit einem besonderen Anforderungsprofil konfrontiert: Sie müssen in der Lage sein, Texte bereitzustellen, deren Informationen unabhängig von dem Wissen desjenigen, der sie liest, selbstexplikativ, aus sich selbst heraus zu verstehen sind. Sie fungieren als Absicherung gegen das Vergessen, indem sie den Wissensbestand einer Gesellschaft entpersonalisieren, d.h. dem Einzelnen als Träger entziehen. Bei mündlichen Kommunikationen scheinen die einzelnen Komponenten der Kommunikation kaum differenzierbar. Während die Sprache den Anschein der Einheit des kommunikativen Ereignisses noch dadurch zu wahren vermag, dass das gesprochene und gehörte Wort in ihrer Gleichzeitigkeit zur „permanenten Oszillation“ zwischen den Komponenten der Kommunikation provozieren, legen Verbreitungsmedien unvermeidlich die Differenz zwischen Mitteilung und 52 53 Beim Überqueren eines Zebrastreifens sieht man ein heranbrausendes Auto und zeigt auf dieses, um der Person, die neben einem steht, auf eine nahende Gefahr aufmerksam zu machen. Das Zeigen reicht in den meisten Fällen schon aus – je nach Nähe und Geschwindigkeit des Autos –, weil man sich gewiss sein kann, dass der Andere aus der Information – ein heranbrausendes Auto – die gleichen Schlüsse zieht, wie man selbst. Dies ändert sich aber in dem Moment, wo dem Anderen dieses Verstehen der Information nicht mehr unterstellt werden kann, etwa im Falle eines Kleinkindes. Es bedarf dann der klärenden Worte, warum eine Information eine bestimmte Verhaltensweise notwendig macht. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 202. 33 Verstehen frei.54 Der Kontext, in dem der Verfasser einen Text schrieb, ist nicht mehr der, in dem ihn sein Rezipient liest.55 Erst wenn Alter und Ego nicht mehr in eine Situation eingebunden sind, in welcher der eine dem anderen ein zeitgleich mit der Mitteilung einsetzendes Verstehen unterstellen und in der Interaktion beständig überprüfen kann, wird es offensichtlich, dass die Mitteilung das Ergebnis einer Zuschreibung ist, die etwas Vergangenes in die Gegenwart einzuholen versucht. Alter kann dann zwar verstehen, warum Ego etwas so und nicht anders formuliert hat, aber aufgrund der fehlenden interaktionellen Kontrolle lassen sich für ihn aus der Mitteilung selbst keine Verhaltensdirektiven mehr ableiten. Verbreitungsmedien neigen dementsprechend dazu, personale Zurechenbarkeiten und Relevanzen der Autorenschaft gänzlich aufzulösen, eben weil sie ohne Konsequenzen bleiben.56 Auf Grund der sowohl raumzeitlichen Distanz zwischen Ego und Alter als auch der Zunahme sich widersprechender Wissensbestände eröffnen sie folglich einen größeren Spielraum der interpretativen Verarbeitung von Informationen. Mit der Sprache und den Verbreitungsmedien haben sich in der Gesellschaft Kommunikationsmedien etabliert, welche die in der operativen Geschlossenheit der psychischen Systeme begründete Unwahrscheinlichkeit des Verstehens der Information wie auch der Mitteilung zu überwinden imstande sind. Aber weder die Sprache noch die Verbreitungsmedien verfügen ihrerseits über ein ausreichendes Potential, das Problem der doppelten Kontingenz in eine soziale Ordnung zu überführen, die den Anschluss von Kommunikation an Kommunikation hinreichend erwartungssicher konditioniert. Rückblickend zeigt sich vielmehr, dass mit dem Wahrscheinlichwerden des Verstehens zugleich auch die Wahrscheinlichkeit der Ablehnung einer Kommunikation zunimmt. Dieser sich kumulativ verstärkende Prozess ist bereits im Negationspotential der Sprache angelegt.57 Warum sollte Alter die Sinnselektion Egos als Prämisse der eigenen Selektivität akzeptieren? Die Annahmeunwahrscheinlichkeit steigert sich noch einmal in dem Maße, wie die Verbreitungsmedien den Horizont möglicher Adressaten einer Kommunikation ausweiten. Dort, wo die Kontrollmechanismen der Interaktion nicht mehr greifen, wo sich die gemeinsame Basis der Welterfahrung und somit die im gemeinsamen Erleben und Handeln situierte Kongruenz des personalen Gedächtnisses aufzulösen beginnt, ist für Alter kein Anlass mehr gegeben, die Mittei54 55 56 57 Vgl. BOHN, Inklusion (wie Anm. 12), S. 186 f.; BOHN, Cornelia: Literacy. In: HARRINGTON, Austin / MARSHALL, Barbara L / MÜLLER, Hans-Peter (Hg.): Encyclopedia of Social Theory. London [u.a.] 2006, S. 324-326, hier S. 325. Selbst der Autor eines Tagebuchs wird die Memoiren seiner Jugendzeit nicht mehr mit den Augen lesen können, wie zu der Zeit, als er sie verfasste. Um ein zeitloses Werk niederzuschreiben, müsste er in der Lage sein, einen Text zu verfassen, der nicht mit der Zeit erodiert, seine Form verliert, um schließlich mit neuem Informationsgehalt und einer bloß vagen Vorstellung von dem Vergangenen restauriert zu werden. Er müsste in der Lage sein, einen Text so zu codieren, dass ein Verstehen unabhängig von seinen Stimmungen und Erfahrungen einem decodieren feststehender Informationen gleich kommt. Für eine Religion, die ihre Dogmen an eine göttliche Offenbarung koppelt, ist es dementsprechend unumgänglich, Gott als einen Beobachter zu installieren, der den Menschen in all seinen Handlungen im Blick behält. Vgl. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 221 ff. 34 lung Egos zu akzeptieren. Es stellt sich dann aber die Frage, wie eine geordnete Kommunikationsabfolge aussehen kann, mit der sich die nun offenkundig für jedermann zutage tretende Differenz zwischen Ego und Alter überbrücken lässt? In die von den Kommunikationsmedien geschlagene Bresche zwischen Alter und Ego springt zunächst die Moral. Ihre Funktion besteht darin, die Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs der Kommunikation dadurch zu überwinden, dass sie die Möglichkeit einer Alter/Ego-Synthese kommunikabel macht.58 „Sie [...] vollzieht gesellschaftliche Inklusion, indem sie die Kommunikation so einrichtet, daß Bedingungen der Übereinstimmung symbolisiert und in der Kommunikation signalisiert werden können [...].“59 Kommunikationen, in denen die Moral von Verhaltensweisen zur Sprache kommt, sind somit imstande, sowohl Gleichheit als auch Ungleichheit im Verhältnis von Personen zueinander darzustellen. Was an moralischen Kriterien für das Verhalten Alters gilt, davon kann auch Ego sich nicht lossagen. Die Moral greift dabei auf einen Katalog von Tugenden und Lastern zurück, zwischen denen man wählen kann, und dessen eine Seite, nämlich die der Tugenden, für jene Verhaltensweisen steht, welche die Vollendung einer sozialen Ordnung in Aussicht stellt, in der die Menschen in Gerechtigkeit miteinander leben, d.h. in der sich Alter und Ego reziprok aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen schulden. Die Beziehung zwischen Alter und Ego wird auf diese Weise als eine symmetrische gedacht, in der beide Seiten das Gute für den jeweils anderen wollen.60 Allerdings vermag die Moral dabei keine Sozialität zu begründen, sie setzt vielmehr bereits eine Ordnung voraus, in der sowohl Ego als auch Alter als Person in ihren Verhaltensdispositionen vollständig inkludiert sind. Entsprechend entscheidet die Moral auch nicht über gesellschaftliche Exklusion, allenfalls kommt ihr die Aufgabe zu, ein Verhalten im Hinblick auf die bestehende Ordnung als gut oder schlecht zu bewerten. Ego nimmt dabei das selektive Verhalten Alters zum Anlass, um die Achtung bzw. Missachtung seines Gegenübers durch sein Anschlussverhalten – etwa durch Lob oder Tadel – zum Ausdruck zu bringen. Achtung zeigt er ihm, „wenn er sich selbst als Alter im Alter wiederfindet, wiedererkennt und akzeptieren kann [...].“61 Bei der Moral geht es also noch nicht primär um die Annahme einer Kommunikation, deren Selektion sich aus dem Möglichkeitshorizont einer bestimmten Situation heraus erklärt, sondern um die Akzeptanz der ganzen Person, die als Bestandteil einer sozialen Ordnung zu einem tugendhaften Verhalten verpflichtet ist. 58 59 60 61 Zur kommunikationstheoretischen Konzeption der Moral, die diese nicht anthropologisch in den moralischen Gefühlen und in der praktischen Vernunft fundiert vgl. LUHMANN, Niklas: Soziologie der Moral. In: LUHMANN, Niklas / PFÜRTNER, Stephan H. (Hg.): Theorietechnik und Moral. Frankfurt (Main) 1978, S. 8-116. LUHMANN, Niklas: Ethik als Reflexionstheorie der Moral. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 3. Frankfurt (Main) 1989, S. 358-447, hier S. 363. Ich komme auf diese Vorstellung im Rahmen meiner Darstellung des Wandels historischer Reziprozitätsvorstellungen in Kapitel 3.4 Reziprozität als kulturhistorisches Phänomen – Von der Freundschaft zum Interesse noch ausführlicher zu sprechen. LUHMANN, Soziologie der Moral (wie Anm. 58), S. 46. 35 Über Moral lässt sich die Abfolge von Kommunikationen nur solange hinreichend erwartungssicher konditionieren, wie die Kommunikationsmöglichkeiten noch eindeutig durch den sozialen Status einer Person limitiert werden. Je nach Stellung innerhalb dieser auf Perfektion ausgerichteten kosmischen bzw. gottgegebenen Ordnung kommen dem Menschen verschiedene Grade der moralischen Eignung zu. Da somit nicht von jedem zu erwarten ist, dass er sich auch tugendhaft zu verhalten weiß, müssen jene Personen Herrschaftsbefugnisse übertragen bekommen, die ihr Handeln aufgrund ihres Ethos in den Dienst aller zu stellen vermögen. Mit dem normativen Naturbegriff und dem Willen Gottes, der Rückschlüsse vom Sein aufs Sollen zulässt, stehen der Moralkommunikation dabei universale Plausibilitäten zur Verfügung, die anzeigen, warum das moralische im Gegensatz zum unmoralischen Verhalten eine besondere Dignität aufweist. Je mehr sich jedoch im Zuge der Komplexitätssteigerung der Gesellschaft Tendenzen durchzusetzen beginnen, die Person nicht länger allein über ihre natürlichen Qualitäten als Teil der Gesellschaft zu begreifen, sondern sie über ihre tatsächlichen Leistungen und ihre Selbstbezüglichkeit zu definieren, werden die universalen Plausibilitäten selbst fragwürdig und zum Gegenstand von individuell zurechenbaren Entscheidungen und Motiven.62 Was dem einen als moralisch erscheint, das stellt sich für den anderen als unmoralisch dar. Und was sich in der einen Situation als richtig und gut erwiesen hat, das muss in einer anderen Situation unter veränderten Bedingungen nicht auch richtig und gut sein. Zudem setzt sich mehr und mehr die Einsicht durch, dass die rein äußerliche Handlung noch nichts darüber aussagt, welche tatsächlichen Motive ihr zugrunde liegen. Vor allem aber: Nicht jede moralisch verwerfliche Handlung zeitigt auch gesellschaftlich negative Folgen – das große Thema von Mandeville.63 Die maßgeblichen Kriterien der Selektion einer Verhaltensweise werden infolge ihrer situativen Kontextualisierung verstärkt von den unveränderlichen Grundsätzen einer tugendhaften von lasterhaften Verhaltensweisen unterscheidenden Moral abgelöst und von den Folgen abhängig gemacht, die sich prospektiv mit ihr in Verbindung bringen lassen. An diesen neuralgischen Punkten differenzieren sich schließlich vermehrt Kommunikationsmedien aus, die mit der Unsicherheit der Zukunft rechnen und gerade darauf abzielen, diese zu absorbieren. Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien wie Macht, Geld, Recht, Wahrheit und Liebe setzen an dem grundsätzlichen Problem an, wie sich die Erfolgsaussichten prinzipiell unwahrscheinlicher Kommunikationen erhöhen lassen.64 Es sind funktionale Äquivalente zur Moral, 62 63 64 Im 18. Jahrhundert reagiert die Ethik mit der Theorie der ‚moral sentiments’ auf das Problem, die Moral nicht mehr über außersoziale Instanzen absichern zu können. Jedem Menschen obliegt es vielmehr selbst, im Umgang mit seinen Mitmenschen moralische Gefühle zu empfinden und danach sein Handeln auszurichten. Vgl. LUHMANN, Ethik (wie Anm. 59), S. 403 ff. Vgl. MANDEVILLE, Bernard: Die Bienenfabel oder Private Laster, öffentliche Vorteile. Frankfurt (Main) 1968. Vgl. LUHMANN, Niklas: Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 1975, S. 170-192, LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 316 ff. 36 die allerdings im Gegensatz zu deren Universalität Anschlussfähigkeit von Kommunikationen, und damit soziale Ordnung, lediglich innerhalb ihres jeweiligen sachlichen Anwendungsbereichs garantieren.65 Luhmann geht nun davon aus, dass eine Kommunikation nur dann Erfolg hat, „wenn Ego den selektiven Inhalt der Kommunikation (die Information) als Prämisse eigenen Verhaltens übernimmt. Annehmen kann bedeuten: Handeln nach entsprechenden Direktiven, aber auch Erleben, Denken, weitere Informationen Verarbeiten unter der Voraussetzung, daß eine bestimmte Information zutrifft. Kommunikativer Erfolg ist: gelungene Kopplung von Selektionen.“66 Er stellt sich also nur dann ein, wenn es gelingt, Anschlusskommunikationen zu disziplinieren, d.h. eine Konditionierung des Erlebens bzw. Handelns Alters durch das Erleben bzw. Handelns Egos zu forcieren. Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien kombinieren somit die Selektion einer Verhaltensweise mit der Motivation, auf diese in einer bestimmten Art und Weise zu reagieren. Da sich Alter unter Berücksichtigung festgelegter Bedingungen aus einem Repertoire an Möglichkeiten für die Mitteilung einer spezifischen Information entschieden hat, kann Ego dazu motiviert werden, eine im Kommunikationssystem prädisponierte Anschlusskommunikation zu akzeptieren. Die Selektion Alters ist für Ego das Motiv, auf eine Kommunikation mit einer immer auch anders möglichen Kommunikation zu reagieren. Die handlungstheoretische Kopplung von Zwecken und Mitteln, die parallel in mindestens zwei Handlungsakteuren stattfindet und die sich dabei allgemeingültigen Normen unterwerfen muss, um eine beiderseitige Erwartungserfüllung in Aussicht stellen zu können, übersetzt die Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien in ein zeitliches Nacheinander von Selektion und Motivation. Dieses zeitliche Nacheinander stellt sich als Konstrukt einer jeweils aktuell vollzogenen Kommunikation ein, die ihre eigenen Bedingungen beobachtet. Mit den Begriffen der Selektion und Motivation sind von daher auch keine psychischen Zustände gemeint, die sich ihren Weg in die Kommunikation bahnen. Es sind vielmehr Attributionen, die sich in der Kommunikation rekursiv manifestieren. Was auch immer die beteiligten Bewusstseinsysteme denken, der Erfolg einer Kommunikation hängt maßgeblich davon ab, inwieweit sich im Vollzug ihrer Operationen Selektion und Motivation voneinander unterscheiden lassen. Ein Verkäufer kann erwarten, dass derjenige, der bereit ist, für eine Ware einen festgeschrieben Preis zu zahlen, seinerseits erwartet, dass diese auch in seinen Besitz übergeht, wohingegen derjenige, der nicht zahlen will (oder kann), auch keinen Anspruch auf ihren Erwerb hat. Für den Erfolg einer Kommunikation genügt es jedoch nicht, dass ein Verkäufer die Erwartung des Käufers erwarten kann. Wenn er die Erwartungserwartung annehmen will, muss er zudem das Handeln des Käufers – das Zahlen eines Preises – zum Motiv seines Erlebens – das Übergehen der Ware in den 65 66 Ebd., S. 317. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 218. 37 Besitz des Käufers – machen. Erst im Zuge dieser Bestätigung entsteht ein marktorientiertes Wirtschaftssystem, in dem der Käufer seinerseits die Sinnselektion des Verkäufers als seine Motivation deklariert, einen Preis für den Erhalt einer Ware zu zahlen. Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien bearbeiten dabei mit Hilfe binärer Codes, also der Gegenüberstellung zweier komplementärer Werte (zahlen/nicht-zahlen, machtunterworfen/machtüberlegen, Recht/Unrecht, wahr/unwahr), jeweils eine begrenzte Auswahl möglicher Sinnselektionen, die ihrerseits eine Präferenz anzeigen, wann eine Kommunikation Aussicht auf Erfolg hat und wann nicht. Sozialsysteme, die über solche Codewerte verfügen, sind imstande, aus jedem beobachtbaren kommunikativen Ereignis eine Information zu gewinnen, welche Aufschluss darüber gibt, ob sich eine Kommunikation im Sinne der Kombinatorik von Selektion und Motivation anschließen lässt oder nicht. Über Codewerte beschränken die Funktionssysteme der modernen Gesellschaft die Horizonte beobachtbarer Ereignisse, welche die Wahrscheinlichkeit der Aktualisierung einer systeminternen Operation erhöhen, und zwar ungeachtet dessen, dass der situative Kontext, in dem eine Kommunikation als Ereignis für den Moment ihres Erscheinens von Bestand ist, sich immer wieder aufs Neue verändert. Es stellt sich dann aber die Frage, wie sich diese Einschränkungen des Erwartbaren in der Kommunikation selbst bemerkbar machen? Und eine erste vorläufige Antwort hierauf soll lauten: über symbolische Generalisierungen. 1.2.3.3 Die Bedeutung von Semantiken für den Aufbau sozialer Strukturen Symbolische Generalisierungen verleihen einer Kommunikation eine Regelhaftigkeit, mit der sie eine Bedeutung erhält, die über die Situation hinaus, in der sie aktualisiert wird, Geltung beansprucht. Immer wenn Situation x gegeben ist, kann man mit der Kommunikation y rechnen. Natürlich verfügt auch unser Bewusstsein über die Fähigkeit, vom singulären Ereignis auf das Allgemeine zu schließen, also das Einzelereignis zu einem Typus zu abstrahieren und damit vergangene Erfahrungen für die Zukunft offen zu halten. Aufgrund seiner operativen Geschlossenheit bleibt es allerdings bei der Hervorbringung solcher Generalisierungen ausschließlich auf seine eigenen Erlebnisse verwiesen. Soziale Systeme dahingegen müssen die Abfolge ihrer Kommunikationen über Sinngeneralisierungen regulieren, welche die Differenz zwischen Alter und Ego zu überbrücken, oder genauer: als eine Einheit zu symbolisieren in der Lage sind. Sie müssen, und hierin besteht ihre eigentliche Leistung, immer zugleich auch anzeigen, dass ihre Sinnfestlegungen für beide Seiten der Differenz bindend sind. Will man nun diesen Vorgang der Gewinnung von symbolischen Generalisierungen, die dem Format des Sozialen entsprechen, näher 38 ausleuchten, bedarf es zunächst eines kurzen Rückgriffs auf den Modus, wie soziale Systeme ihre Elemente kontinuieren. Letztelemente sozialer Systeme sind Kommunikationen, die im Medium Sinn operieren. Sinn, darauf wurde bereits verwiesen, stellt sich als ein Operationsmodus dar, der jede Kommunikation als kontingent erscheinen lässt. Eine bestimmte Sinnselektion ist so gegeben, weil sie sich gleichfalls auch ganz anders hätte manifestieren können. Über diese Differenz des ‚so-oder-anders’, die sich bei jedem Aktualisieren von Sinn einstellt, lassen sich nun unterschiedliche Sinndimensionen benennen.67 Luhmann unterscheidet entsprechend zwischen der Sozial-, Sach- und Zeitdimension von Sinn, mit denen sich jeweils ein Ausschnitt der Weltkomplexität vor dem Hintergrund auch anderer Möglichkeiten hervorheben lässt. Die einzelnen Sinndimensionen sind je für sich als Unterscheidung zweier Horizonte gegeben, als unterschiedliche personale Weltzugänge in der Form ‚Ego’ oder ‚Alter’, als primäre Disjunktion in der Form ‚dieses’ oder ‚anderes’, und schließlich als Irreversibelwerden der Gegenwart in der Form ‚Vergangenheit’ oder ‚Zukunft’. Für den Fall von Kommunikationen heißt das: Wer teilt eine Information mit und wäre sie die gleiche, wenn ein anderer sie mitteilen würde? Was ist Thema der Kommunikation und was nicht? Und wie ist diese Kommunikation zeitlich einzuordnen: Ist sie eine Reaktion auf ein Ereignis, das ihr voraus liegt, oder verfolgt sie einen Zweck, dessen Erfüllung sich erst in der Zukunft einstellen wird? Die von den Sinndimensionen aufgespannten Horizonte eröffnen einem Beobachter – also in unserem Fall: einer Anschlusskommunikation – die Möglichkeit, sich auf einer der beiden Seiten zu verorten. So kann sie sich etwa als Beitrag zu einem bestimmten Thema verstehen oder das Anliegen signalisieren, das Thema zu wechseln. Sie kann dem Vorredner in seiner Meinung beipflichten oder sich eben von dieser distanzieren. Die Sinndimensionen statten die Kommunikation also mit einem Potential aus, den durch ihre eigene Operation aktualisierten Sinn zu generalisieren wie auch genauer zu spezifizieren. Sie ist ein Beitrag zu diesem Thema und nicht etwa zu jenem. Über dieses Verhältnis von Generalisierung und Spezifikation versetzen sich Kommunikationen in die Lage, unterschiedliche Anknüpfungspunkte für ihren weiteren Vollzug offen zu legen. Auch wenn eine jede Kommunikation für sich besehen ein einzigartiges Ereignis darstellt, das im Hinblick auf andere Kommunikationen in einer jeweils eigenen Situation, zu einem jeweils eigenen Zeitpunkt und eventuell auch mit jeweils unterschiedlichen Partnern stattfindet, so zeichnen sich die einzelnen Sinndimensionen doch für die Formung von Schemata verantwortlich, mittels derer sich Kommunikationen miteinander in Verbindung setzen, also Typen von Kom- 67 Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Sinndimensionen findet sich in LUHMANN, Sinn (wie Anm. 35), S. 48 ff.; LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 111 ff. 39 munikationen bilden lassen.68 Solche Schemata sind die Voraussetzung dafür, Analogien zwischen den Kommunikationen ausweisen und damit eine operative Ebene der unendlichen Fülle kommunikativer Einzelereignisse von einer symbolischen Ebene, auf der Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zu beobachten sind, unterscheiden zu können. Ohne diese symbolische Ebene wäre ein selbstreferentielles, innerhalb eines sozialen Systems immer wieder aufeinander Bezug nehmendes Operieren von Kommunikationen nicht denkbar.69 Die einzelne Kommunikation sähe sich mit der Komplexität überfrachtet, unter deren Umstände sie zustande kommt. Sie bliebe ein einmaliges Ereignis, das mit der Unmöglichkeit belastet wäre, über den Rückgriff auf bereits erfolgreich angewandte Sinnselektionen eine reduzierte Auswahl von Anschlussmöglichkeiten kenntlich zu machen. An dieser Gefahr des In-sich-selbst-Verharrens setzen symbolische Generalisierungen an. „Über symbolische Generalisierungen wird es möglich, Identität und NichtIdentität zu kombinieren, also Einheit in der Mannigfaltigkeit darzustellen und als Beschränkung des Möglichen erwartbar zu machen. Mit Hilfe symbolischer Generalisierungen kann deshalb jeder Partner einer Kommunikationsbeziehung seine eigenen Selektionen kommunikationslos mit einer interpretierten Realität und Intentionalität anderer abstimmen, in der er selbst als Objekt vorkommt.“70 Er kann über die Verwendung von Symbolen (Geld, Macht, Status, Ehre) den Bereich dessen abstecken, was im weiteren Verlauf der Kommunikation zu erwarten ist. Symbole sind aber keineswegs einfach nur Zeichen für etwas anderes (Wert, Gewaltmonopol, Ansehen), auf die Ego zurückgreifen kann, um Alter eine Information mitzuteilen. Vielmehr überbrücken sie die Differenz von Alter und Ego, indem sie immer schon Bedeutungen und Funktionen mit einschließen, die der Eine für den Anderen erfüllt. Symbolische Generalisierungen sind als zeitpunktunabhängige Identitäten in Form von Objekten, Begriffen, Themen, Rollen, Personen, Werten gegeben. Sie weisen Anknüpfungspunkte für weitere Kommunikationen aus und entbinden damit diese von der jeweiligen Notwendigkeit einer situationsabhängigen Reflexion der Bedingungen ihres Zustandekommens. Den über die Schemata der Sinndimensionen konstruierten Identitäten fällt dabei die Aufgabe zu, Sinn zu konfirmieren und damit für die Wiederverwendung in ganz unterschiedlichen, neu entstehenden Situationen offen zu halten.71 Solche innerhalb eines sozialen Systems als bewahrenswert ausge- 68 69 70 71 Zur Bedeutung der ‚Schemata’ für eine Theorie des sozialen Gedächtnisses vgl. LUHMANN, Niklas: Zeit und Gedächtnis. In: Soziale Systeme 2 (1996), S. 301-330, hier S. 315 ff. Vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (Anm. 24), S. 135. LUHMANN, Kommunikationsmedien (wie Anm. 64), S. 177. Analog zum Vorgang der ‚symbolischen Generalisierung’ geht Reinhart Koselleck davon aus, dass sich in den ‚Begriffen’, die eine Gesellschaft hervorbringt, eine Reflexion des tatsächlich sich Ereignenten erfolgt. „Ein Begriff bündelt die Vielfalt geschichtlicher Erfahrung und eine Summe von theoretischen und praktischen Sachbezügen in einem Zusammenhang, der als solcher nur durch den Begriff gegeben ist und wirklich erfahrbar wird.“ KOSELLECK, Reinhart: Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte. In: KOSELLECK, Reinhart: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt (Main) 1989, S. 107-129, hier S. 120. Vgl. dazu auch KO- 40 zeichneten, kondensierten und konfirmierten, wieder erkennbaren und zum Mehrfachgebrauch zur Verfügung stehenden, also in Textform vorliegenden Sinnfestlegungen bezeichnet Luhmann auch als Semantiken. Über Semantiken lassen sich allgemein gültige Erwartungen des Verhaltens aktivieren, ohne dass dabei die Erwartungen selbst in der Kommunikation über zeitraubende Aushandlungsprozesse abgestimmt werden müssten. Gerade weil sie „einen höherstufig generalisierten, relativ situationsunabhängig verfügbaren Sinn“72 anbieten, sind sie imstande, Anschlussmöglichkeiten von Kommunikationen kenntlich zu machen. Semantiken lassen sich von daher kaum von sozialen Strukturen unterscheiden, die im Gegensatz zum ephemen Ereignis einen zeitlich invarianten Horizont möglicher Operationen eines sozialen Systems begrenzen.73 Luhmann spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „Themenvorrat“74, der die Autopoiesis der Kommunikation einschränkt. Dieser Themenvorrat ist das Ergebnis von Selbstbeschreibungen, anhand derer Sozialsysteme die Kontingenz ihrer eigenen Operationen in den Blick nehmen.75 Der Unterschied zwischen solchen Selbstbeschreibungen und Selbstbeobachtungen, die in der Kommunikation über Symbole vermittelt werden, besteht dann darin, dass Selbstbeschreibungen Texte zur Wiederverwendung anfertigen, während Selbstbeobachtungen für die fortlaufende Autopoiesis eines Sozialsystems verantwortlich sind und so auf der Ebene der Operationen relativ blind für das erfolgen, wodurch sich ein System von seiner Umwelt abgrenzt. Die Beobachtung 72 73 74 75 SELLECK, Reinhart: Einleitung. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhart (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 1. Stuttgart 1972, S. XIII-XXVII. LUHMANN, Niklas: Gesellschaftliche Struktur und semantische Tradition. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Bd. 1. Frankfurt (Main) 1980, S. 9-72, hier S. 19. Rudolf Stichweh hat entsprechend auf die konstitutive Bedeutung von Semantiken bei der Bildung von sozialen Strukturen hingewiesen. „Was Semantik von Sozialstrukturen unterscheidet, ist, daß der Sinn, der in Semantiken generalisiert und auf mögliche situationsübergreifende Erwartungen hin spezifiziert ist, noch relativ unspezifisch hinsichtlich der Unterscheidung von kognitivem und normativem Erwarten fungiert. Diese Festlegung, ob Strukturen des Erwartens normativ oder kognitiv ausgeflaggt werden, vollzieht sich in Prozessen der Strukturbildung selbst, zu denen die semantische Kultur einer Gesellschaft gerade dadurch Distanz hält, daß sie die Festlegung auf normatives oder kognitives Erwarten nicht selbst mitsteuern muß.“ STICHWEH, Rudolf: Semantik und Sozialstruktur. Zur Logik einer systemtheoretischen Unterscheidung. In: Soziale Systeme 6 (2000), S. 237250, hier S. 248. Kritisch setzt sich dahingegen Wil Martens mit der theoriebautechnischen Nähe von sozialen Strukturen und Semantiken auseinander. Er betrachtet Semantiken als „Strukturen für soziale Systeme“, die außerhalb ihres Operationszusammenhangs anzusiedeln sind und somit einen Phänomenbereich eigener Art besetzen. Deutlich tritt hier jedoch hervor, dass sich ein solcher Phänomenbereich eigener Art innerhalb einer Theorie selbstreferentieller Systeme kaum denken lässt. Vgl. MARTENS, Wil: Struktur, Semantik und Gedächtnis. Vorbemerkungen zur Evolutionstheorie. In: GIEGEL, Hans-Joachim / SCHIMANK, Uwe (Hg.): Beobachter der Moderne. Beiträge zu Niklas Luhmanns ‚Die Gesellschaft der Gesellschaft’. Frankfurt (Main) 2003, S. 167-203, hier S. 174. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 224. Luhmann überträgt damit den in der Subjektphilosophie verorteten Reflexionsbegriff vom Menschen auf die Gesellschaft, indem er zeigt, wie sich Selbstbeschreibungen nicht nur auf der Ebene des Bewusstseins, sondern auch auf der des Sozialen denken lassen. Vgl. LUHMANN, Niklas: Selbst-Thematisierung des Gesellschaftssystems. Über die Kategorie der Reflexion aus der Sicht der Systemtheorie. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 1975, S. 72-102. Zum Begriff der Selbstbeschreibung vgl. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 866 ff; KNEER, Georg: Reflexive Beobachtung zweiter Ordnung. Zur Modernisierung gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen. In: GIEGEL, Hans-Joachim / SCHIMANK, Uwe (Hg.): Beobachter der Moderne. Beiträge zu Niklas Luhmanns ‚Die Gesellschaft der Gesellschaft’. Frankfurt (Main) 2003, S. 301-332. 41 von Symbolen, der Differenz von Information und Mitteilung, reicht ihnen vollkommen aus, um Anschlusskommunikationen sicherzustellen. Entscheidend ist nun zu sehen, wie sich mit der Etablierung neuartiger Kommunikationsmedien auch die Formen verändern, die Semantiken innerhalb einer Gesellschaft anzunehmen vermögen. In der Form einer Semantik kommt das Verhältnis von Operation und Beobachtung, von Ereignis und Text zum Ausdruck, anhand dessen ein soziales System die Grenze zwischen seinem Innen und Außen definiert. Im Medium der Sprache entstehen zunächst Semantiken, die das Vertraute in Differenz zum Unvertrauten konturieren. Der Bereich des Vertrauten repräsentiert dabei jene erlebten Gewissheiten, die sich im Zuge ihrer Wiederholung unter vergleichbaren Bedingungen ins personale Gedächtnis eingeschrieben haben. Sinnselektionen, die aus diesem Horizont herausfallen, haftet dahingegen der Makel an, Erwartungsunsicherheiten in die Kommunikation einzuführen. In diesen Fällen besteht dann nur die Möglichkeit, dass Unvertraute entweder als etwas Vertrautes zu behandeln – als Beispiele für archaische Gesellschaften nennt Luhmann den Mythos und die Magie76 – oder aber seine Wiederverwendung innerhalb des Systems zu unterbinden. Semantiken sind hier bereits auf der Ebene des „Alltagsgebrauchs [...] von Sinn“77 als Namen und Worte, Redensarten, Situationsdefinitionen und Erzählungen für jedermann gegeben. Mit dem Aufkommen der Verbreitungsmedien treten neben diese oral weitergegebenen Texte nun auch jene, die als schriftliche Fixierung des Erwartbaren symbolischen Beschreibungen überantwortet werden. Die Semantik wird jetzt als eine „ernste, bewahrenswerte Kommunikation“78 ausgeflaggt, deren korrekte Interpretation in den Händen einer begrenzten Anzahl von auserwählten Personen liegt. Luhmann spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „gepflegten Semantik“79, die das, was an moralischen und rechtlichen Maximen innerhalb einer Gesellschaft vorausgesetzt werden kann, unter Androhung von Sanktionen aufrechtzuerhalten versucht.80 Die bewahrenswerte Semantik konkurriert dabei mit Semantiken der Volkskultur (Sprichwörtern, Lebensweisheiten, Liedgut, Aberglauben etc.), die Missdeutungen, Abweichungen, Widersprüche transportieren. Ihre unterschiedliche Bewertung basiert auf der Vorstellung, 76 77 78 79 80 Vgl. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 645 ff. LUHMANN, Gesellschaftliche Struktur (wie Anm. 72), S. 19. Ebd., S. 19. Ebd., S. 19. Ähnlich hatte bereits Friedrich Tenbruck versucht, den Gegenstandsbereich der Kultur näher einzugrenzen. „Kultur meint dann nicht alle, sondern nur die jeweils repräsentativen geistigen Bestände einer Gesellschaft, in denen sich ihre gemeinsamen Daseinsverständnisse fundieren und gültig ausdrücken. Repräsentative Bestände sind jene religiös oder anders verankerten Ideen, Bedeutungen und Werte, die allgemein als gültige Weltdeutung angesehen werden und für das soziale Handeln den nötigen Rahmen gemeinsamer Daseinsverständnisse liefern. Sie sind die verbreiteten, mit wechselndem Verständnis und wechselnder Intensität allgemein gehegten oder zumindest öffentlich respektierten und jedenfalls gesellschaftlich wirksamen Vorstellungen, die in dieser oder jener Weise von ‚Intellektuellen’ geschaffen, verbreitet, beglaubigt und gedeutet werden müssen und entsprechend auch von anderen ‚Intellektuellen’ mit anderen Ideen herausgefordert und beiseitegeschoben werden können.“ TENRBUCK, Friedrich H.: Die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft. Der Fall der Moderne. Opladen 1989, S. 19. 42 dass hinter der Vielfalt dessen, was in der Welt über die Wahrnehmung als unsicheres und fehlbares Wissen (doxa) zugänglich ist, ein von der Perzeption unabhängiges wahres Wesen der Dinge existiert, dem man sich lediglich über ein rationales Verstehen (episteme) anzunähern vermag. Der Ägyptologe Jan Assmann weist in seiner Theorie des kulturellen Gedächtnisses darauf hin, dass die Gesellschaft im Verlaufe ihrer Evolution mit der Sprache und der Schrift unterschiedliche Mnemotechniken hervorgebracht hat, um das Identischbleiben bestimmter Wissensinhalte über ihre Generationsfolge hinweg zu garantieren. Sprache und Schrift sind Medien – hier noch im Sinne von ‚Informationsvermittler’ verwendet –, die je eigene Praktiken bereithalten, um das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft zu bewahren. Nach Assmann setzt von dem Zeitpunkt an, als die Schrift gegenüber der Sprache im Hinblick auf diese Funktion an Bedeutung gewinnt, ein Prozess des allmählichen Übergangs „von der Dominanz der Wiederholung zur Dominanz der Vergegenwärtigung, von ‚ritueller’ zu ‚textueller Kohärenz’ [ein – J.H.]. Damit ist eine neue konnektive Struktur entstanden. Ihre Bindekräfte heißen nicht Nachahmung und Bewahrung, sondern Auslegung und Erinnerung. An die Stelle der Liturgie tritt die Hermeneutik.“81 Die Theorie des kulturellen Gedächtnisses betrachtet dabei die Praktiken der Wiederholung und der Interpretation als funktionale Äquivalente, die zur Herstellung einer kulturellen Kohärenz herangezogen werden können.82 Was aber über die Medien der Sprache und Schrift noch erreichbar scheint, dass stellt sich mit der Ausdifferenzierung symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien endgültig als ein Projekt ohne Erfolgsaussichten dar.83 Die Vorstellung einer kulturellen Kohärenz wird durch die operative Wirklichkeit sozialer Systeme konterkariert, die das Verhältnis zu ihrer Umwelt nicht länger über eine dominante Kontextur (vertraut/unvertraut; Vernunft/Unvernunft, Sein/Nicht-Sein) beobachten. Die Vielzahl symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien mit ihren jeweiligen Kontexturen formieren vielmehr eine polykontexturale Gesellschaft, die keinen privilegierten Ort mehr anerkennt, von dem aus sich das Absolute der Gesellschaft in den Blick nehmen ließe. An die Stelle einer einheitlichen, einzig richtigen, so und nicht anders möglichen Beobachtbarkeit der Welt tritt eine Diversität von Perspektiven, an die Stelle eines wahren Wissens von der Welt tritt eine Produktion von Semantiken, die ihren Anspruch auf universale Gültigkeit verliert. Die Form einer Semantik verweist in funktional aus- 81 82 83 ASSMANN, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München 1992, S. 18. Vgl. ebd., S. 89. Bezeichnend ist, dass gerade im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, als eine kulturelle Homogenität aufgrund der Ausdifferenzierung verschiedener symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien als Zielvorgabe kaum mehr haltbar erscheint, die Semantik der ‚Kultur’ auftaucht und vor allem im Bereich des Politischen stark gemacht wird. Mit der Semantik der Kultur lässt sich ein Zweifaches erreichen: Zum einen übergreift sie die gesamte Welt bzw. Menschheit; und zum anderen schafft sie eine Vergleichbasis, vor dessen Hintergrund nationale Unterschiede bewertet werden können. Vgl. LUHMANN, Niklas: Kultur als historischer Begriff. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 4. Frankfurt (Main) 1995, S. 31-54. 43 differenzierten Gesellschaften geradewegs auf das System, das sie hervorbringt, oder genauer: auf den Beobachter, der seine systeminternen Operationen über eine ihm eigene Kontextur beobachtet und vertextet. 1.3 Zur Korrelation von Semantik und Sozialstruktur Soziologische Untersuchungen, die den Wandel der Gesellschaft zu ihrem Gegenstand erheben, haben als Substrat ihrer Überlegungen es nicht nur mit einzelnen historischen Ereignissen und ihren Strukturzusammenhängen zu tun, sie sehen sich darüber hinaus auch mit der Aufgabe konfrontiert, die zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt gegebenen Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Erkenntnis, also die historische Gestalt des Wissens, in ihren Aussagen zu reflektieren. Seit ihren Anfängen setzt sich die Wissenssoziologie mit diesem Sachverhalt theoretisch auseinander. Dabei hat sie sich zunächst für die Vorstellung einer „Seinsverbundenheit des Denkens“84 stark gemacht und entsprechend versucht, den Konnex von sozialen Strukturen und Wissensinhalten über verschiedene Basis/Überbau-Modelle zu veranschaulichen.85 Der von diesen Modellen vollzogenen strikten Trennung zwischen Sein und Bewusstsein, Materie und Geist, Sozialstruktur und Kultur liegt die Annahme der Existenz zweier unterschiedlicher Realitätsbereiche zugrunde, die sich gegenseitig zu beeinflussen bzw. zu determinieren imstande sind. Die von der Soziologie hervorgebrachten Beschreibungen sozialen Wandels variieren entsprechend danach, ob sie die treibenden Kräfte des historischen Geschehens entweder im Fortschritt der Ideen suchen oder aber die Ideen – wie im historischen Materialismus – durch die Produktionsverhältnisse beziehungsweise – wie in der Wissenssoziologie Karl Mannheims – durch die geschichtlich geprägten Gruppeninteressen bedingt sehen, ihre Existenz demnach als bloße Ideologie demaskieren. Nun scheint Luhmann auf den ersten Blick dem Duktus, der diesen Annahmen immanent ist, genau an dem Punkt zu folgen, wo er von „einer Korrelation und Kovariation von Wissensbeständen und gesellschaftlichen Strukturen“86 ausgeht. Doch trügt hier, wie so oft, der erste Schein. Seine wissenssoziologischen Arbeiten zielen im Wesentlichen nicht darauf ab, zu zeigen, wie sich Veränderungen der historischen Strukturen einer Gesellschaft unmittelbar auf ihre Wissensbestände niederschlagen. Indem er sich auf das Problem fokussiert, inwieweit die Sinndimensionen – und damit die Schemata, über die Wissensinhalte reproduziert werden – auf das sich wandelnde 84 85 86 Vgl. MANNHEIM, Karl: Ideologie und Utopie. Frankfurt (Main) 1969, S. 229 ff. Eine Darstellung der historischen Wurzeln solcher Basis/Überbau-Modelle findet sich in HAHN, Alois: Basis und Überbau und das Problem der begrenzten Eigenständigkeit der Ideen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 31 (1979), S. 450-484. LUHMANN, Gesellschaftliche Struktur (wie Anm. 72), S. 15. 44 Komplexitätsniveau einer Gesellschaft reagieren, baut er zwischen dem mechanischen Bedingungsverhältnis von Struktur und Kultur eine zusätzliche Analyseebene ein. Luhmann spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „Gesamttransformation des semantischen Apparats der Kultur“87, in deren Folge es zu einer zunehmenden Trennung der einzelnen Sinndimensionen kommt. Setzten etwa mit Anbeginn der antiken Philosophie Bestrebungen ein, die Unterschiede zwischen den Menschen über ihre Natur, also in der Sachdimension, zu begründen, so entstand im ausgehenden Mittelalter insbesondere im Bereich des Religiösen ein vermehrter Bedarf, ihre Eigenarten zusätzlich in der Sozialdimension über die Subjektivität ihres Weltzugangs zu erklären. Neben dieser Tendenz, die Selektivität der Dimensionen unabhängiger voneinander zu denken, lassen sich mit dem Wandel des Komplexitätsniveaus einer Gesellschaft zudem Umgestaltungen innerhalb der einzelnen Sinndimensionen beobachten. Es handelt sich hierbei um Transformationen der Sinnverarbeitungsregeln, also der Schemata, welche die zu einer bestimmten Zeit aktualisierten Wissensinhalte in Relation zum Möglichen setzen und damit limitieren. Diese Umgestaltungen weisen auf eine Ausweitung der Möglichkeitshorizonte hin, so dass sich jede Sinnselektion in dem Moment, in dem sie vollzogen wird, einer immer größer werdenden Anzahl anderer bestimmbarer Alternativen ausgesetzt sieht. Je mehr sich etwa die Zeitspanne zwischen dem Vergangenen und Künftigen auszuweiten beginnt, umso unsicherer stellen sich Entscheidungen dar, die im Hier und Jetzt getroffen werden. Ihre Auswirkungen finden sich dann nicht nur durch den Ausblick auf die Reaktionen eines Handlungspartners, vielleicht auch noch durch die Unumgänglichkeit des Jüngsten Gerichts beschränkt, sie können sich darüber hinaus in jede beliebige, noch so unbekannte Zukunft erstrecken. Führt man, wie Niklas Luhmann dies tut, die Transformationen der Sinnverarbeitungsregeln auf das jeweilige Komplexitätsniveau einer historischen Gesellschaftsformation zurück, dann stellt sich unweigerlich die Frage nach den soziostrukturellen Bedingungen, die ihnen zugrunde liegen. In der klassischen Soziologie finden sich zumeist Positionen, welche die Komplexität einer Gesellschaft durch ihr Potential zur Ausdifferenzierung verschiedener Rollen, Positionen, Institutionen etc. bestimmt sehen. Gesellschaft wird dabei als eine Ganzheit konzipiert, deren Homogenität sich im Verlaufe ihres demographischen Wandels bzw. der Zunahme ihrer Bevölkerungsdichte in eine Heterogenität von spezialisierten, wechselseitig voneinander abhängigen Teilen differenziert.88 Sobald die Gesellschaft als lokal begrenzte soziale Einheit erst einmal ein quantitatives Niveau erreicht hat, bei dem nicht mehr jedem Mitglied der freie Zugang zu den ökonomischen Ressourcen gestattet werden kann, erscheint es aufgrund des Konkurrenz- und Konflikt87 88 Ebd., S. 33. Zu den unterschiedlichen historischen Wurzeln der Differenzierungstheorie vgl. TYRELL, Hartmann: Zur Diversität der Differenzierungstheorie. Soziologiehistorische Anmerkungen. In: Soziale Systeme 4 (1998), S. 119-149. Eine Überblicksdarstellung der differenzierungstheoretischen Ansätze in der Soziologie leistet SCHIMANK, Uwe: Theorien gesellschaftlicher Differenzierung. Opladen 1996. 45 potentials einer solchen Konstellation unhaltbar, die Erfüllung der gesellschaftlich notwendigen Aufgaben in die Hände aller zu legen. Der wohl prominenteste Vertreter dieses „Dekompositionsparadigmas“89 ist der französische Soziologe Émile Durkheim, dessen Entwicklungsgeschichte von der segmentären zur arbeitsteilig organisierten Gesellschaft, von der mechanischen zur organischen Solidarität zugleich auch eine Kritik der Moderne und ihrer mangelnden moralischen Integrität in der soziologischen Theorie verankerte.90 Die von Niklas Luhmann vertretende Differenzierungstheorie verabschiedet sich von einem solchen auf Ganzheiten rekurrierenden Denken. Sie entwirft einen Gesellschaftsbegriff, der sich nicht an einer letzten Einheit, sondern an der Differenz von System und Umwelt orientiert. Gesellschaft wird hier als das umfassende Sozialsystem verstanden, das mithin alle Kommunikationen in sich einschließt und damit Bewusstsein, Leben und Materie in ihre systemexterne Umwelt verweist.91 Differenzierung meint dann die im Sozialsystem Gesellschaft über die autopoietische Reproduktion von Kommunikationen sich vollziehende Ausdifferenzierung von System/Umwelt-Differenzen.92 Nicht die Dekomposition eines Gesamtsystems in eine mehr oder weniger große Anzahl von Subsystemen, die bestimmte Funktionen stellvertretend für das Ganze übernehmen, steht somit im Fokus der systemtheoretischen Differenzierungstheorie. Indes geht es ihr vielmehr um die Frage, wie es den verschiedenen Teilsystemen gelingt, innerhalb der Grenzen des Sozialsystems Gesellschaft durch den Ausschluss dessen, was sie an Kommunikationen ihrer Umwelt zurechnen, eine autonome Sphäre der Reproduktion von Sinn zu errichten. Diese Differenzierungsprozesse, in denen System-zu-System-Beziehungen jeweils in der Gesellschaft artikuliert werden, unterliegen einem Wandel, der sich in scheinbar abrupten Schüben von Zeit zu Zeit einstellt. Luhmann bezeichnet diese Brüche als evolutionär unwahrscheinliche Umstellungen der Differenzierungsform einer Gesellschaft.93 Entscheidend ist nun zu sehen, dass die Differenzierungsform nicht nur ein analytisches Modell begründet, mit dessen Hilfe der Soziologe dem Ziel beizukommen versucht, den soziostrukturellen Wandel einer Gesellschaft zu erfassen und die Vielschichtigkeit des menschlichen Zusammenlebens auf ein überschaubares Maß einzudampfen. Die soziologische Kategorie der Differenzierungsform rechtfertigt sich vielmehr aus den Beobachtungsoperationen der Teilsysteme einer Gesellschaft, mit denen diese sich in 89 90 91 92 93 Vgl. MAYNTZ, Renate: Funktionelle Teilsysteme in der Theorie sozialer Differenzierung. In: MAYNTZ, Renate / ROSEWITZ, Bernd / SCHIMANK, Uwe / STICHWEH, Rudolf (Hg.): Differenzierung und Verselbständigung. Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme. Frankfurt (Main) / New York 1988, S. 11-44, hier S. 14. Vgl. DURKHEIM, Émile: Über soziale Arbeitsteilung. Frankfurt (Main) 1988. Vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 555 ff. Es handelt sich hierbei also um die Wiederholung einer Unterscheidung innerhalb einer Unterscheidung, einen Vorgang, der in der Systemtheorie als ‚re-entry’ bezeichnet wird. Entsprechend heißt es bei Luhmann: „Systemdifferenzierung ist somit nichts anderes als eine rekursive Systembildung, die Anwendung von Systembildung auf ihr eigenes Resultat. Dabei wird das System, in dem weitere Systeme entstehen, rekonstruiert durch eine weitere Unterscheidung von Teilsystem und Umwelt. [...] Die Systemdifferenzierung generiert, mit anderen Worten, systeminterne Umwelten.“ LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 597. Vgl. ebd., S. 609 ff. 46 Abgrenzung zu ihrer gesellschaftsinternen Umwelt der eigenen Einheit vergewissern. Luhmann unterscheidet dabei zwischen einer segmentären Differenzierung, einer Differenzierung nach Zentrum und Peripherie, einer stratifikatorischen und einer funktionalen Differenzierung.94 Segmentäre Gesellschaften nehmen ihre innergesellschaftliche Umwelt als eine Ansammlung von gleichen Segmenten wahr, die sich entweder aufgrund ihrer begrenzten Lokalität oder aufgrund von Abstammungslinien voneinander unterscheiden lassen. Während das primäre Einteilungsprinzip der nach Zentrum und Peripherie differenzierten Gesellschaften in der Ungleichheit voneinander abhängiger lokaler Segmente (z.B. Stadt/Land) liegt, unterscheiden stratifizierte Gesellschaften anhand von Verwandtschaftsbeziehungen Schichten gemäß ihrer rangmäßigen Ungleichheit. Die moderne Gesellschaft ist schließlich durch die Ausdifferenzierung einer Vielzahl von Teilsystemen entlang spezifischer gesellschaftlicher Funktionen charakterisiert. Mit einer solchen Ausrichtung der Differenzierungstheorie an dem System/UmweltParadigma lässt sich die Vorstellung eines Steigerungszusammenhangs zwischen dem Differenzierungsgrad und dem Komplexitätsniveau einer Gesellschaft, wie sie von der klassischen Soziologie vertreten wurde, kaum mehr vorbehaltlos aufrechterhalten. Entgegen der Auffassung, dass die möglichen Relationierungen der Elemente einer Gesellschaft proportional mit ihrer Anzahl anwachsen, begründet die Systemtheorie das Komplexitätsniveau über die Modalität, die innerhalb eines sozialen Systems zur Anwendung kommt, um eine Eigenkomplexität aufzubauen. Erst durch die Reduktion derjenigen Kommunikationen, die in einem System als anschlussfähig betrachtet werden, eröffnet sich diesem ein Potential zur Steigerung der kombinatorischen Möglichkeiten seiner Elemente. Die einzelnen Differenzierungsformen sind mithin Ausdruck dieses Umgangs mit Kontingenz. Wie bereits dargelegt wurde, ist dabei der Vorgang, durch den Kommunikationen in ihrem Sinn generalisiert und damit mit Anschlussfähigkeit ausgestattet werden, eng an die verfügbaren Kommunikationsmedien einer Gesellschaft gekoppelt. Sie setzen die Grenze, bis zu welchem Grad die Teilsysteme eine Eigenkomplexität entfalten können, indem sie jenen Bereich markieren, von dem ab Kommunikationen Gefahr laufen, zum Erliegen zu kommen. Sprache, Verbreitungsmedien und symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien fungieren somit als eine Art Katalysator, der die Evolution der Gesellschaft beschleunigt, wenn nicht gar ermöglicht. Auch wenn Luhmann zwar von einer Kovariation und Korrelation von Gesellschaftsstruktur und Semantik spricht, geht es ihm weniger darum, das Auftauchen von bestimmten Semantiken unmittelbar aus den soziostrukturellen Bedingungen abzuleiten. Sein wissenssoziologischer Anspruch ist im Gegensatz zu solchen kausalen Erklärungsmustern, denen ein mechanisches Entsprechungsverhältnis zugrunde liegt, ein weitaus bescheidenerer. Er vertritt 94 Vgl. ebd., S. 634 ff; LUHMANN, Niklas: Differentiation of Society. In: The Canadian Journal of Sociology 2 (1977), S. 29-52. 47 vielmehr die These, dass sich in der Gesellschafsstruktur eine soziale Ordnung angelegt findet, welche die Schematismen und Selektionsspielräume einschränkt, innerhalb derer sich Sinninhalte als bewahrenswerte und wiederverwendbare Semantiken auszeichnen lassen. Den epistemologischen Dualismus, der für die Basis/Überbau-Modelle konstitutiv ist, umgeht der systemtheoretische Ansatz, indem er Gesellschaftsstrukturen und Semantiken nicht als distinkte ontologische Wirklichkeitsbereiche – im Sinne einer sprachlichen und nichtsprachlichen Realität95 – begreift, die sich zu durchdringen und zu determinieren in der Lage sind. Ihre Kovariation und Korrelation beruht vielmehr darauf, dass sie, wenn auch auf je unterschiedliche Weise, das Medium Sinn in Anspruch nehmen, um Komplexität zu reduzieren und damit die Abfolge von Kommunikationen erwartbar zu machen. Im Anschluss an die Unterscheidung von Operation und Beobachtung betont Luhmann dementsprechend die in der Systemtheorie vorgesehene Möglichkeit, Strukturen der Systemdifferenzierung von semantischen Strukturen zu trennen.96 Auf der Ebene der Operationen garantiert das Medium Sinn die Reproduktion von Kommunikationen. Eine jede Kommunikation signalisiert in dem Moment, in dem sie aktualisiert wird, dass sie auf einem Verstehen einer vorhergehenden Mitteilung basiert.97 Sie trifft damit zugleich auch eine Vorselektion, die den Horizont aller möglichen nachfolgenden Kommunikationen einschränkt. Erst durch dieses rekursive, sinnhafte Prozessieren von Operation zu Operation kondensiert eine Differenz von System und Umwelt, die das System wiederum nutzen kann, um über die Beschreibung der eigenen Identität der Kontingenz seiner Operationen eine Grenze zu setzen. Insofern gilt es zwischen der Erzeugung und der Beschreibung (und damit zwischen basaler und reflexiver Selbstreferenz) der Einheit des Systems zu unterscheiden. Eine Beschreibung dieser Einheit bleibt allerdings „immer ein Teil dessen, was sie beschreibt, und ändert es allein schon dadurch, daß sie auftritt und sich der Beobachtung aussetzt.“98 Sie ist selbst eine Operation, die innerhalb des Systems durch das System vollzogen werden muss. Auf der Ebene der Beobachtungen eröffnet also das Medium Sinn die Chance, Redundanzen zu bilden, die ungeachtet der unablässigen Veränderungen der Systemzustände eine gewisse Bandbreite von Informationen als Semantiken für die Wiederverwendung fixieren. Jene Semantiken setzen immer schon voraus, „daß das System schon vorliegt, sind also nie konstitutive, sondern immer nachträgliche Operati- 95 96 97 98 Reinhart Koselleck verwendet die Unterscheidung von sprachlicher und nicht-sprachlicher Realität als Bezugsgrößen, um Konvergenzen und Divergenzen zwischen der Sozialgeschichte und der Begriffsgeschichte herauszuarbeiten. Vgl. KOSELLECK, Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte (wie Anm. 71). Vgl. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 538. Verstehen einer Mitteilung darf in diesem Zusammenhang nicht mit einem hermeneutischen Sinnverstehen verwechselt werden. Es geht einzig und alleine darum, dass eine Kommunikation immer auch Bezug auf das nimmt, woran sie anschließt. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 884. 48 onen [...].“99 Es sind, mit anderen Worten, Beschreibungen einer die Beobachtungsoperation erst ermöglichenden Ordnung. Betrachtet man sich unter diesem Blickwinkel das Verhältnis von Semantik und Gesellschaftsstruktur, kommt den Umbruchsphasen von einer zur nächsten Differenzierungsform – der „Sattelzeit“100, wie es Reinhart Koselleck für den Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert formuliert hat – in zweierlei Hinsicht eine maßgebliche Bedeutung zu. Zum einen hängt die Plausibilität von Semantiken davon ab, inwieweit sie sich als kompatibel mit den Systemstrukturen erweisen, die sich auf der Ebene der basalen Selbstreferenz ausdifferenzieren. Semantiken können nur in dem Maße als wiederverwendbar und aufbewahrungswürdig ausgezeichnet werden, wie sie die Gesellschaftsstrukturen zu stabilisieren imstande sind. Es ist daher zu vermuten, dass die Umstellung einer Differenzierungsform auch in der Semantik einer Gesellschaft ihren Niederschlag findet. Zum anderen können in einer Gesellschaft nicht nur verschiedene Differenzierungsformen miteinander kombiniert werden,101 ihre Kommunikationszusammenhänge weisen mit der Interaktion und der Organisation immer auch Ordnungsformate des Sozialen auf, die sich nicht als gesellschaftliche Teilsysteme konstituieren. In ihnen lassen sich relativ gefahrlos Semantiken ausprobieren, die auf einen von der primären Differenzierungsform abweichenden Modus der Komplexitätsreduktion rekurrieren. Es sind zumeist die Brutstätten für Semantiken, die den Entwicklungen der Sozialstruktur vorauseilen. Luhmann spricht in diesem Zusammenhang von preadaptive advances, „die im Rahmen eines älteren Ordnungstypus entwickelt und stabilisiert werden können, die aber erst nach weiteren strukturellen Änderungen des Systems in ihre endgültige Funktion eintreten. Preadaptive advances sind sozusagen Lösungen für Probleme, die noch gar nicht existieren. [...] Sie können strukturelle Veränderungen vorbereiten, ohne sie schon voraussetzen zu müssen.“102 Katastrophen können sich also durchaus auf der Ebene der Semanti- 99 100 101 102 Ebd. S. 883. Urs Staehli hat dem systemtheoretischen Modell der ‚linearen Nachträglichkeit’ das psychoanalytische Modell der ‚konstitutiven Nachträglichkeit’ kritisch entgegengestellt. „Die Systemtheorie geht davon aus, daß ein blindes Operieren die Grenzen eines Systems erzeugt und damit auch bereits Komplexität reduziert, die durch Selbstbeobachtungen und -beschreibungen weiter reduziert werden kann. Gerade diese Präexistenz des Systems macht es möglich, die Beziehung von operativer Autopoiesis und ihrer semantischen Selbstbeschreibung letztlich mit einem Modell zu erklären, das von einem präkonstituierten Signifikat (‚dem funktional differenzierten System’) für die Semantik ausgeht. Das psychoanalytische Modell der Nachträglichkeit dekonstruiert dagegen die Annahme, daß Beschreibungen stets auch zu spät sind, um systemkonstitutiv sein zu können und Differenzierungstypen mitzubestimmen. Hier sind Selbstbeschreibungen nicht nur ein komplexitätssteigernder Zusatz, sondern entfalten retroaktive Effekte auf die von ihnen beobachtete Ebene.“ STÄHELI, Urs: Die Nachträglichkeit der Semantik. Zum Verhältnis von Sozialstruktur und Semantik. In: Soziale Systeme 4 (1998), S. 315-339, hier S. 330 f. KOSELLECK, Einleitung (wie Anm. 71), S. XV. Rudolf Stichweh nennt mit der ‚Zweitinterpretation einer Einheit’, der ‚Koexistenz’ und der ‚Innendifferenzierung von Teilsystemen’ drei verschiedene Möglichkeiten der Kombinierbarkeit von Differenzierungsformen. Vgl. STICHWEH, Rudolf: Soziologische Differenzierungstheorie als Theorie sozialen Wandels. In: MIETHKE, Jürgen / SCHREINER, Klaus (Hg.): Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen. Sigmaringen 1994, S. 29-44, hier S. 41. LUHMANN, Niklas: Geschichte als Prozeß und die Theorie sozio-kultureller Evolution. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 1981, S. 178-197, hier S. 191. 49 ken ankündigen. In Kapitel 4 - Das Interaktionssystem der personalen Hilfe werde ich dementsprechend der Hypothese nachgehen, ob wir es bei dem Bettler mit einem solchen semantischen Vorboten einer neuen Zeit zu tun haben, der den Übergang von der stratifikatorischen zur funktional differenzierten Gesellschaft begleitet. 50 2. Reziprozität – Ein sozialintegrativer Mechanismus der Gesellschaft? 2.1 Vorbemerkungen zur gesellschaftstheoretischen Verankerung des Verhaltensprinzips der Reziprozität Die soziologische Theorie hat das Problem der doppelten Kontingenz, obgleich es unter diesem Namen so nicht geführt wurde, stets aufs Neue zum Anlass genommen, einen systematisierenden Blick auf die Bedingungen der Möglichkeit sozialer Ordnung zu werfen. Ziel dieser Bemühungen war und ist es noch heute, einen sozialintegrativen Mechanismus ausfindig zu machen, mit dem sich die in der Gesellschaft zur Geltung kommenden Beschränkungen individuellen Verhaltens erklären lassen. Konzepte wie ‚Wechselwirkung’, ‚Reziprozität der Perspektiven’ und ‚Reziprozität von Leistungen’ sind Zeugnisse dieser Suche nach einem globalen Lösungsansatz des Ordnungsproblems sozialer Vergemeinschaftungsformen. Über die soziologische Theorie hinaus wird der Reziprozität auch in verwandten Disziplinen wie der Moralphilosophie, der politischen Theorie, der Psychologie, der Volkswirtschaftslehre und selbst der Logik eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.103 Der eigentliche Verdienst aber, das Verhaltensprinzip der Reziprozität entdeckt und als einen sozialintegrativen Mechanismus der Gesellschaft näher analysiert zu haben, bleibt der ethnologischen und sozialanthropologischen Forschung vorbehalten. Obschon bereits in der antiken Philosophie mit ihrer Vorstellung der Freundschaft (philia) bis hin zum spätaufklärerischen Entwurf einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft Reflexionen zur Gegenseitigkeit des Verhaltens unternommen wurden, so war es doch erst die sozialanthropologischethnologische Forschung, die den Topos der Reziprozität in ein (mehr oder weniger) elaboriertes System von theoretischer Abstraktheit eingearbeitet und damit für den wissenschaftlichen Diskurs über die immerwährenden Gesetzmäßigkeiten des Sozialen fruchtbar gemacht hat. Insbesondere Autoren wie Bronislaw Malinowski, Marcel Mauss, Richard C. Thurnwald, Alfred R. Radcliffe-Brown und Claude Lévi-Strauss verdanken wir erste systematische Einblicke in die Beschaffenheit und Funktionsweise der Reziprozität.104 Ihre Arbeiten konzentrieren sich dabei vornehmlich auf archaische Figurationen der Gegenseitigkeit, wie sie sich idealtypisch an dem Ga- 103 104 Vgl. BECKER, Lawrence C.: Reciprocity. London / New York 1986; ANTONUCCI, Toni C. / JACKSON, James S.: The Role of Reciprocity in Social Support. In: SARASON, Barbara (Hg.): Social Support. An Interactional View. New York 1990, S. 173-198; FEHR, Ernst / GÄCHTER, Simon: Fairness and Retaliation. The Economics of Reciprocity. In: Journal of Economic Perspectives 14 (2000), S. 159-181; JOHNSTON, Frederick S.: Fundamental Relationships and Their Logical Formulations. New York 1974. Vgl. die einschlägigen Arbeiten von MALINOWSKI, Bronislaw: Argonauten des westlichen Pazifiks. Ein Bericht über Unternehmungen und Abenteuer der Eingeborenen in den Inselwelten von Melanesisch-Neuguinea. Frankfurt (Main) 1979; MAUSS, Marcel: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Frankfurt (Main) 1990; THURNWALD, Richard C.: Gegenseitigkeit im Aufbau und Funktionieren der Gesellungen und deren Institutionen. In: ALBRECHT, Gerhard / JURKAT, Ernst (Hg.): Reine und angewandte Soziologie. Eine Festgabe für Ferdinand Tönnies zu seinem achtzigen Geburtstage am 26. Juli 1935. Leipzig 1936, S. 275-297; LÉVI-STRAUSS, Claude: Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft. Frankfurt (Main) 1993. 51 bentausch exemplifizieren lassen. Mit dem Gabentausch, so die einhellige Auffassung, liegt eine Urform sozialer Beziehungen vor, die sich gegenüber den modernen Gestaltungen wirtschaftlicher Tauschbeziehungen deutlich abgrenzt. Während dem Akt des Gebens und Nehmens in archaischen Gesellschaften ein psychologisches Korrelat unterliegt, welches sich in dem Gefühl eines persönlichen Verpflichtetseins manifestiert, zählt im ökonomischen Tausch alleine die an der wechselseitigen Bedürfnisbefriedigung ausgerichtete materielle Balance im Verhältnis von Leistung und Gegenleistung. Jan van Baal hat die Merkmale dieses Unterschieds wie folgt zusammengefasst: „In gift-exchange goods are exchanged for the purpose of establishing or strengthening a relation between the persons who make the exchange. In trade the relations between those engaged are weak [...] and the participants’ aim is not to strengthen their mutual relations but to acquire one another’s goods. Whereas the gift establishes or strengthens a bond, a sale exhausts the (weak) link between the traders; the act accomplished, the parties disperse without any future obligation toward each other.“105 Anschlussverpflichtungen, die über den tatsächlichen Tausch hinausgehen und auf diese Weise soziale Kohäsion garantieren, fehlen hier gänzlich. Je mehr also der wirtschaftlich-materielle Aspekt des Tauschverhaltens im historischen Zeitverlauf in den Vordergrund tritt, umso dringender zeichnet sich ein gesellschaftlicher Bedarf ab, ein von bestehenden persönlichen Bindungen abstrahierendes formelles Recht zu institutionalisieren, in dem sich die Grundsätze sozialen Zusammenlebens allgemeingültig definiert finden. Es geht dann um die Frage, inwieweit sich in den Tauschbeziehungen Gerechtigkeit verwirklichen oder auch Macht und Abhängigkeit beschränken lassen. Die sozialanthropologisch-ethnologische Forschung hat letztlich das Feld bereitet, auf dem die Soziologie schließlich ihre eigenen Theorien zu entwickeln vermochte. Folgende zentrale Grundannahmen, mit denen sich das Verhaltensprinzip der Reziprozität gesellschaftstheoretisch verankern ließ, wurden dabei weitestgehend übernommen: „(A) It is believed to be ubiquitos: thus, even when the possibility of exploitive relationships is taken into account, there is the assumption that social life would be impossible without some minimal commitment to returning benefits. [...] (B) It provides the basis for the emergence of structured relationsships. [...] Reciprocity, in this sense, is constitutive of continous emergence and reconfirmation of social structure. [...] (C) Reciprocity is fundamentally an interpersonal tie. [...] Reciprocity, at the interpersonal level, always implied the ability or capacity to forecast the other’s behaviour with respect to the indications that ones presents.”106 Insbesondere bei einigen amerikanischen Soziologen lässt sich dabei eine Tendenz feststellen, die Reziprozität von Leistungen zum eigentlichen Antrieb sozialen Handelns hypostasieren zu wollen. Jedes Verhalten, zu dem sich ein Individuum entscheidet, 105 106 BAAL, Jan van: Reciprocity and the position of women. Anthropological Papers. Assen 1975, S. 39. BRITTAN, Arthur: Meanings and Situations. London / Boston 1973, S. 38 f. 52 wird letztendlich durch das Verhalten eines anderen Individuums stimuliert. Dem ausschließlich seinen Eigeninteressen verpflichteten Individuum dient das Wissen um diese Gegenseitigkeit als eine Richtschnur, die es ihm ermöglicht, mit anderen Individuen zwecks Maximierung der Effizienz seines Handels in sozialen Gruppen zusammenzuleben. Es ist wohl diese Frage nach den Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit sich soziale Strukturen im sozialen Miteinander entfalten und erhalten können, die dazu geführt hat, dass das Thema jüngst auch in der deutschsprachigen soziologischen Literatur wieder Fuß fasst, „scheint doch gerade angesichts einer Anzahl sich lösender Bindungen, die Gegenseitigkeit eines der letzten universal gültigen beziehungsstiftenden Regularien zu sein, die Bindungen produziert und reproduziert und auf diese Weise zur Herstellung eines gesellschaftlichen Gefüges, einer Struktur einen wesentlichen Beitrag leistet.“107 Doch eine solche Aussage wirft für sich besehen gleich eine ganze Reihe von Fragen auf, die eine soziologische Theorie der Reziprozität zu beantworten hat. Sind es tatsächlich die über Interaktionen sich einstellenden Bindungen, die eine Struktur hervorbringen, oder sind es nicht umgekehrt die sozialen Strukturen respektive Symbole, die den Vollzug von Interaktionen überhaupt erst ermöglichen? Des Weiteren bleibt unklar, ob lediglich dort jene für das gesellschaftliche Gefüge notwendigen sozialen Beziehungen entstehen können, wo auch die Regularien der Reziprozität am Werke sind? Was hat man dann allerdings jenseits dieser Bindungen produzierenden und reproduzierenden sozialen Beziehungen zu erwarten: Chaos, Anarchie, Beliebigkeit, ein Kampf aller gegen alle, dem allein noch das Recht die Stirn zu bieten vermag? Gehören diese Bereiche, in denen sich Verhaltensweisen beobachten lassen, die gerade von jeder Notwendigkeit absehen, emotionale Bindungen zwischen Personen aufbauen zu müssen, überhaupt noch zur Gesellschaft? Und wenn dies nicht der Fall ist, macht es dann noch Sinn von einem gesellschaftlichen Gefüge zu sprechen, wenn dieses analytische Gebilde nicht einmal imstande ist, alltägliche Formen zwischenmenschlicher Kontakte zu erfassen? Oder wäre es mithin nicht konsequenter, den Gesellschaftsbegriff ganz fallen zu lassen und damit ausschließlich die einzelnen sozialen Beziehungen in den Blick zu nehmen, so wie es Simmel vorgeschlagen hat? Die Soziologie hat sich seit jeher zur Aufgabe gemacht, das eine, alle sozialen Interaktionen umfassende Band zu benennen, das sich für den Zusammenhalt der Gesellschaft, für ihre Integration, verantwortlich zeichnet. Während der methodische Individualismus versucht, über das natürliche Eigeninteresse und die rationale Zweckgerichtetheit des Individuums die Einheit der Gesellschaft zu wahren, wird die konzeptionelle Alternative offenbar darin gesehen, das Soziale als ein Wesen sui generis zu begreifen, dem es seine geheimen Gesetzmäßigkeiten zu entreißen gilt. Aber wie in dem einen scheint auch in dem anderen Fall eine gesunde Skepsis angebracht. 107 STEGBAUER, Christian: Reziprozität. Einführung in soziale Formen der Gegenseitigkeit. Wiesbaden 2002, S. 157. Vgl. dazu auch die Beiträge in ADLOFF, Frank / MAU, Steffen (Hg.): Vom Geben und Nehmen. Zur Soziologie der Reziprozität. Frankfurt (Main) 2005. 53 Denn gerade das ausgewiesene Ziel, der gesellschaftlichen Einheit eine Letztbegründung und einen universalhistorischen Stabilisationsfaktor zu unterlegen, markiert keineswegs eine Selbstverständlichkeit, die über jeden Zweifel erhaben wäre. Wenn es zutrifft, worauf Rudolf Stichweh hingewiesen hat, dass für eine multiple Verankerung des Individuums in die vielfältigen Funktionszusammenhänge der modernen Gesellschaft gerade ‚weak ties’ eine entscheidende Rolle spielen, „d.h. soziale Kontakte, die nicht der laufenden Affirmation bedürfen“,108 gilt es sich wohl von einer Gesellschaftsauffassung zu verabschieden, die in den sozialen Bindungen der Gesellschaftsmitglieder die unabdingbare Voraussetzung ihres Funktionierens erblickt. Im folgenden Kapitel soll nun genauer geklärt werden, was es heißt, mit einer soziologischen Theorie zu arbeiten, die die Gesellschaft nicht mehr als ein aus verschiedenen Teilen zusammengesetztes Ganzes, sondern als ein in sich differenziertes soziales System versteht, das sich erst über die Differenz zu seiner außergesellschaftlichen Umwelt konstituiert. Gegenüber Friedrich H. Tenbruck, der ähnlich wie Simmel für eine prinzipielle Verwerfung des Gesellschaftsbegriffs plädiert, kommt diesem in der Systemtheorie eine durchaus zentrale Bedeutung zu – allerdings in „einem radikal antihumanistischen, einem radikal antiregionalistischen und einem radikal konstruktivistischen“109 Sinne. Den Vorwurf Tenbrucks, die Soziologie könne ihre eigenen Vorannahmen – nämlich zum einen, „daß sich alles Zusammenleben global in eine Vielheit von Gesellschaften aufgliedern läßt, die sich aus sich selbst bestimmen und entwickeln [...], so daß alle Menschen, von Ausnahmen abgesehen, prinzipiell einer Gesellschaft angehören“110, und zum anderen, dass bei einer Kenntnis der Gesetze des Sozialen gesellschaftliche Entwicklungen berechenbar und vorhersehbar werden111 – nicht verifizieren, entkräftet Luhmann durch eine Theorie der Systemdifferenzierung auf der einen und einer Theorie der sozialen Evolution auf der anderen Seite. Bei der Beantwortung der Frage, welchen Stellenwert die Systemtheorie dem Verhaltensprinzip der Reziprozität bei der Hervorbringung und Stabilisierung gesellschaftlicher Strukturen einräumt, wird es somit unumgänglich sein, diese beiden Theoriebausteine mit zu berücksichtigen. In einem ersten Schritt sollen zunächst klassische Positionen zur Reziprozität dargestellt werden, um dann in einem zweiten Schritt die bei jenen Autoren aufgeworfenen gesellschaftstheoretischen Fragestellungen mit dem Blick der Systemtheorie neu auszuleuchten. Luhmann betrachtet dabei Reziprozität als einen historischen Sonderfall der Lösung des Problems der doppelten Kontingenz, der vor allem in Gesellschaften zur Anwendung kommt, die sich über Mitgliedschaften definieren und über Interaktionen kontinuieren. 108 109 110 111 STICHWEH, Rudolf: Zum Verhältnis von Differenzierungstheorie und Ungleichheitsforschung. Am Beispiel der Systemtheorie der Exklusion. In: SCHWINN, Thomas (Hg.): Differenzierung und soziale Ungleichheit. Die zwei Soziologien und ihre Verknüpfung. Frankfurt (Main) 2004, S. 353-367, hier S. 357. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 35. TENBRUCK, Grundlagen der Gesellschaft (wie Anm. 80), S. 205 f. Vgl. ebd., S. 206. 54 2.2 Zur klassischen Soziologie der Reziprozität 2.2.1 Die Sozialanthropologie Marcel Mauss’ Die wichtigsten gesellschaftstheoretischen Problemstellungen, welche die Soziologie mit dem Verhaltensprinzip der Reziprozität zu lösen hofft, finden sich bereits bei dem französischen Sozialanthropologen Marcel Mauss formuliert. In seinem berühmten Essay Die Gabe begibt sich Marcel Mauss auf die Suche nach dem elementaren Vergesellschaftungsprinzip, durch das der Mensch der Natur entrissen und als ein soziales Wesen konstituiert wird.112 Sein Ziel ist es, mittels der Erforschung archaischer Gesellschaftsformationen gleichsam die Ursprünge wie auch die zu allen Zeiten wirksamen Bestandteile dieses Prinzips aufzudecken. Offenkundig war Marcel Mauss bei diesem Vorhaben von dem soziologischen Forschungsprogramm Èmile Durkheims inspiriert, der in seiner Kritik an der ökonomisch-utilitaristischen Denktradition die zentrale Frage aufwarf, ob ein geordnetes Zusammenleben von Individuen alleine auf der Grundlage ihrer egoistischen Nutzenkalküle möglich sein kann. Gegen eine solche Auffassung wendet sich Durkheim nachdrücklich, wenn er schreibt: „Denn wo das Interesse allein regiert, ist jedes Ich, da nichts die einander gegenüberstehenden Egoismen bremst, mit jedem anderen auf dem Kriegsfuß, und kein Waffenstillstand kann diese ewige Feindschaft auf längere Zeit unterbrechen. Das Interesse ist in der Tat das am wenigsten Beständige auf der Welt. Heute nützt es mir, mich mit ihnen zu verbinden; morgen macht mich derselbe Grund zu ihrem Feind. Eine derartige Ursache kann damit nur zu vorübergehenden Annäherung und zu flüchtigen Verbindungen führen.“113 Durkheim bezieht sich hier augenscheinlich auf den von Thomas Hobbes beschriebenen Naturzustand des Menschen, in dem ein Krieg eines jeden gegen jeden herrscht. Allerdings geht er in Abgrenzung zu Hobbes davon aus, dass Verträge keineswegs hinreichen, um aus einer Ansammlung von ihren Eigeninteressen verpflichteter Individuen eine soziale Ordnung zu begründen. Die rechtliche Durchsetzbarkeit von Verträgen setzt vielmehr bereits die Gesellschaft als einen „soziologischen Tatbestand“114 voraus, der den beteiligten Vertragspartner, eben weil er ihnen allen als eine emergente Struktur äußerlich bleibt, kollektive Verhaltensregeln aufzwängt. Die Einhaltung von Verträgen ist somit an einen gewissen sozialen Zusammenhalt (cohésion sociale) jener Personen geknüpft, welche sich bereit erklärt haben, die in ihnen festgeschriebenen Verhaltenseinschränkungen als Grundlage ihrer Lebensführung zu akzeptieren.115 Eine jede Gesellschaft gründet also auf einem solidarischen Zusammengehörigkeitsgefühl, das im Vertrag allenfalls seine rechtliche und in der Erziehung seine moralische Absicherung findet. Durkheim interessiert sich somit nicht nur für die Repräsentationen, welche dieses Zusammengehörigkeitsgefühl äußerlich 112 113 114 115 Vgl. MAUSS, Gabe (wie Anm. 104). DURKHEIM, Arbeitsteilung (wie Anm. 90), S. 260. Vgl. DURKHEIM, Regeln der soziologischen Methode (wie Anm. 18), S. 105 ff. Vgl. DURKHEIM, Arbeitsteilung (wie Anm. 90), S. 256 ff. 55 sichtbar machen, er fragt zudem nach den Praktiken, die daran beteiligt sind, einen solchen inneren Zustand, in dem sich der Einzelne in seiner Persönlichkeit als Angehöriger eines umfassenderen Ganzen erfährt, hervorzubringen. Um nun die spezifischen Charakteristika der modernen Gesellschaft darlegen zu können, nimmt er eine evolutive Perspektive ein, die darauf abzielt, den kausalen Entwicklungszusammenhang sozialer Strukturen offen zu legen. Während segmentäre Gesellschaften noch alles daran setzen müssen, Solidarität über die Ähnlichkeit ihrer Mitglieder zu generieren, sehen moderne Gesellschaften gerade Möglichkeiten ihrer Spezialisierung vor. Mit der Arbeitsteilung etabliert die moderne Gesellschaft eine soziale Ungleichheit, durch die dem Individuum seine Abhängigkeit von den Leistungen seines sozialen Gegenübers vor Augen geführt wird. Analog zu diesen historischen Gesellschaftsbeschreibungen Durkheims macht Marcel Mauss den Gabentausch als eine Urform der überindividuellen Vertragsbindung aus, die an der Hervorbringung eines solidarischen Zusammengehörigkeitsgefühls von Gesellschaftsmitgliedern entscheidend beteiligt ist. Während es Durkheim jedoch vornehmlich darum geht, die soziale Bedingtheit des Individuums zu belegen und die jeweiligen Mechanismen herauszuarbeiten, durch die es in die Gesellschaft integriert wird, fügt Mauss dieser soziologischen Analyseebene die der Interaktionsbeziehungen zwischen den Individuen hinzu. Indem er der Gabe eine Kraft zuschreibt, Interdependenzen zwischen den Individuen zu begründen, betont Mauss ihren Symbolcharakter. Symbole sind nicht einfach nur Zeichen bereits bestehender sozialer Beziehungen, sie bringen diese vielmehr durch ihre Verwendung in der Praxis hervor. Über den Einsatz von Symbolen wird es möglich, das getrennt voneinander Existierende als eine zusammengehörige Einheit zu denken. Die Gabe figuriert damit zum elementaren Vergesellschaftungsprinzip segmentärer Gesellschaften. Ihrer sozialintegrativen Wirkungsweise versucht sich Mauss zunächst dadurch zu nähern, dass er die einzelnen Elemente, aus denen sie sich zusammensetzt, je für sich betrachtet. Jeder Gabentausch besteht demnach aus drei analytisch isolierbaren Operationen, die in der Form von Verpflichtungen, nämlich des Gebens, Annehmens und Erwiderns, eine spezifische Sequenz von Verhaltensweisen in Gang setzen. Die Verpflichtung zu Geben erklärt sich zum einen aus moralischen Gründen – dem Nichtgeben haftet zugleich auch der Makel an, Freundschaft und Gemeinschaft zu verweigern – und zum anderen aus dem Fehlen von Eigentumsrechten.116 Solange, wie eine Sache nicht der freien Disposition ihres Eigentümers untersteht, existiert eine Verbindlichkeit zur Gabe, weil ein jeder auf alles, was gegeben werden kann, einen generellen Anspruch hat. Die Freiwilligkeit der Gabe äußert sich hier darin, dass sie ohne Vorleistung desjenigen erfolgt, an den sie sich richtet. Der Nehmende seinerseits sieht sich aus den gleichen moralischen und rechtlichen Gründen mit der Erwartung konfrontiert, diese anzu116 Vgl. MAUSS, Gabe (wie Anm. 104), S. 36 ff. 56 nehmen. Neben dem Geben und Annehmen ist der Gabe zudem die Verpflichtung immanent, sie – wenn auch nicht unmittelbar – zu erwidern. Marcel Mauss konzentriert sich nun maßgeblich auf jene letzte der drei Pflichten, indem er danach fragt, warum in archaischen Gesellschaften Gaben obligatorisch erwidert werden und welche Kräfte in ihnen stecken, die bewirken, dass sie zum Geber zurückkehren.117 Es geht ihm dabei letztlich um das Problem, wie es einer Gesellschaft gelingen kann, zeitbeständige Bindungen zwischen ihren Mitgliedern zu etablieren. Bei der Lösung dieses Problems orientiert sich Mauss an den religiösen Glaubensvorstellungen archaischer Gesellschaften, in denen sich die Gründe, auf eine Gabe mit einer Gegengabe zu reagieren, festgehalten finden. Danach wohnt jeder Gabe nicht nur eine magische Kraft inne, das hau, die darauf drängt, sich wieder mit seinem ursprünglichen Besitzer zu vereinen, sie führt darüber hinaus die geistige Präsenz des Gebers mit sich, die über den Empfänger eine verpflichtende Macht ausübt, seinerseits die Gabe zu einem späteren Zeitpunkt zu vergelten.118 Das hau macht die Gabe erst zu einem Symbol, das zwei Individuen miteinander in eine soziale Beziehung setzt. Auf diese Weise entsteht ein zirkuläres Verhältnis zwischen Geber und Nehmer, das den Geber zum Nehmer bzw. den Nehmer zum Geber werden lässt. Es ist diese Moral und Ökonomie der Gabe, auf deren Basis archaische Gesellschaften den gegenseitigen Austausch von materiellen Gütern, aber auch von Festessen, Riten, Frauen, Kindern, Arbeit etc. organisieren und „eine bestimmte Mentalität [hervorbringen – J.H.]: daß nämlich alles [...] Gegenstand der Übergabe und der Rückgabe ist. Alles kommt und geht, als gäbe es einen immerwährenden Austausch einer Sachen und Menschen umfassenden geistigen Materie zwischen den Clans und den Individuen, den Rängen, Geschlechtern und Generationen.“119 Marcel Mauss betrachtet den Gabentausch folgerichtig auch als ein „System der totalen Leistungen“,120 das juristische, religiöse, mythologische, ästhetische Aspekte umspannt und dabei eine soziale Morphologie entwirft, die nicht nur einzelne Individuen, sondern ganze Gruppen, Familien, Clans, Stämme aneinander bindet. Beim Gabentausch steht insofern nicht ein ökonomischer Nutzen und Zweck im Vordergrund, in seiner agonistischen Ausformung, dem Potlatsch, geht es vielmehr um Anerkennung, Einfluss und Prestige zwischen den Gesellschaftsmitgliedern.121 Wer zu geben imstande ist, dem kommt zugleich auch die Gunst der anderen Gesellschaftsmitglieder zu. Die Gabe erscheint somit als das Medium der Integration, welches zum einen im Innersten der Gesellschaft für den Ausgleich ihrer verschiedensten Lebenssphären Sorge trägt und zum anderen gleichzeitig die Regeln festlegt, unter denen der Einzelne bzw. die Gruppe an der Gesellschaft mit anderen zu partizipieren 117 118 119 120 121 Vgl. ebd., S. 18. Vgl. ebd., S. 31 ff. Ebd., S. 39. Ebd., S. 22. Der Verweis darauf, dass eine Gabe nicht zwangsläufig einen agonistischen Charakter annehmen muss, findet sich bei GOEDLIER, Maurice: Das Rätsel der Gabe. Geld, Geschenke, heilige Objekte. München 1999, S. 61 ff. 57 vermag. In seiner Erklärung, warum Gaben zu Gegengaben verpflichten, tritt dabei die Nähe Marcel Mauss’ zu den religionssoziologischen Überlegungen Durkheims deutlich zu Tage.122 Die religiösen Glaubensüberzeugungen, auf die sich Mauss bezieht, entspringen demnach dem Gefühl, einer höheren und übermächtigen Gemeinschaft anzugehören, die den Einzelnen als Individuum transzendiert und kollektiven Zwängen unterwirft. Bei der Gabe handelt es sich somit letztendlich um eine rituelle Praktik, durch welche die Gemeinschaft, indem sie sich ihrer Einheit vergegenwärtigt, diese auch gleichzeitig reproduziert.123 Wer sich außerhalb dieses Systems von Gabe und Gegengabe befindet, der steht zugleich auch außerhalb der Gemeinschaft. 2.2.2 Der Strukturalismus Claude Lévi-Strauss’ Die an Glaubensüberzeugungen orientierte Sicht auf die Gabe war es, die Claude Lévi-Strauss dazu veranlasste, eine von seinen Gegnern wie auch von seinen Anhängern als Wiege des französischen Strukturalismus gewürdigte Kritik an der phänomenologischen Vorgehensweise von Marcel Mauss zu formulieren. In seiner Abhandlung Die Gabe, so kann man bei Lévi-Strauss nachlesen, versucht Marcel Mauss, „ein Ganzes aus Teilen zu rekonstruieren, und da dies sichtlich unmöglich ist, muß er diesem Gemisch ein zusätzliches Quantum hinzufügen, das ihm die Illusion gibt, seine Rechnung ginge auf. Dieses Quantum ist das hau.“ Aber, so führt er weiter aus: „Das hau ist nicht der letzte Grund des Austauschs: es ist die bewußte Form, in welcher die Menschen einer bestimmten Gesellschaft, in der das Problem eine besondere Bedeutung hatte, eine unbewußte Notwendigkeit erfaßt haben, deren Grund anderswo liegt.“124 Wo aber hat der Wissenschaftler zu suchen, um diesen durch die bewusste Form verdeckten Grund des Gabentauschs offen zu legen? Lévi-Strauss vermutet ihn in den „unbewußten mentalen Strukturen [...], die sich durch die Institution hindurch und besser noch in der Sprache fassen lassen.“125 Unbewusst sind diese Denkstrukturen, nicht etwa weil sie latente Gefühle bzw. verdrängte Wünsche und Hoffnungen im Unterbewussten des Menschen beheimaten, sie sind es vielmehr, weil sie auf natürliche, unveränderliche Gesetze und Prinzipien verweisen, die dem menschlichen Denken universal zu 122 123 124 125 Vgl. DURKHEIM, Emile: Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt (Main) 1981. Entsprechend hat Maurice Godelier darauf hingewiesen, dass die Phänomene der Gabe auch aus dem Grunde als ‚total’ betrachtet werden müssen, „weil sie es der Gesellschaft in gewisser Weise gestatten, sich zu repräsentieren und sich als ein Ganzes zu reproduzieren.“ GOEDLIER, Rätsel der Gabe (wie Anm. 121), S. 61. LÉVI-STRAUSS, Claude: Einleitung in das Werk von Marcel Mauss. In: MAUSS, Marcel: Soziologie und Anthropologie. Bd. I. Theorie der Magie, soziale Morphologie. Frankfurt (Main) / Berlin / Wien 1978, S. 7-41, hier S. 31. Ebd., S. 31. 58 jedem Zeitpunkt seiner phylogenetischen Entwicklung zugrunde liegen.126 Mentale Strukturen sind Verarbeitungsregeln, die dem Wahrgenommenen bestimmte Formen aufzwängen – vergleichbar etwa mit der Grammatik, die es ermöglicht, aus Worten eine schier unendliche Fülle von Sätzen zu bilden, ohne dabei jedoch eine Beliebigkeit der Satzstrukturen zuzulassen. Von der strukturalen Methode der Linguistik beeinflusst geht es Lévi-Strauss darum, eine Anthropologie zu entwerfen, „die uns eines Tages die geheimen Kräfte aufdecken wird, welche unseren Gast bewegen, der, ohne zu unseren Debatten eingeladen zu sein, anwesend ist: den menschlichen Geist.“127 Für die Anthropologie stellt sich insofern die voraussetzungsvolle Aufgabe, den Menschen in das Spannungsfeld von Natur und Kultur zu verorten. Aufgrund seiner geistigphysischen Veranlagung ist er zum einen lediglich fähig, den bewussten Denkinhalten, die ihn in seinem Handeln leiten, spezifische Ausdrucksformen zu verleihen, so dass letztendlich jedes kulturelle Artefakt Spuren seiner natürlichen Dispositionen bewahrt. Dem Menschen bleibt es, mit anderen Worten, verwehrt, seine Natur mittels der Kultur zu überwinden. Zum anderen werden ihm aber durch die Kultur bestimmte Regeln auferlegt, die den Modus seiner sozialen Kontakte regulieren. Diese kollektiven Vorstellungen und Institutionen liefern die materielle Grundlage, auf die der Kulturanthropologe zurückgreifen muss, will er die hinter der phänomenalen Welt verborgen liegenden Strukturen unseres Denkens anhand wissenschaftlicher Modelle frei legen. Durch welche Merkmale lassen sich nun Lévi-Strauss zufolge diese unbewussten mentalen Strukturen, welche die Kultur in ihren empirischen Erscheinungsformen prägen, näher definieren? „Uns scheint, es sind ihrer drei: die Notwendigkeit der Regel als Regel; der Begriff der Gegenseitigkeit, der als die unmittelbarste Form betrachtet werden kann, in die sich der Gegensatz zwischen dem Selbst und den Anderen integrieren läßt; und schließlich der synthetische Charakter der Gabe, d.h. die Tatsache, daß die freiwillige Übertragung eines Wertgegenstandes von einem Individuum auf ein anderes diese Individuen in Partner verwandelt und dem übertragenen Wertgegenstand eine neue Qualität hinzufügt.“128 Die Regel als Regel verweist auf einen kognitiven Mangel des Menschen, der im Unterschied zum Tier aufgrund seiner fehlenden Instinktgeleitetheit darauf angewiesen ist, die auf ihn einwirkende Flut von Umweltreizen durch Regeln zu ordnen. In einer Welt ohne Regeln herrscht die Natur, wohingegen keine Kultur ohne Regeln von Bestand sein kann. Neben den Sprach- und ökonomischen Tauschregeln sind es nach LéviStrauss insbesondere die Heiratsregeln, welche sich für die Sozialordnung einer Gesellschaft ver- 126 127 128 Zur Bedeutung des Unbewussten und Unterbewussten bei Lévi-Strauss vgl. FLEISCHMANN, Eugène: Claude Lévi-Strauss über den menschlichen Geist. In: LEPENIES, Wolfgang / RITTER, Hanns H. (Hg.): Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claude Lévi-Strauss. Frankfurt (Main) 1974, S. 77-109. LÉVI-STRAUSS, Claude: Sprachwissenschaft und Anthropologie. In: LÉVI-STRAUSS, Claude: Strukturale Anthropologie I. Frankfurt (Main) 1991, S. 80-94, hier S. 94. LÉVI-STRAUSS, Verwandtschaft (wie Anm. 104), S. 148. 59 antwortlich zeichnen.129 Die Regeln selbst müssen dabei unabhängig von ihrer jeweiligen kulturellen Ausformung eine Gestalt annehmen, die der binären Opposition bzw. Reziprozität entspricht. Solche binären Oppositionen sind Bedingungen der Möglichkeit, die Kontinuität des Raums wie auch der Zeit in wechselseitig aufeinander verweisende Abschnitte und Klassen zu dekomponieren.130 Sie bilden darüber hinaus die Basis, um Menschen bzw. soziale Gruppen nicht nur voneinander unterscheiden, sondern auch miteinander in Beziehung setzen zu können. In solchen Beziehungen kommen die Gemeinsamkeiten bzw. Berührungspunkte der entsprechenden Oppositionen zum Ausdruck. Diese Fähigkeit zum Symbolisieren der Einheit einer Differenz ist dem menschlichen Geist von Natur aus gegeben. Im sozialen Miteinander konstituiert somit der Austausch von Frauen, von Mitteilungen und ökonomischen Gütern die Differenz zwischen Geber und Nehmer und bringt diese gleichzeitig zur Einheit, indem er eine Äquivalenzbeziehung zwischen beiden Seiten herstellt. Von einer Gesellschaft lässt sich demnach nur dann sprechen, wenn Individuen oder Gruppen im Tauschverkehr miteinander stehen.131 Hatte Mauss noch versucht, den Gabentausch von den Individuen und ihren gesellschaftlich bedingten Motiven her zu verstehen, so wird diese Sichtweise bei Lévi-Strauss vom Kopf auf die Füße gestellt. Der Tausch erscheint bei ihm nicht mehr als eine Wirkung der Gesellschaft, sondern er ist „die Gesellschaft selbst in actu.“132 Es sind somit auch nicht die einzelnen individuellen Verpflichtungen des Gebens, Annehmens und Erwiderns, aus denen sich die Wirklichkeit des Austauschs zusammensetzt. Die Synthese seiner Elemente, die je für sich betrachtet ohne Bedeutung sind, erklärt sich vielmehr aus den objektiven Strukturen, welche die Verhaltensweisen des Individuums unabhängig von dessen subjektiven Erwägungen mehr oder minder zeitlich anordnen. Während also Mauss und Durkheim, obgleich mit einem jeweils unterschiedlichen Interesse am Sozialen, das Kollektivbewusstsein bemühen, um die soziale Kohäsion einer Gesellschaft zu erklären, sind es für Lévi-Strauss jene im geschichtslosen menschlichen Geist angelegten Strukturen, auf denen eine jede Sozialität gründet. 129 130 131 132 Zur Bedeutung des Inzesttabus für die Ausbildung von Heiratsregeln vgl. ebd., S. 57 ff. Vgl. LÉVI-STRAUSS, Claude: Der Strukturbegriff in der Ethnologie. In: LÉVI-STRAUSS, Claude: Strukturale Anthropologie I. Frankfurt (Main) 1991, S. 299-346, hier S. 313 ff. Vgl. ebd., S. 321. MERLEAU-PONTY, Maurice: Von Mauss zu Claude Lévi-Strauss. In: MERLEAU-PONTY, Maurice: Das Auge und der Geist. Philosophische Essays. Hamburg 2003, S. 225-241, hier S. 228. 60 2.2.3 Dankbarkeit als Form der Vergesellschaftung bei Georg Simmel Anders als im Strukturalismus Claude Lévi-Strauss’ versucht Simmel das Soziale nicht von der Natur des Menschen, sondern die Natur des Menschen vom Sozialen her zu durchleuchten. Indem er darauf hinweist, dass Triebe, Interessen, Zwecke, mithin psychisch-physische Zustände im Allgemeinen, nicht unabhängig von den gegenseitigen Beeinflussungen zu betrachten sind, die sich ergeben, wenn Individuen in Interaktion miteinander treten, macht er sich dafür stark, jene notwendige Relation von ‚Inhalt’ und ‚Form’, wie es bei Simmel heißt, mit soziologischen Mitteln genauer in den Blick zu nehmen. Stabile soziale Interaktionsformen, die über den rein ephemen zwischenmenschlichen Kontakt hinausgehen, sind das Ergebnis von über das Handeln und Erleben von Personen oder auch von Gruppen sich einstellenden Wechselwirkungen, in denen „der Mensch in ein Zusammensein, ein Füreinander-, Miteinander-, Gegeneinander-Handeln, in eine Korrelation der Zustände mit andern tritt, d.h. Wirkungen auf sie ausübt und Wirkungen von ihnen empfängt.“133 Gegenstand der Soziologie bildet demnach nicht die Gesellschaft, „aus dessen Bestimmtheit sich nun die Beziehungen und gegenseitigen Wirkungen der Bestandteile ergäben, sondern diese müssen festgestellt werden, und Gesellschaft ist nur der Name für die Summe dieser Wechselwirkungen, der nur in dem Maße der Festgestelltheit dieser anwendbar ist.“134 Simmel unterbreitet dementsprechend den Vorschlag, an die Stelle des abstrakten soziologischen Grundbegriffs der Gesellschaft den der Vergesellschaftung treten zu lassen, da er sich besser dafür eigne, die Formen zu beschreiben, durch welche die Individuen gegenseitig ihre Triebe, Interessen, Zwecke realisieren und somit überhaupt erst zu Elementen des Sozialen werden. Damit negiert er die Existenz einer Gesellschaft an sich, die alle Wechselwirkungen umfasst und diese in 133 134 SIMMEL, Georg: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Frankfurt (Main) 1992, hier S. 18. SIMMEL, Georg: Über sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen. Amsterdam 1966, S. 14. Theodor Litt dahingegen betont, dass Begriffe wie ‚Wechselwirkung’ und ‚soziale Beziehung’ einer grundlegenden Revision bedürfen, weil sie die Elemente, die sie in Relation setzen, als an sich existent begreifen. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „sozialwissenschaftlichen Atomismus, dem das gesellschaftliche Ganze zum Aggregat wird [...]“ und der die Relationen auf Funktionen reduziert, die sich aus dem Wesen der Elemente selbst erklären. LITT, Theodor: Individuum und Gemeinschaft. Grundlegung der Kulturphilosophie. Leipzig 1926, S. 231. Dabei wird aber übersehen, dass das ‚An-sich’ der Elemente bereits eine Relation, oder in seiner Terminologie: eine Perspektive ist. Als ein Ich kann sich eine Person lediglich über seine Stellung im Raum bzw. in der Zeit, vor allem aber über sein Verhältnis zu einem Du erfahren. Dementsprechend betrachtet er die ‚Reziprozität der Perspektiven’ als das „gesellschaftliche Urphänomen“, ohne das ein geordnetes Zusammenleben nicht möglich wäre. Ebd., S. 221. Damit wird erstmals eine Vorstellung angesprochen, die sich schließlich in ähnlicher Weise in der phänomenologischen Soziologie Alfred Schütz’ und dem symbolischen Interaktionismus George H. Meads’ wieder findet. Soziale Ordnung gründet in der Fähigkeit des Individuums, sich aus dem Blickwinkel seines Gegenübers zu betrachten. Indem Ego die Haltungen Alters gegenüber sich selbst einnimmt, vermag es sein Handeln auf dessen Erwartungen auszurichten. Dass Ego die Perspektive von Alter überhaupt zu seiner eigenen macht, wurzelt in dessen Glauben an eine intersubjektive Welt, in welcher der Einzelne sein Wissen mit anderen teilt. Dieser Glaube an eine Intersubjektivität resultiert aus Aushandlungs- und Verständigungsprozessen, die eine Sozialisation typisierten Wissens bei Ego wie auch bei Alter zur Folge haben. Vgl. SCHÜTZ, Alfred: Zur Methodologie der Sozialwissenschaften. In: SCHÜTZ Alfred: Gesammelte Aufsätze I. Das Problem der sozialen Wirklichkeit. Den Haag 1971, S. 3-76, hier S. 8 ff. 61 ihren Ausformungen bedingt.135 Anders als Durkheim interessiert er sich dementsprechend auch nicht für die Art und Weise, wie die Gesellschaft als ein Ganzes im Individuum ein kollektives Bewusstsein hervorbringt. Simmel verbindet vielmehr eine geistige Verwandtschaft mit Marcel Mauss, wenn er nach den verschiedenen sozialen Formen fragt, die Interaktionen annehmen können. Der Grad der Vergesellschaftung variiert dabei je nach ihrem Anspruch an das Individuum, sein Fürsichsein für das Eingebundensein in die Sozialität zu opfern. Der Begriff der Vergesellschaftung „ist deshalb kein einheitlich feststehender, sondern ein gradueller Begriff, von dem auch ein Mehr oder Weniger anwendbar ist, je nach der größeren Zahl und Innigkeit der zwischen den gegebenen Personen bestehenden Wechselwirkungen.“136 Im Anschluss an die Transzendentalphilosophie Kants’ benennt Simmel schließlich in seinem Exkurs über das Problem: Wie ist Gesellschaft möglich? jene formalen Bedingungen, die bei den Individuen a priori vorhanden sein müssen, damit diese Sozialität überhaupt erfahren können. Die Individuen müssen erstens imstande sein, ihre jeweiligen Gegenüber zu typisieren, d.h. in ein Tableau sozialer Handlungsmuster einzuordnen. Zweitens setzen Wechselwirkungen voraus, dass die an ihnen beteiligten Personen in ihrem Vergesellschaftetsein nicht völlig aufgehen. Das Individuum ist als soziales Wesen gerade durch die Doppelstellung einer sowohl sozietären als auch extrasozietären Existenz gekennzeichnet. Die Formen der Vergesellschaftung lassen sich entsprechend danach unterscheiden, inwieweit „die Art seines Vergesellschaftet-Seins [...] bestimmt oder mitbestimmt [ist – J.H.] durch die Art seines Nicht-Vergesellschhaftet-Seins.“137 Mit dem dritten Apriori bezieht sich Simmel auf die Selbsteinordnung des Individuums in die Gesellschaft als ein „objektives Schema“,138 oder in einer moderneren Begriffswendung: als eine Sozialstruktur, deren Elemente (Positionen) sich über die Erbringung wechselseitiger Leistungen zu einem Ganzen zusammenfügen. Eine stabile Ordnung ist nur dort möglich, wo das Individuum das Gefühl eines harmonischen Verhältnisses zwischen seinen Aspirationen und Neigungen auf der einen und seiner jeweiligen Stellung in der Gesellschaft auf der anderen Seite verspürt. Den theoretischen Implikationen seiner allgemeinen Soziologie folgend beschreibt Simmel den Akt des Gebens und Nehmens als eine spezifische, das Gefühl der Dankbarkeit hervorbringende Form der Vergesellschaftung. Simmel geht dabei davon aus, dass soziale Beziehungen prinzipiell „auf dem Schema von Hingabe und Äquivalent“139 beruhen. Bei der Dankbarkeit handelt es sich dabei um eine Ordnungsfunktion des Sozialen, die das Recht mit seinen Sanktionsmechanismen ergänzt und deren Verdienst es ist, soziale Beziehungen mit einem seelischen Korrelat zu unterlegen, das die zeitlich begrenzten Interaktionen zu überdauern vermag. Ähnlich wie 135 136 137 138 139 SIMMEL, Soziologie (wie Anm. 133), S. 24 f. SIMMEL, Über sociale Differenzierung (wie Anm. 134), S. 14. SIMMEL, Soziologie (wie Anm. 133), S. 51. Ebd., S. 57. Ebd., S. 661. 62 bei Mauss ist dieses seelische Korrelat mithin ein Garant der Kontinuität von sozialen Beziehungen auch jenseits der räumlichen Kopräsenz von Personen. Simmel bezeichnet die Dankbarkeit entsprechend auch als das „moralische Gedächtnis der Menschheit“, das sich nicht einfach durch eine Gegenleistung auslöschen lässt, weil in ihm ein „subjektives Residuum des Aktes des Empfangens oder auch des Hingebens“140 unabweislich erhalten bleibt. Worin auch immer die Gegenleistung besteht, sie bleibt der Reflex auf eine freiwillige Leistung, aus der eine ethische Verpflichtung erwächst, die sich weniger an der Gabe selbst, als vielmehr an der Person, der man Dank schuldet, affirmiert. Während beim ökonomischen Tausch der Wert einer Ware nach einem äquivalenten Ausgleich verlangt, ohne dabei die individuellen Eigenarten der an ihm beteiligten Personen berücksichtigen zu müssen,141 geht es bei dem Dankbarkeit auslösenden Akt des Gebens und Nehmens darum, die „Ganzheit der Subjektivität des Einen wie des Anderen sowohl hinzugeben wie hinzunehmen. Der tiefste Fall dieser Art liegt vor [...], wenn, was wir von einem Andern an Gutem und Dankeswertem erfahren, nur wie eine Gelegenheitsursache ist, in der ein in der inneren Beschaffenheit der Seele vorbestimmtes Verhältnis zu jenem nur verwirklicht wird.“142 Die Gabe erscheint hier, mit anderen Worten, lediglich als oberflächlicher Ausdruck einer tiefer liegenden sozialen Beziehung, die Geber und Nehmer auf der Ebene der Gefühle zeitpunktunabhängig als Individuen aneinander bindet und dergestalt die gesamte Facette ihres Handelns mit umfasst. Dankesverpflichtungen können somit im Großen und Ganzen sachlich unspezifiziert bleiben, weil sie Leistung und Gegenleistung nicht in einen Kontext der wechselseitigen Bedürfnisbefriedigung stellen, sondern sie sich für Situationen offen halten, in denen die Person, der man zum Dank verbunden ist, eine Bestätigung ihrer selbst bedarf. Diese „Stimmung eines ganz allgemeinen Verpflichtetseins [...] gehört zu jenen gleichsam mikroskopischen, aber unendlich zähen Fäden, die ein Element der Gesellschaft an das andre und dadurch schließlich alle zu einem formfesten Gesamtleben aneinanderhalten.“143 Allerdings erachtet Simmel Dankbarkeit keineswegs als eine notwendige Bedingung von Gesellschaft, vielmehr verleiht sie dieser ein spezifisches Gepräge, das sich mit dem Zeitpunkt zu ändern beginnt, als mit der Geldwirtschaft eine Form der Vergesellschaftung an Bedeutung gewinnt, bei der nicht mehr die persönliche, sondern die ökonomische, den Gegenstand der Vermittlung hervorhebende Beziehung zwischen den Individuen im Vordergrund steht.144 140 141 142 143 144 Ebd., S. 662. Bei Simmel heißt es entsprechend: „Der Tausch ist die Sachwerdung der Wechselwirkung zwischen Menschen. [...] Es wird objektiv Gleiches gegen objektiv Gleiches gegeben, und der Mensch selbst, obgleich er selbstverständlich um seines Interesses willen den Prozeß vollzieht, ist eigentlich gleichgültig. Die Beziehung der Menschen ist Beziehung der Gegenstände geworden.“ Ebd., S. 662. Ebd., S. 666. Ebd., S. 670. Simmel hat diesen Wandel der Wechselwirkungsformen in seiner Studie zur Bedeutung des Geldes für moderne Gesellschaften anschaulich dargelegt. Vgl. SIMMEL, Georg: Philosophie des Geldes. Berlin 1977. 63 2.2.4 Die amerikanischen Austauschtheorien Die Fokussierung auf Wechselwirkungsformen, die das Verhalten interagierender Individuen strukturieren, haben die sozialwissenschaftlichen Austauschtheorien, wie sie vor allem von den amerikanischen Soziologen Georg C. Homans und Peter M. Blau entwickelt wurden, zum Anlass genommen, ein ganz und gar an den impliziten Logiken der Interaktion orientiertes Forschungsprogramm aufzustellen.145 Bei der Lektüre der beiden Autoren gewinnt man jedoch schnell den Eindruck, dass der Preis, den sie für dieses Vorhaben zu zahlen bereit sind, unangemessen hoch angesetzt zu sein scheint. Legte Simmel noch besonderen Wert darauf, verschiedenste Formen und Vermittlungsgegenstände der Vergesellschaftung des Individuums je für sich zu betrachten, so geht diese analytische Präzision in den Austauschtheorien weitestgehend verloren. Der ökonomische Tausch konvertiert zur speziellen Ausprägung eines allgemeineren Phänomens, das überall dort zur Geltung kommt, wo sich Interaktionen ereignen: Die Interaktion „between persons is an exchange of goods, material and non-material“, so heißt es in einer grundlegenden Begriffsbestimmung bei Georg C. Homans.146 Austauschtheorien verfechten dabei die These, dass Interaktionen nur deshalb eingegangen werden, weil sich die Beteiligten jeweils einen Vorteil von ihnen versprechen.147 Interaktionen beruhen, mit anderen Worten, auf einem in der menschlichen Natur verankerten Eigeninteresse, das als innerer Antrieb die Notwendigkeit hervorruft, im sozialen Miteinander das Prinzip der Reziprozität als einen Prozess des Austauschs von Leistung und Gegenleistung zu entfalten. Denn kaum ein Mensch würde einem anderen Menschen Leistungen offerieren, so die einhellige Auffassung, wenn er nicht auch die berechtigte Erwartung hegen könnte, als Reaktion auf seine Leistungen eine adäquate Gegenleistung zu empfangen. Handlungen unterliegen also einem Kosten/Nutzen-Kalkül, sind – in der Terminologie Max Webers – einer „Zweckrationalität“148 geschuldet und werden folgerichtig lediglich in den Fällen vollzogen, in denen die kalkulierten Gewinne – in Form von materiellen Gütern und Geld, aber auch von Liebe, sozialer Anerkennung oder Information – die in die eigenen Leistungen hinein145 146 147 148 Zur Selbsteinschätzung der Bedeutung der Soziologie Simmels für den eigenen theoretischen Zugang vgl. HOMANS, Georg C.: Social Behavior as Exchange. In: The American Journal of Sociology 63 (1958), S. 597-606, hier S. 597; BLAU, Peter M.: Exchange and Power in Social Life. New York / London / Sidney 1964, S. 13. Einen allgemeineren Überblick liefert LEVINE, Donald N. / CARTER, Ellwood B. / GORMAN, Eleanor M.: Simmel’s Influence on American Sociology I. In: American Journal of Sociology 81 (1976), S. 813-843. Vgl. HOMANS, Social Behavior (wie Anm. 145), S. 597. Zu den soziologischen Wurzeln der Austauschtheorie Georg C. Homans vgl. KNOX, John B.: The concept of exchange in sociological theory. In: Social Forces (1963), S. 341-346. Auf eine einfache Formel gebracht heißt es entsprechend: „The conception of social interaction as an exchange process follows logically from the assumption that men seek to obtain rewards in their social associations.“ BLAU, Peter M.: Interaction. Social Exchange. In: SILLS, David L. (Hg.): International Encyclopedia of Social Sciences. Bd. 7/8. Chicago [u.a.] 1972, S. 452-457, hier S. 452. Bekanntlich lässt sich nach Max Weber ein soziales Verhalten als zweckrational bezeichnen, wenn es „durch Erwartungen des Verhaltens von Gegenständen der Außenwelt und von anderen Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als ‚Bedingung’ oder als ‚Mittel’ für rational, als Erfolg, erstrebte und abgewogene eigne Zwecke“ bestimmt ist. WEBER, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Tübingen 1980, S. 12. 64 gelegten Investitionen zu übersteigen beginnen. Das Prinzip der Reziprozität erhält innerhalb dieses Interaktionsmodells, das von entscheidungsbasierten, rationalen Handlungen auf der einen und der Herstellung eines interpersonalen Gleichgewichts von Gratifikationen auf der anderen Seite ausgeht,149 einen unverkennbar utilitaristischen Anstrich. Dabei verkürzt sowohl die Austauschtheorie Homans’ als auch die Blaus’ soziale Ordnung auf einen zwangsläufig sich einstellenden Effekt eines Interdependenzverhältnisses, in dem Alter und Ego im beiderseitigen Einvernehmen ihre Leistungen zum wechselseitigen Nutzen aufeinander abgestimmt haben. Austausch ist hier das Synonym für die reziproke Beeinflussung sozialen Handelns zum Wohle aller beteiligten Personen. Was geschieht nun aber in den Fällen, in denen Austauschprozesse ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Ego und Alter etablieren, in denen, mit anderen Worten, das homöostatische System von Geben und Erwidern ins Wanken gerät, weil lediglich die eine Seite imstande ist, mit seinen erbrachten Leistungen einen Ausschnitt von Bedürfnissen der anderen Seite zu decken? Austauschprozesse haben immer auch etwas mit Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen zu tun, in denen es darum geht, den eigenen Nutzen zu maximieren, um auf diese Weise einen Zugewinn an Macht und Status zu erlangen. Macht und Status wird in diesem Ansatz an die Fähigkeit gekoppelt, durch die Kontrolle von Ressourcen, welche für die allgemeine Bedürfnisbefriedigung notwendig sind, die eigene Unabhängigkeit zu forcieren. Auf eine kurze Formel gebracht: Ego übt Macht über Alter aus, wenn Alter von Egos’ Leistungen abhängig ist, während Ego seinerseits gleichzeitig von Alter unabhängig bleibt. Bemerkenswert sind nun die zwischen Homans und Blau festzustellenden Divergenzen, wenn es darum geht, solche Asymmetrien in das theoretische Modell eines symmetrischen Aufbaus sozialer Ordnung zu integrieren. Während Homans, darauf hat Peter P. Ekeh hingewiesen, asymmetrische Austauschprozesse als „the forum for validation of power and status“150 behandelt, stellt Blau vielmehr ihre Bedeutung für den Erwerb von Macht und Status heraus. Nach Homans besteht Macht und Status in der Chance, bestimmte Reize zu setzen, die von anderen als besonders belohnenswert erachtet werden, weil sie als knappe Güter nicht jedem gleichermaßen zugänglich sind. Indem der Nachfragende den individuellen Wert, den ein Angebot für ihn persönlich einnimmt, durch seine Bereitschaft dokumentiert, einen außergewöhnlichen Preis zu zahlen, legitimiert er die im ungleichen Zugang zu bestimmten Ressourcen (Kapital, Bildung, Intelligenz, Physiognomie etc.) begründet liegenden Macht- und Statusdifferenzen.151 Blau dahingegen hebt den Asymmetrien konstituierenden As149 150 151 Nicht im Sinne einer Wertentsprechung, aber eines gegenseitigen Ausgleichs von Bedürfnissen. EKEH, Peter P.: Social Exchange Theory. The Two Traditions. Cambridge 1974, S. 182. Homans formuliert diesen Sachverhalt wie folgt: „Power, then, depends on an ability to provide rewards that are valuable because they are scarce. [...] Yet the objective scarcity of the rewards is not what counts. The ability to whistle well may scarce, but probably no one has ever acquired power through the ability to whistle well. Only if a large number of persons found it valuable to listen to concert whistling would be a basis for power – a means, 65 pekt hervor, der solchen Austauschprozessen innewohnt. „Under specifiable conditions [...], exchange processes give rise to a differentiation of power. A man who commands services others cannot do without, who is independent of any services at their command, and whose services they can neither obtain elsewhere nor take from him by force can attain power over them by making the satisfaction of their needs contingent on their compliance with his directives.“152 In dieser Betrachtungsweise sind Macht und Status nicht einfach gegeben, weil Ego etwas besitzt, wonach Alter trachtet. Macht und Status müssen vielmehr in der Interaktion hervorgebracht werden, indem Ego definiert, wie Alter sich zu verhalten hat, um eine erwünschte Leistung zu erhalten, wobei Alter aber seinerseits nach Lösungen sucht, diese Abhängigkeit gegenüber Ego zu umgehen. Nicht die Bekräftigung einer Ungleichheit, die bereits vor dem Austausch existent war, sondern die Konstruktion interaktionsrelevanter Asymmetrien im zeitlichen Nacheinander von Handlung und Reaktion steht hier im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. In der Berücksichtigung bzw. Nicht-Berücksichtigung des Zeitfaktors spiegelt sich der methodische Stellenwert wider, dem die beiden Autoren der soziologischen Kategorie der sozialen Struktur beimessen. So schimmert in ihrer jeweiligen konzeptionellen Ausarbeitung des Formats von Macht und Status der viel globalere Fragekomplex durch, wodurch interpersonale Austauschprozesse eine gewisse Regelhaftigkeit gewinnen. Für Homans bilden die aus der allgemeinen Natur des Menschen deduzierbaren Verhaltensgesetzmäßigkeiten den Ausgangspunkt seiner an den psychologischen Motiven des Individuums orientierten Forschungen. Die Analyse des Sozialen kommt hier einer Bilanzierung der ökonomischen Verhaltensweisen des Individuums gleich, deren Erfolge – im Sinne eines Zugewinns von Macht und Status – sich an der Maximierung ihres Ertrages bzw. Minimierung ihrer Kosten ablesen lassen. Während Homans die Verhaltensweisen des Individuums in Anlehnung an die behavioristische Lerntheorie Burrhus F. Skinners anhand eines Reiz-/Reaktionsschematas zu erklären versucht, die Stabilität von Verhaltensmustern also exklusiv über ihren individuellen Wert begründet,153 betont Blau das Vorhandensein von sozialen Strukturen, in denen unabhängig von den Kosten/Nutzen-Abwägungen der Individuen kollektive Zwänge begründet liegen, ohne die eine soziale Gruppe nicht von Bestand sein könnte. Ähnlich wie Alvin W. Gouldner behandelt Blau dabei Reziprozität als einen „starting mechanism“,154 der unweigerlich – wenn er erst einmal in Gang gesetzt worden ist – die 152 153 154 for instance, of getting people to pay money. What determines the scarcity value of a reward is the relation between the supply of it and the demand for it.“ HOMANS, Georg C.: Fundamental Social Process. In: SMELSER, Neil J. (Hg.): Sociology. An Introduction. New York 1976, S. 27-78. BLAU, Interaction (wie Anm. 147), S. 456. Vgl. HOMANS, Social Behavior (wie Anm. 145), S. 599. GOULDNER, Alvin W.: The Norm of Reciprocity. In: American Sociological Review 25 (1960), S. 161-171, hier S. 176. 66 Ausdifferenzierung solcher Erwartungsstrukturen zur Folge hat.155 Während sich dieser Mechanismus zum einen für die Ausbildung eines Vertrauensverhältnisses und mithin die soziale Integration verantwortlich zeigt, so ist er zum anderen aber auch daran beteiligt, Weisungsbefugnisse und Statusdifferenzen zu institutionalisieren.156 Unter sozialen Strukturen versteht Blau dementsprechend jenes Netzwerk sozialer Beziehungen, die den Zusammenhalt einer Gruppe über wechselseitige Rollenerwartungen manifestieren. In seinem Versuch, komplexere von einfacheren sozialen Prozessen herzuleiten, begibt sich Blau dabei auf einen schmalen Grad, dessen Gefahren er selbst mit folgenden Worten umschreibt: „[...] the Scylla of abstract conceptions too remote from observable empirical reality and the Charybdis of reductionism that ignores emergent social and structural properties. [...] The limitation of psychological reductionism is that it tends to ignore these emergent characteristics of social life and explain it exclusively in terms of the motives that govern individual behavior. The limitation of abstract conceptions of social structure [...] is [...] that the most complex aspects of social life cannot be fully explained without reference to its simpler aspects in which they are rooted.“157 In diesem Zitat wird deutlich, dass sich Blau ausdrücklich von der methodischen Fiktion Homans’ distanziert, Soziologie auf Psychologie zu reduzieren. Indem er die soziokulturelle Bedingtheit von Verhaltensmustern unterstreicht, folgt er vielmehr der Diktion Durkheims, Soziales auf der Basis soziologischer Erklärungsansätze zu begründen.158 Wenngleich sich also zwischen beiden Autoren in ihrer theoretischen Herangehensweise, insbesondere in ihrer Bewertung des Stellenwertes sozialer Strukturen, ein nicht von der Hand zu weisender Unterschied ausmachen lässt, so teilen sie jedoch ein Gesellschaftsverständnis, das in der interpersonalen Transaktion jenes Grundelement erblickt, über welches sich das Soziale stets aufs Neue reproduziert. 155 156 157 158 Bei Blau heißt es entsprechend: „When people are thrown together, and before common norms or goals or role expectations have crystallized among them, the advantages to be gained from entering into exchange relations furnish incentives for social interaction, and the exchange processes serve as mechanisms for regulating social interaction, thus fostering the development of a network of social relations and a rudimentary group structure.“ BLAU, Exchange and Power (wie Anm. 145), S. 92. Vgl. ebd. S. 106. Ebd., S. 2 f. Vgl. DURKHEIM, Regeln der soziologischen Methode(wie Anm. 18), S. 192. 67 2.2.5 Der praxeologische Ansatz bei Pierre Bourdieu Ähnlich wie Peter Blau befindet sich auch Pierre Bourdieu im steten Kampf mit jenen Ungeheuern, die bei dem Versuche, sich dem Sozialen in seiner Totalität wissenschaftlich zu nähern, essentielle Elemente dieser Realität zu verschlucken drohen – obgleich diese Gefahr bei Bourdieu im Gegensatz von Subjektivismus und Objektivismus einen nüchterneren, damit aber zugleich auch präziseren Namen erhält. Die Arbeiten des französischen Soziologen sind insgesamt durch dessen Bestreben geprägt, ein Forschungsprogramm zu entwickeln, das handlungs- wie auch strukturtheoretische Unzulänglichkeiten, ihre ‚blinden Flecke’, aufzudecken imstande ist, ohne dabei ihre epistemologischen Errungenschaften zu ignorieren. In seinen Ausführungen zur Gabe, in denen er die Grenzen, aber auch die Potentiale des Subjektivismus und Objektivismus deutlich kenntlich macht, kommt dieses mikro- und makrosoziologische Forschungstraditionen synthetisierende Erkenntnisinteresse in besonders markanter Weise zum Ausdruck. Bourdieu unterwirft hier zunächst den Strukturalismus Claude Lévi-Strauss’ einer vehementen Kritik. Zwar seien strukturalistische Modelle imstande, so Bourdieu, die Wechselseitigkeit von Gabe und Gegengabe zu erklären, dadurch aber, dass sie ausschließlich auf die inneren Regeln des Tauschs abstellen, verkennen sie jene Strategien, die in der Praxis zur Anwendung kommen, um einen reibungslosen Ablauf zwischen den am Tausch beteiligten Personen zu gewährleisten. Die strukturalistische Reduzierung der Akteure auf Marionetten eines unbewussten Mechanismus, dessen Logik jenseits der Praxis zu suchen ist, greift also nach Bourdieu zu kurz. Sein praxeologisch angelegtes Erkenntnisinteresse postuliert vielmehr eine Dialektik zwischen objektiven Strukturen – den so genannten Feldern –, welche die Handlungsspielräume der Akteure durch feldspezifische Spielregeln begrenzen, und subjektiven Strukturen – in der Terminologie Bourdieus: dem Habitus als System von Wahrnehmungs-, Denk-, Bewertungs- und Handlungsdispositionen –, die den Akteuren unterschiedliche Strategien an die Hand geben, sich entsprechend der objektiven Gegebenheiten und der bisherigen sozialen Erfahrungen zu verhalten. Um nun jene dem sozialen Tausch zugrunde liegenden Strategien in den Blick zu bekommen, sei es bei der Analyse notwendig, die Zeitspanne zwischen Gabe und Gegengabe mit einzubeziehen, durch welche die Praxis erst ihren eigentlichen Sinn erhalte.159 „Die objektivistische Betrachtung gibt nämlich der Praxis, wie sie von außen und augenblicksbezogen erscheint, den Vorzug vor der Art und Weise, wie Praxis gelebt und ausagiert wird, und reduziert das Erleben kurzerhand auf bloßen Schein.“160 Dahingegen müsse eine praxisnahe Analyse berücksichtigen, „daß die Reihe von Akten, die sich von außen nachträglich als Zyklus der Wechselseitigkeit darstellt, durchaus nicht wie eine mechanische Ver159 160 Im Unterschied zur objektivistischen Methode der Wissenschaft weist die Praxis mit der Irreversibilität, dem Rhythmus und der Dringlichkeit Attribute auf, deren Wirkungsweisen sich gerade durch ihren Zeitbezug erklären lassen. Vgl. BOURDIEU, Pierre: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt (Main) 1987, S. 217. Ebd., S. 192. 68 kettung abläuft, sondern wirklich kontinuierlich geschaffen werden muß und jeden Augenblick unterbrochen werden kann; und daß jede Eröffnungshandlung zur Bildung einer solchen Reihe ins Leere gehen, ohne Antwort bleiben kann und damit Gefahr läuft, rückwirkend ihres beabsichtigten Sinns entkleidet zu werden (da sich die subjektive Wahrheit der Gabe [...] nur in der Gegengabe erfüllen kann, die sie erst zur Gabe macht).“161 Bourdieu geht es also vor allem darum, die im strukturalistischen Modell unberücksichtigt bleibende Ungewissheit – das „Risiko der Gabe“,162 wie es bei Alain Caillé heißt – in der Abfolge von Leistung und Gegenleistung in seine Theorie zu inkorporieren. Während die objektivistische, mit abstrakten Modellen arbeitende Herangehensweise das Charakteristikum der Gabe an ihrer Reziprozität und Umkehrbarkeit festmacht, lässt sich demgegenüber in der Praxis die Überzeugung beobachten, die Gabe sei eine unumkehrbare, voraussetzungslose, von jedem Interesse und egoistischen Kalkül absehende Handlung, deren Intention in der Großzügigkeit des Gebers wurzelt. Zwar scheint es nach dieser Auffassung in den Handlungsspielräumen und der Improvisation des Empfängers selbst zu liegen, ob, wie und vor allem: wann er auf die Gabe mit einer Gegengabe reagiert, allerdings gilt es hier den Fehler zu vermeiden, die Realisierung des Tauschs ausschließlich von den subjektiven Motivationen der beteiligten Akteure abhängig zu machen. Denn für Bourdieu sind Verhaltensweisen generell nicht einfach Ergebnisse bewusster Entscheidungen, in denen sich der freie schöpferische Wille und die Selbstbestimmung des sich selbst transparenten Subjekts zum Ausdruck bringen. Vielmehr betont er die Existenz kollektiver Situationsbeschreibungen, die sich in den Habitus einschreiben und auf diese Weise nicht nur den Modus festlegen, wie Dinge subjektiv wahrgenommen werden, sondern auch wie sich der Akteur je nach Konstellation des Alltags angemessen zu verhalten hat. Bourdieu geht nun davon aus, dass die Verlaufsform des Gabentauschs nur solange den Schein der Selbstlosigkeit wahren kann, wie zwischen der Gabe und Gegengabe ein zeitlicher, durch Regeln der Höflichkeit und des Anstands garantierter Abstand Berücksichtigung findet, der Raum für andere Ereignisse und Handlungen lässt. Es ist diese, das Prinzip der Reziprozität scheinbar durchbrechende Diskontinuität, aus der sich die Möglichkeit erklärt, die „doppelte Wahrheit der Gabe“163 zu verdecken, oder präziser: „den Widerspruch zwischen der gewollten Wahrheit der Gabe als großzügigem, uneigennützigem, mit keiner Gegenleistung rechnendem Akt und der in dem Modell herausgearbeiteten Wahrheit der Gabe als Element einer die einzel- 161 162 163 Ebd., S. 192. CAILLÉ, Alain: Weder methodologischer Holismus noch methodologischer Individualismus – Marcel Mauss und das Paradigma der Gabe. In: MOEBIUS, Stephan / PAPILLOUD, Christian (Hg.): Gift – Marcel Mauss’ Kulturtheorie der Gabe. Wiesbaden 2006, S. 161-214, hier S. 180. In der Systemtheorie würde man an dieser Stelle wohl eher auf die ‚Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation’ hinweisen. BOURDIEU, Pierre: Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Frankfurt (Main) 1997, S. 180. 69 nen Tauschakte transzendierenden Tauschbeziehung zu vernebeln.“164 Würde auf eine Gabe unmittelbar eine Gegengabe folgen, so wäre aufgrund der unverhohlenen Demaskierung ihrer objektiven Struktur die subjektive Illusion der Selbstlosigkeit kaum noch zu halten. Erst infolge dieses sozial geduldeten, ja sogar erwünschten Selbstbetruges, dem eine „common miscognition“165 unterliegt, gerät die eigentliche Ökonomie des Tausches aus dem Blickfeld der Akteure. Es stellt sich jedoch an dieser Stelle die Frage, warum dies so sein muss? Warum wurde eine Verschleierungstechnik, eine illusio, notwendig, deren Wirkungsweise darin besteht, die objektiv eigennützige Natur der Gabe mit einem Mantel der Uneigennützigkeit zu verhüllen; oder noch viel subtiler: dem Gabenempfänger eine Brille aufzusetzen, deren Optik den Geber im Antlitz seiner Selbstlosigkeit erscheinen lässt? Um die Antwort, die Bourdieu auf diese Frage gibt, besser verstehen zu können, muss man sich noch einmal seine bereits oben angedeutete These einer Dialektik zwischen sozialen Feldern und Habitus vergegenwärtigen. Wenn man eine solche Dialektik unterstellt, dann lässt sich die eine Seite innerhalb dieses Beziehungsgeflechts von Feld und Habitus nicht isoliert ohne die Einwirkungen der anderen Seite analysieren, wobei Bourdieu explizit die These eines zirkulären Bedingungsverhältnisses vertritt. Der Habitus wird nicht nur geprägt durch die objektiven Strukturen der Felder, in denen dem Akteur gewisse Handlungsspielräume und Strategien offen stehen. Darüber hinaus ist er zugleich auch aktiv an ihrer Hervorbringung, Reproduktion und Stabilisierung beteiligt. Als eine mentale Disposition, welche von den Angehörigen der verschiedenen sozialen Klassen im Verlaufe ihres bisherigen Agierens im Feld inkorporiert wurde, zeigt er sich für die Empathie der Individuen verantwortlich, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwarten zu können, wie sich ihr Gegenüber unter bestimmten Gegebenheiten verhalten wird. Damit relativiert das Habituskonzept die im Subjektivismus vertretene Vorstellung, Handlungen seien berechenbar, weil sie durch ihre Ausrichtung auf einen bestimmten Zweck rational nachvollziehbar sind. Bourdieu geht vielmehr davon aus, dass die über den Habitus intervenierenden objektiven Strukturen des Feldes die Grundlagen für einen erfolgreichen Ausgang von Interaktionen legen. Die für die wechselseitige Erfüllung von Erwartungen erforderlichen Wahrnehmungs- und Handlungsdispositionen stehen dabei unmittelbar im Einklang mit den Strukturen des sozialen Feldes, in welchem sich die Interaktionspartner gemeinsam bewegen. Neben der ökonomisch-rationalen Praxis lassen sich also durchaus auch noch weitere Handlungsformen beobachten, die von jeder Zweckgerichtetheit absehen, denen aber deswegen – solange jedenfalls, wie sie sich als kompatibel mit dem Anforderungsprofil eines sozialen Feldes erweisen – keineswegs weniger Rationalität zugesprochen werden kann. 164 165 Ebd., S. 246 f. Ebd., S. 247. 70 Nach Bourdieu sind es nun gerade Gesellschaften, die sich über das enge personale Beziehungsgeflecht ihrer Mitglieder verstehen, die mithin „Strukturen einer Wirtschaft auf Treu und Glauben“166 realisieren, innerhalb derer – gewissermaßen zum Schutz ihres eigenen Bestandes – das Bewusstwerden einer Ökonomie des wirtschaftlichen (interessevermittelten) Tausches unbedingt vermieden werden muss.167 Denn die Etablierung eines solchen reflexiven Wissens über die Zweckgerichtetheit des Handelns birgt in sich die Gefahr, die Einheit des in seiner Totalität verschiedene Lebenssphären umschließenden Feldes der Verwandtschaft zu durchbrechen. Bourdieu weist vielmehr darauf hin, dass die Gabe einen Bedeutungswandel zu durchlaufen beginnt, je mehr sie als eine „Insel im Ozean der Ökonomie des do ut des“168 wahrgenommen wird. „Die Ökonomie des do ut des ist Produkt einer symbolischen Revolution [...]. Diese ‚große und ehrwürdige Revolution’ kann die Gesellschaft von der Ökonomie der Gabe [...] nur dadurch abbringen, daß sie nach und nach die kollektive Verneinung der ökonomischen Grundlagen der menschlichen Existenz suspendiert (außer in einigen verschonten Sektoren: Religion, Kunst, Familie) und damit, gestützt auf die Erfindung der Lohnarbeit und den Einsatz des Geldes, das Aufkommen des reinen Interesses und die Verallgemeinerung der Berechnung und des Geistes der Berechnung ermöglicht.“169 Ähnlich wie bei Simmel bleibt also auch bei Bourdieu die Gabe einer bestimmten Form der Vergesellschaftung bzw. einem gesonderten Praxisfeld vorbehalten, das sich in einem sozialen Raum eingebettet findet, in dem andere, dominantere Praxisfelder im Verlaufe der Zeit entstehen können. Solange aber, wie ein solcher Differenzierungsprozess noch nicht eingesetzt hat, fällt der Gabe die multifunktionale Aufgabe zu, nicht nur für die Warenzirkulation und für den Aufbau von personalen Bindungen zu sorgen, sondern darüber hinaus auch die Konstituierung von Herrschaftsverhältnissen voranzutreiben, „wobei die Pause [zwischen Gabe und Gegengabe – J.H.] den Ausgangspunkt für die Institutionalisierung von Zwang darstellt.“170 Die Diskontinuität der Gabe ist also als Voraussetzung dafür zu sehen, dass sich in einem Verband von Verwandten, welcher die prinzipielle Gleichheit seiner Mitglieder betont, ein Statusund Machtgefälle etablieren kann. Derjenige, der bereit und imstande ist, eine Gabe zu geben, verfügt über ein Reservoir an Verhaltensweisen, mit dem er seine Ehre und sein Ansehen zu stei166 167 168 169 170 BOURDIEU, Sozialer Sinn (wie Anm. 159), S. 208. Ein solcher ökonomischer Tausch lässt sich nach Bourdieu nur im Kontakt mit fremden Gesellschaften realisieren. Interessant an dieser Stelle sind die Parallelen zu Marshall D. Sahlins, der entlang des Verhältnisses von räumlicher Distanz und sozialen Beziehungen verschiedene Typen der Reziprozität unterschieden hat. Vgl. SAHLINS, Marshall D.: On the Sociology of Primitive Exchange. In: BANTON, Michael (Hg).: The Relevance of Models for Social Anthropology. London 1965, S. 139-187. BOURDIEU, Meditationen (wie Anm. 163), S. 252. Ebd., S. 251. Bourdieu stimmt an dieser Stelle durchaus Max Webers’ zu, wenn dieser schreibt, dass der „ökonomische Rationalismus in seiner Entstehung auch von den Fähigkeiten und Dispositionen der Menschen zu bestimmten Arten praktisch-rationaler Lebensführung überhaupt abhängig [war – J.H.]. Wo diese durch Hemmung seelischer Art obstruiert war, da stieß auch die Entwicklung einer wirtschaftlich rationalen Lebensführung auf schwere innere Widerstände.“ WEBER, Max: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. I. Tübingen 1986, S. 12. Vgl. BOURDIEU, Sozialer Sinn (wie Anm. 159), S. 206. 71 gern und damit gleichzeitig seine Vormachtstellung im Kampf um Positionen und knappe Kapitalien innerhalb des sozialen Feldes der Verwandtschaft zu untermauern vermag. Dieses in der Gestalt von Ehre und Ansehen anfallende „symbolische Kapital“ funktioniert wie ein Kredit, den der Geber je nach Bedarf – etwa bei der Rekrutierung von Arbeitskräften für die Bestellung seiner Felder – einzulösen berechtigt ist.171 Als ‚symbolisch’ kann dieses Kapital bezeichnet werden, weil es sich nicht wie in der marxistischen Theorie um einen Wert handelt, dem ein äquivalenter Gegenwert in der Form von Arbeitskraft entspricht; vielmehr basiert es auf einem unbestimmten Glauben, sich derjenigen Person gehorsamspflichtig unterwerfen zu müssen, der Ehre und Ansehen zukommt. Mit der Gabe liegt also eine kollektiv im Habitus der Selbstlosigkeit abgesicherte Praxis vor, deren verborgene Ökonomie der Akkumulation von symbolischem Kapital gehorcht, das sich seinerseits wiederum nutzbringend für denjenigen, der über dieses verfügt, einsetzen lässt. In dem Moment, in dem diese latente Funktionsweise der Gabe unverkennbar in der Praxis hervortritt, sind die Bedingungen dafür gegeben, dass sich mit dem Markt ein neues Praxisfeld errichtet, in dem die ‚illusio’ der Selbstlosigkeit durch die des Eigeninteresses bzw. des sich selbst genügsamen Individuums substituiert wird. Während die Austauschtheorien diesen Individualitätstypus anthropologisch im ‚homo oeconomicus’ zu verankern versuchen, so erscheint er bei Bourdieu als unerlässliches Beiwerk, als habituelle Grundsicherung eines erst im historischen Zeitverlauf sich konstituierenden ökonomischen Feldes, in dem ein Kampf um knappe materielle Güter vorherrscht. 2.3 Das Verhaltensprinzip der Reziprozität in der Systemtheorie 2.3.1 Interaktion und Gesellschaft Es sollte bis hierin deutlich geworden sein, dass die verschiedenen soziologischen Betrachtungsweisen des Verhaltensprinzips der Reziprozität, wenngleich sie ihre analytischen Schwerpunkte auf ganz unterschiedliche Art und Weise setzen, doch stets mehr oder weniger um ein und dieselbe gesellschaftstheoretische Fragestellung kreisen. Immer geht es ihnen um das bereits bei Thomas Hobbes aufgeworfene und bis heute die soziologische Forschung in ihren Bann ziehende Problem, wie in einer Gesellschaft von Individuen soziale Ordnung möglich sein kann. Dort, wo die eher subjektivistischen Theorieansätze das Eigeninteresse und entscheidungsbasierte Handeln des Individuums zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen machen, vermuten objektivistische Theorieangebote eine alles Verhalten transzendierende Struktur am Werk, in welche die 171 Zur Wirkungsweise des symbolischen Kapitals als Kredit vgl. ebd., S. 218 f. 72 Individuen hineingeboren werden. Und während die Vertreter des einen Lagers vehement dafür eintreten, die Gesellschaft in ihrer Abstraktheit lediglich als einen Oberbegriff zu verwenden, unter dem sich das vielfältige interaktive Miteinander der Menschen subsumieren lässt, so sehen die Vertreter des anderen Lagers die konzeptionelle Alternative offenbar darin, die Gesellschaft als ein Wesen sui generis zu begreifen, das sich für die Regulierung sozialer Beziehungen verantwortlich zeichnet. Aber ist dieses Entweder-Oder, mit dem mikro- und makrosoziologische Theorieansätze ihr jeweiliges Untersuchungsfeld abzustecken versuchen, tatsächlich in dieser Absolutheit haltbar? Oder gilt es nicht vielmehr soziologische Erklärungen anzubieten, die das Zusammenspiel dieser beiden Ordnungsformate des Sozialen in den Blick zu nehmen vermögen? Der praxeologische Ansatz Pierre Bourdieus nimmt seinen Ausgang eben an der Ablehnung eines solchen kruden Dualismus, bei dem die eine Seite sich auf Kosten der jeweils anderen Seite zu profilieren sucht. Dabei zielt Bourdieu keineswegs darauf ab, die Soziologie und ihre Begrifflichkeiten neu zu erfinden. Vielmehr signalisiert er die Anschlussfähigkeit seiner Theorie mit älteren Ansätzen, indem er klassische soziologische Termini aufgreift (z.B. Herrschaft, Status, Ungleichheit, Konflikt) und als zentrale Bezugspunkte seines Blicks auf die Gesellschaft ausweist. Bourdieu stellt sich damit durchaus bewusst in eine soziologische Forschungstradition, die ihre Motivation aus der kritischen Reflexion sozialer Verhältnisse schöpft. Interessant ist nun zu sehen, dass Niklas Luhmann zwar auf ganz ähnliche Weise wie Bourdieu seine Einwände an den Konzepten des Subjektivismus und Objektivismus formuliert, bei dem Weg allerdings, den er zu ihrer Überwindung einschlägt, offenkundig von dem des französischen Soziologen abweicht.172 So urteilt Luhmann: „Der Subjektivismus hatte das Problem, sagen und zeigen zu müssen, wie man mit Mitteln der Introspektion, das heißt des Rückganges auf Selbstreferenz des eigenen Bewußtseins, zu Urteilen über die Welt der anderen kommen könne. [...] Der Objektivismus hatte sich darauf kapriziert, alle Erkenntnis als Zustand oder Vorgang in einem bestimmten Objekt zu beschreiben [...]. Hier liegt der Fehler in der Annahme, man könne ein Objekt ohne Rücksicht auf seine Beziehung zur Umwelt vollständig beschreiben. Sowohl subjektivistische als auch objektivistische Erkenntnistheorien müssen, wenn man diese Folgeprobleme ihres Ausgangspunktes vermeiden will, durch die System/Umwelt-Differenz ersetzt werden, und damit wird die Unterscheidung von Subjekt und Objekt selbst irrelevant.“173 Nicht die Dialektik von sozialem Feld und Habitus, sondern die Differenz von System und Umwelt bildet also das theoretische Fundament, von dem aus Niklas Luhmann seine Theorie entfaltet. Während 172 173 Theorievergleiche von Niklas Luhmann und Pierre Bourdieu finden sich in BOHN, Cornelia: Habitus und Kontext. Ein kritischer Beitrag zur Sozialtheorie Pierre Bourdieus. Opladen 1991; NASSEHI, Armin / NOLLMANN, Gerd (Hg.): Bourdieu und Luhmann. Ein Theorievergleich. Frankfurt (Main) 2004. LUHMANN, Niklas: Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realität. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven. Opladen 1990, S. 31-58, hier S. 34 f. 73 sich Bourdieu noch für die These stark macht, das Prozessieren von Sinn sei an die Strategien der Akteure gebunden, die über ihr Handeln nicht nur an den sozialen Feldern teilhaben, sondern diese auch aktiv hervorbringen, vertritt Luhmann die Auffassung, dass Kommunikationen für ihre eigene Anschlussfähigkeit Sorge tragen, indem sie in ihrem operativen Vollzug eine Differenz von System und Umwelt erzeugen. Im Fokus seines Forschungsinteresses stehen also weniger die verborgenen habituellen Handlungsdispositionen, die den Akteur in seinem Tun mehr oder weniger beherrschen, als vielmehr die am Aufbau von Systemstrukturen beteiligten binären Codes, welche die Reproduktionsmöglichkeiten von Kommunikationen einschränken.174 Und während Bourdieu bei seinen Analysen gesellschaftlichen Wandels folgerichtig von einem kontinuierlichen Differenzierungsprozess der sozialen Felder und einer damit einhergehenden Diversifikation von Verteilungskonflikten um verschiedene Kapitalien ausgeht, hebt Luhmann die Diskontinuitäten der soziokulturellen Evolution hervor, die sich in den strukturellen Problemen der gesellschaftlichen Differenzierungsform selbst angelegt finden.175 Bevor ich nun im Weiteren näher darauf eingehen werde, welche Bedeutung Luhmann dem Verhaltensprinzip der Reziprozität bei der Lösung dieser strukturellen Probleme beimisst, gilt es an dieser Stelle zunächst einige einführende Bemerkungen zur systemtheoretischen Überwindung des Dualismus von Interaktion und Gesellschaft voranzustellen. Mit der Gesellschaft und der Interaktion sind in der Systemtheorie zwei Ordnungsformate des Sozialen benannt, in denen sich Kommunikationen auf je ungleiche Art und Weise zu sozialen Systemen verdichten.176 Beide Ordnungsformate nehmen jeweils ihnen eigentümliche Strukturierungsprinzipien in Anspruch, um Kommunikationsgrenzen ausweisen und dergestalt System/Umwelt-Differenzen konstituieren zu können. Entscheidend an diesem Punkt ist, dass die Gesellschaft gleichermaßen wie die Interaktion in der Lage sein muss, diese Differenz von System und Umwelt durch systeminterne Operationen herzustellen. Das Sozialsystem Gesellschaft definiert dabei die Grenzen zu seiner Umwelt über den Ausschluss all dessen, was nicht mit dem Kriterium des Sozialen belegt werden kann. Soziales kommt immer und ausschließlich dort zustande, wo Kommunikationen stattfinden. Demnach lassen sich weder Materie noch Leben noch Bewusstsein, weder Motive noch Interessen, weder einzelne Individuen noch ihre Beziehungen unter die basalen Grundelemente subsumieren, über die sich eine Sozialität begründet. Gesell- 174 175 176 Vgl. BOHN, Cornelia / HAHN, Alois: Pierre Bourdieu. In: KAESLER, Dirk (Hg.): Klassiker der Soziologie. Bd. II. Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu. München 1999, S. 252-271, hier S. 261 f. Vgl. KNEER, Georg: Differenzierung bei Luhmann und Bourdieu. Ein Theorievergleich. In: NASSEHI, Armin / NOLLMANN, Gerd (Hg.): Bourdieu und Luhmann. Ein Theorievergleich. Frankfurt (Main) 2004, S. 25-56; NASSEHI, Armin: Sozialer Sinn. In: NASSEHI, Armin / NOLLMANN, Gerd (Hg.): Bourdieu und Luhmann. Ein Theorievergleich. Frankfurt (Main) 2004, S. 155-188, hier S. 177 ff. Zum Folgenden vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 551 ff; LUHMANN, Niklas: Interaktion, Organisation, Gesellschaft. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 1975, S. 9-20. 74 schaft muss dahingegen als das umfassende Sozialsystem verstanden werden, welches innerhalb ihres eigenen Operationszusammenhangs keine soziale Umwelt kennt, weil es all das einschließt, was sich als anschlussfähige Kommunikationen beobachten lässt.177 Eine jede Kommunikation ist dann, um dies an dieser Stelle noch einmal deutlich hervorzuheben, letztendlich Vollzug von Gesellschaft. Bei der Differenzierung von Gesellschaft und Interaktion geht es also nicht darum, zwei je für sich autarke Handlungsbereiche voneinander zu scheiden, so als bestehe die Alternative, zwischen einem öffentlichen und privaten Verhalten zu wählen.178 Eine jede Interaktion vollzieht sich vielmehr in der Gesellschaft, wie auch die Gesellschaft darauf angewiesen bleibt, sich über Interaktionen zu reproduzieren. Damit soll keineswegs gesagt sein, dass die Einheit der Gesellschaft mit der Summe aller Interaktionen gleichzusetzen sei, denn innerhalb ihrer Grenzen finden sich stets – jedenfalls seit der Erfindung der Schrift und des Buchdrucks – auch Kommunikationsformen, die sich nicht der Interaktion bedienen. Ihre Einheit vergegenwärtigen vermag sich die Gesellschaft jedoch lediglich über die Differenz zur Interaktion. Sobald man nämlich damit beginnt, nach Gemeinsamkeiten zwischen den Interaktionen zu suchen und damit Ordnungsmuster herauszuarbeiten, also etwa Abstraktionen wie Natur, Moral und Vertrag, die unabhängig vom tatsächlichen interaktiven Geschehen universale Geltung beanspruchen, erscheint die jeweils einzelne Interaktion als Episode, die sich jenseits ihres Anfangs und Endes in der gesellschaftlichen Totalität eingebettet findet.179 Vor diesem Hintergrund lässt sich die Interaktion dann lediglich noch als situationsgebundene, zeitpunktabhängige Anwendung der allumfassenden Abstraktionen interpretieren. Aus diesem fiktiven Rahmen vermag sie kaum auszubrechen, und tut sie es dennoch, dann allenfalls als Sünde, Normverletzung oder Barbarei, also als Abweichungen von dem, wodurch die Gesellschaft ihren Zusammenhalt wahrt – von Glauben, Recht und Humanität. Doch sieht man einmal von dieser Ebene der Selbstbeschreibungen ab und wendet sich der der Operationen zu, dann stellt sich die Frage, wie die Gesellschaft über die Differenz zur Interaktion imstande ist, soziale Komplexität aufzubauen. Interaktionen entbinden die Gesellschaft davon, all das, worüber kommuniziert und was prinzipiell in den Kommunikationen erwartet 177 178 179 Zur Kritik an diesem kommunikationstheoretischen Gesellschaftsbegriff vgl. FIRSCHING, Horst: Ist der Begriff ‚Gesellschaft’ theoretisch haltbar? Zur Problematik des Gesellschaftsbegriffs in Niklas Luhmanns ‚Die Gesellschaft der Gesellschaft’. In: Soziale Systeme 4 (1998), S. 163-173. Genau diese Alternative sah das römische Recht noch vor, indem es einen Unterschied machte „zwischen der Privatautonomie des pater familias und den Ämtern der res publica, in denen jeder Vollbürger sich vollendete und ohne die er [...] privatus, d.h. ‚amtsberaubt’ wurde.“ Mit der im ausgehenden Mittelalter einsetzenden Institutionalisierung des Staates und der damit einhergehenden Ausweitung seiner Regelungsbefugnisse nimmt die Unterscheidung schließlich eine Konnotation an, die dem gemeinnützigen ein eigennütziges Verhalten gegenüberstellt. MOOS, Peter von: Das Öffentliche und das Private im Mittelalter. Für einen kontrollierten Anachronismus. In: MELVILLE, Gert / MOOS, Peter von (Hg.): Das Öffentliche und das Private in der Vormoderne. Köln / Weimar / Wien 1998, S. 3-83, hier S. 26. Vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 553. 75 werden kann, zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig realisieren zu müssen. Sie kann es den Interaktionen überlassen, im Nacheinander ihrer Operationen spezifische Erwartungen für Anschlusshandlungen zu aktualisieren oder auch wieder fallen zu lassen. Die besondere Stellung der Interaktion in der Gesellschaft resultiert also daraus, dass sie nicht zugleich auch Gesellschaft sein muss. Indem sie Kommunikationsschranken in die Gesellschaft einzieht, also lediglich Ausschnitte des Sozialen behandelt, die für die Dauer der Interaktion von Belang sind, schafft sie Aufmerksamkeit. Plastischer formuliert: Sie fixiert das Panorama des Sozialen und steht deshalb unaufhörlich vor der Aufgabe, zu verhindern, dass die Blicke im Bereich des gesellschaftlich Möglichen zu sehr schweifen. Im Gegensatz zur Gesellschaft sieht die Interaktion folglich durchaus eine soziale Umwelt vor; sie ist, genauer genommen, durch das Paradox gekennzeichnet, sowohl Element der Gesellschaft zu sein als auch die Gesellschaft in ihrer Umwelt zu verorten. Aber es stellt sich dann die Frage, wie es ihr in einer solchen Konstellation, in der sie sich permanent der Bedrohung gegenübersieht, von der Gesellschaft okkupiert zu werden, gelingen kann, Aufmerksamkeit an sich zu binden. Welches also sind die Strukturierungsprinzipien, auf die Interaktionen zurückgreifen, um sich als ein soziales System in der Gesellschaft ausdifferenzieren zu können? Bei dem Aufbau einer Eigenkomplexität bleiben Interaktionen strukturell darauf angewiesen, ihre Teilnahmebedingungen über die Kopräsenz von Personen zu organisieren. Interaktionen lassen sich damit auch präziser als Kommunikationen unter Anwesenden fassen.180 Sie setzen eine wechselseitige Wahrnehmbarkeit derjenigen Personen voraus, die an ihnen teilhaben, wobei jede Interaktion stets aufs Neue eine Entscheidung darüber fällen muss, wer als anwesend und wer als abwesend behandelt werden soll. Interaktionen machen sich insofern zu einem hohen Grad von Wahrnehmungen abhängig, wenngleich letztere nicht unmittelbar in die Kommunikation einfließen. Wahrnehmungen realisieren sich als nicht-kommunikative Ereignisse im Bewusstsein der Interaktionspartner. Sie sind also lediglich als bewusstseinsimmanente Vorstellungen von dem gegeben, was gesehen und gehört, vielleicht auch gerochen oder gefühlt wurde. Auch wenn Wahrnehmungen der Kommunikation nicht unmittelbar zugänglich sind, müssen Interaktionen gleichwohl auf jene vertrauen, um eine wechselseitige Wahrnehmbarkeit der an ihr beteiligten Personen unterstellen zu können. Erst auf der Grundlage dieser „präkommunikativen Sozialität“181 wird es möglich, ein rein körperliches Beisammensein von einem sozialen Kontakt zu unterscheiden, dem Erwartungen zugrunde liegen und der damit geradezu zwangsläufig Interaktionen heraufbeschwört. „Wenn Alter wahrnimmt, daß er wahrgenommen wird und daß auch sein Wahrnehmen des Wahrgenommenwerdens wahrgenommen wird, muß er davon ausgehen, daß 180 181 Vgl. LUHMANN, Interaktion (wie Anm. 176), S. 9-20; LUHMANN, Niklas: Einfache Sozialsysteme. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 1975, S. 21-38; KIESERLING, André: Kommunikation unter Anwesenden. Studien über Interaktionssysteme. Frankfurt (Main) 1999. Ebd., S. 127. 76 sein Verhalten als darauf eingestellt interpretiert wird; es wird dann, ob ihm das paßt oder nicht, als Kommunikation aufgefaßt, und das zwingt ihn fast unausweichlich dazu, es auch als Kommunikation zu kontrollieren.“182 Ich habe diese Ausgangslage einer jeden Interaktion bereits eingangs mit dem Problem der doppelten Kontingenz näher präzisiert. Ein solches reflexives Wahrnehmen legt es Alter nahe, am Verhalten Egos Information und Mitteilung zu scheiden und dergestalt separate Bezugspunkte zu isolieren, die eigene Chancen für Anschlusskommunikationen bereithalten. Neben der Anwesenheit von Personen ist mit dem Thema ein weiteres, gleichermaßen auf Wahrnehmungen rekurrierendes Strukturmerkmal benannt, das sich für das Zustandekommen von Interaktionen verantwortlich zeigt. Wahrnehmungen und Themen sind verschiedene Modi der Generierung von Informationen, die sich insbesondere darin unterscheiden, bei der Abfolge ihrer Operationen im ungleichen Maße Zeit in Anspruch nehmen zu müssen. Insofern der Bereich des Wahrnehmbaren nahezu gleichzeitig und damit effizienter verarbeitet werden kann, als dies interaktiv überhaupt möglich wäre, ist die Wahrnehmung im Vergleich zum Thema durch ein höheres Tempo des Prozessierens von Informationen gekennzeichnet. Dort, wo ein Blick in einen Raum genügt, um zu wissen, wie sich dieser gestaltet, bedarf die Interaktion einer Vielzahl von Beiträgen, die in einem zeitlichen Nacheinander angeordnet werden müssen. Themen sind also stets das Produkt von Selektionen, die durch die Aneinanderreihung verschiedener Beiträge solange aktuell gehalten werden können, wie sie imstande sind, Interaktionen zu faszinieren. Auf Grund ihres hohen Zeitfaktors setzen sie ein vermeintliches Vorverständnis über die in der Situation gegebenen Bedingungen voraus, die nicht eigens zum Thema von Kommunikationen gemacht werden müssen, weil sie jedem, der an der Kommunikation beteiligt ist, in ihrer Evidenz gleichermaßen zugänglich sind. Im gewissen Sinne verdanken Interaktionen ihr Zustandekommen diesem naiven Realismus, der die Welt als eine Welt von Dingen darbietet, in der allein schon die Kompetenz zur Wahrnehmung genügt, um bestimmte Themen ausschließen zu können, andere wiederum wahrscheinlicher werden zu lassen.183 Interaktionen setzen folglich unhinterfragt einen Konsens voraus, dass die Umwelt, in der sie sich abspielen, von allen auf gleiche Weise wahrgenommen wird. Dieses Strukturierungsprinzip macht sie auf der einen Seite anfällig für Irritationen, die der Komplexitätslast der Umwelt und der geringen „Autonomie und Umweltkontrolle“184 der Interaktionen geschuldet sind, stattet sie aber auf der anderen Seite auch mit 182 183 184 LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 561 f. Es mag an jenem Verhältnis zur Wahrnehmung liegen, dass Interaktionen bei ihrer Themenwahl eine besondere Offenheit für Abwesendes an den Tag legen. Denn wer über das spricht, was den Interaktionspartnern sowieso über die Wahrnehmung bewusst sein kann, der setzt sich leichtfertig der Gefahr aus, keine neuen Informationen zu offerieren, also letztendlich Langweile zu verbreiten und damit den Abbruch der Interaktion zu provozieren. LUHMANN, Einfache Sozialsysteme (wie Anm. 180), S. 24. 77 einer „Elastizität“185 aus, sich stets aufs Neue durch die Wahl ihrer Themen den wechselnden Umweltgegebenheiten anzupassen. Die Differenz von Gesellschaft und Interaktion, so lässt sich an dieser Stelle resümieren, ist durch ein Komplexitätsgefälle gekennzeichnet, insofern die von der Gesellschaft bereitgehaltenen Kommunikationsmöglichkeiten stets den Horizont dessen übersteigen, was sich in einer Interaktion verwirklichen lässt. Während die Gesellschaft imstande ist, durch Ausdifferenzierung verschiedener Subsysteme Kommunikationen parallel zu prozessieren, sieht sich die Interaktion gezwungen, sowohl die Inklusion von Personen als auch die Bearbeitung von Themen in zeitlich begrenzten Episoden vorzunehmen. Da sie dabei nicht die Grenzen der Gesellschaft zu überschreiten vermag, bleibt die Auswahl der Themen, die in ihr zur Sprache kommen können, wie auch die Grundlagen der Identifikation von Personen im hohen Maße von dem Komplexitätsniveau des umfassenden Sozialsystems abhängig. „Was eine Interaktion ist, ist sie nur durch das, was sie in Differenz zur Gesellschaft ist, und was sie in dieser Differenz ist, ist ihre Gesellschaftlichkeit als sachliche, zeitliche, soziale Selektivität. Dies vorausgesetzt, ist der Gedanke unabweisbar, daß Veränderungen des Gesellschaftssystems Interaktion nicht unberührt lassen.“186 Niklas Luhmann geht nun davon aus, dass sich im Zuge der Umstellung der primären Differenzierungsform eine stärkere Differenzierung zwischen Gesellschaft und Interaktion etabliert.187 Als Folge dieser Entwicklung lässt sich sowohl auf der Seite der Gesellschaft als auch auf der der Interaktion eine wachsende Indifferenz gegenüber dem jeweilig anderen Ordnungsformat beobachten. Einerseits bleiben in der funktional differenzierten Gesellschaft mit ihren symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien die Möglichkeiten, Verhaltensweisen zu konditionieren, immer weniger von einer unmittelbaren Kontrolle abhängig, wie sie durch die wechselseitige Wahrnehmbarkeit der in face-to-face Situationen eingebundenen Personen gegeben ist. Andererseits entbinden sich Interaktionen ihrerseits davon, innerhalb der Erwartungshorizonte der gesellschaftlichen Teilsysteme ablaufen zu müssen. Interaktionen können sich demnach – einem Systematisierungsvorschlag von André Kieserling folgend – erstens innerhalb von Teilsystemen oder zweitens an den Grenzen von Teilsystemen ausdifferenzieren. Sie dienen hier „zur selektiven Verknüpfung mit spezifischen Umweltsystemen [...], für die dann wiederum gilt, daß die Interaktion weder eindeutig innerhalb noch eindeutig außerhalb des Systems abläuft. Keines der daran beteiligten Großsysteme kann daher die Interaktion zuverlässig steuern, und die Prämissen beider Systeme verlieren ihr Monopol auf Relevanz und Beachtung in der Interaktion. Sie verlieren ihre Selbstverständlichkeit, und es kann sein, daß in der Interaktion etwas entschieden wird, was in 185 186 187 Ebd., S. 24. FUCHS, Peter: Die Erreichbarkeit der Gesellschaft. Zur Konstruktion und Imagination gesellschaftlicher Einheit. Frankfurt (Main) 1992, S. 196. Vgl. LUHMANN, Niklas: The Evolutionary Differentiation between Society and Interaction. In: ALEXANDER, Jeffrey C. (Hg.): The Micro-Macro Link. Berkeley 1987, S. 112-131. 78 keinem der beiden Großsysteme voll überzeugt und hier wie dort eher als Irritation wirkt: Aber genau das könnte ja die Funktion dieser Verbindungsinteraktionen sein.“188 Drittens lassen sich Interaktionen aber auch ohne jeden Bezug auf ein gesellschaftliches Teilsystem verwirklichen. Und es ist wahrscheinlich dieser letztere Typus, für den es keine Rolle spielt, wie die beteiligten Personen jenseits des Anfangs und Endes der Interaktion in der Gesellschaft wahrgenommen werden, für den ausschließlich der Augenblick der wechselseitigen Wahrnehmbarkeit zählt, der sich in der heutigen Gesellschaft am häufigsten realisiert findet. Die einzelnen hier benannten Möglichkeiten, Interaktion und Gesellschaft miteinander in Beziehung zu setzen, haben sich nur nach und nach durchzusetzen vermocht, sind also selbst das Resultat eines evolutionären Prozesses, in dessen Folge die Strukturierungsangebote der verschiedenen Ordnungsformate voneinander unabhängiger wurden. Auf der einen Seite sind also den Interaktionen durch die Komplexität des Gesellschaftssystems enge Grenzen gesetzt. Ungeachtet dessen spielen Interaktionen jedoch auf der anderen Seite eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, den Ort zu bestimmen, wo soziale Erwartungsstrukturen hinterfragt, neue Optionen für Kommunikationen ausprobiert und damit Variationen in die Gesellschaft eingeführt werden. Bei Niklas Luhmann heißt es dazu: „Im Bereich sozialer Systeme wird die Einnahme von relativ unwahrscheinlichen Positionen dadurch erleichtert, daß das Risiko auf Interaktionssysteme verteilt wird. Interaktionen müssen ohnehin aufhören, also kann man sie auch zum Experimentieren nutzen.“189 Diese zeitliche Befristung bringt es mit sich, dass es sich die Gesellschaft leisten kann, sowohl die Themen, die in den Interaktionen prozessiert werden, als auch die Identifikationsmerkmale von Personen dem Vergessen der jeweiligen Anwesenden zu überantworten. Interaktionen verfügen über kein institutionelles Regelarrangement, in dem sich auf der Basis von Programmen oder Entscheidungen das festgelegt findet, was unabhängig von der jeweiligen Situation auch für zukünftige Kommunikationen Anschlussfähigkeit garantiert. Es ist diese prinzipielle Offenheit gegenüber jenen Personen, die in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten können, und es ist die relative Freiheit der Themenwahl, die sich an den flüchtigen Gegebenheiten des Zusammentreffens zu orientieren vermag, welche Interaktionen zur geeigneten Kommunikationsform machen, um die im umfassenden Sozialsystem Gesellschaft fundierten Erwartungsstrukturen samt ihrer Abstraktionen innovativ zu hintergehen. Der Gesellschaft ihrerseits bleibt es dann letztendlich überlassen, ob sie die ‚Früchte’ des Experimentierens und Variierens, die ausschließlich in den Momenten der Interaktion aufscheinen, textlich fixiert und somit mit einer von der jeweiligen Situation abstrahierenden Allgemeingültigkeit versieht. In der Differenz von Gesellschaft und Interaktion ist demzufolge nicht nur die Bedingung der Möglichkeit 188 189 KIESERLING, Kommunikation unter Anwesenden (wie Anm. 180), S. 78. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 591. 79 von Komplexität, sondern auch die der soziokulturellen Evolution angelegt.190 Systemtheoretisch betrachtet sind die Triebfedern sozialen Wandels demnach weder in finalen Entwicklungsgesetzen noch in Konflikten sozialer Großgruppen, sondern vielmehr in den Freiräumen zu suchen, die in der Differenz von Interaktion und Gesellschaft begründet liegen. 2.3.2 Die Norm der Reziprozität bei Niklas Luhmann In welchem Maße greift nun die Systemtheorie auf das Verhaltensprinzip der Reziprozität zurück, um den Bedingungen der Möglichkeit sozialer Ordnung mit soziologischen Mitteln auf den Grund zu gehen? Bei der Beantwortung dieser Frage gilt es zunächst einmal einen differenzierten Blick einzunehmen, der dem historischen Wandel der Gesellschaftsstrukturen Rechnung trägt. Dabei geht es keineswegs darum, ein Abfolgemodell zu entwerfen, mit dem sich darlegen lässt, warum bestimmte Gesellschaftstypen das Verhaltensprinzip der Reziprozität zum Aufbau und Erhalt sozialer Strukturen nutzen und andere wiederum nicht. Obgleich in Luhmanns Analysen der modernen Gesellschaft Reziprozität keine Erwähnung findet, worauf Adloff und Mau zu Recht abstellen, muss man sich doch davor hüten, diese Abstinenz so zu deuten, als würde die Systemtheorie in der Reziprozität ein mehr oder minder zum Untergang geweihtes Relikt vergangener Tage erblicken.191 Eine solche Interpretation verkennt ein wesentliches Argument der Systemtheorie Luhmann’scher Provenienz. Zwar vertritt Luhmann in seiner Theorie der Moderne die These, dass im Übergang von stratifikatorisch zu funktional differenzierten Gesellschaften symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien an sozialer Relevanz gewinnen, welche die Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs von Kommunikationen zu überwinden imstande sind, ohne dabei einen Leistungsausgleich zwischen Individuen in Aussicht stellen zu müssen. Entsprechend sieht er die primäre Differenzierungsform der Gesellschaft nicht mehr durch Sozialsysteme garantiert, bei denen Mitgliedschaften und folglich die Herstellung stabiler Bindungen zwischen interagierenden Personen im Vordergrund stehen. Damit wird aber keineswegs bestritten, dass jenseits oder auch innerhalb dieser gesellschaftlichen Funktionsbereiche sekundäre bzw. tertiäre Differenzierungsformen fortbestehen können, in denen Reziprozität „als Gemeinschaftsressource [....] beschworen und gepflegt werden kann. Das sind vor allem Bereiche“, so heißt es bei Dirk Baecker weiter, „in denen es unnegierbar auf die Differenz zu den psychischen Systemen der Personen ankommt: in der Familie, in der Freundschaft, in der Erziehung, in der ‚Gruppen- 190 191 Vgl. ebd., S. 589. Vgl. ADLOFF, Frank / MAU, Steffen: Zur Theorie der Gabe und Reziprozität. In: ADLOFF, Frank / MAU, Steffen (Hg.): Vom Geben und Nehmen. Zur Soziologie der Reziprozität. Frankfurt (Main) 2005, S. 9-57, hier S. 9. 80 arbeit’ in Betrieben und Verwaltungen und eben auch: in der sozialen Hilfe.“192 Allerdings lässt sich bei dem Vorhaben, die Gesellschaft als das umfassende Sozialsystem aller Kommunikationen zu analysieren, solchen sozialen Enklaven der Gemeinschaft gegenwärtig kaum mehr eine tragende Rolle zusprechen. Dass sich dies in prämodernen Gesellschaften noch ganz anders darstellte, darauf verweist auch Luhmann. Dort aber, wo sich Sozialsysteme auszudifferenzieren beginnen, deren Beobachtungen die Gesellschaft über ein Funktionsprimat – etwa die Durchsetzbarkeit von kollektiv bindenden Entscheidungen oder die Erzielung von Profiten – rekonstruieren und deren Kommunikationsgrenzen dahin tendieren, sich in die Weltgesellschaft auszudehnen,193 haben sich Kommunikationsmedien durchsetzen können, die nicht mehr auf das Verhaltensprinzip der Reziprozität angewiesen sind, um die Komplexität ihrer Anschlussmöglichkeiten zu reduzieren. Die politische Macht des Monarchen baut darauf, dass er von seinen Untertanen gehorsam gegenüber seinen Gesetzeserlässen erwarten kann, ohne dass er seinerseits an die Erbringung einer Gegenleistung gebunden wäre. Ebenso folgt ein von den Zwängen ökonomischer Hausgemeinschaften losgelöstes Wirtschaftssystem einer Logik, wonach sich Kapital auch gegen die Interessen jener, die nicht an ihm profitieren, einsetzen und vermehren lässt. Kommunikationsmedien wie Macht und Geld vermögen die Operationen eines Sozialsystems autonom zu regulieren, eben weil sie von der Vorstellung abrücken, der Mensch sei jenseits ihrer Funktionslogik bereits Bestandteil eines Ordnungsgefüges, dessen Mitglieder sich den zeitlichen Ausgleich ihrer Leistungen wechselseitig schulden. Die Klassiker der soziologischen Theorie haben diesen Sachverhalt als Indiz eines Mangels der moralischen Integrität der modernen Gesellschaft gewertet. Aber diese Diagnose bleibt der Vorstellung verhaftet, die Gesellschaft sei ein Ganzes, das sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt. Das Problem sozialer Ordnung musste dann zwangsläufig darin gesehen werden, wie sich die verschiedenen Teile zu einem Ganzen integrieren lassen, wie also aus einer Ansammlung von Individuen eine Gesellschaft entstehen kann. Und die plausibelste Antwort auf diese Frage lautete dann: über das Verhaltensprinzip der Reziprozität. Die zwischen den soziologischen Ansätzen bestehenden Divergenzen lassen sich dabei im Wesentlichen daraus erklären, dass sie entweder am Ganzen oder an den einzelnen Teilen ansetzen, um das Problem sozialer Ordnung in eine Lösung zu überführen. Will man nun im Gegensatz zu dieser Vorgehensweise in Erfahrung bringen, wie es im Verlaufe der sozialen Evolution zu einer Ausdünnung von Gesellschaftsbereichen kommen konnte, in denen die Vorstellung einer Gemeinschaft von Individuen 192 193 BAECKER, Dirk: ‚Stellvertretende’ Inklusion durch ein ‚sekundäres’ Funktionssystem. Wie ‚sozial’ ist die soziale Hilfe? In: MERTEN, Roland (Hg.): Systemtheorie Sozialer Arbeit. Neue Ansätze und veränderte Perspektiven. Opladen 2000, S. 39-46, hier S. 42. Zum Begriff der ‚Weltgesellschaft’ in der Systemtheorie vgl. STICHWEH, Rudolf: Die Weltgesellschaft. Frankfurt (Main) 2000; BOHN, Cornelia: Eine Welt-Gesellschaft. Operative Gesellschaftskonzepte in den Sozialtheorien Luhmanns und Bourdieus. In: COLLIOT-THÉLÈNE, Catherine / FRANÇOIS, Etienne / GEBAUER, Günther (Hg.): Pierre Bourdieu: Deutsch-französisch Perspektiven. Frankfurt (Main) 2005, S. 43-78. 81 strukturbildend wirkt, gilt es zunächst die jeweiligen in der Differenzierungsform selbst angelegten Ordnungsprobleme prämoderner Gesellschaften in den Blick zu nehmen, an deren Lösung das Verhaltensprinzip der Reziprozität beteiligt war. Wie bereits dargelegt wurde, beschreibt die primäre Differenzierungsform Relationen, welche jene Teilsysteme einer Gesellschaft miteinander verbindet, die das soziale Zusammenleben in seiner Gesamtheit überwölben. Das entscheidende Moment einer segmentären Differenzierung ist die Einteilung des umfassenden Gesellschaftssystems in eine Vielzahl von kleinen, nach Innen durch Verwandtschaft und Abstammung – Familien, Clans, Stämme –, nach Außen durch territoriale Begrenzungen – des Hauses oder Dorfes – definierten, relativ homogenen sozialen Einheiten.194 Gemäß diesem Differenzierungsprinzip bestimmen die einzelnen sozialen Einheiten das Verhältnis zu ihrer jeweiligen gesellschaftsinternen Umwelt über das Kriterium der Ähnlichkeit. Dort, wo eine solche mit einem anderen Segment konzediert wird und sich eine räumliche Abgrenzung schwierig darstellt, vermag sich der Kreis derjenigen, die dem Familienverband angehören, zu erweitern, so dass aus einzelnen Familien Clans, aus Clans wiederum ganze Stämme etc. hervorgehen können. Segmentär differenzierten Gesellschaften stehen außer der Sprache keine weiteren Medien zur Verfügung, um Kommunikationen in Gang zu setzen. Wann immer soziale Kontakte zwischen den Mitgliedern eines Haushalts oder auch Clans eingegangen werden, vollziehen sie sich in Interaktionen. In der Gesellschaft lassen sich folglich auch nur die Kommunikationen als bewahrenswert und wiederverwendbar festhalten, die in den einzelnen Interaktionssystemen zu überzeugen vermögen. Entsprechend weisen segmentär differenzierte Gesellschaften eine lediglich rudimentär entwickelte Differenzierung von Interaktion und Gesellschaft auf.195 Jede Interaktion repräsentiert im Moment ihres Vollzugs den Bereich dessen, was sich unter vergleichbaren Bedingungen in der Gesellschaft ereignen kann. Sie ist dabei rekursiv auf voraus liegende Situationen verwiesen, denen auf Grund ihrer Ähnlichkeit mit den jeweils aktuellen Gegebenheiten Handlungsrelevanz zugesprochen werden muss.196 Die einzelnen Interaktionen werden dabei selbst noch nicht als gesellschaftliche Episoden wahrgenommen, in denen sich die Möglichkeiten der an ihnen beteiligten Personen, verschiedene Verhaltensweisen an den Tag zu legen, durch situationsübergreifende allgemeine Regeln und ewige Gesetze beschränkt finden. Abstraktionen wie etwa Moral und Natur, mit deren Erfüllung dem Anspruch Genüge 194 195 196 Zur segmentären Differenzierungsform vgl. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 634 ff. Vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 576. Vor dem Hintergrund dieses Prozessierens von Ähnlichem macht es durchaus Sinn, segmentär differenzierte Gesellschaften als ‚geschichtslose’ Gesellschaften zu bezeichnen, die keinen Anfang und kein Ende kennen, weil sich in ihnen lediglich das wiederholt, was sich in dem engen Rahmen von verhältnismäßig wenigen, allen Gesellschaftsmitgliedern vertrauten und für jedermann relevanten Alltagssituationen eingefasst findet. Der Blick auf eine Welt, die den Prinzipien des Entstehens und Vergehens unterliegt und in der sich demnach alles, wie es schließlich Heraklit gut 500 v. Chr. betonen wird, in einem unaufhörlichen Fluss des Werdens befindet, bleibt diesem Zeitbewusstsein verwehrt. Vgl. SCHOTT, Rüdiger: Das Geschichtsbewusstsein schriftloser Völker. In: Archiv für Begriffsgeschichte 12 (1968), S. 166-205. 82 getan werden kann, Mitverantwortung für das Fortbestehen und die Vollendung einer alle Interaktionen umfassenden sozialen Ordnung zu übernehmen, bleiben archaischen Gesellschaften fremd. Die an der Interaktion beteiligten Personen wissen sich vielmehr kraft der Situation, in der sie sich gemeinsam befinden, unmittelbar und unabwendbar aneinander gebunden. Dabei lassen sich Erwartungsunsicherheiten im Umgang miteinander solange mehr oder minder ausblenden, wie es in der Interaktion gelingt, von einem geteilten Erfahrungshorizont auszugehen.197 Soweit jeder also sein Handeln ausschließlich im direkten Spiegel der Reaktionen seines Gegenübers erlebt und sein Tun zudem an Wirkungen koppelt, die keine Erwartungsabweichungen vorsehen, vermag sich ein Bewusstsein der Gleichheit auszubilden, das die in der Interaktion selbst begründet liegende Differenz zwischen Alter und Ego nahezu zum Verschwinden bringt.198 Über Situationsdefinitionen führen segmentär differenzierte Gesellschaften Asymmetrien in ihre Operationen ein, mit denen sie die Tautologie ihrer Selbstreferenz, nach der jedes Systemelement seine Bedeutung erst durch einen Verweis auf andere Elemente des gleichen Systems erhält, durchbrechen. Systemtheoretisch betrachtet repräsentieren Asymmetrien nicht einfach Tatbestände der sozialen Wirklichkeit, wie sie sich mehr oder minder zwangsläufig aus dem Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Machtpotentialen einstellen. Es sind auch keine verborgenen, durch einen externen Beobachter zu lüftenden Wahrheiten, anhand derer sich die Funktionsweise sozialer Felder sichtbar machen ließe. Asymmetrien gehen vielmehr aus Selbstbeobachtungen selbstreferentieller Systeme hervor. Es sind Komplexitätsreduktionen, auf die Sinnsysteme zurückgreifen müssen, um die Anschlussfähigkeit ihrer Operationen garantieren zu können.199 Über die Ausstaffierung zeitlicher, sozialer und sachlicher Asymmetrien versetzen sich diese in die Lage, die Reproduktion ihrer Systemoperationen mit Hilfe von 197 198 199 Das soziale Gedächtnis, dessen Funktion ja generell darin liegt, über den Rückgriff auf bereits Geschehenes und Bewährtes die Anschlussfähigkeit von gegenwärtigen Ereignissen zu gewährleisten, muss unter diesen Bedingungen eine Gestalt annehmen, die der Situationsgebundenheit der Autopoiesis segmentärer Gesellschaften gerecht werden kann. Für die Kennzeichnung und Ausstaffierung von Situationen, in denen sich bestimmte Verhaltensweisen wiederholen, andere hingegen ausschließen lassen, stehen ihnen insofern vor allem ‚Objekte’ und rituelle bzw. mythische Inszenierungen (‚Quasi-Objekte’) zur Verfügung. Niklas Luhmann spricht in diesem Zusammenhang auch von einem topographischen Charakter des sozialen Gedächtnisses vorschriftlicher Kulturen, das vertraute Szenen und Routinen bereithält, um den Ablauf von Verhaltensweisen festzulegen, ohne das eigens Reflexionen über ihre Richtigkeit angestellt werden müssten. Noch sind den Verhaltensmöglichkeiten, mit denen man im wechselseitigen Miteinander rechnen kann, durch solche Symbolisierungen des Vertrauten klare Grenzen gesetzt. Vgl. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 585 f. Alfred K. Treml hat entsprechend darauf hingewiesen, dass Erziehung in segmentär differenzierten Gesellschaften noch nicht auf einem intentional organisierten, sondern vielmehr auf einem mimetischen Lernen basiert. Vgl. TREML, Alfred K.: Einführung in die Allgemeine Pädagogik. Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1987, S. 68 ff. Bei Émile Durkheim fließt dieses Bewusstsein der Gleichheit in sein Theorem der ‚mechanischen Solidarität’ ein. Die Gesellschaft erscheint hier als „eine mehr oder weniger organisierte Gesamtheit von Glaubensüberzeugungen und Gefühlen, die allen Mitgliedern der Gruppe gemeinsam sind. [...] Die Solidarität, die aus den Ähnlichkeiten der Gesellschaftsmitglieder entsteht, erreicht ihr Maximum, wenn das Kollektivbewußtsein unser ganzes Bewußtsein genau deckt und in allen Punkten mit ihm übereinstimmt: aber in diesem Augenblick ist unsere Individualität gleich Null. [...] In den Gesellschaften, in denen diese Solidarität sehr entwickelt ist, gehört sich das Individuum nicht selbst [...]. Es ist im besten Sinn des Wortes eine Sache, über die die Gesellschaft verfügt.“ DURKHEIM, Arbeitsteilung (wie Anm. 90), S. 181 f. Zum Begriff der ‚Asymmetrisierung’ vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 631 ff. 83 Generalisierungen zu konditionieren: Wenn Fall A (und nicht B) zutrifft, dann gilt C. Mit Hilfe solcher über Asymmetrisierung gewonnen Generalisierungen lässt sich etwa in der Zeitdimension ein kontingentes Ereignis der Vergangenheit zur Legitimation des Gegenwärtigen heranziehen, während die Ungewissheit der Zukunft auf eine Entscheidung in der Gegenwart drängt. Anhand sozialer Asymmetrien können verschiedene Beobachterperspektiven und Qualitäten von Personen unterschieden werden, denen man im sozialen Kontakt mit typisierten Verhaltensmustern zu begegnen hat. Schließlich vermag sich in der Sachdimension ein System in Differenz zu einer spezifischen Umwelt verorten, von der es sich als abhängig erfährt und auf die es mit seinen Operationen reagiert. Für die Kontinuität und Einheit eines Systems sind Asymmetrien also durchaus funktional. Inwieweit soziale Systeme jedoch diese Funktionalität von Asymmetrien in Gebrauch nehmen und in ihre Operationen einbauen können, hängt entscheidend von der Differenzierungsform einer Gesellschaft ab. So verfügt ein Gesellschaftssystem, dessen Strukturen das Soziale in sachlich separierte, aber durchaus äquivalente Segmente zerlegt, weder über Kapazitäten, zeitliche Bindungen des Gegenwärtigen durch Vergangenes (Kausalitäten) bzw. des Zukünftigen durch Gegenwärtiges (Finalitäten) vorzusehen noch soziale Bindungen aus Ungleichheiten ihrer Gesellschaftsmitglieder herzuleiten. Je häufiger solche zeitlichen und sozialen Asymmetrien dazu verwendet werden, spezifische Verhaltensselektionen zu motivieren, desto wahrscheinlicher bewegt sich ein segmentär differenziertes Gesellschaftssystem einer Katastrophe entgegen, die letztlich in der Überwindung seiner Differenzierungsform kulminiert. Wann immer sich also in archaischen Gesellschaften soziale und zeitliche Asymmetrien beobachten lassen – etwa im Verhältnis zweier über ungleiche Ressourcen verfügender Familienverbände oder bei der Begegnung mit Fremden –, muss ein Mechanismus zu greifen beginnen, der diese invisibilisiert. Bei dem Verhaltensprinzip der Reziprozität handelt es sich eben um einen solchen Mechanismus, der im Bereich der Kooperation wie auch dem des Konflikts als ein „internes Regulativ“200 fungiert, um symmetrische Beziehungen zwischen den an ihnen beteiligten Personen bzw. sozialen Segmenten wiederherzustellen. In der Systemtheorie wird Reziprozität dementsprechend als eine „evolutionäre Errungenschaft“201 in den Blick genommen, die sich erst zu einem Zeitpunkt entfalten konnte, als innerhalb des Gesellschaftssystems ein Bedarf für eine „Resymmetrisierung von zeitlichen und sozialen Asymmetrien“202 aufkeimte. Reziprozität setzt also bereits das Vorhandensein eines Gesellschaftssystems voraus. Ihre soziale Funktion erklärt sich aus Problemen, die dessen Differenzierungsform inhärent sind. Für ein Gesellschaftssystem, das seine Komplexität aus einem an Situationsdefinitionen gebundenen Prozessieren von Interaktionen gewinnt, ist eine gewisse Statik und begrenzte Anzahl aktualisierbarer Themen überlebensnot200 201 202 LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 649. Zum Begriff der ‚evolutionären Errungenschaft’ vgl. ebd., S. 505 ff. Ebd., S. 654. 84 wendig. Und dies aus Gründen, die sich sowohl aus der geringen Gedächtnisleistung seiner Mitglieder als auch aus der Notwendigkeit einer Konkordanz bestimmter Wissensinhalten erklären. Jede Abweichung vom Vertrauten, jedes Erleben von Neuheit, birgt in sich die Gefahr, Ungleichheiten zwischen den Gesellschaftsmitgliedern freizulegen und damit Verhaltensunsicherheiten im wechselseitigen Umgang zu initialisieren. Um ihren Status quo wahren zu können, müssen segmentär differenzierte Gesellschaften also die Beziehungen zwischen ihren Segmenten – sei es nun zwischen den einzelnen Mitgliedern, den Familien oder Clans – so einrichten, als wären die in ihnen begründet liegenden Verhaltensmöglichkeiten reversibel. Denn nur dort, wo soziale Beziehungen die Form einer solchen Umkehrbarkeit der erbrachten Leistungen oder zugefügten Nachteile annehmen, vermag sich die Vorstellung einer Symmetrie voneinander unterscheidbarer Segmente aufrecht zu erhalten. Die Verfestigung einseitiger Abhängigkeitsverhältnisse gilt es somit kategorisch auszuschließen, weil sich in Verhältnissen der Über- und Unterordnung bereits soziale und zeitliche Asymmetrien angelegt finden, welche die Situationsgebundenheit von Interaktionen überwinden. Indem das Verhaltensprinzip der Reziprozität also Restriktionen festlegt, auf welche Weise Kooperationen eingegangen und Konflikte ausgetragen werden können, wirkt es der Gefahr einer Implementierung von sozialen und zeitlichen Asymmetrien in die Gesellschaftsstruktur entgegen. Es übernimmt damit eine Stabilisierungsfunktion des umfassenden Gesellschaftssystems. Reziprozität kann auch als der eigentliche Stammvater der Moral betrachtet werden. Es ist ein Verhaltensprinzip, das segmentär differenzierte Gesellschaften hervorbringen, um den Erfolg ihrer Kommunikationen sicherzustellen, ohne dabei schon auf einen verklausulierten Tugendkatalog zurückgreifen zu müssen, in dem sich die ethischen Grundlinien richtigen Verhaltens in der Gemeinschaft – der zuteilenden und ausgleichenden Gerechtigkeit, wie es schließlich bei Aristoteles heißen wird203 – festgehalten finden. Mit dem Verhaltensprinzip der Reziprozität bleibt also zunächst einmal offen und unspezifiziert, welche Verhaltensweisen in der Kooperation und im Konflikt zu verfolgen und welche zu unterlassen sind. Luhmann betrachtet Reziprozität dementsprechend auch als einen „Sonderfall von Konditionierung: Die Leistung des einen wird unter der Bedingung der Gegenseitigkeit von der Leistung des anderen abhängig gemacht – also doppelte Kontingenz reduziert auf doppelte Konditionierung.“204 Um nun den infiniten Regress des ‚Ich gebe Dir, wenn Du mir gibst, und Du gibst mir, wenn ich Dir gebe’, der als solcher unabwendbar das Zustandekommen einer Interaktion blockieren würde, durchbrechen zu können, muss einer der beiden Seiten die erste Initiative ergreifen. Sie muss einen Anfangspunkt setzen, mit dem sich ihr Gegenüber vor die Alternative gestellt sieht, die ihr entgegengebrachten Erwartungen zu erfüllen 203 204 Zum Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles vgl. dessen V. Buch in: ARISTOTELES: Die Nikomachische Ethik. Zürich / München 2006. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 186. 85 oder sie zu missachten. Das Verhaltensprinzip der Reziprozität macht also zunächst einmal das Problem sichtbar, welches es löst. Es führt Asymmetrien ein, die es dann zu resymmetrisieren hat. Aber wie gelingt ihm das? Was berechtigt Ego überhaupt dazu, Alter eine Leistung zukommen zu lassen, die nach einer Gegenleistung verlangt? Gibt es so etwas wie einen legitimen Anlass, die Symmetrie ihrer Beziehung zeitlich und sozial zu asymmetrisieren? Eine Grundbedingung für solche Asymmetrisierungen besteht in der Möglichkeit ihrer Typisierung. Es müssen Situationsdefinitionen existieren, die nahe legen, wann sich welche Verhaltensmuster von wem wiederholen lassen. Derartige Situationsdefinitionen umfassen nicht nur die Abfolge von Handlungen, insofern eine Leistung – die prinzipiell auch hätte ausbleiben können – erst einmal erbracht werden muss, damit sie überhaupt eine Gegenleistung in Aussicht stellen kann (zeitliche Asymmetrie). Sie legen auch fest, wer die Personen sind, die Leistungen geben bzw. diese annehmen (soziale Asymmetrie). Bei der Kooperation verfügt der Geber über Überschüsse, die über das hinausreichen, was er für sein Überleben bzw. das seiner Familie nötig hat. Den Nehmer dahingegen kennzeichnet eine Bedarfslage, in der er auf die Hilfe eines Dritten angewiesen ist. Mit der Annahme werden schließlich die durch die Leistung selbst eingeführten Asymmetrien resymmetrisiert. Zum einen werden die sozialen Ungleichheiten, welche den einen zum Geber, den anderen aber zum Nehmer machen, nivelliert. Von einer unmittelbaren Entgeltung der Leistung durch eine Gegenleistung, wie sie für den ökonomischen Tausch bezeichnend ist, muss dabei abgesehen werden, weil sie die Resymmetrisierung der sozialen Asymmetrie selbst infrage stellen würde. Denn die Leistung selbst bleibt ja gerade an einen Bedarf gebunden, der durch den Geber ausgeglichen wird. Für segmentär differenzierte Gesellschaften gilt gerade: „The true gift is futile in essence.“ Als uneigennützig lässt sich ein Handeln auffassen, „which is neither causative nor telic, whose significance does not transcend the act itself.“205 Durch das zeitliche Auseinanderziehen von Leistung und Gegenleistung werden zum anderen beim Leistungsempfänger soziale Verpflichtungen in der Form von Dankbarkeit gespeichert, die sich je nach Bedarfslage zu einem späteren Zeitpunkt reaktivieren lassen. Jede erbrachte Leistung erscheint somit bereits als Reaktion auf eine erhaltene Leistung, jeder Geber war letztlich selbst einmal ein Nehmer. Der oben beschriebene infinite Regress löst sich infolge dieses unentwegten Alternierens zwischen den Rollen des Gebers und Nehmers in ein ‚Ich gebe Dir, weil mir selbst gegeben wurde’ – oder auch: Ich füge Dir Leid zu, weil mir selbst Leid zugefügt wurde’ – auf. Wichtig ist nun zu sehen, dass es sich bei der Gabe keineswegs um eine Informationsübertragung handelt, durch die Ego Alter seine Bereitschaft mitteilt, ihn in seiner Notlage zu unterstützen. Bei allen Divergenzen, die sich zwischen den soziologischen Zugängen zum Verhaltensprin- 205 LEE, Demetracopoulou D.: A Primitive System of Values. In: Philosophy of Science 7 (1940), S. 355-378, hier S. 367. 86 zip der Reziprozität feststellen lassen, so scheint doch ihr kleinster gemeinsamer Nenner – mit Ausnahme vielleicht von Bourdieu – darin zu bestehen, von einer solchen Linearität des Tauschs auszugehen. Mauss etwa reduziert die Gabe auf eine Opferhandlung, zu der sich Ego entschließt, weil er sich äußeren Zwängen und sittlichen Verpflichtungen unterworfen sieht, die dies von ihm verlangen. Bei Simmel bekommt die Gabe das Potential zugeschrieben, bei ihrem Empfänger, der sie als freiwillig vollzogen erlebt, Gefühle der Dankbarkeit zu evozieren. Am deutlichsten findet sich die Linearität der Handlungsabfolge derweil bei Lévi-Strauss formuliert. Lévi-Strauss zufolge lässt sich ein symbolisches Ordnungssystem wie z.B. die Heiratsregeln auch als Sprache begreifen, „das heißt als ein Operationsgefüge, das dazu bestimmt ist, zwischen den Individuen und den Gruppen einen bestimmten Kommunikationstyp zu sichern. Daß die ‚Nachricht’ hier durch Frauen der Gruppe weitergegeben wird, die zwischen den Clans, den Sippen oder Familien ausgetauscht werden (und nicht, wie in der Sprache, durch die zwischen den Individuen ausgetauschten Wörter der Gruppe), ändert in nichts die Gleichartigkeit des in beiden Fällen beobachteten Phänomens.“206 Matthias Waltz hat an der Entscheidung Lévi-Strauss’, den „Tausch als einen Modus der Kommunikation aufzufassen“, kritisiert, dass sie die Existenz von tauschfähigen Subjekten und Gruppen vorgängig unterstellt. Sie setzt sich damit aber außerstande, den Tausch als eine „subjektivierende Struktur“207 in den Blick zu nehmen, welche die Subjekte als Tauschpartner erst konstituiert. Systemtheoretisch gewendet liegt das Problem des von Lévi-Strauss verfolgten objektivistischen Beschreibungsansatzes aber nicht darin, den Tausch als eine Kommunikation zu verstehen, sondern Kommunikation auf einen Modus der Übertragung von Informationen zwischen einem Sender und Empfänger zu verkürzen. Seine subjektivierende Struktur erhält der Tausch gerade dadurch, dass erst die Attributionen Alters darüber entscheiden, inwieweit dem Verhalten Egos die Bedeutung einer Gabe innewohnt. Indem nämlich Alter durch die Annahme der Gabe seine Dankbarkeit gegenüber Ego signalisiert, bringt er zugleich auch zum Ausdruck – und zwar ungeachtet dessen, ob er auch tatsächlich Gefühle der Dankbarkeit hegt –, dass er dessen Verhaltensselektion als Motiv seines eigenen Verhaltens akzeptiert. Dankbarkeit erhält eine soziale Relevanz erst in dem Augenblick, in dem sie sich auch der Beobachtbarkeit aussetzt. Mit der Annahme der Gabe symbolisiert Alter, dass von ihm unter vergleichbaren Bedingungen, in denen Ego von seinem Wohlwollen abhängt, ein ähnliches Verhalten zu erwarten ist. Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle also festhalten, dass es sich bei dem Verhaltensprinzip der Reziprozität um ein „funktionales Äquivalent für Kredit“208 handelt, über das segmentär differen206 207 208 LÉVI-STRAUSS, Claude: Sprache und Gesellschaft. In: LÉVI-STRAUSS, Claude: Strukturale Anthropologie I. Frankfurt (Main) 1991, S. 68-79, hier S. 74. WALTZ, Matthias: Tauschsysteme als subjektivierende Ordnungen: Mauss, Lévi-Straus, Lacan. In: MOEBIUS, Stephan / PAPILLOUD, Christian (Hg.): Gift – Marcel Mauss’ Kulturtheorie der Gabe. Wiesbaden 2006, S. 81-105, hier S. 84. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 652. 87 zierte Gesellschaften die Redistribution ihrer Güter und Leistungen abwickeln, um auf diese Weise die Symmetrie ihrer Teilsysteme zu bewahren. Der Übergang von segmentär zu stratifikatorisch differenzierten Gesellschaftssystemen scheint vor allem durch Wandlungsprozesse angestoßen worden zu sein, in deren Gefolge sich Statuspositionen innerhalb der Gesellschaftsstruktur zu konsolidieren vermochten, die der Vorstellung einer „Reversibilität der Lagen“209, wie sie für das Reziprozitätsprinzip segmentärer Gesellschaften grundlegend war, entgegenliefen. Luhmann führt diese soziostrukturellen Veränderungen auf zwei im Verlaufe der sozialen Evolution sich immer stärker herauskristallisierenden und mittels der segmentären Differenzierungsform kaum noch zu lösenden Problemkonstellationen zurück. Zum einen kam es aufgrund der im Verhaltensprinzip der Reziprozität angelegten fehlenden Anlässe, kriegerische Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Familien oder Clans zu beenden, zu einer Ethnisierung der Gesellschaft. Zum anderen ließen sich im Bereich der Kooperation über die Akkumulation von Besitz und Dankesverpflichtungen Rangdifferenzierungen zwischen den Familien etablieren. Beide Problemkonstellationen haben gemein, dass sie die Vorteilhaftigkeit sozialer Asymmetrien entdecken und nutzen, um mit einem komplexeren Ordnungsniveau als der Segmentierung zu experimentieren. Soziale Ungleichheiten werden jetzt nicht länger als Störung oder als Abweichung von Gleichheit wahrgenommen, sie werden vielmehr für die Begründung von Differenzierungen nach Außen (in der Form eines politischen Zentrums) bzw. nach Innen (in der Form von Stratifikation) herangezogen. Auf Ungleichheit beruhende Differenzierungsformen leiten die Merkmale ihrer Mitglieder unmittelbar aus ihrer gesellschaftlichen Stellung ab. Über die mögliche thematische Ausgestaltung einer Interaktion entscheidet dann, inwieweit die an ihr beteiligten Personen ein und demselben oder aber unterschiedlichen Teilsystemen der Gesellschaft angehören. Solche an der Person selbst festgemachten Vorselektionen anschlussfähiger Themen sind in segmentären Gesellschaften nur im geringen Umfange vorzufinden. Gerade die Vergleichbarkeit der Lebensläufe und der Lebensführung ihrer Mitglieder macht ein Sozialsystem plausibel, das eine Gleichverteilung von Rollen vorsieht, die je nach Situation mal von dem einen, mal von dem anderen übernommen werden müssen. Letztendlich werden in segmentär differenzierten Gesellschaften bestehende soziale Asymmetrien noch durch die Vorstellung einer kollektiven Familienzugehörigkeit überwölbt, die zwar interne soziale Ungleichheiten zulässt, diese aber zeitlich limitiert. Der Familienverband als das umfassende Sozialsystem der Gesellschaft musste jedoch von dem Moment an seine Überzeugungskraft verlieren, als sich die Interaktionsmöglichkeiten vermehrt durch den sozialen Status der an ihr beteiligten Personen beschränkt sah. 209 Ebd., S. 657. 88 Mit der Durchsetzung von Stratifikation als Differenzierungsform der Gesellschaft wird das Verhaltensprinzip der Reziprozität keineswegs verworfen, es nimmt lediglich eine veränderte Gestalt an. Kommt ihm in segmentären Gesellschaften noch die Funktion zu, bei einer erbrachten Leistung eine unspezifizierte Gegenleistung erwartbar zu machen, demzufolge sozialen Ungleichheiten in der Zeit entgegenzuwirken, schließt das Verhaltensprinzip der Reziprozität in stratifikatorisch differenzierten Gesellschaften an das strukturelle Problem an, das Differente als eine zusammengehörige Einheit zu denken. Einheit wird dabei synonym verwand für eine objektive Ordnung, die ein natürliches Gleichgewicht der ‚Dinge’ sichert, in der Ego nicht ohne Alter, aber Alter auch nicht ohne Ego sein kann. Für die sozialen Beziehungen zwischen den Gesellschaftsmitgliedern werden jetzt allgemeingültige Regeln formuliert und in Verträgen festgeschrieben, mit denen sich die Vertragspartner zur Erbringung bestimmter Leistungen verpflichten, um auf diese Weise ihren jeweiligen Beitrag an der Vollendung sozialer Ordnung zu leisten. Das Verhaltensprinzip der Reziprozität findet sich dementsprechend auch als Recht kodifiziert.210 Das Recht von Alter gegenüber Ego beinhaltet zugleich auch eine Pflicht von Alter gegenüber Ego, und im gleichem Maße führt die Pflicht von Ego gegenüber Alter ein Recht von Ego gegenüber Alter mit sich.211 Alter und Ego gleichen sich also darin, dass sie Träger eines Rechts sind, welches unmittelbar an eine Pflicht gekoppelt ist, die man seinem Mitmenschen schuldet. Wer von diesen Verpflichtungen abweicht, der verstößt nicht nur gegen die gültigen Konventionen einer Gesellschaft, der verstößt vor allem gegen seine eigene Natur. Letztlich sind es nämlich die in der Natur des Menschen selbst veranlagten Befähigungen, seinen Verpflichtungen gegenüber dem sozialen Ganzen gerecht zu werden, auf die sich die Differenz zwischen Alter und Ego zurückführen lässt. In stratifikatorisch differenzierten Gesellschaften erhebt sich damit das in archaischen Gesellschaften unausgesprochene Verhaltensprinzip der Reziprozität zu einer Schicht- und Statusdifferenzen überbrückenden Norm, die aus den inneren Gesetzmäßigkeiten einer natürlichen Ordnung hergeleitet wird. Dabei werden die Leistungen, die sich die Gesellschaftsmitglieder wechselseitig erbringen müssen, in sich funktional differenziert und je nach Schichtzugehörigkeit höher oder niedriger bewertet. So obliegt die Aufrechterhaltung von ‚Recht und Frieden’ etwa dem Adel, während die Bauern als der Nahrungsstand für die ökonomische Versorgung der Gesellschaft verantwortlich gemacht werden. Diese Ausgewogenheit wechselseitiger Rechte und Pflichten gerät erst zu einem Zeitpunkt ins Wanken, als sich mit der Ausdifferenzierung symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien Komplementärrollen durchzusetzen beginnen, die von einer Reziprozität von Rechten und Pflichten gänzlich absehen. 210 211 Vgl. LUHMANN, Niklas: Subjektive Rechte. Zum Umbau des Rechtsbewußtseins für die moderne Gesellschaft. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 2. Frankfurt (Main) 1981, S. 45-104, hier S. 50 f. Gouldner hat auf den Unterschied hingewiesen, der zwischen der Reziprozität und der Komplementarität von Verhaltensweisen besteht. Vgl. GOULDNER, Norm of Reciprocity (wie Anm. 154), S. 167 f. 89 3. Die Ordnung der Gesellschaft 3.1 Das Problem der Ordnung Das Zusammenleben der Menschen scheint, jedenfalls seitdem Gesellschaften Selbstbeschreibungen ihrer selbst anfertigen, nie so selbstverständlich gewesen zu sein, dass es ohne Hinweise auf die Notwendigkeit von Herrschaftsinstitutionen und Sanktionsgewalten, von Gesetzen, Werten, Normen und Tugenden ausgekommen wäre. Der Modus, wie eine Gesellschaft Menschen an ihr teilhaben lässt, korreliert dabei nicht nur mit den Eigenarten, durch welche das Individuum als Person definiert und in einen relativ stabilen, dauerhaften Struktur- und Wirkzusammenhang eingebunden wird, sondern gleichermaßen auch mit den sozialen Beschränkungen wechselseitigen Verhaltens, durch welche ihre Interaktionen koordiniert werden. Die in diesen beiden Problembezügen zum Ausdruck kommende Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit sozialer Ordnung bildet die Kernfrage, auf die die Soziologie seit ihren Anfängen eine Antwort zu geben versucht, die in ihren Grundzügen allerdings bereits auf Aristoteles und seiner Unterscheidung von Politik und Ethik verweist. Die soziologische Disziplin hat also keineswegs die Grundproblematik sozialer Ordnung entdeckt. Ihre Leistung besteht allenfalls darin, den in diesem Fragekomplex vernachlässigten Gesellschaftsbegriff einer systematischen Untersuchung unterworfen zu haben. In weiten Teilen der Soziologie herrscht nun die Auffassung vor, mit der Reziprozität jenes grundlegende sozialintegrative Verhaltensprinzip ausfindig gemacht zu haben, das sich für die Entstehung und Aufrechterhaltung sozialer Ordnung verantwortlich zeichnet. Wenngleich weitestgehend Einigkeit darüber zu bestehen scheint, dass eine Gesellschaft auf den reziproken Sozialbeziehungen ihrer Mitglieder gründet, so entbrennt doch der Streit an der Frage, ob soziale Ordnung in konkreten Interaktionen von unten heraus entsteht oder ob sie vielmehr bereits eines institutionellen Regelarrangements bedarf, das von oben herab den Einzelnen in seinem Verhalten Schranken setzt. Während die Vertreter subjektivistischer Positionen in den Werturteilen der Individuen den einzigen Maßstab sozialen Handelns erblicken, weisen die Vertreter objektivistischer Positionen auf die Notwendigkeit des Bestandes von sozialen Strukturen hin, welche die Möglichkeiten, unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag zu legen, unabhängig von den individuellen Eigeninteressen vorselektieren. Beide Begründungszusammenhänge sozialer Ordnung führen letztlich jedoch, obgleich sie unterschiedliche Pfade beschreiten, in ein und dieselbe Sackgasse. Früher oder später sehen sie sich vor die Alternative gestellt, entweder vor den Problemen ihrer Argumentation zu kapitulieren bzw. diese zu desavouieren oder aber ihre Grundannahmen immer wieder ein Stück weit zu revidieren. Denn sowohl die eine als auch die andere Position 90 verfängt sich in einer Tautologie, die gerade das voraussetzt, was sie zu begründen sucht, nämlich Ordnung. Der Subjektivismus hat dabei das Problem, zeigen zu müssen, wie Alter und Ego gemeinsam zu einem Konsens darüber kommen, in ihrem Verhalten das Prinzip der Reziprozität walten zu lassen, und dies, obwohl beiden Seiten immer auch die Möglichkeit offen steht, gegen die Widerstände ihres Interaktionspartners den eigenen Willen durchzusetzen. Diese in der Interaktion selbst lauernde Gefahr des Konflikts lässt sich nur ausblenden, indem man dem Menschen eine Vernunftbegabung unterstellt, die ihn dazu befähigt, den Vorteil einer gegenseitigen Verhaltensabstimmung zu erkennen. Aber auch die Vernunft bedarf Regeln, die intersubjektiv gültig sind und in denen sich die Bedingungen der Möglichkeit vernünftigen Denkens und Urteilens festgelegt finden. Doch wenn diese Regeln kein Geschenk der Natur oder Gottes sind, auf welche Weise eignet sich dann der Mensch ihrer an – etwa über Sozialisation und Erziehung, also über soziale Erfahrungen? Hier schließt sich letztlich der Kreis, in dem das Subjekt an den objektiven Gegebenheiten seiner Umwelt gebunden bleibt, die es eigentlich zu überwinden trachtet. Die objektivistische Betrachtungsweise hat dahingegen das Problem zu verschleiern, wie sich gleichsam aus dem Nichts eine soziale Ordnung entfalten konnte, die das Verhalten der Individuen auf Reziprozität hin koordiniert. Irgendwann und irgendwo musste es einmal einen Anfang und Ursprung gegeben haben, dem sich das Soziale in seinen Strukturen verdankt. Wenn das Soziale demnach etwas bedurfte, aus dem es hervorgehen konnte, scheint zunächst wiederum bloß der Hinweis auf einen transzendenten bzw. kollektiven Willen möglich, der die Ordnung in die Welt gerufen hat. Was aber geschieht dann? Wie lässt sie sich bewahren, vor allem aber: wodurch verändern, wenn sie einmal gegeben ist? Bleibt den Individuen tatsächlich nichts anderes übrig, als einer präexistenten Ordnung blind zu gehorchen, oder ist es nicht so, wie es Max Weber gemutmaßt hat,212 dass eine Ordnung ihre Geltung lediglich dort erhält, wo die Akteure sich an ihren Geboten auch tatsächlich orientieren? Welche Formen diese Gebote auch immer annehmen – die des Rechts, der Sitte oder Moral –, ihre Wirkungen können sie nur dann entfalten, wenn im Subjekt bereits ein Gefühl des Verpflichtetseins ihnen gegenüber vorhanden ist, wenn also das Subjekt ihnen eine Relevanz für das eigene Verhalten zuschreibt. Auch die objektivistische Betrachtungsweise kommt somit nicht umhin, auf die Eigenleistungen der Individuen hinzuweisen, ohne deren willentlichen Entscheidungen ein Zustand der Ordnung kaum erreicht werden könnte. Mit der Tautologie der Ordnung stellt sich also unweigerlich die Frage, was wir eigentlich in den Blick bekommen, wenn wir Ordnungen zu erfassen suchen. Worin, so könnte man an dieser Stelle das Problem zugespitzt formulieren, besteht die Ordnung des Begriffs der Ordnung? Aus welchen Elementen setzt er sich zusammen? Und wovon wiederum ist die Anordnung seiner 212 Vgl. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (wie Anm. 148), S. 16. 91 Elemente abhängig? Die bei Luhmann vorgezeichnete Antwort auf diese Fragen liegt auf der Hand: von der Gesellschaftsstruktur. Auf die Konsequenzen dieser Annahme werde ich im Folgenden noch näher eingehen. Zunächst lohnt es sich aber, einmal den Begriff selbst genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Ordnungsbegriff kommt gegenwärtig in ganz unterschiedlichen Kontexten zur Anwendung, in der Begründung von Staatsverfassungen genauso wie in der Mathematik, Biologie, Informatik, Physik, Chemie, Kunst etc. Wann immer man sich seiner bedient, scheint es sich um den Versuch zu handeln, eine Relation zwischen mindestens zwei Elementen darzustellen, die in ihrem Neben- bzw. Nacheinander gewissen Gesetzmäßigkeiten oder Prinzipien gehorchen und sich dabei zu einem Ganzen zusammenfügen. Ordnungen sind also letztendlich nichts anderes als Klassifikationsschemata, Taxinomien, anhand derer sich aus einer Mannigfaltigkeit ungleicher Elemente Gruppen von Merkmalsträgern zusammenfassen lassen. Dabei gilt es generell zwischen zwei Arten von Ordnung zu unterscheiden, dem ordo extrinsecus und dem ordo intrinsecus, also einer auf äußerlichen, unwesentlichen und einer auf innerlichen, wesentlichen Beziehungen beruhenden Ordnung.213 Für unser Anliegen, die Problembezüge einer Sozialordnung zu konkretisieren, ist insbesondere der letztere Typus von Interesse. Die Elemente des ordo intrinsecus zeichnen sich dadurch aus, dass sie je für sich als Entitäten mit eigenen Ordnungsmustern voneinander geschieden werden können. Jenseits dieser Differenz wird ihnen allerdings eine Kompatibilität bzw. Gemeinsamkeit unterstellt, über die sie sich wechselseitig in ihren Möglichkeiten beschränken und dabei relativ stabile Beziehungen miteinander begründen. Im Gegensatz zum ordo extrinsecus beruhen diese Beziehungen gewissermaßen auf einem inneren Gesetz, das sich in allen Elementen der Ordnung gleichermaßen wieder findet. Da jedes Element für sich betrachtet dekomponierbar, also bereits schon durch eine innere Ordnung gekennzeichnet ist, wird es in ihrer Beziehung zueinander möglich, niedere und höhere Ordnungsniveaus zu denken. Die ungleichen Ordnungsniveaus unterscheiden sich dann nicht nur nach dem Grad ihrer Differenziertheit und Komplexität, sie weisen darüber hinaus auch eine Geschichte auf, die sie vom Niederen zum Höheren wie auch vom Höheren zum Niederen durchlaufen haben.214 Letztendlich liegen die Probleme, mit denen sich subjektivistische und objektivistische Denktraditionen befrachten, in einer Anwendung dieses Ordnungsbegriffs begründet, die das Individuelle aus dem Allgemeinen, oder umgekehrt: das Allgemeine aus dem Individuellen herzuleiten versucht. Vor diese Alternative gestellt, hat sich die soziologische Theorie bei der Wahl ihrer forschungsleitenden Methode zu entscheiden: Ist es die Gesellschaft, die als das umfassende Ganze ihren Mitgliedern notwendige Verhaltensregeln auferlegt, oder sind es die Individuen, aus 213 214 Zu dieser Unterscheidung vgl. KUHN, Helmut: Ordnung im Werden und Zerfall. In: KUHN, Helmut / WIEDMANN, Franz (Hg.): Das Problem der Ordnung. Meisenheim am Glan 1962, S. 11-25, hier S. 14 f. Ein anschauliches Beispiel hierfür hat bereits Aristoteles geliefert, der eine Fortentwicklung verschiedener Ordnungsstadien von der ehelichen Partnerschaft über die Haus- und Dorfgemeinschaft bis hin zum Staat vorsieht. Vgl. ARISTOTELES, Politik (wie Anm. 14), 1252 a 25 ff. 92 deren Verhaltensweisen sich gemeinsame Regeln erst a posteriori formulieren lassen? Im Gegensatz zu einer solchen deduktiven bzw. induktiven Herangehensweise, die unweigerlich auf die Tautologie der Ordnung stößt und diese als eine theorieimmanentes Problem markiert, das es zu eliminieren gilt, fragt die Systemtheorie nicht nach dem genuinen Wesen einer Sozialordnung. Ihr Anliegen ist weitaus bescheidener, insofern es ihr allein darum geht, zu erklären, warum im Verlaufe der sozialen Evolution gewisse Ordnungsvorstellungen an Plausibilität gewinnen, während andere an Plausibilität verlieren. Was musste sich innerhalb der Gesellschaftsstrukturen verändert haben, damit bestimmte Ereignisse Zweifel an der Richtigkeit bestehender Ordnungsvorstellungen initialisieren konnten, die dann ihrerseits danach verlangten, durch die Formulierung neuer Regeln des sozialen Zusammenlebens ausgemerzt zu werden? Ordnungsvorstellungen sind demnach Beschreibungen, die innerhalb einer Gesellschaft angefertigt werden, um über Typisierungen den im Medium Sinn sich reproduzierenden Kommunikationen eine Berechenbarkeit abzuringen. Es sind, anders formuliert, Semantiken, die sich Beobachtungen verdanken, mittels derer ein Beobachter versucht, die Ordnung der Operationen sozialer Systeme offen zu legen und damit dem Problem der Erwartbarkeit kontingenter Verhaltensweisen – der Unwahrscheinlichkeit der Anschlussfähigkeit von Kommunikationen – eine Lösung zuzuführen.215 Die Stabilität von Verhaltenserwartungen kann dabei zum einen in der Sozialdimension, zum anderen aber auch in der Zeitdimension von Sinn problematisiert werden. In der Sozialdimension geht es um die Frage, wie sich zwischen Personen in ihrem wechselseitigen Verhalten ein Konsens garantieren lässt, obwohl diese je für sich als Individuen existieren. In der Zeitdimension rückt dahingegen die Frage in den Vordergrund, inwieweit dem Individuum in seinem Verhalten Freiheit zugestanden werden kann, wenn die Gesellschaftsstrukturen als zeitbeständige Ordnung über den jeweiligen Moment hinaus Geltung beanspruchen sollen. Interpersonale Beziehungen auf der einen Seite, die sich in Situationen der doppelten Kontingenz auf der Ebene von Interaktionen ereignen, und Interpenetrationen psychischer in soziale Systeme auf der anderen Seite, wie sie paradigmatisch am Anfang des 20. Jahrhunderts an dem Dualismus von Individuum und Gesellschaft diskutiert wurden, bilden somit die beiden bereits seit der Antike geläufigen Problemkreise, mit denen sich die Frage, wie soziale Ordnung möglich ist, auseinandersetzt.216 215 216 In den Worten Michel Foucaults lässt sich dieser Sachverhalt vielleicht wie folgt etwas literarischer reformulieren: „Die Ordnung ist zugleich das, was sich in den Dingen als ihr inneres Gesetz, als ihr geheimes Netz ausgibt, nach dem sie sich in gewisser Weise alle betrachten, und das, was nur durch den Raster eines Blicks, einer Aufmerksamkeit, einer Sprache existiert. Und nur in den weißen Feldern dieses Rasters manifestiert es sich in der Tiefe, als bereits vorhanden, als schweigend auf den Moment seiner Aussage Wartendes.“ FOUCAULT, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt (Main) 1971, S. 22. Luhmann hat diese beiden Grundfragestellungen sozialer Ordnung wie folgt zusammengefasst: „Die eine Frage zielt auf Beziehungen zwischen Personen. Personen sind getrennt lebende Wesen, Substanzen, Individuen, Systeme mit je eigenem Bewußtsein, also je verschiedenem Vorstellungshaushalt. Wie ist es möglich, daß sie trotzdem in geordneten Beziehungen treten können, und zwar hinreichend erwartbar, hinreichend enttäuschungssicher, hinreichend schnell, gemessen an den je eigenen Lebenserfordernissen? Die andere Frage setzt voraus, daß 93 Der historische Blick auf diese beiden Problemkreise offenbart die enorme Vielfalt von Ordnungssemantiken, welche die christlich-abendländischen Gesellschaften im Verlaufe ihrer sozialen Evolution hervorgebracht haben. Termini wie kósmos, ordo, order, ordre weisen je eigene Konnotationen auf, deren Wandlungen Ulrich Dierse treffend mit den folgenden Punkten zusammengefasst hat: „1. Aus der Ordnung als einer hierarchischen Gliederung und Rangfolge wird zunehmend die Ordnung einer Reihe oder Serie, deren Elemente nicht nach Qualitäts-, sondern nach Funktionsmerkmalen untereinander geordnet sind. [...] 2. Ordnung wird zunehmend abhängig von einem Subjekt, das sie als Ordnung erkennt oder erst setzt. [...]. 3. Damit hängt zusammen, daß die Ordnung nicht mehr primär in Gott fundiert ist, sondern daß der Mensch es übernommen hat, Ordnung zu stiften. [...] 4. Daraus folgt, daß die Ordnung nicht die vorgegebene und immer gültige Ordnung ist, sondern die erst zu schaffende oder wiederherzustellende, die deshalb oft als ‚neue Ordnung’ bezeichnet wird. [...] 5. Damit wird fraglich, welche Ordnung gelten soll. Zumindest im politisch-sozialen Bereich ist die jeweilige Ordnung nicht mehr konkurrenzlos und hat folglich besondere Begründungen nötig.“217 Die weiteren Ausführungen verfolgen das Ziel, die Eckpunkte dieses Veränderungsprozesses in der Thematisierung sozialer Ordnung skizzenhaft – mit einer gewissen Unschärfe fürs Detail – nachzuzeichnen, ohne sich dabei auf eine reine Begriffsgeschichte zu kaprizieren, mittels derer sich die einzelnen semantischen Wendungen genau datieren und bestimmten Autoren zuschreiben lassen. Der Ausgangspunkt dieses Vorhabens bildet die These, dass die semantischen Verschiebungen selbst Problemen geschuldet sind, die erst zu einem Zeitpunkt virulent werden konnten, als die primären Teilsysteme einer Gesellschaft damit begannen, ihre operative Schließung von Stratifikation auf funktionale Differenzierung umzustellen. Zur Erläuterung dieses problemorientierten Ansatzes sollen in einem ersten Schritt jene Umgestaltungen des operativen Modus des Gesellschaftssystems präzisiert werden, die sich unmittelbar auf die Sinnverarbeitungsregeln der Sozial- und Zeitdimension ausgewirkt haben. In einem zweiten Schritt gilt es dann anhand der Semantik des Individuums zu erläutern, inwieweit man diesbezüglich von einer Ausweitung der Sinnhorizonte sprechen kann. Die Argumentation mündet schließlich in der Darlegung historisch gewachsener Semantiken der Rezipro- 217 solche Beziehungen sich von der je aktuellen Situation ablösen, so daß soziale Realitäten eigener Art entstehen, die Kommen und Gehen, Leben und Tod der einzelnen Individuen überdauern. Die Frage ist dann: Welche Beziehungen besteht zwischen dem einzelnen Individuum und der sozialen Ordnung?“ LUHMANN, Niklas: Wie ist soziale Ordnung möglich? In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie. Bd. 2. Frankfurt (Main) 1983, S. 195-285, hier S. 208. Bezeichnend ist, dass die etymologische Wortbedeutung von Gesellschaft bzw. Gemeinschaft ein Zweifaches besagt: „den Inbegriff aktuellen sozialen Handelns und ein soziales Handlungsschema (z.B. Familie, Staat, Betrieb, Schule), das in Institutionen, Gruppen, Verbänden usw. geschichtlich aktualisiert wird.“ RIEDEL, Manfred: Gesellschaft, Gemeinschaft. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 2. Stuttgart 1979, S. 801-862, hier S. 801. MEINHARD, H. / HÜBENER, W. / DIERSE, U. / STEINER, H.G.: Ordnung. In: RITTER, Joachim (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. VI. Darmstadt 1984, Sp. 1249-1309, hier Sp. 1294 f. 94 zität, wie sie sich der Gesellschaft mit ihrem Erfahrungszuwachs von Kontingenz in jeweils spezifischer Form dargeboten haben. 3.2 Die Ordnungsdimensionen der Gesellschaft 3.2.1 Die Sozialdimension sozialer Ordnung Jede Kommunikation ist Beobachtung und setzt sich als solche zugleich auch der Beobachtung aus. Sie eröffnet damit bei jenem, der an sie anschließt, Gelegenheiten, zu hinterfragen, warum jemand etwas so und nicht anders mitgeteilt hat. Kurzum: In der Sozialdimension erfolgt eine Personalisierung von Sinn. In ihr lässt sich der in jedem Sinn inhärente Möglichkeitsüberschuss über die Art und Weise erfassen, wie Personen auf ein und denselben Sinngehalt unterschiedlich erlebend und handelnd reagieren. Während etwa die einen im ‚Ende der Welt’ die Erlösung, den Anbeginn des ewigen Lebens im Reich Gottes erblicken, so erkennen die anderen darin das Schreckgespinst einer durch Menschenhand verursachten, alles Leben auslöschenden Naturkatastrophe. Das ‚Ende’ der einen ist also keineswegs das der anderen. Wie lässt sich aber auf der Grundlage dieses Bewusstseins der Divergenz von Weltperspektiven noch eine soziale Ordnung garantieren, in der Verhaltensweisen hinreichend erwartbar erscheinen? Diese Frage wurde zu einem historischen Zeitpunkt akut, als mit der Erfindung der Schrift deutlich zutage trat, dass die im Medium der Sprache fixierten Sinngehalte völlig konträre Interpretationen und Erwartungen mit sich führen können. Betrachtet man unter diesem Aspekt die Veränderungen, die im Verlaufe der sozialen Evolution in der Sozialdimension stattfanden, dann sieht man, dass es bei der Beantwortung jenes Problembereichs lange Zeit genügt hatte, Reflexionen innerhalb der Sachdimension anzustellen. Der Sinn einer Beobachtung war schon allein deswegen verbürgt, weil er sich auf ein Sein bezog, das jenseits der Frage nach dem Beobachter stand. Abweichende Erwartungshaltungen ließen sich somit auf die unterschiedlichen Begabungen der Beobachter (Weisheit, Vernunft) zurückführen, die Welt so wahrzunehmen, wie sie sich aufgrund ihrer dinghaften Natur offenbart. Aber je mehr sich die Sozialdimension von der Sachdimension zu emanzipieren vermochte, je mehr der Beobachter selbst aus der Natur ausgekoppelt und ihm Freiheitskonzessionen in seiner Weltaneignung zugestanden wurde, desto dringender rückte die Aufgabe in den Vordergrund, zu klären, wie eine soziale Ordnung von Subjekten möglich sein kann. Jüngst haben einige Vertreter der Postmoderne mit der Subjektivität des Bewusstseins die These eines innergesellschaftlichen Pluralismus und Relativismus verbunden, der letztendlich auf die Auflösung der Realität zuläuft, da „ein und derselbe Sachverhalt in einer anderen Sichtweise sich völlig anders darstellen kann und daß diese andere Sichtweise doch ihrerseits keineswegs 95 weniger ‚Licht’ besitzt als die erstere – nur ein anderes. Licht, so erfährt man dabei, ist immer Eigenlicht“218, und Sinn – bringt man diesen Gedanken zu Ende – immer Eigen-Sinn. Wenn man aber derart das Subjekt verabsolutiert, bleibt die Frage, wie Erwartungssicherheiten, die unser Alltagserfahrungen prägen, überhaupt zustande kommen können. Kommunikationstheoretisch betrachtet lässt sich die Sozialdimension also nicht schon aus einer Differenz heraus begründen, die Alter und Ego als gesonderte Entitäten mit je eigenem Bewusstsein, also als zwei psychische Systeme, voneinander scheidet. Die Sozialdimension tritt erst dort hervor, wo Ego Alter als ein ‚alter Ego’ in die Kommunikation einführt, um auf diese Weise einen Vergleich zwischen dessen und der eigenen Weltperspektive zu vollziehen. „Die Sozialdimension betrifft das“, so hat dies Niklas Luhmann formuliert, „was man als seinesgleichen, als ‚alter Ego’ annimmt, und artikuliert die Relevanz dieser Annahme für jede Welterfahrung und Sinnfixierung.“219 Für Ego ergibt sich daraus die Möglichkeit, jedes Thema einer Kommunikation danach zu befragen, ob Alter die gleiche oder aber eine abweichende Weltperspektive von ihm einnimmt. Erst infolge dieser „Reduplizierung von Auffassungsmöglichkeiten“220 ist die Sozialdimension imstande, einen Doppelhorizont aufzuspannen, anhand dessen sich Kommunikationsangebote im Hinblick auf einen vorhandenen Konsens bzw. Dissens sortieren lassen. Damit geht die in der Sprache angelegte Gewissheit verloren, dass der Gegenüber die Welt auch so wahrnimmt, wie sie sich einem selbst darstellt. Letztendlich löst also die Beobachtung dieses Doppelhorizonts eine Verunsicherung im Umgang mit dem Anderen aus, die einen gesellschaftlichen Bedarf für Zuschreibungen heraufbeschwört, mit deren Hilfe sich der Horizont möglicher Weltperspektiven beschränken lässt, ohne dabei der gesteigerten Komplexität im Verhältnis von Ego und Alter einen Abbruch zu tun. Die Reduzierung von Komplexität erfolgt dabei über Konsens- und Dissensattributionen, die als reflexive Prozesse sich ständig unter Mithilfe ihres ‚Objekts’ der eigenen Richtigkeit vergewissern müssen. Sobald sich infolge dieser reflexiven Prozesse Positionen des Dissenses verfestigen, sobald Kommunikationen also ein ‚Wir’ und ‚Ihr’ als differente Weltperspektiven kondensieren, entsteht auch ein Bedarf für Semantiken des Sozialen (Freundschaft, Gemeinschaft), anhand derer sich Personen nach ihrem spezifischen Welterleben und -handeln voneinander unterscheiden lassen. Kommunikationen können dann davon abhängig gemacht werden, wer kommuniziert bzw. wem sich eine bestimmte Kommunikation zurechnen lässt oder an wen eine bestimmte Kommunikation adressiert wird. Luhmann zufolge sind die Freiheitsgrade, über die sich Alter und Ego als divergente Weltperspektiven konstituieren, maßgeblich von den vorhandenen Strukturen einer Gesellschaft abhängig. Der Mensch ist also nicht von Natur aus ein Subjekt. Die Vorstellung der Subjektivität seines 218 219 220 WELSCH, Wolfgang: Unsere postmoderne Moderne. Weinheim 1987, S. 6. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 119. Ebd., S. 119. 96 Bewusstseins ist vielmehr eine evolutionäre Errungenschaft, mit der es möglich wurde, dem Einzelnen eine Verantwortung für den Erhalt sozialer Ordnung zu übertragen. Historisch betrachtet tauchte mit dieser Übertragung von Verantwortung erstmals das Problem auf, welche Vorkehrungen innerhalb der Gesellschaft getroffen werden müssen, um die Wahrscheinlichkeit eines die sozialen Strukturen stabilisierenden Verhaltens zu erhöhen. Die Theoriestelle, an der die Systemtheorie diese Problematik sozialer Ordnung zur Sprache bringt, ist die Analytik von Inklusion und Exklusion. Mit der Inklusions- und Exklusionsanalytik verfügt man über ein wissenschaftliches Instrumentarium zur Beschreibung gesellschaftlich vorgesehener Teilhabechancen, die sich der Person als Anknüpfungspunkt von Kommunikationen eröffnen.221 Luhmann verwendet den Terminus Person für die Beschreibung von in der Kommunikation zur Verwendung kommenden Identifikationsschemata, die psychische Systeme unter einen spezifischen Fokus stellen, innerhalb dessen sie in ihren Handlungsmotiven für ein soziales System von Bedeutung sein können. Handlungsmotive sind für Sozialsysteme freilich nur insofern von Belang, soweit es anhand ihrer möglich wird, einem Akteur eindeutig ein Verhalten zuzurechnen. Die Kommunikation bedarf eines Bezugspunktes, an dem sie ihre Beobachtungen orientiert, um die unendliche Fülle ihrer Anschlussmöglichkeiten, die sich in Situationen der doppelten Kontingenz einstellen, zu kontrollieren. Über das Identifikationsschema Person erfolgt also eine „individuell attribuierte Einschränkung von Verhaltensmöglichkeiten“,222 mit deren Hilfe soziale Systeme Adressen von Kommunikationen festlegen. Auf solchen Adressen beruht die Chance, den Kommunikationspartner danach zu beurteilen, ob und inwieweit er in seinem Verhalten im Einklang oder im Widerspruch mit den Reproduktionsbedingungen des sozialen Systems steht. Die Form der Person umfasst somit neben den anschlussfähigen auch die zu vermeidenden Verhaltensweisen, die – wenn sie in die Kommunikation durchschlagen – zu einer Gefährdung der Inklusion der Person in das soziale System führen. „Inklusion muß man demnach“, so Niklas Luhmann, „als eine Form begreifen, deren Innenseite (Inklusion) als Chance der sozialen Berücksichtigung von Personen bezeichnet ist und deren Außenseite unbezeichnet bleibt. Also gibt es nur Inklusion, wenn Exklusion möglich ist. Erst die Existenz nichtintegrierbarer Personen oder Gruppen läßt soziale Kohäsion sichtbar werden und macht es möglich, Bedingungen dafür zu spezifizieren.“223 Eine zentrale These der Systemtheorie besagt nun, dass mit dem Wandel der Differenzierungsform einer Gesellschaft auch eine Umstellung ihrer Inklusions- und Exklusionsmodi einhergeht. 221 222 223 Vgl. dazu grundlegend LUHMANN, Inklusion und Exklusion (wie Anm. 12). LUHMANN, Niklas: Die Form ‚Person’. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. Opladen 1995, S. 142-154, hier S. 148. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 620 f. 97 Nach Strata differenzierte Gesellschaften spezifizieren ihre Inklusionsbedingungen über die Schichtzugehörigkeit, in welcher sich der Sozialstatus des Individuums eindeutig festgelegt findet. Die Inklusion erfolgt hier über die exklusive Zugehörigkeit zu einer Kaste, Stand oder Schicht, die qua Geburt jeweils das einschränkt, was an Verhaltensweisen von ihren Mitgliedern zu erwarten ist. Durch die Verteilung der Gesellschaftsmitglieder auf nach Rangstufen voneinander unterschiedenen Teilsystemen wird Ego als Träger eines sozialen Status mit demjenigen vergleichbar, mit dem er seine Teilsystemzugehörigkeit teilt – genauer: mit seinem alter Ego. Diese fiktive Homogenität von Personen, die einem Teilsystem angehören, wird insbesondere durch die endogamen Beziehungen innerhalb der Oberschicht symbolisiert und so gut wie es eben geht auch in die Realität umgesetzt. Innerhalb einer Schicht sind dabei durchaus Ungleichheiten erlaubt, die etwa in der Oberschicht graduelle Unterschiede des Ansehens und der Ehre bzw. Voll- und Minderberechtigungen an Herrschaftsbefugnissen zur Folge haben.224 Im gewissen Sinne garantieren solche sozialen Ungleichheiten, wie sie zwischen dem höheren und niederen Adel vorzufinden sind, die Erhaltung einer einheitlichen sozialen Identität, indem sie für mögliche Statusabstiege einen Ort innerhalb der Schicht vorsehen. Die Angehörigen der unterschiedlichen Schichten nehmen sich dahingegen als völlig andersartige Personengruppen wahr, denen aufgrund ihrer jeweils eigenen Qualitäten des Handelns und Erlebens eine gemeinsame Basis fehlt, vor deren Hintergrund Vergleiche zwischen Alter und Ego angestellt werden könnten. Den ‚ökonomischen Einheiten’ der stratifizierten Gesellschaften, den so genannten Häusern, fällt dabei die Funktion zu, durch die Zuweisung unterschiedlicher Rechte und Pflichten eine schichtübergreifende Ordnung des Gesellschaftsgefüges zu stabilisieren. Nach Otto Brunner ist das Haus (oikos) „ein Ganzes, das auf der Ungleichartigkeit seiner Glieder beruht, die durch den leitenden Geist des Herrn zu einer Einheit zusammengefügt wird.“225 Diese Einheit von Herr und Knecht, Mann und Frau, Vater und Kind wird vertraglich durch einen Treueid abgesichert, bei dem sich die Mitglieder der Hausgemeinschaft wechselseitig dazu verpflichten, ihren rechtlich fixierten Aufgaben nachzukommen. Obgleich die Mitglieder des Hauses mit ganz unterschiedlichen Aufgaben betraut sind, denen jeweils im ungleichen Maße eine Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Ganzen zufällt, so wäre doch der eine Teil nicht ohne den anderen überlebensfähig. Das Haus fungiert somit als eine multifunktionale Überlebensgemeinschaft, die auf der Kooperation ihrer heterogenen Teile beruht. Diese nehmen jeweils exklusiv einen Funktionsbereich innerhalb des Ganzen wahr, sodass der eine Teil nicht die Aufgaben des anderen Teils übernehmen kann und sich infolgedessen in einem Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten eingebettet findet. Die Hausväter ihrerseits 224 225 Vgl. HAHN, Alois: Funktionale und stratifikatorische Differenzierung und ihre Rolle für die gepflegte Semantik. Zu Niklas Luhmann ‚Gesellschaftsstruktur und Semantik’. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 33 (1981), S. 345-360, hier S. 351. BRUNNER, Otto: Das „ganze Haus“ und die alteuropäische „Ökonomik“. In: BRUNNER, Otto: Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. Vorträge und Aufsätze. Göttingen 1968, S. 103-127, hier S. 112. 98 begründen zusammen die politische Gesellschaft (‚societas civilis’), einer Assoziation freier und gleicher, über Eigentum verfügender Bürger, die auf der Tugend und dem Recht ihrer Mitglieder beruht. Dahingegen sind die sozialen Beziehungen innerhalb des sozialen Systems des Hauses durch Herrschaft und die Norm der Reziprozität definiert. Wer sich der Herrschaft bzw. der Reziprozität verweigert, dem droht die Exklusion aus der Hausgemeinschaft. Räumliche Mobilität ist demgemäß entweder ein Privileg, über das nur wenige verfügen (Freie, Pilger, Händler, Gesandte etc.), oder es kennzeichnet Menschen, die sich bindungs- und herrenlos außerhalb der partikularistischen Personenverbände im Exklusionsbereich der Gesellschaft bewegen. Für den Großteil der Bevölkerung hingegen ist Sesshaftigkeit und damit einhergehend die Interaktion zwischen bekannten und sich wechselseitig vertrauten Personen kennzeichnend.226 Dieser Sozialstruktur entsprechend erfolgt bei Exklusion, also bei der Entlassung aus einem Treueverhältnis, in der Regel die erneute Inkorporation in eine andere Rechtsgenossenschaft.227 Im Übergang zur modernen funktional differenzierten Gesellschaft, deren Wurzeln sich bis in das Hoch- und Spätmittelalter zurückverfolgen lassen, gestalten sich die Maßgaben für Inklusion Schritt für Schritt um. In der modernen Gesellschaft bleibt es den Funktionssystemen (Recht, Politik, Wissenschaft, Religion, Wirtschaft, Kunst, Erziehung etc.) überlassen, Inklusion aus ihrer je eigenen Systemperspektive stets aufs Neue zu gewähren. Der evolutionäre Vorteil einer solchen Differenzierungsform liegt in ihren strukturellen Möglichkeiten begründet, eine höhere gesellschaftliche Komplexität zuzulassen. Verhalten, das nicht den sachlogischen Erwartungen der Funktionssysteme entspricht, kann jetzt als ‚Rauschen’ der Umwelt einfach ignoriert werden.228 Dieser flexiblere Umgang mit Verhaltensweisen, die sich nicht den jeweiligen Systemrationalitäten fügen, hat zur Folge, dass die Person nicht mehr als Ganze, d.h. unter Berücksichtigung der verschiedenen Facetten ihrer Handlungen, sondern ausschnittsartig als Anknüpfungspunkt für spezifische Kommunikationen wahrgenommen wird. Der Inklusionsbereich ist dann „letztendlich nur 226 227 228 Zum mittelalterlichen Gebundensein an Scholle und Grundherren vgl. MÖHLENBRUCH, Rudolf: „Freier Zug, Ius Emigrandi, Auswanderungsfreiheit“. Eine verfassungsgeschichtliche Studie. Bonn 1977, S. 25 ff. Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet das spätmittelalterliche Verhältnis von Grundherrschaft und Stadt. Zwar macht Stadtluft bekanntlich frei, aber dennoch sind alle Bürger und Einwohner über einen Bürger- bzw. Beisasseneid genossenschaftlich miteinander verbunden. Vgl. dazu DILCHER, Gerhard: Bürger, Einwohner, Fremder. In: BADER, Karl S. / DILCHER, Gerhard (Hg.): Deutsche Rechtsgeschichte. Land und Stadt – Bürger und Bauer im alten Europa. Berlin [u.a.] 1999, S. 445-474. In einer primär stratifikatorisch differenzierten Gesellschaft verwirklicht sich eine sachlogische Autonomie jedoch nur in dem Umfang, wie die an Funktionen orientierten Systeme imstande sind, sich in eine durch Hausgemeinschaften differenzierte Gesellschaft einzupassen und diese zu stabilisieren. Bis weit in die Frühe Neuzeit setzte sich etwa das politische System in seinem Funktionsbereich korporative Grenzen, indem es die politische Entscheidungsfindung auf die noch ganz in der Tradition der Hausherrschaft stehenden Reichs- und Landesstände beschränkte. Alois Hahn hat dabei die These vertreten, dass bei der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft evolutionäre Errungenschaften beteiligt waren, deren Leistungen eben darin bestanden, die Eigendynamiken und wechselseitigen Freiheitsgrade der einzelnen Funktionssysteme durch die Konstituierung eines gemeinsamen Möglichkeitshorizonts zu begrenzen. Ähnlich wie die multifunktionalen Einheiten der alteuropäischen ‚Familie’ bzw. Hausgemeinschaft konnte sich mit dem Territorium eine neue Form der segmentären Differenzierung etablieren, welche die funktionale Differenzierung zu überformen und zu integrieren in der Lage war. Vgl. HAHN, Alois: Identität und Nation in Europa. In: Berliner Journal für Soziologie 3 (1992), S. 193-203. 99 jeweils an einem Teil (Dividuum) des Unteilbaren (Individuum) interessiert – der ‚Rest’ wird gewissermaßen dem Zugriff funktionsspezifischer Konditionierung entzogen.“229 Dem Individuum wird damit aber zugemutet, sich zum Zwecke der Inklusion gemäß den jeweiligen sachlogischen Verhaltenserwartungen zu präsentieren. Da die Inklusionsbedingungen nunmehr universelle Gültigkeit beanspruchen und nicht mehr von dem Sozialstatus einer Person abhängig gemacht werden, lassen sich Exklusionen jedem Einzelnen selbst (im Sinne von nicht in Anspruch genommenen Inklusionschancen) zuschreiben. Unverkennbar tritt hier zutage, wie mit der Durchsetzung moderner Sozialstrukturen die bisher gängige Art und Weise, Personen als Anknüpfungspunkte für Kommunikationen wahrzunehmen, ins Wanken gerät. Während stratifikatorisch differenzierte Gesellschaften den Vorgang ihrer Perzeption über Verortungen innerhalb eines oben/untenSchemas leisten und die Zugangsbeschränkungen zu den gesellschaftlichen Teilsystemen über ihre natürlichen Begabungen legitimieren, organisiert die funktional differenzierte Gesellschaft Inklusionen über die Ausdifferenzierung heterotroper, den verschiedenen Funktionssystemen zuordenbarer Leistungs- und Publikumsrollen.230 Das evolutionär neuartige Moment dieser Rollenmuster ist gerade darin zu sehen, dass sich mit ihrer Hilfe relativ zeitunabhängige Identifikationsgesichtspunkte für Erwartungen kenntlich machen lassen, „die von der je spezifischen Person abheben, indem sie ein je funktionssystemspezifisches ‚Anforderungsprofil’ konturieren.“231 Es sind eben diese Anforderungsprofile, mit denen sich die Moderne – wenngleich nur zögerlich – von der Vorstellung zu lösen beginnt, es seien die natürlichen Verhaltensdispositionen und nicht etwa die willentlichen Entscheidungen der Person, die sich für die Inklusion in die gesellschaftlichen Teilsysteme verantwortlich zeichnen. Letztendlich gelangt erst durch diese Absonderung der Person von der Rolle die Unabhängigkeit der Sozialdimension von der Sachdimension zu ihrer endgültigen Realisation.232 Insofern über Rollen Verhaltenserwartungen festgeschrieben werden, fungieren diese als Orientierungshilfen, kraft derer Personen darüber zu befinden ver- 229 230 231 232 NASSEHI, Armin: Inklusion, Exklusion – Integration, Desintegration. Die Theorie funktionaler Differenzierung und die Desintegrationsthese. In: HEITMEYER, Wilhelm (Hg.): Was hält die Gesellschaft zusammen? Bundesrepublik Deutschland. Auf dem Weg von der Konsens- zur Konfliktgesellschaft. Bd. 2. Frankfurt (Main) 1997, S. 113-148, hier S. 127 f. Zur Bedeutung der Leistungs- und Publikumsrollen bei der Ausdifferenzierung von Funktionssystemen vgl. STICHWEH, Rudolf: Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft. In: MAYNTZ, Renate / ROSEWITZ, Bernd / SCHIMANK, Uwe / STICHWEH, Rudolf: Differenzierung und Verselbständigung. Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme. Frankfurt (Main) / New York 1988, S. 261-293, LUHMANN, Niklas / SCHORR, Karl Eberhard: Reflexionsprobleme im Erziehungssystem. Frankfurt (Main) 1988, S. 29 ff. GÖBEL, Markus / SCHMIDT, Johannes F.K.: Inklusion – Exklusion. Karriere, Probleme und Differenzierungen eines systemtheoretischen Begriffpaars. In: Soziale Systeme 4 (1998), S. 87-117, hier S. 103. Vgl. zur Differenz von Rolle und Person auch LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 429 ff. Im Bereich des Politischen finden sich erste Ansätze, die eine solche Trennung fordern, in der Diskussion zur Differenzierung von Amt und Person. Um den Staatskörper zu optimieren und von unnötigen Kosten zu befreien, fordert etwa Georg Obrecht von den Regenten, „daß sie alle ihre Aempter / mit tuechtigen Personen ersetzen / und nicht die Personen mit den Aempteren / sondern die Aempter mit den Personen versehen [...].“ OBRECHT, Georg: Fünff Vnterschiedliche Secreta Politica von Anstellung / Erhaltung vnd Vermehrung guter Policey. Hildesheim / Zürich / New York 2003 [ND Straßburg, 1617], S. 45. 100 mögen, inwieweit sie mit der Aktualisierung eines spezifischen Verhaltens den eigenen Aspirationen gerecht werden oder diese geradezu konterkarieren.233 Mit Leistungs- und Publikumsrollen konstituieren Funktionssysteme zwei voneinander geschiedene Inklusionsbereiche, die einerseits der Person Spezialisierungen qua Ausbildung und Professionalisierung abverlangen – etwa als Priester, Arzt, Lehrer, Produzent, Mandatsträger etc. –, die aber andererseits die Gesamtbevölkerung qua Universalisierung und Generalisierung umfasst – etwa als Kläger, Glaubender, Patient, Schüler, Konsument, Wähler etc. Wenn Niklas Luhmann die potentielle Inklusion der Gesamtbevölkerung in die Funktionssysteme als Charakteristikum der modernen Gesellschaft ausmacht, dann bezieht sich diese Aussage darauf, dass Diskriminierungen der Teilhabechancen nun eben nicht mehr über den Sozialstatus, sondern über sachthematische Relevanzen der Personen verlaufen, die sich innerhalb der Funktionssysteme selbst entscheiden.234 Keineswegs soll damit die These einer jederzeit realisierten Totalinklusion der Gesamtbevölkerung in alle Funktionssysteme vertreten werden. Dies schließt schon der operative Charakter der Inklusion aus. Denn in dem Geflecht von Leistungs- und Publikumsrollen bewegt sich die Person von einem Inklusions-/Exklusionsverhältnis zum nächsten, durchläuft dabei Inklusionen wie Exklusionen gleichermaßen. Inklusionen und Exklusionen ereignen sich, anders gesagt, permanent und haufenweise; und dies in den verschiedensten Ordnungsformaten einer Gesellschaft: Man nimmt teil an einer Interaktion und bleibt damit doch gleichzeitig anderen Interaktionen fern, man nimmt die Dienste jener und nicht einer anderen Organisation in Anspruch, man klagt für sich Recht ein, ohne dabei parallel auch seinen Kontrahenten zu erziehen. Die mit jeder Inklusion gegebene andere Seite steht jedoch für eine Aktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt offen – man bleibt in seinen Teilhabemöglichkeiten nicht an einer Interaktion, einer Organisation oder einem gesellschaftlichen Teilsystem verhaftet; jedenfalls lässt sich dies für die moderne Gesellschaft behaupten. Diese prinzipielle Möglichkeit, an den unter- 233 234 Diese Differenzierung von Rolle und Person wird bei Mandeville in sehr anschaulicher Weise am Beispiel des Armen dargestellt. Mandeville verweist in seiner ‚Abhandlung über Barmherzigkeit, Armenpflege und Armenschulen’ auf die spezifische Rolle der Armen für die Gesellschaft, insofern eine „soziale Gemeinschaft [...] nun unmöglich lange bestehen [kann – J.H.], wenn sie duldet, daß viele ihrer Mitglieder müßiggehen und sich alle erdenklichen Annehmlichkeiten und Genüsse leisten, ohne daß gleichzeitig eine große Masse von Individuen vorhanden ist, die des Ausgleichs wegen sich zu dem geraden Gegenteil hiervon verstehen, nämlich sich durch rastlose Arbeit daran gewöhnen, im Interesse jener anderen, und ihrem eigenen dazu, tätig zu sein.“ MANDEVILLE, Bienenfabel (wie Anm. 63), S. 318. Aus diesem Grund wehrt sich Mandeville auch gegen die Forderung nach einer besseren Erziehung und Bildung der Armen, da mit der Steigerung ihrer Aspirationen und Bedürfnisse zugleich auch ihre Bereitschaft sinken würde, harte und schmutzige Arbeit zu tun. „Wo sollten wir für diese Notwendigkeiten einen besseren Nachwuchs finden als unter den Kindern der Armen? Sicher steht niemand dieser Art Leben näher und ist dafür geeigneter. Außerdem ist es so, daß die Dinge, die ich hart nannte, solchen Leuten weder hart scheinen, noch für solche Leute eine Last sind, die mit ihnen aufwuchsen und nichts Besseres kennen. Unter uns gibt es keine zufriedeneren Menschen als die, die am härtesten arbeiten und am wenigsten mit dem Glanz und den Annehmlichkeiten der Welt vertraut sind.“ Ebd., S. 343. Vgl. LUHMANN, Niklas: Jenseits von Barbarei. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie. Bd.4. Frankfurt (Main) 1995, S. 138-150, hier S. 142; LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 725. 101 schiedlichen Funktionssystemen teilzuhaben, setzt freilich voraus, dass in der Gesellschaft „Interdependenzunterbrechungen“235 vorhanden sind, die hinsichtlich der partikularen Inklusionsbereiche ein Ineinanderübergreifen und ein wechselseitiges Bedingen der Teilhabechancen verhindern. Und genau diese prinzipielle Möglichkeit des ‚crossings’, des Selbstbestimmten Zugangs zu den verschiedenen Teilsystemen einer Gesellschaft, schreibt sich die Moderne auf ihre Fahnen, wenn sie die Freiheit und Gleichheit aller Menschen als ihr Credo ausruft. Nun zeigt sich bereits an dieser Stelle, dass eine derartige Ausweitung von Inklusionschancen nicht ohne eine Verkürzung der Inklusionsdauer möglich wäre. Ließ sich in stratifikatorisch differenzierten Gesellschaften die exklusive und dauerhafte Inklusion der Person in ein Teilsystem der Gesellschaft noch über ihre unveränderliche Natur begründen, so wird in der modernen Gesellschaft die Aufrechterhaltung der Inklusionsordnung zu einer Aufgabe, die sich den einzelnen Funktionssystemen unter der Voraussetzung von im Wandel befindlicher Umweltbedingungen über den Bezug auf ihre eigenen Operationen immer wieder aufs Neue stellt. Diese Umgestaltungen in der Zeitdimension sozialer Ordnung gilt es im folgenden Kapitel genauer zu untersuchen. 3.2.2 Die Zeitdimension sozialer Ordnung Betrachten wir die Zeit aus unserem Alltagsverständnis heraus, so erscheint sie uns als etwas selbstverständlich Gegebenes, als ein objektives Faktum, dem wir nicht einfach zu entfliehen vermögen. Während wir uns von einem Raum in den nächsten begeben und uns von Dingen trennen können, folgt uns die Zeit auf Schritt und Tritt. Sie schreitet voran, ohne das wir imstande wären, sie mit unserem Willen zu ergreifen, uns ihrer zu bemächtigen. Der Traum, verschiedene Zeiten zu bereisen, lässt sich literarisch so schön träumen, gerade weil er uns in seiner Fiktion so unrealisierbar und phantastisch daher kommt. Dort, wo er die Zeit verdinglicht, erleben wir sie als flüchtig, als verloren und eben deshalb auch als nicht verfügbar. Sie ist und ist im nächsten Moment nicht mehr; oder präziser: im nächsten Moment eine ganz andere, als sie vorher war. Entsprechend belegen wir die Zeit nicht nur mit einem ihr zugehörigen Sein, sondern auch mit einer an ihr erlebbaren Veränderung. Aber es wird hier schon ersichtlich, dass die Zeit für sich alleine nicht sein kann, dass sie der Mithilfe des Raumes oder eines Dinges bedarf, um sich unserer Wahrnehmung preiszugeben. Die Gewissheit ihrer Anwesenheit erschließt sich uns etwa durch die Natur und den in ihr zu beobachtenden Zyklen und Verläufen: dem Wechsel der Jahreszeiten, dem Sonnenaufgang und -untergang, dem stetigen Fließen eines Flusses, der mit dem Leben gegebenen Unausweichlichkeit des Alterns. Daneben ist sie uns aber auch auf Grund der 235 LUHMANN, Inklusion und Exklusion (wie Anm. 12), S. 249. 102 Kultur prädisponiert: Termine, die einzuhalten sind; Mahlzeiten, die wir in unserem Familienund Berufsalltag zu ritualisieren haben; ja selbst Fernsehprogramme, die uns dazu nötigen, in dem was wir tun, den Blick auf die Uhr im Hinterkopf zu behalten. All dies führt uns vor Augen, dass unser Leben in permanenter Bewegung ist, dass Dinge sich ändern, dass Zeitpunkte zu unterscheiden sind, die jeweils ihnen eigentümliche Bedeutungen und Dringlichkeiten aufweisen. Es führt uns aber vor allem vor Augen, dass wir dem ausgeliefert sind, ob wir das nun wollen oder nicht. Unser Alltagsverständnis von Zeit changiert dementsprechend zwischen zwei Bedeutungsinhalten: der Notwendigkeit, mit der ein bestimmtes Ereignis eintritt, und der Möglichkeit, ein bestimmtes Ereignis zu gestalten – entweder es ist Zeit oder aber wir haben Zeit, etwas zu tun. Es scheint also, als würde jedwedem Verhalten in der Welt bereits eine Zeitlichkeit innewohnen. Weshalb aber ist dies der Fall? Die weiteren Ausführungen zielen weder darauf ab, eine Soziologie der Zeit systemtheoretisch neu zu begründen,236 noch darauf, die Metamorphose der Zeit in all ihren Facetten zu rekonstruieren.237 Auch soll keineswegs der Versuch unternommen werden, jene in der Gesellschaft wirksamen Mechanismen aufzuspüren, die an der Synchronisation individueller Zeitempfindungen und somit an der Erzeugung einer sozial verbindlichen Zeit beteiligt sind.238 Derartige Vorhaben würden den thematischen Rahmen sprengen, den es hier zu verfolgen gilt. Ich interessiere mich im Weiteren einzig und allein für die Frage, inwieweit soziale Ordnungsvorstellungen von den Zeithorizonten abhängen, die eine Gesellschaft zum Zwecke des Aufbaus und der Reduktion von Komplexität hervorbringt. Eine solche Herangehensweise an das Phänomen der Zeit macht es zunächst einmal unumgänglich, genauer auf das Problem einzugehen, was soziale Systeme eigentlich beobachten, wenn sie Zeitlichkeit als ein Kriterium ausweisen, mittels dessen sich die Welt beschreiben lässt. „Die Zeitdimension wird dadurch konstituiert“, so heißt es dazu bei Niklas Luhmann, „daß die Differenz von Vorher und Nachher, die an den Ereignissen unmittelbar erfahrbar ist, auf Sonderhorizonte bezogen, nämlich in die Vergangenheit und die Zukunft verlängert wird. Die Zeit wird damit von der Bindung an das unmittelbar Erfahrbare gelöst [...]. Zeit ist demnach für Sinnsysteme die Interpretation der Realität im Hinblick auf eine Differenz von 236 237 238 Vgl. dazu die Arbeiten von LUHMANN, Niklas: Weltzeit und Systemgeschichte. Über Beziehungen zwischen Zeithorizonten und sozialen Strukturen gesellschaftlicher Systeme. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 1975, S. 103-133; LUHMANN, Niklas: The Future Cannot Begin. Temporal Structures in Modern Society. In: Social Research 43 (1976), S. 130-152. Sowie im Anschluss an die Überlegungen Luhmanns vgl. BERGMANN, Werner: Die Zeitstrukturen sozialer Systeme. Eine systemtheoretische Analyse. Berlin 1981; NASSEHI, Armin: Die Zeit der Gesellschaft. Auf dem Weg zu einer soziologischen Theorie der Zeit. Opladen 1993. Dass die Zeit nicht mehr das ist, was sie einmal war, kann man in zahlreichen Abhandlungen über die historischen und kulturellen Besonderheiten des Zeitbewusstseins detailliert nachlesen. Vgl. dazu exemplarisch die materialreiche Studie von WENDORFF, Rudolf: Zeit und Kultur. Geschichte des Zeitbewußtseins in Europa. Opladen 1980. Foucault hat in diesem Zusammenhang vor allem auf die historische Bedeutung von Klöstern, Arbeitshäusern und Schulen wie auch dem Militär hingewiesen. Vgl. FOUCAULT, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt (Main) 1998, S. 192 ff. 103 Vergangenheit und Zukunft. Dabei ist der Horizont der Vergangenheit (und ebenso: der Zukunft) nicht etwa der Anfang (bzw. das Ende) der Zeit. Diese Vorstellung des Anfangs bzw. des Endes schließt der Horizontbegriff gerade aus. Vielmehr fungieren die gesamte Vergangenheit und ebenso die gesamte Zukunft als Zeithorizonte [...].“239 Zeit erscheint damit immer paradox konstituiert, da die Vergangenheit und Zukunft lediglich als Einheit des Differenten in der Gegenwart beobachtet werden kann. Es ist dieses Paradox der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“,240 das Zeitsemantiken zu entfalten in der Lage sein müssen, um Plausibilität in den gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen erlangen zu können. Entscheidend ist nun zu sehen, dass die Zeitdimension mit ihren Endloshorizonten von Vergangenheit und Zukunft erst relativ spät in der sozialen Evolution zur Reduzierung der Verhaltenskomplexität einer jeweils gegebenen Gegenwart herangezogen wurde. Bis in die Neuzeit hinein schien das, was in der Welt überhaupt möglich ist, bereits in der Sachdimension durch vergangene Kausalitäten (Natur, Schöpfung, Sündenfall) bzw. zukünftige Finalitäten (Jüngstes Gericht, Apokalypse) eingegrenzt. Wie also konnte es zur Ausdifferenzierung einer von der Sachdimension autonomen Zeitdimension kommen? Und was verändert sich, wenn sie einmal als solche zur Verfügung steht? Bei der Beantwortung dieser Fragen geht die Systemtheorie von zwei zentralen Grundannahmen aus, nämlich zum einen, dass jede Zeiterfahrung innerhalb eines Systems erfolgen muss, und zum anderen, dass jede temporale Modularisierung auf ein Problem reagiert und damit eine bestimmte Funktion bei der Reproduktion der Systemelemente erfüllt. Die Systemtheorie Luhmanns begründet Zeitlichkeit aus der Art und Weise, wie sich Systeme über das Medium Sinn reproduzieren. Da jeder aktuell bezeichnete Sinn auf bereits selektierten, auch anders möglichen Sinn verweist und zugleich über zu Erwartendes Auskunft gibt, sind Systemelementen zeitliche Implikationen immer schon inhärent. Sinnsysteme reproduzieren sich also selbstreferentiell, über den Rekurs auf ihre eigenen Operationen, und ziehen somit stets aufs Neue im Nacheinander ihrer Operationen eine Grenze zwischen den Elementen des Systems und deren Umwelt. Gedanken schließen an Gedanken an, bleiben dabei aber darauf angewiesen, sich auf etwas außerhalb ihrer selbst zu beziehen; Kommunikationen setzen Kommunikationen fort, erhalten aber ihren Sinn erst dadurch, dass sie andere Kommunikationsmöglichkeiten ausschließen. Niklas Luhmann hat nun im Anschluss an Talcott Parsons die These vertreten, „daß die Differenzierung von System und Umwelt Zeitlichkeit produziert, weil sie eine momenthafte, Punkt für Punkt korrelierende Erhaltung der Differenz ausschließt. Es kann nicht mehr alles gleichzeitig gesche- 239 240 LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 116. LUHMANN, Niklas: Gleichzeitigkeit und Synchronisation. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven. Opladen 1990, S. 95-130, hier S. 100. 104 hen. Die Erhaltung braucht Zeit und hat Zeit.“241 Zwar verweist die Differenz von System und Umwelt auf eine Gleichzeitigkeit, weil mit jeder Operation eine Selektion getroffen wird, die das, was sich innerhalb eines Systems aktuell ereignet, von dem, was in der Umwelt des Systems möglich ist, unterscheidet. Damit ist aber gerade nicht gesagt, dass alles, was in der Umwelt eines Systems an Möglichkeiten gegeben sind, auch für dieses von Belang und nicht alle möglichen Aggregatzustände eines Systems durch eine jeweils gegebene Umwelt bedingt sein müssen. Wäre dies der Fall, so ließe sich eine strikte Differenzierung zwischen System und Umwelt nicht aufrechterhalten, weil die Umwelt jeweils das festlegen würde, was sich in einem System ereignet. Entsprechend müsste man die Anlässe eines Systems, seine Strukturen zu verändern, in dessen Umwelt verlagern und den Vorgang an sich auf bloße Adaption verkürzen. Das hieße aber, dem System jede Zeitlichkeit abzusprechen, da diese gerade darin gründet, dass das System im Nacheinander seiner Operationen das Verhältnis zu seiner Umwelt jeweils systemintern neu bestimmen kann. Es muss nicht auf alles reagieren, was sich in seiner Umwelt auch tatsächlich ereignet.242 Auf der Ebene basaler Selbstreferenz bleibt den Sinnsystemen selbst freilich ihre Zeitlichkeit verschlossen. Eine Operation folgt der nächsten, ohne dass ihre Abfolge eigens zum Thema gemacht werden müsste. Für den Aufbau und die Reduktion von Komplexität sind sie allerdings darauf angewiesen, Zeithorizonte und bestimmte Auslegungen zeitlicher Relevanzen zu institutionalisieren.243 Denn nur mittels dieses Präsenthaltens nicht aktualisierter Möglichkeiten sind sie imstande, Systemgrenzen auszuweisen und damit Anschlussmöglichkeiten vorzuseligieren. Diejenigen Möglichkeiten, die von dem System innerhalb der Sachdimension in die Umwelt ausgelagert wurden, lassen sich dann zu einem späteren Zeitpunkt erinnern und in das System einholen. Dabei machen sich soziale Systeme ihre Zeitlichkeit als Systemgeschichte bewusst. Unter Geschichte ist hier nicht einfach ein Prozess, eine zeitliche Abfolge mehr oder weniger bedeutsamer Ereignisse zu verstehen, die das System durchlaufen hat und in Erinnerung rufen oder dem Vergessen anheim stellen kann. Geschichte meint mehr als bloße Historie. Sie verleiht Identität, indem sie als „prozessuale Selbstreferenz“244 über den Vergangenheitsbezug hinaus das zu beschränken vermag, was innerhalb des Systems zukünftig zu erwarten ist. Soziale Systeme vergegenwärtigen sich ihrer Geschichte also, um den Bereich möglicher Anschlussoperationen zu 241 242 243 244 LUHMANN, Niklas: Weltzeit und Systemgeschichte (wie Anm. 236), S. 105. Vgl. dazu auch LUHMANN, Niklas: Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart 1973, S. 8 ff. Ein einfaches Beispiel kann dies verdeutlichen: Eine Interaktion innerhalb eines Zugabteils kann sich relativ indifferent gegenüber dem ‚Blick aus dem Fenster’, dem permanenten Wandel ihrer Umwelt verhalten, solange jedenfalls, wie sie über genug Gesprächsstoff verfügt. Freilich kann sie aber auch selektiv auf Gegebenheiten außerhalb des Zugabteils, etwa dem alten Bahnhof an der Wegstrecke, zurückgreifen, um die Kommunikation fortzuführen. Die Entscheidung, was von der Umwelt als Information im System verarbeitet wird, bleibt somit letztlich der Interaktion selbst überlassen. Vgl. dazu grundlegend LUHMANN, Weltzeit und Systemgeschichte (wie Anm. 236). Nassehi führt an dieser Stelle die Unterscheidung zwischen der Zeit der Autopoiesis und der Beobachtungszeit ein. Vgl. NASSEHI, Zeit der Gesellschaft (wie Anm. 236), S. 192 ff. Vgl. zum Begriff der ‚prozessualen Selbstreferenz’ LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 601. 105 limitieren. Geschichte ist, mit anderen Worten, dem sozialen System nicht schlichtweg gegeben, sondern sie entsteht, so Niklas Luhmann, „wenn gesellschaftswichtige Ereignisse im Hinblick auf die Differenz von vorher und nachher (also als Ereignisse, und schärfer: als Zäsuren) beobachtet werden. Sie setzt weiter voraus, daß die damit sichtbare Differenz in der Zeit nicht einfach durch Desidentifikation aufgelöst werden kann in dem Sinne, daß die Gesellschaft vorher eine andere ist als die nachher.“ Die Differenz des Vorher und Nachher muss vielmehr dazu benutzt werden, „die Einheit des Differenten zu feiern.“245 Mit der Differenz von Vorher und Nachher ist jener allen Sinnsystemen zugrunde liegende kleinste gemeinsame Nenner benannt, von dem aus Zeit an einer Abfolge von Ereignissen etwa als Bewegung, als Wandel oder auch als Schisma wahrgenommen werden kann. Allerdings reicht die Differenz alleine nicht aus, um zeitliche Relevanzen innerhalb des Systems zu konstruieren. Für sich betrachtet erfasst sie lediglich eine sachliche Differenz von Ereignissen. Temporal modalisiert wird sie erst in dem Moment, in dem man der einen Seite das Potential zuschreibt, die Möglichkeiten der anderen Seite zu beschränken. Das Gewahrwerden von Geschichte beruht demnach immer auf der Konstruktionsleistung einer aktuellen Beobachtungsoperation. Die ihr zugrunde liegende Einheit des Differenten kann somit lediglich in der Gegenwart zustande kommen, und zwar als „Simultanpräsenz von Dauer und Wechsel.“246 Das System darf sich in seinem gegenwärtigen Zustand nicht als ein komplett anderes wahrnehmen, als es in der Vergangenheit war oder in der Zukunft sein wird. In der Beobachtung seiner Zeitlichkeit setzt es gerade etwas voraus, was das Intervall zwischen dem Vorher und Nachher überdauert. Luhmann geht entsprechend davon aus, „daß immer zwei Gegenwarten gleichzeitig gegeben sind und daß erst deren Differenz den Eindruck des Fließens der Zeit erzeugt. Die eine Gegenwart fällt punktualisiert an: Sie markiert an irgendetwas (z.B. am Uhrzeiger, an Geräuschen, an Bewegungen, am Wellenschlag), daß immer etwas sich irreversibel verändert. Die andere Gegenwart dauert und symbolisiert damit die in allen Sinnsystemen realisierbare Reversibilität. Die Selbstreferenz ermöglicht eine Rückwendung zu vorherigen Erlebnissen bzw. Handlungen und zeigt diese Möglichkeit laufend an [...]. Diese beiden Gegenwarten polarisieren sich wechselseitig als Differenz von Ereignissen und Beständen, von Wandel und Dauer, und das wiederum ermöglicht das Präsentwerden einer am irreversiblen Ereignis noch sichtbaren Vergangenheit und schon sichtbaren Zukunft in einer noch dauernden Gegenwart.“247 Die Gegenwart ist den Sinnsystemen also einerseits immer irreversibel gegeben, da sie auf Ereignisse verweist, die ihr voraus liegen. Insofern diese Ereignisse aber andererseits auf Selektionen gründen und somit nicht so eintreten mussten, wie sie es taten, liegen in ihnen auch in der Gegenwart noch Möglichkeiten begründet, die im Hinblick auf die Zukunft gewählt werden können. 245 246 247 LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 573. BERGMANN, Zeitstrukturen (wie Anm. 236), S. 76. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 117. 106 Mit Hilfe seines Gedächtnisses, genauer: über die Erinnerung vergangener Selektionen, versetzt sich das System in die Lage, dem unentwegten Zerfall seiner Operationen eine Dauer entgegenzusetzen, welche die Zeit als reversibel erscheinen lässt. „Das Systemgedächtnis rekonstruiert mit der Geschichte des Systems auch die Selektivität dieser Geschichte und vergegenwärtigt sich die den Selektionen des Systems [...] zum Opfer gefallenen Möglichkeiten. Erinnert wird auch das, was hätte geschehen können. Die gegenwärtige Erinnerung versorgt die Vergangenheit und über diese auch die Gegenwart mit Modalisierungen des Systemverhaltens.“248 Sinnsysteme verdanken ihrem Gedächtnis somit ein Wissen von einer durch vergangene Selektionen herbeigeführten, aber durchaus auch anders möglichen Gegenwart. In segmentär differenzierten Gesellschaften spielen solche über Geschichte vollzogenen Modalisierungen kaum eine Rolle. Sie kennen zwar Geschichte im Sinne einer mythischen Vorzeit, diese wird aber gerade dazu verwendet, dem Bereich des Vertrauten einen Bereich des Unvertrauten gegenüberzustellen. Das System baut auf das Bewährte, während es die Möglichkeit des auch Anderseins in eine ferne Vergangenheit (bzw. Zukunft) verlegt. Natürlich nehmen auch segmentäre Gesellschaften Zeitverläufe und Veränderungen innerhalb ihrer Grenzen wahr, aber sie zielen gerade darauf ab, die ihnen anhaftenden Unsicherheitspotentiale durch Ritualisierung, durch die Schaffung von allen Gesellschaftsmitgliedern vertrauten, da sich permanent wiederholenden Situationen zu absorbieren. Diese Ausrichtung der Systemoperationen auf eine begrenzte Anzahl ritualisierter Situationen, deren Wiederkehr Anlass genug ist, sich stets aufs Neue auf eine bestimmte Weise zu verhalten, lässt einen Bedarf an die Vorzeit und Jetztzeit übergreifende Geschichtskonstruktionen erst gar nicht aufkeimen. Gerade weil die Ahnen in einer ganz anderen Zeit lebten, standen ihnen noch Verhaltensmöglichkeiten offen, die den Abkömmlingen der Jetztzeit selbst verwehrt bleiben. Das Leben der Ahnen fand sozusagen in einer Umwelt statt, die durch die Gegenwart des Systems abgelöst wurde. Die Karriere der Zeit als eine Dimension der Weltbeschreibung, über die sich Komplexität aufbauen und zugleich reduzieren lässt, setzt erst zu einem Zeitpunkt ein, als soziale Systeme damit beginnen, einen kausalen Zusammenhang zwischen ihrem gegenwärtigen und vergangenen Zustand zu konstruieren. Die Selektivität des Systems, so wie sie sich in der Gegenwart darstellt, wird hier über den Verweis auf eine Vergangenheit legitimiert, in der aus einem Horizont von Möglichkeiten eine Selektion getroffen wurde, deren Auswirkungen sich noch bis in die Gegenwart hinein erstrecken. Dabei wird eben nicht, worauf Otthein Rammstedt hingewiesen hat, eine „zeitlich vorausgehende Wirklichkeit [...] der nachfolgenden entgegengesetzt, sondern beide sind Teile der Wirklichkeit; von hier aus wird 248 BAECKER, Dirk: Überlegungen zur Form des Gedächtnisses. In: SCHMIDT, Siegfried J. (Hg.): Gedächtnis. Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Frankfurt (Main) 1991, S. 337-359, hier S. 356. 107 durch die Frage nach der Identität die Frage nach dem Bewegungsgesetz relevant [...].“249 Die Anschlussselektivität findet sich dabei durch eine alle temporalen System/Umwelt-Differenzen umfassende, ihren Eigengesetzlichkeiten folgende Weltgeschichte limitiert.250 Durch die Annahme dieses immerwährenden Bewegungsgesetzes wird es dann möglich, die Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft des Systems in Verbindung zu setzen und in ihrer Einheit zu denken. Die zurück liegende Vergangenheit wie auch die noch ausstehende Zukunft geben Auskunft darüber, in welchem Stadium sich das System befindet, vor allem aber: mit welchen Verhaltensweisen man gemäß des bereits Erreichten zu rechnen hat. Dieser Beschreibungsansatz ist in etwa vergleichbar mit unserer heutigen Vorstellung vom heranwachsenden Menschen, der unterschiedliche Entwicklungsstufen durchläuft und sich dabei sukzessiv sowohl neue Verhaltensmöglichkeiten eröffnet als auch alte verschließt. An dieses Geschichtsbewusstsein anknüpfend entfalteten sich mit der Differenz von bewegt und unbewegt bzw. tempus und aeternitas die wohl prominentesten und evolutionär folgenreichsten Zeitschemata der alteuropäischen Tradition. Die Wahrnehmung von Zeit blieb im Gegensatz zu dem, was sich als unbewegt darstellte, auf das verwiesen, was in der Welt als beweglich und insofern als invariant und auch anders möglich betrachtet wurde. Das Bewegte befindet sich in einem Transitorium von seiner nur nach der Möglichkeit gegebenen hin zu seiner wirklichen Bestimmung, während das Unbewegte in sich selbst ruht, mit sich selbst identisch ist. Die Zeit erscheint hier als Epiphänomen eines natürlichen Prozesses, mit der sich die Wegstrecke bemessen lässt, wie weit sich ein Seiendes von seinem Ursprung entfernt hat oder wie lange es noch benötigt, zu diesem zurück zu gelangen. Das, was es werden kann, findet sich dabei immer schon in seinem Ursprung angelegt. Die Systemgeschichte wird dementsprechend als das Maß für ein Vergehen und Werden gewertet, das sich am Jetzt, an der Gegenwart, als jener Moment erfahren lässt, in dem ein Unterschied zwischen einem Vorher und Nachher festgestellt werden kann. Die Gegenwart markiert eine Grenze, in der das Vergangene und Zukünftige hineinragt und die doch beides voneinander scheidet. Sie ist jener vergängliche Augenblick, in der sich das Nicht-Mehr und das Noch-Nicht als anwesend erleben lässt. Jede Gegenwart weist dabei eine jeweils individuelle Stellung im Kontinuum der Bewegung auf und verfügt insofern über eine Dauer, deren Länge sich aus der jeweiligen Zeitstrecke des Vergangenen und des Zukünftigen ergibt. Die Systemgeschichte erscheint damit als ein aus dem Vorher und Nachher, aus verschiedenen Zeitaltern (Äonen) zusammengesetztes Ganzes. Sie beruht auf heterogenen Entwicklungsphasen, die das System von seinem Ausgangspunkt hin zu seinem Endpunkt durchläuft und mit je unterschiedlichen Verhaltensmöglichkeiten konfrontiert. Eine wesensmäßige Unterscheidung zwischen Vergangenheit und 249 250 RAMMSTEDT, Otthein: Alltagsbewußtsein von Zeit. In: Kölner Sozialpsychologie 27 (1975), S. 46-63, hier S. 52. Vgl. LUHMANN, Weltzeit und Systemgeschichte (wie Anm. 236), S. 107. Zeitschrift für Soziologie und 108 Zukunft im Sinne zweier voneinander abgrenzbarer Möglichkeitshorizonte ist innerhalb eines solchen teleologischen Geschichtsverständnisses allerdings noch nicht vorgesehen, weil sich bereits in der Vergangenheit das angelegt findet, was sich in der Zukunft ereignen wird. Getreu der stratifikatorischen Gesellschaftsordnung ließ sich die Einheit der Differenz von Vorher und Nachher durch den Verweis auf eine von dem menschlichen Willen unabhängige höhere Instanz, der Natur bzw. dem Willen Gottes, selbst verbürgen. Zwar wurde mit der Unterscheidung von System- und Weltgeschichte zunächst die Zeitdimension von der Sachdimension geschieden, letztendlich lag aber das, was sich in der Zeit verändern konnte, bereits in der Sachdimension begründet. Die Systemgeschichte ließ sich demgemäß im Hinblick auf ein unabänderliches Sein und den ewigen Gesetzen rekonstruieren. In jedem Augenblick, in dem die Geschichte voranschreitet, hinterlassen diese Gesetze ihre Spuren, sodass der Gegenwart immer schon ein durch die Vergangenheit und/oder Zukunft bedingter Status der Notwendigkeit innewohnt. Entsprechend werden im System Abweichungen von dem, was die jeweilige Zeit an Verhaltensweisen verlangt, als Störung wahrgenommen, die es in Anbetracht eines in Aussicht gestellten Zustandes der Ordnung, in dem sich alle Systemelemente miteinander im Einklang befinden, zu vermeiden oder zu beheben gilt. Ein wesentlicher Anstoß zur Umstellung dieses Geschichtsverständnisses erfolgte durch eine im 15. und 16. Jahrhundert einsetzende und durch die Kunst und Wissenschaft vorangetriebene Umwertung des ‚Neuen’.251 Erstmals erscheint jetzt das Neue nicht mehr ausschließlich als Abweichung vom Gewohnten und Hergebrachten, als Verfall einer gottgegebenen Ordnung, als Korruption des weltimmanenten Logos oder – wie bei Thomas von Aquin – als Freilegung einer verborgenen Wahrheit in einer wesenskonstanten Welt.252 Wurde das Neue im Mittelalter noch „als anrüchig und bekämpfenswert [betrachtet – J.H.], weil es einen bisherigen Zustand durchbricht“253, verhält es sich nun weitestgehend indifferent gegenüber einer qualifizierenden Interpretation. Weil die Vergangenheit das Neue noch nicht kannte, ja weil es etwas verkörpert, was in der Vergangenheit noch gar nicht war, bekommt es nun den Status einer Irritation verliehen, dessen gesellschaftliche Relevanz sich noch erweisen muss. Die Gegenwart wird zu dem Moment stilisiert, in dem man die Vor- und 251 252 253 Vgl. LUHMANN, Niklas: Die Behandlung von Irritationen. Abweichung oder Neuheit? In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie. Bd. 4. Frankfurt (Main) 1995, S. 55-100. Johannes Spörl konnte zeigen, dass diese positive Bewertung des Neuen, die in den Funktionsbereichen der Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft in der Frühen Neuzeit zu beobachten ist, bereits im Mittelalter angelegt war. Vgl. SPÖRL, Johannes: Das Alte und das Neue im Mittelalter. Studien zum Problem des mittelalterlichen Fortschrittsbewußtseins. In: Historisches Jahrbuch 50 (1930), S. 297-341 u. S. 498-524. Zum Fortschrittsgauben bei Thomas von Aquin vgl. HAHN, Alois: Soziologische Aspekte des Fortschrittsglaubens. In: HAHN, Alois: Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte. Aufsätze zur Kultursoziologie. Frankfurt (Main) 2000, S. 315-334, hier S. 321 ff. SPÖRL, Das Alte und das Neue (wie Anm. 251), S. 299. 109 Nachteile der Verwerfung oder Beibehaltung der Neuerung abzuwägen hat.254 Mit der Affirmation des Neuen wird also generell ein Prozess eingeläutet, in dessen Folge sich die Zeitdimension in kaum merklichen Schritten gegenüber einer Welt der invarianten Dinge abzulösen beginnt, um sich schließlich als eine unabhängige Dimension der Weltbeschreibung zu konstituieren. Im Übergang zur modernen Gesellschaft werden die temporalen Unterscheidungen von bewegt und unbewegt, tempus und aeternitas zunehmend durch die Zeithorizonte von Vergangenheit und Zukunft verdrängt. Die soziale Durchschlagskraft dieser Differenz, die im Vergleich zu den alteuropäischen Zeitschemata eine unüberbrückbare Trennung zwischen ihren beiden Horizonten vollzieht und sich somit endgültig von der Sachdimension löst, erklärt sich aus ihrem Potential, der Erfahrung von Kontingenz in einer Welt Rechnung zu tragen, in der an die Stelle einer Gewissheiten verbürgenden Vergangenheit, zu der man zurückkehren kann, die Unsicherheit und Ungewissheit der Zukunft getreten ist.255 Die Welt der Moderne ist nicht mehr eine Welt der Dinge und Wesenskonstanten, die sich von ihrem Ursprung her begreifen lässt. Eben weil nun davon ausgegangen werden muss, dass die Welt in der Zukunft eine andere sein wird als sie in der Vergangenheit war, erscheinen die Möglichkeiten, die jeweils in der Vergangenheit und Zukunft begründet liegen, abhängig von dem Moment, in dem sie als solche in der Gegenwart bezeichnet werden. Der für den Beobachter selbst nicht greifbare Moment der Gegenwart tritt an die Stelle der Ewigkeit und des Unbeweglichen. Das, was in der Welt möglich ist, kann dann nicht mehr in einer der Zeit losgelösten Zeit ereignistranszendent vorkommen, denn wenn lediglich das unveränderlich ist, „was ohnehin keine Dauer hat: das Ereignis“256, lässt sich Zeit ausschließlich als eine Momentaufnahme ohne ontologischen Anspruch rekonstruieren. Damit verbunden ist das Bild einer von der Vergangenheit in die Zukunft irreversibel voranschreitenden Zeit, in der sich nichts wiederholt, weil immer Neues geschieht. Das einzige, was konstant reproduziert wird, ist das Ereignis, in dem sich die Welt für die Dauer eines gegenwärtigen Augenblicks als Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft konstituiert, um im nächsten Moment wieder verloren zu gehen.257 Das Wissen darüber, was in einer jeweils augenblicklichen Gegenwart in Anbetracht einer 254 255 256 257 Allerdings folgte dieser Wertschätzung des Neuen zunächst keineswegs die Gesellschaft als Ganzes mit all ihren Lebenssphären. Insbesondere die Politik und Religion, die sich gerade aus ihrem Anspruch legitimierten, das Vergangene in der Gegenwart zu bewahren, blieben einem Konservatismus verhaftet, der sich vehement gegenüber einer Inkorporation des Neuen als Bestandteil der Weltbeschreibung zu wehr setzte. So waren z.B. die politischen Ordnungsvorstellungen der Renaissance ausdrücklich durch eine Rückbesinnung auf antike Werte geprägt. Erst im Zuge der Fortschrittsideen der Aufklärung vermochte das Neue dann auch im politischen Diskurs seinen Siegeszug anzutreten. Vgl. KOSELLECK, Reinhart: Fortschritt. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhart (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 2. Stuttgart 1975, S. 351-424, hier S. 375 ff. Vgl. LUHMANN, Future (wie Anm. 236); LUHMANN, Niklas: Die Beschreibung der Zukunft. In: LUHMANN, Niklas: Beobachtungen der Moderne. Opladen 1992, S. 129-147. LUHMANN, Irritationen (wie Anm. 251), S. 84. Luhmann hat diese Verzeitlichung von Gegenwart anhand des Wandels frühneuzeitlicher Zeitsemantiken im Übergang von stratifikatorisch zu funktional differenzierten Gesellschaften anschaulich dargelegt. Vgl. LUHMANN, Niklas: Temporalisierung von Komplexität. Zur Semantik neuzeitlicher Zeitbegriffe. In: LUHMANN, Ni- 110 ihr eigentümlichen Vergangenheit und Zukunft überhaupt möglich ist, stellt sich nun als die Grundlage für die Angemessenheit eines Verhaltens dar. Zeit wird damit „eine Art Abstraktion des Zwanges zur Ordnung schlechthin“258 und löst sich infolgedessen immer stärker von der Sozial- und Sachdimension von Sinn ab. Sie wird unabhängig von der Frage, wer was, wo und wie beobachtet und steigt auf zu einem Erklärungsmuster eigener Logik, mit dem sich Anschlussmöglichkeiten innerhalb der Gesellschaft allein durch den Rückgriff auf zeitliche Horizonte bestimmen lassen. Die Gegenwart entwickelt sich somit zu einem Grenzbegriff, der die Vergangenheit von der Zukunft scheidet, der aber zugleich auch die Option nahe legt, sich ein Überschreiten dieser Grenze vorzustellen. Jede Gegenwart verfügt nicht nur über eine gegenwärtige Vergangenheit wie auch eine gegenwärtige Zukunft, mit Hilfe der Zeitdimension lassen sich nunmehr auch vergangene Gegenwarten (bzw. zukünftige Gegenwarten) in den Blick nehmen, von denen aus sich jeweils eigene Horizonte der Vergangenheit und Zukunft entfalten. Die Zeit steht hier also nicht nur für ein chronologisches Maß, mit dem sich natürliche Entwicklungsverläufe in historische Zeitabschnitte einteilen lassen. Das, was sich jeweils als Vergangenheit und Zukunft darstellt, bleibt vielmehr davon abhängig, von welcher Gegenwart aus man sie in Betracht nimmt. Bei der Vergangenheit und der Zukunft handelt es sich also um Endloshorizonte, die sich mit jeder vergangenen oder zukünftigen Gegenwart neu formieren. Damit lässt sich die Vorstellung der Geschichte als einem Kontinuum, das durch zwei Extrempunkte, einen zurückliegenden Anfang und ein kommendes Ende, seine Begrenzung findet, kaum mehr aufrechterhalten. Dem teleologischen Geschichtsverständnis dienten Anfang und Ende, dem „Wirksamwerden bzw. Unwirksamwerden von Beschränkungen“,259 noch als funktionale Äquivalente für die Beschreibung der Unveränderlichkeit der Welt, heute dagegen sind sie allenfalls noch Orte der Spekulation, die immer zugleich auch die Frage nach dem davor bzw. danach mit sich führen. Im Vordergrund der Konstruktion der Systemgeschichte steht jetzt nicht mehr das Problem, wie sich die verschiedenen Entwicklungsphasen zu einem homogenen Ganzen zusammenfügen lassen, sondern wie Systeme ihre Identität in einer sich permanent wandelnden Welt erhalten können. Denn sobald Sinnsysteme zu registrieren beginnen, dass sie im Nacheinander ihrer Operationen ganz unterschiedliche Aggregatszustände annehmen und dass sie sich über eine „temporalisierte Komplexität“260 kontinuieren, stehen sie vor der Aufgabe, auszuweisen, was sich innerhalb ihrer Grenzen als irreversibel 258 259 260 klas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie. Bd. 1. Frankfurt (Main) 1980, S. 235-300. Ebd., S. 257. LUHMANN, Niklas: Anfang und Ende. Probleme einer Unterscheidung. In: LUHMANN, Niklas / SCHORR, Karl Eberhard (Hg.): Zwischen Anfang und Ende. Fragen an die Pädagogik. Frankfurt (Main) 1990, S. 11-23, hier S. 14. Zum Begriff der temporalisierten Komplexität vgl. LUHMANN, Niklas: Temporalization of Complexity. In: GEYER, Felix R. / ZOUWEN, Johannes van der (Hg.): Sociocybernetics. Bd. 2. Leiden 1978, S. 95-111. 111 und was als reversibel darstellt. Sinnsystemen, die den permanenten Zerfall ihrer eigenen Operationen beobachten, geht es also nicht „um Rückkehr in eine stabile Ruhelage nach Absorption von Störungen, sondern um die Sicherung der unaufhörlichen Erneuerung der Systemelemente; oder in kurzer Formulierung: nicht um statische, sondern um dynamische Stabilität.“261 Die Funktionssysteme der modernen Gesellschaft greifen zu diesem Zweck auf binäre Codes zurück, mit denen sie einen zeitlich invarianten Entscheidungsbereich markieren, innerhalb dessen die Möglichkeit der Fortsetzung bzw. des Abbruchs von Kommunikationen vorgesehen ist. Während soziale Systeme über binäre Codes eine den Zerfall der einzelnen Systemelemente überdauernde Struktur ausbilden, bedürfen sie zudem Konditionierungen, so genannte Programme (Methoden und Theorien, Gesetze, Lehr- und Lernpläne), die festlegen, unter welchen Bedingungen sich ein Ereignis dem positiven oder dem negativen Wert ihres Codes zuteilen lässt. Über solche durchaus flexibel gestaltbaren Programme passen sich die Funktionssysteme der modernen Gesellschaft den veränderlichen Gegebenheiten ihrer Umwelt an.262 Sie begnügen sich nicht einfach, Geschichte schicksalhaft zu erleiden und auf eine wohlwollende Zukunft zu hoffen. Sie schreiben ihre eigene Geschichte, und zwar immer wieder aufs Neue, in der sie die Schicksalsfäden weitestgehend selbst in den Händen halten. Nicht in der Bewahrung des Bestehenden oder der Wiederholung des Vergangenen liegt somit die Crux des modernen Geschichtsbewusstseins begründet. Vielmehr ist es die Offenheit, die Unbestimmtheit und Unsicherheit der Zukunft, die sich nicht einfach durch einen Rückgriff auf eine in der Vergangenheit verborgene Gewissheit schmälern lässt. 3.3 Die gesellschaftliche Ordnung und ihre Individuen 3.3.1 Die Inklusionsindividualität des vormodernen Individuums Die bisherigen Ausführungen haben sich von der Absicht leiten lassen, die Wandlungsprozesse innerhalb der Sozial- und Zeitdimension sozialer Ordnung zu rekonstruieren. Dabei standen zwei Problemstellungen im Mittelpunkt: Hat sich im Verlaufe der sozialen Evolution etwas an dem Modus verändert, wie Personen wahrgenommen werden, wenn sie an den Kommunikationen sozialer Systeme teilhaben? Und in welchem Maße sind soziale Systeme imstande, den Bestand ihrer Elemente als wandelbar auszuzeichnen? Die nachfolgenden Überlegungen gehen nun der Frage nach, ob und in welchem Maße sich die innerhalb der Sozial- und Zeitdimension zu beobachtende Ausweitung der Sinnhorizonte auch auf die Stellung des Individuums in der Gesell261 262 LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 79. Vgl. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 376 f. 112 schaft ausgewirkt haben. Dabei soll keineswegs der semantische Werdegang des Individuums im Detail bis in die Gegenwart nachvollzogen werden. Die Überlegungen widmen sich vielmehr der Art und Weise, wie die Semantiken des Individuums und der Individualität daran beteiligt waren (und noch immer sind), Ordnungsprobleme historischer Gesellschaftsformationen zu lösen. Sie gehen dementsprechend von der These aus, dass die Bestimmungen dessen, was ein Individuum zum Individuum macht und wodurch es seine Individualität erlangt, von der sozialen Evolution der Gesellschaftsstruktur nicht unberührt bleiben, ja dass solche Bestimmungen geradezu ein semantisches Reservoir für Innovationen bilden, an die sich gesellschaftsstrukturelle Veränderungen anzudocken vermochten.263 Den Ausführungen Luhmanns folgend gilt es sich somit von der Vorstellung des Individuums als anthropologisches Faktum, dessen Wesen es unabhängig von den Ausformungen gesellschaftlicher Strukturen zu betrachten möglich wäre, zu verabschieden. Seine wissenssoziologischen Rekonstruktionen vermeiden es entsprechend, von einem vorgängig harmonisierten, sich selbst transparenten autonomen Subjekt auszugehen, das zum Letztgaranten des Sozialen erhoben werden könnte. Anthropologische Konzepte vom Wesen des Menschen werden stattdessen auf gesellschaftliche Strukturentwicklungen bezogen, die Selbstkonzepte genealogisch erklären. Obgleich einem psychischen System aufgrund seiner operativen Geschlossenheit immer schon eine Individualität konzediert werden muss, so gilt es darüber hinaus jedoch die Frage zu beantworten, „welche sozialen Anregungen ein solches System benötigt, um sich selbst beobachten und beschreiben zu können. [...] Und hier stellt sich die Frage, ob und unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen ihm das Insistieren auf Individualität als Selbstbeschreibung erlaubt oder gar aufgenötigt wird.“264 Luhmann vertritt dabei die Auffassung, dass sich im Zuge der Komplexitätssteigerung der Gesellschaft die Individualitätssemantik von Inklusion auf Exklusion umstellt.265 In der modernen Gesellschaft gewinnt das Individuum seine Individualität nicht mehr als Angehöriger einer Schicht, einer Klasse oder eines Standes, auf ihm lastet auch nicht mehr eine Schuld, die es infolge des Sündenfalls als Habitus mit allen anderen Menschen teilt, vielmehr folgt es als Subjekt eigenen Aspirationen und Weltaneignungen. Diese Entwicklung gilt es im Folgenden anhand sozialer Problemkonstellationen, in denen sich der Gedanke des Individuums und der Individualität eingeschrieben haben, ansatzweise darzustellen. Ist man bereit den Ausführungen Niklas Luhmanns zu folgen, so bleibt der Begriff Individuum bis in das 17. Jahrhundert hinein auf seinen etymologischen Sinngehalt beschränkt.266 Bereits in der römisch-antiken Philosophie sowie der mittelalterlichen Theologie kommt er zur Anwen263 264 265 266 Vgl. dazu grundlegend LUHMANN, Niklas: Individuum, Individualität, Individualismus. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Bd. 3. Frankfurt (Main) 1989, S. 149-258. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 361. LUHMANN, Individuum (wie Anm. 264), S. 158 ff. Vgl. LUHMANN, Niklas: Die gesellschaftliche Differenzierung und das Individuum. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie des Menschen. Opladen 1995, S. 125-141, hier S. 125. 113 dung, um etwas Unteilbares (in-dividuum) und von anderem getrennt Existierendes zu bezeichnen, das seine Wesensnatur und Einheit verliert, wenn es zerlegt wird.267 In diesem vormodernen Sinne, und das mutet aus unserer heutigen Perspektive äußerst befremdlich an, kann also nicht nur der Mensch schlechthin, sondern alles, was für sich genommen im Sein steht, als Individuum betrachtet werden. Ein Stein, ein Hut, eine Pflanze, ein Tier etc., all diese Einzeldinge verfügen ebenso über die Qualität, ein Individuum zu sein, wie der Mensch selbst, weil sie sich in ihrer Singularität von anderem Seienden ihrer Gattung unterscheiden. Mit der Kennzeichnung als Individuum wird der Mensch also in ein Dingschema gepresst, das sich einer ontologischen Metaphysik bedient, wonach jedwede Dinge, die in der Welt vorkommen, auf ein beständiges Sein und eine unabänderliche Ordnung verweisen. Jedes Ding muss mit sich selbst identisch gedacht werden: A ist A bzw. A ist nicht Nicht-A. Auch wenn der Mensch im Vergleich zu anderen Individuen durchaus eine höhere Seinsqualität zugeschrieben bekommt, so erscheint er doch als ein Ding unter anderen Dingen. Das Individuum findet sich dabei in eine Ordnungsstruktur eingefügt, die sich vom Allgemeinen hin zum Besonderen entfaltet, insofern es das letzte, nicht weiter auflösbare Element darstellt, aus dem sich das Allgemeine zusammensetzt. Es ist die dem Menschen von Natur aus gegebene Seele, seine indestruktible rationale Substanz, die sich sowohl für seine Zugehörigkeit zu einer spezifischen Gattung als auch für seine Singularität verantwortlich zeichnet. Mit den vormodernen Beschreibungen der Seele sind somit die ersten systematischen Überlegungen gegeben, die zu erklären versuchen, worauf die Differenzen zwischen den Wesensformen der Welt wie auch innerhalb der Gattung Mensch gründen. Es waren vor allem die antiken Philosophen Platon und Aristoteles, welche die Seele als Konstituens des Menschen entdeckten und zum zentralen Bezugspunkt der Anthropologie erhoben.268 Die in der antiken Philosophie entwickelten Vorstellungen vom Menschen sollten schließlich für die nachfolgenden Jahrhunderte, für die christliche Theologie des Mittelalters genauso wie für die neuzeitliche Philosophie, von prägendem Einfluss sein. Aristoteles begreift die Seele als Entelechie, also als Lebenskraft, die ihren Zweck in sich selbst trägt und aus sich selbst heraus anstrebt. Während wir heute im Anschluss an Descartes eher dazu neigen, sie als immaterielle Heimat unseres Bewusstseins zu erachten, so erscheint sie in der aristotelischen Philosophie dahingegen als ein allgemeines Formprinzip des Materiellen. Sie ist jene Substanz, die den Leib einerseits zum Leben erweckt, die andererseits aber gleichzeitig diesen mit seinen gegebenen Möglichkeiten (Organen) voraussetzt, um sich tatsächlich als Prinzip des Lebendigen verwirklichen zu 267 268 Vgl. AERTSEN, Jan A.: Einleitung. Die Entdeckung des Individuums. In: AERTSEN, Jan A. / SPEER, Andreas (Hg.): Individuum und Individualität im Mittelalter. Berlin / New York 1996, S. IX-XVII, hier S. XV; BORSCHE, Tilmann: Individuum, Individualität. In: RITTER, Joachim / GRÜNDER, Karlfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 4. Stuttgart 1976, Sp. 300-323. Zu den antiken Ursprüngen der Seele wie auch ihrer begriffsgeschichtlichen Entwicklung vgl. KLEIN, HansDieter (Hg.): Der Begriff der Seele in der Philosophiegeschichte. Würzburg 2005; KREMER, Klaus (Hg.): Seele. Ihre Wirklichkeit, ihr Verhältnis zum Leib und zur menschlichen Person. Leiden / Köln 1984. 114 können. Im Gegensatz zur unbelebten Natur, die des äußeren Anstoßes bedarf, um in ein zweckgerichtetes Geschehen eingebunden zu werden, verfügt nach Aristoteles jedwedes Leben – sei es der Pflanzen, Tiere oder Menschen – über ein solches inneres Bewegungsprinzip. Kennzeichnend für die menschliche Seele ist es nun, dass sie sich aus verschiedenen Anteilen zusammensetzt. Neben dem vegetativen (Wachstum, Ernährung, Fortpflanzung) und sensitiven Seelenvermögen (Wahrnehmung), die zusammengenommen den vernunftlosen Anteil ausmachen, kennt Aristoteles einen vernunftbegabten Anteil – den Geist (nous) –, der sich sowohl im reinen Denken als auch im Wollen zu äußern vermag. Im Wollen (bzw. Handeln) manifestiert sich die Fähigkeit des Intellekts, die unvernünftigen Seelenanteile, wie sie auch den Pflanzen bzw. den Tieren gegeben sind, bis zu einem gewissen Grad zu beherrschen, wohingegen das reine Denken zur Schau der ewigen Wahrheiten befähigt, weil es des Materiellen, des nur der Möglichkeit nach Gegebenen, nicht bedarf. Jener vernünftige Anteil der Seele ist es, über den Aristoteles letztendlich das Wesen des Menschen definiert.269 Die innerhalb der Gattung Mensch beobachtbaren Unterschiede lassen sich dann daraus erklären, inwieweit sich das Individuum in seinem Lebensvollzug mehr dem vernunftlosen oder dem vernünftigen Seelenanteil hinneigt und damit in Abstufungen das innere Prinzip dessen realisiert, was ihn zum Menschen macht. Während die Sklaven wie auch die Handwerker, Bauern, Händler etc. aufgrund ihrer natürlichen Anlagen lediglich dazu geeignet sind, sich auf der untersten Stufe des animalischen Lebens zu bewegen, scheinen allein die Bürger der Polis imstande, unmittelbar an der Vernunft selbst teilzuhaben, um auf diese Weise das menschliche Lebensprinzip zu realisieren.270 Das in der frühneuzeitlichen Philosophie akut werdende Problem, in welchem Maße das Ich an der Wahrnehmung der Wirklichkeit beteiligt ist, liegt Aristoteles’ Fragestellungen noch völlig fern. Ihm geht es allein darum, die „Seele als Prinzip der Subjektivität“271 zu objektivieren, um von hieraus systematisch all die denkbaren, in den Lebensvollzügen selbst begründeten Zugänge zur Welt offen zu legen. Erste Ansätze, den Menschen über sein einzigartiges Ich zu definieren und in diesem das maßgebliche Movens des Handelns zu erblicken, werden in der mittelalterlichen Theologie vorbereitet. Ihre besondere Leistung ist darin zu sehen, dass antike Seelenkonzept mit dem biblischen Mythos eines aus dem willentlichen Schöpfungsakt Gottes geschaffenen Menschen in Einklang gebracht zu haben. Gegenüber der vorchristlichen Auffassung, wonach jeder Lebensform eine allgemeine Seelenkraft innewohnt, wird nun gerade die Einmaligkeit der individuellen Seele 269 270 271 Aristoteles fragt entsprechend nach der besonderen Leistung, die dem Menschen eigentümlich ist: „Welche mag sie nun wohl sein? Das Leben offenbar nicht, denn dies besitzen auch die Pflanzen, wir suchen aber das dem Menschen Eigentümliche. Das Leben der Ernährung und des Wachstums ist auszuscheiden. Es würde darauf das Leben der Wahrnehmung folgen, aber auch dieses ist uns gemeinsam mit dem Pferde und Rinde und allen Tieren überhaupt. Es bleibt also das Leben in der Betätigung des vernunftbegabten Teiles übrig.“ ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203), 1097 b 33 ff. Vgl. ARISTOTELES, Politik (wie Anm. 14), 1254 a 18 ff. CASSIRER, Ernst: Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. Darmstadt 1969, S. 133. 115 des Menschen betont. Die Seele tritt hier nicht mehr ausschließlich als allgemeine Form zutage, die sich im Materiellen individuiert. Vielmehr setzt sich die gegenteilige Ansicht durch, es sei ihre individuelle Form, die unabhängig von ihrer jeweiligen akzidentiellen Verbindung mit dem Materiellen die Singularität des Menschen begründet. Während Gott in der übrigen Schöpfung nur seine ‚Spur’ hinterlassen hat, sind die menschlichen Seelen die Stätten der imago dei. In ihnen spiegelt sich die Unendlichkeit und Mannigfaltigkeit seines Wesens wider. Die Seele präexistiert also nicht vor, sondern entsteht erst mit der Schöpfung des Menschen, wobei sie sich aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit Gott grundsätzlich von dem rein Körperlichen unterscheidet. Dieser Dualismus von Leib und Seele ist für das christliche Menschenbild von kaum zu unterschätzender Bedeutsamkeit. Denn erst infolge dieser Annahme einer im Gegensatz zur Vergänglichkeit des Körpers unsterblichen Seele wird es möglich, das Diesseits vom Jenseits zu trennen und eine beide Lebensabschnitte übergreifende personale Identität des einzelnen Menschen anzunehmen. Mit der christlichen Vorstellung eines Lebens nach dem Tode verbindet sich unweigerlich eine Aufwertung des menschlichen Selbst, welches bereits im Diesseits Verantwortung für seine ferne Zukunft im Jenseits zu übernehmen hat. In einer auf Boethius zurückgehenden Formulierung wird der Mensch dabei zunächst als ‚Person’, oder genauer: als ‚Einzelsubstanz der vernunftbegabten Natur’ (rationabilis naturae individua substantia), charakterisiert.272 Er ist ein unteilbares Individuum, dessen Natur sich durch Vernunft auszeichnet. In dieser Definition wird das Individuelle in Abgrenzung zum Allgemeinen, zur Wesenheit der Gattung Mensch, gesehen, die sich ihrerseits von jenen Substanzen unterscheidet, denen von Natur aus keine Rationalität zukommt. In der Folgezeit wurden jedoch an dieser Begriffsklärung immer mehr Probleme sichtbar, die allesamt um die Frage nach dem Verhältnis vom Allgemeinen und Individuellen kreisten; Probleme, die letztlich bis heute die Semantiken des Individuums und der Individualität bestimmen. Die Person muss zum einen über das hinausreichen, was ihr als Natur in der Form der vernunftbegabten Seele zugrunde liegt. Soweit diese nämlich als etwas Allgemeines jedem Menschen als Individuum zu Eigen ist, erscheint sie für den Erweis der Singularität der Person bzw. der Verschiedenheit der Personen als ungeeignet. Richard von St. Viktor korrigierte dementsprechend Boethius’ Definition, indem er die Person nicht mehr als eine Einzelsubstanz (individua substantia), sondern als eine nichtmitteilbare Existenz (incommunicabilis existentia) begreift. Mit dem Attribut der Inkommunikabilität verweist die scholastische Theologie auf die Unmöglichkeit, etwas über den Seinszustand einer Person auszusagen, weil sie als Individuum ja gerade keine allgemeinen Merkmale aufweist, die sie mit anderen Personen teilt. Im Verlaufe des Mittelalters 272 Vgl. WALD, Berthold: „Rationalis naturae individua substantia“. Aristoteles, Boethius und der Begriff der Person im Mittelalter. In: AERTSEN, Jan A. / SPEER, Andreas (Hg.): Individuum und Individualität im Mittelalter. Berlin / New York 1996, S. 371-388; PANNENBERG, Wolfhart: Person und Subjekt. In: MARQUARD, Odo / STIERLE, Karlheinz (Hg.): Identität. München 1979, S. 407-422. 116 verlagert sich entsprechend der Diskurs, worauf das Individuelle der Person im Vergleich zur Gattung Mensch gründet, mehr und mehr von der Frage nach der Möglichkeit ihrer Subsistenz auf die ihrer Existenz.273 Im Zentrum steht hier nicht mehr das bereits in der antiken Philosophie formulierte Problem, aufgrund welcher Qualitäten das Individuum aus sich selbst heraus bestehen kann, sondern wodurch diese Qualitäten ursprünglich in ihm bewirkt wurden. Die Person wird damit näher definiert als „Selbstbezug-im-Fremdbezug.“274 Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie durch einen Anderen – sei es nun Gott oder die Eltern – sie selbst sein kann. Obgleich für eine jede Person eine solche Herkunft konstitutiv ist, liegt der Grund ihrer individuellen Existenz gerade in dieser Relation, in der das Selbst und der Andere in Beziehung miteinander treten. Entscheidend für die Beschaffenheit der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist es nun, dass sie sich asymmetrisch über das Prinzip der Emanation, also vom Höheren, Vollkommeneren zum Niederen, Unvollkommeneren verwirklicht. Ihre beiden Pole sind somit zwar als differente Entitäten gegeben, mit der rationalen Substanz weisen sie jedoch eine Ähnlichkeit auf, auf deren Grundlage sich eine Gemeinschaft zwischen ihnen ausformen kann. Im 13. Jahrhundert beginnt sich neben dem Bezugsproblem der Inkommunikabilität des Seinsprinzip das der Inkommunikabilität des Erkenntnisprinzips des Menschen herauszukristallisieren.275 Beide Probleme sind eng miteinander verflochten und verweisen fast zwangsläufig aufeinander. Die Person ist nicht nur durch einen Fremdbezug gekennzeichnet, sie verfügt zum anderen mit der Vernunft über ein Erkenntnisprinzip, vermittels dessen sie das Verhältnis zu ihrem eigenen Wesen mitbestimmen kann. Sie muss demnach als das betrachtet werden, so Thomas von Aquin, „was am vollkommensten in der gesamten Natur ist.“276 Denn die dem Menschen von Natur aus gegebene individuelle rationale Substanz entscheidet noch nicht darüber, was dieser auch tatsächlich aus sich kraft seines Willens macht. Während sich die ‚vernunftlosen’ Individuen der Schöpfung in ihrem Wirken unmittelbar determiniert sehen, kommt dem Menschen die Freiheit zu, zwischen verschiedenen Verhaltensoptionen zu wählen, sich in seinem Wesen also selbst zu bestimmen. Voraussetzung hierfür ist seine Begabung, seine wahre Natur zu erkennen und sein Handeln danach zu beurteilen, inwieweit es mit dem ihm vorgegebenen Ziel, sich dem Wesen Gottes anzunähern, im Einklang steht. Aber gerade in diesem Selbstbezug liegt der Kern der Inkommunikabilität des Erkenntnisprinzips begründet, weil die Person in ihrem Wollen immer auf das verwiesen bleibt, was sie selbst in der Offenbarung Gottes als wahr und gut erkannt 273 274 275 276 Vgl. FUHRMANN, M. / KIBLE, B. Th. / SCHERER, G. / SCHÜTT, H.-P. / SCHILD, W. / SCHERNER, M.: Person. In: RITTER, Joachim (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. VII. Basel / Stuttgart 1989, Sp. 269-338, hier Sp. 285 f. HEINRICHS, Johannes / STOCK, Konrad: Person. In: MÜLLER, Gerhard (Hg.): Theologische Realenzyklopädie. Bd. XXVI. Berlin / New York 1996, S. 220-231, hier S. 221. Vgl. WALD, Rationalis naturae individua substantia (wie Anm. 273), S. 377 ff. AQUIN, Thomas von: Summa Theologica. Übers. von Dominikanern u. Benediktinern Deutschlands u. Österreichs. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg. I. Buch. Bd. 3. Gott, der Dreieinige. Graz / Wien / Köln 1939, q. 29,3. 117 hat. Als Person kann der Mensch somit nur insoweit betrachtet werden, wie er Verantwortung für sein Tun übernimmt, wie ihm ein esse morale, ein moralisches Sein, zukommt.277 Die Inkommunikabilität der Person, wie sie in der mittelalterlichen Theologie zum Thema wurde, weist auf zwei grundlegende Problembezüge hin, die eine soziale Ordnung zu lösen hat, um Kommunikationen in der Gesellschaft mit relativ stabilen Verhaltenserwartungen ausstatten zu können. In der Systemtheorie finden sich diese Problembezüge mit den Begriffen der doppelten Kontingenz einerseits und der strukturellen Kopplung andererseits näher präzisiert. Die mittelalterliche Theologie hat dabei das Problem der doppelten Kontingenz auf die Grundlage einer ontologischen Metaphysik gestellt, wonach die Welt über ein natürliches Sein verfügt, das aus der göttlichen Schöpfung hervorgegangen ist. Die Differenz von Ego und Alter wird folgerichtig als eine Differenz von Dingen beschrieben, denen jeweils ein unveränderliches Wesen mit besonderen Qualitäten anhaftet. Die Feststellung der Inkommunikabilität des Seinsprinzips führt das Problem der doppelten Kontingenz nun auf die Frage hin, wie die Verhaltensweisen Egos und Alters füreinander erwartbar sein können, obwohl sich beide außerstande gesetzt sehen, ihre individuellen Eigenschaften mitzuteilen. Wenn Ego und Alter sich als Individuen prinzipiell der Generalisierbarkeit entziehen, dann wird ihr Wesen zum Geheimnis, das in der Interaktion invisibilisiert werden muss. Denn nur so können hinreichend stabile Erwartungsstrukturen kondensieren, die unabhängig von der konkreten Beteiligung dieser oder jener Person auch für zukünftige Situationen Geltung beanspruchen. Genau an diesem Punkt gewinnt der Stand als ein „Deutungsschema der sozialen Wirklichkeit“278 seine eigentliche Plausibilität. Er ist ein über den Hinweis auf Geburt und Herkunft legitimiertes Beobachtungsschema, mit dem man sich die Chance eröffnet, Generalisierungen in die Interaktion einzuführen, die das limitieren, was sich an möglichen Verhaltensweisen von einer Person erwarten lässt. Der Stand überwindet die Singularität des Individuums, indem er der Inkommunikabilität des Individuellen die Kommunikabilität des Allgemeinen gegenüberstellt. Um etwas über die Eigenschaften, und d.h.: möglichen Verhaltensweisen, einer Person in Erfahrung zu bringen, musste man entsprechend auf soziale Konstellationen (Geburtstand, Schichtzugehörigkeit, Korporationszugehörigkeiten etc.) verweisen, in denen der Einzelne im Gegensatz zu anderen verortet war.279 Die Lösung des Problems der doppelten Kontingenz wird hier durch den Rekurs auf eine kosmologische Weltordnung vorgezeichnet, wonach die geschaffene Natur die Schranken dessen 277 278 279 Nach Theo Kobusch entstammt die Idee, der Mensch verfüge von Natur aus über subjektive Rechte, wie sie insbesondere mit der Deklaration der Menschenrechte stark gemacht wurde, der mittelalterlichen Lehre des ‚esse morale’. Vgl. KOBUSCH, Theo: Die Entdeckung der Person. Metaphysik der Freiheit und modernes Menschenbild. Darmstadt 1997. Vgl. OEXLE, Otto Gerhard: Die funktionale Dreiteilung als Deutungsschema der sozialen Wirklichkeit in der ständischen Gesellschaft des Mittelalters. In: SCHULZE, Winfried: Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität. München 1988, S. 19-51. Vgl. LUHMANN, Die gesellschaftliche Differenzierung und das Individuum (wie Anm. 267), S. 126. 118 symbolisiert, was der Einzelperson an Verhalten zugerechnet werden kann. Es ist dieser Gedanke eines allumfassenden göttlichen Ordos, in dem sich der Mensch eingebettet findet, der das Sozialmodell über Jahrhunderte hinweg prägen sollte. Gott hat alles in der Welt so eingerichtet, dass es in einer vernünftigen Ordnung zueinander steht und dem allen Christen anheim gestellten Ziel der ewigen Seligkeit dienlich ist. Als Einzelwesen erscheint der Mensch dabei nicht nur unmittelbar an den Willen Gottes gebunden, soweit sich dieser auch in seinen Mitmenschen äußert, ist er von Natur aus auf ein Leben in Gemeinschaft angelegt. Er kann sich nicht selbst genügen, sondern verwirklicht sich in seinem Tun. Der Mensch wird demgemäß, wie es bereits seit der antiken und römischen Philosophie heißt, als ein zoon politikon bzw. animal sociale begriffen.280 Diesem kosmologischen Prinzip der Welt gehorchend, die als ein Ganzes auf das harmonische Zusammenwirken ihrer hierarchisch gestuften Teile beruht, hat jedes Individuum einen sozialen Ort in der Gemeinschaft inne, als dessen Teil es sich durch Gott berufen sieht.281 Eine derartige im Willen Gottes verbürgte Sozialordnung verschiedener Stände (ordines) garantiert zum einen die universale Inklusion aller Christen in die Gesellschaft und vollzieht zum anderen innerhalb der Gesellschaft eine Spezifizierung der Merkmale der Individuen anhand rechtlicher und sozialer Kriterien. Auf diese Weise lässt sich zwischen den Personen ein relativ stabiles Leistungsverhältnis denken. Aber solche interpersonalen Beziehungen haben immer auch mit der Möglichkeit zu rechnen, dass Verhaltensweisen von dem abweichen, was sie als konstitutiv für ihre Reproduktion erachten. Sie kommen dementsprechend nicht umhin, sowohl erklären zu müssen, wo die Gründe für derartige Abweichungen zu suchen sind, als auch Institutionen vorzusehen, die darauf abzielen, bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher werden zu lassen als andere. Während das Problem der doppelten Kontingenz auf die Frage hinführt, wie sich in der Interaktion zwischen Alter und Ego relativ stabile Erwartungsstrukturen ausbilden können, so wird mit dem Problem der strukturellen Kopplung die Frage akut, auf welche Weise die Einzelperson an solchen invarianten Strukturzusammenhängen teilhaben kann, ohne dabei das Bewusstsein seiner eigenen Identität aufgeben zu müssen. Systemtheoretisch reformuliert geht es hier um das Verhältnis zwischen psychischen und sozialen Systemen. Strukturell gekoppelte Systeme differenzieren sich zwar auf der Basis des Möglichkeitshorizonts des jeweils anderen Systems aus, sie können sich dabei aber eben nicht wechselseitig determinieren. Jedes System verfügt seinerseits über Möglichkeitsüberschüsse, die sich aus dem Umgang mit seiner Umwelt ergeben. In diesen durch die Umwelt selbst nicht zu kontrollierenden Überschüssen an Möglichkeiten liegt die Bedingung für Freiheit be280 281 Vgl. ARISTOTELES, Politik (wie Anm. 14), 1253 a 1 f. Vgl. SCHWER, Wilhelm: Stand und Ständeordnung im Weltbild des Mittelalters. Die geistes- und gesellschaftsgeschichtlichen Grundlagen der berufsständischen Idee. Paderborn 1970; OEXLE, Otto. G.: Stand, Klasse. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 6. Stuttgart 1990, S. 155-200. 119 gründet, denn diese lässt sich nur dann erfahren, „wenn das Individuum Entscheidungen treffen kann, die es sich selbst zurechnet [...]. Freiheit ist also immer von kognitiven Vorgaben abhängig und entzieht sich in dieser Abhängigkeit jeder sozialen Aggregation.“282 Die mittelalterliche Theologie hat sich nun das Problem der strukturellen Kopplung über die Annahme eines vorgängig harmonisierten Verhältnisses zwischen sozialen und psychischen System erschlossen, so dass immer dann, wenn die Person ihrer eigenen Natur gerecht wird, sie sich auch im Sinne der Gemeinschaft verhält. Die Freiheit ist dem Menschen dabei aufgrund seiner Vernunftbegabung als Fähigkeit moralischer Einsicht gegeben. Ähnlich wie Gott in seinen Möglichkeiten, die Schöpfung zu gestalten, dadurch beschränkt war, alles auf das Gute hinzuordnen, so erfährt auch der Mensch seinen Willen als eine in ihm wirkende Strebekraft, die sich als unstillbarer Drang zum Guten bemerkbar macht. Dergestalt teilt sich Gott dem Menschen unmittelbar mit, ja begründet erst seine gnadenhafte Erwählung in der Schöpfung, ohne dass der Einzelne selbst die Freiheit besäße, darüber zu befinden, was gut und böse ist. Bei Jesaja (45,7) sagt Gott: „Das Licht bilde ich und erschaffe die Finsternis, bewirke das Heil und das Unheil! Ich, der Herr bin es, der all dieses wirkt.“ Gott ist das Licht, das in die Finsternis scheint, aber die Menschen nicht zwingt, sich erleuchten zu lassen. Insofern der Möglichkeitshorizont menschlichen Handelns damit im göttlichen Willen fundiert bleibt, betont das christlich-theologische Denken die relative Freiheit des Einzelnen, zwischen Gutem und Bösem zu wählen. Die ständisch differenzierte Gesellschaft kam auf diese Weise „mit einer Art Glanzstück-Version von Individualismus, mit Helden und Schurken aus. Es genügte, die Richtung der Auszeichnung anzugeben und sie auf die allgemeine Qualitäten-Skala des Seins zu beziehen. Die Selbst-Orientierung war ans Bessersein, nicht ans Anderssein als die anderen gebunden. Sie hatte ihren Auslauf in Richtung nach oben – oder nach unten.“283 Das höhere Ziel der Freiheit lag entsprechend darin begründet, sich durch die Gnade Gottes als Einzelperson von der Sünde erlösen zu lassen. Strebten die Menschen im irdischen Paradies noch gemeinsam dem Ziel der ewigen Seligkeit entgegen und war ihnen nur als Gemeinschaft die Möglichkeit zur Sünde gegeben, ist sie nach der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies zu einem Faktum seiner Existenz geworden, die jede individuelle Handlung unaufhörlich vor die eigenverantwortliche Alternative stellt, entweder ein Leben im Konsens oder Dissens mit den Geboten Gottes zu führen bzw. der göttlichen Berufung Folge zu leisten oder aber dieser einen Abbruch zu tun. Mit dem Sündenfall gerät das menschlichen Verhalten unter Generalverdacht. Die Sünde bedarf in der nachparadiesischen Welt nicht mehr der Versuchung, sie ist vielmehr jeder Handlung immanent. Sie wird, und hier folge ich einem Gedanken von Niklas Luhmann, zugleich als ‚Habitus’ wie auch als ‚Schuld’ thematisiert. Weil sich die Menschen von 282 283 LUHMANN, Niklas: Metamorphosen des Staates. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 4. Frankfurt (Main) 1995, S. 101-137, hier S. 121. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 349. 120 dem Willen Gottes entfernt haben, ist sie ihnen einerseits auf Lebenszeit mit all ihren Konsequenzen für das irdische Zusammenleben auferlegt. Andererseits ist sie aber auch Bedingung dafür, dass der Mensch eine je individuelle Heilskarriere beschreiten kann.284 Der Verweis auf die Selbstreferenz der Person findet sich also zunächst insbesondere in dem religiösen Differenzschema Heil/Verdammnis angelegt.285 Anhand dieses Schemas vermag die Einzelperson zu reflektieren, was es heißt, gegen die in ihrer Natur angelegte Perfektion zu verstoßen, sie zu korrumpieren und damit von dem in der Schöpfung begründeten Telos zum Guten abzuweichen. Für den weiteren Fortgang dieses Gedankens der Selbstreferenz ist ein im Hochmittelalter einsetzender Perspektivenwechsel von entscheidender Bedeutung, in dessen Folge sich ein immer stärkeres Interesse an den inneren Einstellungen der Individuen ausbildet. Als eigentliche Wurzel unmoralischen Handelns wird nun die hinter den äußeren Handlungen verborgen bleibenden Motive entdeckt. Eine Tat ist nicht an sich schlecht oder gut, es kommt vielmehr auf die innere Einstellung und Gesinnung, an, die ihr seitens des Handelnden zugrunde liegt. Letztendlich verweist die Inkommunikabilität des Erkenntnisprinzips der Person bereits auf das Motiv als unkommunizierbare Bedingung von Kommunikation, die es zu entschleiern und sozial zu domestizieren gilt. Alois Hahn hat dabei auf die besondere Rolle der Beichte hingewiesen, die quasi als ein vorgezogenes Jüngstes Gericht bereits im Diesseits eine Geständnispraxis institutionalisiert, mit der sich das Innerste nach Außen kehren und damit zum Gegenstand von Kommunikationen machen lässt.286 Gleichzeitig wird durch die „Verschiebung der Schuld in den Raum der Intentionen [...] das Individuum zu einer Besinnung auf sich selbst zurückgeworfen, wie dies vorher nie der Fall war. Seine innersten Motive werden heilsrelevant, deshalb erforschungsbedürftig. Mit dieser Erhellung des eigenen Motivhaushalts ist aber gerade auch eine Steigerung der Empfindung für die eigene Subjektivität verbunden, die historisch neu ist. Subjektivität ergibt sich also als Folge sozialer Kontrolle.“287 Die Bestimmung des Menschen durch Selbstreferenz spiegelt sich also zunächst in dem hochmittelalterlichen Dispositiv der christlichen Beichtpraxis wider und setzt sich schließlich in der Strafrechtslehre des Spätmittelalters fort, die zwischen der Tat und dem Täter die Geständnispflicht des Angeklagten installiert. 284 285 286 287 Vgl. LUHMANN, Niklas: Das Medium der Religion. Eine soziologische Betrachtung über Gott und die Seelen. In: Soziale Systeme 6 (2000), S. 39-51, hier S. 46. Vgl. BOHN, Cornelia: Individuen und Personen. In: HUBER, Jörg (Hg.): Person/Schauplatz. Zürich / New York 2003, S. 161-181; MOOS, Peter von: Vom Inklusionsindividuum zum Exklusionsindividuum. Persönliche Identität in Mittelalter und Moderne. In: BOHN, Cornelia / HAHN, Alois (Hg.): Annali di Sociologia / Soziologisches Jahrbuch. Bd. 16. 2002/03. Berlin 2006, S. 253-265, hier S. 258 ff. Vgl. HAHN, Alois: Zur Soziologie der Beichte und anderer Formen institutionalisierter Bekenntnisse. Selbstthematisierung und Zivilisationsprozeß. In: HAHN, Alois: Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte. Aufsätze zur Kultursoziologie. Frankfurt (Main) 2000, S. 197-236. Es ist vielleicht das Paradox der Inkommunikabilität, dass über die Dinge, über die man nicht sprechen kann, gesprochen werden muss, weil es ansonsten kaum einen Sinn machen würde, zu schweigen. Reden und Schweigen bedürfen also Orte und Zeiten, in denen sie je für sich kultiviert werden können. Ebd., S. 200. 121 3.3.2 Die Exklusionsindividualität des modernen Individuums Obschon in der Philosophie wie auch in der Soziologie vereinzelt immer wieder Stimmen laut werden, die das „Ende des Individuums“288 herannahen sehen, so wird die Moderne zumeist doch als das Zeitalter umschrieben, in dem das Individuum – befreit von seinen traditionellen Fesseln und kollektiven Abhängigkeiten voraus liegender Epochen – zu sich selbst findet. Dem Duktus der Aufklärung folgend hat sich das soziologische Forschungsinteresse am Individuum lange Zeit vorzugsweise auf die Untersuchung veränderter Verhältnisse des Menschen zu bisher weitestgehend standardisierten Lebensformen (z.B. Konditionen des Familienlebens, der Geschlechterrollen, der religiösen Bindung, Schichtzugehörigkeiten etc.) und eines infolge dieser Umbrüche sich einstellenden Werte- und Normenwandels konzentriert.289 Angesichts der gesellschaftlichen Pluralisierung, so lautet der Befund, erscheinen die sozialen Lebensformen des Menschen als Gegenstände individueller Wahlvorgänge und Entscheidungen. Soziale Bindungen werden als Etappen eines jeweils eigenen Lebensarrangements gewählt und müssen sich dementsprechend in Aushandlungsprozessen stets aufs Neue individuell bewähren. Neben dieser eher positiv konnotierten Entwicklung wird darüber hinaus eine Individualisierung der gesellschaftlichen Zwänge konzediert. Der Mensch trifft auf soziale Vorgaben, die ihn als einzelnen unmittelbar berühren (z.B. Arbeitsmarkt) und die er, ohne auf den Rückhalt traditioneller Bindungen noch hoffen zu können, in Eigenverantwortung zu bewältigen hat. Individualisierung ist also nicht nur mit dem Gewinn individuell wählbarer Optionen gleichzusetzen, ihre Kehrseite verweist gleichermaßen auf den Verlust eines verbindlichen, sozial vorstrukturierten sinnvollen Daseins. Im Zentrum individualisierter Lebenspraxis steht somit die Aufgabe, eine eigene Biographie zu entwickeln und Verantwortung für das persönliche Lebensschicksal zu übernehmen. Aber es stellt sich an diesem Punkt die Frage, ob dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, wie es hier beschrieben wird, tatsächlich Ausdruck von Umwälzungen gesellschaftlicher Teilhabechancen ist, die mit der Aufklärung einsetzten und deren Konsequenzen wir in Reinform gegenwärtig beobachten können? Oder wurzelt dieser Wandel nicht in einer viel tiefer liegenden Evolution der Gesellschaftsstrukturen, deren Geschichte weiter zurückreicht, als dies die Orientierung an den Prämissen der Aufklärung nahe legt? Aber vor allem: Wie konnte sich diese Vor- 288 289 Vgl. LANDMANN, Michael: Das Ende des Individuums. In: LANDMANN, Michael: Das Ende des Individuums. Anthropologische Skizzen. Stuttgart 1971, S. 115-126. Als prominente Vertreter dieser soziologischen Forschungsperspektive sind Autoren zu nennen wie BECK, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt (Main) 1986; SCHULZE, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt / New York 1996; INGLEHART, Ronald. Wertwandel in den westlichen Gesellschaften: Politische Konsequenzen von materialistischen und postmaterialistischen Prioritäten. In: KLAGES, Helmut / KMIECIAK, Peter (Hg.): Wertewandel und gesellschaftlicher Wandel. Frankfurt (Main) 1979, S. 279-316; KLAGES, Helmut: Wertorientierungen im Wandel. Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognosen. Frankfurt (Main) 1984. 122 stellung, Individuen seien Subjekte, die sich ihrer Ichhaftigkeit selbst bewusst sind und die sich in Negation zur Welt als autonom erfahren, überhaupt herausbilden? Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass sich die Grundannahmen des neuzeitlichen Subjektgedankens im institutionellen Kontext der Beichte und des Strafrechts längst vorbereitet finden, bevor René Descartes schließlich im 17. Jahrhundert ihre philosophische Fundierung liefern wird. Allerdings bleibt das Subjekt bei Descartes im Gegensatz zu seiner modernen Gleichsetzung mit dem Ich, das jedem Handeln als Intention zugrunde liegt, der Kennzeichnung des menschlichen Geistes als dem Träger bestimmter Bewusstseinsinhalte vorbehalten.290 Der Geist stellt sich ihm als eine Substanz dar, dessen Wesen alleine aus seinen denkenden Bewegungen heraus begreifbar ist. Anders als dies die auf Aristoteles zurückgehende Unterscheidung von Form und Materie nahe legt, gehorchen der Geist und der Körper jeweils eigenen Gesetzlichkeiten und müssen von daher als zwei strikt voneinander getrennte Substanzen untersucht werden. Aus diesem radikalen Dualismus folgert Descartes nun, dass jede Erkenntnis auf einer Leistung der denkenden Substanz (res cogitans) beruht, sodass uns die Welt der ausgedehnten Substanzen (res extensa) lediglich als Vorstellung gegeben sein kann. Letztendlich ist also eine Gewissheit über diese Welt des Körperlichen nicht zu erlangen. Jede Erkenntnis läuft Gefahr, im Zweifel stecken zu bleiben, weil sie niemals eine finale sein kann. Während das erkennende Subjekt im Denken die Grenze zum Materiellen niemals zu überschreiten imstande ist, es also auf seine eigenen Operationen beschränkt bleibt, kann es an seiner eigenen Existenz nicht zweifeln, denn um zweifeln zu können, muss es sein. Das Subjekt erfährt sich also im Zweifeln als identisch, weil die Selbstreferentialität seines Denkens ihm die Gewissheit gibt, zu sein – cogito ergo sum. Was mit Descartes’ Subjektphilosophie auf den Weg gebracht wird, ist eine allmähliche Erosion der ProvidenzMetaphysik, in deren Folge die scholastische Reduktion der Vernunft als Voraussetzung der „metahistorischen Teilhabe an der Ewigkeit Gottes“291 überwunden und gleichzeitig eine stärkere Hinwendung zum menschlichen Selbst als Ausgangspunkt jeglicher Erkenntnis von und Handelns in der Welt eingeführt wird. In den Tätigkeiten des Menschen realisiert sich seine Freiheit, die nicht wie im Vorsehungsglauben in der Möglichkeit begründet liegt, im Konsens oder Dissens mit den Geboten Gottes und der Natur zu leben, sondern durch das Erkennen der Welt diese nach eigenen Maßgaben und Zwecken zu gestalten. Das neue Selbstbildnis des Menschen, wie es sich verstärkt seit der Renaissance zu formieren beginnt, bot nun genügend Anknüpfungspunkte, das Individuum aus seiner unmittelbaren personalen Beziehung zu Gott herauszulösen. Die Unterscheidung von Natur und Gnade, von der 290 291 Zum Folgenden vgl. insbesondere Descartes Zweite Meditation: Über die Natur der menschlichen Seele, und daß sie uns bekannter ist als ihr Körper in DESCARTES, René: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Hamburg 1977, S. 41 ff. KOSELLECK, Fortschritt (wie Anm. 254), S. 373. 123 menschlichen Vernunftbegabung und der Liebe Gottes, mit der sich die Einzelperson erst vor die Option eines individuellen Heils bzw. einer individuellen Verdammnis gestellt sieht, wird in der Folgezeit substituiert durch die von Natur und Zivilisation.292 Gerade die von Natur aus allen Individuen im gleichen Maße gegebene Freiheit, das zu tun, was ihrem Überleben dient, gebietet es, eine soziale Ordnung zu errichten, in der die Menschen friedlich miteinander koexistieren können. Vor dem Hintergrund dieser Notwendigkeit einer sozialen Kontrolle der natürlichen Freiheit des Menschen bildet sich zunächst die Vorstellung aus, dass im Zuge der Zivilisation einige Individuen – sei es aufgrund ihrer Macht, sei es aufgrund ihrer Arbeit – zu Eigentümern aufsteigen, denen aufgrund ihrer privilegierten Stellung in der Gesellschaft besondere Rechte wie auch Pflichten zufallen. Die Freiheit, über ihr Eigentum zu disponieren, wird ihnen seitens des Staats garantiert, allerdings unter dem Vorbehalt, als Gegenleistung ihren Verbindlichkeiten gegenüber der Allgemeinheit zu genügen. Als Eigentümer bzw. Eigentumsloser, als Reicher oder Armer bleibt das Individuum somit Teil einer ständisch differenzierten Gesellschaft, deren Ordnung es ihm erst ermöglicht, sich im Vergleich zu anderen Mitgliedern seines Standes in seiner Individualität zu erfahren. Neben diesen an rechtlich-ökonomischen Denktraditionen anknüpfenden Staatstheorien rekurriert auch die Anthropologie des 18. Jahrhunderts auf das Differenzschema von Natur und Zivilisation. Das Wesen des Menschen wird hier auf Unendlichkeit angelegt, seine durch die Vernunft gegebene Erkenntnisfähigkeit selbst verzeitlicht und damit als steigerbar gedacht. Der Mensch gewinnt seine Vorrangstellung auf Erden also nicht mehr dadurch, dass er als Ebenbild Gottes einen im Vergleich zum Tier höheren Grad der Perfektion genießt. Vielmehr ist es, in den Worten Rousseaus, seine Perfektibilität, seine Veranlagung, sich – und damit eben auch die Menschheit – permanent zu Vervollkommnen, die ihn vor allen anderen Kreaturen der Welt auszeichnet.293 „Mit dem Umbau von Perfektion auf Perfektibilität“, so Niklas Luhmann, „sprengt die Anthropologie den Menschen aus der Natur heraus und setzt ihn ein als Geschichte.“294 Aber gerade diese ‚Weltoffenheit’ und ‚natürliche Unbestimmtheit’ macht ihn abhängig von Bildung und Zivilisation, ohne die er in einem ursprünglichen Stadium der Wildheit verharren bleibt, in dem sich seine Begabung zur Vernunft nicht weiter entfalten und „die schlaffe Seele noch nicht einmal eine Erfahrung festhalten [konnte – J.H.], die sich doch täglich wiederholte.“295 Bildung wird entsprechend als Anleitung zum freiheitlichen, autonomen Vernunftgebrauch gedacht und zur Bedingung erhoben, den Menschen aus den traditionellen Abhängigkeiten loszulösen, die seine vernunftbestimmte Natur entfremden. 292 293 294 295 Vgl. LUHMANN, Individuum (wie Anm. 264), S. 194 ff. Zu den Ursprüngen dieser Idee vgl. KOSELLECK, Fortschritt (wie Anm. 254), S. 375. LUHMANN, Niklas: Frühneuzeitliche Anthropologie. Theorietechnische Lösungen für ein Evolutionsproblem der Gesellschaft. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 1. Frankfurt (Main) 1980, S. 162-234, hier S. 213. SCHILLER, Friedrich: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? In: SCHILLER, Friedrich: Sämtliche Werke. Bd. 4. Historische Schriften. München 1968, S. 749-768, hier S. 755. 124 Erst im 18. Jahrhundert verschmelzen schließlich die bis dato getrennt voneinander geführten Diskurse um Subjektivität und Individualität endgültig.296 Kurzum: Das Individuum wird zum Subjekt, dem es zur Aufgabe gestellt ist, sich immerfort selbst zu individuieren. Der Mensch definiert sich von nun an über seine Selbstbestimmung und Einzigartigkeit, und muss gerade deswegen auch dies seinen Mitmenschen im gleichen Maße zugestehen. „Jetzt gilt: Das Allgemeinste am Menschen ist gerade seine Individualität, weil ‚jedermann’ ein konkretes Individuum ist. Das Individuum ist dann nicht mehr Teil eines seriellen Arrangements (nach dem Muster: Mensch – Bürger – Mitglied eines Standes oder Berufes – Individuum), sondern es ist selbst Grund aller allgemeinen und besonderen Merkmale: Subjekt.“297 Während in der alteuropäischen Tradition Individuen als integrale Bestandteile einer sozialen Ordnungsstruktur betrachtet wurden, die verschiedene Seinsqualitäten bereithielt, anhand derer sich das je Individuelle nach gattungsmäßigen Ähnlichkeiten gruppieren ließ, werden sie im Zuge ihrer modernen Umwertung als „Zentren je ihrer Welt“298 jenseits einer solchen Ordnung platziert. Individualität resultiert somit aus der „Mannigfaltigkeit der Weise [...], wie sich die Welt in verschiedenen Individuen spiegelt.“299 Das Individuum erlangt seine Individualität demgemäß „nicht durch seine Beziehung zu anderen, sondern durch seine Beziehung zu sich selbst und, da dies tautologisch ist, durch seine auf Grund dieser Selbstbeziehung erworbenen Eigenschaften.“300 Diese sind ihm also nicht mehr durch die Natur, durch einen göttlichen Willen oder durch seine Geburt in der Gesellschaft prädisponiert, sie resultieren vielmehr aus einer Introspektion, mit der das Individuum das eigene Erleben und Handeln zum Gegenstand seiner Beobachtungen macht. Dabei bleibt es darauf angewiesen, sich in seinem Anderssein sowohl zu anderen Individuen (Subjekten) in Distanz zu setzen als auch von diesen eine Bestätigung seiner selbst zu erfahren. Ich bin ich, weil ich nicht Du bin; und gleichermaßen: Ich bin ich, weil Du das Ich in mir als Ich erkennst. Einerseits muss das Individuum also in Abgrenzung gegenüber seiner sozialen Umwelt seine Identität selbstreferentiell über eigene Erlebnisse bestimmen, andererseits bedarf es jedoch der Umwelt zur Selbstimplifikation. Letztendlich erscheint erst jetzt die in der Sozialdimension angelegte Differenz von Alter und Ego unmissverständlich auf ihr jeweiliges Welterleben und -handeln zurückgeführt. Infolge dieser Subjektivierung des Individuums sehen sich die interpersonalen Beziehungen auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Was auch immer wir in unserem Gegenüber sonst zu erblicken vermögen, er ist zunächst einmal ein Subjekt, und genau darin wissen wir uns mit ihm identisch. Er repräsentiert das Allgemeine, was jeder mit dem anderen gemein hat, wobei es dann 296 297 298 299 300 Vgl. LUHMANN, Die gesellschaftliche Differenzierung und das Individuum (wie Anm. 267), S. 127. LUHMANN, Ordnung (wie Anm. 216), S. 243. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 1021. HUMBOLDT, Wilhelm: Theorie der Bildung. In: HUMBOLDT, Wilhelm: Werke in fünf Bänden (Hg. von Andreas Flitner und Klaus Giel). Bd. I. Schriften zur Anthropologie und Geschichte. Stuttgart 1960, S. 234-240, hier S. 239. LUHMANN, Die gesellschaftliche Differenzierung und das Individuum (wie Anm. 267), S. 126. 125 dem jeweiligen Interaktionskontext überlassen bleiben muss, darüber zu befinden, worin sich denn seine Besonderheiten jeweils äußern. Solange, wie das Individuum lediglich als ein Begriff der Logik fungierte, konnte man davon ausgehen, dass es unabhängig von der Situation, in der es sich befindet, identisch bleibt. Eben weil ihm ein Dingcharakter zukam, ließ es sich als Träger gleich bleibender Personenmerkmale betrachten, auf deren Grundlage eine Berechenbarkeit seiner Verhaltensweisen weitestgehend möglich erschien. In dem Moment jedoch, in dem das Individuum selbst zum Subjekt erkoren wird, muss die Interaktion eine viel stärker ausgeprägte Sensibilität für die Motive ausbilden, warum sich der Gegenüber verhält, wie er sich verhält. Auch wenn es unmöglich erscheint, sein Denken zu durchschauen, so besteht doch die Möglichkeit, gerade weil man wie er selbst ein Individuum ist, sich in dessen Lage hineinzuversetzen. Nur durch eine solche Übernahme der Perspektive des jeweils Anderen, durch ein Beobachten seines Beobachtens, wird es möglich, sich auf den Interaktionspartner als ein die Welt beobachtendes Subjekt einzulassen und darüber zu urteilen, inwieweit man bereit ist, die eigenen Verhaltensweisen an dessen Erwartungen anzupassen.301 Die Interaktion verläuft somit reflexiv. Sie orientiert sich nicht mehr daran, wer oder was jemand ist bzw. worauf seine Verhaltensweisen abzielen, sondern wie er auf das reagiert, was er als Welt zugrunde legt. Sie wird, anderes gesagt, von einer Beobachtung erster Ordnung auf eine Beobachtung zweiter Ordnung umgestellt. Die Bedingungen der Möglichkeit sozialer Ordnung müssen dabei in den Individuen selbst angelegt sein, deren geordnetes Miteinander in der Interaktion eine gemeinsame Übereinkunft, eine innere Übereinstimmung von Werten, Normen und Überzeugungen voraussetzt. Soziale Systeme, die ihre Teilhabemöglichkeiten von der Art und Weise abhängig machen, wie ein Beobachter die Welt beobachtet, konfrontieren das Individuum unweigerlich mit der Forderung, „ein sein eigenes Beobachten beobachtender Beobachter zu sein: ein Selbstbeobachter zweiter Ordnung.“302 Es geht hier also nicht mehr darum, die eigene Natur zu erkennen und ihr durch ein entsprechendes Handeln gerecht zu werden. Im Vordergrund steht vielmehr die Frage, welche Verhaltensweisen man an den Tag legen muss, um zweckdienliche Reaktionen bei jenen wahrscheinlich zu machen, die das eigene Beobachten beobachten. Im Vergleich zu vormodernen Gesellschaften, in denen es mehr oder weniger genügte, sich in seinem Verhalten an sozial verbindlichen Identitätsschemata zu orientieren, setzt diese Form der Selbstbeobachtung, die auf eine Antizipation der Folgen des eigenen Verhaltens abzielt, ein gesteigertes Maß an Selbstkontrolle voraus. Bei der Teilhabe an Sozialität bleibt dem Individuum die Möglichkeit verstellt, über seine wahren Motive, seine Icherfahrung, Auskunft zu geben, weil sich die Auskunft 301 302 Diese Vorstellung findet sich sehr plastisch in Adam Smiths’ ‚Theorie der ethischen Gefühle’ ausgearbeitet. Vgl. SMITH, Adam: Theorie der ethischen Gefühle oder Versuch einer Analyse der Prinzipien, mittels welcher die Menschen naturgemäß zunächst das Verhalten und den Charakter ihrer Nächsten und sodann auch ihr eigenes Verhalten und ihren eigenen Charakter beurteilen. Leipzig 1926. LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 1026. 126 selbst immer schon mit dem Problem der Inkommunikabilität von Aufrichtigkeit und Authentizität belastet sähe. Was sich der Kommunikation entzieht, nämlich Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen, lässt sich auch nicht kommunizieren.303 Eine erfolgsversprechende Inklusion in ein soziales System ist für die Person entsprechend nur durch ein Kopieren von Rollenmuster zu erreichen. Das Individuum muss dafür die Fähigkeit ausbilden, „sich in mehrere Selbsts, mehrere Identitäten, mehrere Persönlichkeiten zu zerlegen, um der Mehrheit sozialer Umwelten und der Unterschiedlichkeiten der Anforderungen gerecht werden zu können. [...] Es benötigt ein musikalisches Selbst für die Oper, ein strebsames Selbst für den Beruf, ein geduldiges Selbst für die Familie.“304 Es erscheint hier nicht mehr durch seine Unteilbarkeit, sondern vielmehr durch seine Teilbarkeit definiert. Allerdings zeigt sich dabei sofort, dass eine Reflexion auf die eigene personale Identität keine hinreichende Basis mehr liefert, um zu einer stabilen Identitätsfindung zu gelangen, denn als Beobachtung zweiter Ordnung führt sie in sich selbst keinen Anlass, ihren Fortgang zu beenden. Nicht die Natur und das gottgegebene Sein, sondern die Biographie erscheint nunmehr als das Medium der Reflexion, an dem die Identität der Person, ihre Selbigkeit, über die Zeit hinweg beobachtet werden kann.305 „Individualität“, darauf verweist Niklas Luhmann in einer knappen, aber präzisen Formulierung, „ist Unzufriedenheit.“306 Wenn Luhmann die Unzufriedenheit mit sich selbst als das Charakteristikum der modernen Individualität heraushebt, dann radikalisiert er die Gedanken der Subjektphilosophie Descartes’ aufs Schärfste. War bei Descartes die Einheit des Subjekts noch durch die Schöpfung Gottes in der denkenden Substanz verbürgt, so weist Luhmanns Formulierung darauf hin, dass in der Moderne selbst das ‚Ich’ des Denkens fragwürdig und zum Objekt wird, an dem man zweifeln kann. Zweifeln jedoch heißt, Differenzen zu setzen und das auch anders Mögliche mitzudenken. So resultiert aus der modernen Bestimmung von Individualität das Los der Erfahrung von Kontingenz am eigenen Selbst: An die Stelle der religiös-moralistischen 303 304 305 306 Bei Luhmann heißt es dazu: „Man braucht nicht zu meinen, was man sagt (zum Beispiel, wenn man ‚guten Morgen’ sagt). Man kann gleichwohl nicht sagen, daß man meint, was man sagt. Man kann es zwar sprachlich ausführen, aber die Beteuerung erweckt Zweifel, wirkt also gegen die Absicht. Außerdem müßte man dabei voraussetzen, daß man auch sagen könnte, daß man nicht meint, was man sagt. Wenn man aber dies sagt, kann der Partner nicht wissen, was man meint, wenn man sagt, daß man nicht meint, was man sagt. Er landet beim Paradox des Epimenides. Er kann es nicht wissen, selbst wenn er sich Mühe gäbe, den Sprecher zu verstehen; also verliert die Kommunikation ihren Sinn.“ LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 207 f. Zur Inkommunikabilität der Liebe vgl. LUHMANN, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt (Main) 1982, S. 153 ff. LUHMANN, Individuum (wie Anm. 264), S. 223. Um diese Unsicherheit im Erleben der eigenen personalen Identität zu meistern, werden den Individuen seitens der Gesellschaft Bewältigungsressourcen an die Hand gegeben, mit denen sie ermächtigt werden sollen, die Kontingenz ihrer Persönlichkeit zu verarbeiten. Alois Hahn bezeichnet derartige Bewältigungsmechanismen als „Biographiegeneratoren“ – wie sie in der Beichte, der Autobiographie und der Psychoanalyse zur Verwendung kommen –, die durch Selektion und Vereinfachung von Ereignissen im Lebenslauf als auch über die Bereitstellung von Ansatzpunkten weiteren Erlebens und Handelns die Möglichkeit eröffnen, der eigenen Existenz einen Sinn zu verleihen. Vgl. HAHN, Alois: Identität und Selbstthematisierung. In: HAHN, Alois / KAPP, Volker: Selbstthematisierung und Selbstzeugnis. Bekenntnis und Gedächtnis. Frankfurt (Main) 1987, S. 9-24. LUHMANN, Individuum (wie Anm. 264), S. 243. 127 Forderung, seine wahre Natur zu erkennen und zu lieben, sie gegen die Unperson, das böse und sündige Ich, zu verteidigen, tritt die reflexive Selbstentwurzelung des Individuums, der Anspruch, morgen ein anderer sein zu können, als man heute ist und gestern war. Das Individuum lässt sich folglich auch nicht mehr auf eine durch die Seele in der Sachdimension garantierte letzte substantielle Einheit zurückführen, die nur Abstufungen und Abarten der Vollkommenheiten zulässt. In der Moderne steigt die Individualität zur Triebkraft eines Weltaneignungsprozesses auf, über die sich das Individuum als Individuum stets aufs Neue generiert. Sie löst sich von sozialen Vorgaben eines schichtgemäßen Lebens ab und lagert sich infolgedessen in die Zeitdimension aus. In ihrem Mittelpunkt steht nicht mehr der Vergleich mit anderen, von denen man sich durch seine eigene Vorzüglichkeit abhebt, sondern die unaufhörliche Veränderung des eigenen Ichs. Der Lebenslauf figuriert zu einer offenen Zukunft, der es sich – ob man dies nun will oder nicht – eigenverantwortlich zu stellen gilt. Karriere heißt nun die neue Losung, die diesen Verlust an Zukunftsgewissheit in einen Zugewinn umzumünzen versucht.307 „In dem Maße, als sozialstrukturelle Bestimmungen der Lebensläufe zurückentwickelt, das heißt: auf Bedingungen für Karrieren reduziert werden, wird Karriere zur universellen Lebensform. Sie läßt die Möglichkeit offen, sich als träge und uninteressiert zu erweisen und in einer Nische ein ruhiges Leben zu suchen. Man kann, anders gesagt, den Beitrag einer eigenen Selbstselektion für Karrieren verweigern. Man kann eine Null-Karriere wählen. Aber auch das ist noch Karriere [...]. Auch sie kann nicht ausschließen, daß Momente kommen, in denen man sie, weil kontingent, bereuen wird. Die Karriere [...] bietet dem Individuum die Form, in der es sich selbst, ohne an Individualität zu verlieren und ohne in einem höheren Ganzen ‚aufzugehen’, in die asymmetrische Irreversibilität der Zeit versetzen kann (obwohl die Karriere selbst eine rekursive Verknüpfung aller für sie relevanten Ereignisse vorsieht). Und diese Form ist abgestimmt auf das, was als Sozialstruktur ohnehin gegeben ist.“308 Kurzum: Das Individuum erscheint jetzt als das, wozu es sich kraft seiner Auseinandersetzung mit der Welt macht. Auch wenn sich erst im Nachhinein in einer zukünftigen Gegenwart herausstellen wird, welche Folgen die bewusste Wahl einer Verhaltensmöglichkeit zeitigt, unser Blick in die Zukunft wird dadurch motiviert, dass vieles von dem, was in künftigen Gegenwarten der Fall sein wird, von unseren gegenwärtigen Sinnselektionen abhängt. Und wir bauen weiterhin auf die Gestaltbarkeit der Zukunft (was bleibt dem Individuum auch anderes übrig), obwohl wir in unser Kalkül einbeziehen können, dass nicht alles so kommen muss, wie wir es uns erhofft und angestrebt haben, dass Faktoren in unser Leben eingreifen, die wir nicht zu beeinflussen vermögen. Über die Erwartbarkeit von Enttäuschungen gelingt dem modernen Menschen die Anpassung an eine Zukunft, die letztlich immer anders ausfallen kann, als man 307 308 Genaueres zum Begriff der Karriere findet sich bei LUHMANN / SCHORR, Reflexionsprobleme (wie Anm. 230), S. 277 ff.; LUHMANN, Individuum (wie Anm. 264), S. 231 ff. Ebd., S. 235 f. 128 erwartet hatte, und die gerade aufgrund dessen auch für zukünftige Gegenwarten noch die Möglichkeit bereithält, es anders zu machen (oder aber: zu resignieren). Die Metamorphose des Individuums findet an diesem Punkt ihren (vorläufigen) Abschluss. In den folgenden Kapiteln soll nun untersucht werden, ob und inwieweit sich die in den Semantiken des Individuums und der Individualität zu beobachtenden Bedeutungsverschiebungen auch auf das Verhaltensprinzip der Reziprozität ausgewirkt haben. Geht man von der These aus, dass in stratifikatorisch differenzierten Gesellschaften das Verhaltensprinzip der Reziprozität auf das strukturelle Problem reagiert, wie sich die Differenz zwischen Alter und Ego als Einheit des Differenten denken lässt, dann liegt die Annahme nahe, dass mit dem Verlust der substantiellen Füllung des Individuums zugleich auch das Problem sozialer Ordnung auf eine völlig neue Grundlage gestellt wird. Die ab dem 17. Jahrhundert sich in rasanter Weise vollziehende Umstellung der Ordnungssemantik interpersonaler Beziehungen von Freundschaft auf Interesse kann dementsprechend als Ausdruck einer historischen Gesellschaftskonstellation gewertet werden, der infolge der sukzessiv voranschreitenden Zersetzung grundherrschaftlicher Strukturen die Gewissheit eines in der Natur selbst angelegten harmonischen Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft abhanden gekommen ist. 3.4 Reziprozität als kulturhistorisches Phänomen – Von der Freundschaft zum Interesse 3.4.1 Die sozialintegrative Funktion der Freundschaft Die ersten systematischen Überlegungen zum Verhaltensprinzip der Reziprozität finden sich in der bereits in der antiken Philosophie formulierten Idee der Freundschaft (philia). Für die historische Genese dieses Gedankens hat Aristoteles’ praktische Philosophie mit ihrem Gegenstand des ‚guten Lebens’ das entscheidende Fundament gelegt.309 Nach Aristoteles erstrebt jede menschliche Tätigkeit ein Gut, wobei das einzige Gut, das niemals um eines anderen willen anvisiert wird, die Glückseligkeit ist. Streben meint also eine Bewegung, der bereits eine Finalität innewohnt, in der sich das Telos des Tätigseins vollendet. Nun kennt Aristoteles drei Gründe, aus denen heraus 309 So auch Stern-Gillets’ Einschätzung der Bedeutung von Aristoteles: „While systemazing the spirit of his time and place, he often transcended it. His analysis of the various forms of friendship have remained the terminus a quo for later writers on the subject, from Cicero to present day via Aquinas and Montaigne.“ STERN-GILLET, Suzanne: Aristotle’s Philosophy of Friendship. New York 1995, S. 171. Aristoteles’ Gedanken zur Freundschaft finden sich vor allem in dem VIII. und IX. Buch der Nikomachischen Ethik unterbreitet. Vgl. ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203). Zur Entwicklung des Freundschaftsgedankens von der Antike bis zum Mittelalter vgl. MCEVOY, James: Philia and Amicitia. The Philosophy of Friendship from Plato to Aquinas. In: Sewanee Medieval Colloquium Occasional Papers 2 (1985), S. 1-21. 129 der Mensch etwas anstrebt und liebt, nämlich weil es ihm nützlich, angenehm oder aber gut an sich erscheint.310 Analog zu diesen Handlungsmotiven, die entweder mehr von den Leidenschaften oder mehr von der Vernunft bestimmt sind, unterscheidet er drei verschiedene Ausprägungen der Freundschaft: So liebt man „den einen wegen seiner Artung und Tugend, den anderen, weil er nützlich und brauchbar ist, den dritten, weil er angenehm und begehrenswert ist. Zum Freunde wird er, wenn er die Liebe erwidert und beide sich dessen auch bewußt werden.“311 Eine Freundschaft setzt demnach nicht nur ein Gut voraus, das geliebt wird, sie beruht gleichermaßen auch auf einer Reziprozität, über die sich ein gegenseitiges Wohlgesonnensein der Handlungspartner zum Ausdruck bringt. Jedes Wohlwollen verdient eine Reaktion, weil es auf eine freiwillige Entscheidung zurückgeht, die auch hätte anders ausfallen können. Aristoteles konzipiert die Freundschaft somit als ein soziales System, in dem das Wohlwollen des Einen sich durch ein vergleichbares Handeln des Anderen entgolten sieht. Innerhalb dieses sozialen Systems erscheint der Freund als ein „anderes Selbst“,312 der gleichermaßen wie der Liebende im Vollzug seiner Handlungen darauf abzielt, unter Mithilfe des Gegenübers sich dessen zu beschaffen, was er im Leben aus sich selbst heraus nicht erreichen kann. Zwischen den Freunden besteht somit eine gewisse Ähnlichkeit, insofern beide in ihrem Handeln einander dasselbe wünschen, obschon Aristoteles durchaus auch eine Freundschaft zwischen Ungleichen (Vater/Sohn; Mann/Frau; Regierender/Regierter) vorsieht. In diesen Fällen, in denen die Freundschaft aufgrund eines in Aussicht gestellten gemeinsamen Nutzens zustande kommt, „muß die Zuneigung eine proportionierte sein, so daß der bessere mehr geliebt wird, als er selbst liebt, und ebenso der Nützlichere usw. Denn wenn die Zuneigung der Würdigkeit entspricht, so ergibt sich eine gewisse Gleichheit, was eben der Freundschaft eigentümlich zu sein scheint.“313 Die vollkommenste Ausgestaltung der Freundschaft realisiert sich allerdings in der Tugendfreundschaft, bei der man den Freund seiner selbst willen und nicht – wie bei den niederen Formen – allein der Lust bzw. dem Nutzen willen liebt. „Und in dem man den Freund liebt, liebt man, was einem selbst gut ist. Denn der Tugendhafte, der zum Freund geworden ist, wird zu einem Gute für den, dessen Freund er geworden ist. Also liebt jeder von beiden das, was für ihn gut ist, und gibt das gleiche zurück durch die Gesinnung und indem er dem andern angenehm ist. Denn Freundschaft gilt als Gleichheit. Dies gilt am meisten von der Freundschaft der Tugendhaften.“314 Für Aristoteles ist es also letztlich die Eigenliebe des Menschen, aus der heraus er die Freundschaft begründet. Der Tugendhafte „wünscht sich selbst das Gute, und was als solches 310 311 312 313 314 Vgl. ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203), 1155b 18 f. ARISTOTELES: Eudemische Ethik. Darmstadt 1979, 1236a 13 ff. ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203), 1166a 32. Zur Konzeption des ‚anderen Selbst’ bei Aristoteles und Thomas von Aquin vgl. HEDWIG, Klaus: Alter Ipse. Über die Rezeption eines Aristotelischen Begriffs bei Thomas von Aquin. In: Archiv für Geschichte der Philosophie 72 (1990), S. 253-274. ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203), 1158b 23-28. Ebd., 1157b 33 ff. 130 erscheint, und tut es (denn es ist Sache des Guten, das Gute durchzuführen) und um seiner selbst willen; und zwar um des denkenden Teils willen, der am meisten er selbst zu sein scheint.“315 Nur in der Tugendfreundschaft verrichtet der Mensch seine ihm von Natur aus angemessene und eigentümliche Tätigkeit. Er handelt tugendhaft und hat dabei sowohl am eigenen als auch an dem Glück seines Freundes teil, weil er sich „zum Freund verhält wie zu sich selbst (denn der Freund ist ein anderer er selbst) [...].“316 Bei der Verwirklichung seiner eigenen Natur bleibt der Mensch damit auf einer Gemeinschaft angewiesen, die nur dann von Bestand sein kann, wenn sie auf der Freundschaft der ihr zugehörigen Personen gründet. „Denn der Wille, zusammenzuleben, ist Freundschaft.“317 Entscheidend ist nun, dass Aristoteles zum einen die Formen der Freundschaft von den jeweiligen Qualitäten der Personen, aus denen sich eine Gemeinschaft zusammensetzt, abhängig macht, und dass er zum anderen das Problem, wie der Empfänger einer bestimmten Leistung diese entgelten soll, in den verschiedenen Freundschaftsformen auf je unterschiedliche Art und Weise gelöst sieht. Während bei der Tugendfreundschaft allein die Absicht des Gebenden, Gutes zu tun, als das Maß der Entgeltung zu betrachten ist, steht bei den anderen Formen der Freundschaft die Frage im Vordergrund, wie groß der Nutzen einer Leistung beim Empfänger tatsächlich war. Die christlich-mittelalterlichern Konzepte der Nächsten- und Gottesliebe führen den in der antiken Philosophie ausgearbeiteten Gedanken der Freundschaft fort, obgleich sie ihn näher spezifizieren. Im Anschluss an Aristoteles hat Thomas von Aquin den Akt, durch den hindurch sich die Liebe kundgibt, auf die kurze Formel gebracht: „Lieben heißt, einem Gutes zu wollen.“318 Er unterscheidet dabei zwischen zwei Grundformen der Liebe, nämlich die Liebe der Freundschaft (amor amicitiae), bei der man den Anderen als Wert an sich seiner selbst wegen liebt, und die Liebe des Begehrens (amor concupiscentiae), die durch ein Gut bewirkt wird, mit dem man bei sich selbst bzw. bei einer anderen Person einen Nutzen und Vorteil zu erreichen bzw. einen Mangel zu beheben sucht.319 Als eigentlichen Grund der Liebe betrachtet er die Ähnlichkeit zwischen der liebenden und geliebten Person, die einmal deswegen wahrgenommen werden kann, „weil beide dasselbe in Wirklichkeit haben […]. Dann deswegen, weil das eine anlagemäßig und in einer ge- 315 316 317 318 319 Ebd., 1166a 14 ff.. Ebd., 1166a 31 f. Niklas Luhmann hat herausgestellt, dass sich der Sozialtypus Freundschaft über zwei Merkmale konstituiert, „die in seiner vollkommensten Form aber am vollkommensten realisiert werden [...]: (1) Selbstreferenz der an der Beziehung Beteiligten und (2) Gleichheit trotz Andersheit. Beides zusammen ist Voraussetzung dafür, daß man sich zum anderen wie zu einem andren Selbst verhalten kann [...].“ LUHMANN, Ordnung (wie Anm. 216), S. 216. ARISTOTELES, Politik (wie Anm. 14), 1280b 38. AQUIN, Thomas von: Summa Theologica. Übers. von Dominikanern u. Benediktinern Deutschlands u. Österreichs. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg. I. Teil des II. Buches. Bd. 10. Die menschlichen Leidenschaften. Graz / Wien / Köln 1955, q. 26,4. Vgl. ebd., q. 26,4. 131 wissen Neigung das hat, was das andere in Wirklichkeit hat […].“320 So wie Aristoteles’ hierarchische Stufenfolge verschiedener Freundschaftstypen in der Tugendfreundschaft gipfelt, so bezeichnet auch Thomas von Aquin jene Form der Liebe als die höchste, in der sich die Möglichkeit zur Freundschaft auch tatsächlich angelegt findet. Eine wahre Freundschaft kann nur durch eine Liebe hervorgerufen werden, die am Gegenüber nicht ein Gut begehrt, über das dieser lediglich akzidentiell verfügt, sondern die ihn in seiner Wirklichkeit als Person anerkennt. Anders als bei Aristoteles bleibt bei Aquin die Freundschaftsliebe nicht mehr einem engen Personenkreis vorbehalten, denen bereits aufgrund ihrer natürlichen Qualitäten eine Begabung zum tugendhaften Verhalten innewohnt. Die Freundschaftsliebe wird demgegenüber zu einem allen Christen anheim gestellten Ideal stilisiert, welches in der Liebe Gottes zum Menschen sein Vorbild hat. In der theologischen Rezeption des Freundschaftsgedankens findet die Entelechie des Menschen damit nicht mehr in der Tugend, sondern in der Schau Gottes, also nicht mehr im Diesseits, sondern im Jenseits ihre eigentliche Vollendung. Hatte die aristotelische Anthropologie den Menschen noch ausschließlich substantiell als ein animal rationale begriffen, so sieht sich der Mensch in der mittelalterlichen Theologie zudem auf Gott seinem Schöpfer verwiesen. Seiner Vernunft ist ein Verlangen immanent, durch die ‚Schau’ des höchsten, ihre Potenz ausfüllenden Gegenstands zur Ruhe zu gelangen. Voraussetzung dieses Verlangens ist jedoch, dass Gott sich zunächst seinem Abbild (imago) in der Form einer übernatürlichen Gnadengabe zuwendet. Indem er die Tugenden der Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und des Maßhaltens, die seiner vernunftbegabten Schöpfung durch Einübung zugänglich sind, um die gnadenhaft geschenkten theologischen Tugenden der Hoffnung, Liebe und des Glaubens erweitert, eröffnet er dem Menschen die Möglichkeit, sich selbst durch ein Imitieren Gottes (similitudo) zu vollenden.321 Die Gnade ist also immer ein Zweites, die Vernunftnatur des Menschen Komplementierendes, das dieser zwar nicht bedarf, um Menschsein zu können, deren Fehlen es ihm aber unmöglich macht, seine Perfektion zu erlangen. War ihm vor dem Sündenfall diese Gnade durch ein unmittelbares Verhältnis zu Gott eingegossen und vermochte er aufgrund dieser habituellen Ausstattung im Einklang mit Gott, den anderen Geschöpfen und sich selbst zu leben, so geht ihm mit dem Sündenfall diese Gottverbundenheit und Urstandsgerechtigkeit (iustitia originalis) verloren. Seine Vernunft wird verdunkelt, seine Befähigung, die Vollkommenheit Gottes zu erschauen, geschwächt.322 Ohne die Menschwerdung Gottes in Jesu Christi bliebe er in seinen Lebensvollzügen der Sünde verhaftet. Erst infolge dieser selbstlosen Gabe, mit der Gott sich in 320 321 322 Ebd., q. 27,3. Zu dieser auf Irenäus zurückgehenden und für die mittelalterliche Anthropologie zentrale Unterscheidung von Imago und Similitudo vgl. PANNENBERG, Wolfhart: Gottebenbildlichkeit als Bestimmung des Menschen in der neueren Theologiegeschichte. München 1979, S. 7 f. Zu den soziologischen Problemen, die sich aus dem Zwei-Personen-Modell Gott/Mensch ergeben, vgl. LUHMANN, Niklas: Läßt unsere Gesellschaft Kommunikation mit Gott zu? In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen 1987, S. 227-235. 132 seiner Andersheit dem Menschen ähnlich macht und mit ihm in seiner Sprache kommuniziert, wird dieser in die Lage versetzt, seine auf die Schau der Wahrheit und des Guten ausgerichteten Natur zu verwirklichen, d.h., Gott als Person um seiner selbst willen zu lieben.323 Aus soziologischer Sicht stellt sich der theologische Entwurf der Gottesliebe schon allein deswegen als sehr aufschlussreich dar, weil er eine Semantik der Reziprozität bereithält, die nicht an der interpersonalen Beziehung zwischen Gott und dem Menschen Halt macht, sondern zugleich auch eine Anleitung für den Aufbau und Erhalt einer diesseitigen sozialen Ordnung preisgibt. Das mittelalterlich-theologische Verständnis des Verhaltensprinzips der Reziprozität nimmt seinen Ausgang in der Gnade Gottes. Nach Thomas von Aquin kommt der Gnade eine dreifache Bedeutung zu, die sich unter Bezugnahme auf die von Luhmann vorgeschlagenen Sinndimensionen wie folgt beschreiben lässt: Sie sieht sich durch eine Zuneigung (Liebe) verursacht, die im Erleben einer Person begründet liegt (Sachdimension); sie stellt sich als ein ungeschuldetes Geschenk dar, das Alter von Ego erhält (Sozialdimension); und sie ist eine in der Form der Dankbarkeit vollzogene Erwiderung einer voraus liegenden Wohltat (Zeitdimension).324 Mit der Gnadengabe wird die soziale Symmetrie, die zwischen Gott und dem Menschen analog zum platonischen Urbild/Abbild-Verhältnisses besteht, asymmetrisiert, sofern sie als ungeschuldetes Geschenk dem Menschen als vernunftbegabtes Geisteswesen die Unmöglichkeit vor Augen führt, die Endlichkeit seiner Existenz aus eigenen Kräften zu überwinden und die Vernunft mit ihren ewigen Gesetzen zu schauen. Um seinem Urbild gewahr werden zu können, bedarf er der Hilfe, die ihm Gott in der Form seiner Liebe anbietet. Neben dieser sozialen Asymmetrie führt die Gnadengabe eine zeitliche Asymmetrie ein. Nach dem Sündenfall steht Gott vor der Wahl, dem Menschen entweder einen Weg aus seiner Unvollkommenheit zu weisen oder ihn als Strafe in seiner Unvollkommenheit zu belassen. Gott entschließt sich schließlich aufgrund der Zuneigung zu seiner Schöpfung zur Gnade. Der Mensch sieht sich damit seinerseits vor die Alternative gestellt, die Selektion Gottes und die mit ihr verbundenen Erwartungen als Motiv seines eigenen Verhaltens an- oder abzulehnen. Warum sollte er aber, kommunikationstheoretisch betrachtet, bei der Wahl seiner Anschlusshandlungen die Annahme und nicht etwa die Ablehnung der Gnadengabe präferieren und damit die ihm gegenüber zum Ausdruck gebrachte Zuneigung Gottes zum Maßstab seines Verhaltens nehmen? Oder anders gewendet: Warum sollte er mit der Annahme die Verpflichtung eingehen, durch die Entsagung von der Sünde und die Vollbringung guter Werke sich Gott gegenüber dankbar zu erweisen? Für die mittelalterliche Theologie stellt 323 324 Nach Maria Fürth lässt sich die Genese der Liebesvorstellungen von dem Urchristentum bis hin zur Gegenwart anhand des Wandels des religiösen Erlösungsgedankens rekonstruieren. Vgl. FÜRTH, Maria: Caritas und Humanitas. Zur Form und Wandlung des christlichen Liebesgedankens. Stuttgart 1933. Vgl. AQUIN, Thomas von: Summa Theologica. Übers. von Dominikanern u. Benediktinern Deutschlands u. Österreichs. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg. I. Teil des II. Buches. Bd. 14. Der Neue Bund und die Gnade. Graz / Wien / Köln 1955, q. 110,1. 133 sich dieses Problem der Unwahrscheinlichkeit des kommunikativen Erfolgs kaum. Sie geht davon aus, dass den vernunftbegabten Wesen a priori geltende Prinzipien eigen sind, die lediglich einen ersten Anstoß und eine gewisse Kenntnis von dem voraussetzen, was ihrem Wesen entspricht, um nach dem Guten und dem wahren Glück zu verlangen. Mit der Offenlegung des Mangels, an dem der Mensch in seinem diesseitigen Leben leidet, folgt sein Wollen und Handeln geradezu zwangsläufig dem Ziel, die Kluft zwischen dem Liebenswerten und seinem Ist-Zustand zu schließen, d.h. nach Selbstvollendung und Perfektion im höchsten Gut zu streben und damit der Schöpfung Gottes gerecht zu werden. Die mittelalterliche Theologie fasst die Liebe insofern als eine ‚Vereinigungskraft’ (vis unitiva) auf.325 Die Liebe stiftet eine soziale Beziehung, in der das getrennt voneinander Existierende zu einer Einheit verschmilzt, indem der Liebende den Geliebten als zu sich gehörig, als einen Teil seiner selbst erfährt. „Dabei hat die Vereinigung einen gemäß dem Formenniveau der Partner verschiedenen Sinn: sie reicht von der körperlichen bis hinauf zur geistigen Einswerdung, dem unum velle, das Personen miteinander verbindet und das sogar die Kluft zwischen Gott und dem Menschen überbrücken kann.“326 Entscheidend ist nun zu sehen, dass nicht alle Menschen gleichermaßen über die Befähigung verfügen, die verschiedenen Perfektionsgrade der Vereinigung zu durchlaufen. So setzt etwa eine bereits im Diesseits verwirklichte Freundschaft mit Gott ein Leben voraus, das nicht durch körperliche Leidenschaften, sondern allein durch den Geist bestimmt wird. Offenbar ist dieses Verständnis einer Gesellschaftsordnung nachempfunden, die über hierarchische Abstufungen verschiedene Qualitäten ihrer Mitglieder voneinander unterscheidet. Damit sich nun aber die an der Liebesbeziehung beteiligten Personen jenseits ihrer formalen Ähnlichkeit auch faktisch zu einer Einheit zusammenfügen können, muss die asymmetrische Beziehung zwischen ihnen resymmetrisiert werden, muss sich der Liebende zum Geliebten bzw. der Geliebte zum Liebenden erheben. Durch dieses Alternieren der Rollen vermögen sie sich in ihrem Handeln genauso wie in ihrem Erleben als gut zu erfahren. Die Liebe ist (als Thema einer Kommunikation) nicht nur ein Zeichen für die Zuneigung, die ein Liebender für den Geliebten hegt, sie symbolisiert zugleich auch dessen Erwartung, vom Geliebten als liebenswert wahrgenommen zu werden. In ihr kommt also der Liebende als Objekt des Geliebten selbst vor, sodass sie nicht nur die Bejahung des Gegenübers, sondern auch des eigenen Selbst in Aussicht stellt. Der Liebe geht es dabei nicht darum, durch das Eingehen auf die Wünsche und Hoffnungen des Geliebten eine Erwiderung wahrscheinlich zu machen, die den eigenen Erwartungen entspricht. Vielmehr findet sie in der Selbstliebe ihre Voraussetzung, insoweit nur derjenige, der sich selbst Gutes will, auch erwarten darf, wegen seiner Gutheit geliebt zu werden. Wir werden 325 326 Vgl. S. th. I-II, q. 26,2 ad. 2. KUHN, Helmut: ‚Liebe’. Geschichte eines Begriffs. München 1975, S. 132. 134 im nachfolgenden Kapitel noch genauer sehen, dass exakt an diesem Punkt das Konzept der Selbstliebe von dem des Eigeninteresses grundlegend abweicht. Zunächst gilt es jedoch noch die Frage zu klären, wie man sich eine Freundschaft mit Gott vorstellen kann, welche die mit der Gnadengabe geschaffene Asymmetrie zu resymmetrisieren imstande ist. Die Liebe des Menschen hat ein janusköpfiges Gesicht: Zum einen ist sie geprägt durch ein Streben nach der Vereinigung mit Gott; einem Streben, das zwar ohne die Tatkraft des Menschen, nicht aber ohne dessen Zustimmung hervorgerufen wurde. Lieben heißt hier, Gott als Objekt übernatürlicher Glückseligkeit zu erleben. Mit diesem Erleben Gottes erwirbt der Mensch zugleich auch einen latenten Willen zum Guten, der nur auf Gelegenheiten wartet, sich im Tätigsein zu verwirklichen. In diesem Sinne meint Lieben zum anderen auch ein Handeln, das den Entscheidungen des Menschen unterliegt und von daher seiner Verantwortung zugerechnet werden kann. Warum sucht nun aber diese Liebe gerade im Mitmenschen nach Gelegenheiten, sich in die Tat umzusetzen? Bei allen Unterschieden, die zwischen den Menschen bestehen, sind sie sich doch darin ähnlich, dass jeder Einzelne von ihnen nicht ohne die Schöpfung Gottes sein könnte und somit das Ebenbild Gottes in sich trägt. Da also jeder aus der Gutheit Gottes entsprungen und damit selbst gut ist, und da das Wesen des Guten eben darin besteht, sich mitzuteilen, muss es das Gebot eines jeden Christen sein, seinen Nächsten zu lieben, d.h., ihm Gutes zu wollen. Die Liebe zu sich selbst bildet dabei den Maßstab, an dem sich die Liebe zum Nächsten zu orientieren hat. „Wenn jemand einen liebt mit der Liebe der Freundschaft“, so Thomas von Aquin, „so will er ihm Gutes, wie er auch sich selbst Gutes will. Mithin faßt er ihn als sein anderes Ich, sofern er ihm Gutes will wie auch sich selbst.“327 Das Urbild/Abbild-Verhältnis, das die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen charakterisiert, findet sich hier auf die Beziehungen zwischen den Menschen übertragen. Alter kann demnach für Ego nur deshalb zu einem alter Ego werden, weil er ihn als ein Ebenbild seiner selbst annimmt. An anderer Stelle konkretisiert dann Thomas von Aquin den Anlass der Liebe, wenn er schreibt: „Der Grund aber, den Nächsten zu lieben, ist Gott; denn das müssen wir im Nächsten lieben, daß er in Gott sei. Daher ist es klar, daß der Akt, mit dem wir Gott lieben und mit dem wir den Nächsten lieben, ein und derselben Art ist. Und deshalb erstreckt sich das Gehaben der heiligen Liebe nicht nur auf die Liebe zu Gott, sondern auch auf die Liebe zum Nächsten.“328 Die tätige Liebe realisiert sich dabei immer von oben nach unten, sie neigt sich herab auf denjenigen, der einer guten Tat bedarf.329 Sie hat somit als Voraussetzung, „daß es ein Hohes und Tiefes gibt, daß nicht nur der absolute und nicht 327 328 329 S. th. I-II, q. 28,1. AQUIN, Thomas von: Summa Theologica. Übers. von Dominikanern u. Benediktinern Deutschlands u. Österreichs. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg. II. Teil des II. Buches. Bd. 17a Die Liebe. Graz / Wien / Köln 1955, q. 25,1. Hierin unterscheidet sich die christlich-mittelalterliche Liebe von der antiken Vorstellung einer emporstrebenden Liebe, die allein durch einen Drang nach einem höheren Gut bestimmt wird. Vgl. SCHOLZ, Heinrich: Eros und Caritas. Die platonische Liebe und die Liebe im Sinne des Christentums. Halle 1929. 135 überbrückbare Gegensatz zwischen Gott-Mensch vorhanden ist, sondern daß auch innerhalb der Welt Niveauunterschiede bestehen, die nicht überbrückbar sind.“330 Die Liebe Gottes liefert dabei letztlich das Modell, das der Mensch zu imitieren hat, um sich seinem Schöpfer ähnlich zu machen. Indem er die Liebe, die er von Gott empfangen hat, seinem Mitmenschen weitergibt, schenkt er sie Gott zurück und bestätigt sich damit in seiner eigenen Gutheit. Nicht die Beobachtung des alter Ego als Subjekt, das über ein ihm eigentümliches Welterleben verfügt, steht hier im Vordergrund, stattdessen wird Alter als Armer, Kranker, Leidender entindividualisiert und zum hilfsbedürftigen Objekt generalisiert, an dem Ego sein eigenes Selbst – genauer: das Selbstbildnis Gottes in sich – zu verwirklichen vermag, und zwar allein dadurch, dass er Gutes tut.331 Der Selbstreferenz, mit der sich Ego zu seinem eigenen Wesen in Distanz setzt, haftet dabei immer auch die Möglichkeit an, die eigene Gutheit zu korrumpieren. Im Mittelpunkt der mittelalterlich-theologischen Reziprozitätsvorstellungen steht also die Nachbildung der Liebe Gottes durch den Menschen. Am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts mehren sich jedoch die Stimmen, die eine Kritik an diesem Ideal, das dem Menschen als Subjekt nur wenig Beachtung schenkt, äußern. Bei dem spanischen Humanisten Juan Luís Vives wird das Gebot, Gott auf Erden nachzuahmen, geradezu in sein Gegenteil verkehrt. Vives zeichnet das Bild eines vergangenen Goldenen Zeitalters, in dem jeder Mensch – ausgestattet mit Gesundheit, Verstand und Tugend – als Individuum über die Fähigkeiten verfügte, mit Gott in eine Gemeinschaft zu treten. Diese Befähigung ging ihm allerdings verloren, als er damit begann, so sein zu wollen wie Gott. Als Folge dieser egoistischen Selbstliebe (amor sui) büßte er nicht nur seine Begabung ein, das Göttliche zu erkennen und seine Leidenschaften der Vernunft zu unterwerfen. Bei der Erlangung seines Glücks sah er sich von nun an zudem auf die Hilfe seiner Mitmenschen verwiesen. „So ist der ganze Mensch innerlich und äußerlich hilfsbedürftig geworden; das ist der gerechte Lohn für sein Unterfangen, Gottgleichheit zu beanspruchen. Die Selbstüberschätzung des bevorzugtesten Wesens scheiterte, so dass es nichts Schwächeres und Hilfloseres gibt. Sein ganzes Leben und Wohlbefinden hängt von fremder Hilfe ab, zum einen um die Wurzel der Überheblichkeit, die von den Urvätern auf die Nachkommen vererbt wird, zu unterdrücken, zum anderen im Einzelfall durch Gottes verborgenen Plan, dass den einen das Geld fehlt, den anderen, die nicht damit umgehen können, der gesunde Menschenverstand. Manchen hilft die Bedürftigkeit, große Tugenden zu entwickeln.“332 Um den Verlust seiner gottgege330 331 332 FÜRTH, Caritas und Humanitas (wie Anm. 324), S. 63. Max Scheler hat entsprechend darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zu antiken Vorstellungen es in der christlichen Liebesidee keine Liebe zum ‚Guten’ schlechthin gibt, sondern die Liebe selbst Träger des Wertes gut ist. Vgl. SCHELER, Max: Wesen und Formen der Sympathie. Bern / München 1973, S. 164 ff. VIVES, Juan Luis: Über die Unterstützung der Armen – De subventione pauperum für die Stadt Brügge (1526). In: STROHM, Theodor / KLEIN, Michael (Hg.): Die Entstehung einer sozialen Ordnung Europas. Historische Studien und exemplarische Beiträge zur Sozialreform im 16. Jahrhundert. Bd. 1. Heidelberg 2004, S. 282-339, hier S. 286 136 benen Fähigkeiten und seine damit einhergehende Unvollkommenheit kompensieren zu können, muss sich der gefallene Mensch in sozialen Ordnungsformen zusammenfinden (Ehe, Haushalt, politische Gemeinschaft). Mit dem Sündenfall schlägt, so lässt sich Vives’ Sichtweise pointiert resümieren, die Geburtsstunde der Gesellschaft.333 Der Mensch sieht sich schlagartig mit einer Vielzahl von Bedürfnissen konfrontiert, zu deren Befriedigung er auf die Hilfe seines Gegenübers angewiesen ist.334 Erst dank des kooperativen Miteinanders in der Gemeinschaft, in der das Geben seliger erscheint als das Nehmen,335 bekommt er Mittel an die Hand gegeben, sich der Vollkommenheit Gottes, der absoluten Bedürfnislosigkeit, wieder zu nähern. Allerdings ist ihm auf dem Weg zu Gott eine ungewisse Zukunft beschieden, da er sich letztendlich in einem auf der Basis von Aufrichtigkeit und Treue funktionierenden Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten und Bindungen wieder findet. Jedes soziale Zusammenleben ruht in dem reziproken Geben und Nehmen von Wohltaten, in der Liebe des Individuums zu seinem Nächsten.336 Es ist also nicht so sehr die Kontemplation, sondern die Praxis, nicht so sehr die Imitation Gottes, sondern die Jesu Christi, dessen Leben und Wirken die Gottebenbildlichkeit des Menschen im vollkommensten Maße realisiert hat, die Vives als das höchste Ziel des menschlichen Daseins ausmacht. „So greift Liebe und Gemeinschaftsgefühl allmählich um sich und dringt nach außen. Indem einer dem anderen durch Dienste und Entgegenkommen verpflichtet ist, bleibt die Liebe nicht mehr nur im Herd eingeschlossen, sondern durch die Wohltat angeregt, entwickelt sie Dankbarkeit, und wenn ihr eine Gefälligkeit erwiesen wird, versäumt sie es nicht, sie zu erwidern. Denn die Natur verabscheut nichts mehr als einen undankbaren Sinn; selbst wilden Tieren wie Elefanten, Löwen, Schlangen, hat sie ein Gefühl für Dankbarkeit, eine gewisse Erinnerung an Wohltaten mitgegeben.“337 Insoweit jedes Wohlwollen Wohlwollen hervorbringt und damit das Zusammenleben veredelt, entwirft Vives einen Steigerungszusammenhang, der letztlich in einer arbeitsteiligen, das Paradies im Diesseits bereits vorwegnehmenden Gesellschaftsordnung gipfelt. Indem Vives das weltliche Leben auf die Grundlage eines moralischen Verpflichtetseins stellt, sich durch ein Wohlwollen wechselseitig 333 334 335 336 337 Vgl. dazu ausführlich FERNÁNDEZ-SANTAMARÍA, José Antonio: The Foundations of Vives’ Social and Political Thought. In: MESTRE, Antonio (Hg.): Opera Omnia. Volumen Introductiorio. Valencia 1992, S. 217-262. Nach Winfried Schulze finden sich erste Ansätze, die Vergesellschaftung von Individuen auf die wechselseitige Befriedigung ihrer Bedürfnisse zurückzuführen, nicht erst bei liberalistischen Autoren wie Bernhard Mandeville und Adam Smith, die Wurzeln dieses Gedankens reichen vielmehr bis ins 16. und 17. Jahrhunderts zurück. Vgl. SCHULZE, Winfried: Vom Gemeinnutz zum Eigennutz. Über den Normenwandel in der ständischen Gesellschaft der Frühen Neuzeit. In: Historische Zeitschrift 243 (1986), S. 591-626. Vives hat sich dementsprechend gegen die Forderung der Wiedertäufer gewandt, die Gesellschaftsordnung sei auf einem Gemeineigentum zu gründen. Eine Gemeinschaft, deren Mitglieder sich ihrer gegenseitigen Liebe gerade im Geben bezeugen, bedarf des Eigentums, will sie nicht zu einer Gemeinschaft von Nehmern verkommen. Denn: „Die frumbsten pflegen am liebsten zugeben / dagegen ye lieber einer nimt / ye ärger er ist.“ Vgl. VIVES, Juan Luis: Von der Gemeynschaft aller Dingen (übers. von Jacob Kammerlandern). Strassburg 1536, S. 11. VIVES, De subventione pauperum (wie Anm. 333), S. 339. Ebd., S. 284. 137 nützlich zu sein, spricht er dem Menschen die Freiheit zu, nicht nur Gutes zu tun, sondern auch Gutes zu bewirken und sich aus dem Zustand der Sünde zu erlösen. Seinen Nächsten gilt es dabei nicht mehr als Abbild der Liebe Gottes zu lieben, sondern weil er wie man selbst Mensch ist und damit in Not geraten und der Sünde verfallen kann. Und es ist nicht mehr dessen sozialer Status, der dem Helfenden gebietet, durch gute Werke der Liebe Gottes gerecht zu werden, sondern dessen individuelle Lebenslage, welche die Eintracht und Harmonie des sozialen Zusammenlebens gefährdet. Neben dem allgemeinen Gebot Gottes, anderen zu helfen, und neben der Angst jedes Einzelnen, eines Tages selbst auf Hilfe angewiesen zu sein, geht Vives von einem inneren Trieb des Menschen zum Helfen aus. Das Helfen ist „in die menschliche Brust eingepflanzt“338, es vermag auf diese Weise in ihm ein Lustgefühl zu wecken, dessen er sich erinnern kann und das ihn dazu bewegt, immer dann, wenn ein Mensch Hilfe bedarf, zu helfen. Durch den eudämonistischen Charakter der Hilfe wird der Antrieb, seinem Mitmenschen Beistand zu leisten, offenkundig von den objektiven Gegebenheiten moralischer Kriterien losgelöst und in das Subjekt verlagert, das seine Handlungen von der Reflexion seiner Gefühlsregungen abhängig macht. Der politischen Obrigkeit fällt dabei lediglich die Aufgabe zu, überall dort, wo sich aufgrund der menschlichen Neigung zum Laster dieses soziale System wechselseiger Hilfe nicht realisiert findet, steuernd einzugreifen und durch die Erziehung des Menschen zum Gutsein eine auf christlicher Nächstenliebe beruhende soziale Ordnung zu installieren. Im Humanismus war die Einheit von Individuum und Gesellschaft noch durch eine menschliche Natur verbürgt, die lediglich der zusätzlichen Bildung bzw. Erziehung bedarf, um ihr Potential zum Guten auch tatsächlich zu realisieren. Dieser Glaube an das Gute im Menschen, das sich in den interpersonalen Beziehungen zur Geltung bringt, um auf diese Weise einer Sozialordnung Stabilität zu verleihen, wird in der Reformation grundsätzlich infrage gestellt. Im Gegensatz zur theologischen Anthropologie des Mittelalters mit ihrer Unterscheidung von imago und similitudo vertritt Luther die Auffassung, dass der Mensch mit dem Sündenfall seine ursprüngliche Natur und Gottebenbildlichkeit gänzlich verloren hat.339 Was ihm von dieser bleibt, ist lediglich ein gewisser ‚Rest’, der ihn zur Herrschaft über die Tier- und Pflanzenwelt befähigt. Seine Natur aber ist schlecht und durch die Sünde verdorben. Angesichts dieser Verdorbenheit seiner Natur hält es Luther für vermessen, dem Menschen die Befähigung zuzusprechen, Gott in seiner Liebe zu imitieren, denn: „Amor Dei non invenit sed creat suum diligibile, Amor hominis fit a suo diligibili.” [„Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe des Menschen 338 339 Ebd., S. 290. Vgl. HOFFMANN, Adolf: Zur Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen in der neueren protestantischen Theologie und bei Thomas von Aquin. In: SCHEFFCZYK, Leo (Hg.): Der Mensch als Bild Gottes. Darmstadt 1969, S. 292-327. 138 entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet.“]340 Sie setzt als ihre Ursache also ein Objekt und Gut voraus, von dem sie angezogen wird und das sie in ihren Besitz nehmen will, während das Wesen der Liebe Gottes gerade darin besteht, aus dem Nichts etwas Gutes hervorzubringen. Eine solche selbstlose Liebe, wie sie Gott zu eigen ist, bleibt dem Menschen verwehrt, da dieser nur das begehren kann, was ihm einen Vorteil verspricht und für ihn einen Wert hat. Nicht in sich selbst, so kritisiert Luther die scholastische Anthropologie, sondern allein in Jesu Christi vermag der Mensch das Bild zu finden, das ihn der Perfektion und Liebe Gottes näher bringt. Kraft des Lebens und der Worte Jesu Christi wird er in die Lage versetzt, seine sündhafte Natur zu erkennen und sich zu dieser vor Gott zu bekennen. Anstatt zur Selbstliebe und Selbstvervollkommnung fordert Luther den Christen zum – überspitzt formuliert – ‚Selbsthass’ auf, der sich nicht durch gute Werke und das Befolgen moralischer Gebote, sondern einzig und allein durch ein Vertrauen in die Güte Gottes schmälern lässt. Erst durch den Glauben an eine Zukunft, in der das im Leben Christi angekündigte Heil auch für ihn als Sünder in Erfüllung geht, tritt der Mensch zu Gott in eine Beziehung, die ihrer sozialen Asymmetrie adäquat erscheint. Der Glaube umfasst dabei weitaus mehr als den bloßen Erkenntnisakt eines für sich schon im Sein stehenden Vernunftwesens, das die Offenbarungslehre als wahr anerkennt. Vielmehr ist er eine „Antwort auf eine Kommunikation“341, die den Menschen erst zum Subjekt macht, indem sie ihn dazu auffordert, als Sünder auf seine zukünftige Erlösung zu vertrauen. Warum sollte er aber diese Kommunikationsofferte annehmen und sich der Unsicherheit der Zukunft aussetzen, wenn ihm gleichzeitig doch die katholische Kirche eine Welt verheißt, die bereits im Diesseits genügend Gelegenheiten bereithält, etwas für die Gewissheit des künftigen Seelenheils zu tun? Jede Ablehnung der Kommunikationsofferte gründet Luther zufolge in einem Zweifel an der Gnade Gottes und ist somit Ausdruck von Sünde und Unglauben. Wahrscheinlich wird die Annahme der Kommunikation erst, wenn der Mensch seine sündhafte Natur erkennt und Gott Vertrauen schenkt, ihm also unterstellt, die mitgeteilte Information bewusst an seinem Erleben ausgerichtet zu haben. Die Freundschaft, in dem die mittelalterliche Theologie die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen verankert sah, wird hier durch das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium Glauben substituiert, das an die Stelle des Verhaltensprinzips der Reziprozität die in der Kommunikation erfolgende Kopplung von Selektion und Motivation treten lässt.342 Die Selektion Gottes, seine Liebe in der Gestalt Jesu Christi mitzuteilen, stellt sich dem 340 341 342 LUTHER, Martin: Disputatio Heidelbergae habita (1518). In: KÖPF, Ulrich (Hg.): D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Bd. 1. Schriften der Jahre 1518-19. Weimar 1966 [ND Weimar, 1883], S. 353-374, hier S. 365. LUHMANN, Niklas: Die Ausdifferenzierung der Religion. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie moderner Gesellschaften. Bd. 3. Frankfurt (Main) 1989, S. 259-357, hier S. 318. Zum Glauben als symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium vgl. LUHMANN, Niklas: Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt (Main) 2000, S. 205 f. Man kann diesen Wandel bei der Lösung des Problems der dop- 139 Menschen dabei nicht nur als ein innerpsychisches Motiv dar, auf seine Gnade zu vertrauen, sie wird ihm auch zur Aufgabe, seinen Nächsten zu lieben. Die Liebe Gottes ist, mit anderen Worten, nicht nur eine Technik der Umweltveränderung, die auf die Umgestaltung der Bewusstseinsstrukturen des Gläubigen abzielt, sie fordert von diesem zugleich auch eine Fortsetzung der Kommunikation. Auffällig dabei ist zunächst, dass die Nächstenliebe hier als eine Kommunikation begriffen wird, deren emergente Eigenschaften durch das Individuum selbst nicht zu beeinflussen sind. Das Individuum kann sich zwar ihrer bedienen, es ist aber nicht der eigentliche Akteur der Nächstenliebe. Luther geht vielmehr davon aus, „that God uses man as the ‚instrument’ or ‚medium’ of his love. Man himself cannot love, but he can receive God’s love and pass it on to his neighbor. Though faith increases and facilitates man’s receptivity, God’s love does not require it.“343 Erst dank der Liebe Gottes kann der Gläubige die selbstsüchtige, den eigenen Vorteil im Blick habende menschliche Liebe überwinden und dem Nächsten das zukommen lassen, woran dieser als Sünder leidet. Im Gegensatz zur Caritas der mittelalterlichen Theologie muss den guten Werken damit zwar ihre unmittelbare Bewandtnis für das individuelle Seelenheil abgesprochen werden, insofern in ihnen aber die Verheißungen Christi – eines Lebens der selbstlosen Liebe – gegenwärtig sind, eröffnen sie dem Gläubigen die Möglichkeit, sich der Liebe Gottes zu vergewissern. Gerade weil sich der Mensch prinzipiell außerstande sieht, die Absichten Gottes in der Welt zu erkennen, bedarf er eines inneren Orientierungspunktes, der ihm Auskunft über die Werthaftigkeit seines Verhaltens gibt. Das, was Gott für den Menschen ist, ist er nur durch den Glauben, denn indem er glaubt, ist er mit Gott, gleichwohl diese durch den Glauben verursachte Vergottung des Menschen nicht missverstanden werden darf als ein Prozess der Angleichung, an dessen Endpunkt die Verschmelzung des Glaubenden mit seinem Objekt steht. Anders als in der scholastischen Theologie kommt dem Glauben bei Luther ein solches transformierendes Potential nicht zu. Er macht den Glaubenden nicht zu einem Anderen als er vorher war. Seiner Natur nach bleibt der Mensch auch weiterhin ein Sünder, obgleich ihm sein Glaube die subjektive Gewissheit gibt, ein Bürger des Reich Gottes zu sein. Die Zugehörigkeit zu diesem Reich der durch Jesu Christi Gerechtfertigten ist dem Menschen also nicht schon von Natur aus gegeben, sie hängt vielmehr von dessen freiwilligen Entscheidung ab, an die Gnade Gottes zu glauben und durch den Dienst am Nächsten sein weltliches Amt zu erfüllen.344 Durch seine guten Werke ver- 343 344 pelten Kontingenz auch als eine „Entritualisierung der christlichen Religion“ beschreiben, so DINKEL, Christoph: Der Glaube als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. In: Soziale Systeme 7 (2001), S. 56-70, hier S. 60. Zur Auflösung des Verhaltensprinzip der Reziprozität zwischen Gott und dem Menschen bei Calvin vgl. DAVIS, Natalie Z.: Die schenkende Gesellschaft. Zur Kultur der französischen Renaissance. München 2002, S. 165 ff. SINGER, Irving: The Nature of Love. Bd. I. From Plato to Luther. Chicago / London 1984, S. 329. Zur Zwei-Reichen-Lehre bzw. Zwei-Regimenten-Lehre vgl. LUTHER, Martin: Von weltlicher Oberkeyt, wie weyt man yhr gehorsam schuldig sei (1523). In: KÖPF, Ulrich (Hg.): D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Bd. 11. Nachtr. zu den Predigten und ungedr. Schriften des Jahres 1523. Weimar 1966 [ND Weimar, 1900], S. 245-281. 140 mag er dabei keineswegs die soziale Asymmetrie, die zwischen ihm und Gott besteht, zu resymmetrisieren. Wer anderen Gutes tut und an dem eigenen Glauben teilhaben lässt, der gibt auf der einen Seite Auskunft über seine innere Einstellung, sein Vertrauen auf Gott, der erwartet auf der anderen Seite aber auch, dass seine Adressaten in Momenten des Unglaubens in ihm Christus erleben und zur Grundlage ihres Verhaltens machen.345 Die Funktion der religiösen Kommunikation, „die Bestimmbarkeit allen Sinnes gegen die miterlebte Verweisung ins Unbestimmbare“346 zu garantieren, wird hier nicht mehr in die Hände einer zahlenmäßig kleinen klerikalen Elite gelegt, die über die richtige Auslegung der Heiligen Schrift wachen. Das geistliche Regiment, von dem Luther spricht, zielt vielmehr auf die Hervorbringung einer Glaubensgemeinschaft, in der das Erleben Egos das Erleben Alters konditioniert und von der all jene Personen auszuschließen sind, die in ihrem Unglauben nur durch eine äußere Macht, ein weltliches Regiment, gezähmt werden können. Das weltliche Regiment dient allein dem Schutz der Rechtschaffenden, indem es jenen mit Strafe droht, die gegen die Gebote Christi aufbegehren. Nicht Wohlwollen und Erziehung, sondern Glaube und Unterwerfung bedarf es, so Luther, um eine Sozialordnung christlichen Gepräges entstehen zu lassen. 3.4.2 Die sozialintegrative Funktion des Eigeninteresses Je mehr das Individuum in seiner Besonderheit und als Letztinstanz aller Erkenntnis zum eigentlichen Bezugspunkt sozialphilosophischer Überlegungen hypostasierte, umso mehr verlor die traditionelle Auffassung eines automatischen Zusammenfallens des Eingebundenseins in die Sozialität bei gleichzeitiger Vollendung der eigenen Natur an Plausibilität. Und je mehr der Mensch in seiner Natur aus einer gottgegebenen kosmologischen Ordnung entlassen und in seiner Selbstbezüglichkeit entdeckt wurde, umso drastischer musste die Brisanz interpersonaler Beziehungen zutage treten. Im Übergang zur Moderne erhebt sich das Subjekt zu einer „’jedermann’Qualität“,347 die den Interaktionspartner im wechselseitigen Umgang nicht nur als ein undurchschaubares Erkenntnisobjekt kennzeichnet, sondern diesem gleichermaßen unterstellt, seinerseits subjektiv den Zugang zur Welt zu organisieren. Die Vorstellung, dass voneinander getrennt Existierende sei in der Freundschaft miteinander zu verschmelzen, wird unter diesen Umständen zwar nicht gänzlich negiert, aber doch in ihrer Unwahrscheinlichkeit erkannt. Nachdrücklich kommt diese neue Sichtweise bei Montaigne zum Ausdruck, der die Frage nach den Beweggründen sei345 346 347 Vgl. KÄRKKÄINEN, Veli-Matti: The Christian as Christ to the Neighbour. On Luther's Theology of Love. In: International Journal of Systematic Theology 6 (2004), S. 101–117. LUHMANN, Religion der Gesellschaft (wie Anm. 343), S. 127. LUHMANN, Ordnung (wie Anm. 216), S. 238. 141 ner engen Freundschaft zu La Boëtie mit der knappen, aber vielsagenden Aussage beantwortet: „[…] weil er es war, weil ich es war.“348 Bei Montaigne sieht sich die Freundschaft strikt von anderen sozialen Beziehungsformen, wie sie etwa zwischen Eltern und ihren Kindern oder in der Ehe vorzufinden sind, unterschieden. Sie gilt ihm nicht mehr als das allgemeine Vergesellschaftungsprinzip, auf dem eine jede Gemeinschaft gründet und das an der Vervollkommnung des Menschen teilhat. Gerade weil sie allein im spontanen Erleben der Seelenverwandtschaft des Freundes erfahrbar wird, sie also gänzlich ohne Ziele und Zwecke auskommt, steht sie im schroffen Widerspruch zu allen anderen Formen des sozialen Miteinanders. Seit dem 17. Jahrhundert gewinnt schließlich die bereits bei Montaigne sich ankündigende Entwicklung, die Freundschaft zu privatisieren und die Liebe für intime, das Individuum als ganze Person in den Blick nehmende Sozialbeziehungen zu reservieren, endgültig an Fahrt.349 Zur gleichen Zeit wird das bis dato vornehmlich im juristischen Fachjargon zur Bezeichnung von Schadensersatzforderungen und Zinsen verwendete Interesse aus seinem begrenzten Anwendungsgebiet herausgelöst und zu einem grundlegenden Motiv menschlichen Handelns generalisiert.350 Die Bedeutungsverschiebungen, welche die Semantik des Interesses im 17. Jahrhundert an Aufmerksamkeit gewinnen lassen, mögen durch sozialgeschichtliche Entwicklungen wie die Glaubensspaltung, die politische Territorialisierung, die Diffusion des Adels durch das Bürgertum wie auch den 30jährigen Krieg und den Siegeszug der Geldwirtschaft vorangetrieben worden sein. Aber wie auch immer man nun versucht, das Auftauchen seiner neuen Bedeutungsinhalte aus der Retrospektive zu erklären, was sich mit dem Interesse abzeichnet, ist die Hinwendung zu einer Semantik, die ihren Ausgang in einer Beobachtung zweiter Ordnung nimmt. Im Vordergrund steht jetzt nicht mehr die Frage nach der Tugendhaftigkeit eines Verhaltens, welches sich anhand objektiver Kriterien bemessen lässt. Vielmehr geht es darum, zu zeigen, wie sich in sozialen Beziehungen Erwartungssicherheiten verfestigen können, obwohl die an ihnen beteiligten Personen ihren Zugang zur Welt rein subjektiv gewinnen und infolgedessen die vormals in der kosmologischen Ordnung verbürgte Kongruenz von Selbst- und Fremdwahrnehmung an Evidenz verliert. Warum also verhält sich eine Person so, wie sie sich verhält, wenn ihr gleichzeitig doch immer auch andere Verhaltensmöglichkeiten offen stehen? Und die Lösung dieses Problems sozialer Ordnung lautet nun: Weil sie mit ihrem Verhalten eigene Interessen verfolgt! 348 349 350 MONTAIGNE, Michel de: Von der Freundschaft. Wiesbaden 1960, S. 14. Vgl. LUHMANN, Liebe als Passion (wie Anm. 304). Vgl. zur Begriffsgeschichte ORTH, Ernst Wolfgang / FISCH, Jörg / KOSELLECK, Reinhart: Interesse. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhart (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 3. Stuttgart 1982, S. 305-365; GERHART, V.: Interesse. In: RITTER, Joachim / GRÜNDER, Karlfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 4. Basel / Stuttgart 1976, Sp. 479-494; NEUENDORFF, Hartmut: Der Begriff des Interesses. Eine Studie zu den Gesellschaftstheorien von Hobbes, Smith und Marx. Frankfurt (Main) 1973; HIRSCHMAN, Albert O.: Leidenschaften und Interessen. Politische Begründungen des Kapitalismus vor seinem Sieg. Frankfurt (Main) 1987. 142 Das Interesse nimmt eine Art Vermittlungsfunktion zwischen den seit der griechischen Philosophie unterschiedenen Handlungsmotiven der Leidenschaft und Vernunft ein.351 Es versorgt die Leidenschaften mit Rationalität und Kalkül, die Vernunft dahingegen mit einer auf der Eigenliebe des Menschen beruhenden inneren Kraft. Die soziokulturelle Tragweite der Semantik des Interesses liegt dementsprechend darin begründet, dass mit ihr „eine reflexive Vermittlung zwischen dem Subjekt und seiner Umwelt als unmittelbares Motiv des Handelns gesetzt wird.“352 Sie umschreibt, mit anderen Worten, die Reflexionsleistung eines Subjekts, das einen Weltbezug herstellt, indem es die Differenz von Subjekt und Objekt in sich wiederholt, um sich auf diese Weise jener Mittel zu vergegenwärtigen, die es zur Behebung eines am eigenen Selbst erfahrenen Mangels bedarf. Ein Interesse kann sich dabei sowohl auf eine Sache als auch auf eine Person richten, von der man ein Verhalten erwartet, das den eigenen Wünschen und Zielen entspricht. Auf der Beschreibungsebene interpersonaler Beziehungen setzt sich mit dem Interesse eine Semantik durch, die sich strikt von der Einheit und Vereinigung implizierenden Kraft der Liebe distanziert. Es geht nicht mehr um die Herstellung zeitbeständiger Bindungen bzw. die körperliche oder seelische Verschmelzung von Personen, die als Teile eines übergeordneten Ganzen von Natur aus ähnlich und aufeinander verwiesen sind. Ganz im Gegenteil: „Das Interesse ist das Trennende, das was jeder für sich und nicht mit allen gemeinsam hat.“353 Eben weil es sich nicht mehr durch eine Liebe Gottes verursacht sieht, durch die der Mensch in seinen Affekten wie auch in seiner Vernunft berührt und zu guten Taten bewegt wird, bleibt das Interesse allein den Motiven und Antrieben verhaftet, mittels derer das Individuum in einer jeweiligen Gegenwart seinen Zugang zur Welt rein subjektiv bestimmt. Der rasante Aufstieg der Semantik des Interesses liegt in dessen Potential begründet – und zwar unabhängig von den Ausgestaltungen, die sie historisch erfährt – einen Bezugspunkt anzubieten, der eine Beständigkeit im Handeln suggeriert, ohne dabei noch auf einen teleologischen Aufbau der Welt, einem letzten Ziel aller Bewegungen, rekurrieren zu müssen. Es setzt sich in Distanz zu den Seinsqualitäten der Welt, denen man sich durch ein moralisches Verhalten anzunähern versucht, und trägt damit dem Bewusstwerden einer zunehmenden gesellschaftlichen Dynamik Rechnung. Gerade weil das Interesse stets die durch die Situation gegebenen Möglichkeiten kalkuliert und die in ihnen begründeten Chancen für den eigenen Nutzen antizipiert, werden die Verhaltensweisen im interpersonalen Kontakt berechenbar und vorhersagbar. Die Semantik des Interesses reagiert damit auf ein Welterleben, in dem die Evidenzen und Einheitsvorstellungen des theologischen Weltbildes zu verblassen beginnen. Sie propagiert demgegenüber einen Empirismus, der die Handlungssicherheiten in die Gegebenheiten einer 351 352 353 Ebd., S. 55. NEUENDORFF, Der Begriff des Interesses (wie Anm. 351), S. 7. SPAEMANN, Robert: Reflexion und Spontaneität. Studien über Fénelon. Stuttgart 1990, S. 321. 143 jeweiligen Situation verlagert und sich damit von der Allegorie einer metaphysischen Verankerung von Sozialität in der Natur verabschiedet. In ihren Grundzügen finden sich diese neuen Bedeutungsinhalte des Interesses bereits bei Machiavelli im Kontext seiner Bemühungen um die Verbesserung der Staatskunst angelegt. Machiavelli geht von einer grundsätzlichen Differenz zwischen ‚Wahrheit’ und ‚Einbildung’ der Dinge, zwischen ‚Sein’ und ‚Sollen’ aus.354 Für die Staatskunst sieht er es als unabdingbar an, diese auf die Grundlage eines rationalen Kalküls zu stellen und damit den Fürsten in seiner Entscheidungsgewalt von den in der politischen Theorie seiner Zeit vorherrschenden moralischen Geboten und Tugendvorschriften zu entbinden. Das neuartige Verständnis des Interesses findet also ursprünglich im Modell der Staatsräson, einer von den sittlichen Normen losgelösten Machtpolitik,355 Eingang in die Selbstbeschreibungen der Gesellschaft. In Anlehnung an die Ideen der Staatsräson wird schon bald darauf zunächst in Frankreich, dann in England das Bild eines europäischen Staatenverbundes gezeichnet, dessen Stabilität auf den interdependenten Beziehungen der sich wechselseitig in ihren Eigeninteressen tolerierenden Staaten beruht.356 Störungen dieses Gleichgewichtsverhältnisses können nur dann entstehen, so lautet die Überzeugung jener Zeit, wenn in den bilateralen Übereinkünften die Interessen der jeweiligen Staaten unberücksichtigt bleiben. Es dauert dann noch eine geraume Zeit bis diese positive, den gemeinsamen Vorteil herausstellende Bewertung des Eigeninteresses auf das innenpolitische Verhältnis von Staat (societas civilis) und Untertan und schließlich auf das ökonomische Verhältnis zwischen den Bürgern selbst übertragen wird. Es geht dann nicht mehr um das Problem der Aufrechterhaltung einer Machtbalance zwischen in ihren Strukturen längst vorhandenen Staaten, sondern um die viel elementarere Frage, wie aus einer Vielzahl von ihren Eigeninteressen verpflichteter Individuen eine soziale Ordnung erwachsen kann. Die Entdeckung des Interesses als jenem Antrieb, der durch äußere Reize bedingt das soziale Handeln des Individuums bestimmt, verläuft parallel zu einer Entwicklung, in der Gesellschaftsbeschreibungen an Gewicht gewinnen, die den Menschen nicht mehr in einen Heilsplan göttlicher Absichten verorten, sondern sein Verhältnis zur umfassenden Sozialität zu problematisieren beginnen. Solange wie sich das Individuum als Teil der Gesellschaft in einen solchen 354 355 356 Machiavelli begründet seine entmoralisierte Sichtweise der Staatskunst damit, dass es ihm besser erscheint, „der Wahrheit der Dinge nachzugehen als der Einbildung von ihnen. Viele haben sich Republiken und Fürstentümer eingebildet, die sie niemals gesehen haben. Aber da in meinen Augen ein großer Unterschied zwischen dem besteht, wie man lebt und wie man leben sollte, so wird derjenige eher seinen Untergang erleben als seinen Erfolg, der das nicht beachtet, was wirklich geschieht und sich an das hält, was geschehen sollte. Ein Mensch, der sich in jeder Hinsicht für das Gute einsetzt, muß zugrunde gehen unter so vielen, die nicht gut sind. Deshalb muß ein Fürst, der sich behaupten will, lernen, nicht gut zu sein. Davon muß er Gebrauch machen, je nach Notwendigkeit.“ MACHIAVELLI, Nicollo: Der Fürst (Il Principe). Essen 2004, S. 79. Vgl. MEINECKE, Friedrich: Die Idee der Staatsräson in der neuren Geschichte. München 1924. Vgl. GUNN, J. A. W.: ‚Interest will not lie’. A seventeenth-century political maxim. In: Journal of the History of Ideas 29 (1968), S. 551-564. 144 Heilsplan eingebettet findet, folgen seine Handlungen dem einzigen Zweck, die auf den Willen Gottes beruhende Sozialordnung zu erhalten bzw. zur Geltung zu bringen. Alle Ständereflexionen mit ihren Zuteilungen von verschiedenen gesellschaftlichen Funktionen zielen zunächst auf diesen Aspekt sozialen Handelns ab. Doch markiert das 17. Jahrhundert diesbezüglich einen tief greifenden Wendepunkt, insofern nun offen der Gedanke einer aus den Erfordernissen der menschlichen Natur resultierende Sozialordnung artikuliert wird. Dieser neuen Sichtweise liegt eine Umkehrung des kausalen Begründungszusammenhangs von Natur und Sozialität zugrunde. Die Natur des Menschen erscheint hier nicht mehr in eine soziale Ordnung eingepasst, die dem göttlichen Willen entspringt, sie markiert vielmehr die Grundlage, von der aus die Regulierung des sozialen Zusammenlebens zu erfolgen hat. Es war insbesondere Thomas Hobbes, der mit seiner Lehre einer historischen Abfolge von Naturzustand und bürgerlichem Zustand am entschiedensten die Bahnen für eine derartige Problematisierung von Sozialität ebnete.357 Im Naturzustand begegnen sich die Menschen wie Tiere, alleine darauf bedacht, ihre natürlichen Begierden (cupiditas naturalis) zu befriedigen. In diesem Bestreben, das eigene Interesse vor Augen, sind alle Menschen mit den gleichen subjektiven Rechten versehen und von Natur aus gleich, auch wenn zwischen ihnen aufgrund ihrer natürlichen Anlagen unterschiedliche Voraussetzungen existieren, sich im Kampf ums Überleben durchzusetzen. Im Naturzustand, in dem ein Krieg aller gegen alle (bellum omnium contra omnes) herrscht, sehen sich die interpersonalen Beziehungen insbesondere durch den Überlebenstrieb der Individuen wie auch deren Furcht vor dem Anderen bestimmt. Es ist dieser unhaltbare Zustand des immerwährenden Krieges, aus dem erst die bürgerliche, zivilisierte Gesellschaft hervorgehen konnte, in der jeder Einzelne seine Rechte beschränkt und sich einem auf freie Konvention beruhenden Gesellschaftsvertrag unterwirft.358 Der bei Hobbes als ‚Leviathan’ auftretende Staat wird hier zum Garanten der Ordnung, welche die Lebenssphären der Gesellschaftsmitglieder in genaue Deckung mit den im Vertrag festgelegten Zielen bringt. Ganz entgegen der auf Aristoteles zurückgehenden und von der Scholastik nur in Nuancen abgewandelten Tradition, den Menschen als ein von Natur aus politisches bzw. geselliges Wesen zu betrachten, erkennt Hobbes die Triebkräfte, die zu einem solchen Zusammenschluss führen, in den kollektiven Nutzen- und Machtkalkülen der Individuen.359 Damit verabschiedet er sich von der Vorstellung, es gäbe so etwas wie eine in der Natur prädisponierte, auf den Willen Gottes 357 358 359 Vgl. vor allem Kapitel 13. Von der natürlichen Bedingung der Menschheit im Hinblick auf ihr Glück und Unglück in HOBBES, Thomas: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Frankfurt (Main) 2004, S. 94 ff. Nach Talcott Parsons besteht das besondere Verdienst von Thomas Hobbes darin, auf die Notwendigkeit der Verhaltenskoordination von miteinander interagierenden Individuen durch allgemeingültige Normen hingewiesen zu haben. Vgl. PARSONS, Talcott: The Structure of Social Action. Glencoe 1961, S. 97. Diese Sichtweise ist keineswegs mit der eines Juan Luis Vives gleichzusetzen. Denn Vives bleibt durchaus der Vorstellung verhaftet, der Zusammenschluss zu einer Gesellschaft sei dem Menschen durch den Willen Gottes vorgezeichnet, obgleich sie sich lediglich als die zweitbeste Möglichkeit darstellt, sich der Vollkommenheit Gottes zu nähern. 145 zurückführbare ideelle Ordnung der Gesellschaft, die mit der Konvention von Rechten und Gesetzen lediglich zur Realisation gelangt. Ausgehend von der Unwahrscheinlichkeit des Zustandekommens von Sozialität werden nun Erklärungen unumgänglich, die anzugeben imstande sind, unter welchen Bedingungen die Herstellung einer sozialen Ordnung überhaupt möglich erscheint. Vor dem Hintergrund dieses sozialen Erfordernisses hat sich die „Verständigung über das, was in diesem Zusammenhang Gesellschaft (societas, communitas) ist, gewandelt [...], und zwar in Richtung von natürlich-korporativer Einheit zu zweckmäßigem Zusammenschluß, von Einheit auf Kollektiv. Der Einheitsverlust wird insbesondere am Verlust der einheitlichen Kirche erfahren [...]. Nach dem Verlust der religiösen Füllung wird das Gemeinsame zur Rekonstruktion, und dafür gibt der Vertrag ein Sozialmodell. Ein Kollektiv von natürlich divergierenden Interessen wird dank erkennbarer Kompatibilitäten zusammengehalten, das koinón ist jetzt der größere Nutzen, der aus einer Aggregation der Interessen zu erwarten ist.“360 Als notwendige Bedingung sozialer Ordnung wird nun nicht mehr die Imitation einer in der Natur begründeten harmonischen Einheit des Differenten erachtet, der man sich über die Verteilung reziproker Rechte und Pflichten anzunähern versucht. Mit dem Gedanken des Kollektivs stellt sich vielmehr die Frage, wie auf der Grundlage durchaus heterogener und disparater Interessen ein homogenes Ganzes überhaupt erst entstehen kann. Der Vertrag scheint im Hinblick auf dieses Problem die angemessene Lösung bereitzuhalten. Er vermag die Ungleichheit der durch ihn aneinander gebundenen Personen sowohl zu überwinden als auch zu respektieren, indem er den Vertragsschluss auf dem freien Willen jedes Einzelnen gründet und eben darin das Moment ihrer Gemeinsamkeit erkennt. Egal wie sich die Ungleichheiten der Vertragspartner ansonsten äußern, durch die Entscheidung, ihre natürliche Freiheit zugunsten der im Vertrag festgelegten Verpflichtungen aufzugeben bzw. zu beschränken, werden alle Mitglieder des Kollektivs dazu angehalten, ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung des Ganzen und zur Erreichung des gemeinsamen Zwecks zu leisten. „Ein jedes Mitglied der Gesellschaft“, so liest man bei Christian Wolff, „ist also das zu thun verbunden, was es zur Erhaltung der Absicht thun kann und was insbesondere verabredet worden, daß es geschehen soll; folglich haben die Mitglieder der Gesellschaft das Recht einen der ein Mitglied ist, anzuhalten seiner Verbindlichkeit ein Gnügen zu leisten.“361 Der Vertrag schafft also die Möglichkeit, einen Bereich kollektiver Zwänge, in dem sich konforme und nonkonforme Verhaltensweisen voneinander scheiden lassen, von einem 360 361 LUHMANN, Ordnung (wie Anm. 216), S. 226. WOLFF, Christian: Grundsätze des Natur- und Völkerrechts worin alle Verbindlichkeiten und alle Rechte aus der Natur des Menschen in einem beständigen Zusammenhange hergeleitet werden. Königstein/Ts. 1980 [Halle, 1754], S. 614 f. 146 Bereich der natürlichen Freiheit abzugrenzen, der jenseits des gesellschaftlichen Zugriffs auf die Vertragspartner liegt.362 Unter Gesellschaft wird hier also ein Zusammenschluss von Menschen verstanden, denen der Entschluss gemein ist, zum Wohle aller Vertragspartner auf ihre natürliche Freiheit zu verzichten. Je nach Gestalt und Umfang des angestrebten Zwecks lassen sich dann verschiedene Formen der Gemeinschaft (Ehe, Hausgemeinschaft, societas civilis) voneinander unterscheiden. Die ‚societas civilis’ erscheint dabei als eine Gesellschaft zur Steigerung der Wohlfahrt – d.h. des körperlichen, geistigen und sittlichen Wohls – und Erhaltung der inneren und äußeren Sicherheit – der Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit nach innen (‚tranquillitas’) und die Bewahrung des Friedens nach außen (‚securitas’).363 Diese Zwecke werden keineswegs als Selbstzwecke des Staats formuliert, vielmehr zielen sie auf die Vervollkommnung des Einzelmenschen und letztlich der gesamten Staatengemeinschaft (‚civitas maxima’).364 Nur das, was der Wohlfahrt und Sicherheit des Staats förderlich ist, kann demnach auch im Interesse des Einzelnen sein. Gleichermaßen „muss die hohe Landes-Obrigkeit nicht allein auf ihr Interesse, sondern auch auf die Wohlfahrt der Unterthanen sehen [...].“365 Denn, darauf weist Christian Wolff mahnend hin, es sei eine folgenschwere „Staats-Maxime, dadurch Land und Leute verdorben werden, daß man das Interesse des Landes-Herrn von dem Interesse der Unterthanen trennet und als zwey wiedrige Dinge einander entgegen setzet.“366 Somit steht der Einzelne genauso wie seine Vertragspartner in der Pflicht, all seine Kräfte zur „Beförderung des gemeinen Bestens“367 anzuwenden; und „so sind sie in diesem Stücke nichts anders anzusehen als eine Person, und haben demnach ein gemeinschaftliches Interesse: folgends ist es der Natur einer Gesellschaft zuwieder, wenn man das Interesse des einen dem Interesse des andern, oder (welches gleichviel ist) die Wohlfahrt des einen der Wohlfahrt des andern entgegen setzen will. Und erhellet hieraus ferner, daß es unrecht sey, wenn einer in der Gesellschaft seine Wohlfahrt mit Hinansetzung oder wohl gar mit Nachtheile des andern suchen will.“368 Christian Wolff folgt in dieser Argumentation der politischen Theorie des Absolutismus, die Staat und Gesellschaft miteinander gleichsetzt und insofern keine Trennung von staatlichen und nichtstaatlichen Zwecken, von öffentlichen und privaten Interessen vorsieht. Privatheit wird dem Untertan einzig und allein im Bereich des Glaubens und der politisch unbedeutenden Ge362 363 364 365 366 367 368 Inwieweit sich die natürliche Freiheit durch den Gesellschaftsvertrag beschneiden lässt, ist dann eine Frage, die je nach Autor auf ganz unterschiedliche Art und Weise beantwortet wird. Vgl. WOLFF, Grundsätze des Natur- und Völkerrechts (wie Anm. 362), S. 996. In der ‚civitas maxima’ findet sich bei Christian Wolff die Idee des Gleichgewichts eines Staatenverbundes wieder. Die Mitglieder der ‚civitas maxima’ sind keineswegs einzelne Menschen, unter ‚civitas maxima’ ist vielmehr eine Vereinigung bzw. Gesellschaft von Staaten zu verstehen, denen jeweils die Verpflichtung obliegt, nach ihren Kräften das Wohl der Gesamtheit zu befördern. Vgl. ebd., S. 796 ff. WOLFF, Christian: Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Leben. Frankfurt (Main) 1971 [ND Halle, 1721], S. 581. Ebd. S. 582. Ebd., S. 3. Ebd., S. 4 f. 147 wissensfreiheit zugebilligt, ansonsten aber ist er der Öffentlichkeit des Staats preisgegeben.369 Dem Staat obliegt dabei die Aufgabe, in die heterogenen sozialen Lebenssphären steuernd einzugreifen und diese auf den letzten Endzweck der Gesellschaft hin abzustimmen. Aber genau an diesem Punkt, an dem die politische Theorie des Absolutismus den Staat und das Leben in der Gesellschaft identisch setzt, vollzieht sich Mitte des 18. Jahrhunderts ein tief greifender Bruch, der sich von England mit seinem liberalistischen Gedankengut ausgehend auf das europäische Festland ausweitet, um schließlich mit einer gewissen Zeitverzögerung seine gesellschaftspolitische Sprengkraft auch in Deutschland zu entladen. Mit dem Auseinandertreten von Staat und Gesellschaft macht sich ein Bewusstsein breit, das in der Politik und der Wirtschaft zwei autonome soziale Sphären erkennt, die eigenen Gesetzlichkeiten gehorchen.370 Als treibende Kraft des Zusammenhalts der commercial society wird nun die dem Menschen von Natur aus gegebene Neigung ausgemacht, über Tauschbeziehungen sich mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. Eine moralische Integration der Gesellschaft, wie sie von der christlich-abendländischen Tradition angemahnt wurde, erscheint vor diesem Hintergrund nicht mehr zwingend erforderlich – das große Thema Émile Durkheims. Wer zur Befriedigung eigener Bedürfnisse auf die Hilfe Anderer angewiesen ist, der wird diese vergeblich allein wegen ihres Wohlwollens erwarten können. „Er kommt viel eher zum Ziel, wenn er ihre Eigenliebe an seinem Vorteil interessieren und ihnen zeigen kann, daß es ihr eigener Nutzen ist, das für ihn zu tun, was er von ihnen fordert. Jeder, der einem anderen irgendein Tauschgeschäft anbietet, schlägt vor: Gib mir, was ich wünsche, und du wirst das bekommen, was du verlangst! […] Wir erwarten unser Essen nicht von der Wohltätigkeit des Fleischers, Brauers oder Bäckers, sondern davon, daß sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschlichkeit, sondern an ihre Eigenliebe und sprechen mit ihnen nie von unseren Bedürfnissen, sondern von ihren Vorteilen.“371 Bei Adam Smith sehen sich die Individuen in ihrem wechselseitigen Verhalten nicht mehr durch einen politischen Willen beschränkt, dem sie gerecht werden oder von dem sie abweichen können. Ihre sozialen Beziehungen werden vielmehr aus der Komplementarität ihrer Interessen abgeleitet. Soziale Ordnung stellt sich ein, wenn und soweit es Ego gelingt, eine seinen eigenen Vorteil dienliche Reaktion bei Alter durch die Befriedigung dessen Bedürfnisse erwartbar zu machen. Zu diesem Zwecke muss Ego sich nicht nur darüber im Klaren sein, ob von Alter Güter und Leis369 370 371 Eine begriffstheoretische und -geschichtliche Verortung der Begriffe ‚öffentlich’ und ‚privat’ leistet MOOS, Peter von: Die Begriffe „öffentlich“ und „privat“ in der Geschichte und bei den Historikern. In: Saeculum 49 (1998), S. 161-192. Vgl. dazu LUHMANN, Niklas: Die Differenzierung von Politik und Wirtschaft und ihre gesellschaftlichen Grundlagen. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen 1987, S. 32-48; LUHMANN, Niklas: Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen 1987, S. 67-73. SMITH, Adam: Eine Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Reichtums der Nationen. Bd. I. Berlin 1976, S. 21. 148 tungen zu erwarten sind, die er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt, er muss sich zudem in dessen Lage hineinversetzen, um seinerseits erwarten zu können, was Alter von ihm als Gegenleistung erwartet. Haftete dem Eigeninteresse lange Zeit der Beigeschmack des Illegitimen und Sozialschädlichen an, so erfährt es im Übergang zur Moderne einer allmählichen Aufwertung, insofern es sich geradezu zur Voraussetzung für die Herstellung und Erhaltung des Gemeinwohls erhebt. „Es ist eine ungezweifelte, aber vielleicht noch nicht genugsam erkannte Wahrheit“, so liest man bei Heinrich Gottlob von Justi, „daß das eigne Interesse das Band ist, welches die ganze Gesellschaft zusammen hält; und eine Gesellschaft darf nur frey seyn, und keiner in derselben eine Macht über dem andern haben; so wird eben dies eigne Interesse eine solche Richtung nehmen, und einen solchen Zusammenhang in dem gesamten Nahrungsstande hervorbringen, als zu dem blühenden Zustande desselben erfordert wird.“372 Analog zur ‚Invisible Hand’ Adam Smiths’ folgt bei Justi das Ineinandergreifen unterschiedlicher Interessen einer selbstregulativen Logik, die sich für die Verbesserung des allgemeinen Wohls verantwortlich zeichnet und dergestalt gesellschaftliche Harmonie bewirkt. Während die Steigerung der privaten Wohlfahrt vornehmlich den Tauschbeziehungen der einzelnen Bürger (bzw. Familien) überantwortet wird, fällt dem Staat lediglich noch die Aufgabe zu, mit der Gewährung von Rechtssicherheit und Schutz die Rahmenbedingungen für das freie Wirken individueller Interessen zu setzen und dabei darauf zu achten, dass es die „wahren“ und nicht die „irrigen und eingebildeten Interessen“373 sind, welche die Handlungen der Bürger leiten. „Allein die Menschen“, darauf hat in ähnlicher Weise Johann Friedrich von Pfeiffer hingewiesen, „werden mit Leidenschaften gebohren, deren einige durch eine aufgeklärte Eigennützigkeit der Gesellschaft nützlich, und andre durch ein blindes Interesse, durch eine grobe Unwissenheit geleitet, denen Gesellschaften und ihren Gliedern in allen Absichten schädlich sind. Diese Verschiedenheit der einander durchkreuzenden Leidenschaften, vermöge welcher ein jeder nur bemühet ist, den Gegenstand seiner Wünsche zu erreichen, ohne sich für jene zu interessiren, die sein Nebenmenschen zu befriedigen verlangt, störten die Ruhe und Einigkeit der kleinen Gesellschaften, und erzeugten innerliche Kriege, in welchen die Starken den Schwachen unterdrückten, oder die Listigen die Einfältigen verführten.“374 Unverkennbar wohnt dem Zitat ein Seitenhieb gegen das ganz und gar pessimistische Menschenbild eines Thomas Hobbes’ inne. Hatte der englische Staatstheoretiker und Philosoph noch auf die ordnungspolitische Notwendigkeit hingewiesen, die natürlichen Freiheiten der Individuen zugunsten des Leviathans zu opfern, gewinnen nun Gesellschaftsbeschreibungen an Plausibilität, die auf die größtmögliche 372 373 374 JUSTI, Heinrich Gottlob von: Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten, oder ausführliche Vorstellung der gesamten Policeywissenschaft, Bd.1. Aalen 1965 [ND Königsberg/Leipzig, 1760], S. 555. Ebd., S. 559. PFEIFFER, Johann Friedrich von: Grundsätze der Universal-Kameral-Wissenschaft. Aalen 1970 [ND Frankfurt (Main), 1783], S. 19 f. 149 Handlungsfreiheit der Individuen bauen.375 Und ließ Hobbes die mit der Gesellschaftsbildung einhergehende Willens- und Kräftevereinigung noch in einem Vertrag kulminieren, so taucht Ende des 18. Jahrhunderts immer häufiger die Vorstellungen auf, sie sei historisch gewachsen, sei das Resultat eines langwierigen Prozesses, in dessen Verlauf dem Menschen infolge seines Zugewinns an Vernunft die Vorteilhaftigkeit des Interessenausgleichs immer klarer vor Augen tritt. Die Sozialordnung der ökonomischen Gesellschaft erscheint nicht mehr als etwas objektiv Gegebenes, ein Monument, von dessen Erhabenheit der Vertrag ein Zeugnis ablegt. Ihre Prämissen wurzeln vielmehr im Innersten des Menschen selbst, der sie im Zuge der „Gewöhnung“376 internalisiert hat und gleichzeitig mit seinen Verhaltensweisen beständig erneuert. Mit dem Begriff der Gewöhnung klingt deutlich der Gedanke einer verinnerlichten Sozialordnung an, die dem institutionalisierten Recht mit seinen Sanktionsgewalten vorausgehen muss.377 3.4.3 Von der Tausch- zur Geldwirtschaft Mit der Verinnerlichung der Sozialordnung wird das Gemeinsame, auf dessen Basis sich soziale Beziehungen zu konstituieren vermögen, zum Bestandteil einer Rekonstruktion, die durch die an der Interaktion beteiligten Personen selbst vollzogen werden muss. Jedes Individuum definiert für sich seine ihm eigene Handlungssituation, indem es sich die Frage stellt, welche Verhaltensweisen notwendig sind, um eine erwünschte Reaktion bei seinem Gegenüber zu provozieren bzw. Leistungen von seinem Gegenüber zu erhalten, nach denen es im eigenen Interesse verlangt. Dem Individuum wird hier offenkundig zugemutet, ein Selbstbeobachter 2. Ordnung zu sein. Wenn aber beide Seiten im gleichen Maße ihr jeweiliges Verhalten von der Erfüllung eigener Erwartungen abhängig machen, dann müssen Ego und Alter über in sich schlüssige Situationsdefinitionen verfügen, die eine wechselseitige Verhaltensabstimmung wahrscheinlichen werden las375 376 377 Vgl. JUSTI, Johann Heinrich Gottlob von: Natur und Wesen der Staaten. Als die Quelle aller Regierungswissenschaften und Gesetze. Aalen 1969 [ND Mittau, 1771], S. 40. Ebd., S. 13 ff. Eine ähnliche Auffassung hat sich in der Soziologie des 20. Jahrhunderts von Max Weber über Berger/Luckmann bis hin zu Bourdieu in mehr oder minder abgewandelter Form halten können. So heißt es bei Berger/Luckmann: „Alles menschliche Tun ist dem Gesetz der Gewöhnung unterworfen. Jede Handlung, die man häufig wiederholt, verfestigt sich zu einem Modell, welches unter Einsparung von Kraft reproduziert werden kann und dabei vom Handelnden als Modell aufgefaßt werden kann. […] Gewöhnung bringt den psychologisch wichtigen Gewinn der begrenzten Auswahl. In der Theorie mag es hundert Möglichkeiten, ein Boot aus Streichhölzern zu basteln, geben. Gewöhnung verringert sie bis hinunter zu einer einzigen. Das befreit den Einzelnen von der ‚Bürde’ der Entscheidung […]. Habitualisierung sorgt für die Richtung und Spezialisierung des Handelns, die der biologischen Ausstattung des Menschen fehlen und baut auf diese Weise Spannungen ab, welche von ungerichteten Trieben kommen. […] Habitualisierungsprozesse gehen jeder Institutionalisierung voraus. […] Institutionalisierung findet statt, sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden. Jede Typisierung, die auf diese Weise vorgenommen wird, ist eine Institution.“ BERGER, Peter L./LUCKMANN, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt (Main) 1970, S. 56 f. 150 sen. Dieses grundsätzliche Problem sozialer Ordnung haben vertragstheoretische Lösungsansätze zum Anlass genommen, auf die Unentbehrlichkeit einer politisch-rechtlichen Machtinstanz hinzuweisen, die vorschreibt bzw. überwacht, welche Verhaltensweisen dem Wohle aller dienen, sodass den Individuen nur die Freiheit bleibt, von den vertraglich festgelegten Zielen abzuweichen oder diesen zu entsprechen. Macht fungiert dabei als Medium der Beobachtung des Gemeinwohls, das sich nur dort einstellt, wo sich die Mitglieder einer Gesellschaft ihr auch unterwerfen. Diese Notwendigkeit einer die einzelnen Individuen in ihrem Willen transzendierenden Macht wird von den Tauschtheorien grundsätzlich infrage gestellt. Die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs eines Tauschs steigt in dem Moment, in dem beide Seiten von sich aus kraft der ihnen gegebenen Vernunft erkennen, dass sich mit der Transaktion ein Vorteil einstellt, auf dem sie ansonsten verzichten müssten. Max Weber hat diese Einsicht wie folgt umschrieben: „Daß Güter ‚getauscht’ werden, bedeutet: Daß nach Vereinbarung das eine aus der faktischen Verfügung des einen in die des anderen um deswillen gegeben wird, weil nach dem vom ersteren gemeinten Sinn das andere aus der Verfügung des anderen in die des einen überführt wird oder werden soll. Die […] am Tausch Beteiligten hegen jeder die Erwartung, daß der andere Teil sich in einer der eigenen Absicht entsprechenden Art verhalten werde. Irgendeine außerhalb ihrer beiderseitigen Personen liegende ‚Ordnung’, welche dies garantiert, anbefiehlt, durch einen Zwangsapparat oder durch soziale Mißbilligung erzwingt, ist dabei begrifflich weder notwendig vorhanden, noch auch ist die subjektive Anerkennung irgenwelcher Norm als ‚verbindlich’ oder der Glaube daran, daß der Gegenpart dies tue, bei den Beteiligten irgendwie notwendig vorausgesetzt. Denn der Tauschende kann sich z.B. beim Tausch auf das der Neigung zum Bruch des Versprechens entgegenwirkende egoistische Interesse des Gegenparts an der künftigen Fortsetzung von Tauschbeziehungen mit ihm verlassen […].“378 Nach Max Weber kann der Gebende also ganz unabhängig von einer rechtlichen bzw. staatlichen Garantie darauf vertrauen, dass der Nehmende die Gegengabe als verbindlich anerkennt, eben weil er sich die Vorteile, die mit dem Tausch einhergehen, auch für die Zukunft nicht verbauen will. Nun scheint aber dieses Axiom der Vorteilhaftigkeit des Tausches, das der Tauschende bei sich selbst wie auch seinem Gegenüber als Handlungsmotiv setzt, mehr als fraglich. Bereits die einmalige Erfahrung eines Tausches, in dem sich die eigenen Erwartungen nicht erfüllt sehen, ließen unversehens Zweifel aufkommen, inwieweit dem Tauschpartner wirklich zu trauen ist. Weder Ego noch Alter kann also mit letzter Gewissheit annehmen, was er von seinem Gegenüber zu erwarten hat, sodass sich nicht nur das Handeln und Erleben des Gegenübers, sondern auch das eigene als kontingent darstellt. Die Unsicherheiten, die solchen Situationen der doppelten Kontingenz innewohnt, lassen sich nur in der Kommunikation selbst ausräumen. Will Ego mit seinem Tun Erfolg haben, muss er zunächst sein 378 WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (wie Anm. 148), S. 379. 151 eigenes Verhalten danach befragen, inwieweit sein Gegenüber es als ein Motiv akzeptieren kann, eine erwünschte Verhaltensweise zu vollziehen. Ego bietet Alter einen bestimmten Wert an und wartet dann ab, ob dieser bereit ist, ihn adäquat zu entgelten. Mit der Tilgung des Wertes durch einen Gegenwert gibt Alter zu verstehen, dass er Egos Selektion annimmt. Entscheidend ist nun aber zu sehen, dass sich die Bedingungen des Tauschs mit der sozialen Evolution fundamental verändert haben, dass die Tauschpartner selbst nicht unabhängig von ihrer Stellung in der Gesellschaft betrachtet werden können. War der Tausch in vormodernen Gesellschaften vornehmlich zwischen Tauschpartnern vorgesehen, die ohnehin als Teil einer Gemeinschaft zur Erbringung bestimmter Güter und Leistungen verpflichtet waren – was keineswegs einen Handel mit Fremden ausschloss, nur unterlag dieser klar umrissenen Restriktionen, die sich aus den Erfordernissen der ökonomischen Hausgemeinschaften erklärten379 –, setzt sich in der Moderne mit dem Geld ein Medium wirtschaftlicher Kommunikation durch, das von solchen „askriptiven Bindungen“ 380 gänzlich absieht. Mit der Durchsetzung der Geldwirtschaft konnte sich zwischen den Transaktionspartnern eine Indifferenz etablieren, die kein Interesse mehr dafür bekundet, wer die Person ist, die etwa für ein Stück feines Tuch, einen Laib Brot oder sonstiger Dienstleistungen Geld bezahlt. Jeder kommt als Käufer infrage, solange jedenfalls, wie er über genügend Geld verfügt, um für den geforderten Preis des Produzenten bzw. Anbieters aufzukommen. Die zwischen dem Käufer und Anbieter bzw. Produzenten bestehende soziale Asymmetrie lässt sich nicht mehr mit Hilfe von ständischen Kategorien moralisieren, geschweige denn resymmetrisieren. Neben der Universalisierung jener Personen, die nach Gesichtspunkten funktionaler Betroffenheit als Rollenträger für die Inklusion ins Wirtschaftssystem in Betracht kommen, vollzieht das Geld am Käufer zudem eine Generalisierung.381 Wer am Wirtschaftssystem teilhat, der tut dies, weil er sich davon die Erfüllung eines bestimmten Bedürfnisses erhofft. Jede Bedürfnisbefriedigung hat seinen Preis, anhand dessen sich die Welt unter dem Aspekt ihrer ökonomischen Verwertbarkeit monetisieren lässt. Bereits am Ende des 18. Jahrhunderts heißt es dazu: „Das gröste und wichtigste Recht der Menschheit ist, seine Existenz zu erhalten, fortzusezzen und zu erhöhen; das alles geschieht durch Befriedigung der wesentlichen und erhöhenden Bedürfnisse; die Mittel zu dieser Befriedigung sind die irdischen Güter, und das Ding, für welches man sie alle bekommen kann, nemlich das Geld.“382 So lässt sich kaum mehr ein menschliches Bedürfnis benennen – mit Ausnahme vielleicht dem Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung –, das 379 380 381 382 Zu den Ursprüngen dieser Vorstellung vgl. SAHLINS, Primitive Exchange (wie Anm. 167). Vgl. PARSONS, Talcott: Evolutionäre Universalien der Gesellschaft. In: ZAPF, Wolfgang (Hg.): Theorien des sozialen Wandels. Köln [u.a.] 1970, S. 55-74, hier S. 65. Rudolf Stichweh betrachtet die Universalisierung, Generalisierung und Respezifikation als Strukturmerkmale von Publikumsrollen, wie sie sich in funktional differenzierten Gesellschaften ausdifferenzieren. Vgl. STICHWEH, Inklusion in Funktionssysteme (wie Anm. 230), S. 262 f. JUNG-STILLING, Johann Heinrich: Staats-Polizey-Wissenschaft. Frankfurt (Main) 1968 [ND Leipzig, 1788], S. 12. 152 sich nicht durch Geld befriedigen ließe. Geld regiert zwar nicht die Welt, wie es im Volksmund so schön heißt, wohl aber den Bedürfnishaushalt des modernen Menschen. Schließlich ermöglicht Geld eine Spezifikation der jeweiligen Publikumsrolle, die das Individuum im Nacheinander seiner unterschiedlichen Teilhabechancen in der funktional differenzierten Gesellschaft tatsächlich wahrnimmt. Wann und ob es am Wirtschaftssystem teilhaben will, bleibt ihm – bis zu einem gewissen Grad jedenfalls – selbst überlassen. Man muss Geld nicht ausgeben, aber man kann es, und zwar zu den Zeitpunkten, die man aufgrund einer zurückliegenden Vergangenheit und einer in Aussicht gestellten Zukunft als die jeweils richtigen erachtet. Geld lässt sich von daher auch ins Unendliche akkumulieren. Es dient auf diese Weise der „Zukunftsvorsorge“383, weil es Zahlungschancen offen hält und damit die Befriedigung von Bedürfnissen in Aussicht stellt, die noch gar nicht aktuell sind. Geld ist aber mehr als nur ein Zahlungsmittel, mit dem Ego Alter seine Bereitschaft mitteilt, für ein bestimmtes Gut einen Preis zu bezahlen, dessen Höhe er in Anbetracht der in der Gesellschaft bereitstehenden Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung für annehmbar hält. Auch greift die Vorstellung zu kurz, Geld sei ein Medium der Verhaltenskoordination, das die am Tausch beteiligten Personen von der Komplementarität ihrer jeweiligen Bedürfnisse und Überschüsse unabhängig macht, weil es für einen Ausgleich des Güterwerts Sorge trägt.384 Der Symbolcharakter, der dem Geld als Konsens stiftendem Medium anhaftet, lässt sich natürlich nicht bestreiten, doch scheint das Problem, zu dessen Lösung es den entscheidenden Beitrag leistet, tiefer zu liegen, als dies die Fokussierung auf die jeweiligen Kosten/Nutzen-Kalküle der Individuen nahe legt. Jegliche Formen der Tauschbeziehung lassen eine Grenze zwischen Personen entstehen, die an ihnen teilhaben, und jenen, die ausgeschlossen bleiben. Der Tausch exkludiert – und hierin unterscheidet es sich in keinerlei Weise vom Eigentum wie auch vom Glauben. Seine Operationen erzeugen eine innerhalb des sozialen Systems selbst beobachtbare Differenz von Innen und Außen, anhand derer sich bestimmen lässt, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit die Ausgeschlossenen akzeptieren, dass ein Gut, an dem sie selbst ein Interesse haben, in den Besitz eines Mitkonkurrenten übergeht. Oder andersherum gewendet: Die Differenz gibt zu erkennen, warum Tauschpartner erwarten können, dass all diejenigen, die sie ausgeschlossen haben, ihre Ansprüche auf das Tauschobjekt fallen lassen. Für vormoderne Wirtschaftssysteme stellte sich 383 384 LUHMANN, Niklas: Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt (Main) 1989, S. 268. Eine Einsicht, die schon älteren Datums ist: „Eben so ziehet die Erbauung der Städte den Gebrauch des Geldes nach sich. So lange die Menschen einzeln und zerstreuet im Lande wohnen; so lange können sie sich mit dem Tausch der Güther behelfen; indem ihre Bedürfnisse, die sie von einander nöthig haben, nicht sehr groß sind. Allein, so bald sie in großer Menge in einer Stadt bey einander leben; so hat ein jeder von denen andern tausenderley Bedürfnisse noethig; und der Tausch kann nicht mehr zureichen; weil derjenige, von dem man diese oder jene Waare erlangen kann, selten diejenige nöthig hat, die ein andrer ueberflüssig besitzet, und davor umtauschen will. Man siehet sich also genöthiget, ein allgemeines Vergütungsmittel anzunehmen, gegen welches man alle Arten von Güthern umtauschen kann […].“ JUSTI, Grundfeste zu der Macht (wie Anm. 373), S. 298. 153 dieser Ausschluss solange als kein Problem dar, wie sowohl die Erzeugung als auch die Verteilung der lebensnotwendigen Güter dem Verantwortungsbereich der einzelnen Hausgemeinschaften oblag. Erst mit dem Wegfall dieser ständisch-korporativen Absicherung des Individuums und der damit einhergehenden Universalisierung des Publikums des Wirtschaftssystems fängt das Medium Geld an, auf das Problem der Knappheit zu reagieren, das entsteht, „wenn jemand im Interesse der eigenen Zukunft andere vom Zugriff auf Ressourcen ausschließt. Die Frage ist: Wann und wie darf er das? […] Die Antwort, die das Kommunikationsmedium Geld ermöglicht, lautet: wenn er zahlt.“385 Erst die Zahlung macht ein Gut knapp, indem sie diejenigen, die sich zu zahlen außerstande sehen, von dem freien Zugriff auf ein Gut ausschließt. Die Funktion des Geldes besteht nun darin, die von dem Zahlungsverkehr Ausgeschlossenen in ihrem Erleben dazu zu motivieren, das Vorrecht des Zahlenden auf ein bestimmtes Gut hinzunehmen. Geld setzt sich als Zahlungsmittel erst dort vollends durch, wo sowohl dem Zahlenden als auch dem Empfänger von Zahlungen die Gewissheit gegeben ist, auch in der Zukunft noch unter den gleichen Bedingungen am Wirtschaftssystem teilhaben, also den erreichten Zuwachs an Eigentum bzw. von Geld reinvestieren zu können. Für alle anderen gilt, dass sie die durch das Wirtschaftssystem zur Verfügung gestellten Möglichkeiten zur Erlangung von Liquidität zu ergreifen haben, um sich an dem Spiel um knappe Güter beteiligen zu können. Die moderne Ökonomie fordert von seinen Subjekten gerade ein Verhalten, das noch von Augustinus bis hin zu Luther als Todsünde des gefallenen Menschen angeprangert wurde, nämlich allein des Geldes wegen zu arbeiten.386 Wurde Knappheit in vormodernen Gesellschaften auf das Fehlverhalten von im Luxus schwelgenden und sich dem Müßiggang ergebenden Menschen zurückgeführt und sah sich das wirtschaftliche Streben dementsprechend durch die Achtung eines in der Natur des Menschen angelegten standesgemäßen Bedarfs beschränkt, ist es in der modernen Gesellschaft der Markt selbst, der sie hervortreten lässt. Knappheit wird hier nicht mehr als Signum der Abweichung von einer gottgegebenen Ordnung interpretiert, die für jeden Menschen das Seinige bereithält, Knappheit ist vielmehr das sich stets aufs Neue reproduzierende Paradox des Wirtschaftsystems selbst. Ihrer Verringerung auf der Seite der Zahlenden und Zahlungen Empfangenden steht ihre Vergrößerung auf der Seite der Nichtzahlenden gegenüber. An diesem Paradox der Knappheit setzt die ökonomische Theorie des Liberalismus an. Solange, wie in einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft jeder über die Freiheit verfügt, das durch den Zahlenden freigesetzte Kapital neu zu investieren, also den Überfluss an Geld zur Reduzierung von Knappheit an Gütern zu ver385 386 LUHMANN, Wirtschaft (wie Anm. 383), S. 252. Bereits Aristoteles betrachtet jene Menschen, die in ihrem Leben in erster Linie durch das Streben nach Geld gekennzeichnet sind, durch den vernunftlosen Seelenanteil bestimmt. Vgl. ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203), S. 320. Im Altertum und frühen Mittelalter wird die Unehrlichkeit des Spielmanns und Lohnkämpfers auf dessen Tätigkeit zurückgeführt, die er allein des Geldes wegen ausübt. Vgl. KRAMER, K.-S.: Ehrliche/unehrliche Gewerbe. In: ERLER, Adalbert / KAUFMANN, Ekkehard: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Bd. I. Berlin 1984, Sp. 855-858. 154 wenden, und dem Nichtzahlenden auf diese Weise gleichzeitig die Chance eröffnet wird, seine Arbeitskraft zwecks Herstellung von Zahlungsfähigkeit zu veräußern, reguliert sich der Markt zum Wohle aller über Angebot und Nachfrage von selbst. Das Geld bildet den Treibstoff, der den Wirtschaftsmotor solange am Laufen hält, wie es in ihm zirkuliert. Dieses Konzept kann jedoch nur überzeugen, weil es die Arbeit als einen (exakter: als den einzigen) wertbildenden Faktor annimmt, mit dem sich Knappheit beseitigen lässt. Denn Arbeit schafft nicht nur Werte und Eigentum, sie muss darüber hinaus auch bezahlt werden. Sie ermöglicht nicht nur, das Angebot an die Nachfrage anzupassen und einen Markt, auf dem die Güter knapp werden, zu versorgen. Arbeit ermöglicht überhaupt erst, nachfragen zu können. Was passiert nun aber mit jenen Überzähligen, die aufgrund der Unverwertbarkeit ihrer Arbeitskraft für das Funktionieren des Motors ohne Bedeutung bleiben, die der Knappheit von Arbeit selbst zum Opfer fallen? Das nachfolgende Kapitel wird sich nun mit dieser Personengruppe, genauer: den Bettlern, eingehender beschäftigen. Zur Erlangung von Liquidität sind sie darauf angewiesen, sich an die Mildtätigkeit ihrer Mitmenschen (oder auch an die Behörden des Wohlfahrtsstaats) zu wenden, also auf Verhaltensweisen zurückzugreifen, die in ihrer Unproduktivität das hoffnungsvolle Ziel einer unaufhörlich wachsenden Wirtschaft, einer Gesellschaft ohne Knappheit, geradezu konterkarieren. 155 4. Das Interaktionssystem der personalen Hilfe 4.1 Der Bettler in der soziologischen und historischen Forschung Die Soziologie hat den Bettlern bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dieser Umstand ist nicht sonderlich verwunderlich, scheinen sie doch in der heutigen Zeit nur ein unbedeutendes Randphänomen darzustellen, dem wir allenfalls in den Einkaufsmeilen unserer Städte begegnen. Aber dies war nicht immer so. Folgt man dem einhelligen Tenor der historischen Quellen überschwemmten sie vor gut 500 Jahre die Städte, zogen von Dorf zu Dorf und gefährdeten mit ihren kriminellen Machenschaften die Stabilität der öffentlichen Ordnung. Den soziologischen Klassikern hat die Personengruppe der Bettler dementsprechend als ein historisches Anschauungsmaterial gedient, anhand dessen sich die sozialen Transformationsprozesse jener Umbruchsphase von einer feudalen zu einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung plastisch darlegen ließen. Nach Karl Marx wurzelt die kapitalistische Produktionsweise in einer ursprünglichen Akkumulation von Gütern. Enteignungen von Bauern, Privatisierungen von Kirchengütern wie auch die Verwandlung von Ackerland in Viehweiden sorgten im 15. und 16. Jahrhundert dafür, dass sich eine immer größer werdende Menschenmasse ihrer Existenzgrundlagen beraubt sah. „Die durch Auflösung der feudalen Gefolgschaften und durch stoßweise, gewaltsame Expropriation von Grund und Boden Verjagten, dies vogelfreie Proletariat konnte unmöglich ebenso rasch von der aufkommenden Manufaktur absorbiert werden, als es auf die Welt gesetzt ward. Andrerseits konnten die plötzlich aus ihrer gewohnten Lebensbahn Herausgeschleuderten sich nicht ebenso plötzlich in die Disziplin des neuen Zustandes finden. Sie verwandelten sich massenhaft in Bettler, Räuber, Vagabunden, zum Teil aus Neigung, in den meisten Fällen durch den Zwang der Umstände.“387 Marx erkennt in den Bettlern und Vagabunden die „Väter der jetzigen Arbeiterklasse“,388 die außer ihrer Arbeitskraft über kein weiteres Kapital verfügen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Gegenüber dem historischen Materialismus, wie er von Marx und seinen Anhängern propagiert wurde, hebt Max Weber den ideellen Ursprung der ökonomischen Reorganisation der Gesellschaft hervor. Als einen entscheidenden Faktor für die Herausbildung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung macht er die Ethik des asketischen Protestantismus aus. Insbesondere der Calvinismus und der Puritanismus trugen zur Verbreitung des Ideals einer ökonomisch-rationalen Lebensführung bei, nach dem sich der Mensch in seiner rastlosen Berufsarbeit stets aufs Neue seinem Gnadenstand vor Gott zu vergewissern habe. Gleichzeitig wendet der Protestantismus die im Mittelalter vorherrschende positive Beurteilung des Bettlers, dessen Notlage dem Wohlhabenden Gelegenheit bot, durch gute Werke sein Ansehen vor Gott zu verbessern, ins Negative. „Der Bettel wird direkt als eine Verletzung der Nächstenliebe gegen den Angebettelten bezeichnet, und 387 388 MARX, Karl: Werke. Bd. 23. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Bd. 1. Berlin 1972, S. 760. Ebd., S. 760. 156 vor allem gehen alle puritanischen Prediger von der Auffassung aus, daß Arbeitslosigkeit Arbeitsfähiger ein- für allemal selbstverschuldet sei. Für Arbeitsunfähige aber, für Krüppel und Waisen, ist die Karitas rational zu organisieren zu Gottes Ehre [...].“389 Nach Max Weber fügt sich die Systematisierung der Caritas wie auch die damit einhergehende Brandmarkung des planlosen Almosengebens nahtlos in einen allgemeineren gesellschaftlichen Rationalisierungsprozess ein, der letztendlich in der Berechenbarkeit und Entzauberung der Welt mündet. Gegenüber solchen, den Bettler lediglich als historisches Exempel sozialen Wandels in den Blick nehmenden Aussagen sind soziologische Abhandlungen, die ihn explizit als ihren formalen Gegenstand ausweisen, eher rar gesät. Neben einem Aufsatz von Georg Simmel, der sich allerdings vornehmlich auf die Darstellung der Vergesellschaftungsformen des Armen konzentriert, ist hier insbesondere auf eine von Andreas Voß verfasste Arbeit jüngeren Datums zu verweisen.390 Voß zielt in seinem Buch darauf ab, die soziologischen Merkmalsausprägungen der formal freiwilligen Armenunterstützung zu eruieren. Anders als die staatliche Armenfürsorge bzw. Sozialhilfe, die den Bedürftigen in Beziehung zu der „Gesamtheit der steuerzahlenden Bürgern und die sie repräsentierenden Institutionen“391 setzt, sieht er die formal freiwillige Armenunterstützung durch ein unmittelbares, auf face-to-face Kontakte angelegtes Beziehungsgeflecht zwischen Bettlern und Almosenspendern charakterisiert. Betteln und Spenden werden als miteinander korrespondierende Handlungstypen beschrieben, denen jeweils sich wechselseitig bedingende Merkmale eigen sind. Als das entscheidende Moment des Bettlers betrachtet Voß sein Ausdrucksrepertoire, mit dem er sich dem potentiellen Almosenspender entweder durch ein aktives (direktes Ansprechen, ‚Schnorren’) oder passives Verhalten (Kauern an den Straßenrändern) als hilfsbedürftig darstellt. In diesen verschiedenen Verhaltensweisen findet sich die Distanz und Dauer des Bettelns auf je eigene Art und Weise arrangiert. Gemeinsam jedoch ist ihnen eine Bittgeste, in der sich eine Asymmetrie zwischen Bettelnden und Almosenspender manifestiert. Diese ist zum einen Ausdruck der Hilfsbedürftigkeit des Bettlers, zum anderen mindert sie bei dem potentiellen Almosenspender zugleich auch das Gefühl der Bedrohung und Unsicherheit, die von der Lebenssituation seines Gegenübers ausgeht. Für die Analyse des Spenders sind nun die Motive maßgeblich, die ihn dazu bewegen, sich entsprechend diesem Gefälle zu verhalten, d.h. entweder ein Almosen zu geben oder dieses zu verweigern. Indem der Spender sein materielles Gut in den Dienst des Ganzen (Prinzip pars-pro-toto) bzw. seines zukünftigen Heils (Prinzip do-ut-des) stellt, nimmt das Almosen die Form einer Verzichtserklärung an, in der an die Stelle des gegen- 389 390 391 WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (wie Anm. 148), S. 354. Vgl. SIMMEL, Soziologie (wie Anm. 133), S. 512 ff.; VOß, Andreas: Betteln und Spenden. Eine soziologische Studie über Rituale freiwilliger Armenunterstützung, ihre historischen und aktuellen Formen sowie ihre sozialen Leistungen. Berlin / New York 1993. Ebd., S. 41. 157 wärtigen Nutzens ein höherer Wert des Lebens tritt.392 Erst durch die Almosengabe wird der Bettler schließlich in seinem sozialen Status als Bedürftiger anerkannt und bestätigt.393 Das Almosen fungiert hier sozusagen als nachträgliche Legitimation des Bettlers, die Entscheidung, betteln zu gehen, getroffen zu haben. In ihren Analysen der Personengruppe der Bettler hat sich die Soziologie bislang ausschließlich handlungstheoretischer Beschreibungsansätze bedient. Handlungstheoretisch fundierte Beschreibungsansätze sehen den Bettler durch gesellschaftlich vorgesehene Verhaltensweisen definiert, auf die er in einem voluntativen Akt zurückgreifen kann, um den Gegebenheiten seiner durch Armut gekennzeichneten Lebenssituation gerecht zu werden. Das auf den Erhalt von Almosen abzielende Betteln erscheint dementsprechend als ein soziales Handeln, das der Ohnmacht des Bettlers entspringt, die eigene Existenz ohne die Hilfe Dritter zu bestreiten. Es ist einer Lebenslage geschuldet, in der es dem Individuum an Gütern mangelt, die es zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt. Der potentielle Almosenspender wird dabei auf die Rolle reduziert, darüber zu befinden, ob die Entscheidung des Individuums, nach Almosen zu heischen, mit den allgemeinen bzw. individuellen Wert- und Normvorstellungen konform geht. Mit der ihm zukommenden Freiheit, ein Almosen zu geben oder es zu verweigern, liegt es in seinem Ermessen, den Erwartungen des Bettlers zu entsprechen. Der Erfolg bzw. Misserfolg des Bettelns hängt somit davon ab, inwieweit es dem Bettler gelingt, bei seinem Gegenüber Gefühle der Betroffenheit zu evozieren, die diesen zur Gabe eines Almosens motivieren. Dem Almosen wohnt somit eine doppelte Funktion inne: Einerseits entlastet es den Geber von jenen Gefühlen, die sich bei ihm durch den Anblick der Hilfsbedürftigkeit des Bettlers einstellen; andererseits stattet es den Nehmer mit Ressourcen aus, die dieser zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt. Mit dem Verhalten des Bettelns liegt also ein überindividuelles Ereignis vor, das eine soziale Beziehung zwischen den an der Interaktion beteiligten Personen konstituiert. Von sozialen Beziehungen lässt sich nur dort sprechen, wo es Ego und Alter in ihrer wechselseitigen Bezugnahme gelingt, eine Sequenz sozialen Handelns hervorzubringen, bei der jeder die Erwartungen des jeweils anderen erfüllt. Soziale Beziehungen gerinnen dabei zu Strukturen, wenn sie über die Einmaligkeit und Zufälligkeit ihres Zustandekommens hinaus eine Reproduzierbarkeit der Handlungssequenz – sei es durch Herrschaftsinstitutionen oder durch Bräuche, Sitten, Werte und Normen – gewährleisten. Sie erhöhen, anders gesagt, die Wahrscheinlichkeit, den Verlauf von Handlungen in Bahnen zu kanalisieren, in denen sich bereits die möglichen Bezugnahmen auf das sinnhafte Handeln des jeweiligen Gegenübers vorstrukturiert finden.394 392 393 394 Zur Interpretation des Almosens als Opfer vgl. auch MAUSS, Gabe (wie Anm. 104), S. 46 f. Vgl. VOß, Betteln und Spenden (wie Anm. 390), S. 140. Zum Begriff der sozialen Beziehung vgl. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (wie Anm. 148), S. 13 f. 158 Auch die historische Forschung fühlt sich mehr oder minder explizit dem handlungstheoretischen Paradigma verpflichtet. Dabei führt sie die Veränderungen der sozialen Wahrnehmung des Bettlers sowohl auf sozialgeschichtliche als auch mentalitätsgeschichtliche Wandlungsprozesse der Gesellschaft zurück. Bei der Sozialgeschichte handelt es sich um „eine Betrachtungsweise, bei der der innere Bau, die Struktur der menschlichen Verbände im Vordergrund steht [...].“395 Es geht ihr hauptsächlich um die Erforschung von Veränderungen sozioökonomischer und verfassungsrechtlicher Art, die im engen Zusammenhang mit der gruppen- und schichtspezifischen Zusammensetzung historischer Vergemeinschaftungsformen gesehen werden. Die sozialgeschichtliche Herangehensweise legt ihren Forschungsschwerpunkt damit vor allem auf „Verhältnisse der Desorganisation“,396 in denen die tradierten Normen und institutionalisierten Verhaltensbeziehungen einer Gesellschaft in ihrer Funktion, für einen Ausgleich zwischen den Interessensgegensätzen der sozialen Gruppen und Kräfte zu sorgen, an Bedeutung verlieren. Insbesondere die Zeitspanne zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert, die in weiten Teilen der historischen Forschung unter dem Namen Krise des Spätmittelalters firmiert, hat hier eine besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen können.397 Aufgrund von Hungersnöten, Pestepidemien und Bauernkriegen sah sich die spätmittelalterliche Gesellschaft mit ständig wechselnden Phasen des Bevölkerungsrückgangs bzw. -wachstums konfrontiert, in deren Folge das ökonomische wie demographische Gleichgewicht zwischen Stadt und Land aus den Fugen geriet. Es war eine Zeit, in der die Anzahl jener Menschen, die durch ihre Tätigkeit in der Agrarwirtschaft ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten, kontinuierlich abnahm, in der aber vor allem das Ungleichverhältnis von Lohn- und Preisentwicklung die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinander klaffen ließ.398 Die unzähligen zeitgenössischen Quellen mit ihren Klagen über Horden von durch das Land ziehenden Bettlern und Vagabunden scheinen diesen sozialgeschichtlichen Befund anschaulich zu belegen. Mit dem Betteln stand dem Menschen eine Handlungsstrategie zur Verfügung, auf die er in einer Gesellschaft, in der nicht mehr ausreichend Arbeit für alle vorhanden war, verstärkt zurückgriff, um sich mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. 395 396 397 398 BRUNNER, Otto: Das Problem einer europäischen Sozialgeschichte. In: BRUNNER, Otto: Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. Göttingen 1968, S. 80-102, hier S. 82. Vgl. OEXLE, Otto G.: Armut, Armutsbegriff und Armenfürsorge im Mittelalter. In: SACHßE, Christoph (Hg.): Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik. Frankfurt (Main) 1986, S. 73-100, hier S. 80. Kritische Anmerkungen zum sozialgeschichtlichen Paradigma der ‚Krise des Spätmittelalters’ finden sich bei SCHULZE, Peter: Die Krise des Spätmittelalters. Zur Evidenz eines sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Paradigmas in der Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts. In: Historische Zeitschrift 269 (1999), S. 19-55. Diese Auffassung wurde insbesondere durch die Arbeiten von Wilhelm Abel in der Geschichtswissenschaft zur Diskussion gestellt. Vgl. ABEL, Wilhelm: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter. Hamburg / Berlin 1978. 159 Gegen die rein sozialgeschichtliche Rekonstruktion des Spätmittelalters hat die Mentalitätsforschung den Einwand vorgebracht, dass sich von einer Krise nur dort sprechen lässt, wo den Umgestaltungen der Gesellschaftsstrukturen auch ein Krisenbewusstsein unterliegt.399 Auslegungen sozialen Wandels stehen insbesondere vor der Aufgabe, die dominierenden Denkweisen einer Zeit zu analysieren, in denen sich die soziostrukturellen Bedingungen des Zusammenlebens zum Ausdruck bringen. Unter dem Begriff der Mentalität versteht man dementsprechend „eine Haltung oder einen Zustand des Geistes von relativer Konstanz, eine Disposition zur Wiederholung gewohnter Denkweisen [...]“400, die immer dann ins Wanken geraten, wenn in „Grenzsituationen“401 die Gewissheiten des Alltags nicht mehr zu greifen imstande sind. Mentalitäten bestehen also aus einem über Sozialisation angeeigneten Ensemble von Emotionen, von Deutungs- und Wahrnehmungsmustern, die im Unbewussten einen Horizont des Erwartbaren abstecken und die immer dort, wo sie in der sozialen Wirklichkeit auf Widerstände treffen, ein nachhaltiges Verlangen hervorrufen, das Unvertraute in den Kosmos der Gewissheiten einzupassen, bzw. es ganz aus der Alltagswelt zu verbannen.402 Die Mentalitätsforschung richtet ihr Augenmerk also weniger auf die materialen Strukturen einer Gesellschaft, die das Einzelindividuum in seinem Handeln umfassen und konditionieren, als vielmehr auf die semantisch-kulturellen Errungenschaften, in denen sich die vorherrschenden Ordnungsvorstellungen einer Epoche widerspiegeln. Insbesondere die zunächst in den spätmittelalterlichen Städten, dann aber auch in den einzelnen Territorien einsetzenden obrigkeitlichen Reflexionen darüber, welche Mittel zur Erhaltung bzw. zur Wiederherstellung der ständisch-feudalen Ordnung zur Verfügung stehen und welche Lebens- und Verhaltensweisen diese Ordnungsbestrebungen konterkarieren, legen ein deutliches Zeugnis von diesen Selbstbeschreibungsbemühungen ab. Gerade in den städtischen Maßnahmen gegen das Bettlerwesen tritt noch deutlich eine Ambivalenz des Denkens hervor, wie sie für Übergangsepochen charakteristisch ist. Noch scheint die Zeit nicht reif, sich im Umgang mit dieser Personengruppe endgültig von einer religiösen Ethik zu verabschieden, die das Seelenheil des Almosenspenders in den Mittelpunkt ihrer Praxis stellt, und demgegenüber eine restriktive 399 400 401 402 Vgl. VIERHAUS, Rudolf: Zum Problem historischer Krisen. In: FABER, Karl Georg / WEBER, Christian (Hg.): Historische Prozesse. München 1978, S. 313-329, hier S. 321 f. TELLENBACH, Gerd: Mentalität. In: HASSINGER, Erich / MÜLLER, Heinz J. / OTT, Hugo (Hg.): Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft. Festschrift für Clemens Bauer zum 75. Geburtstag. Berlin 1978, S. 11-30, hier S. 18. GRAUS, František: Mentalität – Versuch einer Begriffsbestimmung. In: GRAUS, František (Hg.): Mentalitäten im Mittelalter. Methodische und inhaltliche Probleme. Sigmaringen 1987, S. 9-48, hier S. 12. Auf die Frage, inwieweit wissenssoziologische Denkfiguren wie die ‚relativ natürliche Weltanschauung’ Max Schelers und das ‚Kollektivbewusstsein’ Emile Durkheims für die Mentalitätsgeschichte Pate gestanden haben, kann hier nicht weiter eingegangen werden. Unverkennbar sind jedoch die theoretischen Berührungspunkte, die vor allem in der Vorstellung Durkheims zum Ausdruck kommen, dass die Wahrnehmungs- und Kognitionsschemata (Zeit, Raum, Substanz, Relation, Leiden, Befinden) einer mit dem Kollektivbewusstsein korrelierenden historisch-genetischen Veränderung unterliegen. Vgl. DURKHEIM, Formen des religiösen Lebens (wie Anm. 122), S. 27 ff.; SCHELER, Max: Probleme einer Soziologie des Wissens. In: SCHELER, Max: Die Wissensformen und die Gesellschaft. Bern 1960, S. 17-190; RAPHAEL, Lutz: Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart. München 2003, S. 156 ff. 160 Exklusionspolitik zu verfolgen, die sich den ökonomischen Zwängen des Gemeinwohls verpflichtet fühlt. Und dennoch kündigen sich hier bereits zukunftsweisende Mentalitäten an, die dem rationalen Denken der Moderne schließlich endgültig zum Durchbruch verhelfen werden. Sozial- und Mentalitätsgeschichte belegen gleichsam die zwei Seiten einer Medaille, deren Beschaffenheit es zunächst einmal unmöglich macht, sie von beiden Seiten simultan zu betrachten. Wer also wissen will, was sich auf dem Revers der Medaille befindet, der hat sich bereits mit ihrem Avers beschäftigt. Kein Revers, ohne Avers! Es ist der bereits angesprochene Dualismus von Materie und Geist, von Struktur und Kultur, innerhalb dessen sich die historiographischen Darstellungen sozialen Wandelns mit je eigenen Gewichtungen verorten.403 Aber dieser Dualismus verdeckt letztlich nur die Einheit der Medaille, durch welche die Sozial- und Mentalitätsgeschichte unumstößlich aufeinander verwiesen bleiben. Im Gegensatz zu einer bis ins 19. Jahrhundert hinein dominierenden Allgemeinen Geschichte, die in erster Linie an einer Nacherzählung politischer Großereignisse und der historischen Genese von Staaten und Institutionen interessiert war, fokussiert sowohl die Sozial- als auch Mentalitätsgeschichte ihre Untersuchungen auf Fragestellungen, die sich an dem als problematisch erachteten Verhältnis von Individuum und Gesellschaft orientieren. Beide Ansätze legen also ihren historischen Rekonstruktionen sozialen Wandels das soziologische Axiom des in der Gesellschaft agierenden Individuums zugrunde. Während sich das Individuum aus dem Blickwinkel der Sozialgeschichte sozialen Strukturen unterworfen sieht, die ihm gemäß seiner Stellung im gesellschaftlichen Leben mal bessere, mal schlechtere Entfaltungsmöglichkeiten bereithalten, ist es aus dem Blickwinkel der Mentalitätsgeschichte als Angehöriger einer Gruppe gleichgesinnter Menschen aktiv an der Hervorbringung von Gesellschaft beteiligt. Je nachdem, welcher Argumentationslinie man nun folgt, stellt sich der Bettler entweder als eine Person dar, die von den meisten, vor allem aber von den einflussreichsten Positionen einer Gesellschaft ausgeschlossen bleibt und die nur solange von der Mehrheitsgesellschaft geduldet wird, wie nicht zu viele Menschen das gleiche Schicksal mit ihr teilen, oder aber er erscheint als eine Person, deren Lebensweise solange Akzeptanz findet, wie sie den Ansprüchen und Zielen des Kollektivs genügt. Man sieht hier ganz deutlich, dass sich sozialgeschichtliche und mentalitätsgeschichtliche Beschreibungsperspektiven des Bettlers nicht unweigerlich widersprechen müssen.404 Ihr ungleicher Blick auf die Geschichte beruht vielmehr darauf, dass sie die Kau403 404 Zu den wissenssoziologischen Grundannahmen dieses Dualismus vgl. die Ausführungen in Kapitel 1.3. Und so lässt sich in den historischen Arbeiten größtenteils auch keine strikte methodische Trennung zwischen sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Argumenten beobachten. Deutlich kommt dies im folgenden Zitat von Bronislaw Geremek zum Ausdruck, das die Wandlungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Armen im Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit zu beschreiben versucht: „Als von der Stellung der Armen in der mittelalterlichen Gesellschaft die Rede war, wiesen wir darauf hin, daß ihnen in der Mentalität und der Ideologie jener Zeit eine spezifische Funktion zukam. Jetzt ändert sich die Situation. Die Existenz von Bettlern, also einer Masse von Nichtarbeitenden, erscheint dem gesellschaftlichen Bewusstsein als abträglich für das öffentliche Wohl, also als disfunktional. Gleichzeitig hat die Pauperisierung der kleinen Produzenten jedoch ihre Funktion im gesellschaftlichen Prozeß, ist sie die Bedingung für die Entwicklung des Kapitalismus, ist sie ein integraler 161 salzusammenhänge von Struktur und Kultur, vor deren Hintergrund sie den Ausschluss bestimmter Personengruppen begründen, auf je eigene Weise anordnen, insofern sie auf der einen Seite das Ausgeschlossensein des Individuums zur Bedingung seiner gesellschaftlichen Ächtung und auf der anderen Seite die Ächtung zur Bedingung seines Ausschlusses aus der Gesellschaft hypostasieren. Überspitzt könnte man auch sagen: Das eine Mal erfährt der Bettler Verachtung, weil er der Gesellschaft nicht mehr zugehört, das andere Mal dahingegen, weil er noch immer als Bestandteil ihrer wahrgenommen wird. Soziologisch betrachtet weisen solche gezielten Stigmatisierungen von Personengruppen immer auch gesellschaftliche Funktionen auf. Der Funktion fällt in der Soziologie die Bedeutung eines analytischen Grundbegriffs zu, mit dem sich Elemente, Institutionen und Phänomene eines sozialen Ganzen in Relation setzen und im Hinblick auf ihren Beitrag für den Aufbau, Erhalt und Wandel einer sozialen Ordnung interpretieren lassen. Neben den Beschreibungen des Bettelns und Almosenspendens als zwei korrespondierende Handlungstypen hat Andreas Voß entsprechend die Frage nach der spezifischen Funktion gestellt, die diesem Beziehungsgeflecht als einem überindividuellen, soziologischen Tatbestand innewohnt.405 Er geht davon aus, dass innerhalb einer solchen sozialen Beziehung „der Bettler die Rolle des außeralltäglichen Gegenübers auf sich [nimmt – J.H.], mit dessen Hilfe sich die übrigen Gesellschaftsmitglieder über Abgrenzungshandlungen ihrer gemeinsamen Mitgliedschaft in der alltäglichen Sphäre versichern.“406 Im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Funktion scheinen also für die formal freiwillige Armenfürsorge zwei Faktoren von zentraler Bedeutung zu sein. Zum einen konstituiert sie eine Grenze zwischen einer Sphäre des Alltäglichen und Außeralltäglichen, des Vertrauten und Unvertrauten. In diesem Kontext symbolisiert der Akt des Gebens und Nehmens die Möglichkeit der rituellen Grenzüberschreitung, die beide Seiten in Kontakt treten lässt und für den kurzen Moment ihres Vollzugs miteinander versöhnt. Die Spende „ist Grenze und Brücke zugleich.“407 Sie ist eine Möglichkeit, das Unvertraute der Lebenssituation des Bettlers als etwas Vertrautes zu behandeln und somit als Bestandteil der eigenen Lebenswelt zu akzeptieren. Zum anderen fungieren die Sphären des Alltäglichen und Außeralltäglichen als Verweisungshorizonte, vor deren Hintergrund sich ein kollektives Gruppenbewusstsein der Zusammengehörigkeit etablieren kann. Indem man sich seiner Beziehung zu jenen vergegenwärtigt, die nicht der Sphäre des Alltäglichen angehören, wird es möglich, sich der Bedingungen zu vergewissern, die über die Zugehörigkeit zur Gesellschaft entscheiden. „Beim Betteln und Spenden handelt es sich nicht primär darum“, so Voß, „materielle 405 406 407 Bestandteil der ursprünglichen Akkumulation. Dies betrifft in erster Linie die Veränderungen der Agrarverfassung.“ GEREMEK, Bronislaw: Geschichte der Armut. Elend und Barmherzigkeit in Europa. München / Zürich 1988, S. 124. Für eine analoge Betrachtung der gesellschaftlichen Funktionen des Armen vgl. GANS, Herbert: Positive Functions of the Undeserving Poor. Uses of the Underclass. In: Politics and Society 22 (1994), S. 269-283. VOß, Betteln und Spenden (wie Anm. 390), S. 137. Ebd., S. 132. 162 Mittel so umzuverteilen, daß der Mangel auf seiten der Bettelnden nachhaltig behoben wird. Das primäre, universale Problem besteht darin, ob eine Person die vollständige Zugehörigkeit zur Gesellschaft zugebilligt bekommt oder nicht. Dieses Problem wird von dem Handelnden innerhalb des durch Betteln und Spenden geknüpften Beziehungsgeflechts dargestellt und gelöst.“408 Wann immer also eine Gesellschaft ihren Bestand wahren will, hat sie nach Möglichkeiten zu suchen, zwischen ihren Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern eine Grenze der Zugehörigkeit zu ziehen und damit das Verhältnis zwischen ihrem Innen und Außen zu regulieren. Der formal freiwilligen Armenfürsorge fällt eben diese Funktion zu. Sie definiert Maximen des richtigen Verhaltens für Situationen, in denen die Außeralltäglichkeit des Bettlers das Bedürfnis weckt, sich die Voraussetzungen der Zugehörigkeit zur Gesellschaft zu vergegenwärtigen. Aus dem Dargestellten wird ersichtlich, dass sich die Funktion der formal freiwilligen Armenfürsorge bei Voß in einen Ursache/Wirkungs-Zusammenhang eingebettet findet. Die Funktion ist hier nichts anderes als die Wirkung, die sich einstellt, wenn bestimmte Ursachen gegeben sind. Dem Erleben des Bettlers folgt eine Reaktion, das Almosen, mit welcher der Geber die Unsicherheiten, die von seinem Gegenüber ausgehen, in sozial verträgliche, ja sogar zweckdienliche Formen überführt. Die Funktion wird also einer bestimmten Ursache nachgeordnet, wobei völlig unklar bleibt, wie sich aus der Funktion selbst die Ursache erklären lässt. Warum erlebt der Angebettelte den Bettler als unvertraut? Und weshalb hegt er solche Emotionen, die ihn zu einem bestimmten Handeln bewegen? Niklas Luhmann hat sich gegen diesen kausalwissenschaftlichen Funktionalismus gewendet und dabei versucht, ihn durch einen Äquivalenzfunktionalismus zu überwinden. „Die Funktion“, so führt er aus, „ist keine zu bewirkende Wirkung, sondern ein regulatives Sinnschema, das einen Vergleichsbereich äquivalenter Leistungen organisiert. Sie bezeichnet einen speziellen Standpunkt, von dem aus verschiedene Möglichkeiten in einem einheitlichen Aspekt erfaßt werden können. In diesem Blickwinkel erscheinen die einzelnen Leistungen dann als gleichwertig, gegeneinander austauschbar, fungibel, während sie als konkrete Vorgänge unvergleichbar verschiedene sind.“409 Der Äquivalenzbereich einer Funktion kann also ganz verschiedene soziale Verhaltensmuster umfassen, denen jedoch gemein ist, dass sie sich für die Lösung eines bestimmten Problems eignen.410 Solche funktionalen Äquivalente eröffnen die Möglichkeit, voneinander abweichende Lösungsansätze ein und desselben Problems in Augenschein zu nehmen und miteinander zu vergleichen. Das Bezugsproblem, auf das sich Voß bezieht, setzt an der Frage an, wie sich eine Gesellschaft von Individuen ihrer Einheit vergegenwärtigen kann. Er verweist dabei auf die Notwendigkeit, die Grenzen zwischen ihrem Innen und Außen zu sym408 409 410 Ebd., S. 146 f. LUHMANN, Niklas: Funktion und Kausalität. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 1. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. Köln 1974, S. 9-30, hier S. 14. Zur Theorietechnik der funktionalen Analyse vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 83 ff. 163 bolisieren. Wichtig ist nun zu sehen, dass es sich bei Bezugsproblemen keineswegs um Störungen und Konflikte handelt, die sich in der Natur der Gesellschaft bzw. des Menschen per se angelegt finden. Es sind keine unverbrüchlichen Monumente, die den Veränderungen des sozialen Zusammenlebens zu trotzen imstande sind. Vielmehr werden sie im Selbstlauf der Autopoiesis der Gesellschaft stets aufs Neue generiert. Bezugsprobleme und ihre Lösungen verbrauchen sich in der Zeit und werden dabei durch neue ersetzt. Sie sind also durchaus historisch variabel. Wie ich in den vorhergehenden Kapiteln bereits gezeigt habe, gewinnt das Problem der sozialen Einheit gerade in nach Strata differenzierten Gesellschaften an Bedeutung und wird hier über die Norm der Reziprozität gelöst. Es stellt sich also an dieser Stelle zum einen die Frage, inwieweit in der formal freiwilligen Armenfürsorge Verhaltensprinzipien zur Anwendung kommen, die ein funktionales Äquivalent zur Norm der Reziprozität darstellen. Zum anderen gilt es im Weiteren zu zeigen, welche Konsequenzen sich für die formal freiwillige Armenfürsorge einstellen, wenn im Übergang zur Moderne die Vorstellung einer letzten Einheit der Gesellschaft mehr und mehr ihre Überzeugungskraft zu verlieren beginnt. 4.2 Die Stellung des Bettlers in der Gesellschaft 4.2.1 Der Bettler als Gegenstand evolutionstheoretischer Überlegungen Sowohl in der Soziologie als auch in der Geschichtswissenschaft werden die historischen Veränderungen der sozialen Ordnung zumeist auf die Abfolge verschiedener Stadien des Wandels und der Stabilität zurückgeführt. Auf diese Weise entsteht das Bild eines gesellschaftlichen Entwicklungsverlaufs, dessen Dynamiken sich aus den latent bleibenden oder offen ausgetragenen Konflikten zwischen den unterschiedlichen Werten, Motiven und Interessen der jeweiligen historischen Akteure erklären. In der Systemtheorie wird dieser Konfliktbegriff entmystifiziert und in seiner einseitigen Verwendung als maßgeblicher Faktor sozialen Wandels kritisiert.411 Die Systemtheorie rückt damit von dem Vorhaben ab, Veränderungen der Gesellschaft kausal aus den überlieferten Lebenslagen und Motiven ihrer Mitglieder zu begründen, also jene Bedingungen aufzudecken, unter denen Individuen in eine Mehrheitsgesellschaft integriert werden.412 Sie richtet ihr Augenmerk vielmehr auf die Art und Weise, wie es einem Gesellschaftssystem gelingt, die 411 412 Konflikte werden vielmehr als soziale Systeme begriffen, die erlebte Erwartungsunsicherheiten in Erwartungssicherheiten transformieren, indem sie die Ablehnung und den Misserfolg von Kommunikationen zu ihrem Thema machen. Als ein typisches Beispiel hierfür kann an dieser Stelle das Rechtssystem genannt werden. Vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 529 ff. Das schließt keineswegs aus, nach den Anforderungen zu fragen, die ein Individuum als Person in einem sozialen System zu erfüllen hat. Aber der maßgebliche Ansatzpunkt bildet eben das jeweilige soziale System, in dem sich die Inklusionsbedingungen festgelegt finden. 164 Anschlussfähigkeit seiner Operationen durch die Ausdifferenzierung unterschiedlicher sozialer Sinnsysteme aufrecht zu erhalten. Diese Hinwendung zu den historischen Formaten von Sinnsystemen wird notwendig, sobald man Kommunikationen und nicht Individuen als die eigentlichen Grundelemente der Gesellschaft identifiziert. Kommunikationen sind zeitpunktabhängige, rekursive Ereignisse, die auf bereits Geschehenes und noch zu Erwartendes verweisen, in deren zeitlichen Abfolge sich aber stets auch neues, unerwartetes einzuschleichen vermag. Die für die Soziologie relevante Frage lautet dann: Auf welche Weise vermag ein Gesellschaftssystem trotz dieser unaufhörlichen Regeneration seiner Elemente die Stabilität sozialer Strukturen zu garantieren? Bei der Beantwortung dieser Frage gilt es sich zunächst einmal von dem strikten Entweder-Oder des Duals von Wandel und Stabilität zu lösen. An die Stelle der Vorstellung einer durch Konflikte forcierten Genese des sozialen Zusammenlebens setzt die Systemtheorie die Annahme eines sozialen Prozesses der soziokulturellen Evolution, der sich auf der Grundlage dreier Mechanismen, nämlich der Variation, Selektion und Restabilisierung, vollzieht.413 Die Triebfedern der Evolution werden somit nicht aus den Gegebenheiten der Umwelt – den Individuen –, sondern aus den Reproduktionsbedingungen des Gesellschaftssystems selbst erschlossen. Jedem autopoietischen System – in unserem speziellen Fall also: der Gesellschaft – ist prinzipiell die Möglichkeit inhärent, die Elemente, über die es sich kontinuiert, zu variieren. So wie die Zellen eines Organismus mutieren können, so wie das Bewusstsein niemals bei einem Gedanken verharren bleibt, so lassen sich auch Bräuche, Sitten und Normen umgehen, Traditionen hinterfragen, neue Handlungsfelder entdecken. Und dies nicht, weil dem Individuum bereits ein Hang zur Nonkonformität und zum Egoismus eigen wäre, sondern weil sich die Grundelemente der Gesellschaft im Medium der Sprache als Kommunikationen konstituieren und somit immer schon ein Potential in sich tragen, negiert und in ihrem Bedeutungsgehalt variiert zu werden. Solche Variationen treten permanent und relativ zufällig auf – zufällig, insofern sie keinem Gesetz der Vernunft, der Planung und des Fortschrittes gehorchen; relativ, da sie sich stets vor dem Horizont des Bestehenden und Erwartbaren ereignen. Soziale Systeme sehen sich somit unvermeidlich mit dem Zwang zur Selektion konfrontiert. Manche Variationen können dem Vergessen überantwortet werden, weil sie sich entweder der Einmaligkeit der Situation zurechnen oder als Normverletzung verwerfen lassen, andere hingegen werden unter der Maßgabe ihrer Generalisierbarkeit als wiederverwendbar markiert. Variationen erlangen durch ihre Selektion Bedeutung für den Aufbau neuer Systemstrukturen, in denen sich das festgelegt findet, was man unter bestimmten Bedingungen zu erwarten hat. In Hochkulturen, also über Schrift verfügenden Gesellschaften, erfolgt die Selektion von Variationen zunächst durch die Religion. Im Übergang zur Modernen 413 Vgl. LUHMANN, Geschichte als Prozeß (wie Anm. 102); LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 413 ff. 165 übernehmen schließlich vermehrt symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien diese Aufgabe. Sowohl die Religion als auch die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien institutionalisieren die Selektion auf der Ebene einer Beobachtung zweiter Ordnung. Sie machen sich damit von der Interaktion als Probelauf des gesellschaftlich Möglichen unabhängig. „Die Religion beobachtet Gott als Beobachter der Menschen, die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien dirigieren das Beobachten anderer Beobachter, etwa in den Märkten des Wirtschaftssystems oder im Bereich der Wissensbehauptungen. Die jetzt nötigen Selektionseinrichtungen distanzieren sich von der Unmittelbarkeit des Variationsgeschehens wie ein Beobachter, der beobachtet, was andere Beobachter beobachten.“414 Solche Beobachtungen zweiter Ordnung lassen jedoch Kontingenz erst erfahrbar werden. Sie machen das, was selegiert wurde, von der Art und Weise abhängig, wie ein Beobachter die Welt beobachtet. Das schließt natürlich mit ein, dass die Selektion auch hätte anders getroffen werden können. Dem Selektionsmechanismus an sich bleibt es also verwehrt, Systemstrukturen gegen die Wahrscheinlichkeit möglicher Erwartungsenttäuschungen auf Dauer zu stellen. Innerhalb des Gesellschaftssystems wird diese Stabilisierungsfunktion durch die Differenzierungsform erfüllt, „die es ermöglicht, im Rahmen abgesonderter Systeme und besonderer Umwelten evolutionäre Errungenschaften zu erhalten und zu reproduzieren.“415 Kommunikationen, die in dem einen System enttäuscht werden, erhalten auf diese Weise ein Verweisungspotential auf andere Systeme ihrer Umwelt, in denen sie sich unter veränderten Bedingungen fortführen lassen. Wer mit seinen Wahrheitskommunikationen scheitert, der kann sich immer noch auf den Glauben berufen, wer gegen die in den Gesetzen festgeschriebenen kollektiv bindenden Entscheidungen verstößt, der muss damit rechnen, sich rechtlich verantworten zu müssen. Über Restabilisierungen stellt sich eine Gesellschaft auf die veränderte Komplexität ihrer Reproduktionsbedingungen ein, indem sie die Leistungen, die durch die neuen Systemstrukturen erbracht werden, in das Gesamtsystem einpasst. Aus dem Blickwinkel einer Theorie soziokultureller Evolution erfolgt der Aufbau und Erhalt sozialer Ordnung also nicht primär über die Exklusion von Personengruppen, deren Verhaltensweisen im Widerspruch mit bestehenden Herrschaftsverhältnissen, Normen und Werten stehen, sondern über die Ausdifferenzierung von Systemen, die innerhalb ihrer Systemgrenzen über die Inklusion und Exklusion von Personen entscheiden. Der Bettler verdankt seine Inklusion in die Gesellschaft dem Interaktionssystem der personalen Hilfe, dessen Strukturen sich erst zu einem Zeitpunkt ausbilden konnten, als sich bereits Interaktionsformen in der sozialen Evolution abzeichneten, die dem Verhaltensprinzip der Reziprozität widersprachen. Das Interaktionssystem der personalen Hilfe lässt auch in den Fällen noch Hilfe erwartbar werden, in denen die generalisierte 414 415 Vgl. ebd., S. 484. LUHMANN, Gesellschaftliche Struktur (wie Anm. 72), S. 43. 166 Wechselseitigkeit von Leistung und Gegenleistung grundsätzlich infrage steht.416 Letztlich ist die soziale Identität des Bettlers damit dem Erleben von Kontingenz geschuldet. Kontingenz lässt das Handeln, sei es das eigene oder das fremde, als durchaus auch anders möglich erscheinen. Interaktionen sehen sich infolgedessen mit dem generellen Problem konfrontiert, bestimmen zu müssen, mit welchen Kommunikationsverläufen sie rechnen und welche sie dahingegen für die Dauer ihrer Aktualität ausschließen. Für ein am Paradigma der Einheit orientiertes Gesellschaftssystem ergibt sich daraus die Aufgabe, die beobachtbare Diversität von Systemen in ein Nebenund Nacheinander von möglichen Interaktionssequenzen zu übersetzen und dabei die Übergänge von der einen zur nächsten Interaktionsform klar zu umreißen. Interaktionen werden auf diese Weise in die Lage versetzt, auch in jenen Fällen, in denen sich Erwartungsenttäuschungen einstellen, noch wissen zu können, welche Anschlüsse außerhalb ihrer Strukturen möglich sind. Bei diesem Vorgang der Bearbeitung und Handhabung von Kontingenz sind Schemata am Werk, über deren Gebrauch sich Typen von Kommunikationen bzw. Kommunikationen strukturierende Semantiken formen.417 Ein Schema ist ein „operatives Dual“,418 das Kontingentes in eine Option mit zwei Seiten überführt. Anhand solcher operativen Duale wird die Bestimmung dessen möglich, was im weiteren Verlauf der Interaktion zu erwarten ist. Sie bilden geradezu die Bedingung der Möglichkeit, dass sich die am Interaktionssystem der personalen Hilfe beteiligten Personen als Bettler und Almosengeber wahrnehmen; oder genauer: dass Alter aus einem Horizont möglicher Identifizierungen (Frau/Mann; klein/groß; schön/hässlich etc.) ein Erleben von Ego als Bettler selektiert, um damit gleichzeitig zu einer spezifischen Anschlusskommunikation motiviert zu werden – sei es die Gabe oder aber die Ablehnung eines Almosens. Will man also in Erfahrung bringen, worauf die relativ stabilen, Anschlusskommunikationen vorselegierenden Erwartungsstrukturen des Interaktionssystems der personalen Hilfe gründen, hat man zunächst nach den Schemata Ausschau zu halten, in denen sich die zur Inklusion berechtigenden sowie die zur Exklusion führenden Maßgaben festgehalten finden. Exklusion darf in diesem Zusammenhang keineswegs als Ausschluss aus der Gesellschaft missverstanden werden. Exklusion aus dem Interaktionssystem der personalen Hilfe ist vielmehr die Voraussetzung der Inklusion in soziale Systeme, in denen die Norm der Reziprozität zur Anwendung kommt. Mit dem evolutionstheoretischen Ansatz wird die Analyse des Wandels der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Bettlers somit auf die Frage hingeführt, inwieweit die Schemata, über die die Identitätszuschreibungen als Bettler und Almosengeber im wechselseitigen Wahrnehmen erfolgen, sich mit jenen Strukturen 416 417 418 Vgl. dazu auch LUHMANN, Niklas: Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen. In: OTTO, Hans-Uwe / SCHNEIDER, Siegfried: Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit. 1. Halbband. Neuwied / Berlin 1973, S. 21-43, hier S. 28 f. Vgl. dazu auch Kapitel 1.2.3.3. LUHMANN, Niklas: Schematismen der Interaktion. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen 1981, S. 81-100, hier S. 81. 167 als kompatibel erweisen, die außerhalb des Interaktionssystems der personalen Hilfe die Inklusion der Person in die Gesellschaft bewerkstelligen. Ein an evolutionstheoretischen Prämissen orientiertes soziologisches Forschungsprogramm führt zwangsläufig über den Umweg der Analyse einer höheren Abstraktionsebene, auf der bereits Texte bereitstehen, die das Interaktionssystem der personalen Hilfe als ein Interaktionssystem unter anderen beobachten. Was dem historischen Blick offen steht, sind mithin Dokumente der Reflexion, welche die in den sozialen Interaktionen erlebte Kontingenz in eine Unterscheidung von System und Umwelt überführen. Die Beschreibungen des Bettlers, wie sie von den zeitgenössischen Quellen angeboten werden, bleiben dabei größtenteils an der bloßen Negation ordnungskonformer Verhaltensweisen orientiert. Aus den Quellen lassen sich nun zunächst einmal vier Typen des Bettlers herauskristallisieren. Bettler sind dementsprechend Menschen, • die sich auf Grund von Krankheiten, Alter, Behinderungen etc. außerstande sehen, durch körperliche Arbeit ihren eigenen Lebensunterhalt bzw. den ihrer Familien zu gewährleisten; • die zwar arbeiten, deren Auskommen jedoch nicht für die Erfüllung ihrer Lebensbedürfnisse hinreicht; • die in ihrem Versuch, Arbeit zu finden, erfolglos bleiben und damit notgedrungen auf das Betteln zurückgreifen, um sich mit den Grundbedürfnissen des Lebens zu versorgen; • die in Abkehr von einer – wie auch immer begründeten – Arbeitsverpflichtung dem Müßiggang frönen, um das Betteln bewusst in Ansehung ihres eigenen Nutzens zu missbrauchen. Die ersten drei Bettlertypen liefern Darstellungen unterschiedlicher Lebenssituationen, in denen sich ein Individuum dazu gezwungen sieht, auf das Betteln als Verhalten zurückzugreifen. Mit dem vierten Bettlertypus geraten Personen in den Blick, die sich bewusst dem Betteln verschreiben, obwohl ihnen andere Verhaltensmöglichkeiten offen gestanden hätten. Bei der Bewertung der einzelnen Bettlertypen hat man sich allerdings vor der Annahme zu hüten, es handele sich bei ihnen um Beschreibungen, die den Bettler als Subjekt der sozialen Realität erfassen. Demgegenüber gehe ich davon aus, dass sie ihren Gegenstand konstruieren, indem sie ihn in einer sozialen Welt des sonst noch Möglichen lokalisieren. Jeder einzelne Typus hat mit dem anderen gemein, dass er das Betteln als eine Tätigkeit umschreibt, die sich von jenen Verhaltensweisen unterscheidet, mit denen man in einer Gesellschaft rechnen kann, die ihre Stabilität aus der Norm der Reziprozität gewinnt. Es sind mithin Versuche, durch eine Systematisierung von Verhaltensweisen, die eine Störung dieser sozialen Ordnung indizieren, der Kontingenz der im Gesellschaftssystem vollziehbaren Operationen eine Berechenbarkeit abzuringen. Was mit den zeitgenössischen Quel168 len also in den Blick kommt, sind nicht die realen Lebenssituationen, in denen sich eine Person dazu entscheidet, betteln zu gehen. Die Quellen sind vielmehr Zeugnisse von sich im Wandel befindlicher sozialer Ordnungsvorstellungen, die den Bettler als Symptom – und nicht notwendigerweise auch als Ursache – einer Unordnung kennzeichnen. Über die einzelnen Bettlertypen lassen sich am Betteln soziale, sachliche und zeitliche Verhaltensmerkmale spezifizieren, die aufgrund ihres impliziten Verweises auf das auch anders Mögliche und sozial Erwünschte denkbare Verhaltensanschlüsse mit hinreichender Bestimmtheit offen legen. Warum begründet das Verhalten Alters eine Störung in seiner Beziehung zu Ego? Wodurch wurde sein Verhalten veranlasst? Lassen sich die Bedingungen des Verhaltens ändern, so dass eine Wiederherstellung von Ordnung in Aussicht steht? In den Bettlertypen finden sich damit jene Attributionen festgehalten, mit denen Alter dem Erleben und Handeln Egos eine Relevanz für die Wahl des eigenen Verhaltens zuschreiben kann. Nun sind derartige Attributionen keineswegs beliebig gewählt. Ihre Auswahl bleibt an Schematismen gebunden, die den Verlauf der Interaktion strukturieren. Nach Niklas Luhmann wird die im wechselseitigen Wahrnehmen fundierte Kontingenz der Interaktion durch drei elementare Schematismen limitiert.419 In der Sozialdimension dient das Schema Ego/Alter dazu, eine soziale Beziehung zwischen den an der Interaktion beteiligten Personen zu veranschaulichen und der Kommunikation einen Richtungssinn zu verleihen. Dabei kann entweder das Verhalten von Ego oder das von Alter als jener Ansatzpunkt ausgewiesen werden, auf den sich eine Anschlusskommunikation zu beziehen hat. Die soziale Schematisierung ermöglicht auf diese Weise die personale Zurechenbarkeit der Annahme bzw. Ablehnung eines offerierten Sinnangebots. In der Sachdimension lässt sich ein Verhalten durch die Zurechnung internaler oder externaler Ursachenfaktoren als Handeln oder Erleben klassifizieren. Das Schema legt fest, inwieweit einer Person die Kontrollierbarkeit bzw. Unkontrollierbarkeit ihres Verhaltens zugesprochen werden muss. Alter steht somit generell vor der Option, sein Verhalten entweder an Egos Absichten oder an dessen Lebenssituation auszurichten. Für die Zeitdimension gilt das Dual von konstant/variabel als der grundlegende Schematismus der Attribution. Anhand dieses Schemas lassen sich Verhaltensweisen danach ordnen, ob sie einem Zustand geschuldet sind, der durch ein Anschlussverhalten verändert oder nicht verändert werden kann. Wichtig ist nun zu sehen, dass sich die Schematismen nur deshalb beobachten lassen, weil sie in der Interaktion semantische Formen annehmen. Die gesellschaftliche Wahrnehmung des Bettlers hängt somit davon ab, „ob und wie eine (unabhängig hiervon zu erklärende) Evolution des Gesellschaftssystems die semantischen Formen ver- 419 Vgl. LUHMANN, Schematismen der Interaktion (wie Anm. 418), S. 82 ff.; LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 122 ff. 169 ändert, mit denen die Schematismen in Betrieb gesetzt und in Betrieb gehalten werden.“420 Und genau diese historischen Verschiebungen der semantischen Formen, durch die der Bettler seine Identität erhält, nämlich Arbeit, Sittlichkeit und Bedürftigkeit, gilt es zunächst im Einzelnen nachzuspüren, um dann in einem darauf folgenden Schritt die Frage genauer unter die Lupe zu nehmen, inwieweit sich die im Interaktionssystem der personalen Hilfe festgeschriebenen Maßgaben zur Gabe bzw. Ablehnung eines Almosens mit der sozialen Evolution des Gesellschaftssystems verändern. 4.2.2 Die Interaktionsschematismen der personalen Hilfe 4.2.2.1 Arbeit 4.2.2.1.1 Die Beobachtbarkeit von Arbeit Die einzelnen Bettlertypen geben auf die Frage, wer die Person ist, die Betteln geht, eine eindeutige Antwort. Im Unterschied zum Almosengeber verfügt der Bettler über keine oder nur über eine unzureichend vergütete Arbeit. Als Folge seines Unvermögens, aus eigener Kraft das zum Leben Notwendige zu erwerben, sieht er sich mit einer Situation konfrontiert, in der er auf die Hilfsleistungen jener angewiesen ist, deren Auskommen – sei es aufgrund ihres Einkommens, sei es aufgrund ihrer Arbeit – hinreichend gesichert erscheint. Innerhalb dieses einseitigen Abhängigkeitsverhältnisses tritt der Bettler dem Almosengeber als eine Person gegenüber, auf deren Status er zu reagieren hat. Ihm bieten sich dabei zwei gänzlich unterschiedliche Anknüpfungspunkte an, mit deren Wahl er den Kommunikationsverlauf auf entscheidende Weise definiert. Entweder er betrachtet den Bettler als eine Person, von der man bestimmte Verhaltensweisen erwarten kann, oder aber er unterstellt seinem Interaktionspartner selbst Erwartungen, die er als Bettler in die soziale Beziehung investiert. In dem einen Fall taucht er in eine mit Alter gemeinsam geteilte Sinnwelt ein und versucht auf diese Weise seine Verhaltensmöglichkeiten mit der Lebenslage seines Gegenübers in Einklang zu bringen. In dem anderen Fall hebt er seine Freiheit hervor, sich für oder gegen die Erwartungen zu entscheiden, die Ego an ihn als ein Alter richtet. Diese ungleichen Möglichkeiten der Verhaltenszurechnung, so meine These, spiegeln sich in den Arbeitssemantiken wider, die eine Gesellschaft im Verlaufe ihrer sozialen Evolution hervorbringt. In ihnen findet sich die Richtung eines Verhaltens vorstrukturiert. Arbeitssemantiken beschreiben, noch einmal präziser formuliert, die Kommunikationsverläufe in der sozialen Beziehung zwischen Alter und Ego unter der Voraussetzung einer idealen Gesellschaftsordnung, in der jedes 420 LUHMANN, Schematismen der Interaktion (wie Anm. 418), S. 94. 170 Mitglied dem anderen das Seinige schuldet. Sie geben dabei über drei allgemeine Sachverhalte Auskunft: über die Person, die arbeitet; über das System, für das sie arbeitet; und über die Wechselwirkungen, die sich zwischen der Person und dem System über die Arbeit einstellen. „Jede Arbeit kombiniert daher einen Fremdbezug und einen Selbstbezug. Sie positioniert eine Tätigkeit, die das Selbst eines Individuums oder einer Gruppe oder einer Organisation auf das Fremde einer Hierarchie, einer konkurrierenden Gruppe oder eines Marktes bezieht und für dieses Inbeziehungsetzen immer in der Lage sein muß, das Selbst und das Fremde auseinanderzuhalten.“421 Was unter Arbeit zu verstehen ist, hängt dann entscheidend davon ab, ob man den Strukturzusammenhang einer Gesellschaft als eine natürlich-korporative Einheit oder als einen zweckmäßigen Zusammenschluss denkt, ob man die interpersonalen Beziehungen durch Freundschaft und Liebe oder durch Interessen strukturiert begreift. Die weiteren Überlegungen zielen darauf ab, den Bedeutungswandel der Arbeit näher zu ergründen. Dabei gilt es sich von einem (unser Alltagsverständnis prägenden) Arbeitsbegriff zu verabschieden, nach dem sich Tätigkeiten danach sortieren lassen, ob sie dem Kriterium der Arbeit oder dem der Freizeit entsprechen. Diese Unterscheidung von Arbeit und Freizeit bzw. Muße entstammt der Gedankenwelt der griechisch-antiken Kultur. Dass es die Muße und nicht die Arbeit war, die sich in den Gesellschaften der Antike einer positiven Wertung erfreute, ist ein Allgemeinplatz, der sich in den meisten wissenschaftlichen Beiträgen zum Problemfeld der Arbeit wieder findet.422 Bei der Sichtung der Literatur gewinnt man schnell den Eindruck, als wäre die heutige Bedeutung der Arbeit ohne einen solchen Rekurs auf die Vergangenheit – wie flüchtig auch immer – kaum hinreichend zu verstehen. Die Gründe hierfür mögen sich aus unserem Erstaunen über die Art und Weise erklären, wie die antike Sichtweise die Selbstverständlichkeiten des modernen Arbeitsverständnisses schier in ihr Gegenteil umschlagen lassen. Unsere Gegenwart wird durch einen Anthropozentrismus geprägt, der die Arbeit zum exklusiven Wesensmerkmal des Menschen erhebt. Nicht Tiere, Pflanzen oder gar Dinge, sondern ausschließlich Menschen arbeiten.423 Und es ist die Arbeit, die dem menschlichen Geist die Grundlage bereitstellt, das Leben nach seinen Vorstellungen zu gestalten. So finden sich heute wohl kaum noch Tätigkeitsbereiche und Lebenssphären, die nicht mit dem Attribut der Arbeit versehen werden könnten, kaum mehr Lebensabschnitte, in denen wir nicht zu arbeiten gedenken. Die traditionelle Berufsarbeit stellt sich unlängst als ein spezifisches Format der Arbeit unter anderen dar. Daneben finden sich jetzt: Freizeitarbeit (!), Gartenarbeit, Liebesarbeit, Wissenschaftsarbeit, Hausar421 422 423 BAECKER, Dirk: Die Unterscheidung der Arbeit. In: HUBER, Jörg (Hg.): Kultur-Analysen. Zürich 2001, S. 175-196, hier S. 183. Zum antiken Arbeitsverständnis vgl. NIPPEL, Wilfried: Erwerbsarbeit in der Antike. In: KOCKA, Jürgen / OFFE, Claus (Hg.): Geschichte und Zukunft der Arbeit. Frankfurt (Main) / New York 2000, S. 54-66. So bereits SOMBART, Werner: Vom Menschen. Versuch einer geisteswissenschaftlichen Anthropologie. Berlin 1938, S. 56. 171 beit, Friedensarbeit, Trauerarbeit, Gesundheitsarbeit, Geburts- und Sterbearbeit, Frauen- und Männerarbeit etc.424 Das diese „Allgegenwart von Arbeit im modernen Leben“425 im krassen Widerspruch zur antiken Auffassung steht, welche die Arbeit als für einen freien Bürger unwürdig erachtete, ist offensichtlich. Aber auch wenn es durchaus sinnvoll erscheint, unseren Blick auf zurückliegende Bedeutungsgehalte der Arbeit zu lenken und mit denen der Gegenwart zu kontrastieren, ist allein mit dem Erstaunen, das sich dabei einstellt, noch nichts gewonnen. Zwar mag es uns nahe legen, die Überwindung der Sklaverei wie auch die damit verbundene Gleichstellung des Menschen als einen historischen Prozess zu deuten, Arbeit dementsprechend als einen emanzipatorischen Faktor der Zivilisation zu feiern und als treibende Kraft der Menschheitsentwicklung zu würdigen, an deren Ende schließlich der Mensch sein Wesen als homo faber entdeckt.426 Aber diese Erfolgsgeschichte der Arbeit lässt die Frage völlig außer Acht, wodurch denn ein Verhalten zur Arbeit wird? Und worin besteht das Gemeinsame, vor dessen Hintergrund sich das moderne als Fortentwicklung des antiken Arbeitsverständnisses interpretieren lässt, ohne dass wir Gefahr laufen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen? Jeder Versuch der Rekonstruktion des historischen Wandels der Arbeit, der nicht beim bloßen Referieren ihrer Begriffsgeschichte stehen bleiben will, muss das Phänomen der Arbeit ergründen. Die Frage nach dem Phänomen stellt sich als eine Frage nach dem Allgemeinen, das sich im Verschiedenen und Individuellen zum Ausdruck bringt. Denn erst mit der Sondierung des Allgemeinen im Individuellen schafft man sich eine Vergleichsbasis, um die historisch variablen Ausprägungen der Arbeit miteinander in Beziehung setzen zu können. Es gilt also diejenigen Parameter zu benennen, die sich über die Zeit hinweg konstant in den verschiedensten Arbeitssemantiken nachweisen lassen. Die weiteren Analysen setzen dabei an einem Punkt ein, an dem Verhaltensweisen bereits als Arbeit bezeichnet und von der Nicht-Arbeit unterschieden wurden. Indem man sich darauf konzentriert, zu beobachten, wie spezifische Beobachtungsoperationen Arbeit generieren, setzt man sich in kritische Distanz zu Bestrebungen der neueren philosophischen Anthropologie, die Arbeit als das zentrale Prinzip zu definieren, durch welches sich der 424 425 426 Wen es interessiert, in welchen Bereichen der Mensch heute überall arbeitet, der überlege sich einfach ein Nomen, ergänzt dieses schließlich mit dem Zusatz Arbeit und googelt so vorbereitet im Internet. Die Erfolgsaussichten sind verblüffend! CONZE, Werner: Arbeit. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 1. Stuttgart 1972, S. 154-215, hier S. 215. Denn hätte er nicht gelernt, durch seine Arbeit die Welt, in der er lebt, zu kontrollieren und zu verändern, auf welcher Stufe der Evolution würde er heute stehen? Hätte es ihm überhaupt gelingen können, aus den Vorstufen der Gattung der Hominiden herauszutreten, oder hat nicht vielmehr erst die Arbeit „den Menschen selbst geschaffen“, wie dies Friedrich Engels in seiner Schrift Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen formulierte? ENGELS, Friedrich: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. In: Marx, Karl / Engels Friedrich: Werke. Bd. 20. Anti-Dühring. Dialektik der Natur. Berlin 1971, S. 444-455, hier S. 444. Dieser Konnex von Menschsein und Arbeit, der im Sozialismus erstmals – soweit ich das sehe – in ein Geschichtsmodell integriert wurde, hat heute längst den Charakter einer Binsenwahrheit angenommen, die es uns schwer fallen lässt, das eine ohne das andere zu denken. 172 Mensch seiner Stellung in der Welt bewusst wird und seine Menschwerdung vorantreibt. Eine solche Herangehensweise unterstellt, es gäbe so etwas wie beobachtungsunabhängige, ihre Bedeutungen in sich selbst tragende Verhaltensweisen. Die weiteren Überlegungen rücken von einem solchen Zugang ab, der sich dem Wesen der Arbeit, ihrer wie auch immer gearteten Realität, durch Begriffsbildung anzunähern versucht. Arbeit ist einer Tätigkeit nicht als Wesensmerkmal inhärent, sie ist vielmehr die Leistung eines Beobachters, die eine Tätigkeit identifiziert und mit dem Prädikat der Arbeit versieht. Mit den Worten Dirk Baeckers: „Was Arbeit ist, wissen wir erst, wenn wir sehen, welcher Beobachter sich ihr nähert.“427 Und ergänzend lässt sich hinzufügen: Was Arbeit ist, wissen wir erst, wenn wir sehen, wie der Beobachter die Kriterien festlegt, durch welche sich eine Tätigkeit als Arbeit konstituiert. Worin bestehen also diese Kriterien? Die nachfolgenden historischen Darstellungen unterscheiden Arbeitssemantiken, die entweder die Hervorbringung eines Produkts oder die Ausführung einer Anordnung in den Fokus ihrer Beschreibungen stellen. Das Produkt markiert den Endpunkt einer Sequenz von durchaus heterogenen Verhaltensweisen, die an seiner Hervorbringung beteiligt sind. Über das Produkt lässt sich also eine Selektion von Verhaltensweisen betreiben, die in ihrem Vollzug aufeinander verweisen und sich von denjenigen abgrenzen, die aus diesem Zusammenhang herausfallen. Die Grenze, die durch die Beobachtung gezogen wird, verläuft zwischen Verhaltensweisen, die ihren Beitrag zur Hervorbringung eines Produktes leisten, und jenen, die dies nicht tun. Es kommt dabei nicht darauf an, ob dieses Produkt auch tatsächlich schon hervorgebracht wurde oder noch hervorgebracht werden soll, in beiden Fällen wird aus einer Gegenwart (bzw. zukünftigen Gegenwart) heraus vorausgehenden Tätigkeiten das Prädikat der Arbeit zugeschrieben, um dann schließlich in einem weiteren Schritt auf den künftigen Wert des Produkts abzustellen. So bietet etwa die in mehreren Schritten sich vollziehende Fertigstellung eines Hauses Schutz vor drohenden schlechten Witterungslagen; der erwirtschaftete Gewinn einer Ware bietet die Möglichkeit, ihn zu investieren und damit dem Gratifikationsverfall von Bedürfnissen entgegenzutreten usw. Das Produkt bezeichnet den Konvergenzpunkt, der eine Abfolge ungleicher Tätigkeiten in einen Zweck aufgehen lässt und somit Raum schafft für Neues. Es hat insofern einerseits einen gewissen Bestand, weil es vergangene Tätigkeiten in sich einschließt und auch nach seiner Fertigstellung die Gelegenheit bietet, zur Arbeit am Produkt zurückzukehren – es etwa zu verbessern, Fehler auszumerzen etc. Andererseits ist es zugleich ein Ereignis, das von der Arbeit befreit, indem es dieser nicht mehr bedarf und einen Abschluss anzeigt, auf den neue Tätigkeiten folgen. Von dem Endpunkt einer Sequenz verschiedener Tätigkeiten auszugehen, die in ihrem Zusammenwirken ein Produkt hervorbringen, stellt sich jedoch lediglich als eine der denkbaren Be- 427 BAECKER, Dirk: Die gesellschaftliche Form der Arbeit. In: BAECKER, Dirk (Hg.): Archäologie der Arbeit. Berlin 2002, S. 203-245, hier S. 206. 173 obachtungsweisen von Arbeit dar. Eine andere Möglichkeit besteht darin, ähnliche Verhaltensweisen zu isolieren und je für sich zu betrachten. Um den Rang der Arbeit anzunehmen, müssen diese Verhaltensfragmente in Bezug gesetzt werden zu einer prädisponierten Ordnung – sei es des Kosmos, der Vorsehung, der Natur des Menschen oder der Organisation. Unter Ordnung ist hier ein zusammengesetztes Ganzes zu verstehen, dessen Teile in einem spezifischen Verhältnis zueinander stehen und dadurch erst die Emergenz des Ganzen bewirken. Ob die Durchführung einer Verhaltensweise als Arbeit betrachtet werden kann, hängt dann davon ab, inwieweit sie einer Anleitung zum ordnungskonformen Verhalten nachkommt und ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung und Reproduktion des Ganzen leistet. Es ist hier nicht das Produkt, in dem sich der Zweck einer Tätigkeit äußert, sondern die Tätigkeit selbst, die ihren Wert in sich trägt und sich in ihrer Wiederholung mal weniger, mal mehr mit einer bereits bestehenden Ordnung in Einklang bringt. Die Beobachtungsform, mit der in diesem Fall Arbeit in den Blick genommen wird, orientiert sich nicht an einer zeitlichen Abfolge unterschiedlicher, sondern an einer sachlichen Differenzierung ähnlicher Verhaltensweisen, die sich jeweils nach dem Grad ihrer Vollkommenheit entweder als höher- oder minderwertig einstufen lassen. All jene Tätigkeiten, die ohne Wert für den Erhalt des Ganzen bleiben, können dementsprechend auch nicht als Arbeit betrachtet werden. Anhand der hier vorgestellten Herangehensweise an das Phänomen der Arbeit wird es möglich, zwei Analyseebenen des historischen Wandels der Arbeit voneinander zu trennen. Erstens die Unterscheidungen selbst, mit denen die Arbeit bezeichnet und von der Nicht-Arbeit unterschieden wird; und zweitens die Form der Unterscheidung, mit der sich die Einheit der Differenz von Bezeichnung und Unterscheidung beobachten lässt: (1.) Die Unterscheidung der Arbeit Eine nähere Klärung dessen, was Arbeit ist, lässt sich nur dadurch erreichen, indem man sie von dem unterscheidet, was sie nicht ist. Diese differenztheoretische Methode fragt nach Unterscheidungen, durch welche die Arbeit in den sozialen Kommunikationen bezeichnet und gleichzeitig unterschieden wird. In Anlehnung an eine Terminologie von Reinhart Koselleck könnte man auch formulieren: Will man in Erfahrung bringen, wodurch die Semantik der Arbeit ihren jeweiligen Sinn erhält, muss man nach den „asymmetrischen Gegenbegriffen“428 Ausschau halten, die das ausschließen, wodurch die Arbeit ihre Identität erhält. Die Asymmetrie verweist dabei auf ein Gefälle, das die beiden Seiten der Unterscheidung in ein Verhältnis der Über- und Unterordnung 428 Reinhart Koselleck hat den Terminus der asymmetrischen Gegenbegriffe freilich dazu verwendet, um den Vorgang der sozialen Identitätsbildung darzustellen. KOSELLECK, Reinhart: Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe. In: KOSELLECK, Reinhart: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt (Main) 1989, S. 211-259. 174 setzt. Die eine und nicht die andere Seite ist zu präferieren. Und wir werden noch sehen, dass diese Wertung, die der Unterscheidung selbst inhärent ist, ein zentraler Bestandteil der Semantik der Arbeit darstellt. Doch zunächst gilt es erst einmal zu ermitteln, was als die andere Seite von Arbeit in Betracht kommt. Lässt sich ein eindeutiger Gegenbegriff zur Arbeit überhaupt auffinden? Zieht man zu diesem Zwecke Untersuchungen der Begriffsgeschichte zu Rate, so zeigt sich sogleich, dass der Arbeitsbegriff in seinem historischen Wandel ganz unterschiedliche Konnotationen angenommen hat. Die Muße tritt dabei als ein möglicher, sicherlich aber nicht als exklusiver Gegenbegriff der Arbeit auf. Um eine gewisse Ordnung in die Vielfalt der Arbeitssemantiken zu bringen, werde ich im weiteren einen Vorschlag von Dirk Baecker aufgreifen, der die Arbeit durch vier zentrale Unterscheidungen bestimmt sieht, nämlich die „[...] vom Müßiggang, wie sie für die Antike maßgebend war, vom immer etwas anrüchigen Ungebundensein, wie sie im Mittelalter vorherrschte, von Sünde und Schuld, wie sie in der Neuzeit sich durchsetzte, und von der Arbeitslosigkeit, wie sie heute auffällt [...].“429 Diese historischen Verortungen der Arbeit lassen sich nicht einfach im Sinne eines linearen Abfolgemodells interpretieren, in dem die eine Unterscheidung die andere ersetzt. Vielmehr ist auffallend, dass sie durchaus auch parallel, sich wechselseitig ergänzend oder diametral zueinander verlaufend auftreten können. Zu jeder Zeit jedoch dominiert jeweils ein bestimmtes Primat der Arbeit und drängt nicht nur die anderen Unterscheidungen in den Hintergrund, sondern vermag auch ihre Sinngehalte in einem gewissen Maße zu überformen. (2.) Die Form der Arbeit Wenn etwas bezeichnet und von anderem unterschieden wird, so folgt daraus unweigerlich die Frage, wodurch das Differente seine Einheit gewinnt. Oder anders herum gewendet: Was ist das Allgemeine, das eine Spezifikation der beiden Seiten einer Unterscheidung erst ermöglicht? Und noch etwas plakativer formuliert: Auf welcher Basis lässt sich eine Beziehung zwischen dem Unterschiedenen konstruieren, die den Anschein erweckt, das eine ließe sich nicht ohne das andere denken? Differenztheoretisch gewendet ist dies die Frage nach der Form einer Unterscheidung, die ihrerseits eine Grenze zieht zwischen dem, was sie als Differenz bezeichnet, und dem, was sonst noch im unmarked space möglich wäre. So erhält das Recht mit seiner Unterscheidung von Recht und Unrecht erst dadurch seine Form, dass es neben seiner eigenen noch andere Formen – der Politik, Liebe, Wissenschaft etc. – zulässt. Als Beobachtung zweiter Ordnung verfügt eine jede Form über ein Reflexionspotential, auf das Systeme zurückgreifen können, um das Verhältnis zu ihrer Umwelt näher zu bestimmen. Die eine Seite der Unterscheidung legt dabei die Operationen fest, über die sich ein System reproduziert, während die andere Seite das benennt, was 429 BAECKER, Unterscheidung der Arbeit (wie Anm. 421), S. 186. 175 der Reproduktion zuwiderläuft. Gehen wir mit Dirk Baecker davon aus, dass sich Arbeit im historischen Verlauf in verschiedenen Unterscheidungen manifestiert, dann stellt sich als nächstes die Aufgabe, nach den entsprechenden Formen der Unterscheidungen Ausschau zu halten. Für die Unterscheidung von Arbeit und Müßiggang, wie sie zunächst in der Antike entworfen wurde, besteht diese Form in der Kennzeichnung zweier Lebensformen, der vita activa auf der einen und der vita contemplativa auf der anderen Seite. Während Arbeit in Differenz zum Ungebundensein auf einen Dienst an der Schöpfung Gottes, in Differenz zu Sünde / Schuld auf Religion (Glaubensgehorsam) verweist, betont sie in Differenz zur Arbeitslosigkeit die Bedeutung der politischen Ökonomie bzw. der Selbstverwirklichung.430 Die weiteren Überlegungen werden nun die einzelnen Formen der Arbeit und den ihnen jeweils zugrunde liegenden Unterscheidungen näher beleuchten. 4.2.2.1.2 Die Arbeit im historischen Wandel Mit der Unterscheidung von vita contemplativa und vita activa – dem beschauenden und tätigen Leben – wurde in der antiken Philosophie erstmals der Versuch unternommen, die den Menschen in seinem Wesen charakterisierenden Verhaltensweisen zu klassifizieren. Alle Arbeitssemantiken der Folgezeit haben sich auf der Grundlage dieses Fundaments zu entfalten vermocht. Augenfällig dabei ist, dass sich die verschiedenen Möglichkeiten, Arbeit zu beobachten, bereits in der vita activa angelegt finden. Jeder Tätigkeit wohnt ein Richtungssinn auf ein Gut und Ziel inne, das entweder allein seines selbst willens oder als Mittel für etwas anderes angestrebt wird. Diese Zweiteilung der Möglichkeit, tätig zu sein, kommt begrifflich in der aristotelischen Unterscheidung von Praxis und Poesis zum Ausdruck.431 Mit der Poesis verbindet Aristoteles eine Tätigkeit des Herstellens bzw. Hervorbringens, die um etwas anderen willen geschieht. Beim Beackern des Feldes und beim Errichten eines Hauses liegt das Ziel der Tätigkeit außerhalb ihrer selbst, weil sie in einem Werk aufgeht, dessen Zweck – in unserem Fall: die Gewinnung von Nahrung bzw. Schutz – der Tätigkeit selbst nicht immanent ist. So offenbart erst im Nachhinein das Werk, inwieweit das Streben seinen Zweck zu erfüllen in der Lage war. Der Begriff der Praxis bezieht sich dahingegen auf Tätigkeiten, die um ihrer selbst willen vollzogen werden, deren Zwecke sich also in der Handlung selbst erfüllen. Das Spielen eines Instruments – Aristoteles nennt als Beispiel das Kitharaspielen432 – vollendet sein angestrebtes Ziel im Musizieren, sodass während des Spiels über den Grad der Vollkommenheit der Tätigkeit geurteilt werden kann. Bei der Praxis handelt es 430 431 432 Ich folge an diesem Punkt wiederum dem Vorschlag von Dirk Baecker. Vgl. ebd., S. 186. Vgl. ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203), 1140 b 5 f. Vgl. Ebd., 1098 a 11. 176 sich also um Tätigkeiten, die sich in ihrem Vollzug selbst reflektieren. Aristoteles belegt nun die herstellende Tätigkeit mit einer eindeutigen Abwertung, weil sie „den Körper oder die Seele oder den Intellekt der Freigeborenen zum Umgang mit der Tugend und deren Ausübung untauglich macht. Darum nennen wir alle Handwerke banausisch, die den Körper in eine schlechte Verfassung bringen, und ebenso die Lohnarbeit. Denn sie machen das Denken unruhig und niedrig.“433 Demgegenüber verweist die Praxis auf ein ethisch-politisches Handeln, das ausschließlich den Bürgern der Polis zukommt. Es geht ihr um ein tugendhaftes Verhalten, in dem sich die Bürger wechselseitig zum Beispiel werden, um sich auf diese Weise des guten Lebens in der Polis – dessen also, was das Seinsziel des Lebens ausmacht – zu vergewissern. Gegenüber dem Tätigsein der Praxis und Poesis setzt das beschauende Leben dem permanenten Streben nach Höherem ein Ende, denn während das Wollen sich stets mit dem Problem konfrontiert sieht, seine eigenen Zwecke im Hinblick auf ihre Vollkommenheit zu hinterfragen, meint das Denken ein In-sich-ruhen, ein Identisch-Sein mit dem ewigen und unveränderlichen der Natur, mit dem also, was nicht so oder anders sein kann.434 Die philosophische Unterscheidung zweier Lebensformen sieht damit ein ausdrücklich asymmetrisches Verhältnis ihrer beiden Pole vor. Dem tätigen Leben, das vom sittlichen Handeln bis zur Versorgung mit dem alltäglich Notwendigen reicht, steht das theoretische Leben gegenüber, in dem sich das aristokratische Ideal einer Hingabe an das Wahre, Gute und Ewige verwirklicht. In diesem Zustand der Muße erscheint der Mensch ausschließlich als vernunftbegabte Einzelperson, die auch ohne die Unterstützung seiner Mitbürger Perfektion erlangt. Eine solche vollständige Autarkie läuft letztendlich auf die Exklusion des Einzelnen aus der Gesellschaft hinaus. „Wer aber nicht in Gemeinschaft leben kann, oder ihrer, weil er sich selbst genug ist, gar nicht bedarf“, so heißt es bei Aristoteles, „ist kein Glied des Staates und demnach entweder ein Tier oder ein Gott.“435 Aristoteles ist sich natürlich dessen bewusst, dass eine absolute Autarkie für den Menschen außerhalb der Reichweite des Möglichen liegt. Als ein von Natur aus in der Gemeinschaft lebendes Wesen vermag er sich aber in der Ökonomia (Hauswirtschaft) und Polis auf eine Weise zusammenzuschließen, die ihm in den verschiedenen Teilbereichen seines Lebens eine relative Unabhängigkeit – von anderen Hauswirtschaften bzw. Stadtgemeinden – gewährt. Das höchste Maß an Autarkie indes bleibt dem beschauenden Leben der theoria vorbehalten.436 433 434 435 436 ARISTOTELES, Politik (wie Anm. 14), 1337 b 7 ff. Denken und Wollen stellen dabei ungleiche Zugangsweisen zur Welt dar, nämlich „einen, mit dem wir jene Wesen betrachten, deren Ursprünge nicht so oder anders sein können, und einen andern, mit dem wir jene betrachten, die sich so oder anders verhalten können.“ ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203), 1139 a 6 f. Vgl. ARISTOTELES, Politik (wie Anm. 14), 1253 a 27 ff. Vgl. ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203), 1177 b 27 ff. 177 Das Ideal des sich der Kontemplation widmenden Menschen wird schließlich von den mittelalterlichen Theologen mit der christlichen Gnadenlehre in Einklang gebracht.437 Doch trotz aller Gemeinsamkeiten zeigt sich schnell, dass der Sinnzusammenhang, vor dessen Hintergrund die christliche Theologie das Modell der unterschiedlichen Lebensformen rezipiert, nicht eins zu eins mit dem der philosophischen Tradition übereinkommt. Die unterschiedlichen Konzeptionen der Welt als natürlicher Kosmos auf der einen und als Schöpfung auf der anderen Seite hielten genügend Anknüpfungspunkte bereit, dass Modell in ein neues Licht zu rücken, ohne dabei freilich seine asymmetrische Grundstruktur gänzlich auszuhebeln. In der mittelalterlichen Ordolehre wird das Tätigsein zum Beruf und damit zum Signum innerweltlicher Heilsverwirklichung.438 Der Beruf ist nicht nur eine Vorstufe zum beschauenden Leben, sondern ein persönlicher Dienst an der Schöpfung. Mit der Kontemplation dahingegen öffnet sich der gläubige Christ der Gnade Gottes. Der Scholastiker Thomas von Aquin beschreibt die vita activa und vita contemplativa entsprechend als zwei Möglichkeiten, den Weg zu Gott zu beschreiten. Im Gegensatz zur antiken Philosophie verlagert er dabei das höchste Gut, das Telos des Lebens, aus der Natur in das jenseitige Paradies der Seligen. Das Ziel der vita contemplativa ist die „Beschauung der göttlichen Wahrheit, weil eine solche Beschauung das Ziel des ganzen menschlichen Lebens ist.“439 In ihr äußert sich unmittelbar die Liebe des Menschen zu Gott, derweil bei der vita activa der Weg zu Gott über die Liebe zum Nächsten verläuft.440 Die vita contemplativa umschreibt also den Bereich menschlichen Verhaltens, in dem sich die Person als reines Vernunftwesen verwirklicht, wohingegen bei der vita activa „die niederen Kräfte [...], die uns mit den Tieren gemeinsam sind“,441 zutage treten und die Erfordernisse des gegenwärtigen Lebens im Vordergrund stehen.442 437 438 439 440 441 442 Vgl. MIETH, Dietmar: Die Einheit von vita activa und vita contemplativa in den deutschen Predigten und Traktaten Meister Eckharts und Johannes Tauler. Untersuchungen zur Struktur des christlichen Lebens. Regensburg 1969, hier S. 68 ff; BALTHASAR, Hans Urs von: Aktion und Kontemplation. In: Geist und Leben 21 (1948), S. 361-370. Hannah Arendt hat die bis in die Neuzeit hinein gültige positive Bewertung des beschauenden Lebens anschaulich folgendermaßen umschrieben: „So ist bis zum Beginn der Neuzeit die Vorstellung der Vita activa immer an ein Negativum gebunden; sie stand unter dem Zeichen der Un-ruhe, sie war nec-otium [...]. Dies hielt sie in engstem Bezug zu der noch grundsätzlicheren griechischen Unterscheidung zwischen den Dingen, die aus sich selbst sind, und jenen anderen, die ihr Dasein den Menschen verdanken [...]. Das absolute Primat der Kontemplation vor jeglicher Tätigkeit ruhte letztlich auf der Überzeugung, daß kein Gebilde vom Menschenhand es je an Schönheit und Wahrheit mit dem Natürlichen und dem Kosmischen aufnehmen könne, das, ohne der Einmischung oder der Hilfe des Menschen zu bedürfen, unvergänglich in sich selbst schwingt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist dieses Ewigsein, das sich den veränderlichen Sterblichen nur enthüllen kann, wenn sie mit allen Bewegungen und Tätigkeiten an sich halten und völlig zur Ruhe gekommen sind.“ ARENDT, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München / Zürich 1985, S. 21. Vgl. PAULUS, Nikolaus: Die Wertung der weltlichen Berufe im Mittelalter. In: Historisches Jahrbuch 32 (1911), S. 723-755; CONZE, Werner: Beruf. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 1. Stuttgart 1972, S. 490-507. AQUIN, Thomas von: Summa Theologica. Übers. von Dominikanern u. Benediktinern Deutschlands u. Österreichs. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg. II. Teil des II Buches. Bd. 23. Besondere Gnadengaben und die zwei Wege menschlichen Lebens. Graz / Wien / Köln 1954, q. 180,4. Vgl. S. th. II-II, q. 182,2. S. th. II-II, q. 182,1. Vgl. S. th. II-II, q. 179,2 ad 3. 178 Aber auch diese Tätigkeiten haben an der göttlichen Vorsehung teil. Bei Aquin werden auf diese Weise die beiden Lebensformen in ein dialektisches Verhältnis zueinander gebracht. Auch wenn einige Menschen mehr zur Beschauung der göttlichen Wahrheit, andere wiederum mehr zu äußeren Handlungen neigen, von einer allgemeinen Verbindlichkeit, beiden Lebensformen gerecht zu werden, kann sich kein Christ lossagen.443 Er hat vielmehr zwischen beiden Seiten zu oszillieren, die Grenze der Unterscheidung zu überschreiten. Über dieses crossing, das Zeit beansprucht, weil man sich nie auf beiden Seiten zeitgleich befinden kann – obgleich die mittelalterliche Theologie durchaus die Möglichkeit einer vita mixta diskutiert –, versetzt sich der Gläubige in die Lage, sich sowohl seiner Ähnlichkeit zu Gott zu vergegenwärtigen als auch in Konkordanz mit dieser in der Welt tätig zu sein. Neu an der christlichen Konzeption des beschauenden und tätigen Lebens ist also, dass sie im Gegensatz zur griechisch-antiken Unterscheidung das automatische Zusammenfallen von ständischer Differenzierung und der dazugehörenden Lebensform mehr oder minder aufhebt. Thomas von Aquin geht von einer Ordolehre aus, nach der ein jeder Mensch über ein Amt (officium) verfügt, zu dem er sich von Gott berufen sieht.444 Der Mensch ist der „Ausführende göttlicher Vorsehung.“445 Seine Tätigkeiten sind denen des Schöpfers nachgebildet, es sind Zweitursachen, durch die hindurch sich die Vorsehung auch ohne das unmittelbare Eingreifen Gottes in der Welt realisiert. Mit der Erfüllung seines Amtes trägt der Mensch nicht nur zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung bei, er entspricht zugleich auch seiner eigenen Natur. Dabei bildet die allgemeine Christenpflicht, die beiden Lebensformen der vita contemplativa und vita activa miteinander zu vereinen, den Ausgangspunkt, von dem aus sich die höhere und mindere Vollkommenheit der unterschiedlichen Ämter legitimieren lassen. Denn einige Berufe setzen eine stärkere Hingabe in der vita contemplativa, andere dahingegen in der vita activa voraus. Das theozentrische Weltbild des Mittelalters billigt vor dem Hintergrund dieser ungleichen Teilhabe an den Wahrheiten Gottes den geistlichen gegenüber den weltlichen Ständen einen höheren Rang zu. Aber auch der Klerus und die Ordenspriester sind in der Form von geistiger Arbeit, also durch öffentliche Gebete, Predigten und Vorlesungen, angehalten, ihre Aufgaben für den Nächsten zu erfüllen und damit ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung der irdischen Ordnung zu leisten. „Die Verschiedenheit der Stände und Ämter hindert die Einheit der Kirche nicht, weil diese durch die Einheit des Glaubens und der Liebe und der gegenseitigen Hilfeleistung gewährleistet 443 444 445 Vgl. S. th. II-II, q. 179,1. Zum Arbeitsbegriff bei Thomas von Aquin vgl. WELTY, Eberhard: Vom Sinn und Wert der menschlichen Arbeit. Aus der Gedankenwelt des hl. Thomas von Aquin. Heidelberg 1946. AQUIN, Thomas von: Summe gegen die Heiden. Dritter Band, Teil I. Hrsg. und übers. von Karl Allgaier. Darmstadt 1990, q. 77. 179 ist [...].“446 Die Möglichkeit eines rein kontemplativen Lebens verstößt indessen gegen das Gebot zur Nächstenliebe, es widerspricht der auf Leistung und Gegenleistung gegründeten Sozialordnung einer durch den Sündenfall korrumpierten Welt. Der Beruf eines Menschen wird hier gleichgesetzt mit einem Dienst am Ganzen, das wie ein Organismus auf das Funktionieren seiner einzelnen Teile angewiesen bleibt und das in dem Moment in Unordnung geraten muss, in dem einzelne Teile ihre Aufgaben nicht mehr nachzukommen imstande sind. Dementsprechend kommt jedem Menschen unabhängig von seinem Stand von Natur aus die Pflicht zur Selbsterhaltung zu. Soweit er über keine anderen Möglichkeiten verfügt, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, unterliegt er der naturrechtlichen Verpflichtung zur Handarbeit.447 Der Handarbeit haftet dabei kein Wert an sich an, da sie Zwecke anvisiert – den Lebensunterhalt zu bestreiten, den Müßiggang zu überwinden, die Begierlichkeiten zu zügeln und Almosen zu geben –, die sich auch auf andere Art und Weise erreichen lassen. „Dennoch sündigen die nicht“, so heißt es bei Aquin, „die keine Handarbeit verrichten. Denn zur Beobachtung dieser Gebote des Naturgesetzes, die auf das Wohl vieler abzielen, sind die einzelnen nicht gehalten, sondern es genügt, daß der eine sich dieser, der andere sich einer anderen Aufgabe widmet; daß z.B. die einen Handwerker, die anderen Bauersleute, wieder andere Richter oder Lehrer sind usw. [...].“448 Es ist Egos tugendhaftes, der eigenen Neigung gerecht werdendes Verhalten, durch das Alter erst zu einem alter Ego wird, von dem man einen Dienst erwarten kann, der seinem Wesen, seinem eigenen Selbst, entspricht. Seine Arbeit entspringt genauso wie die von Ego einer Liebe, mit der er zum einen durch seine guten Werke seinem Mitmenschen zur Seite steht und zum anderen sich in seiner Natur realisiert. Nur insoweit Ego also seinen eigenen Verpflichtungen in der innerweltlichen Welt nachkommt, kann er auch von Alter ein ähnliches Verhalten erwarten. Diejenigen dahingegen, die ihrer Berufung nicht nachgehen, stehen außerhalb dieser auf Ähnlichkeit beruhenden Gemeinschaft. Sie definieren sich geradezu durch ein Ungebundensein gegenüber dem, was Gott von ihnen fordert.449 Das Ungebundensein verweist in diesem Zusammenhang nicht nur auf eine Nichtzugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, deren Statuspositionen sich durch die Verteilung verschiedener Ämter genau festgelegt finden, sondern gleichfalls – und dies ist auch gar nicht anders in den religiösen Kosmologien des Mittelalters denkbar – auf die Freiheit, wider den Willen Gottes zu handeln. Wurde in der griechischen Philosophie die Autar- 446 447 448 449 AQUIN, Thomas von: Summa Theologica. Übers. von Dominikanern u. Benediktinern Deutschlands u. Österreichs. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg. II. Teil des II Buches. Bd. 24. Stände und Standespflichten. Graz / Wien / Köln 1952, q. 183,2 ad 1. Vgl. S. th. II-II, q. 187, 3. S. th. II-II, q. 187, 3. Zum ambivalenten Verhältnis des Mittelalters gegenüber dem Fahrenden Volk, das sich aus den verschiedensten sozialen Gruppen wie etwa Gauklern, Tierbändigern, Taschenspielern, Seiltänzern und Akrobaten, Sängern und Musikanten zusammensetzte, vgl. DANCKERT, Werner: Die unehrlichen Leute. Die verfemten Berufe. Bern 1963, S. 214 ff. 180 kie noch als der Maßstab angesehen, der über die Vollkommenheit des Menschen Auskunft gibt, so steht nun das Ungebundensein für die Verwerfung einer Dienstpflicht, mit der der Mensch seine Gemeinschaft mit Gott und damit mit allen Christen aufkündet. Deutlich tritt bei Thomas von Aquin zutage, wie der Dienstcharakter einer Tätigkeit beginnt, die beiden Lebensformen der vita contemplativa und vita activa zu überformen. Arbeit wird als ein Dienst an der Schöpfung begriffen, mit dem die Person als soziales Wesen nicht nur an der Gemeinschaft teilhat und sich in seiner Natur selbst verwirklicht, sondern sich zugleich auch Freiheiten verschafft, um als Vernunftwesen der Kontemplation nachgehen zu können. Im Zeitalter der Reformation macht sich schließlich ein Bewusstsein breit, das von der Unmöglichkeit ausgeht, die ewigen Wahrheiten Gottes in der vita contemplativa zu schauen. Der damit einhergehende Niedergang religiöser Gewissheiten ist eng mit den Erschütterungen verbunden, die durch die Reformation in der römisch-katholischen Einheitskirche ausgelöst wurden. Seitdem stehen zwei Textinterpretationen der Heiligen Schrift nebeneinander, die beide je für sich in Anspruch nehmen, über die richtige Exegese der Offenbarung Gottes zu verfügen. Da die Zugehörigkeit zur Kirche von nun als von der Entscheidung des Einzelnen abhängig erscheint, wird das Wissen von der in der Schöpfung offenbarten Ordnung Gottes zum Glauben, der über die Vermittlung durch den Klerus hinaus vor allem einer fortwährenden Bestätigung durch den Gläubigen selbst bedarf. Der Protestantismus verarbeitet diese durch sein Inerscheinungtreten erst sichtbar gemachte Kontingenz, indem er an die Stelle der hierarchischen Abstufungen sittlichen Verhaltens, der praecepta und consilia – der im Naturrecht verankerten, für alle Menschen gleichermaßen verbindlichen Gebote und der exklusiv für Kleriker und Mönche geltenden evangelischen Räte –, die subjektive Heilsgewissheit setzt. Er kennt „als das einzige Mittel, Gott wohlgefällig zu leben, nicht eine Ueberbietung der inner-weltlichen Sittlichkeit durch mönchische Askese, sondern ausschließlich die Erfüllung der innerweltlichen Pflichten [...], wie sie sich aus der Lebensstellung des einzelnen ergeben, die dadurch eben sein ‚Beruf’ wird.“450 Auch wenn die Absichten Gottes in der Welt nicht unmittelbar zu erkennen sind, so kann ein jeder für sich selbst in der Erfüllung seines Berufs doch darüber befinden, inwieweit er den Erwartungen Gottes gerecht zu werden vermag. Was sich also letztlich mit der Reformation abzeichnet, ist die Subjektivierung eines bis dato in den äußerlichen Werken objektivierbaren gottgefälligen Lebens. Die dem Menschen von Gott auferlegte Arbeit, sein Beruf, betrachtet Martin Luther als ein religiöses Gebot, das ohne Unterschied des Standes für alle Menschen als eine innerweltliche Pflicht zur Nächstenliebe Geltung beansprucht. Gott weist den Menschen entsprechend ihrer Kräfte spezifische gesellschaftliche Rollen zu, die sie zum Wohle ihrer Mitmenschen zu verrichten haben. Auf den ersten Blick klingt das zunächst einmal so, als hätte Luther das thomistische 450 WEBER, Religionssoziologie (wie Anm. 169), S. 69. 181 Berufskonzept mehr oder minder unverändert übernommen. Bei genauerem Hinsehen erkennt man jedoch, wie es ihm gelingt, der Berufung durch Gott dadurch einen neuen Sinn zu verleihen, dass er ihre Erfüllung als eigentlichen Glaubensbeweis auszeichnet.451 Die Tätigkeit im Beruf ist Ausfluss des Glaubens an Gott, sie ist einem inneren Impuls geschuldet, mit dem sich der Mensch seines Glaubens an Gott vergewissert. Die funktionale Dreiteilung der mittelalterlichen Ordolehre in Oratores, Bellatores und Laboratores bleibt auch bei Luther erhalten, allerdings spricht er den einzelnen Ständen eine unterschiedliche Vollkommenheit in der Nachfolge Christi ab. Ihr ungleicher Rang in der diesseitigen Welt löst sich vor Gott wieder auf, denn worauf es bei der Erlösung des Menschen von der Erbsünde allein ankommt, ist nicht seine Verähnlichung mit Gott durch den Vollzug guter Werke, sondern die Demonstration des Vertrauens in dessen Güte im Beruf. Und dieser Anspruch gilt für alle Stände im gleichen Maße. Das objektive Werk der Arbeit, aus welchem sich Hinweise bezüglich der Verdienstlichkeit für die Schöpfung und den Grad der Vollkommenheit des Menschen auf Erden gewinnen lassen, verliert hier gänzlich seine Bedeutung. Luther zeichnet das Bild einer Arbeitsgesellschaft, in der jedem ex aequo die Pflicht anheim gestellt ist, selbstlos seinem Nächsten zu dienen. Nichtstun wird dabei als eine Abweichung von dem sittlichen Gebot der Nächstenliebe gebrandmarkt, es ist ein Zeichen des durch die Erbsünde verdorbenen Menschen, der allein sein eigenes Wohl im Hinterkopf hat. Wer müßig geht, der stellt seine Person nicht in den Dienst der Gemeinschaft, der versucht vielmehr auf den Kosten anderer zu leben. In der Interaktion erscheint er als ein seinen selbstsüchtigen Erwartungen verpflichtetes Ego. Der Arbeitsbegriff wird bei Luther gegenüber seiner Stellung innerhalb der mittelalterlichen Ordolehre nicht nur aufgewertet, sondern zugleich auch abgewertet. Einerseits betrachtet er die Arbeit nicht mehr als eine Leistung des Menschen, dessen Verdienst es ist, als Zweitursache an dem Erhalt der sozialen Ordnung unmittelbar mitzuwirken. Denn die Wirkungen der Arbeit lassen sich allein dem Willen Gottes zugute halten, der sich dem Menschen als sein Werkzeug bedient, um die Welt nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.452 Mithin ist es auch nicht die Arbeit, sondern allein Gott, die den Menschen nährt. „Erbeytten mus und soll man, aber die narung und des hauses fülle ja nicht der erbeyt zu schreyben, sondern alleyn der guete und dem segen Gottes. Denn wo mans der erbeyt zuschreybt, so hebt sich also bald der geytz und sorge und meynet denn mit viel erbeyt viel zuerwerben. So findet sichs widerspiel, das ettlich ungehewr erbeyten und haben doch kaum brod zu essen, Ander thun gemach mit erbeyt, den fleusset es zu. Das macht alles, das Gott will die ehre haben, alls der alleyne gibt alles gedeyen. Denn wenn du 451 452 Zum Berufsbegriff bei Luther vgl. WIEDEMANN, Konrad: Arbeit und Bürgertum. Die Entwicklung des Arbeitsbegriffs in der Literatur Deutschlands an der Wende der Neuzeit. Heidelberg 1979, S. 115 ff. Es scheint geradezu so, als würde dem Menschen hinsichtlich des Erhalts und des Aufbaus sozialer Ordnung nicht mehr all zu viel zugetraut. Was hier deutlich zum Ausdruck kommt, ist ein Bewusstwerden der Unwahrscheinlichkeit des Zustandekommens sozialer Ordnung. 182 gleych hundert jar pflügtest und aller wellt erbeyt thettest, so möchtestu doch nicht einen halm aus der erden bringen, Sondern Got on alle deyn werck, weyl du schleffest, macht aus dem körnlin einen halm und viel körner, wie er will.“453 So sündigen jene Menschen, welche die Arbeit allein um ihrer Daseinsvorsorge willen betreiben. In ihrem Verhalten spiegelt sich ein Misstrauen gegenüber der Güte Gottes wider. Sie vertrauen nicht auf dessen Zuneigung, sondern allein auf ihre eigenen Kräfte. Der Arbeit wird bei Luther also jeglicher ökonomische Wert abgesprochen. Andererseits erfährt bei ihm die Arbeit insofern eine Aufwertung, als jetzt neben die allgemeine Pflicht, seinem Nächsten nützlich zu sein, die dem Menschen durch Gott gestellte Aufgabe tritt, sich durch Arbeit als Einzelperson der Sünde zu entsagen. Arbeit ist eine Gehorsamsübung, die dem sündigen Menschen unabhängig von seiner gesellschaftlichen Stellung hilft, sich gegen seine körperlichen Begierden zu behaupten. „Das die erbeyt soll seyne ubunge seyn, ynn disem leben, das fleysch zu zwingen“,454 so heißt es bei Luther. Und auf ähnliche Weise folgt auch Wenzlaus Linck diesem Gedanken, wenn er schreibt: „Arbeyt ist eyn Artzney, dem menschen nach dem falle der sünden auffgeleget, dardurch er büsse und widerkere zu got. [...] Dann, wo einem ein ding beschwerlich ist, suchet er darvon erlediget zu werden. Wer in disem Leben arbeyt und schmertz füllet, der begeret einss annderen lebens; wer betrübt ist, der suchet trost. Also gibt arbeyt ursachen, das der Mensch ruwe unn trost bey gott suche [...].“455 In seiner Arbeit erfährt der Mensch nicht nur Mühsal, Schmerz und Leid, sondern gleichfalls auch Freude und Zufriedenheit, jedenfalls solange, wie er in dem Beruf verbleibt, der ihm von Gott zugewiesen wurde. Im Ertragen seines Leids kann er sich ganz der Hoffnung auf ein besseres Leben hingeben. Für die Erlangung seines Seelenheils sind dabei die einzelnen Werke, die von den Berufen auf unterschiedliche Art und Weise erbracht werden, völlig belanglos. Allein der Glaube ist es, weshalb der Mensch auf die Erlösung durch die Gnade Gottes hoffen darf. Und genau hierin bestärkt ihn seine Arbeit. Denn: „Wer one Arbeyt und schmertzen lebt, der fület nit die Kraft des götlichen gesetzes, suchet nit hülffe der gnaden.“456 Seit dem 17. Jahrhundert beginnt sich allmählich eine veränderte Arbeitsauffassung den Weg zu bahnen, die in der Arbeit nicht länger eine aus dem Sündenfall resultierende moralische Pflicht und Strafe Gottes, sondern vielmehr einen innerökonomischen Faktor erkennt, der sich für die Hervorbringung von Gütern verantwortlich zeichnet.457 Es sind die Produkte seiner Arbeit und nicht etwa Gott, die dem Mensch das Überleben und die Befriedigung seiner Bedürfnisse garan453 454 455 456 457 LUTHER, Martin: Der 127. Psalm ausgelegt an die Christen zu Riga in Liefland (1524). In: KÖPF, Ulrich (Hg.): D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Bd. 15. Schriften und Predigten des Jahres 1524. Weimar 1966 [ND Weimar, 1899], S. 348-378, hier S. 366. Ebd., S. 367. LINCK, Wenzel: Von Arbeit und Betteln. In: REINDELL, Wilhelm (Hg.): Wenzel Lincks Werke. Erste Hälfte. Eigene Schriften bis zur zweiten Nürnberger Wirksamkeit. Marburg 1894, S. 148-173, S. 152 ff. Ebd., S. 155. Vgl. WOLFF, Grundsätze des Natur- und Völkerrechts (wie Anm. 362), S. 81. 183 tieren. Mit John Locke hat sich die Arbeit zur Bedingung erhoben, ein Recht an Eigentum zu erwerben, ja diesem überhaupt erst einen Wert zu verleihen. Sie wird gleichsam als die eigentliche Quelle von Reichtum und Armut entdeckt und muss deshalb – zum Wohle aller – nach den Grundsätzen der politischen Ökonomie diszipliniert werden. Anfangs richtet sich das Arbeitsgebot ausschließlich auf den Nutzen für den absolutistischen Staat, dem es in erster Linie darum geht, seinen Wohlstand und damit eben auch seine Macht zu mehren. Das merkantilistische Wirtschaftssystem sieht zu diesem Zweck Maßnahmen vor, die zum einen auf die Erhöhung der arbeitsfähigen Bevölkerungszahl und zum anderen auf die vollständige Ausnutzung ihrer Arbeitskraft durch Erziehung und Bildung bzw. durch die Internierung von Arbeitsunwilligen in Arbeits- und Zuchthäusern abzielen. Als Legitimation dieser Bestrebungen dient die einfache wie plausible Erkenntnis: „Kein Staat kann ohne Arbeit bestehen; und er wird allemal nur nach der Maaße thätig und stark seyn, als die Arbeitsamkeit darinnen groß ist.“458 Dieser Steigerungszusammenhang von Arbeit und Reichtum wird zunächst weiterhin auf die natürliche Notwendigkeit zurückgeführt, dass ein jeder die Arbeit zu erwählen hat, „wozu er seine Kräfte hinreichend befindet, folgends die Lebensart, wozu er geschickt ist, das ist, denjenigen Stand, darinnen er seine Zeit mit Arbeit zubringt, welche recht zu verrichten er den nöthigen Gebrauch der Kräfte vermöge seiner natürlichen Fähigkeiten und Neigungen, zu erlangen im Stande ist“459 Indes ist hier weniger die göttliche Berufung, als vielmehr die natürliche Anlage gemeint, die den Einzelnen zu einer bestimmten, dem Wohle aller dienenden Tätigkeit befähigt. Die Differenzierung spezialisierter Tätigkeitsbereiche führt Adam Smith schließlich in seinem Konzept der Arbeitsteilung auf die „Ausdehnung des Marktes“460 selbst zurück. Das Ausmaß der in einer Gesellschaft vorhandenen Arbeitsteilung unterliegt Veränderungen, die sich aus der Größe des Marktes und der Anzahl der in ihm arbeitenden Menschen erklären. Je kleiner der Markt ist, umso unwahrscheinlicher erscheint es ihm, dass sich ein Mensch nur einer einzigen Tätigkeit widmet, denn in seiner Spezialisierung könnte er sich niemals der Befriedigung seiner Bedürfnisse durch die Inanspruchnahme der angebotenen Leistungen anderer gewiss sein. In völliger Abkehr zur Ordolehre des theozentrischen Weltbildes zieht Adam Smith aus dieser Einsicht den Schluss, dass die „Verschiedenheit der natürlichen Anlagen der einzelnen Menschen [...] in Wirklichkeit viel geringer [ist – J.H.], als wir annehmen. Die stark differenzierten geistigen Fähigkeiten, welche die erwachsenen Menschen der verschiedenen Berufsgruppen anscheinend unterscheiden, sind in vielen Fällen nicht so sehr Ursache, sondern Ergebnis der Arbeitsteilung. Der Unterschied zwischen zwei Menschen mit völlig ungleichartiger Stellung, z.B. einem Philosoph und einem gewöhnlichen Lastträger, scheint nicht so sehr der Natur wie der Gewohnheit, Sitte und Erziehung 458 459 460 JUSTI, Grundfeste zu der Macht (wie Anm. 373), S. 265. WOLFF, Grundsätze des Natur- und Völkerrechts (wie Anm. 362), S. 81. Vgl. SMITH, Reichtum der Nationen (wie Anm. 423), S. 25 ff. 184 zu entspringen.“461 Der Mensch wird nicht mit gewissen Neigungen zu einer bestimmten Arbeit geboren, seine Neigungen bilden sich vielmehr durch die Teilnahme an der commercial society aus. Sie sind mithin Folgen der Inklusion in ein autonomes Wirtschaftssystem, das im Verlaufe seiner sozialen Evolution die Arbeitsteilung als eine zivilisatorische Errungenschaft erst hervorbringen musste. Gegenüber Wirtschaftsformen, in denen jeder Mensch weitestgehend selbst für die Befriedigung seiner Bedürfnisse verantwortlich ist, besteht der Vorteil einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft darin, durch die Einsparung von Arbeitskosten und durch die Rationalisierung von Arbeitsprozessen Gewinne maximieren und damit den Wohlstand aller Bürger befördern zu können. Deutlich kommt hier ein Fortschrittsgedanke zum Ausdruck, der die Gesellschaft als Ganzes erfasst und der den Haushaltsgemeinschaften prämoderner Gesellschaften noch völlig fremd war. In dem Modell der Arbeitsteilung erreicht ein mit der sozialen Evolution sukzessiv voranschreitender Auflösungsprozess der unmittelbaren Verkettung von Standeszugehörigkeit und Arbeit seinen vorläufigen Höhepunkt. Ordneten stratifikatorisch differenzierte Gesellschaften die Verpflichtung des Menschen zur Arbeit noch seinem Sozialstatus nach, so dreht sich im Übergang zur Modernen dieses Verhältnis um. Es ist die frei wählbare Arbeit und die aus ihr erwirtschafteten Gewinne, die darüber entscheiden, welchen Sozialstatus das Individuum in der Gesellschaft einnimmt. Die Arbeitsteilung steckt lediglich noch die institutionellen Rahmenbedingungen ab, innerhalb dessen es sich in der Verfolgung seiner Eigeninteressen frei bewegen darf. Arbeit büßt unter diesen Voraussetzungen ihren religiösen Charakter als Dienst am Nächsten ein. In der commercial society kommt ihr allein noch die Funktion zu, die Werktätigen mit den finanziellen Mitteln auszustatten, die sie zu ihrer Bedürfnisbefriedigung und Selbstverwirklichung benötigen. Sie wird damit zu einem Programm des egoistischen Kalküls, zu einer Ware, die sich gemäß den Gesetzen von Angebot und Nachfrage für ein angemessenes Entgelt veräußern lässt. Wer arbeitet, der erwartet für seine Mühen eine Entschädigung, die ihm den ungehinderten Zugang zum Konsum, also zum Genuss von Gütern, ermöglicht. Wer dahingegen in Arbeit investiert, der erwartet die Erbringung einer Leistung, die das eigene pekuniäre Engagement rechtfertigt. Diese zukunftsoffene, durch Unsicherheit geprägte Erwartungsstruktur in der sozialen Beziehung zwischen Alter und Ego lässt sich nun nicht mehr einfach mit dem Hinweis auf die Berufung durch Gott kompensieren. Sie bedarf vielmehr eines Vertragsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und -nehmer, das den Arbeitenden (also beide Seiten der Unterscheidung) zur Selbstdisziplinierung auffordert. Der Arbeitende muss zur Einsicht gelangen, dass seine Erwartungen nur dann eine Aussicht auf Erfüllung haben, wenn Alter ihn als ein Alter Ego akzeptiert, das wie er selbst ein bestimmtes Verhalten von seinem Gegenüber erwartet. Ihm fällt damit die 461 Ebd., S. 23. 185 Aufgabe zu, sich selbst als Beobachter anderer Beobachter zu beobachten. Nur auf diese Weise kann er darüber befinden, ob sich für ihn die Erbringung einer erwarteten Leistung lohnt oder nicht. In ihrer Eigenschaft als Ware streift die Arbeit ihre vormals gegebenen moralischen Konnotationen endgültig ab. Wer zu dem Entschluss kommt, für sich selbst auch ohne Arbeit sorgen zu können, der verhält sich deswegen nicht auch schon moralisch verwerflich. Moralisch verwerflich ist nicht das Ohne-Arbeit-Sein an sich, sondern vielmehr die bewusste Entscheidung, die Erwirtschaftung der zur eigenen Bedürfnisbefriedigung notwendigen Mittel den Arbeitswilligen zu überlassen. Im Zuge dieser Entmoralisierung der Arbeit erhält das Arbeitslos-Sein den faden Beigeschmack eines pathologischen Problems und Krisenphänomens der Gesellschaft, das sich nicht mehr einfach – wie noch unter Bedingungen der göttlichen Berufung – auf eine individuelle Schuld zurückführen lässt.462 Gegenüber den Arbeitsscheuen sind unter Arbeitslosen gerade jene Menschen zu verstehen, „welche sich durch ihre Arbeit ernähren müssen, aber trotz disponibler Arbeitskraft und vorhandener Arbeitslust wegen nicht vorhandener Arbeitsgelegenheiten keine ihren Gewohnheiten, Fähigkeiten und üblichen Lohnansprüchen entsprechende Beschäftigung finden können.“463 Der Arbeitslose sieht sich mit einer Situation der fehlenden Nachfrage nach seiner Arbeitskraft konfrontiert. Er ist das Opfer eines an seinem eigenen Knappheitsparadox leidenden Wirtschaftssystems.464 4.2.2.2 Sittlichkeit Betrachtet man sich die semantischen Formen, die auf das Verhaltensschema internaler und externaler Zurechnung Bezug nehmen, kommen die Gründe in den Blick, warum Bettler nicht arbeiten. Es sind entweder Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit, Invalidität, schlechten Ausbildung etc. zur Aufnahme einer Arbeit unfähig sind und sich deshalb zum Betteln gezwungen sehen, oder aber Menschen, die lieber dem Müßiggang nachgehen, als sich den Anstrengungen und Mühen der Arbeit auszusetzen. Über das Verhaltensschema der internalen und externalen Zurechnung lässt sich also den Bettlern als Personen die Kontrollierbarkeit bzw. Unkontrollierbarkeit ihres Verhaltens unterstellen. Während den einen aufgrund ihrer Lebenssituation kaum 462 463 464 Vgl. ZIMMERMANN, Bénédicte: Arbeitslosigkeit in Deutschland. Zur Entstehung einer sozialen Kategorie. Frankfurt (Main) / New York 2006; CONZE, Arbeit (wie Anm. 425), S. 177. BUSCHMANN, Nikolaus: Die Arbeitslosen und die Berufsorganisationen. Ein Beitrag zur Lösung der Arbeitslosen-Frage. Berlin 1897, S. 6. Die Politik freilich muss darauf erpicht sein – und wer sollte es ihr wirklich verübeln –, mit werbewirksamen Slogans wie Vorfahrt für Arbeit und Was Arbeit schafft, ist sozial weiterhin die Hoffnung zu schüren, das Problem der Arbeitslosigkeit sei mit der Behebung ihrer Ursachen – und hier bietet sich wiederum der Verweis auf den Schlendrian des Einzelnen an – politisch zu lösen; wenngleich beim Wähler unlängst die Überzeugung Oberhand gewonnen hat, dass es sich bei solchen Lippenbekenntnissen lediglich um Versuche handelt, den eigenen Funktionsverlust zu kaschieren. 186 etwas anderes übrig bleibt, als betteln zu gehen, entscheiden sich die anderen aus freien Stücken, dem Müßiggang zu frönen. Warum aber, so könnte man an dieser Stelle fragen, bilden Interaktionen überhaupt ein solches Interesse an den Ursachen eines Verhaltens aus? Warum versuchen sie – handlungstheoretisch gefasst – die subjektiven Intentionen eines Akteurs zu verstehen? In der Soziologie scheint ein breiter Konsens darüber zu bestehen, dass sich über das Verstehen der Verhaltensgründe die Komplexität sozialer Beziehungen reduzieren lässt. Im Interaktionssystem der personalen Hilfe hat sich dabei das Verhaltensschema von internaler und externaler Zurechnung in die moralische Distinktion von unterstützungswürdig und -unwürdig eingeschrieben. Dem Arbeitsfähigen ist eine Unterstützung zu verweigern, wohingegen der Arbeitsunfähige sich durchaus als unterstützungswürdig darstellt. Typisierungen solcher Art erhöhen die Wahrscheinlichkeit, die möglichen Anschlussoperationen an einem Verhalten in erwartbaren Bahnen verlaufen zu lassen. Sie dienen allein dazu, zu begründen, warum der eine für eine Unterstützung infrage kommt, der andere jedoch nicht. Alternative Anschlussmöglichkeiten werden dahingegen von vorneherein ausgeschlossen. So käme wohl kaum einer auf die Idee, dem Bettler für sein Verhalten zu danken, nimmt er doch keinem die Arbeit weg, der arbeiten will. Im Gegensatz zum psychologisch-philosophischen Handlungsbegriff, bei dem die Frage nach dem handlungskonstituierenden Elementen im Vordergrund steht, interessiert sich eine soziologische Analyse primär für jene Ursachen, die innerhalb eines sozialen Systems für ein Verhalten verantwortlich gemacht werden. Es geht ihr allein um die Aufdeckung von Semantiken, mit denen sich ein Verhalten entweder als Handeln einer Person selbst oder aber ihrem Erleben von Umweltbedingungen anrechnen lässt. „Die Differenz von Erleben und Handeln wird demnach durch unterschiedliche Richtungen der Zurechnung konstituiert. Intentionales Verhalten wird als Erleben registriert, wenn und soweit seine Selektivität nicht dem sich verhaltenden System, sondern dessen Welt zugerechnet wird. Es wird als Handeln angesehen, wenn und soweit man die Selektivität des Aktes dem sich verhaltenden System selbst zurechnet.“465 Wichtig ist dabei zu sehen, dass die Differenz von Erleben und Handeln selbst keine Exklusivität im Sinne eines Entweder-Oders beansprucht. An jedem Verhalten lassen sich vielmehr immer beide Zurechnungsfaktoren voneinander scheiden: ein Außenhorizont, durch den das Verhalten seine Ausrichtung auf ein Gut – einen Gegenstand oder eine Person – erhält und ein Innenhorizont, der über die Absichten ihres Urhebers Auskunft gibt. Einer Person kann also lediglich dann Verantwortung für ihr Verhalten zugerechnet werden, wenn sich ihr sowohl ein Bewusstsein der situationsgemäßen Ziele bzw. Mittel als auch ein willentlicher, freier Entschluss unterstellen lässt, das Verhalten an spezifische Ziele und Mittel zu orientieren. Die Art und Weise, auf ein beobachtetes 465 LUHMANN, Niklas: Erleben und Handeln. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen 1981, S. 67-80, S. 68 f. 187 Verhalten zu reagieren, hängt nun entscheidend davon ab, ob man die Motive einer Person ihrem Umwelterleben nachordnet, also glaubt, sie seien von der Situation affiziert worden, oder ob man ihr die Fähigkeit zuspricht, Handlungsziele selbständig zu formulieren, um dann im Nachhinein das Verhalten an mögliche Umweltfolgen rückzubinden.466 Setzt man die Umwelt als Ausgangspunkt eines Verhaltens, bietet es sich an, das Erleben Alters mit dem von Ego zu vergleichen. Nur insoweit Ego aus dem Erleben der Umwelt dieselben Schlüsse zieht wie Alter, verhält sich Letzterer im Einklang mit den in einer Gemeinschaft vorherrschenden Sitten und Tugenden. Abweichungen von dem, was zu erwarten ist, können dahingegen auf einen inadäquaten Umgang mit der Welt zurückgeführt und moralisch bewertet werden. Sie lassen bei Alter Erziehungsmaßnahmen als notwendig erscheinen, die auf eine Korrektur seines Umgangs mit der Umwelt abzielen. Umgekehrt macht die Zurechnung als Handeln deutlich, dass sich das Verhalten Alters aus einem Willen heraus vollzieht, der von dem Willen Egos grundsätzlich geschieden bleibt. Die Unsicherheiten über den weiteren Interaktionsverlauf äußern sich hier in dem Risiko der Unvereinbarkeit der beiden Willensäußerungen. Alter agiert dabei nicht mehr als ein anonymes Objekt, dessen Verhalten sich als richtig oder falsch, als gut oder schlecht qualifizieren lässt, er offenbart sich vielmehr als ein Subjekt, das mit der Wahl seiner Motive eigene Interessen verfolgt. Im Fall der Zurechnung eines Verhaltens als Handeln stellt die Einrichtung rechtlicher, kontrafaktisch stabilisierter Sanktionsmechanismen ein probates Mittel dar, um konfligierenden Handlungsinteressen entgegenzuwirken. In der alteuropäischen Tradition kommt die Differenz von Erleben und Handeln im Rahmen eines Naturbegriffs zur Anwendung, der das Natürliche als ein Werden begreift, das auf einen ihm inhärenten Telos zuläuft. Innerhalb dieses natürlich-teleologischen Prozesses lässt sich ein passiv Bewegtes von einem aktiv Bewegenden, also passio von actio unterscheiden. Diese Differenzierung, die terminologisch auf Aristoteles zurückgeht, gewinnt ihre tiefere Bedeutung für den Menschen aus der bis ins 17. Jahrhundert hinein gängigen Zweiteilung der Seele in ein apprehensives und appetetives Seelenvermögen.467 Während der vernunftlose Seelenanteil die Potenz aufweist, Wahrnehmungen und Sinneseindrücke zu empfangen und Affekte wie Zorn, Angst, Mut, Mitleid etc. zu erleiden, verfügt der vernunftbegabte Seelenanteil über die Fähigkeit, die Affekte zu steuern und in ein kontrolliertes Handeln zu überführen.468 Nach Aristoteles bilden die an sich 466 467 468 Vgl. ebd., S. 74. Vgl. Kap. 3.3. Bis weit ins 17. Jahrhundert wurden die Affekte ausschließlich als eine Empfindung verstanden, die der Mensch im Umgang mit seiner Außenwelt passiv erleidet. Diese Vorstellung steht dem heutigen Bedeutungsinhalt von Leidenschaft als etwas aktives, Handlungen motivierendes konträr gegenüber. Zur Aktivierung der Affekte vgl. LERCH, Eugen: ‚Passion’ und ‚Gefühl’. In: Archivum Romanicum 22 (1938), S. 320-349; AUERBACH, Erich: Passio als Leidenschaft. In: Publications of the Modern Language Association of America 56 (1941), S. 1179-1196. Zur Ideengeschichte des Gedankens der Affekte vgl. JAMES, Susan: Passion and Action. The Emotions in Seventeenth-Century Philosophy. Oxford 1997. 188 moralisch indifferenten Affekte den Gegenstand, an dem der Mensch seine ethischen Tugenden auszubilden vermag. Ethische Tugenden wie etwa die Gerechtigkeit, Tapferkeit oder Großzügigkeit haben sich dabei in der Praxis zu bewähren. Jede Handlung ist dementsprechend durch ein Streben nach einem begehrenswerten Gut gekennzeichnet, das dem Handelnden durch die jeweilige Situation nahe gelegt wird. Bei Aristoteles heißt es dazu: „Wir überlegen uns weiterhin nicht die Ziele, sondern das, was zu den Zielen führt. Denn der Arzt überlegt nicht, ob er heilen soll, noch der Redner, ob er überzeugen soll, noch der Politiker, ob er eine gute Staatsordnung schaffen soll, noch überhaupt jemand hinsichtlich des Zieles. Sondern wir setzen das Ziel an und erwägen dann, wie und durch welche Mittel wir es erreichen, und wenn sich mehrere Wege zeigen, so wird geprüft, welcher der schnellste und schönste sei [...].“469 Während sich die im Verhalten anvisierten Ziele mehr oder minder von selbst aus der natürlichen Ordnung der Dinge verstehen, bedürfen die Mittel, die zu ihrer Verwirklichung führen, der Wahl. Von der Wahl der Mittel, die alle extremen Reaktionen auf einen Affekt zu vermeiden hat, hängt es ab, inwieweit ein Verhalten das Tugendhafte realisiert. Die Frage, weshalb der Mensch sich durch bestimmte Motive in seinem Verhalten leiten lässt, wird damit von vorneherein ausgeblendet. Affiziert durch das Objekt seines Begehrens hat er aus einem Horizont von Möglichkeiten zu selektieren, was in einer Situation zu tun ist, um das wahrlich Gute zu verwirklichen. Die Selektion orientiert sich dabei stets – solange jedenfalls, wie sie auf Überlegung und Vernunft gründet – an jener Möglichkeit, mit der man das Ziel auf die beste Art und Weise erreicht. Bei Aristoteles ist das Wollen des Menschen also allein auf das Ziel gerichtet, nicht aber auf die Handlung selbst, die ihm die überlegte Wahl (prohairesis) verbindlich vorgibt. Ganz deutlich tritt hier zutage, dass die Selektivität des Verhaltens nicht dem Handeln, sondern dem Erleben zukommt, insoweit eine bewusste Entscheidung gegen die überlegte Wahl fundamental der Neigung des Menschen widersprechen würde, das Gute zu suchen und das Schlechte zu meiden.470 Nun ist dem Menschen aber nicht schon von Natur aus auch die Einsicht gegeben, auf welche Weise sich Handlungsziele bestmöglich realisieren lassen. Um ein solches Wissen erlangen zu können, bedarf er bei der Wahl seiner Mittel des Lobes und des Tadels. Nur so kann er sich an das gewöhnen, was in seiner Lebenswelt als tugendhaft gilt.471 Erst die Unterweisung durch einen Beobachter, der seinerseits bereits einen durch die Tugend gefestigten Charakter aufweist, macht es ihm möglich, eine praktisch-sittliche Klugheit (phronesis) auszubilden, die ihn dazu befähigt, sich in den unterschiedlichsten Situationen je gemäß der Tugend zu verhalten. Und genau hierin 469 470 471 ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203), 1112 b13 ff. Noch im 18. Jahrhundert wird heißt es dazu heißen: „Weil die Natur des Menschen so beschaffen ist, daß er das Gute begehret, das Böse aber verabscheuet; so sind die in sich guten, oder bösen Handlungen an und vor sich selbst begehrens- oder verabscheungswürdig […].“ WOLFF, Grundsätze des Natur- und Völkerrechts (wie Anm. 362), S. 10. Vgl. ARISTOTELES, Nikomachische Ethik (wie Anm. 203), 1103 a 18 ff. 189 besteht das Telos des Menschen. Denn lediglich der Tugendhafte beschreitet den rechten Weg zu seiner Glückseligkeit, jenem alle Teilziele umfassenden Endziel, in dem er in all seinen Strebungen sein Gut-Sein realisiert hat und zur Ruhe gelangt. Gut ist aber nur derjenige, der auch in den Augen seiner Mitmenschen gut handelt. Die Bestimmung dessen, was als gut zu betrachten ist, wird so der subjektiven Entscheidung entzogen und in die Hand der Lebenswelt gelegt. Die Lebensweltethik, wie sie von Aristoteles konzipiert wird, muss dementsprechend auf der Seite des Beobachters Tugend voraussetzen, um das Gute von dem Schlechten scheiden zu können. Damit verstellt sie sich jedoch der Möglichkeit, zu begründen, warum gerade das Lobenswerte gut, das Tadelnswerte aber schlecht ist. Es bleibt ihr allenfalls der Hinweis auf die Vernunftbegabung der Tugendhaften, die sich gemäß der natürlichen Ordnung zu verhalten wissen, während andere sich zu sehr von ihren Affekten treiben lassen. Es bleibt ihr also allein der Hinweis auf Stratifikation. In der christlichen Theologie wird schließlich die Natur zur Schöpfung degradiert. Der Natur ist nach dieser Vorstellung nicht schon an sich eine Ordnung immanent, deren Vollendung sie spontan aus sich selbst heraus anstrebt. Sie erhält eine solche vielmehr aus dem Willen Gottes. Im Gegensatz zu den Kosmologien der antiken Philosophie steht die Natur hier nicht mehr synonym für das, was von Ewigkeit Bestand hat, sondern sie verdankt sich der Geschichte, die ihren Anfang in der hervorbringenden Tat Gottes nimmt. Vor dieser Tat gab es nur Gott, der unveränderlich in sich selbst ruhte, nach ihr existiert eine Seinsordnung, die einen Endpunkt richtigen Strebens vorgibt. Innerhalb dieser Ordnung werden dem Menschen jetzt ethische Verhaltensanforderungen zugemutet, die nicht mehr – wie noch in der antiken Philosophie – in dessen eigenen Natur begründet liegen. Sein besonderer Rang in der Schöpfung erklärt sich vielmehr aus seiner Verantwortung, dem Willen Gottes auf Erden gerecht zu werden und damit die Ordnung der Dinge in der Zeit zu erhalten.472 Aber diese Gehorsamsverpflichtung macht die weltliche Ordnung im höchsten Maße korrumpierbar. Denn entzieht sich der Mensch dem Willen Gottes, ja stellt er den eigenen Willen dem seines Schöpfers voran, muss auch die weltliche Ordnung zwangsläufig in Unordnung geraten. Mit dem Sündenfall, der „Inszenierung des spezifisch menschlichen Beitrags zur Schöpfung“,473 büßt der Mensch seine in der Vernunft begründete Fähigkeit ein, im unmittelbaren Vernehmen (Erleben) der Worte Gottes einen Habitus des rechten Handelns zu erwerben. Affekte wie Hass, Neid und Hochmut beherrschen fortan sein Leben in der Gemeinschaft. Ohne Gottes gnadenhafte Offenbarung, mit der er dem Menschen die Überwindung der verdorbenen Welt zur Aufgabe macht, sähe sich dieser außerstande, seine eigene Natur zu erkennen und damit nach Perfektion zu verlangen. Anders als noch bei Aristoteles 472 473 Die Natur erhält hier eine normative Konnotation. Ihre Ordnung ist auch im Falle von Verhaltensabweichungen kontrafaktisch zu stabilisieren. Näher dazu vgl. LUHMANN, Niklas: Über Natur. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 4. Frankfurt (Main) 1995, S. 9-30, hier S. 13 f. LUHMANN, Religion der Gesellschaft (wie Anm. 343), S. 264. 190 stellt sich im Christentum allerdings dieses Streben nach Perfektion nicht mehr als ein Ziel dar, das sich bereits im diesseitigen Leben durch die Vollendung des tugendhaften Charakters erreichen ließe. Die mit der Perfektion erlangte Glückseligkeit ist vielmehr ein Geschenk Gottes, der im Jüngsten Gericht darüber befindet, inwieweit sich der Mensch in seinem Verhalten ihrer würdig erwiesen hat. Mit den Tugenden sind diesem also lediglich die Mittel gegeben, Gott gnädig zu stimmen. Nicht die Lebenswelt, sondern Gott ist es, der von ihm die Beachtung des Moralcodes einfordert. Geboren als Sünder liegt es in seinen Händen, um als Heiliger zu sterben, obgleich nur denen eine solche Freiheit zuteil wird, die auch von Natur aus eine Begabung zur Einsicht in den Willen Gottes mitbringen. Alle anderen bedürfen der Kontrolle durch eine innerweltliche Sanktionsgewalt. Dieser Bezug auf Gott, aus dem sich die christliche Ethik herleitet, ist auch für die handlungstheoretischen Überlegungen Thomas von Aquins maßgebend. Ähnlich wie Aristoteles sieht auch Thomas alles Handeln durch ein Ziel bestimmt, welches der Mensch willentlich zu erstreben sucht. „Es ist offenkundig, daß alle Aktivierung, die aus irgendeinem Vermögen [der Seele – J.H.] hervorgehen, von diesem im Hinblick auf den Begriff eines Objekts verursacht sind. Das Objekt des Willens ist aber das Ziel und das Gute. Von daher ist es nötig, daß alle menschlichen Handlungen wegen eines Zieles erfolgen.“474 Die sittliche Qualität einer Handlung hängt also entscheidend von dem Objekt ab, auf das sicht das Wollen richtet.475 Nur wenn das Objekt, dem sich der Handelnde mit seinem Willensakt zuwendet, auch tatsächlich erstrebenswert ist, kann der Handlung eine Sittlichkeit zukommen. Die Handlung als solche erhält somit durch den Gegenstand, auf den sie sich bezieht, ihren sittlichen Wert. Anhand der Objekte lassen sich nun verschiedene Handlungsgattungen differenzieren – das Helfen hat ihr Objekt im Hilfsbedürftigen, das Heilen im Kranken usw. – und hierarchisieren, also gute von schlechten Handlungen unterscheiden,476 wobei in der Praxis die guten Handlungen sowohl durch die üblen Absichten des Handelnden als auch durch die jeweiligen Umstände ihre sittliche Qualität einbüßen können.477 So ist etwa das Almosengeben als ein Akt der Barmherzigkeit an sich gut. Wer aber allein der eitlen Ruhmsucht willen gibt oder wer stiehlt, um überhaupt ein Almosen verteilen zu können, der handelt schlecht.478 Die Sittlichkeit einer Handlung gründet also primär in ihrem Objekt, erst sekundär gibt sie auch Auskunft über den Akteur, der sich ihrer bedient. Welche Objekte sich dabei als besonders begehrungswürdig und welche als begehrungsunwürdig darstellen, hat dessen Vernunft, oder genauer: Klugheit (prudentia), zu entscheiden, der das Vermögen innewohnt, die 474 475 476 477 478 S. th. I-II, q. 1,1. Vgl. S. th. I-II, q. 19,1. Vgl. dazu auch HÖRMANN, Karl: Die Prägung des sittlichen Wollens durch das Objekt nach Thomas von Aquin. In: BÖCKLE, Franz / GRONER, Franz (Hg.): Moral zwischen Anspruch und Verantwortung. Festschrift für Werner Schöllgen. Düsseldorf 1964, S. 233-251. Vgl. S. th. I-II, q. 18,2. Vgl. S. th. I-II, q. 18,4. Vgl. S. th. I-II, q. 19,7 ad 2. 191 Seinsgüte der Objekte zu erkennen und das Wollen an den Geboten Gottes auszurichten. Ausschlaggebend für die Würdigung eines Verhaltens als sittlich ist demzufolge das Befolgen der Naturgesetze, die sich dem Menschen in seiner natürlichen Neigung offenbaren, Gott zu lieben und sich selbst wie auch seine Mitgeschöpfe im Dasein zu halten. Dem Menschen obliegt es also, diese Gesetze nicht nur zu erkennen, sondern sich in seinem Wollen auch an ihnen zu orientieren, gleichwohl ihm dabei die Freiheit bleibt, sich gegen die Vernunft zu stellen, also auch das, was sie als gut erkannt hat, abzulehnen. Entscheidet er sich für die Einhaltung der Naturgesetze, erscheint der menschliche Wille als der Stoff, der durch die Vernunft seine Form erhält und auf den Willen Gottes bezogen wird, sodass „er das will, von dem Gott will, daß er es will.“479 Jedes Verhalten stellt sich folglich als eine Reaktion des Menschen auf die an ihn gerichtete Erwartung dar, das Gute zu suchen und das Schlechte zu meiden. Diese Erwartungshaltung Gottes, mit der sich der Mensch auf einen Horizont von Möglichkeiten zurückgeworfen sieht, lässt ihn zu einer moralischen Person werden, von der man erwarten kann, dass sie aus freien Stücken das Gute will.480 Dabei wird sein durch die prudentia angeleiteter Wille auf eine Zukunft bezogen, die seinem Streben einen Zustand der Ruhe und des Glücks in Aussicht stellt. Mit der Wahl der Mittel verbinden sich, anders gesagt, Ansprüche an das Jüngste Gericht, ein Urteil zu fällen, das der Person und ihrem verdienstvollen Handeln durch die Vergebung ihrer Sünden und ihrer Erlösung im ewigen Paradies auch tatsächlich gerecht wird. Das summum bonum des Lebens, wie es bei Thomas von Aquin im Anschluss an Aristoteles christlich uminterpretiert wurde, erhält bei Luther eine völlig neue Prägung. Das Wozu des sittlichen Handelns sieht sich dabei vom Ziel, Gott gnädig zu stimmen, gelöst und auf die Einheit von Gott und Mensch bezogen. Im Sittlichen bringt sich die Liebe des Menschen zu Gott zum Ausdruck. Diese am Phänomen des Sittlichen orientierte Herangehensweise lässt bei Luther die Frage nach den Voraussetzungen virulent werden, die es dem der Sünde verfallenen Menschen überhaupt erst ermöglichen, ein Leben im Einklang mit Gott zu führen. Um sie beantworten zu können, kehrt er das in der Scholastik ausgearbeitete Verhältnis von Sittlichkeit und Religion um. „Nicht ist die Sittlichkeit das Mittel, um Gott zu gewinnen – eine ‚Gerechtigkeit’ die sich auch vor Gott behaupten wollte, ist superbia und zwar die schlimmste Form der superbia –, sondern umgekehrt: die Gemeinschaft mit Gott ist die Bedingung, unter der wirkliche Sittlichkeit erst möglich ist.“481 Im Vordergrund steht hier also nicht so sehr die Frage, was der Mensch tun soll, um am Jüngsten Gericht vor Gott bestehen zu können, sondern wie er auf die Rechtfertigung Gottes angemessen zu reagieren hat. Luther geht davon aus, dass durch das Erleben der selbstlosen Liebe Gottes 479 480 481 S. th. I-II, q. 19,10. Zum morale esse der Person vgl. Kapitel 3.3. HOLL, Karl: Der Neubau der Sittlichkeit. In: HOLL, Karl: Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. Bd. 1. Luther. Tübingen 1921, S. 131-244, hier S. 153 f. Zur Ethik Luthers vgl. auch ALTHAUS, Paul: Die Ethik Martin Luthers. Gütersloh 1965. 192 beim Menschen ein Affekt ausgelöst wird, mit Gott sein zu wollen. Aus dem Affekt selbst – und nicht etwa aus dem vernünftigen Umgang mit ihm – entspringt der Wille, das eigene Tun und Lassen an der Liebe Gottes zu messen. Der Affekt lässt das Erkennen des wahrhaft Guten in ein Verhalten umschlagen, das die Einheit mit Gott sucht.482 Der sich der Liebe Gottes zuwendende Mensch verfolgt in jedem Moment seines Tuns kein anderes Ziel, als der Gemeinschaft mit Gott zu genügen. Er überwindet auf diese Weise seine durch die Erbsünde verdorbene Natur, deren einziger Antrieb die Erlangung des persönlichen Glücks ist. So sind auch die Gebote Gottes nur für jene gedacht, die auch weiterhin dieser Selbstsucht verfallen bleiben. Denn durch die Gebote Gottes erhalten sie die Möglichkeit, bereits im Jetzt die Kontingenz einer Zukunft zu erfassen, in der das angestrebte Glück erreicht, aber genauso gut auch verfehlt werden kann. Die Alternative des Gehorsams und Ungehorsams befähigt den selbstsüchtigen Menschen also zur prospektiven Kalkulation der Folgen seiner Verhaltenswahl. Doch selbst die, die sich den Geboten Gottes fügen, handeln im Sinne Luthers nicht wahrlich sittlich. Denn stets bleiben sie ihrem Selbstinteresse verhaftet. Erst die Rechtfertigung begründet im Menschen ein neues Leben, das seine Kraft aus der Liebe zu Gott zieht. Wer dessen Liebe erlebt, benötigt keine Gebote, der will das Gute, ohne dafür das Schlechte als Zukunftsoption in Betracht ziehen zu müssen. Luther sieht die Freiheit des Menschen von seiner sündhaften Natur somit erst in dem Moment vollkommen realisiert, in dem sich das Wollen des Guten allein des Gehorsams und nicht des Lohnes willen in einem rechten Verhalten niederschlägt. Die Freiheit des Christenmenschen besteht also nicht in dessen Möglichkeit, zwischen dem Guten und dem Schlechten zu wählen, seine Freiheit äußert sich vielmehr in dem Fehlen seiner selbstsüchtigen Begierden. Die Pflicht, die sich dem Menschen in seinem Beruf stellt, ist nichts, was er mangels wahrer Alternativen schweren Herzens zu ertragen hat. In dem selbstlosen Dienst am Nächsten erlangt er vielmehr die Gewissheit, nicht nur ein nützliches Glied der christlichen Gemeinschaft, sondern von Gott für das ewige Heil bestimmt zu sein. Er erfährt sich als ein Werkzeug, mit dem Gott seinen Willen auf Irden vollendet. Schon bei Luther werden erste Tendenzen erkennbar, das naturteleologische Handlungskonzept der alteuropäischen Tradition, wenn auch nicht einer ausnahmslosen Revision, so doch einer punktuellen Kritik zu unterziehen. Der Sündenfall hat den Menschen verdorben und ihn zum Handlanger seines eigenen Glücks gemacht. Angesichts der Verworfenheit seiner Natur lässt sich das Bild eines in ihm selbst angelegten Strebens nach moralischer Perfektion kaum mehr aufrechterhalten. Gleichwohl hegt auch Luther weiterhin die Hoffnung, die Selbstsucht des Menschen sei durch Gott zu überwinden. Aber dieses Vertrauen in die Gnade Gottes verliert im Übergang zur Modernen nach und nach an Plausibilität. Der Mensch hat nun mit der Natur zu 482 Die Affektlehre Luthers findet sich dargestellt bei MÜHLEN, Karl-Heinz zur: Die Affektlehre im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. In: Archiv für Begriffsgeschichte 35 (1992), S. 93-114. 193 leben, die ihm gegeben wurde. Und die Frage lautet dann nur: Wie ist ihm dies in der Gesellschaft möglich? Bereits bei Luther finden sich zwei alternative Antwortmöglichkeiten auf diese Frage vorgezeichnet, die beide indes noch auf die allsorgende Güte Gottes verweisen. Seit dem 17. Jahrhundert tritt aber unverkennbar eine Entwicklung in Gang, Gott bei der Lösung des Problems sozialer Ordnung völlig außen vor zu lassen. Der eine Argumentationsstrang setzt an den egoistischen Handlungsmotiven der Individuen an und betont entsprechend die Notwendigkeit, mögliche konfligierende Handlungsfolgen durch einen allgemeinverbindlichen Gesellschaftsvertrag zu unterbinden. Der andere geht von altruistischen Gefühlsdispositionen aus, durch die das Individuum in seiner Selbstliebe an dem Wohlergehen seiner Mitmenschen rückgebunden bleibt. Beiden Argumentationen ist der Versuch gemein, die Sozialordnung aus sich selbst heraus zu begründen, ohne dabei noch auf einen Willen Gottes abstellen zu müssen. Diese veränderte Zugangsweise zum Problem der sozialen Ordnung spiegelt sich unweigerlich auch in den Handlungstheorien jener Zeit wider, die nun verstärkt der Anforderung zu genügen haben, das Spannungsverhältnis von ungezügelter Selbstliebe (Egoismus) und uninteressiertem Wohlwollen (Altruismus) miteinander zu versöhnen. Am eindringlichsten hat wohl zunächst Thomas Hobbes seine Skepsis gegenüber einer im Willen Gottes verbürgten Sozialordnung zum Ausdruck gebracht. Hobbes ersetzt dabei das naturteleologische durch ein mechanistisches Handlungskonzept. Nicht Finalursachen, sondern Wirkursachen sind es, die den Menschen in seinen Handlungen antreiben. Ob sich diesem ein Objekt – eine Sache oder Person – als angenehm oder unangenehm darstellt, hängt allein davon ab, inwieweit es seiner Selbsterhaltung nutzt oder schadet. Für sich betrachtet verfügt das Objekt also über keinen anzustrebenden Wert, der sich aus dessen Stellung in der natürlichen Ordnung ableiten ließe. Anders als noch Luther betrachtet Hobbes die Selbstsucht nicht mehr als eine Abweichung von einem moralischen Perfektionszustand, in dem sich das Individuum in selbstloser Liebe der Hilfsbedürftigkeit seiner Mitmenschen hingibt. Sie erklärt sich ihm vielmehr unmittelbar aus dessen Trieb zur Selbsterhaltung. Mit dieser Hinwendung zu einem physikalischen Handlungsbegriff büßt die Natur unweigerlich ihre Bedeutung als „Kontingenzabwehrbegriff“483 ein, anhand dessen es die alteuropäische Tradition noch vermochte, das menschliche Wollen über die Angabe eines feststehenden Sollens zu beschränken. Wenn die Natur aber keine hinreichenden Anhaltspunkte mehr für die Kontrolle der möglichen Reaktionen auf einen wahrgenommnen Reiz liefert, wie kann man dann noch zu einer Entscheidung darüber gelangen, was in einer bestimmten Situation zu tun ist? Diese Lücke füllt zunächst die Prudentia. Sie wird dabei jedoch „aus der lebensethischen Mitte gerückt. Sie besitzt nicht mehr den Charakter der Lebensführungskompetenz. Das Leben verwandelt sich in eine Abfolge von Handlungen, die in einer Welt 483 LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 424. 194 der Kontingenz mit dem Mißerfolgsschicksal bedroht sind. Klugheit nimmt vor diesem Hintergrund die Gestalt einer providentiellen, interessendienlichen Kontingenzbewältigungtechnik an.“484 Sie gründet auf dem individuellen Geschick des Akteurs, die für die Erreichung eines selbst gesetzten Zwecks dienlichen Mittel zu ergreifen. Die Klugheit verliert infolgedessen ihre stratifikatorische Imprägnierung.485 Sie ist nicht mehr Ausdruck einer außergewöhnlichen Begabung, das Gute und Tugendhafte im Leben zu verwirklichen. In ihr kommen vielmehr Erfahrungen zur Anwendung, die sich der Mensch im Umgang mit spezifischen Handlungsproblemen in der Zeit angeeignet hat.486 Um die zukünftigen Folgen eines gegenwärtigen Verhaltens kalkulieren zu können, muss er sich der Handlungsalternativen erinnern, die ihm in ähnlichen Situationen bereits in der Vergangenheit offen gestanden haben. Allerdings bleibt die Zukunft dabei immer eine „Fiktion des Geistes“487, sodass man sich letztendlich niemals gewiss sein kann, ob alles auch tatsächlich so eintrifft, wie es beabsichtigt wurde. „So ist also jeder, besonders aber die Übervorsichtigen, in der gleichen Lage wie Prometheus. Denn wie Prometheus, d.h. der Weitsichtige [...], so nagt auch die Furcht vor Tod, Armut oder einem anderen Unglück den ganzen Tag über am Herzen des Menschen, der aus Sorge über die Zukunft zu weit blickt, und er hat vor seiner Angst nur im Schlafe Ruhe.“488 Und genau diese vorausschauende Sorge um die eigene Zukunft ist es, die das selbstische Individuum zur Einsicht gelangen lässt, dass es seiner Selbsterhaltung durchaus nutzt, wenn es seine natürliche Freiheit aufgibt und sich dem natürlichen Gesetz verpflichtet, alles zu unterlassen, was den Frieden mit seinen Mitmenschen gefährdet. Nicht nur im Schlaf oder in Gott, sondern auch in der Gesellschaft hofft der Mensch von nun an vor seiner unablässigen Zukunftsangst Ruhe zu finden.489 Die Grundannahmen, von denen Thomas Hobbes ausgeht, machen eins deutlich sichtbar: Ob sich ein Verhalten als sittlich darstellt oder nicht, hängt allein von den Urteilen ab, mit denen ein Beobachter den Folgen des Verhaltens einen Wert für sich selbst oder für andere beimisst. Allgemeingültige Werturteile lassen sich dabei aus der egoistischen Natur des Menschen selbst nicht deduzieren, sondern bedürfen einer normsetzenden Instanz – sei es dem Monarchen oder der öffentlichen Meinung –, die unter Berücksichtigung des gemeinen Nutzens aller Gesellschaftsmitglieder festlegt, was gut und was böse ist. Das Sittliche 484 485 486 487 488 489 KERSTING, Wolfgang: Einleitung. Rehabilitierung der Klugheit. In: KERSTING, Wolfgang (Hg.): Klugheit. Weilerswist 2005, S. 7-11, hier S. 7. Das hierzu gehörende Argument lautet nun: „Eine Familie oder ein Königreich gut regieren heißt nicht verschiedene Grade von Klugheit besitzen, sondern verschiedene Geschäfte ausüben – so, wie ein Bild in kleinem Format, in Lebensgröße oder größer malen keine verschiedenen Grade von Kunst sind. Ein einfacher Bauer ist in häuslichen Angelegenheiten klüger als ein Geheimrat in den Angelegenheiten eines anderen.“ HOBBES, Leviathan (wie Anm. 358), S. 55. Vgl. ebd., S. 55 u. 94. Ebd., S. 21. Ebd., 82 f. Dass sich freilich die Realität dabei ganz anders darstellen kann als ersehnt, liegt schon im Anspruch selbst begründet! 195 wird somit im Bereich kollektiv bindender Entscheidungen auf eine Rechtskonformität verkürzt.490 Die Theorie der moral sentiments wendet sich gegen diese Vorstellung, nach der das Sittliche lediglich Gegenstand überindividueller Gesetze sei, die uns vorschreiben, was wir zu tun und was wir zu unterlassen haben.491 Die Kriterien, anhand derer wir ein Verhalten billigen oder missbilligen, können zwar, so lautet jetzt das Argument, durchaus in Gesetzen oder auch religiösen Geboten zementiert werden. Entscheidend aber ist, dass ihnen innere Erfahrungen, genauer: moralische Gefühle, voraus liegen müssen, die uns ein Verhalten erst als gut oder schlecht erscheinen lassen. Diese moralischen Gefühle sind reaktive Einstellungen auf Affekte, die wir unserem Interaktionspartner in seinem Erleben der Welt unterstellen. Sittliche Werturteile kommen also dann zustande, wenn wir die Affekte unseres Gegenübers, die durch ein bestimmtes Objekt ausgelöst werden, reflektieren und dabei zugleich Gefühle der Zustimmung bzw. Ablehnung empfinden. Solche Gefühle bilden die Grundlage, von der aus wir die handlungsleitenden Motive einer Person als für eine Situation angemessen oder unangemessen befinden. Während die Vernunft einzig dazu imstande ist, die zur Erreichung eines bestimmten Ziels erforderlichen Mittel auszuwählen – also etwa den Selbsterhalt über das Erlassen eines Gesellschaftsvertrages sicherzustellen –, so werden wir doch erst durch das moralische Gefühl von der Angemessenheit des verfolgten Handlungsziels – der Selbsterhaltung – überzeugt. Solche Gefühle, welche die Eigeninteressen der Interaktionspartner partiell überwinden, werden uns nicht von außen aufoktroyiert. Es sind also weder Eigenschaften der wahrgenommenen Objekte noch drückt sich in ihnen ein göttlicher Wille aus. Vielmehr gründen sie in unserer eigenen Natur, die uns mit dem moral sense bzw. der Sympathie eine Fähigkeit verliehen hat, über das Empfinden von Freude und Schmerz an der Lebenssituation unserer Mitmenschen teilzuhaben. Deutlich tritt mit dieser Verlagerung des moralischen Wissens in das Innerste des Menschen das Anliegen zum Vorschein, die Bedingungen der Möglichkeit sozialer Ordnung aus einer objektiven, die Handlungsfreiheit disziplinierenden Struktur in die Interaktionspartner selbst zu verlegen. Allerdings ist man sich jetzt durchaus der enormen Komplexität bewusst, die der sozialen Beziehung zwischen Alter und Ego innewohnt. Man beginnt zu erkennen, dass in einer Interaktion sowohl Ego als auch Alter die Position eines Alter Egos einnimmt, dass sich also Egos Handlungsziele ohne die Miteinbeziehung der Erwartungen Alters und Alters Handlungsziele ohne die 490 491 So heißt es entsprechend bei John Locke: „Gut und übel sind [...] nur Freude und Schmerz oder das, was uns Freude und Schmerz verschafft oder verursacht. Das moralisch Gute oder Üble ist demnach nur die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung unserer willkürlichen Handlungen mit einem Gesetz, wodurch wir uns nach Willen und Macht des Gesetzgebers Gutes oder Übles zuziehen. Dieses Gute und Üble, Freude oder Schmerz, die so nach Anordnung des Gesetzgebers auf die Beachtung oder Übertretung des Gesetzes folgen, nennen wir Lohn und Strafe.“ LOCKE, John: Über den menschlichen Verstand. In vier Büchern. Bd. I: Buch I und II. Hamburg 1968, S. 442. Zur Diskussion unterschiedlicher Ansätze der Theorie der moral sentiments vgl. SMITH, Theorie der ethischen Gefühle (wie Anm. 302), S. 535 ff. 196 Miteinbeziehung der Erwartungen Egos kaum erfüllen lassen. Wer unter diesen Bedingungen (der doppelten Kontingenz) bei seinem Gegenüber ein Gefühl der Sympathie hervorrufen will, der kann dies nur erreichen, „wenn er seinen Affekt auf jenen Grad herabstimmt, bis zu welchem die Zuschauer mitzugehen vermögen. Er muß, wenn ich so sagen darf, die Heftigkeit des Tones dämpfen, den dieser Affekt von Natur aus hat, um denselben in Harmonie und Einklang mit den Gefühlen derer zu bringen, die um ihn sind.“492 Die Kontrolle des Affekts obliegt hier nicht mehr einer Klugheit, deren eigentümliches Vermögen es ist, die natürlichen Moralprinzipien zu erkennen. Die Klugheit erscheint demgegenüber als eine Fähigkeit zur Reflexion von Wertorientierungen, mit der man zu sich selbst in Distanz tritt und sich den Blickwinkel vergegenwärtigt, aus dem heraus der Interaktionspartner die eigene Lebenssituation wahrnimmt. Dabei dient ihr die Kalkulation zukünftiger Handlungsfolgen als maßgebliches Kriterium, um das eigene Welterleben einer Selbstbeherrschung zu unterwerfen.493 Auch wenn die Ursache eines Affekts jenseits dessen liegt, was wir kontrollieren können, so haben wir es doch selbst in der Hand, den Affekt in eine Form zu bringen, die bei unseren Mitmenschen Akzeptanz findet. Wer in einer Gesellschaft, in der Arbeit knapp ist, an seiner Arbeitslosigkeit verzweifelt und sich apathisch seinem Lebensschicksal ergibt, muss damit rechnen, als ein Sozialschmarotzer hingestellt zu werden, der das hart erarbeitete Geld anderer Leute aus deren Taschen zieht. Wer dahingegen glaubhaft den Eindruck vermittelt, dass er trotz seiner steten Bemühungen, ins Arbeitsleben zurückzukehren, keine Arbeit findet, der ist ein bedauernswertes Opfer seiner Umstände und kann sich der Unterstützung durch die Gesellschaft gewiss sein. Und so wie derjenige, der auf die Sympathie anderer spekuliert, deren Beobachtungen beobachten muss, so hat auch derjenige, der ein Verhalten moralisch beurteilt, von sich als Individuum zu abstrahieren und den Standpunkt eines parteilosen Zuschauers einzunehmen.494 Nur mittels dieses prüfenden Blicks von Außen auf seine eigene Person vermag er seinem Urteil das Prädikat einer Allgemeingültigkeit zu verleihen. 492 493 494 Ebd., S. 24. Vgl. ebd., S. 323 ff. Vgl. ebd., S. 166 ff. 197 4.2.2.3 Bedürftigkeit In das Verhaltensschema konstant/variabel haben sich die Semantiken des Lebensnotwendigen und des Bedürfnisses eingeschrieben, mit denen sich genauer begrenzen lässt, wer unter die Kategorie der Bedürftigen zu subsumieren ist. Als bedürftig werden all jene Personen erachtet, die bei der Erlangung des Lebensnotwendigen auf Dritte angewiesen sind, ohne dabei selbst eine Gegenleistung für die erhaltene Hilfe erbringen zu können. Entscheidend ist nun zu sehen, dass die Aussicht, die Bedürftigkeit des Bettlers durch die Gabe eines Almosens zu überwinden, maßgeblich davon abhängt, auf welcher Seite des Schemas man das Lebensnotwendige und das Bedürfnis verortet. Begreift man das Bedürfnis als eine Abweichung von einer statischen Größe des Lebensnotwendigen, für die vormoderne Gesellschaften Begriffe wie indigentia, necessitas bzw. Notdurft bereithielten,495 so lässt es sich mehr oder minder mit Armut assoziieren. Das Label Armut fungiert hier als Zeichen für das Vorhandensein von Bedürfnissen. Definiert man dahingegen das Lebensnotwendige als einen veränderlichen Wert, der am jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungsstand zu bemessen ist, erscheint das Bedürfnis als eine allgemeine Triebkraft, die sich im jeweiligen Individuum partikularisiert. In diesem Modell lassen sich dann konstante, allen Gesellschaftsmitgliedern gemeinsame und variable, dem jeweiligen sozialen Status entsprechende Bedürfnisse voneinander scheiden. „Arm ist in diesem weiteren Sinne jeder, welcher nicht im Stande ist, diejenigen Bedürfnisse für sich und die Seinigen zu befriedigen, ohne welche ihr Dasein den an das Leben eines civilisierten Menschen zu machenden Anforderungen nicht entspricht. [...] Der Begriff dessen, was als Zustand der Armuth anzusehen ist, ändert sich so mit den Kulturzuständen, mit dem Wohlstande der einzelnen Völker und es wird bei fortschreitender Kultur und zunehmendem Volkswohlstande als Armuth empfunden, was früher als gewöhnliche Lebensweise ohne Murren ertragen worden ist.“496 Allerdings wird in den Gesellschaftsbeschreibungen des 18. und 19. Jahrhunderts dieser Steigerungszusammenhang von allgemeinen Bedürfnissen und Zivilisation nicht uneingeschränkt positiv aufgenommen. So beanstandet etwa Justus Möser, dass zu den „Bedürfnissen eines Bettlers“497 inzwischen sogar Kaffee, Zucker, Tee und Weizen gehöre. Durch die Gabe lässt sich der Bettler nunmehr nicht einfach in einen Zustand zurückversetzen, in dem ihm das zum Leben Notwendige gegeben ist. Mit der Befriedigung seiner Bedürfnisse werden in ihm vielmehr neue Begehrlichkeiten geweckt, die ihn wiederum von 495 496 497 Zum Zusammenhang von Notdurft und Bedürfnis vgl. auch SZÖLLÖSI-JANZE, Margit: Notdurft - Bedürfnis. Historische Dimensionen eines Begriffswandels. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48 (1997), S. 653-674. Zur Tradition des necessitas-Begriffs vgl. PICHLER, Johannes W.: Necessitas. Ein Element des mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechts. Dargestellt am Beispiel österreichischer Rechtsquellen. Berlin 1983. BITZER, Friedrich: Das Recht auf Armenunterstützung und die Freizügigkeit. Ein Beitrag zu der Frage des allgemeinen deutschen Heimathrechts. Stuttgart / Oehringen 1863, S. 43 f. MÖSER, Justus: Gedanken über den Verfall der Handlung in den Landstädten. In: MÖSER, Justus: Patriotische Phantasien. Sämtliche Werke. Bd. 4. Oldenburg 1943, S. 15-28, hier S. 23. 198 dem Ertrag seines Bettelns abhängig machen. Wie konnte es aber zu diesem Bedeutungswandel im Verhältnis von Bedürfnissen und Lebensnotwendigen kommen? Die Akzentverschiebung von dem ersten zum zweiten Modell verläuft parallel zu einer im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert sich vollziehenden Temporalisierung des Wirtschaftssystems. Dessen Leistungen werden jetzt nicht mehr auf den Erhalt der bis dorthin relativ statisch gedachten ökonomischen Hausgemeinschaften bezogen. Das Wirtschaftssystem hat vielmehr für die Befriedigung der sich stets im Wandel befindlichen Bedürfnisse der Gesellschaftsmitglieder zu sorgen. In der modernen Gesellschaft nehmen Bedürfnisse einen universellen ökonomischen Rang ein, der sich daraus begründet, dass sich nahezu jedes menschliche Verhalten letztendlich auf ein wirtschaftlich verwertbares Bedürfnis zurückführen lässt. Nach Kim-Wawrzinek setzt sich der Begriff dabei aus drei Komponenten zusammen, deren historische Wurzeln teilweise bis in die antike Philosophie zurückreichen.498 Erstens beschreibt das Bedürfnis etwas Unerlässliches, Notwendiges und schließt damit an eine durch die christliche Theologie vermittelte Tradition an, das für die Lebenserhaltung Unentbehrliche vom Luxus, Überflüssigen und Disponiblen abzugrenzen. Daneben kann das Bedürfnis zweitens als ein momentan-aktuelles Problem wahrgenommen werden, insofern es auf etwas verweist, das man eigentlich bedarf, über das man aber gerade nicht verfügt. Diese Auffassung einer durch die jeweiligen Umstände legitimierten Angemessenheit des Bedürfnisses greift auf typisch vormoderne Vorstellungen politischer Zielsetzung zurück, die an der Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Gleichgewichts gesellschaftlicher Verhältnisse, der guten policey, orientiert waren und entsprechend vorsahen, jeweils nach den Erfordernissen der Zeit die Gesetze zu ändern oder auch neu zu erlassen. Als dritte Komponente haftet dem Bedürfnis der Beiklang einer seelischen Triebkraft an, der an antike und mittelalterliche Affektlehren mit ihrer Betonung von Glück, Lust und Unlust als Movens des Verhaltens erinnert. So heißt es bereits bei Aristoteles: „Bedürfnisse aber sind Begehrungen und unter diesen vorzugsweise die, die bei Nicht-Erlangen mit Schmerz verbunden sind.“499 Mit dem Akutwerden eines Bedürfnisses wird also im Menschen ein Begehren geweckt, das nach einer Befriedigung oder aber nach seiner Beherrschung bzw. Unterdrückung verlangt. Im Vergleich zu dieser Bedeutungsvielfalt des modernen Bedürfnisbegriffs nimmt das Nomen Notdurft im heutigen Sprachgebrauch allenfalls noch die Bedeutung der Ausscheidung körperlicher Exkremente an, während das Adjektiv notdürftig auf etwas Provisorisches, Behelfsmäßiges und kaum Ausreichendes verweist. Es stellt sich an dieser Stelle also die Frage, warum – und vor allem: wie es der Semantik des Bedürfnisses gelang, sich die Bedeutungsinhalte der Notdurft anzueignen und diese zugleich 498 499 Vgl. KIM-WAWRZINEK, Uta: Bedürfnis. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 1. Stuttgart 1972, S. 440-466. ARISTOTELES: Rhetorik. München 1995, 1385 a. 199 in einen neuen Kontext zu stellen? Ich gehe im Weiteren davon aus, dass die semantische Entkopplung des Bedürfnisses von der Notdurft der Ausdifferenzierung eines autonomen Wirtschaftssystems an der Wende zum 19. Jahrhundert und der damit einhergehenden Verselbständigung der Zeitdimension von Sinn folgt. Für die weitere Argumentation stellt sich also zunächst die Aufgabe, die zeitlichen Implikationen der vormodernen Semantiken der Notdurft und des Bedürfnisses näher darzustellen. In seinem Grammatisch-kritischen Wörterbuch aus dem Jahre 1798 definiert Adelung Notdurft noch als „dasjenige, was zur Erhaltung des natürlichen Lebens unentbehrlich nothwendig ist, und so viel als unentbehrlich dazu erfordert wird.“500 Die Semantik der Notdurft verweist in diesem Zusammenhang auf etwas Notwendiges, und zwar im Sinne eines Mindestwertes, dessen Unterbzw. Überschreitung über einen bestehenden Mangel bzw. Überfluss Auskunft gibt. Entsprechend beschreibt Adelung Mangel als einen Zustand der „Abwesenheit der Nothdurft, der unentbehrlichsten Nahrungsmittel“,501 in den der Mensch geraten und an dem er leiden kann, wohingegen Überfluss „ein größerer Vorrath an zeitlichen Gütern [meint – J.H.], als man zur Notdurft und Bequemlichkeit bedarf.“502 Mangel wird somit als der fehlende Teil dessen verstanden, was der Mensch benötigt, um seine Notdurft und damit die natürlichen Unentbehrlichkeiten seines Lebens zu stillen. Versteht man Mangel in dieser Weise in Ausrichtung auf etwas objektiv Notwendiges, dann ist mit der Semantik des Bedürfnisses nichts anderes als ein Ungleichgewicht im Verhältnis des Ganzen zu seinen Teilen gemeint, das durch die Bereitstellung des abwesenden Teils, an dem es mangelt, behoben werden kann. Die Wiederherstellbarkeit des Ganzen liegt in dessen Beständigkeit begründet, die zwar Abweichungen in der Zeit zulässt, die aber durch das menschliche Verhalten selbst nicht zu beeinflussen ist. Weil die Notdurft in der Vergangenheit die gleiche war wie sie in der Zukunft sein wird, steht sie außerhalb der Zeit und fungiert damit als Wesenskonstante des Menschseins, als Norm und Ausdruck einer zeitlosen Ordnung. Eine Annäherung an das, was die Notdurft ist, kann dabei allenfalls über ihre Negation, also das, was sie nicht ist, erfolgen, nämlich: Überfluss und Luxus auf der einen und Mangel auf der anderen Seite. Als das Dazwischenliegende ist sie ein Bestandteil beider Seiten, sie muss aber gerade deswegen weitestgehend unbestimmt bleiben. Differenztheoretisch gewendet ist die Notdurft das eingeschlossen ausgeschlossene Dritte, der Parasit, welcher der Differenz von Überfluss und Mangel zugrunde liegt, ohne aber selbst einer der beiden Seiten exklusiv zugeordnet werden zu können. Die Differenz schließt gerade die Notdurft aus, und doch ist es die Notdurft, die erst die Diffe500 501 502 ADELUNG, Johann Christoph: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen. Bd. 3 M-Scr. Hildesheim 1979 [ND Leipzig, 1798], S. 527-528, hier S. 528. Ebd., S. 49. ADELUNG, Johann Christoph: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen. Bd. 4 Seb-Z. Hildesheim 1979 [ND Leipzig, 1801], S. 750-751, hier S. 751. 200 renz erzeugt, um sich gleichzeitig von ihr abzuheben. Interessant ist nun zu sehen, auf welche Weise stratifikatorisch differenzierte Gesellschaften dieses Paradox des eingeschlossen ausgeschlossenen Dritten entfalten. Um das bestimmen zu können, was als lebensnotwendig und damit als zeitlich invariant zu erwägen ist, haben sie zwei unterschiedliche Strategien der Paradoxieentfaltung entwickelt. Bei der ersten Strategie wird die Notdurft sozial differenziert und als das erforderliche Auskommen für die Zugehörigkeit zu einem Stand ausgewiesen. Noch Mitte des 18. Jahrhunderts sieht der Polizeiwissenschaftler Justi das Vermögen und den Überfluss eines Menschen in Abhängigkeit davon, wie sich dieser „alle Nothdurft und Bequemlichkeiten des Lebens seinem Stande gemäß verschaffen kann. [...] Ein reicher Bauer würde deshalb kein reicher Kaufmann seyn, oder ein reicher Edelmann würde vielleicht nur einen vermögenden Grafen vorstellen: so wie ein Vornehmer einige tausend Thaler im Vermögen haben kann, die einen Menschen von geringem Stande reich machen würden; denn ein Vornehmer brauchet nach der Lebensart der Menschen so viel zu seiner unumgänglichen Nothdurft, daß sich ein Mann von geringem Stande dabey in allem Überfluß befinden würde.“503 Zwar lassen sich bei Justi bereits Textstellen nachweisen, die den Bereich dessen ausdehnen, was die Notdurft umfasst, insoweit sie die Bequemlichkeit, die Commodität, in einem Atemzug mit ihr nennen und im Gegensatz zu älteren Auffassungen als legitimes Anliegen menschlichen Strebens erachten. Worauf es aber hier ankommt, ist die Einsicht, dass die standesgebunde Begrenzung der Notdurft bis in das 18. Jahrhundert hinein ihre Geltung nicht verliert. Jedem Mitglied eines Standes kommt dabei die eigenverantwortliche Aufgabe zu – die Pflicht gegen sich selbst, wie es in den Quellen zumeist heißt –, sich mit dem standesgemäßen Unterhalt zu versorgen.504 Die zweite Strategie der Paradoxieentfaltung macht die Beschaffung der Notdurft zur Obliegenheit von Lebens- und Wirtschaftseinheiten, den so genannten Häusern, und ihren jeweiligen Hausvätern. Der Hausvater hat dabei als höchste Autorität Sorge dafür zu tragen, dass die entsprechenden Mittel, die zur Gewährleistung der Notdurft benötigt werden, innerhalb des Hauses bereitstehen und keines der Mitglieder in der Erbringung von Leistungen (Steuerabgaben, Arbeit etc.) über Gebühr seiner ihm zukommenden Pflichten beansprucht wird. Über ein solches Konzept der „Hausnotdurft“505 lassen sich Abstufungen des ökonomischen Bedarfs einer Familie, Grundherrschaft oder Stadt einführen. Immer aber gebührt 503 504 505 JUSTI, Johann H. G.: Staatswirthschaft oder Systematische Abhandlung aller ökonomischen und Kameralwissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden. Bd. 1. Aalen 1963 [ND Leipzig, 1758], S. 450. Die Maßgaben zur Erfüllung dieser Pflicht finden sich seit dem Mittelalter durch religiöse Direktiven vorgezeichnet. Das Gebot der Mäßigung des Lebenswandels oder ausschließlichen Verwendung zeitlicher Güter zum Zwecke des Lebensunterhalts und – damit eng verbunden – das Verbot des gewinnorientierten Erwerbs sind nur einige religiöse Vorschriften, die in diesem Zusammenhang zu erwähnen sind. Vgl. BLICKLE, Renate: Hausnotdurft. Ein Fundamentalrecht in der altständischen Ordnung Bayerns. In: BIRTSCH, Günter (Hg.): Grund- und Freiheitsrechte von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft. Göttingen 1987, S. 42-64; BLICKLE, Renate: Nahrung und Eigentum als Kategorien in der ständischen Gesellschaft. In: SCHULZE, Winfried: Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität. München 1988, S. 73-93. 201 dem Hausvater die Aufgabe, über die auskömmliche oder ziemliche Nahrung der Mitglieder des Hauses zu wachen.506 Das Verschiebungen innerhalb der Semantik, mit der eine Gesellschaft das Lebensnotwendige bestimmt, sich unmittelbar auch auf das niederschlagen, was sie als Mangel des Lebensnotwendigen erachtet, ist trivial und nicht weiter erklärungsbedürftig. Aber wie selbstverständlich dieser Zusammenhang auch sein mag, so bleibt doch völlig unklar, warum Gesellschaften überhaupt eine solche Differenz einführen? Warum konfrontieren sie sich mit dem daraus erwachsenden Problem, sowohl das Umschlagen von der einen zur anderen Seite als auch die Einheit der Differenz erklären zu müssen. Gewiss, auf die Frage, ab wann eine Person beginnt, sich in einer Situation des Mangels bzw. des Überflusses zu befinden, lässt sich mit dem Hinweis auf das Standesgemäße und die auskömmliche Nahrung reagieren. Jedoch wird hiermit nur die eine Seite des Problems, nämlich die Aufdeckung des durch die Differenz Unterschiedenen, berührt. Welche Unterscheidung liegt aber der Unterscheidung von Lebensnotwendigen und Mangel/Überfluss zugrunde? Oder noch etwas abstrakter formuliert: Wodurch erhält das Differente seine Form? In dieser Frage nach der Einheit der Differenz klingt das zentrale Problem an, wie die Differenz von Lebensnotwendigen und Mangel/Überfluss aus ihrer Einheit hervorgehen konnte. Welcher Teil der Unterscheidung bewahrt die Kontinuität zum Ursprung, ist sozusagen Repräsentant des Ganzen im System, so wie der Mann zum Menschen schlechthin avanciert, weil er als Sohn Gottes nach seinem Bilde geformt wurde, während Eva geboren aus einer männlichen Rippe dem Göttlichen niemals so nahe stehen kann wie ihr Gefährte. Bezeichnet also der Mangel die Abweichung vom Lebensnotwendigen oder umgekehrt: das Lebensnotwendige die Abweichung vom Mangel? Und ist das Verhaltensschema konstant/variabel selbst konstant oder variabel? Der historische Blick auf diesen Fragekomplex zeigt, dass Gesellschaften ganz unterschiedliche Erklärungsmuster anbieten, um darlegen zu können, wie aus einem Weltzustand, in dem allen Menschen das Lebensnotwendige gegeben war, die Differenz von Lebensnotwendigen und Mangel erwachsen konnte. Alle Erklärungsmuster haben dabei eins gemein: Es geht ihnen um die Begründung des Anfangs einer sozialen Ordnung. Der Mensch wird in solchen Beschreibungen als ein Mängelwesen konzipiert, das der Gesellschaft bedarf, um sich mit dem Lebensnotwendigen versorgen zu können. Dieser anthropologische Minimalkonsens, der sich von der Antike bis in die Gegenwart hinein fortschreibt, verbindet sich mit der Vorstellung eines der Gesellschaft inhärenten Telos, mit dem das soziale Zusammenleben der Menschen auf eine vollkommene, alle Mangelzustände aufhebende Einheit ausgerichtet wird. Wodurch letztendlich der 506 So sah Georg Obrecht die Aufgabe der Obrigkeit darin, für den notwendigen Unterhalt ihrer Untertanen zu sorgen. Als Voraussetzung dieser Verpflichtung betrachtet er, „Gelt und Gut gebührlicher weiß zu erlangen“, und zwar durch Vermeidung sowohl „aller unnothwendigen und überflüssigen Außgaben“ seitens der Beamten als auch der Verschwendung der „zeitliche[n] Narung“ durch „obermessiger Fullerey un Trunckenheit“ der Bevölkerung. OBRECHT, Secreta Politica (wie Anm. 232), S. 45 u. 79 f. 202 Mangel hervorgerufen wurde und in welcher Form die Gesellschaft imstande ist, für einen Ausgleich zu sorgen, hängt freilich von den Unterscheidungen ab, mittels derer der Anfangs- bzw. Endpunkt und damit zugleich auch der höhere Sinn des Gesellschaftslebens festgelegt wird. Die mittelalterliche Theologie löst das Problem des Anfangs der Welt mit dem Hinweis auf einen in absoluter Freiheit handelnden personalen Gott. Die Welt erscheint hier als Resultat einer Schöpfung, einer creatio ex nihilo. Ihre Wirklichkeit beruht nicht auf einer eigenen inneren ewigen Ordnung, sondern sie verfügt über ein Sein, weil Gott sie aus dem Nichts – mittels seiner Beobachtungen – hervorbringt. Während der Schöpfungsmythos auf die Schwierigkeit, wie man sich den Ursprung des Seins vorstellen kann, mit „der Annahme eines ‚big bang’, einer ersten Differenz“507 zwischen Gott und seiner Schöpfung antwortet, begründet der Mythos des Sündenfalls den Anbeginn der nachparadiesischen Gesellschaftsordnung aus dem Paradies selbst.508 Ein sehr anschauliches und für die theologischen Diskurse des Mittelalters folgenschweres Bild vom Paradies hat dabei Augustinus in seinem Werk Vom Gottesstaat gezeichnet: „Es lebte also der Mensch im Paradiese, wie er wollte, solange er wollte, was Gott befohlen hatte. Er lebte im Genusse Gottes, des guten, durch den er gut war. Er lebte ohne Mangel und hatte es in seiner Macht, immer so zu leben. Speise war da, daß ihn nicht hungerte, Trank, daß er nicht dürstete, der Baum des Lebens, daß ihn Siechtum des Alters nicht beschlich. Nichts, was schadhaft gewesen wäre, sei es in seinem Leibe, sei es von seiner Leiblichkeit ausgehend, bereitete einem seiner Sinne irgendwelche Beschwer. Keine innere Krankheit, kein Schlag von außen war zu befürchten. Im Fleische höchste Gesundheit, im Geiste volle Ruhe. Wie es im Paradiese weder Hitze noch Kälte gab, drohte auch dem guten Willen seines Bewohners keine Gefahr, weder von Begierde noch von Furcht. Trauer fehlte ganz und gar, auch eitele Freude gab es nicht. Aber die wahre Freude aus Gott herrschte ununterbrochen, und für ihn war entbrannt die Liebe, die aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Die Ehegatten verband treue Gemeinschaft in ehrbarer Liebe. Einträchtig gab man Obacht auf Leib und Seele, und ohne Mühe erfüllte man das Gebot. Muße erschlaffte nicht, und nicht wider Willen stellte Schlafbedürfnis sich ein.“509 Das Paradies wird hier als ein Ort beschrieben, an dem sich die Unterwerfung des Geistes unter Gott wie auch des Leibes unter den Geist in vollkommener Weise realisiert, an dem Herrschaft ohne Zwang, Nahrungsaufnahme ohne Hunger, Arbeit ohne Mühe, Altern ohne Tod, ein Wille ohne Lust und Unlust möglich ist. So mangelt es dem Menschen im Paradies an nichts, aber nicht, weil er dort im Überfluss lebt, sondern weil das Paradies keine Differenz zwischen Mangel 507 508 509 LUHMANN, Religion der Gesellschaft (wie Anm. 343), S. 216. Umfassende ideengeschichtliche Überblicke zur Trias von Paradies, Sündenfall und irdischer Ordnung leisten TÖPFER, Bernhard: Urzustand und Sündenfall in der mittelalterlichen Gesellschafts- und Staatstheorie. Stuttgart 1999; STÜRNER, Wolfgang: Peccatum und potestas. Der Sündenfall und die Entstehung der herrscherlichen Gewalt im mittelalterlichen Staatsdenken. Sigmaringen 1987. AUGUSTINUS, Aurelius: Vom Gottesstaat (De civitate dei). Buch 11 bis 22. Zürich [u.a.] 1978, S. 206 f. 203 und Überfluss kennt. Aber auch Gott konnte das Paradies nur hervorbringen, weil er es bezeichnen und von einer auch anders denkbaren Welt, dem unmarked space seiner Beobachtung, unterscheiden musste. Durch den als Person vorgestellten Gott wird die Welt an sich – und das scheint lediglich auf den ersten Blick paradox – kontingent, denn sobald die Welt ins Dasein gerufen ist, gibt es zwar innerhalb ihrer Notwendigkeit, es ist aber nicht erforderlich, dass die Welt selbst, so wie sie dem Menschen gegeben wurde, existieren müsse. Entstanden aus einem Schöpfungsakt bezeichnet das Paradies einen Welthorizont, der nicht nur eine Differenz zu Gott, ihrem Beobachter, begründet, sondern auch zu dem, was durch seine Beobachtungsoperation unterschieden wurde. Das Paradies steht dabei in unmittelbarer Kontinuität zu Gott und verfügt insofern im Gegensatz zum unbezeichneten Teil seiner Schöpfung über einen höheren Grad der Vollkommenheit. Solange sich nun der Mensch in einer Welt ohne Differenzen bewegte, blieb ihm die innerweltliche Kontingenz verschlossen. Mit dem Biss in die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis versetzte er sich jedoch in die Lage, zu sehen, dass das, was ihm gegeben ist, auch anders möglich sein kann. Sein Beobachten wird damit von einer Beobachtung erster Ordnung auf eine Beobachtung zweiter Ordnung umgestellt. Der zum Fall führende Hochmut des Menschen besteht also in dessen Bestrebungen, mit den Augen Gottes die Welt beobachten zu wollen. Erst der Blick von außen auf das Paradies macht es ihm möglich, die Beobachtungsoperation Gottes ihrerseits bezeichnen zu könne. Aber damit sieht er sich selbst mit der Aufgabe konfrontiert, das Gute von dem Bösen unterscheiden zu müssen. Die Metapher der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies symbolisiert also das für einen derartigen Perspektivenwechsel erforderliche Überschreiten (‚crossing’) der durch die Beobachtung Gottes gezogenen Grenze. Mit dem Mythos des Sündenfalls wird eine Zäsur eingeführt, die das Problem der Einheit der Differenz von vorher und nachher zugleich aufzeigt und löst. Die nachparadiesische Welt, in der sich der Mensch vom Zeitpunkt seiner Grenzüberschreitung an befindet, ersetzt nicht einfach das Paradies. Das Paradies bleibt auch nach dem Sündenfall, obgleich vom Menschen entvölkert, weiterhin bestehen. Es selbst kennt also einen Zustand vor und nach dem Sündenfall. Entsprechend kursieren unter den theologischen Autoren des Mittelalter ganz unterschiedliche Vorstellungen, wo das Paradies zu finden sei: im Osten, angrenzend an die Mondsphäre oder aber am Äquator im Bereich der Tagundnachtgleiche.510 Der Sündenfall vollzieht eine strikte räumliche Trennung zweier unterschiedlicher Möglichkeitshorizonte, einer Welt der Abwesenheit und einer Welt der Anwesenheit von Bedürfnissen. Damit wird die Auffassung einer nachparadiesischen irdischen Welt ohne Armut von vornherein negiert.511 Der Mythos des Sündenfalls komplettiert 510 511 Vgl. KOSTER, Heinrich: Urstand, Fall und Erbsünde in der Scholastik. Freiburg / Basel / Wien 1979, S. 47 ff. Der Umstand, dass Paradiesvorstellungen in ganz unterschiedlichen Kulturen und Zeiten immer wieder dazu verwendet werden, Gesellschaftsbeschreibungen hervorzubringen, in denen Not und Elend aus dem Alltag des Menschen verbannt zu sein scheinen, lässt ein ganzes Bündel soziologischer Fragestellungen hervortreten. Wann 204 mit seinen Erzählungen von einer unvertrauten Welt ohne Mangel die andere Seite der vertrauten Differenzen, in denen sich Mangel und Überfluss gegenüberstehen.512 Er bewirkt die Einheit seiner beiden Seiten, indem er die unterschiedlichen Welten einem gemeinsamen Ursprung, der Beobachtungsleistung Gottes, zuschreibt. Gewissermaßen findet also mit der Beschreibung des Paradieses eine Duplizierung der irdischen Welt statt, bei der die eine Seite das Negativ der anderen Seite darstellt. Die paradiesische Welt der harmonischen Einheit, der totalen Bedürfnislosigkeit, wie sie schon als Ideal in der griechischen Philosophie formuliert wurde, steht hier im Kontrast zu einer Welt, die die Einführung von Eigentum und Zwang bedarf, um die innerweltlichen Differenzen kontrollieren zu können. Ihren Sinn – hier streng systemtheoretisch zu verstehen als Differenz von Aktualität und Potentialität – erhält die Semantik des Bedürfnisses somit letztendlich erst über das Bild vom Paradies und dem Mythos des Sündenfalls.513 Sie stellt sich als eine „problemgenerierende Problemlösung“514 dar, über die eine Konstruktion der Wirklichkeit erfolgt. Das Paradies fungiert dabei als eine Art soziales Gedächtnis, das ein Inventar von negationsfreien Unterscheidungen bereithält, mit deren Hilfe sich die möglichen Mangelzustände des Menschen klassifizieren lassen. Es lässt sich dann zwar nicht sagen, wie die Mangelzustände des Menschen bewirkt werden, da sie sich allein der Vorsehung Gottes erschließen, aber man hat immerhin eine Vorstellung davon, in welchen Formen sie in der nachparadiesischen Welt anzutreffen sind. Die Verbannung der Mangels aus der Gesellschaft wird dahingegen in das Dunkel einer zukünftigen Erlösung nach dem Tode bzw. nach dem Ende der Zeit verlegt, mit der sich alle innerweltlichen Differenzen in der Ewigkeit des Paradieses wieder auflösen. 512 513 514 und warum haben sich solche Paradiesvorstellungen in Gesellschaften etablieren können? Waren bzw. sind mit ihnen bestimmte Funktionen für die Stabilisierung sozialer Ordnung verbunden? Welche Rolle spielen dabei kollektive Bilder und eine geteilte Hoffnung auf ein glücklicheres irdisches Leben? Und sind diese Bilder einem historischen Wandel unterworfen? Vgl. dazu HAHN, Alois: Soziologie der Paradiesvorstellungen. Trier 1976. Nach Niklas Luhmann bezeichnet der Mythos im Allgemeinen „nicht nur das Hier und Jetzt des vertrauten Lebens, sondern gerade die Differenz zum anderen, vor der es vertraut sein kann. Der Mythos kontrolliert also gewissermaßen die Gefahr des Sichverlierens ins Unheimliche. Er inkorporiert damit die Paradoxie, die darin besteht, daß das Unvertraute im Rahmen einer vertrauten Unterscheidung als vertraut behandelt werden kann [...]“. LUHMANN, Niklas: Brauchen wir einen neuen Mythos? In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen 1987, S. 254-274, hier S. 256. In der Forschungsliteratur zur Armut findet sich an dieser Stelle die fast einhellig vertretene Meinung, dass in den theologischen Gesellschaftsbeschreibungen des Mittelalters der Überfluss einerseits zur „Insignie des Segen Gottes“, der Mangel andererseits „zum Denkmal der Vertreibung – zur Insignie der Strafe Gottes“ figuriert. KEHNEL, Annette: Der freiwillig Arme ist ein potentiell Reicher. Eine Unterscheidung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Armut. In: MELVILLE, Gert / KEHNEL, Annette (Hg.): In proposito paupertatis. Studien zum Armutsverständnis bei den mittelalterlichen Bettelorden. Münster 2001, S. 203-229, hier S. 206. Die Differenz zwischen potestas und pauperes, zwischen Reichen und Armen wird dabei auf die mit Schuld beladende Existenz des Menschen zurückgeführt. Die in dieser Argumentation mitschwingende Auffassung eines die Gesellschaftsordnung legitimierenden Mythos des Sündenfalls, der den Mangel zum Zeichen der Erbsünde des Menschen stilisiert, greift meines Erachtens jedoch zu kurz. Denn ein solcher Bedarf nach Rechtfertigung setzt bereits einen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der bestehenden Gesellschaftsordnung voraus. Der Sündenfall dient also weniger der Legitimation, als vielmehr der Konstruktion einer sozialen Ordnung. Diese Formulierung geht auf Cornelia Bohn zurück. Sonderforschungsbereich 600: Arbeits- und Ergebnisbericht für die erste Förderphase. 01.01.2002-31.12.2004. Trier 2004, S. 281. 205 Die religiösen Implikationen, die dem Bedürfnis in den Gesellschaftsbeschreibungen des Mittelalters zufielen, verlieren im Verlaufe der sozialen Evolution mehr und mehr an Bedeutung. Immer häufiger treten sie in Konkurrenz mit innerweltlichen Erklärungsansätzen. Ein erster, wenngleich kleiner Schritt in diese Richtung vollzieht Vives. Zwar führt er die Tatsache, dass der Mensch überhaupt Begehrlichkeiten verspürt, weiterhin auf den Sündenfall und die Sterblichkeit des menschlichen Leibes zurück. Indem er jedoch das Bild einer wohlgeordneten Gemeinschaft zeichnet, in der auch nach der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies keine Not herrschte, weil jeder gemäß seiner Fähigkeiten und Notdurft lebte, verabschiedet er sich von der Vorstellung, Armut sei ein in der Erbsünde begründetes Schicksal, dem sich der Mensch demütig zu fügen hat. „Schon bald [nach dem Sündenfall – J.H.] empfand man es als zweckdienlich und angenehm, wenn diejenigen, die den Wunsch hatten, durch gegenseitige Wohltaten einander zu helfen, ihre Hütten und Wohnungen nahe beieinander bauten, damit nicht bei unvorhergesehenen Ereignissen niemand da wäre, dem man helfen möchte. Sie nahmen jeweils den nächsten Acker in Besitz; und jeder übernahm freiwillig die Aufgabe, durch die er sich und den anderen nützen konnte, zu der er am meisten Begabung zeigte: Fischerei, Vogelstellerei, Ackerbau, Viehzucht, Weberei, Baugewerbe oder was sonst zum Leben gehört. Soweit arbeiteten sie schön und einträchtig zusammen.“ 515 In den von Vives angefertigten Gesellschaftsbeschreibungen steht nicht mehr so sehr der Gegensatz einer paradiesischen und nachparadiesischen Ordnung im Vordergrund. Vielmehr geht es ihnen um die Frage, mit welchen Mitteln sich die in der Vergangenheit bereits im Diesseits erreichte Idealität auch in der Gegenwart verwirklichen lässt. Damit erhält die Semantik des Bedürfnisses eine neue Sinnform. Die Differenz des Aktuellen und Potenziellen verweist nun nicht mehr auf zwei in der Sachdimension voneinander geschiedene Welten, sie wird dahingegen in die Geschichte selbst eingeholt. Die in einer Gemeinschaft vorzufindenden Bedürfnisse verweisen auf ein mit jeder Gegenwart abrufbares historisches Maß der Abweichung von einem Idealzustand, in dem allen Menschen das ihnen zum Leben Erforderliche gegeben war. Seine gegenwärtige Sinnform erhält das Bedürfnis allerdings erst in dem Moment, in dem es von der Notdurft vollständig entkoppelt und nicht mehr als dessen fehlender Teil betrachtet wird. Während sich im Modell der Notdurft die Möglichkeit der Reversibilität von Zeit, der Rückkehr zu einem Zustand der vollkommenen Bedürfnislosigkeit, angelegt findet, geht man nun davon aus, dass Bedürfnisse die Geschichte irreversibel vorantreiben. Das Bedürfnis selbst unterliegt dabei einer unablässigen Metamorphose, insofern aus jedem befriedigten Bedürfnis neue Bedürfnisse erwachsen. Diesem sich selbst perpetuierenden Prozess der Bedürfnissteigerung nähert man sich zunächst über die Ausarbeitung einer Bedürfnishierarchie. Die Differenz von pri515 VIVES, De subventione pauperum (wie Anm. 333), S. 284 f. 206 mären (natürlichen) und sekundären (erworbenen) Bedürfnissen (Grund- und Nebenbedürfnissen) bildet dabei das einfachste Muster der zeitlichen Abfolge, subtilere Differenzierungen in solche etwa der „Nothwendigkeit, der Bequemlichkeit und der Ueppigkeit“516 folgen. Diese Klassifikationen sind Ausdruck einer Historisierung des Bedürfnisses. Mit der Befriedigung der Grundbedürfnisse setzt sich ein zukunftsoffener gesellschaftlicher Entwicklungsprozess frei, dessen Fortschreiten durch das zirkuläre Verhältnis von Bedürfnisbefriedigung und neu entstehender höhergradiger Bedürfnisse stetig in Gang gehalten wird. Sah sich der Mensch auf der niedrigsten Stufe seiner sozialen Evolution noch dazu befähigt, seine Grundbedürfnisse ohne die Inanspruchnahme der Hilfe seiner Mitmenschen unmittelbar durch Mittel zu befriedigen, die ihm die Natur bereithielt, so wächst mit der Herausbildung von Nebenbedürfnissen zugleich auch seine Abhängigkeit von den Produkten seiner Arbeit und den Leistungen der Gesellschaft. Dieser historische Entwicklungsschritt folgt einem zivilisatorischen Impetus, der den Menschen zum einen aus der Knechtschaft seiner Natürlichkeit befreit und ihn als Gestalter seiner Zukunft einsetzt und der zum anderen für bestehende kulturelle Bedürfnisdivergenzen eine Vergleichsbasis schafft, vor dessen Hintergrund sich die Entwicklungsstufen unterschiedlicher Völker, Staaten und Nationen bewerten lassen.517 In den gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen des 18. und 19. Jahrhunderts wird entsprechend die Errichtung der bürgerlichen Verfassung als eine in der Geschichte stattfindende Zäsur gefeiert. Durch die Überwindung der auf Unfreiheit und Gewaltherrschaft beruhenden Ständeordnung des Ancien Régime durch eine arbeitsteilig organisierte Gesellschaft, deren in Freiheit und Gleichheit lebenden Mitglieder sich einander Dienste anbieten, um ihre mannigfachen Bedürfnisse zu befriedigen, werden die egoistischen und isolierten Individuen in ein eigendynamisches Beziehungsgeflecht eingebunden, das ihnen jeweils Möglichkeiten der Persönlichkeitsentfaltung eröffnet. Hegel hat dementsprechend die bürgerliche Gesellschaftsordnung als ein „System der Bedürfnisse“518 umschrieben, in dem jeder für die Bedürfnisse des anderen arbeitet und dessen Eigengesetzlichkeiten die Vielfalt und die stete Vervielfältigung der sozialen Bedürfnisse bewirken. In völliger Verkehrung des antiken und christlichen Ideals der Bedürfnislosigkeit, dessen Verwirklichung allein dem höheren Menschen zukommt, wird der Grad der menschlichen Vollkommenheit nun aus der Quantität und Qualität seiner Bedürfnisse hergeleitet. Die Anwesenheit von Bedürfnissen ist also nicht Ausdruck seiner Unvollkommenheit, sie ist vielmehr die transzendentale Bedingung seiner Persönlichkeitsentfaltung und damit verbunden des Fortschritts der 516 517 518 PFEIFFER, Johann Friedrich: Bedürfnisse nach den Gesetzen der Policey erwogen. In: Teutsche Encyclopädie oder Allgemeines Realwörterbuch aller Künste und Wissenschaften. Bd. 3. Frankfurt (Main) 1781, S. 157-162, hier S. 161. Vgl. als ein Beispiel unter vielen BLUNTSCHLI, Johann Kaspar: Allgemeines Staatsrecht, geschichtlich begründet. München 1852, S. 43 f. Vgl. HEGEL, Georg W. F.: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Frankfurt (Main) 1993, S. 346 ff. 207 Gesellschaft schlechthin. Weder das Modell der standesgemäßen Lebensführung noch das der Hausökonomie sieht eine solche Dynamik der quantitativen und qualitativen Zunahme von Bedürfnissen vor. Sie gewinnen ihre Plausibilität gerade aus der Annahme, dass es nur eine begrenzte Anzahl objektivierbarer Bedürfnisse gibt, die als Signum eines malums gesellschaftlicher Ordnung die Orientierung an moralischen Verhaltensregeln heraufbeschwören. Es ist dies vielleicht die entscheidende Innovation der neuzeitlichen Bedürfnissemantik, dass sie im Gegensatz zu ihrer Stellung im Modell der Notdurft nicht mehr darauf angewiesen bleibt, das, was mit ihr bezeichnet und unterschieden wird, fremdreferentiell spezifizieren zu müssen. Bedürfnisse lassen sich weder über die Knappheit der Ressourcen der Welt noch über die Unveränderlichkeit der Sozialordnung in der Sach- und Sozialdimension von Sinn beschränken. Vielmehr ist es ihr selbstreferentieller Rekurs auf vergangene befriedigte und zukünftig zu befriedigende Bedürfnisse, anhand dessen sie ihre Möglichkeitshorizonte limitieren. Dem Menschen wird dabei ein Zeitbewusstsein unterstellt, das ihn im Gegensatz zum Tier in die Lage versetzt, aus den eigenen Lebenserfahrungen lernend seinen Zugang zur Welt stets aufs Neue zu hinterfragen. „Die Thiere“, so heißt es Ende des 18. Jahrhunderts, „besitzen weder die Kenntnisse noch die Schwachheiten der Menschen; erstere begnügen sich, die Bedürfnisse der Natur zu befriedigen, letztere sind ausserdem geschikt, sich Bequemlichkeiten zu verschaffen, Quellen von Glückseligkeit zu eröfnen, sich des Vergangenen zu erinnern, es mit dem Gegenwärtigen zu vergleichen, und daraus Schlüsse zu ziehen. Allein der üble Gebrauch, welchen sie von diesen Vorzügen machen, vermindert die daraus zu ziehenden Vortheile.“519 Insoweit das Verhalten der Tiere unmittelbar durch ihre Instinkte geleitet wird, leben diese ausschließlich in der Gegenwart und sehen sich somit außerstande, zwischen Vergangenem und Zukünftigen zu unterscheiden. Dem Menschen dahingegen ist kraft seiner Vernunft die Fähigkeit gegeben, sich Vergangenes zu vergegenwärtigen und Ansprüche an eine Zukunft zu formulieren. Aber, und dies ist die Kehrseite des Zeitbewusstseins, weil die Bedürfnisse durch die Vernunft kontrolliert werden müssen, die Vernunft jedoch von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann, besteht die Gefahr, dass dieser ein Bedarf für Dinge entwickelt, der seiner gegenwärtigen Lebenssituation nicht entspricht – etwa durch die unreflektierte Übernahme der Bedürfnisse anderer oder durch die Gewöhnung an Bedürfnisse. Nur dann, so vernimmt man die warnenden Stimmen jener Zeit, wenn das aktuelle Bedürfnis im Einklang mit der tatsächlichen Lebenssituation des Menschen steht, nur dann kann es ihm auch Glück und Zufriedenheit und nicht Schmerz und Unzufriedenheit verheißen.520 Ver519 520 PFEIFFER, Universal-Kameral-Wissenschaft (wie Anm. 375), S. 5. Eine sehr plastische Umschreibung dieser Gefahr liefert folgendes Zitat: „Nichts ist schädlicher, zweckloser, ungereimter und doch zugleich gewöhnlicher, als wenn man in Befriedigung der üppigen Bedürfnisse Ehre sucht. Das Kleid macht den Mann, und nun um ein Mann zu seyn, schaft man sich ein prächtiges Kleid an; die Mode befiehlt Gold, Silber und Juwelen zu tragen, und man trägts und sollte man Schulden machen müssen, gnug man muß es haben, oder man hält sich für entehrt, man schämt sich, man glaubt nicht mehr die gehörige 208 suchten die Entparadoxierungen der Notdurft noch die Frage zu klären, durch welche Mangelzustände ein Bedürfnis hervorgerufen wird, so liefert die Bedürfnissemantik des 18. und 19. Jahrhunderts weniger einen Hinweis darauf, was ein Bedürfnis ist, als vielmehr wie der Mensch anhand seiner Bedürfnisse die Welt wahrnimmt. Das Bedürfnis beschreibt „das ‚natürliche’ VerVerhältnis des Menschen zu seiner Zukunft. [...] Damit kommt der Begriff mit der Funktion der Wirtschaft zur Deckung, und zugleich bedeutet diese Einschließung der Zukunft, daß sich im generalisierten Begriff die Unsicherheit darüber verbirgt, welche Bedürfnisse und in welcher Dringlichkeit und Rangfolge künftig zu befriedigen sein werden.“521 Das Bedürfnis verliert damit, da es erst „mit der Empfindung und dem Gefühl“522 hervortritt, seinen objektiven Gehalt und wird subjektiviert. Für die Wirtschaftstheorie ergibt sich daraus die Aufgabe, die Bedürfnisse als „die letzten den Wirtschaftssubjekten noch bewußten psychischen Bestimmungsgründe des wirtschaftlichen Handelns darzustellen und mit ihrer Hilfe die Gesetzmäßigkeiten im Ablaufe des wirtschaftlichen Handelns abzuleiten.“523 Mit dem Bedürfnis hat man nun die generalisierte Voraussetzung der Inklusion des Menschen in die Wirtschaft entdeckt. Wer an dem Wirtschaftssystem teilhat, tut dies, weil er sich davon die Befriedigung seiner Bedürfnisse erhofft. 4.3 Die Ausdifferenzierung des Interaktionssystems der personalen Hilfe 4.3.2 Die Person des Bettlers Die nachfolgenden Überlegungen gehen von der Grundannahme aus, dass es sich beim Betteln und Almosengeben um Operationen eines in der Gesellschaft sich ausdifferenzierenden Interaktionssystems handelt. Mit dieser Verortung des Ausgangsproblems in eine Theorie sozialer Systeme gilt es sich zunächst einmal von dem Gedanken zu verabschieden, der Bettler an sich verfüge bereits über ihm eigentümliche, im Verhalten des Bettelns objektivierbare Merkmale und Eigenschaften. Gegenstand der weiteren Überlegungen bildet dementsprechend auch nicht der Bettler als Akteur, der sich aufgrund seiner Lebenssituation zu einem bestimmten Verhalten genötigt sieht und dabei in der Interaktion die Grenze des Vertrauten und Normalen überschreitet. Im Mittelpunkt wird vielmehr die Frage stehen, wie Kommunikationen beschaffen sein müssen, 521 522 523 Würde zu haben; man muß essen und trinken was Vornehmere essen und trinken, sonst verliert man seinen Werth. Welcher Unsinn!“ JUNG-STILLING, Staats-Polizey-Wissenschaft (wie Anm. 382), S. 293. LUHMANN, Wirtschaft (wie Anm. 383), S. 60 f. GRUBER, Johann Gottfried: Art. Bedürfniss. In: ERSCH, Johann Samuel / GRUBER, Johann Gottfried (Hg.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Sektion 1 A – G. Teil 8. Bas-Bednorf. Graz 1970 [ND Leipzig, 1822], S. 324-325, hier S. 324. MAYER, Hans: Bedürfnisse. In: WEBER, Adolf [u.a.] (Hg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Bd. 2. Jena 1924, S. 450-456, hier S. 450. 209 damit das Betteln als Handeln beobachtet werden und als ein solches das Almosengeben als eine Anschlusshandlung wahrscheinlich machen kann. Untersucht werden soll die Art und Weise, wie es dem Interaktionssystem gelingt, durch den Anschluss von Kommunikation an Kommunikation eine Differenz zu seiner innergesellschaftlichen genauso wie auch zu seiner außergesellschaftlichen Umwelt zu erzeugen und damit die Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs einer Kommunikation zu überwinden. Den Bettler und den Almosengeber gilt es dabei lediglich als soziale Adressen zu behandeln, die sich innerhalb des Interaktionssystems der personalen Hilfe konstituieren. Auf der innergesellschaftlichen Ebene ist das Interaktionssystem der personalen Hilfe zu unterscheiden von Kommunikationssystemen, in denen es etwa um die Erzeugung von Wahrheit, um die Abwicklung ökonomischer Tauschbeziehungen, um Intimität, aber auch um organisatorische Formen des Helfens geht. In Bezug auf seine außergesellschaftliche Umwelt setzt es sich sowohl gegen die Gedanken, Hoffnungen und Wünsche der beteiligten Personen als auch gegen die physiologischen Reproduktionsbedingungen der anwesenden Körper in Distanz. Die Theorie sozialer Systeme schließt es somit kategorisch aus, die Motive des Bettelns anthropologisch über die existentiellen Grundbedürfnissen des Menschen zu erklären. Damit soll keineswegs bestritten werden, dass die biochemischen Vorgänge des menschlichen Organismus zur Reproduktion von Leben auf ein Mindestmaß an Ernährung angewiesen sind. Letztendlich bleibt aber das, was sich als lebensnotwendig bezeichnen lässt, immer die Konstruktion einer Kommunikation, die dem Menschen bestimmte Grundbedürfnisse unterstellt. Nicht der Hunger ist es also, der das Individuum zum Betteln treibt, mit dem Hunger liegt allenfalls ein Motiv vor, das im Interaktionssystem der personalen Hilfe als Grund für das Betteln Akzeptanz findet. Dem Individuum steht es dann frei, sein Handeln an der objektiven Motivlage zu kontrollieren, und zwar ungeachtet dessen, ob es tatsächlich Hunger leidet oder nicht. Es ist diese unüberbrückbare Differenz von System und Umwelt, die es dem Interaktionssystem der personalen Hilfe erst ermöglicht, eine Eigenkomplexität auszubilden und damit seinen Kontakt zur Umwelt auf eine selektive Weise zu organisieren, so dass nicht alles, was sich in dieser ereignet, auch im System nach einer Entsprechung verlangt, aber doch jene Umweltbezüge ausgewiesen werden können, die das System benötigt, um sein Innen von seinem Außen zu scheiden. Im Gegensatz zum sozialen System der Freundschaft, das innerhalb seiner Grenzen sinnverdichtete Sequenzen von ähnlichen Verhaltensweisen vorsieht, schließt sich das Interaktionssystem der personalen Hilfe über komplementär andersartiges Verhalten524 – dem Betteln auf der einen und dem Almosengeben auf der anderen Seite. Die Handlungstheorie begründet dieses komplementäre Verhalten über das Vorhandensein zweier Ursache/Wirkungs-Beziehungen, die 524 Zur Unterscheidung komplementär andersartigen und Sequenzen sinnverdichteten Verhaltens vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 392. 210 sich aus den unterschiedlichen Motiven der an der Interaktion beteiligten Individuen erklären: Das Betteln Egos bewirkt das Almosengeben Alters, wohingegen das Almosengeben Alters die Annahme bzw. eine Geste der Dankbarkeit bei Ego veranlasst. Im Fokus des handlungstheoretischen Beschreibungsansatzes steht somit die Frage, ob sich zwischen dem Bettler und dem Almosengeber eine soziale Beziehung nachweisen lässt, die den Austausch wechselseitiger Leistungen und insofern auch die Erfüllung individueller Erwartungen reguliert. Das theoretische Problem eines solchen Beziehungsgeflechts nun besteht darin, den Anfang der Kausalreihe in das jeweilige Individuum selbst verlagern, d.h., von dessen subjektiven Sinn abhängig machen zu müssen. Indem das Individuum für sich definiert, in welcher Situation welcher Zweck mit welchen Mitteln erreicht werden kann, trifft es unter Berücksichtigung der Erwartbarkeit von Folgereaktionen die Entscheidung für die Wahl eines sozialen Handelns.525 So hat nicht nur der Bettler zu erkennen, wann er dazu berechtigt ist, sein Handeln auf den Erhalt eines Almosens auszurichten, desgleichen muss auch der potentielle Almosengeber die Situation auf eine Weise auslegen, die bei ihm ein Gefühl des Verpflichtetseins gegenüber dem Bettler hervorruft und ihm gleichzeitig Wege aufzeigt, diesem Gefühl durch die Wahl seiner Mittel gerecht zu werden. Da jedoch erst im Nachhinein die Reaktionen des Interaktionspartners darüber befinden, inwieweit sich die Mittel als hinreichend geeignet erwiesen haben, ihren Zweck bzw. Funktion zu erfüllen, müssen im Individuum selbst jene Ursachen angelegt sein, welche die Wahl der Mittel prädeterminieren. Das Individuum wird somit in die Position der ersten Ursache gerückt, das über den Rückgriff auf die eigenen Erfahrungen eine Ursache/Wirkungs-Kette in Gang setzt. Begreift man jedoch die individuell interpretierte Lebenssituation als Grundvoraussetzung der Entfaltung solcher auf Dauer gestellten sozialen Beziehungen, sieht man sich mit dem grundsätzlichen Problem konfrontiert, erklären zu müssen, wie Ego und Alter zu einer gemeinsamen (oder doch wenigstens sinnverwandten) Situationsdefinition kommen können, obwohl sie jeweils auf ihre eigenen Erfahrungen verwiesen bleiben. Insofern die individuellen Situationsdefinitionen immer auch Momente enthalten, die über sie hinausweisen, selbst also Wirkung einer Vielzahl von Ursachen sind, die in den Erfahrungshorizonten der Individuen begründet liegen, erscheint es mehr als zweifelhaft, wie es anhand ihrer gelingen soll, die Verhaltensweisen Alters und Egos miteinander zu koordinieren. Die wissenssoziologische Annahme, dass jedes kontrollierte Interagieren auf der Grundlage einer geteilten Alltagswelt erfolgen muss, die es den Individuen ermöglicht, sich in die jeweilige Weltperspektive des Gegenübers hineinzuversetzen und dessen Erwartungen zu erwarten, sieht sich mit dem prinzipiellen Problem der Intersubjektivität konfrontiert. Wie können 525 „Die Situationsdefinition“, so heißt es entsprechend bei William Isaac Thomas, „ist eine notwendige Voraussetzung für jeden Willensakt, denn unter gegebenen Bedingungen und mit einer gegebenen Kombination von Einstellungen wird eine unbegrenzte Vielzahl von Handlungen möglich, und eine bestimmte Handlung kann nur dann auftreten, wenn diese Bedingungen in einer bestimmten Weise ausgewählt, interpretiert und kombiniert werden [...].“ THOMAS, William I.: Person und Sozialverhalten. Neuwied / Berlin 1965, S. 85. 211 Subjekte, deren kennzeichnendes Merkmal ja gerade ihr selbstreferentieller Zugang zur Welt ist, eine Gewissheit über die Weltperspektive ihres Gegenübers erlangen? Und die Antwort auf diese Frage kann nur lauten: Sie können es nicht! Stellt man also die Aussicht einer intersubjektiven Koordination von Verhaltensweisen generell in Abrede, fällt es schwer, die Einheit einer sozialen Beziehung nicht anders als ein emergentes soziales System zu denken, in dem sich die Situationsdefinition in ihrer sozialen, sachlichen und zeitlichen Dimension bereits limitiert findet. Soziale Systeme legen fest, wer in welcher Situation weshalb handelt, ohne dabei auf die Reflexionsleistungen der Individuen angewiesen sein zu müssen. Sie ziehen zwischen ihrem Innen und Außen eine Grenze, die sie im Fortgang ihrer Operationen mittels ihrer eigenen Beobachtungen stets aufs Neue reproduzieren. An die Stelle des klassischen Problems der Intersubjektivität tritt hier die Frage, auf welche symbolische Generalisierungen Sozialsysteme zurückgreifen, um in Situationen der doppelten Kontingenz den Fortgang ihrer Kommunikationen zu gewährleisten. Im handlungstheoretischen Modell der ‚sozialen Beziehung’ bleibt das Problem der doppelten Kontingenz, wie einem Verhalten Folgen angerechnet werden können, obwohl sich die in die Interaktion involvierten Individuen außerstande sehen, das Erleben und Wollen des jeweils Anderen zu durchschauen, weitestgehend unterbelichtet. Für eine erfolgsversprechende Interaktion gilt, dass die an ihr beteiligten Personen nicht nur lernen müssen, wie ihre Interaktionspartner auf ein Verhalten reagieren, sie haben sich zudem ein Bild davon zu machen, was andere ihrerseits erwarten, wenn sie ihnen ein bestimmtes Verhalten attribuieren. Während der erste Sinnabschnitt des Satzes den Interaktionspartner auf ein zu stimulierendes Objekt verkürzt, an dessen Reaktionen sich der Erfolg oder Misserfolg einer Handlung ablesen lässt, leistet der zweite Sinnabschnitt eine die handlungstheoretische Sichtweise überwindende Ergänzung. Um das eigene Verhalten auf das seines Gegenübers abstimmen zu können, hat Ego zu wissen, auf welche Weise Alter sein Handeln erlebt und welche Schlüsse er daraus zieht. Verhaltenskoordinationen in sozialen Beziehungen basieren somit unweigerlich auf Kommunikationen, über die Verhaltensweisen zugerechnet und zugleich als Motiv ausgewiesen werden, eine entsprechende Anschlusshandlung folgen zu lassen. Entscheidend ist also, dass Ego erst in dem Moment die soziale Identität eines Bettlers annimmt, in dem er durch Alters Almosengabe die Handlung des Bettelns zugeschrieben bekommt. Bei der Almosengabe geht es also weniger um eine nachträgliche Anerkennung und Legitimation des im Betteln begründeten sozialen Status des Bettlers, so wie es Voß formuliert hat, als vielmehr um die Konstruktion seiner Person, die über die Alternativen des weiteren Verlaufs der Kommunikation entscheidet. Kommunikationstheoretisch betrachtet stellt sich der Bettler demnach nicht als jemand dar, der sein Verhalten auf das Erlangen eines Almosens ausrichtet, sondern als jemand, der ein Almosen erhält. Die Handlung des Bettelns ist in ihrer sozialen Evidenz nicht schon deswegen gegeben, weil ein Individuum die Entscheidung trifft, auf ein 212 sozial akzeptiertes Repertoire an Darstellungsformen zurückzugreifen, um sich seiner Mitwelt als Bettler zu präsentieren. Wer letztlich ein Bettler ist und wer nicht, warum ein Bettler bettelt und welche Folgen sich daraus ergeben, resultiert vielmehr aus Attributionen, die in der Kommunikation erfolgen. Natürlich kann sich das Individuum dazu entschließen, um ein Almosen zu bitten; und es kann diese Entscheidung als Anlass nehmen, sich selbst in seinem Handeln als Bettler zu identifizieren. Vergleichbares gilt selbstverständlich auch für den Almosengeber. Aber solche Selbstidentifikationen sind letztendlich außerstande, die operative Geschlossenheit der Gedanken und Vorstellungen zu transzendieren. Sie bleiben der Ebene individueller Reflexionen verhaftet, ohne dabei unmittelbar das Ordnungsniveau des Sozialen zu berühren. Erst über die Almosengabe signalisiert Alter seine Bereitschaft, Egos (zugeschriebene) Bitte nach einem Almosen unter der Bedingung zu entsprechen, dass dieser die Gabe annimmt und sich dankbar erweist. Das Interaktionssystem der personalen Hilfe vermag dabei seine Operationen nur solange zu kontinuieren, wie innerhalb der Gesellschaft Plausibilitäten abrufbar sind, die auf Dauer stellen, dass Alter Egos attribuierte Selektion, betteln zu gehen, als Motiv anerkennt, ein Almosen zu geben; wie auch umgekehrt: dass Ego Alters attribuierte Selektion, ein Almosen zu geben, als Motiv anerkennt, es anzunehmen. Betrachtet man lediglich die operative Ebene des Interaktionssystems der personalen Hilfe, so lässt sich auf die Frage, wie ein Almosengeber erkennt, wer ein Bettler ist, freilich tautologisch antworten: Ein Bettler ist, wer bettelt.526 Auf der operativen Ebene scheint es schon zu genügen, dass der Bettler mit einer Geste, einem entsprechenden Blick oder einem Karton, der die Bitte symbolisch zum Ausdruck bringt, eine Aufmerksamkeit auf sich zieht, in der bereits die Evidenz seiner Person begründet liegt. Es ist nun interessant zu sehen, wie die von Voß benannten Betteltechniken, das aktive direkte Ansprechen zum einen und das passive Kauern an den Straßenrändern zum anderen, auf ganz unterschiedliche Weise daran beteiligt sind, diese Evidenz hervorzubringen. In beiden Fällen hat der Bettler zunächst die Öffentlichkeit zu suchen, um wahrgenommen werden und damit die Wahrscheinlichkeit des kommunikativen Erfolgs erhöhen zu können. Beim aktiven Ansprechen geht es nun primär darum, eine Situation zu modellieren, in welcher der Bettler als ein Anwesender erscheint, dessen Blicke man sich nicht einfach entziehen kann; oder genauer: dessen Blicke man sich nur unter der Bedingung entziehen kann, dass man das SichEntziehen kommuniziert. Das direkte Ansprechen versetzt den Angebettelten in eine Lage, in der er mit Ja oder Nein zu antworten hat und er selbst erwarten kann, dass seine Handlungen als auf die Erwartungen des Bettlers eingestellt interpretiert werden, also selbst Selektionen sind, die ein 526 So heißt es entsprechend lapidar im Grammatisch-kritischen Wörterbuch der hochdeutschen Mundart: Der Bettler ist eine „Person, die um etwas bettelt“. ADELUNG, Johann C.: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Bd. 1. Hildesheim 1970 [ND Leipzig, 1793], S. 952. 213 bestimmtes Verhalten hervorzurufen versuchen. Die Gabe kann hier nur unter dem Vorsatz erfolgen, vom Bettler eine Geste der Dankbarkeit zu erlangen, welche die eigene Großzügigkeit und Mitmenschlichkeit affirmiert. Es ist dieses paradoxe Dilemma, entweder freigiebig oder habgierig, selbstlos oder egoistisch sein zu müssen, die Nietzsche geißelt, wenn er fordert: „Bettler aber sollte man ganz abschaffen! Wahrlich, man ärgert sich, ihnen zu geben und ärgert sich, ihnen nicht zu geben.“527 Während sich beim direkten Ansprechen ein nicht nicht Kommunizieren als unmöglich und die Interaktion sich damit als unausweichlich darstellt, eröffnet das passive Kauern an den Straßenrändern dem Passanten die Freiheit, zu beurteilen, ob eine Situation gegeben ist, in der er eine Interaktion eingehen will oder nicht. Der im direkten Angesprochenwerden begründeten Unmöglichkeit, die Anwesendheit des Bettlers und dessen Erwartungen zu ignorieren, steht hier die Leistung des Gebers gegenüber, die Hilfsbedürftigkeit des Bettlers zu erkennen. Der Bettler wird dabei auf ein Objekt verkürzt, das (als reine Information) für sich selbst stehend genügt, ein an ethischen Grundsätzen ausgerichtetes Verhalten von jenen Personen abzuverlangen, die es wahrnehmen. Es scheint so, als wären seinem Körper Zeichen inskribiert, die sich auch ohne Mitteilung von Verhaltenserwartungen eindeutig in ihrer Bedeutung entschlüsseln lassen. Interaktionsformen, bei denen bereits die Wahrnehmung des Gegenwärtigen ausreicht, um Kommunikationen in Gang zu setzen, entgehen so der Trägheit des Akustischen. Denn an dem, worüber wir sprechen, kann gezweifelt werden, das aber, was wir wahrnehmen, ist zunächst einmal wahr und über jeden Zweifel erhaben. Allein die Anwesenheit eines deformierten Körpers, eines Mangels oder einer Schwäche ist hier Anlass genug, die Situation danach zu bewerten, was getan werden sollte. Worauf es dabei aber im Wesentlichen ankommt, ist die Durchführung des Verhaltens selbst, nicht jedoch die Folgen, die sich mit ihm einstellen. Man sieht hier ganz deutlich, dass nicht nur der Verlauf der Interaktion, ihr Anfang und ihr Ende, sondern gleichfalls auch der Sinn des Almosens maßgeblich davon abhängt, ob es entweder auf das Handeln oder das Erleben des Bettlers Bezug nimmt. Während beim Erleben das Ziel, der Bedürftigkeit des Bettlers einer Abhilfe zu verschaffen, außerfrage steht und es nur um die Wahl der zum Ziel führenden Mittel geht, wird mit dem Handeln das Problem akut, ob dem Bettler überhaupt geholfen werden soll. Hier steht also das Ziel selbst zur Disposition. War es nun aber reiner Zufall, dass das Interaktionssystem der personalen Hilfe mit dem passiven Kauern und der direkten Anrede zwei unterschiedliche Formen des Bettelns hervorgebracht hat oder spiegeln sich in ihnen nicht vielmehr historische Bedeutungsverschiebungen innerhalb der Semantik des Helfens wider? 527 NIETZSCHE, Friedrich: Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und keinen. Stuttgart 1969, S. 94. 214 4.3.3 Die Paradoxie der personalen Hilfe Interaktionssysteme vermögen die Abfolge von Verhaltensweisen solange erwartungsfähig zu halten, wie sich die an ihnen beteiligten Personen wechselseitig in ihrem Wahrgenommenwerden wahrnehmen und dabei auf ein bestimmtes Thema fokussiert werden.528 Das Thema reduziert die Auswahl der Beiträge, die sich zur Aufrechterhaltung der Kommunikation in die Interaktion einbringen lassen. Für das Interaktionssystem der personalen Hilfe ist es nun bezeichnend, dass es die Anzahl von zugelassenen Beiträgen auf ein Minimum begrenzt. Der Möglichkeit, die Interaktion durch eine Fülle erdenklicher Beiträge schier endlos zu betreiben, wird eine Interaktionsform gegenübergestellt, die scheinbar alles daran setzt, das Kommunikationstempo zu erhöhen. Mehr oder minder unterbindet das Interaktionssystem der personalen Hilfe die zu voluminöse Ausgestaltung ihres Themas vermittels der Komplementarität des Almosengebens und -nehmens. Es entgeht auf diese Weise der Gefahr, Widersprüche der Verhaltensmotive, die sich im Geben und Nehmen manifestieren, durch eine zu extensive Selbstbeobachtung aufzudecken. Wer einem Bettler aufgrund seiner Notsituation ein Almosen zukommen lässt, der misst dessen Autonomie, die Gabe anzunehmen oder aber sie abzulehnen, lediglich eine zweitrangige Bedeutung zu. Warum sollte er die Hilfe ablehnen, wenn sie ihm doch eine Chance eröffnet, seine Bedürftigkeit zu überwinden? Erst in dem Augenblick, in dem der Bettler in seiner Entscheidungsfreiheit wahrgenommen wird, entweder nach Hilfe nachzusuchen oder aber diese zu negieren, tritt zutage, dass er den Erfolg des Helfens seinem eigenen Verhalten zuschreiben kann, dass sich das Helfen also keineswegs alleine im Akt des Gebens erschöpft. Die Vorstellung, Hilfe beruhe exklusiv auf dem sozialen Handeln eines Akteurs, der sich zum Helfen entscheidet, greift unter diesen Voraussetzungen offenkundig zu kurz. Worauf gründet nun aber diese Möglichkeit, Widersprüche der Zurechnung in der Interaktion feststellen zu können? Es scheint zunächst nahe zu liegen, dafür die unterschiedlichen Willensbekundungen der Individuen verantwortlich zu machen. Der systemtheoretische Beschreibungsansatz sieht jedoch von einer solchen Zugangsweise ab. Für ihn verweisen Widersprüche vielmehr auf in den Strukturen sozialer Sinnsysteme selbst begründet liegenden Paradoxien. Ein jedes Sinnsystem kondensiert infolge der autopoietischen Reproduktion seiner Operationen eine Unterscheidung zwischen den Elementen, aus denen es besteht, und all dem, was sonst noch möglich ist, aber nicht durch das System aktualisiert wird. Um die eigene Identität und damit die Wiederverwendbarkeit seiner Elemente garantieren zu können, muss es diese durch seine Operationen selbst erzeugte Differenz von System und Umwelt beobachten. Sinnsysteme beschränken sich dabei allerdings darauf, zwischen ihrem Innen und Außen zu oszillieren, also entweder die Operationen des Systems oder dessen Umweltbedingungen zu bezeichnen. Ihnen bleibt 528 Zu den Strukturmerkmalen eines Interaktionssystems vgl. Kap. 2.3.1. 215 aus diesem Grunde notwendigerweise verborgen, dass sich die Umwelt des Systems im System als dessen Bestandteil konstituiert. Für Sinnsysteme stellt sich dieser eingeschränkte Blick auf ihre Identität als durchaus funktional dar. Denn würden sie die Einheit von System und Umwelt reflektieren, könnten sie nicht mehr mit letzter Gewissheit bestimmen, an welcher Seite der Differenz ihre Operationen anzuschließen haben, um das System zu kontinuieren. Sie sehen sich insofern mit der Notwendigkeit konfrontiert, die Paradoxie der Gleichzeitigkeit von System und Umwelt in ein zeitliches Nacheinander beziehungsweise sachliches Nebeneinander aufzulösen, in einen durch die Umwelt bedingten Systemzustand, den es durch den Anschluss der Operationen zu bearbeiten gilt. So entfaltet etwa das Rechtssystem seine Paradoxie, indem es davon ausgeht, dass in der Welt Betrügereien, Diebstähle und Streitigkeiten, also Unrecht, möglich ist, wobei es seinen Operationen obliegt, Recht zu sprechen. Was bedeutet nun dieses Paradox der Gleichzeitigkeit von System und Umwelt, welches ein jedes Sinnsystem durch seine Operationen hervorbringt und zugleich auch zu entparadoxieren hat, konkret für das Interaktionssystem der personalen Hilfe? Damit das Betteln nicht nur als individuell attribuierbare Mitteilungshandlung sichtbar werden, sondern sich zudem mit spezifischen Verhaltenserwartungen aufladen kann, muss die Interaktion neben der Gewährleistung der Reflexivität des Wahrnehmens auch den Kontext konkretisieren, innerhalb dessen die Mitteilung erfolgt. Ohne diesen fremdreferentiellen Bezug auf die Situation, durch welche die Mitteilung ihren Informationswert erhält, ohne die Beobachtung der Pragmatik des Bettlers, der sich aufgrund seiner Lebensumstände zu einer bestimmten Verhaltensweise genötigt sieht, wäre das Betteln an sich außerstande, die Almosengabe wahrscheinlich zu machen. Es bliebe eine isolierte, für sich stehende Handlung, die aufgrund ihres fehlenden Wiedererkennungswertes dem Interaktionspartner keinerlei Ansatzpunkte bieten würde, seinerseits sein Handeln an sozialen Erwartungen zu kontrollieren. Um also mögliche Anschlüsse andeuten zu können, muss ein Verhalten generalisierbar sein, d.h. an ihm müssen sich über den Rückgriff auf bereits Geschehenes Bezüge zu Situationen herstellen lassen, die unabhängig von den jeweils an der Interaktion beteiligten Personen anzeigen, warum es aktuell vollzogen wird. In seiner ursprünglichen Bedeutung liegt dem Betteln eine Generalisierung zugrunde, welche immer schon voraussetzt, dass es aus einer Notlage heraus geschieht, die den Bettler als Person in seiner Existenz gefährdet und ihm von daher das Recht zuspricht, Hilfe zu erhalten. Bereits der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel beschreibt den Bettler entsprechend als jemanden, „der eines Andern bedarf und nicht in sich alles zum Leben Nöthige trägt [...].“529 Es ist diese defizitäre Lebenslage, in welcher der Bettler auf die Hilfe Dritter angewiesen ist, ohne dabei selbst eine adä- 529 AUREL, Marc A.: Selbstbetrachtungen. Stuttgart 1967, S. 43. 216 quate Gegenleistung für die erhaltene Hilfe erbringen zu können, die ihm seine soziale Identität verleiht. Das Interaktionssystem der personalen Hilfe legt seine Inklusionsbedingungen fest, indem es eine klare Grenze zwischen jenen Personen zieht, bei denen aufgrund ihrer Notlage eine Pflicht zum Helfen besteht, und jenen, die keine Hilfe bedürfen. Die Differenz von Hilfsbedürftigkeit und Nicht-Hilfsbedürftigkeit wird dabei sachlich und zeitlich in die Gesellschaft externalisiert, ist also, mit anderen Worten, das Resultat ihrer Vollzüge. Dass es Menschen gibt, die keine Unterstützung durch ein Almosen bedürfen, heißt dabei nicht, dass sie zur Vollendung ihrer Existenz nicht auch auf die Hilfe anderer angewiesen wären, aber im Gegensatz zu den Hilfsbedürftigen finden sie sich in einer Gemeinschaft eingebunden, deren Mitglieder sich die dafür notwendigen Leistungen je gemäß ihrer Berufung wechselseitig erbringen. Sie gehören einem Ganzen an, dessen Teile sich über reziproke Rechte und Pflichten miteinander verbunden wissen. Das Interaktionssystem der personalen Hilfe kommt erst dort zum Zuge, wo das Individuum den Verpflichtungen gegenüber seiner Person nicht mehr gerecht zu werden vermag und sich damit die in der Kooperation der Gemeinschaftsmitglieder zum Ausdruck bringende Norm der Reziprozität außer Kraft gesetzt sieht. Es gewährleistet auch noch in den Fällen, in denen Exklusionen stattgefunden haben, die Inklusion in die Gesellschaft. Die Pflicht zum (einseitigen) Helfen wird dabei – jedenfalls in ihrer religiösen Begründung – unmittelbar aus den Eigenschaften des Hilfsbedürftigen abgeleitet, der mit seiner Exklusion keineswegs die Würde als Geschöpf Gottes verliert. Er eröffnet dem Almosengeber vielmehr die Möglichkeit einer satisfactio, einer Genugtuung für die begangenen irdischen Sünden durch ein Bußwerk. Mit dem Almosen macht der Almosengeber einen Anspruch an eine Zukunft geltend, in der er als Individuum Gott für sein Leben Rechenschaft abzulegen hat. Gleichzeitig verweigert das Interaktionssystem der personalen Hilfe Reziprozitätserwartungen, wie sie zwischen den Gemeinschaftsmitgliedern vorherrschen. Da dem Empfänger eines Almosens keine unmittelbaren weltlichen Verpflichtungen gegenüber dem Geber erwachsen, wird es ihm erleichtert, die Hilfe anzunehmen. Allein, er hat für dessen Seelenheil zu beten. Die atypische Stellung des Bettlers im gesellschaftlichen Leben wird insbesondere durch seine Abgrenzung vom Armen deutlich. Es ist das einseitige Abhängigkeitsverhältnis von der Hilfe Dritter, das ihn von dem Armen unterscheidet, der sich seinerseits in einer (prekären) Lebenssituation befindet, insofern er „von sich aus zum Leben hat, wenn auch erbärmlich und mit Mühe [...].“530 Diese Unterscheidung zwischen den Armen (paupers) und den Notleidenden (indigentes) bzw. Bettlern (mendici) folgt einer Tradition, die bis in das römische Recht zurückreicht und die 530 DOMINGO DE SOTO: Über die Regelung der Armenhilfe (1545). In: STROHM, Theodor / KLEIN, Michael (Hg.): Die Entstehung einer sozialen Ordnung Europas. Die Reformbemühungen der Frühen Neuzeit. 2 Bde. Heidelberg 2004, S. 340-399, hier S. 393 f. 217 noch in der territorialen Gesetzgebung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nationen ihre Anwendung findet.531 Auffallend an ihrer semantischen Genese ist dabei zweierlei: Zum einen wird die Hilfsbedürftigkeit des Menschen im Verlaufe der Zeit immer mehr auf dessen Besitzund Eigentumsverhältnissen verengt; zum anderen lässt sich damit einhergehend die Einführung immer feinere Abstufungen verschiedener Formen der Armut beobachten. Entsprechend betrachtet im 18. Jahrhundert der Naturrechtstheoretiker Christian Wolff jenen als „arm (pauperem) dessen Vermögen weiter nichts als das nothwendigste enthält; dürftig aber oder gar sehr arm (egenum) denjenigen, dem es auch an dem nothwendigen fehlet. Wenn jemand so dürftig ist, daß ihm auch dasjenige fehlt, was zur äußersten Nothdurft des Lebens gehört; so ist er ein Bettler, oder bettelarm (mendicus).“532 Und nur demjenigen kommt das Recht zu, betteln zu gehen, der sich in dieser Situation nicht selbst mit dem Verdienst seiner Arbeit zu ernähren vermag.533 Die Unterschiede zwischen den Bettlern und den Armen werden hier als graduelle dargestellt und im Sinne einer Armutskarriere interpretiert. Im Mittelalter – und selbst noch bei Vives534 – wurden dahingegen zu den Armen nicht nur diejenigen gezählt, denen es an materiellen Gütern und Besitz mangelte, als arm galten vielmehr all diejenigen, die keine Macht, kein gesellschaftliches Ansehen, keine rechtlichen Privilegien aufwiesen. Diese paupers fanden sich allerdings durchaus in den Personenverbänden der familiae inkludiert und waren damit der Schutz- und Fürsorgepflicht der Starken und Mächtigen (potentes) unterstellt.535 Armut umschreibt hier einen Zustand, den der Mensch mehr oder weniger passiv erduldet, weil er sich in der Obhut eines Dritten, dem pater pauperum, weiß. Während der Arme als integraler Bestandteil eines gesellschaftlichen Ordnungsgefüges seinen Berufungen nachgeht, kennzeichnet den Bettler einen Mangel, einen „defectus“536, wie es bei dem Scholastiker Thomas von Aquin heißt, der es ihm unmöglich macht, im Einklang mit den Anforderungen seiner körperlich-seelischen Natur zu leben. In den leiblichen und geistigen Werken der Barmherzigkeit, die im Anschluss an das Matthäus-Evangelium von zahlreichen mittelalterlichen Theologen ausformuliert wurden, finden sich diese Mängel näher konkretisiert, nämlich im Bereich des Körperlichen: Hunger, Durst, Nacktheit, Fremdheit, Krankheit, Gefangenschaft, Unbeerdigtsein; und im Bereich des Seelischen: Unwissenheit, Zweifel, Trauer, Sünde, 531 532 533 534 535 536 Vgl. SCHERNER, Karl Otto: Das Recht der Armen und Bettler im Ancien régime. In: Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte 96 (1979), S. 55-99, hier S. S. 71. Zu Frankreich vgl. HUFTON, Olwen H.: The Poor of Eighteenth-Century France 1750-1789. Oxford 1974, S. 20. Zur Unterscheidung von ‚pauperes’ und ‚indigentes’ vgl. MOLLAT, Michel: Die Armen im Mittelalter. München 1984, S.37 f. WOLFF, Grundsätze des Natur- und Völkerrechts (wie Anm. 362), S. 302 f. Vgl. ebd., S. 303. Allerdings reflektiert Vives bereits, dass sich dieser allgemeine Begriff von Armut langsam zu zersetzen droht. „Wer also fremder Hilfe bedarf, ist arm und braucht Mitleid, was auf griechisch Almosen heißt; das bedeutet nicht nur Geldspenden, wie die Leute glauben, sondern jede Leistung, die menschliche Not lindert. VIVES, De subventione pauperum (wie Anm. 333), S. 286. Vgl. BOSL, Karl: Potens und Pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zur gesellschaftlichen Differenzierung im frühen Mittelalter und zum ‚Pauperismus’ des Hochmittelalters In: Alteuropa und die moderne Gesellschaft. Festschrift für Otto Brunner. Hamburg / Göttingen 1963, S. 60-87. S. th. II-II, q. 32,2. 218 Beleidigung, getanes Unrecht und fehlender seelischer Beistand. Die Art des Almosens war entsprechend davon abhängig zu machen, welche Mängel dem Helfenden als objektive Erscheinungsformen der Hilfsbedürftigkeit gegenübertraten.537 Für die mittelalterliche Almosenlehre ist dabei die Hilfsbedürftigkeit lediglich „Anlaß und Objekt [...]. Die Ganzheit der individuellen Notlage, die aus der Besonderheit der äußeren Bedingungen und der Eigenart der Persönlichkeit erwächst [...], kennt sie daher nicht, nur die einzelnen zuständlichen Mängel, die sich aus der Unmöglichkeit ergeben, die verschiedenen natürlichen und geistlichen Bedürfnisse zu befriedigen.“538 Beim Almosengeben kam es insofern allein darauf an, die Mängel des Gegenübers festzustellen, nicht aber nach dessen Motive zu fragen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mit dem sozialen, ökonomischen und politischen Aufstieg der spätmittelalterlichen Städte beginnt sich allmählich eine Armutssemantik herauszukristallisieren und durchzusetzen, die auf die Bedeutung des Ungleichgewichts der Besitzverhältnisse von Armen und Reichen hinweist. Seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bildete die Formel arm und reich nicht nur die vorherrschende Bezeichnung für die nach Strata differenzierte Gesellschaft, darüber hinaus kommt in ihr ein städtisches Gleichheitsdenken zum Ausdruck.539 Unabhängig davon, ob ein Mensch zu den Armen oder zu den Reichen zu zählen ist, sieht er sich als Geschöpf Gottes den moralischen Pflichten einer christlichen Gemeinschaft verpflichtet. Die Unterscheidung selbst wird aus der Notwendigkeit von Ordnung und der Einrichtung von Eigentum abgeleitet, wobei den Reichen die Pflicht zufällt, die Armen an ihren Überschüssen zu beteiligen, während sich die Armen ihrerseits mit ihrer Arbeit in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen haben.540 Vermehrt tauchen jetzt Beschreibungen des Bettlers auf, die sich nicht mehr so sehr an dessen Mängel und Defekten, also an dessen Eigenschaften, orientieren, sondern vielmehr dessen fehlende Bereitschaft bean537 538 539 540 Zur Vielgestaltigkeit des mittelalterlichen Almosen vgl. SCHUBERT, Ernst: Gestalt und Gestaltwandel des Almosens im Mittelalter. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 52 (1992), S. 241-262. SCHERPNER, Hans: Theorie der Fürsorge. Göttingen 1962, S. 37. Vgl. FRENZ, Barbara: Gleichheitsdenken in deutschen Städten des 12. bis 15. Jahrhunderts. Geistesgeschichte, Quellensprache, Gesellschaftsfunktion. Köln 2000. Diese Unterstützungsverpflichtung der Reichen lag in einer theologischen Eigentumslehre begründet, die von einem ursprünglichen Gemeineigentum ausging. Noch bis in das 18. Jahrhundert hinein wird entsprechend dem Armen das Recht zugesprochen, in Notsituationen, in denen die Reichen nicht ihrer Unterstützungspflicht nachkommen, für die Beschaffung des zum Leben Notwendigen zu stehlen. Bereits bei Thomas von Aquin heißt es dazu: „Im Falle äußerster Not sind alle Dinge gemeinsam. Deshalb darf der, der solche Not leidet, von fremden Gut zu seinem Unterhalt nehmen, wenn er keinen findet, der ihm freiwillig gibt.“ S. th. II-II, q. 32,7 ad 3. Zur Bedeutung der Eigentumslehre im kanonischen Recht vgl. TIERNEY, Brian: Medieval Poor Law. A Sketch of Canonical Theory and Its Application in England. Berkely / Los Angeles 1959, S. 22 ff. Das Recht, dem Besitzenden das zum Leben Notwendige zu entwenden, wird schließlich im späteren Naturrecht abgelehnt. Gleichzeitig wird die Unterstützungsverpflichtung des Reichen auf eine ethische Verpflichtung verkürzt. „Wer stiehlt, um nicht zu verhungern, hat bey aller seiner Noth doch niemals ein Recht, dem anderen unrecht zu thun. Der Andere aber, der bestohlen wird, hätte in einem solchen Falle die innere (ethische) Pflicht, von dem ihm Entbehrlichen dem Nothleidenden mitzutheilen. Um dieser Pflicht des Beeinträchtigten willen wird dem Stehlenden wegen seines Unrechts Nachsicht gewährt, deßen Handlung übrigens nach der bloß juristischen Gesetzgebung immer widerrechtlich ist, und bleibt; ob sie gleich nicht bestraft werden kann; weil die Strafe niemals mit dem Beweggrunde zum Handeln gegen das Gesetz in eine Gleichgewicht kommen kann.“ BUHLE, Johann Gottlieb: Lehrbuch des Naturrechts. Brüssel 1969 [ND Göttingen, 1798], S. 73 f. 219 standen, sich dem Wohl der Gemeinschaft unterzuordnen. „Betler nenne ich“, so heißt es in einem Traktat von Wenzeslaus Link aus dem Jahre 1523, „die von eynem ortte zum andern lauffen, und alle, die vermügen anndern leutten yrgenterley weys zudienen (noch dem eyn yeder mensch geschaffen ist, den andern zu dienen nach seynem vermügen, wie eyn yetzlich glidmaß des leybes nach seiner art dem leybe dienet) unn solchs nit thum wollen. Das sein, die nit dienen wöllen der gemeyne so vil jn müglich, dar mit sie auch in der gemeyne enthalten wurden, sondern nur die andern beschweren und beschedigen, darmit sie wider gottes ordnung und brüderliche liebe selber jren wollust der bauchmatungen suchen. Also sihesttu, das solcher bettel stracks wider die liebe strebet, welcher Art ist, yederman zuhellfen und dienen, niemant zubeschedigen. Der bettel aber will niemandt dienen und von yederman dienst haben.“541 Im Gegensatz zum Armen, der demütig seine Stellung und Aufgaben in der Gemeinschaft akzeptiert, ist der Bettler durch ein aktives Handeln gekennzeichnet, das Bindungen nur für den kurzen Augenblick, in dem es an der Verteilung von Überschüssen partizipiert, einzugehen bereit ist. Der Bettler wird jetzt als fordernd und arbeitsscheu gebrandmarkt. Er ist ein Betrüger, der über die Darstellung von körperlichen Handicaps das Almosen zu erschleichen sucht, ohne dafür auch eine Gegenleistung erbringen zu wollen. Diese an der Person des Bettlers selbst festgemachte Differenzierung von Handeln und situativen Kontext, von Mitteilung und Information, tritt in der Folgezeit immer klarer ins öffentliche Bewusstsein. Dem Bettler wird jetzt unterstellt, dass er seine Mitteilungshandlung bewusst auf ihren Informationswert hin befragt. Es ist dann nicht mehr so sehr die Hilfsbedürftigkeit an sich, sondern vielmehr ihre gelungene Darstellung im Akt des Bettelns, von der der Erfolg seines Verhaltens abhängt.542 Wurde er bisher ausschließlich in seiner Not und in seinem Angewiesensein auf die Hilfe Dritter wahrgenommen, so wird jetzt die Handlung des Bettelns selbst zum Wesensmerkmal stilisiert, das ihm zum Bettler macht.543 Diese veränderte Sichtweise auf seine Person setzt ein verstärktes Interesse an den Handlungsmotiven frei, die den Menschen dazu bewegen, sich für oder gegen das Betteln zu entscheiden. Seit dem Spätmittelalter wird diese Wahlfreiheit des Hilfsbedürftigen am Gegensatzpaar des verschämten Armen und des ‚starken’, arbeitsfähigen Bettlers diskutiert.544 Der verschämte Arme ist ein vormals Reicher, der sich auf- 541 542 543 544 LINCK, Von Arbeit und Betteln (wie Anm. 455), S. 162. Diese Verschiebung der Perspektive auf den Bettler spiegelt sich auch in der Kunst wider. Noch bis in das 15. Jahrhundert werden die Bettler ausschließlich in ihrem Gebrechen dargestellt, während im 16. Jahrhundert die Bittgebärde als ihr Wesensmerkmal in den Vordergrund tritt. Vgl. JÜTTE, Robert: Arme, Bettler, Beutelschneider. Eine Sozialgeschichte der Armut in der Frühen Neuzeit. Weimar 2000, S. 20 ff. Noch der Spätscholastiker Domingo de Soto hat diese veränderte Sichtweise nicht ganz mit vollzogen, wenn er schreibt: „’Bettler’ nennt man nicht nur die, welche betteln gehen, sondern auch alle die, welche Almosen erhalten und davon leben.“ DOMINGO DE SOTO, Regelung der Armenhilfe (wie Anm. 530), S. 393 f. Am Anfang des 16. Jahrhunderts listet das Liber vagatorum unterschiedliche Bettlertypen auf, wobei es einzig und allein dem verschämten Armen das Recht zubilligt, ein Almosen zu erhalten. Vgl. ANONYM: Liber vagato- 220 grund seiner Herkunft geniert, betteln zu gehen. Der starke Bettler dahingegen verlegt sich aufs Betteln, um seiner Arbeitsverpflichtung zu entgehen, die ihm als Armer zukommt. Scham auf der einen und Müßiggang auf der anderen Seite werden jetzt als Motive ausgemacht, die der Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme am Interaktionssystem der personalen Hilfe zugrunde liegen. Während der verschämte Arme seine Lebenssituation dissimuliert, also seine Not so gut wie es eben geht vor den Augen der Öffentlichkeit verbirgt, ist das Verhalten des starken Bettlers allein darauf ausgerichtet, durch die Simulation seiner Hilfsbedürftigkeit Almosen zu erlangen. Bei der Simulation wie auch bei der Dissimulation handelt es sich um Formen der Selbstkontrolle, die ein Wissen von dem voraussetzen, welche Reaktionen zu erwarten sind, wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält.545 Es sind Techniken der Selbstdarstellung, mit denen man das eigene Verhalten auf die jeweiligen Beobachtungen des Gegenübers abzustimmen versucht. Mit ihrer Entdeckung und mit ihrer Thematisierung im gesellschaftlichen Diskurs stellen sich für das Interaktionssystem der personalen Hilfe zum Teil gravierende Konsequenzen ein. Auf der normativen Ebene kommt es zum Erlaß von Maßnahmen, die darauf abzielen, das Betteln gänzlich zu verbieten.546 Denn den wahrhaft hilfsbedürftigen Menschen wird „nur wenig geholfen, wenn man ihnen erlaubt, betteln zu gehen, und mitleidige Herzen, welche Triebe der Menschenliebe empfinden, um Allmosen anzusprechen. Diese Hülfe ist allemal ungewiß, und diejenigen, welche des Allmosen am würdigsten sind, erlangen dadurch die wenigste Unterstützung; weil auch das Betteln eine gewisse Kunst und Geschicklichkeit erfordert, worunter sich viel Unverschämtheit und Bosheit einmischet.“547 Zum einen ist man sich jetzt darüber bewusst, dass die im Erscheinungsbild des Bettlers zum Ausdruck kommende Not lediglich ein trügerisches Blendwerk einer tatsächlichen Hilfsbedürftigkeit sein kann. Als Simulant einer Lebenssituation, die nicht seiner eigenen entspricht, vermag er sich an sozialen Verhaltenserwartungen zu orientieren, um auf diese Weise ein erhofftes Wohlwollen bei seinem Gegenüber zu evozieren. Wer demnach wirklich wissen will, mit wem er es in der Interaktion zu tun hat, muss nach dessen Handlungsmotiven fragen. Die Almosengabe wird damit der Beliebigkeit des wahrnehmenden Subjekts überantwor- 545 546 547 rum. In: BOEHNCKE, Heiner / JOHANNSMEIER, Rolf (Hg.): Das Buch der Vaganten. Spieler, Huren, Leutbetrüger. Köln 1987, S. 79-101. Es sind insbesondere die Bettelorden, die bei der Verbreitung dieses Wissens eine entscheidende Rolle gespielt haben. Einerseits entwerfen sie in ihren an die Bevölkerung gerichteten Predigten und den darin zur Verwendung kommenden Exempla ein ‚öffentliches’ Bild des typischen Bettlers – ähnlich wie es später in den öffentlich verkündeten Bettelordnungen der Städte geschieht. Der Bettler wird zu einer markanten Erscheinung, die es den Almosengebern ermöglicht, sich seiner Hilfsbedürftigkeit zu vergewissern. Andererseits zielen die Bettelorden vor allem auf die im direkten Kontakt zu bewerkstelligende Kontrolle des Bettlers. Er wird zum Akteur, der die Form seines Verhältnisses zu Gott mitbestimmt und sich von daher nicht länger seinem Schicksal passiv ausgeliefert sieht. Vgl. MOLLAT, Die Armen im Mittelalter (wie Anm. 531), S. 108 f. Vgl. dazu Kap. 4.4 der Dissertation. JUSTI, Johann H. G. von: Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten, oder ausführliche Vorstellung der gesamten Policeywissenschaft. Bd. 2. Aalen 1965 [Königsberg / Leipzig, 1761], S. 394. 221 tet, der über die Glaubwürdigkeit seines Interaktionspartners zu befinden hat.548 Zum anderen verliert die Lebenssituation, mit der sich der Bedürftige konfrontiert sieht, die Qualität, Verhaltensweisen mehr oder minder schicksalhaft zu bewirken. Sie wird vielmehr als jene Rahmung ausgemacht, die einen Horizont alternativer Verhaltensweisen preisgibt, zwischen denen man wählen kann. Denn nur insoweit dem Hilfsbedürftigen auch die Freiheit zuzustehen ist, das zu negieren, was die Situation nahe legt, lässt sich ihm sein Handeln als Selektion zurechnen, die über die Teilnahme am Interaktionssystem der personalen Hilfe entscheidet. Wenn es also das Interaktionssystem der personalen Hilfe ist, welches den Bedürftigen die Entscheidung abverlangt, ob er nach Hilfe nachsuchen will oder nicht, dann ist es auch dasselbe Interaktionssystem, das jene Bedürftigen hervorbringt, die von der Hilfe ausgeschlossen bleiben, weil sie sich eben nicht zu einem entsprechenden Handeln entschließen konnten. Das Interaktionssystem der personalen Hilfe generiert auf diese Weise eine Ungleichheit zwischen Personen, denen geholfen, und jenen, denen nicht geholfen wird, und dies ungeachtet dessen, dass sowohl der einen als auch der anderen Personengruppe durchaus das Recht zufallen kann, Hilfe zu erfahren. Wer dieses Paradox beobachtet, der kann dem Helfen keinen eindeutigen Wert mehr zuordnen, von dem her es sich legitimieren ließe. Warum sollte demjenigen geholfen werden, der darum bittet, demjenigen aber die Hilfe nicht zuteil werden, der sich seiner Lebenssituation schämt? Vor allem aber lassen sich jene Personen, die innerhalb des Interaktionssystems keine Unterstützung erfahren, nicht mehr mit jenen gleichsetzen, die aufgrund ihres Eingebundenseins in die Gemeinschaft keiner Hilfe bedürfen. Man sieht jetzt vielmehr, dass das Interaktionssystem der personalen Hilfe die Differenz von hilfsbedürftig/nicht-hilfsbedürftig selbst erzeugt und dass der Erfolg des Helfens somit von den Motiven dessen abhängt, der sich um die Hilfe bemüht, Hilfe sich also keineswegs nur in dem asymmetrischen Gefälle zwischen dem Geber und Nehmer manifestiert. Die soziale Asymmetrie zwischen dem Geber und dem Nehmer, die Voß als ein Wesensmerkmal der formal freiwilligen Armenunterstützung ausgemacht hat, ist folglich nur ein historischer Sonderfall, der vor allem in einer hierarchisch gestuften, nach spezifischen Rangpositionen untergliederten Sozialordnung Plausibilität erlangen konnte. Sie beginnt jedoch in dem Moment ihre Evidenz einzubüßen, in dem man sich nicht mehr vollends gewiss sein kann, ob der Bettler nicht über Geldreserven verfügt, welche die eigenen Mittel übersteigen, in dem Moment 548 Gleichwohl wird gerade an der Beliebigkeit des Almosengebens von Autoren Kritik geübt, die der mittelalterlichen Almosentheorie verhaftet bleiben. Für sie war die spontane Almosengabe eine christliche Pflicht, die ohne genaue Prüfung der Hilfsbedürftigkeit des Bettlers auszukommen hatte. Der Bettler „leidet am Nötigsten Mangel, er hat also ein Recht zu fordern, und du darfst ihm die Gabe nicht verweigern. Kommt dir deshalb in den Sinn, er sei ein Lungerer, ein Faulenzer, ein Lügner und Betrüger [...], so antworte durch den Glauben. Ich gebe es nicht ihm, sondern einem anderen, denn Gott ist es, der mich durch ihn bittet.“ DE LORENZI, Phillip: Geiler von Kaysersberg. Ausgewählte Schriften. Bd. I. Trier 1881, S. 413; zit. n.: SCHERPNER, Theorie der Fürsorge (wie Anm. 538), S. 57. 222 also, in dem man das Betteln als eine (wenngleich sozial inakzeptable) Praktik zur Erhaltung von Liquidität erkennt. „Dann bættlen das důt nyeman we On dem / der es zů nott můß triben Sunst ist gar gůt eyn bættler bliben [...] Vil neren vß dem bættel sich Die me geltts hant / dann du vnd ich“549 Als Ausweg aus dieser misslichen Lage wird die Hilfe schließlich in die Hand von Organisationen gelegt, die sich auf das Helfen spezialisieren und in denen Regeln zur Anwendung kommen, mit denen sich die Hilfsbedürftigkeit eines Menschen auch unabhängig von den subjektiven Erwägungen des Helfenden feststellen lässt.550 4.3.4 Die Funktion des Almosens Wenn die Almosengabe Egos die Hilfsbedürftigkeit Alters voraussetzt, dann ist es offensichtlich, dass die Lebenssituation Alters nach der Gabe nicht die gleiche sein kann wie vor der Gabe, dass also jedes weitere Wahrnehmen der Bedürftigkeit Gefahr laufen würde, den Anlass der Gabe selbst infrage zu stellen. Und dies nicht nur, weil bei einer Notlage, die durch eine Gabe nicht zu beheben ist, es kaum mehr plausibel erschiene, dem Bedürftigen zu helfen. Vielmehr steht die Bedürftigkeit des Bettlers selbst auf dem Spiel. War es überhaupt seine Not, die ihn zum Betteln bewegte oder aber ist das Betteln nur ein äußeres Verhalten, das sich an gängigen Erwartungserwartungen orientiert, um ungeachtet einer tatsächlich vorhandenen Bedürftigkeit Unterstützung zu erlangen? Das Interaktionssystem der personalen Hilfe darf die Wiederverwendbarkeit seiner Operationen also gerade nicht von einer in den Wirkungen des Almosens unmittelbar ablesbaren Zweckmäßigkeit abhängig machen. Würde es dies tun, sähe sich die Almosengabe schnell mit dem Enttäuschungsfall konfrontiert, dass sie nicht das erreichen kann, was sie sich als Ziel vorgibt, nämlich zu helfen. Die mittelalterliche Almosenlehre umgeht dieses Problem der Zweckmäßigkeit, indem sie den Almosengeber erst gar nicht mit der Verpflichtung belastet, für das not549 550 BRANDT, Sebastian: Narrenschiff. Nach der Erstausgabe (Basel 1494) mit den Zusätzen der Ausgaben von 1495 und 1499 sowie den Holzschnitten der deutschen Originalausgaben. Tübingen 1968, S. 155 f. Vgl. LUHMANN, Niklas: Formen des Helfens (wie Anm. 416). Die historische Armutsforschung spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Bürokratisierung und Rationalisierung der Armenfürsorge. Vgl. SACHßE, Christoph / TENNSTEDT, Florian : Vom Almosen zur frühmodernen Sozialpolitik. Armut und Armenfürsorge im Spätmittelalter. In: SACHßE, Christoph / TENNSTEDT, Florian: Bettler, Gauner und Proleten. Armenfürsorge in der deutschen Geschichte. Reinbeck b. Hamburg 1983, S. 34-48, hier S. 43 ff. 223 wendige Auskommen des Bettlers Sorge zu tragen. Der Almosengeber hat lediglich seinen ihm möglichen Beitrag zu leisten, und indem er dies tut, entbindet er sich von jeder weiteren Verpflichtung, den in Not Geratenen zur Seite zu stehen. Die Hilfeleistung trägt als Nächstenliebe ihren Wert in sich selbst und lässt sich somit auf den Moment des Kontaktes, des Sichtbarwerdens eines Mangels, beschränken. Diese Ambivalenz der personalen Hilfe, die das Wohlergehen des Notleidenden einerseits von der Nächstenliebe abhängig macht, die andererseits aber zugleich auch die begrenzte Verantwortlichkeit des Helfenden betont, leitet sich aus der Ordolehre des Mittelalters ab. Diese sieht vor, dass jeder Mensch von Natur aus einer Gemeinschaft angehört, dessen Mitglieder sich die Erbringung von Leistungen wechselseitig schulden. Der Bettler jedoch steht außerhalb dieser Ordnung von Leistung und Gegenleistung, insofern er an einem Mangel leidet, der ihn außerstande setzt, den Verpflichtungen gegenüber seiner eigenen Natur gerecht zu werden. Die aus seinem defizitären Status sich ergebenden Konsequenzen betreffen aber nicht nur ihn selbst, sondern sie berühren gleichermaßen die Gemeinschaft als Ganzes. Zum einen, weil das Ganze die Elemente, aus denen es sich zusammensetzt, also die einzelnen Mitglieder des Hauses, in ein interdependentes Beziehungsgeflecht einbindet, sodass jeder Ausfall eines Elements den Bestand des Ganzen gefährdet. Die mittelalterliche Almosenlehre weist von daher seit alters her auf die Verpflichtung hin, die in Not geratenen Familienangehörigen vorrangig zu unterstützen. Zum anderen eröffnen die einzelnen Teile in ihrer wechselseitigen Bezugnahme aufeinander dem Individuum erst die Möglichkeit, sich über die Erbringung spezifischer Leistungen als Person zu konstituieren. Für die einzelnen Gemeinschaftsmitglieder gilt somit, dass sie zwar jenen zu helfen bereit sein müssen, die sich nicht aus eigenen Kräften in der Ordnung zu halten vermögen, und zwar aus Gründen des Zusammenhalts des Ganzen, dass sie aber in ihren Bemühungen niemals ein Limit überschreiten dürfen, wodurch es ihnen unmöglich wird, ihre Verpflichtungen gegenüber sich selbst wie auch gegenüber den anderen Mitgliedern zu erfüllen. Das Interaktionssystem der personalen Hilfe differenziert sich an dem in der Sozialordnung stratifikatorisch differenzierter Gesellschaften angelegten Problem aus, wie sich die im Teil/Ganzen-Schema vorausgesetzte Einheit des Differenten auch gegen soziale Beziehungen absichern lässt, die sich der Norm der Reziprozität verweigern. Es entspringt, anders gesagt, einem Bedarf nach Kommunikationen, die sich gegenüber der Möglichkeit des Misslingens eines wechselseitigen Leistungsausgleichs zwischen Alter und Ego offen verhalten. Von diesem analytischen Blickwinkel aus betrachtet geht es beim Helfen „um ‚Daseinsnachsorge’ im Sinne einer gegenwärtigen Kompensation aus der Vergangenheit übernommener Defizite an Teilnahmecha- 224 ncen an gesellschaftlicher Kommunikation.“551 Wie kann nun aber Ego dazu veranlasst werden, Alter zu helfen, obwohl dieser als Person sich seinerseits außerstande gesetzt sieht, die Leistung mit einer Gegenleistung zu entgelten? Das Interaktionssystem der personalen Hilfe hat zu diesem Zweck Verhaltensmotive zu offerieren, die – obzwar sie von einem innergesellschaftlichen Leistungsausgleich absehen – hinreichend plausible Gründe ihrer Aktualisierung anzeigen. In der mittelalterlichen Almosenlehre erfolgt die Konturierung dieser Verhaltensmotive im Medium der Religion. Für den Gläubigen gilt das Almosengeben als eine ethisch-religiöse Pflicht, die immer dann zum Tragen kommt, wenn auf seiner Seite ein Überfluss, ein superfluum, auf der Seite des Nehmers dahingegen ein tatsächlicher Mangel vorliegt.552 Ein Überfluss besteht dort, wo eine Person mehr ihr eigen nennen kann, als sie für ihren standesgemäßen Unterhalt benötigt. Eigentum verpflichtet, da die „zeitlichen Güter, die dem Menschen von Gott gegeben werden, [...] ihm zwar [gehören – J.H.], was das Eigentumsrecht angeht; was aber den Gebrauch angeht, so dürfen sie nicht ihm allein gehören, sondern auch den anderen, die aus ihrem Überfluß unterstützt werden können.“ Und in Bezugnahme auf Basilius führt Thomas von Aquin weiter aus: „Wenn Du bekennst, daß sie (nämlich die zeitlichen Güter) dir von Gott kommen – ist Gott vielleicht ungerecht, daß Er die Lebensgüter an uns so ungerecht verteilt? Warum bist du dann reich, jener aber bettelarm? Jedenfalls nur deshalb, damit du für deine gute und treue Verwaltung einen Lohn erhältst, jener aber mit den herrlichen Siegespreisen der Geduld geschmückt werde! Dem Hungrigen gehört das Brot, das du zurückhältst; dem Nackten das Kleid, das du im Schranke verwahrst; dem Barfüßigen der Schuh, der bei dir verfault; dem Bedürftigen das Silber, das du vergraben hast.“553 Die Person sieht sich nicht nur allgemeinen Verpflichtungen unterworfen, insofern sie Teil einer Gemeinschaft ist. Sie befindet sich zugleich auch in einer unmittelbaren Beziehung zu Gott, von dem sie einen Lohn für ihr verdienstvolles Handeln zu erwarten hat. „Almosen ist ein Werk“, so heißt es bei Thomas von Aquin weiter, „das wir aus Mitleid den Bedürftigen leisten um Gottes willen.“554 Indem der Almosengeber Barmherzigkeit gegenüber dem in Not geratenen Nächsten walten lässt, steht ihm selbst in Aussicht, Barmherzigkeit zu erfahren. Mit dem Almosen macht er einen Anspruch an eine Zukunft geltend, in der er Gott für sein Leben Rechenschaft abzulegen hat. In diesem Sinne bildet das Almosen ein funktionales Äquivalent zum Geld. Es dient in einer Gesellschaft, deren soziale Ordnung sich allein aus dem höheren Ziel erklärt, dem Individuum Möglichkeiten zur Heilsverwirklichung bereitzustellen, der Daseinsvorsorge. Das Interaktionssystem der personalen Hilfe weist demnach sowohl eine manifeste als auch eine 551 552 553 554 BAECKER, Dirk: Soziale Hilfe als Funktionssystem. In: Zeitschrift für Soziologie 23 (1994), S. 993-110, hier S. 98. Zur mittelalterlichen Almosentheorie vgl. FOERSTL, Johann Nepomuk: Das Almosen. Eine Untersuchung über die Grundsätze der Armenfürsorge in Mittelalter und Gegenwart. Paderborn 1909; SCHERPNER, Theorie der Fürsorge (wie Anm. 538), S. 24 ff. S. th. II-II, q. 32,5 ad 2. S. th. II-II, q. 32,1. 225 latente Funktion auf.555 Während die religiösen Selbstbeschreibungen der Gesellschaft das Almosen in seiner manifesten Funktion als eine Daseinsvorsorge des sündigen Christen für das zu erwartende Jüngste Gericht würdigen, bleibt ihnen seine latente Funktion der Daseinsnachsorge, mit der sich die Norm der Reziprozität gegen Kontingentes stabilisiert, verborgen. Es stellt sich an diesem Punkt aber die Frage, warum sich die latente Funktion den gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen als Thema nicht preisgeben darf? Liegt es daran, dass die Latenz selbst eine Funktion hat? Wenn dies der Fall ist, welche Struktur muss das Interaktionssystem der personalen Hilfe annehmen, um seine latente Funktion latent halten zu können? Und welche Konsequenzen stellen sich schließlich für das System ein, wenn die Latenz freigelegt und einer Plausibilitätsprüfung unterzogen wird? In der mittelalterlichen Almosenlehre wird die Funktion des Interaktionssystems der personalen Hilfe noch nicht gesamtgesellschaftlich rekonstruiert. Generell sehen vormoderne Gesellschaften solche Differenzierungen unterschiedlicher sozialer Systeme, die jeweils eine spezifische Funktion für die Gesellschaft als Ganzes erfüllen, noch nicht vor. Funktionen werden nicht an einzelnen Sinnsystemen, sondern an Rollenträgern festgemacht, die in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen. Diese hierarchische Struktur ist es, die den Systemen ihre Einheit verleiht. Auch die soziale Beziehung zwischen dem Almosengeber und Bettler ist durch ein solches asymmetrisches Gefälle gekennzeichnet. Innerhalb dieser Struktur fällt dem Bettler als Inhaber eines sozialen Status die Funktion zu, dem Almosengeber in seinem diesseitigen Leben Möglichkeiten zu eröffnen, für eine ausgeglichene Bilanz zwischen seinen begangenen Sünden und seinen begangenen Wohltaten zu sorgen. Während die Stabilität sozialer Ordnung von der Norm der Reziprozität abhängig gemacht wird, dient das Interaktionssystem der personalen Hilfe allein der Kompensation von aus dem Sündenfall des Menschen resultierenden Zukunftsunsicherheiten. Vor dem Sündenfall, als der Mensch noch keine Vergangenheit und Zukunft hatte, bedurfte er des Bettlers nicht. Erst mit dem Sündenfall wurde das Interaktionssystem der personalen Hilfe als eine Institution unerlässlich, die der Person Gelegenheiten bereithält, eine Daseinsvorsorge zu betreiben: dem Almosengeber durch seine guten Werke, dem Bettler durch seine innerweltliche Askese. Um sich nahtlos in die hierarchischen Strukturen vormoderner Gesellschaften einpassen zu können, muss das Interaktionssystem der personalen Hilfe dabei imstande sein, die Differenz zwischen Alter und Ego als Einheit des Differenten zu symbolisieren. Es muss das jeweils Individuelle ihrer Differenz aus dem Allgemeinen deduzieren, ohne dabei das eine dem anderen zu opfern. Der gleichen Logik folgt auch die Norm der Reziprozität, insofern ihr der Gedanke eigen ist, dass Alter und Ego in der Erbringung ihrer jeweiligen Leistungen sich wechselseitig ergänzen 555 Zu dieser Unterscheidung vgl. MERTON, Robert K.: Manifeste und latente Funktionen. In: MERTON, Robert K.: Soziologische Theorie und soziale Struktur. Berlin / New York 1995, S. 17-80. Zur systemtheoretischen Anwendung vgl. LUHMANN, Soziale Systeme (wie Anm. 24), S. 456 ff. 226 und ohne den jeweils Anderen der ihnen gegebenen Natur nicht entsprechen können. Innerhalb des Interaktionssystems der personalen Hilfe ist es nun aber nicht die Reziprozität, sondern vielmehr die Komplementarität von Rechten und Pflichten, über die eine Symbolisierung der Differenz als Einheit des Differenten zu erfolgen hat. Das genauer zu klärende soziologische Problem, welches sich an diesem Punkt einstellt, besteht dann in der Frage, wie es dem Interaktionssystem der personalen Hilfe unter diesen veränderten Bedingungen gelingen kann, seine Einheit sicherzustellen, ohne dabei einen Funktionsbezug zu seiner Umwelt einzurichten. Im Interaktionssystem der personalen Hilfe erfolgt die Symbolisierung der Einheit einer Differenz über das Almosen. Eine erste Annäherung an den Symbolcharakter des Almosens lässt sich über dessen semantischen Bedeutungsgehalt erreichen. Die etymologischen Wurzeln des Wortes liegen in dem griechischen eleemosyne begründet, das ins Deutsche übersetzt soviel heißt wie Mitleid.556 In der Anthropologie der antiken Philosophie gehört das Mitleid zu den Affekten, welche den Menschen in einen Gemütszustand versetzen, in dem dieser entweder Lust oder Unlust verspürt. Die Affekte machen die menschliche Seele von ihrem Erleben der Außenwelt, dem Empfang äußerer, sinnlicher Eindrücke abhängig. Sie bilden damit das genaue Gegenstück zur Vernunft, mittels derer der Mensch die Bewegungen seiner Seele beherrscht und damit seiner Natur als Vernunftwesen entspricht. Wer also Mitleid empfindet, der partizipiert an den Schmerzen und Leiden des Anderen, und zwar in einer Weise, die ihm selbst Unlust, Unbehagen und Niedergeschlagenheit verspüren lässt.557 Bei Thomas von Aquin heißt es entsprechend: „Mitleid ist Mit-erleben des fremden Leides; so kommt es, daß einer Mitleid hat, weil er Schmerz empfindet über das fremde Leid. Weil aber Trauer und Schmerz auf das eigene Übel gehen, so empfindet einer insoweit über das fremde Leid Trauer und Schmerz, als er das fremde Leid als eigenes erlebt.“558 Im Mitleid wird mithin das Erleben Alters zum Erleben Egos. In seiner ursprünglichen Bedeutung meint es also mehr, als aus einer Position der Distanz heraus das Leid des Gegenübers zum Anlass des Mitfühlens zu nehmen. Mit-Leiden heißt, an dessen Leid teilzuhaben, zu erleben, was dieser erlebt. Egos Erleben steht hier nicht nur für dessen eigenes Erleben, sondern auch für jenes von Alter, es steht für die Einheit einer Differenz. Nun wurde aber zu keiner Zeit dem Menschen die Fähigkeit zugesprochen, die Gedanken eines anderen Menschen zu denken oder seine Affekte nachzuempfinden, also die Singularität des Individuums zu überwinden. Die Einheit der Differenz muss also auf eine Weise aufgelöst werden, die es weiterhin zulässt, zwischen dem Erleben Alters und dem von Ego zu unterscheiden. Obwohl Ego das Leid Alters als sein eigenes Leid erfährt, so ist doch sein Leid von jenem verschieden, das seinem Gegenüber wider556 557 558 Vgl. Art. Almosen. In: KLUGE, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin / New York 2002. Erst bei Rousseau und Wittgenstein finden sich Mitleidsdefinitionen, die darauf verzichten, es als ein eigenes Leiden zu betrachten. Vgl. HAMBURGER, Käte: Das Mitleid. Stuttgart 1985, S. 98. S. th. II-II, q. 30,2. 227 fahren ist. Aber wie kann es dann angesichts der Differenz zwischen Alter und Ego überhaupt sein, dass Mitleid erlebt wird? Was veranlasst Ego dazu, sich nicht von dem Leid Alters abzuwenden und anderen erfreulicheren Dingen zuzuwenden, die ihm Lust bereiten? Eine Antwort auf diese Frage findet sich bereits bei Aristoteles vorgezeichnet, der das Mitleid als „ein Schmerzgefühl über ein in die Augen fallendes, vernichtendes und schmerzbringendes Übel [beschreibt – J.H.], das jemanden trifft, der nicht verdient, es zu erleiden, das man auch für sich selbst oder einen der unsrigen zu erleiden erwarten muß, und zwar wenn es in der Nähe zu sein scheint [...].“559 Mitleid lässt sich also nur in jenen Fällen empfinden, in denen das Unglück Alters eine Perspektive für Ego aufweist, die ihm sein eigenes Betroffensein vor Augen führt. Mitleid setzt, noch einmal etwas zugespitzter formuliert, ein Bewusstsein voraus, in demjenigen, der ein Übel erleidet, das eigene Selbst zu erblicken. Woher kann nun aber Ego wissen, dass Alter leidet? Auf der Grundlage eines einfachen Gefühls, das sich aus der Wahrnehmung, genauer: aus dem ‚Mitleiden’, speist, ließen sich solche intersubjektiven Gewissheiten kaum erzielen. Das Gefühl – was auch immer darunter zu verstehen ist – wäre niemals imstande, die operative Geschlossenheit des Bewusstseins, das rein Subjektive, hinter sich zu lassen. Erst im Almosen nimmt das Mitleid eine symbolische Gestalt an, in der sich der Status Alters als das Motiv Egos darstellt, Barmherzigkeit zu üben. Das Almosen ist ein Dispositiv, das unweigerlich daran teilhat, den Geber und Nehmer als komplementäre Rolleninhaber zu konstituieren.560 Es schreibt dabei Alter nicht nur ein Verhalten zu, das Betteln, es legt auch fest, in welcher Situation sich dieser befindet. Mit der Annahme bestätigt Alter seinerseits die mit dem Akt des Almosengebens vollzogenen Zuschreibungen. Das Almosen hat also in dem Moment Erfolg, in dem die im Geben implizierten Unterstellungen durch das Annehmen akzeptiert und dem weiteren Verhalten des Nehmers gegenüber dem Geber zugrunde gelegt werden. Für Ego ist Alter demnach in zweifacher Hinsicht von Bedeutung: Zum einen als Person, der man ein Leiden im Akt des Almosengebens zuschreiben kann, weil man sich mit dieser nicht identisch weiß, also in einer gewissen Distanz zu ihr steht. Zum anderen als eine Person, die dem eigenen Selbst ähnlich ist. Es sind diese beiden personalen Bezüge, über die es dem Almosen gelingt, die Differenz zwischen Alter und Ego als Einheit des Differenten zu symbolisieren. 559 560 ARISTOTELES, Rhetorik (wie Anm. 499), 1385 b. Als Dispositiv begreift Foucault das Zusammenspiel sowohl von diskursiven als auch nicht-diskursiven Praktiken, aus dem eine semantisch instruierte Handlungspraxis hervorgeht. Demnach lassen sich drei Dimensionen der Analytik des Dispositivs unterscheiden: erstens den Diskurs, der den Sinnzusammenhang bestimmt, in dem etwas wahrgenommen, interpretiert und als Realität erschaffen wird; zweitens die Macht, die als ein Kräfteverhältnis die Person aus der diskursiven Praktik heraus in seinem Handeln bestimmt; und drittens, als Effekt der ersten beiden Dimensionen, das Selbst, das sich den etablierten Kräfteverhältnissen sowie dem Wissen zu entziehen vermag und neue soziale Problemlagen entstehen lassen kann, auf die die Gesellschaft mit andersartigen Dispositiven reagiert. Vgl. dazu FOUCAULT, Michel: Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin 1978, S. 119 ff. 228 Will man nun in Erfahrung bringen, auf welche Weise sich der Symbolcharakter des Almosens mit der sozialen Evolution des Gesellschaftssystems verändert hat, muss man sich zunächst die Erklärungen für diese Ähnlichkeit, die Ego das Leid Alters als sein eigenes Leid erfahren lässt, näher anschauen. Nach Thomas von Aquin „ist immer die Schwäche der Grund des Mitleids, sei es, daß einer die Schwäche des anderen als seine eigene betrachtet, auf Grund der Einigung durch die Liebe, sei es wegen der Möglichkeit, Ähnliches zu erleiden.“561 Der erste Fall entfaltet sich vor dem Hintergrund der Vorstellung einer sozialen Symmetrie, in der sich Alter und Ego durch ihr wechselseitiges Wohltun im Akt der Liebe im Sein halten. Der Liebende betrachtet den Freund, als sei dieser er selbst, womit dessen Leid sich zugleich zu seinem eigenen Leid erhebt.562 Die vereinigende Kraft der Liebe bringt es dabei mit sich, dass die Schwäche des einen unumstößlich die Schwächung des anderen zur Folge hat. Dem zweiten Fall legt Thomas von Aquin eine zeitliche Symmetrie zugrunde, die in einer Ordnung wurzelt, in der jeder zeit seines Lebens einen mehr oder weniger unveränderlichen Status innehat. Indem Ego erlebt, wie Alter seine Pflichten gegenüber sich selbst nicht mehr nachzukommen imstande ist, vergegenwärtigt er sich die Kontingenz seiner eigenen Existenz. Vor dem, was Alter zugestoßen ist, kann auch Ego sich nicht gefeit wissen, weil beide demselben Ordnungsgefüge zugehören, in dem sich nicht nur das, was von Bestand, sondern auch das, was Veränderlich ist, angelegt findet. Das Mitleid erklärt sich hier aus der Furcht vor einer Zukunft, in der Ego selbst in Situationen der Hilfsbedürftigkeit geraten kann.563 Das Mitleid bleibt bei Thomas von Aquin also für Situationen reserviert, in denen die Beobachtung sozialer und zeitlicher Asymmetrien die Infragestellung einer vormals gegebenen Symmetrie zur Folge hat. Beim Almosen steht nun aber nicht der Bedürftige im Vordergrund, dem es bei der Wiedererlangung seines alten Status zum Wohle der Gemeinschaft zu helfen gilt. Denn mit einer solchen Fokussierung auf seine Person würde der gesellschaftliche Funktionsbezug des Interaktionssystems der personalen Hilfe unweigerlich zutage treten. Das Almosen dient vielmehr dazu, die bestehende Statusdifferenz zwischen dem Geber und dem Nehmer im Geber symbolisch zum Ausdruck zu bringen. „Für den Menschen also, der Gott über sich hat, ist die heilige Liebe, durch die er Gott geeint wird, größer als das Erbarmen, durch das er dem Elend des Nächsten Abhilfe schafft. Aber unter allen Tugenden, die sich um den Nächsten bemühen, ist das Erbarmen die höchste und wichtigste, weil sie auch einen höheren Akt hat; denn der Schwäche des anderen aufhelfen ist, an sich betrachtet, Sache des Höheren und Besseren.“564 561 562 563 564 S. th. II-II, q. 30,2. Zur Bedeutung der Freundschaft und der Liebe für die Ordnungsvorstellungen des Mittelalters vgl. Kapitel 3.4.1 der Dissertation. Schon Aristoteles betont, dass wir Mitleid nur mit denen empfinden, „die uns ähnlich sind hinsichtlich des Alters, des Charakters, seelischer Verfassung, des Ansehens und der Herkunft, im Vergleich mit all diesen nämlich scheint es eher, daß auch uns selbst ein solches Geschick zuteil werden kann.“ ARISTOTELES, Rhetorik (wie Anm. 499), 1386 a 13. S. th. II-II, q. 30,4. 229 Während der Bettler selbst des Mitleidens unfähig ist, weil er sich bereits am untersten Ende der Hierarchie befindet, also keinen mehr unter sich weiß, belegt der Almosengeber sein Bessersein durch das Geben eines Almosens. Seine guten Werke erfolgen auf der Grundlage einer zwischen dem Höheren und Niederen bestehenden sozialen Asymmetrie. Die soziale Asymmetrie selbst wird dabei als Signum der Gnade Gottes mit dem Menschen gewertet. Der Richtungssinn des Almosens vom Höheren zum Niederen macht es dem Geber somit möglich, seine Ähnlichkeit mit Gott zur Darstellung zu bringen. Mit dem Wandel der sozialen Ordnungsvorstellungen verliert jedoch die aus dem Wesen Gottes selbst hergeleitete Begründung der sozialen Beziehung zwischen dem Almosengeber und dem Bettler nach und nach ihre Plausibilität. Im 18. Jahrhundert bemüht Christian Wolf das Naturgesetz, nach dem ein jeder Mensch dazu verpflichtet ist, das zu tun, was dem Glück seines Gegenübers dient, um das Geben von Almosen zu rechtfertigen. „Barmherzig (misericordem) nennt man denjenigen, dem das Elend des andern ein Bewegungsgrund ist, ihn von dem Übel umsonst zu befreyen, oder wenigstens ihm dasselbige, so viel an ihm ist, erträglicher zu machen. Derowegen da wir, so viel wir können, verhüten sollen, daß andere nicht Schaden an ihrer Seele, oder an ihrem Leibe, oder an ihrem Glücke leiden [...].“565 Die Almosengabe erfolgt hier nicht mehr aus dem Grund, sich Gott gegenüber wohlgefällig zu verhalten. Sie büßt damit ihre Funktion als Zukunftsvorsorge für das eigene Seelenheil ein. In ihrem Fokus steht vielmehr der Bettler, dem aufgrund seines Unvermögens, im gesellschaftlichen Leben für die eigenen Interessen einzustehen – sei es „aus Mangel der Kräfte, oder aus Mangel der Gelegenheit zu arbeiten“566 – ein Recht zugesprochen werden muss, um Almosen zu bitten. Der Bettler erscheint jetzt nicht mehr als integraler Bestandteil einer hierarchischen Struktur, er ist nicht mehr Objekt der Hilfe, sondern er ist ein Subjekt, das seinen Rechtsanspruch einklagt und Hilfe erwartet. Gleichwohl obliegt es dem Willen des Angebettelten, darüber zu befinden, ob er den Erwartungen des Bettlers zu entsprechen bereit ist oder nicht. Angetrieben wird er dabei durch seine Neigung, Gutes tun zu wollen. Denn: „Wohlzuthun und mitzutheilen, ist ein so herrliches Gefühl, ein Gefühl, welches uns beseeligt und uns in unsern eignen Augen als bessere Menschen erscheinen läßt.“567 Die kirchliche Lehre vermag dieses natürliche Verlangen allenfalls noch zu bestärken, keineswegs aber mehr zu begründen. Im Übergang zum 19. Jahrhundert wird die Bereitschaft, dem Bettler zu helfen, strikt von der Nachvollziehbarkeit dessen Gefühlslebens abhängig gemacht. Der Erfolg des Bettelns wird damit in seiner Unwahrscheinlichkeit wahrgenommen. Nur wenn es dem Bettler gelingt, den Angebettelten soweit zu bringen, sich in dessen Lebenssituation hineinzuversetzen und dessen Not als ein mitleidwürdiges Unglück zu erleben, kann ihm auch in seinem Ver565 566 567 WOLFF, Grundsätze des Natur- und Völkerrechts (wie Anm. 362), S. 306. Ebd., S. 303. ANONYM: Betteley und deren Abhülfe. Erlangen 1839, S. 10 f. 230 halten ein Erfolg beschieden sein. Als ein anschauliches Beispiel für diesen Perspektivenwechsel in der Beschreibung der sozialen Beziehung zwischen dem Bettler und dem Almosengeber soll im Folgenden eine kurze Erzählung wiedergegeben werden, die sich in einer Zeitschrift der deutschen Aufklärung abgedruckt findet. „Als ich diesen Frühling in Paris war, machte ich eines Tages einen Spaziergang in die elisäsischen Felder, und sahe wie die Bettler den Ort benutzten, um milde Gaben zu erflehen. Es ist doch übel, dachte ich, daß man bey schönem Wetter in einer angenehmen Jahreszeit, nicht eine Stunde lustwandeln kann, ohne zugleich das Gemälde des menschlichen Elends vor Augen zu haben, und von scheußlich aussehenden Bettlern verfolgt zu werden. Noch voll dieses Gedankens, kam einer dieser Unglücklichen auf mich zu, und streckte stehend die Hand aus. Man urtheile, ob ich gestimmt war, seine Bitte zu erfüllen. «Ach! mein Herr, mein werther Herr! erbarmen Sie sich!» - «Nichts!» - «Die kleinste Hülfe für meine arme kranke 80jährige Frau!» - «Du lügst» - «Ach Gott! Noch heute muß sie umkommen, da ihr alles mangelt!» - «Nichts! sage ich euch noch einmal!» und nun verlängerte ich meine Schritte, um mich seiner fernern Zudringlichkeiten zu entziehen, als ich folgende herzangreifende Worte aus dem Munde dieses Greises hörte: «Ach Gott! Sie, mein Herr, können nicht einmal die Erzählung meines Elends anhören, urtheilen Sie nun, wie sehr ich zu beklagen bin, ich, der diese Übel selbst leidet!» Gerührt durch diese Äußerung, und ein wenig beschämt, stehe ich erst still, kehre um, und drücke dem Unglücklichen ein Silberstück in die Hand, mit den Worten: «Ich hatte unrecht» Nun warf ich meine Blicke umher: ich fand die Blumen frischer, die jungen Mädchen schöner, und den ganzen Spaziergang angenehmer. «Es ist doch wahr – sagte ich nun zu mir selbst – daß wenn man mit sich zufrieden ist, man es auch mit der ganzen Natur ist.“568 In der Erzählung stößt der Bettler mit seinem Ansinnen, ein Almosen zu erlangen, zunächst auf die ablehnende Haltung des Angebettelten. Unberührt von dessen Schilderungen versucht der Angebettelte den Anblick des Bettlers zu entfliehen. Was ihn umtreibt, ist die Freude an der Natur, nicht aber das Elend des Bettlers. Erst in dem Augenblick, in dem der Bettler für einen kurzen Augenblick den Platz des Angebettelten einnimmt und sich selbst beginnt mit dessen Augen zu betrachten, also das Unbehagen zu sehen, das seine Anwesenheit auslöst, nimmt die Interaktion eine entscheidende Wendung. Indem er dem Angebettelten sein Versagen vor Augen führt, Mitgefühl für das Unglück eines Anderen zu empfinden, konfrontiert er ihn mit dem Appell, seinerseits in die Rolle eines Bettlers zu schlüpfen und sich dabei die Frage zu beantworten, was es heißen muss, in einer Notlage Ablehnung zu erfahren. Zwar kann der Angebettelte weder wissen, ob sich der Bettler tatsächlich in einer Notlage befindet, noch wie sich Hunger und Durst anfühlt, aber er kann sich die Situation vergegenwärtigen, in einer Notlage zurückgewiesen zu 568 ANONYM: Der Bettler. In: Minerva (1801), S. 558-559. 231 werden. Sein Wohlwollen gegenüber dem Bettler hängt somit unmittelbar davon ab, inwieweit er selbst imstande ist, sich in das Erleben eines Bettlers hineinzuversetzen. Der Schilderung geht es also in erster Linie nicht darum, nach der Sittlichkeit des Bettlers zu fragen. Sie interessiert sich vielmehr dafür, wodurch der Almosengeber die Gewissheit erlangt, richtig gehandelt zu haben. Allein über das Hineinversetzen in die Notlage des Bettlers ist ein solches Zutrauen in die eigene Gutheit allerdings nicht zu erreichen. Der Angebettelte bedarf dafür einer Instanz, die sein Handeln von Außen betrachtet und bewertet. Aus diesem Grund wendet sich die Erzählung an ihren Leser, der dadurch zu dem gemacht wird, was Adam Smith in seiner Theorie der ethischen Gefühle den unparteiischen Zuschauer genannt hat. Gerade weil er nicht unmittelbar in die affektgeladene Interaktion involviert ist, vermag er von einer neutralen Position aus die Sittlichkeit der Verhaltensziele zu beurteilen. Als gut kann sich der Mensch nur erfahren, indem er sich mit den Augen des unparteiischen Zuschauers mustert. Nicht sein Verhalten an sich – der Akt der Liebe – gibt ihm also die Gewissheit, wahrlich gut und ehrenwert zu sein. Er bedarf dafür vielmehr eines Spiegels, in dem er das Abbild seiner eigenen Gutheit oder Schlechtheit – wie im Falle von Dorian Gray – erblickt.569 Gleichermaßen lassen sich die Disprivilegierungen des Bettlers nicht aus dessen gesellschaftlicher Stellung ableiten. Es ist umgekehrt das soziale Desinteresse an seiner Person, das seinen Status begründet. Während die mittelalterliche Almosenlehre den Bettler noch als integralen Bestandteil einer gesellschaftlichen Ordnung beschreibt, wird er am Ende des 18. Jahrhunderts in seinen beschränkten Möglichkeiten wahrgenommen, aus eigener Kraft die Inklusionsbedingungen des Wirtschaftssystems zu erfüllen und über Tauschbeziehungen seine Bedürfnisse zu befriedigen. „Nur ein Bettler zieht es vor, hauptsächlich von der Wohltätigkeit seiner Mitbürger abzuhängen; und sogar er hängt nicht ausschließlich davon ab. Die Nächstenliebe gutherziger Leute verschafft ihn zwar die gesamten Mittel für seinen Lebensunterhalt, aber obwohl dieser Charakterzug ihn letzten Endes mit allen lebensnotwendigen Dingen versorgt, stattet er ihn nicht – und er kann es nicht – so mit Gütern aus, wie er sie gerade braucht. Den größten Teil seines jeweiligen Bedarfs verschafft er sich in der gleichen Weise wie andere Menschen: durch Übereinkommen, Tauschhandel und Kauf.“570 Im Unterschied zu solchen im Wirtschaftssystem ablaufenden symmetrischen Interaktionen, in denen sich Personen mit jeweils eigenen Interessen gegenüberstehen und in denen beide Seiten versuchen, diese in Konkordanz mit den jeweiligen Interessen ihres Tauschpartners bestmöglich zu verwirklichen, ist die soziale Beziehung zwischen dem Bettler und dem Almosengeber durch ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis gekennzeichnet. Das Wahrnehmen dieses Abhängigkeitsverhältnisses lässt die natürliche Neigung des Menschen, in der In- 569 570 Vgl. SMITH, Theorie der ethischen Gefühle (wie Anm. 302), S. 203. SMITH, Reichtum der Nationen (wie Anm. 372), S. 22. 232 teraktion sein Eigeninteresse zu verfolgen, zurücktreten, denn der „innere Mensch ruft uns sofort zu, daß wir dabei uns selbst zu hoch und andere zu niedrig werten, und daß wir, wenn wir so vorgehen, die Verachtung und den Zorn unsere Brüder verdienen.“571 Die Einheit des Systems scheint hier nicht mehr durch eine hierarchische Struktur gesichert, an deren Spitze sich der Almosengeber befindet. In der Gestalt des unparteiischen Zuschauers gerät vielmehr der Umweltbezug des Systems in den Blick. Analog zu der Wirkungsweise des Geldes, das die von den Zahlungen Ausgeschlossenen in ihrem Erleben dazu motiviert, den Tausch von Gütern und Leistungen zu billigen, schließt auch die Almosengabe jene mit in das System ein, die nicht an den Operationen des Interaktionssystems der personalen Hilfe teilhaben. Kann sich der Almosengeber auch der Zustimmung jener gewiss sein, die keinen unmittelbaren Vorteil aus seiner Hilfeleistung ziehen? Von hier aus ist dann der Schritt zur Frage, ob sich das Interaktionssystem der personalen Hilfe dazu eignet, Probleme zu lösen, welche die Gesellschaft hervorbringt, nicht mehr weit. Mit dieser Frage entsteht zugleich auch ein Bedarf nach Reflexionstheorien, anhand derer sich darlegen lässt, welche Formen die personale Hilfe anzunehmen hat, um bei der Erfüllung ihrer Funktion nicht an Problemen zu scheitern, die in ihren eigenen Operationen begründet liegen. Ein Unternehmen, das letztlich aber allenfalls sporadisch in Angriff genommen wurde. 4.4 Der Bettler und das politische System 4.4.1 Der Bettler im Fokus politischen Kalküls Im Gegensatz zu den religiösen Diskursen des Mittelalters, in denen der Bettler vornehmlich als Objekt der Werke der Barmherzigkeit und in seiner Rolle für das Seelenheil des Almosenspenders in den Blick gerät, also als ein eigener Berufsstand zentrale Funktionen innerhalb der Sozialordnung zugeschrieben bekommt, steht im Bereich des Politischen die Frage nach den Auswirkungen seines Verhaltens auf das Gemeinwohl im Vordergrund.572 Im 12. und 13. Jahrhundert erhebt sich das Gemeinwohl im Sinne des bonum commune zu einem zentralen Aspekt der Stabilisierung sozialer Ordnung. Mit dem bonum commune bekommt der Fürst bzw. die politische Obrigkeit erstmals eine über die Rechtsfindung und -wahrung hinausgehende legislative Steue- 571 572 SMITH, Theorie der ethischen Gefühle (wie Anm. 302), S. 204. Die Hauptargumente dieses Kapitels finden sich bereits in kürzerer Form dargelegt in HOFMANN, Jens. Die Figur des Peripheren. Darlegung einer analytischen Kategorie anhand der historischen Semantik des Bettlers. In: GESTRICH, Andreas / RAPHAEL, Lutz (Hg.): Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt (Main) [u.a.] 2001, S. 511-536. 233 rungsfunktion übertragen.573 Dem positiven Recht wird damit eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber der Moral konzediert. Es genügt nun nicht mehr, lediglich auf die in der Ökonomie des Hauses festgelegten rechtlichen Beziehungen zwischen den Ständen zu vertrauen, stattdessen zeichnet sich das politische Bestreben ab, in den „rechtsfreien Räumen“574 der korporativ verfassten Gesellschaft „kollektiv bindende Entscheidungen“575 durchzusetzen. Die societas civilis transformiert auf diese Weise Schritt für Schritt zu einem Verfügungszentrum, das über die Gesellschaft als Ganzes – zunächst: als Summe aller Hausgemeinschaften – entscheidet und politisch erwünschte Ordnungszustände auf dem Wege der Gesetzgebung zu bewahren, ja neu zu konstituieren sucht. Im Übergang zur Frühen Neuzeit wird sich schließlich für diesen Bereich öffentlicher Ordnung der Terminus der guten Policey etablieren.576 Die im Spätmittelalter beobachtbare Intensivierung der Gemeinwohltopik steht also im engsten Zusammenhang mit „der Formulierung einer autonomen Zwecksetzung des vom kirchlich-geistlichen Bereich unabhängigen politisch verfaßten Gemeinwesens.“577 Zwar ist es noch ein langer Weg hin zur Ausdifferenzierung eines von religiösen Legitimationen emanzipierten, autonomen politischen Funktionssystems, doch ist mit dem Gemeinwohl der Grundstein für systeminterne Limitationen des politischen Entscheidens gelegt. Luhmann bezeichnet das Gemeinwohl dementsprechend auch als eine Kontingenzformel, mit der das politische System den Bereich seiner möglichen anschlussfähigen Themen beschränkt.578 573 574 575 576 577 578 Vgl. SIMON, Thomas: Gemeinwohltopik in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Politiktheorie. In: MÜNKLER, Herfried / BLUHM, Harald (Hg.): Gemeinwohl und Gemeinsinn. Historische Semantiken politischer Leitbegriffe. Berlin 2001, S. 129-146. Gerade der Umstand, so lautet die These von Hans Maier, „daß die in Landes- und Polizeiordnungen betätigte Gebotsgewalt des Fürsten sich zunächst in einem – nach Meinung der Zeit – ‚rechtsfreien’ Raum bewegte, sicherte dieser Gesetzgebung eine Bewegungsfreiheit zu, die sie innerhalb des Rechtsherkommens und seiner schwerfälligen, jeder Neuerung abgeneigten Rechtsfortbildung nicht gehabt hätte. Als reine Ordnungsmaßnahme gewannen die Polizeigesetze eine Schlagkraft, die den althergebrachten, auch gemeinrechtlichen Regelungen oft überlegen war. […] Ordnung ging jetzt vor Recht, ja sie wurde vielfach zum Ursprung neuen Rechts.“ MAIER, Hans: Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre (Polizeiwissenschaft). Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Wissenschaft in Deutschland. Neuwied / Berlin 1966, S. 112. Luhmann erkennt in dem „Bereithalten der Kapazität zu kollektiv bindendem Entscheiden“ die Funktion des politischen Systems. LUHMANN, Niklas: Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt (Main) 2000, S. 84. Zur Begriffsgeschichte des Wortes Polizei vgl. KNEMEYER, Franz-Ludwig: Polizeibegriffe in den Gesetzen des 15. bis 18. Jh. In: Archiv des öffentlichen Rechts 92 (1967), S. 153-180; NITSCHKE, Peter: Von der Politeia zur Polizei. In: Zeitschrift für Historische Forschung 19 (1992), S. 1-27; PANKOKE, Eckart: Von ‚guter Policey’ zu ‚socialer Politik’. ‚Wohlfahrt’, ‚Glückseligkeit’ und ‚Freiheit’ als Wertbindung aktiver Sozialstaatlichkeit. In: SACHßE, Christoph (Hg.): Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik. Frankfurt (Main) 1986, S. 148-177. HIBST, Peter: Utilitas Publica – gemeiner Nutz – Gemeinwohl. Untersuchungen zur Idee eines politischen Leitbegriffs von der Antike bis zum späten Mittelalter. Frankfurt (Main) 1991, S. 220. LUHMANN, Politik (wie Anm. 575), S. 120 ff. Selbstverständlich fließen religiöse Aspekte in das politische Denken solange mit ein, wie die politische Entscheidungsfindung an ethisch-religiösen Leitformeln orientiert bleibt. Die Unterscheidung von Recht und Billigkeit ist eine dieser zentralen Leitformeln: „Billigkeit ist des Gesetzes untrügliche Setzwaage (schrotwach) und Verbesserung, im Bedenken, was Gott den Herrn gefällig (behaglick), dem gemeinen Besten und unserem Nächsten am nützlichsten sein möge. Demnach müssen auch alle geschriebenen Rechte, alle Gewohnheiten und Handlungen weltlichen Regiments der Billigkeit stattgeben und weichen, wie auch die Kaiser und Päpste bezeugen und bekennen.“ OLDENDORP, Johann: Was billig und recht ist. (Org.: Wat byllich unn recht ys 1529). Frankfurt (Main) 1948, S. 12. 234 Mit der allmählichen Dekomposition seines religiösen Überbaus kommt es im politischen Diskurs zu einer Neuformulierung von Verhaltenserwartungen gegenüber der Person des Bettlers. Dieser Prozess steht im unmittelbaren Zusammenhang mit strukturellen Umgestaltungen des politischen Systems selbst, das seine Inklusionsbedingungen vom schichtgebundenen Sozialstatus einer Person löst und schließlich in der Zugehörigkeit zu einem Herrschaftsraum verankert. In den Beschreibungen der Sozialordnung treten an die Stelle von abgestuften hierarchischen Positionen binäre Unterscheidungen wie Monarch/Untertan, Regierung/Volk.579 Rückblickend zeigt sich, dass die Modifikationen der an den Bettler gerichteten Verhaltenserwartungen auf zwei Ebenen verliefen, die der Politik jeweils unterschiedliche Anknüpfungspunkte für die Ausdifferenzierung einer eigenen Systemrationalität eröffneten. (1.) Konstruktion eines politischen Raums Politisch verfasste Gemeinwesen sind in ihrem Bestreben, das Gemeinwohl ihrer Mitglieder zu befördern, darauf angewiesen, den Bereich ihrer Verantwortlichkeit räumlich zu begrenzen. Obgleich soziale Systeme sich aufgrund ihrer operativen Schließung dabei grundsätzlich außerstande sehen, in eine räumliche Welt an sich vorzudringen und diese in Besitz zu nehmen, können sie den Raum doch als ein Sinnmedium verwenden, anhand dessen sich komplexitätsreduzierende Beobachtungsschemata (z.B. Innen/Außen, Stellen/Objekte, Nähe/Ferne) formen und in die Kommunikation einführen lassen.580 Solche räumlichen Beobachtungsschemata ermöglichen es nicht nur, homogene Einheiten zu bilden und über Grenzziehungen zu separieren, sondern diese auch miteinander in Verbindung zu setzen. Über Grenzen lassen sich, mit anderen Worten, die jeweiligen Beziehungen und Kontakte zwischen einem System und seiner Umwelt überhaupt erst konkretisieren und spezifizieren. Räumliche Beobachtungsschemata kommen dabei insbesondere in Gesellschaften zur Anwendung, die sich segmentär differenzieren und über Interaktionen kontinuieren. Die weiteren Überlegungen werden von der These ausgehen, dass der frühmoderne Staat über die Inklusion von einheimischen und der Exklusion von fremden Bettlern einen räumlichen Machtbereich abzugrenzen beginnt, innerhalb dessen sich kollektiv bindende Entscheidungen vollziehen und durchsetzen lassen. Dieser räumlich abgegrenzte Machtbereich fungiert als eine Art „Synchronisations- und Inklusionsmaschine“581 die es dem politischen System gestat579 580 581 Vgl. LUHMANN, Niklas: Staat und Staatsräson von traditionaler Herrschaft zu moderner Politik. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie. Bd. 3. Frankfurt (Main) 1989, S. 65-148, hier S. 86 f. Vgl. LUHMANN, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt (Main) 1995, S. 179 ff.; KUHM, Klaus: Raum als Medium gesellschaftlicher Kommunikation. In: Soziale Systeme 6 (2000), S. 321-348; STICHWEH, Rudolf: Raum und moderne Gesellschaft. Aspekte der sozialen Kontrolle des Raums. In: KRÄMER-BADONI, Thomas / KUHM, Klaus (Hg.): Die Gesellschaft und ihr Raum. Raum als Gegenstand der Soziologie. Opladen 2003, S. 93-102. Vgl. NASSEHI, Armin: Dichte Räume. Städte als Synchronisations- und Inklusionsmaschinen. In: LÖW, Martina (Hg.): Differenzierungen des Städtischen. Frankfurt (Main) 2002, S. 211-232. 235 tet, den Bettler sowohl einem zusammengehörenden Sozialverband (Bürgerschaft, Untertanen, Staatsbürger) zuzuordnen als auch den Sozialverband selbst in seiner differenzierten Zusammensetzung zu berücksichtigen. (2.) Ausdifferenzierung eines symbolisch generalisierten Machtmediums Die klassische Staatslehre genauso wie die Soziologie hat neben dem Staatsgebiet das Gewaltmonopol als ein konstitutives Element des modernen Staats ausgemacht.582 Ein Staat erlangt seine vollständige Souveränität, sobald ihm das alleinige Recht zufällt, bei der Umsetzung seiner Zielvorgaben mit physischer Gewalt zu drohen bzw. diese auch anzuwenden. Er setzt also die Ausdifferenzierung eines symbolisch generalisierten Machtmediums voraus. Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien bilden sich dabei generell an bestimmten Bezugsproblemen einer Gesellschaft aus und versuchen die Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs von Kommunikationen, also die Verknüpfung von Selektion und Motivation, zu überwinden. Nach Niklas Luhmann beruht politische Macht auf der Antizipation von Gehorsam, insofern das Handeln des Machthabers auf einer kontingenten, auch anders möglichen Entscheidung beruht, die über das Handeln des Machtunterworfenen entscheidet.583 Die Androhung von Sanktionen zielt auf die Vermeidung der jenseits der politischen Entscheidung liegenden Handlungsalternative. Deren Aktualisierung wird als Widerstand gegen den Willen des Machthabenden gewertet und mit in der Zukunft sich einstellenden negativen Konsequenzen belastet, die der Machtunterworfene allerdings der eigenen Verhaltenswahl zu Lasten zu legen hat. Bei der Ausdifferenzierung eines solchen politischen Machtmediums diente dem politischen System die Personengruppe der Bettler lange Zeit dazu, Probleme der Gesellschaft zu thematisieren und geeignete Lösungsansätze zu präsentieren. Zu diesem Zweck sah es zunächst innerhalb seines Inklusionsbereichs eine Differenzierung von unterstützungswürdigen und -unwürdigen Bettler vor. Dieser in sich differenzierte Inklusionsbereich veranschaulichte das Verhältnis der Machthabenden zu den Machtunterworfenen und zeigte dem Bettler Verhaltensalternativen auf, an die positive bzw. negative Zukunftserwartungen gekoppelt waren. 582 583 Vgl. JELLINEK, Georg: Allgemeine Staatslehre. Bad Homburg [u.a.] 1966, S. 294 ff.; WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (wie Anm. 148), S. 28.; ELIAS, Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Bd. 2. Frankfurt (Main) 1979, S. 123 ff. Vgl. LUHMANN, Politik (wie Anm. 575), S. 19 ff. 236 4.4.2 Die gemeinwohlschädigenden Folgen des Bettelns 4.4.2.1 Der Bettler als Problem ständischer Differenzierung Im Jahre 1370 wird in der Bettelverordnung der Stadt Nürnberg erstmals zwischen einheimischen und fremden Bettlern unterschieden.584 Diese Differenzierung erhebt sich zu einem Leitprinzip der Bettelverordnungen hoch- und spätmittelalterlicher Städte und findet schließlich in den frühneuzeitlichen Policey-, Reichs- und Landesverordnungen ihre Fortsetzung. Zum Betteln berechtigt sind ausschließlich die Ortsansässigen, die als Bürger oder als Einheimische unter den Schutz der gemeinen Bürgerschaft fallen. Der Aufenthalt fremder Bettler in der Stadt sieht sich dahingegen zeitlichen und räumlichen Restriktionen unterworfen. Das sich gerade in den mittelalterlichen Städten solche Ordnungsbestrebungen etablieren konnten, liegt wohl auch daran, dass sie nicht nur die Handelsbeziehungen weit über die Grenzen ihrer Peripherie ausweiteten und stets darauf angewiesen blieben, je nach ökonomischer Bedarfslage neue Einwohner aus den ländlichen Gebieten zu rekrutieren. Durch ihre interne Segmentierung in verschiedene unabhängige Rechtskreise (Zünfte, Gilden, Bruderschaften) konfrontierten sie sich zudem mit der permanenten Erfahrung voneinander fremd bleibender Lebenssphären, die oftmals nur noch über das Medium des Geldes miteinander in Kontakt traten.585 Zwar sah sich der politische Machtbereich weitestgehend durch die einzelnen Normbereiche von der Aufgabe entlastet, für die Pflichterfüllung der Ortsansässigen zu sorgen. Doch zugleich trat mit dieser Sozialordnung das Problem eines rechtlichen Vakuums in den Beziehungen der einzelnen Rechtskreise zueinander in Erscheinung. Vor allem stellte sich aber die Frage, wie mit jenen Menschen umzugehen sei, die keinem Rechtskreis angehörten. Mit dem fremden Bettler zeichnet die mittelalterliche Stadt das Sinnbild einer Lebensweise, die das Vertraute einer auf reziproken Rechten und Pflichten beruhenden Sozialordnung sprengt. Erst durch diese Abgrenzung von einem auf das Almosenheischen reduzierten, von Stadt zu Stadt vagabundierenden Dasein lässt sich der einheimische Bettler als ein dem Gemeinwesen verpflichtetes, aber durch einen Statusabstieg gekennzeichnetes soziales Wesen denken. Die für einheimische Bettler in Form von Bruderschaften eingerichteten genossenschaftlichen Strukturen dienten entsprechend dazu, ihre rechtliche Einbindung in eine noch weitestgehend durch partikulare Personenverbände differenzierte städtische Sozialordnung zu gewährleisten.586 Mit ihrer Inklusion in korporative Strukturen, die der Kontrolle durch einen 584 585 586 Die Bettelordnung findet sich abgedruckt in RÜGER, Willi: Mittelalterliches Almosenwesen. Die Almosenordnung der Reichsstadt Nürnberg. Nürnberg 1932, S. 68 f. Nach Hans Thieme erscheint in den mittelalterlichen Gesellschaften jedermann „als ein Fremder im Verhältnis zu allen jenen Gemeinschaften, denen er nicht angehört, und die Rechtsstellung der Fremden betrifft alle Welt, sobald sich menschliche Beziehungen jenseits von Haus und Sippe angebahnt haben.“ THIEME, Hans: Die Rechtsstellung der Fremden in Deutschland vom 11. bis zum 18. Jahrhundert. In: THIEME, Hans: Ideengeschichte und Rechtsgeschichte. Bd. 1. Köln 1986, S. 289-304, hier S. 289. Zur korporativen Einbindung der Bettler in Bruderschaften vgl. SCHUBERT, Gestaltwandel des Almosens (wie Anm. 537), S. 262; FISCHER, Thomas: Städtische Armut und Armenfürsorge im 15. und 16. Jahrhundert. Sozial- 237 städtischen Verwaltungsapparat (Bettelvogt, Stadtknecht) oblag, werden sie zu einer in sich geschlossenen sozialen Gruppe homogenisiert und auf eine aus ihrem Verhältnis zum politischen Gemeinwesen resultierende kollektive Identität festgelegt. Anders als bei den Zünften, Gilden und Bruderschaften, denen man von Geburt an zugehört oder deren Strukturen doch die Möglichkeit einer lebenslangen Mitgliedschaft vorsehen, wird der Sozialstatus des Bettlers als ein transitorischer konzipiert, den es in festgeschriebenen Zyklen zu überprüfen gilt. Der Bettler muss stets aufs Neue mit Hilfe der eidesstattlichen Erklärung Dritter unter Beweis stellen, dass er des Almosens würdig ist. Gegenüber der religiösen Selbstverpflichtung des Almosenspenders, der allein auf der Grundlage seiner Wahrnehmungen und der Überprüfung seines Gewissens zu entscheiden hat, wer unterstützungswürdig ist und wer nicht, entwickeln die spätmittelalterlichen Städte objektive Kriterien der Bedürftigkeit (Grad der Arbeitsfähigkeit, Höhe des Arbeitsertrags, Familiensituation).587 Die zum Betteln Berechtigten werden in städtischen Bettelregistern verzeichnet und mit gut sichtbaren, an der Kleidung befestigten Bettelzeichen versehen. Zwar bleibt die Versorgung des Bettlers durch das Spenden von Almosen weiterhin überwiegend von der religiösen Selbstverpflichtung des jeweiligen Bürgers abhängig, in der Visualisierung der offiziellen Anerkennung des Bettlers kommt aber nun sein legitimer Anspruch auf Unterstützung zur Geltung. Die an den Bettler gerichteten Verhaltenserwartungen erklären sich damit vornehmlich aus seiner Zugehörigkeit zum Gemeinwesen. Der einheimische Bettler ist dabei lediglich zu gewissen Zeiten und an ausgewiesenen Orten zum Betteln berechtigt und darf durch sein äußeres Erscheinungsbild das Mitleid des Spenders nicht zu erregen versuchen. Soweit es seine körperliche Verfassung erlaubt, ist er zur Handarbeit verpflichtet.588 In der Nürnberger Bettelverordnung von 1478 heißt es dazu: „Item die betler und betlerin, den hie zu peteln erlawbt wirdt, die nit krüppel, lam oder plint sind, sollen an keinen wercktag vor den kirchen an der pettelstat müssig sitzen, sunder spynnen oder annder arbeit, die in irem vermügen wer, thun.“589 Für den Kodex von Pflichten, über den sich der einheimische Bettler definiert, ist bezeichnend, dass er gleichermaßen die Inklusion in das städtische Gemeinwesen wie auch – bei Nichterfüllung – die Bestrafung bzw. Exklusion in Aussicht stellt. Folgt man einem Gedanken von Ernst Schubert, dann hatten die von Zeit zu Zeit durchgeführten Stadtverweisungen von vagabundierenden Bettlern nicht nur den Sinn, diese aus der Stadt und ihrem Umland zu vertreiben, sondern auch „den ohne Bürgerrecht in der Stadt ansässigen Tagelöhner, den Arbeitern und Dienstboten die Gefährdung ihres Status als ‚Einwohner’ vor Augen 587 588 589 geschichtliche Untersuchungen am Beispiel der Städte Basel, Freiburg i. Br. und Straßburg. Göttingen 1979, S. 224. Ebd., S. 313 f. Siehe dazu auch die naturrechtliche Verpflichtung des Menschen zur Handarbeit bei Thomas von Aquin. Vgl. Kap. 4.2.2.1.2 der Dissertation. BAADER, Joseph: Nürnberger Polizeiordnungen. Aus dem XIII. bis XV. Jahrhundert. Amsterdam 1966, S. 317. 238 zu führen und sie zum Gehorsam ihrer Herrschaft gegenüber zu verpflichten.“590 Die städtischen Austreibungen dienten auf diese Weise auch der Zurschaustellung des ambivalenten Sozialstatus des einheimischen Bettlers. Durch ihren Vollzug ließ sich eine für seine Person infrage kommende Zukunftsperspektive in die Gegenwart einholen und von der Möglichkeit seiner Reintegration in das städtische Gemeinwesen abgrenzen. Diese Möglichkeit der Reintegration wurde dabei von dem Gehorsam gegenüber den an seine Person gerichteten Verhaltenserwartungen abhängig gemacht. Mit den städtischen Bemühungen, den aus der Stratifikation gelösten Bettler zu erfassen und über korporative Ordnungsmuster neu in die Gemeinschaft einzugliedern, wurden allerdings die Problemlagen der ständischen Differenzierung geradezu exponiert. Dem im Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert sich ausdifferenzierenden frühneuzeitlichen Territorialstaat eröffnete dabei das Bettelwesen ein geeignetes Betätigungsfeld, um die in den Gesetzesgeboten des Fürsten verfolgte politische Zwecksetzung der „Ordnung und Reformation guter Policey“591 umzusetzen. Die städtische Exklusion des fremden Bettlers verlagerte zunächst das Problem der Stabilisierung ständischer Differenzierung auf die umliegenden Städte bzw. auf das Land. Das Land war jedoch in Folge der sich im Wandel befindlichen grundherrschaftlichen Strukturen kaum mehr imstande, die vagabundierenden Bettler in die Gesellschaftsordnung zu inkludieren. „Den Armenordnungen kam […] die Funktion zu“, so Friedrich Battenberg, „die sozialen Probleme im Interesse eines einheitlichen Untertanenverbandes zu lösen, um auf diese Weise Herrschaft im Rahmen der Landesgrenzen intensivieren zu können.“592 Mehr noch: Durch die 1530 in Augsburg erlassene reichseinheitliche Kommunalisierung der Armenfürsorge (‚Heimatprinzip’) hypostasiert das Territorium geradewegs zu einem in sich geschlossenen, durch Landesgrenzen und Untertanen definierten politischen Herrschaftsraum, der durch eine Vielzahl benachbarter Städte und Kommunen eine klar umrissene Fläche vollständig ausfüllt. Dem vagabundierenden Bettler sollte innerhalb dieses Herrschaftsraumes keine Möglichkeiten mehr gegeben sein, sich durch sein Umherschweifen von einem Ort zum nächsten den politischen Ordnungsbestrebungen zu entziehen. Erstreckten sich am Ende des 15. Jahrhunderts die Bettelverbote lediglich auf jenen Bettler, „der nit mit Schwachheit oder Geprechen seines Leibs beladen, und des nit notdürfftig sey“593, so wird nun das Betteln schlichtweg untersagt. Schon 1520 artikuliert Martin Luther in seiner Schrift An 590 591 592 593 SCHUBERT, Ernst: Mobilität ohne Chance. Die Ausgrenzung des fahrenden Volkes. In: SCHULZE, Winfried (Hg.): Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität. München 1988, S. 113-164, hier S. 146. Diese Formulierung findet sich in der Augsburger Reichspoliceyordnung von 1530. Vgl. SCHMAUSS, Johann J. / SENCKENBERG, Heinrich C. (Hg.): Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede […]. Tl. II. Frankfurt 1747, S. 332. BATTENBERG, Friedrich J.: Obrigkeitliche Sozialpolitik und Gesetzgebung. Einige Gedanken zu mittelrheinischen Almosenordnungen des 16. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für historische Forschung 18 (1991), S. 33-70, hier S. 41. SCHMAUSS, Sammlung der Reichs-Abschiede (wie Anm. 591), S. 32. 239 den christlichen Adel Deutscher Nation die Vorstellung, dass „niemand unter den Christen betteln gahn sollte, es were auch eine leychte ordnung drob zumachen, wen wir den Mut und Ernst datzu theten. Nemlich das eine yglich stad yhr arm leut vorsorgt, und keynen frembden betler zuliesse […].“594 Diese Forderung Luthers sieht sich in den Policeyordnungen des 16. Jahrhunderts vollends umgesetzt. Jede Stadt und Kommune hat jetzt für seine Armen selbst zu sorgen. Dabei knüpft der frühneuzeitliche Staat an die Bettelverordnungen der hoch- und spätmittelalterlichen Städte an, erweitert diese aber durch Bestrebungen, fremde Bettler gänzlich aus dem Landesterritorium zu verweisen bzw. an den Landesgrenzen abzuwehren. Diese „Exklusionspolitik“595 zielt nun nicht mehr allein auf die Exklusion einzelner devianter Individuen ab, sie zeichnet vielmehr das Bild einer durch die Asozialität ganzer Personengruppen gefährdeten guten Ordnung. Gut ist eine Ordnung dann, wenn jeder seinen Pflichten gegenüber seinem Nächsten nachkommt und seine gottgegebene Stellung im gesellschaftlichen Gefüge erfüllt. Gegenüber einer der sozialen Bindungslosigkeit geschuldeten Unvertrautheit des Umherziehenden spezifiziert der frühneuzeitliche Territorialstaat seine Inklusionsbedingungen über die Zugehörigkeit zu einer Rechtsgemeinschaft und damit verbunden über die Sesshaftigkeit seiner Gesellschaftsmitglieder. Die Bedingungen der Möglichkeit sozialer Ordnung werden hier noch eindeutig auf der Basis von Interaktionen rekonstruiert, in denen sich die beteiligten Personen je gemäß ihrer Natur wechselseitig Gutes wollen. Das in der christlichen Sünden- und Erlösungsdogmatik begründete Interaktionssystem der personalen Hilfe musste dem sich ausdifferenzierenden politischen System dabei allerdings ein Dorn im Auge sein, fanden sich in ihm doch Handlungsspielräume angelegt, sich entgegen der politischen Zwecksetzung der Stabilisierung ständischer Differenzierung zu verhalten. Für den Bettler ist heute wie in früheren Zeiten die Evidenz seiner Identität von zentraler Relevanz, denn von ihr hängt es ab, inwieweit es ihm in der Interaktion gelingt, den Angebettelten zum Geben eines Almosens zu motivieren. Der Bettler muss sich immer auch als Bettler darzustellen wissen und demgemäß diejenigen Aspekte seiner Person verheimlichen, durch die er als Almosenempfänger disqualifiziert werden würde. Aus der Perspektive der politischen Entscheidungsträger 594 595 LUTHER, Martin: An den christlichen Adel deutscher Nation. Von des christlichen Standes Besserung. Halle 1877, S. 57 f. Eine ähnliche Auffassung formulierte auch Andreas Karlstadt: „Betdler seind die nach brott vmbher lauffen / oder auff den gassen / vor den heußern / oder sitzen vor den kirchen / vnd biten vmb brot. Soliche lewte sollen wir nit leyden / sondern vertreiben / nicht vnvernufftiger vnd tyrannischer weyß / sonder mit gutwilliger hilff / alßo / das wir Christen / keinen / in solich armut vnd nott sollen kumen lassen / das er vervrsacht vnd bedrengt werd / nach brot zuschreihen vnd gehn. Demnach sag ich / das wir alle tzeit arme bruedern vnd schwestern haben. Matth. xxvi. Welche vnßer hilff vnd stewer bedurffen. Aber wir sollen fleyssig achten auf vnßere nachpuren vnnd mitchristen / vnd ihrer not tzu hilff komen. ehr sie tzu vns schreyen Thund wir das nit / ßo seind wir auch nit Christen.“ KARLSTADT, Andreas: Von abtuhung der Bylder / Vnd das keyn Betdler vnther den Christen seyn soll. In: SIMON, Karl (Hg.): Deutsche Flugschriften zur Reformation (1520-1525). Stuttgart 1980, S. 227-279, hier S. 267 f. Ein noch früheres Zeugnis dieser Forderung findet sich bei AGRIPPA VON NETTESHEIM: De mendicate oder Von der Bettelei. In: AGRIPPA VON NETTESHEIM: Die Eitelkeit und Unsicherheit der Wissenschaften und die Verteidigungsschrift. Bd. 1. München 1913, S. 289-296, hier S. 289. Vgl. LUHMANN, Inklusion und Exklusion (wie Anm. 12), S. 245. 240 waren dementsprechend die Leistungen des Interaktionssystems der personalen Hilfe gegenüber Personen abzusichern, welche das Almosen für ihren Eigennutz instrumentalisierten und damit entgegen ihrer Verpflichtung zur ständischen Lebensführung agierten. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts wird mit dem Gemeinen Kasten eine kommunale Versorgungsleistung eingerichtet, die den persönlichen Kontakt zwischen Almosengeber und -nehmer zu überwinden und als eine Verwaltungstätigkeit zu institutionalisieren sucht. Gleichzeitig lässt sich auf der semantischen Ebene eine verstärkte Moralisierung des Bettlers feststellen. Bereits der Lindauer Reichsabschied von 1497 sieht eine Differenzierung zwischen arbeitsunfähigen (würdigen) und arbeitsfähigen (unwürdigen) Bettlern vor.596 Die Unterscheidung an sich freilich ist schon älteren Ursprungs. Den ethischreligiösen Handlungstheorien diente sie vor allem zur Präzisierung jener Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit dem Almosengeber in seinem Tun eine Sittlichkeit und Tugendhaftigkeit zugesprochen werden kann. Ist auch das Almosengeben an sich gut, so setzt es doch als sein Objekt die Hilfsbedürftigkeit des Gegenübers voraus. Jedes Almosen also, das man den unwürdigen Bettlern gibt, „schadet ihnen und dir selbst, weil du ihnen Anlaß zur Sünde gibst.“597 Erst im Übergang zur Frühen Neuzeit werden schließlich die schädlichen Folgen des unberechtigten Almosengebens in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt, wobei die Bettler jetzt weniger als Objekte wohltätigen Verhaltens, als vielmehr als handelnde Subjekte in den Blick geraten. Die starken Bettler entziehen der Gesellschaft nicht nur knappe Ressourcen, die von Rechts wegen den wahrlich Hilfsbedürftigen zustehen, sie verweigern sich zudem ihrer Verantwortung gegenüber dem Wohl der Gemeinschaft. Dementsprechend sieht die Reichspolizeiordnung von 1530 vor, dass starke Bettler „gebührlich gestrafft werden sollten, andern zu Abscheu und Exempel.“598 Die Untertanen ihrerseits werden jetzt dazu angehalten, in ihrem Umgang mit den Bettlern den auf das Gemeinwohl abzielenden Gesetzen der politischen Obrigkeit Folge zu leisten. Die Rede vom starken, müßiggehenden Bettler ist lediglich ein Spiegelbild des in der Frühen Neuzeit einsetzenden allgemeinen Wehklagens über die moralischen Fehlentwicklungen der Menschheit. Die Klagen beziehen sich dabei ausdrücklich auf die ansteigende Anzahl jener Personen, die in ihrem Leben nach mehr Eigentum und größeren Reichtum verlangen, als ihnen aufgrund ihres Standes eigentlich zusteht. Dieser Zeitdiagnose entsprechend sah der Jurist Johann Oldendorp die Aufgabe obrigkeitlicher Gesetze darin, nach „Gelegenheit der Zeit“599, denn „die Artzney muß ja nach der Krankheit bereitet werden“600, gute Policey zu erhalten und wiederherzustellen. In der Metapher der Krankheit kommt deutlich die Auffassung zur Geltung, dass es 596 597 598 599 600 SCHMAUSS, Sammlung der Reichs-Abschiede (wie Anm. 591), S. 32. DE LORENZI, Phillip: Geiler von Kaysersberg. Ausgewählte Schriften. Bd. III. Trier 1881/84, S. 180; zit. n.: SCHERPNER, Theorie der Fürsorge (wie Anm. 538), S. 55. SCHMAUSS, Sammlung der Reichs-Abschiede (wie Anm. 591), S. 343. OLDENDORP, Johann: Von Rathschlägen / Wie man gute Policey und Ordnung in Stedten und Landen erhalten möge. Glashütten im Taunus 1971 [ND Rostock, 1597], S. 35. Ebd. S. 32 f. 241 in der Vergangenheit ein diesseitiges goldenes Zeitalter gegeben habe, in dem die Menschen in einem wohl geordneten Gemeinwesen zusammenlebten. Diesem goldenen Zeitalter gilt es mit gezielten politischen Interventionen in das gesellschaftliche Leben zu einer Renaissance zu verhelfen. Die Herstellung des Gemeinwohls setzt dabei das Zusammenspiel einer wohl informierten politischen Elite auf der einen und ein an moralischen Prinzipien orientiertes Verhalten der Gesellschaftsmitglieder auf der anderen Seite voraus.601 Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts wurde dementsprechend das soziale Problem, auf das sich das politische Kommunikationsmedium der Macht bezog, in der Ordnungsfunktion von pax et iustitia gesehen. Die politischen Theorien jener Zeit betrachten Frieden als einen ungebrochenen natürlichen Ordnungszustand, der sich in einer Gemeinschaft von in Gerechtigkeit miteinander lebenden Menschen verwirklicht. Dem Staat kam dabei lediglich die Aufgabe zu, bei Verhaltensdevianzen wie etwa dem Betteln die zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung dieser Ordnung notwendigen machtpolitischen Maßnahmen zu ergreifen. 4.4.2.2 Der Bettler als volkswirtschaftliches Problem Die gemeinwohlschädigenden Folgen des Bettelns mussten innerhalb der Selbstbeschreibungen des politischen Systems von dem Zeitpunkt an in einem veränderten Licht erscheinen, als man damit begann, den Staatszweck von der Erhaltung von ‚Frieden und Gerechtigkeit’ in die Schaffung von ‚Wohlfahrt und Sicherheit’ zu verlegen. Der Staat bekommt jetzt von den ökonomischen Haushalten der alteuropäischen Gesellschaft die zentrale machtpolitische Aufgabe überantwortet, für die Subsistenz und das Wohl seiner Untertanen Sorge zu tragen. Sah sich die Sozialordnung im frühneuzeitlichen Territorialstaat noch durch die natürlichen moralischen Verpflichtungen der Stände verbürgt, so sind es nun die Bedürfnisse der Individuen selbst, in denen sowohl der Zusammenschluss als auch das Zusammenleben der Menschen gründet. Dem Staat obliegt es entsprechend, durch die Gewährung von Sicherheit und Wohlfahrt die heterogenen Interessen der Gesellschaftsmitglieder auf den letzten Endzweck ihrer zeitlichen Glückseligkeit hin abzustimmen.602 Im Gegensatz zum Eudämonismus aristotelischer Prägung wird das Erleben von 601 602 Eine ähnliche Position vertritt auch der Humanist Juan Luis Vives, dessen Schrift De subventione pauperum eine zentrale Stellung in den Armenfürsorgereformen der Frühen Neuzeit einnimmt. Auch Vives begreift die politische Obrigkeit als jene Schaltzelle, von der aus der moralische Verfall der Menschheit bekämpft und der christliche Glauben gestärkt werden muss. Gerade aufgrund der vielfältigen Bedürfnisse des Menschen und den beschränkten irdischen Ressourcen kommt der weltlichen Obrigkeit die Pflicht zu, über die Bedürfniserfüllung des Einzelnen zu wachen und die unterschiedlichen Einzelwillen zu harmonisieren. Vgl. VIVES, De subvetione pauperum (wie Anm. 333), S. 317 ff. Man geht jetzt davon aus, dass Religion und Politik unterschiedliche Endzwecke verfolgen, die dem Individuum im ungleichen Maße Einschränkungen seiner natürlichen Freiheit abverlangen. Dabei sieht sich die zeitliche Glückseligkeit dann erreicht, „wenn ein Mensch seine Person, sein Eigenthum, seine Ehre und seine Freyheit 242 Glück dabei von der Befriedigung eigener Aspirationen und Wünsche abhängig gemacht. Glück ist also lediglich an sich selbst durch Reflexion erfahrbar. Dergestalt verinnerlicht und subjektiviert erhebt sich das Glückskonzept zu einem generalisierenden Prinzip, das auf alle Gesellschaftsmitglieder gleichermaßen anzuwenden ist, obgleich es die bestehenden Ungleichheiten zwischen ihnen nicht gänzlich unberücksichtigt lässt, insofern jeder nur nach Maßgabe seines Standes Anspruch hat, glücklich zu sein.603 Die Untertanen erscheinen dabei als Träger von in den bürgerlichen Gesetzen festgelegten Pflichten, die über den Gehorsam hinaus ein individuelles Engagement verlangen, gemäß des jeweils eigenen (nun historisch legitimierten) Standes den Wohlstand des Staats zu mehren. „Thue, was die Wohlfahrt der Gesellschaft befördert; unterlaß, was ihr hinderlich, oder sonst nachtheilig ist“,604 so lautet jetzt der kategorische Imperativ, an dem sich der Untertan in seinem Verhalten zu orientieren hat. Als Beurteilungskriterium für den Grad der Annäherung an den idealen Zustand der Glückseligkeit fungiert der Reichtum des Staats und seiner Untertanen. Glücklich ist also der Staat, „worinnen kein Einwohner ganz arm wäre“,605 oder positiv gewendet: in dem eine „zweckgemäße Bevölkerung“606 lebt. Während im 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts die Glücksbeschaffung noch weitestgehend in den Händen der Wohlfahrtspolitik des Polizeistaats liegt, wird ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehr und mehr das Individuum für sein Glück selbst verantwortlich gemacht. Humboldt bringt diese veränderte Auffassung mit seinem Versuch, die „Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen“,607 unmissverständlich auf den Punkt. Indem er die Staatsaufgaben auf die rechtsstaatliche Leistung der Gewährung von Sicherheit reduziert, billigt er dem Individuum den größtmöglichen Freiheitsspielraum zu, sich in der Gesellschaft zu entfalten – oder eben auch: in der Gesellschaft zu scheitern. Das politische System hatte im Verlaufe seiner sozialen Evolution mit dem über Landesgrenzen definierten Territorium eine neue Form der segmentären Differenzierung hervorgebracht, die ähnlich wie die multifunktionalen Einheiten der Häuser die verschiedenen sozialen Lebenssphären des Menschen zu überformen und zu integrieren imstande war. Die Staatsgewalt bleibt jetzt nicht mehr auf die rechtsfreien Räume einer Gesellschaft beschränkt, die sich in eine Vielzahl 603 604 605 606 607 leicht und ungehindert, und so vervollkommnen kann, daß dadurch auch zugleich diese nemliche Glückseeligkeit der ganzen bürgerlichen Gesellschaft befördert wird. Denn da ein Mensch für sich allein nicht alles thun kann, was zu dieser Vervollkommnung erfordert wird, sondern vieler Menschen Hülfe dazu bedarf, so muß er so viel als möglich ist, zum allgemeinen Besten mitwürken, damit sie ihn zur Wiedervergeltung auch unterstüzzen mögen.“ JUNG-STILLING, Staats-Polizey-Wissenschaft (wie Anm. 382), S. 3 f. Vgl. LUHMANN, Politik (wie Anm. 575), S. 206. WOLFF, Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben (wie Anm. 366), S. 7. JUSTI, Grundfeste zu der Macht (wie Anm. 373), S. 154. Joachim G. Darjes bringt es auf die kurze Formel: „Gute und reiche Unterthanen wirken reiche und mächtige Fürsten […].“ DARJES, Joachim G.: Erste Gründe der Kameralwissenschaften. Aalen 1969 [ND Leipzig, 1768], S. 364. JUNG-STILLING, Staats-Polizey-Wissenschaft (wie Anm. 382), S. 6. HUMBOLDT, Wilhelm: Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. In: HUMBOLDT, Wilhelm: Werke in fünf Bänden (Hg. von Andreas Flitner und Klaus Giel). Bd. I. Schriften zur Anthropologie und Geschichte. Stuttgart 1960, S. 56-233. 243 rechtlich selbständiger Untereinheiten differenziert. Der absolutistische Staat erweitert seinen Regulierungsanspruch auf ein in sich homogenes Staatsgebiet, innerhalb dessen Grenzen er keine Konkurrenz neben sich mehr duldet. Wer sich auf diesem Herrschaftsraum befindet oder bewegt, und sei es nur für die kurze Dauer einer Reise, der hat sich automatisch auch der Gehorsamsverpflichtung gegenüber dem Monarchen zu unterwerfen. So sind selbst Fremde, die „sich in unsern Landesbezirken aufhalten, […] Untertanen unsers Oberherrn, weil in der bürgerlichen Gesellschaft derjenige ein Untertan ist, der die Majestät nicht hat und weil auch sonst der Regent seine Hoheitsrechte nicht füglich würde ausüben können, wenn der Fremde nicht unter seinen Befehlen stehen sollte.“608 Mit der Vorstellung des zum Gehorsam verpflichteten Untertanen sieht sich die alte ständische Differenzierung zwischen Einwohnern und Bürgern außer Kraft gesetzt,609 insoweit jetzt jeder Anwesende in einem Herrschaftsraum im gleichen Maße dazu angehalten ist, dem Monarchen in seiner Befehlsgewalt Folge zu leisten und dem Wohl des Staats, wenn auch je nach seinen Kräften, zu dienen.610 Die in den mittelalterlichen Städten eingeführte Unterscheidung von einheimischen und fremden Bettlern, die noch eine strikte Differenzierung zwischen einem Inklusionsbereich ständischer Rechte und Pflichten auf der einen und einem Exklusionsbereich der Rechtlosigkeit auf der anderen Seite vollzieht, verliert damit ihre zentrale Bedeutung bei der Ausgestaltung politischer Restriktionen des Bettlerwesens. Zwar setzen auf der ordnungspolitischen Ebene Bestrebungen ein, fremde Bettler und Vagabunden bereits am Überschreiten der Landesgrenzen – etwa durch Grenzposten und Passkontrollen – zu hindern, bzw. sie in den Staat ihrer Herkunft zurückzusenden. Neben diesen sicherheitspolitischen Maßnahmen steht jedoch das wohlfahrtspolitische Kalkül, von solchen Landesverweisungen immer dann abzusehen, wenn der Gesellschaft durch ihren Vollzug nützliche Arbeitskräfte entzogen werden. So können auch fremde Bettler zu einer Arbeit herangezogen und verpflichtet werden, die das Wohl des Staats befördert. Nicht fremd oder einheimisch, sondern zu einer gemeinwohlförderlichen Arbeit tauglich oder nicht-tauglich lauten jetzt die ausschlaggebenden Kriterien, die über das Schicksal des Bettlers entscheiden. Der absolutistische Wohlfahrtsstaat erkennt in der Arbeit nicht mehr nur eine moralische Pflicht, aus der eine ständisch differenzierte Sozialordnung ihre Stabilität gewinnt; er erkennt in ihr vielmehr den Grundstein des Wohlstands einer jeden Gesellschaft. Dementsprechend galt es auch den Müßiggang einzudämmen, denn „wenn nun das gesamte Volk wenig Lust zu arbeiten hat, oder wenn viele darunter dem Müssiggang ergeben sind; so kann der Zustand des gemeinen 608 609 610 SCHEIDEMANTEL, Heinrich G.: Das allgemeine Staatsrecht überhaupt nach der Regierungsform. Jena 1979 [ND Jena, 1775], S. 219. Vgl. STICHWEH, Fremde im Europa der frühen Neuzeit (wie Anm. 16), S. 27 f. Vgl. SONNENFELS, Joseph von: Politische Abhandlungen. Aalen 1964 [ND Wien, 1777], S. 91 f.; JUSTI, Heinrich Gottlob von: Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten, oder ausführliche Vorstellung der gesamten Policeywissenschaft. Bd. 2. Aalen 1965 [ND Königsberg/Leipzig, 1761], S. 210. 244 Wesens nicht anders als schlecht seyn.“611 Den staatlichen Bemühungen, die Glückseligkeit aller durch kollektiv bindende Entscheidungen zu gewährleisten, standen die Verhaltensweisen des Bettlers geradezu entgegen, war er doch nicht gewillt bzw. wegen seiner Lebensumstände nicht in der Lage, sich mit seiner Arbeitskraft für das gemeine Wohl zu engagieren. Die Policeywissenschaftler des 18. Jahrhunderts sahen entsprechend in dem Betteln „eine Unordnung in dem Staate, sowohl wegen des üblen Ansehens, das die häufigen Bettler auf denen Straßen verursachen, als wegen der Ungleichheit, die dabey sowohl auf Seiten der Geber, als der Empfänger der Allmosen vorgehet; wie denn auch als denn schwehrlich zu vermeiden ist, daß nicht das Betteln eine Unterstützung der Faulheit wird. Das Betteln kann also in einem wohl eingerichteten Staate auch diesen unglücklichen und mittleidenswürdigen Leuthen nicht erlaubet werden.“612 Der Bettler figuriert zur Unperson schlechthin, zum „freventliche[n] Widerstreber seiner eigenen Glückseligkeit“613, wie es in einer Mainzer Verordnung aus dem Jahre 1787 heißt. Und weil seine soziale Präsenz geradezu die Grenzen und das Misslingen des politischen Anliegens, den Wohlstand aller durch die Steuerung der Ökonomie zu steigern, zur Anschauung bringt, gar die Gehorsamsverpflichtung des Untertanen gegenüber dem Monarchen selbst in Frage stellt, werden allerorts mit Arbeits- und Zuchthäusern Institutionen eingerichtet, die auf eine Verhüllung seiner öffentlichen Sichtbarkeit abzielen.614 „Exklusion vollzieht sich jetzt nicht mehr durch Distanznahme und Meidung [...], sondern als kontrollierte Form der Distanznahme, durch Überwachung. Die neue Form der Exklusion ist daher gleichzeitig eine Inklusion, eine inkludierende Exklusion durch räumliche Konzentration [...].“615 Die Arbeitshäuser sollen aber nicht nur dazu beitragen, das unnütze Gesindel durch eine Disziplinierung ihres Verhaltenshabitus in die bürgerliche Gesellschaft zu reintegrieren bzw. ihre Arbeitskraft nutzbar zu machen. Sie sollen zudem von jenen Menschen als Rückzugsstätte in Anspruch genommen werden können, denen aufgrund fehlender Qualifikationen oder körperlicher Gebrechen die Möglichkeit verschlossen bleibt, an der Gesellschaft teilzuhaben und damit Ehre und Ansehen zu erwerben.616 Der Aufenthalt in einem Arbeits- und 611 612 613 614 615 616 JUSTI, Johann H. G. von: Grundsätze der Policeywissenschaft. Frankfurt (Main) 1969 [ND Göttingen, 1782], S. 281. JUSTI, Grundfeste zu der Macht Bd. 2 (wie Anm. 610), S. 394 f. Verordnung vom 2. Januar 1787. StA Mainz, LVO. Den Hinweis auf diese Textstelle verdanke ich Dr. Sebastian Schmidt. Bereits Seckendorff stellt die Forderung auf, Bettler seien in Arbeits- und Zuchthäuser einzusperren. Vgl. SECKENDORFF, Veit L. von: Deutscher Fürstenstaat. Aalen 1972 [ND Jena, 1737], S. 232 f. BOHN, Cornelia: Inklusionsindividualität und Exklusionsindividualität. In: BOHN, Cornelia / WILLEMS, Herbert (Hg.): Sinngeneratoren. Fremd- und Selbstthematisierung in soziologisch-historischer Perspektive. Konstanz 2001, S. 159-176, hier S. 173. Der Sozialstatus ist spätestens seit dem aufgeklärten Absolutismus durch den Dienst am Staat erwerbbar. Vergleiche dazu auch die Verschiebungen innerhalb der Konzeption der Ehre, die sich von einer ständischen Begründung löst. „Die Ehre ist, im gewöhnlichen Sinn genommen, die Meynung der bürgerlichen Gesellschaft von dem Werth eines ihrer Mitglieder.“ JUNG-STILLING, Staats-Polizey-Wissenschaft (wie Anm. 382), S. 11. 245 Zuchthaus darf von daher auch „nichts infamierendes an sich haben.“617 Er dient nicht ausschließlich der Bestrafung, sondern er muss „die letzte Zuflucht aller derer seyn [...], die in denen elendsten Umständen sind, wodurch sie sich das Betteln erwehren können.“618 Sobald man damit beginnt, die Moral nicht mehr als eine Disposition zu begreifen, die in der Natur des Menschen selbst wurzelt, lassen sich Lebensumstände denken, in denen man in seiner Verhaltenswahl gar nicht mehr vor der Option steht, sich für oder gegen das Gute zu entscheiden, in denen vor jeder Moral das Fressen kommt. „Der Arme ist bey uns oftermal mit Leib und Seele unter der Last aller Bedürfnisse erdrükt. Er kennt den Ruf der Ehre nicht mehr. Er fühlet den Stachel der Tugend nicht. Er ist ganz sorglos. In der äussersten Dürftigkeit, darein er gerathen ist, bleiben alle Triebfedern kraftlos. [...] Keine seiner Verrichtungen kündiget den Sieger der Thiere, noch den künstlichen Vermehrer der vielfältigen Vegetabilien, noch den weisen Scheidekünstler der Mineralien an, der sie mit bewundernswürdiger Einsicht in schönere und eben so dauerhafte Formen, als der erste Stoff war, zu entkleiden und wieder zu bilden weiß. Nein, unser Arme ist ein Bettler, er ist zaghaft, niederträchtig, von allem sittlichen Gefühle entblößt. Er beschäftigt sich blosserdingen mit der Erhaltung seines wirklichen Daseyns. Er ist kein unermüdeter Landmann, kein fleißiger Handwerker, kein nützlicher Bürger. Er ist unwerth, und hat seine Würde verloren.“619 Und es gebietet dem Staat in seiner Zwecksetzung, durch die Bereitstellung angemessener Inklusionschancen dieser negativen Karriere, an dessen Endpunkt dem Menschen seine Würde abhanden gekommen ist, entgegenzuwirken. 617 618 619 CELLA, Johann Jakob: Freymüthige Gedanken über Landesverweisungen, Arbeitshäuser und Bettelschübe. Anspach 1784, S. 15. JUSTI, Grundfeste zu der Macht Bd. 2 (wie Anm. 610), S. 432. BRISSON: Von dem Bettelstande in Frankreich. In: Abhandlungen und Beobachtungen durch die Ökonomische Gesellschaft Bern 10 (1769), S. 59-86, hier S. 64 f. 246 5. Schlussbetrachtung – Der Fremdheitstypus des Peripheren In der historischen Forschung wird die Personengruppe der Bettler zumeist unter dem Aspekt ihrer Armut in den Blick genommen. Die Unterschiede zwischen Bettlern und Armen lassen sich dann als graduelle darstellen und im Sinne einer Armutskarriere interpretieren. Die Lektüre von Monographien, welche die Geschichte der Armut zum Gegenstand haben, erweckt dabei den Eindruck, Armut sei ein konstantes Phänomen sozialen Zusammenlebens, das universalhistorische Geltung beansprucht.620 Was historisch variiert, sind Einstellungen gegenüber den Armen, ihre Einbettung in die Gesellschaft wie auch Formen des Helfens, nicht aber die fundamentale Notwendigkeit, Armut durch Integration des Armen in die Gesellschaft sozial zu konditionieren. Eine Gesellschaft, die sich ihrem Armutsproblem nicht annimmt bzw. deren Mittel sich als unzureichend erweisen, dieses zu lösen, erscheint aus diesem Blickwinkel außerstande, soziale Stabilität aufrechterhalten zu können. Die historische Armutsforschung macht sich dementsprechend zur Aufgabe, Armut als einen, wenn nicht sogar: als den Motor gesellschaftlicher Wandlungsprozesse zu analysieren. Die hier vorliegende Dissertation hat einen von dieser Sichtweise abweichenden Zugang gewählt. Sie unterscheidet methodisch zwischen einer Analytik der Inklusion und Exklusion auf der einen und einer Analyse der Korrelation von Gesellschaftsstruktur und historisch variierenden Semantiken auf der anderen Seite.621 Mit der Analytik von Inklusion und Exklusion verfügt man über ein wissenschaftliches Instrumentarium zur Beschreibung gesellschaftlich vorgesehener Teilhabechancen, die sich der Person als Anknüpfungspunkt für Kommunikationen eröffnen. Gegenüber dem Modell der Integration, das von dem Idealzustand einer Totalinklusion aller Gesellschaftsmitglieder ausgeht, gewinnt man mit der Analytik von Inklusion und Exklusion die Möglichkeit, temporalisierte und selektive Zugänge zu den verschiedenen Subsystemen der Gesellschaft erfassen und unterscheiden zu können. Jede Inklusion in ein soziales System birgt von daher immer auch Exklusionen aus anderen Systemen in sich. Semantiken dahingegen sind wieder verwendbare, als bewahrenswert ausgezeichnete und insofern historische Sinnmuster, die aus den Selbstbeschreibungen sozialer Systeme hervorgehen. Über Semantiken bestimmen soziale Systeme ihr Verhältnis zur Welt und geben zugleich Auskunft über ihre Inklusionsbedingungen. Mit der Unterscheidung von Analytik und Semantik wird das soziologische Forschungsinteresse von einer Analyse gesellschaftlicher Fehlentwicklungen und Ursachen von Armut auf die Funktionen gelenkt, die dem Bettler bei der Aufrechterhaltung und Stabilisierung sozialer Ordnung zu620 621 Vgl. dazu die großen Monographien von MOLLAT, Armen im Mittelalter (wie Anm. 531); GEREMEK, Geschichte der Armut (wie Anm. 404). Zur Unterscheidung von Analytik und Semantik vgl. STICHWEH, Rudolf: Inklusion/Exklusion und die Soziologie des Fremden. In: STICHWEH, Rudolf: Inklusion und Exklusion. Studien zur Gesellschaftstheorie. Bielfeld 2005, S. 133-143, hier S. 133 ff.; BOHN, Individuen und Personen (wie Anm. 286). 247 fallen. Seine soziale Präsenz gilt es von daher nicht mehr als manifestes Zeichen eines Armutsproblems zu behandeln, das die Gesellschaft auf dem Weg hin zu ihrem Idealzustand zu lösen hat. Im Gegensatz dazu erscheint er vielmehr bereits als die Lösung eines in den Gesellschaftsstrukturen angelegten Problems. Der Bettler verdankt seine Identität dem Interaktionssystem der personalen Hilfe. Im Vollzug seiner Operationen generiert es den Bettler als eine soziale Adresse, der man bestimmte Verhaltensmerkmale zuschreiben kann. Soziologisch interessant ist das Interaktionssystem der personalen Hilfe gerade deshalb, weil es Verhaltensroutinen offeriert, welche die Norm der Reziprozität, mit der stratifikatorisch differenzierte Gesellschaften ihr Einheitsproblem lösen, außer Kraft setzen, indem sie den Geber und Nehmer des Almosens als komplementäre Rolleninhaber konstituieren. Es zeigt die Kontingenz einer an wechselseitigen Rechten und Pflichten orientierten Gesellschaftsordnung an, in der jeder als Angehöriger einer Schicht dem anderen das Seinige schuldet. Der Bettler dahingegen verfügt über keinen eindeutigen, durch spezifische ständische Rechte und Pflichten gekennzeichneten Sozialstatus. Für ihn ist die Exklusion aus der Ordnung stratifikatorisch differenzierter Gesellschaften bezeichnend. Es sind aber gerade diese durch seine Person zur Anschauung gebrachten rechtlichen Leerstellen, die dem politischen System Chancen eröffneten, sich in seiner Zwecksetzung bzw. Verwaltungstätigkeit auszudifferenzieren und von religiösen Limitationen der ständischen Differenzierung zu befreien. Erst im Zuge dieses Autonomisierungsprozesses traten beim politischen System gesellschaftliche Steuerungsansprüche hervor, die zunächst auf eine Stabilisierung der ständischen Differenzierung (‚gute Policey’) durch eine aktive und öffentliche Gesetzgebung ausgerichtet waren, bis sie sich schließlich immer stärker mit ökonomischen Zielvorgaben verbanden. Konnte dem Bettler in den theologischen Diskursen des Mittelalters als Objekt der Werke der Barmherzigkeit und in seiner Rolle für das Seelenheil des Almosenspenders noch eine zentrale Funktion in der Schöpfung Gottes zugesprochen werden, so wird sein Verhalten zu Beginn der Frühen Neuzeit – einhergehend mit einer stärkeren Erforschung seiner Handlungsmotive – mehr und mehr mit Sünde in Verbindung gebracht. Das ausschließlich seinem Eigennutz dienliche Betteln wird als eine Gefahr für die Aufrechterhaltung der Sozialordnung wahrgenommen, die es mit politischen Mitteln zu bekämpfen gilt. Im 17. und 18. Jahrhundert ist es nicht mehr das Anliegen der Stabilisierung ständischer Differenzierung, das den Bettler in den Fokus politischer Entscheidungen rückt, seine Verhaltensweisen stehen vielmehr im Widerspruch zu einer bürgerlichen Gesellschaftsordnung, die auf dem Fundament der vollständigen ökonomischen Inklusion aller Untertanen gebaut ist. Für die historische Forschung ist der Befund einer im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit einsetzenden verstärkten sozialen Wahrnehmung bzw. quantitativen Zunahme von so verschiedenen Personengruppen wie Bettlern, Prostituierten, Scharfrichtern, Spielleuten, Kranken, Aus248 sätzigen, Hexen, Zigeunern etc. ein Allgemeinplatz, der in einer Reihe von Studien zur Randgruppenforschung Eingang gefunden hat.622 Dabei kommt die analytische Kategorie der Randgruppe zumeist weitestgehend unreflektiert zum Gebrauch. Eine Arbeit an ihrem theoretischen Gehalt erfolgt nur in Ausnahmefällen. Die historische Forschung scheint vielmehr von dem Versuch geleitet zu sein, die in der Soziologie von Friedrich Fürstenberg ausgearbeitete Kategorie auf ihren Gegenstand zu übertragen. Fürstenberg hat den Begriff der Randgruppe zur Beschreibung und zur Erklärung von in der modernen Mittelstandsgesellschaft sichtbar werdenden „Anzeichen sozialer Desintegration“623 verwendet. Die Desintegration sieht er insbesondere durch soziale Gruppen verursacht, deren Angehörigen die Bereitschaft fehlt, sich in das Sozialgefüge einzupassen. „Derartige lose oder fester organisierte Zusammenschlüsse von Personen, die durch ein niedriges Niveau der Anerkennung allgemein verbindlicher sozio-kultureller Werte und Normen und der Teilhabe an ihren Verwirklichungen sowie am Sozialleben überhaupt gekennzeichnet sind, sollen als soziale Randgruppen bezeichnet werden.“624 Analog hierzu hat der Historiker František Graus unter die Kategorie Randgruppe all jene Personen subsumiert, welche „die Normen der Gesellschaft, in der sie leben, nicht anerkennen bzw. nicht einhalten oder nicht einhalten können und aufgrund dieser Ablehnung bzw. Unfähigkeit (infolge sog. nichtkonformen Verhaltens) von der Majorität nicht als gleichwertig akzeptiert werden.“625 Als Träger von im Widerspruch mit den Normen der Mehrheitsgesellschaft stehenden Verhaltensweisen sehen sie sich Diffamierungen ihrer Ehre wie auch sozioökonomischen Diskriminierungen ausgesetzt. Neben den aktiven Maßnahmen, die eine Gesellschaft ergreift, um diese Personengruppen die Teilhabe an ihren Strukturen zu erschweren oder gar unmöglich zu machen, sind vor allem die Überlebensstrategien von Interesse, mit denen die Betroffenen auf ihre Lebenssituation reagieren.626 Dabei stellt sich ein zirkulärer, sich selbst verstärkender Prozess ein, bei dem jede Maßnahme der einen Seite eine entsprechende Gegenmaßnahme der anderen Seite provoziert und damit zur Herausbildung spezifischer Selbstbilder und kollektiver Identitäten beiträgt. Die Frage nach den 622 623 624 625 626 Exemplarisch seien an dieser Stelle folgende historische Arbeiten genannt: GRAUS, František: Randgruppen der städtischen Gesellschaft im Spätmittelalter. In: Zeitschrift für Historische Forschung 8 (1981), S. 385-437; HERGEMÖLLER, Bernd-Ulrich: Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Wege und Ziele der Forschung. In: HERGEMÖLLER, Bernd-Ulrich (Hg.): Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Ein Hand- und Studienbuch. Warendorf 2001, S. 1-57; ROECK, Bernd: Außenseiter, Randgruppen, Minderheiten. Fremde im Deutschland der frühen Neuzeit. Göttingen 1993; HIPPEL, Wolfgang von: Armut, Unterschichten, Randgruppen in der Frühen Neuzeit. München 1995. FÜRSTENBERG, Friedrich: Randgruppen in der modernen Gesellschaft. In: Soziale Welt 16 (1965), S. 236-245, hier S. 236. Ebd., S. 237. GRAUS, Randgruppen (wie Anm. 622), S. 396. Ein soziologisches Pendant dieser geschichtswissenschaftlichen Fragerichtung findet sich bei Susanne Karstedt. Während Fürstenberg die Randgruppe als eine mehr oder minder geschlossene soziale Entität begreift, betont Susanne Karstedt das Erfordernis, „die Dimensionen des Interaktionsprozesses zwischen Randgruppen und ‚herrschender’ Mehrheit“ in die Analyse mit einzubeziehen.“ KARSTEDT, Susanne: Soziale Randgruppen und soziologische Theorie. In: BRUSTEN, Manfred / HOHMEIER, Jürgen (Hg.): Stigmatisierung I. Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen. Neuwied 1975, S. 169-196, hier S. 181. 249 Ursachen und den soziokulturellen Bedingungen des gesellschaftlichen Bedeutungszuwachses von Randgruppen wird in der historischen Forschung zumeist unter dem Blickwinkel der Krise des Spätmittelalters und den ihr zugrunde liegenden sozioökonomischen und demographischen Veränderungen bzw. Mentalitätsverschiebungen der Gesellschaft beantwortet. Die Rede von Menschen, die sich am Rand der Gesellschaft befinden, impliziert, es gäbe so etwas wie die eine Gesellschaft, die wie ein monolithischer Block ihr Innen von ihrem Außen, ihre Mitglieder von ihren Nicht-Mitgliedern scheidet. Einem solchen Modell liegt die soziologische Annahme einer normativ integrierten Gesellschaft zugrunde, deren Außengrenze geradezu durch ein Fehlen „normativer Kohärenz“627 gekennzeichnet ist. In seinem Buch Die Metamorphose der sozialen Frage entwirft Robert Castel ein Gesellschaftsmodell, das diese bipolare Sichtweise zu modifizieren sucht, indem es das soziale Leben in drei „Zonen der sozialen Kohäsion“628 einteilt. Als maßgebliche Indikatoren für den jeweiligen Grad des Eingebundenseins des Individuums in die Gesellschaft macht er das Vorhandensein von Erwerbsarbeit auf der einen und von primären Netzen der Sozialbeziehungen auf der anderen Seite aus. Zwischen den beiden Zonen der Integration und Entkoppelung, der Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit, lokalisiert er eine Zone der Verwundbarkeit. Ihr gehören Menschen an, denen aufgrund der Prekarität ihrer Arbeitsverhältnisse der Fall, die „Desaffiliation“629, in die Zone der Entkoppelung droht. Während die Randgruppenforschung die Dichotomie von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit mehr oder minder als ein universalhistorisches Problem zu begreifen scheint, das in den Eigenlogiken des Sozialen selbst wurzelt, hebt Castel die historisch variablen Verhältnisse der einzelnen Zonen zueinander hervor. Am Ende des 17. Jahrhunderts, so lautet einer seiner zentralen Thesen, beginnt sich im europäischen Raum ein Bewusstsein der kollektiven Verwundbarkeit der arbeitslohnabhängigen Bevölkerung durchzusetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde diese Personengruppe der Besitzlosen als integraler Bestandteil einer auf dem Gleichgewichtsverhältnis von Arm und Reich beruhenden Sozialordnung betrachtet. Den gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen des 17. Jahrhunderts dahingegen schwebt ein ganz anderes Bild vor. Die soziale Ordnung erscheint hier nicht mehr vornehmlich von Außen durch die Lebensweise der vom Gemeinwesen vollständig entkoppelten Bettler und Vagabunden bedroht, vielmehr werden die Armen selbst als ein destabilisierender Faktor der Gesellschaft erkannt. Mit diesem Bewusstwerden der sozialen Frage „ist eine fundamentale Aporie [verbunden – J.H.], an der eine Gesellschaft das Rätsel ihrer Kohäsion erfährt und das Risiko ihrer Fraktur abzuwenden sucht. Sie stellt eine Herausforderung dar, welche die Fähigkeit einer Gesellschaft [...] auf die Probe bzw. in Frage stellt, als eine durch 627 628 629 Vgl. PARSONS, Talcott: Das System moderner Gesellschaften. München 1972, S. 21. CASTEL, Metamorphosen der sozialen Frage (wie Anm. 8), S. 13. Zum Begriff der Desaffiliation vgl. CASTEL, Robert: Nicht Exklusion, sondern Desaffiliation. Ein Gespräch mit François Ewald. In: Das Argument 217 (1996), S. 775-780. 250 wechselseitige Abhängigkeitsbeziehungen verbundene Gesamtheit zu existieren.“630 Man beginnt jetzt zu erkennen, dass es die Gesellschaft selbst ist, die durch die Festlegung ihrer Zugehörigkeitsbedingungen zugleich auch Voraussetzungen schafft, an diesen zu scheitern. Diese Einsicht läutet den Beginn des Nachdenkens über die Notwendigkeit der politischen Steuerung des Konfliktpotentials zwischen Armen und Reichen ein. Der Bettler und der Vagabund repräsentieren infolgedessen nicht mehr einfach nur das Unvertraute einer Ordnung, in der jeder gemäß seiner Stellung im Ganzen eine Leistung seinem Gegenüber schuldet. Von nun an markieren sie die Endpunkte negativer, in der Exklusion aus der Gesellschaft mündender Karrieren. Fokussiert die Randgruppenforschung ihren Blick noch vornehmlich auf Personengruppen, die bereits außerhalb des gesellschaftlichen Normenkonsenses stehen, so geht es Castel um die Analyse von in den Gesellschaftsstrukturen angelegten Möglichkeiten des zeitlichen Prozesses der Exklusion. Er weist damit auf die generelle Gefahr eines sozialen Statusabstiegs hin, mit der sich der Lohnabhängige in der modernen Gesellschaft konfrontiert sieht. Allerdings bleibt auch Castel bei seiner Darstellung des historischen Wandels der Lohnarbeit einem Sozialmodell verhaftet, das von „der Kohäsion einer gesellschaftlichen Ganzheit“631 ausgeht. Zwar löst er sich von der Vorstellung, die Gesellschaft sei ein statisches, Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit strikt voneinander trennendes Gebilde, indem er darauf verweist, dass sich bereits innerhalb ihrer Strukturen die Ausschlusskriterien sowie die möglichen Wege der Exklusion des Individuums vorgezeichnet finden. Seine soziologischen Analysen richtet er jedoch weiterhin an einem Referenzsystem aus, das sich als Ganzheit über die Arbeitsteilung und über die primären Sozialbeziehungen, also über die relativ dauerhaften Bindungen der Gesellschaftsmitglieder, konstituiert. Folgerichtig versucht er den Wandel sozialer Strukturen mit dem verstärkten Auftauchen von Personengruppen zu erklären, die sich nicht mehr ohne weiteres in eine althergebrachte Sozialordnung einpassen lassen und damit einen Veränderungsdruck auf diese ausüben. So brachte in der Ständegesellschaft die Vagabunden-Frage „die Grundforderung nach freiem Zugang zur Arbeit zum Ausdruck, von der aus sich die Produktionsverhältnisse auf einer neuen Grundlage definierten. Zugleich verschleierte sie diese aber auch.“632 Unklar dabei bleibt jedoch, ob es die Veränderungen der Produktionsverhältnisse waren, welche die Vagabunden-Frage akut werden ließen, oder umgekehrt: ob sich erst mit dem Akutwerden der Vagabunden-Frage auch die Produktionsverhältnisse zu verändern begannen. Dieses Kausalitätsproblem, das jeder Relationierung von Struktur und Kultur immanent ist, lässt sich nur umgehen, wenn man die Wahrnehmungen des Neuen, Andersartigen und Fremden zunächst einmal als das nimmt, was sie sind, nämlich: Beobachtungsleistungen, die von einem sozialen System vollzogen werden müssen. Ni630 631 632 CASTEL, Metamorphosen der sozialen Frage (wie Anm. 8), S. 17. Ebd., S. 13. Ebd., S. 18. 251 klas Luhmann spricht in diesem Zusammenhang auch von Irritationen. „Irritationen ergeben sich aus einem internen Vergleich von (zunächst unspezifizierten) Ereignissen mit eigenen Möglichkeiten, vor allem mit etablierten Strukturen, mit Erwartungen. Es handelt sich immer um ein systemeigenes Konstrukt, immer um Selbstirritation – freilich aus Anlaß von Umwelteinwirkungen. Das System hat dann die Möglichkeit, die Ursache der Irritation in sich selber zu finden und daraufhin zu lernen oder die Irritation der Umwelt zuzurechnen und sie daraufhin als ‚Zufall’ zu behandeln oder ihre Quelle in der Umwelt zu suchen und auszunutzen oder auszuschalten.“633 Vor diesem theoretischen Hintergrund soll nun die Frage diskutiert werden, inwieweit die Personengruppe der Bettler analog zu der der Vagabunden in einer ständischen Gesellschaftsordnung eine Andersheit und Fremdheit zur Anschauung bringt, die ein soziales System mit spezifischen Themen versorgt und die es dazu veranlasst, sein Verhältnis zur Umwelt neu zu bestimmen. Das Erleben von Fremdheit setzt also keinesfalls eine der Beobachtung vorgängigen Andersheit des als ‚fremd’ Bezeichneten voraus. Dessen Andersheit ist weder einer naturalen noch einer sozialen Realität geschuldet. Sie ist vielmehr konstruktiv an der Erschaffung von Realität beteiligt, indem sie diese aus der Perspektive eines sozialen Systems repräsentiert. Fremdheit entsteht, sobald Sozialsysteme über das Kriterium der Mitgliedschaft ein an der Person festgemachtes Verhältnis von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit, von Inklusion und Exklusion reflektieren und dabei soziale Identitäten generieren, die über die Inklusionsbedingungen der Person informieren.634 Fremdheit darf also keineswegs mit Ausschluss und Disprivilegierung gleichgesetzt werden. Der als fremd Bezeichnete gewinnt seine ihm eigentümliche Identität gerade daraus, dass ihm exklusive Teilhabemöglichkeiten offen stehen, die ihrerseits den Gemeinschaftsmitgliedern verschlossen bleiben. Im Gegensatz zum Angehörigen der ständisch-feudalen Gesellschaft, der als Mitglied einer Korporation Teil der Sozialität ist und dessen Sozialstatus in seiner Schichtzugehörigkeit begründet liegt, müssen also die Inklusionsbedingungen des in seiner Andersheit Wahrgenommen stets aufs Neue ausformuliert und respezifiziert werden. Die unzähligen städtischen Verordnungen bzw. Policey-, Reichs- und Landesordnungen, in denen diese Personengruppen eine bedeutende Stellung einnehmen, legen hiervon Zeugnis ab. Auffallend dabei ist, dass die neu erlassenen Verordnungen oftmals kaum von ihren Vorgängern abweichen, ja Bekanntes beharrlich mit geringfügigen Variationen des Gesetzestextes wiederholen. Ferner werden 633 634 LUHMANN, Gesellschaft der Gesellschaft (wie Anm. 13), S. 118 f.; vgl. auch LUHMANN, Irritationen (wie Anm. 251). Vgl. STICHWEH, Rudolf: Der Fremde – Zur Soziologie der Indifferenz. In: MÜNKLER, Herfried (Hg.): Furcht und Faszination. Facetten der Fremdheit. Berlin 1997, S. 45-65, hier S. 46 f. Auf eine ähnliche Weise sieht Armin Nassehi den Fremden durch die Differenz von vertraut/unvertraut definiert. Nassehi hat darauf hingewiesen, dass in nach Strata differenzierten Gesellschaften ein politischer und ökonomischer Umgang mit dem Fremden einsetzt, der die Außenseite der Unterscheidung vertraut/fremd nicht mehr wie in segmentären Gesellschaften als amorphe Unbestimmtheit begreift. Vielmehr scheint die Unterscheidung vertraut/fremd nun ihrerseits vertraut zu werden. Vgl. NASSEHI, Armin: Der Fremde als Vertrauter. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 47 (1995), S. 443-463. 252 die Verordnungen von der Kanzel oder vor den Pforten der Kirche bzw. auf dem Marktplatz verlesen, sie werden an öffentlich zugänglichen Plätzen angeschlagen oder in so genannten Intelligenzblättern publiziert. Repetition und Öffentlichkeit sind folglich die tragenden Stützen innerhalb eines Prozesses, in dem sich bestimmte Personenmerkmale erst zu jeweils eigenen Identitäten verdichten. Über solche Identitätsmuster führen spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Gesellschaften neuartige Formen der Differenzierung sozialer Gruppen in ihr hierarchisches Ordnungsgefüge ein. Sie tragen damit aber nicht einfach nur einer historischen Realität Rechnung. Mit der Implementierung dieser neuartigen Identitätsformen in ihre Sozialstruktur spezifizieren und generalisieren sie zugleich auch die Inklusions- und Exklusionsbedingungen ihrer Mitglieder. „Denn wie immer man soziale Identität definieren (‚identifizieren’) will, es bleibt unvermeidlich, daß Identität durch Fremdheit konstituiert wird. Jede Selbstbeschreibung muß Alterität in Anspruch nehmen. Wenn man sagt, was man ist, muß man dies in Abgrenzung von dem tun, was man nicht ist. Die paradoxe Funktion von ‚Fremden’ besteht eben darin, daß sie Selbstidentifikationen gestatten. Je mehr Möglichkeiten folglich genutzt werden, sich positiv als so und nicht anders zu bestimmen, desto zahlreicher werden auch die ausdrücklichen Ausgrenzungen, desto mehr Typen von Fremdheit entstehen. Und je nach der Art der ‚Grenzen’, über die sich ein System definiert, werden andere Aus-Grenzungen produziert.“635 Fremdheitssemantiken dienen also stets auch dazu, das Eigenbild durch eine Kontrastierung vom auch anders Möglichen zu schärfen und zu stabilisieren. Diese differenztheoretische Herangehensweise legt es nahe, verschiedene Fremdheitstypen voneinander zu unterscheiden und miteinander zu vergleichen, insofern die Reflexion von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit in jeweils einer der drei von Niklas Luhmann benannten Sinndimensionen erfolgen kann. Fremdheit kann demnach an einer Person unter sozialen, sachlichen und zeitlichen Aspekten festgemacht werden. Für die Frühe Neuzeit lassen sich dementsprechend die Fremdheitsfiguren des Fremden (Sozialdimension), Vagabunden (Sachdimension) und Peripheren (Zeitdimension) analytisch voneinander scheiden.636 Diese Fremdheitstypen haben sich zu einem Zeitpunkt der gesellschaftlichen Reorganisation ständisch-feudaler Sozialstrukturen und einer damit einhergehenden funktionalen Ausdifferenzierung von Religion, Wirtschaft und Politik ausgebildet. Sie entspringen einer Übergangsgesellschaft, die ihre sozialen Teilhabemöglichkeiten zwar noch immer primär über Stratifikation und korporative Mitgliedschaften organisiert, innerhalb derer sich aber vermehrt Strukturen abzuzeichnen beginnen, die Personen unter sachthematischen, funktionalen Gesichtspunkten inkludieren. Jeder einzelne dieser drei Fremdheitstypen hat mit dem anderen gemein, dass er mittels der Gegenüberstellung von Zuge635 636 HAHN, Alois: ‚Partizipative’ Identitäten. In: HAHN, Alois: Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte. Frankfurt (Main) 2000, S. 13-79, hier S. 15. Vgl. STICHWEH, Fremde im Europa der Frühen Neuzeit (wie Anm. 16). 253 hörigkeit und Fremdheit eine Limitierung möglicher Personenmerkmale leistet und gleichzeitig einen Exklusionsbereich hervortreten lässt, in dem sich Individuen bewegen, die von der Gesellschaft als nicht mitteilungsrelevant eingestuft werden. Diese ausgeschlossenen Dritten lassen sich allenfalls noch als Körper objektivieren. Bei ihnen tritt damit der Versuch zurück, über die Instruktion und die Kontrolle erwünschten Verhaltens soziale Effekte zu erzielen.637 Es reicht vollkommen aus, sie per se von den gesellschaftlichen Kommunikationen auszuschließen oder sie gar in ihrer Existenz ganz zu eliminieren. Abschließend gilt es nun die Figur des Peripheren, mit der sich die Personengruppe der Bettler wissenschaftlich analysieren lässt, etwas genauer zu betrachten.638 Mit dem Fremdheitstypus des Peripheren eröffnet man sich die Möglichkeit, die soziale Funktion von Personengruppen in den Blick zu nehmen, denen gerade aufgrund ihres zeitlichen Übergangs von einer sozialen Zugehörigkeit zu einer Nicht-Zugehörigkeit Aufmerksamkeit in den gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen zuteil wird. Der Periphere gewinnt seine ihn kennzeichnenden Attribute durch eine zeitliche Perspektive auf seine Person, oder genauer: durch eine als ‚Entfremdungsprozess’ markierte Unterscheidung ihres vergangenen und gegenwärtigen Sozialstatus. Unter die Figur des Peripheren fallen demnach Personengruppen, die ihren ständisch fixierten Pflichten nicht mehr nachzukommen imstande sind und insofern durch den Verlust ihres ursprünglichen Sozialstatus gekennzeichnet werden können. „Der Anblick des Peripheren irritiert“, so Rudolf Stichweh, „weil er die Kontingenz von Lebensläufen als Person zur Anschauung bringt […].“639 Indem der Periphere vergegenwärtigt, dass alles, was dem Lebenslauf eine normative Autorität verleiht – die Geburt bzw. Verwandtschaft und schließlich das Streben nach Glückseligkeit – auch anders möglich sein kann, sprengt er den Rahmen des Vertrauten einer auf mehr oder minder unveränderlichen Statuszuschreibungen beruhenden Sozialordnung. Gleichzeitig werden aber über diese Negationen des Notwendigen bestimmbare Kontingenzen in den Lebenslauf des Einzelnen eingebaut. Der Periphere steckt also den Horizont dessen ab, was für den Statusabstieg innerhalb eines Lebenslaufs verantwortlich gemacht werden kann, und trägt damit dazu bei, die Grenzen der Sozialordnung neu auszuloten. In den gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen werden die Gründe für den Statusabstieg auf zwei Exklusionsmuster zurückgeführt: Zum einen auf eine ‚implizite’ bzw. ‚nicht-intentionale’ Exklusion, die sich durch Faktoren einstellt, die jenseits des Handelns der Person liegen (Krankheit, Verwaisung, Invalidität, Konjunktureinbrüche etc.); zum 637 638 639 Vgl. LUHMANN, Inklusion und Exklusion (wie Anm. 12), S. 262 f. Die analytische Kategorie des Peripheren wurde erstmals von Ernst Grünfeld in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht. Unter die Peripheren fasst Grünfeld all diejenigen, „die in Bezug auf irgend ein soziales Gebilde peripher sind, so daß ihre Zugehörigkeit zu den übrigen Gebildegliedern und dem Gebilde selbst gelockert oder aufgehoben ist.“ GRÜNFELD, Ernst: Die Peripheren. Ein Kapitel der Soziologie. Amsterdam 1939, S. 2. STICHWEH, Fremde im Europa der frühen Neuzeit (wie Anm. 16), S. 17. 254 anderen auf eine ‚Selbstexklusion’, insofern die Exklusion dem Verhalten der Person individuell angerechnet werden kann (Sünde, Müßiggang). Im Unterschied zur Metaphorik des Randes und ihrer Akzentuierung einer weder dem Innen noch dem Außen zugehörigen statischen Trennungslinie, welche das Innen von dem Außen scheidet, beschreibt der Begriff der Peripherie ein durch Nähe und Distanz bestimmtes Verhältnis zweier sich wechselseitig konstituierender Bezugssysteme. Die Peripherie ist vom Zentrum divergent, existiert aber lediglich aus der Perspektive des Selben heraus. Gleichfalls eröffnet diese Differenz dem Zentrum erst die Möglichkeit, sich selbst positiv als Zentrum zu identifizieren. Kurzum: Ohne Zentrum keine Peripherie, aber ohne Peripherie auch kein Zentrum. Setzt man diese reziproke Beziehung als Analysekriterium des Peripheren an, so sind es nicht seine Lebensumstände und seine materiellen wie sozialen Benachteiligungen an sich, die den Peripheren zum Peripheren machen. Seine Identität erhält er vielmehr durch die immer wiederkehrenden Bezeichnungsprozesse, in denen er in seiner Andersheit konstruiert und als Person spezifischen Verhaltenserwartungen unterworfen wird. Will man also etwas über den Peripheren erfahren, so muss sich der Blick auf die Kommunikationssysteme richten, in denen er Berücksichtigung findet und in denen sich ihm Teilhabemöglichkeiten eröffnen. Die an seine Person gerichteten Verhaltenserwartungen verleihen ihm dabei einen Sozialstatus, der eine Relation von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit vorsieht. Zwar bewegt sich der Periphere außerhalb der korporativen Netzwerke, da jedoch jedem Statusabstieg auch ein Ort immanent ist, von dem aus der Statusabstieg erfolgen musste, können über seine Person Wege der Reintegration in die Sozialordnung nachgezeichnet werden. Die unter den Fremdheitstypus des Peripheren fallenden Personengruppen finden sich also in einer Situation wieder, in der die Evidenz ihrer Person nicht mehr ausschließlich in den rechtlichen Verpflichtungen ihres Standes begründet liegt, sondern es das ihnen individuell angerechnete Verhalten ist, das Rückschlüsse auf ihre Soziabilität ermöglicht. Durch diese Individualisierung des Peripheren wird ein politisches Interesse an der Entschleierung und Domestizierung seines hinter der Handlung verborgenen Willens geweckt. Die Verordnung von Arbeit entwickelt sich dabei zur zentralen Praktik, mit der sich sowohl die Eröffnung von Teilhabechancen als auch die Kontrolle der Peripheren verwirklichen lassen. Stets sind sie – die Terminologie von Robert Castel aufgreifend – durch eine gewisse ‚Prekarität’ und ‚Verletzbarkeit’ gekennzeichnet, welche die Gefahr des aus der sozialen Ordnung Fallens immer schon beinhaltet, sie zugleich aber auch von den ausgeschlossenen Dritten unterscheidet. Zu den ausgeschlossenen Dritten zählen etwa die fremden Bettler, die sich nicht über einen Statusabstieg definieren lassen, weil sie zu keiner Zeit über einen Sozialstatus innerhalb des Gemeinwesens verfügten. Der Fremdheitstypus des Peripheren eröffnet also zum einen den Blick auf die Entstehung von Sozialstrukturen, die darauf ausgerichtet sind, den aus ständisch-feudalen Bindungen sich loslösenden 255 Menschen zu erfassen und ihm durch die Zuweisung eines politisch-rechtlichen Sonderstatus Wege der Reintegration vorzuzeichnen. Zum anderen finden sich die Peripheren aber auch in einer Situation wieder, in der es nicht mehr primär der Vollzug ihrer ständischen Pflichten, sondern der Gehorsam gegenüber einer politischen Machtinstanz ist, der Rückschlüsse auf ihre Soziabilität zulässt. Den Peripheren kennzeichnet damit der paradoxe Sachverhalt, gleichermaßen als Stabilisationsfaktor wie auch als Triebfeder des Wandels von stratifikatorisch zu funktional differenzierten Gesellschaften betrachtet werden zu können. 256 Literaturliste ABEL, Wilhelm: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter. Hamburg / Berlin 1978. ADELUNG, Johann C.: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Hildesheim 1970 ff. ADLOFF, Frank / MAU, Steffen: Zur Theorie der Gabe und Reziprozität. In: ADLOFF, Frank / MAU, Steffen (Hg.): Vom Geben und Nehmen. Zur Soziologie der Reziprozität. Frankfurt (Main) 2005, S. 9-57. AERTSEN, Jan A.: Einleitung. Die Entdeckung des Individuums. In: AERTSEN, Jan A. / SPEER, Andreas (Hg.): Individuum und Individualität im Mittelalter. Berlin / New York 1996, S. IX-XVII. AGRIPPA VON HEIM: NETTESHEIM: De mendicate oder Von der Bettelei. In: AGRIPPA VON NETTES- Die Eitelkeit und Unsicherheit der Wissenschaften und die Verteidigungsschrift. Bd. 1. München 1913, S. 289-296. ALTHAUS, Paul: Die Ethik Martin Luthers. Gütersloh 1965. ANDERSEN, John / LARSEN, Jørgen Elm: The Underclass Debate – a Spreading Disease? In: MORTENSEN, Nils (Hg.): Social Integration and Marginalisation. Frederiksberg 1995, S. 147-182. ANONYM: Betteley und deren Abhülfe. Erlangen 1839. ANONYM: Der Bettler. In: Minerva (1801), S. 558-559. ANONYM: Liber vagatorum. In: BOEHNCKE, Heiner / JOHANNSMEIER, Rolf (Hg.): Das Buch der Vaganten. Spieler, Huren, Leutbetrüger. Köln 1987, S. 79-101. ANTONUCCI, Toni C. / JACKSON, James S.: The Role of Reciprocity in Social Support. In: SARASON, Barabara (Hg.): Social Support. An Interactional View. New York 1990, S. 173-198. AQUIN, Thomas von: Summa Theologica. Übers. von Dominikanern u. Benediktinern Deutschlands u. Österreichs. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg. Graz / Wien / Köln 1933 ff. AQUIN, Thomas von: Summe gegen die Heiden. Dritter Band, Teil I. Hrsg. und übers. von Karl Allgaier. Darmstadt 1990. ARENDT, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München / Zürich 1985. ARISTOTELES: Eudemische Ethik. Darmstadt 1979. ARISTOTELES: Rhetorik. München 1995. ARISTOTELES: Die Nikomachische Ethik. Zürich / München 2006. ARISTOTELES: Politik. Zürich / München 2006. 257 ASSMANN, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München 1992. AUERBACH, Erich: Passio als Leidenschaft. In: Publications of the Modern Language Association of America 56 (1941), S. 1179-1196. AUGUSTINUS, Aurelius: Vom Gottesstaat (De civitate dei). Buch 11 bis 22. Zürich [u.a.] 1978. AUREL, Marc A.: Selbstbetrachtungen. Stuttgart 1967. BAADER, Joseph: Nürnberger Polizeiordnungen. Aus dem XIII. bis XV. Jahrhundert. Amsterdam 1966. BAAL, Jan van: Reciprocity and the position of women. Anthropological Papers. Assen 1975. BAECKER, Dirk: Überlegungen zur Form des Gedächtnisses. In: SCHMIDT, Siegfried J. (Hg.): Gedächtnis. Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Frankfurt (Main) 1991, S. 337-359. BAECKER, Dirk: Soziale Hilfe als Funktionssystem der Gesellschaft. In: Zeitschrift für Soziologie 23 (1994), S. 93-110. BAECKER, Dirk: Die Unterscheidung zwischen Kommunikation und Bewußtsein. In: KROHN, Wolfgang / KÜPPERS, Günter: Emergenz. Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung. Frankfurt (Main) 1999, S. 217-268. BAECKER, Dirk: ‚Stellvertretende’ Inklusion durch ein ‚sekundäres’ Funktionssystem. Wie ‚sozial’ ist die soziale Hilfe? In: MERTEN, Roland (Hg.): Systemtheorie Sozialer Arbeit. Neue Ansätze und veränderte Perspektiven. Opladen 2000, S. 39-46. BAECKER, Dirk: Die Unterscheidung der Arbeit. In: HUBER, Jörg (Hg.): Kultur-Analysen. Zürich 2001, S. 175-196. BAECKER, Dirk: Die gesellschaftliche Form der Arbeit. In: BAECKER, Dirk (Hg.): Archäologie der Arbeit. Berlin 2002, S. 203-245. BAECKER, Dirk / BUDE, Heinz / HONNETH, Axel / WIESENTHAL, Helmut: ‚Die Überflüssigen’. Ein Gespräch. In: Mittelweg 36 (1998), S. 65-81. BALTHASAR, Hans Urs von: Aktion und Kontemplation. In: Geist und Leben 21 (1948), S. 361-370. BATTENBERG, Friedrich J.: Obrigkeitliche Sozialpolitik und Gesetzgebung. Einige Gedanken zu mittelrheinischen Almosenordnungen des 16. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für historische Forschung 18 (1991), S. 33-70. BECK, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt (Main) 1986. BECKER, Lawrence C.: Reciprocity. London / New York 1986. BERGER, Peter L. / LUCKMANN, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt (Main) 1970. 258 BERGMANN, Werner: Die Zeitstrukturen sozialer Systeme. Eine systemtheoretische Analyse. Berlin 1981. BITZER, Friedrich: Das Recht auf Armenunterstützung und die Freizügigkeit. Ein Beitrag zu der Frage des allgemeinen deutschen Heimathrechts. Stuttgart / Oehringen 1863. BLAU, Peter M.: Exchange and Power in Social Life. New York / London / Sidney 1964. BLAU, Peter M.: Interaction. Social Exchange. In: SILLS, David L. (Hg.): International Encyclopedia of Social Sciences. Bd. 7/8. Chicago [u.a.] 1972, S. 452-457. BLICKLE, Renate: Hausnotdurft. Ein Fundamentalrecht in der altständischen Ordnung Bayerns. In: BIRTSCH, Günter (Hg.): Grund- und Freiheitsrechte von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft. Göttingen 1987, S. 42-64. BLICKLE, Renate: Nahrung und Eigentum als Kategorien in der ständischen Gesellschaft. In: SCHULZE, Winfried: Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität. München 1988, S. 73-93. BLUNTSCHLI, Johann Kaspar: Allgemeines Staatsrecht, geschichtlich begründet. München 1852. BOHN, Cornelia: Habitus und Kontext. Ein kritischer Beitrag zur Sozialtheorie Pierre Bourdieus. Opladen 1991. BOHN, Cornelia: Inklusionsindividualität und Exklusionsindividualität. In: BOHN, Cornelia / WILLEMS, Herbert (Hg.): Sinngeneratoren. Fremd- und Selbstthematisierung in soziologischhistorischer Perspektive. Konstanz 2001, S. 159-176. BOHN, Cornelia: Individuen und Personen. In: HUBER, Jörg (Hg.): Person/Schauplatz. Zürich / New York 2003, S. 161-181. BOHN, Cornelia: Die Medien der Gesellschaft. In: JÄCKEL, Michael (Hg.): Mediensoziologie. Grundfragen und Forschungsfelder. Wiesbaden 2005, S. 365-374. BOHN, Cornelia: Eine Welt-Gesellschaft. Operative Gesellschaftskonzepte in den Sozialtheorien Luhmanns und Bourdieus. In: COLLIOT-THÉLÈNE, Catherine / FRANÇOIS, Etienne / GEBAUER, Günther (Hg.): Pierre Bourdieu: Deutsch-französisch Perspektiven. Frankfurt (Main) 2005, S. 43-78. BOHN, Cornelia: Inklusion, Exklusion und die Person. Konstanz 2006. BOHN, Cornelia: Literacy. In: HARRINGTON, Austin / MARSHALL, Barbara L / MÜLLER, HansPeter (Hg.): Encyclopedia of Social Theory. London [u.a.] 2006, S. 324-326. BOHN, Cornelia / HAHN, Alois: Pierre Bourdieu. In: KAESLER, Dirk (Hg.): Klassiker der Soziologie. Bd. II. Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu. München 1999, S. 252-271. BOHN, Cornelia / HAHN, Alois: Patterns of Inclusion and Exclusion. Property, Nation and Religion. In: Soziale Systeme 8 (2002), S. 8-26. BORSCHE, Tilmann: Individuum, Individualität. In: RITTER, Joachim / GRÜNDER, Karlfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 4. Stuttgart 1976 , Sp. 300-323. 259 BOSL, Karl: Potens und Pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zur gesellschaftlichen Differenzierung im frühen Mittelalter und zum ‚Pauperismus’ des Hochmittelalters. In: Alteuropa und die moderne Gesellschaft. Festschrift für Otto Brunner. Hamburg / Göttingen 1963, S. 60-87. BOURDIEU, Pierre: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt (Main) 1987. BOURDIEU, Pierre: Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Frankfurt (Main) 1997. BRANDT, Sebastian: Narrenschiff. Nach der Erstausgabe (Basel 1494) mit den Zusätzen der Ausgaben von 1495 und 1499 sowie den Holzschnitten der deutschen Originalausgaben. Tübingen 1968. BRISSON: Von dem Bettelstande in Frankreich. In: Abhandlungen und Beobachtungen durch die Ökonomische Gesellschaft Bern 10 (1769), S. 59-86. BRITTAN, Arthur: Meanings and Situations. London / Boston 1973. BRUNNER, Otto: Das Problem einer europäischen Sozialgeschichte. In: BRUNNER, Otto: Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. Göttingen 1968, S. 80-102. BRUNNER, Otto: Das „ganze Haus“ und die alteuropäische „Ökonomik“. In: BRUNNER, Otto: Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. Vorträge und Aufsätze. Göttingen 1968, S. 103-127. BUDE, Heinz: Die Überflüssigen als transversale Kategorie. In: BERGER, Peter A. / VESTER, Michael (Hg.): Alte Ungleichheiten – neue Spannungen. Opladen 1989, S. 363-383. BUHLE, Johann Gottlieb: Lehrbuch des Naturrechts. Brüssel 1969 [ND Göttingen, 1798]. BUSCHMANN, Nikolaus: Die Arbeitslosen und die Berufsorganisationen. Ein Beitrag zur Lösung der Arbeitslosen-Frage. Berlin 1897. CAILLÉ, Alain: Weder methodologischer Holismus noch methodologischer Individualismus – Marcel Mauss und das Paradigma der Gabe. In: MOEBIUS, Stephan / PAPILLOUD, Christian (Hg.): Gift – Marcel Mauss’ Kulturtheorie der Gabe. Wiesbaden 2006, S. 161-214. CASSIRER, Ernst: Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. Darmstadt 1969. CASTEL, Robert: Nicht Exklusion, sondern Desaffiliation. Ein Gespräch mit François Ewald. In: Das Argument 217 (1996), S. 775-780. CASTEL, Robert: Die Fallstricke des Exklusionsbegriffs. In: Mittelweg 36 (2000), S. 11-25. CASTEL, Robert: Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit. Konstanz 2000. CELLA, Johann Jakob: Freymüthige Gedanken über Landesverweisungen, Arbeitshäuser und Bettelschübe. Anspach 1784. 260 CONZE, Werner: Arbeit. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd.1. Stuttgart 1972, S. 154-215. CONZE, Werner: Beruf. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd.1. Stuttgart 1972, S. 490-507. DANCKERT, Werner: Die unehrlichen Leute. Die verfemten Berufe. Bern 1963. DARJES, Joachim G.: Erste Gründe der Kameralwissenschaften. Aalen 1969 [ND Leipzig, 1768]. DAVIS, Natalie Z.: Die schenkende Gesellschaft. Zur Kultur der französischen Renaissance. München 2002. DESCARTES, René: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Hamburg 1977. DILCHER, Gerhard: Bürger, Einwohner, Fremder. In: BADER, Karl S. / DILCHER, Gerhard (Hg.): Deutsche Rechtsgeschichte. Land und Stadt – Bürger und Bauer im alten Europa. Berlin [u.a.] 1999, S. 445-474. DINKEL, Christoph: Der Glaube als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. In: Soziale Systeme 7 (2001), S. 56-70. DOMINGO DE SOTO: Über die Regelung der Armenhilfe (1545). In: STROHM, Theodor / KLEIN, Michael (Hg.): Die Entstehung einer sozialen Ordnung Europas. Die Reformbemühungen der Frühen Neuzeit. 2 Bde. Heidelberg 2004, S. 340-399. DURKHEIM, Emile: Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt (Main) 1981. DURKHEIM, Emile: Die Regeln der soziologischen Methode. Frankfurt (Main) 1984. DURKHEIM, Emile: Über soziale Arbeitsteilung. Frankfurt (Main) 1988. EKEH, Peter P.: Social Exchange Theory. The Two Traditions. Cambridge 1974. ELIAS, Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Frankfurt (Main) 1979. ENGELS, Friedrich: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. In: Marx, Karl / Engels Friedrich: Werke. Bd. 20. Anti-Dühring. Dialektik der Natur. Berlin 1971, S. 444-455. FEHR, Ernst / GÄCHTER, Simon: Fairness and Retaliation. The Economics of Reciprocity. In: Journal of Economic Perspectives 14 (2000), S. 159-181. FERNÁNDEZ-SANTAMARÍA, José Antonio: The Foundations of Vives’ Social and Political Thought. In: MESTRE, Antonio (Hg.): Opera Omnia. Volumen Introductiorio. Valencia 1992, S. 217-262. FIRSCHING, Horst: Ist der Begriff ‚Gesellschaft’ theoretisch haltbar? Zur Problematik des Gesellschaftsbegriffs in Niklas Luhmanns ‚Die Gesellschaft der Gesellschaft’. In: Soziale Systeme 4 (1998), S. 163-173. 261 FISCHER, Thomas: Städtische Armut und Armenfürsorge im 15. und 16. Jahrhundert. Sozialgeschichtliche Untersuchungen am Beispiel der Städte Basel, Freiburg i. Br. und Straßburg. Göttingen 1979. FLEISCHMANN, Eugène: Claude Lévi-Strauss über den menschlichen Geist. In: LEPENIES, Wolfgang / RITTER, Hanns H. (Hg.): Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claude Lévi-Strauss. Frankfurt (Main) 1974, S. 77-109. FOERSTL, Johann Nepomuk: Das Almosen. Eine Untersuchung über die Grundsätze der Armenfürsorge in Mittelalter und Gegenwart. Paderborn 1909. FOUCAULT, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt (Main) 1971. FOUCAULT, Michel: Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin 1978. FOUCAULT, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt (Main) 1998. FRENZ, Barbara: Gleichheitsdenken in deutschen Städten des 12. bis 15. Jahrhunderts. Geistesgeschichte, Quellensprache, Gesellschaftsfunktion. Köln 2000. FUCHS, Peter: Die Erreichbarkeit der Gesellschaft. Zur Konstruktion und Imagination gesellschaftlicher Einheit. Frankfurt (Main) 1992. FUCHS, Peter: Adressabilität als Grundbegriff der soziologischen Systemtheorie. In: Soziale Systeme 3 (1997), S. 57-79. FUCHS, Peter: Weder Herd noch Heimstatt – Weder Fall noch Nichtfall. Die doppelte Differenz im Mittelalter und in der Moderne. In: Soziale Systeme 3 (1997), S. 413-437. FUHRMANN, M. / KIBLE, B. Th. / SCHERER, G. / SCHÜTT, H.-P. / SCHILD, W. / SCHERNER, M.: Person. In: RITTER, Joachim (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. VII. Basel / Stuttgart 1989, Sp. 269-338. FÜRSTENBERG, Friedrich: Randgruppen in der modernen Gesellschaft. In: Soziale Welt 16 (1965), S. 236-245. FÜRTH, Maria: Caritas und Humanitas. Zur Form und Wandlung des christlichen Liebesgedankens. Stuttgart 1933. GANS, Herbert: Positive Functions of the Undeserving Poor. Uses of the Underclass. In: Politics and Society 22 (1994), S. 269-283. GEREMEK, Bronislaw: Geschichte der Armut. Elend und Barmherzigkeit in Europa. München / Zürich 1988. GERHART, V.: Interesse. In: RITTER, Joachim / GRÜNDER, Karlfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 4. Basel / Stuttgart 1976, Sp. 479-494. 262 GESTRICH, Andreas / LUTZ, Raphael (Hg.): Inklusion / Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt (Main) 2004. GÖBEL, Markus / SCHMIDT, Johannes F.K.: Inklusion – Exklusion. Karriere, Probleme und Differenzierungen eines systemtheoretischen Begriffpaars. In: Soziale Systeme 4 (1998), S. 87-117. GOEDLIER, Maurice: Das Rätsel der Gabe. Geld, Geschenke, heilige Objekte. München 1999. GOULDNER, Alvin W.: The Norm of Reciprocity. In: American Sociological Review 25 (1960), S. 161-171. GRAUS, František: Randgruppen der städtischen Gesellschaft im Spätmittelalter. In: Zeitschrift für Historische Forschung 8 (1981), S. 385-437. GRAUS, František: Mentalität – Versuch einer Begriffsbestimmung. In: GRAUS, František (Hg.): Mentalitäten im Mittelalter. Methodische und inhaltliche Probleme. Sigmaringen 1987, S. 9-48. GRUBER, Johann Gottfried: Art. Bedürfniss. In: ERSCH, Johann Samuel / GRUBER, Johann Gottfried (Hg.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Sektion 1 A – G. Teil 8. Bas-Bednorf. Graz 1970 [ND Leipzig, 1822], S. 324-325. GRÜNFELD, Ernst: Die Peripheren. Ein Kapitel der Soziologie. Amsterdam 1939. GUNN, J. A. W.: ‚Interest will not lie’. A seventeenth-century political maxim. In: Journal of the History of Ideas 29 (1968), S. 551-564. HAHN, Alois: Soziologie der Paradiesvorstellungen. Trier 1976. HAHN, Alois: Basis und Überbau und das Problem der begrenzten Eigenständigkeit der Ideen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 31 (1979), S. 450-484. HAHN, Alois: Funktionale und stratifikatorische Differenzierung und ihre Rolle für die gepflegte Semantik. Zu Niklas Luhmann ‚Gesellschaftsstruktur und Semantik’. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 33 (1981), S. 345-360. HAHN, Alois: Identität und Selbstthematisierung. In: HAHN, Alois / KAPP, Volker: Selbstthematisierung und Selbstzeugnis. Bekenntnis und Gedächtnis. Frankfurt (Main) 1987, S. 9-24. HAHN, Alois: Sinn und Sinnlosigkeit. In: HAFERKAMP, Hans / SCHMID, Michael (Hg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt (Main) 1987, S. 155-164. HAHN, Alois: Verstehen bei Dilthey und Luhmann. In: Annali di Sociologia / Soziologisches Jahrbuch 8 (1992), S. 421-430. HAHN, Alois: Identität und Nation in Europa. In: Berliner Journal für Soziologie 3 (1992), S. 193-203. 263 HAHN, Alois: ‚Partizipative’ Identitäten. In: HAHN, Alois: Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte. Frankfurt (Main) 2000, S. 13-79. HAHN, Alois: Zur Soziologie der Beichte und anderer Formen institutionalisierter Bekenntnisse. Selbstthematisierung und Zivilisationsprozeß. In: HAHN, Alois: Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte. Aufsätze zur Kultursoziologie. Frankfurt (Main) 2000, S. 197-236. HAHN, Alois: Soziologische Aspekte des Fortschrittsglaubens. In: HAHN, Alois: Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte. Aufsätze zur Kultursoziologie. Frankfurt (Main) 2000, S. 315-334. HAHN, Alois: Theoretische Ansätze zu Inklusion und Exklusion. In: BOHN, Cornelia / HAHN, Alois (Hg.): Annali di Sociologia / Soziologisches Jahrbuch. Bd. 16 (2002/03). Berlin 2006, S. 67-88. HAMBURGER, Käte: Das Mitleid. Stuttgart 1985. HEDWIG, Klaus: Alter Ipse. Über die Rezeption eines Aristotelischen Begriffs bei Thomas von Aquin. In: Archiv für Geschichte der Philosophie 72 (1990), S. 253-274. HEGEL, Georg W. F.: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Frankfurt (Main) 1993. HEINRICHS, Johannes / STOCK, Konrad: Person. In: MÜLLER, Gerhard (Hg.): Theologische Realenzyklopädie. Bd. XXVI. Berlin / New York 1996, S. 220-231. HEITMEYER, Wilhelm (Hg.): Was treibt die Gesellschaft auseinander? Frankfurt (Main) 1997. HERGEMÖLLER, Bernd-Ulrich: Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Wege und Ziele der Forschung. In: HERGEMÖLLER, Bernd-Ulrich (Hg.): Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Ein Hand- und Studienbuch. Warendorf 2001, S. 1-57. HERKOMMER, Sebastian: Deklassiert, ausgeschlossen, chancenlos - die Überzähligen im globalisierten Kapitalismus. In: HERKOMMER, Sebastian (Hg.): Soziale Ausgrenzungen. Gesichter des neuen Kapitalismus. Hamburg 1999, S. 7-34. HIBST, Peter: Utilitas Publica – gemeiner Nutz – Gemeinwohl. Untersuchungen zur Idee eines politischen Leitbegriffs von der Antike bis zum späten Mittelalter. Frankfurt (Main) 1991. HILLMANN, Karl-Heinz: Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart 1994. HIPPEL, Wolfgang von: Armut, Unterschichten, Randgruppen in der Frühen Neuzeit. München 1995. HIRSCHMAN, Albert O.: Leidenschaften und Interessen. Politische Begründungen des Kapitalismus vor seinem Sieg. Frankfurt (Main) 1987. HOBBES, Thomas: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Frankfurt (Main) 2004. 264 HOFFMANN, Adolf: Zur Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen in der neueren protestantischen Theologie und bei Thomas von Aquin. In: SCHEFFCZYK, Leo (Hg.): Der Mensch als Bild Gottes. Darmstadt 1969, S. 292-327. HOFMANN, Jens. Die Figur des Peripheren. Darlegung einer analytischen Kategorie anhand der historischen Semantik des Bettlers. In: GESTRICH, Andreas / RAPHAEL, Lutz (Hg.): Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt (Main) [u.a.] 2001, S. 511-536. HOLL, Karl: Der Neubau der Sittlichkeit. In: HOLL, Karl: Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. Bd. 1. Luther. Tübingen 1921, S. 131-244. HOMANS, Georg C.: Social Behavior as Exchange. In: The American Journal of Sociology 63 (1958), S. 597-606. HOMANS, Georg C.: Fundamental Social Process. In: SMELSER, Neil J. (Hg.): Sociology. An Introduction. New York 1976, S. 27-78. HÖRMANN, Karl: Die Prägung des sittlichen Wollens durch das Objekt nach Thomas von Aquin. In: BÖCKLE, Franz / GRONER, Franz (Hg.): Moral zwischen Anspruch und Verantwortung. Festschrift für Werner Schöllgen. Düsseldorf 1964, S. 233-251. HUFTON, Olwen H.: The Poor of Eighteenth-Century France 1750-1789. Oxford 1974. HUMBOLDT, Wilhelm: Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. In: HUMBOLDT, Wilhelm: Werke in fünf Bänden (Hg. von Andreas Flitner und Klaus Giel). Bd. I. Schriften zur Anthropologie und Geschichte. Stuttgart 1960, S. 56-233. HUMBOLDT, Wilhelm: Theorie der Bildung. Bruchstück. In: HUMBOLDT, Wilhelm: Werke in fünf Bänden (Hg. von Andreas Flitner und Klaus Giel). Bd. I. Schriften zur Anthropologie und Geschichte. Stuttgart 1960, S. 234-240. INGLEHART, Ronald : Wertwandel in den westlichen Gesellschaften. Politische Konsequenzen von materialistischen und postmaterialistischen Prioritäten. In: KLAGES, Helmut / KMIECIAK, Peter (Hg.): Wertewandel und gesellschaftlicher Wandel. Frankfurt (Main) 1979, S. 279-316. JAMES, Susan: Passion and Action. The Emotions in Seventeenth-Century Philosophy. Oxford 1997. JELLINEK, Georg: Allgemeine Staatslehre. Bad Homburg [u.a.] 1966. JOHNSTON, Frederick S.: Fundamental Relationships and Their Logical Formulations. New York 1974. JUNG-STILLING, Johann Heinrich: Staats-Polizey-Wissenschaft. Frankfurt (Main) 1968 [ND Leipzig, 1788]. 265 JUSTI, Johann H. G. von: Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten, oder ausführliche Vorstellung der gesamten Policeywissenschaft. 2 Bde. Aalen 1965 [ND Königsberg / Leipzig, 1760 u. 1761]. JUSTI, Johann H. G.: Staatswirthschaft oder Systematische Abhandlung aller ökonomischen und Kameralwissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden. 2 Bde. Aalen 1963 [ND Leipzig, 1758]. JUSTI, Johann H. G. von: Natur und Wesen der Staaten. Als die Quelle aller Regierungswissenschaften und Gesetze. Aalen 1969 [ND Mittau, 1771]. JUSTI, Johann H. G. von: Grundsätze der Policeywissenschaft. Frankfurt (Main) 1969 [ND Göttingen, 1782]. JÜTTE, Robert: Arme, Bettler, Beutelschneider. Eine Sozialgeschichte der Armut in der Frühen Neuzeit. Weimar 2000. KÄRKKÄINEN, Veli-Matti: The Christian as Christ to the Neighbour. On Luther's Theology of Love. In: International Journal of Systematic Theology 6 (2004), S. 101–117. KARLSTADT, Andreas: Von abtuhung der Bylder / Vnd das keyn Betdler vnther den Christen seyn soll. In: SIMON, Karl (Hg.): Deutsche Flugschriften zur Reformation (1520-1525). Stuttgart 1980, S. 227-279. KARSTEDT, Susanne: Soziale Randgruppen und soziologische Theorie. In: BRUSTEN, Manfred / HOHMEIER, Jürgen (Hg.): Stigmatisierung I. Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen. Neuwied 1975, S. 169-196. KEHNEL, Annette: Der freiwillig Arme ist ein potentiell Reicher. Eine Unterscheidung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Armut. In: MELVILLE, Gert / KEHNEL, Annette (Hg.): In proposito paupertatis. Studien zum Armutsverständnis bei den mittelalterlichen Bettelorden. Münster 2001, S. 203-229. KERSTING, Wolfgang: Einleitung. Rehabilitierung der Klugheit. In: KERSTING, Wolfgang (Hg.): Klugheit. Weilerswist 2005, S. 7-11. KIESERLING, André: Kommunikation unter Anwesenden. Studien über Interaktionssysteme. Frankfurt (Main) 1999. KIM-WAWRZINEK, Uta: Bedürfnis. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 1. Stuttgart 1972, S. 440-466. KLAGES, Helmut: Wertorientierungen im Wandel. Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognosen. Frankfurt (Main) 1984. KLEIN, Hans-Dieter (Hg.): Der Begriff der Seele in der Philosophiegeschichte. Würzburg 2005. KLUGE, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin / New York 2002. 266 KNEER, Georg: Reflexive Beobachtung zweiter Ordnung. Zur Modernisierung gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen. In: GIEGEL, Hans-Joachim / SCHIMANK, Uwe (Hg.): Beobachter der Moderne. Beiträge zu Niklas Luhmanns ‚Die Gesellschaft der Gesellschaft’. Frankfurt (Main) 2003, S. 301-332. KNEER, Georg: Differenzierung bei Luhmann und Bourdieu. Ein Theorievergleich. In: NASSEHI, Armin / NOLLMANN, Gerd (Hg.): Bourdieu und Luhmann. Ein Theorievergleich. Frankfurt (Main) 2004, S. 25-56. KNEMEYER, Franz-Ludwig: Polizeibegriffe in den Gesetzen des 15. bis 18. Jh. In: Archiv des öffentlichen Rechts 92 (1967), S. 153-180. KNOX, John B.: The concept of exchange in sociological theory. In: Social Forces (1963), S. 341-346. KOBUSCH, Theo: Die Entdeckung der Person. Metaphysik der Freiheit und modernes Menschenbild. Darmstadt 1997. KOSELLECK, Reinhart: Einleitung. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhart (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 1. Stuttgart 1972, S. XIII-XXVII. KOSELLECK, Reinhart: Fortschritt. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhart (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 2. Stuttgart 1975, S. 351-424. KOSELLECK, Reinhart: Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte. In: KOSELLECK, Reinhart: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt (Main) 1989, S. 107-129. KOSELLECK, Reinhart: Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe. In: KOSELLECK, Reinhart: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt (Main) 1989, S. 211-259. KOSTER, Heinrich: Urstand, Fall und Erbsünde in der Scholastik. Freiburg / Basel / Wien 1979. KREMER, Klaus (Hg.): Seele. Ihre Wirklichkeit, ihr Verhältnis zum Leib und zur menschlichen Person. Leiden / Köln 1984. KRONAUER, Martin / NEEF, Reiner: ‚Exklusion’ und ‚soziale Ausgrenzung’. Neue soziale Spaltung in Frankreich und Deutschland. In: Deutsch-Französisches Institut (Hg.): FrankreichJahrbuch 1996. Opladen 1997, S. 35-58. KUHM, Klaus: Raum als Medium gesellschaftlicher Kommunikation. In: Soziale Systeme 6 (2000), S. 321-348. KUHN, Helmut: Ordnung im Werden und Zerfall. In: KUHN, Helmut / WIEDMANN, Franz (Hg.): Das Problem der Ordnung. Meisenheim am Glan 1962, S. 11-25. KUHN, Helmut: ‚Liebe’. Geschichte eines Begriffs. München 1975. KUHN, Thomas S.: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt (Main) 1981. 267 LANDMANN, Michael: Das Ende des Individuums. In: LANDMANN, Michael: Das Ende des Individuums. Anthropologische Skizzen. Stuttgart 1971, S. 115-126. LEE, Demetracopoulou D.: A Primitive System of Values. In: Philosophy of Science 7 (1940), S. 355-378. LEISERING, Lutz: Zwischen Verdrängung und Dramatisierung. Zur Wissenssoziologie der Armut in der bundesrepublikanischen Gesellschaft. In: Soziale Welt 44 (1993), S. 486-511. LEISERING, Lutz: ‚Exklusion’ – Elemente einer soziologischen Rekonstruktion. In: BÜCHEL, Felix (Hg.): Zwischen drinnen und draußen. Arbeitsmarktchancen und soziale Ausgrenzung in Deutschland. Opladen 1999, S. 11-22. LEISERING, Lutz: Desillusionierung des modernen Fortschrittglaubens. ‚Soziale Exklusion’ als gesellschaftliche Selbstbeschreibung und soziologisches Konzept. In: SCHWINN, Thomas (Hg.): Differenzierung und soziale Ungleichheit. Die zwei Soziologien und ihre Verknüpfung. Frankfurt (Main) 2004, S. 238-268. LENSKI, Gerhard: Macht und Privileg. Eine Theorie sozialer Schichtung. Frankfurt (Main) 1973. LERCH, Eugen: ‚Passion’ und ‚Gefühl’. In: Archivum Romanicum 22 (1938), S. 320-349. LEVINE, Donald N. / CARTER, Ellwood B. / GORMAN, Eleanor M.: Simmel’s Influence on American Sociology I. In: American Journal of Sociology 81 (1976), S. 813-843. LÉVI-STRAUSS, Claude: Einleitung in das Werk von Marcel Mauss. In: MAUS, Marcel: Soziologie und Anthropologie. Bd. I. Theorie der Magie, soziale Morphologie. Frankfurt (Main) / Berlin / Wien 1978, S. 7-41. LÉVI-STRAUSS, Claude: Sprache und Gesellschaft. In: LÉVI-STRAUSS, Claude: Strukturale Anthropologie I. Frankfurt (Main) 1991, S. 68-79. LÉVI-STRAUSS, Claude: Sprachwissenschaft und Anthropologie. In: LÉVI-STRAUSS, Claude: Strukturale Anthropologie I. Frankfurt (Main) 1991, S. 80-94. LÉVI-STRAUSS, Claude: Der Strukturbegriff in der Ethnologie. In: LÉVI-STRAUSS, Claude: Strukturale Anthropologie I. Frankfurt (Main) 1991, S. 299-346. LÉVI-STRAUSS, Claude: Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft. Frankfurt (Main) 1993. LINCK, Wenzel: Von Arbeit und Betteln. In: REINDELL, Wilhelm (Hg.): Wenzel Lincks Werke. Erste Hälfte. Eigene Schriften bis zur zweiten Nürnberger Wirksamkeit. Marburg 1894, S. 148-173. LITT, Theodor: Individuum und Gemeinschaft. Grundlegung der Kulturphilosophie. Leipzig 1926. LOCKE, John: Über den menschlichen Verstand. In vier Büchern. Bd. I: Buch I und II. Hamburg 1968. 268 LUHMANN, Niklas: Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen. In: OTTO, Hans-Uwe / SCHNEIDER, Siegfried: Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit. 1. Halbband. Neuwied / Berlin 1973, S. 21-43. LUHMANN, Niklas: Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart 1973. LUHMANN, Niklas: Funktion und Kausalität. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 1. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. Köln 1974, S. 9-30. LUHMANN, Niklas: Interaktion, Organisation, Gesellschaft. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 1975, S. 9-20. LUHMANN, Niklas: Einfache Sozialsysteme. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 1975, S. 21-38. LUHMANN, Niklas: Selbst-Thematisierung des Gesellschaftssystems. Über die Kategorie der Reflexion aus der Sicht der Systemtheorie. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 1975, S. 72-102. LUHMANN, Niklas: Weltzeit und Systemgeschichte. Über Beziehungen zwischen Zeithorizonten und sozialen Strukturen gesellschaftlicher Systeme. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 1975, S. 103-133. LUHMANN, Niklas: Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen 1975, S. 170-192. LUHMANN, Niklas: The Future Cannot Begin. Temporal Structures in Modern Society. In: Social Research 43 (1976), S. 130-152. LUHMANN, Niklas: Differentiation of Society. In: The Canadian Journal of Sociology 2 (1977), S. 29-52. LUHMANN, Niklas: Soziologie der Moral. In: LUHMANN, Niklas / PFÜRTNER, Stephan H. (Hg.): Theorietechnik und Moral. Frankfurt (Main) 1978, S. 8-116. LUHMANN, Niklas: Temporalization of Complexity. In: GEYER, Felix R. / ZOUWEN, Johannes van der (Hg.): Sociocybernetics. Bd. 2. Leiden 1978, S. 95-111. LUHMANN, Niklas: Gesellschaftliche Struktur und semantische Tradition. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Bd. 1. Frankfurt (Main) 1980, S. 9-72. LUHMANN, Niklas: Frühneuzeitliche Anthropologie. Theorietechnische Lösungen für ein Evolutionsproblem der Gesellschaft. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 1. Frankfurt (Main) 1980, S. 162-234. 269 LUHMANN, Niklas: Temporalisierung von Komplexität. Zur Semantik neuzeitlicher Zeitbegriffe. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie. Bd. 1. Frankfurt (Main) 1980, S. 235-300. LUHMANN, Niklas: Subjektive Rechte. Zum Umbau des Rechtsbewußtseins für die moderne Gesellschaft. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 2. Frankfurt (Main) 1981, S. 45-104. LUHMANN, Niklas: Wie ist soziale Ordnung möglich? In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie. Bd. 2. Frankfurt (Main) 1981, S. 195-285. LUHMANN, Niklas: Vorbemerkungen zu einer Theorie sozialer Systeme. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen 1981, S. 11-24. LUHMANN, Niklas: Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen 1981, S. 25-34. LUHMANN, Niklas: Erleben und Handeln. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen 1981, S. 67-80. LUHMANN, Niklas: Schematismen der Interaktion. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen 1981, S. 81-100. LUHMANN, Niklas: Geschichte als Prozeß und die Theorie sozio-kultureller Evolution. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Op- laden 1981, S. 178-197. LUHMANN, Niklas: Liebe als Passion. zur Codierung von Intimität. Frankfurt (Main) 1982. LUHMANN, Niklas: Sinn als Grundbegriff der Soziologie. In: HABERMAS, Jürgen / LUHMANN, Niklas: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Frankfurt (Main) 1982, S. 25-100. LUHMANN, Niklas: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt (Main) 1984. LUHMANN, Niklas: Die Differenzierung von Politik und Wirtschaft und ihre gesellschaftlichen Grundlagen. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen 1987, S. 32-48. LUHMANN, Niklas: Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen 1987, S. 67-73. LUHMANN, Niklas: Läßt unsere Gesellschaft Kommunikation mit Gott zu? In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen 1987, S. 227-235. 270 LUHMANN, Niklas: Brauchen wir einen neuen Mythos? In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen 1987, S. 254-274. LUHMANN, Niklas: The Evolutionary Differentiation between Society and Interaction. In: ALEXANDER, Jeffrey C. (Hg.): The Micro-Macro Link. Berkeley 1987, S. 112-131. LUHMANN, Niklas: Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt (Main) 1988. LUHMANN, Niklas: Warum AGIL? In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 40 (1988), S. 127-139. LUHMANN, Niklas: Staat und Staatsräson von traditionaler Herrschaft zu moderner Politik. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie. Bd. 3. Frankfurt (Main) 1989, S. 65-148. LUHMANN, Niklas: Individuum, Individualität, Individualismus. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie Bd. 3. Frankfurt (Main) 1989, S. 149-258. LUHMANN, Niklas: Die Ausdifferenzierung der Religion. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie moderner Gesellschaften. Bd. 3. Frankfurt (Main) 1989, S. 259-357. LUHMANN, Niklas: Ethik als Reflexionstheorie der Moral. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 3. Frankfurt (Main) 1989, S. 358-447. LUHMANN, Niklas: Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realität. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven. Opladen 1990, S. 31-58. LUHMANN, Niklas: Gleichzeitigkeit und Synchronisation. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven. Opladen 1990, S. 95-130. LUHMANN, Niklas: Anfang und Ende. Probleme einer Unterscheidung. In: LUHMANN, Niklas / SCHORR, Karl Eberhard (Hg.): Zwischen Anfang und Ende. Fragen an die Pädagogik. Frankfurt (Main) 1990, S. 11-23. LUHMANN, Niklas: Die Beschreibung der Zukunft. In: LUHMANN, Niklas: Beobachtungen der Moderne. Opladen 1992, S. 129-147. LUHMANN, Niklas: Wer kennt Wil Martens? Eine Anmerkung zum Problem der Emergenz sozialer Systeme. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 44 (1992), S. 139-142. LUHMANN, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt (Main) 1995. 271 LUHMANN, Niklas: Über Natur. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 4. Frankfurt (Main) 1995, S. 9-30. LUHMANN, Niklas: Kultur als historischer Begriff. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 4. Frankfurt (Main) 1995, S. 31-54. LUHMANN, Niklas: Die Behandlung von Irritationen. Abweichung oder Neuheit? In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie. Bd. 4. Frankfurt (Main) 1995, S. 55-100. LUHMANN, Niklas: Metamorphosen des Staates. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 4. Frankfurt (Main) 1995, S. 101-137. LUHMANN, Niklas: Jenseits von Barbarei. In: LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie. Bd. 4. Frankfurt (Main) 1995, S. 138-150. LUHMANN, Niklas: Die operative Geschlossenheit psychischer und sozialer Systeme. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. Opladen 1995, S. 25-36. LUHMANN, Niklas: Was ist Kommunikation? In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. Opladen 1995, S. 113-124. LUHMANN, Niklas: Die gesellschaftliche Differenzierung und das Individuum. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie des Menschen. Opladen 1995, S. 125-141. LUHMANN, Niklas: Die Form ‚Person’. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. Opladen 1995, S. 142-154. LUHMANN, Niklas: Inklusion und Exklusion. In: LUHMANN, Niklas: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. Opladen 1995, S. 237-265. LUHMANN, Niklas: Zeit und Gedächtnis. In: Soziale Systeme 2 (1996), S. 301-330. LUHMANN, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bde. Frankfurt (Main) 1997. LUHMANN, Niklas: Das Medium der Religion. Eine soziologische Betrachtung über Gott und die Seelen. In: Soziale Systeme 6 (2000), S. 39-51. LUHMANN, Niklas: Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt (Main) 2000. LUHMANN, Niklas: Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt (Main) 2000. LUHMANN, Niklas: Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg 2004. LUHMANN, Niklas / SCHORR, Karl Eberhard: Reflexionsprobleme im Erziehungssystem. Frankfurt (Main) 1988. LUTHER, Martin: An den christlichen Adel deutscher Nation. Von des christlichen Standes Besserung. Halle 1877. 272 LUTHER, Martin: Disputatio Heidelbergae habita (1518). In: KÖPF, Ulrich (Hg.): D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Bd. 1. Schriften der Jahre 151819. Weimar 1966 [ND Weimar, 1883], S. 353-374. LUTHER, Martin: Von weltlicher Oberkeyt, wie weyt man yhr gehorsam schuldig sei (1523). In: In: KÖPF, Ulrich (Hg.): D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Bd. 11. Nachtr. zu den Predigten und ungedr. Schriften des Jahres 1523. Weimar 1966 [ND Weimar, 1900], S. 245-281. LUTHER, Martin: Der 127. Psalm ausgelegt an die Christen zu Riga in Liefland (1524). In: KÖPF, Ulrich (Hg.): D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Bd. 15. Schriften und Predigten des Jahres 1524. Weimar 1966 [ND Weimar, 1899], S. 348-378. MACHIAVELLI, Nicollo: Der Fürst (Il Principe). Essen 2004. MAIER, Hans: Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre (Polizeiwissenschaft). Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Wissenschaft in Deutschland. Neuwied / Berlin 1966. MALINOWSKI, Bronislaw: Argonauten des westlichen Pazifiks. Ein Bericht über Unternehmungen und Abenteuer der Eingeborenen in den Inselwelten von Melanesisch-Neuguinea. Frankfurt (Main) 1979. MANDEVILLE, Bernard: Die Bienenfabel oder Private Laster, öffentliche Vorteile. Frankfurt (Main) 1968. MANNHEIM, Karl: Ideologie und Utopie. Frankfurt (Main) 1969. MARTENS, Wil: Die Autopoiesis sozialer Systeme. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 43 (1991), S. 625-646. MARTENS, Wil: Struktur, Semantik und Gedächtnis. Vorbemerkungen zur Evolutionstheorie. In: GIEGEL, Hans-Joachim / SCHIMANK, Uwe (Hg.): Beobachter der Moderne. Beiträge zu Niklas Luhmanns ‚Die Gesellschaft der Gesellschaft’. Frankfurt (Main) 2003, S. 167-203. MARTIN, Claude: French Review Article. The debate in France over ‚Social Exclusion’. In: Social Policy & Administration 30 (1996), S. 382-392. MARX, Karl: Werke. Bd. 23. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Bd. 1. Berlin 1972. MATTHES, Joachim (Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982. Frankfurt (Main) / New York 1982. MAUSS, Marcel: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Frankfurt (Main) 1990. MAYER, Hans: Bedürfnisse. In: WEBER, Adolf [u.a.] (Hg.): Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Bd. 2. Jena 1924, S. 450-456. 273 MAYNTZ, Renate: Funktionelle Teilsysteme in der Theorie sozialer Differenzierung. In: MAYNTZ, Renate / ROSEWITZ, Bernd / SCHIMANK, Uwe / STICHWEH, Rudolf (Hg.): Differenzierung und Verselbständigung. Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme. Frankfurt (Main) / New York 1988, S. 11-44. MCEVOY, James: Philia and Amicitia. The Philosophy of Friendship from Plato to Aquinas. In: Sewanee Medieval Colloquium Occasional Papers 2 (1985), S. 1-21. MEINECKE, Friedrich: Die Idee der Staatsräson in der neuren Geschichte. München 1924. MEINHARD, H. / HÜBENER, Wolfgang / DIERSE, Ulrich / STEINER, H.G.: Ordnung. In: RITTER, Joachim (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. VI. Darmstadt 1984, Sp. 1249-1309. MERLEAU-PONTY, Maurice: Von Mauss zu Claude Lévi-Strauss. In: MERLEAU-PONTY, Maurice: Das Auge und der Geist. Philosophische Essays. Hamburg 2003, S. 225-241. MERTON, Robert K.: Manifeste und latente Funktionen. In: MERTON, Robert K.: Soziologische Theorie und soziale Struktur. Berlin / New York 1995, S. 17-80. MIETH, Dietmar: Die Einheit von vita activa und vita contemplativa in den deutschen Predigten und Traktaten Meister Eckharts und Johannes Tauler. Untersuchungen zur Struktur des christlichen Lebens. Regensburg 1969. MÖHLENBRUCH, Rudolf: ‚Freier Zug, Ius Emigrandi, Auswanderungsfreiheit’. Eine verfassungsgeschichtliche Studie. Bonn 1977. MOLLAT, Michel: Die Armen im Mittelalter. München 1984. MONTAIGNE, Michel de: Von der Freundschaft. Wiesbaden 1960. MOOS, Peter von: Das Öffentliche und das Private im Mittelalter. Für einen kontrollierten Anachronismus. In: MELVILLE, Gert / MOOS, Peter von (Hg.): Das Öffentliche und das Private in der Vormoderne. Köln / Weimar / Wien 1998, S. 3-83. MOOS, Peter von: Die Begriffe ‚öffentlich’ und ‚privat’ in der Geschichte und bei den Historikern. In: Saeculum 49 (1998), S. 161-192. MOOS, Peter von: Vom Inklusionsindividuum zum Exklusionsindividuum. Persönliche Identität in Mittelalter und Moderne. In: BOHN, Cornelia / HAHN, Alois (Hg.): Annali di Sociologia / Soziologisches Jahrbuch. Bd. 16. 2002/03. Berlin 2006, S. 253-265. MÖSER, Justus: Gedanken über den Verfall der Handlung in den Landstädten. In: MÖSER, Justus: Patriotische Phantasien. Sämtliche Werke. Bd. 4. Oldenburg 1943, S. 15-28. MÜHLEN, Karl-Heinz zur: Die Affektlehre im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. In: Archiv für Begriffsgeschichte 35 (1992), S. 93-114. NASSEHI, Armin: Die Zeit der Gesellschaft. Auf dem Weg zu einer soziologischen Theorie der Zeit. Opladen 1993. 274 NASSEHI, Armin: Der Fremde als Vertrauter. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 47 (1995), S. 443-463. NASSEHI, Armin: Inklusion, Exklusion – Integration, Desintegration. Die Theorie funktionaler Differenzierung und die Desintegrationsthese. In: HEITMEYER, Wilhelm (Hg.): Was hält die Gesellschaft zusammen? Bundesrepublik Deutschland. Auf dem Weg von der Konsens- zur Konfliktgesellschaft. Bd. 2. Frankfurt (Main) 1997, S. 113-148. NASSEHI, Armin: Exklusion als soziologischer und sozialpolitischer Begriff? In: Mittelweg 36 (2000), S. 18-25. NASSEHI, Armin: Dichte Räume. Städte als Synchronisations- und Inklusionsmaschinen. In: LÖW, Martina (Hg.): Differenzierungen des Städtischen. Frankfurt (Main) 2002, S. 211-232. NASSEHI, Armin: Sozialer Sinn. In: NASSEHI, Armin / NOLLMANN, Gerd (Hg.): Bourdieu und Luhmann. Ein Theorievergleich. Frankfurt (Main) 2004, S. 155-188. NEUENDORFF, Hartmut: Der Begriff des Interesses. Eine Studie zu den Gesellschaftstheorien von Hobbes, Smith und Marx. Frankfurt (Main) 1973. NIETZSCHE, Friedrich: Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und keinen. Stuttgart 1969. NIPPEL, Wilfried: Erwerbsarbeit in der Antike. In: KOCKA, Jürgen / OFFE, Claus (Hg.): Geschichte und Zukunft der Arbeit. Frankfurt (Main) / New York 2000, S. 54-66. NITSCHKE, Peter: Von der Politeia zur Polizei. In: Zeitschrift für Historische Forschung 19 (1992), S. 1-27. OBRECHT, Georg: Fünff Unterschiedliche Secreta Politica von Anstellung / Erhaltung und Vermehrung guter Policey. Hildesheim / Zürich / New York 2003 [ND Straßburg, 1617]. OEXLE, Otto G.: Armut, Armutsbegriff und Armenfürsorge im Mittelalter. In: SACHßE, Christoph (Hg.): Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik. Frankfurt (Main) 1986, S. 73-100. OEXLE, Otto G.: Die funktionale Dreiteilung als Deutungsschema der sozialen Wirklichkeit in der ständischen Gesellschaft des Mittelalters. In: SCHULZE, Winfried: Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität. München 1988, S. 19-51. OEXLE, Otto. G.: Stand, Klasse. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 6. Stuttgart 1990, S. 155-200. OLDENDORP, Johann: Was billig und recht ist (Org.: Wat byllich unn recht ys 1529). Frankfurt (Main) 1948. OLDENDORP, Johann: Von Rathschlägen / Wie man gute Policey und Ordnung in Stedten und Landen erhalten möge. Glashütten im Taunus 1971 [ND Rostock, 1597]. 275 ORTH, Ernst Wolfgang / FISCH, Jörg / KOSELLECK, Reinhart: Interesse. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhart (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 3. Stuttgart 1982, S. 305-365. PANKOKE, Eckart: Von ‚guter Policey’ zu ‚socialer Politik’. ‚Wohlfahrt’, ‚Glückseligkeit’ und ‚Freiheit’ als Wertbindung aktiver Sozialstaatlichkeit. In: SACHßE, Christoph (Hg.): Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik. Frankfurt (Main) 1986, S. 148-177. PANNENBERG, Wolfhart: Gottebenbildlichkeit als Bestimmung des Menschen in der neueren Theologiegeschichte. München 1979. PANNENBERG, Wolfhart: Person und Subjekt. In: MARQUARD, Odo / STIERLE, Karlheinz (Hg.): Identität. München 1979, S. 407-422. PARSONS, Talcott: The Structure of Social Action. Glencoe 1961. PARSONS, Talcott: Social Interaction. In: SILLS, David L. (Hg.): International Encyclopedia of the Social Sciences. Bd. 7. New York 1968, S. 429-441. PARSONS, Talcott: Evolutionäre Universalien der Gesellschaft. In: ZAPF, Wolfgang (Hg.): Theorien des sozialen Wandels. Köln [u.a.] 1970, S. 55-74. PARSONS, Talcott: Das System moderner Gesellschaften. München 1972. PARSONS, Talcott: Zur Theorie sozialer Systeme. Opladen 1976. PARSONS, Talcott: Gesellschaften. Evolutionäre und komparative Perspektiven. Frankfurt (Main) 1986. PAULUS, Nikolaus: Die Wertung der weltlichen Berufe im Mittelalter. In: Historisches Jahrbuch 32 (1911), S. 723-755. PFEIFFER, Johann Friedrich: Bedürfnisse nach den Gesetzen der Policey erwogen. In: Teutsche Encyclopädie oder Allgemeines Realwörterbuch aller Künste und Wissenschaften. Bd. 3. Frankfurt (Main) 1781, S. 157-162. PFEIFFER, Johann Friedrich: Grundsätze der Universal-Kameral-Wissenschaft. Aalen 1970 [ND Frankfurt (Main), 1783]. PICHLER, Johannes W.: Necessitas. Ein Element des mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechts. Dargestellt am Beispiel österreichischer Rechtsquellen. Berlin 1983. RAMMSTEDT, Otthein: Alltagsbewußtsein von Zeit. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 27 (1975), S. 46-63. RAPHAEL, Lutz: Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart. München 2003. RIEDEL, Manfred: Gesellschaft, Gemeinschaft. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 2. Stuttgart 1979, S. 801-862. 276 RIEDEL, Manfred: System, Struktur. In: BRUNNER, Otto / CONZE, Werner / KOSELLECK, Reinhard (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 6. Stuttgart 1990, S. 285-322. ROECK, Bernd: Außenseiter, Randgruppen, Minderheiten. Fremde im Deutschland der frühen Neuzeit. Göttingen 1993. RÜGER, Willi: Mittelalterliches Almosenwesen. Die Almosenordnung der Reichsstadt Nürnberg. Nürnberg 1932. SACHßE, Christoph / TENNSTEDT, Florian : Vom Almosen zur frühmodernen Sozialpolitik. Armut und Armenfürsorge im Spätmittelalter. In: SACHßE, Christoph / TENNSTEDT, Florian: Bettler, Gauner und Proleten. Armenfürsorge in der deutschen Geschichte. Reinbeck b. Hamburg 1983, S. 34-48. SAHLINS, Marshall D.: On the Sociology of Primitive Exchange. In: BANTON, Michael (Hg.): The Relevance of Models for Social Anthropology. London 1965, S. 139-187. SCHEIDEMANTEL, Heinrich G.: Das allgemeine Staatsrecht überhaupt nach der Regierungsform. Jena 1979 [ND Jena, 1775]. SCHELER, Max: Probleme einer Soziologie des Wissens. In: SCHELER, Max: Die Wissensformen und die Gesellschaft. Bern 1960, S. 17-190. SCHELER, Max: Wesen und Formen der Sympathie. Bern / München 1973. SCHERNER, Karl Otto: Das Recht der Armen und Bettler im Ancien régime. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 96 (1979), S. 55-99. SCHERPNER, Hans: Theorie der Fürsorge. Göttingen 1962. SCHILLER, Friedrich: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? In: SCHILLER, Friedrich: Sämtliche Werke. Bd. 4. Historische Schriften. München 1968, S. 749-768. SCHIMANK, Uwe: Theorien gesellschaftlicher Differenzierung. Opladen 1996. SCHMAUSS, Johann J. / SENCKENBERG, Heinrich C. (Hg.): Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede […]. Tl. II. Frankfurt 1747. SCHOLZ, Heinrich: Eros und Caritas. Die platonische Liebe und die Liebe im Sinne des Christentums. Halle 1929. SCHOTT, Rüdiger: Das Geschichtsbewusstsein schriftloser Völker. In: Archiv für Begriffsgeschichte 12 (1968), S. 166-205. SCHUBERT, Ernst: Mobilität ohne Chance. Die Ausgrenzung des fahrenden Volkes. In: SCHULZE, Winfried (Hg.): Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität. München 1988, S. 113-164. SCHUBERT, Ernst: Gestalt und Gestaltwandel des Almosens im Mittelalter. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 52 (1992), S. 241-262. 277 SCHÜLEIN, Johann: Zur Konzeptualisierung des Sinnbegriffs. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 34 (1982), S. 649-664. SCHULZE, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt (Main) / New York 1996. SCHULZE, Peter: Die Krise des Spätmittelalters. Zur Evidenz eines sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Paradigmas in der Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts. In: Historische Zeitschrift 269 (1999), S. 19-55. SCHULZE, Winfried: Vom Gemeinnutz zum Eigennutz. Über den Normenwandel in der ständischen Gesellschaft der Frühen Neuzeit. In: Historische Zeitschrift 243 (1986), S. 591-626. SCHULZ VON THUN, Friedemann: Miteinander Reden 1. Störungen und Klärungen. Hamburg 1981. SCHÜTZ, Alfred: Zur Methodologie der Sozialwissenschaften. In: SCHÜTZ Alfred: Gesammelte Aufsätze I. Das Problem der sozialen Wirklichkeit. Den Haag 1971, S. 3-76. SCHWER, Wilhelm: Stand und Ständeordnung im Weltbild des Mittelalters. Die geistes- und gesellschaftsgeschichtlichen Grundlagen der berufsständischen Idee. Paderborn 1970. SECKENDORFF, Veit L. von: Deutscher Fürstenstaat. Aalen 1972 [ND Jena, 1737]. SILVER, Hilary: Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. In: International Labour Review 133 (1994), S. 531-578. SIMMEL, Georg: Über sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen. Amsterdam 1966. SIMMEL, Georg: Philosophie des Geldes. Berlin 1977. SIMMEL, Georg: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Frankfurt (Main) 1992. SIMON, Thomas: Gemeinwohltopik in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Politiktheorie. In: MÜNKLER, Herfried / BLUHM, Harald (Hg.): Gemeinwohl und Gemeinsinn. Historische Semantiken politischer Leitbegriffe. Berlin 2001, S. 129-146. SINGER, Irving: The Nature of Love. Bd. I. From Plato to Luther. Chicago / London 1984. SMITH, Adam: Theorie der ethischen Gefühle oder Versuch einer Analyse der Prinzipien, mittels welcher die Menschen naturgemäß zunächst das Verhalten und den Charakter ihrer Nächsten und sodann auch ihr eigenes Verhalten und ihren eigenen Charakter beurteilen. Leipzig 1926. SMITH, Adam: Eine Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Reichtums der Nationen. Bd. I. Berlin 1976. SOMBART, Werner: Vom Menschen. Versuch einer geistwissenschaftlichen Anthropologie. Berlin 1938. SONNENFELS, Joseph von: Politische Abhandlungen. Aalen 1964 [ND Wien, 1777]. 278 SPAEMANN, Robert: Reflexion und Spontaneität. Studien über Fénelon. Stuttgart 1990. SPÖRL, Johannes: Das Alte und das Neue im Mittelalter. Studien zum Problem des mittelalterlichen Fortschrittsbewußtseins. In: Historisches Jahrbuch 50 (1930), S. 297-341 u. S. 498-524. SPRANDEL, Rolf: Mentalitäten und Systeme. Neue Zugänge zur mittelalterlichen Geschichte. Stuttgart 1972. STÄHELI, Urs: Die Nachträglichkeit der Semantik. Zum Verhältnis von Sozialstruktur und Semantik. In: Soziale Systeme 4 (1998), S. 315-339. STEIN, Alois von der: Der Systembegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung. In: DIEMER, Alwin (Hg.): System und Klassifikation in Wissenschaft und Dokumentation. Meisenheim am Glan 1968, S. 1-13. STEGBAUER, Christian: Reziprozität. Einführung in soziale Formen der Gegenseitigkeit. Wiesbaden 2002. STERN-GILLET, Suzanne: Aristotle’s Philosophy of Friendship. New York 1995. STICHWEH, Rudolf: Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft. In: MAYNTZ, Renate / ROSEWITZ, Bernd / SCHIMANK, Uwe / STICHWEH, Rudolf: Differenzierung und Verselbständigung. Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme. Frankfurt (Main) / New York 1988, S. 261-293. STICHWEH, Rudolf: Soziologische Differenzierungstheorie als Theorie sozialen Wandels. In: MIETHKE, Jürgen / SCHREINER, Klaus (Hg.): Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen. Sigmaringen 1994, S. 29-44. STICHWEH, Rudolf: Der Fremde – Zur Soziologie der Indifferenz. In: MÜNKLER, Herfried (Hg.): Furcht und Faszination. Facetten der Fremdheit. Berlin 1997, S. 45-65. STICHWEH, Rudolf: Die Weltgesellschaft. Frankfurt (Main) 2000. STICHWEH, Rudolf: Semantik und Sozialstruktur. Zur Logik einer systemtheoretischen Unterscheidung. In: Soziale Systeme 6 (2000), S. 237-250. STICHWEH, Rudolf: Fremde im Europa der frühen Neuzeit. In: BOHN, Cornelia / WILLEMS, Herbert (Hg.): Sinngeneratoren. Fremd- und Selbstthematisierung in soziologisch-historischer Perspektive. Konstanz 2001, S. 17-33. STICHWEH, Rudolf: Raum und moderne Gesellschaft. Aspekte der sozialen Kontrolle des Raums. In: KRÄMER-BADONI, Thomas / KUHM, Klaus (Hg.): Die Gesellschaft und ihr Raum. Raum als Gegenstand der Soziologie. Opladen 2003, S. 93-102. STICHWEH, Rudolf: Zum Verhältnis von Differenzierungstheorie und Ungleichheitsforschung. Am Beispiel der Systemtheorie der Exklusion. In: SCHWINN, Thomas (Hg.): Differenzierung und soziale Ungleichheit. Die zwei Soziologien und ihre Verknüpfung. Frankfurt (Main) 2004, S. 353-367. 279 STICHWEH, Rudolf: Inklusion/Exklusion und die Soziologie des Fremden. In: STICHWEH, Rudolf: Inklusion und Exklusion. Studien zur Gesellschaftstheorie. Bielfeld 2005, S. 133-143. STICHWEH, Rudolf: Inklusion und Exklusion. Studien zur Gesellschaftstheorie. Bielefeld 2005. STÜRNER, Wolfgang: Peccatum und potestas. Der Sündenfall und die Entstehung der herrscherlichen Gewalt im mittelalterlichen Staatsdenken. Sigmaringen 1987. SZÖLLÖSI-JANZE, Margit: Notdurft – Bedürfnis. Historische Dimensionen eines Begriffswandels. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48 (1997), S. 653-674. TELLENBACH, Gerd: Mentalität. In: HASSINGER, Erich / MÜLLER, Heinz J. / OTT, Hugo (Hg.): Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft. Festschrift für Clemens Bauer zum 75. Geburtstag. Berlin 1978, S. 11-30. TENBRUCK: Die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft. Der Fall der Moderne. Opladen 1989. THIEME, Hans: Die Rechtsstellung der Fremden in Deutschland vom 11. bis zum 18. Jahrhundert. In: THIEME, Hans: Ideengeschichte und Rechtsgeschichte. Bd. 1. Köln 1986, S. 289-304. THOMAS, William I.: Person und Sozialverhalten. Neuwied / Berlin 1965. THURNWALD, Richard C.: Gegenseitigkeit im Aufbau und Funktionieren der Gesellungen und deren Institutionen. In: ALBRECHT, Gerhard / JURKAT, Ernst (Hg.): Reine und angewandte Soziologie. Eine Festgabe für Ferdinand Tönnies zu seinem achtzigen Geburtstage am 26. Juli 1935. Leipzig 1936, S. 275-297. TIERNEY, Brian: Medieval Poor Law. A Sketch of Canonical Theory and Its Application in England. Berkely / Los Angeles 1959. TÖPFER, Bernhard: Urzustand und Sündenfall in der mittelalterlichen Gesellschafts- und Staatstheorie. Stuttgart 1999. TREML, Alfred K.: Einführung in die Allgemeine Pädagogik. Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1987. TYRELL, Hartmann: Zur Diversität der Differenzierungstheorie. Soziologiehistorische Anmerkungen. In: Soziale Systeme 4 (1998), S. 119-149. VANDERSTRAETEN, Raf: Parsons, Luhmann and the Theorem of Double Contingency. In: Journal of Classical Sociology 2 (2002), S. 77-92. VIERHAUS, Rudolf: Zum Problem historischer Krisen. In: FABER, Karl Georg / WEBER, Christian (Hg.): Historische Prozesse. München 1978, S. 313-329. VIVES, Juan Luis: Von der Gemeynschaft aller Dingen (übers. von Jacob Kammerlandern). Strassburg 1536. 280 VIVES, Juan Luis: Über die Unterstützung der Armen – De subventionem pauperum für die Stadt Brügge (1526). In: STROHM, Theodor / KLEIN, Michael (Hg.): Die Entstehung einer sozialen Ordnung Europas. Historische Studien und exemplarische Beiträge zur Sozialreform im 16. Jahrhundert. Bd. 1. Heidelberg 2004, S. 282-339. VOß, Andreas: Betteln und Spenden. Eine soziologische Studie über Rituale freiwilliger Armenunterstützung, ihre historischen und aktuellen Formen sowie ihre sozialen Leistungen. Berlin / New York 1993. WALD, Berthold: „Rationalis naturae individua substantia“. Aristoteles, Boethius und der Begriff der Person im Mittelalter. In: AERTSEN, Jan A. / SPEER, Andreas (Hg.): Individuum und Individualität im Mittelalter. Berlin / New York 1996, S. 371-388. WALTZ, Matthias: Tauschsysteme als subjektivierende Ordnungen. Mauss, Lévi-Straus, Lacan. In: MOEBIUS, Stephan / PAPILLOUD, Christian (Hg.): Gift – Marcel Mauss’ Kulturtheorie der Gabe. Wiesbaden 2006, S. 81-105. WEBER, Max: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. I. Tübingen 1972. WEBER, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Tübingen 1980. WELSCH, Wolfgang: Unsere postmoderne Moderne. Weinheim 1987. WELTY, Eberhard: Vom Sinn und Wert der menschlichen Arbeit. Aus der Gedankenwelt des hl. Thomas von Aquin. Heidelberg 1946. WENDORFF, Rudolf: Zeit und Kultur. Geschichte des Zeitbewußtseins in Europa. Opladen 1980. WIEDEMANN, Konrad: Arbeit und Bürgertum. Die Entwicklung des Arbeitsbegriffs in der Literatur Deutschlands an der Wende der Neuzeit. Heidelberg 1979. WOLFF, Christian von: Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen. Frankfurt (Main) 1971 [ND Halle, 1721]. WOLFF, Christian: Grundsätze des Natur- und Völkerrechts worin alle Verbindlichkeiten und alle Rechte aus der Natur des Menschen in einem beständigen Zusammenhange hergeleitet werden. Königstein/Ts. 1980 [ND Halle, 1754]. ZIMMERMANN, Bénédicte: Arbeitslosigkeit in Deutschland. Zur Entstehung einer sozialen Kategorie. Frankfurt (Main) / New York 2006. 281