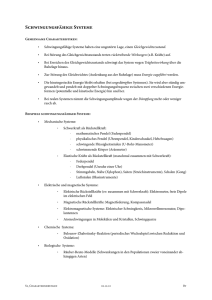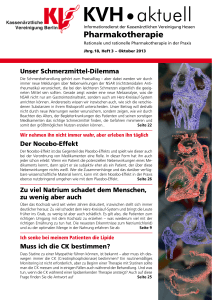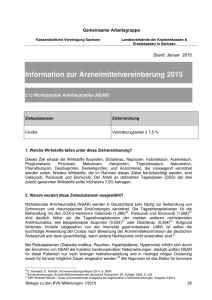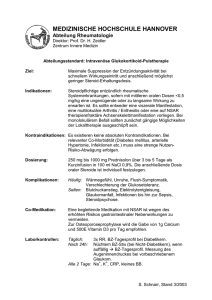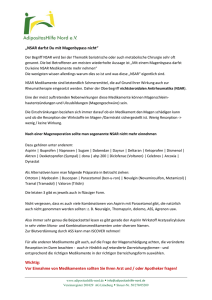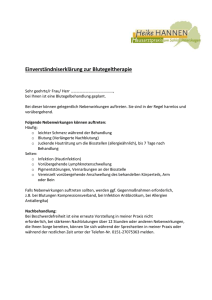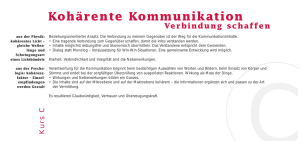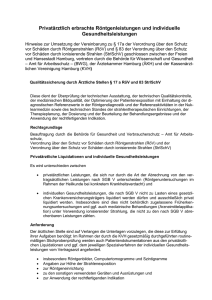KVH•aktuell - Kassenärztliche Vereinigung Sachsen
Werbung

KVH • aktuell Pharmakotherapie Rationale und rationelle Pharmakotherapie in der Praxis Gestaltet von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen Jhrg. 18, Nr. 3 – September 2013 Unser Schmerzmittel-Dilemma Die Schmerzbehandlung gehört zum Praxisalltag – aber dabei werden wir durch immer neue Meldungen über Nebenwirkungen der NSAR (nichtsteroidalen Antirheumatika) verunsichert, die bei den leichteren Schmerzen eigentlich die geeigneten Mittel sein sollten. Gerade zeigt wieder eine neue Metaanalyse, was die NSAR nicht nur am Gastroíntestinaltrakt, sondern auch am Herz-Kreislauf-System anrichten können. Andererseits wissen wir inzwischen auch, wie sich die verschiedenen Substanzen in ihrem Risikoprofil unterscheiden. Unser Beitrag will deshalb nicht durch neue Warnungen weiter verunsichern, sondern zeigen, wie wir durch Beachten des Alters, der Begleiterkrankungen des Patienten und seinen sonstigen Medikamenten das richtige Schmerzmittel finden, die Gefahren minimieren und somit den größtmöglichen Nutzen erzielen können.. Seite 22 Wir nehmen ihn nicht immer wahr, aber erleben ihn täglich Der Nocebo-Effekt Der Nocebo-Effekt ist das Gegenteil des Placebo-Effekts und spielt wie dieser auch bei der Verordnung von Medikamenten eine Rolle. In dieser Form hat ihn auch jeder schon erlebt: Wenn ein Patient die potenziellen Nebenwirkungen eines Medikaments kennt, dann spürt er sie subjektiv eher als ein Patient, der über diese Nebenwirkungen nichts weiß. Wer die Zusammenhänge und das darüber verfügbare wissenschaftliche Material kennt, kann mit dem Nocebo-Effekt in der Praxis ebenso nutzbringend umgehen wie mit dem Placebo-Effekt. Seite 26 Zu viel Natrium schadet dem Menschen, zu wenig aber auch Über das Kochsalz wird seit vielen Jahren diskutiert, inzwischen stellt sich immer deutlicher heraus: Zu viel schadet dem Herz-Kreislauf-System und bringt die Leute früher ins Grab, zu wenig ist aber auch schädlich. Es gilt also, die Patienten zum richtigen Umgang mit dem Kochsalz zu erziehen – was wiederum viel mit der richtigen Ernährung zu tun hat. Die neuesten Erkenntnisse zum Natrium(chlorid) und zu der optimalen Menge in der Nahrung erfahren Sie ab Seite 9 Ich senke bei meinem Patienten die Lipide Muss ich die CK bestimmen? Dass Statine zu einer Myopathie führen können, ist bekannt – aber muss ich deswegen immer die CK (Creatinphosphokinase) bestimmen? Ein routinemäßiges Monitoring ist nicht erforderlich, aber zu Beginn einer Therapie mit Statinen sollte man die CK messen und in einigen Fällen auch während der Behandlung. Und was tun, wenn die CK während einer lipidsenkenden Therapie ansteigt? Auch auf diese Frage finden Sie die Antwort auf Seite 25 Seite 2 Editorial KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 Erneute Masernausbrüche in Deutschland: Was ist zu tun? Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, Deutschland hat sich gegenüber der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verpflichtet, die Masern bis zum Jahr 2015 zu eliminieren. Voraussetzung dafür ist, dass wir eine Inzidenz von weniger als einem Fall pro Jahr und 1.000.000 Einwohner erreichen. Wenn uns das gelingt, können wir wesentlich dazu beitragen, dass es in Europa künftig keine Masernerkrankungen mehr geben wird. Deutschland wird das WHO-Ziel in diesem Jahr allerdings erneut deutlich verfehlen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden bis zum 17. Juni 2013 bereits 905 Fälle gemeldet. Die meisten stammen aus Bayern und Berlin. Fast die Hälfte der Patienten war 20 Jahre und älter. Die Mehrzahl war ungeimpft. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat im Epidemiologischen Bulletin vom 23. April 2013 darauf hingewiesen, dass in den letzten Jahren relativ viele Säuglinge und Kleinkinder unter zwei Jahren an Masern erkrankt sind und verweist auf eine Auswertung der Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen, nach der die zweite Masern-Mumps-Röteln-Impfung häufig nicht rechtzeitig (spätestens im 23. Lebensmonat) erfolgt. Sachsen-Anhalt liegt mit seiner Impfquote für die Zweitimpfung bei Kindern bis zu zwei Jahren von etwa 60 Prozent leicht unter dem Bundesdurchschnitt aller Kassenärztlichen Vereinigungen. Zusammen mit der Impfquote für die erste Impfung, die leicht über dem Bundesdurchschnitt liegt, finden wir uns im Vergleich aller Kassenärztlichen Vereinigungen im Mittelfeld wieder. Laut STIKO haben zudem viele junge Erwachsene keine Masernimmunität. Sie weist daher nachdrücklich auf die Wichtigkeit einer konsequenten Umsetzung der STIKO-Empfehlungen zur Impfung gegen Masern hin. Der Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) hat aufgrund der erneuten Erkrankungsfälle eine Masernimpfpflicht für Kinder ins Gespräch gebracht, will aber zunächst die Aufklärung der Bevölkerung verbessern und verstärken. In einer Stellungnahme hat Dipl.-Med. Regina Feldmann, Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), erklärt, zuerst den Weg über Maßnahmen zur Verbesserung der Impfraten zu gehen. Sie hat speziell die Kinderärzte aufgefordert, stringenter auf die korrekte Durchführung der empfohlenen Impfung zu achten. Ärzte sollen bei Jugendlichen, die in der Kindheit nicht zweimalig gegen Masern geimpft wurden, die zweite Impfung als Masern-Mumps-Röteln (MMR)-Impfung nachholen. Weiterhin empfahl sie den Ärzten, den Patienten in persönlichen Gesprächen aufzuzeigen, dass es schon häufig zu schweren Erkrankungen gekommen ist, weil nicht geimpft wurde. Auch stehe die Wahrscheinlichkeit leichter, kurzzeitiger Nebenwirkungen einer Impfung in keinem Verhältnis zur Erkrankungshäufigkeit wegen eines fehlenden Impfschutzes. Ich teile diese Auffassung und bitte Sie, auch weiterhin bei Ihren Patienten bestehende Impflücken zu schließen. Achten Sie auch darauf, dass alle nach 1970 geborenen Erwachsenen zwei dokumentierte MMR-Impfungen haben. Sind sie entweder ungeimpft, haben in der Kindheit nur eine Impfung bekommen oder ist der Impfstatus unklar, dann sollten sie eine einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff erhalten. Damit unterstützen Sie auch das in Sachsen-Anhalt vereinbarte Gesundheitsziel des Erreichens eines altersgerechten Impfstatus bei über 90 Prozent der Bevölkerung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit. Ihr Burkhard John Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Seite 3 Editorial 2 Deutschland wieder Jodmangelgebiet? Dr. med. Wolfgang LangHeinrich 4 Zum Austausch von Levothyroxin-Präparaten 4 Kalium-Mangel gefährdet viele Funktionen im Körper Dr. med. Klaus Ehrenthal 7 CSE-Hemmer und Diabetes mellitus Typ II 8 Zu viel Kochsalz schadet dem Menschen, zu wenig aber auch Dr. med. Klaus Ehrenthal 9 Therapie der Hepatitis C: Was bringen die neuen Substanzen? Dr. med. Margareta Frank-Doss 14 Cilostazol/Pletal®: Europäische Arzneimittelagentur schränkt Indikation ein 18 Anwendung von Protelos® bei der Osteoporose eingeschränkt 18 Sicherheitsrisiken bei der Behandlung mit Flupirtin 19 Inhaltsverzeichnis Schwierige Einschätzung des Blutungsrisikos bei antikoagulierten Patienten 20 Dr. med. Klaus Ehrenthal Das Schmerzmitteldilemma Dr. med. Joachim Seffrin 22 Diclofenac bei Herzinsuffizienz kontraindiziert! 24 CK-Bestimmung bei Therapie mit Lipidsenkern 25 Der Nocebo-Effekt 26 Erfahrungen unserer Leser: Wenn Metformin versagt, NPH-Insulin dazugeben!29 Antikoagulation: Auch an Cumarin mit Selbstkontrolle denken! 30 Sicherer verordnen Dr. med. Günther Hopf Tetrazepam: schwere Hautreaktionen, Zulassung ruht Methotrexat: genaue Anwendungsempfehlungen erforderlich Donepezil: malignes neuroleptisches Syndrom Kontrastmittelinduzierte Nephropathie Kontrastmittel und Nierenfunktion Protonenpumpenhemmer zur Prophylaxe Agomelatin: zu viele UAW NSAR – UAW auf Dünn- und Dickdarm Glukokortikoide: wenig Erfolg beim Tennisellenbogen Neue Arzneistoffe 2012: kritische Einschätzungen Ein schwarzes Dreieck ... Auch Patienten können jetzt Nebenwirkungen melden 31 Leitlinie Multimedikation, Teil 3 36 Tischversion der Leitlinie Multimedikation, Teil 2 43 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35 35 Impressum Verlag: XtraDoc Verlag Dr. med. Bernhard Wiedemann, Winzerstraße 9, 65207 Wiesbaden Herausgeber und verantwortlich für die Inhalte: Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Georg-Voigt-Straße 15, 60325 Frankfurt (www.kvhessen.de) Redaktionsstab: Dr. med. Joachim Fessler (verantw.), Dr. med. Christian Albrecht, Dr. med. Klaus Ehrenthal, Dr. med. Margareta Frank-Doss, Dr. med. Jan Geldmacher, Dr. med. Harald Herholz, Klaus Hollmann, Dr. med. Günter Hopf, Dr. med. Wolfgang LangHeinrich, Dr. med. Alexander Liesenfeld, Dr. med. Uwe Popert, Karl Matthias Roth, Dr. med. Joachim Seffrin, Dr. med. Gert Vetter, Dr. med. Michael Viapiano, Petra Bendrich, Dr. med. Jutta Witzke-Gross. Fax Redaktion: 069 / 79502 501 Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. med. Ferdinand Gerlach, Institut für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt; Prof. Dr. med. Sebastian Harder, Institut für klinische Pharmakologie der Universität Frankfurt Die von Mitgliedern der Redaktion oder des Beirats gekennzeichneten Berichte und Kommentare sind redaktionseigene Beiträge; darin zum Ausdruck gebrachte Meinungen entsprechen der Auffassung des Herausgebers. Mit anderen als redaktionseignen Signa oder mit Verfassernamen gekennzeichnete Beiträge geben die Auffassung der Verfasser wieder und decken sich nicht zwangsläufig mit der Auffassung des Herausgebers. Sie dienen der umfassenden Meinungsbildung. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Veröffentlichung berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- oder Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Wie alle anderen Wissenschaften sind Medizin und Pharmazie ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere, was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in dieser Broschüre eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Autor und Herausgeber große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angaben dem Wissensstand bei Fertigstellung der Broschüre entsprechen. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Herausgeber jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Seite 4 Kurze Meldung KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 Deutschland wieder Jodmangelgebiet? Jodversorgung in Deutschland wird immer schlechter! Dr. med. Wolfgang LangHeinrich Schon mildes Defizit beeinträchtigt Hirnentwicklung. Kinder nehmen offenbar nur wenig Jod auf. Der Gastbeitrag Nachdruck aus arznei-telegramm 6/2013 (a-t 2013; 44: 51-52) mit freundlicher Genehmigung der Redaktion und des Verlages des arznei-telegramms. Ohne Jod stirbt der Mensch. Jod ist Bestandteil des Schilddrüsenhormons und steuert neben der Reifung des Gehirns der Föten im Mutterleib auch bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wesentliche Herz-, Kreislauf- und Verdauungsfunktionen. Untersuchungen aus Großbritannien haben gezeigt, dass schon ein mildes bis mäßiges Joddefizit der werdenden Mutter zu einer beeinträchtigten Hirnentwicklung der Föten führen kann. Diese Kinder weisen später im Alter von 8 bis 9 Jahren einen deutlich niedrigeren Intelligenzquotienten sowie einen kognitiven Rückstand gegenüber Kindern mit guter Jodversorgung in der Schwangerschaft auf. Dies wird auf eine verschlechterte Jodversorgung der Menschen in Großbritannien zurückgeführt, was auch in Deutschland feststellbar ist. Weil Jod unverzichtbar ist und als Spurenelement immer weniger im Deutschlands Böden vorkommt, wird es seit Jahrzehnten den meisten Speisesalzen zugesetzt und dies stellt neben Milchund Fleischprodukten die Hauptjodquelle dar. Offensichtlich aus regulatorischen und Kostengründen wird zunehmend auf den Einsatz von jodhaltigem Salz bei der Lebensmittelherstellung verzichtet. Nach den Richtwerten sollen Säuglinge 40 bis 80 µg Jod/Tag, Kleinkinder und Jugendliche zwischen 100 und 200 µg Jod/Tag, Erwachsene 200 µg Jod/Tag, Schwangere 230 µg Jod/Tag und stillende Mütter 260 µg Jod/Tag aufnehmen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Jodausscheidung sollte im Durchschnitt ca. 120 µg/Tag betragen. Bei 6- bis 12-jährigen Kindern war dies 2004 bis 2006 im Durchschnitt nur 86 µg/Tag und 2009 mit 80 µg/Tag noch einmal weniger. Dies deutet eindeutig darauf hin, dass die Jodzufuhr zumindest nur im untersten Normbereich, teilweise deutlich darunter liegt, mit zunehmender Tendenz. In diesem Zusammenhang stellt sich erneut die Frage, warum Deutschland als Jodmangelland nicht, wie viele andere Länder mit vergleichbarer Problematik, Jod dem Trinkwasser zusetzt. Zum Austausch von Levothyroxin-Präparaten In a-t 2013; 44: 44-5 fassen wir den Kenntnisstand zur Umstellung von Anti­ epileptika-Originalen auf Nachfolgeprä­parate zusammen. Besonders umstritten ist der Wechsel auf und zwischen Generika auch beim Schild­drüsenhormon Levothyroxin (EUTHYROX, Generika). Le­vothyroxin gilt vielfach als Mittel mit enger therapeutischer Breite, [1] wenngleich nicht im Sinne akuter Toxizität bei gerin­ger Dosiserhöhung.[2] Aus Studien zu den Folgen einer subkli­nischen Schilddrüsendysfunktion, definiert als erhöhtes oder erniedrigtes thyreotropes Hormon (TSH) bei normalen Schilddrüsenhormonspiegeln, ergeben sich aber Hinweise, dass geringe Dosisänderungen langfristig relevante klinische Konsequenzen haben können. [3,4] Über- oder Unterbehandlung kann mit negativen Effekten etwa auf Wachstum und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Knochenmeta­bolismus oder kardiovaskuläre Funktion einhergehen. [1] Eine sorgfaltige Dosistitrierung wird Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell empfohlen, [3] insbesondere im Rahmen der Therapie von Patienten mit Schilddrüsenkarzinom, bei älteren Patienten – vor allem mit vorbestehenden kardiovaskulären Erkrankungen – Kindern oder Schwangeren. [2,5,6] Um die Schwierigkeiten zu überwinden, die durch die un­terschiedlichen Spiegel des vom zugeführten Levothyroxin nicht unterscheidbaren endogenen Schilddrüsenhormons be­dingt sind, wird die Bioäquivalenz heute mit einer suprathe­rapeutischen Dosis von 600 µg bei gesunden Freiwillligen ge­prüft, bei einem Äquivalenzbereich von 80% bis 125% (vgl. a-t 2013; 44: 44-5). [2,7] Dieses Vorgehen wird besonders von Markenherstellern und den von ihnen unterstützten Mei­nungsbildnern seit Jahren als zu insensitiv kritisiert. Die im Gegenzug vorgeschlagene Bioäquivalenzprüfung bei athyreoten Patienten mit der TSH-Konzentration als Messparameter wird von den Behörden nicht akzeptiert, vor allem wegen der hohen Variabilität des TSH-Spiegels, der vielen Einflüssen unterliegt. [8] Daten zu den klinischen Folgen des Wechsels von Levothyroxinoriginalen auf Generika oder zwischen verschiede­nen Generika sind außerordentlich spärlich. Eine 2010 publi­zierte Umfrage von zwei amerikanischen endokrinologischen Gesellschaften und der internationalen Endocrine Society, die alle vom Markenanbieter Abbott unterstützt werden, er­gibt 199 Verdachtsberichte über unerwünschte Effekte in Zu­sammenhang mit einer Änderung des TSH-Spiegels, von de­nen 89% nach einem Präparatewechsel aufgetreten sind. [5] Die Aussagekraft dieser Umfrage ist allerdings zweifelhaft: Da die Autoren im Kopf des Fragebogens bereits mögliche Probleme mit der Austauschbarkeit von Levothyroxinpräparaten the­matisieren, [10] ist nicht von einem repräsentativen und unverzerrten Rücklauf auszugehen, der zudem offenbar weniger als 10% beträgt. In einer Anfang dieses Jahres veröffentlichten offenen randomisierten Cross-over-Studie mit 31 hypothyreoten Kindern wird das US-amerikanische Markenpräparat SYNTHROID mit einem Generikum verglichen, das laut Zu­lassung mit SYNTHROID bioäquivalent ist. Unter der achtwöchigen Einnahme des Generikums liegen die TSH-Werte signifikant höher als unter dem Markenpräparat (im Median 1,8 mU/l versus 0,7 mU/l). Der Unterschied betrifft nur die Kinder mit kongenitaler Hypothyreose. Bei der Mehrzahl lie­gen die TSH-Werte jedoch auch unter dem Generikum im Referenzbereich. Von den drei klaren „Ausreißern“ (TSH 9,4 mU/1 bis 17,8 mU/1) unter dem Nachfolgepräparat sind zudem zwei wegen Non-Compliance nicht interpretierbar. Die Autoren schließen dennoch aus den Ergebnissen, dass die beiden Präparate bei kongenitaler Hypothyreose nicht bioäquivalent sind und raten zur Vorsicht vor dem Austausch auch bei anderen gefährdeten Patientengruppen. [11] Bioäquivalenzstudien zu den in Deutschland verfügbaren Levothyroxingenerika wurden mehrheitlich, aber nicht durchgängig mit LEVOTHYROXIN-HENNING als Referenz­produkt durchgeführt. Referenzpräparat kann zum Beispiel auch eine in einem anderen EU-Land erhältliche Levothyroxinzubereitung sein. [12] Nachvollziehen lässt sich dies für Verordner nicht: Wenn sich in Fachinformationen der Generika überhaupt Angaben zu Bioäquivalenzstudien finden, ist das Referenzpräparat nicht näher bezeichnet. Nach Einschätzung der Britischen Arzneimittelbehörde gehört Levothyroxin nicht zu den Arzneimitteln mit hoher Löslichkeit, sodass von einem möglichen Einfluss von Hilfsstoffen oder Produktionsverfahren auf die Absorption auszu­gehen ist. [2] Vergleiche zur Wirkstofffreisetzung, wie sie das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker (ZL) regelmäßig zu Original- und Nachfolgepräparaten durchführt, wurden in Verbindung mit Levothyroxinzubereitungen seit Jahren nicht mehr vorgenommen. [13] Levothyroxin hat zudem bekanntermaßen ein komplexes Stabilitätsprofil. Die Stabilität von Levothyroxinzubereitun­gen ist anfällig gegenüber Einflussfaktoren wie Licht, Feuch­tigkeit, Temperatur, Sauerstoff oder bestimmten Hilfsstoffen. Auch für den Herstellungsprozess ergeben sich aufgrund der Stabilitätsprobleme besondere Anforderungen. [2] Der Wirk­stoffgehalt von Arzneimitteln darf im Allgemeinen Seite 5 Seite 6 Praxis-Tipp Ist ein Patient einmal gut auf ein L-ThyroxinPräparat eingestellt, sollte nicht mehr gewechselt werden (das heißt: aut idem ankreuzen). KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 nicht mehr als 5% nach oben oder unten von der deklarierten Menge abweichen. Bei instabilen Stoffen können die Grenzen weiter sein. Konkrete Zahlen für Levothyroxinpräparate in Deutschland verweigert das BfArM auf Anfrage: Dabei han­delt es sich nach Einschätzung der Behörde um Betriebsge­heimnisse. [7] Die Kosten für ein günstiges Levothyroxingenerikum un­terscheiden sich von einem Original bei einer Tagesdosis von 150 µg um maximal 3,84 € pro Jahr (Jahreskosten auf der Ba­sis der Listenpreise für 100er-Packungen 57,41 € bis 61,25 €). Auch mit Rabattverträgen dürften sich angesichts dieser Prei­se nur sehr geringe Einsparungen erzielen lassen. Nach Emp­fehlung der Fachinformationen soll ein Präparatewechsel nur unter Überwachung auch der labordiagnostischen Parameter erfolgen. Angesichts der geringen Ersparnismöglichkeiten er­scheint uns dieser zusätzliche Aufwand, der ja auch mit Mehrkosten verbunden ist (TSH-Test: 3 €), wenig gerechtfer­tigt. Bei Gesamtschau der Daten ist es unseres Erachtens daher vernünftig, bei gut auf ein Levothyroxinpräparat einge­stellten Patienten das Produkt nicht zu wechseln. Levothyroxin (EUTHYROX, Generika) ist ein preisgüns­tiges Altarzneimittel, bei dem sich durch Wechsel zwischen den Handelspräparaten nur sehr geringe Einsparungen er­zielen lassen. Levothyroxin wird andererseits zu den Arzneimitteln mit enger therapeutischer Breite gerechnet, bei denen der Austausch von Handelspräparaten problematisch sein kann. Daten zu den klinischen Folgen eines Wechsels von Levothyroxinpräparaten sind äußerst begrenzt. Für die in Deutschland vermarkteten Levothyroxinprodukte mangelt es zudem an nachvollziehbaren vergleichenden Bioäquivalenz- und Qualitätsdaten. Uns scheint es daher vernünftig, bei gut auf ein Levothyroxinpräparat eingestellten Patienten das Präparat nicht zu wechseln, sondern aut idem anzukreuzen. Literatur (R = randomisierte Studie): 1 AbbVie Inc.: US-amerikanische Produktinformation SYNTHROID, Stand Sept. 2012 2 MHRA: Levothyroxine Tablet Products: A Review of Clinical & Quality Consideration, Jan. 2013; http://www.mhra.gov.u3c/home/groups/pl-p/documents/drugsafetymessageZcon222566.pdf 3 GREEN, W.L.: AAPS J. 2005; 7: E54-8 4 FRANKLYN, JA.: Clin. Endocrinol. 2013; 78:1-8 5 American Thyroid Association et al.: Thyroid 2004; 14:486 6 Arzneimittelbrief 2009; 43:31b 7 BfArM: Schreiben vom 16. Apr. 2013 8 LIONBERGER, R. (FDA): Diavortrag Public Meeting for Levothyroxine Sodium Therapeutic Equivalence, Mai 2005; zu finden unter: http://wvvw.fda.gov/DrugsyDrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm161290.htm 9 HENNESSEY, J.V. et al.: Endocr. Pract. 2010; 16: 357-70 10 American Thyroid Association et al.: Thyroid Pharmacovigilance Project; http://www.thyroidpharmacovigiknce.org/?uid=718bd1fd6955edd5f0246188c919ee49 R 11 CARSWELL, J.M. et al.: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2013; 98:610-7 12 BfArM: Schreiben vom 1. Okt. 2009 13 KAUNZINGER, A. (ZL): persönliche Mitteilung (Weitere Informationen und die Möglichkeit des Abonnements unter www.arznei-telegramm.de) Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Kalium-Mangel gefährdet viele Funktionen im Körper Dr. med. Klaus Ehrenthal Seite 7 Beiträge der Redaktion Durch die „moderne“ Ernährung in westlichen Ländern wird die Aufnahme von Kalium und vielerlei lebenswichtigen Stoffen verändert und oftmals reduziert. Das liegt einerseits an der weltweiten Abnahme von selbst zubereiteter Nahrung mit Gemüse und Salat oder Obst, vermindertem Verzehr von Bohnen, Erbsen, Spinat, Kohl, Petersilie, Nüssen, Bananen, Papayas, Datteln usw. und andererseits an der Zunahme von Fertigkost in den westlichen Ländern und an damit verbundenen Schädigungen der Nahrung durch den industriellen Fertigungsprozess, was vielfältig nachzulesen ist und z. B. von Grimm [2] gut recherchiert wurde. Kaliummangel kann zu Elektrolytstörungen und damit zu vielfältigen Störungen der Zellmembranfunktionen und des Stoffwechsels führen, da Kalium in vielfacher Weise auch als Gegenspieler von Natrium wirkt. Mit einer Metaanalyse hat Nancy Aburto mit ihrer Arbeitsgruppe vom Department of Nutrition for Health and Development der WHO in Genf kürzlich gezeigt, dass durch eine Anhebung der Kaliumwerte im Serum der Blutdruck bei Hypertonikern deutlich gesenkt wird und damit auch das Schlaganfallrisiko vermindert wird [1]. Studie: Aburto et al. werteten insgesamt 33 Studien mit rund 129.000 Teilnehmern aus, darunter waren 22 randomisierte kontrollierte Studien mit 1.606 Teilnehmern, die eine den Blutdruck senkende Wirkung bei vermehrter Zufuhr von Kalium zeigten. Elf Studien waren Kohortenstudien mit 127.038 Teilnehmern, bei denen der Einfluss von vermehrter Kaliumzufuhr auf spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht wurde. Durch Kontrollen des Blutdrucks und der Laborergebnisse wurden die Effekte einer vermehrten Kaliumzufuhr (im Mittel +90 bis +120 mmol/die) aufgelistet. Ergebnisse: Bei den 22 untersuchten randomisierten, kontrollierten Studien fand sich eine durchschnittliche blutdrucksenkende Wirkung durch vermehrte Kaliumzufuhr: der systolische Blutdruck sank im Mittel um 3,49 mm Hg der diastolische Blutdruck sank im Mittel um 1,96 mm Hg. Diese Wirkung wurde besonders bei Patienten mit arterieller Hypertonie erzielt, weniger bei normotonen. Bei Hypertonikern war der Effekt deutlich größer: Der systolische Blutdruck bei Hypertonikern sank im Mittel um 7,16 mm Hg. Diese Wirkung wurde erreicht durch die Zufuhr von 90-120 mmol/die Kalium. Die Wirkung war nicht dosisabhängig. Auch fanden sich keine Hinweise auf negative Auswirkungen des Kaliums auf die normale Nierenfunktion. Auch die kontrollierten Werte der Blutlipide und der Katecholamine blieben ebenfalls ohne Hinweise auf schädliche Wirkungen. In 3 Studien an Kindern zeigten sich ebenfalls keine Nachteile durch die Kaliumgaben. Bei gesunden Nieren fanden sich keine negativen Auswirkungen einer erhöhten Kaliumgabe. Die Untersuchungsergebnisse der ebenfalls ausgewerteten 11 Kohortenstu­dien mit 127.038 Teilnehmern wurden in Beziehung zur Gesamtzahl der späteren Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Kaliumzugabe gesetzt. Dabei fand sich ein nicht-signifikanter Trend zu einer protektiven Wirkung: Die Zahl der Schlaganfälle ging bei erhöhter Kaliumzufuhr um 24 % zurück (Risk Ratio 0,76; 95%-Konfidenz­ intervall 0,70-1,11). Blutdruck sank durch kaliumreiche Ernährung – das heißt: viel Obst und Gemüse! Seite 8 KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 Daraus leitete die Arbeitsgruppe die WHO-Empfehlung ab, eine vermehrte Kaliumaufnahme bei Hypertonikern und zur Schlaganfallprävention zu empfehlen: „These results suggest that increased potassium intake is potentially beneficial to most people without renal handling of potassium for the prevention and control of elevated blood pressure and stroke.” Bedeutung für unsere Praxis Kaliumreiche Ernährung senkt bei nierengesunden Hypertonikern den Blutdruck Der Ernährung unserer Patienten muss mehr Beachtung geschenkt werden. Keinesfalls sollte die derzeitige Fast-Food-Welle vom behandelnden Arzt unterstützt werden. Frisches regional gewachsenes und möglichst saisonales Obst und Gemüse sowie selbst zubereitete Speisen sollten den Speiseplan dominieren. Künstliche Nahrungszusätze in Fertigkost, wie Beimengungen von Vitaminen, Salz, Zucker, Geschmacksverstärkern, Farb- und Aromastoffen können die Mängel gegenüber kaliumreicher herkömmlicher Ernährung nicht ausgleichen. Auch Getränke sollten möglichst naturbelassen, ohne Fremdzusätze (wie z.B. Aroma-, Farb- und Geschmackszusätze) und ungezuckert konsumiert werden. Die seit Jahren bestehenden Ernährungsgewohnheiten vieler Patienten müssen vom Hausarzt – nicht selten gegen Widerstände der Patienten – durch bemühte und geduldige Beratungen verbessert werden. Zeit- und auch Geldmangel der Patienten sind dabei zu berücksichtigen. Die Zubereitung gesunder Kost braucht seine Zeit. Sie muss nicht teuer sein. Jahrelange Essgewohnheiten lassen sich nur langsam und geduldig, orientiert an den Gesundheitsdaten und Möglichkeiten des Betroffenen, verbessern. Das gilt besonders bei Hypertonikern und bei Patienten mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko. Hier kann eine kaliumreiche Ernährung, besonders in Verbindung mit natriumarmer Kost, den Hochdruck verringern und das Schlaganfallrisiko mindern. Bei Patienten mit Nierenschäden sollten diese Empfehlungen allerdings mit dem Nephrologen abgestimmt werden. Literatur: 1 Aburto NJ, Hanson S, Gutierrez H, et al.: Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346:f1378, doi: 10.1136/bmj.f11378 (Publ. 05.April 2013) 2 Grimm, Hans-Ulrich: Verschiedene ernährungskritische Schriften, wie z.B.: Vom Verzehr wird abgeraten. Wie uns die Industrie mit Gesundheitsnahrung krank macht. 2012, Droemer Verlag, 319 S. Für Sie gelesen CSE-Hemmer und Diabetes mellitus Typ II In einer retrospektiven Medikamenten-basierten Kohortenstudie (471.259 Patienten) aus Ontario/Kanada [1] wurde bestätigt, dass das Diabetesrisiko unter Statineinnahme mit Atorvastatin, Rosuvastatin und Simvastatin bei über 66-Jährigen steigt. Es erkrankten 3 bis 8 Personen pro Tausend mehr an Diabetes mellitus Typ II als unter Pravastatin, Fluvastatin oder Lovastatin. Das heißt, es ist weiterhin richtig, dass in der Primärprävention erst bei einem hohem kadiovaskulären Risiko, z.B. ARRIBA-Score >20%, ein CSE-Hemmer eingesetzt wird, z.B. Pravastatin. In der Sekundärprävention ist das Risiko eines Diabetes Typ II verglichen mit dem Benefit durch den CSE-Hemmer von untergeordneter Bedeutung. Dr. med. Gert Vetter Literatur: 1 BMJ 2013;346:f2610; Online: http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2610 Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell U-Kurve gilt auch für das Kochsalz Zu viel Natrium schadet dem Menschen, zu wenig aber auch Dr. med. Klaus Ehrenthal Schon ab 115 mm Hg steigt das kardiovaskuläre Risiko mit dem systolischen Blutdruck kontinuierlich an. Um die Homöostase von Wasserhaushalt und Blutdruck zu gewährleisten, steuert der Körper besonders die Natriumkonzentration. Deswegen wird eine Primärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen durch Blutdrucksenkungen mittels Kochsalzreduktion in der Nahrung propagiert. Dazu erschien 2010 im Deutschen Ärzteblatt eine Übersichtsarbeit von Hoyer et al. mit Studienergebnissen und Untersuchungen aus zahlreichen Ländern und Bevölkerungsgruppen [1]. Von der WHO wurde bereits 2006 in Paris eine Reduktion der täglichen Kochsalzaufnahme für Hochdruckkranke von aktuell 8 bis 12 g auf zukünftig 5 bis 6 g NaCl gefordert [2]. Im Ergebnis wurde von Hoyer et al. festgehalten, dass durch eine moderate Senkung der täglichen Kochsalzaufnahme in Deutschland von derzeit 8 bis 12 g Kochsalz (das entspricht umgerechnet etwa 3.150 bis 4.700 mg Natrium) auf 5 bis 6 g (umgerechnet rund 2.000 bis 2.400 mg Natrium) „ein Nutzen für Krankheitslast und Ökonomie zu erwarten ist.“ Es wurde deswegen eine Reduktion des NaCl-Gehalts industriell verarbeiteter Lebensmittel gefordert, die für 75 bis 80% der Salzaufnahme und die derzeitige weitere Zunahme der Kochsalzaufnahme verantwortlich sind, sowie Änderungen des Lebensstils und Umstellung der Ernährung angemahnt. Dies fand entsprechend auch Eingang in Leitlinien zahlreicher medizinischer Fachgesellschaften, wie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie [3]. Die Evidenz für eine Reduktion der kardiovaskulären Mortalität durch Kochsalzreduktion ist unstrittig bei der Verminderung eines sehr hohen Konsums von mehr als 15 g pro Tag auf einen mäßigen Konsum von ca. 10 g pro Tag. Eine weitere Kochsalzreduktion auf einen sehr geringen Salzkonsum von weniger als 6 g pro Tag kann die Mortalität jedoch nicht weiter evidenzbasiert senken. Da die Bemühungen zur Reduktion von Kochsalz in industriell erzeugten Lebensmitteln – auch wegen der Folgen für Haltbarkeit und Keimfreiheit der Lebensmittel sowie Preisgestaltung – in den westlichen Ländern eher gescheitert sind, ist weiterhin mit einer hohen Kochsalzbelastung der Bevölkerung in den Industrienationen zu rechnen. Pro strengere Salzrestriktion So stellten Mozaffarian et al. in einer Metaanalyse (vorgetragen 2010 auf einer Fachtagung der American Heart Association in New Orleans) aus 107 randomisierten kontrollierten klinischen Studien fest, dass weltweit mit 2,3 Millionen Todesfällen durch einen weiterhin überhöhten Salzkonsum zu rechnen ist, von denen 1 Million bereits vor dem 69. Lebensjahr verstorbene Männer wären – besonders auch in Schwellen- und Entwicklungsländern [4]. Seit mindestens 2008 wird darüber diskutiert, bis zu welcher Höhe die tägliche Natriumzufuhr noch toleriert werden sollte, um Hypertonie und Zunahme des kardiovaskulären Risikos zu vermeiden. So haben Whelton et al. vom Vorstand der American Heart Association 2013 vorgeschlagen, die tägliche Natrium-Aufnahme generell auf unter 1500 mg (entspricht etwa 3,8 g Kochsalz) zu beschränken [5]. Kontra allzu strenge Kochsalzrestriktion Hierzu hat das US-amerikanische Institute of Medicine (IOM), das als Mitglied der Amerikanischen Akademie der Wissenschaft der Beratung der US-amerikani- Seite 9 Beiträge der Redaktion KVH • aktuell Seite 10 Nr. 3 / 2013 schen Öffentlichkeit und Politik dient, in einer Erwiderung diskutiert, dass eine tägliche Natriumzufuhr von weniger als 2.300 mg Natrium (= ca 5,8 g Kochsalz) täglich für manche Gruppen sogar gefährlich sein könnte – z.B. bei zunehmender Herzinsuffizienz, bei erhöhten kardiovaskulären Risikofakturen wie erhöhten Lipidwerten und Insulinresistenz. Es wurden unterschiedliche Studien analysiert, um herauszufinden, ob es Patienten gibt, für die eine zu strikte Kochsalzreduktion gefährlich sein könnte und die Begründung hierzu in einem Report niedergelegt [6]. Dieser Report des IOM bestreitet, dass aufgrund vorliegender Studien eine weitere Reduktion der täglichen Natriumaufnahme unter 2.300 mg gefahrlos sei. Er widerspricht damit den Empfehlungen der American Heart Association [5], die weiterhin 1.500 mg (= ca 3,8 g Kochsalz) als maximale tägliche Natriumaufnahme empfiehlt, allerdings ohne eine allgemein anerkannte gesicherte Evidenz. Studie In einer Studie untersuchten Paterna et al. 2007 an Patienten mit einer kompensierten chronischen Herzinsuffizienz (NYHA II) die Effekte unterschiedlicher Konzentrationen von Natrium in der Nahrung auf das kardiovaskuläre Risiko [7]. In einer Interventionsstudie wählten Paterna et al. aus 1.244 internistischen Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz (NYHA II, Ejektionsfraktion < 35%, Serumkreatinin < 2mg/dl), die zur stationären Aufnahme kamen, 232 Patienten aus. Sie wurden nach Anwendung von 2 Diäten mit unterschiedlichem Natriumgehalt untersucht. Sie wurden innerhalb der Zeit bis zur Entlassung, spätestens am 30. Tag medikamentös auf einen „steady state“ eingestellt (je nach Befund der Herzinsuffizienz mit Anpassung der Diuretika, mit ACE-Hemmern, Digitalis, Aldosteron, Betablockern und Nitraten). Nach dieser stationären Einstellung wurden diese Therapien unverändert bis zum 180. Tag beibehalten. Sie wurden randomisiert in 2 Gruppen aufgeteilt: Gruppe 1: 118 Patienten erhielten eine normale Natriumkost („Normaldiät“) mit exakt 120 mmol/die Natrium (= ca 2760 mg Na) + 2 x täglich 250 bis 500 mg Furosemid oral plus 1000 ml/die Flüssigkeit. Hiermit wurde die renale Flüssigkeitsbalance während der Untersuchungszeit zwischen dem 30. und 180. Tag nach stationärer Aufnahme gleichbleibend aufrecht erhalten. Gruppe 2: 114 Patienten erhielten eine natriumarme Diät mit exakt nur 80 mmol/die Natrium (= ca 1840 mg Na) + 2 x täglich 250 bis 500 mg Furosemid oral plus ebenfalls 1000 ml Flüssigkeit. Die Intervention begann am 30. Tag nach der stationären Aufnahme und wurde bis zum 180. Tag nach der 1 mmol Natrium = 23 mg Natrium Entlassung fortgeführt. Zuvor und 1 mmol Natriumchlorid = 58,5 mg ‚Kochsalz (NaCl) während dieser Studiendauer und 1 g Kochsalz = 17,1 mmol NaCl und enthält 0,3934 mg Natrium nach Studienende fanden engmaKochsalz in mg dividiert durch 2,54 ergibt Natrium in mg schig ausführliche Untersuchungen und Messungen statt, um die Wirkung der Natriumgaben aus der Diät auf die Herzinsuffizienz in den beiden Gruppen zu vergleichen (Befunde der chronischen Herzinsuffizienz, von Gewicht, Blutdruck, Herzfrequenz, EKG, und Echokardiogramm, diverse Laborparameter wie natriuretisches Peptid, Aldosteronspiegel, Aktivität des Plasmarenins, sowie Natrium, Kalium, Chlorid, Bikarbonat, Albumin, Harnsäure, Kreatinin, Harnstoff und Glukose im Serum). Primärer Endpunkt war eine notwendige erneute stationäre Aufnahme. Sekundärer Endpunkt waren Rehospitalisationen kombiniert mit Todesfällen. Umrechnung Ergebnis In Gruppe 1 (Normaldiät = ca 2760 mg Na/die) waren notwendige stati- Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell onäre Wiederaufnahmen gegenüber Gruppe 2 (natriumarme Diät) vermindert (7,63 vs. 26,32%, p < 0,05). Ebenso wurde in Gruppe 1 der sekundäre Endpunkt mit 12,71 vs. 39,47% seltener erreicht. In Gruppe 1 mussten 9 Patienten erneut stationär aufgenommen werden wegen Verschlechterung von NYHA II nach NYHA III/IV, 6 Patienten verstarben an irreversibler Herzinsuffizienz. Die Werte von natriuretischem Peptid waren in Gruppe 1 (Normaldiät) niedriger als in Gruppe 2 (natriumarme Diät) (685 +/- 255 pg/ml vs. 425 +/- 125 pg/ ml, p < 0.001). Bei Gruppe 1 (Normaldiät) ergab sich bei Studienende eine geringe signifikante Reduktion der Aldosteronspiegel (p = 0,039) und kein signifikanter Unterschied der Plasmareninspiegel, während in Gruppe 2 (natriumarme Diät) Aldosteron- und Plasmareninspiegel angestiegen waren. In Gruppe 1 (Normaldiät = ca 2760 mg Na/die) zeigte sich zusammengefasst gegenüber Gruppe 2 eine geringere Rate von Rehospitalisationen und eine signifikante Abnahme der Serumspiegel von Aldosteron, natriuretischem Peptid und geringer von Plasmarenin. Bei Gruppe 2 (mit natriumarmer Diät = ca 1840 mg Na/die) fanden Paterna et al. folgende Veränderungen gegenüber der Gruppe 1 mit Normaldiät: In Gruppe 2 mussten 30 Patienten wegen klinischer Verschlechterung ihrer Herzinsuffizienz (NYHA II nach III/IV) stationär behandelt werden: In Gruppe 2 verstarben insgesamt 15 Patienten (4 x plötzlicher Herztod, 9 x durch irreversible Herzinsuffuzienz, 2 aus anderen Gründen: 1 x durch ein Neoplasma, 1 x durch Schlaganfall). In Gruppe 2 (mit natriumarmer Diät = ca 1840 mg Na/die) fanden sich nach 180 Tagen die Aldosteron- und Plasmarenin-Spiegel signifikant höher als bei Gruppe 1 (p < 0.001). Die Ergebnisse der Studie von Paterna et al. zeigen damit, dass eine normale natriumhaltige Kost (hier etwa 7 g NaCl/die) das Outcome bei chronischer Herzinsuffizienz (NYHA II) verbessern kann. Die Natriumverminderung durch natriumarme Diät mit 80 mmol/die Natrium (etwa 5 g NaCl) hatte eine abnehmende neurohormonale Schutzwirkung mit schlechterem klinischen Outcome bei kardiovaskulären Risikopatienten mit kompensierter chronischer Herzinsuffizienz gezeigt. Weitere Studien Zu ähnlichen Aussagen kamen 2013 Aburto et al. [8] in einem systematischen Review und Metaanalyse aus 37 randomisierten kontrollierten Studien sowie 14 prospektiven Kohortenstudien. Es wurden nichtakute Herzkranke und Kinder untersucht mit reduzierter Natriumzufuhr. Die Restriktion der täglichen Natriumaufnahme auf 2.000 mmol/die Natrium (= ca 5,1 g Kochsalz) hatte bei nichtakuten Herzkranken eine evidente Blutdrucksenkung zur Folge ohne negative Veränderungen bei Blutlipiden, Katecholaminspiegeln und Nierenfunktion (p < 0,05). Eine moderate Evidenz für die Senkung des Blutdrucks fand sich bei Kindern. Die reduzierte Salzaufnahme war mit einer Verminderung von Schlaganfällen und fataler KHK bei Erwachsenen assoziiert. „The totality of evidence suggests that most people will likely benefit from reducing sodium intake“. Cochrane Review 2013 Auch die Autoren He FJ, Li J und MacGregor G untersuchten die Wirkung von moderater Kochsalzreduktion in der Nahrung auf den Blutdruck in einem systematischen Cochrane-Review durch eine Metaanalyse aus 34 randomisierten Studien mit Seite 11 Seite 12 KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 insgesamt 3 230 Teilnehmern [9]. Sie untersuchten Studien mit Kochsalzreduktion von täglich 9 bis 12 g (= ca 3500 – 4700 mmol/die Natrium) auf täglich 5 bis 6 g Kochsalz (entsprechend etwa 2000 mg – 2400 mmol Natrium). Auch sie fanden die beschriebene deutliche systolische und diastolische Blutdruckabsenkung bei hypertensiven und auch bei normotensiven Patienten ohne Bezug zum Alter, zum Geschlecht, zu ethnischen Gruppen oder zur Hautfarbe. Es fanden sich in diesem Cochrane Review durch mäßige Verminderung der täglichen Kochsalzzufuhr leichte Steigerungen der Plasma-Renin-, der Aldosteron- und der Katecholamin-Spiegel, ohne auffällige Änderungen des Cholesterins, des LDLund des HDL-Cholesterins und der Triglyceride. Auch bei Kochsalz gibt es eine U-Kurve Schon 2011 stellten Martin O’Donnell et al. durch Urinuntersuchungen auf Natrium und Kalium an den Teilnehmern der ONTARGET- und der TRANSCENT-Studie (nach Hochrechnung auf den täglichen Kochsalzkonsum aus den Urinkonzentrationen mittels der Kawasaki-Formel) fest, dass das kardiovaskuläre Sterberisiko in einer „U“-Kurve nicht nur bei hohem Kochsalzkonsum ansteigt, sondern auch bei Kochsalzmangel erhöht ist. Der Nadir des geringsten kardiovaskulären Risikos lag bei diesen genauen Auswertungen und Nachuntersuchungen bei 4 bis 5 g Natriumzufuhr täglich entspechend 10 bis 12 g Kochsalzaufnahme [10]. Zu ähnlichen Aussagen war auch bereits Michael Alderman 2007 gekommen [11]. Diese Aussagen decken sich auch mit einem Review aus 39 Studien, dessen Ergebnisse 2013 im Lancet publiziert worden waren [12]. Bedeutung für unsere Praxis 10 bis 12 g Kochsalz pro Tag sind für Gesunde optimal Bei Hypertonie und besonders bei kardiovaskulären Risikofällen sollte die tägliche Natriumzufuhr etwa bis zu 2300 mg (entsprechend maximal etwa 5,8 g Kochsalz) reduziert werden. Der Blutdruck wird dadurch signifikant gesenkt. Der Wert einer noch weiteren Natriumreduktion ist weniger gut durch Evidenz gesichert [6]. Bei einer Natriumreduktion in der Nahrung ist wie bei einer Kaliumsubstitution auch auf Nierengesundheit zu achten. Bei der Ernährungsberatung sollte der Arzt auf das Vermeiden gesalzener, aromatisierter und gesüßter Industrie-Fertigkost besonderen Wert legen. Brot und Hartkäse enthalten zur Haltbarmachung besonders viel NaCl [13]. Nicht nur die Kalorienzahlen („süße aromatisierte Dickmacher“) sind bei Fertigkost von Übel, sondern immer wieder die versteckten Kochsalzbeigaben (z.B. in Pizza, Snacks, Wurst und Schinken). Gemüse- und Fleischkonserven aus der Industrie enthalten viel von dem, was es zu vermeiden gilt: Salz, Stärke, Zucker, Geschmacksverstärker, Aromastoffe, Farbstoffe usw. (siehe unten). Nicht zu vergessen ist bei jeder Ernährungsberatung der Hinweis auf die notwendige tägliche Aufnahme von Kalium durch Gemüse, Salate, Obst (siehe dazu auch den Beitrag auf Seite 7). Durch Verminderung eines Natriumüberangebots einerseits und Beseitigung von Kaliummangel andererseits in der täglichen Nahrung lassen sich signifikant Hypertonie und damit das kardiovaskuläre Risiko verbessern. Aber auch eine extrem natriumarme Diät ist zu vermeiden, sie erhöht das Risiko [6]. (Natriumarm: unter 3,8 g Kochsalzaufnahme = ca 1.500 mg Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Seite 13 Natrium täglich). Die optimale Kochsalzzufuhr inklusive aller gesalzener Fertigprodukte liegt nach Auswertung der bisher ermittelten „U“-Kurve des kardiovaskulären Risikos bei etwa 4 bis 5 g Natriumzufuhr täglich, entsprechend etwa 10 bis 12 g Kochsalz. Literatur: 1 Klaus D, Hoyer J, Middeke M: Kochsalzrestriktion zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen. Deutsch Ärztebl 2010;107(26):457-462 2 World Health Organisation: Reducing salt intake in populations. Report of a WHO Forum and Technical meeting. 5.-7.October 2006 in Paris, France: Less salt, less risk of heart disease and stroke. Publikationen der WHO: [email protected] 3 Guidelines Committee 2003 European Society of Hypertension, European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2003;21:1011-1053 4 Mozaffarian D, Tao Hao, Rimm EB, Willett WC, Hu FB: Changes in Diet and Lifestyle and Long-Term Weight Gain in Women and Men. New Engl J Med 2011;364:2392-2404 5 Whelton PK, Appel LJ, Sacco RL, et al.: Further Evidence Supporting the American Heart Association Sodium Reduction Recommandations. Circulation 2012, publ. November 2, 2012, doi: 10.1161/CIR.0b013c318279abcf 6 Institute of Medicine of the National Academies of Sciences: Sodium Intake in Populations. Assessment of Evidence. 2013, www.iom.edu http://national-academies.com/newsroom 7 Paterna S, Gaspare P, Fasullo S, Sarullo M, Di Pasquale P.: Normal-sodium diet compared with low-sodium diet in compensated congestive heart failure: is sodium an old enemy ore a new friend? Clinical Science 2008;114:221-230, doi:10.1142/CS20070193 8 Aburto NJ, Ziolkovska A, Hooper L, et. al.: Effect of lower sodium intake on Health: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346:11326, doi: 10.1136/bmj.f11326 (Publ.05.April 2013) 9 He FJ, Li J, MacGregor GA: Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomized trials. BMJ 2013;346:f11325, doi: 10.1136/nmj.f11325 (Publ. 05.April 2913) 10 O’Donnell M, Salim Y, Mente A, et al.: Urinary Sodium and Potassium Excretion and Risk of Cardiovascular Events. JAMA 2011;306(20):2229-2238, doi: 10.1001/jama.2011.1729 11 Alderman, Michael H: Dietary sodium and cardiovascular disease: the ‘J’-shaped relation. J of Hypertension;25(5):903-1103, May 2007, doi: 10.1097/HJH.0b013e3280c14394 12 siehe auch: Salt: Friend or Foe. The Lancet 2013; 381(9880):1790 (25. May 2013) 13 Grimm, Hans-Ulrich: Verschiedene ernährungskritische Schriften, wie z.B.: Vom Verzehr wird abgeraten. Wie uns die Industrie mit Gesundheitsnahrung krank macht. 2012 Droemer Verlag, 319 S. Wieviel sind eigentlich 12 g Salz? Abschätzen kann man es mit Küchenmethoden: Der Esslöffel auf der gegenüberliegenden Seite enthält 12 g Kochsalz. Wo kommt das meiste Natrium her? Brot ist eines der wichtigsten Lebensmittel, 230 g Brot verspeist der Deutsche im Schnitt pro Tag. In einer solchen Menge Weizenbrot stecken alleine schon 3,6 g Salz. Ansonsten weisen Lebensmittelgruppen, bei denen Salz zur Konservierung verwendet wird, einen hohen Salzgehalt auf. Dabei handelt es sich z.B. um gesalzenen Fisch und gepökelte Fleisch- und Wurstwaren. Hartkäse ist salzhaltiger als Weichkäse, Schmelzkäse enthält wegen der verwendeten Schmelzsalze viel Natrium. Generell enthalten auch Fertigprodukte wie Pizza und Instantsuppen viel Salz. Die folgende Grafik zeigt, aus welchen Lebensmitteln wieviel Prozent des Natriums aufgenommen werden. Wer die Natriumaufnahme reduzieren will, findet hier Ansatzpunkte. Quelle: Stellungnahme Nr. 007/2012 des BfR, MRI und RKI vom 19. Oktober 2011, zu finden unter www.bfr.bund.de. KVH • aktuell Seite 14 Beiträge der Redaktion Nr. 3 / 2013 Therapie der Hepatitis C: Was bringen die neuen Substanzen? Dr. med. Margareta Frank-Doss Einleitung Bis in das 20. Jahrhundert hinein waren akute und chronische bakterielle Infektionserkrankungen, allen voran die Tuberkulose, eine häufige Todesursache. Die Bekämpfung der Armut sowie bessere Hygiene und medizinische Versorgung für die breite Bevölkerung ließen die Hoffnung auf ein infektionsfreies Feld zumindest für die westlichen Industrienationen aufkeimen. Neue und alte Viruserkrankungen haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Eindringlinge heißen SARS, HIV, Hepatitis-B und -C-Viren. Die chronische Infektion mit Hepatitis-C-Virus (HCV) gehört weltweit zu den häufigsten Infektionserkrankungen. Die virusbedingte Leberzirrhose ist die wichtigste Präkanzerose für das hepatozelluläre Karzinom. Für die nächsten 15 Jahre wird für Europa eine signifikante Zunahme der Hepatitis-C-Virus-assoziierten Mortalität prognostiziert. In Deutschland wird dieser Erkrankungsgipfel im Jahr 2024 erwartet [1]. Bereits jetzt sind ein Viertel der Leberzellkarzinome auf eine chronische Hepatitis C Infektion zurückzuführen. Patienten mit chronischer HCV-Infektion weisen nicht nur ein erhöhtes leberbezogenes Mortalitätsrisiko, sondern auch eine erhöhte Morbidität und Mortalität aufgrund von virusassoziierten extrahepatischen Komplikationen auf. Die häufigsten sind rheumatologische (gemischte Kryoglobulinämie), hämatologische (NonHodgkin-Lymphom) und endokrine (Diabetes mellitus aufgrund einer Insulinresistenz) Manifestationen. Hepatitis C Viren können die Blut-Hirn-Schranke passieren und werden für neurokognitive Symptome verantwortlich gemacht [Berg 2013]. Akute Infektion bleibt fast immer unbemerkt Die akute Infektion verläuft nahezu immer unbemerkt. Die Chronizität der Virushepatitis C wird einerseits durch virale Faktoren wie molekulare Heterogenität (Quasiespezies), andererseits durch Wirtsfaktoren wie eine inkompetente Immunantwort, bedingt. Die aktuell gültige Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Verdauung und Stoffwechsel (DGVS) zur Hepatitis C hat die Indikation zur antiviralen Behandlung ausgeweitet. Jedem Patienten mit chronischer HCV-Infektion sollte eine Therapie angeboten werden [2]. Patienten mit dem in Deutschland dominierenden Hepatitis-C-Genotyp 1 (>60% der Patienten) haben mit der dualen Standardbehandlung, pegyliertes (PEG)Interferon plus Ribavirin, eine deutlich schlechtere Therapieprognose als Patienten mit Genotyp 2 und 3. Neue Substanzen können Eradikationsraten deutlich steigern Diese Situation hat sich nun entscheidend verbessert. Seit Ende 2011 sind die beiden direkt antiviralen Proteaseinhibitoren Telaprevir und Boceprevir zur Tripel-Kombination mit der Standardtherapie, PEG-Interferon plus Ribavirin, bei Patienten mit Genotyp 1 zugelassen. Die neuen Substanzen sind Inhibitoren der HCV-spezifischen nichtstrukturellen Serinprotease NS3/4A. Sie binden kovalent an das aktive Zentrum der NS3-Protease, was zur Hemmung des HCV-Proliferationszyklus führt. Die bislang erzielten viralen Eradikationsraten von 40 bis 50% können auf 70 bis 80% in der Ersttherapie und auf 60 bis 70% in der Wiederholungstherapie gesteigert werden. Die Zulassung ist auf Genotyp 1 beschränkt, wobei Telaprevir auch Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell bei Genotyp 2 antiviral wirkt und Boceprivir inhibitorische Effekte bei Genotyp 3 hat. Es zeichnet sich ab, dass die Genotyp-Subgruppendifferenzierung in 1a und 1b eine prognostische Bedeutung hat. Patienten mit Genotyp 1a haben aufgrund einer niedrigen viralen Resistenzbarriere weiterhin ungünstigere Behandlungsaussichten. Anwendung in der Praxis Diagnose Für die Diagnose der chronischen Hepatitisinfektion ergeben sich aus der Zulassung der neuen Substanzen keine Änderungen. Für das Monitoring der Behandlung werden insgesamt jedoch engmaschigere Laborbestimmungen mit hochsensitiven Testverfahren erforderlich. Therapie der akuten Hepatitis C Die Behandlung der selten festgestellten akuten Hepatitis-C-Infektion besteht nach wie vor in der Interferon-Monotherapie als pegylierte Darreichungsform. Eine Empfehlung für Telaprevir oder Boceprevir besteht aktuell nicht. Therapie der chronischen Hepatitis C Die Zulassung der Protease Inhibitoren erfolgte ausschließlich für Hepatitis-CGenotyp 1. Ersttherapie (naive Patienten) Nicht vorbehandelte Patienten sollten primär mit einer Tripel-Kombination therapiert werden. Re-Therapie Die Behandlungsempfehlung ergibt sich aus der differenzierten Analyse der Ersttherapie. Patienten mit viralem Durchbruch (Breakthrough) während oder Rückfall (Relapse) nach Ersttherapie wird eine Triple-Kombination empfohlen. Bei Nullrespondern besteht die Gefahr einer funktionellen Monotherapie mit dem Proteaseinhibitor, woraus wiederum ein hohes Resistenzrisiko resultiert. Boceprevir Die Tagesdosis besteht aus 3 x 800 mg (alle 8 h) zusammen mit einer kleinen Mahlzeit zur Verbesserung der Resorption. Die Therapie wird mit einer sogenannten Lead-in-Phase begonnen. Gestartet wird dual PEG-Interferon plus Ribavirin über 4 Wochen, gefolgt von der Dreifachkombination. Nach 8, 12 und 24 Wochen erfolgt anhand der Viruslast die Entscheidung über das weitere Vorgehen (Response-gesteuertes Therapiekonzept). Eine Viruslast über 100 IU/ml bei Therapiewoche 12 und jede nachweisbare Virusmenge in Woche 24 führt zum Therapieabbruch. Die Einhaltung der Stopp-Regeln ist zur Verhinderung viraler Resistenzen entscheidend wichtig. Bei Ersttherapie mit anhaltend raschem Ansprechen (keine nachweisbare Viruslast ab Woche 4) ist die Dreifachbehandlung bereits nach 28 Wochen abgeschlossen. In allen anderen Fällen erfolgt die Therapie weiterhin über 48 Wochen. Die wesentlichen unerwünschten Begleiteffekte umfassen die Verstärkung der Ribavirin-induzierten Anämie sowie Geschmacksveränderungen. Telaprevir Die Tagesdosis wird aufgeteilt in entweder 2 x 1125 mg (2 x 3 Tabletten à 375 mg alle 12 Stunden) oder 3 x 750 mg (3 x 2 Tabletten alle 8 h) zusammen mit einer fettreichen Mahlzeit zur Verbesserung der Resorption. Telaprevir wird als Dreifachkombination mit PEG-Interferon und Ribavirin gestartet und für maximal 12 Wochen verabreicht, gefolgt von der Standardgabe PEG- Seite 15 KVH • aktuell Seite 16 Nr. 3 / 2013 Interferon plus Ribavirin. Eine Verkürzung auf 24 Wochen bei raschem Ansprechen in Woche 4 (keine Viren mehr nachweisbar) ist sowohl für die Ersttherapie als auch für die Therapie nach Rückfall (Relapse) zugelassen. Bei Leberzirrhose und noch nachweisbarer geringer Virusmenge (<1000 IU/ml) in Woche 4 wird über 48 Wochen behandelt. Das Kriterium zum sofortigen Therapieabbruch (Stoppregel) ist eine Viruslast >1000 IU/ml in Woche 4 oder 12 oder jede nachweisbare Viruslast in Woche 24. Die wesentlichen unerwünschten Begleiteffekte umfassen die Verstärkung der Ribavirin-induzierten Anämie sowie generalisierte Hautausschläge (RASH) und das Analekzem. Unerwünschte Begleiteffekte (Nebenwirkungen) und Interaktionen In den Zulassungsstudien für die beiden Protease-Inhibitoren sind schwere Nebenwirkungen wie Anämie < 10 g/dl in bis zu 50% der Patienten beschrieben. Ein Therapieabbruch war bei 11% der Patienten erforderlich, was sich nicht von der dualen Standardbehandlung unterschied. Mittlerweile sind zwei Todesfälle durch ein generalisiertes Arzneimittelexanthem (Telaprivir-assoziierte exfoliative Dermatitis: StevensJohnson-Syndrom, DRESS-Syndrom) dokumentiert. In beiden Fällen hat möglicherweise ein zu spätes Absetzen der antiviralen Medikation die letale Komplikation begünstigt. Da Boceprevir und Telaprevir eine starke Hemmung des für die Metabolisierung von zahlreichen Arzneistoffen wichtigsten P-450-Isoenzyms CYP 3A4/5 auslösen, sollte eine behandlungsbedürftige HIV-Koinfektion am besten in einem darin erfahrenen Infektionszentrum behandelt werden. Für das Therapieziel einer anhaltenden Viruseradikation ist eine hohe Adhärenz des Patienten im Behandlungsverlauf erforderlich. Einnahmefehler bergen das Risiko viraler Resistenzen. Versäumnisse im Monitoring beinhalten das Risiko vital bedrohlicher Therapienebenwirkungen. Diskussion Die Therapie wird komplexer und nebenwirkungsreicher und muss in vielen Fällen weiterhin über 48 Wochen durchgeführt werden. Die Problematik des Nonresponse ist geblieben. Für Patienten mit fortgeschrittener Leberzirrhose, Genotyp 4, ältere Patienten und für Patienten mit schwerwiegender Komorbidität besteht auch weiterhin keine befriedigende Therapieoption. Neu ist ein erhebliches Interaktionspotential der Proteaseninhibitoren mit gängigen Medikamenten durch einen gemeinsamen Metabolismus im Cytochrom P450 System (CYP 3A4/5, siehe oben). Neu ist zudem die Gefahr rascher Resistenzentwicklungen, vor allem bei Nichtbeachtung der rigiden Einnahmevorschriften. Therapieziel ist die Senkung der leberbezogenen Mortalität Ist die anhaltende Viruseradikation (Sustained Virological Response: SVR) ein geeigneter Surrogatmarker für das verlängerte Überleben bei chronischer Hepatitis C? Die Daten hierzu sind aufgrund der langen Progressionszeiträume noch spärlich. Die Abteilung für Hepatologie am Erasmus Medical Center in Rotterdam, Niederlande, hat eine Langzeitstudie mit Patientengruppen aus 5 europäischen und kanadischen Krankenhäusern vorgelegt. Diese 530 Patienten wurden im Median über 5 Jahre beobachtet. Die kumulative Mortalität nach zehn Jahren betrug 9% für Patienten mit SVR und 26% für Patienten ohne SVR. Die SVR reduzierte das Risiko leberbedingter Mortalität (Leberzellkarzinom oder Leberversagen) signifikant [3]. Viruseradikation erreicht. Sorglos für immer? Die anhaltende virologische Remission (SVR) kann nach den bislang vorliegenden Langzeitdaten als dauerhafte Virusfreiheit angesehen werden. Bei Patienten mit fortgeschrittener Leberfibrose und Zirrhose besteht aufgrund des strukturellen Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Seite 17 Leberumbaus auch nach Eradikation des Erregers ein erhöhtes Leberzellkarzinomrisiko. Es werden daher jährliche Nachsorgeuntersuchungen der Lebermorphologie mittels Ultraschall auch bei erfolgreich behandelten, virusfreien Patienten empfohlen. Indikation erfordert umfangreiche Prüfung Mit der Dreifach-Kombinationsbehandlung kommt es nicht nur zu einer signifikanten Verbesserung des dauerhaften virologischen Ansprechens in der Behandlung bei chronischer Hepatitis C. Ein weiterer Vorteil besteht in der häufig möglichen Therapieverkürzung auf 24 bis 28 Wochen. Die Indikationsstellung zu einer antiviralen Therapie ist entscheidend. Sie umfasst die sorgfältige Evaluation zahlreicher individueller Einflussfaktoren wie Patientenwunsch, Begleiterkrankungen, antivirale Vortherapie, soziale Einbindung und Adhärenzvermögen sowie prognostisch relevante Virusfaktoren. Kurz: Ist der Patient nach detaillierter und exakter Aufklärung therapiefähig? Bei der Behandlungsführung stehen anspruchsvolle Einnahmevorschriften sowie das engmaschige Monitoring von neuen und potentiell vital bedrohlichen unerwünschten Begleiteffekten im Vordergrund. Es bestehen eine Vielzahl relevanter pharmakologischer Interaktionen. Zusammengefasst spricht die Vielschichtigkeit der Einflussfaktoren für Indikationsstellung, Aufklärungskaskade und Behandlungsüberwachung in einem hepatologischen Zentrum. Die Zukunft Die Zukunft jenseits von 2013 stellt neue direkt antivirale Substanzen entweder in Kombination mit Interferon oder auch als sogenannte interferonfreie Therapie für anvisierte Zeiträume von maximal 24 Wochen in Aussicht. Diese kommenden Optionen werden nicht vor 2015 verfügbar sein, beinflussen schon jetzt aber unsere Indikationsfindung. Wen behandeln wir jetzt? Wen später? Und womit? Die Komplexität von Therapieentscheidung und Behandlungsdurchführung wird sich weiter steigern mit dem Ziel, nahezu allen Patienten mit Hepatitis C zur Virusfreiheit zu verhelfen. Bedeutung für unsere Praxis Die beste Lösung: Jeder Infizierte sollte in einem hepatologischen Zentrum vorgestellt werden. Literatur: 1 Deuffic-Burban et al.: Predicted effects of treatment for HCV infection vary among European countries. Gastroenterology 2012; 143 (4); 974 2 Sarrazin et al.: Update der S3-Leitlinie Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Hepatitis C-Virus (HCV)-Infektion, AWMF-Register-Nr.: 021/012. Z Gastroenterologie 2010; 48 (2):289 3 van der Meer et al.: Association between sustained virological response and all-cause mortality among patients with chronic hepatitis c and advanced hepatic fibrosis. JAMA 2012 26;308(24):2584 Erratum Der Artikel „Zweckmäßige medikamentöse Therapie der Osteoporose“ in unserem Heft Nr. 2/2013 beinhaltet leider auf der Seite 31 zwei falsche Zahlen, die durch datentechnische Fehler entstanden. Wir bitten für die Irritation um Entschuldigung und korrigieren die Fehler hier: Für den Wirkstoff Denosumab des Fertigarzneimittels Prolia® wurden Jahrestherapiekosten von 2.622,82 € genannt. Tatsächlich entstehen für Prolia® Jahrestherapiekosten in Höhe von 622,82 € entsprechend der Datenquelle Lauer-Taxe vom 1.12.2012. Für den Wirkstoff Risedronsäure des Fertigarzneimittels Actonel® 5 mg wurden Jahrestherapiekosten von 1.331,52 € genannt. Tatsächlich entstehen für Actonel® 5 mg Jahrestherapiekosten in Höhe von 331,52 € entsprechend der Datenquelle Lauer-Taxe vom 1.12.2012. Seite 18 Kurze Meldung KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 Verordnung von Cilostazol/Pletal® Europäische Arzneimittelagentur schränkt Indikation ein Pletal® ist zur Verlängerung der maximalen und schmerzfreien Gehstrecke bei Patienten mit Claudicatio intermittens ohne Ruheschmerz oder Anzeichen von peripheren Gewebsnekrosen/pAVK – Fontaine Stadium II einzusetzen. Neue Kontraindikationen, wie die Einnahme von zwei oder mehr zusätzlichen Thrombozytenaggregationsoder Gerinnungshemmern, das Vorliegen einer instabilen Angina pectoris oder einer Koronarintervention bzw. einem Myokardinfarkt in den letzten 6 Monaten, eine starke Tachyarrhythmie in der Vorgeschichte führen zu nachfolgenden Einschränkungen der Anwendung von Pletal®: Behandlung nur bei Patienten, bei denen Änderungen des Lebensstils, wie Einstellung des Rauchens, Bewegung und andere entsprechende Interventionen keine ausreichende Verbesserung der Symptome der Claudicatio intermittens ergaben. Eine Therapieüberprüfung ist nach 3 Monaten erforderlich. Die Behandlung sollte dann beendet werden, es sei denn, der Patient zeigt klinisch eine relevante Verbesserung der Gehstrecke/Lebensqualität. Die Cilostazol/Pletal®-Dosis ist auf zweimal täglich 50 mg zu reduzieren, wenn Patienten mit anderen Medikamenten behandelt werden, die starke Inhibitoren von CYP3A4 oder CYP2C19 sind. Die normale Dosis beträgt zweimal 100 mg täglich. LH Kurze Meldung Anwendung von Protelos® bei der Osteoporose eingeschränkt Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft informiert darüber, dass nach einem Rote-Hand-Brief des Herstellers die Indikation zum Einsatz von Protelos® zur Behandlung der Osteoporose eingeschränkt wird, weil neue Kontraindikationen und Warnhinweise vorliegen. Dies, um das Risiko für unerwünschte kardiale Ereignisse zu reduzieren. Daten zur kardialen Sicherheit aus randomisierten klinischen Studien zur Behandlung der Osteoporose mit Strontiumranelat haben ein erhöhtes Risiko für Myokardinfarkte gezeigt, jedoch kein erhöhtes Risiko bezüglich der Mortalität. In den nächsten Monaten wird die europäische Arzneimittelagentur eine umfassende Nutzen-Risiko-Bewertung von Protelos® durchführen. Die Anwendung von Protelos® ist nun beschränkt auf die Behandlung der schweren Osteoporose bei postmenopausalen Frauen mit hohem Frakturrisiko und bei Männern mit erhöhtem Frakturrisiko. Es sollte nicht eingesetzt werden bei Patienten mit der Anamnese einer ischämischen Herzkrankheit, einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit und/oder einer zerebrovaskulären Erkrankung sowie bei Patienten mit unkontrollierter Hypertonie. Die Behandlung sollte nur von Ärzten mit Erfahrung in der Osteoporosetherapie unter Berücksichtigung des individuellen Patientenrisikos begonnen werden. LH Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Seite 19 Einschränkungen für die Behandlung mit Flupirtin Kurze Meldung Flupirtin – Katadolon®, Trancolong®, Trancopal® u. a. – ist ein zentral wirksames, nicht opioides Analgetikum. Es ist zugelassen zur Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen, wie schmerzhafte Muskelverspannungen der Halte- und Bewegungsmuskulatur, Spannungskopfschmerz, Tumorschmerzen, Dysmenorrhoe sowie Schmerzen nach traumatologischen/orthopädischen Operationen und Verletzungen. Nach der nationalen Versorgungsleitlinie (NVL) Kreuzschmerz soll Flupirtin nicht zur Behandlung von akuten und chronischen nicht spezifischen Kreuzschmerzen angewendet werden, da die Datenlage für eine Wirksamkeit in dieser Indikation unzureichend ist. In Abstimmung mit der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und dem Bundesinstitut für Arz-neimittel und Medizinprodukte (BfArM) wird von den Herstellern in einem Rote-Hand-Brief über die Einschränkung der therapeutischen Zielgruppe und Begrenzung der Behandlungsdauer für Flupirtin-haltige Arzneimittel nach Bewertung des Lebertoxizitätsrisiko informiert. Die Beurteilung der Spontanberichte zu Lebererkrankungen unter der Anwendung von Flupirtin, die von einem asymptomatischen Anstieg der Leberenzyme bis zu Leberversagen reichten, hat zu einer Aktualisierung der Fachinformation für Flupirtin-haltige Arzneimittel geführt. Flupirtin ist nun für die Behandlung von akuten Schmerzen bei Erwachsenen indiziert und darf nur angewendet werden, wenn eine Behandlung mit anderen Analgetika (z.B. nicht-steroidale Antirheumatika, schwache Opioide) kontraindiziert ist. Flupirtin-Lösung zur Injektion (i.m.) ist als Einzeldosis zur Anwendung bei Erwachsenen mit postoperativen Schmerzen indiziert. Ist eine längere Anwendung erforderlich, stehen andere Darreichungsformen zur Verfügung. Die Anwendung darf nur erfolgen, wenn eine Behandlung mit anderen Analgetika (z.B. nicht-steroidalen Antirheumatika, schwachen Opioiden) kontraindiziert ist. Die Dauer der Behandlung für orale Darreichungsformen und Zäpfchen darf zwei Wochen nicht überschreiten. Die Kontraindikationen umfassen nun auch Patienten mit vorbestehenden Lebererkrankungen oder Alkoholmissbrauch sowie die gleichzeitige Anwendung von Flupirtin mit anderen Medikamenten mit bekannter, klinisch relevanter Hepatotoxizität. Leberwertmessungen müssen in wöchentlichen Abständen während der Behandlung durchgeführt werden. Falls abnorme Leberwerte oder klinische Symptome einer Lebererkrankung auftreten, muss die Behandlung abgebrochen werden. Die Therapie von Flupirtin-Patienten sollte beim nächsten Arzttermin gemäß diesen Empfehlungen überprüft werden. LH So oft wird Flupirtin in Deutschland derzeit verordnet: Substanz Fertigarzneimittel Flupirtin Katadolon®, Flupirtinmaleat Winthrop®, Trancolong®, Trancopal Dolo®, Flupigil®, Flupirtinmaleat Hormosan® Verordnungen Umsatz (AVP) in € 2012 Deutschlad 2012 Deutschland 1.304.742 101.812.134 Quelle: Insight health KVH • aktuell Seite 20 Für Sie gelesen Nr. 3 / 2013 Schwierige Einschätzung des Blutungsrisikos bei antikoagulierten Patienten Dr. med. Klaus Ehrenthal Wie kann bei oral antikoagulierten Patienten das Blutungsrisiko zuverlässig eingeschätzt werden? Dieser Frage gingen angesichts der zunehmenden Zahl von betroffenen Patienten und den neuesten Entwicklungen zu antikoagulierenden Medikamenten die Autoren Donzé J, Rodondi N, Waeber G, et al. am Universitätsspital Lausanne in einer prospektiven Kohortenstudie an 515 antikoagulierten Patienten nach [1]. Derzeit wird immer häufiger die Indikation zur oralen Antikoagulation (oAK) gestellt. In den USA nahm die Therapie mit oraler Antikoagulation zwischen 1998 und 2004 um das 1,45-fache zu – von 21 Millionen auf 31 Millionen [2]. Dabei müssen der Nutzen einer oAK einerseits und das Risiko einer schwerwiegenden Blutung andererseits mit möglichst zuverlässiger Vorhersage abgewogen werden. Donzé et al. verglichen jetzt das durch das „Bauchgefühl der beteiligten Ärzte“ geschätzte Blutungsrisiko mit den Vorhersagewerten nach der Anwendung von 7 bekannten Risiko-Scores [1]. Vorgehensweise: Aus 650 mit Phenprocoumon oder einem analogen Medikament oral antikoagulierten, nicht näher selektionierten Patienten des Universitätsspitals Lausanne, die fortlaufend zwischen dem 01.01.2008 und dem 31.03.2009 ambulant oder stationär dort behandelt wurden, konnten sie für die Studie insgesamt 515 Patienten (alle über 18 Jahre alt, 65% Männer, mittleres Alter 71 Jahre) auswählen. 96% der Fälle waren bei Studienbeginn stationär behandelt worden, 64% standen dabei bereits bis zu drei Monate unter oralen Antikoagulantien. Ausschlusskriterium war mangelndes Einverständnis zur Studienteilnahme. Die Studienpatienten wurden ein Jahr lang nachkontrolliert und durch Telefoninterviews und mittels klinischer Daten auf Blutungskomplikationen überwacht. 12% verstarben während der 12-monatigen Beobachtungszeit aus Gründen, die nicht mit einer Blutung zu tun hatten. Als primärer Endpunkt der Studie galten größere Blutungen innerhalb von 12 Monaten, definiert als tödlich verlaufende Blutung, als symptomatische Blutung in kritischen Arealen, als Blutung mit einem Hgb-Abfall von 2 g/l oder mehr sowie als transfusionsbedürftige Blutung. Nach statistischer Aufarbeitung der in dieser Zeit eingetretenen Blutungen wurde der Vorhersagewert von 7 Risikoscores mit der Einschätzung der behandelnden Ärzte verglichen. Ergebnisse Bei 7% der 515 Studienpatienten trat innerhalb des Jahres eine größere Blutung auf, 1% erlitten eine tödliche Blutung. Bei 26% der Blutungen lag der INR-Wert über dem Zielgebiet, bei 23% war zusätzlich ein Thrombozytenaggregationshemmer verordnet worden. Gastrointestinale Blutungen waren mit 38% am häufigsten, intrazerebrale Blutungen folgten mit 17%, urogenitale mit 14%. Die tatsächlich eingetretenen Blutungen wurden mit den Risiko-Abschätzungen der behandelnden Ärzte und nach Anwendung von 7 Risikoscores verglichen. Die Untersuchung der Vorhersagewerte der Risiko-Abschätzungen der Ärzte (sogenanntes „Bauchgefühl“) und der verschiedenen Scores bezog sich auf die ursprünglichen Krankheitsbilder, in denen die verschiedenen Scores validiert Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Seite 21 worden waren. Allerdings waren bei den verschiedenen Scores sehr unterschiedliche Validierungen und Ausgangssituationen sowie auch verschiedene Laborbefunde zur Bewertung herangezogen worden (z.B. unterschiedliche INR-Labilität und -Zielwerte, CYP 2C9-Werte). Insgesamt konnten die ausgewählten 7 Scores wegen ihrer unterschiedlichen Validierungen teilweise nur eingeschränkt angewendet werden. Die Anwendung der 7 Scores bezog sich meist auf eine Antikoagulation bei Vorhofflimmern. Die Vergleiche der eingetretenen mit den erwarteten Blutungsereignissen des spontanen „Bauchgefühls“ der Behandler und mit den angewandten Risikoscores (OBRI [3], Kuijer et al. [4], Shireman et al. [5], HEMORR2HAGES [6], RIETE [7], HASBLED [8], ATRIA [9]) zeigten, dass lediglich der ATRIA-Score (für oAK bei Vorhofflimmern) einen wahrscheinlich richtigen, etwas besseren Vorhersagewert für das Eintreten einer Blutung erkennen ließ. Auch die behandelnden Ärzte (mit durchschnittlich 3-jähriger Berufserfahrung) konnten keine besseren Vorhersagewerte bei der Beurteilung des Blutungsrisiko durch orale Antikoagulation erbringen. Auch Risikoscores erlauben keine zuverlässige Vorhersage Bei der oralen Antikoagulation bleibt eine bedrohliche Blutung als chwer vorhersagbares Risiko. Sowohl die ärztliche Einschätzung als auch die Anwendung verschiedener Risikoscores erlauben keine zuverlässige Risikovorhersage. Die Vorhersagewerte von Risikoscores sind nicht ausreichend sicher. Lediglich der ATRIA-Score (für die Gabe von oAK bei Vorhofflimmern) erlaubt eine gering verbesserte, vorsichtige Risikoeinschätzung für eine Blutung. Engmaschige Überwachungen, besonders auf gastroenterale Blutungen hin und genaues Einhalten der Therapieplanung sind erforderlich. INR-Kontrollen müssen bei schwankenden Werten zeitlich angepasst werden, besonders auch unter Beachtung interkurrenter Erkrankungen und veränderter Komedikation. Dass unter den neuen oralen Antikoagulantien INR-Gerinnungskontrollen bisher nicht möglich sind, darf nicht dazu führen, dass das Blutungsrisiko verharmlost und unterschätzt wird. Auch mit diesen neuen oAK behandelte Patienten sollten engmaschig vom Arzt gesehen und auf Blutverluste und Blutungen (besonders gastroentestinal, neurologisch, urologisch) hin kontrolliert werden. Literatur: 1 Donzé J, Rodondi N, Waeber G, et al.: Scores to Predict Major Bleeding Risk During Oral Anitkoagulation Therapy: A Prospective Validation Study. Amer J Med. Nov 2012;125(11):1095-1102, doi: org/10.1016/j. amjmed.2012.04.005 2 Wysowski DK, Nourjah P, Swartz L, : Bleeding complications with warfarin use: a prevalent adverse effect resulting in regulatory action. Arch Intern Med. 2007;167:1414-1419 3 Beyth RJ, Quinn LM, Landefeld CS: Prospective evaluation of an index for predicting the risk of major bleeding in outpatients treated with warfarin. Am J Med. 1998;105:91-99 4 Kuijer PM, Hutten BA, Prins MH, Buller HR: Prediction of the risk of bleeding during anticoagulant treatment for venous thromboembolism. Arch Intern Med. 1999;159:457-460 5 Shireman TI, Mahnken JD, Howard PA, et al.: Development of a contemporary bleeding risk model for elderly warfarin recipients. Chest. 2006;130:1390-1396 6 Gage BF, Yan Y, Milligan PE, et al.: Clinical classification schemes for predicting hemorrhage: results from the National Registry of Atrial Fibrillation (NRAF), HEMORRHAG2HAGES. Am Heart J. 2006;M151:713-719 7 Ruiz-Gimenez N, Suarez C, Gonzalez R, et al.; Predictive variables for major bleeding events in patients presenting with documented acute venous thromboembolism. Findings from the RIETE Registry. Thromb Haemost. 2008;100:26-31 8 Pisters R, Lane DA, Niewlaat R, et al.: A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year-risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. Chest. 1020;138:1093-110 9 Fang MC, Go AS, Chang Y, et al.; A new risk scheme to predict warfarin-associated hemorrhage. The ATRIA (Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation)-Study. J Am Coll Cardiol. 2011;58:395-401 Bedeutung für unsere Praxis Auch unter den neuen Antikoagulanzien müssen Patienten engmaschig kontrolliert werden. Praxis-Tipp In der Praxis beobachtet man ein GerinnungsChaos in der Spargelzeit: Dann ist besondere Vorsicht geboten – der INR-Wert gerät in dieser Zeit durcheinander.. Seite 22 Beiträge der Redaktion KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 Das Schmerzmittel-Dilemma Dr. med. Joachim Seffrin Da haben wir‘s: Eine große Metaanalyse zeigt uns, dass die Behandlung mit NSAR (NichtSteroidale AntiRheumatika, dazu zählen auch Coxibe) eine ganze Reihe von Risiken für unsere Patienten bereithält (siehe Kasten auf der gegenüberliegenden Seite). Eigentlich nichts Neues, aber so komprimiert und deutlich? Schmerzen sind ein außerordentlich häufiges Problem, mit dem uns unsere Patienten konfrontieren. Also müssen wir Wege kennen, um den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden bei gleichzeitig verantwortbarem Schadpotenzial. Aber Alternativen in der Schmerztherapie sind relativ rar. Was bedeutet dies für unseren Berufsalltag? Vor Beginn einer Schmerztherapie würde ich zuallererst die Indikation prüfen. Diese sollte immer, und dies gilt letztlich für alle Medikamente, streng gestellt werden. Nicht jede Fragestellung muss mit einem Medikament beantwortet werden. Also sind immer auch die Patientenpräferenzen zu eruieren. Nicht selten erhält man die Antwort, dass ein Schmerzmittel momentan gar nicht gewünscht ist. Oftmals ist dem Patienten die Beratung viel wichtiger und er ist schon zufrieden, wenn keine schlimme Ursache dahinter steckt. Fragen Sie ruhig öfter nach! Simple Maßnahmen wie Lagerung und Kühlung reichen auch manchmal aus. Als nächstes würde ich schauen, ob nun eine länger dauernde Therapie erforderlich wird oder lediglich kurzzeitiger Bedarf besteht. Für eine länger dauernde oder gar Langzeittherapie scheiden NSAR aus meiner Sicht weitestgehend aus. Auch bei sonst gesunden, jüngeren Menschen sind Risiken für den Magen-Darm-Trakt und die Nierenfunktion zu bedenken. Prinzipiell ist die Dosis der NSAR so niedrig wie möglich anzusetzen und immer zeitlich begrenzt anzuwenden. Bei Patienten, die älter als 65 Jahre sind, sollte man besonders kritisch hinschauen. Ältere nehmen oft weitere Medikamente ein und haben eine oder mehrere Grunderkrankungen. Im Zweifelsfall ist nur ein kurzer Einsatz zu erwägen oder auf das NSAR ganz zu verzichten. So berücksichtige ich die Nebenwirkungen Bei Niereninsuffizienz ganz auf NSAR verzichten. Falls eine Kurzzeittherapie geplant ist, müssen die spezifischen Nebenwirkungsrisiken des NSAR auf den Patienten mit seinen konkreten Gegebenheiten hin überprüft werden: Liegt eine Herzinsuffizienz vor, eine Gefäßerkrankung, Hypertonie, oder werden Begleitmedikamente (danach fragen) eingenommen, mit denen (z.B. ACE-Hemmer, Lithium) Schwierigkeiten zu erwarten sind? Je nach Ausmaß der Herzinsuffizienz kann es sein, dass NSAR absolut kontraindiziert sind; für Diclofenac haben die Hersteller jetzt per Rote-Hand-Brief die Herzinsuffizienz NYHA II - IV zur Kontraindikation erklärt (siehe dazu auch Kasten auf Seite 24). Bei einer leichteren, stabilen Herzinsuffizienz kann unter Überwachung (Gewicht) eventuell ein Einsatz gewagt werden. Bei Niereninsuffizienz würde ich auf NSAR gänzlich verzichten, da der potenzielle Schaden für die Nieren nicht berechenbar ist. Bei Vorliegen einer KHK bietet sich unter den NSAR Naproxen an, das nach der Datenlage offensichtlich in dieser Konstellation unproblematisch ist. Hinsichtlich der Nebenwirkungsrisiken im Magen-Darm-Trakt (auch im Dünn- und Dickdarm! Protonenpumpenhemmer schützen hier auch nicht) sind alle NSAR (inklusive der Coxibe) mehr oder weniger kritisch. Naproxen ist aber in Bezug auf Magen-DarmBlutungen unter den NSAR in der Metaanalyse am ungünstigsten. Unter dem Aspekt der gastrointestinalen Verträglichkeit stünde Ibuprofen oder Diclofenac zur Wahl. Wenn man trotz einer KHK ein NSAR benutzt, muss der Einnahmezeitpunkt von ASS mehrere Stunden vor der NSAR-Einnahme liegen, um die Wirkung des ASS Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell an den Thrombozyten nicht zu beeinträchtigen. Bei Ulkus- bzw. Blutungsanamnese sollten NSAR entweder gänzlich vermieden oder in Kombination mit einem Protonenpumpenhemmer eingesetzt werden. Diese Kombination würde ich persönlich gegenüber einem Coxib bevorzugen, auch wegen der erhöhten Gesamtsterblichkeit, die die Metaanalyse für Coxibe gezeigt hat. Andere Untersuchungen haben erwiesen, dass die Nebenwirkungen inklusive Blutungen im Magen durch Beseitigung einer Helicobacterinfektion erheblich reduziert werden können. Somit kann eine Untersuchung auf den Keim und eine Eradikation sinnvoll sein. Eine Therapie mit oralen Antikoagulanzien ist für mich eine absolute Kontraindikation für den Einsatz von NSAR, die ich strikt zu vermeiden suche. Hier entscheide ich mich konsequent für Opioide oder unter Umständen Novaminsulfon. Wenn bei starken Schmerzen eine längere Behandlung absehbar ist, greife ich oft gleich zu Opioiden, gegebenenfalls in Kombination mit Novaminsulfon, evtl. mit Therapieeskalation gemäß der WHO-Stufentherapie. Paracetamol scheint nach meinem Eindruck bei starken Schmerzen selten einen nennenswerten Zusatznutzen zu bringen. Ein Versuch kann sich dennoch lohnen, wobei die Tagesdosis dann bei 3 bis 4 Gramm liegen sollte. Flupirtin, das wenig im Gebrauch ist und für das relativ wenig Daten für eine Nutzenbeurteilung vorliegen, ist wegen des Abhängigkeitsrisikos und teils tödlicher Leberkomplikationen im Visier der AkdÄ, vom BfArM und der EMA und könnte vom Markt genommen werden. Das arznei-telegramm bescheinigt ihm nur schwache Wirkung. Der Wirkstoff ist somit aus meiner Sicht wegen der potenziellen Risiken für meine Patienten Seite 23 Keine NSAR, wenn schon Antikoagulanzien gegeben werdn! Nebenwirkungen der NSAR – Ergebnisse einer neuen Metaanalyse Am 30. Mai 2013 wurde bei Lancet Online eine umfangreiche Metaanalyse zu den Nebenwirkungen der nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) am Herz-Kreislauf-System und am Magen veröffentlicht. Sie bestätigt die im Prinzip schon bekannten Risiken, erweitert aber unser Wissen über die Nebenwirkungshäufigkeit der einzelnen Substanzen und verbreitert damit die Basis für differentialtherapeutische Überlegungen, inbesondere bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen. Nebenwirkungen am Herz-Kreislauf-System Die Analyse zeigt, dass hochdosiertes Diclofenac ebenso wie Coxibe drei zusätzliche schwere kardiovaskuläre Ereignisse pro 1000 Patienten und Jahr verursachen können – einer davon mit tödlichem Ausgang. Die Situation bei Ibuprofen ist nicht ganz so gut durch Studiendaten untermauert, aber auch hier ist mit einem erheblichen kardiovaskulären Risiko zu rechnen. Zweimal 500 mg Naproxen pro Tag scheinen dagegen keinen Einfluss auf das kardiovaskuläre Risiko zu haben – allerdings weisen die Autoren darauf hin, dass dies für niedrigere Dosen und eine Langzeitbehandlung nicht gesichert ist. Alle NSAR, auch Naproxen, erhöhen das Risiko einer Herzinsuffizienz: Die Wahrscheinlichkeit, wegen einer Herzinsuffizienz stationär aufgenommen zu werden, verdoppelt sich. Bitte beachten Sie hierzu auch den Kasten auf Seite 24 (Rote Hand zu Diclofenac: Bei Herzinsuffizienz kontraindiziert). Nebenwirkungen am Magen-Darm-Trakt Alle NSAR erhöhen das Risiko für Komplikationen im Gastrointestialtrakt um das zwei- bis vierfache, wobei Naproxen am ungünstigsten erscheint. Wie sich die Studienergebnisse in die praktische Arbeit integrieren lassen, zeigt der nebenstehende Beitrag. red Literatur: 1 Coxib and traditional NSAID Trialists’ (CNT) Collaboration: Vasular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials; Lancet, Online Publication: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60900-9 Seite 24 KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 nicht erwägenswert bzw. nicht zumutbar. (Siehe hierzu auch Seite 19). Beim Einsatz von Novaminsulfon sollte der Patient über die bekannten spezifischen Risiken entsprechend informiert und gegebenenfalls Blutbildkontrollen vereinbart werden. Fazit: Aufgrund der kleinen Zahl der Wirkprinzipien, der vielen Nebenwirkungsrisiken und Interaktionsmöglichkeiten gibt es leider keinen idealen Weg in der Schmerztherapie. Durch Beachten des Alters, der Begleiterkrankungen des Patienten und seiner Medikamente können die Gefahren bei größtmöglichem Nutzen immerhin vermindert werden. Bei kritischer Anwendung sind die Gefahren der NSAR damit überschaubar und verantwortbar. Diclofenac und Piroxicam nie in den Muskel spritzen! Ach ja, eins wollte ich im Zusammenhang mit NSAR noch anmerken, da leider immer noch medizinischer Alltag. Intramuskuläre Spritzen mit Diclofenac und Piroxicam sind schon lange obsolet und sollten ausnahmslos nicht mehr verabreicht werden. Oral wirken diese Medikamente genauso gut, wenn auch vielleicht 30 Minuten später. Alternativ nimmt man für den erwünschten Placeboeffekt die Gefahr schlimmster Nebenwirkungen bis zum Tod des Patienten nebst Rechtsfolgen in Kauf. Rote Hand: Diclofenac bei Herzinsuffizienz kontraindiziert! Aufgrund neuerer Daten zu Diclofenac haben die Hersteller Diclofenac-haltiger Präparate nun einen Rote-Hand-Brief verschickt. Hier die von den Herstellern selbst verfasste Zusammenfassung: Der Nutzen von Diclofenac überwiegt die Risiken. Allerdings weisen die derzeit verfügbaren Daten darauf hin, dass die Therapie mit Diclofenac mit einem erhöhten Risiko arterieller thrombotischer Ereignisse, vergleichbar mit dem von selektiven COX-2-Hemmern, assoziiert ist. Diclofenac ist jetzt kontraindiziert bei Patienten mit bestehender Herzinsuffizienz (New York Heart Association, NYHA, Stadien II-IV), ischämischer Herzerkrankung, peripherer Arterienerkrankung oder zerebrovaskulärer Erkrankung. Bei Patienten mit diesen Erkrankungen sollte die Behandlung überprüft werden. Die Behandlung mit Diclofenac sollte bei Patienten mit signifikanten Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse (z.B. Hypertonie, Hyperlipidämie, Diabetes mellitus, Rauchen) nur nach sorgfältiger Abwägung begonnen werden. Bei allen Patienten sollte die niedrigste wirksame Dosis über den kürzesten, zur Symptomkontrolle erforderlichen Zeitraum angewendet werden. red Quelle: Rote-Hand-Brief zu Diclofenac vom 15.7.2013 (einsehbar auf der Website der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft unter http://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/DSM/Archiv/2013-36.html) Bitte beachten Sie zum Thema NSAR auch unseren Beitrag auf Seite 33 Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell CK-Bestimmung bei Therapie mit Lipidsenkern Folgende Frage erreichte uns aus der Praxis: Muss ich die Creatinphosphokinase(CK-)Serumaktivität bei Patienten mit lipidsenkender Therapie bestimmen? Die Antwort gibt der Pharmakotherapie-Informationsdienst in Tübingen Diese Frage erhält vor dem Hintergrund des Risikos einer Myopathie – deren schwerste Form die Rhabdomyolyse ist – durch lipidsenkende Arzneimittel praktische Relevanz. Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) nimmt dazu in ihren Leitlinien [1] Stellung und gibt in einer Frage-Antwort-Form nützliche Hinweise. Wie oft sollte die CK bei Patienten mit lipidsenkender Arzneimitteltherapie bestimmt werden? Vor der Behandlung: Wenn vor Behandlungsbeginn die CK mehr als das Fünffache der oberen Normgrenze beträgt, soll die Therapie nicht begonnen werden. In diesem Fall soll die CK erneut kontrolliert werden. Während der Behandlung ist ein routinemäßiges Monitoring der CK nicht erforderlich. Wenn der Patient eine Myalgie entwickelt, soll die CK bestimmt werden. Erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich Myopathie und CK-Erhöhung soll den Risikopatienten gelten: höheres Alter, gleichzeitige Therapie mit interagierenden Wirkstoffen, Multimedikation, Leber- oder Nierenerkrankung. Was soll ich tun, wenn die CK bei Personen mit lipidsenkender Arzneimitteltherapie erhöht ist? Bei CK über dem Fünffachen der oberen Normgrenze: Behandlung stoppen, Nierenfunktion prüfen, Monitoring der CK alle 2 Wochen, Möglichkeit anderer Ursachen einer vorübergehenden CK-Erhöhung (zum Beispiel Muskelarbeit) in Betracht ziehen, sekundäre Myopathie-Ursachen in Betracht ziehen, wenn die CK erhöht bleibt. Bei CK unterhalb des Fünffachen der oberen Normgrenze: Falls keine Muskelsymptome bestehen, Statin-Therapie fortsetzen (die Patienten sollten darauf aufmerksam gemacht werden, Symptome zu berichten; weitere CK-Kontrollen in Betracht ziehen). Falls Muskelsymptome bestehen, regelmäßig Symptome und CK überwachen. Literatur: 1 European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Reiner Z, Catapano AL, De Backer G et al.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) 2008-2010 and 2010-2012 Committees: ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011; 32: 1769-818. Seite 25 Der Gastbeitrag Druck mit freundlicher Genehmigung der KV BadenWürttemberg Aus: KVBW Verordnungsforum 25; Februar 2013 Seite 26 Der Gastbeitrag Druck mit freundlicher Genehmigung der KV BadenWürttemberg Aus: KVBW Verordnungsforum 25; Februar 2013 KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 Der Nocebo-Effekt Nocebo-Effekte – Gegenteil der bekannteren Placebo-Effekte – sind bislang wenig erforscht, spielen jedoch im ärztlichen Alltag eine offensichtlich nicht zu unterschätzende Rolle. Der folgende Artikel liefert Ihnen eine aktuelle Übersicht – insbesondere zur Frage der ärztlichen Aufklärung über medikamentöse Nebenwirkungen. Fallbeispiel: Ein 26-jähriger Proband einer Antidepressiva-Studie hatte zu Hause ein Behältnis mit der täglich einzunehmenden Studienmedikation. Weil seine Freundin ihn verlassen hatte, wollte er sich umbringen und schluckte die verbleibenden 29 Tabletten auf einmal. Daraufhin bekam er Todesangst; der Blutdruck sackte ab und konnte auch in der Klinik zunächst nicht stabilisiert werden. Was er nicht wusste: Die eingenommenen Tabletten waren alle wirkstofffrei. Als sich dies im Krankenhaus herausstellte, hatte er innerhalb kürzester Zeit keine Beschwerden mehr und war – zumindest körperlich – kerngesund [1]. Ein klassischer Nocebo-Effekt. Das Wort „nocebo“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „ich werde schaden“. Auch in Wörtern anderer Sprachen findet sich der Wortstamm wieder: Im Englischen bedeutet „innocent“ unschuldig, unschädlich. Während das Wissen um Placebo-Effekte fast schon zur Allgemeinbildung zählt, fristen Nocebo-Phänomene bislang ein Schattendasein. Dies lässt sich auch an der Menge der publizierten Arbeiten ablesen: Bei einer Medline-Recherche stößt man auf cirPlacebo-Effekt ca 180 Treffer zu „Nocebo“, während es zum Placebo-Effekt 2.000 Publikationen sind – nicht „Placebo“ = ich werden gefallen (lat.). Placebomitgerechnet die über 150.000 Treffer, in denen Effekte sind nichtspezifische Effekte einer Benur der Begriff „Placebo-kontrollierte Studie“ vorhandlung, die für den Patienten mit positiven kommt. Beiden Phänomenen ist gemeinsam, dass körperlichen Reaktionen einhergehen. Eine Wirksich Erwartungen und Gedanken eines Menschen samkeit von Placebo ist für subjektive Beschwer(zum Beispiel als Folge verbaler Suggestion) auf den wie Schmerzen und Übelkeit nachgewiesen seine körperlichen Reaktionen oder auf den Ver[2]. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundeslauf einer medizinischen Behandlung niederschlaärztekammer hat 2010 eine Stellungnahme zu gen können. Auf positive oder negative Weise [4]. Placebo in der Medizin verfasst [3]. Definitionsgemäß versteht man unter NoceboEffekten nichtspezifische Effekte einer Behandlung, die für den Patienten mit negativen körperlichen Reaktionen einhergehen [5]. Bei der medikamentösen Behandlung eines Patienten muss das Auftreten solcher Effekte prinzipiell gegenüber tatsächlichen unerwünschten Arzneimittelwirkungen sowie gegenüber möglichen Symptomen einer (weiteren) Erkrankung abgegrenzt werden, was in vielen Fällen nicht ohne Weiteres möglich ist. Auf Neurotransmitter-Ebene laufen bei Nocebo-Effekten vermutlich ähnliche Vorgänge ab, die auch bei Panik und Furcht eine Rolle spielen. So wird beispielsweise die Ausschüttung von Dopamin, welches eine positiv motivierende Grundstimmung bewirkt, gehemmt. Die Wahl der Worte spielt auch im modernen Medizinbetrieb eine immense Rolle bei der Auslösung von Nocebo-Effekten. So kann sich die Nennung negativ besetzter Worte wie „Angst“ oder „Schmerz“ ungünstig auf den Patienten auswirken, auch wenn die Aussage positiv gedacht ist („Sie brauchen keine Angst zu haben.“). Bestimmte Formulierungen sollten Sie deshalb vermeiden („Ich hole noch schnell etwas aus dem Giftschrank.“). Und positiv formulieren: Statt der Aussage, dass fünf Prozent der Patienten über Nebenwirkungen berichten, ist es besser zu sagen: Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Seite 27 „Die meisten Patienten vertragen das Mittel gut.“ [5] Neben dem „Schreckgespenst“ Beipackzettel, darf in der heutigen Zeit nicht der Einfluss des Internets unterschätzt werden. Viele Patienten informieren sich in Online-Foren über Wirkungen und Nebenwirkungen eines Medikaments. Dies kann gefährlich sein, weil hier mögliche Wirkungen von Therapien unkontrolliert und ohne rationales Abwägen diskutiert oder in Frage gestellt werden. Es fehlt nicht viel, dass sich entsprechende Erwartungen auch bestätigen – der Patient beobachtet körperliche Symptome und nimmt ein für die Therapie nützliches Arzneimittel möglicherweise gar nicht ein. Für die Neueinstellung auf ein Medikament wurde gezeigt, dass mögliche Nebenwirkungen umso häufiger auftreten, je genauer diese vom verordnenden Arzt im Vorfeld angesprochen worden sind. Beispielsweise wurden Patienten, die wegen einer Prostatahyperplasie Finasterid einnahmen, darüber informiert, dass das Arzneimittel die Erektionsfähigkeit schwächen und die Libido mindern kann. Danach hatten 43 Prozent der Patienten entsprechende Symptome. Wurde dies den Patienten nicht gesagt, traten solche Nebenwirkungen nur bei rund 15 Prozent auf. Ähnliche Beobachtungen zu sexueller Dysfunktion traten auch bei Patienten mit Betablocker-Einnahme auf [6]. Auch an Nebenwirkungen aus dem Internet denken! Informieren Sie ohne Nocebo-Effekt Für den verordnenden Arzt ergibt sich daraus das ethische Dilemma, wie detailliert er den Patienten über mögliche Nebenwirkungen einer Behandlung informieren soll. Einerseits muss der Patient eine informierte Entscheidung über medizinische Behandlungsoptionen treffen können, andererseits kann ein Aufklärungsgespräch insbesondere bei ängstlichen Patienten oder in Extremsituationen Nocebo-Effekte hervorrufen [5]. Neben der oben erwähnten Lösungsstrategie, dass Sachverhalte möglichst mit positiven Worten formuliert werden sollen, wurde von einigen Autoren die Vorgehensweise des „erlaubten Verschweigens“ vorgeschlagen: Demnach wird der Patient vor der Verschreibung eines Medikaments gefragt, ob er damit einverstanden ist, keine Informationen über milde und/ oder passagere Nebenwirkungen zu erhalten. Über mögliche schwerwiegende und/oder irreversible Nebenwirkungen muss der Patient in jedem Fall aufgeklärt werden [5, 7]. Auf jeden Fall bestätigt sich die alte Weisheit, dass ein pessimistisch dreinschauender Arzt grundsätzlich weniger Erfolg haben wird als einer mit positiver, optimistischer Ausstrahlung [6]. Erlaubtes Verschweigen Vorschlag für den Beginn eines ärztlichen Aufklärungsgesprächs über unerwünschte Arzneimittelwirkungen: „Eine relativ geringe Zahl von Patienten erfährt lästige, aber ungefährliche Nebenwirkungen der Behandlung. Aus der Forschung weiß man, dass Patienten, die über diese Art von Nebenwirkungen informiert werden, häufiger diese Nebenwirkungen erleben als Patienten, die nicht über diese Nebenwirkungen aufgeklärt wurden. Möchten Sie, dass ich Sie über diese Nebenwirkungen aufkläre oder nicht?“ [7] Spielen Nocebo-Effekte eine Rolle beim Austausch von Medikamenten? Ein weiteres Problemfeld von Nocebo-Effekten im Verordnungsalltag hängt mit der Aut-idem-Regelung zusammen. Die meisten Ärzte sehen sich mit Patienten konfrontiert, die unter Verweis auf angebliche Nebenwirkungen bestimmte Präparate (meist günstige Generika oder Rabattpräparate) ablehnen und stattdessen auf die Verordnung des teureren Originals drängen. Eine qualitative systematische Übersichtsarbeit hat gezeigt, dass Patienten mit vermehrter Angst, Depressivität und Somatisierungsneigung tatsächlich ein höheres Risiko für unerwünschte Wirkungen nach Umsetzen auf Generika haben [8]. In dem Zusammenhang müsste diskutiert werden, ob beispielsweise medizinische Meinungsbildner von PatientenselbsthilfeOrganisationen durch kritische Stellungnahmen Nocebo-Effekte triggern kön- Ängstliche und depressive Patienten vertragen das Umsetzen auf ein Generikum am schlechtesten. KVH • aktuell Seite 28 Nr. 3 / 2013 nen, die ansonsten vermeidbar wären (zum Beispiel bezogen auf das Umsetzen von starken Opioiden auf entsprechende Generika) [5]. Es wäre daher wünschenswert, wenn Nocebo-Effekte minimiert würden, indem den Patienten in der ärztlichen Aufklärung nahegebracht wird, dass Generika gleich gut und gleich wirksam sind wie das entsprechende Original. Bedeutung für unsere Praxis Fazit: Der Nocebo-Effekt – das Gegenteil des Placebo-Effektes – muss bei jeder Form der Behandlung, beispielsweise in Bezug auf unerwünschte subjektive Arzneimittelwirkungen, mit einkalkuliert werden. Nocebo-Effekte können durch unbeabsichtigte negative Suggestionen von Ärzten und Pflegepersonal hervorgerufen werden. Hinsichtlich der Induktion von Nocebo-Effekten befinden sich verschreibende Ärzte in einem ethischen Dilemma, wie ausführlich sie ihre Patienten über mögliche Nebenwirkungen eines Arzneimittels aufklären sollen. Auch im Zusammenhang mit dem Aut-idem-Austausch können NoceboEffekte eine Rolle spielen. Wir verweisen auf die Möglichkeit der Mehrkostenregelung bei Wunschverordnungen. Literatur: 1 Czycholl H. Eingebildet krank – Die dunkle Seite der Placebos. www.welt.de/gesundheit/article4951876/Eingebildet-krank-Die-dunkle-Seite-der-Placebos.html, letzter Zugriff am 31.01.2013 2 Hróbjartsson A, Gøtzsche PC. Placebo interventions for all clinical conditions. Cochrane Database Syst Rev 2010; (1): CD003974 3 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats der Bundes­ ärztekammer „Placebo in der Medizin“. www.bundesaerztekammer.de/downloads/StellPlacebo2010. pdf, letzter Zugriff am 31.01.2013 4 Colloca L, Finniss D. Nocebo effects, patient-clinician communication, and therapeutic outcomes. JAMA 2012; 307: 567-8 5 Häuser W, Hansen E, Enck P. Nocebophänomene in der Medizin. Dt Ärztebl 2012; 109(26): 459-65 6 Höffler D. Zum Nocebo-Effekt. Arzneiverordnung in der Praxis (AVP) 2012; 39(6): 142-3 7 Colloca L, Miller FG. The nocebo effect and its relevance for clinical practice. Psychosom Med 2011; 73: 598-603 8 Weissenfeld J, Stock S, Lüngen M, Gerber A. The nocebo effect: a reason for patients’ non-adherence to generic substitution? Pharmazie 2010; 65: 451-6 Mehrkostenregelung Sofern ein Patient ohne ärztliche Indikationsstellung auf „seinem“ nichtrabattierten oder teureren wirkstoffgleichen Wunschpräparat beharrt, kann er die seit 2011 im Gesetz verankerte Mehrkostenregelung in Anspruch nehmen, ohne dass der verordnende Arzt ein Wirtschaftlichkeitsrisiko trägt. Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Wenn Metformin versagt: NPH-Insulin dazugeben! Zur Frage aus Heft 1/2013 „Metformin reicht nicht mehr: wie gehen sie nun vor?“ berichtet hier ein Kollege über eine Untersuchung in seiner Diabetes-Schwerpunkt-Praxis. Ein Paradebeispiel dafür, dass Fragen aus der Praxis hervorragend durch Untersuchungen in der Praxis beantwortet werden können. Bei Versagen der Metformin-Monotherapie bessert zusätzliches NPH-Insulin zur Nacht den HbA1c ohne Gewichtszunahme und ohne Hypoglykämien Fragestellung Die Nationale Versorgungsleitlinie empfiehlt nach Versagen der Metformin-Monotherapie die problematische Kombination mit Sulfonylharnstoffen, mit Gliptinen oder die Einstellung auf konventionelle (CIT) oder supplementäre Insulintherapie (SIT). Die Kombination NPH-Insulin (NPH) zur Nacht mit Metformin findet dabei keine Erwähnung. Bietet diese einfache Therapie eine Alternative, zumindest für einige Zeit? Methode In einer Diabetes-Schwerpunktpraxis wurden 147 Patienten (Alter 59,8 ± 9,6 [Jahre], bekannte Diabetesdauer 7,3 ± 5,8 [Jahre], Gewicht 92,9 ± 19,5 [kg]) nach Versagen der Metformin-Monotherapie auf NPH zur Nacht unter Beibehaltung von Metformin (NPH+Metformin) durch individuelle Schulung eingestellt. Dabei sollte die Injektion unmittelbar vor dem Schlafengehen vorgenommen werden. Die NPH-Dosis wurde durch nächtliche Blutzuckermessung individuell ermittelt. Die Metformindosis wurde nach Verträglichkeit angepasst. Die Häufigkeit von schweren oder nicht-schweren Hypoglykämien wurde durch Befragung registriert. Die Nachuntersuchung erfolgte zu dem Zeitpunkt, als das individuelle Therapieziel für HbA1c unter NPH+Metformin noch erreicht worden war, also vor Umstellung auf CIT oder SIT. Ergebnisse Bei 6 Patienten (4%; Gruppe A; Alter 60,8 ± 14,9 [Jahre], Diabetesdauer 4 ± 1,9 Jahre) wurde die Therapie bereits nach 1,9 ± 0,8 Monaten beendet: zwei mussten auf SIT bzw. einer auf CIT umgestellt werden und bei drei konnte das NPH wieder abgesetzt und die Metformin-Monotherapie fortgesetzt werden. 66 Patienten (45%; Gruppe B; Alter 59,1 ± 9,4 [Jahre], Diabetesdauer 7,2 ± 5 Jahre) wurden 6,9 ± 2,7 Monate erfolgreich behandelt: HbA1c vor NPH 8,5 ± 1 bzw. nachher 7,4 ± 0,9%; p < 0,001 Gewicht vor 93,8 ± 20,5 bzw. nach 93,4 ± 20,5 kg; p ≥ 0,05 75 Patienten (51%; Gruppe C; Alter 60,4 ± 9,1 Jahre und Diabetesdauer 7,7 ± 6,5 Jahre) wurden 29,2 ± 16,5 Monate erfolgreich behandelt: HbA1c vor 8,2 ± 1,1 bzw. nach 7,0 ± 0,6 [%]; p < 0,001 Gewicht vor 91,6 ± 18,1 bzw. nach 91,6 ± 17,8 [kg]; p ≥ 0,05 Schwere Hypoglykämien kamen nicht vor, die Häufigkeit nicht-schwerer Hypoglykämien war ohne klinische Relevanz. Diskussion Bei 4% der Patienten (Gruppe A) ist die Behandlung gescheitert bzw. war nur wenige Wochen notwendig. Aber bei 96% der Patienten konnte durch NPH+Metformin eine Umstellung auf problematische Medikamenten-Kombinationen bzw. auf CIT oder SIT für ein halbes (Gruppe B) bis über zwei Jahre (Gruppe C) hinausgezö- Seite 29 Briefe an die Redaktion Seite 30 KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 gert werden. Die gefürchtete Gewichtszunahme unter Insulin blieb aus, Hypoglykämien kamen nicht vor. Dies mag daran liegen, dass zur Nacht gespritztes NPH nicht am Tage wirkt. Der Schulungsaufwand war gering, da bei dieser Therapiestrategie ein Kostplan mit Berücksichtigung von Kohlenhydrateinheiten nicht erforderlich ist. Nach Versagen der Metformin-Monotherapie stellt die Kombination NPH + Metformin eine ausgezeichnete Option zur Weiterbehandlung dar. Dr. med. B. Mertes, CCB Diabetes Centrum Frankfurt am Main [email protected] Briefe an die Redaktion Antikoagulation: Auch an Cumarin mit Selbstkontrolle denken! In Ihrem Artikel in der „KVH aktuell“ vermisse ich einen Aspekt völlig: Die Patienten unter Cumarinen, die sich in der Selbstkontrolle befinden. Diese Patienten sind nach verschiedenen europäischen Studien deutlich besser und stabiler eingestellt als andere Patienten. Ein großer Vorteil, den diese Patienten haben, ist, dass sie in bestimmten Situationen (z. B. Einnahme von Antibiotika) engmaschiger eine INRWert-Kontrolle durchführen können, was ein Blutungsrisiko deutlich minimiert. Auch nicht außer Acht lassen sollte man, dass es für die neuen Antikoagulanzien noch kein Gegenmittel für den Notfall gibt. Dies wirft im chirurgischem Bereich Probleme auf. Es stellt sich die Frage, ob die Patienten darüber explizit aufgeklärt werden. Die in Ihrem Artikel angesprochenen wirtschaftlichen Aspekte haben auch keinen Vergleich zu den Patienten, die in der Selbstkontrolle sind. Nach meinem Wissenstand ist die finanzielle Situation die: Die Verordnung von neuen Antikoagulanzien kostet das 10-fache einer entsprechenden Versorgung mit einem Gerinnungsmonitor und die sich daraus ergebene Selbstkontrolle. Nach neuesten Leitlinien ist ein „Bridging“ nicht so oft nötig, wie es durchgeführt wird. Heparine sind ebenfals kostspielig. Ein Einsatz der neuen Medikamente führt dazu, dass die Nierenfunktion der Patienten überwacht werden sollte. Ist diese nicht gut, ist die Komplikationsrate bei den neuen Antikoagulanzien hoch. Daher sollte immer von Patient zu Patient entschieden werden, welche Antikoagulation die Richtige ist. Die Selbstkontrolle unter Cumarine sollte dabei auch beachtet, und ggf. einen neuen Stellenwert erhalten, gerade im Bezug auf Sicherheit, Blutungsrisiken und Kostenaufwand. Dies ist meine Meinung zu dem Thema. Im Kinderherz-Zentrum der Universitätsklinik Gießen schule ich zusammen mit einem Schulungsarzt Eltern, Jugendliche und Erwachsene, die eine Antikoagulation benötigen. Von Beruf bin ich MTA. Es würde mich freuen, wenn die oben genannten Argumente ein wenig mehr in den Blickwinkel derer fielen, die eine Verordnung für Antikoagulanzien ausstellen. Silvia Possehn , Universitäts-Rhön-Klinikum Gießen, Kinderherz-Zentrum Anmerkung der Redaktion: Der Gedankengang ist plausibel, allerdings ist die Selbstkontrolle im hausärztlichen Klientel die große Ausnahme, sie liegt sicher unter 1% der Marcumarpatienten. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Indikation zur Therapie mit zunehmenden Alter häufiger wird (vor allem absolute Arrythmie). Damit steigen auch die Schwierigkeiten, mit dem Selbstmessungsverfahren gut klar zu kommen. Insofern haben wir hierzu keine Ausführungen gemacht. Das fehlende Gegenmittel ist in der Tat ein großes Problem. Über die Stellung des Bridging liegen leider keine Studiendaten vor, ob zu häufig oder zu selten angewandt, unterliegt lediglich Vermutungen. Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Tetrazepam: schwere Hautreaktionen Grundsätzlich sollte das Benzodiazepin und Muskelrelaxans Tetrazepam (Musaril®, Generika) wegen zentralnervöser UAW (z.B. Benommenheit) und wegen seines Abhängigkeitspotentials nur zurückhaltend eingesetzt werden. Aufgrund schwerer Hautreaktionen (Stevens-Johnson-Syndrom (SJS), Toxische epidermale Nekrolyse (TEN), DRESS-Syndrom) und Kontaktdermatitiden hat nun die französische Überwachungsbehörde ein Verfahren zur Prüfung der Sicherheit dieses Arzneistoffes bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA beantragt. 11 Todesfälle sind in der französischen Pharmakovigilanz-Datenbank dokumentiert. Quelle: Pharm. Ztg. 2013; 158: 119-20 Aktuelle Ergänzung: Zulassung ruht seit 01.08.2013 Das BfArM hat nach einem nicht einstimmigen europäischen Verfahren zur Risikobewertung das Ruhen der Zulassung Tetrazepam-haltiger Arzneimittel (Musaril®, Generika) zum 1. August 2013 angeordnet. Grund für diese Maßnahme waren Berichte über schwerwiegende und lebensbedrohliche Hautreaktionen (wie z.B. Stevens-Johnson-Syndrom) und Kontaktdermatitiden, auftretend zu jedem Zeitpunkt der Therapie und nicht vorhersehbar. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis wird auch aufgrund eines unsicheren therapeutischen Nutzens negativ beurteilt. Aufgrund eines strukturellen Unterschiedes von Tetrazepam im Vergleich zu anderen Benzodiazepinen besteht keine Kreuzreaktion, so dass andere Benzodiazepine weiter eingenommen werden können. Das Absetzen von Tetrazepam sollte bei Patienten mit bereits länger andauernder Therapie mit Tetrazepam (mehr als eine Woche) schrittweise erfolgen, um Absetzphänomene zu vermeiden. Quellen: Bull. AM-Sicherheit 2013 (2), 03-11; Pharm. Ztg. 2013; 158(26): 105 Methotrexat: genaue Anwendungsempfehlungen erforderlich Bei rheumatologischen oder dermatologischen Erkrankungen wird Methotrexat (Generika) einmal wöchentlich appliziert. Nach Warnungen der europäischen Arzneimittelagentur EMA kommt es immer wieder zu Berichten über schwerwiegende oder tödliche UAW, weil z.B. bei Einweisung in ein Krankenhaus aufgrund von Übermittlungsfehlern und Unkenntnis der Toxizität Methotrexat täglich bereitgestellt und eingenommen wird. Seit 31.10.2012 sollten Hersteller deutlichere Warnhinweise zur einmal wöchentlichen Gabe, z.B. auf der äußeren Umhüllung, aufnehmen. Bei einer Verordnung sollte der geplante Wochentag für die Einnahme auf dem Rezept vermerkt werden. Quelle: Dt. Apo. Ztg. 2012(50): 6104-6 Donepezil: malignes neuroleptisches Syndrom Unsere Arzneimittelüberwachungsbehörde BfArM hat ein Stufenplanverfahren zu Donepezil-haltigen Arzneimitteln (Aricept®) eingeleitet: in Zukunft muss in den Fachinformationen und der Packungsbeilage auf ein mögliches Auftreten eines malignen neuroleptischen Syndroms hingewiesen werden. Dieses potentiell Seite 31 Sicherer verordnen Dr. med. Günter Hopf Seite 32 Sicherer verordnen Dr. med. Günter Hopf KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 lebensbedrohliche Syndrom ist charakterisiert durch Hyperthermie, Muskelsteifigkeit, vegetative Instabilität, Bewusstseinsveränderungen und Erhöhung der Kreatinkinase, sowie nachfolgend Rhabdomyolyse und akutes Nierenversagen. Bereits bei Auftreten von unklarem hohem Fieber muss die Therapie mit Donepezil abgebrochen werden. Der Cholinesterasehemmer wird als Antidementivum eingesetzt und ist von umstrittener Wirksamkeit, vor allem von Kombinationen mit Antipsychotika ist abzuraten. Quelle: Pharm. Ztg. 2013; 158 (9): 99 Kontrastmittelinduzierte Nephropathie Neue Empfehlungen zur Therapie einer kontrastmittelinduzierten Nephropathie (CIN, Anstieg des Serumkreatinins um mehr als 0,5 mg/dl bzw. eine relative Zunahme von über 25 % innerhalb von drei Tagen nach Kontrastmittelgabe) beinhalten keine Gabe von Acetylcystein (ACC) mehr. Auch hohe ACC-Dosen (1200 mg alle 12 Stunden zweimalig vor und nach der Kontrastmittelgabe) wirkten nach einer neuen prospektiven und randomisierten Studie weder protektiv auf ein Auftreten einer CIN noch die Dialysehäufigkeit. Nun werden empfohlen: Gabe einer 0,9 % NACl-Lösung (1 ml/kg/h) mindestens 6 h vor bis 12 h nach Kontrastmittelgabe, alternativ auch 0,84 % Natriumbikarbonatlösung 1 h (3 ml/kg/h) vor und bis 6 h (1 ml/kg/h) nach der Kontrastmittelgabe. Bei Patienten mit einer guten Compliance kann auch eine orale Hydratation erwogen werden. Besonders gefährdete Patienten: Alter über 70 Jahre, bekannte Nierenfunktionseinschränkung mit einer berechneten GFR < 60 ml/min. Quelle: Dtsch.med.Wschr. 2013; 138: 71-8 Kontrastmittel und Nierenfunktion Eigentlich ein alter Hut, schon längst abgehakt, vielleicht kaum noch im Bewusstsein, aber unter Umständen für den Patienten von allergrößter Bedeutung: Das Risikopotenzial jodhaltiger Kontrastmittel für die Nierenfunktion. Die Fakten seien hier deshalb kurz in den Fokus gestellt. Für viele radiologische Untersuchungen (CT, Herzkatheter etc.) werden Kontrastmittel benötigt, um eine vernünftige Aussage treffen zu können. Diese Präparate können eine Reihe ernster Probleme nach sich ziehen. Neben gelegentlichen Schockreaktionen während der Gabe oder folgender Schilddrüsenüberfunktion ist besonders bedenkenswert, dass eine eingeschränkte Nierenfunktion nach Kontrastmittelgabe zu einem völligen Funktionsverlust der Nieren und damit unter Umständen zur Dialysebehandlung führen kann. Bei Untersuchungen mit MRT kommt es seltener ebenfalls zur Notwendigkeit einer Kontrastmittelgabe, hier mit gadoliniumhaltigen Stoffen. Dabei ist die Nierenfunktion ebenfalls von großer Bedeutung, aber mit einem ganz anderen Hintergrund. Bei schwerer Niereninsuffizienz ist die Ausscheidung des Gadolinium verzögert, so dass eine NSF (eine nephrogene systemische Fibrose) auftreten kann. Es handelt sich um eine Bindegewebserkrankung, die unbehandelbar ist und zu schwerwiegenden Nekrosen in Haut, Gelenken und inneren Organen führen und auch tödlich ausgehen kann. Diese relativ seltene Komplikation ist bisher fast nur bei Dialysepatienten oder Menschen mit einer GFR unter 30 ml/min aufgetreten, muss aber immer in Betracht gezogen werden. Auch wenn man sich durch die Kontrolle von Kreatinin und TSH vor der Untersuchung absichert, sollten diese Fakten uns dazu bewegen, die Indikation zu Kontrastmitteluntersuchungen weiterhin streng zu stellen. Dr. med. Joachim Seffrin Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Protonenpumpenhemmer zur Prophylaxe Seite 33 Sicherer verordnen Protonenpumpenhemmer (PPI) werden zunehmend prophylaktisch eingesetzt. Am bekanntesten scheint die zusätzliche Einnahme eines PPI bei einer Dauertherapie eines nichtsteroidalen Antiphlogistikums (NSAID) zu sein, um gastrointestinale unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) dieser Stoffe zu vermeiden. Dieses Prinzip hat jedoch einen gravierenden Nachteil: zusätzlich zu den UAW eines Arzneistoffes können sich die UAW des anderen addieren. Von PPI ist bekannt, dass sie u.a. eine Hypomagnesiämie, eine gesteigerte Fraktur- und Pneumonierate und einen Vitamin-B12-Mangel sowie Interaktionen mit z.B. Thrombozytenaggregationshemmern verursachen können. Dem Autor ist zuzustimmen, dass das individuelle Risiko für Ulzera, Stressläsionen und Blutungen evaluiert werden muss, PPI abgesetzt werden, wenn keine Indikation mehr vorliegt, durch eine versuchsweise Dosisreduktion die niedrigstmögliche wirksame Dosis angestrebt werden soll, eine Intervalltherapie entsprechend der Risikosituation (z.B. bei Chemotherapie) angewandt wird, eine On-Demand-Therapie grundsätzlich vorzuziehen ist. Auch wenn der Gemeinsame Bundesausschuss vor Kurzem der Verordnung von fixen Kombinationen eines NSAID mit einem PPI bei Patienten mit hohem Risiko gastroduodenaler UAW zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen zugestimmt hat, bleiben Zweifel am medizinischen Sinn dieser Kombination: sowohl die wirksame Dosis eines NSAID als auch die Dosis eines PPI sind immer individuell festzulegen, um eine Unter- bzw. Überdosierung einer der beiden Arzneistoffe zu vermeiden. Derzeit auf dem deutschen Markt: Vimovo®, eine fixe Kombination von 500 mg Naproxen und 20 mg Esomeprazol. Quelle: Internist 2013; 54:366 – 371; Dt. Ärztebl. 2013; 110(11): C467 Agomelatin: zu viele UAW Eine französische kritische Fachzeitschrift bezeichnet das A ­ ntidepressivum Agome® latin (Val­doxan ), ein Melatonin-Rezeptoragonist, aufgrund seiner unerwünschten Wirkungen (UAW) und strittigen Wirksamkeit als u ­ nnötig und gefährlich. Unterschiedliche, auch schwere Leberfunktionsstörungen, Hautreaktionen bis hin zum Stevens-Johnson-Syndrom, muskuläre UAW bis hin zu Rhabdomyolyse, mögliche Herzfunktionsstörungen, gastro­-intestinale UAW und zentralnervöse UAW (u. a. Aggression, Schlafstörungen, Tinnitus, Krämpfe, Selbsttötungsgedanken bis hin zu erfolgreichen Versuchen) lassen das Risikoprofil von Agomelatin wenig positiv erscheinen. Die Autoren empfehlen, auch vor e­ iner möglichen Marktrücknahme dieses Antidepressivum nicht zu verordnen. Quelle: Prescr. Internat. 2013; 22: 70-1 NSAR – UAW auf Dünn- und Dickdarm Neben den bekannten UAW auf den Magen wirken nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAR) auch auf Dünn- und Dickdarm ulzerogen, beginnend mit einem subklinischen Mukosaschaden bei 60 bis 70 Prozent der Patienten. Im Dünndarm zeigen sich nach 14-tägiger Einnahme eines NSAR bereits ähnlich häufige Blutungen, Dr. med. Günter Hopf Seite 34 Sicherer verordnen Dr. med. Günter Hopf KVH • aktuell Nr. 3 / 2013 Ulzerationen und konzentrische Diaphragmen mit Stenosen wie nach Langzeiteinnahme. Spezifische COX-2-Inhibitoren zeigen keinen Vorteil, ebenso wie die ­zusätzliche Gabe von H2-Blockern oder Protonenpumpeninhibitoren (PPI). Nur Misoprostol scheint eine Wirkung zu zeigen, ist jedoch aufgrund seiner UAW (Diarrhoe, Bauchkrämpfe) nur bedingt empfehlenswert. Generell sollte bei g ­ astrointestinalen UAW ein Präparat abgesetzt werden – mit schnellem Abheilen entzündlicher Prozesse. Diaphragmatische Stenosen und Strikturen bilden sich jedoch nicht zurück (evtl. Ballondilatation erforderlich). Am Dickdarm verursachen NSAR bei oraler Gabe nur selten UAW. Grundsätzlich können jedoch ähnliche UAW wie am Dünndarm auftreten, vor allem am Colon ascendens. Cave: Die Kombination eines NSAR mit ASS erhöht das Risiko, auch die Low-DoseTherapie mit zum Beispiel 100 mg/d. Fragen nach einer Einnahme von zusätzlichen freiverkäuflichen Präparaten eines NSAR oder ASS vor einer Verordnung dringend zu empfehlen! Quelle: Gastroenterol. 2010; 5: 461-72, nachgedruckt in Hess. Ärztebl. 2013; 1: 19 -28 Bitte beachten Sie zum Thema NSAR auch unsere Beiträge auf den Seiten 22-24 Glukokortikoide: wenig Erfolg beim Tennisellenbogen In einer Zusammenfassung e­ iner amerikanischen Studie zur Anwendung von Glukokortikoiden bei chronischer Epicondylalgia lateralis, dem sogenannten Tennisellenbogen, im Vergleich zu Placeboinjektionen und Physiotherapie wird festgestellt, dass Glukokortikoide in dieser Indikation zu höheren Rezidivraten als Placebo nach einem Jahr f­ ühren (Kurzzeitergebnisse nach 4 Wochen waren für Glukokortikoide noch positiv). Physiotherapie die Ergebnisse nicht verschlechtert, aber auch keine objektiven Vorteile zeigt. Quelle: Dtsch Med Wschr 2013; 138: 769 Neue Arzneistoffe 2012: kritische Einschätzungen In Gegensatz zu oft überschwänglichen Werbeaussagen über die Wirksamkeit neuer Arzneistoffe bleibt eine französische kritische medizinische Zeitschrift bei ihrer Einschätzung, dass seit 2008 (!) kein neuer Arzneistoff einen Preis für einen generellen größeren therapeutischen Fortschritt verdient hat. 82 neue Wirkstoffe bzw. neue Indikationen alter Wirkstoffe wurden bewertet. Boceprevir (Victrelis®) bei chronischer Hepatitis C wurde ein wirklicher Vorteil attestiert, ebenso scheinen Abirateron (Zytiga®) nach Therapieversagen anderer Arzneistoffe bei Prostatakarzinom, Telaprevir (Incivo®) bei chronischer Hepatitis C und Trastuzumab (Abraxane®) zur adjuvanten Therapie bei Brustkrebs vorteilhaft zu sein. Nachdenklich stimmen Einschätzungen wie „nichts Neues“ für 42 und „nicht Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell akzeptierbar“ für 15 neue Arzneistoffe oder Indikationen. In letztere Gruppe fallen u.a. Asenapin (Sycrest®) bei manischen Episoden bipolarer Störungen, Bevacizumab (Avastin®) bei fortgeschrittenem Ovarialkarzinom, Domperidon (Motilium®, Generika) bei gastrointestinalen Störungen, zwei Gliptine zur Therapie eines Diabetes Typ 2. Wenn auch die Beurteilungen etwas streng erscheinen, sie sind vergleichbar mit der Nutzenbewertung des IQWIG, deutlich z.B. bei der Einschätzung von Gliptinen. Ob es bei der ersten Reaktion des Herstellers von Linagliptin (Trajenta®), das Präparat in Deutschland nicht anzubieten, bleiben wird? Seite 35 Sicherer verordnen Dr. med. Günter Hopf Quellen: Prescr. Internat. 2013; 22 (136 und 137): 79 und 105-107 Ein schwarzes Dreieck ... Ab September dieses Jahres sollen Arzneimittel, die einer zusätzlichen Überwachung unterliegen, sowohl in der Packungsbeilage als auch in der Fachinformation mit einem gleichseitigen, auf der Spitze stehenden Dreieck und mit einem zusätzlichen Text versehen werden. Dies gilt für alle Mittel, die seit 2011 zugelassen wurden und neue Arzneistoffe enthalten und generell für alle Biologicals. In anderen europäischen Ländern haben sich diese Warnhinweise bereits bewährt. Mit der Zulassung ist das Risikoprofil eines neuen Arzneistoffes noch längst nicht erfasst. Besondere Risikogruppen wie Kinder und alte Menschen können auf einen neuen Arzneistoff sensibler reagieren. Insbesondere medikamentös behandelte chronisch Kranke fallen oft unter die Ausschlusskriterien einer Zulassungsstudie, sodass zum Beispiel die Frage der Interaktionen mit anderen Arzneistoffen nur unzureichend geklärt ist. Offen bleibt, aus welchen Gründen ein Warnhinweis nicht bereits auf der äußeren Verpackung angebracht werden muss. Es soll Patienten geben, die sich die Gebrauchsinformation nicht ansehen – ebenso wie Ärzte, die einen Blick in die jeweiligen Fachinformationen nicht für nötig erachten. Auch sollen zum Stichtag keine Rückrufe aufgrund der geplanten Änderung erfolgen, noch jahrelang werden sich daher Arzneimittel mit nicht geklärtem Sicherheitsprofil ohne schwarzes Warndreieck im Handel befinden. Für Patienten ist dies sicher nicht von Vorteil. Es bleibt wenigstens zu hoffen, dass der Warnhinweis auch bei der Publikation von Werbeanzeigen nicht vergessen wird. Quelle: Pharm. Ztg. 2013; 158(11):105 Auch Patienten können jetzt Nebenwirkungen melden Aufgrund einer Initiative der EU sollen Patienten und Verbraucher die Möglichkeit bekommen, den Verdacht einer Nebenwirkung direkt der zuständigen Behörde zu melden. In Deutschland sind dies PEI (Paul-Ehrlich-Institut) und BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinalprodukte). Inzwischen wurde dafür diese Website eingerichtet: https://verbraucher-uaw.pei.de/. Die Meldung muss nicht durch Angehörige eines Gesundheitsberufs bestätigt werden, aber das PEI fordert gleich am Seitenkopf alle Patienten auf, wegen der beobachteten eventuellen Nebenwirkung einen Arzt zu konsultieren. Das Institut erklärt auch, dass solche Spontanmeldungen nicht geeignet sind, um daraus eine Statistik über Nebenwirkungen abzuleiten, wohl aber wichtige Signale geben können, um seltene und bisher unbekannte Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen und weiter zu untersuchen. red KVH • aktuell Seite 36 Nr. 3 / 2013 Hausärztliche Leitlinie Multimedikation Empfehlungen zum Umgang mit Multimedikation bei Erwachsenen und geriatrischen Patienten Konsentierung Version 1.00 16.01.2013 Revision bis spätestens Januar 2016 Version 1.00 vom 16.01.2013 Hausärztliche Leitlinie Hausärztliche Leitlinie Multimedikation Multimedikation F. W. Bergert M. Braun K. Ehrenthal J. Feßler J. Gross U. Hüttner B. Kluthe A. Liesenfeld J. Seffrin G. Vetter M. Beyer (DEGAM) C. Muth (DEGAM) U. Popert (DEGAM) S. Harder (Klin. Pharmakol., Ffm) H. Kirchner (PMV) I. Schubert (PMV) Empfehlungen zum Umgang mit Multimedikation Empfehlungen zumund Umgang mit Multimedikation bei Erwachsenen geriatrischen Patienten bei Erwachsenen und geriatrischen Patienten Anmerkung: Die Leitlinie Multimedikation umfasst Konsentierung Version 1.00 insgesamt knapp 100 Seiten. Wir veröffentlichen angesichts des Umfangs Konsentierung Version 1.00 16.01.2013 nur die wichtigsten Aspekte, aufgeteilt auf mehrere Hef16.01.2013 te. In diesem Heft finden Sie den dritten und letzten Teil. Revision bis spätestens Die gesamte Leitlinie einschließlich der im Text erwähnRevision bis spätestens Januar 2016 ten Anhänge und Literaturstellen (Ziffern in eckigen Klammern), die hier Januar 2016nicht abgedruckt sind, finden Sie im Internet unter www.kvhessen.de/Leitlinie oder www. pmvforschungsgruppe.de. Auf dieser Webseite bitte den Cursor in der Menü-Leiste im oberen Teil der Seite Version 1.00 vom 16.01.2013 auf Publikationen positionieren und im aufklappenden Version 1.00 vomklicken. 16.01.2013 Untermenü auf Leitlinien Dann können Sie die gesamte Leitlinie einsehen bzw. als PDF-Datei auf Ihren Computer herunterladen. Eine weitere Bezugsquelle finden Sie unter www.leitlinien.de. Dort oben auf „Leitlinie finden“ klicken, dann links Anbieter auswählen, anschließend führt unter L die „Leitliniengruppe Hessen“ zu den hausärztlichen Leitlinien. F. W. Bergert Braun F. W.M.Bergert K. Ehrenthal M. Braun J. Feßler K. Ehrenthal Gross J.J.Feßler U.J.Hüttner Gross Kluthe U.B.Hüttner A. Liesenfeld B. Kluthe J. Seffrin A. Liesenfeld G.Seffrin Vetter J. M. Beyer (DEGAM) G. Vetter Muth (DEGAM) (DEGAM) M.C.Beyer U.C.Popert (DEGAM) Muth (DEGAM) S. Harder U. Popert (DEGAM) (Klin. Pharmakol., Ffm) S. Harder H. Kirchner (PMV) (Klin. Pharmakol., Ffm) I. Schubert (PMV) H. Kirchner (PMV) I. Schubert (PMV) Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Seite 37 Studienlage zur Medikationsbewertung Beschreibung der Studien Der Prozess der Medikationsbewertung, wie er in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben wurde, steht im Zentrum eines wirksamen Medikamentenmanagements. Durch die Recherche sollte geklärt werden, ob die Durchführung eines Medikamentenreviews positive Effekte auf die Patientenversorgung hat und ob sich dies auch für die hausärztliche Versorgung in Deutschland zeigt. Bei einer ersten orientierenden Recherche in der Cochrane Library fanden sich kontrollierte Studien, die sich mit verschiedenen Fragestellungen zum Thema Medikamentenreview beschäftigten. Die Studien unterschieden sich deutlich hinsichtlich der untersuchten Endpunkte und des Settings, in dem die Untersuchungen durchgeführt wurden (Tabellen stehen in der Originalfassung der Leitlinien im Web – sie sind erreichbar, wie in diesem Heft auf Seite 36 beschrieben). Im Verlauf der Leitlinienarbeit erschienen weitere wichtige Publikationen, in deren Literaturverzeichnissen eine Handsuche durchgeführt wurde. Insbesondere die Literaturangaben des CochraneReviews »Interventions to improve the appropriate use of polypharmacy for older people« [111] sowie der Leitlinie »Multidiciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen« der Niederländischen Hausärztevereinigung [107], die im Mai 2012 veröffentlicht wurden, lieferten wichtige Hinweise auf weitere Publikationen. In Studien eingeschlossene Patienten Alle in unserer Übersicht aufgeführten Studien wurden mit Patienten durchgeführt, die 65 Jahre oder älter waren und Medikamente einnahmen. Die Schwere der Erkrankungen und die Anzahl der eingenommenen Medikamente waren in den meisten Studien nicht definiert. Setting Die Studien wurden in England, Finnland, Dänemark, Irland, Niederlande, Australien und den USA durchgeführt, nur ein Teil davon in ambulanten Einrichtungen wie Arztpraxen, ambulante Zentren, etc.. Intervention Ausgeschlossen wurden Untersuchungen, bei denen der Arzneimittelreview ohne Patientenkontakt »nach Aktenlage« oder in Form einer rein telefonischen Kontaktaufnahme erfolgte sowie Studien, an denen Ärzte im gesamten Review-Prozess und an der Umsetzung nicht beteiligt waren. In einigen Studien war der Medikamentenreview Bestandteil von Versorgungsprogrammen wie z. B. Pharmaceutical Care [115] oder umfassenderen Assessments [82]. Keine der Studien wurde in einer deutschen Hausarztpraxis durchgeführt. Endpunkte Die Tabelle auf der folgenden Seite gibt einen Überblick über die untersuchten Endpunkte. Überwiegend wurde die Angemessenheit und Sicherheit der Arzneitherapie z. B. in Form von Dosierungsfehlern, Veränderungen im Medikamentenmanagement (Absetzen/Ansetzen von Medikamenten) und die Anzahl der Medikamente untersucht. Es wurden auch Studien berücksichtigt, die keine validierten Messinstrumente eingesetzt haben. Studiendauer Die Studiendauer war in fast allen Studien sehr kurz. Sie variierte zwischen 4 Wochen und 1 Jahr. Fazit aus der Studienlage Die Studien sind äußerst heterogen und zeigen bezogen auf einzelne Endpunkte z. T. widersprüchliche Ergebnisse. Da keine der Studien in einem der hausärztlichen Versorgung in Deutschland identischen Setting durchgeführt wurde, ist es schwierig, die Ergebnisse auf unseren Versorgungsbereich zu übertragen. Die Heterogenität der angewendeten Methoden zur Medikationsbewertung und der untersuchten Endpunkte kommen dabei erschwerend hinzu. Auswirkungen auf die Morbidität konnten in keiner der Studien nachgewiesen werden und sind bei der älteren Klientel (> 65 Jahre) aufgrund möglicher Störfaktoren (Confounder) auch nur schwer auf die Intervention zurückzuführen. Darüber hinaus sind die Studien mit Laufzeiten von 4 Wochen bis zu maximal einem Jahr bei den beschriebenen Interventionen zu kurz, um eine Beeinflussung harter Endpunkte nachzuweisen oder auszuschließen. Verbesserungen des Gesundheitszustandes der Studienteilnehmer sind innerhalb der Studiendauer daher nicht zu erwarten. Der Cochrane-Review von Patterson et al. Seite 38 KVH • aktuell [111] beschränkte sich von vornherein auf Studien mit den primären Endpunkten »Angemessenheit der Arzneimittelverordnung, Prävalenz der angemessenen Arzneimittelverordnungen und Krankenhauseinweisung«. Als sekundäre Outcomes wurden medikamentenbezogene Probleme wie z. B. Nebenwirkungen, Medikamenteninteraktionen oder Medikationsfehler, Adhärenz und Lebensqualität untersucht. Dabei wurden ausschließlich Studien berücksichtigt, die validierte Instrumente zur Messung der Outcomes (MAI/Beers Kriterien) verwendeten. Die Autoren kamen zu folgendem Schluss: Eine signifikante Verbesserung der Arzneitherapie bei Multimedikation ließ sich nicht nachweisen. Maßnahmen wie z. B. Pharmaceutical Care [64], bei denen Apotheker mit Ärzten gemeinsam das Arzneimittelmanagement durchführen, schei- Endpunkt Lebensqualität Nr. 3 / 2013 nen jedoch vorteilhaft zu sein in Bezug auf eine Reduzierung von unangemessener Verschreibung und medikamentenbezogenen Problemen. Vor dem Hintergrund der recherchierten Studien zum Medikamentenreview und den Ergebnissen des beschriebenen Cochrane-Reviews kommt die Leitliniengruppe zu folgender Empfehlung: Trotz der z. T. widersprüchlichen Evidenz in Bezug auf einzelne Endpunkte weisen die meisten Studien auf einen Nutzen hinsichtlich der Reduktion von Fehlern im Arzneimittelmanagement und der Verbesserung der Lebensqualität hin. Deshalb empfiehlt die Leitliniengruppe, die Durchführung eines strukturierten Medikamentenreviews (= Medikationsbewertung) bei Patienten mit Multimedikation. Ergebnis Kein Effekt Positiver Trend, nicht signifikant Signifikante Verbesserung Leichte Senkung, nicht signifikante Senkung der Krankenhauseinweisungen Studien Krska [78], Lisby [91], RESPECT [115] Lenaghan [89] Walsh [158] Krska [78] Reduzierung der Arzneimittel Lenaghan [89], Walsh [158] Keine signifikante Reduzierung Vinks [155] Anzahl der DDD Anzahl der Verordnungsänderungen Medikamenteninduzierte Probleme Signifikante Reduzierung der DDD Pitkala [110] Mehr Verordnungsänderungen durch die Intervention Lampela [82] Reduzierung Jameson [72], Vinks [155] Keine signifikante Reduzierung Pitkala [110], Vinks [155] Angemessenheit der Verordnungen Risikoreduktion für unangemessene Medikamente und Unterversorgung Gallagher [50] Keine signifikante Verbesserung RESPECT [115] Patientenzufriedenheit (Wieder-) Einweisung ins Krankenhaus, Dauer des stationären Aufenthalts Anzahl der verordneten Arzneimittel Aufdecken von Dosierungsfehlern, Positiver Effekt unangemessenen Arzneimitteln Inanspruchnahme von Leistungen, Leichter Anstieg nachgewiesen Anzahl der Arztbesuche Kein Effekt nachgewiesen Kein Effekt nachgewiesen Stürze Funktionale und kognitive Verbes- Kein Effekt nachgewiesen serungen Kein Effekt nachgewiesen Mortalität Kosten Walsh [158] Krska [78] Lisby [91] Gallagher [50] Williams [161] Gallagher [50], Lenaghan [89], Lisby [91], RESPECT [115] Kostenreduktion Williams [161] Kein Effekt nachgewiesen Jameson [72], Krska [78] Tabelle: Übersicht zu den Endpunkten in den herangezogenen Studien. Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Die Leitliniengruppe hält eine regelmäßig durchgeführte Medikationsbewertung für eine wirksame Maßnahme, mit der Verordnungs- oder Einnahmefehler aufgedeckt und die Arzneimittelsicherheit erhöht werden können. Sie schließt sich damit den Empfehlungen aus anderen Ländern an, wie z. B. der Royal Society of Physicians und der Royal Seite 39 Pharmaceutical Society of Great Britain [24, 119], Niederlande [107] oder Neuseeland [26], in denen Medikamenten-Reviews bereits Bestandteil nationaler Versorgungsprogramme sind. Die Tabelle auf Seite 38 zeigt die Studienergebnisse hinsichtlich der untersuchten Endpunkte. Schnittstellen Dem Sozialgesetzbuch zufolge (§11 (4) SGB V) haben alle Leistungserbringer eine sachgerechte Anschlussversorgung ihrer Versicherten sicherzustellen. Im Krankenhaus stellt das Entlassungsmanagement einen Teil der Krankenhausbehandlung dar. Hierbei soll der reibungslose Übergang in die ambulante Versorgung, Reha oder Pflege gewährleistet werden (zu den Inhalten eines Entlassungsmanagements s. Anhang). Zum Entlassungsmanagement gehört u.a. auch der Arztbrief mit Angaben zu Diagnosen und Therapievorschlägen inkl. der Medikation. Hierbei sollte die Wirkstoffbezeichnung und – sofern mehrere vergleichbare Wirkstoffe vorhanden sind – ein preisgünstigerer Therapievorschlag benannt werden (§11 (5c) SGB V). Veränderungen der Medikation durch einen Krankenhausaufenthalt sind häufig. Dort wird abgesetzt, umgestellt, neu eingestellt und die Dosis verändert etc. Diese Änderungen sind anhand des Entlassungsbriefes oftmals nicht nachvollziehbar. Somit ist eine Kommunikation mit dem Patienten über die neue Therapie erschwert, es besteht die Gefahr, dass die Kenntnis von Unverträglichkeiten bzw. Interaktionen verloren geht, dass Therapiekonzepte nicht nachvollziehbar sind, dass befristete Medikationen unbeabsichtigt in eine Dauertherapie überführt werden oder es zu Akzeptanzproblemen mit der Entlassungsmedikation bei Arzt und Patient kommt. Empfehlungen für ein Entlassungsmanagement (d. h. Aufgaben des Krankenhauses) sehen in Bezug auf die Medikamentenversorgung u. a. folgende Punkte vor (zit. nach Reuss, Deutsche Krankenhausgesellschaft, 2012 [114]): Dokumentation der Medikation in Gegenüberstellung zur Medikation bei der Einweisung (Wunsch der einweisenden Ärzte), Angaben über den Zeitraum der im Entlassungsbrief aufgelisteten Medikation, Hinweis auf Blutwertkontrollen etc., Patientenberatung und -schulung zu bestimmten Medikamenten. Aus Sicht der Leitliniengruppe ist eine frühzeitige Information des Hausarztes vor Entlassung und eine Begründung zur Medikationsumstellung erforderlich. Bei der Therapieübernahme ist zu berücksichtigen, dass die stationären Verweilzeiten oft sehr kurz sind und ein stabiler Wirkstoffspiegel (steady state) eines Pharmakons, der sich meist erst nach 4 bis 5 Halbwertszeiten einstellt, dort nicht erreicht wird, d. h. im Krankenhaus kann Wirksamkeit und Verträglichkeit der Therapie oft nicht beurteilt werden. Bei Anwendung mehrerer, sich gegenseitig beeinflussender Stoffe verschärft sich diese Situation noch. Für die Verordnungen nach Krankenhausentlassung trägt der Hausarzt alleine die Verantwortung (ökonomisch und juristisch). Die Berufung auf die Empfehlungen des Krankenhauses schützen den Hausarzt nicht vor Regress- bzw. Schadenersatzansprüchen. In einem Forschungsvorhaben (HEICare) wurde eine strukturierte EDV-gestützte Kommunikation (AiD Praxis) zur Medikation zwischen ambulantem und stationärem Sektor entwickelt und erprobt. Ziele waren die Verbesserung der Arzneimittelsicherheit (Erkennen von Interaktionen, Vermeidung unnötiger Therapieumstellungen zwischen den Sektoren) sowie der Kommunikation zwischen einweisenden Hausärzten und stationären Behandlern. Die Evaluation ergab, dass die Zahl der stationären Therapieumstellungen reduziert werden konnte. Ein solches System zur Unterstützung der Verordnungsentscheidung zu implementieren und die Kommunikation zu verbessern, ist – so die Autoren der Studien – jedoch ein langwieriger und ressourcenintensiver Prozess [92]. Seite 40 KVH • aktuell Vor einer Krankenhauseinweisung bzw. Vorstellung bei einem Spezialisten ist zu empfehlen, dem Patienten wesentliche Vorbefunde, Fragestellung und Einweisungs-/Überweisungsindikation sowie den aktuellen Medikationsplan mitzugeben, mit dem Hinweis, diese Informationen dem behandelnden Arzt persönlich zu übergeben. Patienten sollte die Wahl einer Stammapotheke empfohlen werden, in der sie alle Arzneimittel (verordnet/OTC) dokumentieren lassen können. Dies erlaubt die Prüfung auf Interaktionen und auf Doppelverordnungen sowie die Klärung der Medikamenteneinnahme nach Therapieumstellung oder Austausch durch Rabattvertrag. Außerdem können die Patienten einen Ausdruck der Medikationsliste ihrem Hausarzt vorlegen. Wünschenswert wäre auch eine engere Koope- Nr. 3 / 2013 ration zwischen Hausärzten und Apothekern (s.w.o. zur Arzneimittelabgabe). Klinische Pharmazie ist Bestandteil der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Apothekern. Beispiele für ein Medikationsmanagement werden regelmäßig publiziert (s. DAZ: Reihe POP – Patientenorientierte Pharmazie). In verschiedenen Studien (UK, USA, Deutschland [8, 55, 59, 118, 120, 153]) wurde gezeigt, dass durch Apotheker/klinische Pharmazeuten arzneimittelbezogene Probleme erkannt und gelöst werden konnten (s. Arzneimittelabgabe). Ein Modellprojekt zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Arzneitherapie durch ein Medikationsmanagement, das sich an Patienten wendet, die mehr als fünf systemisch wirkende Arzneimittel dauerhaft einnehmen müssen, ist zur Zeit (2012) von der KBV und ABDA in Vorbereitung. Qualitätsindikatoren Eine Reihe der in der Leitlinie genannten Empfehlungen zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit bei Multimedikation können theoretisch einem Monitoring mittels Qualitätsindikatoren unterzogen werden. Da auch die in der Literatur vorgeschlagenen Indikatoren eine eigene Erfassung vorsehen, die zumindest gegenwärtig nicht ohne entsprechende Softwareunterstützung machbar ist, werden im Folgenden nur einige mögliche Indikatoren (ohne weitere Operationalisierung) benannt: Der AQUIK-Indikatorensatz führt unter verschiedenen Themen Qualitätsindikatoren auf, die auch für die Thematik Multimedikation herangezogen werden können (www.kbv.de/aquik.html). Arzneimittelsicherheit Dauermedikation: Anteil der Patienten mit vier und mehr Dauermedikamenten, deren Medikation in den letzten 12 Monaten überprüft wurde. Orale Antikoagulation: Anteil der Patienten unter dauerhafter oraler Antikoagulation (Anm. Phenprocoumon, LL-Gruppe), bei denen mindestens eine INR-Wert-Bestimmung alle 6 Wochen erfolgte. Polymedikation: Anteil der Patienten (65 Jahre und älter) innerhalb der letzten 12 Monate, die täglich mindestens sechs ärztlich verordnete Medikamente einnehmen. Anmerkung: Aus Sicht der Leitliniengruppe handelt es sich hier nicht um einen Qualitätsindikator, sondern um eine Kennziffer zur Darstellung einer Risikogruppe. Praxismanagement Dokumentation von Medikamentenallergien: Die Dokumentation von Medikamentenallergien und unerwünschten Arzneimittelwirkungen erfolgt nach einem Standardverfahren und ist klar erkennbar. Aus dem Set an QISA Indikatoren [142] sind folgende Indikatoren nutzbar: Interaktionen: Anteil der Arzneimittelpatienten mit Wirkstoffkombinationen, die aufgrund ihres Interaktionspotentials zu vermeiden sind (an allen Arzneimittelpatienten). Potentiell inadäquate Medikation (PIM) / PRISCUS: Anteil der älteren Patienten mit potentiell inadäquater Medikation (problematischen Wirkstoffen) an allen älteren Patienten. (Anmerkung: Die Leitliniengruppe empfiehlt, diesen Indikator als Risikoindikator einzusetzen und nicht als Qualitätsindikator, da noch Diskussionbedarf hinsichtlich der möglichen Alternativen zu einigen hausärztlich relevanten Wirkstoffgruppen (z. B. Neuroleptika, Antidepressiva, Nitrofurantoin) besteht.) Weitere mögliche Indikatoren sind: Medikationsplan: Anteil der Patienten mit Nr. 3 / 2013 KVH • aktuell Multimedikation und einem aktuellen Medikationsplan. MAI: Anteil der Risikopatienten mit Multimedikation, bei denen ein jährlicher Arzneimittelcheck erfolgte. Medikationsreview: Anteil der Patienten, bei Seite 41 denen für jedes Medikament eine Indikation dokumentiert wurde. Monitoring: Verwendet die Praxis ein Verfahren zur Durchführung von empfohlenen Routinekontrollen und gibt es ein Recallsystem zur Einbestellung des Patienten? Multimedikation im Alter Die mit zunehmendem Alter ansteigende Multimorbidität führt häufig zur Multimedikation [1, 20]. Aufgrund der im Alter veränderten Pharmakokinetik und -dynamik [94, 149, 150] sind ältere Menschen auch besonders anfällig für Arzneimittelnebenwirkungen. Es kann zu einer Wirkverstärkung, aber bei einzelnen Medikamenten auch zu Wirkabschwächungen kommen. Typische Veränderungen im Alter sind eine verzögerte renale Elimination und eine höhere Empfindlichkeit auf anticholinerge und sedierende Effekte. Teilweise wirken Arzneimittel aber auch vermindert (z. B. Beta-Blocker bei verminderter Ansprechbarkeit der Rezeptoren) oder können paradoxe Reaktionen auslösen. Arzneimittel können aber auch das Risiko für alterstypische Komplikationen wie z. B. Stürze erhöhen. Insgesamt haben 70- bis 80-Jährige im Vergleich zu jüngeren Patienten ein 4- bis 5-mal häufigeres Risiko für unerwünschte Arzneimittelwirkungen [46]. Wichtigste Risikofaktoren für unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) im Alter sind [79, 99, 100, 112, 113, 143] eingeschränkte Nierenfunktion, Gebrechlichkeit: Physiologische Kompensationsmöglichkeiten sind erschöpft, niedriges Körpergewicht, Multimorbidität und Multimedikation [99, 100]. Die Ausprägung der Veränderungen ist dabei sehr individuell und lässt sich keiner festen Altersgrenze zuordnen. Mit Ausnahme der Beurteilung der Nierenfunktion gibt es keine weiteren Tests, die einfach durchzuführen sind und eine Einschätzung der altersbedingten Pharmakokinetik und -dynamik ermöglichen. Neben physiologischen Veränderungen können bei einer Multimedikation im Alter arzneimittelbedingte Probleme nicht nur durch Drug-DrugInteraktionen sondern auch durch Drug-DiseaseInteraktionen bedingt sein. Hinzu kommen noch weitere patientenseitige Gründe wie Anwendungsprobleme und auch Verständnisprobleme für die Therapie (Compliance/Adhärenz) [58]. Im Laufe des Lebens verändern sich die entscheidenden pharmakologischen Parameter (inter-) individuell sehr unterschiedlich. 1.Die Resorption von Medikamenten verschlechtert sich im Alter für viele Stoffe, auch weil Tabletten nicht mit der ausreichenden Trinkmenge zur Auflösung eingenommen werden [84, 100, 112]. 2. Elektrolytverschiebungen (z. B. bei Laxantienabusus, Fehlernährung, Exsikkose) können die Wirksamkeit wasserlöslicher Medikamente behindern. 3. Veränderungen der Verteilungsräume [112]: a) Reduktion des Gesamtkörperwassers von 42% auf 33% des Körpergewichts (KG) sowie der Extrazellularflüssigkeit, d. h. niedrigeres Verteilungsvolumen hydrophiler Arzneimittel wie ACE-Hemmer, Digoxin, Lorazepam, Metronidazol, L-Thyroxin. Es droht u. U. Kumulation verstärkt durch: sinkendes Durstgefühl im Alter trotz Flüssigkeitsmangel (sog. »Altersexsikkose«), Abnahme der Nierenleistung, nicht altersangepasste Arzneimitteldosen. b) Zunahme des Körperfetts auf bis zu 30% des KG, Abnahme der Muskelmasse, d. h. erhöhtes Verteilungsvolumen und verlängerte Wirkdauer durch vermehrte und längere Speicherung in den vergrößerten Fettdepots bei lipophilen Arzneimitteln wie z. B. Amoxicillin, Furosemid, Diazepam, Nitrazepam, Oxazepam [17]. 4. Die renale Elimination nimmt im Alter ab [112, 146]: Faustregel: Ab dem 30. Le- Seite 42 KVH • aktuell bensjahr vermindert sich die Nierenclearance (Glomeruläre Filtrationsrate: eGFR) jährlich um 1%, bei über 70-Jährigen ist die eGFR um 30 bis 50% vermindert [11, 101]. Renal ausgeschiedene Wirkstoffe müssen im Alter meist niedriger dosiert werden, z. B. Digoxin, Metronidazol, Theophyllin, Triamteren. In der Regel wird von den Laborärzten aus Alter, Geschlecht und Kreatinin entsprechend der MDRD-Formel der adäquate Clearance Wert für eingeschränkte Nierenfunktion errechnet (MDRD = modification of diet in renal disease). 5. Interaktion und Enzyminduktion, z. B. Verdrängung aus der Eiweißbindung (z. B. von Phenprocoumon durch NSAR) [25]. Körpereigene (z. B. endogene Steroide, Östrogene), körperfremde Stoffe (Nahrungsmittel, z. B. Grapefruit, Johanniskraut) und Medikamente können das Enzymsystem der P-450-Zytochrome bei der Verstoffwechselung hemmen oder induzieren und den Medikamenten-Wirkspiegel dadurch verändern [84, 85, 96, 112, 131, 143]. 6. Veränderung der Pharmakodynamik: Empfindlichkeitssteigerung oder paradoxe Wirkung im Alter für zentral wirksame Stoffe (wie Benzodiazepine, Chlorpromazin) erfordern ggf. eine Dosisreduktion oder eine Änderung der Therapie. Individuelle Nutzen-RisikoAbschätzung im Alter Aufgrund der im Alter veränderten Pharmakokinetik und -dynamik sowie zunehmender Multimorbidität gelten zahlreiche Medikamente wegen ihrer potenziellen Nebenwirkungen als ungeeignet für ältere Menschen. Bei diesen Medikamenten kann das Risiko für Nebenwirkungen bzw. alterstypischer Komplikationen den klinischen Nutzen überwiegen. Eine Weiterverordnung dieser Medikamente ist nicht sinnvoll. Dies gilt insbesondere dann, wenn besser verträgliche Alternativen vorhanden sind [83]. Vor dem Hintergrund der potentiellen Gefährdung, die für Ältere durch die Anwendung von unangemessenen Arzneimitteln entsteht, haben sich seit den 1990er Jahren mehrere Arbeitsgruppen damit beschäftigt, Informationen über die potenziell schädigende Wirkungen bei Älteren zusammenzutragen. Dabei wurden einzelne Arzneimittel und Medikamentengruppen hinsichtlich ihres Gefähr- Nr. 3 / 2013 dungspotenzials (meist in Konsensusprozessen) systematisch bewertet und gelistet (z. B. Beers-Liste). Für den deutschen Versorgungsraum wurde im Jahr 2011 die PRISCUS-Liste veröffentlicht. Die PRISCUS-Liste umfasst 83 Arzneistoffe des deutschen Arzneimittelmarktes, die im Expertenkonsens als potentiell inadäquate Medikation (PIM) bei älteren Patienten eingestuft wurden. Grundlage der Bewertung waren u. a. Studien zu unerwünschten Wirkungen. Im Verordnungsprozess sollte überprüft werden, ob diese Medikation abgesetzt bzw. durch einen anderen Arzneistoff ersetzt werden kann. Die Liste nennt auch Therapiealternativen und beschreibt Maßnahmen (Monitoringparameter, Dosisanpassungen), die erfolgen sollen, falls die Verordnung eines potenziell ungeeigneten Medikamentes nicht vermeidbar ist. Die Entwicklung der Liste war Bestandteil des Aktionsplans Arzneimitteltherapiesicherheit des Bundesministeriums für Gesundheit. Grundlage war eine Literaturrecherche und eine qualitative Analyse verschiedener international gebräuchlicher PIM-Listen wie z. B. von Beers, Laroche, Mc Leod, Fick [16, 40, 83, 97, 144]. Die Liste kann kostenfrei unter http://priscus.net/download/PRISCUS-Liste_ PRISCUS-TP3_2011.pdf heruntergeladen werden. Dort sind auch sogenannte Fast-PIMs aufgeführt, die nicht von allen Bewertern gleichermaßen als problematisch eingestuft wurden. Hier sind u. a Diclofenac, Naproxen und Etoricoxib sowie einige Chinolone genannt. PIMs der PRISCUS-Liste werden häufig verordnet: So ergab eine Auswertung von bundesweiten AOK-Daten für das Jahr 2010 eine Behandlungsprävalenz bei 65-Jährigen und Älteren von 24%. Hochgerechnet auf Deutschland erhielten somit 4 Millionen ältere Personen mindestens einmal einen dieser Wirkstoffe verordnet [147]. Da einige Substanzen der PRISCUS-Liste auch als OTC verfügbar sind, liegt die PIM-Prävalenz noch höher. Die PRISCUS-Liste ist in einem DELPHI-Prozess entstanden und wird zur Zeit validiert. Bei ihrer Nutzung zur Bewertung der Medikation ist dieser Entwicklungsprozess zu berücksichtigen. Die Leitliniengruppe versteht die Liste als eine Hilfestellung zum kritischen Umgang mit Medikamenten und nicht als eine Verbotsliste. Aus hausärztlicher Sicht sind einige der gelisteten Wirkstoffe unverzichtbar. Tischversion Multimedikation Leitfragen des MAI Gibt es eine Indikation für das Medikament? Stellen Sie sicher, dass für jedes Medikament noch ein aktueller Verordnungsanlass vorliegt. Prüfen Sie, ob ggf. eine Verordnung aufgrund einer Nebenwirkung erfolgte (Cave: Verordnungskaskaden). Ist das Medikament wirksam für die Hilfestellung erhalten Sie hier durch die Nationalen VersorgungsIndikation und Patientengruppe? Leitlinien, hausärztliche Leitlinien, AWMF-Leitlinien, Cochrane reviews, IQWIG Berichte. Stimmt die Dosierung? Prüfen Sie die Nierenwerte des Patienten. Sind die Einnahmevorschriften Prüfen Sie das Therapieregime hinsichtlich Tageszeit der Einnahme, korrekt? Einnahme zu Mahlzeiten, aktualisieren Sie den Medikationsplan. Sind Einnahmevorschriften Fragen Sie den Patienten, ob er mit der Anwendung zurecht kommt, praktikabel? lassen Sie sich die Anwendung von Inhalern, Pens etc. vorführen (Vorsicht: Teilen von Tabletten möglichst vermeiden). Gibt es klinisch relevante Interaktionen Nach Möglichkeit interaktionsärmere Wirkstoffe auswählen, bei zu anderen Medikamenten? elektronischem Interaktionscheck auf klinische Relevanz achten (s. Tischversion Interaktionen). Gibt es klinisch relevante Interaktionen Kontraindikationen/Anwendungsbeschränkungen beachten. zu anderen Krankheiten/Zuständen? Wurden unnötige DoppelverschreiPrüfen Sie, ob Wirkstoffe aus einer therapeutisch-pharmakolobungen vermieden? gischen Gruppe indiziert sind. Ist die Dauer der medikamentösen Prüfen Sie, seit wann der Patienten das Medikament einnimmt und Therapie adäquat? ob für die weitere Einnahme noch Evidenz besteht. Wurde die kostengünstigste Alternative Wirtschaftlichkeit beachten. gewählt? Wird jede behandlungsbedürftige Auch bei Patienten mit Multimedikation kann Unterversorgung Indikation therapiert? vorliegen. Liegt ein aktueller Einnahmeplan vor? Plan aktualisieren, prüfen, ob Patient oder Angehöriger die Angaben versteht. Ist die Nierenfunktion bekannt? Es wird empfohlen zur Überprüfung der Nierenfunktion die z. B. mit der Cockcroft-Gault-Formel oder der MDRD-Formel errechnete glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) heranzuziehen. Prüfen Sie, ob Ihre Patientenakte aktuelle Angaben zur Nierenfunktion bei Ihren (älteren) Patienten mit Multimedikation enthält. Ist die Adhärenz zur Therapie gegeben? Prüfen Sie in festgelegten Intervallen, was der Patient über die Medikamente weiß, ob Bedenken gegen die Einnahme bestehen und ob der Patient der Auffassung ist, dass die Medikamente weiterhin für ihn von Nutzen sind. Fragen Sie den Patienten, wie er die Medikation für den Tag vorbereitet und was er tut, wenn eine Einnahme vergessen wurde. Quelle: Medication Appropriateness Index (MAI); modifiziert nach Hanlon JT, Schmader K, Samsa GP, Weinberger M, Uttech KM, Lewis IK, Cohen HJ, Feussner JR. A method for assessing drug therapy appropriateness. J Clin Epidemiol 1992; 45: 1045-1051 Korrespondenzadresse Ausführliche Leitlinie im Internet Hausärztliche Leitlinie PMV forschungsgruppe Fax: 0221-478-6766 Email: [email protected] http:\\www.pmvforschungsgruppe.de www.pmvforschungsgruppe.de > publikationen > leitlinien www.leitlinien.de/mdb/downloads/lghessen/ multimedikation-lang.pdf »Multimedikation« Hier MAI Tischversion 1.0 April 2013 XtraDoc Verlag Dr. Wiedemann, Winzerstraße 9, 65207 Wiesbaden PVSt Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, 68689 PH863453V Hausärztliche Leitlinie Multimedikation Tischversion: Bestandsaufnahme/MAI Medikationsbewertung Zentraler Bestandteil im Prozess der Verordnungsentscheidung ist die kritische Prüfung und Bewertung der vorhandenen Medikation. Die Leitliniengruppe empfiehlt hierzu die Fragen des Medication Appropriateness Index (MAI) – hier auch als Instrument zur Medikationserfassung als Voraussetzung zur Bewertung der Angemessenheit für gezielte Intervention bezeichnet. Umseitig finden Sie die Leitfragen des MAI. Die Fragen sind generell bei jeder Neuverordnung relevant, vorrangig die Fragen nach der Evidenz für die Indikation, der Dosierung und Aktualität des Medikationsplanes. Die Leitlinie empfiehlt einen Medikationsplan zum Ausdrucken (siehe: http://www.akdae.de/ AMTS/Massnahmen/docs/Medikationsplan.pdf). Im Rahmen einer umfassenden Medikationsbewertung (brown bag) werden diese Fragen. für alle Medikamente, die der Patient zum Beispiel mit in die Praxis gebracht hat, systematisch durchgegangen. Fragen Sie immer, ob der Patient einen aktuellen und gut verständlichen Medikationsplan besitzt! Darüber hinaus bietet die Bestandsaufnahme die Möglichkeit festzustellen ob ggf. Anwendungsprobleme bestehen, die dazu führen, dass der Patient die Medikation nicht wie ursprünglich vorgesehen, einnimmt. Die Anwendungsprobleme können vielfältiger Art sein. So können Handhabungsprobleme vorliegen wie unzulängliche Tablettenteilung, falsches Inhalieren oder inadäquate Anwendung von Augentropfen. Auch eine Gefahr der Verwechslung von Packungen und Tabletten ist zu beachten. Die Bestandaufnahme und – zu einem späteren Zeitpunkt – das Monitoring stellen eine gute Gelegenheit dar, nach unspezifischen Symptomen zu fragen, da diese Folgen einer Therapieänderung sein könnten, wie z. B.: Trockener Mund Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Schläfrigkeit oder reduzierte Wachsamkeit, Schlafstörung Schwäche Bewegungsstörungen, Tremor, Stürze Obstipation, Diarrhoe oder Inkontinenz, Appetitlosigkeit, Übelkeit Hautausschläge, Juckreiz Depression oder mangelndes Interesse an den üblichen Aktivitäten Verwirrtheit (zeitweise oder dauerhaft) Halluzinationen Angst und Aufregung Nachlassen des sexuellen Interesses Schwindel Ohrgeräusche Denken Sie bei unspezifischen Symptomen immer auch an die Möglichkeit einer Verordnungskaskade, d. h. ein neu aufgetretenes Symptom wird behandelt, obwohl es eine Folge der bestehenden Therapie ist. So können durch die Verordnung von Calciumantagonisten Ödeme auftreten. Daraufhin erfolgt eine Verordnung von Diuretika mit der möglichen Folge von Obstipation, Dranginkontinenz, erhöhtem Harnsäurespiegel und Osteoporose. Diese Diagnosen lösen dann möglicherweise ihrerseits wieder Verordnungen aus mit dem Risiko weiterer unerwünschter Wirkungen. Je komplexer die Medikation, um so schwieriger ist es, die Ursache einer Beschwerde zu erkennen.