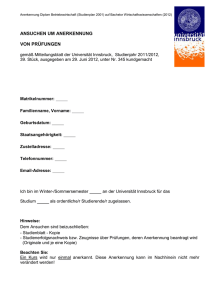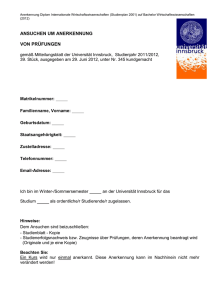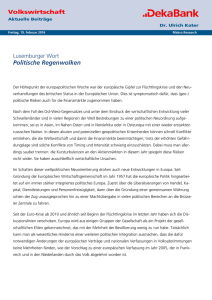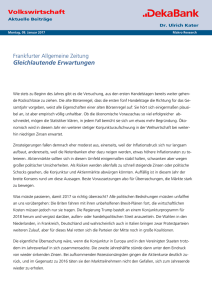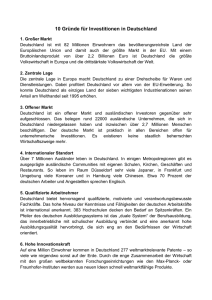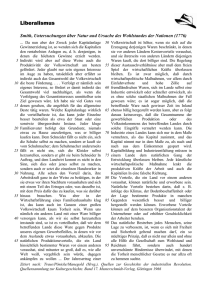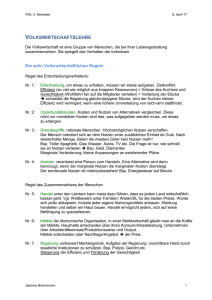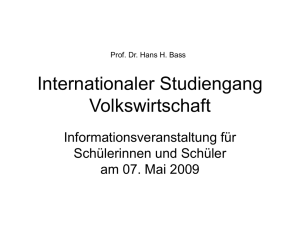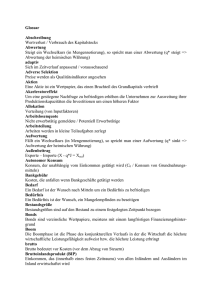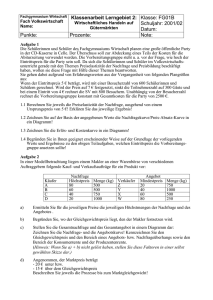Schwerpunkt - Die Volkswirtschaft
Werbung
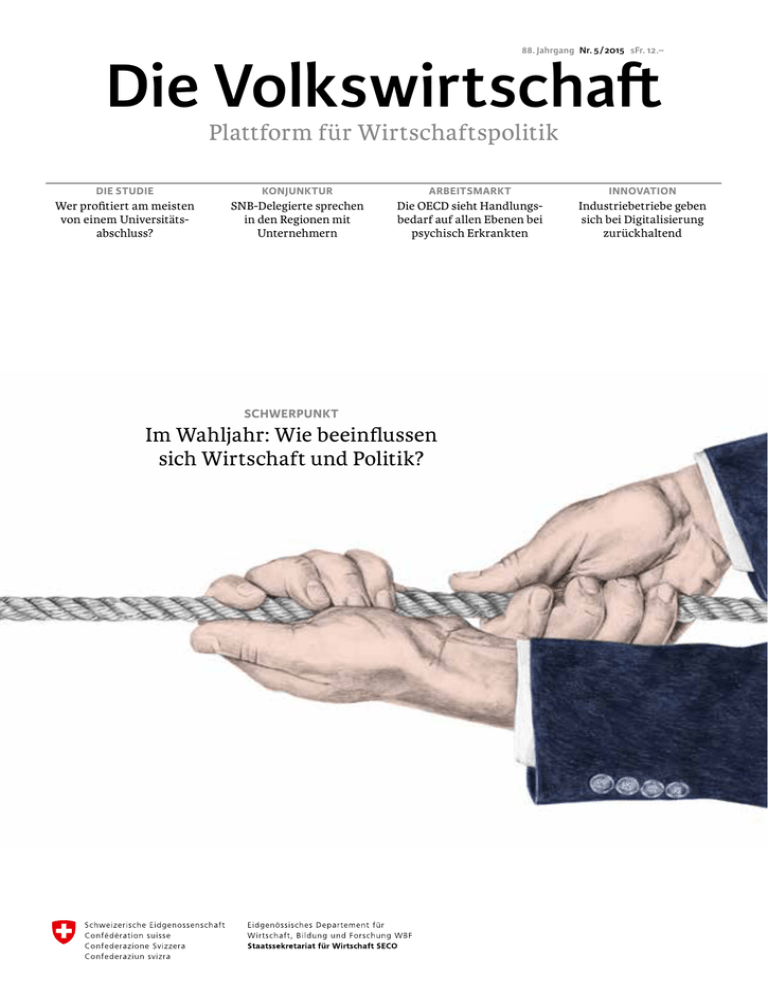
88. Jahrgang Nr. 5/2015 sFr. 12.– Die Volkswirtschaft Plattform für Wirtschaftspolitik DIE STUDIE KONJUNKTUR ARBEITSMARKT INNOVATION Wer profitiert am meisten von einem Universitäts­ abschluss? SNB-Delegierte sprechen in den Regionen mit Unternehmern Die OECD sieht Handlungs­ bedarf auf allen Ebenen bei psychisch Erkrankten Industriebetriebe geben sich bei Digitalisierung ­zurückhaltend SCHWERPUNKT Im Wahljahr: Wie beeinflussen sich Wirtschaft und Politik? Wichtiger HINWEIS ! Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf kein anderes Element platziert werden! Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand die Schutzzone nicht verletzen! Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken! Siehe auch Handbuch „Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone www. cdbund.admin.ch EDITORIAL Primat der Wirtschaft oder Primat der Politik? Sie halten die neue «Volkswirtschaft» in den Händen. In der aktuellsten Überarbeitung des Magazins – der ersten nach 14 Jahren – haben wir im Vorfeld vieles hinterfragt und überprüft. Die «Volkswirtschaft» verstärkt, was sie auszeichnet. Sie ist eine wirtschaftspolitische Publikation mit einem Schwerpunktthema, das sowohl in die Tiefe als auch in die Breite geht. Wir wollen uns noch klarer als Plattform für wirtschaftspolitische Meinungsbildung positionieren. Fragestellungen werden von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Und: Die Stärke der «Volkswirtschaft» bleiben die Autoren. Die renommierten Experten aus Wissenschaft, Forschung und Verwaltung vermitteln Authentizität und Fachwissen auf hohem Niveau. Zudem erhält die «Volkswirtschaft» einen modernen Print- und Onlineauftritt. Die verbesserte Leserführung, neue Gefässe und exklusive Studienergebnisse steigern die Attraktivität der Zeitschrift zusätzlich. Eine wesentliche Neuerung ist die Tablet-App. Das Wahljahr 2015 bildet die Ausgangslage für das Schwerpunktthema der erneuerten Ausgabe: Wie beeinflussen sich Wirtschaft und Politik? Die Forderung nach dem Primat der Politik hat durch die Finanzkrise Aufwind erhalten, denn die Krise führte zu einer Regulierungswelle. Antworten liefern sowohl die Wirtschafts- als auch die Politikwissenschaften. Gerade in der Politischen Ökonomie, das heisst in der Erforschung politischer Prozesse mittels der ökonomischen Methodik, arbeiten Forscher aus beiden Disziplinen Hand in Hand. Ökonomen und Politologen halten sich bei der Autorenschaft entsprechend die Waage. Im Hinblick auf den Wahlherbst interessiert uns die folgende Frage: Beeinflusst die Wirtschaftslage in der Schweiz das Wahlergebnis? Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre. Susanne Blank und Nicole Tesar Chefredaktorinnen «Die Volkswirtschaft» INHALT Schwerpunkt 6 11 14 Schweizer Rezepte gegen überhöhte Staatsausgaben funktionieren Regierungen beeinflussen Konjunkturzyklen aus wahltaktischen Gründen Die entzauberte Konkordanz als Problem für die Schweizer Wirtschaft Christoph A. Schaltegger, Christian Frey Universität Luzern Gebhard Kirchgässner Universtität St. Gallen Silja Häusermann Universität Zürich « 28 Peter A. Fischer, Leiter der Wirtschaftsredaktion der «NZZ» im Interview 18 23 Interessengruppen verlieren in der Schweizer Politik an Einfluss Wie beeinflusst die Entschädigung die Disziplin und die Selektion von Politikern? Manuel Fischer Universität Bern Pascal Sciarini Universität Genf Thomas Brändle Eidgenössische Finanzverwaltung «Wirtschaft und Politik haben sich voneinander. entfernt.» 34 40 Kleine Parteien sind Verlierer des föderalen Wahlsystems Wirtschaftslage beeinflusst Wahlen in der Schweiz kaum Adrian Vatter Universität Bern Georg Lutz Universität Lausanne und Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften FORS « INHALT Themen 52 55 58 KONJUNKTUR ARBEITSMARKT INNOVATION Delegierte der Nationalbank messen den Puls der Wirtschaft in den Regionen Politik muss bei psychischen Erkrankungen handeln Schweizer Unternehmen sehen Digitalisierung als Chance Attilio Zanetti, Hans-Ueli Hunziker Schweizerische Nationalbank Katrin Jentzsch Bundesamt für Sozialversicherungen Maggie Graf Staatssekretariat für Wirtschaft Annette Hitz Psychische Gesundheit Schweiz Patricia Deflorin, Christian Hauser, Maike Scherrer-Rathje Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur 62 65 67 STEUERN ARBEITSMARKT STEUERN Die Reform der Verrechnungssteuer stärkt den Finanzplatz Schwarzarbeit-Inspektoren sollen mehr Kompetenzen erhalten Schattenwirtschaft in der Schweiz geht zurück Daniela Schwarz Eidgenössische Steuerverwaltung Peter Jakob Staatssekretariat für Wirtschaft Friedrich Schneider Johannes Kepler Universität Linz Christoph A. Schaltegger Universität Luzern, Universität St. Gallen Felix Schmutz Universität Luzern und Institut für Finanzdienstleistungen Zug Spots AUFGEGRIFFEN DIE STUDIE ZAHLEN CARTOON Wie Ökonomen die Politik weiterbringen Bildungsrenditen: Wer profitiert? Infografik und Wirtschaftskennzahlen Politik in der Wirtschaft Eric Scheidegger Staatssekretariat für Wirtschaft Lionel Perini Schweizerischer Nationalfonds Staatssekretariat für Wirtschaft Stephan Bornick 46 48 70 72 IMPRESSUM Herausgeber Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, ­Bildung und Forschung WBF, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern Redaktion Chefredaktion: Susanne Blank, Nicole Tesar Redaktion: Käthi Gfeller, Christian Maillard, Stefan Sonderegger Redaktionsausschuss Eric Scheidegger (Leitung), Antje Baertschi, ­Susanne Blank, Eric Jakob, Evelyn Kobelt, Peter Moser, Markus Tanner, Nicole Tesar Leiter Ressort Publikationen: Markus Tanner Holzikofenweg 36, 3003 Bern Telefon +41 (0)58 462 29 39 Fax +41 (0)58 462 27 40 E-Mail: [email protected] Internet: www.dievolkswirtschaft.ch App: erhältlich im Appstore Layout Patricia Steiner, Marlen von Weissenfluh Zeichnungen Alina Günter, www.alinaguenter.ch Cartoon Stephan Bornick, www.tgd.ch Abonnemente/Leserservice Telefon +41 (0)58 462 29 39 Fax +41 (0)58 462 27 40 E-Mail [email protected] Abonnementpreise Inland Fr. 100.–, Ausland Fr. 120.–, Einzelnummer Fr. 12.– (MWST inkl.) Erscheint 10x jährlich in deutscher und franzö­sischer Sprache (französisch: La Vie économique), 88. Jahrgang, mit Beilagen. Druck Somedia Production, Kasernenstrasse 1, 7007 Chur Der Inhalt der Artikel widerspiegelt die Auffassung der Autorinnen und Autoren und deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung der Redaktion. Der Nachdruck von Artikeln ist, nach Bewilligung durch die Redaktion, unter Q ­ uellenangabe gestattet; Belegexemplare e­ rwünscht. ISSN 1011-386X SCHWERPUNKT Im Wahljahr: Wie beeinflussen sich ­ Wirtschaft und Politik? Die eidgenössischen Wahlen im Herbst werfen aus ökonomischer Sicht die Frage auf: Welchen Einfluss hat die Wirtschaftslage auf den Wahlentscheid? Die Frankenstärke dürfte sich laut einer politologischen Untersuchung kaum auf die Parteienwahl auswirken (S. 40). Im Wahljahr verhalten sich Regierungen oft berechnend – und verschieben etwa heikle Budgetentscheide (S. 11). Bei der Höhe der Finanzausgaben spielen zudem Kabinettsgrösse und Regierungssystem eine Rolle (S. 6). In der Schweiz lancieren die Regierungsparteien in zunehmendem Ausmass Initiativen aus wahltaktischen Überlegungen. Das gefährdet das auf Kompromissen beruhende Konkordanzsystem (S. 14). WIRTSCHAFT UND POLITIK Schweizer Rezepte gegen überhöhte Staatsausgaben funktionieren Ohne Beschränkungen droht jedem Staatsbudget die Übernutzung. Entscheidend sind die institutionellen Rahmenbedingungen. So geben grosse Kabinette mehr Geld aus als kleine. Finanzreferenden und Schuldenbremsen beschränken hingegen das Ausgabeverhalten. Christoph A. Schaltegger, Christian Frey Abstract Das Staatsbudget stellt eine von den Einwohnern eines Landes gemeinsam genutzte Ressource dar. Inwiefern dieser die Übernutzung droht, hängt wesentlich von den institutionellen Rahmenbedingungen ab. So wirkt sich etwa die Regierungsgrösse auf die Staatsausgaben aus: Je mehr Mitglieder ein Kabinett zählt, desto höher sind die Ausgaben. Auch weitere institutionelle Faktoren wie die Konkordanz, der Fiskalföderalismus, die direkte Demokratie und Schuldenbremsen beeinflussen die Finanzpolitik. Sie erklären zu einem guten Teil die im internationalen Vergleich solide finanzielle Situation der Schweiz. Griechenland weist diesbezügliche weit weniger vorteilhafte Rahmenbedingungen auf. D Finanzreferenden und Schuldenbremsen haben sich als taugliche Instrumente erwiesen, um die Staatsausgaben im Griff zu haben. 6 as Problem der Allmende – des gemeinschaftlichen Eigentums – ist in der Ökonomie wohlbekannt: Es handelt sich um eine begrenzte Ressource in kollektivem Besitz, von deren Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann. Damit besteht der individuelle Anreiz, die Allmende ausgiebig zu nutzen, denn nur ein Teil der damit verbundenen Kosten entfällt auf einen selbst. Der Rest wird in Form von externen Kosten der Allgemeinheit überbürdet. In der Konsequenz droht der Allmende die Übernutzung. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Analog verhält es sich bei den Staatsfinanzen. Auch staatlich finanzierte Projekte zeichnen sich durch eine inhärente Asymmetrie zwischen dem Kreis der Nutzniesser und der Entscheidungsträger sowie demjeniger der Kostenträger aus. Während eine partikulare Interessengemeinschaft von einem staatlichen Programm profitiert, verteilen sich die Kosten auf alle Steuerzahler. Politische Akteure setzen staatliche Ressourcen zum Vorteil der von ihnen vertretenen Interessengemeinschaft ein – die Kosten trägt die Allgemeinheit. Durch Stimmentausch und die geschickte Bündelung von Ausgabenprogrammen lassen sich im politischen Prozess auch für kleine Interessengruppen Mehrheiten erreichen. Genau wie der Allmende droht auch dem Staatsbudget die Übernutzung. Das Problem der fiskalischen Allmende ist in der Volkswirtschaftslehre etabliert1. Die grundlegende Ursache liegt in der Fragmentierung der Gesellschaft in Interessengemeinschaften mit ihren jeweiligen politischen Akteuren. Beispiele sind etwa die geografische Fragmentierung innerhalb des Parlaments in Gliedstaaten und Wahlkreise oder die Fragmentierung entlang von Parteigrenzen innerhalb einer Regierungskoalition. Frühe Arbeiten wurden inspiriert durch ein bekanntes Phänomen, wofür sich in den USA der Begriff pork barrel politics eingebürgert hat: Um die eigene Wiederwahl zu sichern, versuchen die Kongressabgeordneten durch Zusatzartikel zu neuen Gesetzen Staatsausgaben gezielt im eigenen Wahlkreis anfallen zu lassen. Diese Art der Kirchturmpolitik, bei der sich Politiker für regionale Interessen einsetzen, ohne die finanziellen Konsequenzen für die Allgemeinheit zu beach- ISTOCK ten, ist auch in der Schweiz bekannt. Sie äusserte sich jüngst etwa im «föderalen Wunschkonzert» bei der Finanzierung des Ausbaus der Bahninfrastruktur2. Breite Koalitionen haben Vor- und Nachteile Im Gegensatz zum präsidentiellen System mit Mehrheitswahlrecht in den USA kennt Europa mehrheitlich parlamentarische Systeme mit Verhältniswahlrecht, woraus sich häufig Koalitionsregierungen ergeben. Eine erste Reihe empirischer Analysen des Phänomens der fiskalischen Allmende untersucht den Effekt, der durch die Koalitionsgrösse ausgelöst wird. Die Hypothese lautet: Je mehr Parteien an einer Regierungskoalition beteiligt sind und auf das Staatsbudget Einfluss nehmen können, desto stärker die Fragmentierung und desto gravierender das Problem der fiskalischen Allmende. Die empirischen Belege sind diesbezüglich jedoch ambivalent3. Eindeutige negative Effekte der Koalitionsgrösse auf die Finanzpolitik können nicht festgestellt werden. Eine mögliche Erklärung hierfür liefert die Theorie von Alesina und Rosenthal (1996). Zwar ist die Fragmentierung in grossen Koalitionen stärker ausgeprägt, gleichzeitig repräsentieren breitere Koalitionen tendenziell aber auch einen grösseren Anteil der Bevölkerung. Der Einfluss einzelner Parteien und Interessengruppen auf die Finanzpolitik fällt damit geringer aus. Insbesondere in einer Konkordanzdemokratie – wie der Schweiz – dürfte sich die Fragmentierung in mehrere Regierungsparteien somit kaum negativ auswirken. In präsidentiellen Systemen steigt die Gefahr, dass Politiker sogenannte Kirchturmpolitik betreiben, indem sie sich für regionale Interessen einsetzen. 1 Vgl. Buchanan & Tullock (1962) sowie Weingast et al. (1981). 2 Vgl. Müller-Jentsch (2013): Föderales Wunschkonzert der Verkehrsinvestitionen 3 Vgl. Schaltegger und Feld (2009). Die Volkswirtschaft 5 / 2015 7 WIRTSCHAFT UND POLITIK Grosse Kabinette geben mehr aus 4 Niskanen (1971). 5 Gemäss Stigler (1971). 6 Vgl. Schaltegger und Feld (2009) für eine Übersicht. 7 Ebd. Das Problem der fiskalischen Allmende kann sich jedoch auch innerhalb des Regierungskabinetts auswirken: Jeder Minister hat Einfluss auf die fiskalpolitischen Entscheide des Gremiums und gleichzeitig Interesse daran, die finanziellen Ressourcen möglichst in das eigene Ressort zu lenken – etwa zur Maximierung des Einflusses der eigenen Behörde auf die Politik4 oder aufgrund der Kollusion von Ministerien mit den wichtigen Interessengruppen für das jeweilige Ressort (regulatory capture)5. Nicht zuletzt sind Magistratspersonen immer auch gewählte Politiker, die eine bestimmte Wählerschicht vertreten. Das Allmende-Problem sollte sich somit innerhalb des Kabinetts umso stärker auswirken, je grösser die Anzahl der Ressortminister – und damit die Fragmentierung – ist. Eine starke Stellung des Finanzministeriums oder eine Regierungschefin mit Richtlinienkompetenz dürfte dem Phänomen hingegen aufgrund ihrer Verantwortung für das Gesamtbudget tendenziell entgegenwirken. Tatsächlich findet sich für OECD-Staaten deutliche empirische Evidenz: Das Defizit, die Staatsausgaben und insbesondere die Transferausgaben fallen umso höher aus, je grösser die Fragmentierung im Regierungskabinett ist.6 Fiskalische Allmende gibt es auch in der Schweiz Das Allmende-Phänomen existiert auch in den Schweizer Kantonen.7 Heute zählen die Regierungen je nach Kanton zwischen fünf und sieben Weitere institutionelle Einflüsse auf die Finanzpolitik Mehrheitswahlrecht (Majorz) vs. Verhältniswahlrecht (Proporz) In einem Wahlsystem nach dem Majorz-Prinzip ist die Rechenschaftspflicht eines Politikers gegenüber seinem Wahlkreis unmittelbar. Die Verantwortlichkeiten sind klar zuordenbar. Gelegentlich hat dies aber den Effekt, dass zur Sicherung der Wiederwahl Kirchturmpolitik verfolgt wird. Gleichzeitig ist es jedoch im Majorz-System für eine starke Partei deutlich einfacher, eine Parlamentsmehrheit zu erreichen. Bei einem Proporz-Wahlsystem sind in der Regel Koalitionen aus mehreren Parteien notwendig. Diese Fragmentierung der Regierung begünstigt das Problem der fiskalischen Allmende. Zur Steigerung der Wiederwahlchancen sind Regierungen insbesondere vor Wahlen an einer Steigerung der Staatsausgaben interessiert. Persson und Tabellini (2003) finden denn auch in Staaten mit Proporz-Wahlsystemen eine systematische Ausdehnung der Sozialausgaben in Wahljahren, in Majorz-Systemen lässt sich hingegen kein solcher Zusammenhang finden. 8 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Parlamentarische vs. präsidentielle Regierungssysteme In einem parlamentarischen System kann die Regierung jederzeit durch das Parlament aufgelöst werden. Um dieses Risiko zu vermindern, ist eine disziplinierte Koalition mit einer stabilen Mehrheit notwendig. Kirchturmpolitik für einzelne Wahlkreise wird durch die starke Parteibindung eingeschränkt. Transfers oder Steuererleichterungen für breite Bevölkerungsschichten sind jedoch wahrscheinlicher. In einem präsidentiellen System wird die Regierung hingegen direkt vom Volk für eine fixierte Legislaturperiode gewählt. Die Regierung ist somit nicht von einer Parlamentsmehrheit abhängig. Die Parteibindung nimmt tendenziell ab, während Kirchturmpolitik wahrscheinlicher wird. Gleichzeitig sind jedoch grosse Ausgabenprogramme für breite Bevölkerungsschichten kaum mehrheitsfähig. Persson und Tabellini (2004) finden denn auch, dass die Staatsausgaben in präsidentiellen Systemen um 5 Prozentpunkte des Bruttoinlandprodukts geringer ausfallen als in vergleichbaren Staaten mit einen parlamentarischen Regierungssystem. Kompetenz des Finanzministers Eine Möglichkeit, das Problem der fiskalischen Allmende einzuschränken besteht darin, den Finanzminister mit starken Kompetenzen auszustatten. Hallerberg et al. (2006) weisen für die EU-Staaten nach: Insbesondere bei ideologisch homogenen Regierungen lässt sich dadurch die Verschuldung einschränken. Bei grösseren Koalitionen mit teils ideologischen Differenzen – wie sie in parlamentarischen Systemen verbreitet sind – vermag sich der Finanzminister hingegen schlechter gegenüber Regierung und Parlament durchzusetzen. Hier eignen sich stattdessen Koalitionsverträge oder eine Richtlinienkompetenz des Regierungschefs mit strikt festgehaltenen Fiskalzielen, um das Problem der fiskalischen Allmende einzugrenzen. Politische Stabilität und Amtsdauer des Finanzministers Je länger die Amtsdauer eines Finanzministers, desto grösser der Anreiz und die Möglichkeit, sich durch eine nachhaltige Finanzpolitik auszuzeichnen. Ein langjähriger Finanzminister verfügt über eine gestärkte Position innerhalb der Regierung wie auch gegenüber Parlament und Interessengruppen. Häufige Regierungswechsel schwächen dagegen seine Position. Feld und Schaltegger (2010) haben diese Hypothese für die Schweiz anhand einer historischen Datenreihe seit Bestehen des modernen Bundesstaates (1849 bis 2007) getestet: Tatsächlich kann festgestellt werden, dass – kontrolliert um andere Einflussfaktoren – das Defizit sowie die Ausgaben tendenziell geringer sind, je länger sich der Finanzminister im Amt befindet. Fiskalföderalismus und Steuerwettbewerb Die fiskalische Dezentralisierung und der sich daraus ergebende Steuerwettbewerb schränken die Ausdehnung der Staatsbudgets nachweislich ein. Unter dem Druck des Wettbewerbs wird die Politik gehalten, die Steuern moderat zu setzen und öffentliche Güter effizient bereit zu stellen. Eine Übernutzung der staatlichen Ressourcen wird dadurch reduziert. Feld et al. (2010) weisen diesen Effekt empirisch für die Schweizer Kantone nach. Je höher der Anteil der Gemeinden an den Staatseinnahmen und je stärker der Wettbewerbsdruck in einem Kanton, desto geringer die Steuereinnahmen. Der Steuerwettbewerb führt tendenziell zu einer Verschiebung: weg von Steuern, hin zu Nutzungsgebühren. Damit wird die Äquivalenz zwischen Nutzer und Kostenträger bei staatlich bereitgestellten Gütern gestärkt. SCHWERPUNKT Mitglieder. Dabei haben sich über die Zeit verschiedene Veränderungen ergeben. In der jüngeren Vergangenheit haben etwa Obwalden (2002), Luzern (2003) sowie Glarus (2006) ihre Regierungen auf fünf Mitglieder verkleinert. Zuvor reduzierten Bern (1989), Appenzell I. Rh. (1995) und Nidwalden (1997) die Anzahl der Regierungspersonen von neun auf sieben. Die Unterschiede zwischen den Kantonen, sowie die Veränderungen über die Zeit, erlauben es, den Einfluss der Regierungsgrösse auf die kantonale Finanzpolitik zu untersuchen. Die Analyse der kantonalen Finanzpolitik der Jahre 1980 bis 1998 von Schaltegger und Feld (2009) ergibt einen robusten Effekt durch die Fragmentierung: je grösser die Regierung, desto höher – unter sonst gleichen Umständen – die kantonalen Staatsausgaben wie auch die Kantonseinnahmen. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Problem der fiskalischen Allmende kein rein theoretisches Konstrukt ist, sondern sich nachweislich – etwa innerhalb der kantonalen Exekutiven – auf die Finanzpolitik auswirkt. Diese Analyse ist Teil einer vielfältigen politökonomischen Forschung, die Auswirkungen der institutionellen Rahmenbedingungen auf die Finanzpolitik untersucht. Neben der Fragmentierung einer Koalition oder des Kabinetts hat diese Forschungsliteratur weitere institutionelle Variablen identifiziert, die das Phänomen der fiskalischen Allmende erwiesenermassen beeinflussen (siehe Kasten). Finanzreferendum als Gegenmittel Führt das Problem der fiskalischen Allmende tendenziell zur Übernutzung staatlicher Ressourcen, so stellt sich die Frage: Welche Institutionen wirken dem entgegen? Es soll hier auf zwei Mechanismen eingegangen werden: das Finanzreferendum sowie die Schuldenbremse. Direktdemokratische Institutionen stärken die Kontrolle durch die Bürger. Verhandlungen unter Interessengruppen sowie Stimmentausch zulasten der Allgemeinheit sind im Rahmen von Initiativ- oder Referendumsabstimmungen eingeschränkt. Viele Schweizer Gemeinden kennen etwa ein obligatorisches Finanzreferendum, das durchgeführt werden muss, sobald ein Projekt eine bestimmte Ausgabenschwelle überschrei- tet. Untersuchungen zeigen: Finanzreferenden haben einen signifikant negativen Effekt auf die Verschuldung und auf das Ausgabenniveau.8 Gemäss einer Simulation fällt die Pro-Kopf-Verschuldung in einer Gemeinde mit einem Finanzreferendum um In den Gemeinden mit 23% bis 45% geringer aus. Auch auf Ebene der Kantone ­Finanz­referendum gibt es vergleichbare empirische sinkt die Pro-KopfEvidenz; 17 Kantone kennen ein Verschuldung stark. obligatorisches Finanzreferendum. Es zeigt sich: Die kantonalen Staatsausgaben fallen um 19% geringer aus, wenn sie – um andere Einflussfaktoren bereinigt – einem solchen Referendum unterworfen sind.9 In einer Auswertung historischer Daten über das 20. Jahrhundert findet sich zudem ein Effekt von 12% tieferen Kantonsausgaben.10 Das Finanzreferendum scheint somit ein effektives Gegenmittel gegen die allzu starke Ausbeutung der fiskalischen Allmende zu sein.11 Schuldenbremsen bewähren sich 8 Feld und Kirchgässner (2001a, 2001b) sowie Feld, Kirchgässner und Schaltegger (2011). 9 Feld und Matsusaka (2003). 10 Funk und Gathmann (2011). 11 Eine alternative Interpretation des Einflusses direktdemokratischer Institutionen wäre, dass das Stimmvolk fiskalisch konservativer ist als die verantwortlichen Politiker. Da Politiker jedoch vom selben Stimmvolk gewählt werden, bleibt diese Interpretation zumindest fragwürdig. Vielmehr scheint das Problem der fiskalischen Allmende zu einer Verzerrung der finanzpolitischen Entscheide der Politik zu führen. Direktdemokratische Institutionen können diese Verzerrung korrigieren. 12 Funk und Gathmann (2011). 13 Lüchinger & Schaltegger (2013). Einzelne Kantone (wie St. Gallen seit 1929) weisen eine lange Tradition von Budgetregeln auf. Im Rahmen der Diskussion um die Schuldenbremse auf Bundesebene haben seit 2001 zehn Kantone entsprechende Regeln eingeführt. Dabei konnte nachgewiesen werden: Kantonale Schuldenbremsen verringern Haushaltsdefizite signifikant. Indem Budgetregeln die Staatsausgaben auf die Höhe der Einnahmen beschränken, kann ein Aufschieben der Steuerlast in die Zukunft verhindert werden.12 Zudem unterstützen Schuldenbremsen die Finanzminister dabei, das Ausgabenverhalten ihrer Regierungskollegen in Grenzen zu halten. Denn Finanzminister sind oft versucht, ihre Regierungskollegen durch pessimistische Budgetprognosen in Zaum zu halten.13 Das Resultat sind prognostizierte Budgetdefizite, die sich anschlies­send nicht oder in geringerem Ausmass realisieren. Lüchinger und Schaltegger (2013) stellen die Hypothese auf, dass sich dieses taktische Verhalten der Finanzminister durch die Einführung einer kantonalen Schuldenbremse teilweise erübrigt. Und tatsächlich ergibt eine empirische Analyse: Die Einführung einer kantonalen SchulDie Volkswirtschaft 5 / 2015 9 WIRTSCHAFT UND POLITIK denbremse verringert – deutlicher noch als die tatsächlichen Defizite – die prognostizierten Defizite. Die Budgetprognosen werden durch die Einführung von Budgetregeln also genauer. Kantonale Schuldenbremsen scheinen die Finanzministerin somit zu entlasten (bzw. zu unterstützen). Sie sind offenbar ein effektiveres Mittel gegen das Problem der fiskalischen Allmende als taktisch übermässig konservative Budgetprognosen. Effektivste Mechanismen setzen sich durch 14 OECD Fiscal Decentralisation Database Das Problem der fiskalischen Allmende ist kein theoretisches Konstrukt, sondern ein sowohl anekdotisch wie auch empirisch belegtes Problem der Finanzpolitik, das in unterschiedlichen Varianten auftritt. Um das Allmende-Problem einzuschränken, ist die institutionelle Ausgestaltung von zentraler Bedeutung, wie die politökonomische Forschung zeigt. Durch den ausgeprägten Fiskalföderalismus und die institutionelle Vielfalt ist die Schweiz ein ideales Untersuchungsobjekt dieser Forschung. Gleichzeitig scheinen sich aus der Vielfalt der im föderalen Labor entwickelten Mechanismen die effektivsten durchzusetzen. Es sind dies: kleine Regierung, Konkordanzdemokratie, Fiskalföderalismus, Referendumsrechte und Schuldenbremse. Die Relevanz der Institutionen zeigt sich in Staaten, in denen die diesbezüglichen Voraussetzungen weit weniger vorteilhaft sind. So ver- fügt zum Beispiel Griechenland über ein rein repräsentatives parlamentarisches System, das jahrzehntelang von zwei abwechselnd regierenden Parteien dominiert wurde. Das Kabinett von Ministerpräsident Samaras (2012 bis 2015) zählte nicht weniger als 23 Minister. Im Jahr 2011 wurden über 96% der Steuern vom griechischen Zentralstaat vereinnahmt.14 Und seit dem Beitritt zur Eurozone 2001 wurden die Stabilitätskriterien des Vertrags von Maastricht in keinem einzigen Jahr eingehalten. Unter diesen institutionellen Rahmenbedingungen liessen sich gravierende fiskalische Fehlentwicklungen offensichtlich nicht verhindern. Christoph A. Schaltegger Professor (Ordinarius) für Politische Ökonomie an der Universität Luzern und Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft und Finanzrecht der Universität St. Gallen. Christian Frey Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Luzern. Literatur Alesina, A. und Rosenthal, H. (1996). A theory of divided government. Econometrica, 64, 1311–1341. Buchanan, J.M. und Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent. University of Michigan Press, Ann Arbor. Feld, L.P., Kirchgässner, G. und Schaltegger, C. A. (2010). Decentralized taxation and the size of government: Evidence from Swiss state and local governments. Southern Economic Journal, 27–48. Feld, L.P. und Kirchgässner, G. (2008). On the effectiveness of debt brakes: the Swiss experience. In R. Neck und J.-E. Sturm (Eds.), Sustainability of public debt (pp. 223–255). Cambridge: MIT Press. Feld, L.P. und Kirchgässner, G. (2001a). The political economy of direct legislation: direct democracy and local decision making. Economic Policy, 33, 329–367. 10 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Feld, L.P. und Kirchgässner, G. (2001b). Does direct democracy reduce public debt? Evidence from Swiss municipalities. Public Choice, 109, 347–370. Feld, L.P. und Matsusaka, J.G. (2003). Budget referendums and government spending: evidence from Swiss cantons. Journal of Public Economics, 87, 2703–2724. Feld, L.P. und Schaltegger, C.A. (2010). Political stability and fiscal policy: time series evidence for the Swiss federal level since 1849. Public Choice, 144(3-4), 505–534. Funk, P. und Gathmann, C. (2011). Does direct democracy reduce the size of government? New evidence from historical data 1890-2000. Economic Journal, 121, 1252–1280. Hallerberg, M., Strauch, R. und Von Hagen, J. (2007). The design of fiscal rules and forms of governance in European Union countries. European Journal of Political Economy, 23(2), 338–359. Luechinger, S. und Schaltegger, C.A. (2013). Fiscal rules, budget deficits and budget projections. International Tax and Public Finance, 20(5), 785–807. Niskanen, W.A. (1971). Bureaucracy and Representative Government. Chicago University Press, Chicago. Persson, T. und Tabellini, G. (2004). Constitutions and economic policy. Journal of Economic Perspectives, 75–98. Persson, T. und Tabellini, G. (2003). The Economic Effects of Constitutions: What Do the Data Say? MIT Press, Cambridge and London. Schaltegger, C.A. und Feld, L.P. (2009). Do large cabinets favor large governments? Evidence on the fiscal commons problem for Swiss Cantons. Journal of Public Economics, 93(1), 35–47. Stigler, G.J. (1971). The theory of economic regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, 2, 3–21. Weingast, B.R., Shepsle, K. und Johnson, C. (1981). The political economy of benefits and costs: a neoclassical approach to distributive politics. Journal of Political Economy, 96, 132–163. SCHWERPUNKT Regierungen beeinflussen Konjunkturzyklen aus wahltaktischen Gründen Regierungen sind an einer im Wahljahr pulsierenden Wirtschaft interessiert. Deshalb haben sie einen Anreiz, die Konjunktur so zu beeinflussen, dass vor den Wahlen sowohl Arbeitslosenquote als auch Teuerungsrate niedrig sind. Diese sogenannten politischen Zyklen sind vor allem in repräsentativen Demokratien relevant, sie sind aber auch für die Schweiz von Interesse. Gebhard Kirchgässner Abstract Schwankungen im Wirtschaftsablauf können in der Privatwirtschaft ihren Ursprung haben, aber auch durch wirtschaftspolitische Massnahmen erzeugt werden. So kann eine Regierung versuchen, die Konjunktur so zu beeinflussen, dass sie ein möglichst gutes Wahlergebnis erwarten kann. Insbesondere wenig Arbeitslosigkeit und eine geringe Teuerung zum Wahlzeitpunkt sind dazu von Vorteil. Man spricht in diesem Zusammenhang vom politischen Konjunkturzyklus. Der vorliegende Artikel bespricht die drei in der Literatur bekannten Varianten: den opportunistischen Zyklus, den ideologischen Zyklus und den Budgetzyklus. Die ersten beiden sind im rein parlamentarischen System anzutreffen. Für die Schweiz mit ihrem Konkordanzsystem ist vor allem der Budgetzyklus relevant, da Politiker vor den Wahlen kaum heikle Entscheidungen treffen dürften. I FOTO: KEYSTONE Gewisse Entscheide einer Regierung begünstigen ihre Wiederwahl. Bei den Finanzausgaben spricht man von sogenannten Budgetzyklen. m parlamentarischen System trägt die Regierung – zumindest auf den ersten Blick – Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung. Für ihren Wahlerfolg sind insbesondere Arbeitslosigkeit und Preisentwicklung bedeutend: Je höher die Arbeitslosenquote und die Inflationsrate sind, desto geringer sind – unter sonst gleichen Umständen – ihre Chancen auf Wiederwahl.1 Dies schafft Anreize, die wirtschaftspolitischen Instrumente so einzusetzen, dass die wirtschaftliche Situation zum Wahlzeitpunkt möglichst gut ist. Arbeitslosigkeit und Inflation sollten dann möglichst niedrig sein, auch wenn sie danach möglicherweise wieder ansteigen. Dadurch können Konjunkturschwankungen ausgelöst werden, auch wenn die private Wirtschaft von sich aus keine Zyklen erzeugt. Der opportunistische Zyklus Der Erste, der einen politischen Konjunkturzyklus mit einem formalen Modell beschrieben hat, war US-Ökonom William D. Nordhaus (1975). Er ging davon aus: Eine Regierung möchte bei der nächsten Wahl einen möglichst hohen Stimmenanteil erreichen. Nach ihrer Wahl sorgt sie zunächst für eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit, um die Inflation zu verringern. Danach senkt sie die Arbeitslosenquote bis zur nächsten Wahl wieder ab. Da die Inflationsrate nur verzögert reagiert, hat zum Wahlzeitpunkt nicht nur die Arbeitslosigkeit ihren Tiefpunkt, sondern auch die Inflationsrate ist vergleichsweise niedrig. Dies kann sich von Legislaturperiode zu Legislaturperiode wiederholen, weshalb man von politisch erzeugten Konjunkturschwankungen reden kann.2 Dieses Modell hat zunächst für die Wirtschaftstheorie Bedeutung. Davor ging man in der Konjunkturtheorie davon aus, dass der private Sektor Schwankungen erzeugt und dass die Regierung – wie ein wohlmeinender Diktator – alles daransetzt, diese Schwankungen auszugleichen oder zumindest zu dämpfen. Die Diskussion drehte sich vor allem darum, ob die Regierung dazu überhaupt in der Lage ist und ob sie durch ihr Handeln diese Schwankungen nicht etwa verstärkt oder unbeabsichtigt sogar erzeugt. Schliesslich wirken die wirtschaftspolitischen Instrumente erst verzögert, und die Länge dieser Verzögerungen variiert Die Volkswirtschaft 5 / 2015 11 WIRTSCHAFT UND POLITIK im Zeitablauf. Zudem ist die tatsächliche wirtschaftliche Situation zum Zeitpunkt, wenn über wirtschaftspolitische Massnahmen entschieden werden muss, häufig noch nicht genau bekannt. Regierungen sind am eigenen ­Wohlergehen interessiert Das Nordhaus-Modell stellt einen Paradigmenwechsel dar: Politiker verfolgen in der Konjunkturpolitik ihre eigenen Interessen genauso – und genauso wenig – wie alle anderen Menschen. Der Regierung wird nicht mehr unterstellt, ihr oberstes Ziel sei die Wohlfahrt der Bevölkerung. Sondern: Es geht ihr primär um ihr eigenes Wohlergehen und jenes ihrer Klientel. Da sie für ihre Wiederwahl die Zustimmung der Mehrheit der Wähler benötigt, muss die Regierung deren Interessen ebenfalls berücksichtigen. Solange sie die Maximierung ihres Wahlerfolgs anstrebt, verhält sie sich opportunistisch gegenüber den Wählern und verfolgt keine eigenen Ziele. Man spricht daher auch vom opportunistischen Zyklus. Damit sich die Erzeugung eines Konjunkturzyklus für die Regierung rentiert, müssen die Wähler bei ihrer Entscheidung vergangene Ereignisse schwächer gewichten als gegenwärtige. Das kann damit zusammenhängen, dass sie vergangene Ereignisse vergessen, aber auch damit, dass sie die gegenwärtige Regierungspolitik als stärkeren Indikator für die in Zukunft zu erwartende Politik ansehen als die Handlungen der Regierung in der Vergangenheit. Eine schwächere Gewichtung der Vergangenheit muss daher der Annahme rationalen Verhaltens nicht widersprechen. Andererseits goutieren die Wähler eine solche Politik kaum, wenn sie sich regelmässig wiederholt. Auch wenn die Wähler keine rationale Erwartungen im strengeren Sinn haben, kann man davon ausgehen: Sie sind lernfähig, durchschauen das Verhalten der Regierung und «bestrafen» diese bei den nächsten Wahlen entsprechend. Trotzdem könnten für die Regierung Anreize bestehen, so zu handeln. Denn die Wähler mögen zwar rational sein, aber sie sind nicht vollständig informiert. Deshalb kann eine Regierung versuchen, dies auszunutzen. Um dies abzubilden, wurden Modelle eines rationalen opportunistischen Zyklus entwickelt.3 12 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Der ideologische Zyklus Regierungen haben in aller Regel nicht nur ihre Wiederwahl als Ziel, sondern sie möchten auch eine bestimmte Politik verfolgen. So legen konservative Parteien traditionellerweise mehr Gewicht auf Preisstabilität, während linke Parteien sich mehr um die Arbeitslosigkeit sorgen. Diese Überlegungen wurden vom US-Ökonom Douglas A. Hibbs im Jahr 1977 aufgenommen. Er stellte für die USA und das Vereinigte Königreich von 1948 bis 1972 fest, dass unter republikanischen (bzw. konservativen) Regierungen die Arbeitslosigkeit signifikant höher war als unter demokratischen (bzw. Labour-) Regierungen. Zyklen werden in diesem Ansatz nur generiert, wenn die Regierung wechselt. Dann entspricht die Frequenz nicht dem üblichen Konjunkturverlauf. Trotzdem spricht man hier vom ideologischen Zyklus (Partisan Cycle), da es sich wie beim opportunistischen Zyklus um politische Einflussnahmen auf das Wirtschaftsgeschehen handelt, die Schwankungen erzeugen können, welche nicht aus dem Wirtschaftssystem selbst entstehen. Während die Arbeit von Hibbs rein empirisch ist, sind später auch theoretische Modelle entwickelt worden, die mit rationalem Verhalten der Wirtschaftssubjekte vereinbar sind.4 Budgetzyklen: Input statt Output Sowohl für den opportunistischen wie auch für den ideologischen Zyklus wurden eine Reihe empirischer Untersuchungen angestellt, die freilich kein eindeutiges Bild ergeben.5 Dabei ist die Evidenz für den ideologischen Zyklus noch etwas besser als für den opportunistischen. Auch schneiden die Modelle mit der Annahme rationaler Erwartungen nicht besser ab als die (traditionellen) Modelle mit adaptiven Erwartungen. Angesichts der vielen Faktoren, die auf den Wirtschaftsablauf einwirken, ist dies kaum anders zu erwarten. Da es dennoch wahrscheinlich ist, dass Regierungen (und/oder Parlamente) versuchen, die Konjunktur zu beeinflussen, ist man dazu übergegangen, nicht den Output des Regierungshandelns zu untersuchen, sondern dessen Input: Wenn eine Regierung entsprechende Versuche unternimmt, sollte dies am ehesten am Einsatz ihrer Instrumente deutlich werden. Die 1 Siehe hierzu die Übersicht bei Nannestadt und Paldam (1994). 2 Zur Darstellung siehe auch Frey und Kirchgässner (2002), S. 292ff. 3 Siehe z. B. Rogoff und Siebert (1988). 4 Ausführlich in Alesina und Rosenthal (1995). 5 Siehe hierzu auch die Einschätzung in Drazen (2008), S. 4f. SCHWERPUNKT 6 Siehe Drazen (2008a). 7 Siehe z. B. Abrams und Iossifov (2006). 8 Shi und Svensson (2006) sowie Haan (2014). 9 Brender und Drazen (2005). 10 Alt und Lassen (2006). 11 Jong-A-Pin, Sturm und Haan (2012). 12 Mechtel und Potrafke (2013) zeigen dies für Deutschland. 13 Vicente, Benito und Batista (2013). jüngere Literatur behandelt daher vorwiegend Budgetzyklen: Neue Ausgaben werden eher vor Wahlen, Steuererhöhungen eher nach Wahlen beschlossen.6 Zum Teil werden auch mögliche Zyklen bei den geldpolitischen Instrumenten untersucht.7 Die Ökonomen Bruno S. Frey und Friedrich Schneider (1978) waren die Ersten, die ein solches Modell entwickelten, damals noch unter dem Begriff «politischer Konjunkturzyklus». Sie kombinierten die beiden Ansätze der früheren Arbeiten: Hat eine Regierung gute Aussichten auf eine Wiederwahl, handelt sie ideologisch, sind die Aussichten dagegen schlecht, verhält sie sich opportunistisch. Im Gegensatz dazu wird in den jüngeren Arbeiten zum Budgetzyklus nur noch gefragt, ob bestimmte Variable, insbesondere die Staatsausgaben und das Budgetdefizit, innerhalb der Legislaturperiode einen bestimmten Verlauf aufweisen. Hierzu gibt es – im Gegensatz zu den politischen Konjunkturzyklen – eine reichhaltige empirische Literatur. Die Evidenz ist eindeutig: Es gibt politische Budgetzyklen. Ihre Ausgestaltung hängt freilich von einer Reihe von Faktoren ab. Neuere Arbeiten zeigen, dass sie in Entwicklungsländern signifikant stärker ausgeprägt sind als in entwickelten Ländern.8 Zudem treten solche Zyklen eher in jüngeren als in entwickelten Demokratien auf.9 Und je weniger transparent ein System ist, umso stärker sind sie ausgeprägt.10 Denn dies erleichtert es den Regierungen, entsprechende Aktivitäten zu verbergen. Eine Studie zu geplanten Ausgaben und anschliessenden Revisionen in 25 OECD-Staaten macht deutlich: Regierungen geben vor einer Wahl mehr aus, als sie zuvor angekündigt haben.11 Solche Aktivitäten sind nicht auf das Budget beschränkt, sondern betreffen etwa auch die Arbeitsmarktpolitik.12 Zudem werden sie auch auf lokaler Ebene beobachtet, wie eine Untersuchung anhand spanischer Gemeinden zeigt.13 Budgetzyklen vermutlich auch in der Schweiz Die Schweiz unterscheidet sich wegen ihres Konkordanzsystems von den meisten anderen Ländern. Daher können politische Konjunkturzyklen (im engeren Sinn) hier – wenn überhaupt– nur insofern eine Rolle spielen, als Verschiebungen in der Zusammensetzung der Parlamente Änderungen in der Politik nach sich ziehen. Hingegen dürften Budgetzyklen auch in der Schweiz von Bedeutung sein: Auch unsere Parlamente berücksichtigen bei ihren Aktivitäten wohl die Wahltermine. So dürften unpopuläre Entscheidungen kaum kurz vor den Wahlen getroffen werden. Leider steht bisher keine entsprechende Untersuchung zur Verfügung. Gebhard Kirchgässner Emeritierter Professor des Schweizerischen Instituts für Aussenwirtschaft und Angewandte Wirtschaftsforschung SIAW, Universität St. Gallen, Gelehrtenakademie Leopoldina und Netzwerk CESifo. Literatur Abrams, Burton A. und Plamen Iossifov (2006). Does the Fed Contribute to a Political Business Cycle?, Public Choice 129, S. 249–262. Alesina, Alberto und Howard Rosenthal (1995). Partisan Politics, Divided Government, and the Economy, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.). Alt, James E. und David Dreyer Lassen (2006). Transparency, Political Polarization, and Political Budget Cycles in OECD Countries, American Journal of Political Science 50, S. 530–550. Brender, Adi und Allan Drazen (2005). Political Budget Cycles in New Versus Established Democracies, Journal of Monetary Economics 52, S. 1271–1295. Drazen, Allan (2000). The Political Business Cycle After 25 Years, NBER Macroeconomics Annual 25, S. 75–117. Drazen, Allan (2008). Political Business Cycles, in: S.N. Durlauf und L.E. Blume, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2. Auflage, Palgrave Macmillan. Artikel ist online aufgeschaltet. Drazen, Allan (2008a). Political Budget Cycles, in: S.N. Durlauf und L.E. Blume, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2. Auflage, Palgrave Macmillan. Artikel ist online aufgeschaltet. Frey, Bruno S. und Gebhard Kirchgässner (2002). Demokratische Wirtschaftspolitik: Theorie und Anwendung, Vahlen, München, 3. Auflage. Frey, Bruno S. und Friedrich Schneider (1978). An Empirical Study of Politico-Economic Interaction in the United States, Review of Economics and Statistics 66, S. 174–183. Haan, Jakob de (2014). Democracy, Elections and Government Budget Deficits, German Economic Review 15, S. 131–142. Hibbs, Douglas A. (1977). Political Parties and Macroeconomic Policy, American Political Science Review 71, S. 1467–1487. Jong-A-Pin, Richard, Jan-Egbert Sturm und Jakob de Haan (2012). Using Real-Time Data to test for Political Budget Cycles, CSEifo Working Paper Nr. 3939, München. Nannestadt, Peter und Martin Paldam (1994), The VP-Function: A Survey of the Literature on Vote and Popularity Functions After 25 Years, Public Choice 79, S. 213–245. Nordhaus, William D. (1975). The Political Business Cycle, Review of Economic Studies 42, S. 169–190. Mechtel, Mario und Niklas Potrafke (2013). Electoral Cycles in Active Labor Market Policies, Public Choice 156, S. 181–194. Rogoff, Kenneth und Anne Siebert (1988). Elections and Macroeconomic Policy Cycles, Review of Economic Studies 55, S. 1–16. Shi, Min und Jakob Svensson (2006). Political budget Cycles: Do They Differ Across Countries and Why?, Journal of Public Economics 90, S. 1367–1389. Vincente, Cristina, Bernardino Benito und Francisco Bastida (2013). Transparency and Political Budget Cycles at Municipal Level, Swiss Political Science Review 19, S. 139–156. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 13 WIRTSCHAFT UND POLITIK Die entzauberte Konkordanz als Problem für die Schweizer Wirtschaft Die zunehmende Polarisierung der Regierungsparteien in der Schweiz wird zum Problem für die Wirtschaft. Die Zunahme von Initiativen und Referenden als Wahlkampf­instrumente bringt Unberechenbarkeit. Silja Häusermann Z wei Merkmale kennzeichnen das politische System der Schweiz im internationalen Vergleich: die Konkordanz und die direkte Demokratie. Interessanterweise beruhen diese beiden Spezifika auf gegensätzlichen Logiken der Entscheidfindung. Während Konkordanz nach dem Konsensprinzip funktioniert, werden Entscheide SVP-Vertreter – darunter Parteipräsident Toni Brunner (5. v. l.) – überreichen der Bundeskanzlei Unterschriften einer Volksinitiative. Regierungspar­ teien haben in den vergangenen Jahren vermehrt Initiativen lanciert. 14 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 in der direkten Demokratie nach dem Mehrheitsprinzip gefällt. Die Konkordanzdemokratie äussert sich in einer ausgeprägten Machtteilung und steter Verhandlung. Konkordanzelemente sind etwa eine stabile grosse Regierungskoalition («Zauberformel»), das Proporzsystem und der Interessensausgleich mit Verbänden und Kantonen in der vorparlamentarischen Phase. Die Entscheidungsprozesse sind lang und inklusiv, und sie führen zu moderaten, breit abgestützten und austarierten Entscheidungen. Die direkte Demokratie funktioniert grundlegend anders: Eine kleine Minderheit der Bevölkerung kann zwingende direktdemokratische Abstimmungen verlangen, welche per einfacher Mehrheit der Stimmenden (bei Referenden) oder per Mehrheitsentscheid der Stimmenden und der KEYSTONE Abstract Die Schweizer Konkordanzdemokratie beruht auf Verhandlungen und Kom­ promissen, um zu pragmatischen und berechenbaren politischen Entscheiden zu gelangen. Pragmatismus und Berechenbarkeit dienen den wirtschaftlichen Interes­ sen der Schweiz als kleiner, offener Volkswirtschaft. Im Gegensatz dazu stellt die unberechenbare und majoritäre Logik der direkten Demokratie ein Problem für die Wirtschaft dar. Bisher wurden diese Dynamiken durch die Konkordanzdemokratie im Zaum gehalten. Die Konkordanz ist jedoch weitgehend entzaubert. Weil die Parteien in einem polarisierten Wettbewerb stehen, benutzen sie zur Profilierung zunehmend direktdemokratische Instrumente. Die resultierende Unberechenbarkeit gerät zum Problem für die Schweizer Wirtschaft. Es ist an der Zeit, den Gebrauch von Initiativen und Referenden durch Regierungsparteien zu hinterfragen. SCHWERPUNKT Kantone (bei Volksabstimmungen) verbindliche Entscheide fällen. Somit bringt die Konkordanzdemokratie wenig spektakuläre, aber berechenbare und breit abgestützte politische Entscheidungen hervor. Die direkte Demokratie hingegen begünstigt wohl mutigere, aber auch weniger konsistente Entscheidungen, die zudem von nur einer einfachen Mehrheit der Stimmenden getragen werden müssen. sind, flexibel und pragmatisch auf die Schwankungen der internationalen Märkte zu reagieren. Und wenn sie sicher sein können, in einem stabilen, berechenbaren politischen Umfeld zu agieren. Konkret benötigen solche Länder etwa friedliche Beziehungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, einen flexiblen Arbeitsmarkt, eine stabile Geldpolitik und Kontinuität in der Regierungspolitik. Das Konkordanzsystem der Schweiz hat diese Erfordernisse erfüllt: Alle grösseren Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben gemeinsam, in einem komplexen System der Austarierung von Interessen, politische Entscheide gefällt und getragen – auch gegenüber dem Volk. Insofern ist jedes Referendum, jede Volksinitiative ein Zeichen des Versagens dieser Verhandlungsdemokratie. Konkordanz gibt Wirtschaft Stabilität Wie vertragen sich diese beiden Prinzipien und ihre politischen Folgen mit den wirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Bedürfnissen der Schweiz? Sind sie Vorteil oder Hemmschuh für die Schweizer Wirtschaft? Auch wenn sich die Legitimität eines demokratischen politischen Systems mit Sicherheit nicht vordringlich am Wirtschaftswachstum messen lässt, ist die Frage nach Komplementarität oder Widerspruch zwischen politischen Institutionen und wirtschaftlicher Funktionalität eine wichtige. Und aus dieser Sicht liegen die Dinge klar: Die Konkordanz befriedigt den Bedarf der offenen, kleinen Volkswirtschaft Schweiz nach Stabilität und Berechenbarkeit, während die direkte Demokratie Volatilität generiert und als Instrument für (sachfremde) Partikularinteressen verwendet werden kann. Die Schweiz ist eine kleine, offene Volkswirtschaft, die auf Gedeih und Verderb von den internationalen Märkten abhängt. Der Politökonom Peter Katzenstein hat aufgezeigt, dass solche «small open economies» (Smopec) durchs Band ausgeprägt verhandlungsbasierte Entscheidungsprozesse kennen. Die Schweiz galt bei Katzenstein sogar als Extremfall dieser wirtschaftspolitisch bedingten Konkordanz.1 Sie besteht darin, dass divergierende (wirtschaftliche) Interessen angehört und in alle politischen Entscheidungen einbezogen werden mit dem Ziel konsensueller und berechenbarer Entscheide. Aus wirtschaftlicher Sicht ist diese Berechenbarkeit in solchen «Smopec»-Volkswirtschaften zentral, weil wirtschaftliche Abschottung keine Option ist und weil sie zu klein sind, die internationalen Märkte selber zu steuern. Mit anderen Worten: Diese Länder können ökonomisch nur prosperieren, wenn ihre Produzenten in der Lage Die Bändigung der direkten ­Demokratie durch Verhandlung … 1 Katzenstein (1985); vgl. Mach (1999) für eine ausgezeichnete Erklärung und Erweiterung des Modells von Katzenstein für die Schweiz. 2 Siehe für die Schweiz z. B. Borner/Rentsch (1997), Wittmann (2001). 3 Sciarini und Trechsel (1998), Papadopoulos (1998). Dieser Gedanke gilt auch im Umkehrschluss: Wenn nur wenige Referenden und Initiativen ergriffen werden, ist das ein Zeichen für das gute Funktionieren der Konkordanzdemokratie. Die Verhandlungsdemokratie ist – oder zumindest war – denn auch klar ein Instrument der Vermeidung direktdemokratischer Mobilisierung. Dies ist besonders aus volkswirtschaftlicher Sicht wichtig, weil direktdemokratische Instrumente gut organisierten Partikularinteressen Möglichkeiten zum «Rent-Seeking» auf Kosten des gesamtgesellschaftlichen oder des gesamtwirtschaftlichen Nutzens eröffnet.2 Solche Rent-Seekers können gewisse Wirtschaftssektoren sein, deren Firmen oder Arbeitnehmer sich Vorteile verschaffen wollen, aber auch politische Parteien, welche die direkte Demokratie für ihre partikularen Ziele wie Profilierung und Wahlkampf benutzen. Gerade deswegen muss das Konkordanzsystem als ein Instrument zur Bändigung der direkten Demokratie verstanden werden. Denn kommt ein Referendum zustande, ist der Ausgang der Abstimmung höchst ungewiss, weil die Karten ganz neu gemischt werden: Es findet keine eigentliche, direkte Debatte zwischen den Entscheidungsträgern (wie im Parlament) mehr statt, und es greifen neue Argumente und Entscheidungslogiken.3 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 15 WIRTSCHAFT UND POLITIK KEYSTONE Bundesrätin Doris Leuthard präsentiert eine Vernehmlassungsvorlage. Die Konkordanzdemokratie gibt der Wirtschaft Stabilität. Insofern ist aus volkswirtschaftlicher Sicht nur ein durch Verhandlung vermiedenes Referendum ein gutes Referendum. Jedes ergriffene Referendum zeigt hingegen, dass relevante Interessen nicht genügend einbezogen wurden. Ähnliches gilt für die Volksinitiative. Diese wäre eigentlich als Instrument minoritärer, von der Verhandlung ausgeschlossener Interessen zu verstehen, die punktuell – und quasi in Opposition zu Bundesrat und Parlament – Anliegen in den politischen Entscheidungsprozess einbringen können, der ihnen sonst verschlossen bleibt. 4 Leemann (2015). 5 Eine Sonderausgabe der Schweizerischen Zeitschrift für Politikwissenschaft wird sich im Herbst 2015 voraussichtlich vertieft mit den verschiedenen Aspekten einer «Entzauberung» des schweizerischen politischen Systems befassen. 6 Am umfassendsten wird die Frage bislang bei Ladner et al. (2010) für die Schweiz und im Ländervergleich untersucht. 16 … funktioniert nicht mehr Von dieser eigentlichen Funktion ist insbesondere die Initiative – aber auch das Referendum – heute weit entfernt. Die direkte Demokratie wird immer mehr von den gleichen Akteuren benutzt, die schon im Konkordanzsystem am Verhandlungstisch sitzen und die eigentlich vielfältige andere Kanäle hätten, ihre Interessen einzubringen und ihre Verhandlungspartner von ihren Anliegen zu überzeugen. Am deutlichsten Die Volkswirtschaft 5 / 2015 tritt dieser Funktionswandel der direkten Demokratie im Fall der Schweizer Regierungsparteien zutage. Seit der Einführung der Zauberformel 1959 hat sich der Gebrauch der Volksinitiative durch die Parteien dramatisch verändert. Bis in die 1980er-Jahre wurden pro Jahrzehnt je 4 Initiativen von Regierungsparteien lanciert. In den 1990er-Jahren waren es deren 7, und seit 2000 sind es bereits über 20.4 Dass die Instrumente der direkten Demokratie vermehrt genutzt werden, ist ein Symptom für die Schwächung der Konkordanzdemokratie. Worauf ist diese Entzauberung5 zurückzuführen? Die Antwort ist klar: Sie ist das Resultat einer dramatisch angestiegenen Parteipolarisierung – womit die Distanz zwischen den Parteipositionen gemeint ist. Diese Entfernung kann mittels verschiedener Daten gemessen werden: etwa anhand des Abstimmungsverhaltens im Parlament, anhand von Parteiprogrammen und Experteneinschätzungen oder anhand von Umfragen bei den Kandidierenden der Parteien selber.6 SCHWERPUNKT Polarisierung bringt institutionelles Gefüge ins Wanken Unabhängig von den benutzten Datenquellen kommen alle Studien zu den gleichen zwei Schlüssen: Erstens ist die Polarisierung der Parteien in der Schweiz in den letzten 30 Jahren sehr stark angestiegen, und zweitens gehört die Schweiz mittlerweile zu den am stärksten polarisierten Parteisystemen in Europa. Die Schweizer Parteien stehen in einem scharfen und akuten Parteiwettbewerb, und sie benutzen die direkte Demokratie als Instrument dieses Wettbewerbs. Mittlerweile verwenden alle Bundesratsparteien die direkte Demokratie, als ob sie in der Opposition wären. Das Verhalten der Parteien und das institutionelle Gefüge der Schweiz passen nicht mehr zusammen. Der Anteil an Volksinitiativen, zu denen alle Regierungsparteien die gleiche Abstimmungsempfehlung abgeben, ist seit den 1970er-Jahren von 80% auf heute 0% gesunken.7 Im Parlament hat sich nur schon seit den 1990er-Jahren die Chance halbiert, dass alle Regierungsparteien eine Vorlage gemeinsam tragen.8 Kurz: Die Konkordanzregierung erfüllt ihren mässigenden und pragmatischen Zweck nicht mehr. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die daraus resultierende verstärkte Volatilität der Politik und die Unsicherheit bezüglich der weiteren politischen Entwicklung problematisch. Die politische Unberechenbarkeit ist Gift für eine vom Ausland abhängige Wirtschaft. Die Masseneinwanderungsinitiative und ihre Folgen illustrieren diese Entwicklung, aber sie lässt sich auch in anderen Bereichen beobachten – insbesondere in der Steuerpolitik und der Sozialpolitik, man denke nur an die laufenden Diskussionen um die Altersvorsorge, die Familienpolitik, die Unternehmensbesteuerung und die Bankenregulierung. Zeit für neue Spielregeln Welches sind die erforderlichen Konsequenzen aus wirtschaftlicher Sicht? Soll die direkte Demokratie «verteuert» werden? Nein, denn auch höhere Hürden würden gut organisierte und finanzstarke Interessen nicht an ihrer Nutzung hindern. Zudem hat die direkte Demokratie durchaus auch positive, kontrollierende Wirkun- gen, und vor allem geniesst sie – wie die Konkordanzregierung – in der Bevölkerung einen starken Rückhalt. Eine Anpassung der Institutionen ist deshalb nicht realistisch. Das Problem sind auch gar nicht die (direktdemokratischen) Institutionen an sich, sondern deren Nutzung durch die zentralen Akteure: Die Regierungsbeteiligung politischer Parteien muss wieder eine verbindliche Bedeutung haben für ihr Verhalten. Es liegen bereits Vorschläge auf dem Tisch, wonach Regierungsparteien keine Initiativen in Wahljahren lancieren können sollten. Es wäre jedoch an der Zeit, den Gebrauch direktdemokratischer Oppositionsinstrumente durch Regierungsparteien insgesamt zu hinterfragen. Er führt zu einer Verwischung von Verantwortung und in zunehmendem Mass zu Unsicherheit und Unberechenbarkeit für die Schweizer Wirtschaft. 7 Vatter (2014): 535. 8 Traber (2015). Silja Häusermann Professorin (Ordinaria) für Schweizer Politik und Vergleichende politische Ökonomie, Universität Zürich. Literatur Borner, Silvio und Hans Rentsch (1997). Wieviel direkte Demokratie verträgt die Schweiz? Zürich: Rüegger. Katzenstein, Peter (1985). Small States in World Markets. Industrial Policy in Europe. Ithaca: Cornell University Press. Ladner, Andreas, Gabriela Felder und Stefanie Gerber (2010). Die politische Positionierung der europäischen Parteien im Vergleich. Chavannes-près-Renens: Cahier de l’Idheap. Leemann, Lucas (2015). Political Conflict and Direct Democracy. Explaining Initiative Use 1920–2012, manuscript. Mach, André (1999). Small States in World Markets Revisited: The Questioning of Compensation Policies in the Light of the Swiss Case, WZB Discussion paper FS/99–308. Papadopoulos, Yannis (1998). Démocratie Directe. Paris: Economica. Trechsel, Alexander H. und Pascal Sciarini (1998). Direct Democracy in Switzerland: Do Elites Matter? In: European Journal of Political Research 33: 99–124. Traber, Denise (2014). Disenchanted Swiss Parliament? Electoral Strategies and Coalition Formation, manuscript. Vatter, Adrian (2014). Das politische System der Schweiz. Baden-Baden: Nomos. Wittmann, Walter (2001). Direkte Demokratie. Bremsklotz der Revitalisierung. Frauenfeld: Huber. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 17 WIRTSCHAFT UND POLITIK Interessengruppen verlieren in der Schweizer Politik an Einfluss Eine Studie zeigt: Während Verbände in der Schweizer Politik noch in den 1970er-Jahren eine zentrale Rolle spielten, haben sie 30 Jahre später an Einfluss verloren. Zu den Gewinnern gehören hingegen die Bundesratsparteien. Manuel Fischer, Pascal Sciarini Abstract Interessengruppen wie der Gewerbeverband oder der Bauernverband spielen in der Schweizer Politik eine weniger wichtige Rolle als früher. Im Vergleich zu den Jahren 1971 bis 1976 haben sie im Zeitraum 2001 bis 2006 an Einfluss auf die wichtigsten Entscheidungsprozesse verloren, wie eine Studie zeigt. Zudem sind die Verbände weniger stark eingebunden in die Zusammenarbeitsstrukturen. Dies lässt sich einerseits durch die wachsende Heterogenität der Interessen erklären. Andererseits hat die vorparlamentarische Phase von politischen Entscheidungsprozessen, in welcher Interessengruppen traditionellerweise Kompromisse erarbeiteten, an Bedeutung verloren. Als einziger grosser Verband konnte Economiesuisse im Untersuchungszeitraum seinen Einfluss wahren. Allerdings weisen verlorene Abstimmungskämpfe in den letzten Jahren auch hier auf einen Bedeutungsverlust hin. I n der Schweizer Politik haben Interessenvertreter im 20. Jahrhundert noch eine Schlüsselrolle gespielt. In der kleinen und exportabhängigen Volkswirtschaft sorgten Kompromisse und Absprachen zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und dem Staat vor allem im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik für Stabilität gegenüber den Veränderungen auf der Bühne der Weltwirtschaft.1 Dabei dominierten im sogenannten «liberalen» Korporatismus der Schweiz vor allem die privatwirtschaftlichen Interessen. Auch wenn sich Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften in korporatistischen Arrangements teils unabhängig von der Politik auf Lösungen einigten, war der Einfluss von Interessenverbänden auf den offiziellen politischen Entscheidungsprozess ebenfalls beträchtlich. Dabei kam es häufig in Arbeitsgruppen und Expertenkommissionen der vorparlamentarischen Phase des Entscheidungsprozesses zu Kompromissen, welche später vom Parlament kaum mehr angetastet wurden. So gehörten in den 1970er- und 1980er-Jahren der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse (ehemals Vorort), der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV), der Gewerbeverband (SGV), der Bauernverband (SBV) sowie der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) zu den dominanten Akteuren in der Schweizer Politik (­siehe 18 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Abbildung).2 Die Interessenverbände waren einerseits klar einflussreicher als die stark auf kantonaler Ebene verankerten Parteien. Andererseits hatten die Verbände einen breiteren Einfluss auf die Schweizer Politik als die spezialisierten und mit wenig Ressourcen und Expertise ausgestatteten Ämter der Bundesverwaltung. Vor allem auf der dominanten bürgerlichen Seite war die personelle Verflechtung zwischen Verbänden, Parteien (insbesondere der FDP) und der Bundesverwaltung äusserst intensiv. Die bürgerlichen Verbände und Parteien formten somit gemeinsam mit Vertretern der Bundesverwaltung einen engen Machtzirkel, welcher die wichtigsten Politikprozesse entscheidend prägte.3 Auch Bereiche ausserhalb der Wirtschaftsund Sozialpolitik – wie beispielsweise die Gesundheits- oder Infrastrukturpolitik – wurden von einem sektorspezifischen engen Netzwerk aus spezialisierten Verbänden und der Verwaltung gesteuert. Nicht zuletzt kann die direkte Demokratie für diese starke Stellung der Interessensverbände verantwortlich gemacht werden. Wenn ein Referendum am Ende eines Prozesses droht, haben staatliche Akteure einen starken Anreiz, die wichtigsten Interessenvertreter früh und intensiv in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.4 Bundesratsparteien gewinnen an Macht 1 2 3 4 5 Vgl. Katzenstein (1985). Vgl. Kriesi (1980). Vgl. Kriesi (1980). Vgl. Neidhart (1970). Vgl. Sciarini (2014), Sciarini et al. (2015). Die Schweizer Politik hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Ein Vergleich der wichtigsten Entscheidungsprozesse der Jahre 1971 bis 1976 mit jenen der Jahre 2001 bis 2006 spricht eine deutliche Sprache: Interessenverbände haben an Einfluss auf den politischen Entscheidungsprozess eingebüsst (siehe Abbildung).5 SCHWERPUNKT Reputationsmacht der wichtigsten Akteure in der Schweizer Politik im Zeitvergleich 100 in Prozent 90 80 70 60 50 SCIARINI ET AL. (2015) / DIE VOLKSWIRTSCHAFT 40 30 20 10 e k nt és ui ss an V lb EF 2001–06 Sa 1971–76 Na t io na I V SB ED SA V SE CO ED A EK PD UV EJ Kd K V SG K FD B D EF SG P P CV FD SP t ra es ss Bu ie s ui SV om on Ec nd P e 0 Ein Wert von 100 bedeutet: 100% der Interviewpartner schätzten einen Akteur als sehr einflussreich in der Schweizer Politik ein. Der Krankenkassenverband Santésuisse fehlt mangels eines gesundheitspolitischen Geschäftes in der Untersuchung; die KdK gab es in den 1970er-Jahren noch nicht. Die Akteure sind nach aktueller Reputationsmacht geordnet. SVP: Schweizerische Volkspartei – SP: Sozialdemokratische Partei – FDP: Freisinnig-Demokratische Partei – CVP: Christlichdemokratische Volkspartei – SGB: Schweizerischer Gewerkschaftsbund – EFD: Eidg. Finanzdepartement – FDK: Finanzdirektorenkonferenz – SGV: Schweizerischer Gewerbeverband – KdK: Konferenz der Kantonsregierung – EJPD: Eidg. Justiz- und Polizeidepartement – UVEK: Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation – EDA: Eidg. Departement für Auswärtige Angelegenheiten – SECO: Staatssekretariat für Wirtschaft – SAV: Schweizerischer Arbeitgeberverband – EDI: Eidgenössisches Departement des Innern – SBV: Schweizerischer Bauernverband – EFV: Eidgenössische Finanzverwaltung Anhand der sogenannten Reputationsmethode haben wir für die Studie «The Swiss decision-making system in the 21th century: power, institutions, conflicts» die an einem politischen Prozess beteiligten Akteure im Rahmen von Interviews gebeten, den Einfluss von anderen Akteuren einzuschätzen (siehe Kasten 1). Die Aggregation der Resultate ergibt eine Übersicht über die Machtstruktur. Während in den 1970er Jahren wie erwähnt die Wirtschaftsverbände die Schweizer Politik dominierten, haben diese mit Ausnahme von Economiesuisse im Beobachtungszeitraum klar an politischem Einfluss verloren. Dagegen finden sich nun die Bundesratsparteien an der Spitze. Auch die Integration von politischen Akteuren in Zusammenarbeitsnetzwerke gibt Aufschluss über ihre Einflussmöglichkeiten: In der eng verflochtenen Struktur zwischen Verwaltung, bürgerlichen Parteien und Interessenverbänden der 1970er-Jahre waren letztere klar die zentralsten Akteure. Heute nehmen vorwiegend die Bundesratsparteien diese Rolle ein. Am stärksten vom Machtverlust betroffen sind mit dem Bauernverband und dem Gewerbeverband die wichtigsten Vertreter der Bin- nenwirtschaft. In der Mehrheit der untersuchten Entscheidungsprozesse zu Beginn des 21. Jahrhunderts, an denen der Gewerbeverband Interesse zeigte, war er nur schwach mit den einflussreichsten Akteuren vernetzt und hatte somit kaum Einfluss auf den Prozess. Auch der Gewerkschaftsbund hat im Vergleich mit den 1970er Jahren an Einfluss verloren. Die Gewerkschaften gehörten in der Mehrheit der untersuchten Prozesse, in welchen sie partizipierten, Kasten 1: Studie zu wichtigen Entscheidungen in der Schweiz Im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Forschungsprojektes «The Swiss decision-making system in the 21th century: power, institutions, conflicts» haben die Autoren (zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Denise Traber von der Universität Zürich) die 11 wichtigsten politischen Entscheidungsprozesse zu Beginn des 21. Jahrhunderts untersucht. Laut einer breiten Expertenumfrage waren dies zwischen 2001 und 2006: 11. AHV-Revision, Verfassungsartikel Bildung, Kernenergiegesetz, Infrastrukturfonds, Neuer Finanzausgleich, Neues Ausländergesetz, Entlastungsprogramm 2003, Revision Fernmeldegesetz, Bilaterales Abkommen Schengen-Dublin, Bilaterales Abkommen Zinsbesteuerung, Erweiterung Personenfreizügigkeit. Die Untersuchungen basieren auf 251 Interviews mit Vertretern der Verwaltung, Parteien, Interessengruppen, Kantonen und der Wissenschaft. Die Interviewpartner wurden unter anderem gebeten, über den Einfluss anderer Akteure sowie ihre Zusammenarbeits- und Konfliktbeziehungen zu anderen Akteuren Auskunft zu geben. Ein Buch, welches aufgrund der Projekterkenntnisse den Zustand des politischen Systems der Schweiz diskutiert, erscheint im Sommer (Sciarini et al. 2015). Die Volkswirtschaft 5 / 2015 19 KEYSTONE WIRTSCHAFT UND POLITIK zur Verliererseite. Demgegenüber setzte sich Economiesuisse in den Jahren 2001 bis 2006 in allen Prozessen, an welchen sich der Verband beteiligte, durch. Trotz des anhaltenden Einflusses von Economiesuisse muss festgestellt werden: Die Interessenverbände haben in der Schweizer Politik allgemein an Macht verloren und sind von den politischen Parteien überholt worden. Ausserdem zeigen sich gewichtige Unterschiede zwischen verschiedenen Politikbereichen, was die Rolle und Stärke der Interessenverbände anbelangt (siehe Kasten 2).6 Bauern an einem vom Schweizerischen Bauernverband organisierten Umzug in Bern. Viele Verbände haben gegenüber den 1970er-Jahren an politischem Einfluss verloren. Verändertes Umfeld führt zum Machtverlust der Verbände Wie ist diese Entwicklung der letzten 40 Jahre zu begründen? Im Folgenden werden die vier wichtigsten Ursachen der Machtveränderungen erläutert: Traditionelle Politikfelder mit weniger Gewicht Heute sind andere Politikbereiche wichtig als früher. In diesen sind die Interessenverbände schlechter aufgestellt. Mit dem Ende des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit in den 20 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 6 Vgl. Fischer (2012). 1970er-Jahren und dem Beginn der Wirtschaftskrise Mitte der 1970er-Jahre waren wirtschaftsund sozialpolitische Themen besonders wichtig. Diese wurden von den klassischen Wirtschaftsverbänden dominiert. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gehörte nur ein einziger der wichtigsten Prozesse in den Bereich der Sozialpolitik (11. AHV-Revision), während die Wirtschaftspolitik im traditionellen Sinne überhaupt nicht unter den wichtigsten Prozessen vertreten war. Dennoch sind wirtschaftliche Interessen eindeutig von Entscheidungsprozessen in der Energie-, Telekommunikations-, Infrastruktur- oder Finanzpolitik direkt betroffen. Auch die heute allgegenwärtige Europapolitik hat häufig eine stark wirtschaftspolitische Färbung: Bei den wichtigsten Entscheidungsprozessen zwischen 2001 und 2006 ging es um Migrations-, Zoll- und Steuerfragen, welche zwischen der Schweiz und der Europäischen Union verhandelt wurden. Heterogenität innerhalb der Interessensgruppen Durch die zunehmende Differenzierung in spezialisierte Politikbereiche lassen sich verschiedene Partikularinteressen immer schlechter innerhalb von Interessengruppen bündeln. Zum Beispiel ging es bei der untersuchten Revision KEYSTONE SCHWERPUNKT des Fernmeldegesetzes um die Liberalisierung der letzten Meile im Telekommunikationsmarkt. In diesem Geschäft spielten vor allem einzelne Firmen eine wichtige Rolle, grosse Wirtschaftsverbände hatten nur wenig Einfluss auf dieses Geschäft. Neben der hohen technischen Komplexität und dem dazu nötigen Spezialwissen ist die Differenzierung der Interessen dafür verantwortlich: Innerhalb von Economiesuisse vertraten die Swisscom als ehemalige Monopolistin und deren Konkurrenzfirmen diametral gegenüberstehende Positionen. Generell erschwert die Differenzierung in spezialisierte Politikbereiche und die damit einhergehende Herausbildung von Partikularinteressen das Bündeln von Interessen in Verbänden. Diese können weniger geeint auftreten und vertreten eine schmälere Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Paul Rechsteiner (oben links); Parteipräsidenten Martin Landolt (BDP), Christophe Darbellay (CVP), Philipp Müller (FDP) und Toni Brunner (SVP) vor dem Bundeshaus (von links, unten rechts); Journalisten befragen Bundesrat Didier Burkhalter (rechts). Kasten 2: Unterschiede zwischen Politikbereichen Auch wenn der Trend, dass Interessengruppen an Einfluss auf die Schweizer Politik verloren haben, allgemein gültig ist, so gibt es doch wichtige Unterschiede zwischen verschiedenen Politikbereichen. Grundsätzlich kann gesagt werden: Der Einfluss von Interessenverbänden ist minim in föderalistischen Entscheidungsprozessen, in welchen es um die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen geht. Von den untersuchten Prozessen gehören besonders der Verfassungsartikel zur Bildung und der Neue Finanzausgleich. Besonders Mühe scheinen Interessenverbände auch mit indirekt europäisierten Prozessen zu haben, in welchen eine europäische Norm ohne internationale Verhandlungen übernommen wird. Aus unserer Untersuchung gehört hierzu die Revision des Fernmeldegesetzes und das Neue Ausländergesetz. Basis, was zu einem Verlust an politischen Einfluss führt. Internationales Umfeld prägt Politik Die Europäisierung der Politik trägt ihren Teil zum Einflussverlust von Interessenverbänden bei. Einerseits führt die Wichtigkeit der Koordination der nationalen mit der europäischen Politik zu einem stärkeren Gewicht von staatlichen Akteuren in politischen Entscheidungsprozessen. Wichtige Fragen werden häufig in internationalen Verhandlungen und nicht mehr im nationalen Parlament geklärt. Staatliche Akteure verfügen daher über relevantere Informationen und Einflussmöglichkeiten als nationale Interessengruppen oder Verbände. Andererseits trägt die Abhängigkeit der Schweizer Politik vom internationalen und europäischen Umfeld ebenfalls zu der oben besprochenen Differenzierung der Interessen bei. Seit den 1990er Jahren sind exportorientierte Wirtschaftsbereiche weniger bereit, den Schweizer Binnenmarkt durch Abschottung zu schützen. Internationaler Druck führt zu einer Schwächung der den Binnenmarkt vertretenden Verbände, wie zum Beispiel des Schweizerischen Bauernverbandes oder des Gewerbeverbandes. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 21 WIRTSCHAFT UND POLITIK Mediatisierung der Politik Eine traditionelle Stärke von Interessengruppen in der Schweizer Politik war, dass diese in korporatistischer Manier fähig waren, ausserhalb des politischen Prozesses oder in der vorparlamentarischen Phase tragfähige Kompromisse zu finden. Die erhöhte Mediatisierung und Polarisierung der Schweizer Politik haben jedoch die Möglichkeit vertraulicher Verhandlungen und die Kompromissbereitschaft der Sozialpartner reduziert. Ein Vergleich der eingeschätzten Wichtigkeit der vorparlamentarischen Phase gegenüber der parlamentarischen Phase von Entscheidungsprozessen zeigt: Erstere hat ihre klare Dominanz aus den 1970er-Jahren weitgehend verloren. Natürlich ist denkbar, dass die Verbände auf diese Entwicklung reagiert haben und vermehrt versuchen, den Gang politischer Geschäfte im Parlament zu beeinflussen. Zwar scheint sich die Intensität und Professionalität der Lobbyarbeit im Parlament tatsächlich zu intensivieren. Ob dies aber den Einflussverlust der Interessenverbände in der vorparlamentarischen Phase zu kompensieren vermag, ist zu bezweifeln. Die seit einiger Zeit erhöhte Polarisierung des Parlamentsbetriebs erschwert zudem die Einflussnahme von Interessenverbänden via Parlamentsvertreter. Im Gegensatz zu den 1970erund 1980er-Jahren existiert im Parlament keine stabile bürgerliche Mehrheit mehr. scheidende Erklärungsfaktoren wie die Abhängigkeit der Schweiz von der europäischen und internationalen Politik oder die Mediatisierung sind heute nicht weniger wichtig als vor zehn Jahren. Die Aufhebung des Bankgeheimnisses auf Druck aus dem Ausland ist ein aktuelles Beispiel dafür, dass Interessenverbände – in diesem Fall jene der Schweizer Finanzwirtschaft – kaum mehr Einfluss auf die nationale Politik ausüben, wenn sich diese mit internationalem oder europäischem Druck konfrontiert sieht. Auch im aktuellen Fall der Energiestrategie 2050 lässt sich eine starke Differenzierung der Interessen beobachten. Wirtschaftsverbände unterstützen nicht mehr, wie es traditionellerweise der Fall war, fast ausschliesslich die Atomenergie, sondern es formieren sich wirtschaftliche Interessen im Bereich der alternativen Energien und der Energieeffizienz. So entstand etwa der neue Verband Swisscleantech. Des Weiteren mehren sich neuerdings Anzeichen eines Einflussverlusts von Economiesuisse. Zumindest was Volksabstimmungen betrifft, scheint auch dieser Verband nicht mehr die alte Stärke zu haben. Dies suggerieren zumindest die Niederlagen bei der Zweitwohnungs-, der Masseneinwanderungs- und der Abzockerinitiative. Anzeichen des Einflussverlusts von Economiesuisse Obwohl der Grossteil der hier besprochenen Erkenntnisse aus Entscheidungsprozessen stammt, welche sich bereits vor zehn Jahren abspielten, kann davon ausgegangen werden, dass die Rolle und Wichtigkeit der Interessenverbände in der Schweizer Politik noch immer den hier beschriebenen Entwicklungen entspricht. Ent- Manuel Fischer Dr. rer. pol. Forscher am Departement für Umweltsozialwissenschaften der Eawag (Dübendorf) und Lehrbeauftragter am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern. Pascal Sciarini Professor für Schweizer Politik am Departement für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen der Universität Genf. Literatur Fischer, Manuel (2012). Entscheidungsstrukturen in der Schweizer Politik zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Zürich/Chur: Verlag Rüegger. Katzenstein, Peter (1985). Small States in World Markets. Cornell: Cornell University Press. Kriesi, Hanspeter (1980). Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in der Schweizer Politik. Frankfurt: Campus Verlag. 22 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Neidhart, Leonhard (1970). Plebiszit und pluralitäre Demokratie, eine Analyse der Funktionen des schweizerischen Gesetzesreferendum. Bern: Francke. Sciarini, Pascal (2014). ‚Eppure si muove: muove: «The changing nature of the Swiss consensus democracy.» Journal of European Public Policy 21(1): 116–132. Sciarini, Pascal, Fischer, Manuel and Denise Traber (2015). Political Decision-Making in Switzerland: The Consensus Model under Pressure. Basingstoke/New York: Palgrave/ MacMillan. SCHWERPUNKT Wie beeinflusst die Entschädigung die Disziplin und die Selektion von Politikern? Ob eine höhere Entschädigung das Engagement von Parlamentariern steigert, wird kontrovers diskutiert. Eine Studie zur EU-Entschädigungsreform zeigt: Eine bessere Bezahlung führt zu mehr Engagement und erhöht die Wiederwahlwahrscheinlichkeit. Allerdings werden keine besser qualifizierten Kandidaten angezogen. Thomas Brändle Abstract Eine höhere Entschädigung in der Politik sollte zu engagierteren Mandatsträgern führen und besser qualifizierte Kandidaten anziehen. Diese politökonomischen Überlegungen werden anhand einer Studie zur grundlegenden Entschädigungsreform im EU-Parlament aus dem Jahr 2009 konkretisiert. Die empirische Analyse zeigt: Ein Anstieg der Entschädigung führt zu mehr parlamentarischem Engagement. Gleichzeitig nehmen jedoch die Absenzen zu. Mit Blick auf die Selektion der Politiker wird beobachtet, dass eine höhere Entschädigung die Wiederwahlwahrscheinlichkeit der Amtsinhaber erhöht, jedoch keine besser qualifizierten Politiker anzieht. Im letzten Teil des Artikels werden Überlegungen zur Situation in der Schweiz angestellt. G 1 Der Beitrag basiert auf Forschungsarbeiten des Autors an der University Pompeu Fabra, Department of Economics, Barcelona (2012/2013). Siehe Braendle (2015a): Does Remuneration Affect the Discipline and the Selection of Politicians? Evidence from the European Parliament. In: Public Choice, 162 (1-2), S. 1–24. emäss Überlegungen der Politischen Ökonomie (siehe Kasten 1) ist die finanzielle Entschädigung eines politischen Mandats eine wichtige institutionelle Rahmenbedingung. In der Literatur wird zum einen argumentiert, dass eine höhere Entschädigung die Arbeitsmoral steigert und den Wert eines Mandats erhöht. Wird ein einfaches Kosten-Nutzen-Kalkül unterstellt, geht der Verlust des Mandats durch Abwahl bei einer höheren Entschädigung mit mehr Kosten einher. Zum anderen lässt sich die Hypothese ableiten, dass besser qualifizierte Bürger mit attraktiven alternativen Verdienstmöglichkeiten (sogenannten hohen Opportunitätskosten) im privaten Sektor eher zu einer Kandidatur motiviert werden können, wenn die finanzielle Entschädigung hoch ist. Eine höhere Entschädigung sollte so das Verhalten der Politiker im Amt durch einen gesteigerten Wiederwahlanreiz disziplinieren und besser qualifizierte Kandidaten anziehen.1 Zu berücksichtigen ist, dass sich diese theoretischen Überlegungen nicht eins zu eins auf die Politik übertragen lassen. Erstens ist der «Arbeitsvertrag» zwischen Wählern und Politikern unvollständig. Zweitens spielen Faktoren wie das Kandidatennominierungsmonopol der Parteien, die Politikfinanzierung, die Informationsbedingungen in der Politik und die zugrunde liegenden Wählerpräferenzen eine gewichtige Rolle. Zudem hängt die Attraktivität eines politischen Mandats neben der finanziellen Entschädigung auch vom vorhandenen Gestaltungsspielraum Kasten 1: Politische Ökonomie Die politischen Prozesse und die politischen Entscheide sollten in demokratischen Gemeinwesen möglichst den Präferenzen der Bürger entsprechen. Ausgehend von diesem Ideal, drehen sich die zentralen Überlegungen in der Politischen Ökonomie um die Strukturierung der Beziehung zwischen Wählern und Politikern und die Rolle des politischen Wettbewerbs. Für die Analyse wird dabei das ökonomische Verhaltensmodell auf den politischen Sektor übertragen. Den politischen Entscheidungsträgern wird das rationale Verfolgen von Eigeninteressen, wie beispielsweise ihre Wiederwahl, unterstellt. Verhaltensänderungen von Politikern werden primär durch veränderte Restriktionen erklärt. Die institutionellen Rahmenbedingungen in der Politik sollen entsprechend so ausgestaltet werden, dass eine möglichst grosse Verantwortlichkeit im politischen Handeln der Entschei- dungsträger erzeugt wird. Der Wettbewerb um die Gunst der Wähler und insbesondere der Anreiz zur (Wieder)wahl sollen die Politiker einerseits bei der Ausgestaltung der Wahl- oder Parteiprogramme und andererseits beim Verhalten im Amt disziplinieren. Angesichts nicht bindender Wahlversprechen und unvollständiger Möglichkeiten zur Kontrolle der gewählten Mandatsträger ist aus Sicht der Politischen Ökonomie zudem die sorgfältige Auswahl der Politiker im Hinblick auf Kompetenz und Glaubwürdigkeit von Bedeutung.a a Vgl. Buchanan (1989), Mueller (2003), Persson und Tabellini (2005) für eine Diskussion der grundlegenden Ansätze in der Politischen Ökonomie. Vgl. Besley (2005) für die komplementäre Erweiterung um den Aspekt der politischen Selektion. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 23 WIRTSCHAFT UND POLITIK 144 084 € Die Entschädigungsreform im Europäischen Parlament im Jahr 2009 86 126 € 84 108 € 83 712 € 83 312 € 72 018 € 69 816 € 63 791 € 62 069 € 59 640 € 52 041 € 38 396 € 28 860 € 21 864 € 19 774 € 15 534 € 14 197 € 14 085 € 10 226 € ie n ar Bu lg ga 24 Le ttl a Slo nd wa k Li t ei au en M Ts alt ch a ec h Ru ien m än ie n Es t la nd Po le Sp n an ie Po n r tu Slo gal we ni en Zy pe F in r n nl S c an d hw L u e de xe n m b Dä u r g ne m ar k Be Gr lg ie c ie n he nl Fr and G r ank os sb re i c h r it an ni en D e Ir l a ut nd sc N i hl a n ed d er la Ö s n de te r re ic h It a lie n 0 Un 2 Vgl. Padovano (2013) für eine Diskussion. 3 Die Mitglieder des EU-Parlaments erhalten ausserdem Tagespauschalen (etwas über 300 Euro pro Sitzungstag) und eine Entschädigung für im Wahlkreis anfallende Kosten (4299 Euro monatlich), beispielsweise für Büro und Material. Effektive Reisekosten und Kosten für Mitarbeiter der Parlamentarier werden bis zu einem gewissen Betrag übernommen. Dieser Teil der Entschädigung wurde vor und nach der Reform der Grundentschädigung aus EU-Mitteln finanziert und ist durch die Reform nicht tangiert. 10 226 € 20 rn Jährliche Grundentschädigung der Abgeordneten vor der Reform (2004) 10 080 € 40 21 746 € 60 48 815 € 80 48 286 € Jährliche Grundentschädigung der Abgeordneten nach der Reform (2009) 73 850 € 100 91 983 € 81 273 € 120 und dem Ausmass an Befriedigung aus dem Dienst an der Gemeinschaft ab. Diese Aspekte sind jedoch weniger exakt greifbar. Nur wenige Studien untersuchen den Zusammenhang zwischen der Entschädigung und der Disziplin (respektive dem Engagement im Amt und der Qualifikation) der gewählten Politiker auf individueller Ebene. Bis anhin sind nur wenig verwertbare Daten über Politiker, ihre Herkunft und ihre politischen Aktivitäten systematisch verfügbar gewesen. Ausserdem ist die Identifikation kausaler Zusammenhänge in diesem Bereich anspruchsvoll. Entsprechend dreht sich die wissenschaftliche Diskussion um die Frage, wie das individuelle Engagement und die Qualifikation von Politikern adäquat gemessen werden kann.2 Bisherige Studien konzentrierten sich primär auf die lokale Ebene (siehe Kasten 2). Von grossem Interesse ist aber auch, ob die Höhe der Entschädigung Auswirkungen auf das Engagement und die Selektion der Politiker auf höheren staatlichen Ebenen hat. Die Entschädigungsreform im EU-Parlament im Jahr 2009 Die Harmonisierung der Grundentschädigung der Mitglieder des EU-Parlaments im Jahr 2009 stellt eine aussergewöhnliche empirische Gelegenheit dar, die Anreiz- und Selektionseffekte der Entschädigung von Politikern zu analysieren. Die Parlamentarier aus 27 verschiedenen Staaten mussten sich gleichzeitig an diese grundlegende und finanziell bedeutende Reform anpassen. Ausserdem war die Entschädigungsreform von keinen anderen institutionellen Veränderungen begleitet. Bis einschliesslich der sechsten Wahlperiode (2004–2009) wurde die Grundentschädigung, die den grössten Teil des Entschädigungspakets eines EU-Abgeordneten darstellt, aus dem Bud- Kasten 2: Angrenzende Literatur Ferraz und Finan (2009) analysieren diskontinuierliche Gehaltssprünge von Politikern auf lokaler Ebene in Brasilien, die in Abhängigkeit der Einwohnerzahl der Gemeinden gewährt werden. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass eine höhere Entschädigung den Effort der Politiker im Amt, angenähert durch die Anzahl eingereichter Gesetzesentwürfe und die Bereitstellung von öffentlicher Infrastruktur, erhöht. Die Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Untersuchung zeigt auch, dass eine höhere Entschädigung mit einem besseren formalen Qualifikationsniveau (Ausbildung und Beruf) der Politiker einhergeht. Gagliarducci und Nannicini (2013) finden in einem sehr ähnlichen Studiendesign, jedoch für italienische Bürgermeister, vergleichbare empirische Evidenz. Ihre Resultate legen nahe, dass Gemeinden mit besser bezahlten Bürgermeistern sparsamere öffentliche Haushalte und ein geringeres Ausmass an Bürokratie aufweisen. Mit Blick auf die Selektion in die Politik zeigt sich, dass eine höhere Entschädigung zu besser qualifizierten Politikern, angenähert durch Anzahl Ausbildungsjahre und den beruflichen Hintergrund, führt.a a Vgl. Braendle (2015b) für einen Überblick zur entstehenden Literatur zu den Auswirkungen der Entschädigung und weiterer institutioneller Rahmenbedingungen auf den Effort und die Selektion von Politikern. CORBETT ET AL. (2005) UND EU-PARLAMENT, INFORMATIONSBÜRO DEUTSCHLAND. DARSTELLUNG BRÄNDLE / DIE VOLKSWIRTSCHAFT 106 583 € 140 In Tausend Euro SCHWERPUNKT get des jeweiligen Heimatlandes bezahlt und entsprach der Grundentschädigung eines nationalen Abgeordneten.3 Beispielsweise erhielt zu Beginn der sechsten Wahlperiode ein EU-Parlamentarier aus Ungarn eine jährliche Grundentschädigung von 10 080 Euro, während ein Abgeordneter aus Italien 144 084 Euro erhielt. Im Jahr 2005 beschlossen EU-Rat und EU-Parlament eine neue, harmonisierte Entschädigungsordnung, die ab Beginn der siebten Wahlperiode in Kraft treten sollte. Gemäss dieser Entschädigungsregelung erhalten alle Parlamentarier, unabhängig von ihrem Herkunftsland, eine einheitliche Grundentschädigung, die sich an den Löhnen von EU-Beamten orientiert und aus EU-Mitteln finanziert wird. Bei Einführung im Jahr 2009 entsprach die harmonisierte Grundentschädigung 91 983 Euro. Während Abgeordnete aus osteuropäischen Ländern sowie Spanien, Portugal, Finnland und Schweden finanziell deutlich von der Harmonisierung profitierten, mussten die italienischen und österreichischen Abgeordneten Senkungen hinnehmen (siehe Abbildung). Für die empirische Analyse wurde ein neuer Datensatz mit umfangreichen Informationen zu den EU-Abgeordneten vor und nach der Entschädigungsreform erhoben. Mithilfe eines multiplen Regressionsmodells wurde versucht, den Einfluss der Veränderung der Entschädigung auf das Engagement der Politiker im Amt und die Selektion in das EU-Parlament zu ermitteln.4 Als empirische Annäherung der Auswirkungen der Entschädigungsreform auf das Engagement der Politiker wurden vier unterschiedliche individuell zurechenbare Masse betrachtet. Zuerst wurden die Absenzen als Mass für das Engagement analysiert. In einem zweiten Schritt stand der direkte parlamentarische Einsatz der Abgeordneten im Fokus, wobei die Anzahl parlamentarischer Reden, schriftlicher Erklärungen und ausgearbeiteter Legislativberichte herangezogen wurde. Die empirische Analyse konzentrierte sich auf den Vergleich des Engagements der Amtsinhaber in den ersten zwei Jahren der Legislaturperiode vor und nach der Entschädigungsreform. Die Resul- 4 Zur Absicherung gegen unbeobachtete zeitund länderspezifische Einflüsse wurden in der empirischen Analyse feste Zeit- und Ländereffekte eingesetzt. Zudem wurde für eine Vielzahl von individuellen (Alter, Geschlecht, Parteizugehörigkeit, Dienstalter, Position im Parlament) und Delegationscharakteristika (nationale Delegationsgrösse, Parteigrösse, BIP pro Kopf und wahrgenommene Korruption im Heimatland) kontrolliert, die das Engagement und die Selektion beeinflussen können. ^KEYSTONE Debatte im EU-Parlament in Strassburg. Die Entschä­ digungsreform im Jahr 2009 brachte für die meisten Abgeordneten mehr Geld. Beeinflusst die Entschädigung das Engagement der Politiker? Die Volkswirtschaft 5 / 2015 25 WIRTSCHAFT UND POLITIK tate zeigen: Die Erhöhung der Entschädigung hat einen positiven Anreizeffekt auf das direkte parlamentarische Engagement der Politiker. Gleichzeitig wird jedoch auch ein Anstieg der Absenzen infolge einer höheren Entschädigung beobachtet. Was sind plausible Erklärungen für dieses überraschende Resultat bei den Absenzen? Es kann argumentiert werden: Mit der gestiegenen Grundentschädigung hat die Anwesenheit und die damit verbundene Tagespauschale als Einkommensquelle relativ an Bedeutung verloren. Auch kann ein verstärkter Wiederwahlanreiz infolge der gestiegenen Entschädigung dazu führen, dass das Engagement im Wahlkreis oder das Sichern von (finanzieller) Wahlkampfunterstützung bei Interessenverbänden im Vergleich zur parlamentarischen Anwesenheit wichtiger geworden sind. Beeinflusst die Entschädigung die Qualifikation neu gewählter Politiker? Als Mass für die Qualifikation der Politiker wurde ein möglichst breiter Ansatz gewählt. Es wurden die Dimensionen formaler Bildungsabschluss (wie etwa Hochschulabschluss oder Doktorat), vorherige politische Erfahrung in gewählten Ämtern (lokal, regional oder national) und vorheriger beruflicher Hintergrund (insbesondere hoch qualifizierte Berufe) näher betrachtet. Das überraschende Resultat ist: Der erhebliche Entschädigungsanstieg infolge der Reform hat die Zusammensetzung des Pools an neu gewählten Abgeordneten in den drei Dimensionen formale Bildung, vorherige politische und berufliche Erfahrung nicht verbessert. Es zeigt sich sogar ein negativer Zusammenhang zwischen der Entschädigung und der Wahrscheinlichkeit, dass ein Politiker bei der Wahl in das EU-Parlament über politische Erfahrung in einer gewählten Position auf höchster nationaler Ebene verfügt. Im Gegensatz zu den bisherigen Studien auf lokaler Ebene findet diese Arbeit keinen positiven Zusammenhang zwischen der Entschädigung und den Massen der Qualifikation von Politikern. Eine wichtige Komponente zur Erklärung dieses Resultats ist sicher im proportionalen Wahlrecht zu sehen, welches bei den EU-Parlamentswahlen angewendet wird. Dieses verleiht den 26 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 nationalen Parteien eine bedeutende Rolle bei der Nominierung von Kandidaten. Falls die Parteien den Zugang zu politischen Ämtern massgeblich bestimmen und die Sitze an entweder unerfahrene, junge Politiker mit Ambitionen für die nationale Politik als Trainingsarena vergeben oder für verdiente Politiker reservieren, die kurz vor dem Rückzug aus der Politik stehen, sind Entschädigungsveränderungen vermutlich von nachrangiger Bedeutung. Angesichts der wenigen direkten Entscheidungskompetenzen und der geringen Reputation könnte zudem – trotz gestiegener Entschädigung – die Arbeit im EU-Parlament als weniger attraktiv angesehen werden als ein Mandat auf nationaler Ebene. Des Weiteren kann die zugrunde liegende Studie einfach zu früh angesetzt haben, und der Pool an Kandidaten und gewählten Abgeordneten verändert sich erst mit deutlicher Verzögerung. Beeinflusst die Entschädigung die Wiederwahl von Politikern? Die Veränderung der Wiederwahlwahrscheinlichkeit ist das Ergebnis von mindestens zwei Kräften. Einerseits erhöht eine grosszügigere Entschädigung die Attraktivität eines Mandats. Dies führt zu einem stärker umkämpften Wettbewerb um die Mandate, was wiederum die Wahrscheinlichkeit der Wiederwahl von Amtsinhabern senken sollte. Andererseits verstärkt eine höhere Entschädigung den Wiederwahlanreiz der Amtsinhaber, da der Wert der (zukünftigen) Mandatsträgerschaft gestiegen ist. Dies sollte die Anstrengungen der Amtsinhaber steigern und zu einer höheren Wiederwahlwahrscheinlichkeit beitragen. Aus der empirischen Analyse geht hervor: Beispielsweise führt eine Verdoppelung der Grundentschädigung zu einem Anstieg der Wiederwahlwahrscheinlichkeit um etwas mehr als 17 Prozentpunkte. Welche Parallelen lassen sich zur Situation in der Schweiz ziehen? Entschädigungsreformen für politische Ämter stehen regelmässig und insbesondere in Wahljahren zur Diskussion. So stellt sich beispielsweise bei näherer Betrachtung auch die Frage, ob die 5 Die Parlamentarier erhalten auch eine Mahlzeiten- und Übernachtungsentschädigung, eine Distanz- und Familienzulage. Vgl. Parlamentsressourcengesetz (PRG) für Details. SCHWERPUNKT finanzielle Attraktivität eines Parlamentsmandats auf Bundesebene in der Schweiz hoch oder niedrig ist, als relativ komplex heraus. Erstens sind die Grundentschädigung und die Tagespauschalen nur eine Facette der finanziellen Attraktivität eines Mandats. Zwischen den Ländern ist ein diesbezüglicher aussagekräftiger Vergleich jedoch nur beschränkt möglich. Die finanzielle Entschädigung im Schweizer Parlament, mit 26 000 Franken jährlichem Grundeinkommen, einer Jahresentschädigung von 33 000 Franken für Personal- und Sachausgaben und einem Taggeld von 440 Franken pro Sitzungstag erscheint jedoch vergleichsweise nicht überhöht5. Dies zeigt sich auch in der Studie von Z’graggen und Linder (2004), welche die Bundesversammlung mit weiteren Parlamenten in ausgewählten OECD-Ländern vergleicht. Zweitens muss gefragt werden, in welchem Ausmass Nebenbeschäftigungen möglich sind und welche Nebenbeschäftigungen sich erst durch das Mandat ergeben. Letztere Frage stellt sich auch im Hinblick auf Positionen nach Beendigung der Parlamentstätigkeit, wie beispielsweise Verwaltungsratsmandate oder Verbandspositionen, die nur durch neu geschlossene Kontakte in der Politik möglich wurden. Für die Attraktivität eines Mandats spielt es auch eine Rolle, welche materiellen und personellen Ressourcen den Politikern unterstützend zur Mandatsausübung zur Verfügung stehen. In direktem Zusammenhang mit der Entschädigung der Politiker steht die Frage der Organisation der Parlamentsarbeit. Die Schweiz zeichnet sich durch ein Milizparlament aus. Durch die Berufstätigkeit neben dem Mandat sollen berufliche Erfahrungshintergründe und Herausforderungen der Berufswelt einfacher Gehör finden und direkter in die parlamentarischen Prozesse einfliessen als in anderen Ländern. Von einer Erhöhung der Entschädigung liesse sich tendenziell eine stärkere Professionalisierung des Parlaments erwarten. Erstens wären die Parlamentarier finanziell weniger von einer zusätzlichen Tätigkeit abhängig. Zweitens legen die präsentierten Studien nahe, dass eine gestiegene Entschädigung mit einer höheren Wiederwahlwahrscheinlichkeit und somit längeren durchschnittlichen parlamentarischen Verweildauern einhergeht. Angesichts der zunehmenden Komplexität der Gesetzgebung scheint eine gewisse Tendenz zur Professionalisierung jedoch auch sachbedingt absehbar. Ob – wie oft im politischen Diskurs argumentiert – eine höhere Entschädigung besser qualifizierte Kandidaten anzieht, kann vor dem Hintergrund der diskutierten Studien nicht ohne Weiteres bejaht werden. Neben der Entschädigung sind jedoch weitere institutionelle Besonderheiten der Schweizer Politik von Bedeutung. Dazu gehören die Regeln bezüglich der Unvereinbarkeit eines Amts im öffentlichen Sektor mit einem politischen Mandat, die Offenlegung von Interessenbindungen, der ausgeprägt föderale Staatsaufbau sowie die direktdemokratischen Elemente und deren potenzielle Auswirkungen auf den politischen Wettbewerb, das Engagement und die Selektion der Politiker. Thomas Brändle Dr. rer. pol., Ökonomische Analyse und Beratung, Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, Bern und Research Fellow, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel. Literatur Besley, Timothy (2005). Political Selection. Journal of Economic Perspectives 19(3): 43–60. Braendle, Thomas (2015a). Does Remuneration Affect the Discipline and the Selection of Politicians? Evidence from Pay Harmonization in the European Parliament, Public Choice, 162(1–2), 1–24. Braendle, Thomas (2015b). Do Institutions Affect Citizens’ Selection into Politics? Erscheint in Journal of Economic Surveys. Buchanan, James M. (1989). The PublicChoice Perspective. In: James M. Buchanan (Hrsg.). Essays on the Political Economy. Honolulu: University of Hawaii Press. Corbett, Robert, Francis Jacobs und Michael Shackleton (2005). The European Parliament. 6th edition. London: John Harper Publishing. Ferraz, Claudio und Federico Finan (2009). Motivating Politicians: The Impacts of Monetary Incentives on Quality and Performance. NBER Working Paper No. 14906, Cambridge, MA. Gagliarducci, Stefano und Tommaso Nannicini (2013). Do Better Paid Politicians Perform Better? Disentangling Incentives from Selection. Journal of the European Economic Association, 11(2), 369–398. Mueller, Dennis C. (2003). Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press. Padovano, Fabio (2013). Are We Witnessing a Paradigm Shift in the Analysis of Political Competition, Public Choice, 156 (3–4), 631–651. Persson, Torsten und Guido Tabellini (2005). The Economic Effects of Constitutions. Cambridge: MIT Press. Z’graggen, Heidi und Wolf Linder (2004). Professionalisierung der Parlamente im internationalen Vergleich. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste der Schweizerischen Bundesversammlung. Institut für Politikwissenschaft. Universität Bern. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 27 DIE VOLKSWIRTSCHAFT Peter A. Fischer, NZZ-Wirtschafts­ ressortleiter, im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in Bern SCHWERPUNKT INTERVIEW «Wirtschaft und Politik haben sich voneinander entfernt» Der Leiter der Wirtschaftsredaktion der «Neue Zürcher Zeitung», Peter A. Fischer, äussert sich im Gespräch mit der «Volkswirtschaft» zum Verhältnis zwischen dem globalisierten Wirtschaftsstandort Schweiz und der Schweizer Politik. Manchen Managern fehle wohl die Zeit, sich um den Heimstandort zu kümmern, sagt der Ökonom. Er erklärt, warum er sich weniger Politprofis im Parlament wünscht. Nach der Finanzkrise gewinnt die Forderung nach dem Primat der Politik an Legitimation. Bereitet das dem Leiter des liberalen NZZ-Wirtschaftressorts Sorgen? Über die Forderung nach dem Primat der Politik diskutieren wir gelegentlich auch hausintern. Ich halte die Diskussion einerseits für banal und andererseits für gefährlich. Banal, weil es doch völlig klar ist, dass die Wirtschaft nicht in einem luftleeren Raum operiert, sondern innerhalb eines politisch bestimmten Ordnungsrahmens. Zudem hoffe und denke ich, dass sich die meisten Manager bewusst sind, dass sie von einem Standort aus handeln, für den sie eine gewisse Mitverantwortung tragen. Warum halten Sie die Diskussion für gefährlich? Weil sie oft die Vorstellung ausdrückt, uns ginge es so gut, dass wir alles machen können – ob es nun der Wirtschaft schadet oder nicht. Das ist gefährlich. Es stimmt zwar: Uns geht es sehr gut. Aber nur, weil wir immer wieder entschieden haben: Was für die Wirtschaft gut ist, ist auch für das Land gut. Und wer träge wird und denkt, «naja, das ist ja alles egal, wir sind sowieso besser», der läuft Gefahr zurückzufallen. Ich bin Ökonom und für mich sind Freiheit und Verantwortung wichtig. Das funktioniert nur, wenn Wirtschaft und Politik Hand in Hand gehen. Sind sich die Manager ihrer Verantwortung bewusst? In den letzten Jahrzehnten haben sich meines Erachtens Wirtschaft und Politik etwas voneinander entfernt. Das hängt damit zusammen, dass die Schweizer Wirtschaft – zum Glück – sehr global orientiert ist. Viele Manager sind stark unter Druck. Zur Person Sie müssen um die Welt reisen Peter A. Fischer ist seit November 2010 und sind immer knapp an Zeit. Leiter der Wirtschaftsredaktion der NZZ in Zürich. Zuvor war der Doktor der Ökonomie während dreieinhalb Jahren NZZ-Chinakorrespondent in Peking. Von 2001 bis 2007 wirkte er als Wirtschaftskorrespondent für Russland, Zentralasien und den Kaukasus in Moskau. Sein Eintritt in die Wirtschaftsredaktion der NZZ erfolgte 1999. Die Dissertation erlangte Fischer in Hamburg zum Thema «Ökonomie der Immobilität». Das Studium der Wirtschaftswissenschaften absolvierte der Ökonom in Bern, Kiel und Hamburg. Fischer ist verheiratet und lebt in Wetzikon bei Zürich. Wollen Sie sagen, den Managern sei das Verständnis für die Schweizer Politik abhandengekommen? Manchen fehlt wohl die Zeit, sich um den Heimatstandort zu kümmern. Vielleicht empfinden sie manchmal auch das Provinzielle der Politik als fremd. Und das ist gefährlich, wie sich in einigen Abstimmungen gezeigt hat. Denn das Wesen der Schweizer Demokratie beruht darin, dass der Ordnungsrahmen wirtschaftsfreundlich ist. Bisher ist es fast immer gelungen, eine Mehrheit der Stimmbürger davon zu überzeugen. Deshalb ist es wichtig, dass sich Unternehmer äussern und für ihre Sache kämpfen. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 29 WIRTSCHAFT UND POLITIK Ist das nicht zu pauschal mit der Entfremdung? In den vergangenen Jahren ist der Binnensektor stärker gewachsen als die Exportwirtschaft. In den letzten Jahren sind tatsächlich geschützte, oft staatsnahe Binnensektoren wie beispielsweise das Gesundheitswesen und die öffentliche Verwaltung überproportional gewachsen. Das ist aber eher ein Alarmzeichen. Denn unser Wohlstand wird ganz wesentlich im exportorientierten Sektor erwirtschaftet, der sehr produktiv ist. Ohne florierende Exportwirtschaft könnte auch der eng damit verzahnte Binnensektor niemals so hohe Löhne bezahlen. Stellen Sie eine gewisse Trägheit in der Schweiz fest? Wohlstand fällt nicht vom Himmel. Die ausländischen Konkurrenten schlafen nicht. Ich habe zehn Jahre in Russland und in China gearbeitet. Da sah ich: Gerade in China sind die Leute bereit, viel dafür zu tun, dass es ihnen besser geht. In der Schweiz müssen wir deshalb zu unserer durchaus vorhandenen Effizienz und Geschicktheit Sorge tragen. Wie? Ganz entscheidend ist für mich: Was wir machen, müssen wir effizient tun. Lasst Märkte effizient funktionieren. Danach können wir diskutieren, ob wir das Marktergebnis politisch verändern wollen – indem wir beispielsweise umverteilen. Wobei: Jeder Eingriff verursacht Kosten. Deshalb sollten solche Aktionen zielgerichtet und effizient sein. Der Erhalt der Freiheit ist aus ökonomischer Sicht zentral. Das heisst Nachtwächterstaat? Nein, das heisst nicht Nachtwächterstaat. Es braucht einen starken aber schlanken, dem Bürger verpflichteten Staat. Denken wir etwa an das Schlagwort Marktversagen. Der Markt ist sehr effizient. Aber er braucht in vielen Fällen eine effiziente Regulierung. Und wenn wir von Marktversagen sprechen, hat dies häufig mit Politik- oder Regulierungsversagen zu tun – und nicht mit Marktversagen selbst. Es braucht den Staat also einerseits, um diesen Ordnungsrahmen sicherzustellen, aber es braucht ihn auch, um politisch bestimmte Verteilungsfragen zu lösen. 30 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Denken wir an die Finanzkrise, wo der Markt versagt hat: Begrüssen Sie die neuen Finanzmarktregulierungen? Eine zentrale Erkenntnis aus der Finanzkrise ist: Es geht nicht, dass Gewinne privatisiert und Verluste vergemeinschaftet werden. Der Staat soll nicht für Verluste aufkommen, die durch ein zu risikoreiches Verhalten generiert wurden. Deshalb ist die Lösung des «too big to fail»-Problems zentral. Banken müssen Konkurs gehen können, und sie müssen einstehen für das, was sie machen. Zu viel Regulierung ist allerdings «Ich bin durch das, gefährlich. was ich in China und Russland gesehen habe, zu einem noch stärkeren Anhänger der direkten Demokratie geworden.» Inwiefern? Sie verursacht den Banken nicht nur hohe Kosten. Die Überregulierung führt verstärkt zu einer Tick-the-box-Mentalität: Manager verbringen ihre Zeit, Listen abzuarbeiten, und haken ab, ob alle Bedingungen der Finanzmarktaufsicht und der Corporate Governance erfüllt sind. Bei einer solchen Arbeitsweise stehen strategische Fragen und Fragen der Verantwortung nicht mehr im Zentrum. Und das ist heikel. Gehen die Reformen zu den Finanzmarktgesetzen auch in Richtung Überregulierung der Banken? Die Reformen haben eine gewisse Berechtigung. Erstens, weil wir einen internationalen Finanzplatz haben, und der muss global agieren können. So verlangt die EU beispielsweise für einen Marktzutritt regulatorische Äquivalenz. Das heisst, die Regulierung in der Schweiz muss gleichwertig sein. Da können wir nicht einfach sagen: Das kümmert uns nicht. In der Schweiz haben wir zum Glück die Tradition, zuerst die Prinzipien festzulegen und sie dann mit Vernunft anzuwenden. Dabei sprechen wir miteinander. Und nicht: Wir legen Regeln für jedes Detail fest und nehmen dann einfach das Handbuch aus dem Regal. Was ist schlecht daran, wenn durch das Finanzdienstleistungsgesetz die Anleger besser geschützt werden sollen? Die Frage ist doch: Wen schützt man wirklich? Wie beispielsweise beim Arbeitnehmerschutz. DIE VOLKSWIRTSCHAFT Wenn man zu sehr reguliert beim Arbeitsmarkt, dann ist der Arbeitnehmer arbeitslos und findet keine neue Stelle. Wir sprechen hier vom Bankenwesen. Das Bankenwesen funktioniert beim Anlegerschutz ähnlich. Die Bank muss unzählige Formulare ausfüllen, die besagen, dass der Kunde dieses oder jenes zur Kenntnis genommen hat. Damit sichert sie sich letztlich bloss selber ab. Deshalb gilt auch hier: Der Kunde ist nicht dumm. Er trägt eine gewisse Verantwortung für sein Verhalten. Mehr Formulare und Zertifizierungen für Berater garantieren keineswegs eine bessere, verantwortungsvollere Dienstleistung. Die Gesetzesänderungsvorschläge schiessen teilweise deutlich über das Ziel hinaus. Themenwechsel. Nach der Annahme der Masseneinwanderungs- und der Abzockerinitiative wurde kritisiert, die direkte Demokratie schade der Wirtschaft. Teilen Sie diese Kritik? In Russland und in China hat man mir immer erklärt, die direkte Demokratie überfordere die Bürger. Im Sinne von Churchills bekanntem Zitat kann ich sagen: Die direkte Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, mit Ausnahme aller anderen, die ich kenne. Ich bin durch das, was ich in diesen Ländern gesehen habe, zu einem noch stärkeren Anhänger der direk- ten Demokratie geworden. Erstens, weil bei uns Entscheidungen breit abgestützt werden: Interessensgruppen werden dazu gebracht, sich zu erklären, um anschliessend einen Konsens zu finden. Zweitens, weil die Stimmbürger hierzulande nicht nur darüber abstimmen können, welche Ausgaben sie wollen, sondern auch, wie sie diese finanzieren. Das halte ich für ganz zentral. Vereinzelt habe ich mich aber auch schon gefragt, ob die direkte Demokratie manche Stimmbürger überfordert. Bei einer Stimmbeteiligung von 40 Prozent zum Beispiel? Die Stimmbeteiligung ist nicht so entscheidend. Jeder kann ja entscheiden, ob er abstimmen will. Aber ich war schon sehr betroffen, als die Masseneinwanderungsinitiative angenommen wurde. Da führten durchaus berechtigte Sorgen und Ängste dazu, dass man einem Instrument zugestimmt hat, das viele neue Probleme schafft und uns schadet – ohne die eigentlichen Probleme zu lösen. Ich glaube, da waren sich zumindest einige Stimmbürger nicht ganz bewusst, was das bedeutet. Sie sagen, die direkte Demokratie trage zum Konsens bei. Aber die Entscheide an der Urne werden eben gerade nicht durch einen Kompromiss gefällt. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 31 WIRTSCHAFT UND POLITIK Der binäre Entscheid ist das eine. Aber schauen wir doch auch, was nachher kommt. Im Fall der Masseneinwanderungsinitiative ist nun ein längerer Prozess in Gang gesetzt worden, dessen genaues Ergebnis noch unklar ist. Das haben wir der direkten Demokratie zu verdanken. Nun hoffe ich, dass es uns gelingen wird, eine Lösung zu finden, die es erlaubt unser Verhältnis zu Europa zu bewahren und gleichzeitig die Migrationsfrage so zu regeln, dass wieder ein Konsens entsteht. Dennoch: Bei solchen Volksabstimmungen kommen Emotionen hoch. Das ist Gift für die Wirtschaft. Mit solchen Situationen muss man umgehen können. Es ist gefährlicher, wenn sich Emotionen in politischem Extremismus entladen. In der Schweiz führen solche Volksentscheide immer zu langen Diskussionen – und einer Konsenssuche. Initiativen müssen ja auch umgesetzt werden. Was mich mehr beunruhigt: Diese stark etablierte Konsenskultur ist in letzter Zeit in Bedrängnis geraten – durch die Polarisierung auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Auch Referenden und Initiativen haben in den vergangenen Jahren zur Polarisierung beigetragen. Ja. Traditionell war ja die Volksinitiative ein Instrument für Gruppen, die im parlamentarischen Betrieb kein Gehör fanden. Heute verwenden es Parteien immer mehr, um Wahlkampf zu betreiben. Das ist eine ungute Entwicklung. Dennoch ist jetzt keine Panik angesagt. Nach der Massen­ einwanderungsinitiative kamen komplexe Initia­ tiven zur Abstimmung: Ecopop, Goldinitiative und Pauschalsteuer. Wären sie angenommen worden, wären sie alle schädlich für die Wirtschaft und für das Land gewesen – doch alle wurden deutlich abgelehnt. Das zeigt doch, dass die direkte Demokratie in der Schweiz funktioniert. Insofern sehe ich die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative auch als ein Weckruf an die Wirtschaft, dass etwas nicht stimmt. Wollen Sie sagen: Die direkte Demokratie weist die Wirtschaft in Schranken, wenn sie überschiesst? Die direkte Demokratie definiert den Ordnungsrahmen, in dem die Wirtschaft agieren kann. Sie 32 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 definiert etwa, ob ein Unternehmen Fachkräfte genug schnell finden kann und deshalb lieber hier tätig ist als an einem ausländischen Standort. Wenn nicht, dann wandern eben Arbeitsplätze ins Ausland ab. Haben wirtschaftspolitische Themen einen Einfluss auf den Wahlkampf und das Wahlergebnis? Wirtschaftspolitische Themen sollten beim Wahlkampf präsent sein. Und zwar nicht nur im Sinne von Schlagwörtern, sondern weil es wirklich um ernsthafte Fragen geht. Die Schweiz ist wirtschaftlich erfolgreich. Wir haben sehr viele internationale Unternehmen und unsere KMU sind eng verzahnt mit den vielen internationalen Unternehmen. Wenn ein Teil der grossen Firmen wegzieht, dann kommt schnell Sand ins Getriebe. SCHWERPUNKT Ist es erfolgsversprechend für die Parteien solche Fragen aufzunehmen? Ich glaube, es ist noch nicht allen genügend bewusst, wie sehr die Frankenstärke zusammen mit der Unsicherheit über unser künftiges Verhältnis zu Europa und der Zukunft der Unternehmensbesteuerung für den Wirtschaftsstandort Schweiz ein gefährlicher Schock sind. Darauf müssen wir geschickt reagieren. Ich hoffe, dass die Wähler wirtschaftspolitische Themen ernst nehmen und überlegen, welche Parteien vernünftige Antworten haben. Die Schweiz leidet in vielen Bereichen wieder unter einem Reformstau, weil für längerfristig orientierte, vernünftige Reformen die notwendigen soliden politischen Mehrheiten fehlen. Die Stimmbürger haben es in der Hand, das zu ändern. Die Forschung zeigt aber, dass im Jahr 2011 die Frankenstärke von den Parteien nicht in Wählerstimmen umgemünzt werden konnte. Ich hoffe, dass die wirtschaftspolitischen Themen mehr Einfluss haben werden als bei den letzten Wahlen. Das ist eine Chance für die Parteien. Die direkte Demokratie hat sehr viel mit Erklären zu tun und mit der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte herunterzubrechen. Die Wirtschaft hat es in den letzten Jahren etwas verpasst, zu vermitteln, dass es nicht nur darum geht, Abstimmungskämpfe zu gewinnen. Es geht um das Grundverständnis: Was für die Wirtschaft gut ist, ist in einem guten Ordnungsrahmen auch für die Gesellschaft gut. Der freie Markt steht in der Kritik bei der Bevölkerung. Das führt zu Misstrauen gegenüber der Position der Wirtschaftsvertreter. Es braucht glaubwürdige Wirtschaftsvertreter, die ihre Position nachvollziehbar erklären. Es braucht auch Medien, die wirtschaftspolitische Zusammenhänge aufzeigen, analysieren und kommentieren. Es braucht hoffentlich die NZZ (lächelt). Wenn ich die Länder in Europa und die Schwellenländer mit der Schweiz vergleiche, ist das Verständnis der Bevölkerung für wirtschaftliche Zusammenhänge bei uns deutlich grösser. Ich glaube, das verdanken wir der direkten Demokratie. Insofern bin ich nicht so pessimistisch. Es gibt einen Grundkonsens, dass eine marktwirtschaftliche liberale Grundordnung der Schweiz zu ihrem Erfolg verholfen hat. Wir haben einen attraktiven Standort. Die Schweiz ist politisch stabil, verlässlich und solide, manchmal sind wir halt etwas langweilig und langsam. Wie steht es um die Verfilzung in unserem Land? Ich habe lange in grossen Ländern gearbeitet und bin deshalb überzeugt: «small is beautiful». Man kennt sich, kommt regelmässig zusammen, muss sich immer wieder begegnen und mit den Argumenten des anderen auseinandersetzen. Das «Die stark etablierte bedeutet, dass man immer wieKonsenskultur ist in der den Konsens suchen muss. Es ist wichtig, dass die Politiker letzter Zeit in Bedrängdie Anliegen der Wirtschaft vernis geraten – durch stehen. Und deswegen ist es auch die Polarisierung auf wichtig, dass Interessenvertreter beiden Seiten des poliden Politikern das erklären. tischen Spektrums.» Sie halten wenig von der Kritik am Lobbyismus … Ich glaube nicht, dass Politiker in der Schweiz gekauft werden können. Aber es ist manchmal ein Problem, dass die Politik die Wirtschaft und die Probleme eines Unternehmers nicht mehr versteht und umgekehrt. Deshalb wäre es mir eigentlich lieber, wenn es wieder mehr Durchlässigkeit zwischen Politik und Wirtschaft gäbe, und etwas weniger klassische Politprofis im Parlament. Die Chefredaktorinnen Nicole Tesar und Susanne Blank haben das Gespräch mit Peter A. Fischer geführt. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 33 WIRTSCHAFT UND POLITIK Kleine Parteien sind Verlierer des föderalen Wahlsystems Das Wahlsystem in der Schweiz ist nicht perfekt: In kleinen Kantonen gehen Kleinparteien bei Nationalratswahlen oft leer aus. Eine Reform des Wahlsystems könnte dies ändern. Der Preis dafür ist aber hoch. Adrian Vatter Abstract Wahlsysteme bevorzugen – oder benachteiligen – einzelne Parteien. Untersuchungen zum Schweizer Wahlsystem zeigen: Die Wahlkreisgrösse übt den stärksten Effekt auf die Umwandlung von Stimmen in Mandate aus. Während bei Nationalratswahlen besonders die mittleren und grossen Volksparteien von den kleinen kantonalen Wahlkreisen mit hohen Eintrittsschwellen profitieren, gehören kleinere Parteien zu den Verlierern des föderalen Wahlsystems. Aus den Listenverbindungen ziehen vor allem die Mitteparteien den grössten Nutzen. Die grosse Offenheit des schweizerischen Wahlsystems wirkt sich für die (rechts)bürgerlichen Parteien hingegen negativ aus. Die Einführung eines biproportionalen Wahlverfahrens würde insbesondere in den kleinen Kantonen zu einer besseren Repräsentation der Wähler führen. Für eine allfällige Reform des Wahlsystems müssten allerdings potenzielle Nachteile in Kauf genommen werden: So könnte eine weitere Parteienzersplitterung zu mehr Instabilität führen. W ahlsysteme prägen entscheidend den Charakter eines politischen Systems.1 Durch sie werden die politischen Präferenzen der Wähler in Mandate für die Repräsentationsorgane wie den Nationalrat übersetzt. Die Gestaltung des Wahlsystems ist damit auch immer eine zentrale Machtfrage, die darüber entscheidet, welche politischen Gruppierungen die Parlamentsmehrheit stellen und welche in der Minderheit sind.2 Der Artikel sucht nach Antworten auf folgende Fragen: Wie wirkt sich das schweizerische Wahlsystem auf den Erfolg der Parteien bei den Nationalratswahlen aus? Ist eine Systemreform angezeigt? Die institutionellen Grundlagen des Wahlsystems für den Nationalrat Bei den alle vier Jahre stattfindenden Nationalratswahlen gilt das Proporzwahlsystem. Die Mandatszahl einer Partei richtet sich im Grundsatz nach dem prozentualen Stimmenanteil. 34 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 1 Der Beitrag bildet einen gekürzten Vorabdruck des gleichnamigen Kapitels aus dem Buch «Wahlen und Wählerschaft in der Schweiz» (Markus Freitag und Adrian Vatter, Hg.), welches anlässlich der eidgenössischen Wahlen im Sommer 2015 beim NZZ-Verlag erscheint. 2 Nohlen (2009), S. 68. 3 Vatter (2014). 4 Blais und Massicotte (1996). Damit werden nicht direkt Kandidaten gewählt, sondern in erster Linie die Parteien. Ausdruck des stark föderalen Charakters des Wahlsystems ist der Grundsatz: Jeder Kanton bildet einen eigenen Wahlkreis und erhält mindestens einen der insgesamt 200 Sitze. Die Mandate werden unter den Kantonen im Verhältnis zu ihrer gesamten Wohnbevölkerung verteilt. Die Stimmenverrechnung erfolgt nach dem Hagenbach-Bischoff-Verfahren; einem Wahlzahlverfahren, welches einen möglichst exakten Proporz anstrebt.3 Ein weiteres wichtiges Element ist die Einzelstimmenkonkurrenz, bei der der Wähler so viele Einzelstimmen hat, wie in seinem Wahlkreis Nationalratssitze zu vergeben sind. Die Stimme für einen Kandidaten ist dabei zunächst eine Stimme für die Parteiliste, die den Kandidaten aufführt. Die Einzelstimmenkonkurrenz räumt den Wählern in Kombination mit den Möglichkeiten des Panaschierens, des Kumulierens und des Streichens äusserst grosse Gestaltungsfreiheiten in der Auswahl und der Bevorzugung von Kandidaten ein.4 Ein weiteres Merkmal ist das Instrument der Listenverbindung. Dies ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Parteilisten, die bei der Mandatsverteilung wie eine einzige Liste betrachtet werden. So soll eine bessere Verwertung der Reststimmen gewährleistet werden. Diese Regeln haben unterschiedliche Effekte auf die Proportionalität von Stimmen und Mandaten. Insbesondere die Wahlkreisgrösse, das Wahlzahlverfahren und die Listenverbindungen spielen eine Rolle. SCHWERPUNKT KEYSTONE Landsgemeinde in Appenzell-Innerrhoden. In Kantonen mit nur einem Nationalrats­ vertreter gehen Kleinparteien meist leer aus. WIRTSCHAFT UND POLITIK Wahlkreisgrösse als Sperrklausel Von herausragender Bedeutung für den Wahlerfolg der Parteien sind die Einteilung und die Grösse der Wahlkreise.5 Führende Wahlforscher bezeichnen die Wahlkreisgrösse sogar als das wichtigste Merkmal eines Wahlsystems und weisen darauf hin, dass der Proporzeffekt primär von der Wahlkreisgrösse abhängt.6 Die Wahlerfolgsschwelle gibt an, wie viele Wähleranteile es braucht, damit eine Partei in einem Kanton auch mindestens einen Sitz im Nationalrat gewinnt. Die beträchtlichen Bevölkerungsdifferenzen zwischen den Kantonen führen zu sehr unterschiedlich hohen Schwellen und damit auch zu einer empfindlichen Einschränkung des Proporzwahlsystems.7 So müssen die Parteien in den 13 mittleren und kleineren Proporzkantonen, wo weniger als zehn Mandate zu vergeben sind, für einen Sitz theoretisch einen Stimmenanteil von mehr als zehn Prozent erreichen. In den Kantonen Jura und Schaffhausen, wo nur zwei Sitze zu verteilen sind, braucht es einen Drittel der Stimmen, um in den Nationalrat einzuziehen. Und in den sechs bevölkerungsschwachen Kantonen (Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden) wird nur ein einziges Nationalratsmandat vergeben.8 Dort existiert faktisch ein Mehrheitswahlsystem, denn es ist derjenige Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen erhält. Damit wirkt sich die geringe Wahlkreisgrösse in den kleinen Kantonen wie eine hohe Sperrklausel aus, und die Anteile der erhaltenen Sitze weichen von denjenigen der Stimmen oft beträchtlich ab. Anders sieht es in den sieben grössten Kantonen aus, wo die Wähler- und Sitzanteile annähernd übereinstimmen. So brauchte es bei den eidgenössischen Wahlen von 2011 im Kanton Zürich mit 34 Sitzen weniger als drei Prozent der Stimmen, um einen Nationalratssitz zu gewinnen. Im Kanton Bern sind bei den Nationalratswahlen 2015 fast vier Prozent Stimmen für ein Vollmandat notwendig. In der Praxis ist die Wahlerfolgsschwelle, bedingt durch Restmandatsverteilungen und Listenverbindungen, aber niedriger. Grüne und EVP verlieren am meisten 5 Nohlen (2009), S. 86. 6 Anckar (1997); Gallagher (1991); Lijphart (1994); Taagepera und Shugart (1989). 7 Linder (2012). 8 Vatter (2014). 9 Vatter (2002, 2003). 10 Vatter (2002). 11 Seitz 1993, Seitz und Schneider 2007). Biproportionales Zuteilungsverfahren («doppelter Pukelsheim») Das biproportionale Zuteilungsverfahren (auch als «doppelter Pukelsheim» entsprechend dem Namen seines Begründers bekannt) ist eine Methode zur Verteilung von Parlamentsmandaten auf Parteien bei mehreren Wahlkreisen in Proporzwahlen. In den letzten Jahren wurde das Verfahren in mehreren Kantonen (z. B. Zürich, Schaffhausen, Aargau) eingeführt. Denn die bisherige Aufteilung in zahlreiche kleine Wahlkreise 36 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 verminderte die Chancen kleinerer Parteien auf eine Parlamentsvertretung. Das Verfahren will eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen Wähler- und Mandatsanteilen der Parteien gewährleisten (Erfolgswertgleichheit der Stimmen), ohne dass die bestehenden Wahlkreise aufgehoben werden. Die «doppelte Proportionalität» bezieht sich darauf, dass die Parteien und die Wahlkreise proportional in der Legislative vertreten sein sollen. Abbildung 1 zeigt die direkte Beziehung zwischen der Wahlkreisgrösse und ihrem Proporzeffekt. Abbildung 2 führt den Zusammenhang zwischen der durch die Wahlkreisgrösse bedingten Wahl­ erfolgshürde und der kantonalen Parteienzahl im Nationalrat vor Augen. Dabei wird deutlich, dass die Wahlkreisgrösse nicht nur die Fragmentierung des Parteiensystems deutlich beeinflusst.9 Sie benachteiligt vor allem die kleinen Parteien stark und schränkt damit den Wettbewerb zwischen den Parteien ein. Im Extremfall herrscht in Kleinkantonen manchmal überhaupt kein Wettbewerb. Während die kleinen Kantone mit wenigen Sitzen pro Wahlkreis nur ein bis drei grosse Parteien in den Nationalrat entsenden, sind es in den sieben bevölkerungsreichsten Kantonen mit grossen Wahlkreisen sechs oder mehr Parteien.10 Die Stimmenverrechnung durch das Hagenbach-Bischoff-Verfahren wirkt diesem Effekt nicht entgegen, sondern verstärkt ihn vielmehr noch. Denn die Berechnung bevorzugt grosse Parteien leicht und benachteiligt die kleinen und kleinsten dementsprechend. Generell zeigt sich: Je höher die Wahlerfolgsschwelle ist, umso ungleicher sind die Chancen unter den Parteien verteilt, Mandate zu gewinnen. Während nämlich die grossen Volksparteien wie die FDP, die CVP und die SP, aber auch Parteien mit lokalen Hochburgen – wie lange Zeit die Liberalen in der Westschweiz oder die SVP in der Deutschschweiz – von einer hohen Eintrittsschwelle profitieren, gehören kleinere Parteien wie etwa die Grünen oder die EVP zu den Verlierern.11 Rot-grünes Lager profitiert von Listenverbindungen Dieser Ungleichheit können Listenverbindungen entgegenwirken: Der Zusammenschluss kleinerer Parteien zu einem Bündnis soll vor allem verhindern, dass ihre Stimmen verloren gehen. Abb. 1: Wahlkreisgrösse und Anzahl Parteien im Nationalrat (Wahlen 2011) Abb. 2: Wahlkreisgrösse und Erfolgshürde bei den Nationalratswahlen 2011 Anzahl Parteien im Nationalrat Wahlerfolgshürde (in % der Stimmen) 8 50 7 40 6 5 30 4 20 3 2 10 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Wahlkreisgrösse (Anzahl Nationalratssitze) 15 18 26 0 34 Mittelwert 1 2 3 4 5 6 7 8 Wahlkreisgrösse (Anzahl Nationalratssitze) 10 11 12 15 18 26 34 benötigte Stimmen Lesebeispiel: In einem Kanton mit nur einem Nationalratssitz beträgt die Erfolgshürde 50% der Stimmen. Lesebeispiel: Bei einem Kanton mit 7 Mandaten verteilen sich die Nationalratssitze auf über 4 Parteien. BERECHNUNGEN VATTER AUF BASIS DES BUNDESAMTES FÜR STATISTIK (2012) / DIE VOLKSWIRTSCHAFT Abb. 3: Sitzgewinne und -verluste der Parteien durch Listenverbindungen bei den Nationalratswahlen 1995–2011 Anzahl Sitze +4 +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8 1995 SVP GLP 1999 FDP SPS CVP 2003 2007 2011 Grüne DARSTELLUNG VATTER AUF DER GRUNDLAGE VON BOCHSLER (2010) UND BOCHSLER UND ALPIGER (2011) / DIE VOLKSWIRTSCHAFT KEYSTONE WIRTSCHAFT UND POLITIK Die Ergebnisse der Nationalratswahlen der letzten Jahre machen deutlich, dass der Einsatz von Listenverbindungen bedeutsam für den Wahl­ erfolg der Parteien ist, wobei diese ganz unterschiedlich davon profitieren (siehe Abbildung 3). Das rot-grüne Lager nutzt dieses Instrument seit Längerem konsequent und hat damit im Durchschnitt pro Legislaturperiode rund fünf Sitze allein der Möglichkeit von Listenverbindungen zu verdanken. Das zeugt aber nicht alleine von beträchtlichem wahltaktischem Bündnisgeschick, sondern hängt einerseits mit der starken parteipolitischen Zersplitterung des rot-grünen Lagers, andererseits aber auch mit der gleichzeitigen politischen Geschlossenheit aufgrund hoher ideologischer Gemeinsamkeiten zusammen.12 Grundsätzlich gilt: Innerhalb einer Listenverbindung profitiert jeweils die grösste Partei der Allianz, während aus Unterlistenverbindungen besonders Kleinparteien Nutzen ziehen. Im Weiteren fördern Listenverbindungen sogenannte Splitlisten innerhalb der Parteien, um verschiedene Wählersegmente – wie Junge, Senioren, Frauen – innerhalb einer Partei anzusprechen, was zusätzlich die Kandidatenselektion in den Parteien proportionalisiert.13 Umgekehrt gehen die Sitzgewinne aus Listenverbindungen in der Regel auf Kosten derjenigen grossen Parteien, die alleine antreten. Dies gilt insbesondere für die (rechts-)bürgerlichen Parteien, die politisch zwar deutlich heterogener, gleichzeitig aber par- 38 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Grünen-Politikerinnen Maja Graf (BL, Mitte) und Franziska Teuscher (BE, rechts) an einer Wahlveranstaltung im September 2011. Die Grünen scheitern in Kleinkantonen oft am Wahlsystem. teipolitisch weniger fragmentiert sind als die links-grünen Gruppierungen. Insgesamt stärkt die freie Listenform mit der Möglichkeit der Listenverbindung zwischen ideologisch einander nahestehenden Parteien die Partizipations- und Inklusionsfunktion des Wahlsystems im Sinne der ausgebauten Möglichkeiten für die Wählenden, ihre Präferenzen im Idealfall möglichst genau auszudrücken.14 Gleichzeitig schwächen diese Instrumente aber die Stellung, die Geschlossenheit und die Rolle der Parteien im politischen System, da nicht mehr sie alleine über die gewählte Reihenfolge der Kandidaten entscheiden können. Der Repräsentationseffekt des Schweizer Wahlsystems: Ist es Zeit für eine Revision? 12 Bochsler (2010). 13 Ebd. 14 Blais und Massicotte (1996); Nohlen (2009). 15 Bochsler (2005); Bundeskanzlei (2013); Linder et al. (2011). 16 Pukelsheim (2014); Pukelsheim und Schuhmacher (2004). Der Anspruch eines proportionalen Wahlsystems ist die möglichst präzise Übersetzung von Wählerstimmen- in Mandatsanteile. Dieser Repräsentationseffekt wird durch die Möglichkeit der Listenverbindungen insgesamt optimiert. Die föderale Wahlkreiseinteilung mit den zahlreichen kleinen Kantonen in Kombination mit dem Hagenbach-Bischof-Verfahren mindert hingegen diesen Effekt, was vor allem zulasten kleiner Parteien geht. Wahlsystemanpassungen in den Kantonen Zürich, Aargau, Schaffhausen, Nidwalden und Zug haben in jüngster Zeit zu einer öffentlichen SCHWERPUNKT Diskussion, parlamentarischen Vorstössen und einer breit abgestützten Abklärungsstudie der Bundeskanzlei über das geeignetste Wahlsystem geführt.15 Das in den Kantonen eingeführte biproportionale Wahlverfahren («doppelter Pukelsheim», siehe Kasten) weist gegenüber dem Hagenbach-Bischoff-Verfahren verschiedene Vorteile auf:16 Es führt zu mehr proportionaler Gerechtigkeit, höherer Stimmkraft- und Erfolgswertgleichheit, einer besseren Vertretung kleinerer Parteien und einer grösseren Parteienauswahl. Auf nationaler Ebene würde dies – insbesondere bei kleineren Kantonen – ebenfalls gelten. Eine neuere Simulation von Bochsler und Alpiger (2011) zeigt: Bei der Anwendung des «doppelten Pukelsheim» auf Nationalratsebene profitieren die kleinen Parteien, während die grossen Parteien tendenziell Sitze abgeben müssen. Zudem sprechen die zunehmende Nationalisierung von Wahlen und das Verschwinden kantonaler Parteibesonderheiten für eine weitere Proportionalisierung des stark kantonal geprägten Wahlsystems auf nationaler Ebene. Eine Reform in Richtung eines möglichst proportionalen Wahlsystems mit nationalem Verrechnungsverfahren – bei weiterhin kantonalen Wahlkreisen – würde zu einer verbesserten Erfüllung der wichtigen Funktion des Verhältniswahlsystems führen: eines möglichst präzisen Abbilds der Wählerschaft im Parlament. Es stellt sich allerdings die Frage, ob eine weitere Stärkung der Repräsentationsfunktion durch ein entsprechendes Wahlverfahren nicht gleichzeitig eine weitere Parteienzersplitterung, eine Schwächung der gemässigten Mitteparteien und eine zunehmende Instabilität der Regierungsbildung durch das Parlament begünstigt. Dies würde eine andere und für die Schweiz zunehmend wichtige Kernfunktion von Wahlsystemen schwächen, nämlich die regierungsbildende Konzentrationsfunktion. Aufgrund des bisher praktizierten Verbots von Listenverbindungen beim doppelt proportionalen Verrechnungsverfahren würde zudem die Partizipationsfunktion reduziert. Nicht übersehen sollte man bei all diesen Überlegungen: Das Schweizer Wahlsystem gehört im internationalen Vergleich zu den gerechtesten, was die Proportionalität von Stimmen und Mandaten betrifft. Adrian Vatter Professor (Ordinarius) für Politikwissenschaft und Direktor am Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. Literatur Anckar, Carsten (1997). Determinants of Disproportionality and Wasted Votes. Electoral Studies 16: 501–515. Blais, André und Louis Massicotte (1996). Electoral Systems. In Le Duc, Lawrence, Richard G. Niemi und Pippa Norris (Hrsg.), Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective. Thousand Oaks, London: Sage (40–69). Bochsler, Daniel (2005). Biproportionale Wahlverfahren für den Schweizer Nationalrat. Modellrechnungen für die Nationalratswahlen 2003. Universität Genf. www.bochsler.eu/publi/nationalrat_biproportional.pdf Bochsler, Daniel (2010). Was bringen Wahlallianzen? Links-grüne Parteien und deren Listenverbindungen im d’Hondtschen Verhältniswahlrecht der Schweizer Nationalratswahlen von 1995 bis 2007. Zeitschrift für Parlamentsfragen 41: 855–873. Bochsler, Daniel und Claudia Alpiger (2011). GLP und SP haben am besten taktiert. Die Bilanz der Listenverbindungen bei den Nationalratswahlen. Neue Zürcher Zeitung, 15. November 2011, 11. Bundesamt für Statistik (2012). Daten zu Wahlberechtigten und Bevölkerung. Bundesamt für Statistik (BFS). Bundeskanzlei (2013). Proporzwahlsysteme im Vergleich. Studienbericht vom 21.8.2013. Bern: Bundeskanzlei. Gallagher, Michael (1991). Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems. Electoral Studies 10: 33–51. Lijphart, Arend (1994). Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945–1990. Oxford: Oxford University Press. Linder, Wolf (2012). Schweizerische Demokratie. Institutionen, Prozesse, Perspektiven, 3. Auflage. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt. Linder, Wolf, Georg Lutz, Christian Bolliger und Sophia Hänny (2011). Switzerland. In Nohlen, Dieter und Philip Stöver (Hrsg.), Elections in Europe. A Data Handbook. Baden-Baden: Nomos (1879–1966). Nohlen, Dieter (2009). Wahlrecht und Parteiensystem. Theorie und Empirie der Wahlsysteme, 6. Auflage. Opladen: Verlag Barbara Budrich. Pukelsheim, Friedrich (2014). Proportional Representation. Apportionments Methods and Their Applications. Berlin: Springer. Pukelsheim, Friedrich und Christian Schuhmacher (2004). Das neue Zürcher Zuteilungsverfahren für Parlamentswahlen. Allgemeine Juristische Praxis 5: 505–522. Seitz, Werner (1993). Die Nationalratswahlen 1991. Übersicht und Analyse. Bern, Neuenburg: Bundesamt für Statistik. Seitz, Werner und Madeleine Schneider (2007). Die Nationalratswahlen 2007. Der Wandel der Parteienlandschaft seit 1971. Neuenburg: Bundesamt für Statistik (BFS). Taagepera, Rein und Matthew Shugart (1989). Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems. New Haven, London: Yale University Press. Vatter, Adrian (2002). Kantonale Demokratien im Vergleich. Entstehungsgründe, Interaktionen und Wirkungen politischer Institutionen in den Schweizer Kantonen. Opladen: Leske + Budrich. Vatter, Adrian (2003). Legislative Party Fragmentation in Swiss Cantons: A Function of Cleavage Structures or Electoral Institutions? Party Politics 9: 445–461. Vatter, Adrian (2014). Das politische System der Schweiz. Baden-Baden: Nomos. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 39 WIRTSCHAFT UND POLITIK Wirtschaftslage beeinflusst Wahlen in der Schweiz kaum In der Schweiz hat die Wirtschaftslage die Wahlen in den letzten 20 Jahren nur minim beeinflusst. Dies dürfte sich auch dieses Jahr nicht ändern. Georg Lutz Abstract Die Annahme, dass wirtschaftspolitische Themen und die wirtschaftliche Lage zentral für den Wahlausgang sind, ist weit verbreitet. Allerdings sind die wissenschaftlichen Belege dafür umstritten, und auch für die Schweiz lässt sich kein Effekt feststellen. Zwar wird die FDP überdurchschnittlich als jene Partei wahrgenommen, die am kompetentesten ist, wirtschaftliche Probleme zu lösen. Dies stärkt die Liberalen allerdings nicht merklich, da viele andere Faktoren für den Wahlentscheid wichtig sind. Zudem war die Wirtschaftslage in den letzten 20 Jahren aus Sicht der Wähler nur einmal überhaupt ein wichtiges Problem. Das zeigen die Daten der Studie Selects aus dem Jahr 2011. Die Frankenstärke dürfte bei den nationalen Wahlen keinen grossen Einfluss auf einzelne Parteien haben. Denn in der Schweiz wird keine Partei mit der Lösung des Problems identifiziert. Wie wirkt die Wirtschaft auf die Wähler? D Für die Wähler waren im Herbst 2011 Immigration und Umwelt wichtigere Themen als die Wirtschaftslage. Die Grundannahme über den Einfluss der Wirtschaft bei Wahlen ist einfach: Ist die wirtschaftliche Lage gut, dann nützt dies der Regierung. Ist die wirtschaftliche Lage schlecht, dann verliert sie Stimmen. Nach dieser Lesart werden SHUTTERSTOCK er Leitsatz «It’s the economy, stupid», den Bill Clintons Wahlkampfmanager 1992 im Hauptquartier der Demokraten aufhängte, um die Präsidentschaftskampagne fokussiert zu halten, wurde berühmt. Er ging davon aus: Die wirtschaftspolitischen Rezepte des Kandidaten sind relevant für den Wahlerfolg. Die Frage, wie wichtig die wirtschaftliche Lage und wirtschaftspolitische Themen sowie die persönliche wirtschaftliche Situation für den Wahlausgang sind, beschäftigt Politik und Wissenschaft seit langer Zeit. Bangend schauen viele Regierungen vor den Wahlen auf die Wirtschaftszahlen und hoffen, dass zentrale Wirtschaftsindikatoren positiv sind. Doch gibt es wirklich starke Belege für diese Zusammenhänge? 40 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Abb. 1: Das wichtigste Problem aus Wählersicht seit 1995 2011 20191710 7 5 4 4 4 3 2 6 2007 2615 1 17 6 3 74 3 82 9 3035 Befragte 1940 Befragte 20 3 1 191616 4 3 9 2 1 7 2003 2243 Befragte 1999 1318 Befragte 34 3 2 1013 6 315 8 1 1 6 9 10 5 025 3 217 16 1 0 13 1995 Ausländerfragen haben die Wähler bei den letzten vier Urnengängen am stärksten beschäftigt. 100% = alle Nennungen eines Wahlgangs. Regierungen für die wirtschaftliche Situation verantwortlich gemacht. Die Prämisse über die Zentralität der Wirtschaftslage ist in Politik und Wissenschaft weit verbreitet. In jüngster Zeit haben neue Forschungsergebnisse jedoch Zweifel daran aufkommen lassen. Unklar ist auch, ob dieser Effekt in der Schweiz erkennbar ist. Wie die wirtschaftliche Situation die Wahlen beeinflusst, ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Erstens stellt sich die Frage, welche Wirtschaftsindikatoren überhaupt relevant sind und wahrgenommen werden: Ist das Wirtschaftswachstum (bzw. eine wirtschaftliche Rezession), die Arbeitslosigkeit oder die Inflation entscheidend? Zweitens ist zu klären, ob eher die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Lage in der Vergangenheit oder die Erwartung für die Zukunft entscheidend ist. Und entsprechend: Wer wird dafür verantwortlich gemacht? Wie überzeugend sind die Antworten der politischen Akteure auf die wirtschaftlichen Herausforderungen? Drittens ist unklar, ob für die Wähler die objektive wirtschaftliche Situation wichtig ist; oder ob ihre subjektive Wahrnehmung – die durchaus von der objektiven Situation abweichen kann – den Ausschlag gibt. Und schliesslich ist viertens re de An ng e Au n z u sla m nd hu z ie Be Kr im Sic ina h e li t ä rh t , ei t an z St en u eu nd er n ,P ie n r te Pa F in oli po it s he nd su Ge Eu In t r o p e g äi s c r a he t io n lit i t ik er k t rk ma it s be Ar zia So le zia Sic lw he er k rh e, ei t so ft ha sc ir t W A u Im m slä ig nd r a er, tio A s n, yl Um we lt , En er K li g i e , ma 2841 Befragte SELECTS (2011), SHUTTERSTOCK zu klären: Schauen Wähler vor allem auf die generelle ökonomische Entwicklung, oder ist ihre persönliche wirtschaftliche Situation wichtig, Hinzu kommt, dass viele andere Themen und Faktoren einen Wahlentscheid beeinflussen und der Einfluss deshalb in jedem Fall limitiert ist. Bei dieser Komplexität ist es nicht erstaunlich, dass die Forschung keine eindeutigen Ergebnisse über den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Wahlverhalten liefert. Die empirischen Befunde sind instabil und inkonsistent: Während in einigen Ländern ein Zusammenhang erkennbar ist, gibt es viele Wahlen und Länder, in denen ein solcher fehlt. Dies lässt einzig den Schluss zu: Die wirtschaftliche Lage beeinflusst Wahlen selektiv und situativ. Wirtschaftslage selten entscheidend Die Vermutung eines situativen und eher geringen Einflusses lässt sich auch auf die Schweiz übertragen. Die Wirtschaftslage ist selten ein zentrales Problem für die Wählerschaft, womit eine Grundbedingung für die Wirkungskette schon mal nicht erfüllt ist. Bei den Wahlen in der Schweiz gibt es eine ausgeprägte Themenkonjunktur. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 41 WIRTSCHAFT UND POLITIK Abb. 2: Kompetenteste Partei, wirtschaftliche Probleme zu lösen – aus Wählersicht SVP 10% FDP 32% BDP 7% CVP 7% GLP 6% SP 17% Grüne 1% Andere 21% SELECTS (2011) / DIE VOLKSWIRTSCHAFT Partei (in % aller Parteinennungen), die am kompetentesten ist, das wichtigste Problem zu lösen, wenn «Wirtschaft» genannt wurde. (N=552) 1 Sämtliche Auswertungen basieren auf den Daten der Wahlstudie Selects (www.selects. ch). In den Analysen sind jeweils nur die Wählenden einbezogen. 42 Abbildung 1 zeigt, welche Themen von 1995 bis 2011 von den Wählerinnen und Wählern als wichtigstes Problem wahrgenommen wurden1: Die Wirtschaft war im untersuchten Zeitraum aus Sicht der Wähler einzig im Jahr 2011 ein wichtiges Thema. Damals befand sich Europa in einer Finanzkrise, und der Franken wurde immer stärker, worauf die Nationalbank einen Mindestkurs festsetzte. Zwar wurden im Beobachtungszeitraum verwandte Themen wie Finanzen und Steuern, der Arbeitsmarkt oder die Sozialwerke ebenfalls genannt, jedoch waren andere Themen – wie etwa Migration oder Umwelt – oft wichtiger. Die gängige Theorie ist zudem nur beschränkt auf das Schweizer Konkordanzsystem übertragbar, da sie davon ausgeht, dass die wirtschaftliche Situation vor allem einen Einfluss auf die Regierungs- und Oppositionsparteien hat. Diese Überlegungen funktionieren hier nur schlecht, da es kein Regierungs-/Oppositionssystem gibt, sondern die grossen Parteien seit vielen Jahren in die Regierung eingebunden sind und damit klare Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Verantwortlichkeiten für positive und negative Entwicklungen fehlen. In der Schweiz ist somit unklar, welche Parteien überhaupt für die Wirtschaftsentwicklung verantwortlich sind. FDP kann Wirtschaftskompetenz nur begrenzt in Stimmen umsetzen Trotzdem ist es möglich, dass wirtschaftliche Themen einer Partei mehr nutzen als anderen. Die Parteien haben dies erkannt und richten ihre Kampagnen systematisch darauf aus. Zudem lancieren sie Initiativen und ergreifen Referenden, um ihre Themenführerschaft zu untermauern – was ihnen auch gelingt. Das Feld ist in der Schweizer Parteienlandschaft klar abgesteckt: Sozialpolitik ist das Kernthema der SP, Umweltpolitik jenes der Grünliberalen und der Grünen; Migration jenes der SVP. Bei der Wirtschaft dominiert die FDP. Sie wird am ehesten als Partei wahrgenommen, welche dieses «Problem» am besten lösen kann. Von den Befragten, die 2011 gesagt hatten, die Wirtschaft sei das wichtigste oder zweitwichtigste SCHWERPUNKT ISTOCK Menschen in einem Einkaufszentrum. Die Wirtschaftslage in der Schweiz dürfte im Herbst einen relativ geringen Einfluss auf den Wahlentscheid haben. «Problem» in der Schweiz, gaben 32% an, die FDP habe dazu die besten Lösungen parat. 17% nannten die SP und nur 10% die SVP (siehe Abbildung 2). Allerdings konnte die FDP ihre Themenkompetenz nur beschränkt in Wählerstimmen umsetzen. Schaut man, welche Partei diese Befragten effektiv gewählt haben, dann liegt die FDP nur noch leicht über ihrem tatsächlichen Wähleranteil. Die subjektive Wahrnehmung der Wirtschaftslage Die Verantwortung für den Konjunkturverlauf einer bestimmten Partei zuzuschreiben, ist objektiv zwar schwierig. Dennoch ist es möglich, dass bestimmte Parteien von der subjektiven Wahrnehmung der Wähler profitieren. Im Rahmen der Wahlstudie Selects wurden 2011 nach den Wahlen sämtliche Personen gefragt, wie sie die wirtschaftliche Lage in der Schweiz beurteilen und ob sie der Meinung sind, die wirtschaftliche Lage habe sich verschlechtert oder verbessert. Die Sicht auf die Wirtschaft war damals weitgehend optimistisch. 64% jener, die sich an den Wahlen beteiligten, meinten 2011, es gehe der Wirtschaft gut oder sehr gut, und nur 8% gaben an, der Wirtschaft gehe es schlecht oder sehr schlecht. Allerdings beurteilte auch etwas über die Hälfte der Wählenden (53%), dass sich die wirtschaftliche Lage in den letzten zwölf Monaten verschlechtert habe, und nur 6% meinten, es habe eine Verbesserung gegeben: Die Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa wurde also in der Schweiz durchaus als bedrohlich wahrgenommen. Dies hatte allerdings keinen messbaren Einfluss auf den Wahlentscheid. Korreliert man die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Lage mit dem effektiven Wahlverhalten, so sind keine signifikanten Unterschiede zwischen den Parteien feststellbar. Oder in anderen Worten: Wer die wirtschaftliche Lage als gut und besser einschätzte, wählte nicht systematisch andere Parteien als jene, welche die wirtschaftliche Lage als schlecht und schlechter beurteilten (siehe Abbildungen 3 und 4). Die Volkswirtschaft 5 / 2015 43 WIRTSCHAFT UND POLITIK 8 8 18 6 «gut oder sehr gut» (64% der befragten Wähler) SVP GLP 4 12 5 «weder gut noch schlecht» (29% der befragten Wähler) FDP SPS 9 8 24 20 13 5 3 «schlecht oder sehr schlecht» (8% der befragten Wähler) CVP 8 Grüne Frankenstärke dürfte sich kaum auf Parteienwahl auswirken Theoretisch ist es auch in der Schweiz möglich, dass die Wirtschaft bei künftigen Wahlen einen grösseren Einfluss auf den Wahlentscheid haben wird. Dies vor allem dann, wenn die Schweiz plötzlich mit einem massiven Konjunktureinbruch, hohen Arbeitslosenzahlen oder starker Inflation zu kämpfen hätte. Dies zeichnet sich vor den Wahlen im Herbst jedoch nicht ab. Die Situation ist vergleichbar mit jener vor vier Jahren. Die Angst vor negativen Auswirkungen des starken Frankens auf die Beschäftigungssituation oder die Unsicherheit für die Wirtschaft über die Beziehungen der Schweiz zur EU sind zwar spürbar. Allerdings ist wie 2011 nicht er- 9 26 20 18 13 4 6 8 27 21 16 12 9 9 27 Abb. 4: Wählerumfrage nach Wahlen im Herbst 2011: Wahl­ entscheid und Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen 12 Monaten (N=3231) «verbessert» (6% der befragten Wähler) BDP 15 12 6 «unverändert geblieben» (41% der befragten Wähler) Übrige kennbar, dass eine Partei mit dem Problem oder mit möglichen Lösungen positiv oder negativ identifiziert wird, und darum sind für 2015 auch kaum Auswirkungen auf das Wahlverhalten zu erwarten. Georg Lutz Professor für Politikwissenschaft an der Universität Lausanne, Projektleiter der Wahlstudie Selects beim Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften FORS. Literatur Anderson, Christopher J. (2007). The End of Economic Voting? Contingency Dilemmas and the Limits of Democratic Accountability.Annual Review of Political Science 10: 271–296. 44 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Lewis-Beck, Michael S. und Mary Stegmaier (2000). Economic Determinants of Electoral Outcomes. Annual Review of Political Science 3: 183–219. Lutz, Georg (2012). «Eidgenössische Wahlen 2011. Wahlteilnahme und Wahlentscheid. Lausanne: Selects-FORS. 8 27 18 5 5 8 26 20 15 14 8 Van der Brug, Wouter, Cees Van der Eijk und Mark Franklin (2007). The Economy and the Vote: Economic Conditions and Elections in Fifteen Countries. Cambridge University Press. 6 16 12 5 «verschlechtert» (51% der befragten Wähler) SELECTS (2011) / DIE VOLKSWIRTSCHAFT Abb. 3: Wählerumfrage nach Wahlen im Herbst 2011: Wahl­ entscheid und Einschätzung der Wirtschaftslage (N=3231) AUFGEGRIFFEN INTERN «Die Volkswirtschaft» im neuen Kleid: Wer alles mitgeschneidert hat Christoph Bigler Kreativlead Christian Müller Technische Projektleitung Marlen von Weissenfluh Gestaltungskonzept und Layout Bart Podlewski, Entwicklung (extern, liip) Christian Maillard Redaktion französisch Stefan Sonderegger Redaktion deutsch Patricia Steiner Layout und App Susanne Blank Co-Chefredaktorin und Gesamtprojektleitung Käthi Gfeller Redaktionsassistenz Nicole Tesar Co-Chefredaktorin und Gesamtprojektleitung Alina Günter Illustration Cover 5 / 2015 | Die Volkswirtschaft 45 AUFGEGRIFFEN Wie Ökonomen die Politik ­weiterbringen Wenn es um politische Beratung geht, geniesst die Ökonomenzunft manchmal einen zweifelhaften Ruf. Wer kennt sie nicht, die zahlreichen Vorurteile über die Möglichkeiten und Grenzen der Wirtschaftswissenschaften. Abgesehen davon, dass es auch populäre Witze über Juristen, Ingenieure und Mathematiker gibt, muss sich die Ökonomie nicht scheuen, für ihre wissenschaftliche Disziplin politische Relevanz zu beanspruchen. Die ökonomische Politikberatung geniesst denn auch einen hohen Stellenwert und wird rege nachgefragt. Was darf von ihr als Beitrag zu einer «guten» Wirtschaftspolitik erwartet werden – und was nicht? Beratung als Resultat von Nachfrage und Angebot Die Entwicklung einer Volkswirtschaft hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Wohlfahrt der Bürgerinnen und Bürger. Dementsprechend haben politische Akteure den Anspruch, die Komplexität gesamtwirtschaftlicher Prozesse besser zu verstehen. Politische Führungspersönlichkeiten suchen zudem typischerweise das Primat der Politik über Marktprozesse. Dieses Anliegen ist nicht unumstritten, da verbreitete Bedürfnisse der Menschen über kurz oder lang immer auf Marktangebote – im Sinne freiwilliger Tauschhandlungen – treffen. In der Folge bekräftigen Politiker aber umso mehr den Willen, Marktentwicklung durch «gute» Staatseingriffe in politisch genehme Bahnen zu lenken. Die Nachfrage nach Politikberatung findet auch in der Schweiz ein vielfältiges Angebot. Ob Forschungsinstitute an den Hochschulen, Fachhochschulen, Thinktanks oder private Beratungsunternehmen: Der Markt an politischer Beratung ist in unserem kleinen Land eng abgesteckt, aber diversifiziert. Verschiedene Bedürfnisse der Beratung können so durch unterschiedlich spezialisierte Anbieter abgedeckt werden. Auch in der Bundesverwaltung üben Ökonominnen und Ökonomen eine Rolle der ökonomischen Beratung aus. Komplexe Volkswirtschaft – kein einfacher Rat In der Literatur über ökonomische Politikberatung wird seit Jahrzehnten das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Anspruch der Beratertätigkeit und der Zweckmässigkeit für den politischen Alltag debattiert. Ökonomen betonen zu Recht die Bedeutung der evidenzbasierten, empirisch abgestützten Beratung. Dies ist in der Abgrenzung zum 46 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Lobbyismus, bei dem es um die Vertretung von Partikularinteressen geht, eine zentrale Ambition. Politiker wünschen sich demgegenüber eindeutige Resultate und klare Handlungsanweisungen; «Einerseits/anderseits»-Aussagen gehören nicht zu ihren beliebtesten Erkenntnissen. Zwischen diesen Ansprüchen kann es Spannungsfelder geben. Die Ökonomie ist keine exakte Wissenschaft und ist deshalb bei der Suche nach einer unumstösslichen Wahrheit nicht dienlich. Sie kann es auch nicht wollen, da es in einer komplexen (Wirtschafts-) Welt die absolute Wahrheit nicht gibt. Dennoch sind die Wirtschaftswissenschaften als Grundlage wirtschaftspolitischer Entscheidfindung jeder anderen Disziplin der Geisteswissenschaften überlegen, weil sie konsequent auf theoretische Grundlagen und empirische Methoden setzen. Politikberatung kann Handlungsoptionen vor allem dann hilfreich aufzeigen, wenn die politischen Entscheidungsträger in realistischen Zeithorizonten denken und Einblicke in die Determinanten der langfristigen Entwicklung der Gesamtwirtschaft oder von Teilen davon suchen. Denn auch die beste Politik kann die Wirtschaft nicht innerhalb von Monaten beeinflussen oder wissen, welches die treibenden (Markt-)Kräfte in zehn Jahren sind. Es gibt Rezepte gegen die Frankenstärke Dies erklärt auch, warum es mit Blick auf die aktuelle Frankenstärke kein einfaches Unterfangen ist, wirtschaftspolitische Massnahmen zur Kompensation der produktionsverteuernden Währungsaufwertung zu formulieren. Natürlich ist es vorstellbar, per Dekret die Unternehmen sofort von der Steuerpflicht auszunehmen; dies dürfte aber politisch wenig realistisch sein. Zielführender ist etwa eine glaubwürdige Verpflichtung, mittel- und langfristig eine Unternehmenssteuerreform III umzusetzen, welche die Steuerattraktivität der Schweiz im nächsten Jahrzehnt trotz Verzicht auf kantonale Steuerstatus aufrechterhält. Ökonomen haben dieser Tage also durchaus klare Vorstellungen von prioritären Massnahmen zur Abfederung der Frankenstärke. Hingegen darf die Politik nicht erwarten, dass die Ratschläge in Massnahmen münden, welche den Unternehmen innert Monatsfrist eine wirksame Entlastung zur Frankenaufwertung in Aussicht stellen. Ökonomisch fundierte Beratung hat auch in der öffentlichen Verwaltung eine wichtige Bedeutung. In diesem Umfeld ist es besonders wichtig, Empfehlungen auf transparente, nachvollziehbare wissenschaftliche Grundlagen abzustützen. Es müssen Vor- und Nachteile politischer Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen offengelegt werden. Was kurzfristig politisch opportun scheint, kann ökonomisch langfristig schädlich sein – und umgekehrt. Die theorie- und evidenzgeleiteten Entscheidungsgrundlagen müssen in der Wirtschaftspolitik differenziert erläutert an die politischen Entscheidungsträger herangetragen werden. Es braucht Rückgrat, erklären zu können: Nicht für jedes erkannte politische Problem gibt es einen Königsweg ohne Fallstricke. Eric Scheidegger Dr. rer. pol., Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern [email protected] Die Volkswirtschaft 5 / 2015 47 DIE STUDIE Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik Société suisse d’économie et de statistique Società svizzera di economia e di statistica Swiss Society of Economics and Statistics Bildungsrenditen: Wer profitiert in der Schweiz am meisten von einem Universitätsabschluss? Bisherige Studien gingen von der Hypothese aus, dass die Rendite von Universitätsabschlüssen gleich für alle sei. Das scheint aber zu pauschal. Denn die Einkommen variieren je nach familiärem Umfeld. Die Resultate der vorliegenden Studie können deshalb für die Bildungspolitik wichtige Anhaltspunkte liefern. Lionel Perini Abstract Die aktuelle Literatur zur privaten Bildungsrendite befasst sich mit der Diversität der Populationen, der Einkommensheterogenität und der Selbstselektion beim Studium. Die vorliegende Arbeit will in Erfahrung bringen, inwieweit die Bildungsrendite eines Universitätsabschlusses in der Schweiz von der Wahrscheinlichkeit abhängt, dass eine Person aufgrund ihrer familiären Herkunft eine solche Ausbildung abschliesst. Ein Matching-Modell, das Daten aus dem Schweizer Haushalt-Panel mit Daten zur Wahrscheinlichkeit einer Universitätsausbildung kombiniert, zeigt nach Bereinigung der Arbeitsmarktvariablen: Personen mit geringen Wahrscheinlichkeitsraten profitieren stärker als die übrigen von einem Uni-Abschluss. Bei den Frauen ist die Verteilung homogener als bei den Männern. Dies weist darauf hin, dass in der Schweiz die Renditemöglichkeiten eines Uni-Abschlusses für Männer aus benachteiligten Familien grösser sind als für solche aus wohlhabenderen Verhältnissen. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zur Hypothese der komparativen Vorteile. Eine Hilfsanalyse mit einem Quantil-­ Regressionsmodell, die den Schwerpunkt auf die Beziehungen zwischen Bildungsrendite und angeborenen Fähigkeiten legt, führt zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Z ur Bestimmung der privaten Bildungsrendite wird üblicherweise gemessen, wie sich ein Jahr zusätzliche Ausbildung auf den späteren Lohn auswirkt.1 Weil jedoch viele Studierende ihre Ausbildung nicht im vorgesehenen Zeitraum abschliessen und gewisse Diplome («Credentials») keine einheitlichen Renditen aufweisen, können Berechnungen aufgrund der Anzahl Ausbildungsjahre irreführend sein. In den meisten Arbeiten wird die Rendite nach Ausbildungsstufe betrachtet2. Hingegen stellen nur wenige Studien die Frage, ob die Bildungsrenditen innerhalb einer Stufe variieren, d. h. von Person zu Person verschieden sind. 1 Die private Bildungsrendite bezieht sich auf den Lohn. Andere Aspekte sind die gesellschaftliche oder die steuerliche Rendite. Für weitere Einzelheiten zu diesem Thema siehe Weber und Wolter (2005). 2 Psacharopoulos und Patrinos (2004), Wolter und Weber(2005). 48 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Uneinheitliche Renditen der universitären Ausbildung Anerkannte Arbeiten aus dem Bereich der Bildungsökonomie kommen zu dem Schluss: Bei der Entscheidung für oder gegen den Besuch einer nächsthöheren Ausbildungsstufe ist der danach zu erwartende Lohn massgebend.3 Einen Einfluss auf den Lohn haben aber auch Faktoren wie die angeborenen Fähigkeiten und die Situation der Eltern. Gemäss dem Prinzip der komparativen Vorteile wählen sogenannt privilegierte Personen (d. h. solche mit guten kognitiven Fähigkeiten oder Eltern mit hohem Bildungsniveau, finanziellem Wohlstand oder gesellschaftlichem Ansehen) die längsten Ausbildungen, 3 Becker (1964), Willis und Rosen (1979), Willis (1986), Card (1999, 2001). die auf dem Arbeitsmarkt die höchsten Renditen einbringen.4 Gewisse Studien liessen jedoch Zweifel daran aufkommen, Bildungsentscheidungen aufgrund rationaler Kriterien getroffen werden. Betroffene entscheiden demnach nicht allein aufgrund finanzieller Kriterien, sondern auch aufgrund ihrer Kultur, ihres Umfelds oder anderer Gegebenheiten.5 Ausserdem ist es auch möglich, dass Jugendliche aus weniger privilegierten Verhältnissen ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Status verbessern wollen. Ein Universitätsabschluss ermöglicht es ihnen unter gewissen Umständen, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zu privilegierteren Personen, die auch ohne gleichwertige Ausbildung Zugang zu qualifizierten Stellen haben können, zu verbessern. Die bisherigen Arbeiten zu dieser Frage haben noch zu keinem Konsens geführt6. (siehe Kasten 1) Ziele der Studie Das Ziel der vorliegenden Studie besteht darin, die Rendite eines Universitätsabschlusses in der Schweiz zu schätzen. Dazu wurden die Studierenden in Gruppen eingeteilt, die auf der Wahrscheinlichkeit beruhen, mit der sie aufgrund ihrer famili4 Carneiro, Heckman und Vytlacil (2003, 2007), Heckman, Urzua und Vytlacil (2006). 5 Coleman (1988). 6 Die in diesem Artikel formulierten Gedanken entsprechen der persönlichen Meinung des Autors und repräsentieren nicht die Position des Schweizerischen Nationalfonds. KEYSTONE DIE STUDIE Studenten an der Universität in Lugano (Symbolbild). Ein Universitätsabschluss bringt Männern aus benachteiligten Verhältnissen tendenziell die grössten Renditen. ären Herkunft eine Universitätsausbildung abschliessen. Personen mit Universitätsabschluss (Bachelor, Lizenziat oder Master) bilden die Experimentalgruppe, jene mit einer gymnasialen Maturität (die nicht mehr in Ausbildung sind) die Kontrollgruppe. Weshalb sich die Situation in der Schweiz besonders gut eignet, wird im Kasten 2 besprochen. Das eigentliche Studienziel besteht darin, in Erfahrung zu bringen, ob der Erwerb eines Universitätsabschlusses die sozioökonomischen Ungleichheiten im Zusammenvhang mit der familiären Herkunft verstärkt oder verringert. Die empirische Analyse soll somit den Zusammenhang aufzeigen zwischen Bildungsniveau, familiärer Herkunft und Lohn und es ermöglichen, geeignete wirtschaftspolitische Massnahmen zu treffen. Wenn nämlich die am wenigsten privilegierten Studierenden am meisten von einer Universitätsbildung profitieren, bedeutet dies, dass ein solcher Studienabschluss es ermöglicht, die sozioökonomische Kluft zwischen zwei Generationen zu verringern. Falls hingegen ein Universitätsabschluss für die privilegiertesten Studierenden die höchste Rendite abwirft, würde dies bedeuten, dass die akademische Bildung die Chancenungleichheiten verstärkt und ein einfacherer Zugang zu den Universitäten insgesamt nicht unbedingt zu Effizienzgewinnen führt. Empirische Analyse Die empirische Analyse basiert auf Daten des Schweizer Haushalt-Panels, einer seit 1999 jährlich durchgeführten Umfrage bei den Privathaushalten in der Schweiz. Diese Umfrage beinhaltet Variablen zu den sozioökonomischen Merkmalen und zur Nationalität der Befragten im Alter von 15 Jahren. So werden etwa Bildungsstand, wirtschaftliche Situation, sozialer Status oder Nationalität der Eltern aufgelistet. Weitere Daten betreffen den Arbeitsmarkt: Stellenwechsel im Vorjahr, Berufserfahrung in Jahren, Beschäftigungsgrad oder Lohn. Der gewählte methodische Ansatz ist relativ intuitiv und eignet sich ideal, um die Rendite der Ausbildung in den verschiedenen Teilgruppen zu ermitteln. Die Methode der mehrstufigen Schichtung («stratification-multilevel method») besteht darin, Schichten mit Personen aufgrund der Wahrscheinlichkeit zu bilden, mit der diese aufgrund ihrer Herkunft einen Universitätsabschluss erwerben («propensity score matching»). Mit diesen Schichten lassen sich Umfang und Trend der entsprechenden Bildungsrenditen messen.7 Eine logistische Regression zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit einer Universitätsausbildung zeigt: Der gesellschaftliche Status der Eltern (nach der Prestige-Skala von Treiman) hat einen signifikanten Einfluss auf den Zugang zur Universität – sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Die Personen wurden in drei Schichten (sowie nach Geschlecht) gruppiert, basierend auf der Wahrscheinlichkeit, dass sie eine universitäre Ausbildung absolvieren. Abbildung 1 zeigt, dass die am wenigsten privilegierten Personen die höchsten Renditen erzielen 7 Diese Methode berücksichtigt die Dimension der Längsstudie nicht. In der Stichprobe werden nur die aktuellsten Angaben zu einer Person verwendet. Kasten 1: Kurzer Überblick zur Literatur Die Heterogenität der Bildungsrenditen wird im Allgemeinen mit einer Interaktionsvariable zwischen Ausbildung und Faktoren wie Geschlecht oder sozioökonomischen Merkmalen der Eltern berücksichtigt.a Die Interaktion zwischen der Ausbildung und der Wahrscheinlichkeit, eine solche Ausbildung aufgrund der familiären Herkunft zu absolvieren, ist der Schlüsselindikator zur Analyse der Unterschiede bei der Ausbildungswahl. Die Annahme, dass die Ausbildungsrenditen je nach Ausbildungswahrscheinlichkeit variieren können, hat insbesondere zu zwei neuen Analysemethoden geführt. Die erste beruht auf den Arbeiten von James Heckman und dessen Co-Autoren, die das Konzept des «marginal treatment effect» entwickelt haben, das auf Björklund und Moffitt (1987) zurückgeht. Dieser Parameter ist definiert als Grenzlohnsteigerung einer Person unabhängig vom gewählten Ausbildungsniveau, das aufgrund der Ausbildungswahrscheinlichkeit modelliert wird. Die meisten Studien mit diesem Ansatz kommen zum Schluss, dass Personen, die am ehesten ein Universitätsstudium abschliessen, die höchsten Renditen erzielen, was dem Prinzip der komparativen Vorteile entspricht.b Die Studie von Heckman, Tobias und Vytlacil (2001) gelangt hingegen zum gegenteiligen Schluss, d. h., dass eine zufällig in der Stichprobe ausgewählte Person mit einem Universitätsabschluss eine höhere Rendite erzielt als die Personen, die diese Ausbildung tatsächlich absolvieren. Auf der zweiten Methode beruht die vorliegende Studie. Bei diesem Ansatz wird die Bildungsrendite für verschiedene Teilpopulationen geschätzt. Deren Einteilung erfolgt aufgrund ihrer Wahrscheinlichkeit, einen Universitätsabschluss zu erwerben. Tsai und Xie (2008) sowie Brand und Xie (2010) beobachteten eine negative Korrelation zwischen der Wahrscheinlichkeit einer höheren Ausbildung und der Rendite eines solchen Abschlusses. Dies bedeutet, dass die am wenigsten privilegierten Personen die höchsten Renditen erzielen. a Altonji und Dunn (1996), Schnabel und Schnabel (2002). b Carneiro, Heckman und Vytlacil (2003, 2007), Heckman und Li (2004), Heckman, Urzua und Vytlacil (2006), Chuang und Lai (2010). Die Volkswirtschaft 5 / 2015 49 DIE STUDIE Rendite von über 30%.10 Bei den Frauen resultieren relativ homogene Werte über alle Schichten hinweg, kein Trendkoeffizient ist signifikant. Schliesslich ist anzumerken, dass die Originalstudie ergänzende Analysen beinhaltet, welche die Ergebnisse der Schichtungsmethode bestätigen. Bildungsrendite und Wahrscheinlichkeit eines Universitätsabschlusses Männer Heterogene Bildungsrendite 1,5 Diskussion 1 0,919 und die Männer grössere Renditen erreichen als die Frauen.8 Nur bei einer einzigen Spezifikation – bei Männern mit Berücksichtigung der Variablen zum Arbeitsmarkt – resultiert eine signifikant negative Korrelation zwischen der Bil- dungsrendite und der Wahrscheinlichkeit eines Universitätsabschlusses (lineare Trendkurve).9 Mit einem Universitätsabschluss verbessern sich somit die Verdienstmöglichkeiten für Männer aus bescheidenen Verhältnissen signifikant, und es resultiert eine jährliche Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass der Entscheid zugunsten einer universitären Ausbildung in der Schweiz nicht dem Prinzip der komparativen Vorteile folgt. Personen, bei denen die Wahrscheinlichkeit aufgrund ihrer familiären Herkunft gross ist, dass sie einen solchen Abschluss erwerben, erzielen nämlich nicht die grössten Lohngewinne. Unter Berücksichtigung der Berufserfahrung ist sogar das Gegenteil der Fall, insbesondere bei den Männern. Wenn es gelingt, Personen aus weniger privilegierten Verhältnissen für eine akademische Berufslaufbahn zu motivieren, könnte dies somit nicht nur die sozioökonomischen Unterschiede zwischen den Generationen verringern, sondern auch die Effizienz der höheren Bildung in der Schweiz verbessern. Somit sind Massnahmen zu fördern, die den Zugang zur Universität erleichtern. Die seit dem 1. März 2013 geltende Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen ist ein vielversprechender Schritt in diese Richtung, da sie insbesondere darauf abzielt, Ungleichheiten beim Bildungszugang abzubauen. Gleichzeitig sollte die Chancengleichheit möglichst früh gefördert werden, beispielsweise auf Vorschulstufe. Zu begrüssen sind daher die kürzliche Einführung des Harmos-Konkordats (je nach Kanton obligatorischer Kindergarten ab 4 Jahren) sowie die Schaffung 8 Die jährliche durchschnittliche Rendite ohne Schichtung beträgt 11,9% für die Männer und 6,2% für die Frauen mit durchschnittlich vier Jahren Studium. 9 Die Korrelation ist nur signifikant, wenn bei den Lohnberechnungen die Berufserfahrung berücksichtigt wird. 10 Siehe Halvorsen und Palmquist (1980) zur Interpretation der Koeffizienten der dichotomischen Variablen in einer semi-logarithmischen Gleichung. 0,5 0,488 0,369 ch ho t ie f sc dur hn c h itt lic h 0 Schichten der Propensity Score Analyse (nach Stufe) Frauen Heterogene Bildungsrendite 4 0,222 2 0,213 0,205 1 ch ho t ie f sc dur hn c h itt lic h 0 PERINI / DIE VOLKSWIRTSCHAFT 3 Schichten der Propensity Score Analyse (nach Stufe) Konfidenzintervall Bildungsrendite (nach Schicht) Linearer Trend Kasten 2: Rendite der universitären Bildung und Chancengleichheit in der Schweiz Aufgrund einer Kosten-Nutzen-Analyse kommt die Studie von Wolter und Weber (2005) zum Schluss, dass die universitäre Bildung mit 5,4% in der Schweiz die geringste Rendite abwirft. Für die Schulen der höheren Berufsbildung und die Fachhochschulen resultieren deutlich höhere Werte (8,7% bzw. 10,6%). Bei den Frauen ist der Unterschied noch ausgeprägter, hier beträgt die Rendite eines Universitätsstudiums rund 2,2%. Dies ist insbesondere mit den hohen 50 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Opportunitätskosten einer akademischen Ausbildung in der Schweiz zu erklären. Eine andere, von der SKBF (2010) durchgeführte Studie bestätigt die geringe Rentabilität des universitären Bildungswegs gegenüber anderen Ausbildungen. In der Schweiz gestaltet sich der Zugang zu Universitäten für Personen aus weniger privilegierten Verhältnissen manchmal schwierig, da sie während ihrer Ausbildungszeit mit hohen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und institutionellen Hürden konfrontiert sind und sie eine hohe Motivation benötigen.a Verschiedene Beobachtungen bestätigen dies. Erstens besuchen Personen aus einer Familie mit hohem Bildungsstand 1,5-mal häufiger eine akademische Tertiärausbildung.b Zweitens üben die meisten Studierenden in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit aus, um ihr Studium zu finanzieren, insbesondere (aber nicht nur) solche aus Familien mit bescheidenem Einkommen, was negative Auswirkungen auf die für die Ausbildung verfügbare Zeit haben kann. Ausserdem ist zwar der Anteil ausländischer Studierender auf der Tertiärstufe mit rund 25% relativ hoch, lediglich ein Viertel von ihnen hat aber den Zulassungsausweis in der Schweiz erworben.c Die genderbedingten Benachteiligungen hingegen sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen.d a b c d Vellacott und Wolter (2005) SKBF (2014) SKBF (2010) OECD (2013) DIE STUDIE zahlreicher Betreuungsplätze für Kleinkinder. Von Interesse könnten auch Ansätze wie Bildungsgutscheine sein. Grenzen der Studie Die Ergebnisse der Studie sind mit Vorsicht zu interpretieren, da die Analyse gewisse ökonometrische Grenzen aufweist. Erstens berücksichtigt die gewählte Methode nur die beobachteten Variablen (Hypothese der bedingten Unabhängigkeit), nicht aber die nicht erhobenen Variablen, was in der Analyse zu gewissen Verzerrungen führen kann. Zweitens lässt sich aufgrund der verfügbaren Daten nicht im Detail bestimmen, welche Kriterien bei Ausbildungsentscheidungen eine Rolle spielen (Motivation für ein Studium, Unterstützung durch die Eltern usw.) und welche kognitiven Fähigkeiten die Studierenden mitbringen (Prüfungsergebnisse). Schliesslich beschränkt die relativ kleine Stichprobengrösse die Aussagekraft der empirischen Analyse. Abgesehen von diesen methodologischen Problemen müssten künftige Forschungsarbeiten die Analyse ergänzen, indem sie das Augenmerk auf weitere Auswirkungen eines Studiums legen, beispielsweise dessen Einfluss auf den sozialen Status oder die Gesundheit. Ebenfalls interessant wäre eine Analyse, die zwischen verschiedenen Universitätsabschlüssen unterscheidet, z. B. Bachelor oder Master, oder andere Ausbildungen der Tertiärstufe einbezieht (Fachhochschulen oder höhere Berufsbildung). Lionel Perini PhD in Economics, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften, Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Bern. Die «Volkswirtschaft» und die Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik verbessern den Wissenstransfer von der Forschung in die Politik: Aktuelle wissenschaftliche Studien mit einem starken Bezug zur schweizerischen Wirtschaftspolitik erscheinen in einer Kurzfassung in der «Volkswirtschaft». Literatur Ein vollständiges Literaturverzeichnis enthält der Artikel «Who Benefits Most from University Education in Switzerland?» in der Schweizerischen Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Band 150, S. 119–159, 2014, www.sjes.ch/published.php. EINLADUNG 1. S CHWEIZER KOLLOQUIUM ZUM T HEMA JOBSHARING Job s haring E i n d ri t t Er W E g auf dE m arb E its m arkt? V E ranstalt E r vEREIN PTO (PART TIME OPTIMISATION) WWW.G O-FO R-JOBS HARING .CH m ontag 4. M ai 2 015 frE ib urg U NI v ERS I TäT FREI B U RG B d P éRO L L ES 90 1 70 0 FREI B U RG 1 4 .3 0 –2 1 .0 0 U H R I n Zusamme n ar be I t mI t UNI FR | HEG Arc | FHNW me dI e n part n e r Die Volkswirtschaft 5 / 2015 51 KONJUNKTUR Delegierte der Nationalbank messen den Puls der Wirtschaft in den Regionen Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses sind Wirtschaftsinformationen aus den Regionen für die Nationalbank besonders wichtig. Sie signalisieren ihr erste Konjunkturtendenzen. Attilio Zanetti, Hans-Ueli Hunziker Abstract Die Nationalbank ist auch in den Regionen vertreten. Regelmässig tauschen sich ihre Delegierten für regionale Wirtschaftskontakte vor Ort mit Firmenchefs aus. Als «Pulsfühler der Wirtschaft» signalisieren sie dem Direktorium Konjunkturtendenzen: So haben gemäss diesen Informationen die realen Umsätze im ersten Quartal 2015 stagniert. Auch die Umsatzaussichten haben sich als Folge des starken Frankens spürbar eingetrübt. Die kurzfristigen Inflationserwartungen liegen mit –1,3% neu im negativen Bereich. Die regionale Verankerung der Nationalbank stellt im internationalen Vergleich kein Unikum dar: Auch andere Notenbanken greifen auf lokale Vertreter zurück. A uf die Kontaktpflege und den Informationsaustausch mit den Wirtschaftsakteuren, insbesondere mit den Unternehmen, hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) schon immer grossen Wert gelegt. Zu diesem Zweck verfügt sie über ein Netz von acht Vertretungen in den Regionen Genf, Waadt-Wallis, Mittelland, Zürich, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Zentralschweiz und italienischsprachige Schweiz (siehe Abbildung 1). In jeder dieser Regionen ist die Nationalbank mit einem Delegierten für regionale Wirtschaftskontakte präsent. Diese acht Delegierten haben einerseits die Aufgabe, die realwirtschaftlichen Entwicklungen vor Ort zu beobachten, indem sie regelmässig mit Firmenleitungen sprechen. Die aus diesen Gesprächen gewonnenen Informationen fliessen in die geldpolitischen Entscheide der Nationalbank ein. Sie sind zeitnah verfügbar und liefern eine wertvolle Ergänzung zu den modellgestützten Prognosen. Anderseits wirken die Delegierten als Botschafter der SNB und erläutern den lokalen Wirtschaftsakteuren und den regionalen Behörden die Geldpolitik. und sowohl qualitativ als auch quantitativ auszuwerten. Pro Jahr finden vier Umfragerunden statt, die jeweils etwa sieben Wochen dauern. Jeder Delegierte führt dabei 30 vertiefte Gespräche. Die auf diesem Weg gewonnenen Informationen stützen sich somit pro Quartal auf 240 Gespräche aus allen Regionen. Wichtig für den Zugang zu den Unternehmen ist die Vertraulichkeit, mit der die SNB die erhaltenen Informationen behandelt. Die Gesprächspartner wechseln jedes Quartal, wobei die Auswahl nach vorgegebenen Kriterien wie der Anzahl der Beschäftigten pro Branche und der Grösse der Unternehmen erfolgt. Diese Kriterien tragen den wirtschaftlichen Eigenheiten jeder Region Rechnung. Die Stichprobenauswahl richtet sich somit sowohl nach der regionalen Firmenlandschaft als auch nach der branchenmässigen Zusammensetzung des Bruttoinlandprodukts, wobei der öffentliche Sektor und die Landwirtschaft ausser Acht gelassen werden. Einblick in die konkreten Wirtschaftsabläufe Die Gespräche haben als Ziel, einerseits den Geschäftsgang der betreffenden Unternehmen möglichst umfassend abzuschätzen und anderseits die Aussichten mit den entsprechenden Chancen und Risiken aus Sicht des Unternehmens zu beurteilen. Standardmässig angesprochene Themen sind Umsatzentwicklung, Kapazitätsauslastung, Margenlage, Beschäftigungs- und Investitionspläne. Im Fokus steht immer auch die Wirkung der aktuellen monetären Nationalbank-Vertreter tauschen sich regelmässig mit Firmenchefs aus. Die Gesprächspartner wechseln jedes Quartal (Symbolbild). Die Gespräche mit den Unternehmenschefs führen die Delegierten anhand eines Leitfadens. Dieses strukturierte Vorgehen erlaubt es der Nationalbank, die Informationen aus den verschiedenen Regionen und Branchen zusammenzutragen 52 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 SHUTTERSTOCK Gesprächspartnerauswahl aufgrund der Wirtschaftsstruktur KONJUNKTUR Abb. 1: Regioneneinteilung der SNB Genf Mittelland Zürich Ostschweiz italienischsprachige Schweiz Waadt-Wallis Zentralschweiz Nordwestschweiz Die Nationalbank ist in acht Regionen der Schweiz mit einem Delegierten für regionale Wirtschaftskontakte präsent. Rahmenbedingungen – wie Zinsniveau, Kreditbedingungen und Wechselkurse – auf die Unternehmen. Die qualitativen Angaben werden von den Delegierten auf einer fünfstufigen Skala zugeordnet. Die Informationen lassen sich so quantitativ zusammenfassen und grafisch darstellen. Im Gegensatz zu den offiziellen Statistiken beruhen die von den Delegierten gesammelten Informationen zwar auf einer verhältnismässig kleinen Stichprobe. Ein wichtiger Vorteil ist aber die rasche Verfügbarkeit der Daten. Zudem unterliegen die gewonnenen Zeitreihen keinen Revisionen. Ferner erlauben die aus den Umfragen gewonnenen Erkenntnisse einen aufschlussreichen Quervergleich zu den modellgestützten Konjunkturprognosen und fördern damit die Erhärtung oder auch die Relativierung der so erstellten Prognosen. In Zeiten extremer Ereignisse und Entwicklungen stossen Prognosemodelle oft an ihre Grenzen. Und gerade dann sind die aus Interviews gewonnenen Informationen von besonderem Wert, wie verschiedene Studien gezeigt haben (siehe Literatur-Kasten). Mehr denn je bringt im aktuellen Umfeld nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses der direkte Dialog mit den Wirtschaftsakteuren höchst wertvolle Erkenntnisse über das, was in der Wirtschaft konkret abläuft. Umsätze stagnieren im ersten Quartal 2015 Die Ergebnisse aus den von Mitte Januar bis Anfang März geführten Gesprächen erlauben eine erste Einschätzung der Folgen der Aufwertung des Frankens. Das Wachstum der realen Umsätze (nominelle Umsätze, bereinigt um Preisveränderungen) ist gemäss dieser Umfrage (wie erwähnt wird der öffentliche Sektor nicht berück­ sichtigt) im Berichtsquartal zum Stillstand gekommen. Die Margenlage hat sich bei vielen Unternehmen deutlich verschlechtert und die Firmen veranlasst, eine Vielzahl von Gegenmassnahmen zu ergreifen. Viele Gesprächspartner sind durch die neue Wechselkurssituation stark gefordert und müssen zunächst genau analysieren, welche Auswirkungen dies für ihr Unternehmen hat. Diese Neueinschätzung der Lage braucht Zeit, und entsprechend hat die Unsicherheit über den weiteren Geschäftsverlauf deutlich zugenommen. Die Aussichten für das reale Umsatzwachstum in den kommenden sechs Monaten haben sich – insbesondere in der verarbeitenden Industrie – spürbar eingetrübt (siehe Abbildung 2). Über alle Sektoren betrachtet deuten sie aber nicht auf eine Kontraktion hin. Die Personalbestände dürften insgesamt leicht zurückgehen. Aufgrund der Unsicherheit rechnen die BFS GEOSTAT / DIE VOLKSWIRTSCHAFT Gesprächspartner damit, dass die Investitionsvolumen geringer als im Vorjahr ausfallen werden. Inflationserwartungen im ersten Quartal rückläufig Informationen über die Inflationserwartungen sind für Zentralbanken von grosser Bedeutung. An ihnen lässt sich ablesen, wie gut diese Erwartungen «verankert» sind, d. h., inwiefern sie mit dem von der Notenbank definierten Bereich der Preisstabilität im Einklang stehen. Die Gewährleistung der Preisstabilität ist schliesslich das Hauptziel der Geldpolitik. Zusätzlich zur Geschäftsentwicklung werden deshalb die Unternehmenschefs in ihrer Rolle als allgemeine Wirtschaftsakteure regelmässig auf ihre kurz- und mittelfristigen Inflationserwartungen angesprochen. Dabei werden die Erwartungen für die Zeit in sechs bis zwölf Monaten sowie in drei bis fünf Jahren1 erörtert. Die Umfrage aus dem ersten Quartal 2015 zeigt eine spürbare Korrektur der Inflationserwartungen. Die kurzfristigen Inflationserwartungen liegen neu bei –1.3% (siehe Abbildung 3), nachdem sie sich zuvor in den letzten Jahren zwischen 0% und 0,5% bewegt haben. Die längerfristigen Erwartungen haben sich ebenfalls 1 Die Einschätzungen über diese Frist werden erst seit Mitte 2013 systematisch erhoben. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 53 KONJUNKTUR aus den Unternehmergesprächen jeweils im Quartalsheft der Nationalbank zusammengefasst (Konjunkturtendenzen). Abb. 2: Erwartete Umsätze in den kommenden 6 Monaten, in Punkten 0,8 0,6 SNB tauscht sich mit anderen Zentralbanken aus 0,4 0,2 20 15 20 14 20 13 20 12 20 11 20 1 0 0 Total REGIONALE WIRTSCHAFTSKONTAKTE DER SNB / DIE VOLKSWIRTSCHAFT Erwartetes Niveau verglichen mit dem Niveau zum Befragungszeitpunkt (Informationen bis und mit Umfrage erstes Quartal 2015). Anmerkung: Die Grafik basiert auf Informationen aus den Unternehmensgesprächen der SNB, welche einer Skala von «sehr tief» bzw. «deutlich tiefer als im Vorjahresmonat» (zugeordneter Wert: –2) bis «sehr hoch» bzw. «deutlich höher als im Vorjahresmonat» (zugeordneter Wert: +2) zugeordnet wurden. Abb. 3: Erwartete allgemeine Teuerungsrate, in Prozent 1 0 –1 Kurzfristig (in 6–12 Monaten) 20 15 20 14 20 13 20 12 20 11 20 1 0 –2 Langfristig (in 3–5 Jahren) Prognosen für Konsumentenpreisindex (LIK) zum Befragungszeitpunkt zurückgebildet, von 1,1% in den Vorquartalen auf 0,5%. Im Gegensatz zu den kurzfristigen Erwartungen bleiben sie jedoch positiv und sind damit kompatibel mit der SNB-Definition der Preisstabilität. Fixpunkt vierteljährliche ­Lagebeurteilung Als «Pulsfühler der Wirtschaft» sind die Delegierten in der Lage, dem Direktorium der SNB besondere Entwicklungen frühzeitig zu signalisieren. Diese Rolle wird zusätzlich unterstützt durch den regelmässigen Austausch der Delegierten mit einem Regionalen Wirtschaftsbeirat, einem in jeder Region aus drei oder vier Unternehmensleitern zusammengesetzten und vom Bankrat gewählten Gremium. Auswertungen der Informationen aus den Unternehmergesprächen sind Teil der Entscheidungsgrundlagen des Direktoriums in der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung. Wann immer es die aktuelle wirtschaftliche oder geldpolitische Situation erfordert, informieren die Delegierten das Direktorium laufend über ihre Lageeinschätzungen sowie die Rückmeldungen aus Unternehmerkreisen. Für die Öffentlichkeit werden die Resultate Die SNB ist bei Weitem nicht die einzige Zentralbank, die ein regionales Kontaktnetz zur Sammlung von Konjunkturinformationen bei Firmen unterhält. Das Einholen von umfragebasierten Informationen und die Verwendung eines Kontaktnetzes mit Unternehmen liegen international im Trend. So haben in den letzten Jahren weitere Notenbanken, insbesondere in den aufstrebenden Volkswirtschaften, derartige Strukturen auf- oder weiter ausgebaut. Bei einigen Zentralbanken – wie bei der Bank of Canada oder der Bank of England – hat die regionale Verankerung bereits eine lange Tradition. Das Beige Book der US Federal Reserve Bank, das auf Umfragen der verschiedenen Distrikt-Notenbanken beruht, ist bekanntlich auch für Finanzmarktteilnehmer eine Referenz. Seit einigen Jahren findet ein institutionalisierter Austausch der Notenbanken, die auf diesem Gebiet tätig sind, statt. Ziel ist es dabei, neue Entwicklungen und Studien zu diskutieren und sich gemeinsam an eine Best Practice heranzutasten. Die eigene Erhebungsmethodik kritisch zu betrachten und sie laufend zu verbessern, gehört somit für die SNB zum festen Arbeitsbestandteil für die Fortentwicklung dieses Instruments. Attilio Zanetti Dr. rer. pol., Leiter Organisations­ einheit Konjunktur, Schweizerische ­Nationalbank. Hans-Ueli Hunziker Dr. rer. pol., Koordinator Regionale Wirtschaftskontakte, Schweizerische Na­tionalbank. Literatur McCafferty, Ian, 2014. The Use of Business Armesto, Michelle T., Ruben Hernandez-Mu- Ellis, Colin and Tim Pike, 2005. Introducing Intelligence in Monetary Policy. External the Agents’ Scores, Bank of England rillo, Michael T. Owyang und Jeremy Piger, Member of the Monetary Policy CommitQuarterly Bulletin, Winter. 2009. Measuring the Information Content tee, Speech Given at the 5th International of the Beige Book: A Mixed Data Sampling Martin, Monica und Cristiano Papile. 2004a, Workshop on Central Bank Business The Bank of Canada‘s Business Outlook Approach, Journal of Money, Credit and Surveys, 20 November 2014, Bank of Survey: An Assessment, Working Paper – Banking, Vol. 41, No. 1. England, London. 15, Bank of Canada. Balke, Nathan S. und D’Ann Petersen, 2002. Müller, Christian, 2009. The Informative How Well Does the Beige Book Reflect Content of Qualitative Survey Data, OECD Economic Activity? Evaluating Qualitative Journal of Business Cycle Measurement Information Quantitatively, Journal of and Analysis, Vol. 2009/1. Money, Credit and Banking, Vol. 34, No. 1, pp 114–136. 54 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Rolnick, Arthur J., David E. Runkle und David Fettig, 1999. The Federal Reserve’s Beige Book: A Better Mirror Than Crystal Ball, Federal Reserve Bank of Minneapolis, The Region, March. ARBEITSMARKT Politik muss bei psychischen Erkrankungen handeln In der Schweiz sind psychische Erkrankungen bei Arbeitslosen und IV-Bezügern stark verbreitet. Ein OECD-Bericht zeigt Handlungsmöglichkeiten auf. Dazu braucht es das Engagement von Akteuren wie Arbeitgebern, Ärzten und Lehrern. Katrin Jentzsch, Maggie Graf, Annette Hitz Abstract Ein OECD-Bericht zeigt auf, wie die hohe Arbeitslosigkeit bei psychisch Kranken vermindert werden kann. Insbesondere bei leichten bis mittelschweren Erkrankungen gibt es Verbesserungspotenzial. So können eine frühzeitige Erkennung, eine rasche Unterstützung und Behandlung einen Ausschluss aus dem Erwerbsleben verhindern. Die Handelsempfehlungen der OECD-Experten in den untersuchten Bereichen Bildung, Gesundheit, Sozialwesen und Arbeitsmarkt zielen denn auch auf die Früherkennung ab. Arbeitgeber, Ärzte und Lehrer – aber auch die Direktbetroffenen – müssen dafür geschult werden. Erfolgversprechend scheint zudem ein erweitertes Arztzeugnis, das nicht pauschal die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt, sondern auf die Situation der Betroffenen eingeht. Zudem müssten für Unternehmen Anreize gesetzt werden, damit sie stärker auf psychische Erkrankungen eingehen. sychische Erkrankungen betreffen den Arbeitsmarkt und die Sozialpolitik in den OECD-Ländern in hohem Mass. So leidet in der Schweiz jeder dritte Bezüger von Arbeitslosenentschädigung, Invalidenver­sicherungsleistungen oder Sozialhilfe daran. Zudem ist die Arbeitslosenquote bei psychisch Kranken mehr als doppelt so hoch wie die Gesamtarbeitslosenquote. Die Kosten psychischer Erkrankungen für den Betroffenen, den Arbeitgeber und die Gesellschaft als Ganzes sind enorm und in allen OECD-Ländern seit Jahren ansteigend. Für die Schweiz wird von Kosten psychischer Erkrankungen in Höhe von 3,2% des BIP ausgegangen.1 Für Arbeitgeber sind sie in Form von Krankheitsabsenzen und verringerter Arbeitsproduktivität spürbar. Folgen für den Arbeitsmarkt sind Arbeitslosigkeit und eine Reduktion des Arbeitskräftepotenzials. Besonders junge Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen haben es schwer, im Arbeitsleben Fuss zu fassen oder dort zu verbleiben. Bei Ausbildungsabbruch oder Jobverlust geraten sie häufig in eine Negativspirale, die in eine frühe Invaliditätsberentung münden kann. Trotz dieser hohen Kosten psychischer Beeinträchtigungen für den Einzelnen und die Gesellschaft wird den Zusammenhängen von psychischer Gesundheit und Arbeit sowie den Folgen für den Arbeitsmarkt noch wenig Beachtung geschenkt. 1 OECD (2014), S. 24. Die OECD widmet sich seit mehreren Jahren diesen Fragestellungen. In dem im Jahr 2012 erschienenen Bericht Sick on the Job? Myths and Realities About Mental Health and Work ging es zunächst darum, Wissenslücken hinsichtlich der Auswirkungen psychischer Erkrankungen auf die Erwerbsfähigkeit zu schliessen. In neun Länderberichten – darunter die Schweiz2 – wurde zwei Jahre später die Situation untersucht und wurden Empfehlungen formuliert. 2 Vgl. Länderbericht Schweiz, OECD 2014. 3 Der Bericht ist auf der OECD-Internetseite aufgeschaltet. Er erschien im Rahmen eines sogenannten High level policy forum on Mental Health and Work zum Thema «Bridging Employment and Health Policies». Die Veranstaltung vom 4. März 2015 bot Ministern und Akteuren aus den Sektoren Gesundheit und Beschäftigung die Gelegenheit, koordinierte Gesundheits- und Beschäftigungsstrategien zu diskutieren, die dazu dienen können, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in ausbildungsadäquater Arbeit zu halten oder in diese zu intergieren. Für die Schweiz nahmen an diesem Treffen Christel Bornand (Direktorin Office de l’ insertion des jeunes de moins de 30 ans en formation professionelle, Neuchâtel), Philippe Perrenoud (Regierungsrat Kanton Bern), Stefan Ritler (Vizedirektor BSV), M. Hugues Sautière (chef adjoint Service public de l’emploi, Fribourg,) und Stefan Spycher (Vizedirektor BAG) teil. ISTOCK P Im Frühjahr 2015 wurde schliesslich der Synthesebericht Fit Mind, Fit Job – From Evidence to Practice in Mental Health and Work veröffentlicht.3 Dieser weist neben grundsätzlichen Systemschwächen auch auf Verbesserungspotenziale hin. Unter Bezugnahme auf Good-Practice-Beispiele aus den untersuchten Ländern zeigt er Handlungsempfehlungen zuhanden der Politik auf. Im Fokus stehen die leichten bis mittelschweren psychischen Erkran- Bei psychischen Problemen ist ein frühzeitiges Erkennen wichtig. Arbeitgeber, Lehrer und Ärzte spielen dabei eine Schlüsselrolle. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 55 ARBEITSMARKT kungen, die insbesondere bei frühzeitiger Erkennung und rascher und angemessener Unterstützung und Behandlung nicht zu einem Ausschluss aus dem Erwerbsleben führen müssen. Ein voreiliger Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt kann fatal sein Übergeordnete Fragestellungen sieht die OECD hinsichtlich dessen, wann Interventionen zum Erhalt der psychischen Gesundheit bzw. zur Verhinderung psychischer Krankheit stattfinden müssen, wer dabei in der Verantwortung stehen soll und was genau dafür zu tun sei. Beim Wann geht es in erster Linie um Prävention, frühzeitige Erkennung und rasches Handeln. Dadurch werden Chronifizierung, Ausbildungsausfälle/-hemmnisse im Kindes- und Jugendalter sowie der Ausschluss vom Arbeitsmarkt im Erwerbsalter nach Möglichkeit verhindert. Gerade bei den leichten bis mittelschweren Störungen ist es fatal, erst eine allfällige Heilung abzuwarten und damit möglicherweise «vorerst» einen Ausschluss in Kauf zu nehmen, bevor eine (Re) integration erfolgt. Je länger eine Person krankheitsbedingt dem Arbeitsmarkt fernbleibt, desto schwieriger gestaltet sich deren Reintegration. Hinsichtlich des Wer wird dabei den sogenannten Front-Line-Actors eine entscheidende Rolle zugewiesen. Also denjenigen Personen, die in den vier untersuchten Bereichen zuerst und relativ intensiv Kontakt zu möglicherweise betroffenen Personen haben (Lehrer, Arbeitgeber/Vorgesetzte, Hausärzte, RAV-/Sozialhilfe-Betreuer). In Bezug auf das Was ist die Empfehlung einer übergeordneten politischen Gesamtstrategie («mental health strategy») prüfenswert. So könnten etwa Massnahmen zum Erhalt der psychischen Gesundheit in einem integrierten Ansatz geplant und umgesetzt werden – statt dass wie bislang isoliert in einzelnen Systemen gehandelt wird. Für die Umsetzung der Strategie wird ein Monitoring empfohlen. Lehrer, Ärzte und Arbeitgeber gefordert Die wichtigsten inhaltlichen Schwerpunkte und Empfehlungen des OECD-Berichts betreffen das Bildungs-, das Gesundheits-, das Sozialsystem und den Arbeitsmarkt. Die Experten geben Akteuren in den untersuchten Bereichen, unter Be- 56 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Netzwerk Psychische Gesundheit Das Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz (NPG) versteht sich als multisektorale gesamtschweizerische Initiative zur Förderung der psychischen Gesundheit und zur Verminderung psychischer Erkrankungen. Dabei spielt der Kontext Arbeit eine wichtige Rolle. Das NGP ist eine Nonprofitorganisation basierend auf einem Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und ‑direktoren (GDK), der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Durch Vernetzung der relevanten Akteure sollen Synergiemöglichkeiten sichtund nutzbar gemacht sowie die Wirksamkeit und die Effizienz der Massnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit erhöht werden. Derzeit sind über 130 Institutionen aus nationalen Organisationen, kantonalen Verwaltungen und privatwirtschaftlichen zugnahme auf Good-Practice-Beispiele aus verschiedenen OECD-Ländern, Handlungsempfehlungen für die Entwicklung integrierter Strategien ab. Dadurch sollen Menschen mit leichten bis mittelgradigen psychischen Störungen rasche Unterstützung und Behandlung erhalten. Es geht dabei weniger um die Aufstockung von Ressourcen im psychiatrischen Bereich als vielmehr um rasches Erkennen und niederschwellige Intervention gut informierter, befähigter und ihrer Verantwortung bewusster (Erst-Kontakt-)Akteure. Ein solcher Ansatz könnte helfen, individuelles Leiden zu vermindern und die enormen volkswirtschaftlichen Kosten einzudämmen. Im Folgenden wird genauer auf die vier untersuchten Bereiche eingegangen. Bildungssystem: Erkennen von Erkrankungen Erste Anzeichen psychischer Erkrankungen treten häufig bereits im Jugendalter auf und beeinflussen somit die Ausbildung und den Eintritt ins Erwerbsleben. Die OECD weist auf Mängel hinsichtlich des Bewusstseins bezüglich psychischer Probleme der Schüler seitens der Lehrkräfte, aber auch seitens der betroffenen Schüler hin («lack of mental health literacy»). Als Strategie schlägt die OECD vor, bei Bildungsbehörden und Lehrkräften Kompetenzen zu entwickeln, sodass diese psychische Probleme erkennen und damit umgehen lernen. Schülern soll bei Bedarf ein früher niederschwelliger Zugang zu einer koordinierten Unterstützung ihrer psychischen Gesundheit garantiert werden. Das soll besonders auch dann zum Tragen kommen, wenn Übergänge – wie etwa der Eintritt in die Arbeitswelt – besonderer Begleitung bedürfen. Ein spezielles Augenmerk sollte der Verhinderung von Schulabbrüchen gelten, da diese häufig im Zusammenhang mit psychischen Beeinträchtigungen stehen und ungünstige weitere Verläufe zur Folge haben. Gesundheitssystem: Erweiterte Arztzeugnisse einführen Um die Verschlechterung einer psychischen Beeinträchtigung zu verhindern, ist eine rechtzeitige und angemessene Behandlung von psychischen Problemen notwendig – gerade auch bei leichten bis mittelschweren Störungen. Dabei steht weniger eine teure Behandlung durch Spezialisten im Vordergrund. Vielmehr sollten auch Hausärzte zur Behandlung von moderaten psychischen Erkrankungen befähigt werden und bei Bedarf auf Unterstützung zurückgreifen können. Die Erwerbssituation einer Person spielt eine wesentliche Rolle, unter anderem auch für den Behandlungs- und Heilungsprozess. Das wird von der Psychiatrie im Moment zu wenig berücksichtigt. Deshalb gilt es laut den OECD-Experten, diese Perspektive künftig bereits in der Ärzteausbildung zu fördern: Das psychiatrisch-psychotherapeutische System muss ein verstärktes Augenmerk auf Beschäftigung und somit auf Ressourcenorientierung im Umgang mit dem Patienten legen. Dazu gehört auch ein erweitertes Arztzeugnis, welches nicht pauschal eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt, sondern die konkreten Arbeitsanforderungen berücksichtigt und aufzeigt, was eine betroffene Person im Moment erledigen kann. Somit kann mit einem allenfalls vorübergehend angepassten Arbeitspensum, und beispielsweise flankiert von Supported Employment4, der Arbeitsplatz im Idealfall erhalten werden. Entsprechende sogenannte Fit-Notes sind nicht nur aus Grossbritannien5 bekannt. Auch die schweizerische Vereinigung Swiss Insurance Medicine (SIM)6 bietet ein entsprechendes Arztzeugnisfor4 Supported Employment (Unterstützte Beschäftigung) bietet Unterstützung für behindere und andere schwer vermittelbare Personen, um bezahlte Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhalten und zu halten. 5 Best-Practice-Example 3.7., OECD 2015, S. 94. 6 www.swiss-insurance-medicine.ch, Best-Practice-Example 3.10, OECD 2015, S. 97. ARBEITSMARKT mular auf ihrer Internetseite an. Standards zur verbindlichen Anwendung solcher Zeugnisse fehlen allerdings im Moment nicht nur in der Schweiz. Arbeitsmarkt: Leitlinien für Vorgesetzte Arbeitgebende bekommen die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen ihrer Mitarbeitenden in Form von Absenzen und Produktivitätsverlusten zu spüren. Entsprechend wären sie für eine aktivere präventive und unterstützende Rolle prädestiniert. Im Bedarfsfall könnten sie rasch handeln, indem sie etwa professionelle Helfer herbeiziehen. Damit Vorgesetzte ihre Rolle zum Erhalt der psychischen Gesundheit besser wahrnehmen können, müssen sie entsprechend geschult werden. Leitlinien zum Umgang mit Mitarbeitenden mit psychischen Problemen könnten hilfreich sein. Die Anreize und Pflichten der Arbeitgebenden zur Prävention von Krankheitsabsenzen müssten nach Ansicht der OECD verstärkt werden. Auch die Gesetze zur psychosozialen Risikoprävention müssten diesbezüglich angepasst werden. Sozialsystem: Anreize setzen Mindestens ein Drittel der Bezüger von Sozialleistungen über alle Sozialversicherungen hinweg ist in den untersuchten OECD-Ländern im Durchschnitt mit psy- chischen Problemen konfrontiert.7 Somit haben neben der Invalidenversicherung auch die Arbeitslosenversicherung und die Sozialhilfe durch ihre Aktivierungsprogramme und das Setzen von Anreizen starken Einfluss auf die (Wieder)-Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Stellensuchende mit psychischen Problemen – egal in welchem System – müssen daher identifiziert und unterstützt werden. Dazu sind adäquate Instrumente zu entwickeln und bereitzustellen. Finanzielle Anreize für die im jeweiligen System betreuten Personen sowie für die Anbieter von Eingliederungsleistungen sollten so gesetzt werden, dass eine gute Arbeitsmarktintegration ermöglicht wird. Ausblick Die betroffenen Bundesämter werden nun die Empfehlungen analysieren und die nötigen Massnahmen einleiten. Das Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz fördert dabei die Diskussion und den Einbezug der weiteren Akteure im Netzwerk. 7 OECD 2015, S. 142. Katrin Jentzsch Wissenschaftliche Mitarbeiterin Bereich Berufliche Integration, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV; Mitglied Steuerungsausschuss Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz. Maggie Graf Dr. sc. nat. ETH, Ressortleiterin Grundlagen Arbeit und Gesundheit, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Mitglied Steuerungsausschuss Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz. Annette Hitz Projektleiterin Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz. Literatur OECD 2015: Fit Mind, Fit Job – From Evidence to Practice in Mental Health and Work. OECD 2014: Psychische Gesundheit und Beschäftigung: Schweiz. OECD 2012: Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 57 INNOVATION Schweizer Unternehmen sehen Digitalisierung als Chance Eine gross angelegte Umfrage zeigt: Schweizer Unternehmen sind im digitalen Zeitalter angekommen. Insbesondere IT- und Kommunikationsfirmen haben die Chancen erkannt, welche der technologische Umbruch bietet. Industriebetriebe schöpfen das Potenzial aber erst wenig aus. Patricia Deflorin, Christian Hauser, Maike Scherrer-Rathje D igitale Technologien stellen für Unternehmen eine der grössten Herausforderungen dar. Gleichzeitig bieten sie ihnen aber auch die Chance, Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Das zeigen mehrere Studien. Durch den anhaltenden technologischen Fortschritt entstehen immer mehr Daten entlang der Wertschöpfungskette in digitaler Form.1 So bekommen Maschinen Sensoren und werden an einheitliche Softwareplattformen angebunden. Transaktionen werden digitalisiert, Daten auf neue Weise erzeugt und analysiert und einzelne Objekte, Menschen und Aktivitäten miteinander vernetzt.2 Katalysator dieser Veränderungen sind digitale Technologien.3 Sie ermöglichen die Vernetzung – und somit eine effiziente und effektive Zusammenarbeit – internationaler Wertschöpfungsketten. Viele Schweizer Unternehmen sind in solche Wertschöpfungsketten eingebunden und stehen nun vor der Herausforderung, sich in der veränderten Wirtschaft richtig zu positionieren. Das Potenzial digitaler Technologien ist vielfältig: Zum einen ermöglicht es die 1 Bechtold, J. und Lauenstein, C., Digitizing Manufacturing: Ready Set Go. Capgemini, 2014; Ebner, G. und Bechtold, J., Are Manufacturing Companies Ready to Go Digital? Understanding the Impact of Digital. Capgemini, 2012; Jaruzelski, B., Loehr, J., Holman, R., Navigating the Digital Future. strategy+business magazine, Booz and Company Inc., 2013; Ernst & Young, The digitisation of everything. How organisations must adapt to changing consumer behaviour. Ernst & Young, 2011. 2 Iansiti, M. und Lakhani, K.R., Digitale Erneuerung. Harvard Business Manager. S.63-74, Dezember 2014. 3 Der Begriff digitale Technologie umfasst die Gesamtheit aller Technologien welche zur Erstellung, Verarbeitung, Übertragung von digitalen Daten benötigt werden. 58 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Digitalisierung, interne Prozesse effektiver und effizienter zu gestalten, und zum anderen kann sie den Mehrwert eines Dienstleistungs- und Produktangebots für die Kunden erhöhen. Darüber hinaus vermag sie disruptive Veränderungen auszulösen: Durch den Einsatz digitaler Technologien können neue Produkte und Dienstleistungen entstehen sowie Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse oder die Art der Kundeninteraktion umfassend revolutioniert werden. Ein bekanntes Beispiel ist der Internet-Fahrdienst Uber. Das US-Unter- Büro in einem Schweizer Telekommunikationsunternehmen. ICT-Unternehmen sind gegenüber digitalen Technologien aufgeschlossener nehmen hat bei der Reservierung, der Abrechnung, der Kundenbetreuung und der Fahrerbewertung die Regeln der Personenbeförderung neu definiert und den klassischen Taxiservice substituiert. Firmen erwarten mehr Effizienz Welche Potenziale Schweizer Unternehmen erkennen, welche digitalen Technologien bereits eingesetzt werden und welche Ziele damit erreicht werden konnten, zeigt eine Studie des Schweizerischen Instituts für Entrepreneurship (Sife) der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur und des Instituts für Technologiemanagement (Item-HSG) der Universität St. Gallen. Die Digitalisierung bietet für Schweizer Unternehmen grosses Potenzial. Die Mehrheit der befragten Unternehmen stimmen zu, dass die digitale Transformation kompetitive Chancen bietet (siehe Abbildung 1). Die genauere Betrachtung der Daten zeigt: Unternehmen aus der Branche Informationsund Kommunikationstechnologie (ICT) knüpfen mit 97% Zustimmung besonders hohe Erwartungen an die digitale Transformation. KEYSTONE Abstract Die Digitalisierung hat in der Schweiz unterschiedlichste Wirtschaftsbranchen erfasst. Nicht zuletzt aufgrund ihrer starken Einbindung in internationale Wertschöpfungsketten stehen viele Betriebe vor der Herausforderung, die durch den Einsatz digitaler Technologien hervorgerufenen Veränderungen zu identifizieren und rechtzeitig darauf zu reagieren. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen: Die meisten Unternehmen haben die Chancen, welche die Digitalisierung bietet, erkannt und generieren damit bereits Mehrwerte. Aufgeschlossen gegenüber dem Wandel zeigen sich insbesondere Firmen der Informations- und Kommunikationstechnik. Dienstleistungs- sowie Industrieunternehmen hingegen lassen mehr Zurückhaltung erkennen. Nicht ausgeschöpftes Potenzial liegt vor allem in den Schnittstellen zu externen Partnern. 7 INNOVATION Abb. 1: Umfrage – Potenziale der digitalen Transformation 5 1,6 15,1 8,2 36,7 42,7 52,4 Digitale Technologien können uns helfen, die interne Effizienz zu steigern. 5,9 11,1 32,6 19,8 38,2 5 42,7 Der Einsatz digitaler Technologien kann uns helfen, den Mehrwert unserer Dienstleistungen zu verbessern. 9,4 13 43,5 33,5 15,1nicht zu Stimme 39,4 Der Einsatz digitaler Technologien kann uns helfen, den Mehrwert unserer Produkte zu erhöhen. 37,6 17,9 5 45 30,3 Die digitale Transformation bietet eine kompetitive Chance für unser Unternehmen. Die Einbettung von digitalen Schnittstellen in unsere Produkte kann uns helfen, unser Markt- und Kundenwissen zu5steigern. 42,7 21,1 12,2 37,8 37,2 37,5 3,4 11,9 Der Einsatz mobiler Technologien kann 15,1 uns helfen, Prozessverbesserungen umzusetzen. Eingebettete Geräte können uns die Verbesserung der Prozesse erleichtern. 5 15,1 15,1 Stimme eher nicht zu 37,2 Insbesondere sind Effizienzsteigerungen möglich. 90% 37,2 der Studienteilnehmer 37,2 geben an, dass sie durch den Einsatz digitaler Technologien mehr Effizienz erwarten. Darüber hinaus schreiben die Unternehmen der Digitalisierung das Potenzial zu, den Mehrwert ihrer Dienstleistungen zu verbessern. 84% versprechen sich eine Erhöhung des Dienstleistungsmehrwerts. Etwas weniger ausgeprägt wird das Potenzial zur Erhöhung des Mehrwerts der Produkte beurteilt. Nur gut zwei Drittel der befragten Unternehmen stimmen hier zu. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass das verarbeitende Gewerbe das Potenzial für den Produktmehrwert mit 62% Zustimmung im Vergleich zu der Gesamtwirtschaft tiefer einschätzt. Diese Zurückhaltung ist auch international erkennbar. So ergab eine internationale Studie noch 2012, dass eine Vielzahl der Industrieunternehmen den Einfluss der Digitalisierung nicht spürt oder ignoriert. Eine vergleichbare Erhebung aus dem Jahr 2014 machte jedoch deutlich: Industrieunternehmen haben die Potenziale der digitalen Technologien erkannt und haben angefangen, diese vermehrt Stimme eher zu 42,7 Stimme zu (Angaben in %) einzusetzen.4 Auch Politik, Verbände und 37,2 Grossunternehmen treiben das Thema zunehmend voran. Hightech-Initiativen, wie die in Deutschland prominente «Industrie 4.0», gewinnen an Bekanntheit. Wichtige Stichworte sind dabei etwa die Maschi4 Ebner, G. und Bechtold, J., Are Manufacturing Companies Ready to Go Digital? Understanding the Impact of Digital. Capgemini, 2012; Bechtold, J. und Lauenstein, C., Digitizing Manufacturing: Ready Set Go. Capgemini, 2014. DEFLORIN, HAUSER, SCHERRER-RATHJE (2015) / DIE VOLKSWIRTSCHAFT nen-zu-Maschinen-Kommunikation oder autonome, intelligent handelnde Fabriken. Der Fokus der Diskussion liegt jedoch oftmals auf den internen Prozessen, das Potenzial der Digitalisierung für das Produktangebot wird hingegen weniger prominent thematisiert. Knapp drei Viertel der befragten Schweizer Unternehmen geben an, dass Design der Untersuchung Die zur Beantwortung der Forschungsfrage gesammelten Daten wurden in einer onlinebasierten Umfrage im Sommer 2014 erhoben. Diese wurde in Kooperation mit Postfinance durchgeführt. Die Bruttostichprobe bestand aus 7584 Unternehmen aus der Deutschschweiz, die per E-Mail zur Teilnahme eingeladen wurden. 584 Unternehmen nahmen an der Umfrage teil. Für die Interpretation wurden die Anteilswerte der zwei höchsten Zustimmungskategorien («stimme eher zu» und «stimme zu») und der zwei niedrigsten Zustim- mungskategorien («stimme eher nicht zu» und «stimme nicht zu») jeweils zusammengefasst. In Bezug auf die Unternehmensgrösse zeigt sich: 34% der befragten Unternehmen haben weniger als 10 Beschäftigte, und 42% haben zwischen 10 und 99 Mitarbeitende. Die restlichen Unternehmen mit 100 und mehr Beschäftigten machen im untersuchten Datensatz einen Anteil von 23% aus. In 60% der Fälle handelte es sich bei der befragten Zielperson um den Eigentümer, den Inhaber oder einen Teilhaber des Unternehmens. Bei 20% wurden die Angaben von einem angestellten Geschäftsführer gemacht, bei den übrigen 20% der Fälle von einem anderen Entscheidungsträger mit Führungsfunktion. 35% der Antworten stammen aus dem verarbeitenden Gewerbe, 30% aus der Dienstleistungsbranche, 10% sind der Informations- und Kommunikationsbranche (ICT) zuzuordnen. Die restlichen 24% wurden in einer Gruppe «Sonstige» zusammengefasst. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 59 INNOVATION Abb. 2: Umfrage – Digitalisierung der Geschäftsprozesse Abb. 3: Umfrage – Verankerung digitaler Initiativen 11 23,6 8,9 24,5 4,7 22,1 27,2 38,2 Abb. 4: Umfrage – Erzielte Mehrwerte durch den Einsatz digitaler Technologien 8,8 33,6 52,9 44,5 Die Kernprozesse unseres Unternehmens sind automatisiert. Unsere leitenden Angestellten besitzen eine gemeinsame Vision, wie sich das Geschäft durch digitale Technologien wandeln soll. 9,4 6,3 18 28,3 29,9 Durch digitale Technologien konnten wir die Prozesseffizienz steigern. 20,9 18 12,9 31,8 47,7 Durch die Anwendung von Wirtschaftsanalytik verbessern wir unsere Prozesse. Digitale Initiativen werden über Tochtergesellschaften hinweg koordiniert. 8 19,2 24,4 34,4 42,7 29,1 15,5 Durch digitale Technologien konnten wir die Produkteinführungszeit senken. 24,9 13,1 26,9 26,1 30,3 35,1 47,4 Unsere Prozesse werden in Echtzeit überwacht. Digitale Initiativen werden den Geschäftszielen angepasst 10,5 6,9 13,5 24,6 14,8 41,1 Durch digitale Technologien konnten wir den Mehrwert von Produkten steigern. 31,7 11,9 31,2 30,7 33,6 Unterschiedliche Funktionsbereiche benutzen eine gemeinsame digitale Plattform. 49,5 Digitale Initiativen werden durch ein gemeinsames Set von Leistungskennzahlen beurteilt Durch digitale Technologien konnten wir den Mehrwert von Dienstleistungen steigern. 7 30,5 31 36,5 17,9 5 20,6 15,1nicht zu Stimme 42,7 15,1 Stimme eher nicht zu 37,2 42,7 60 40,8 15,1 Wir besitzen IT-Schnittstellen zu externen Partnern in der5 Wertschöpfungskette 5 15,7 7,2 14,7 52,1 Unser Topmanagement unterstützt aktiv eine Zu5 kunftsvision, die digitale Technologien beinhaltet. Durch digitale Technologien haben wir die Integration unserer Funktionen/Prozesse erhöht. 15,1 Stimme eher zu 42,7 Stimme zu (Angaben in %) Die Volkswirtschaft 5 / 2015 37,2 26 37,2 DEFLORIN, HAUSER, SCHERRER-RATHJE (2015) / DIE VOLKSWIRTSCHAFT INNOVATION die Einbettung von digitalen Schnittstellen in die Produkte zur Erhöhung ihres Markt- und Kundenwissens genutzt werden kann. Eine Betrachtung nach Branchen ergibt: Die ICT-Vertreter sehen mit rund 90% Zustimmung die Chancen der Digitalisierung bezüglich der Steigerung des Markt- und Kundenwissens besonders häufig. Weniger stark ausgeprägt ist das Bewusstsein für dieses Potenzial hingegen in den anderen Branchen (verarbeitendes Gewerbe, Dienstleister und Sonstige). Nachholbedarf bei IT-Schnitt­ stellen zu externen Partnern Die Umfrage geht darauf ein, in welchen Bereichen die Unternehmen digitale Technologien einsetzen (siehe Abbildung 2). Die Analyse zeigt: In drei Viertel der befragten Unternehmen nutzen unterschiedliche Funktionsbereiche – wie Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing – eine gemeinsame digitale Plattform. Gleich viele Unternehmen setzen Wirtschaftsanalytik ein, um ihre internen Prozesse zu verbessern. Bei knapp zwei Dritteln der befragten Studienteilnehmer sind die Kernprozesse automatisiert. Hingegen ist der Einsatz von digitalen Technologien zur Überwachung der Prozesse in Echtzeit weniger stark verbreitet: Nur rund die Hälfte der Unternehmen gibt an, dies zu tun. Ebenfalls verfügt nur jedes zweite Unternehmen über IT-Schnittstellen zu externen Partnern in der Wertschöpfungskette. Im Gegensatz zur weitverbreiteten internen Anwendung von digitalen Technologien ist somit die digitale Vernetzung mit externen Partnern der Wertschöpfungskette bei Schweizer Unternehmen noch nicht weit vorangeschritten. an: Die leitenden Angestellten besitzen eine gemeinsame Vision, wie sich das Unternehmen durch den Einsatz digitaler Technologien verändern soll. Bei rund drei Vierteln der Studienteilnehmer unterstützt das Topmanagement die Zukunftsvision der Digitalisierung aktiv. Ebenso viele passen die digitalen Initiativen den Geschäftszielen an und koordinieren die Projekte gar über das gesamte Unternehmen hinweg. Bei deren Erfassung zeigt sich ein weniger einheitliches Ergebnis: Weniger als die Hälfte der Unternehmen misst den Erfolg ihrer digitalen Initiativen durch ein unternehmensweit verankertes Set von Leistungskennzahlen. Besseres Dienstleistungsangebot Abschliessend wird aufgezeigt, welche Ziele aufgrund der Digitalisierung bereits umgesetzt werden konnten (siehe Abbildung 4). Die grosse Mehrheit der befragten Unternehmen konnte durch den Einsatz digitaler Technologien die Effizienz ihrer Prozesse steigern und die Integration der verschiedenen Funktionen und Prozesse erhöhen. Bei vier Fünfteln der Studienteilnehmer hat die Digitalisierung zu einer Steigerung des Mehrwerts beim Dienstleistungsangebot geführt. Etwas weniger ausgeprägt fällt das Resultat bei den Produkten aus. Hier konnten rund zwei Drittel den Mehrwert steigern. Dieses Ergebnis widerspiegelt sich zudem im Beitrag der digitalen Technologien zur Senkung der Produkteinführungszeit: Lediglich rund die Hälfte der analysierten Unternehmen konnte dadurch die Einführungszeit verringern. Wertschöpfungskette optimieren Zusammenfassend ist festzuhalten: Der Einsatz digitaler Technologien ist in den Schweizer Unternehmen weit verbreitet und trägt wesentlich dazu bei, sowohl die Effizienz als auch den Mehrwert von Produkten und Dienstleistungen zu steigern. Die ICT-Unternehmen nehmen hier eine Vorreiterrolle ein. Aber auch die Dienstleistungsbranche und das verarbeitende Gewerbe stehen vor der Herausforderung, die – oftmals notwendige – Transformation einzuleiten. Je nach Geschäftsfeld und Strategie kann die Digitalisierung eine digitale Transformation, also einen fundamentalen Wandel von Unternehmensstrategie, Kultur, Struktur oder Prozessen, bedeuten. Digitale Technologien können des Weiteren die Prozesseffizienz erhöhen oder den Dienstleistungs- und Produktmehrwert steigern. Sie bieten zudem die Chance, neue Geschäftsmodelle zu initiieren. Die Studie über den Stand der Digitalisierung der Schweizer Unternehmen zeigt: Ein Grossteil der Firmen beschäftigt sich mit der Thematik und hat den Mehrwert, der durch die Digitalisierung erzielt werden kann, erkannt. Damit Schweizer Unternehmen die Potenziale, welche die Einbettung in eine internationale Wertschöpfungskette mit Partnerunternehmen bietet, ausschöpfen können, ist es notwendig, dass die Unternehmen Fähigkeiten aufbauen, welche für das Erkennen der Chancen digitaler Veränderungen, aber auch deren Implementierung notwendig sind. Das dürfte in den nächsten Jahren ein wesentlicher Bestandteil der unternehmerischen Aktivitäten Schweizer Unternehmen sein. Mangager stehen hinter Digitalisierung Um auf eine Veränderung, wie sie durch die Digitalisierung hervorgerufen wird, erfolgreich reagieren zu können, muss in den Unternehmen eine gemeinsame Vision existieren. Darauf aufbauend müssen Initiativen entwickelt werden, die an die Geschäftsziele angepasst und über das gesamte Unternehmen hinweg koordiniert sind. Die befragten Unternehmen widerspiegeln mit ihren Antworten die Wichtigkeit der Digitalisierung (siehe Abbildung 3). Gut zwei Drittel der Unternehmen geben Patricia Deflorin Professorin für Innovationsmanagement am Schweizerischen Institut für Entrepreneurship der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur. Christian Hauser Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management am Schweizerischen Institut für Entrepreneurship der HTW Chur. Maike Scherrer-Rathje Dr. oec. HSG, Projektleiterin am Institut für Technologiemanagement der Universität St. Gallen und Lehrbeauftragte für Operationsmanagement an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 61 STEUERN Die Reform der Verrechnungssteuer stärkt den Finanzplatz Der Bundesrat will mit der geplanten Verrechnungssteuerreform den Finanzplatz Schweiz stärken. Die erleichterte Kapitalaufnahme im Inland schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Zudem soll die Reform die Steuereinnahmen sichern. Daniela Schwarz D ie Verrechnungssteuer dient gegenüber inländischen Leistungsbegünstigten (und damit Steuerpflichtigen) dem Zweck, die ordnungsgemässe Deklaration der direkten Steuern (Gewinn-, Einkommens- und Vermögenssteuern) sicherzustellen. In diesem Zusammenhang wird auch vom Sicherungszweck der Verrechnungssteuer gesprochen. Gegenüber Leistungsbegünstigten mit Wohnsitz im Ausland hat die Verrechnungssteuer teilweise ebenfalls Sicherungsfunktion, was angesichts der Ausdehnung der internationalen Zusammenarbeit im Steuerbereich indes an Bedeutung verloren hat. Daneben verfolgt die Steuererhebung gegenüber ausländischen Personen aber auch einen reinen Fiskalzweck im Umfang der nicht (vollständig) rückforderbaren Verrechnungssteuer. Daraus erzielt die Schweiz beträchtliche Steuereinnahmen. Aktuelles System weist Mängel auf Die heute geltende Verrechnungssteuer beruht auf dem Schuldnerprinzip und erfasst ausschliesslich Erträge aus inländischen Quellen (siehe Kasten). Steuerpflichtig ist dabei ausschliesslich der inländische Schuldner der steuerbaren Leistung. Das kann ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz sein, das eine Obligation ausgibt und darauf den Investoren einen Zins ausrichtet. Der Verrechnungssteuer unterliegen somit bloss Leistungen, welche ein inländischer Schuldner einer steuerbaren Leistung ausrichtet. Die Steuer wird ferner unabhängig von der Person des Leistungsempfängers erhoben und damit auch gegenüber institutionellen Anlegern. 62 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 System des Schuldnerprinzips System des Zahlstellenprinzips Schuldner der steuerbaren Leistung Schuldner der steuerbaren Leistung Nettoertrag Steuerabzug Empfänger der steuerbaren Leistung Nettoertrag Rückerstattung Steuerverwaltung Voraussetzung der Steuererhebung ist, dass es sich beim Schuldner der steuerbaren Leistung um einen Inländer handelt. Die Sicherungsfunktion der Verrechnungssteuer im Inland wird mit der geltenden Regelung der Verrechnungssteuer jedoch nur teilweise erfüllt. Denn bei in der Schweiz unbeschränkt steuerpflichtigen Personen unterliegen im Bereich des beweglichen Vermögens nicht nur die inländischen Erträge, sondern auch die Erträge aus ausländischen Quellen der Einkommens- und Vermögenssteuer. Diese Einkommensbestandteile werden von der Verrechnungssteuer nicht erfasst und damit auch nicht gesichert. Dies ist etwa dann der Fall, wenn eine in der Schweiz unbeschränkt steuerpflichtige Person in ihrem Depot ausländische Obligationen hält und ihr darauf Zinsen entrichtet werden. Gleichzeitig ergeben sich aus der aktuellen Konzeption der Verrechnungssteuer volkswirtschaftliche Nachteile. Da in der Schweiz emittierte Anleihen der Verrechnungssteuer unterliegen, ist der Kapitalmarkt für institutionelle Investoren, welche eine volumenmässig grosse In- Zahlstelle Bruttoertrag Empfänger der steuerbaren Leistung Rückerstattung Steuerabzug Steuerverwaltung Voraussetzung der Steuererhebung ist, dass sich die Zahlstelle im Inland befindet. vestorengruppe darstellen, unattraktiv. In der Schweiz ansässige Konzerne begeben ihre Obligationen daher regelmässig über ausländische Strukturen, um die schweizerische Verrechnungssteuerbelastung zu vermeiden. Erträge aus ausländischen ­Quellen unterliegen neu der Verrechnungs­steuer Die aktuelle Reform der Verrechnungssteuer1 verfolgt zwei Ziele: Erstens soll sie die Kapitalaufnahme im Inland erleichtern und dadurch einen Beitrag zur Stärkung des schweizerischen Finanzmarkts leisten. Zweitens soll die Sicherungsfunktion der Verrechnungssteuer verbessert werden, indem nun neu auch Erträge aus ausländischen Quellen der Verrechnungssteuer unterliegen, sofern sie über eine in1 Bundesgesetz über das Schuldner- und das Zahlstellenprinzip bei der Verrechnungssteuer (Vernehmlassungsvorlage einsehbar im Bundesblatt [BBl] 2015 432ff.). ESTV / DIE VOLKSWIRTSCHAFT Abstract Die geplante Verrechnungssteuerreform des Bundesrats will den Schweizer Kapitalmarkt stärken und dabei die Kapitalaufnahme im Inland erleichtern. Dies geschieht, indem die Verrechnungssteuer differenzierter ausgestaltet wird. Ein Systemwechsel – weg vom Schuldnerprinzip, hin zum Zahlstellenprinzip – erlaubt mehr Flexibilität. Anstelle des Schuldners einer steuerbaren Leistung (z. B. eines Unternehmens, das eine Obligation ausgibt) tritt nun die Zahlstelle (oftmals eine Bank) in den Vordergrund. In gewissen Fällen – etwa bei inländischen institutionellen Anlegern – kann dadurch auf eine Erhebung der Steuer verzichtet werden. Inländische Privatpersonen haben zwei Möglichkeiten: Entweder wird ihnen gegenüber die Verrechnungssteuer erhoben, oder die steuerbare Leistung wird gemeldet. Dank der Reform kann die Verrechnungssteuer auch ihre Sicherungsfunktion zugunsten der direkten Steuern besser wahrnehmen. Grundbedingung ist der automatische Informationsaustausch im internationalen Verhältnis. Unter dem Strich sollten im Bereich der permanenten Auswirkungen die Einnahmen für Bund und Kantone mittelfristig gleich bleiben. STEUERN ländische Zahlstelle (z. B. eine Bank) an den wirtschaftlich Berechtigten (z. B. eine in der Schweiz wohnhafte natürliche Person) ausgerichtet werden. Bei der Verrechnungssteuer nach dem Zahlstellenprinzip wird die Steuer nicht mehr durch den Schuldner der steuerbaren Leistung (z. B. die Unternehmung mit Sitz in der Schweiz, die eine Obligation ausgibt) anonym erhoben, sondern durch die Zahlstelle (oftmals eine Bank). Diese kennt den wirtschaftlich Berechtigten (z. B. die Person, der die Zinsen aus der Obligation wirtschaftlich zustehen). Somit kann im Zahlstellenprinzip die Steuer differenziert erhoben werden und damit nur noch in denjenigen Fällen, in welchen dies aufgrund des Sicherungszwecks der Verrechnungssteuer als sinnvoll erscheint. Der Verrechnungssteuer nach dem Zahlstellenprinzip unterliegen gemäss Vorschlag des Bundesrates Erträge aus Obligationen, aus Kundenguthaben bei Banken und Sparkassen, aus ausländischen Beteiligungsrechten sowie aus kollektiven Kapitalanlagen (z. B. Anlagefonds), sofern es sich bei letzteren nicht um indirekt ausgerichtete Erträge von inländischen Beteiligungsrechten handelt. Schliesslich unterliegen auch bestimmte Versicherungs- und Vorsorgeleistungen dem Zahlstellenprinzip. Nicht dem Zahlstellenprinzip, sondern nach wie vor dem Schuldnerprinzip unterliegen Erträge aus direkt gehaltenen inländischen Beteiligungsrechten und Erträge aus inländischen Beteiligungsrechten, wel­ che von inländischen kollektiven Kapitalanlagen ausgeschüttet oder thesauriert werden. KEYSTONE Zahlstellenprinzip erlaubt differenzierte Erhebung Schalterhalle in einer Schweizer Bank. Mit dem geplanten Systemwechsel der Verrechnungssteuer spielen die Banken als Zahlstellen eine Schlüsselrolle. Schliesslich unterliegen nach wie vor Lotteriegewinne der Steuer nach dem Schuldnerprinzip. Das Zahlstellenprinzip wird im Bereich der Verrechnungssteuer auf Erträgen aus beweglichem Vermögen somit nicht vollständig umgesetzt. Weder aus Sicht des Kapitalmarkts noch aus Sicht des Sicherungszwecks der Verrechnungssteuer ist für Erträge aus inländischen Beteiligungsrechten (Dividenden aus inländischen Aktien) ein Wechsel vom Schuldner- hin zum Zahlstellenprinzip angezeigt. Zudem ist die Erhebung von Quellensteuern auf Erträgen aus Beteiligungsrechten international üblich. Gleichzeitig bleibt das bisherige be- trächtliche Steueraufkommen in diesem Bereich gewährleistet. Wer ist eine Zahlstelle? Als Zahlstelle gilt, wer im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit Erträge, welche der Steuer nach dem Zahlstellenprinzip unterliegen, überweist, vergütet oder gutschreibt. Damit qualifizieren sich in erster Linie Banken und Vermögensverwalter als Zahlstellen. Daneben kann dies auch auf Versicherungen und Unternehmen des Werkplatzes zutreffen – nämlich dann, wenn sie z. B. Zinsen aus von ihnen ausgegebenen Obligationen direkt an ihre Gläubiger ausrichten. Verrechnungssteuer nach aktuellem System Die Verrechnungssteuer ist eine vom Bund an der Quelle erhobene Steuer auf dem Ertrag des beweglichen Kapitalvermögens (insbesondere auf Zinsen und Dividenden), auf schweizerischen Lotteriegewinnen und auf bestimmten Versicherungsleistungen. Die Steuer bezweckt in erster Linie die Eindämmung der Steuerhinterziehung; die Steuerpflichtigen sollen veranlasst werden, den für die direkten Steuern zuständigen Behörden die mit der Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte und Vermögenserträge sowie das Vermögen, auf dem die steuerbaren Gewinne erzielt wurden, anzugeben. Die Verrechnungssteuer wird unter bestimmten Voraussetzungen durch Verrechnung mit den Kantons- und Gemeindesteuern oder in bar zurückerstattet. Der in der Schweiz wohnhafte Steuerpflichtige, der seiner Deklarationspflicht nachkommt, wird durch die Steuer somit nicht endgültig belastet. Die Verrechnungssteuer ist eine Objektsteuer, d. h., sie wird ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Empfängers der steuerbaren Leistung erhoben. Der Steuersatz beträgt –– 35% auf Kapitalerträgen und Lottogewinnen, –– 15% auf Leibrenten und Pensionen (d. h. auf Rentenleistungen) und –– 8% auf sonstigen Versicherungsleistungen (d. h. auf Kapitalleistungen). Der Kantonsanteil am Nettoertrag der Verrechnungssteuer beträgt gegenwärtig 10%. Steuerpflichtig sind die inländischen Schuldner der steuerbaren Leistung. Sie haben auf der steuerbaren Leistung die Steuer zu entrichten und diese durch entsprechende Kürzung der Leistung auf deren Empfänger zu überwälzen. Der Steuerschuldner hat sich unaufgefordert bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung anzumelden, die vorgeschriebenen Abrechnungen und Belege einzureichen und gleichzeitig die Abgabe zu entrichten (Prinzip der Selbstveranlagung). Auf Steuerbeträgen, die nach ihrem Fälligkeitstermin ausstehen, ist ohne Mahnung ein Verzugszins geschuldet. Für im Ausland wohnhafte Leistungsempfänger stellt die Verrechnungssteuer grundsätzlich eine endgültige Belastung dar. Personen, deren Wohnsitzstaat mit der Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, können jedoch je nach Ausgestaltung dieses Abkommens Anspruch auf die ganze oder die teilweise Rückerstattung der Verrechnungssteuer erheben, sofern sie die im betreffenden Abkommen aufgestellten Voraussetzungen erfüllen. Die Einnahmen aus der Verrechnungssteuer beliefen sich im Jahr 2014 auf rund 5,66 Mrd. Franken. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 63 STEUERN Neuerungen bei der Steuer­ erhebung – am Beispiel einer Obligation Das Zahlstellenprinzip lässt eine differenzierte Erhebung der Verrechnungssteuer zu, da die Zahlstelle den Empfänger der steuerbaren Leistung kennt (bzw. aufgrund der bereits heute geltenden Sorgfaltspflichten kennen muss). Daher kann im Zahlstellenprinzip – anders als im anonymen Schuldnerprinzip – die Steuererhebung beschränkt werden auf Sachverhalte, bei denen der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer dies erfordert. Dies soll nachfolgend am Beispiel einer Obligation bzw. dem darauf ausgerichteten Zins illustriert werden. … für Schweizer Kapitalgesellschaften Hält eine inländische juristische Person die Obligation und vereinnahmt den Zins, tritt bei Bestehen einer Buchführungspflicht der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer in den Hintergrund. Die Steuer nach dem Zahlstellenprinzip wird daher nicht erhoben, wodurch diese wirtschaftlich Berechtigten die entsprechenden Erträge brutto, das heisst ohne Steuerabzug ausgerichtet erhalten. Die gilt insbesondere für Kapitalgesellschaften mit Nachweis der ordentlichen oder der eingeschränkten Revision (inkl. Vorsorgeeinrichtungen etc.). Vereine und Stiftungen werden nur bei Nachweis der ordentlichen Buchführungspflicht wie Kapitalgesellschaften behandelt. Für Kapitalgesellschaften mit «Milchbüchleinrechnung» (solche, die keiner Revision unterliegen; sogenanntes Opting-out) gibt es hingegen keine Ausnahme, womit in diesen Fällen die Steuer auch im Zahlstellenprinzip zu erheben ist. … für inländische natürliche Personen Ist eine inländische natürliche Person Inhaberin der Obligation, so hat sie zwei Möglichkeiten: Entweder wird die Verrechnungssteuer durch die Zahlstelle entrichtet, oder die steuerbare Leistung (Obligationenzins) wird von der Zahlstelle an die Steuerbehörde gemeldet. Beide Arten der Erhebung sind dabei gleichwertig. Eine Meldung an die Steuerbehörden setzt eine entsprechende Willensäusserung des Obligationärs voraus, die die Zahlstelle zur Meldung ermächtigt. Die Meldeoption ist daher freiwillig. Durch die nach wie vor mögliche (gegenüber dem Fiskus anonyme) Steuerentrichtung und die Überwälzung auf den wirtschaftlich Berechtigten wird das Bankkundengeheimnis im Inland weiterhin gewahrt. 64 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 … für wirtschaftlich berechtigte Personen im Ausland Bei Personen mit Wohnsitz im Ausland wird im Zahlstellenprinzip auf eine Steuererhebung verzichtet. Der Wegfall der Steuer auf Zinserträgen steigert die Attraktivität von zinstragenden Schweizer Anlagen für ausländische, namentlich institutionelle Anleger. Damit werden die steuerlichen Voraussetzungen für die anvisierte Stärkung des Kapitalmarkts Schweiz geschaffen. Die damit verbundenen Mindereinnahmen für den Fiskus sind verkraftbar. Im Unterschied zu den Zinsen generiert die Verrechnungssteuer auf den Dividenden aus inländischen Beteiligungsrechten heute substanzielle Steuereinnahmen. Da in diesem Bereich am Schuldnerprinzip festgehalten werden soll, ergeben sich diesbezüglich keine Mindereinnahmen. Automatischer Informations­ austausch als Grundbedingung Der Wechsel zum Zahlstellenprinzip stärkt die Sicherungsfunktion der Verrechnungssteuer sowie auch den Kapitalmarkt Schweiz. Er setzt allerdings ohne Gegenmassnahmen insbesondere für inländische natürliche Personen einen Anreiz, ihre Zahlstelle (das heisst ihr Depot oder ihr Konto) von der Schweiz weg zu einer ausländischen Zahlstelle zu verlegen, um damit die Verrechnungssteuer zu vermeiden. Diesem Risiko, das eine Schwächung des Finanzplatzes Schweiz und erhebliche Mindereinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern für Bund, Kantone und Gemeinden zur Folge hätte, wird in zweierlei Hinsicht begegnet: Für steuerehrliche Personen wird bei der Verrechnungssteuer eine freiwillige Meldeoption eingeführt, wodurch diese ebenfalls die jeweiligen Erträge ohne Abzug der Verrechnungssteuer vereinnahmen können. Steuerunehrliche Personen, die eine Steuerhinterziehung über eine ausländische Bank beabsichtigen, werden sich im internationalen Umfeld zunehmend einem ausgedehnten Informationsaustausch und damit einem Entdeckungsrisiko ausgesetzt sehen. Die Einführung eines automatischen Informationsaustausches im internationalen Verhältnis ist daher eine Bedingung für die Implementierung der vorliegenden Reform der Verrechnungssteuer. Zentral erscheint weiter: Mit dem Wechsel zum Zahlstellenprinzip werden steuerliche Rahmenbedingungen geschaffen, womit Banken zur Stärkung der Eigenmittel ihre Pflichtwandelanleihen (inkl. Bail-inBonds) und Anleihen mit Forderungsverzicht auch in Zukunft aus dem Inland heraus begeben können. Unter dem Strich bleiben Einnahmen gleich Die vorliegende Reform wirkt sich einerseits direkt auf die Einnahmen der Verrechnungssteuer und anderseits indirekt auf die Einnahmen der Gewinn-, der Einkommensund der Vermögenssteuer aus. Bei der Verrechnungssteuer ergeben sich Mindereinnahmen von rund 200 Mio. Franken pro Jahr. Die Beseitigung der Hindernisse im Kapitalmarktbereich und im Treasury-Bereich schafft jedoch mittelfristig Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Dies führt zu Mehreinnahmen bei der Einkommenssteuer und bei der Gewinnsteuer. Weitere Mehreinnahmen ergeben sich aus der Erfassung bisher unversteuerter Vermögenswerte von inländischen Personen. Die Mehreinnahmen aufgrund dieser Effekte dürften die permanenten Mindereinnahmen bei der Verrechnungssteuer aufwiegen. Mit der Reform sind auch einmalige finanzielle Auswirkungen verbunden. Diese bewegen sich zwischen Mehreinnahmen von bis zu 0,5 Mrd. Franken, wenn von der Meldeoption wenig bis kein Gebrauch gemacht wird, und Mindereinnahmen von bis zu 1,7 Mrd. Franken, wenn die Meldeoption stark genutzt wird oder die Steuererhebung sogar vollständig verdrängt. Zum Umgang mit solchen einmaligen Effekten im Übergang bestehen schuldenbremsenkonforme Lösungen. Darüber hinaus erhöht die Reform die Systemstabilität. Denn die Emission von bestimmten Finanzinstrumenten durch systemrelevante Banken aus der Schweiz heraus wird steuerlich attraktiver. Daniela Schwarz Rechtsanwältin, Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Bern. ARBEITSMARKT Schwarzarbeit-Inspektoren sollen mehr Kompetenzen erhalten Das im Jahr 2008 eingeführte Bundesgesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit hat sich ­bewährt. Insbesondere die kantonalen Inspektoren leisten einen wesentlichen Beitrag. Deshalb sollen sie in einer Gesetzesrevision gestärkt werden. Peter Jakob Abstract Die Schwarzarbeit richtet für die Gesamtwirtschaft grosse Schäden an. Alleine den Sozialversicherungen entstehen Einnahmeausfälle in mehrfacher Millionenhöhe. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Rückgang der Schwarzarbeit in den letzten Jahren aus. Die Arbeit von kantonalen Inspektoren trug auch dazu bei. Im Jahr 2014 arbeiteten in den Kantonen rund 70 Kontrolleure eng mit den involvierten Behörden zusammen. Nach einer Evaluation des 2008 eingeführten Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA) kommt der Bundesrat in einem Revisionsvorschlag zum Schluss: Die Inspektoren müssen mehr Kompetenzen erhalten. So sollen sie auch Informationen aus den Unternehmen, die nicht die Schwarzwirtschaft betreffen, an die Behörden weiterleiten können. Das kann etwa die Sozialhilfe betreffen. Zudem sollen sie Bussen aussprechen dürfen. D er Umfang der Schattenwirtschaft im Vergleich zur Gesamtwirtschaft ist beeindruckend. Eine Schätzung aus dem Jahr 2002 bezifferte ihn auf 37 Mrd. Franken und damit 9,3 Prozent des Bruttosozialprodukts. Diese beiden Zahlen wurden damals in der Botschaft zum Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA; SR 822.41) genannt.1 Diese Schätzung wies laut dem Bundesrat zwar «bedeutende Mängel» auf – so sei der Umfang der Schattenwirtschaft naturgemäss nicht messbar, da diese im Verborgenen stattfinde. Zudem muss in Bezug auf die Schwarzarbeit angemerkt werden, dass der Begriff der Schattenwirtschaft umfangreicher ist als derjenige der Schwarzarbeit. Doch trotz dieser beiden Einschränkungen war damals klar: Schwarzarbeit ist ein gravierendes Problem, welches angegangen werden muss. Selbst bei aller gebotenen Skepsis gegenüber den eingangs genannten Zahlen: Ginge man davon aus, dass sich der Anteil der Schwarzarbeit nur auf einen Zehntel dieser Schätzungen belief, hätten die Einnahmenausfälle allein für die verschiedenen Sozialversicherungen immer noch bei über 400 Mio. Franken pro Jahr gelegen. Hinzu treten weitere negative Folgen der Schwarzarbeit wie Wettbewerbsverzerrungen und Steuerausfälle. Heute, etwas mehr als 13 Jahre später, hat sich an der Ausgangslage nichts geändert: Die aktuellsten Schätzungen – immer 1 BBl 2012 3605. noch mit den gleichen Mängeln behaftet wie in der Vergangenheit – sehen den Anteil der Schattenwirtschaft heute zwar um 1 bis 2 Prozent tiefer als zu Beginn des Jahrtausends. Der dadurch entstehende Schaden liegt damit aber noch immer in Milliardenhöhe, und ein konsequentes Vorgehen gegen die Schwarzarbeit ist nach wie vor angezeigt. BGSA mit langer Entstehungsgeschichte In den Neunzigerjahren wurde Schwarzarbeit erstmals vermehrt als Problem wahrgenommen und auf politischer Ebene diskutiert. Einige Kantone, besonders in der Westschweiz, begannen bereits damit, spezialisierte Kontrollorgane zur Schwarzarbeitsbekämpfung einzusetzen. Auf Bundesebene wurde zunächst eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche in Erfüllung von parlamentarischen Aufträgen einen fast 200-seitigen Bericht über die Bekämpfung der Schwarzarbeit erstellte. Auf dessen Grundlage wurde ein Gesetzesentwurf für ein neues Gesetz, das BGSA, erarbeitet. Als das BGSA am 1. Januar 2008 in Kraft trat, hatte es bereits eine bewegte Geschichte hinter sich: Nachdem der Bundesrat den Entwurf und die Botschaft im Januar 2002 an das Parlament überwiesen hatte, tat sich Letzteres schwer, sich auf den Inhalt zu einigen. Die Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben (WAK) der beiden Räte bildeten je Subkommissionen, welche den Entwurf intensiv debattierten und zahlreiche Anpassungen vorschlugen. Der Gesetzestext, der schliesslich Mitte 2005 vom Parlament verabschiedet wurde, unterschied sich denn auch in wesentlichen Punkten vom bundesrätlichen Entwurf. So strich das Parlament beispielsweise die Definition der Schwarzarbeit und ersetzte sie durch eine indirekte Umschreibung. Demnach liegt Schwarzarbeit heute vor, wenn gegen Melde- und Bewilligungspflichten gemäss Sozial­ versicherungs-, Ausländeroder Quellensteuerrecht verstossen wird. Pfeiler des Gesetzes: Die kantonalen Inspektoren Trotz aller Änderungen blieb das zentrale Element des Entwurfs in seinem Kern erhalten: In jedem Kanton wurde ein Organ geschaffen, welches rechtsgebietsübergreifend Kontrollen durchführt und eng mit den verschiedenen fachlich zuständigen Spezialbehörden (den Ausgleichskassen im Bereich der AHV/IV-Pflichten, den Migrationsämtern im Bereich des Ausländerrechts oder den Steuerbehörden im Bereich des Quellensteuerrechts) zusammenarbeitet. Ergibt sich bei einer solchen Kontrolle ein Verdacht auf Schwarzarbeit, so wird der Fall zur weiteren Abklärung an die zuständige Spezialbehörde weitergeleitet. Erhärtet sich dieser Verdacht, so ist es nach wie vor Aufgabe der Spezialbehörde, diejenigen Die schwarz-orange Informations­ kampagne Die Einführung des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA) Anfang 2008 wurde von einer Informationskampagne unter dem Motto «Keine Schwarzarbeit. Das verdienen alle.» begleitet. Ziel war die Aufklärung der Bevölkerung, in welcher Schwarzarbeit als ein Kavaliersdelikt betrachtet wurde. Während zweier Jahre machten die schwarz-orangen Plakate mit ihren eingängigen Slogans (z. B. «Des einen Lohneinsparung ist des anderen Versicherungslücke» oder «Unter der Hand ist unter der Gürtellinie») auf das neue Gesetz aufmerksam. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 65 ARBEITSMARKT Massnahmen zu treffen, welche gesetzlich vorgesehen sind. Diese reichen von Beitragsnachforderungen bis hin zu Bussen. Neue Pflichten wurden im BGSA nicht eingeführt; einzig die bereits vorhandenen Bestimmungen sollten effizienter kontrolliert werden können. Damit handelt es sich mit dem BGSA um ein Rahmengesetz, welches die Durchsetzung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen unterstützen will. Im Jahr 2008 stellten die Kantone dem Bund die Lohnkosten von etwas über 50 Inspektoren2 in Rechnung.3 Sechs Jahre später waren bereits knapp 70 Inspektoren im Einsatz. In diesem Zeitraum wurden jeweils zwischen ca. 34 000 und 37 000 Personenkontrollen pro Jahr durchgeführt. In rund einem Viertel der Fälle wurden Verdachtsfälle an die Spezialbehörden weitergeleitet. Hinzu kommen zahlreiche Meldungen an die Spezialbehörden seitens der Inspektoren ohne vorgängige Kontrollen. Die Inspektoren prüfen sämtliche Branchen. Einer Kontrolle kann dabei ein eingegangener Hinweis zugrunde liegen. Es gibt aber auch Spontankontrollen ohne vorbestehenden Verdacht. Zu den meistgeprüften Branchen zählen das Bauhaupt- und das Baunebengewerbe sowie das Gastgewerbe. Diese werden von den Kantonen als risikobehafteter betrachtet als andere Branchen. Evaluation zeigt Verbesserungs­ potenzial beim BGSA auf In den Jahren 2011 und 2012 befragte ein externes Büro die Inspektoren sowie weitere beteiligte Behörden und Instanzen. Der daraus entstehende Bericht folgerte: Die Massnahmen des BGSA sind grundsätzlich erfolgversprechend, ihr Beitrag zur Eindämmung der Schwarzarbeit kann jedoch noch verbessert werden.4 Auch das vom Bundesrat darauf kontaktierte Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) kam – in Zusammenarbeit mit den weiteren betroffenen Bundesämtern – 2Vollzeitäquivalente. 3 Der Bund übernimmt 50% der bei den Kantonen anfallenden Personalkosten für die Kontrolltätigkeit. 4 Das Parlament hat im BGSA eine Evaluationspflicht verankert. Die Massnahmen sollten innert fünf Jahren nach Inkrafttreten geprüft werden. Der Bericht ist auf der Internetseite des Seco abrufbar. 66 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Das vereinfachte Abrechnungsverfahren bewährt sich Mit dem BGSA wurde auch das vereinfachte Abrechnungsverfahren eingeführt. Dadurch sollte ein Anreiz geschaffen werden, Arbeitnehmende (insbesondere im Bereich der Anstellungen im Privathaushalt; Stichwort: Putzhilfen) bei den Ausgleichskassen abzurechnen. Mit der Benutzung des ver­ einfachten Abrechnungsverfahrens werden gleichzeitig die vorgesehenen Sozialversicherungsabgaben geleistet sowie das Einkommen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers versteuert. Seit 2008 sind die abgerechneten Beiträge stetig zum Schluss: Das Gesetz sollte punktuell revidiert werden. Einig war man sich, dass die vorhandenen Instrumente des BGSA und dessen Ansatz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit beizubehalten und zu stärken sind. Da sich das Gesetz grundsätzlich bewährt hat, sollte davon abgesehen werden, die Ausrichtung des BGSA grundlegend zu ändern. Die Arbeiten wurden zu Beginn dieses Jahres abgeschlossen, sodass der Bundesrat die Vernehmlassung zur Revision des BGSA am 1. April 2015 eröffnen konnte.5 Kontrolleure sollen Bussen ­aus­sprechen dürfen Eine der Stärken des BGSA ist die Vernetzung sowie der Austausch von Informationen. Die Kontrollorgane sind aufgrund ihrer Vernetzung mit den direkt betroffenen Behörden zu einer wichtigen Anlaufstelle für Verdachtsmeldungen geworden. Dieser Vorteil soll mit der Revision ausgebaut werden: Weitere Behörden, welche mit Schwarzarbeitstatbeständen konfrontiert sein können, sollen ebenfalls zur Verdachtsmeldung an das Kontrollorgan befugt werden (beispielsweise die Sozialhilfebehörden). Gleichzeitig soll den Kontrollorganen ermöglicht werden, Hinweise auf strafbares Verhalten in Zusammenhang mit der Verrichtung von Arbeit, die aber nicht als Schwarzarbeit zu taxieren ist, den dafür zuständigen Behörden zu melden. Da sie vor Ort Kontrollen vornehmen und befugt sind, in verschiedene Unterlagen Einblick zu erhalten, stossen sie auch auf Tatbestände, welche ausserhalb des Sozialversicherungs-, des Ausländer- oder des Quellensteuerrechts liegen. 5 Die Unterlagen sind auf www.admin.ch abrufbar. gestiegen: Während im ersten Jahr des Bestehens rund 5,8 Mio. Franken über das vereinfachte Abrechnungsverfahren abgerechnet wurden, stieg diese Zahl bis ins Jahr 2012 auf über 15,6 Mio. Franken. Die Tendenz ist weiterhin steigend. Neu sollen die kantonalen Kontrollorgane – und das ist eine Abkehr des geltenden Systems – Bussen aussprechen dürfen. Diese beziehen sich auf Verstösse gegen die Anmeldepflicht neuer Arbeitnehmender bei den Ausgleichskassen: Die bereits heute bestehende Pflicht ist zeitlich gesehen die erste, welche nach Abschluss eines Arbeitsvertrages von einem Arbeitgeber erfüllt werden muss und welche von den kantonalen Kontrollorganen überprüft werden kann. Allerdings wird das präventive Potenzial dieser Pflicht nicht ausgeschöpft. Wer diese Meldung innert Frist unterlässt, kann zukünftig gestützt auf das BGSA direkt von den Inspektoren gebüsst werden. Die kantonalen Ausgleichskassen sowie die Verbandsausgleichskassen geben den Arbeitgebern die Möglichkeit, die Anmeldung neuer Arbeitnehmender sowie die Meldung der Jahreslohnabrechnung online vorzunehmen, sodass sich der Aufwand in engen Grenzen hält. Insgesamt soll also die Stellung der Kontrollorgane verstärkt werden. Dies ist aus heutiger Sicht angezeigt, sind sie es doch, welche täglich direkt vor Ort Kontrollen durchführen und damit am stärksten mit Schwarzarbeit konfrontiert werden. Peter Jakob Wissenschaftlicher Mitarbeiter Ressort Arbeitsmarktaufsicht, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern. STEUERN Schattenwirtschaft in der Schweiz geht zurück Die Schattenwirtschaft in der Schweiz ist im internationalen Vergleich tief. Neuste Zahlen zeigen: Im laufenden Jahr dürfte sie weiter zurückgehen. Rückschlüsse auf die Steuerhinter­ ziehung lassen sich daraus aber kaum ableiten. Friedrich Schneider, Christoph A. Schaltegger, Felix Schmutz I n den letzten Jahren ist die Bekämpfung der Schattenwirtschaft und der Steuerhinterziehung vermehrt in den Fokus der Politik gerückt. Deren Erfassung ist naturgemäss schwierig, da die Aktivitäten darauf abzielen, im Verborgenen zu bleiben. Um Massnahmen zur Stärkung der Steuermoral möglichst effizient zu gestalten, ist es wichtig, relativ genaue Informationen über Ausmass und Struktur der Schatten- KEYSTONE Abstract Auf der Spur des Unsichtbaren: Dank Kenntnissen über die Schattenwirtschaft und die Steuerhinterziehung kann die Politik mit gezielten Massnahmen Gegensteuer geben. Unsichtbares oder schwer Fassbares zu messen, ist aber anspruchsvoll. Im Idealfall werden für eine fundierte Analyse mehrere Methoden miteinander kombiniert. Aus umfassenden Resultatvergleichen können bessere Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Prognosen zur Schweiz zeigen: Im Jahr 2015 reduziert sich die Schattenwirtschaft voraussichtlich weiterhin leicht. Sie bewegt sich damit im unteren Drittel der OECD-Staaten. Aufgrund dieser Zahlen kann aber nur beschränkt auf das Ausmass der Steuerhinterziehung geschlossen werden. Für das laufende Jahr wird von einem Umfang der Schattenwirtschaft in der Schweiz von 30,7 Mrd. Franken ausgegangen. Das entspricht rund 6,5% des BIP. wirtschaft und der Steuerhinterziehung zu ermitteln. Auch sind die Daten von gesellschafts- und wirtschaftspolitischer Bedeutung. So kann eine zunehmende Schat- Messmethoden Makromethoden Mikromethoden Makro-Indikatoren: einzelner Indikator; monetäre Ansätze; – Elektrizitätsverbrauch / Physikalischer-InputAnsatz; – Erwerbsquote; – mehrere Indikatoren / Modellierung mit multiple indicator multiple causes (Mimic) / latente Schätzverfahren Individuelle Steuerprüfungen Umfragen Mikro-Diskrepanzen-Methoden Indikationen aufgrund des Konsumverhaltens Diskrepanzen basierend auf der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR): – VGR versus Steuerdaten; – VGR-Einkommensdaten versus VGR-Verwendungs- oder Produktionsdaten. Weitere Mikromethoden: – L aborexperimente und kontrollierte Feldexperimente; – Steueramnestien, Nach- und Strafsteuerverfahren. Weitere Makro-Diskrepanzen-Methoden Nicht zurückgeforderte Verrechnungssteuer SCHNEIDER, SCHALTEGGER, SCHMUTZ tenwirtschaft aus gesellschaftlicher Sicht Ausdruck einer erhöhten Unzufriedenheit mit dem Staat sein. Finanzpolitisch verringert sie die Steuer- und die Sozialversicherungsbasis.1 Die in der Literatur oft genannten Methoden zur Messung des Ausmasses der Schattenwirtschaft oder der Steuerhinterziehung können in Makro- und Mikromethoden unterschieden werden (siehe Kasten und Tabelle).2 Obwohl einzelne Schätzungen zur Höhe der nicht versteuerten Vermögen auf Kantonsebene bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen3, sind für die Schweiz insgesamt nur wenige Zahlen vorhanden. Die seit den 1970er-Jahren erstellten Schätzungen zur Höhe der nicht versteuerten Vermögen 1 Schaltegger und Schneider (2005). 2 Siehe z. B. Schneider und Enste (2000); Gemmell and Hasseldine (2012) und Schneider (2015a) für weitere Ausführungen zu den Methoden sowie Schmutz (2015) zu deren Anwendbarkeit im Falle der Schweiz. 3 Vgl. z. B. Cohn (1884, S. 22/25). Die Volkswirtschaft 5 / 2015 67 STEUERN Grösse in % des BIP 20,1 22,5 22,4 Grösse der Schattenwirtschaft in 21 OECD-Ländern für 2015 17,6 18,2 20 16,2 17,5 8,4 8,2 12,6 12,4 12,3 12,3 12,2 12,0 11,3 10,3 9,4 SCHNEIDER (2015B) / DIE VOLKSWIRTSCHAFT 8,0 5,9 6,5 7,5 9,0 10 10,3 12,5 13,0 15 5 2,5 d an n nl he Gr ie c en lie It a l ga ni Sp a r tu ie n lg Be Po n de en hw e eg rw No hn sc ch OE CD -2 1-D ur Sc itt d an nl ic h F in hl nk an Fr a sc ut De re d k ar m an d ne Dä Ir l da na n lie ra st Au r it sb Gr os Ka en ni de an lan an er Ni ed Ja p ic h d r re te Ös ee lan iz Ne us hw e Sc US A 0 Als Methoden wurden die Bargeldnachfrage und das Mimic-Verfahren verwendet. wurden fast ausschliesslich aufgrund der nicht zurückgeforderten Verrechnungssteuer berechnet. Sie variieren mit 40 Mrd. Franken bis über 500 Mrd. Franken erheblich.4 Hinsichtlich nicht deklarierter Einkommen ging der Bundesrat in seinem Bericht im Jahr 1962 davon aus, dass «die Differenz zwischen dem Sollbetrag gemäss Volkseinkommensrechnung und steuerlich erfasstem Einkommen [ … ] mindestens 2 Milliarden Franken betragen dürfte».5 Spätere Vergleiche der aggregierten Einkom- 4 Vgl. Bundesrat (1974); Howald (2010). 5 Bundesrat (1962, S. 1075). men gemäss Steuerstatistiken versus Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) weisen je nach Kanton und Jahr Differenzen zwischen rund 13% und 35% aus.6 6 Vgl. Feld and Frey (2004); siehe Schmutz (2015) für eine Übersicht zu den Schätzungen nicht deklarierter Vermögen und Einkommen in der Schweiz. Schwierige Wahl: Makro- oder Mikromethode? Makromethoden stützen sich entweder auf aggregierte Daten, wie die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) und aggregierte Steuerdaten, oder auf beobachtbare makroökonomische Indikatoren. Mikromethoden basieren hingegen auf Individualdaten. Eine eindeutige Meinung bzw. ein eindeutiges Ergebnis, welche Methoden zu bevorzugen sind, gibt es in der Literatur nicht. Der Entscheid für eine oder mehrere Methoden hängt von diversen Faktoren ab: Welche Steuerart und welche Schattenwirtschaft steht im Fokus? Soll lediglich das Ausmass geschätzt werden, oder werden detaillierte Ergebnisse erwartet, beispielsweise zum Hintergrund der nicht gesetzeskonformen Steuerpflichtigen oder Schwarzarbeiter? Welche Daten und Mittel sind verfügbar? Ein wichtiger Vorteil von Mikromethoden ist, dass diese Informationen zur Struktur der Schattenwirtschaft oder der Steuerhinterziehung liefern. Diese Detailliertheit geht jedoch oft mit wesentlich höheren Kosten einher. 68 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 Zahlreiche Autorena bevorzugen unter den Mikromethoden zufällige, individuelle Steuerprüfungen mit anschliessender Hochrechnung auf die Gesamtbevölkerung, um das Ausmass der Einkommenshinterziehung zu schätzen. Ebenfalls spricht für diese Methode, dass Steuerprüfungen zentraler Bestandteil von Tax-Gap-Schätzungen durch Steuerbehörden in Dänemarkb, Grossbritannienc und den USAd sind. Von den Makromethoden sind neben dem Bargeldansatz und den latenten Schätzverfahrene auch die auf der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) basierenden Diskrepanzenmethoden hervorzuheben. Bei der Anwendung des Bargeldansatzes und den latenten Schätzungsverfahren basieren die Schätzungen des Umfangs der Schattenwirtschaft meistens auf einer Kombination dieser beiden Methoden. Der «multiple indicator multiple causes»-(Mimic)-Ansatz geht von der Annahme aus, dass die Schattenwirtschaft eine nicht direkt beobachtbare, latente Grösse ist, die näherungsweise aufgrund von quantitativ erfassbaren Ursachen (z. B. Steuerbelastung, Regulierungsdichte, Good Governance), im Schatten zu arbeiten, und Indikatoren (Bargeld pro Kopf, offizielle Arbeitszeit etc.), in denen sich Schattenwirtschaftsaktivitäten widerspiegeln, berechnet werden kann. Da mit dem Mimic-Verfahren nur relative Grössenordnungen der Schattenwirtschaft der einzelnen Länder berechnet werden können, werden zur Umrechnung der Schattenwirtschaft in absolute Werte (in % des offiziellen BIP oder in Mrd. Geldeinheiten) Startwerte, die beispielsweise mithilfe des Bargeldverfahrens errechnet wurden, benötigt. Der Bargeldeinsatz fusst auf der Idee, dass die in der Schattenwirtschaft erbrachten Leistungen bar entlohnt werden und dass es mithilfe einer Bargeldnachfragefunktion gelingt, diese bar entlohnten Leistungen zu schätzen und das Volumen der Schattenwirtschaft zu berechnen. Bei den auf der VGR basierenden Diskrepanzmethoden wird beispiels- weise Einkommen gemäss VGR mit aggregiertem Einkommen gemäss Steuerdaten verglichen. Die Anforderungen an die verfügbaren Daten und an die Dokumentation für einen entsprechenden Abgleich sind hoch, und die Umsetzbarkeit muss im konkreten Fall geprüft werden. Grundsätzlich basiert diese Methode jedoch auf einer fundierten theoretischen Grundlagef. Auch die OECDg vertritt die Meinung, dass eine Differenz zwischen den Gesamteinkommen gemäss Steuer- und VGR-Daten, welche nach Berücksichtigung von statistischen und rechtlichen Unterschieden übrig bleibt, auf die Schattenwirtschaft und die Steuerhinterziehung zurückzuführen ist. a b c d e Vgl. z.B. Gemmell and Hasseldine (2012) SKAT (2009). IMF (2013). Black et al. (2012) Diese Methoden, wie andere, werden in Schneider (2015a) und in Schneider und Enste (2000) ausführlich dargestellt und einer kritischen Wirkung unterzogen. f Vgl. Schmutz (2015). g OECD (2002) S. 52. STEUERN Prognose: Schattenwirtschaft in der Schweiz sinkt im laufenden Jahr Weitaus mehr Schätzungen liegen zum Ausmass der Schattenwirtschaft vor. Diese beruhen oft auf einer Makro-Indikatoren-Methode (siehe Kasten).7 Nachdem das Ausmass der geschätzten Schattenwirtschaft in der Schweiz über eine längere Periode hinweg angestiegen war, wurde zwischen 2004 und 2005 erstmals ein Rückgang von 9,5% auf 9,1% des BIP beobachtet. Bis 2008 folgte eine weitere Reduktion auf 8,0% des BIP, bevor diese infolge der Wirtschaftskrise wieder leicht anstieg. Ausgehend von den aktuellen Prognosen, wird auch für das Jahr 2015 mit einem Rückgang der Schattenwirtschaft auf 6,5% des BIP (auf 30,7 Mrd. Franken) gerechnet. Damit bleibt die Schweiz im unteren Drittel der OECD-Länder (siehe Abbildung 1). Die Schweiz hat im OECD-Vergleich eine sehr niedrige Steuerbelastung, und in vielen Bereichen ist sie auch weniger reguliert. Aufgrund oben genannter Zahlen zur Schattenwirtschaft nun auf das Ausmass der Steuerhinterziehung zu schliessen, ist zwar verlockend, sollte jedoch vermieden werden: Obwohl es Überschnei- dungen zwischen den beiden Phänomenen gibt, sind Rückschlüsse nur sehr beschränkt möglich.8 Da es keine einzelne beste Methode gibt, um die Höhe der Steuerausfälle zu schätzen,9 gilt es vielmehr einen wirksamen Gesamtrahmen zu erschaffen. Dieser sollte alle potenziellen Steuerzahler, alle potenziell zu versteuernden Aktivitäten sowie alle Formen der steuerlichen Nichtkonformität erfassen, dabei jedoch Überlappungen der verschiedenen Komponenten vermeiden.10 Folglich – und da jegliche Schätzungen im Idealfall als Annäherungen zu betrachten und mit 8 Vgl. OECD (2002, S. 140-146). 9 OECD (2008). 10 IMF (2013). Friedrich Schneider Professor für Volkswirtschaftslehre, Johannes Kepler Universität in Linz. 7 Schneider (2015a, 2015b) kombiniert beispielsweise das MIMIC-Verfahren und den Bargeldansatz, um den Umfang der Schattenwirtschaft und dessen Entwicklung zu schätzen; siehe Schneider (2015a) für Ausführungen zu den beiden Methoden. Vorsicht zu geniessen sind – sollten Makro-, Mikro- und Datenquellen-Methoden kombiniert werden. Dies gestattet, die resultierenden Zahlen auf Konsistenz hin zu überprüfen und die Steuerhinterziehung möglichst vollständig – im Rahmen des Möglichen – zu erfassen.11 Die Tax-Gap-Schätzungen durch die Steuerbehörden in Dänemark12, Schweden13, Grossbritannien14 und den USA15 zeugen von der Relevanz, die Steuerlücke zu analysieren, und vom Nutzen, dabei mehrere Methoden zu kombinieren. 11 Schmutz (2015). 12 Vgl. z. B. SKAT (2009). 13 Vgl. Skatteverket (2008). 14 Vgl. HM Revenue & Customs (2013). 15 Vgl. Black et al. (2012). Christoph A. Schaltegger Professor (Ordinarius) für Politische Ökonomie an der Universität Luzern und Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft und Finanzrecht der Universität St. Gallen. Felix Schmutz Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft und Doktorand am ökonomischen Seminar der Universität Luzern. Literatur Black, Theodore, Kim Bloomquist, Edward Emblom, Andrew Johns, Alan Plumley und Esmeralda Stuk (2012). Federal Tax Compliance Research: Tax Year 2006 Tax Gap Estimation, IRS Research, Analysis & Statistics Working Paper. Bundesrat (1962). Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung zur Motion Eggenberger betreffend wirksamere Bekämpfung der Steuerdefraudation (vom 25. Mai 1962), Bundesblatt, 114(23), 1057–1117. Bundesrat (1974). Kleine Anfrage Eggenberger vom 27. November 1973: Steuerdefraudation, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, 1, 17/18. Cohn, Gustav (1884). Die Steuerreform im Kanton Zürich und der Bundeshaushalt der Schweiz, Georg Schanz, separate Publikation Finanz-Archiv, 1(1), Stuttgart: J.G. Cotta’schen Buchhandlung. Feld, Lars P. und Bruno S. Frey (2004). Illegal, Immoral, Fattening or What?: How Deterrence and Responsive Regulations Shape Tax Morale, Volkswirtschaftliche Beiträge, 26/2004, Philipps-Universität Marburg. Gemmell, Norman und John Hasseldine (2012). The Tax Gap: A Methodological Review, Working Papers in Public Finance 09/2012, Victoria University of Wellington. Howald, Stefan (2010). Eine ressentimentgeladene Einstellung provozieren. Kurzer Abriss über Versuche, die einheimische Steuerhinterziehung in der Schweiz zu berechnen, www.stefanhowald.ch/pdf/ texte/11/Denknetz_Steuerhinterziehung_ Juni11.pdf (21.08.2014). HM Revenue und Customs (2013). Measuring Tax Gaps 2013 Edition: Tax Gap Estimates for 2011–12. IMF (2013). United Kingdom: Assessment of HMRC’s Tax Gap Analysis, by Juan Toro, Kentaro Ogata, Eric Hutton and Selcuk Caner, IMF Country Report No. 13/314. OECD (2002). Measuring the Non-Observed Economy: A Handbook, Paris. OECD (2008). Monitoring Taxpayers’ Compliance: A Practical Guide Based on Revenue Body Experience, Final Report, Centre for Tax Policy and Administration (CTPA). Schaltegger Christoph A. und Schneider Friedrich (2005). Schattenwirtschaft: Ausmass, Gründe und Konsequenz für die Finanzpolitik, Arbeitspapier, Johannes-Kepler-Universität Linz; Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV. Schmutz, Felix (2015) Measuring the Invisible: An Overview of and Outlook for Tax Non-Compliance Estimates and Measurement Methods for Switzerland, Preprint (February 2015), University of Lucerne. Schneider, Friedrich (2015a). Schattenwirtschaft und Schattenarbeitsmarkt: Die Entwicklungen der letzten 20 Jahre, in: Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Band 16, Heft 1. Schneider, Friedrich (2015b). Der Einfluss der Wirtschaftslage auf die Schattenwirtschaft in Deutschland und anderen OECD-Staaten in 2015: Kein einheitliches Bild. Schneider, Friedrich und Enste, Dominik (2000). Shadow Economies: Sizes, Causes and Consequences, The Journal of Economic Literatur, 38/1, pp. 77–114. SKAT (2009). Compliance with Tax Rules by Businesses in Denmark: Tax year 2006. Skatteverket (2008). Tax Gap Map for Sweden: How Was It Created and How Can It Be Used?, Report 2008:1B, Swedish National Tax Agency. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 69 ZAHLEN Infografik – Entwicklung privater und staatsnaher Dienstleistungssektor Die Zahl der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor ist zwischen 2010 und 2014 um gut acht Prozent auf 3,65 Millionen gestiegen. Das sind 277 000 zusätzliche Angestellte im Dienstleistungssektor – 127 000 im staatsnahen und 150 000 im privaten Bereich. Die Zunahme der Erwerbstätigkeit fiel damit in den letzten vier Jahren rund doppelt so stark aus wie im ersten und zweiten Sektor, welche um insgesamt 3,9 % wuchsen. Im Jahr 2010 arbeiteten 69,1 % im privaten Dienstleistungsbereich (z. B. Handel, Banken, Versicherungen, Gastgewerbe, Beratung) und 30,9 % im staatsnahen Bereich (öffentliche Verwaltung, Erziehung und Unterricht sowie Gesundheits- und Sozialwesen). Im Jahr 2014 haben sich die Anteile im Vergleich dazu zugunsten des staatsnahen Dienstleistungssektors verschoben (siehe Kuchendiagramm). Der Anteil der Erwerbstätigen im staatsnahen Dienstleistungssektor stieg um 1,5 Prozentpunkte auf 32,4 Prozent. Tertiärer Sektor staatsnaher Dienstleistungssektor privater Dienstleistungssektor 67,6 % 2,47 Mio. Erwerbstätige 32,4 % 1,18 Mio. Erwerbstätige 2014 Entwicklung der Erwerbstätigkeit (saisonbereinigt) im privaten und staatsnahen Dienstleistungsbereich 15 Veränderung der Erwerbstätigenzahlen, in % 12,5 10 7,5 5 2,5 0 öffentliche Verwaltung Private Dienstleistungen Erziehung und Unterricht 20 14 20 13 20 12 20 11 20 1 0 –2,5 Gesundheits- und Sozialwesen Bei den staatsnahen Dienstleistungen wächst die Erwerbstätigkeit in erster Linie im Gesundheitsund Sozialwesen sowie im Bereich Erziehung und Unterricht kräftig. In der öffentlichen Verwaltung entwickelt sich die Erwerbstätigkeit insgesamt ähnlich wie im privaten Dienstleistungsbereich. 70 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 BFS, SECO Wirtschaftskennzahlen Auf einen Blick finden Sie hier die Kennzahlen Bruttoinlandprodukt, Arbeitslosenquote und Inflation von sieben Ländern, der EU und der OECD. Zahlenreihen zu diesen Wirtschaftszahlen sind auf der Internetseite www.dievolkswirtschaft.ch aufgeschaltet. Bruttoinlandprodukt: Reale Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Bruttoinlandprodukt: Reale Veränderung in % gegenüber dem Vorquartal1 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 Schweiz 2,0 Schweiz 0,4 0,3 0,6 0,6 Deutschland 1,6 Deutschland 0,8 –0,1 0,1 0,7 Frankreich 0,4 Frankreich 0,0 –0,1 0,3 0,1 Italien –0,4 Italien –0,1 –0,2 –0,1 0,0 Grossbritannien 2,6 Grossbritannien 0,7 0,8 0,7 0,5 EU 1,3 EU 0,4 0,2 0,3 0,4 USA 2,4 USA –0,5 1,1 1,2 0,5 Japan 0,0 Japan 1,3 –1,6 –0,7 0,4 China 7,4 China 1,5 2,0 1,9 1,5 OECD 1,8 OECD 0,2 0,4 0,6 0,5 Bruttoinlandprodukt: In Dollar pro Einwohner 2013 (PPP*) Arbeitslosenquote: in % der Erwerbstätigen, Jahreswert 2013 Arbeitslosenquote: in % der Erwerbstätigen, Quartalswert1 2014 4/2014 Schweiz 56940 Schweiz 4,5 Schweiz 4,3 Deutschland 43108 Deutschland 5,0 Deutschland 4,9 Frankreich 37556 Frankreich 10,2 Frankreich 10,5 Italien 34836 Italien 12,7 Italien 13,0 Grossbritannien 38256 Grossbritannien 6.2 Grossbritannien 5,6 EU 35211 EU 10,2 EU 10,0 USA 52985 USA 6,2 USA 5,7 Japan 36225 Japan 3,6 Japan 3,5 China 11874 China – China – OECD 37871 OECD 7,3 OECD 7,1 * kaufkraftbereinigt Inflation: Veränderung in % gegenüber dem ­Vorjahresmonat 2014 Februar 2015 0,0 Schweiz 0,9 Deutschland Frankreich 0,5 Frankreich –0,3 Italien 0,2 Italien –0,1 Grossbritannien 1,5 Grossbritannien 0,0 EU – EU –0.2 USA 1,6 USA 0,0 Japan 2,7 Japan 2,2 China 2,0 China 1,4 OECD 1,7 OECD 0,6 Schweiz Deutschland –0,8 0,1 SECO, BFS, OECD Inflation: Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr www.dievolkswirtschaft.ch d Zahlen 1 Saisonbereinigt und arbeitstäglich bereinigte Daten. Die Volkswirtschaft 5 / 2015 71 CARTOON 72 Die Volkswirtschaft 5 / 2015 VORSCHAU 88. Jahrgang Nr. 1/2015 sFr. 12.– Die Volkswirtschaft Plattform für Wirtschaftspolitik 88e année N° 5 /2015 88. Jahrgang Nr. 1/2015 sFr.Frs. 12.–12.– 88. Jahrgang Nr. 1/2015 sFr. 12.– La économique DieVie Volkswirtschaft Die Volkswirtschaft STRUKTURPOLITIK FINANZPOLITIK ARBEITSMARKT STANDORTFÖRDERUNG Vertiefte Zusammenarbeit der Wettbewerbsbehörden zwischen der Schweiz und der EU 13 Die Unternehmenssteuerreform III ist ein komplexes Grossprojekt 15 Die Arbeitsbeteiligung älterer Erwerbstätiger ist ausbaufähig 19 Strukturwandel fordert die Grossregion Ostschweiz heraus 66 Plateforme de politique économique Plattform für Wirtschaftspolitik Plattform für Wirtschaftspolitik STRUKTURPOLITIK FINANZPOLITIK ARBEITSMARKT STANDORTFÖRDERUNG STRUKTURPOLITIK FINANZPOLITIK ARBEITSMARKT STANDORTFÖRDERUNG Vertiefte Zusammenarbeit Die UnternehmenssteuerDie Arbeitsbeteiligung Strukturwandel fordert Vertiefte Zusammenarbeit Die UnternehmenssteuerArbeitsbeteiligung fordert der Wettbewerbsbehörden reform III ist ein komplexes Die älterer Erwerbstätiger ist Strukturwandel die Grossregion Ostschweiz der Wettbewerbsbehörden ein komplexes älterer Erwerbstätiger die Grossregionheraus Ostschweiz zwischen der Schweiz reform III istGrossprojekt ausbaufähigist zwischen der Grossprojekt ausbaufähig heraus 66 undSchweiz der EU 15 19 und der EU 15 19SCHWERPUNKT 66 13 13 Europa: Quo vadis? SCHWERPUNKT SCHWERPUNKT Europa: Europa: Quo vadis? Quo vadis? 88. Jahrgang Nr. 1/2015 sFr. 12.– Die Volkswirtschaft 88. Jahrgang Nr. 1/2015 sFr. 12.– 88. Jahrgang Nr. 1/2015 sFr. 12.– Plattform für Wirtschaftspolitik DieVolkswirtschaft Volkswirtschaft Die Plattform Wirtschaftspolitik Plattform fürfür Wirtschaftspolitik FINANZPOLITIK ARBEITSMARKT STRUKTURPOLITIK STANDORTFÖRDERUNG Vertiefte Zusammenarbeit Die UnternehmenssteuerDie Arbeitsbeteiligung Strukturwandel fordert der Wettbewerbsbehörden reform III ist ein komplexes älterer Erwerbstätiger ist die Grossregion Ostschweiz FINANZPOLITIK ARBEITSMARKT STANDORTFÖRDERUNG zwischen der Schweiz Grossprojekt ausbaufähig heraus 66 STRUKTURPOLITIK STRUKTURPOLITIK FINANZPOLITIK ARBEITSMARKT STANDORTFÖRDERUNG Vertiefte Zusammenarbeit Die UnternehmenssteuerDie Arbeitsbeteiligung Strukturwandel fordert Vertiefte Zusammenarbeit Arbeitsbeteiligung fordert und der EUDie Unternehmenssteuer19 Grossregion der Wettbewerbsbehörden reform III ist ein komplexes15 Die älterer Erwerbstätiger ist Strukturwandel die Ostschweiz der Wettbewerbsbehörden ein komplexes älterer Erwerbstätiger die Grossregionheraus Ostschweiz 13 reform III istGrossprojekt zwischen der Schweiz ausbaufähigist zwischen der Grossprojekt ausbaufähig heraus 66 undSchweiz der EU 15 19 und der EU 15 19 66 13 13 SCHWERPUNKT SCHWERPUNKT SCHWERPUNKT Europa: Europa: Europa: Quo vadis? Quo vadis? Quo vadis? Wichtiger HINWEIS ! Wichtiger HINWEIS ! Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf Wichtiger HINWEIS ! Rahmen) Innerhalb der Schutzzone (hellblauer darf werden! kein anderes Element platziert kein anderes Element Rahmen) platziert werden! Innerhalb der Schutzzone (hellblauer darf Ebenso darf der Abstand zu Formatresp. Papierrand kein anderes Element platziert werden!resp. Ebenso darf der Abstand zu FormatPapierrand die Schutzzone nicht verletzen! die Schutzzone Ebenso darf der Abstand zu Format-nicht resp. verletzen! Papierrand die Schutzzone nicht der verletzen! Hellblauen Rahmen Schutzzone drucken! nie drucken! Hellblauen Rahmen dernie Schutzzone Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken! Siehe auch Handbuch Siehe auch Handbuch „Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ „Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ Siehe auch Handbuch Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone „Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone www. Kapitel „Grundlagen“, 1.5cdbund.admin.ch / Schutzzone www. cdbund.admin.ch www. cdbund.admin.ch SCHWERPUNKT Wichtiger HINWEIS ! Wichtiger HINWEIS ! Rahmen) darf Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Energie- und Klimapolitik: lenken statt subventionieren kein anderes Element Rahmen) platziert werden! Innerhalb der Schutzzone (hellblauer darf kein anderes Element platziert werden!resp. Papierrand Ebenso darf der Abstand zu Format- die Schutzzone Ebenso darf der Abstand zu Format-nicht resp. verletzen! Papierrand die Schutzzone nicht der verletzen! Hellblauen Rahmen Schutzzone nie drucken! Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken! Wichtiger HINWEIS ! Siehe auch Handbuch „Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ Siehe auch Handbuch Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone „Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf www. Kapitel „Grundlagen“, 1.5cdbund.admin.ch / Schutzzone www. cdbund.admin.ch kein anderes Element platziert werden! Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand die Schutzzone nicht verletzen! Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken! Siehe auch Handbuch „Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone www. cdbund.admin.ch Die zweite Etappe der Energiestrategie 2050 ist eröffnet. Der Verfassungsartikel dazu befindet sich in der Vernehmlassung. Die Klima- und Energiepolitik sollen gemeinsam neu ausgerichtet werden. Ab 2021 wird das heutige Fördersystem schrittweise überführt in ein Lenkungssystem. Vorgesehen sind Abgaben auf Brenn-, Treibstoffen und Strom. Ziel ist eine Verminderung der Treibhausgasemissionen und die effiziente und sparsame Nutzung von Energie. Was gilt es bei der Ausgestaltung der Abgaben zu berücksichtigen? Wie werden die Erträge an die Haushalte und Unternehmen rückverteilt? Welche Fehler gibt es zu vermeiden? Lesen Sie mehr dazu in der nächsten Ausgabe. Welche Rolle spielt der Staat bei der Lösung der Klimaprobleme? Damien Vacheron, SECO Mit intelligenter Lenkung Klima- und Energieziele erreichen Martin Baur, EFV, Matthias Gysler, BFE und Isabel Junker, BAFU Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen und Verteilungseffekte eines Lenkungssystems André Müller, Ecoplan und Christoph Böhringer, Uni Oldenburg Internationale Erfahrungen mit Umweltabgaben – ein Überblick Patrick Brink und Sirini Withana, IEEP, Brüssel Klimapolitik post 2020 – welche Interdependenzen bestehen zur Lenkungsabgabe? Isabel Junker und Roman Ramer, BAFU Auf dem Weg aus dem Kohlenstoff Phillippe Thalmann und Marc Vielle, EPFL Sind die Reduktionsziele aus ökonomischer Sicht richtig gewählt? Patrick Koch, IWSB Was die Schweiz von der deutschen Energiewende lernen kann Andreas Löschel, Universität Münster Zuckerbrot, Peitsche und Predigt – ein politikwissenschaftlicher Blick auf die Lenkungsabgabe Andreas Balthasar, Interface Politikstudien Forschung Beratung