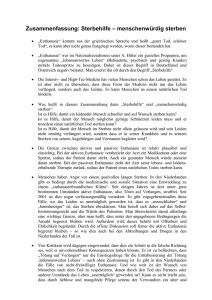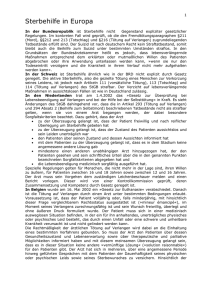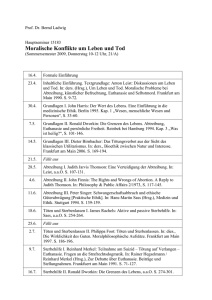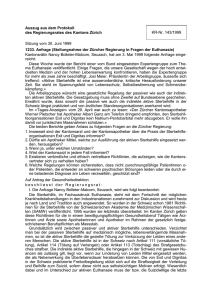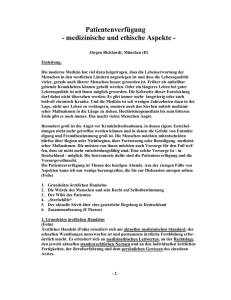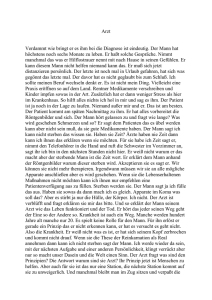PDF-Download - Zentrum für Medizinische Ethik
Werbung
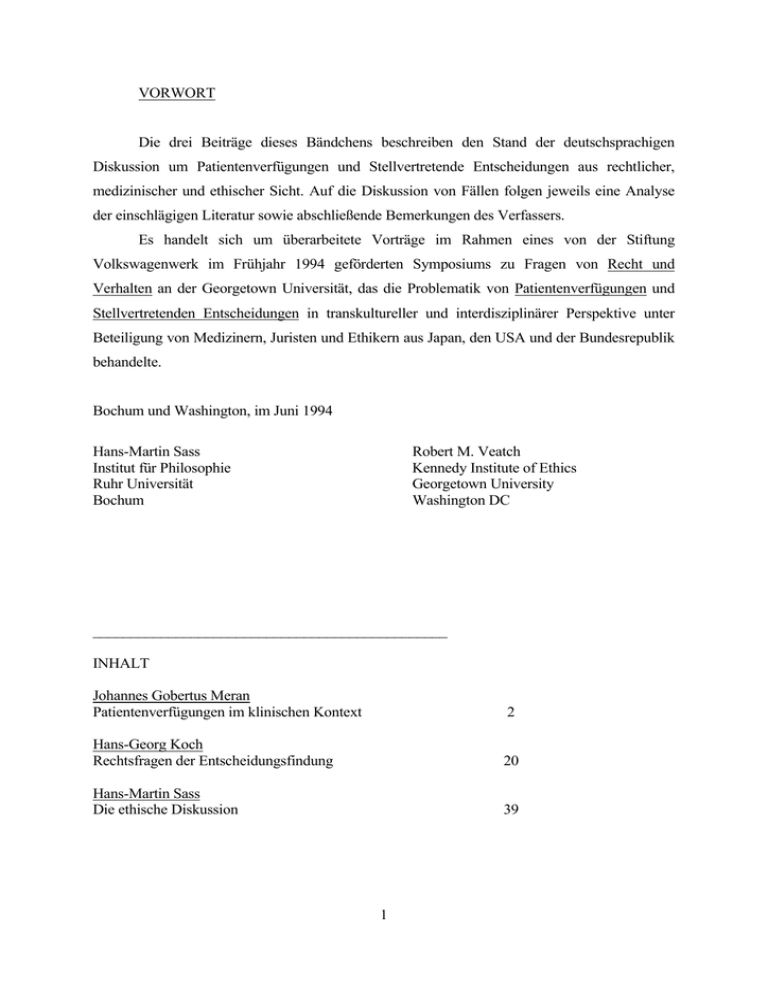
VORWORT Die drei Beiträge dieses Bändchens beschreiben den Stand der deutschsprachigen Diskussion um Patientenverfügungen und Stellvertretende Entscheidungen aus rechtlicher, medizinischer und ethischer Sicht. Auf die Diskussion von Fällen folgen jeweils eine Analyse der einschlägigen Literatur sowie abschließende Bemerkungen des Verfassers. Es handelt sich um überarbeitete Vorträge im Rahmen eines von der Stiftung Volkswagenwerk im Frühjahr 1994 geförderten Symposiums zu Fragen von Recht und Verhalten an der Georgetown Universität, das die Problematik von Patientenverfügungen und Stellvertretenden Entscheidungen in transkultureller und interdisziplinärer Perspektive unter Beteiligung von Medizinern, Juristen und Ethikern aus Japan, den USA und der Bundesrepublik behandelte. Bochum und Washington, im Juni 1994 Hans-Martin Sass Institut für Philosophie Ruhr Universität Bochum Robert M. Veatch Kennedy Institute of Ethics Georgetown University Washington DC _______________________________________________ INHALT Johannes Gobertus Meran Patientenverfügungen im klinischen Kontext 2 Hans-Georg Koch Rechtsfragen der Entscheidungsfindung 20 Hans-Martin Sass Die ethische Diskussion 39 1 PATIENTENVERFÜGUNG UND STELLVERTRETENDE ENTSCHEIDUNG IM KLINISCHEN KONTEXT Johannes Gobertus Meran VORBEMERKUNG: THERAPIEENTSCHEIDUNG UND SELBSTBESTIMMUNG DES PATIENTEN: Therapieentscheidungen gehören zu den schwierigsten und wichtigsten Aufgaben des Arztes. Sie sind jedoch nicht allein ärztliche Sache, sondern in idealer Weise das Ergebnis eines konstruktiven Dialogs zwischen Patient und Arzt. Neben dem speziellen physiologischen Krankheitsbild und dessen Behandlungsmöglichkeiten, sollen auch die persönlichen Prioritäten und Wertvorstellungen des Patienten sowie seine psychosoziale Situation mit ausschlaggebend sein. [20] Diese letztgenannten individuellen Entscheidungsgrundlagen sind jedoch nur vom Patienten selbst evaluierbar. Er muß sich zwar des ärztlichen Expertenrates bedienen, jedoch die getroffene Entscheidung und deren Folgen im Wesentlichen selbst tragen. Man spricht in den letzten Jahren von einem Paradigmenwechsel in der Arzt-Patient-Beziehung. Der väterlich fürsorgende Arzt werde zunehmend abgelöst vom partnerschaftlichen Experten, der den Patienten nach bestem Wissen und Gewissen berät, ihm aber die Freiheit lassen sollte, zwischen verschiedenen Optionen auszuwählen. Damit ist aber die letztlich asymetrische Grundfigur vom Leidenden und Helfer nicht aufgehoben. Der Patient bleibt angewiesen auf die Hilfe und ist vom Rat des Arztes abhängig. Die Autonomie und der tatsächliche Einfluß des Patienten auf seine Behandlung ist zumindest in Deutschland wahrscheinlich viel geringer als angenommen. Juristisch ist jedoch die Kompetenzverteilung klar gefaßt: Voraussetzung jeder Therapie ist die Zustimmung des Patienten, der über Alternativen, Nebenwirkungen und Komplikationen ausreichend aufgeklärt werden muß. [5, 6, 15] "Informed Consent" ist dementsprechend Bestandteil jedes Therapieprotokolls. Hierbei ist wichtig zu erkennen, daß die Zustimmung zu einem ärztlichen Therapievorschlag eine andere Qualität der Autonomie hat, als die eigenständige Auswahl von verschiedenen Optionen. Das Verhalten der Ärzte Bei den meisten Patienten, die im Krankenhaus aufgenommen werden, sind Entscheidungen zu treffen ob eine Therapie begonnen, erweitert, begrenzt oder beendet werden 2 soll. Leitlinie für diese Entscheidungen ist neben dem Auftrag des Patienten, dem Therapiewunsch, hauptsächlich die Prognose. Hierbei ist ein bemerkenswerter und charakteristischer Unterschied im Aufklärungsverhalten der Ärzte festzustellen: Während tendentiell Therapiebeginn und Eskalation einer Therapie, beides eher positiv belegt und mit Hoffnung verbunden, mit dem Patienten besonders ausführlich besprochen werden, erfolgt die Aufklärung über Therapiebegrenzung und Therapieabbruch eher zurückhaltend. [8, 16] Visiten und Gespräche mit Sterbenden werden meist immer kürzer und seltener. Wie H.-J. Schmoll es formulierte: "Der soziale Tod des Sterbenden eilt dem biologischen Tod schon weit voraus." [21] Die Information eines Patienten, daß für ihn eine Anweisung besteht keine Reanimation zu versuchen, dürfte die Ausnahme sein. Eine unlängst in Holland durchgeführte Studie zu dieser Frage ergab, daß nur 14% der Patienten an der Entscheidung dieser Frage beteiligt werden. [3] Man kann davon ausgehen, daß dieser Prozentsatz in Deutschland noch geringer ist. Verständlicherweise besteht eine psychologische Barriere jemandem mitzuteilen, daß weitere Therapie sinnlos erscheint, und daß man die Weisung gegeben hat, im Falle eines Herzstillstandes auf Wiederbelebungsmaßnahmen zu verzichten. Hier besteht ein Tabubereich, der von Arzt und Patient gleichermaßen gemieden wird. [8,16] Dilemmata der Therapieentscheidungen Die Problematik liegt nicht in den gut vorhersagbaren Verläufen - sondern vielmehr in den unvorhersagbaren, in denen das Risiko und der Nutzen weitgehend offene und wenig kalkulierbare Größen sind. So umfaßt die Risikoeinschätzung einer aggressiven Chemotherapie von gänzlicher Heilung bis akutem therapiebedingtem Tod alle Zwischenstufen von mehr oder weniger wünschenswerten Zuständen. Gleiches gilt für palliative Chemotherapie, abgesehen von der fehlenden Heilungsmöglichkeit und den zumeist geringeren Risiken der therapiebedingten Nebenwirkungen. Es geht hierbei nie um eine einfache Entscheidung, die ein für alle Mal getroffen wird, sondern um einen dynamischen Prozeß, der Veränderungen von körperlichem Zustand und Gefühlen, ebenso wie den Verlauf der Krankheit berücksichtigen muß, und sich als therapeutischer Weg entsprechend immer wieder neu den Erfordernissen anzupassen hat. a) Entscheidungskompetente Patienten Solange Patienten in der Lage sind mit dem Arzt zu kommunizieren und therapeutischen Optionen zuzustimmen oder sie abzulehnen, können sich Entscheidungen an ihrem autonomen Willen orientieren. Damit sind die Schwierigkeiten jedoch nicht behoben. Die Zustimmung zu 3 einer Therapie (der Informed consent) setzt die Fähigkeit zu kompetenter Entscheidung nach ausreichender Information voraus. Informationsdefizite: Der Informationsfluß zwischen Arzt und Patient ist eine Frage der Kommunikation. In einer Studie in Hannover fanden wir heraus, daß nur ein kleiner Teil der gegebenen Information wirklich aufgenommen und vom Patienten auch gemerkt werden kann. Selbst bei einfachen diagnostischen Eingriffen, wie etwa der Bronchoskopie waren über 50% der geschilderten Risiken innerhalb von 30 Minuten vergessen. Sobald schwierigere Therapieformen erklärt werden müssen, ist anzunehmen, daß nur Bruchteile wirklich verstanden und verarbeitet werden können. Daher sollte Aufklärung auch ein Prozeß sein, der den jeweiligen Informationsbedürfnissen des Patienten anzupassen ist und sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Schwierigkeiten der Entscheidungskompetenz: Die Entscheidungsfähigkeit eines schwerkranken Patienten ist eigentlich immer eingeschränkt, allein schon aufgrund von bestehender Angst, Schmerzen, Depression und Hilflosigkeit. Hinzu kommen Probleme, all die komplexen medizinischen Sachverhalte zu verstehen und gewichten zu können. b) Entscheidungsunfähige Patienten Manchmal stehen schwerwiegende Entscheidungen über Fortsetzung, Eskalation oder Absetzen therapeutischer Maßnahmen gerade dann an, wenn der Patient in einem Zustand ist, der seine Mitwirkung nicht mehr zuläßt. Das Korrektiv durch den Patientenwillen fehlt, und dies führt häufig zu einem Tutiorismus, einem Sicherheits- oder Absicherungsdenken, das Entscheidungen an den jeweiligen Oberarzt oder Chefarzt delegiert und von dessen eigenen Vorstellungen abhängt. Angehörige sind aufgrund ihrer Betroffenheit in der Mehrzahl der Fälle kaum in der Lage, an den Entscheidungen wesentlich teilnehmen zu können. Die Unsicherheit gerade von unerfahrenen Ärzten, ob und bis zu welcher Grenze therapeutische Maßnahmen gehen sollen, wächst proportional zu dem Unvermögen von Patienten sich an dem Entscheidungsprozeß in welcher Form auch immer zu beteiligen. 1. FÄLLE AUS DER KLINISCHEN PRAXIS 1.1. Ein junger Mann, Leukämiepatient im Rezidiv, wurde bewußtlos auf die Intensivstation gebracht. Jede weitere Chemotherapie hätte die bereits nicht mehr ausreichende Blutbildung zusätzlich reduziert und den schweren Infektionen mit Bakterien und Pilzen 4 Vorschub geleistet. Dieser Patient, Vater von drei kleinen Kindern, hatte sich zuvor schweren Herzens zur erneuten Behandlung im Krankenhaus entschieden, um jede mögliche Chance zu nützen. Die hoffende Familie wollte, daß alles mögliche getan werde. Während der Zustand des Patienten sich täglich verschlechterte und neben den Infektionen auch Lähmungen und epileptische Krämpfe als Zeichen einer Beteiligung auch des Gehirns auftraten, mußte er zusätzlich mehrfach reanimiert werden und benötigte hohe Dosen kreislaufstützender Medikamente. Aufgrund der anwesenden Ehefrau, die als Vertretung seines Willens zwar nicht offiziell benannt aber akzeptiert war, und des vorbekannten Therapiewunsches des Patienten wurden weitere Wiederbelebungsversuche mit elektrischer Defibrillation, künstlicher Beatmung und eine umfangreiche antibiotische Behandlung durchgeführt. Das erfahrene Pflegepersonal und auch die behandelnden Ärzte hielten diese weitere Therapie für sinnlos. Die Frage ob der Patient selbst in diesem nicht vorhersehbaren Zustand noch weiter der extensiven Therapie hätte ausgesetzt sein wollen war nicht zu klären. Auch eine noch so genaue Patientenverfügung hätte dieses Dilemma nicht gelöst. 1.2. Ein Professor der Klinik wurde mit einem soliden, metastasierenden Krebsleiden im Endstadium auf die Intensivstation genommen. Er hatte einen Brief bei sich, der festlegte, daß eine außerordentliche Therapie über das vernünftige Maß hinausgehend nicht stattfinden sollte. An der eigentlichen Behandlung änderte sich zwar durch die Verfügung nichts, aber eine Gesprächsbasis für ein vertrauensvolles Verhältnis war gegeben. Darüberhinaus hatte er einen letzten Willen verfaßt, der aus Ratschlägen für seine Familie und ärztliche Kollegen sowie aus konkreten Wünschen hinsichtlich seiner Beerdigung bestand. 1.3. Eine Patientin mit Rheumatoider Arthritis und Diabetes Mellitus wurde auf eine internistische Normalstation eingeliefert um medikamentös neu eingestellt zu werden. Im Rahmen des Aufnahmegespräches ging sie zunächst nicht auf ihre aktuellen Beschwerden ein, sondern zeigte mir ein Patiententestament (Patientenverfügung der OMEGA) und erklärte, was sie nicht wollte: Nämlich auf einer Intensivstation an vielen Schläuchen hängend qualvoll am Sterben gehindert zu werden. Für diese Patientin war die Patientenverfügung ein Anknüpfungspunkt um über tabuisierte Fragen ins Gespräch zu kommen und Ängste abzubauen. 1.4. Eine 22jährige Chemiestudentin wurde unter Reanimationsbedingungen in die Notaufnahme gebracht. Sie hatte sich mit Cyankali vergiftet und einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem sie angab, daß ihr Leben nach dem Tod ihres Freundes durch einen 5 Autounfall keinen Sinn mehr habe. Sie bat dies zu verstehen. Trotz 2 Stunden Reanimationsbemühungen mit Magenauspumpen, künstlicher Beatmung, Herzmassage und Katecholaminen konnte sie nicht gerettet werden. Hätte man ihren Wunsch von Anfang an akzeptieren und auf Wiederbelebungsmaßnahmen verzichten sollen? 2. LITERATURÜBERSICHT UND MEDIZINISCHE PROBLEMATIK Vergleicht man im Hinblick auf Patientenverfügungen und Stellvertreter-Entscheidungen die amerikanische mit der deutschsprachigen Literatur, so fallen zwei wesentliche Unterschiede auf: Erstens ist die Diskussion dieser Themen in Deutschland und Österreich weitestgehend auf juristische Publikationen beschränkt [e.g. 1, 5, 7, 15, 22, 23]. E. Bernat hat sicherlich Recht, wenn er darauf hinweist, daß hierzulande vor allem die strafrechtlichen Pflichten des Arztes im Mittelpunkt stehen, während es in den USA die Rechte der Patienten sind, besonders hinsichtlich des Selbstbestimmungsrechtes, des Rechtes auf Privatsphäre und auf den eigenen Tod. Der zweite große Unterschied besteht in der Tatsache, daß bei uns Patientenverfügungen und Stellvertreterbevollmächtigungen kaum in der Praxis genützt werden, und daher auch weitestgehend unbekannt sind. Eine Umfrage an unserer Klinik ergab, daß weniger als ein Drittel aller Kollegen überhaupt jemals mit einer Patientenverfügung persönlich Kontakt hatten. Beinahe alle stimmten überein, daß es hilfreich sei, wenn ein Patient eine Verfügung getroffen hat. Interessanterweise gaben aber diejenigen Kollegen, die bereits Kontakt mit Verfügungen hatten, an, daß diese auch problematisch seien, gerade dann nämlich wenn der schriftlich geäußerte Willen der medizinischen Einschätzung und Empfehlung entgegenstand. Zusätzlich ergab die Untersuchung, daß eine verbreitete Unsicherheit hinsichtlich rechtlicher Verbindlichkeit dieser Schriftstücke besteht. Die Mehrzahl der befragten Ärzte sagte, daß die Verfügung ein wichtiger Hinweis für den Willen des Patienten sei, aber keine absolute Verpflichtung darstelle. Sofern in unklaren Situationen rasches Handeln nötig sei, wenn etwa eine Reanimation nötig wäre, so war überwiegend die Meinung, daß erst gehandelt werden sollte. Nur wenige Ärzte gaben an, daß die Verfügungen ihre therapeutischen Entscheidungen beeinflußt hätten. Auch R. Füllmich betont, daß sich in Deutschland die Diskussion um das Patiententestament auf die Frage konzentriert, ob es den Arzt rechtlich bindet oder nicht. Drei verschiedene Rechtsmeinungen werden vertreten: [7] cf [5, 22]: 6 a) Die Patientenverfügung ist ein Anhaltspunkt für den Willen des Patienten, hat aber keinerlei Bindungswirksamkeit. b) Die Patientenverfügung hat absoluten Bindungscharakter, solange sie nicht widerrufen ist. c) Die Patientenverfügung hat relative Bindungswirkung, nämlich immer dann, wenn eine Situation genau vorbeschrieben ist und die Konsequenzen bekannt sind. Typisch für die juristisch ungelösten Fragen sind auch die Gerichtsurteile. Die populärste Entscheidung ist der sogenannte Wittig-Fall. Auf Grundlage einer formlosen Verfügung, nämlich eines Briefes mit dem Inhalt: "Ich will zu meinem Peterle" und der langjährigen Kenntnis der Patientin respektierte Dr. Wittig den Suizid-Wunsch und verzichtete, als er zu der komatösen Patientin kam, auf Wiederbelebungsversuche. Das Gericht ging auf die Fragen der Gültigkeit des Abschiedsbriefes als Verfügung oder die Wertigkeit einer Verfügung per se gar nicht ein. Der Arzt wurde von unterlassener Hilfeleistung mit der Begründung freigesprochen, daß der Zustand der Patientin den Erfolg einer Reanimation unwahrscheinlich sein ließ und ein bereits bestehender gravierender Hirnschaden anzunehmen war. [5, 7, 9] Insgesamt ist es somit nicht überraschend, daß die deutschsprachige Literatur zu Patientenverfügungen und Stellvertreterentscheiden weitestgehend von Juristen stammt. Nur einige wenige Ärzte haben sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. [8, 10-12, 19, 20] Entstehung der Patientenverfügungen Die große Mehrzahl der Patienten kommt in ein Krankenhaus um Hilfe zu suchen und ist mit der Behandlung weitestgehend einverstanden, und zwar auch ohne zusätzliche Absicherung, daß ihr Willen befolgt werde. Dennoch bestehen auch Ängste, vor allem für die Zeit, in der sie nicht mehr in der Lage sind, den eigenen Willen zu äußern. Interessanterweise unterscheiden sich die Inhalte der Ängste von potentiell Kranken, die noch in guter körperlicher Verfassung sind gravierend von denen sterbender Patienten. Sterbende fürchten einerseits ihren nächsten Verwandten eine Bürde zu werden, andererseits von ihnen getrennt sein zu müssen. Daneben haben sie die verständliche Sorge vor Schmerzen und einem leidvollem Sterben. [8, 16] Patienten, deren Tod noch weit entfernt scheint, haben viel eher die Sorge, daß zuviel getan werden könnte. Nicht ganz zu Unrecht fürchten manche dieser potentiellen Patienten, einer Übertherapie ausgesetzt zu werden. Jeder in der Klinik weiß um gewisse Mechanismen, die, sind sie einmal begonnen, nur schwer rückgängig gemacht werden können (z.B. Beatmung). Doch es gibt, wenn auch seltener, auch die gegenteilige Befürchtung, daß nämlich zu wenig getan würde, 7 und aus Altersgründen oder ökonomischen Erwägungen eine Therapie demjenigen vorenthalten wird, der sie nicht mehr einfordern kann. [14] Vor allem die leichter Kranken und "bedingt Gesunden" haben Ängste vor medizinischer Technik und Intensivmedizin als einer Athmosphere der Unpersönlichkeit und Anonymität, sowie vor dem Gefühl, ein "Fall" zu sein. Diese Gefühle werden von den akut und schwer Kranken meist nicht geteilt, die Intensivstationen meist eher als Beruhigung und Ort der Sicherheit erleben. [8, 10] M. v. Lutterotti wies darauf hin, daß der kritisierte medizinische Aktivismus in den meisten Fällen erst im Nachhinein als solcher erkannt wird - dann nämlich, wenn Mabnahmen vergeblich waren oder zu unerwünschten Ergebnissen führten. [10] Jeder mündige Patient soll und muß das Recht haben, seine medizinische Behandlung zu bestimmen, insbesonders lebenserhaltende Maßnahmen wie Beatmung und künstliche Ernährung auch ablehnen zu können. Eine Möglichkeit hierzu wären Patientenverfügungen oder die Bevollmächtigung von Stellvertretern. Wie die o.a. Fallberichte deutlich machen, wäre hierbei eine Differenzierung nach Patientengruppen bzw. Krankheitskollektiven sinnvoll, da je nach Krankheit unterschiedliche Ängste, Ansprüche und Bedürfnisse bestehen. Zumindest die folgenden Gruppen sollten unterschieden werden: 1) Tumorpatienten, 2) Chronische Patienten, 3) Akutpatienten (Herzinfarkt, Lungenembolie) und als eine grundsätzlich anders motivierte Gruppe 4) Suizidpatienten, die eine Verfügung als Mittel zur Ausführung ihrer Absicht einsetzen wollen. Die Situation in Deutschland und Österreich Die bei uns in verschiedenen Formen erst seit 16 Jahren angebotene und meist "Patiententestament" genannte, schriftliche Äußerung des Patientenwillens weist etwas einseitig auf einen Verzicht von lebenserhaltenden Maßnahmen hin. Genauso kann der legitime Wille eines Patienten aber auch dem Wunsch nach maximaler Therapie entsprechen, wie das äquivalente Schriftstück in den USA, bislang "Living Will" genannt, suggeriert. Doch auch dieses dokumentiert zumeist den Wunsch nach Behandlungsverzicht im Falle eines unheilbaren Leidens. Obwohl in der klinischen Realität überwiegend Ärzte die therapeutischen Entscheidungsträger sind, wird allein aufgrund der Gesetzeslage zumindest die formale Zustimmung der Patienten immer eingeholt. In Österreich ist jede Behandlung ohne Einwilligung des Patienten laut § 90 Strafgesetzbuch strafbar, außer der Aufschub der Behandlung führt zu einer ernstlichen 8 Gefährdung. Auch in Deutschland ist laut § 1a der Berufsordnung für deutsche Ärzte das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu achten und jede Behandlung einwilligungsbedürftig. Der eigenmächtige Eingriff in die körperliche Integrität ist sogar bei therapeutischem Erfolg als Körperverletzung gemäß § 223 Abs.1 Strafgesetzbuch strafbar. Eine spezifische Rechtsvorschrift für Patientenverfügungen wie in den USA wurde bislang nicht festgelegt - da der Wille des Patienten jedoch maßgeblich ist, wird eine glaubhaft gemachte Willensäußerung in schriftlicher Form von den behandelnden Ärzten, zumindest nicht grundlos, außer Acht gelassen werden. [5, 7, 11-13, 15, 22] Folgende Patientenverfügungen sind in Deutschland erhältlich: 1) Patientenverfügung von OMEGA e.V. Hierbei handelt es sich um ein kleines Ausweisblatt welches neben persönlichen Daten den Verzicht auf weiterführende extensive Behandlung fordert, wenn keine Aussicht auf Erfolg besteht. Weiter wird gefordert, daß Schmerzmedikation in ausreichender Form gegeben werden soll, auch wenn dadurch eventuell eine Lebensverkürzung herbeigeführt wird. Omega ist eine der ersten und wichtigsten Vereinigungen, die ambulante und stationäre Hospizprogramme betreuen. Schwerpunkte hierbei sind die Sterbebegleitung und Betreuung von Schwerstkranken möglichst in häuslicher Umgebung sowie die Unterstützung auch der Angehörigen. 2) Freundschaftsvertrag von OMEGA e.V. Mit diesem Vertrag verpflichtet sich ein "Freund", sei es ein Angehöriger oder sonstiger Vertrauter, den Patienten zu betreuen. Der "Freund" wiederum wird bevollmächtigt Informationen über den Gesundheitszustand zu erhalten und auf die ärztliche Behandlung im Sinne des Patienten Einfluß zu nehmen. 3) Wertanamnese und Betreuungsverfügung von H.-M. Sass und R. Kielstein Anhand kurzer kasuistischer Berichte werden 5 kritische Situationen in schwerer Krankheit beschrieben. Der narrative Charakter und die einfache Sprache ermöglicht es über diese Episoden nachzudenken und eine eigene Position zu formulieren. In einem zweiten Teil wird versucht, die Überlegungen in Direktiven zu übersetzen und deren Verbindlichkeit festzulegen. Ergänzend wird empfohlen einen Stellvertreter zu bevollmächtigen. 4) Patientenverfügung von DGHS e.V. (Formblatt A) 9 Diese Verfügung fordert ausreichende Schmerzbehandlung und die Einstellung der Therapie, wenn der unaufhaltsame Sterbeprozeß begonnen hat, bzw. keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewußtseins besteht. Zahlende Mitglieder erhalten dieses Formblatt und werden auch juristisch beraten. Als Bekräftigung dient eine Jahresmarke. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) vertritt die Forderung nach aktiver Sterbehilfe. Unter bestimmten Bedingungen gibt die Gesellschaft auch Anleitungen und konkrete Hilfen zum Suizid. 5) Freitodverfügung von DGHS e.V. Diese Verfügung erklärt, daß der Unterzeichnende Selbstmord begehen möchte und daher keine therapeutischen Maßnahmen wünscht. Für den Fall, daß dennoch eine Behandlung stattfindet, wird die DGHS bevollmächtigt, den Arzt und die Institution zu verklagen. 6) Patiententestament von W. Uhlenbruck Eine der ersten deutschsprachigen Verfügungen, die in juristischer Terminologie von einem Richter abgefaßt, bereits 1978 veröffentlicht wurde. 7) "Eine christliche Patientenverfügung" der Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern Diese kurze Patientenverfügung erklärt, daß der Inhaber seine Lebenszeit in Gottes Händen sieht. Aktive Sterbehilfe wird abgelehnt, und solange realistische Möglichkeiten bestehen, wird angemessene Therapie, zumal Schmerztherapie gewünscht. Jedoch soll nicht um jeden Preis das Leben verlängert, sondern eher ein friedliches Sterben unter christlichem Beistand ermöglicht werden. Ein Betreuer kann angeführt werden, der gerichtlich bestätigt, Zugang zu Informationen erhalten und auf Entscheidungen Einfluß nehmen soll. 8) Patientenanwalt-Verfügung von J. Hackethal Diese Verfügung entspricht weitgehend der Kalifornischen Advanced Directive, ist etwas kürzer und unterscheidet sich in zwei wichtigen Punkten. [7] Der Patient kann Entscheidungen auch delegieren, solange er noch kommunikations- und entscheidungsfähig ist, und der Widerruf der Verfügung bzw. Vollmacht muß schriftlich erfolgen. 9) "Persönliche Willenserklärung" der Ärztekammer Hamburg Inhaltlich weitgehend entsprechend der Patientenverfügung von Omega. Es wird jedoch empfohlen, den Text handschriftlich und persönlich modifiziert aufzusetzen. 10 3. ABSCHLIESSENDE ÜBERLEGUNGEN AUS MEDIZINISCHER SICHT 1. Bedeutung von Patientenverfügungen und Stellvertreter-Entscheidungen aus ärztlicher Sicht. In Deutschland sind Patientenverfügungen kaum bekannt und werden nur von einer verschwindend kleinen Minorität von Patienten benützt. Eine Studie an unserer Klinik konnte zeigen, daß nur ein Drittel der Ärzte überhaupt jemals Kontakt mit Verfügungen hatte. Weiter besteht Unsicherheit über die rechtliche Verbindlichkeit der Verfügungen. Die erhältlichen Formulare wurden oben kurz beschrieben. 2. Einfluß der Gesetzgebung Der praktische Einfluß der Gesetzgebung auf Patientenverfügungen und Stellvertreter-Entscheidungen erscheint derzeit verschwindend gering. Zum einen gibt es hinsichtlich der Verfügungen keine explizite Gesetzgebung, weder standesrechtlich noch strafrechtlich, andererseits ist die Selbstbestimmung per se jedoch durch das Strafrecht abgesichert und auch im Standesrecht verankert. Der Arzt ist im Falle von entscheidungsunfähigen Patienten gehalten, Entscheidungen im wohlverstandenen Interesse des Patienten zu treffen. (Dieses kann im Extremfall mit dem bestverstandenen Interesse kollidieren.) Hierzu muß er die Angehörigen befragen und deren Angaben im Kontext der Situation beurteilen. Sofern nicht Interessenskonflikte (wie etwa Erbschaftskonflikte oder unglaubwürdige Angaben der nächsten Angehörigen) vorliegen, ist von diesen fremdanamnestisch erhobenen Informationen rückschließend auf den Willen des Patienten auszugehen. Die konkrete rechtliche Situation ist den meisten Ärzten nicht im Detail bekannt. Dementsprechend wissen auch Patienten wenig über Möglichkeiten und rechtlichen Status von Patientenverfügungen und Stellvertreterentscheidungen. 3. Welche Rolle sollte die Legislative im Zusammenhang mit Wertentscheidungen am Lebensende spielen? Wünschenswert wäre die Auflösung der Unsicherheiten hinsichtlich der Verbindlichkeit von Verfügungen. Hierzu sollte ein regulativer Rahmen von vernünftigen Regeln entstehen, der ausreichend Spielraum für die Variabilität der klinischen Wirklichkeit bietet, immer aber unter Berücksichtigung der Autonomie von Patient und Arzt. 4. Wo liegen die Hauptkonfliktpunkte zwischen Gesetz und tatsächlichem Verhalten, und welche Bereiche erfordern Vermittlung zwischen Patienteninteressen, klinischer Praxis und rechtlichen Vorgaben? 11 Derzeit erscheinen quantitativ wenige Konfliktpunkte vorhanden zu sein, da im klinischen Alltag die Patientenverfügungen (PV) kaum eine Rolle spielen. Dennoch, das Hauptproblem der Verfügungen liegt in der möglichen Inkonsistenz zwischen dem zurückliegend geäußerten Willen und aktuellen Interessen des dann inkompetenten (komatösen, aphasischen...) Patienten. Die Grundannahme der Autonomieposition ist, daß eine Person über ihre eigenen Interessen und Prioritäten Auskunft geben kann, und selbst am besten geeignet ist, diese auch zu vertreten. Diese Kompetenz (Zurechnungsfähigkeit) muß für PV auch in die Zukunft hinein reichen. Es wird also vorausgesetzt, daß auch zukünftige Interessen abgeschätzt und abgewogen werden können. Problematisch erscheint hierbei, daß die Wertigkeiten und Interessen aus Sicht des bewußten, gesunden Zustandes nicht mehr notwendig diesselben sind, wenn der Patient inkompetent geworden ist; dann also, wenn PV überhaupt erst aktuell werden. In Übereinstimmung mit Robertson, der darauf hinwies, daß sich die Bedürfnisse eines schwerstkranken Patienten radikal ändern, ist davon auszugehen, daß es zu einem Konflikt zwischen zurückliegenden "kompetenten" Wünschen und aktuellen Interessen eines inkompetenten Patienten (z.B. Komatösen, Apoplektiker...) kommen kann. Die Berücksichtigung der PV führt dann dazu, daß inkompetente Patienten so behandelt werden, als ob sie weiterhin die gleichen Interessen und Werte hätten wie vorher. Die subjektiven Empfindungen von Angst und die aktuellen Wünsche verändern sich aber während des Krankheitsverlaufs. [18] Ein weiteres Problem, oder besser gesagt, eine Grenze der Patientenverfügung ist dort erreicht, wo der Patient aktive Euthanasie wünscht. Denn hierbei geht es nicht nur um Selbstbestimmung, sondern wie Callahan es formuliert: "es ist eine gegenseitige (soziale) Entscheidung zwischen zwei Personen, dem einen, der getötet werden soll, und dem anderen, der töten wird; und einer komplizenhaften Gesellschaft, die dies akzeptiert" [2] Weitere Grenzen von Patientenverfügungen ergeben sich vor allem dort, wo der Patientenwille und die ärztliche Einschätzung stark divergieren. Entweder wenn eine weitere Behandlung aus medizinischer Sicht für nutzlos gehalten wird, aber vom Patienten gewünscht wurde, oder umgekehrt jegliche Maßnahmen abgelehnt wurden, die aus ärztlicher Sicht geboten erscheinen. Im ersten Fall ist der Arzt zumindest nicht juristisch verpflichtet, jeden Wunsch auszuführen. Der Begriff "Futile medical treatment" wurde für diese Situationen geprägt. Auf die Schwierigkeiten der Ablehnung einer Therapie, aber auch die Reduktion oder das Einstellen 12 einer Behandlung bei durch Angehörigen repräsentiertem "Willen" wurde oben bereits (in Fall 1) hingewiesen. Im Gegensatz dazu ist die Ablehnung einer Therapie durch einen kompetenten (zurechnungsfähigen) aufgeklärten Patienten auch dann zu respektieren, wenn es für diesen tödliche Folgen hat. [5] Weiter sind folgende formale Vorbehalte bei Patientenverfügungen zu berücksichtigen: Die Mehrzahl der Verfügungen sind zu allgemein formuliert und daher unpräzise. Die gewünschten Konsequenzen können nicht befolgt werden, da zuviele Voraussetzungen interpretationsbedürftig bleiben. e.g. Patientenverfügung von Omega (Nr. 1) : "Ich .... erkläre und verfüge, daß ich im Falle eines unheilbaren Leidens nicht mit künstlichen Mitteln am Leben erhalten werden will. Ich gebe diese Erklärung nach sorgfältiger Überlegung und zu einer Zeit ab, da ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin, für den Fall, daß ich einmal nicht mehr über meine eigene Zukunft entscheiden kann....soferne keine Aussicht auf meine Genesung von körperlicher oder geistiger Krankheit oder Schädigung besteht, von der angenommen werden muß, daß sie mir schwere Leiden verursachen oder mir bewußtes Existieren unmöglich machen wird, fordere ich, daß man mich sterben läßt und mich nicht mit künstlichen Mitteln am Leben erhält." Hier stellen sich die Fragen was unter "künstlichen Mitteln" verstanden wird und schwieriger noch die Prognose der Aussicht auf Genesung. Die gleichen Schwierigkeiten gelten für die Verfügungen Nr. 4, 6, 7, 8 und 9. Dennoch sind alle diese Patientenverfügungen sicherlich eine wertvolle Orientierungshilfe für behandelnde Ärzte. Andere Verfügungen (e.g. Nr. 6) sind in einer juristischen Fachsprache abgefaßt, die für den Patienten unverständlich ist und an der klinischen Realität vorbeigeht. "Unabhängig vorstehender Ermächtigung Dritter, zu dringend indizierten ärztlichen Eingriffen im Falle meiner Bewußtlosigkeit oder Bewußtseinstrübung für mich die notwendige Zustimmung zu erteilen, erkläre ich hiermit, nachdem ich mich über die medizinische Situation und rechtliche Bedeutung einer solchen Erklärung ausführlich informiert habe, daß ich im Falle irreversibler Bewußtlosigkeit, wahrscheinlicher schwerer Dauerschädigung des Gehirns (Decerebration) oder des dauernden Ausfalls lebenswichtiger Funktionen meines Körpers oder bei infauster Prognose hinsichtlich meiner Erkrankung mit einer Intensivtherapie oder Reanimation nicht einverstanden bin." (Patiententestament Dr. Uhlenbruck) Neben den medizinischen Unschärfen der "Decerebration" und dem problematischen Begriff "infaust" erschwert eine technische Fachsprache mit Schachtelsätzen das Verständnis. 13 Das patientenorientierte "narrative" Konzept von H.-M.Sass und R. Kielstein [19, 20] benützt eine verständliche, einfache Sprache und ermöglicht den Patienten einen Zugang zu klinischen Grenzsituationen. Das sogenannte "Storykonzept" als Vermittler einer ethischen Botschaft, von D. Ritschl bereits 1976 erwähnt [17], wurde hier zu einer praktischen Anwendung gebracht. Dieser Ansatz erfordert jedoch genügend Zeit und ist wohl nur in Zusammenarbeit mit einem engagierten Arzt sinnvoll durchführbar. Im Rahmen der praktischen Umsetzung des Selbstbestimmungsrechtes in den USA (Patient-Self-Determination-Act) erwies sich der Aufnahmezeitpunkt als problematisch, um eine Patientenverfügung anzubieten. Bei der Klinikaufnahme ist einfach weder der Ort noch die Zeit um ein ruhiges und ausführliches Gespräch über Therapierichtlinien zu führen. Menikoff hat völlig richtig bemerkt, daß es sich um den wahrscheinlich ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt handelt. [14] Das Szenario wird beinahe grotesk, wenn der Arzt in der Notaufnahme den Patienten mit akutem Herzinfarkt fragt, ob er allenfalls beatmet und künstlich ernährt werden möchte. Die Kommunikation über Patientenverfügungen ist eher im Kontext einer hausärztlichen langfristigen Betreuung denkbar. Ursachen für mangelnde Akzeptanz von Patientenverfügungen: Trotz der inzwischen rechtlichen Verankerung werden auch in den USA Patientenverfügungen wenig angenommen. [4] In Deutschland liegt der Hauptgrund in dem fehlenden Angebot, obwohl die amerikanischen Erfahrungen zeigen, daß dies nicht allein ausschlaggebend ist. Ein weiterer Grund könnte sein, daß einfach gar keine Notwendigkeit von Verfügungen gesehen wird, da sich das übliche therapeutische Vorgehen mit dem mutmaßlichen Willen deckt. Viele Menschen wünschen aber, auf "heroische" Therapiemaßnahmen am Lebensende lieber zu verzichten. Dennoch sind nur wenige zu dem Schritt bereit, dies schriftlich festzulegen. [14] Es bestehen offenbar Vorbehalte sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten. Die meisten Ärzte sind weder bereit noch aufgrund der unklaren juristischen Situation in der Lage, gegebenen Richtlinien ohne weitere Überlegungen oder eigene Urteilsbildung zu folgen. Neben diesen formalen Schwierigkeiten spielen auch emotionale Faktoren eine Rolle. Sicherlich ist die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit, oder noch konkreter mit dem unweigerlich jedem von uns bevorstehenden Tod tabuisiert und unangenehm. Jede Patientenverfügung konkretisiert diese von uns gerne verdrängte Realität und fragt nach den Begleitumständen in denen wir sterben wollen. Dieses Unbehagen ist ja auch zumeist ein Grund 14 für nicht gemachte erbrechtliche Testamente, mit dem wesentlichen Unterschied, daß die Patientenverfügung das Lebensende betrifft und nicht erst nach dem Tod, sondern eben vorher relevant wird. In diesem emotionalen Unbehagen liegt aber auch eine positive Möglichkeit für Patientenverfügungen. Denn dem Versuch, die eigenen, persönlichen Wünsche und Prioritäten zu formulieren, muß eine Klärung vorausgehen. Es ist die Chance durch diese Konfrontation mit der Möglichkeit von schwerer Krankheit und der Realität der eigenen Sterblichkeit vertraut zu werden, zumindest in ein Verhältnis dazu zu treten. Das Gespräch über mögliche Krankheitsverläufe kann unbegründete Angst nehmen. Und das Wissen auf die Therapie, selbst dann noch Einfluß zu haben, wenn man ganz ausgeliefert erscheint, kann auch emotional entlastend sein. 5. Welche Grundfragen sollten im Zusammenhang mit Patientenverfügungen weiter interdisziplinär und interkulturell untersucht werden? a) Autonomie: In Deutschland ist das hinter dem Informed Consent stehende Prinzip der Patientenautonomie bei weitem noch nicht internalisiert und umgesetzt. Daher sollten die Patientenrechte und auch Pflichten deutlicher als bisher öffentlich gemacht werden. b) Information: Krankheitsverläufe muß Das weiter Ausmaß möglicher untersucht werden. Information Unsere über Studie bevorstehende zur Frage der Aufnahmekapazität von Informationen bei Patienten ergab, daß nur kleine und konkrete Informationseinheiten erfahren und nur ein Bruchteil davon gemerkt werden kann. In jedem Fall ist eine schriftliche Ergänzung der Information hilfreich. c) Entscheidungskompetenz: Die realistische Einschätzung, inwieweit eine freie und kompetente Entscheidung von einem Patienten überhaupt getroffen werden kann, ist schwierig. Hierzu sollte der reale Entscheidungsspielraum von Patienten ebenso wie die Frage nach der minimal erforderlichen Kompetenz für diese Entscheidungen untersucht werden. d) Veränderung der Wünsche und Werte des Patienten: Die Frage, inwieweit sich das "Wertprofil" (H.-M.Sass) während einer schweren Erkrankung verändert, ist keineswegs geklärt. Aus klinischer Sicht spricht vieles für gravierende Änderungen der aktuellen Bedürfnisse von Patienten, besonders für den Übergang von einem kompetenten zu einem inkompetenten, nicht mehr kommunikationsfähigen Zustand. Studienergebnisse zur Evaluation von Lebensqualität bei Hodentumorpatienten haben gezeigt, daß selbst kleine Veränderungen des körperlichen Befindens wichtige Veränderungen in den Wünschen und der nötigen Betreuung ergaben. 15 e) Medizinrecht: Zumeist entstehen Patientenverfügungen aus der Sorge nicht wunschgemäß behandelt zu werden, sondern hilflos der Willkür eines medizinischen Apparates ausgeliefert zu sein. Die Gründe und Wurzeln dieser Angst sollten näher untersucht werden. Berichte über Mißstände der "Apparatemedizin" in den Medien sollten präzise und genau aufklären, aber die Wirklichkeit nicht verzerren und damit unnötige Angst schüren. Patientenaufklärung ist sicherlich weiter verbesserungsfähig und nötig. Aus ärztlicher Sicht ist eine Verrechtlichung des Arzt-Patient-Verhältnisses mit den entsprechenden Auswüchsen von Prozessen und Gutachtenwesen wie in den USA jedoch nicht erstrebenswert. Die Arzt-Patient-Beziehung sollte eine Vertrauensbeziehung bleiben und nicht zur Vertragsbeziehung reduziert werden. Gerichte, wo persönliche Tragödien öffentlich diskutiert werden, erscheinen der falsche Ort zur Lösung ethischer Fragen. Nichtsdestoweniger ist ein juristischer Rahmen zur Bestimmung von Pflichten und Rechten der Ärzte im Hinblick auf Patientenverfügungen notwendig. 6. Zukunftsperspektiven und Erwartungen Eine große Gefahr ist die mögliche negative Beeinflußung der Beziehung zwischen Patient, Arzt und Angehörigen durch bevorstehende Verteilungsentscheidungen bei begrenzten medizinischen Ressourcen. Das Bestreben zu sparen könnte zum Motiv etwa für aktive Sterbehilfe werden, wenn institutionelle ebenso wie private Mittel knapp werden. Auch viele Patienten fürchten, zur finanziellen Bürde ihrer Angehörigen zu werden, und könnten diesen Bestrebungen Vorschub leisten. Die klare Unterscheidung zwischen Patientenverfügungen, die eine übermäßige Therapie begrenzen sollen, und solchen, die suizidale Tendenzen, womöglich im Interesse Dritter unterstützen, ist von größter Bedeutung. Patientenverfügungen und alle Formen der Bevollmächtigung sollten in einer umfabenden Aufklärungspraxis integriert sein, und den dauernden Informationsprozeß zu einer sensitiveren Kommunikationsform machen. Eine ideale Form ist noch nicht gefunden. Wichtig wäre es, eine dynamische Form von Verfügung zu haben, die den wechselnden Bedürfnissen gerecht werden kann. Diese Anpassungsvorgänge werden am ehesten in einer Kombination von schriftlicher Richtlinie mit Bevollmächtigung eines Vertrauten zu suchen sein. Doch sollte man nicht übersehen, daß Stellvertreter nie genau die Entscheidung treffen können, die der Patient selbst gemacht hätte. [14] Daher ist eine große Sorgfalt nötig, gerade bei "ungewöhnlichen" Entscheidungen. 7. Ziele 16 Ein Hauptziel könnte das zunehmende Problembewußtsein hinsichtlich Selbstbestimmung und Lebensende sein. Diese Themen sollten sensibel und vorsichtig aus dem verdrängten Tabubereich herausgeführt und in eine umfaßende Aufklärung integriert werden. Die Arzt-Patientbeziehung ist verbesserungsbedürftig, und Patientenverfügungen können der Einstieg zu wichtigen vertrauensvollen Gesprächen sein, auch wenn bislang nur wenige Patienten diese Angebote in Anspruch nehmen wollen. ZUSAMMENFASSUNG: Viele hämato-onkologische Patienten haben eine begrenzte Zeit zu leben. Die Möglichkeit der Patientenverfügungen sollten im Repertoire der Hämato-Onkologen vorhanden sein. Es geht darum, ein Angebot zu machen und feinfühlig und klar herauszufinden, ob es gewünscht wird. Die Form des Angebotes ist individuell zu wählen und gehört in den Bereich der ärztlichen Aufklärung. Jede Aufklärung bedarf weiterer Betreuung und Begleitung. Eine Orientierung an juristischen Normen, wie der Rechtsverbindlichkeit, greift mit Sicherheit zu kurz. Erst die Integration von Patientenverfügung in Aufklärung und Begleitung eröffnet deren Wert als Entscheidungshilfe für komplexe klinische Situationen, in denen dann eher im Sinne des Patienten entschieden werden kann. Entlastend können gute PV dann sein, wenn der Arzt seine Überlegungen am Patientenwillen orientieren kann, und sich die Sorge des Patienten verringert, daß gegen seinen Willen zuviel oder zuwenig getan wird. Die Grenzen der PV entsprechen den Grenzen der Patientenautonomie und liegen bei den Wünschen nach aktiver Euthanasie und unsinniger Behandlung. Patientenverfügungen können und sollen die Fragen nach aktiver Euthanasie, assisted suicide und Therapieverzicht bei Suizidanten nicht lösen. Diese Themen sind zwar eng mit der Problematik verbunden, müssen aber zunächst auf Ebene der wachen, kompetenten Patienten gelöst werden. Die ideale Form ist noch nicht gefunden, aber der Bereich gehört zur Patientenaufklärung, und es ist Zeit, sich über Möglichkeiten Gedanken zu machen, die uns und unseren Patienten entsprechen. 17 LITERATUR 1) Bernat E: Das Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod; in Bernat E (ed): Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod. Graz, Leykam, 1993. 2) Callahan D: When Self-Determination Runs Amok. Hastings Center Report 1992;2:52-55. 3) Delden vJJM, Maas vdPJ, Pijnenborg L, Loomann CWN: Deciding not to resuscitate in Dutch hospitals. Journal of medical ethics 1993;19:200-205. 4) Emanuel LL, Emanuel EJ: Decisions at the End of Life. Guided by Communities of Patients. Hastings Center Report 1993;23:6-14. 5) Eser A, Koch HG: Materialien zur Sterbehilfe. Eine internationale Dokumentation. Freiburg i.Br., Eigenverlag Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 1991. 6) Franzki H: Ärztliche Aufklärung aus juristischer Sicht. DF Med Eth in Wien Med Wschr 1991;2:IX-X. 7) Füllmich R: Der Tod im Krankenhaus und das Selbstbestimmungsrecht des Patienten. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1990. 8) Geisler L: Arzt und Patient - Begegnung im Gespräch. Frankfurt am Main, Pharma Verlag, 1987. 9) Illhardt FJ: "Ich will zu meinem Peterle". DF Med Eth in Wien Med Wschr 1992;11/12:LXVI-LXXI. 10) Lutterotti Mv: Menschenwürdiges Sterben. Freiburg, Herder, 1985. 11) Lutterotti Mv: Sterbehilfe, lex artis und mutmaßlicher Patientenwille. Ärztliche Überlegungen zu juristischen Vorschlägen. MedR 1988;2:55-58. 12) Lutterotti Mv: Patiententestament. DF Med Eth in Wien Med Wschr 1991;3:XIII-XIV. 13) Lutterotti Mv: Der Arzt und das Tötungsverbot. MedR 1992;1:7-14. 14) Menikoff JA, Sachs GA, Siegler M: Sounding Board - Beyond Advanced Directives - Health Care Surrogate Laws. N Engl J Med 1992;327:1165-1169. 15) Pichler JW: Internationale Entwicklungen in den Patientenrechten. Wien, Köln, Weimar, Böhlau Verlag, 1992. 16) Rest F: Sterbebeistand, Sterbebegleitung, Sterbegeleit. Stuttgart, Kohlhammer, 1989. 17) Ritschl D: Das "Storykonzept" in der medizinischen Ethik; in Sass HM, Viefhues H (eds): Güterabwägung in der Medizin. Berlin, Heidelberg, Springer, 1991, S. 156-167. 18 18) Robertson JA: Second Thoughts on Living Wills. Hastings Center Report 1991;6:6-9. 19) Sass HM, Kielstein R: Die Wertanamnese. Medizinethische Materialien, Zentrum für Medizinische Ethik 1992;76 20) Sass HM, Kielstein R: Wertanamnese und Betreuungsverfügung. Instrumente zur Selbstbestimmung des Patienten und zur Entscheidungshilfe des Arztes und Betreuers. Zentrum für Medizinische Ethik, Medizinethische Materialien 1993;81 21) Schmoll HJ: Sterben als sozialer Prozeß. Über das soziale Umfeld des Sterbenden; in Engelke E, Schmoll HJ, Wolff G (eds): Sterbebeistand bei Kindern und Erwachsenen. Stuttgart, Enke Verlag, 1979, S. 40-48. 22) Schöllhammer L: Die Rechtsverbindlichkeit des Patiententestaments. Berlin, Duncker & Humbolt, 1993. 23) Uhlenbruck W: Patiententestament; in Eser A, Lutterotti Mv, Sporken P (eds): Lexikon Medizin, Ethik, Recht. Freiburg i.Bg., Herder, 1989, S. 782-791. 19 RECHTSFRAGEN DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG IN STERBEHILFE-FÄLLEN "Patiententestament" und "Patientenanwalt" im deutschen Recht Hans-Georg Koch VORBEMERKUNG: RECHTSFRAGEN BEI STERBEHILFE-FÄLLEN Fragen der Sterbehilfe gehören zu den meistdiskutierten Problemen des Medizinrechts und der medizinischen Ethik in Deutschland. Terminologisch wird das Wort "Euthanasie" in diesem Zusammenhang zumeist vermieden, um Assoziationen zu den NS-Untaten aus dem Wege zu gehen. Der hier vorgelegte Beitrag kann und will nicht alle Aspekte abdecken; er konzentriert sich auf Rechtsfragen der Entscheidungsfindung über das weitere ärztliche Vorgehen in Fällen, in denen sich der Patient selbst im Zeitpunkt der anstehenden ärztlichen Entscheidung zur Handlung oder Unterlassung nicht mehr rechtlich verbindlich äußern kann.1 Damit sind Fragen der Dispositionsbefugnis über das eigene Leben impliziert. Schlagwortartig verkürzt lassen sich als Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen folgende Grundpositionen des deutschen Rechts markieren: Einerseits ist jegliche aktiv lebensverkürzende Handlung zumindest als Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) - mit Strafe bedroht. Andererseits besteht für einen Kranken grundsätzlich keine Verpflichtung, sich ärztlichen Behandlungsbemühungen zu unterziehen - auch dann nicht, wenn die Nichtbehandlung zum Tode führen würde. Das bedeutet: Grundsätzlich legitimiert sich ärztliches Handeln nicht schon aus dem Vorliegen einer behandlungsbedürftigen und -fähigen Erkrankung, sondern erst aus der Einwilligung des Patienten (oder einem ihrer rechtlichen Surrogate). Diese Grundregel erfährt auf Lebenserhaltung gerichtete Abweichungen im Fall des nicht selbst entscheidungsfähigen Patienten - die Verpflichtung des gesetzlichen Vertreters auf die Wahrung des Wohls des Vertretenen wird dahin verstanden, grundsätzlich die Realisierung vorhandener Lebensverlängerungschancen betreiben zu müssen - sowie des Suizidenten - zumindest dem bewußtlosen Suizidenten mutet die deutsche Rechtsprechung bislang (freilich vielfach kritisiert) zu, lebensrettende ärztliche Handlungen hinzunehmen, obwohl die Begehung eines Suizides nicht explizit verboten ist. Besondere Behandlungsbefugnisse bestehen nach deutschem Recht schließlich im Fall psychisch Kranker, die sich selbst zu gefährden drohen. Diese Rechtslage 1 Für einen umfassenden Überblick über Rechtslage und Reformdiskussion zur Problematik der Sterbehilfe in Deutschland sei auf meinen Landesbericht Bundesrepublik Deutschland in Eser/Koch (Hrsg), Materialien zur Sterbehilfe, Eigenverlag des Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg 1991, S. 31 ff., verwiesen. 20 wirft, wie sogleich zu zeigen sein wird, Probleme auf, wenn suizidale Geschehnisse mit typischen Sterbehilfekonstellationen zusammentreffen. Die folgende Darstellung präsentiert im ersten Teil einige Fälle, in denen sich in der einen oder anderen Form Fragen der Patientenverfügung oder der stellvertretenden Entscheidung stellen. Diesen Fälle ist gemeinsam, daß sich mit ihnen - in unterschiedlicher Weise - Organe der Rechtspflege befassen mußten. Mit anderen Worten: Die ärztliche Entscheidung wurde zumindest nachträglich justiziell "hinterfragt"; es handelt sich nicht bloß um erdachte "Lehrbuchfälle". Nach einer kurzen Sachverhaltsdarstellung werden die wesentlichen Rechtsfragen jeweils kurz skizziert. Mit der Präsentation dieser Fälle soll zugleich sichtbar gemacht werden, welche Art von - überwiegend extraordinären - Konstellationen die Organe der Rechtspflege bislang beschäftigt hat. Im Unterschied zu den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es in Deutschland bislang keine Rechtsprechung zu den einschlägigen Standardproblemen, etwa dem des langzeitkomatösen Patienten. Entsprechend schwierig ist es, hierfür aus der vorhandenen Judikatur klare Erkenntnisse ableiten zu wollen - und entsprechend verunsichert scheinen weite Kreise der Ärzteschaft zu sein. Im zweiten Teil wird eine kurze Übersicht über die rechtliche Gesamtproblematik gegeben und die einschlägige juristische Literatur diskutieren. Im dritten Teil wird zu Einzelfragen thesenhaft Stellung genommen, vor allem, soweit sie im Hinblick auf den internationalen Zuschnitt des Projekts als bedeutsam erscheinen. 1. Fälle und ihre rechtliche Problematik Fall 1 (Wittig-Fall): Fallschilderung: Dr. W. war Hausarzt von Frau U., einer an verschiedenen Krankheiten leidenden und nach dem Tod ihres Ehemannes lebensmüden, 76jährigen Frau. Diese hatte in einer dem Arzt bekannten schriftlichen Erklärung folgendes niedergelegt: "Im Vollbesitz meiner Sinne bitte ich meinen Arzt: Keine Einweisung in ein Krankenhaus oder Pflegeheim, keine Intensivstation und keine Anwendung lebensverlängernder Medikamente. Ich möchte einen würdigen Tod sterben. Keine Anwendung von Apparaten. Keine Organentnahme." Als Dr. W. seine Patientin verabredungsgemäß am 28.11.1981 aufsuchte, fand er sie bewußtlos auf der Couch liegend vor mit einem Zettel in der Hand, auf den sie geschrieben hatte: "An meinen Arzt - bitte kein Krankenhaus - Erlösung!" Anhand zahlreicher Medikamentenpackungen erkannte Dr. W., daß Frau U. in Selbsttötungsabsicht eine Überdosis Morphium und Schlafmittel zu sich 21 genommen hatte. Es war nur noch geringe Atemtätigkeit und kein Pulsschlag mehr feststellbar. Dr. W. ging davon aus, daß Frau U. nicht mehr oder allenfalls mit schweren Dauerschäden zu retten sein würde. In Anbetracht dieser Situation unternahm er nichts zu ihrer Rettung, sondern blieb in der Wohnung, bis der Tod eintrat. Zur rechtlichen Problematik: In diesem Fall steht die Problematik ärztlichen Handelns an der Schnittstelle von Suizid und Sterbehilfe im Mittelpunkt. Durfte oder mußte gar der Arzt auf Rettungsbemühungen verzichten? Oder hat er sich wegen unterlassener Hilfeleistung bzw. gar wegen eines Tötungsdelikts strafbar gemacht? Inwieweit spielt für die rechtliche Beurteilung eine Rolle, daß der Zustand der Patientin auf einem Suizidversuch beruhte? Die Staatsanwaltschaft hatte in diesem Fall die Anklage offenbar mit dem Ziel betrieben, durch den erwarteten Freispruch des Arztes Dr. Wittig auf eine Modernisierung der in vielen Punkten zweifelhaften und kritikwürdigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Suizidproblematik hinzuwirken. Erwartungsgemäß wurde Dr. Wittig denn auch in allen Instanzen freigesprochen, wobei sich allerdings der Bundesgerichtshof sichtlich damit schwer tat, daß das Tatgeschehen suizidalen Charakter trug, und die erhoffte rechtliche Klärung der Problematik des freiverantwortlichen Suizids nicht zustande brachte. Auf Fragen der Patientenverfügung geht das Urteil (BGHSt 32, S. 367 ff.) nicht explizit ein. Fall 2: (Beatmungsgerät-Fall) Fallschilderung: Frau M. litt an einer Rückenmarkserkrankung, die ärztlich nicht behandelbar ist und durch stetig fortschreitende Lähmung zum Tod führt. Bei Einlieferung ins Krankenhaus am 2.7.1985 war sie bewußtlos und lag "im Sterben". Sie hatte in zahlreichen Gesprächen vorher geäußert, im Endstadium der Krankheit auf keinen Fall künstlich beatmet werden zu wollen. Die behandelnden Ärzte wollten diesen Wunsch der Frau respektieren. Auf Anordnung ihres Sohnes, der Arzt ist, wurde bei Frau M. dann aber doch eine künstliche Beatmung durchgeführt. Sie kam daraufhin vorübergehend wieder zum Bewußtsein, ohne daß jedoch mehr als eine Verlängerung des Sterbevorgangs hätte erreicht werden können. Sie empfand ihren Zustand als "unerträgliche Quälerei" und verfaßte am 3.7.1985 mit Hilfe einer elektrischen Spezialschreibmaschine, mit der allein sie sich noch verständlich machen konnte, "im Vollbesitz ihrer Geisteskräfte" folgende Erklärung: "Ich möchte sterben, weil mein Zustand nicht mehr erträglich ist. Je schneller, desto besser. Dies wünsche ich mir von ganzem Herzen." Daraufhin schaltete ihr Ehemann - nunmehr mit Zustimmung des Sohnes - in einem unbeobachteten Augenblick das Beatmungsgerät ab. 22 Frau M verstarb eine Stunde später, während sie bei Weiterbeatmung noch mindestens 24 Stunden gelebt hätte. Zur rechtlichen Problematik: Auch in diesem Fall entschied das erkennende Gericht (LG Ravensburg NStZ 1987, S. 229 f.) auf Freispruch vom Vorwurf der Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB). In der Urteilsbegründung wird jedoch auf die Voraussetzungen einer wirksamen Patientenverfügung nur am Rande eingegangen. Besondere Probleme warf vor allem die atypische Tatsache auf, daß Beatmungsgerät nicht von dem behandelnden Arzt, sondern von einem Dritten abgeschaltet wurde. Der Entscheidung wurde im Ergebnis in der Fachliteratur nahezu einhellige Zustimmung zuteil; eine höhere Gerichtsinstanz hatte sich mit dem Fall offenbar nicht zu befassen. Fall 3 (Operationserweiterungs-Fall: Fallschilderung: Herr X hat sich wegen eines unklaren, aber potentiell gravierenden Befundes einer neurochirurgischen Operation unterzogen. Der Eingriff sollte zunächst nur der diagnostischen Abklärung dienen; für den Fall, daß sich intraoperativ ergebe, daß eine Operationserweiterung medizinisch geboten sei, sollte die Angelegenheit mit der während der Operation erreichbaren Ehefrau besprochen werden. Die Ehefrau war von Herrn X bevollmächtigt worden, "einer entsprechenden Ausweitung der Operation zuzustimmen oder auch sie abzulehnen." Es wurde jedoch eine erweiterte Operation durchgeführt, ohne daß die Entscheidung der Ehefrau eingeholt worden wäre. Wegen operationsbedingt eingetretener Halbseitenblindheit verlangte Herr X Schadensersatz. Die Klage hatte Erfolg (LG Göttingen, VersR 1990, S. 1401 f. mit Anmerkung von E. Deutsch; nicht rechtskräftig). Zur rechtlichen Problematik: Der Fall betrifft zwar keine Sterbehilfe-Konstellation; bei ihm handelt es sich indes um die bislang einzige feststellbare Entscheidung eines deutschen Gerichts zu Fragen der Bevollmächtigung eines Vertreters bei der Entscheidung über einen ärztlichen Eingriff. Während die juristische Literatur der Möglichkeit einer rechtsgeschäftlich erteilten Vollmacht in höchstpersönlichen Angelegenheiten teilweise kritisch gegenübersteht und z.B. Parallelen zum Verbot der Eheschließung durch Stellvertreter zieht -, sieht das LG Göttingen die Vereinbarung einer Beiziehung der Ehefrau zur Entscheidungsfindung über eine etwaige Operationserweiterung mit therapeutischer Zielsetzung ohne weiteres als zulässig an. Im Hinblick darauf, daß auch gesetzliche Vertreter in Heileingriffe stellvertretend einwilligen dürfen, ja unter Umständen müssen, ist dem Urteil im Ergebnis zuzustimmen. Allerdings ist damit noch nichts 23 über die Kompetenzen eines - gesetzlichen oder auch eines rechtsgeschäftlich bestimmten Entscheidungsvertreters in Sterbehilfe-Fällen ausgesagt. Fall 4 (Apallisches Syndrom) Fallschilderung: Angehörige eines seit beinahe zwei Jahren bewußtlosen Patienten begehrten die vormundschaftsgerichtliche Zustimmung zum Abbruch der ärztlichen Krankenbehandlung sowie die Anordnung, im Falle auftretender Komplikationen weitere Behandlungsmaßnahmen zu unterlassen. Die Existenz des Patienten könne nur als "entmenschlicht" empfunden werden. Das Gericht (Amtsgericht Berlin-Neukölln, NJW 1987, S. 2933 f.) konnte sich jedoch dieser Einschätzung nicht anschließen. Es schloß eine künftige Besserung des Zustandes des - auf Kosten der Krankenversicherung behandelten - Patienten nicht aus; auch sei kein Leidensdruck des Patienten feststellbar. Das Gericht sah keine Handhabe, in die Entscheidungsbefugnisse des bestellten Pflegers, der sich für eine Fortsetzung der Behandlung ausgesprochen hatte, einzugreifen. Darauf, ob der mutmaßliche Wille des Patienten auf einen Abbruch der Behandlung gerichtet sei, komme es nicht an, da in der vorliegenden Situation ein Behandlungsabbruch einen Verstoß gegen die Grundsätze der Menschenwürde (Art. 1 Grundgesetz) darstelle. Dies ist wohl dahingehend zu verstehen, daß das Gericht der Auffassung ist, der Patient sei - auch wenn er bei Bewußtsein wäre - zu entsprechenden Verfügungen gar nicht befugt. Die Angehörigen haben gegen diese Entscheidung Rechtsmittel eingelegt. Bevor sich das zweitinstanzliche Gericht mit dem Fall befassen konnte, ist der Patient verstorben. Zur rechtlichen Problematik: Dieser Fall stellt vielleicht die einzige einschlägige Entscheidung eines deutschen Vormundschaftsgerichts dar; jedenfalls die einzige, die bislang publiziert ist. Es handelt sich auch um die einzige Entscheidung, die sich zu Lebzeiten des Betroffenen mit Fragen passiver Sterbehilfe zu befassen hatte. Sie scheint von einem Vorverständnis getragen, das betont lebensschützerisch im Sinne des Bewahrens der Existenz als solcher ausgerichtet ist. In Anbetracht der nationalsozialistischen Euthanasie-Exzesse kann man es verstehen, wenn sich staatliche Organe bei der ihnen angesonnenen "Genehmigung" von lebensbeendigendem Verhalten Zurückhaltung auferlegen wollen. Andererseits ist es für die deutsche Diskussion kennzeichnend, daß immer wieder versucht wird, mit dieser tatsächlich ja ausgesprochen selbstbestimmungsfeindlichen Praxis der Hitler-Zeit auch gegen Selbstbestimmung am Lebensende zu argumentieren. Die deutsche Geschichte stellt daher für die aktuelle Sterbehilfe-Diskussion immer noch eine nicht zu unterschätzende Belastung dar. Fall 5: Konflikt zwischen Angehörigen und Arzt: 24 Fallschilderung: Der Patient P. hatte am 15.2.1985 einen Schlaganfall erlitten. Er war seitdem bewußtlos und beatmungspflichtig. Am 6.3.1985 - und ebenso am Tag darauf - hatte dessen Ehefrau, auch in ihrer Eigenschaft als Gebrechlichkeitspflegerin, die behandelnden Ärzte des Universitätsklinikums zu bestimmen versucht, das Beatmungsgerät abzuschalten, damit ihr Mann "eines natürlichen und nicht würdelosen Todes" sterbe. Die Ärzte kamen dieser Aufforderung jedoch nicht nach, sondern stellten das Beatmungsgerät erst am 7.3.1985 gegen 18.00 Uhr ab, als keine Hirnströme mehr meßbar waren. Aufgrund wechselseitiger Strafanzeigen kam es zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen die behandelnden Ärzte wegen des Verdachts der Körperverletzung des P. und gegen die Ehefrau wegen des Verdachts der versuchten Anstiftung zum Totschlag. Beide Ermittlungsverfahren wurden eingestellt (vgl. H.-G. Koch, Landesbericht Bundesrepublik Deutschland, in: Eser/Koch, Materialien zur Sterbehilfe, Freiburg 1991, S. 128 ff.). Zur rechtlichen Problematik: Der Fall macht einige wichtige Probleme bei Entscheidungen in Sterbehilfe-Fällen deutlich: Ärzte und Angehörige schätzen unter Umständen die Erfolgsaussichten weiterer Behandlungsversuche unterschiedlich ein; beide Seiten bewerten die Situation des Patienten unter dem Gesichtspunkt eines menschenwürdigen Daseins nicht selten kontrovers. Auffallend an diesem Fall ist nicht zuletzt, daß innerhalb des relativ kurzen Verlaufs der tödlichen Erkrankung des Patienten sich das Verhältnis zwischen der Ehefrau des Patienten und den behandelnden Ärzten derart dramatisch zerrüttet hat. Die Hintergründe dieses Geschehens verschließen sich allerdings dem Juristen, zumal es nicht zu einem Gerichtsverfahren kam. 2. ÜBERSICHT ÜBER DIE RECHTLICHE PROBLEMATIK 1. Stellenwert von Patientenverfügungen Das im Mittelpunkt des Projektes stehende Thema "Patiententestament" hat, wie auch aus den dargestellten Fällen deutlich wird, in der deutschen Judikatur bisher keine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Nur wenige Fälle, die als einschlägig betrachtet werden können, sind publiziert. Charakteristischerweise wird die Problematik vor allem unter strafrechtlichem Aspekt gesehen. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob lebenserhaltende Bemühungen eingestellt werden durften, nicht, ob sie eingestellt werden mußten. Mit Fällen, in denen ein Arzt zur Rechenschaft gezogen werden sollte, weil er entgegen einer Patientenverfügung den Patienten nicht hat sterben lassen, hat sich bislang offenbar die deutsche Justiz überhaupt noch nicht befassen müssen. Besondere gesetzliche Regelungen, die sich speziell mit Fragen der 25 "Patientenverfügung" bzw. des "Patientenanwalts" beschäftigen, gibt es in Deutschland bislang nicht. Gleichwohl wird in der medizinrechtlichen und medizinethischen Literatur die Sterbehilfeproblematik im allgemeinen und die hier im Vordergrund stehende Thematik im besonderen intensiv diskutiert (vgl. dazu unten, 3. Teil). Um einen persönlichen Eindruck wiederzugeben, auch wenn er nicht Anspruch auf Representativität erheben kann: Bei zahlreichen einschlägigen Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, an denen ich mitgewirkt habe, war das Interesse des nachfragenden Publikums - übrigens gerade älterer Menschen dezidiert von der Besorgnis geleitet, im "Ernstfall" werde dem Patienteninteresse an einem Sterben in Würde möglicherweise nicht hinreichend entsprochen, während Bedenken, man könne als entsprechender Patient möglicherweise zu früh "aufgegeben" werden, kaum einmal zum Ausdruck gebracht wurden. 2. Zum Stand der Gesetzgebung in Fragen der Sterbehilfe Allgemein wird der Frage der Entscheidungsfindung und der Entscheidungskriterien in Sterbehilfe-Fällen in der einschlägigen juristischen Literatur große Beachtung geschenkt. Es hat auch private Bemühungen gegeben, die entsprechenden Leitgedanken in die Form eines Gesetzes zu bringen (vgl. J. Baumann u. a., Alternativ-Entwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe, Stuttgart 1986 - vgl. Anhang). Jedoch stehen die zuständigen politischen Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland bislang auf dem Standpunkt, daß eine gesetzliche Spezialregelung von Sterbehilfe-Fragen nicht erforderlich sei. Nachdem das Thema Sterbehilfe Mitte der 80er Jahre zu umfangreicheren rechtspolitischen Diskussionen Anlaß gegeben hatte, sind Bemühungen um eine gesetzliche Regelung in letzter Zeit offensichtlich ins Stocken geraten. Derzeit ist nicht damit zu rechnen, daß sich der Gesetzgeber der Sterbehilfe-Problematik alsbald generell oder auch nur in einem Teilaspekt wie dem des Patiententestaments annehmen wird. Wie so viele medizinrechtliche Fragen wird also auch die Sterbehilfe-Problematik in Deutschland auf absehbare Zeit hinaus gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt bleiben - auch wenn sich einige Regelungen des neuen Rechts der Betreuung Volljähriger im Hinblick auf Sterbehilfe-Probleme nutzbar machen lassen (siehe dazu unten, 3. Teil, Ziff. 2, am Ende). Zulässigkeitsvoraussetzungen und -grenzen müssen daher aus eher allgemeinen Normen - etwa den strafrechtlichen Tötungsdelikten - herausinterpretiert werden. Dies ist der Rechtssicherheit schon im Prinzip nicht förderlich; es leistet darüber hinaus der Unsicherheit in der Beurteilung von Spezialfragen - wie etwa der hier besonders interessierenden Frage nach Patiententestament und stellvertretender Entscheidung in Sterbehilfe-Fällen - Vorschub. 26 Dieser Rechtsunsicherheit hat die deutsche Bundesärztekammer schon 1979 durch "Richtlinien für die Sterbehilfe" (Deutsches Ärzteblatt 1979, S. 957 ff.) entgegenzuwirken versucht. Diese dürfen jedoch nicht einmal als berufsständische Rechtssetzung im eigentlichen Sinn verstanden werden, sondern stellen lediglich eine - als solche freilich bedeutsame - Auslegungshilfe dar. Die Richtlinien selbst gehen auf die hier im Mittelpunkt stehende Problematik nur indirekt ein, wenn sie formulieren, beim bewußtlosen oder sonst urteilsunfähigen Patienten seien Hinweise auf den mutmaßlichen Willen zu berücksichtigen; nahestehende Personen müßten angehört werden. Nach dem zugehörigen Kommentar sollen frühere Verfügungen, worin der Patient auf jede künstliche Lebensverlängerung verzichtet, für die Ermittlung seines Willens ein gewichtiges Indiz abgeben können. Entscheidend sei jedoch der gegenwärtige mutmaßliche Wille, der nur aufgrund einer sorgfältigen Abwägung aller Umstände des Falles gefunden werden könne. Verbindlich sei die frühere Erklärung schon deshalb nicht, weil sie zu jeder Zeit rückgängig gemacht werden könne. Es müsse stets danach gefragt werden, ob der Patient die Erklärung im gegenwärtigen Augenblick widerrufen würde oder nicht (Richtlinie Ziff. II b) und Kommentar Ziff. III.3). 27 3. Fallkonstellation aus juristischer Sicht Wie schon die eingangs geschilderten Fälle erkennen lassen, erfaßt der Problemkreis "Sterbehilfe" die unterschiedlichsten tatsächlichen Fallkonstellationen. Auch im Hinblick auf rechtliche Differenzierungen haben sich folgende begriffliche Unterscheidungen weitestgehend durchgesetzt: - Sterbebegleitung durch palliative ärztliche wie pflegerische Versorgung und mitmenschliche Betreuung - Passive Sterbehilfe als Unterlassen lebensverlängernder Maßnahmen beim todkranken Patienten - Indirekte Sterbehilfe, d.h. Gabe schmerzlindernder Mittel unter Inkaufnahme möglicher Lebensverkürzung - Aktive Sterbehilfe als gezieltes und tätiges Herbeiführen des Todes, in aller Regel auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten - (Tätige) Suizidbeihilfe durch Mitwirkung an fremder Selbsttötung, die in mit Sterbehilfe verwandten Fällen regelmäßig erfolgt, um ein als unerträglich empfundenes Leiden zu beenden - Nichtverhinderung eines Suizids trotz dazu bestehender Möglichkeit, wobei sich der Sterbehilfebezug aus dem Motiv des Suizidenten ergibt. Als Sonderproblem findet die Frage nach den Grenzen der ärztlichen Behandlungspflicht bei schwerstgeschädigten Neugeborenen besondere Beachtung. Diese Fallgruppen werfen unterschiedliche Fragen im Hinblick auf die Entscheidungsfindung im Einzelfall auf. Im hier vorgegebenen Rahmen wird es vor allem um Behandlungsabbruch und indirekte Sterbehilfe gehen; direkte aktive Sterbehilfe ist, wie sich aus § 216 StGB ergibt, nach geltendem deutschen Recht strafbar und damit auch dem Arzt verwehrt. 4. Zum Stand der juristischen Literatur zu Sterbehilfe-Fragen Es wäre vermessen, die Vielzahl allein schon der Stellungnahmen in der juristischen Fachliteratur 2 zu Fragen der Sterbehilfe hier inhaltlich zusammenfassen zu wollen. Die Zahl der 2 Auch im philosophisch-ethisch-theologischen Bereich einschließlich des medizinethisch ausgerichteten Schrifttums ist die Zahl der literarischen Stellungnahmen Legion. Einführend insoweit etwa Illhardt, Medizinische Ethik, S. 123 ff.; M.v. Lutterotti, Menschenwürdiges Sterben, passim, sowie die einschlägigen Artikel in Eser u.a. (Hrsg.), Lexikon Medizin-Ethik-Recht, Freiburg 1989/1992. Fast überflüssig, darauf hinzuweisen, daß die Thematik auch in der an den Laien gerichteten Literatur erhebliche Beachtung findet (vgl. etwa Kübler-Ross, Was können wir noch tun?) und in den der Aktualität verpflichteten Medien einen hohen Stellenwert einnimmt. Demgegenüber weist Schöne-Seifert, Ethik Med 1989, 144, 156 ff. auf ein Defizit bei der empirischen Erforschung der einschlägigen Fragen hin. 28 rechtsdogmatisch wie der rechtspolitisch ausgerichteten Spezialveröffentlichungen ist enorm; in den Kommentaren und Lehrbüchern nimmt die Behandlung der Thematik breiten Raum ein. In ihren Grundannahmen und -Aussagen ist ein breites Meinungsspektrum von sich explizit und vorrangig der Lebenserhaltung verpflichtet fühlenden Äußerungen 3 über sich um Ausgleich bemühende Stellungnahmen 4 bis hin zu eindeutig den Aspekt des Selbstbestimmungs- und Selbstverfügungsrechts in den Vordergrund rückenden Positionen 5 festzustellen. Insgesamt ist die (straf-)rechtliche, medizinische (medizinethische) und philosophisch-theologische Literatur zu Fragen von Sterbehilfe und Suizid seit langem praktisch unübersehbar, wobei auf diskursfördernde Fallerörterungen6 und vor allem auf interdisziplinäre Sammelwerke, mit denen der Meinungsaustausch über die Grenzen des jeweiligen Faches hinaus vorangebracht werden soll, besonders hingewiesen sei.7 Ausführliche Bibliographien namentlich zu juristischen Publikationen, die jedoch ebenfalls nicht Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, finden sich z.B. bei Bade 8 , Bottke, 9 v. Dellingshausen, 10 G. Koch, 11 H.-G. Koch 12 und Otto. 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vgl. etwa Bockelmann, Strafrecht des Arztes, Stuttgart 1968, S. 112 ff.; Schöttler, Menschenrechte für jeden oder "Sterbehilfe" vom Anfang bis zum Ende - Eine liberale Antwort, Krefeld, 1990. Vgl. schon Ehrhardt, Euthanasie und Vernichtung "lebensunwerten" Lebens, Stuttgart 1965, insbes. S. 44 ff.; Eser in Auer/Menzel/Eser, Zwischen Heilauftrag und Sterbehilfe, Köln 1977, S. 105 ff. Dies drückt sich namentlich in Forderungen nach rechtlicher Zulässigkeit der Tötung auf Verlangen als Mittel der Sterbehilfe aus, vgl. etwa Hoerster, NJW 1986, 1786 ff.; ders. ZRP 1988. 1 ff., insbes. S. 3 mit Kritik von Wilms/Jäger ZRP 1988, 41 ff. und Rings, ZRP 1988, 104 sowie Replik von Hoerster ZRP 1988, 185 f.; Merkel, DJT-Sitzungsberichte, S. M 78 ff.; sowie die auch in der juristischen Fachliteratur diskutierten Standpunkte von Singer, Praktische Ethik, insbes. S. 174 ff., und Kuhse, DÄBl. 87 (1990), 783 ff. Keineswegs extrem ist jedoch die (absolut herrschende) Auffassung, die das ärztliche Behandlungsrecht an die zumindest mutmaßliche Einwilligung des Patienten bindet, vgl. nur Leonardy in Jung/Meiser/Müller (Hrsg.), Aktuelle Probleme und Perspektiven des Arztrechts, Stuttgart 1989, S. 19. Vgl. etwa v. Troschke/Schmidt, Ärztliche Entscheidungskonflikte, Stuttgart 1983, S. 71 ff.; Anschütz/Jahrmärker/Toellner, Ethik Med 1989, 163 ff.; Anschütz/Wellmer/Laufs, Ethik Med 1990, 90 ff.; Ruhrmann/Seidler/Niemann/Anschütz, Ethik Med 1990, 200 ff. Insoweit setzte der von Eser herausgegebene Tagungsband "Suizid und Euthanasie als human- und sozialwissenschaftliches Problem" (Stuttgart 1976) in einem frühzeitigen Stadium der Diskussion hohe Maßstäbe; vgl. weiter Eid (Hrsg.), Euthanasie oder soll man auf Verlangen töten, 2. Aufl., Mainz 1985; Hiersche (Hrsg.), Euthanasie, München 1975; Leist (Hrsg.), Um Leben und Tod, Frankfurt 1990; Winau/Rosemeyer (Hrsg.), Tod und Sterben, Berlin 1984. - Hingewiesen sei auch auf eine Vielzahl interdisziplinärer Veranstaltungen durch Einrichtungen der Erwachsenenbildung, vgl. etwa Blaha u.a. (Hrsg.), Schutz des Lebens - Recht auf Tod, München 1978; Evangelische Akademie Hofgeismar, Gibt es ein Recht auf einen würdigen Tod?, Hofgeismarer Protokolle 231, 1987 (hrsg. von Schöch); Evangelische Akademie Baden, Sterbehilfe - was heißt das?, Herrenalber Protokolle 55, 1988; Evangelische Akademie Bad Boll, Suizidalität als Herausforderung an Medizin, Recht und Seelsorge, Protokolldienst 31/1988. Bade, Der Arzt an den Grenzen von Leben und Recht, Lübeck 1988, S. 15 ff. Bottke, Suizid und Strafrecht, Berlin 1982, S. 334 ff. v. Dellingshausen, Sterbehilfe und Grenzen der Lebenserhaltungspflicht des Arztes, Düsseldorf 1981, S. 491 ff. G. Koch, Euthanasie, Sterbehilfe, Eine dokumentierte Bibliographie, Erlangen 1984. 29 5. Insbesondere: Patientenverfügung und Bennenung eines Stellvertreters Die Frage, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen der Patient selbst vorsorglich Verfügungen für den Fall künftiger Sterbehilfe-Situationen treffen kann, findet in der deutschen juristischen Fachliteratur etwa seit Ende der 70er Jahre zunehmende Beachtung. Als erster dürfte sich der medizinrechtlich sehr interessierte Amtsrichter Uhlenbruck - möglicherweise angestoßen durch ein einschlägiges Referat des Amerikaners Luis Kutner 14 - umfassender aus deutschrechtlicher Sicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben. 15 Die meinungstragende juristische Kommentarliteratur handelt das Thema bislang leider eher pauschal ab. Auch die strafrechtliche Abteilung des 56. Deutschen Juristentages (Berlin 1986), die sich eingehend mit Sterbehilfe-Fragen befaßte, hat, ebenso wie der Alternativ-Entwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe aus dem gleichen Jahr, diesen Fragenkreis nicht ins Zentrum seiner Überlegungen gestellt. In der Sache votierte der Deutsche Juristentag - mit großer Mehrheit - betont zurückhaltend: Die Bedeutung von Patientenverfügungen bedürfe einer "kritischen Überprüfung"; die Einschaltung sog. Patientenanwälte verspreche im deutschen Recht keine Verbesserung der Situation des Patienten und erscheine auch nicht geeignet, Mißtrauen in ein am Patientenwohl orientiertes Verhalten auf Dauer ernstlich abzubauen. 16 Der AE-Sterbehilfe vertrat den Standpunkt, die Lösung von Detailfragen sei der Praxis zu überlassen.17 Im Schrifttum gibt es speziell zu Fragen der Patientenverfügung gerade in den letzten Jahren eine eingehendere Auseinandersetzung. Unter den ins Detail gehenden Stellungnahmen überwiegen Positionen, die in der Grundsatzfrage für eine stärkere Verbindlichkeit votieren, 18 ja sogar sich für eine Strafbarkeit des Arztes bei Verstoß gegen ein Patiententestament ausspre- 12 13 14 15 16 17 18 H.-G. Koch, Landesbericht Bundesrepublik Deutschland, in: Eser/Koch, Materialien zur Sterbehilfe, Freiburg 1991, S. 31 ff., 173 ff. Otto, Recht auf den eigenen Tod, Gutachten D für den 56. Deutschen Juristentag, in: Verhandlungen des Deutschen Juristentages Berlin 1986, Bd. I (Gutachten), München 1986, S. D 100 ff. Kutner, Die Verfügung zu Lebzeiten - Zur Bewältigung des historischen Vorgangs Tod, in: Eser (Hrsg.), Suizid und Euthanasie als human- und sozialwissenschaftliches Problem, Stuttgart 1976, S. 360 ff. (Dokumentation des wohl bis dahin am breitesten angelegten Symposiums zu Sterbehilfefragen in der Bundesrepublik Deutschland, das im März 1975 in Bielefeld stattfand). Uhlenbruck, NJW 1978, S. 566 ff. 56. Deutscher Juristentag, Sitzungsbericht M, S. 193. Vgl. Baumann u.a., Alternativ-Entwurf eines Gesetzes über die Sterbehilfe (AE-Sterbehilfe), Stuttgart 1986, S. 6. So etwa Füllmich, Der Tod im Krankenhaus und das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, Frankfurt a.M. 1990, S. 71 ff.; Uhlenbruck, MedR 1992, S. 134 ff.; Schöllhammer, Die Rechtsverbindlichkeit des Patiententestaments, Berlin 1993, S. 29 ff. 30 chen. 19 In der zentralen Verbindlichkeitsfrage bemüht sich etwa Rickmann in ihrer 1987 veröffentlichten Dissertation um eine abgewogene, differenzierende Lösung: Als Fallgruppen verbindlicher Verfügungen nennt sie solche des informierten, sich dem Lebensende konkret nähernden Testators (z.B. bei infauster Krebsprognose, aber auch bei Menschen, die ihre altersbedingte Hinfälligkeit wie eine tödliche Krankheit erleben) sowie solche, die von einem auch von einem gesunden - urteilsfähigen Testator für den Fall "totaler irreversibler Bewußtlosigkeit" abgegeben wurden. Weiterhin betont Rickmann die immanente Schwäche vorformulierter Formulare und weist auf die Überlegenheit einer eigenständigen Formulierung des Dokuments hin.20 Bei gesunden Verfassern und anderen Konstellationen bleibe es demgegenüber bei der bloßen Indizfunktion.21 In der Verbindlichkeitsfrage eher noch weiter gehend kommt Schöllhammer zu dem Ergebnis, das Risiko eines Prognoseirtums sei letztlich vom verfügenden Patienten selbst zu tragen. 22 Es obliege allerdings dem Arzt zu prüfen, ob der Patient seine Meinung geändert hat oder ob Anhaltspunkte für Defizite bei der Willensbildung bestehen. 23 Besondere Formerfordernisse sind rechtlich nicht zwingend vorgegeben. Unzutreffend ist es daher, wenn beispielsweise verlangt wird, die Verfügung müsse von zwei Zeugen gegengezeichnet sein 24 oder wenn die "Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben" die Gültigkeit von Verfügungen, die mittels von ihr vertriebenen Vordrucken getätigt werden, vom Nachweis der Zahlung des Mitgliedsbeitrages abhängig machen wollte. Jedoch wird in der Praxis eine Patientenverfügung im allgemeinen schriftlich niedergelegt, was sicherlich dem Nachweis des Patientenwillens gegenüber dem Arzt förderlich ist. 25 Manche versuchen darüber hinaus, die Verbindlichkeit ihrer Verfügung dadurch zu bekräftigen, daß sie eine notarielle Beurkundung der Erklärung oder zumindest eine notarielle Beglaubigung ihrer Unterschrift vornehmen lassen. Derartige Formalia mögen im Einzelfall auf den Arzt nicht ohne Eindruck bleiben; über etwaige 19 20 21 22 23 24 25 Vgl. dazu z.B. Sternberg-Lieben, NJW 1985, S. 2734 ff.; Rickmann, Zur Wirksamkeit von Patiententestamenten im Bereich des Strafrechts, Frankfurt a.M. 1987. Vgl. zusammenfassend Rickmann, aaO, S. 210 f. Ähnlich im Ergebnis Harder, Arztrecht 1991, S. 11 ff. Vgl. Rickmann, aaO. Dem im wesentlichen zustimmend die einschlägige medizinische Dissertation von Saueracker, Die Bedeutung des Patiententestaments in der Bundesrepublik Deutschland aus ethischer, medizinischer und juristischer Sicht, Frankfurt a.M. 1990, S. 138 ff., freilich mit deutlicher Skepsis gegenüber verbindlichen rechtlichen Regelungen (vgl. S. 143 ff.). Vgl. Schöllhammer, aaO, S. 150 f. Vgl. Schöllhammer, aaO, S. 153. So etwa Kleinsorge, in: Deutsch/Kleinsorge/Ziegler, Das Patiententestament, Hildesheim 1983, S. 13. Zutreffend Uhlenbruck, MedR 1992, S. 134 ff., 138. 31 inhaltliche Mängel, insbesondere hinsichtlich der Bestimmbarkeit des Willens, können sie natürlich nicht hinweghelfen. Angesichts gewisser immanenter Grenzen, die mit dem Instrument der Patientenverfügung verbunden sind, mehren sich in Deutschland die Stimmen in der Literatur, die der "gewillkürten Stellvertretung in Gesundheitsangelegenheiten", wie sie namentlich auf Sterbehilfe-Situationen hin konzipiert ist, positiv gegenüberstehen, ja sie in gewisser Weise als der Patientenverfügung überlegen ansehen.26 Dem seit 1.1.1992 in Kraft befindlichen Betreuungsrecht, durch das die früheren Bestimmungen über die Vormundschaft über Erwachsene grundlegend geändert wurden, wird in neueren Arbeiten einerseits entnommen, die Bestellung eines Betreuers sei unzulässig, wenn der Betroffene selbst rechtzeitig alles geregelt hat, insbesondere, wenn er durch eine Patientenverfügung seinen Willen für die Situation, in der die Betreuerbestellung in Frage kommt, festgelegt hat.27 Andererseits kann diese Festlegung auch in der Benennung eines etwaigen Betreuers bestehen. Dies wäre als Vorschlag im Sinne des neuen § 1897 Abs. 4 BGB zu verstehen, dem das Vormundschaftsgericht zu entsprechen hat, soweit es dem Wohl des Betroffenen nicht zuwiderläuft. Bemerkenswert für die hier behandelten Fallkonstellationen erscheint auch die Bestimmung des neuen § 1901a BGB, wonach derjenige, der ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung geäußert hat, unverzüglich an das Vormundschaftsgericht abzuliefern hat. Der Betreuer hat den Wünschen des Betreuten zu entsprechen; er ist in seinen Entscheidungen freilich an das Wohl des Betreuten gebunden (vgl. § 1901 Abs. 2 BGB). Wesentliches Element dieses Wohls ist aber auch, daß ersichtlich beachtliche Verfügungen, die vor Beeinträchtigung der Fähigkeit zur Willensbildung getroffen wurden, ernstgenommen und befolgt werden. Die neuen betreuungsrechtlichen Bestimmungen können daher durchaus als implizite Anerkennung von Patientenverfügung und Benennung eines Entscheidungs-Stellvertreters verstanden werden. 28 Entscheidungen des als Betreuer verstandenen Entscheidungs-Vertreters über Heilbehandlungen mit lebensverkürzendem Risiko (wie bei manchen Formen indirekter Sterbehilfe) bedürfen jedoch der Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht (vgl. § 1904 26 27 28 Vgl. etwa Uhlenbruck, NJW 1978, S. 568; ders., MedR 1992, S. 139; Füllmich, aaO, S. 80 ff., Koch, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie - Mitteilungen, 1/1988, S. 22. Schöllhammer, aaO, S. 137. Ebenso Schöllhammer, aaO, S. 137 ff., 141. 32 BGB). Noch ungeklärt ist, inwieweit diese Bestimmung entgegen ihren Wortlaut auch auf Fälle des lebensbeendenden Behandlungsabbruchs entsprechend anzuwenden ist. 3. VORLÄUFIGE ÜBERLEGUNGEN AUS RECHTLICHER SICHT 1. In der deutschen juristischen Literatur überwiegt bislang eine eher kritische Beurteilung der Patientenverfügung. Eine im Vordringen begriffene Auffassung sieht in diesem Instrument demgegenüber eine prinzipiell geeignete Methode zur Manifestation des Patientenwillens in bezug auf Art und Umfang einer ärztlichen Behandlung für den Fall eigener Entscheidungsunfähigkeit, insbesondere bei terminaler Erkrankung. 2. Die herkömmlichen Bedenken, wie sie auch im Beitrag von Meran dargestellt sind, greifen zu Unrecht das Instrument der Patientenverfügung generell an. So richtig es einerseits ist, daß es sich hier nicht um ein Allheilmittel für Entscheidungen über ärztliches Handeln bei nahem Lebensende handeln kann, so geboten erscheint doch andererseits eine differenzierte Beurteilung. Entscheidend kommt es darauf an, ob die jeweils im konkreten Einzelfall getroffene Verfügung als beachtlich angesehen werden kann, oder ob sich aus den jeweiligen Umständen Bedenken gegen ihre Wirksamkeit ergeben können. 3. Patientenverfügungen sollten erkennen lassen, daß der Verfasser seinen Krankheitszustand und die voraussichtliche weitere Entwicklung seiner Erkrankung kennt. Sie sollten möglichst konkret abgefaßt sein und auf schwer ausdeutbare Termini (wie z.B. "menschenwürdigen Tod") möglichst verzichten. Die derzeit von verschiedenen Institutionen verbreiteten Muster (vgl. auch hierzu den Beitrag von Meran) können insoweit nicht immer befriedigen. Spezielle "Do not resuscitate orders", deren Errichtung vor geplanten größeren operativen Eingriffen von Krankenhäusern den Patienten angeboten wird (wie insbesondere in den USA gebräuchlich), sind in Deutschland derzeit noch nicht gebräuchlich. 4. Um Bedenken hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit zu begegnen, ist es wünschenswert, daß die Fortgeltung einer einmal formulierten Verfügung in angemessenen Zeitabständen deutlich gemacht wird. Dies sollte am besten durch einen ausdrücklichen Vermerk geschehen; jedoch ist auch das Mitsichführen einer solchen Verfügung als Manifestation fortbestehenden aktuellen Geltungswillens zu verstehen - wie es auch im Falle eines Organspenderausweises geschieht. Bei einer wesentlichen Änderung der gesundheitlichen Situation sollte die Verfügung inhaltlich angepaßt werden. 33 5. Bei Beachtung dieser Voraussetzungen sollte eine Patientenverfügung nicht nur als Indiz für den mutmaßlichen Patientenwillen, sondern als manifestierte Selbstbestimmung verstanden werden. 6. Auch bei bindender Wirkung einer Patientenverfügung dürfte eine dieser entgegenstehende Lebenserhaltung im allgemeinen nicht die Dimension strafwürdigen Unrechts erreichen. Jedoch kann sie eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts darstellen, für die in gravierenden Fällen ein Anspruch auf Schmerzensgeld in Betracht kommt. Auch sind entgegen dem - wie auch immer verbindlich geäußerten Patientenwillen vorgenommene Behandlungsmaßnahmen nicht mehr vom Behandlungsvertrag umfaßt; eine Vergütung sollte dafür daher nicht - weder vom Patienten selbst noch von seiner Krankenversicherung - verlangt werden können. 7. Prinzipiell liegt es im Verantwortungsbereich des Patienten, dafür zu sorgen, daß eine von ihm getroffene Verfügung den behandelnden Ärzten zur Kenntnis gelangt. Patientenverfügungen sind kein Instrument zur staatlich organisierten Bewältigung von Allokationsproblemen. Eine Pflicht der Ärzte, Patienten auf die Möglichkeit des Verfassens einer entsprechenden Verfügung - etwa vor einer Operation - hinzuweisen, besteht nach deutschem Recht nicht. Jedoch sollten sich Ärzte - mehr als bisher offenbar geschieht - im Verlauf der Behandlung progredienter, zum Tode führender Krankheiten um die Ermittlung, aber auch um die rechtzeitige Bildung des Patientenwillens im Hinblick auf gravierende Behandlungsentscheidungen bemühen. Die Form der Dokumentation dieses Willens dürfte demgegenüber eine zweitrangige Frage sein. Für ein staatlich organisiertes, zentrales Patientenverfügungs-Register, wie es seit kurzem in Dänemark besteht, dürfte in Deutschland jedenfalls derzeit kein Bedarf bestehen. 8. In einer Patientenverfügung kann auch die Fortführung einer Behandlung bestimmt werden. Bindend ist dies für den Arzt jedoch nur im Rahmen seines generellen Heilauftrages; zu Maßnahmen, die nicht mehr als medizinisch indiziert anzusehen sind, kann der Arzt auch auf diesem Weg nicht gezwungen werden. 9. Die Schaffung und die Tätigkeit von Institutionen, die bei der Abfassung von Patientenverfügungen behilflich sind und dafür Sorge tragen, daß diese im "Ernstfall" dem behandelnden Arzt zur Kenntnis gelangen, sollte der Privatinitiative überlassen bleiben. 10. Gegenüber dem eher statischen Instrument der Patientenverfügung hat die Bevollmächtigung eines Entscheidungs-Stellvertreters manche und gewichtige Vorzüge; sie setzt jedoch ein stabiles Vertrauensverhältnis zwischen Vertreter und Vertretenem voraus. Die in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung "Patientenanwalt" ist in tendenziöser Weise irreführend. Spezielle 34 juristische Sachkunde ist hier nicht gefragt; in Erwägung sollte man hier nicht zuletzt den langjährigen Hausarzt des Patienten ziehen. 11. Verpflichtender Inhalt einer Patientenverfügung wie einer stellvertretend getroffenen Entscheidung kann nur rechtlich erlaubtes Handeln sein, das - weitergehend - schützenswerten Belangen des Adressaten nicht zuwiderläuft. Daher können zwar ärztliche Bemühungen um Lebensverlängerung wirksam abgelehnt, nicht aber die Vornahme ärztlicher Maßnahmen zur direkten Lebensbeendigung verlangt werden. Die von der gesetzlichen Vertretung her bekannte Leitlinie der Bindung an das Wohl des Vertretenen sollte übernommen werden; dabei ist jedoch zu bedenken, daß sich dieses Wohl auch nach dem Willen des Betroffenen bestimmt und nicht einseitig unter dem Gesichtspunkt größtmöglicher zeitlicher Lebensquantität, sondern auch unter dem der Lebensqualität gesehen werden muß. 12. Sowohl vom medizinischen Sachverhalt her als auch im Hinblick auf die persönliche Situation des Patienten müssen auch Konstellationen bedacht werden, in denen der Patient nicht in der Lage oder nicht willens ist, sich der rechtsförmlichen Instrumente einer Patientenverfügung oder der Benennung eines Vertreters zu bedienen. Soweit in solchen Fällen nach juristischen Maßstäben der mutmaßliche Patientenwillen entscheidend sein soll, kann eine vorherige "Wertanamnese" im Sinne von Sass/Kielstein als "Ermittlungshilfe" nützlich sein; sie kann auch dem benannten Vertreter eine Hilfe sein. Erfolgt eine solche Wertanamnese jedoch nicht im Zusammenhang mit der Krankheitssituation des Patienten, die zur Entscheidung nötigt, können sich auch gegenüber diesem Instrument Zweifel hinsichtlich der Validität ergeben. 13. "Hospizbewegung" und Sterbehilfe-Vereinigungen kümmern sich um unterschiedliche Aspekte würdigen Sterbens. Die jeweils verfolgten Hauptanliegen - gute medizinische und pflegerische Betreuung Sterbender bzw. Stärkung des Selbstbestimmungsrechts am Lebensende - sollten nicht als einander ausschließendes aliud verstanden werden, sondern als zueinander komplementäre Aspekte des Persönlichkeitsschutzes Sterbender. Dies schließt nicht aus, einzelne Aktivitäten bzw. Zielvorstellungen dieser Institutionen kritisch zu beurteilen. 14. Wie zumeist bei medizinrechtlichen Fragestellungen, bedarf auch die rechtspolitische Befassung mit der Thematik der Sterbehilfe und insbesondere der Entscheidungsfindung bei der Behandlung terminal kranker Patienten des kontinuierlichen interdisziplinären Diskurses. Dabei kommt auch der Rezeption ausländischer Erfahrungen und Lösungsmodelle erhebliche Bedeutung zu. Über die in Amerika in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen mit Patientenverfügungen und Entscheidungsstellvertretern besteht bislang in Deutschland offenbar 35 noch ein erhebliches Informationsdefizit. Aber auch schon die derzeitige Praxis deutscher Ärzte bei der Entscheidungsfindung in Fragen weiterer Behandlung terminal kranker Patienten liegt noch allzusehr im Dunkeln und bedarf dringend empirischer Erforschung. 15. Bemühungen, Fragen der Sterbehilfe gesetzlich zu regeln, haben in Deutschland zwar gegenwärtig keine vorrangige rechtspolitische Priorität, sollten jedoch konsequent weitergeführt werden. Dabei ist eine Kodifizierung anzustreben, in der auch Patientenverfügung und Entscheidungs-Vertreter ihren Platz haben, Zulässigkeitsvoraussetzungen und -grenzen der verschiedenen Sterbehilfeformen jedoch umfassend geregelt werden sollten. 36 Anhang 1. Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe (AE-Sterbehilfe) Entwurf eines Arbeitskreises von Professoren des Strafrechts und der Medizin sowie ihrer Mitarbeiter (zur Einfügung in den Abschnitt über die Straftaten gegen das Leben im deutschen Strafgesetzbuch) * § 214 Abbruch oder Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen (I) Wer lebenserhaltende Maßnahmen abbricht oder unterläßt, handelt nicht rechtswidrig, wenn 1. der Betroffene dies ausdrücklich und ernstlich verlangt oder 2. der Betroffene nach ärztlicher Erkenntnis das Bewußtsein unwiederbringlich verloren hat oder im Falle eines schwerstgeschädigten Neugeborenen niemals erlangen wird oder 3. der Betroffene nach ärztlicher Erkenntnis sonst zu einer Erklärung über Aufnahme oder Fortführung der Behandlung dauernd außerstande ist und aufgrund verläßlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, daß er im Hinblick auf Dauer und Verlauf seines aussichtslosen Leidenszustandes, insbesondere seinen nahe bevorstehenden Tod, diese Behandlung ablehnen würde, oder 4. bei nahe bevorstehenden Tod im Hinblick auf den Leidenszustand des Betroffenen und die Aussichtslosigkeit einer Heilbehandlung die Aufnahme oder Fortführung lebenserhaltender Maßnahmen nach ärztlicher Erkenntnis nicht mehr angezeigt ist. (II) Abs. 1 gilt auch für den Fall, daß der Zustand des Betroffenen auf einem Selbsttö- tungsversuch beruht. § 214a Leidensmindernde Maßnahmen * vorgelegt von J. Baumann et al, Stuttgart 1986, 60 Seiten. 37 37 Wer als Arzt oder mit ärztlicher Ermächtigung bei einem tödlich Kranken mit dessen ausdrücklichem oder mutmaßlichen Einverständnis Maßnahmen zur Linderung schwerer, anders nicht zu behebender Leidenszustände trifft, handelt nicht rechtswidrig, auch wenn dadurch als nicht vermeidbare Nebenwirkung der eintritt des Todes beschleunigt wird. § 215 Nichthinderung einer Selbsttötung (I) Wer es unterläßt, die Selbsttötung eines anderen zu hindern, handelt nicht rechts- widrig, wenn die Selbsttötung auf einer frei verantwortlichen, ausdrücklich erklärten oder aus den Umständen erkennbaren ernstlichen Entscheidung beruht. (II) Von einer solchen Entscheidung darf insbesondere nicht ausgegangen werden, wenn der andere noch nicht 18 Jahre alt ist oder wenn seine freie Willensbestimmung entsprechend §§ 20, 21 StGB beeinträchtigt ist. § 216 Tötung auf Verlangen (I) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.[geltendes Recht, ebenso Abs. 3]. (II) [vorgeschlangene Ergänzung] Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1 von Strafe absehen, wenn die Tötung der Beendigung eines schwersten, vom Betroffenen nicht mehr zu ertragenden Leidenszustandes dient, der nicht durch andere Maßnahmen behoben oder gelindert werden kann. (III) Der Versuch ist strafbar. 38 38 DIE ETHISCHE DISKUSSION Bilder von Selbstbestimmung und ärztlicher Verantwortung, von Sterbebegleitung, Sterbenlassen und Töten Hans-Martin Sass VORBEMERKUNG: EIN FALL FÜR FALLSTUDIEN Es gibt Problembereiche, die sich dem Zugang zu ethischer Analyse eher durch die Diskussion konkreter Fälle als durch die Beschäftigung mit philosophischen Theorien oder Gesetzestexten erschließen. Die Problematik der Verlängerung von Selbstbestimmung auch in die dunklen Zeiten möglichen Komas oder Demenz und in der Nähe des Todes gehören dazu. Keine wissenschaftliche Beschäftigung mit Betreuungsverfügungen und stellvertretenden Entscheidungen kann davon absehen, daß Tod und Sterben, Leiden, Schwachsein und Abhängigsein und stellvertretende Entscheidungen von anderen über uns oder von uns über andere nicht nur theoretische, sondern mehr noch praktische und existentielle Risiken enthält. Jeder von uns wird einmal seinen eigenen Tod sterben und früher oder später eigenes Leiden und eigene Endlichkeit erfahren. Es gibt gute Gründe, die eigene Geschichte so zu sehen, wie sie in das Netz von vielfältig miteinander verwobenen Geschichten eingebunden ist. Die eigenen Pläne, Wünsche und Werte erscheinen in der Spiegelung der Geschichten anderer in einem hermeneutischen Licht, welches dazu beitragen kann, primär praktische und nur sekundär theoretische Fragen bei der Erstellung und Anwendung von Wertanamnesen (WA), Betreuungsverfügungen (BV) und Vorsorgevollmachten (VV) zu erhellen. [Kielstein und Sass 1993a-c]. Einleitend werden deshalb vier Fälle vorgestellt, in denen Wünsche und Werte, Prinzipien und Tugenden, Rechte und Pflichten untereinander und mit medizinischen und rechtlichen Parametern im Konflikt liegen, die es im Lichte der ethischen Tradition und der Ethik beruflicher und individueller Verantwortung auszumessen gilt. In Deutschland ist die Diskussion über berufliche Ethik und Verantwortungsethik nicht selten übermäßig theoriebeladen oder überschattet von weltanschaulichen Auseinandersetzungen. Diese können entweder aus dem ideologischen oder philosophischen Schulstreit, aus häufig sachfremden juristischen Streitereien oder aus einem öffentlichen Unbehagen im Umgang mit neuen ethischen Herausforderungen stammen. Spontane emotionale Empörung ersetzt häufig die rationale ethische Analyse und die differenzierte Güterabwägung. In solchen Fällen kann die 39 ethische Fallstudie dazu beitragen, (a) sich zunächst einmal der täglichen Erfahrungen zu vergewissern, (b) die komplexe Verwobenheit von ethischen Parametern mit technischen, kulturellen und rechtlichen innerhalb eines Szenariums zu verstehen, (c) die in Entscheidungen verborgen liegenden kulturellen oder ethischen Vorentscheidungen zu begreifen, (d) sich eines frischen und direkten Eindruckes zu vergewissern in bezug auf das Verhältnis zwischen geschriebenem und praktiziertem Recht und zwischen öffentlichem und individuellem Moralverhalten, und schließlich (e) Strategien abzuwägen, die eine ethische Bewertung und rechtliche Würdigung neuer Tatbestände erlauben. Diskussionen über ethische und rechtliche Aspekte der medizinischen Versorgung sterbenskranker, dementer oder komatöser Patienten sind aber nicht nur theoriebeladen, sondern im Nachgang von ideologisch begründeten und staatlich durchgeführten sogenannten Euthanasieprogrammen in dunklen Kapiteln der neueren deutschen Geschichte auch geschichtsbeladen. Interventionskonflikte einer patientenorientierten Behandlung am Lebensende aus dem Ethos des Schadensverbots und des Linderungsauftrages und im Respekt vor der Würde des Menschen in der Person des Patienten verlangen auch aus diesem Grunde einer besonders verantwortlichen und sorgfältigen Abwägung von ethischen, rechtlichen, kulturellen und technischen Aspekten eines Falles oder eines Szenariums. Gefordert ist, was ich an anderer Stelle [Sass, 1991a, 1992a-b] Differentialethik genannt habe, also die differenzierende Erhebung und Interpretation mittlerer ethischer Prinzipien innerhalb eines konkreten Handlungsund Problemzusammenhangs. Während technische Neuerungen auf der einen Seite ethische Konflikte reduzieren oder aufheben, schaffen sie auf der anderen Seite oft neue und bisher ungewohnte. Solche neuen Situationen haben wir im Zeitalter der Hochleistungsmedizin und im Zeitalter einer gesellschaftlich und kulturell akzeptierten Wertpluralität bei den Fragen der Behandlung, des Behandlungsverzichts und des Behandlungsziel am Lebensende, in Fällen von Koma, Demenz und Multimorbidität vor uns. Altersvorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen im Sinne des Betreuungsgesetzes [Bundesminister für Justiz, 1992] sind Instrumente, deren ethische Wirksamkeit und kulturelle Akzeptanz es erst noch auszumessen gilt, sowohl in der Medizinethik wie im Medizinrecht. Die Risiken einer in der Situation, ausgehend von prima facie Überlegungen, sich umsehenden ethischen Güterabwägung liegen in einer möglichen Fehleinschätzung von gerechtfertigten oder 40 nicht zu rechtfertigenden Gewohnheiten, dem traditionellen Rollenverhalten von Experten und Laien, der Rolle des Rechts bei der Ausgestaltung und Begründung des moralischen Verhaltens oder des Einflusses des faktischen Moralverhaltens auf Rechtsbildung und Rechtseinflub, von Rechten, Pflichten und Tugenden. Demgegenüber liegen die ethischen Risiken der Güterabwägungen aus ethischer Theorie, Glaube oder Metaphysik zunächst in einer möglichen Blindheit den situativen Realitäten gegenüber, insbesondere in bezug auf die unvermeidbare Vernetzung von ethischen, technischen und rechtlichen Parametern eines konkreten Falls oder Szenariums. Ethische Güterabwägung ohne situative Erfahrung ist stumpf; bloße situative Erfahrung ohne ethische Güterabwägung ist blind für berufliche und individuelle Entscheidungskonflikte. Fallstudien können grundsätzliche Entscheidungskonflikte übersehen, während generelle Überlegungen die speziellen Herausforderungen eines bestimmten Falles vernachlässigen können. Die deutsche Diskussion, nicht nur um das Recht oder Unrecht von Betreuungsverfügungen und stellvertretende Entscheidungen, scheint eher durch eine zu grundsätzliche als durch eine zu sehr an der konkreten Situation sich orientierende Diskussion bestimmt zu sein [Sass 1992b], hat aber eine lange vorkantische Tradition in der aristotelischen und thomistischen Ethik (ThAq. STh. I-II, art 4: quanto magis ad particularia descenditur). 1. MEDIZINISCHE FÄLLE IN ETHISCHER DIAGNOSE 1. WER SOLL JETZT ENTSCHEIDEN, UND WIE?: Herr B. ist 79 Jahre alt und benötigt für alle Verrichtungen des täglichen Lebens die Hilfe anderer. Er kann zunehmend schlechter hören und sehen, er hat keine Interessen mehr und ist häufig geistig verwirrt. Weil er früher starker Raucher war, ist die Durchblutung seiner Beine gestört; er kann nur wenige Meter ohne Schmerzen laufen. Durch eine größere Gefäßoperation könnten die Schmerzen beim Gehen behoben werden, seine Bewegungsfähigkeit verbessert und seine Hilfsbedürftigkeit reduziert werden. Herr B. ist aber nicht in der Lage, sich zu den Vorteilen und Risiken des Eingriffs sinnvoll zu äußern. Seine Kinder halten den geplanten Eingriff für problematisch und neigen dazu, ihrem Vater die Risiken einer Operation zu ersparen, da sie meinen, daß seine Lebensqualität nur unwesentlich verbessert werden würde. Herr B. selbst hat sich früher nie, als er noch Situationen klar verstehen und auch in ihnen entscheiden 41 konnte, zu problematischen Fragen medizinischer Behandlungen geäußert. [Kielstein und Sass 1993] Der Fall von Herrn B. illustriert das grundsätzliche Problem, das sich bei stellvertretenden Entscheidungen ergibt, wenn einerseits keine eindeutigen und überwältigenden medizinischen Gründe für eine bestimmte Intervention sprechen und andererseits vom Betroffenen weder eine vorsorgliche Verfügung noch eine Betreuungsvollmacht vorliegen. Wie sollen oder können ohne Vorliegen einer Wertanamnese oder Betreuungsverfügung des nicht mehr entscheidungsfähigen Patienten, ohne einen von ihm benannten Beauftragten für stellvertretende Entscheidungen Konflikte allein aus ärztlichem Paternalismus gelöst werden? Greift nicht das Prinzip des aegroti salus suprema lex ins Leere, wenn dieses Heil des Patienten nur uniform und generell und nicht individuell bestimmt werden kann. Andere Kriterien, wie die einer leichteren oder kostengünstigen Versorgung des Patienten, könnten sich unakzeptabel in den Vordergrund drängen. Auch kann es zu ethischen und rechtlichen Kontroversen zwischen heilberuflich Tätigen, Ärzten, Familienangehörigen, auch Kassen oder Trägern von Einrichtungen kommen. Die Situation des Entscheidungskonflikts am Krankenbett von Herrn B. ist eine sehr alltägliche; sie repräsentiert die schlechteste der möglichen Voraussetzungen für eine gute Lösung in einer Betreuungssituation. 2. DIESE KREBSERKRANKUNG IST NICHT HEILBAR Vor fünf Jahren wurde Frau M., 46 Jahre alt, wegen einer Krebserkrankung die linke Brust abgenommen. Jetzt machen sich als späte Folge des Brustkrebses Tochtergeschwülste in der Wirbelsäule bemerkbar. Frau M. wird nicht vollständig über die schlechte Prognose aufgeklärt; sie stimmt aber einer belastenden Chemotherapie zu, was ihre Schmerzen vorübergehend lindern, aber den Knochenkrebs nicht heilen kann. Sie stirbt nach sechs Monaten im Krankenhaus und nicht, wie sie gewünscht hatte, zu Hause. [Kielstein und Sass 1993] Frau M.s Geschichte steht für solche Szenarien, in denen Patienten nur unzureichend über die Unheilbarkeit ihrer Krankheit aufgeklärt werden oder in denen Ärzte sich auf Informationen über technische Interventionsmöglichkeiten beschränken, um die Zustimmung zu deren Einleitung und Durchführung einholen, selbst unter der Gefahr, daß beim Patienten falsche Hoffnungen geweckt werden oder daß leidvolles Leben ohne Besserungsaussicht und ohne daß die ausdrückliche Zustimmung des Patienten zu einer solchen nur noch lebens-(leidens)verlängernden Behandlung tatsächlich vorliegt. Die Patientin wird nicht als Person mit ihren 42 Hoffnungen, Werten, Lebensqualitätskriterien behandelt, nur die Symptome werden kuriert. Aus der von Wolff [1989:193-204] zusammengestellten Liste von prima facie Pflichten Verantwortungsbereitschaft, Verschwiegenheit, Wahrhaftigkeit - und ärztlichen Tugenden Geduld, Einfühlungsvermögen, Mitempfinden, Hilfsbereitschaft - sind in diesem Fall die Verpflichtungen der Wahrhaftigkeit und Verantwortungsbereitschaft und sämtliche Tugenden verletzt worden. Die arztethischen Prinzipien des primum nil nocere und des bonum facere wurden nur medizinisch-technisch abgewogen, das Prinzip der Selbst- und Mitbestimmung des Patienten wurde verletzt und damit dem Modell einer Verantwortungs- und Kooperationspartnerschaft zwischen Arzt und Patient der Boden entzogen [Sass 1992a:134]. Eine Integration der Ergebnisse von 'Blutbild' und 'Röntgenbild' mit dem 'Wertbild', wie es erforderlich gewesen wäre, wurde überhaupt nicht erst versucht [Sass und Viefhues 1989]. 3. DIE URSACHE DES STERBENS AUSWÄHLEN? Herr M., 42 Jahre alt, ist zuckerkrank und muß sich seit seinem 14. Lebensjahr täglich mehrmals Insulin spritzen und eine strenge Diät einhalten. Als Folge der "Zuckerkrankheit" ist er seit vier Jahren blind. Seit zwei Jahren muß er dreimal wöchentlich für einige Stunden an die "Künstliche Niere" angeschlossen werden; schon damals äußerte er den Wunsch, lieber zu sterben, ließ sich dann aber doch behandeln. Vor einem Jahr wurde ihm wegen schwerer Durchblutungsstörungen ein Bein amputiert; er hatte dieser Operation zugestimmt, weil er die inzwischen erfolgte Hochzeit seiner Tochter und die Geburt seines ersten Enkels noch erleben wollte. Als jetzt wegen einer schweren Durchblutungsstörung die Amputation des rechten Armes notwendig wird, verweigert er diese und auch die Weiterbehandlung an der "Künstlichen Niere". Trotz Zuredens der Ärzte läßt er sich nicht von seiner Entscheidung abbringen, wird nicht mehr dialysiert und dämmert eine Woche später, wie er gewünscht hatte, schmerzlos in den Tod hinüber. [Kielstein und Sass 1993] D.’s Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Patienten in veränderte und verminderte Parameter von Lebensqualität einfügen und dafür, wie sehr ihr Leben, Wünschen, Hoffen und ihre Lebensqualität von sozialen und familiären Beziehungen, Zielen und Hoffnungen geprägt ist. Herr M., ein Patient erfahren und gereift im Umgang mit dem chronisch Kranksein, entdeckt neue Inhalte von Lebensqualität, die das Leben lebenswert machen, - bis zu einem gewissen Grade oder einem gewissen Zeitpunkt. Man mag sich fragen, ob der 'alte Mensch' (Herr D. vor einigen Jahren) die nunmehr von dem 'neuen Menschen' (Herrn D. im 43 Zeitpunkt seines jetzigen Entschlusses) getroffene Entscheidung gutgeheißen hätte, aber das ist eine sehr theoretische Frage, denn Herr D. hat sich in den Jahren seines Krankseins weiterentwickelt zu einem anderen Herrn D. mit anderen Wünschen und Werten [Buchanan und Brock, 1989: 184-189; vgl. Veatch 1993:17]. In diesem Fall hat Herr D. selbst die Entscheidung zum Behandlungsverzicht getroffen; die Ärzte seines Vertrauens haben diese Entscheidung akzeptiert. Was aber, wenn in ähnlichen Situationen stellvertretende Entscheidungen fällig werden, gibt es einen Maßstab, das 'beste Interesse' des Patienten, das 'salus aegroti' zu ermitteln in Anlehnung an die Werte und Wünsche des 'alten' oder besser des 'neuen' Menschen? Ein anderes Dilemma in der klinischen Hermeneutik von mutmaßlichen Wünschen und Werten des Patienten unter dem wunsch- und wertverändernden Einfluß der Krankheit zeigt sich in der Geschichte des Frank Williams, einem aktiven Sportler und erfolgreichen Rennfahrers, der nach einem Rennen zu Hause einen schweren Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Wenn er zu der Zeit seines Unfalls eine Betreuungsverfügung gehabt hätte, hätte er verfügt, daß man ihn sterben lassen solle und seine Frau hätte als gewillkürte Stellvertreterin entsprechend entschieden. Jetzt hat er schwerverletzt überlebt, kann sprechen und genießt es, zu Rennen gefahren zu werden und seine Rennteams zu trainieren. [Williams 1992]. Herr Williams hatte keine frühere Erfahrung mit schwerem Trauma und Behinderung, wohl aber Ilonas Mutter (61). Ilona (39) war 22 Jahre lang Dialysepatientin als sie und ihre Mutter von dem sie über Jahre behandelnden Arzt eingeladen wurden, Betreuungsverfügungen zu diskutieren und aufzustellen. In den Gesprächen und in ihrer schriftlichen Stellungnahme forderte Ilona, daß alles technisch Mögliche unternommen werden solle, sie am Leben zu erhalten, während ihre Mutter genau entgegengesetzte Wünsche formulierte und für sich selbst beispielsweise eine Dialysebehandlung ablehnte. Wie soll im Betreuungsfall die Position von Ilona, die 'wußte, wovon sie sprach' gewertet werden und wie die von Herrn Williams, der vor seinem Unfall 'nicht wußte, wovon er sprach'? 44 4. DEN ZEITPUNKT DES STERBENS WÄHLEN? Frau S., 80 Jahre alt, geistig aktiv und urteilsfähig, ist stark gehbehindert, herzkrank und leidet seit Jahren unter einer schmerzhaften, aber gutartigen Darmerkrankung. Seit sie vor zwei Jahren ihren Mann verlor, hat sie der Lebensmut verlassen; ihrem Hausarzt hat sie seitdem des öfteren gesagt, daß er sie in Ruhe sterben lassen möge, wenn sie einmal ihrem Leben selbst ein Ende setzen würde. Jetzt ruft die Nachbarin den Arzt an und informiert ihn, daß Frau S. eine Überdosis Schlaftabletten genommen habe. Der Arzt findet sie bewußtlos auf dem Sofa, neben ihr ein Zettel mit dem Hinweis, daß sie keiner Einweisung ins Krankenhaus und auch keiner lebenserhaltenden Maßnahme zustimme, sie wolle sterben: 'Bitte labt mich sterben; ich will zu meinem Peterle'. Der Arzt folgt ihren Wünschen. Selbstbestimmung ist für Frau S. das handlungsbestimmende Prinzip. Sie will nicht ohne ihren geliebten Mann leben und auch nicht mit zunehmenden Altersbeschwerden leben. Sie begeht zu einem von ihr gewählten Zeitpunkt einen geplanten sogenannten 'Bilanzselbstmord'. Man könnte aber auch vermuten, daß sie in einer Situation besonderer Vulnerabilität etwas tat, von dem sie vorher zwar immer gesprochen hatte, es aber nie in die Tat umgesetzt hatte. Hat der Arzt ihres Vertrauens also in einer entscheidenden Situation die Pflicht zur Hilfe verweigert oder hat er ein in ihn gesetztes Vertrauen honoriert? Wären andere (Nachbarn oder Familienangehörige) verpflichtet gewesen, ihr im Vorfeld des Suizides oder bei der rechtzeitigen Entdeckung des Suizidversuches zu 'helfen'; wie hätte eine solche Hilfe auch in Verantwortung vor dem Selbstbestimmungsrecht von Frau S. aussehen sollen? Hat der Hausarzt gegen Verantwortungsbereitschaft und Hilfsbereitschaft verstoben, als er nicht sofort zur 'Ersten Hilfe' griff, oder hat er sie verletzt, weil er ihre Wünsche befolgt hat? Hatte er die Basis des Vertrauens zerstört, weil er nicht entschieden genug während der vorangegangenen Besuche gegen Selbstmord beraten hat. Soweit wir wissen, hat Frau S. nie die Techniken von Dosierung und Auswahl von Medikamenten zum erfolgreichen Selbstmord mit ihrem Arzt besprochen. Hätte er eine solche Unterredung zurückweisen sollen oder hätte er Informationen geben und/oder Medikamente für die Selbsttötung verschreiben sollen, die er für wirksamer hält als jene, die der Patientin schon zur Verfügung stehen? Welche Rolle soll der Arzt im Beratungsgespräch bei der Abfassung einer Betreuungsverfügung haben, die der Information und nichtdirektiven Beratung oder die einer aktiven Warnung vor dem Suizid? Wenn Frau S. in Frank Williams Situation gewesen wäre, 45 hätte sie Hilfe bei der Ausführung der Selbsttötung benötigt. Wären alle anderen medizinischen Parameter identisch, würde das 'Slippery Slope Argument' oder das Berufsethos den Arzt davon abgehalten haben, die tödliche Dosis mit den eigenen Händen zu geben? Gibt es einen prinzipiellen Unterschied zwischen Töten und Sterbenlassen? Gilt eine solche Unterscheidung nur für den medizinischen Experten oder auch für den medizinischen Laien? Wenn die Partnerschaft im Vertrauen konstitutiv für die Interaktion von Arzt und Patient ist, wodurch wird das Vertrauen eher untergraben und ausgehöhlt (a) durch die Akzeptierung des suizidalen Wunsches und die Billigung des Suizids oder gar die Beihilfe dazu oder (b) durch Verweigerung von Information und Kommunikation und Hilfsbereitschaft in Fragen des Suizids und den Ausschlub der Selbsttötung als einer überhaupt zu diskutierenden Alternative. 5. ÄRZTLICHE RICHTLINIEN UND ÄRZTLICHES VERHALTEN Die 'Richtlinien für die Sterbehilfe' der Bundesärztekammer [Bundesärztekammer 1979] bezeichnen als entscheidungsleitend bei Interventionsüberlegungen den 'aktuell angenommenen Willen', nicht frühere mündliche oder schriftliche Weisungen, Werte, Wünsche und Präferenzen: 'Ein früheres schriftliches Dokument mit der Ablehnung von künstlich lebensverlängernden Maßnahmen kann ein wichtiger Anhaltspunkt für den Willen des Patienten werden. Trotzdem ist der aktuell angenommene Wille wichtig, welcher nur als Resultat von sorgfältiger Abwägung aller Aspekte des Falles ermittelt werden kann'. Frühere Äußerungen, so wird argumentiert, können aus dem einfachen Grund nicht ohne weiteres bindend sein, da sie jeder Zeit widerrufen werden können. Diese Richtlinien beziehen sich ausnahmslos auf Szenarien von Krankheiten im Endstadium und lassen die Unterlassung ausschließlich lebensverlängernder Maßnahmen bei gleichzeitiger Konzentration auf palliative Behandlung zu; sie erlauben ausdrücklich keine direkte Verkürzung der Lebenszeit. Die Richtlinien empfehlen, Angehörige an Entscheidungen zu beteiligen, machen aber klar, daß die letzte Verantwortung für die Entscheidung beim Arzt liegt. In Betreuungssituationen im Sinne des Betreuungsgesetzes ist die Zustimmung des jeweiligen Betreuers einzuholen. Auberdem läßt das Betreuungsgesetz (BetrG) nun die Möglichkeit zu, selbst für den künftigen Betreuungsfall einen Betreuer vorzuschlagen [Bundesminister für Justiz 1992]; das gibt dem Instrument des 'gewillkürten Stellvertreters' [Uhlenbruck 1992] eine stärkere rechtliche Position in der Begründung einer Intervention oder eines Interventionsverzichts auf den mutmaßlich aktuellen Willen des Patienten. Der 46 Bundesminister für Justiz gibt in einer Informationsbroschüre [BMJ 1993:29-32] unter der Überschrift 'Wer klug ist, sorgt vor!' Anregungen zum Abfassen von Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten und macht Formulierungsvorschläge. Das Betreuungsgesetz setzt also zunächst einmal voraus, daß der Bürger seine Selbstbestimmungsrechte auch in der Betreuungssituation so weit wie möglich wahrnimmt; erst danach kann herausgefunden werden, wie Ärzte und Betreuer mit den neuen Instrumenten umgehen werden. Der 'Bochumer Arbeitsbogen für die medizinethische Praxis' war 1987 ursprünglich für die medizinische Einzelfallanalyse entwickelt worden und betont ein auf Vertrauen basierendes Beratungs- und Entscheidungsverhältnis zwischen Arzt und Patient in Partnerschaft. Er fragt beispielsweise: 'Erfolgt bei infauster Prognose eine Abwägung zwischen intensivmedizinischen oder palliativen Therapiemaßnahmen? Ist sichergestellt, daß hierbei der explizierte oder mutmaßliche Wille des Patienten berücksichtigt wird?' [Sass und Viefhues 1992]. Der Bogen wird vereinzelt in der klinischen Entscheidungsfindung und bei der ärztlichen Ausbildung benutzt, wird jedoch nicht offiziell von einer Ärztekammer empfohlen oder unterstützt. In bezug auf klinische Entscheidungsfindungen betont er Aspekte der Lebensqualität und der Selbstbestimmung, Recht und Pflicht des Patienten zur Mitverantwortung. Für die terminale und die Betreuungssituation stellt der Bogen sechs Leitfragen: '(1) Wünscht der Patient eine optimale Schmerzbehandlung, auch wenn sie lebensverkürzend ist? (2) Wünscht der Patient Linderung der Begleiterscheinungen des Sterbeprozesses? Hat man sie angeboten? (3) Sind die Wünsche des Patienten klar und deutlich? (4) Wie drückt er/sie die Wünsche aus? (5) Kann der Arzt ethisch vertreten, den Wünschen des Patienten nicht auch zu folgen? (6) Welche Interventionsoptionen hat der Arzt?' [Sass 1990:24]. Der Bogen bewegt sich innerhalb einer etablierten und von Ärzten und Patienten weitgehend akzeptierten Kultur eines milden Paternalismus von Arztethik, will aber den Arzt verpflichten, in Abwesenheit anderer Informationen, sich in der Feststellung des mutmaßlichen Willens des Patienten zum aktuellen Zeitpunkt an früheren Betreuungswünschen oder vorsorglichen Verfügungen zu orientieren. Die Fragen sind so formuliert, daß dem Arzt die Begründungslast zugeschoben wird, wenn er von früher geäußerten Wünschen des Patienten abweichen will oder Betreuungssverfügungen und Vorsorgevollmachten nicht berücksichtigen will. 2. EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE LITERATUR 47 Das faktische ärztliche Moralverhalten scheint im wesentlichen mit dem in den 'Richtlinien' benutzten paternalistischen Modell konform zu gehen. 'Behandeln bis zum Ende' kann zu Übertherapie und unnötigem und verlängertem Leiden in der letzten Lebensphase führen. Forderungen, den herrschenden 'therapeutischen Aktivismus' durch eine 'emphatische Begleitung' zu ersetzen [Nolte 1993], sind selten. Vor- und Nachteile von Betreuungsverfügungen [BV] und Vorsorgevollmachten [VV] werden in der medizinischen Fachliteratur kaum diskutiert. Das Modell der 'value history' [Doukas und McCullough 1991; Doukas und Gorenflo 1993; Emanuel und Emanuel 1991] ist unbekannt und wurde erst kürzlich unter dem Namen Wertanamnese [WA] in die deutsche Diskussion eingeführt [Kielstein und Sass 1993a-c]; es ist zu früh, die Akzeptanz dieses Instruments durch Mediziner oder Patienten zu beurteilen. Weder bei Medizinern noch bei Laien sind Initiativen in Sicht, die eine verbreiterte Beschäftigung mit oder Verbreitung von Betreuungsverfügungen zur Folge haben könnten. Nur im politischen Raum wird, wie erwähnt, Informationsmaterial bereitgehalten, das aktiv und nachhaltig die Abfassung von Betreuungsverfügungen und die Benennung von Betreuern vorschlägt und Anregungen und Formulierungshilfen für beides gibt [BMJ 1992]. Eine wachsende Aufmerksamkeit für die Notwendigkeit einer wirksamen Schmerztherapie [Klaschik und Nauck 1993] und Studien zu den klinischen und psychologischen Aspekten des Sterbeprozesses [Rosemeier 1993] könnten langfristig unter Ärzten zu einer veränderten Einschätzung gegenüber der WA [Wertanamnese], der BV [Betreuungsverfügung] und der VV [Vorsorgevollmacht] führen. Die Hospizbewegung ist noch klein, wächst aber langsam und findet ihre Nische innerhalb eines Systems, das Sterbebegleitung und die Selbstbestimmung in der Nähe des Todes oder in Fällen von Koma und Demenz verdrängt hat [Pfisterer und Kottnik, 1993]. Beide groben Konfessionen, aber auch humanistische Gruppen haben Hospize eingerichtet; es gibt auch hospizähnliche Abteilungen als Unterabteilungen großer klinischer Versorgungseinrichtungen. Der Sinn einer 'Christlichen Patientenverfügung' beispielsweise wird vom Christopherus Hospiz Verein in München darin gesehen, 'einen Weg zwischen sinnloser Sterbensverlängerung und verzweifelter Lebensverkürzung aufzuzeigen'; der Landeskirchenrat der EvangelischLutherischen Kirche Bayerns spricht in dem Musterentwurf einer Patientenverfügung von den abzulehnenden Extremen 'sinnloser Sterbensverlängerung und christlich nicht verantwortbarer 48 Lebensverkürzung'. Weil sie sich als einzige gröbere Organisation dieser Problematik annimmt, dürfte auch die Zahl der über fünfzigtausend Mitglieder in der DGHS [Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben] künftig eher zu- als abnehmen. Diese Gesellschaft stellt ihren Mitgliedern eine nummerierte Broschüre mit Hinweisen zur Selbsttötung zur Verfügung [Atrott, 1990]; diese limitierte Ausgabe soll ähnliche Hilfsmittel und Methoden empfehlen, wie die von Humphry [1992] vorgeschlagenen, dessen Buch in deutscher Übersetzung erhältlich ist. Die DGHS wurde in den Medien stark kritisiert, als ihrem damaligen Präsidenten nachgewiesen wurde, daß er Zyankali zu überhöhten Preisen verkauft habe [Bönisch und Leyendecker 1993]. Vorschläge prominenter Juristen eines Arbeitskreises 'Alternativentwurf Sterbehilfe' [Baumann 1986], eine auf Wunsch eines schwer leidenden und dem Tode nahen Patienten erfolgende Hilfe zum Sterben nicht unter Strafe zu stellen haben weder unter Juristen noch im politischen Raum eine Mehrheit gefunden [Eser 1976; Schreiber 1986 und 1993; Hoerster 1989]. Der Bundesjustizminister empfiehlt die gemeinsame Benutzung der beiden Instrumente von BV und VV [BMJ 1992; vgl. Jürgens und Kröger 1992; Brückner 1989; Helmrich 1993] und macht Formulierungsvorschläge und Gestaltungshinweise. Die Autorität beider Instrumente im klinischen Alltag und im Gerichtssaal ist jedoch noch nicht getestet. Auf der einen Seite wird befürchtet, daß diese Formulare nicht praktikabel seien [Schick 1993 diskutiert das österreichische Szenario; Wassermannn 1993 argumentiert, daß ein beschleunigter Tod in Deutschland illegal sei], während Uhlenbruck [1989 und 1992] die Rechtmäbigkeit von BV und VV feststellt. Fragen der Selbstbestimmung auch am Lebensende und in bezug auf den eigenen Tod werden weniger direkt als vielmehr indirekt an der Schnittstelle von ethischen, medizinischen, rechtlichen und kulturellen Problemen diskutiert, für welche die Stichworte Tötung aus Mitleid, Sterben in Würde, Selbstbestimmung, Hippokratisches Ethos, Euthanasie und Holocost die jeweiligen Zentren der Debatte bestimmen. Diese Stichworte sind zugleich die Schlüsselworte, unter denen Problematik und mögliche Akzeptanz von WA, BV und VV indirekt diskutiert werden. Daß die Diskussion nicht direkt geführt wird wie beispielsweise in den USA [Bernat, 1993; Cate und Gill, 1991; Cogan et al, 1992; Doukas und McCullough, 1991; Doukas und Gorenflo, 1993; Emanuel und Emanuel, 1991; Emanuel, 1993; Finucane et al, 1993; Gibson, 1990; Grundstein-Amato, 1992; Pearlman et al, 1993; Seghal et al, 1992; Veatch, 1993; Walker, 1993], dürfte nicht darin liegen, daß Patienten den Diskurs wünschen und Ärzte ihn ablehnen, 49 sondern vielmehr an einer gemeinsamen Kultur der Verdrängung der Themen von Sterben, Schmerzen, Leiden und Abhängigsein. Insofern wird auch keine Spannung zwischen Recht und Moral empfunden oder eine Inkonsequenz darin gesehen, daß eine Selbstbestimmungskultur ausgerechnet für die Fälle von Koma, Demenz und in der Nähe des Todes der Diskussion über und der Einforderung von Selbstbestimmung ausweicht. 1. SCHLÜSSELWORT: TÖTUNG AUS MITLEID Während grundsätzliche Fragen und technische Details der WA, BV und VV selten Gegenstand öffentlicher Diskussion sind, findet eine erregte Diskussion immer dann in der Öffentlichkeit statt, wenn es wieder einmal zu einem spektakulären Fall von Mitleidstötung gekommen ist. Folgt man den Presseberichten, so erfolgt Töten aus Mitleid in der Absicht unnötiges Leiden dadurch zu beenden. Mitleid äußert sich darin, daß das Leben des leidenden Mitmenschen aktiv einem Ende zugeführt wird, häufig ohne den ausdrücklichen Wunsch des Getöteten. Schwestern und Pfleger, welche Patienten aus Mitleid 'von ihren Leiden erlösen', werden auch 'Todesengel' genannt. Nachfolgende Gerichtsverhandlungen werden kontrovers diskutiert. Im Vordergrund der Berichterstattung stehen emotionale Fragen: durch seelenlose Maschinenmedizin sinnlos verlängertes Leben / Leiden; Ärzte, die sich nicht menschlich um ihre Patienten kümmern; überarbeitetes Pflegepersonal, das mit den menschlichen Problemen des Umgangs mit dem dementen Alten oder dem unter Schmerzen leidenden Patienten allein gelassen sind. Mitleidstötung scheint die Funktion eines Überdruckventils zu haben, das für emotionalen Streb oder ethisches Empfinden Raum schafft innerhalb eines System, das selbst nicht oder nur unzureichend mit den Problemen von Sterben, Leiden und Tod umgehen kann und das nicht in der Lage ist, ethisch, medizinisch und rechtlich akzeptablere Formen des Umgangs mit dem nahen und nicht aufzuhaltenden Tod zu entwerfen. Mitleidstötung ist im wesentlichen eine heteronome Aktion, die von außen auf den mutmaßlichen Wunsch des Leidenden, 'erlöst' zu werden, reflektiert. Demgegenüber ist 'Tötung auf Wunsch' Ausdruck einer mitmenschlichen, entweder aus dem Prinzip der Hilfe oder dem des Mitleids, kommende Antwort auf eine Bitte. Die Tötung auf Wunsch antwortet auf eine autonome Nachfrage, möglicherweise auf einen Wunsch der situativ und spontan sein kann, von starken Schmerzen oder momentaner Depression beeinflußt und deshalb gegebenenfalls nicht im 'besten Interesse des Patienten'. Wenn bei den spektakulären Fällen die Sympathie der Öffentlichkeit auf der Seite der 'Todesengel' steht, wird in der Regel eine Unterscheidung 50 zwischen der Tötung aus Mitleid und der Tötung auf Verlangen nicht gemacht. Ethisch ist eine heteronome Tötung eines Mitmenschen, auch eines leidenden oder sterbenden, ohne dessen Zustimmung völlig unakzeptabel und wird auch in der Literatur von keiner Position vertreten. Wenn es um die Vermeidung der heteronomen Entscheidung über die Qualität oder den Wert des Lebens eines anderen geht, dann ist die Feststellung einer möglichen Zustimmung oder Akzeptanz der Tötung bei dementen oder sedierten Patienten eine mehr als nur technische Angelegenheit. Die Tötung auf Verlangen und ihre ethischen Parameter sind eher unter dem Prinzip der Selbstbestimmung abzuhandeln als unter dem des Mitleids. Innerhalb unserer Gesellschaft stehen sich unversöhnlich zwei Fronten gegenüber in bezug auf die Frage der Tötung aus Verlangen. Die eine Position wird durch den erwähnten 'Alternativentwurf Sterbehilfe' [Baumann 1986] sowie den Vorschlag für eine Neufassung des Paragraphen 216 des Strafgesetzbuches durch Hoerster vertreten: 'Die Einwilligung des Betroffenen schließt die Rechtswidrigkeit der Tötung nicht aus, es sei denn, daß wegen einer unheilbaren Krankheit des Betroffenen ein Weiterleben seinem Interesse widerspricht und daß die Tötung von einem Arzt vorgenommen wird' [Hoerster 1989:295]. Auf der anderen Seite wird das gesamte Konzept des intervenierenden und manipulierenden Umgangs mit Tod und Sterben fundamental kritisiert, weil es dem Betroffenen die Möglichkeit nimmt, das Leben und seine Grenzen bis zum äußersten zu erfahren. Bartholomäus-Leggewie beispielsweise fragt, ob die christliche Antwort auf das schwere Leiden von Mitmenschen wirklich in der Alternative 'Notschlachten oder Segnen' bestehe [1992], oder ob nicht die christliche Tradition der 'ars moriendi' andere Umgangsformen mit Sterben und Leiden kenne; sie erinnert in diesem Zusammenhang an die Benediktinische Regel, jederzeit mitten im Leben sich des Todes gegenwärtig zu sein; 'morem cotidie ante oculos suspectam habere' (RB4,47). Spaemann [1993] verlangt, daß das Tabu um Tod und Sterben nicht gebrochen werden sollte, und fordert, daß selbst die rationale Diskussion des Für und Wider der Intervention in den Sterbeprozeß, selbst in akademischen Kreisen, unterlassen werden sollte. Er sieht schon den Versuch, zwischen freiwilliger und unfreiwilliger, zwischen aktiver und passiver Euthanasie zu unterscheiden, als einen gefährlichen Schritt auf einem schlüpfrigen Wege an, der bei staatlich sanktionierter oder geforderderter Euthanasie enden könnte. Insbesondere kritisiert er die Argumente von Singer [1984] und Kuhse [1990] für eine vom Betroffenen verlangte 51 aktive Euthanasie und den 'Alternativentwurf Sterbehilfe' [Baumann 1986]. Heimann [1976] unterstreicht ebenfalls die weithin tabuisierte Grauzone, in welcher Tod und Sterben und damit auch Diskussion darüber sich ereignen. 2. SCHLÜSSELWORT: STERBEN IN WÜRDE Die Zahl der Publikationen aus den unterschiedlichsten weltanschaulichen Lagern ist nicht gering, die sich dennoch auf die theologischen, philosophischen und medizinischen Aspekte von Tod und Sterben einzulassen, insbesondere auch, um heilberuflich Tätige, Betroffene und Familienangehörige mit den besonderen Herausforderungen des Umgangs mit Sterben und Leiden zu konfrontieren [Atrott und Pohlmeier 1990; Böckle 1979; Hahn und Thoms 1983 (eine ostdeutsche Publikation); Salomon 1991; Schwartländer 1976 (beinhaltet Beiträge von Auer, Doelle, Eser, Heimann; Juengel; Schulz)]. Sporken war mit einer der ersten, der ausgehend vom Prinzip des Mitgefühls beschrieb, 'Was Sterbende brauchen' [1984]; andere folgten von unterschiedlichen Positionen aus, aber einig in der Ablehnung jeder Form von 'therapeutischem Aktivismus' [Kehl 1989; Koch 1992; Mattheis 1993; Muschaweck-Kürten 1993; Salomon 1991]. Einige Positionen stellen die Bedeutung der mitmenschlichen Kommunikation mit dem Sterbenden heraus [Haarhaus 1993; Muschaweck-Kürten 1993], entweder in Anlehnung an die christliche Tradition [Ebert und Godzik 1993], oder basierend auf Apels [1988] und Habermas [1983] Theorie der diskursiven Interaktion. Jüngel [1976] unterstreicht von protestantischer Seite her die Bedeutung der 'Lebensgemeinschaft' mit dem Sterbenden und Schwachen, eine Gemeinschaft, welche nach physischer und personaler Nähe verlangt, aber auch nach dem 'Wort', d. h. nach dem Zuhören und Zusprechen, auch nach dem gemeinsamen Lesen und Hören des biblischen Wort Gottes. Schon aus dieser christlichen Forderung nach einer Lebensgemeinschaft mit dem Sterbenden würde nach Jüngel jede Form der Mitleidstötung gegen die Prinzipien des Mitgefühls, der Hilfsbereitschaft und Geduld verstoben. Nur wenige Beiträge sind spezialisiert und diskutieren Würde im Sterben bei der Intensivbehandlung und in der Dialyse [Windels-Buhr 1990], bei der Behandlung von Krebspatienten [Stiefel und Senn 1993], in der palliativen Pflege [Klaschik und Nauck 1993] und der Geriatrie [Sass 1991b], Abschätzung von Aspekten der Lebensqualität bei Krebspatienten [Muthny 1993], psychiatrische Aspekte des Wunsches der Leidenden nach dem Tod [Helmchen 52 1993] oder Gebiete der Verweigerung von Nahrung oder Flüssigkeit für Sterbende [Strebel und andere 1993]. Die Achtung vor der Würde der Person muß nach Schobert, dem Generalsekretär der DGHS, [1993] 'Leidhilfe' und 'Freiheit der Wahl' einschließen und ist ohne diese beiden Prinzipien nicht denkbar. Eine vergleichbare, aber konservativere Position bezieht Hans Jonas [1984/85], der für das 'Recht auf Sterben' durch einen humanen Weg des 'Sterbenlassens' und die Unterlassung von leidensverlängernder Intensivmedizin plädiert. Ähnlich argumentiert der Moraltheologe Auer [1976], wenn er vordringlich eine Änderung des klinischen Verhaltens fordert und die Respektierung eines 'Rechts' auf einen 'natürlichen Tod'; moraltheologische Positionen von Böckle [1979] und der Römisch-Katholischen Bischofskonferenz [1975; 1993] stimmen in den Ruf nach dem 'Sterben in Würde' ein. Während die katholischen Bischöfe, ähnlich wie schon die Bundesärztekammer [1979], jede Form von aktiver Euthanasie ablehnen, denken liberalere katholisch-theologische Positionen wie die von Ranke-Heinemann [1987] auch über das christliche Verständnis von Freitod und Beihilfe zum Sterben nach. 3. SCHLÜSSELWORT: SELBSTBESTIMMUNG UND AUTONOMIE In der angelsächsischen Tradition sind vor allem die Positionen von Hume und Morus ausschlaggebend für eine Kultur der Akzeptanz von Freitod und freiwilliger Euthanasie [Timmermann 1993], während die kontinentaleuropäische Tradition stärker von Thomas von Aquins Ablehnung des Tötens in jeder Form als gegen das Naturrecht gerichtet (ThAq II-II,64,5) und Kants These, daß sich aus der regulativen Idee der Freiheit des Willens gerade nicht die Freiheit und das Recht zur Selbsttötung ableiten lasse [1785:395f; 1797:422ff; Römpp 1988; Wolf 1991:252] beeinflußt ist. Das Töten widerspricht nach Kant dem Respekt vor der Würde der Person, der fremden und der eigenen. Konsequent wird deshalb auch in der deutschen Sprachtradition durchgängig vom Selbst-'mord', nicht vom Freitod gesprochen. Man hat argumentiert [Wolf 1991], daß die kantische Argumentation dort nicht schlüssig sei dort, wo zur Bewahrung der Menschenwürde vor Folter und Erniedrigung Freitod oder Töten als die menschenwürdigere Option diskutierbar werden. Schopenhauer, der mehr als einmal mit Kant im Widerspruch lag, gibt ihm jedoch unter dem Einfluß indischen Denkens Recht, wenn er den Tod nicht als Erlösung vom Leiden oder als ein Instrument der Selbsterlösung akzeptiert [[Birnbacher 1985]; andererseits sah Schopenhauers Schüler Mainländer jedoch [1876; 1886] 53 den Freitod als die logische und angemessene Antwort der Selbsterlösung von unnötigem Leiden und von Weltschmerz an. Die klinische Psychiatrie hat die Benutzung der Begriffe von Selbstbestimmung und Autonomie im Zusammenhang mit dem Suizid als nicht akzeptabel kritisiert, da Suizidalität Ausdruck von Krankheit sei [Holderegger 1976; Helmchen 1993]. Wolf [1991] hält dem entgegen, daß (a) Fähigkeit zu risikobewußtem rationalen Urteilen, (b) realistisches Verständnis der Umwelt, und (c) angemessene Informationen als Voraussetzungen für freie und vernünftige Entscheidungen genügen und daß nicht jede Entscheidung zum Suizid als 'krankhaft' bezeichnet werden darf. Während einige Formen von Suizidalität in der Tat kein Ausdruck von Freiheit, sondern eher von schwerer geistiger Krankheit und von Unfreiheit sind, gibt es Formen von 'Depression', negativem Denken, Weltschmerz, unakzeptablem aggressiven Verhalten, bürgerlichen Ungehorsams und exzentrischer Lebensweise, die nicht medikalisiert werden sollten und die nicht in eine psychiatrische Klassifikation hineingehören, wenn wir nicht die Freiheit und Pluralität bürgerlichen und menschlichen Verhaltens auch in ihren nicht alltäglichen Formen ablehnen und durch klinische Uniformität ersetzen wollen. Philosophen wie Amery in 'Hand an sich legen' [1976] und mein Lehrer Kamlah in 'Meditatio mortis' [1976] verstanden und begründeten die Selbsttötung als absolute Form der Selbstbestimmung und als Sieg über Finalität, Leiden und Enttäuschungen im Leben, - beide endeten ihr Leben entsprechend zu einer von ihnen gesetzten Zeit im Freitod. Ihre Argumentationen sind nicht als WA oder BV zu verstehen, sondern als eine vorsorgliche vorweggenommene Erklärung einer von ihnen selbst geplanten späteren Tat, die lange vor ihrer Ausführung überlegt, begründet und geplant war. Auf beide Philosophen könnte die DGHS sich berufen, die zwar keine Beihilfe zur Selbsttötung oder Tötung leistet, aber ihren Mitgliedern Informationen für von der DGHS sicher angesehene Methoden der Selbsttötung zur Verfügung stellt, ebenso Formulare, 'Freitodverfügungen' genannt, auf welchen durch Unterschrift bestätigt wird 'Ich mache von meinem Recht Gebrauch, den Zeitpunkt meines Todes selbst zu bestimmen'. Die DGHS übernimmt den Rechtsschutz gegen eventuelle Wiederbelebungsmaßnahmen, wenn zwischen Erstunterzeichnung des Formulars und dem tatsächlichen Datum des Freitodes weniger als ein Jahr vergangen ist [DGHS 1992c]. Insgesamt spiegeln die philosophischen Stellungsnahmen zum Freitod das bunte Bild der Wertungen innerhalb einer pluralistischen Kultur wider; sie bewegen sich zwischen den 54 Extremen von Singer und Amery auf der einen und Spaemann auf der anderen Seite [DoelleOelmueller 1993]. Schwartländer [1976:31ff] unterscheidet im Autonomiebegriff eine Komponente von Herrschaft, die zur Ausübung von Macht sich berechtigt weiß, und eine andere von ethisch-rechtlicher Autonomie als einer Kategorie der Verantwortung; da es zur Autonomie der Verantwortung gehöre, Macht und Herrschaft zu begrenzen und zu begründen, könne ein 'Recht zum Sterben' gegenüber dem 'Rätsel des Lebens' nicht begründet werden. Ähnlich hatte Jonas [1984/5] argumentiert, wenn er es ablehnte, rationale Argumente für die Kriterien des Hirntodes als des personalen Todes des Menschen zu akzeptieren. Gegner des Suizids berufen sich gern auf Kant, während seine Anhänger Kant Inkonsequenz vorwerfen [Pieper 1993; Wolf 1991] oder sich auf utilitaristische Argumente berufen [Koller 1993; Kuhse 1990; Leist 1989]. Schreibt Pieper: 'Der Arzt, gebunden an sein Ethos des Heilens, kann sich nicht zum Anwalt des Todes machen, indem er dem Wunsch eines Patienten zu sterben, aktiv nachkommt. Aber er kann die Autonomie eines in klarem Bewußtsein zum Suizid Entschlossenen dadurch respektieren, daß er alle lebensverlängernden Maßnahmen unterläßt, ihn also nicht gegen seinen Willen zum Weiterleben zwingt'.[Pieper 1993:98] 4.SCHLÜSSELWORT: HIPPOKRATISCHE ETHIK Das Zitat der Philosophin Pieper leitet über zur Diskussion des hipppokratischen Ethos. Im wesentlichen gibt es zwei Argumente, mit denen jede Form einer aktiven Intervention in den Sterbeprozeß abgewiesen wird. Das eine ist die These, daß das hippokratische zum Heilen und zum Lindern verpflichte und zu nichts anderem, insbesondere nicht zum Töten. Das andere Argument ist das des 'slippery slope', daß eine einmal begonnene Akzeptanz und Praktizierung von sogenannter passiver Euthanasie schlieblich salamischeibenmäbig sich immer weiter von einer ursprünglich sehr restriktiven Handhabung ausweite zu einer immer größeren Zahl von Rechtfertigungen für das Töten. Lutterotti [1992 und 1993] weist hin auf die klinische Erfahrung, daß der Patient in der Regel weder an einer aktiven noch an einer passiven Euthanasie interessiert sei, sondern daran, die restliche Lebensspanne ohne Schmerzen und Unannehmlichkeiten verleben zu können, daß also eine gute palliative und menschliche Behandlung alles sei, was der Patient wolle und brauche. Er bringt fünf Argumente für das Tötungsverbot, eine Ablehnung jeder Form von aktiver Teilnahme an der Beendigung des Lebens, auch wenn es vom Patienten so gewünscht wäre: (1) Das Leben selbst ist nicht Gegenstand von Selbstbestimmung, daher sind 55 utilitaristische Argumente, die es selbst zur Disposition stellen, nicht durchschlagend. (2) Das ärztliche Ethos des Heilens und Linderns ist unvereinbar mit Töten. (3) Die weit überwiegende Zahl der Patienten will keine Diskussion über die Beendigung des Lebens; allerdings gibt es Ausnahmen. (4) Jede Form des Tötens durch Ärzte setzt eine Bewegung in Gang, die zu einem Vertrauensschwund gegenüber Ärzten und dem Ärztestand führen muß. (5) Das Tötungsverbot kann und darf nicht auf utilitaristische Argumente gestützt werden, weil solche sich historisch ändern könnten.- Die Argumente von Lutterotti fassen sehr gut die wesentlichen Argumente aus hippokratischem Ethos zusammen, die von einer groben Mehrheit der Ärzteschaft getragen werden. Auch Schmitz [1993:38] argumentiert, daß bei einem Eintritt in die Euthanasiedebatte die Sprache verrohe und die Kriterien des Tötungsverbotes zunehmend ausgehölt würden, daß deshalb in der Bundesrepublik keine Euthanasiedebatte, wie in den Niederlanden, geführt werden sollte. Die Ablehnung des Tötungsverbot schließt jedoch nicht aus, auf technisch mögliche Interventionen am Lebensende zu verzichten und sich auf eine gute palliative Behandlung, menschliche Zuwendung und Pflege zu konzentrieren. Dem würde auch Lutterotti zustimmen. Selten noch werden die besonderen durch die Situation bedingten Tugenden oder ethischen Prinzipien reflektiert, die in der Begleitungs- und Betreuungssituation vom Arzt und den pflegerisch oder heilberuflich Tätigen erwartet werden. Die Zahl der Publikationen, die sich diesen Themen widmen und die versuchen, differenzierte ethische und medizinische Herausforderungen in diesen Betreuungsszenarien zu entwickeln, scheint zuzunehmen [Klaschik und Nauck 1993; Nolte 1993; Mattheis 1993; Rosemeier 1993; Eid 1993; Storck 1993; Muschaweck-Kürten 1993]. Insgesamt bewegen sich die Vorschläge im Modell eines milden Paternalismus, der für diese Situationen den Schwerpunkt weg von der medizinischen Intervention (mit Ausnahme einer eher stärkeren Forderung nach der bestmöglichen palliativen Intervention) und hin zu einer patientenorientierten menschlichen und mitmenschlichen Kommunikation und Pflege. Zum Ausmessen der individuellen Bedürfnisse für Begleitung und Pflege werden in der Onkologie häufiger als in anderen Bereichen Lebensqualitätserhebungen durchgeführt [Aaronson u.a. 1991]. Die Benutzung von Wertanamnesen [Kielstein und Sass 1993] oder die Einforderung oder Beiziehung von Betreuungsverfügungen scheint eher die Ausnahme darzustellen. 56 Insgesamt scheint es keinen Konflikt zu geben zwischen den ärztlichen Standesorganisationen, den Ratschlägen der Kirchen, den Verlautbarungen der WHO und dem praktischen Moralverhalten der Ärzte, daß es unethisch sei, 'außergewöhnliche Maßnahmen' in aussichtslosen oder terminalen Situationen durchzuführen, insofern solche nur das Leiden verlängern, nicht aber den Heil- und Hilfsauftrag des hippokratischen Ethos erfüllen. Insbesondere, wenn der sterbenskranke, aber nicht entscheidungsfähige Patient den Verzicht auf ausschließlich lebensverlängernde Interventionen verlangt, sollten die 'menschlichen Fakten einfach akzeptiert' werden; eine solche Akzeptanz bedeutet weder Suizid noch Beihilfe dazu [Wolkinger 1993:48-53; Evangelische Kirche und Deutsche Bischofskonferenz 1989; Bundesärztekammer 1979; Bischofskonferenz 1975 und 1993]. 4. SCHLÜSSELWORT: EUTHANASIE Es ist nicht möglich, in Deutschland über die ethischen, gesetzlichen und kulturellen Dimensionen des Verzichts auf Intervention oder gar über den Beistand im Sterben zu diskutieren, ohne die Mißbrauchsgeschichte des Konzepts von Euthanasie und staatlich entworfene und durchgeführte Vernichtungsprogramme für sogenanntes 'lebensunwertes Leben' oder ethnische Minderheiten mitzubedenken. Heteronom wurde von einer kranken Ideologie und einem dämagogischen Paternalismus über 'Lebensqualität' und Lebenswert' von 'anderen' geurteilt. Weithin ist das Wort Euthanasie synonym mit dem Holocoust geworden. In seinem Namen wurden 'Krüppel' oder 'minderwertige Rassen' der Vernichtung durch die 'Herrenrasse' zugeführt. Auch diese Erfahrungen der dunklen Geschichte des Dritten Reiches haben Anlaß gegeben, vor einer Diskussion und Praxis des 'slippery slope' bei der Diskussion um die Euthanasie zu warnen [v. Engelhardt 1993; Schmuhl 1992; Hariba 1993]. Diese weitverbreitete Haltung mag auch der Grund dafür sein, daß angelsächsischen Befürwortern der freiwilligen Euthanasie wie Peter Singer [1984] oder Helga Kuhse [1990] nicht die Gelegenheit zur rationalen Diskussion ihrer Thesen gegeben wird [Schoene-Seifert 1991]. Von Singer selbst und im Ausland wird dieses 'Redeverbot' dann andererseits wieder in Verbindung mit dem Rede- und Diskussionsverbot unter den Nationalsozialisten gebracht. Am Umgang mit den Thesen von Singer, mehr noch in dem kulturellen Tabu der Nichtakzeptanz seiner Thesen durch Nichtdiskussion und Diskussionsverweigerung, zeigt sich das geschichtsbelastete Verhältnis deutscher Diskussionskultur zum Problembereich 'Euthanasie'. 57 Statt des generellen Streites um Verbot oder Notwendigkeit einer rationalen Diskussion, scheint eine differenzierende Benutzung des Wortes Euthanasie hilfreich zu sein, auch im Sinne einer differentialethischen Präzisierung dessen, was abzulehnen, was diskutierbar, und was individuell oder gesellschaftlich wünschbar ist [Wassermann 1993; Winau 1993]. An Vorschlägen hierzu, die auch von einer differenzierenden Diskussion um WA, BV und VV aufgegriffen werden könnte, mangelt es nicht. Dietrich von Engelhardt unterscheidet zwischen den Kategorien von Modus, Anlaß und Subjekt der Euthanasie und differenziert das Reden und Denken von Euthanasie wie folgt: 'physische (äußere) und psychische (innere) Euthanasie; aktive und passive Euthanasie; direkte und indirekte Euthanasie; Euthanasie mit und ohne Lebensverkürzung; Euthanasie durch den Arzt, Angehörige, Freunde, Betroffene; Euthanasie bei unheilbarer Krankheit, im Sterben, bei sozialer Not, politischer Verfolgung, geistigem Sinnverlust oder aus seelischer Verzweiflung. Euthanasie läßt sich ebensowenig mit nur einem Sinn identifizieren, wie es nicht möglich sein wird, auf den Ausdruck 'Euthanasie' wegen seiner Pervertierung während des Dritten Reiches zu verzichten. Diese Pervertierung ist aber nicht nur Vergangenheit, sondern begleitet als drohende Möglichkeit ständig das Denken und Handeln der Menschen' [1993:22]. Solche Differenzierungen sind hilfreich, weil sie die reiche Vielfalt dessen zu unterscheiden und zu bewerten erlauben, das in einer vom Tabu bestimmten Aufarbeitung der Vergangenheit sich der Differenzierung entziehen würde. Hilfreich ist auch der historische Blick in die Auseinandersetzung mit der Euthanasie, wie ihn Viefhues [1991] im Stoff ausgewählter Dramen und Novellen vorführt. Winau [1993:19-21] unterscheidet sehr hilfreich zwischen 'Hilfe beim Sterben' und 'Hilfe zum Sterben'. In der Hilfe beim Sterben macht er drei Differenzierungen: (1) Sterbehilfe ohne Lebenszeitverkürzung: 'alle Maßnahmen, die das Sterben des Patienten erleichtern, ohne dadurch weder den Zeitpunkt, noch die Ursache des Todes zu modifizieren; hierzu gehören schmerzlindernde, aber auch bewußtseinslähmende Mittel'. (2) Sterbehilfe mit Lebensverkürzung als Nebenwirkung: 'Hierunter ist vor allen Dingen die Gabe von Medikamenten zu verstehen, die neben ihrer therapeutischen Wirkung einen Einfluß auch auf die schnellere Herbeiführung des Todes haben können'. (3) Sterbehilfe mit beabsichtigter Lebensverkürzung: 'Hierunter ist vor allen Dingen zu verstehen die Gabe von Medikamenten mit dem ausgesprochenen Ziel, den Tod herbei zu führen'. In der Hilfe zum Sterben unterscheidet er 58 zwischen der Tötung auf Verlangen und der Tötung aus den heteronomen Kriterien des Tötenden. (1) 'Beschließen subjektiv wertlos gewordenen Lebens': das sind 'Selbstmord oder Beihilfe dazu'. (2) 'Ausmerzen objektiv wertlos gewordenen Lebens': 'auf der Basis der deutschen Entwicklung ist eine Frage der Vernichtung lebensunwerten Lebens' für Winau 'undenkbar'. Er unterstreicht, daß neben der 'Sterbehilfe' vor allem die 'Sterbebegleitung' stehen kann als eine nicht kontroverse Pflicht zu einer Handlungen, 'die es ermöglichen, mit dem Sterbenden gemeinsam den letzten Weg zu gehen. Dabei ist davon auszugehen, daß die Sterbebegleitung dem Menschen seinen eigenen Tod ermöglichen soll.' Eine andere Unterscheidung trifft Koller [1993:87], der nach Freiwilligkeit des Betroffenen sechs Differenzierungen macht: 'Passiv: freiwillig: sterbenlassen einer entscheidungsfähigen Person, die zu sterben wünscht; nichtfreiwillig: Sterbenlassen einer nicht entscheidungsfähigen Person ohne Lebensaussichten; unfreiwillig: Sterbenlassen einer entscheidungsfähigen Person gegen deren Willen. Aktiv: freiwillig: Tötung einer entscheidungsfähigen Person auf deren Wunsch; nichtfreiwillig: Tötung einer nicht entscheidungsfähigen Person ohne Lebensaussichten; unfreiwillig: Tötung einer entscheidungsfähigen Person gegen deren Willen.' Auch dies sind wichtige Differenzierungen, weil sie unterschiedliche Formen von Selbst- und Fremdbestimmung thematisieren. Insgesamt dürfte die notwendige Differenzierung im Begriff der 'Euthanasie' dazu beitragen (a) unterschiedliche klinische Szenarien der Sterbebegleitung aus ihren jeweils eigenen Parametern heraus und nicht im Rekurs auf den generellen Begriff von 'Euthanasie' zu bewerten, (b) prospektiv ethische und medizinische Szenarien von unterschiedlichem Grad technischmedizinischer Intervention bei gleicher menschlicher und mitmenschlicher Zuwendung zum Patienten zu entwerfen, (c) medizinisch mögliche und ethisch wünschbare Modelle der Intervention zu beschreiben, die in Richtlinien oder anderen Instrumente für die Hand von heilberuflich Tätigen aufgegriffen werden können, (d) Formulierungen und Konzepte zu entwickeln, die der weiteren Entwicklung von WA, BV und VV für die Hand des medizinischen Laien benutzt werden können. Es ist deshalb Winau gerade auch angesichts der dunklen nationalsozialistischen Geschichte zuzustimmen, wenn er das Thema der Euthanasie wieder zurückbindet an den ärztlichen Auftrag dem einzelnen Patienten gegenüber - aegroti salus suprema lex - und in diesem Zusammenhang auf die Funktion von Patientenverfügungen für die Ermittlung 'des 59 mutmaßlichen Willens' aufmerksam macht: 'Wenn wir dem Sterbenden das Recht auf den eignen Tod zuerkennen, dann auch das Recht, auf medikamentöse oder technische Hilfe zu verzichten. Solange der Patient seinen Willen äußern kann, ist dies kein Problem, problematisch wird ärztliches Handeln wenn dieser Wille nicht eindeutig sichtbar wird. Eine Patientenverfügung kann hier eine wesentliche Hilfestellung bieten, den mutmaßlichen Willen zu erkunden' [1993:21]. 3. VORLÄUFIGE ÜBERLEGUNGEN AUS ETHISCHER SICHT 1. Akzeptanz von Wertanamnesen, Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten Die Beiträge von Meran und Koch in dieser Broschüre äußern sich nicht gerade zuversichtlich, was die Akzeptanz von BV und VV unter Medizinern und Juristen betrifft. Beide Autoren skizzieren auch die Gründe, welche zur Zurückhaltung von Klinikern und Juristen bei der Akzeptanz oder auch nur Zurkenntnisnahme von BV und VV geführt haben. Die philosophische Diskussion um Freitod und 'Sterbehilfe' in der im engeren Sinne philosophischen und moraltheologischen Literatur ist kontrovers. Auf der einen Seite stehen christlich geprägte oder durch den kantischen Rigorismus beeinflußte Ablehnungen des Suizides und der aktiven vom Betroffenen erbetenen Euthanasie, selbst solche, die das Thema des Sterbens weiterhin in der tabuisierten Sprachlosigkeit lassen wollen. Demgegenüber stehen Positionen, die teils aus angelsächsischer Tradition [Hoerster 1989; Wolf 1991; Leist 1989], teils aus klassischem humanistischen Denken heraus [Kamlah 1976; Amery 1976] nicht nur den Suizid, sondern auch das Töten auf Verlangen ethisch rechtfertigen. Dazwischen befindet sich eine grobe Zahl von moraltheologischen, medizinethischen und medizinischen Positionen, welche, das 'Recht auf den eigenen Tod' durch eine sich am salus aegroti orientierende optimale Palliativmedizin und menschliche Zuwendung, aber eine je nach Einzelfall, dem Wunsch des Patienten oder seinem 'mutmaßlichen Willen' entsprechend, auf technisch mögliche Interventionen verzichten, wo sie primär eine Leidensverlängerung und nur sekundär eine Lebensverlängerung bedeuten würden [Böckle 1979; Winau 1993; Eid 1993; Storck 1993; Wolkinger 1993]. Wiederholte Meinungsumfragen widersprechen in gewisser Weise der kontroversen Diskussion unter Intellektuellen. Eine Umfrage von 1993 [sb 1993] hat bestätigt, daß 68% der Befragten die Forderung vertraten, daß sterbenskranken und schwer leidenden Patienten auf 60 ihren Wunsch hin 'Sterbehilfe' gewährt werden solle, 30% waren dagegen, nur 2% äußerten keine Meinung; interessant ist, daß die Zahl der Befürworter unter den CDU- und CSU-Wählern nur auf 58% zurückging, während der Anteil der Wähler von SPD und Grünen entsprechend höher lag. Die Meinungsumfrage hatte jedoch nicht, wie es wünschenswert gewesen wäre, präzisiert, was genau unter Sterbehilfe gemeint sein sollte [siehe oben 2.4.: Euthanasie]. 2. Wie sollten Wertanamnesen, Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten benutzt werden? Die Empfehlungen zur Anwendung des Betreuungsgesetzes [BMJ 1992] sehen den gleichzeitigen Entwurf und die gemeinsame Benutzung der beiden Instrumente von BV und VV vor. Beide Instrumente gemeinsam oder je allein sollen dem betreuenden Arzt bei Entscheidungskonflikten helfen, einen Rückschluß auf 'den mutmaßlichen Willen des Patienten' ziehen zu können. Dieser 'Wille' ist in einem solchen Fall durch eines oder beide Instrumente stellvertretend repräsentiert. Natürlich kann es zu Entscheidungskonflikten zwischen den Instrumenten und der Verantwortung des Arztes kommen; einige der Konflikte können durch verbesserte Instrumente auf der einen Seite und durch eine differentialethische Integration der Instrumente in die Gesamtdiagnose und -prognose entschärft werden, nicht alle. Neben die generellen Modelle von WA, BV und VV für die Hand des Gesunden können spezialisierte Instrumente für bestimmte chronische Krankheiten, auch Altersvorsorgeinstrumente für den Fall einer Demenz entworfen werden. Vor allem die neueren Modelle von wertanamnestischen Verfügungen [Kielstein und Sass 1993] könnten weiterentwickelt werden. Es sind Instrumente, die den Arzt nicht im Detail medizinischer Intervention bevormunden, was er in welchen Situation tun soll [Uhlenbruck 1992], sondern ihn vielmehr wissen lassen, wen er vor sich hat, welche Person mit welchen Werten, Wünschen und Hoffnungen, so daß er selbst aus der Bindung an diese zusätzlichen wertanamnestischen Informationen verantwortliche Schlußfolgerungen für die individuelle, nicht uniforme, Behandlung ziehen kann. Wertanamnestische Narrationen oder Listen allein schon, ohne den rechtlichen Charakter der Verfügung, können in der Betreuungssituation hilfreich sein für Entscheidungen zu einer individualisierten Betreuung. Unabhängig von der rechtlichen und medizinischen Bedeutung der Verlängerung von Selbstbestimmung in die Situationen von Koma, Demenz und Sterben hinein, hat aber die Beschäftigung mit WA, BV und VV für heilberuflich Tätige wie für medizinische Laien eine 61 nicht zu unterschätzende Funktion als Selbstzweck zur Verbesserung (a) der Vertrauenspartnerschaft in der Arzt-Patient Interaktion vor allem auch in der prädiktiven und präventiven Situation, (b) der Gesundheitsmündigkeit des medizinischen Laien durch die Beschäftigung mit Situationen, welche öffentliche Kultur und individuelles Selbst- und Weltverständnis allzuoft verdrängen, (c) der Beschäftigung mit Werten und Wünschen, welche in der Betreuungssituation gelten sollen und die im Gespräch mit dem vertrauten Arzt oder vertrauten Freunden diskutiert werden müssen. 3. Einfluß von Gesetzen auf faktisches Verhalten Der Einfluß der Gesetzgebung auf das faktische Verhalten von Ärzten und Patienten im Umgang mit WA, BV und VV scheint nicht sehr grob zu sein. Andere Faktoren bestimmen den Umgang mit Tod, Leiden und Sterben und die Diskussion um den rechten Umgang mit ihnen: Kultur, Religion, persönliche Werte oder berufliches Ethos, vor allem sich vielfältig überlagernde Tabus von der historischen Erfahrung des Mißbrauchs des Wortes 'Euthanasie' bis hin zu einem in unserer Zeit stärker ausgeprägten Widerwillen, sich überhaupt mit Situationen von Schwäche, Schmerzen und Sterben zu befassen und diese Dinge hinter die Mauern von Krankenhäusern und Pflegeheimen zu verstecken. Der Verzicht des Bürgers, in einer von Selbstbestimmung geprägten Gesellschaft die individuelle Selbstbestimmung auch in die Nähe von Koma, Demenz und Tod hinein so weit wie möglich zu sichern, spricht für das zeitgenössische kulturelle und ethische Tabu. Die häufige Flucht des Mediziners in die Möglichkeiten der Apparatemedizin ist ebenfalls kein Indiz für ein professionell und individuell enttabuisiertes Verhältnis zu Tod und Sterben, sondern ein Indiz für die Flucht vor dem Gespräch mit dem Patienten und die Reduktion des Gesprächs auf technische Informationen. Die Angst vor haftungsrechtlichen Konsequenzen bei Behandlungsverzicht oder -reduktion kann zum Teil auch als eine Fluchtbewegung aus der Sphäre der direkten und situativen Verantwortung für den konkreten Patienten interpretiert werden; die haftungsrechtlichen Grenzen für das ärztliche Handeln sind nicht so eng gezogen, als daß sich in ihnen nicht patientenorientiert menschlicher und medizinischer Beistand im Sterben leisten und verantworten liebe [vgl. Koch in diesem Band]. Angesichts der kulturellen und ethischen Unsicherheiten unserer individuellen, öffentlichen und medizinischen Kultur im Umgang mit Leiden, Schwäche und Sterben ist es verständlich, daß Selbstbestimmung, wenn auch nur ansatzweise, selten eingefordert und auch 62 selten angeboten wird. Die Konsequenz ist ein milder, die menschlichen und medizinischen Erfordernisse der Begleitung schwerstkranker oder sterbenskranker Patienten nicht selten verdrängender Paternalismus auf der Seite der Medizin und ein teils geduldiges, teils widerwilliges passives Ertragen und Compliance mit dem 'Unvermeidlichen', das man passiv an sich herankommen läßt. 'Wer klug ist, sorgt vor', heißt es in der Informationsbroschüre des Bundesministeriums für Justiz [BMJ 1993] über die Möglichkeiten des neuen Betreuungsgesetzes, Selbstbestimmung durch BV und VV in die Zukunft zu verlängern und zu sichern; der Bürger hat bisher das Angebot und den Rat nicht angenommen, der Arzt keinen Versuch zur Hilfestellung gemacht. Gröber als der Einfluß von bestehenden rechtlichen Regelungen oder Möglichkeiten, die Selbstbestimmung durch die Entwicklung und den Gebrauch von WA, BV und VV zu fördern, scheinen mir eine breitere öffentliche Diskussion über bisher tabuisierte Themen medizinischer Behandlung bei Demenz, Koma und am Lebensende zu sein. Wenn die Kultur das Verhalten bestimmt und nicht das Gesetz, dann wird nur eine Transformation von kulturellen und ethischen Prioritäten die Einstellung zu WA, BV und VV ändern. Noch wichtiger ist natürlich die Diskussion, Erarbeitung und Überprüfung von WA, BV und VV im ärztlichen Beratungsgespräch. Wäre es wünschenswert, von Seiten des Gesetzgebers oder der Träger der Gesundheitspflege Anreize für das Abfassen von BV und VV zu schaffen, um Entscheidungskonflikte im Interesse des Bürgers zu reduzieren und um überhaupt erst eine individuelle Betreuung sichern zu können? Wohl nur, wenn das Tabu sich brechen läßt und das eigentlich selbstverständliche Interesse des selbstbestimmungspflichtigen und -berechtigten Bürgers sich entfalten kann. Verbesserte Instrumente könnten helfen, das Tabu zu brechen. Interessant ist, daß von ärztlicher Seite bisher keine Versuche unternommen werden, die als unzureichend bezeichneten Instrumente zu verbessern. 4. Konfliktlösung: Recht und Verhalten im kulturellen Kontext Es scheint eher eine Frage der Aufklärung als der des Rechtes zu sein, den 'Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit' und Sprachlosigkeit angesichts von Koma, Demenz und Sterben zu wagen. Drei Fragenkomplexe lassen sich umreiben, innerhalb derer die weitere Geschichte von WA, BV und VV und mit ihr die Selbstbestimmung auch in diese dunklen Phasen des Lebens hinein sich entscheiden werden. 63 1. Veränderung. (a) Wie kann eine Veränderung der Einstellung zu Demenz, Leiden und Sterben erreicht werden? (b) Aus welchen Gründen (medizinischen, ethischen, rechtlichen, ökonomischen) ist eine Veränderung erwünscht? (c) Wer und wo sind die vermutlichen Träger künftiger Veränderung, Ärzte, Standesvertretungen, Patienten, Kassen oder der Gesetzgeber? (d) Wer will Veränderungen und welche? (e) Was kann der transkulturelle und internationale Vergleich mit Einstellungen und Regelungen andere Kulturen und Länder beitragen zur Analyse des Veränderungspotentials unserer Versorgungs-, Verhaltens- und Rechtssituation? 2.Werte, Wünsche, Verfügungen. (a) Wie verhalten sich aktuelle individuelle Werte und die Projektionen dieser Werte auf die Zukunft zu den tatsächlichen Werten und Wünschen innerhalb einer zukünftigen Situation? (b) Wie kann das Risiko des projektiven Entwurfs von Werten und Wünschen in eine unbekannte Situation hinein reduziert werden? (c) Welche Rolle kann das wiederholte Beratungsgespräch mit dem Arzt spielen, (d) welche die andauernde Kommunikation mit dem oder den potentiellen Betreuern? (e) Inwieweit kann eine optimale Palliativmedizin und eine gute menschliche und medizinische Begleitung chronischer Multimorbidität, Demenz und des Sterbeprozesses selbst die Notwendigkeit von BV und VV überflüssig machen oder reduzieren? 3. Realisierung und Implementierung. (a) Sollten nicht an WA und BV ebenso wie an Grundstücksverträge oder Testamente gewisse Formvorschriften geknüpft werden; wenn man vernünftigerweise kein kompliziertes Testament ohne die Hilfe eines Anwalts anfertigt, wieviel weniger sollte man eine BV ohne die Beratung und Hilfe durch einen erfahrenen Arzt des Vertrauens aufstellen können? (b) Welche Rolle können Kirchen oder Patientengruppen spielen bei der Durchbrechung des Tabus und der Entwicklung und Verbreitung von guten WA, BV und VV Instrumenten?, (c) welche Rolle die Ärzteschaft oder individuelle Ärzte und Fachärzte? (d) Könnte eine bessere Honorierung des ärztlichen Beratungsgesprächs mindestens vergleichbar derjenigen für eine einfache Sonographie Veränderungen in der Einstellung von Ärzten zum Beratungsgespräch im allgemeinen und zur Betreuungsverfügung im besonderen nach sich ziehen und damit auch mittelbar eine Einstellungsänderung beim Patienten bewirken? 64 LITERATUR Aaronson, N.K.; Ahmedzai, S.; Bullinger, M.. 1991. The EORTC core quality-of-life questionnaire. Interim results of an international field study. Effects of cancer on quality of life. D. Osoba ed., Boca Raton: CRC Press Amery, Jean. 1976. Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. Stuttgart: Klett Apel, Karl-Otto. 1988. Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral. Frankfurt Atrott, Hans H. 1990. Menschenwürdiges und selbstverantwortetes Sterben [nicht öffentlich erhältlich, nur für Mitglieder der Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben e.V., Postfach 110529, 86030 Augsburg, jede Kopie nummeriert] Atrott, Hans H.; Pohlmeier, Hermann, ed.. 1990. Sterbehilfe in der Gegenwart. Regensburg Auer, Alfons. 1976. Das Recht des Menschen auf einen 'natürlichen Tod'. Der Mensch und sein Tod. Johannes Schwartländer ed, Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 82-93 Bartholomäus-Leggewie, Lore. 1993. Notschlachten oder segnen?. Zeitschrift für medizinische Ethik 39: 90-94 Baumann, J. et al. 1986. Alternativentwurf Sterbehilfe. Stuttgart: Enke Bernat, Erwin. 1993. Das Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod. Zum Stand der Diskussion in den USA. Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod. Erwin Bernat ed, Graz: Leykam, 141-195 Binding, Kurt; Hoche, Alfred. 1920. Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form. Leipzig Birnbacher, Dieter. 1985. Schopenhauer und das ethische Problem des Selbstmordes. Schopenhauer Jahrbuch 66: 115-129 Bischofskonferenz, Deutsche. 1975. Das Lebensrecht des Menschen und die Euthanasie. Hirtenschreiben der Deutschen Bischöfe. Bonn Bischofskonferenz, Deutsche. 1993. Die Hospizbewegung - Profil eines hilfreichen Weges im katholischen Verständnis. Bonn: Deutsche Bischofskonferenz Böckle, Franz. 1979. Menschenwürdig sterben. Zürich: Benziger (Theologische Meditationen 52) Bönisch, Georg; Leyendecker, Hans. 1993. Das Geschäft mit der Sterbehilfe. Göttingen: Steidl Brückner, Christian. 1989. Was leisten Patientenverfügung und Freitoderklärung als Kommunikationsmittel zwischen Unterzeichner und Drittperson?. Schweizerische Ärztezeitung. 70: 1149-1158 Buckman, Robert. 1991. Was wir für Sterbende tun können. Praktische Ratschläge für Angehörige und Freunde. Zürich: Kreuz Verlag (engl. orginal 'I don't know what to say. How to help and support someone who is dying', Toronto: Key Porter 1988) Bundesärztekammer. 1979. Richtlinien für die Sterbehilfe. Deutsches Ärzteblatt 76 (14): 957-960 Bundesminister für Justiz. 1992. Das neue Betreuungsgesetz. Bonn: Bundesministerium für Justiz. Cate, Fred H., and Gill, Barbara A. 1991. The Patient Self-Determination Act. Implementation Issues and Opportunities. A White Paper of the Annenberg Washington Program. Evanston: Communications Policy Studies, Northwestern University. Cogan, R.; Patterson, B.; Chavin, S. et al. 1992. Surrogate Decision Maker Preferences for Medical Care of Severely Demented Nursing Home Patients. Archives of Internal Medicine 152: 1885-88. Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. 1992a. Betreuungsverfügung. Formblatt. Augsburg: DGHS 65 Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. 1992b. Patientenschutzbrief. Formblatt. Augsburg: DGHS Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. 1992c. Freitodverfügung. Formblatt. Augsburg: DGHS Doelle, Wolfgang. 1976. Der manipulierte Tod?. Möglichkeiten und Grenzen der Sterbehilfe in medizinischer Sicht. Der Mensch und sein Tod. Johannes Schwartländer ed, Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 45-60 Doelle-Oelmueller, Ruth. 1993. Euthanasie - philosophisch betrachtet. Ein Diskussionsbeitrag zu Argumenten von Spaemann und Singer. Zeitschrift für medizinische Ethik 39: 41-54 Doukas, David J., and McCullough, Lawrence B. 1991. The Values History. The Evaluation of the Patient's Values and ADs. Journal of Family Practice 32 (2): 145-153. Doukas, David J., and Gorenflo, Daniel W. 1993. Analyzing the Values History: An Evaluation of Patient Medical Values and ADs. Journal of Clinical Ethics 4 (1): 41-45. Ebert, Andreas, and Godzik, Peter, ed .1993. Verlab mich nicht, wenn ich schwach werde. Handbuch zur Begleitung Schwerkranker und Sterbender. Hamburg: Rissen Eid, Volker. 1993. Ethische Aspekte der Sterbehilfe - aus katholisch-theologischer Sicht. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 87: 55-65 Engelhardt, Dietrich von. 1993. Euthanasie in historischer Perspektive. Zeitschrift für medizinische Ethik 39: 15-25 Emanuel, Ezekiel J., and Emanuel, Linda L. 1991. Living Wills: Past, Present, and Future. Journal of Clinical Ethics 1 (1): 9-19. Emanuel, Linda. 1993. ADs: What Have We Learned So Far. Journal of Clinical Ethics 4 (1): 816. Eser, Albin. 1976. Der manipulierte Tod. Möglichkeiten und Grenzen der Sterbehilfe aus rechtlicher Sicht. Der Mensch und sein Tod. Johannes Schwartländer ed, Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 61-81 Eser, Albin, and Koch, Hans G. 1991. Materialien zur Sterbehilfe. Freiburg: Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. Evangelische Kirche in Deutschland, Deutsche Bischofskonferenz. 1989. Gott ist ein Freund des Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des Lebens. Gütersloh: Mohn Finucane, Thomas E.; Beamer B. A.; Roca, R. P. et al. 1993. Establishing Advance Medical Directives with Demented Patients: A Pilot Study. Journal of Clinical Ethics 4 (1): 51-54. Gibson, John M. 1990. Reflecting on Values. Ohio State Law Journal 51 (2): 451-71. Grundstein-Amato, Rivka. 1992. Value Inquiry: A Method of Eliciting Advance Health Care Directives. Humane Medicine 8: 31-39. Haarhaus, Friedrich. 1993. Anleitung zum Gespräch über das Kranken- und SchwerverletztenTestament. Die Schwester/Der Pfleger. 32: 814-816 Habermas, Jürgen. 1983. Moralbewubtsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt Hahn, Susanne; Thoms, Achim. 1983. Sinnvolle Lebensbewahrung - humanes Sterben. Auseinandersetzung mit dem ärztlichen Bewahrungsauftrag gegenüber menschlichem Leben. Berlin: VEB Verlag der Wissenschaften Hasiba, Gernot D. 1993. Euthanasie im Dritten Reich. Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod. Erwin Bernat ed, Graz: Leykam, 27-42 Heimann, Hans. 1976. Bewubtes und Unbewubtes über Tod und Sterben. Der Mensch und sein Tod. Johannes Schwartländer ed, Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 3443 66 Helmchen, Hanfried. 1993. Tötung auf Verlangen. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 87: 36-41 Helmrich, Herbert. 1993. Rechtliche Aspekte einer humanen Sterbebegleitung. Bonn: Konrad Adenauer Haus, manuscript Hoerster, Norbert. 1989. Tötungsverbot und Sterbehilfe. Medizin und Ethik, Hans-Martin Sass ed. Stuttgart: Reclam 287-295 Holderegger, Adrian. 1979. Suizid und Suizidgefährdung. Freiburg und Wien Humphry, Derek. 1992. In Würde sterben. Praxis Sterbehilfe und Selbsttötung. Hamburg: Carlsen (original edition 1991. Final Exit. Eugene, OR: The Hemlock Society) Jonas, Hans. 1984/5. Das Recht zu sterben. Scheidewege. Jahresschrift für skeptisches Denken 14: 10-22 Juengel, Eberhardt. 1976. Der Tod als Geheimnis des Lebens. Der Mensch und sein Tod. Johannes Schwartländer ed, Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 108-125 Juergens, Andreas; Kröger, Detlev. 1992. Das neue Betreuungsrecht. München: Beck Kamlah, Wilhelm. 1976. Meditatio mortis. Stuttgart Kant, Immanuel. 1785. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Akademie Ausgabe, vol IV Kant, Immanuel. 1797. Metaphysik der Sitten. Akademie Ausgabe, vol VI Kehl, Robert. 1989. Sterbehilfe. Ethische und rechtliche Grundlagen. Bern Kielstein, Rita; Sass, Hans-Martin. 1993a. Using stories to assess values and establish medical directives. The Kennedy Institute of Ethics Journal 3: 303-325 Kielstein, Rita; Sass, Hans-Martin. 1993b. Wertanamnese und Betreuungsverfügung. Instrumente zur Selbstbestimmung des Patienten und zur Entscheidungshilfe des Arztes und Betreuers. Bochum: Zentrum für Medizinische Ethik, 2. Auflage Kielstein, Rita; Sass, Hans-Martin, ed. 1993c. Materialien zur Erstellung von wertanamnestischen Betreuungsverfügungen. Bochum: Zentrum für Medizinische Ethik Kielstein, Rita. 1994. Wertanamnese und Patientenverfügung. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 88 Klaschik, Eberhard and Nauck, Friedemann. 1993. Erfahrungen einer Palliativstation. Deutsches Ärzteblatt. 90 (Heft 48) 3226-3230 Koch, Traugott. 1992. Sterbehilfe als Thema der Ethik. Diakonie 18: 230-236 Koller, Peter. 1993. Personen, Rechte und Entscheidungen über Leben und Tod. Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod. Erwin Bernat ed, Graz: Leykam, 71-95 Kuhse, Helga. 1990. Menschliches Leben und seine Würde. Bochum: Zentrum für medizinische Ethik Lauter, H. 1993. Tötung ohne Verlangen -Tötung bei unterstelltem Verlangen. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 87: 46-51 Leist, Anton, ed. 1989. Leben und Tod. Moralische Probleme bei Abtreibung, künstlicher Befruchtung, Euthanasie und Selbstmord. Frankfurt Lutterotti, Markus von. 1992. Der Arzt und das Tötungsverbot. Medizinrecht. (1): 7-14 Lutterotti, Markus von. 1993. Grenzen ärztlicher Behandlungspflicht und passive Sterbehilfe. Zeitschrift für medizinische Ethik 39: 3-14 Mainländer, Philipp. 1876/86. Philosophie der Erlösung, 2 voll. Frankfurt Mattheis, Ruth. 1993. Ethische Aspekte der Sterbehilfe - aus ärztlicher Sicht. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 87: 68-70 Muschaweck-Kürten, Petra. 1993. Sterbebegleitung. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 87: 9093 67 Muthny, Fritz A.; Koch, Uwe; Stump, Sylvia. 1993. Praxis und Bedeutung der Lebensqualitätsforschung für die Onkologie. Onkologie im psychosozialen Kontext. F. Muthny and G. Haag ed, Heidelberg: Asanger Nolte, Stephan H. 1993. Emphatische Begleitung und Beratung statt therapeutischem Aktionismus. Deutsches Ärzteblatt. 90 (40): C1773-1775 Pearlman, Robert A.; Cain, K. C.; Patrick, D. L. et al. 1993. Insights Pertaining to Patients Assessment of States Worse than Death. Journal of Clinical Ethics 4 (1): 33-41. Pieper, Anemarie. 1993. Stichwort 'Autonomie'. Zeitschrift für medizinische Ethik 39: 95-98 Pohlmeier, Hermann. 1993. Alternativentwurf. Sterbehilfe - eine psychiatrische Position. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 87: 85-90 Rainer, J. Michael. 1993. Zur Euthanasie in der griechischen und römischen Antike. Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod. Erwin Bernat ed, Graz: Leykam, 19-25 Ranke-Heinemann, Uta. 1987. Selbst- und Fremdtötung im Urteil der katholischen Moraltheologie. Humanes Leben - Humanes Sterben, 7 (2) Römpp, Georg. 198. Der unfreie Tod. Kant und die ethische Dimension des Suizids. Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie. 35: 415-431 Rosemeier, Hans-Peter. 1993. Zur Psychologie des Sterbens und des Todes. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 87, 76-100 Salomon, Fred. 1991. Leben und Sterben in der Intensivmedizin. Eine Herausforderung an die ärztliche Ethik. Lengerich: Pabst Sass, Hans-Martin. 1990. Training in Differential Ethics and Quality Control. Bochum: Zentrum für Medizinische Ethik Sass, Hans-Martin. 1991a. Ethische Expertise und Güterabwägung. Güterabwägung in der Medizin, Hans-Martin Sass and Herbert Viefhues ed. Heidelberg: Springer, 116-136 Sass, Hans-Martin. 1991b. Geriatrische Forschung und Ethik in der Medizin. Bochum: Zentrum für Medizinische Ethik Sass, Hans-Martin. 1992a. Risiko aus der Sicht der Medizinethik. Risiko. Klaus Giel, Renate Breuninger ed. Ulm: Humboldt Studienzentrum der Universität. 125-174 Sass, Hans-Martin. 1992b. Generalisierender Moralismus und Differentialethik. Politik und Kultur nach der Aufklärung. Festschrift für Hermann Lübbe. Kurt Röttgers ed. Basel: Schwabe 186-205 Sass, Hans-Martin; Viefhues, Herbert. 1989. Bochumer Arbeitsbogen für die medizinethische Praxis, Medizin und Ethik, H. M. Sass ed, Stuttgart 1989:371-375. Sass, Hans-Martin; Viefhues, Herbert. 1992. Differentialethische Methodik in der biomedizinischen Ethik. München: GSF-Forschungszentrum sb. 1993. Einstellung zur Sterbehilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Humanes Leben. Humanes Sterben. Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben. 13 (3): 1 Schaber, Peter. Recht auf den eigenen Tod?. Arbeitsblätter 1.93, Schweizerischer Arbeitskreis für ethische Forschung, no.29: 43-55 Schick, Peter J.. 1993. Todesbegriff, Sterbehilfe und aktive Euthanasie. Strafrechtsdogmatische und kriminalpolitische Erwägungen. Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod. Erwin Bernat ed, Graz: Leykam, 121-140 Schmitz, Philipp. 1993. 'Euthanasie' - verschiedene Wege ethischer Orientierung in einem christlichen Umfeld. Zeitschrift für medizinische Ethik 39: 27-40 Schmuhl, Hans-Walter. 1992. Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. Göttingen 68 Schobert, Kurt F.. 1993. Die Ehrfurcht vor dem Sterben. Humanes Leben - Humanes Sterben. 13 (4): 2 Schöne-Seifert, Bettina. 1991. Silencing the Singer. Antibioethics in Germany. The Hastings Center Report, 21 (6), 20-27 Schopenhauer, Arthur. 1819/1844. Die Welt als Wille und Vorstellung. Leipzig, vol 1 and 2 Schreiber, Hans-Ludwig. 1986. Das Recht auf den eigenen Tod. Zur gesetzlichen Neuregelung der Sterbehilfe. Neue Zeitschrift für Strafrecht, 337ff Schreiber, Hans-Ludwig. 1993. Tötung auf Verlangen. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 87: 3154 Schulz, Walter. 1976. Wandlungen der Einstellung zum Tode. Der Mensch und sein Tod. Johannes Schwartländer ed, Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 94-107 Schwartländer, Johannes. 1976. Der Tod und die Würde des Menschen. Der Mensch und sein Tod. Johannes Schwartländer ed, Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 14-33 Sehgal, A.; Galbraith, A.; Chesney, M. et al. 1992. How Strictly Do Dialysis Patients Want Their Advance Directives Followed? Journal of the American Medical Association 267: 59-63. Singer, Peter. 1984. Praktische Ethik. Stuttgart: Reclam Spaemann, Robert. 1992. Wir dürfen das Tabu nicht aufgeben. Die Zeit, Nr. 25, 12. Juni 1992: 14 Sporken, Paul, ed.. 1984. Was Sterbende brauchen. Freiburg, Basel, Wien Stiefel, F and Senn, H J. 1993. Euthanasie und fortgeschrittenes Tumorleiden. Zeitschrift für medizinische Ethik 39: 99-104 Storck, Hans. 1993. Ethische Aspekte der Sterbehilfe - aus evangelisch-theologischer Sicht. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 87: 66-67 Strebel, U., ed.. 1993. Herbsttagung der Schweizerischen Gesellschaft für Biomedizinische Ethik 'Gilt die Pflicht zu ernähren, bis zum Tode'. Schweizerische Rundschau Medizin (Praxis) 82: 1025-1058 Timmermann, Jens. 1993. Das Thema Sterbehilfe in Thomas Morus 'Utopia'. Bochum: Zentrum für Medizinische Ethik Uhlenbruck, Wilhelm. 1992. Selbstbestimmung im Vorfeld des Sterbens. Bochum: Zentrum für Medizinische Ethik. Veatch, Robert. 1993. Forgoing Life-Sustaining Treatment: Limits to Consensus. Kennedy Institute of Ethics Journal 3: 1-19. Viefhues, Herbert. 1990. Vom Himmel durch die Welt zur Erde. Zur Geschichte der Lebensqualität. Bochum: Zentrum für Medizinische Ethik Viefhues, Herbert. 1991. Das Motiv der 'Euthanasie' in der fiktionalen Literatur. Bochum: Zentrum für Medizinische Ethik Walker, Margret Urban. 1993. Keeping Moral Space Open. Hastings Center Report. 23 (2), 33-40 Wassermann, Rudolf. 1993. Begriffsbestimmung: Sterbehilfe, Sterbebeihilfe, Euthanasie, unterlassene Hilfeleistung, fahrlässige Tötung - aus juristischer Sicht. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 87: 13-18 Winau, Rolf. 1993. Begriffsbestimmung: Sterbehilfe, Sterbebeihilfe, Euthanasie, unterlassene Hilfeleistung, fahrlässige Tötung - aus ärztlicher Sicht. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 87: 19-21 Winau, Rolf. 1993. Der eigene und der fremde Tod. Überlegungen zur Geschichte der Sterbehilfe. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 87: 3-12 Williams, Virginia; Cockerill, Pamela. 1992. Dein Schmerz geht durch mein Leben. BergischGladbach. Lübbe (English original 1991 A Different Kind of Life. London. Doubleday) 69 Windels-Buhr, Doris, ed.. 1990. Grenzen der Behandlung in der Anästhesie, Intensivmeidizin, Dialyse. Lengerich: Pabst Wolf, Jean-Claude. 1991. Sterben, Tod und Tötung. Praktische Philosophie. Grundorientierungen angwandter Ethik. Kurt Bayertz ed. Reinbek: Rowohlt, S. 243-277 Wolff, Hanns-Peter. 1989. Arzt und Patient. Medizin und Ethik, Hans-Martin Sass ed. Stuttgart: Reclam, 184-211 Wolkinger, Alois. 1993. Todesbegriff, Sterbehilfe und aktive Euthanasie. Ein moraltheologischer Beitrag. Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod. Erwin Bernat ed, Graz: Leykam, 43-60 Zentner, Marcel R.. 1988. Der Selbstmord als Antwort auf das Leid bei Schopenhauer. Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie. 35: 433-448 70 Heft 93 PATIENTENVERFÜGUNG UND STELLVERTRETENDE ENTSCHEIDUNG IN RECHTLICHER, MEDIZINISCHER UND ETHISCHER SICHT Hans-Georg Koch Johannes Gobertus Meran Hans-Martin Sass 1996 71 AUTOREN: Dr. jur. Hans-Georg Koch, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i Br. Dr. med. Johannes Gobertus Meran, Hämatologische Abteilung der Medizinischen Hochschule Hannover, Hannover Prof. Dr. phil. Hans-Martin Sass, Institut für Philosophie, Ruhr Universität, Bochum, und Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, Washington DC Herausgeber: Prof. Dr. phil. Hans-Martin Sass Prof. Dr. med. Herbert Viefhues Prof. Dr. med. Michael Zenz Zentrum für Medizinische Ethik Bochum Ruhr-Universität 44780 Bochum TEL (0234) 32-22750/49 FAX +49 234 3214-598 Email: [email protected] Internet: http://www.medizinethik-bochum.de Der Inhalt der veröffentlichten Beiträge deckt sich nicht immer mit der Auffassung des ZENTRUMS FÜR MEDIZINISCHE ETHIK BOCHUM. Er wird allein von den Autoren verantwortet. Schutzgebühr: Bankverbindung: DM 10,Sparkasse Bochum Kto.Nr. 133.189.035 BLZ: 430 500 01 ISBN 3-927855-72-3 [1. Auflage Juni 1994; 2. Auflage April 1995; 3. Auflage April 1996] 72 73 ZUSAMMENFASSUNG: Die drei Beiträge dieses Bändchens beschreiben den Stand der deutschsprachigen Diskussion um Patientenverfügungen und Stellvertretende Entscheidungen aus rechtlicher, medizinischer und ethischer Sicht. Auf die Diskussion von Fällen folgen jeweils eine Analyse der einschlägigen Literatur sowie abschließende Bemerkungen des Verfassers. Es handelt sich um überarbeitete Vorträge im Rahmen eines von der Stiftung Volkswagenwerk im Frühjahr 1994 geförderten Symposiums zu Fragen von Recht und Verhalten an der Georgetown Universität, das die Problematik von Patientenverfügungen und Stellvertretenden Entscheidungen in transkultureller und interdisziplinärer Perspektive unter Beteiligung von Medizinern, Juristen und Ethikern aus Japan, den USA und der Bundesrepublik behandelte. ABSTRACT: The contributions by Koch, Meran, and Sass present legal, medical, and bioethical aspects of Advance Directives and Surrogate Decision Making in Germany. The papers discuss cases, examine the literature in their field, and review future issues and challenges. Earlier versions were presented at a symposium on Law and Behavior, sponsored by the Volkswagen Foundation and held at Georgetown University in the spring of 1994. The symposium addressed issues of Advance Directives and Surrogate Decision Making in a transcultural and interdisciplinary setting; it included physicians, legal experts, and ethicists from Japan, the US, and Germany. ISBN 3-927855-72-3 74 75