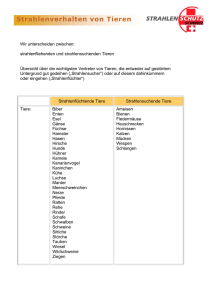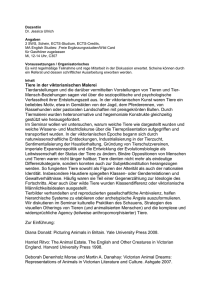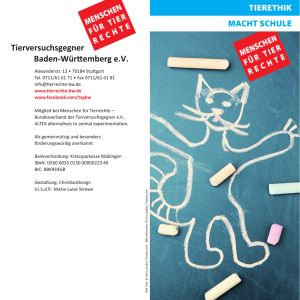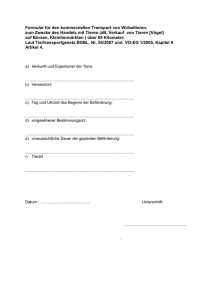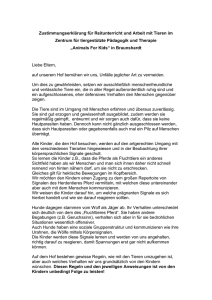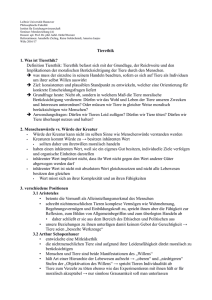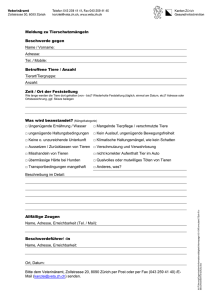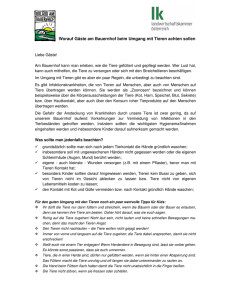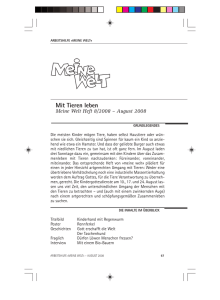Literaturbericht 2/2012
Werbung
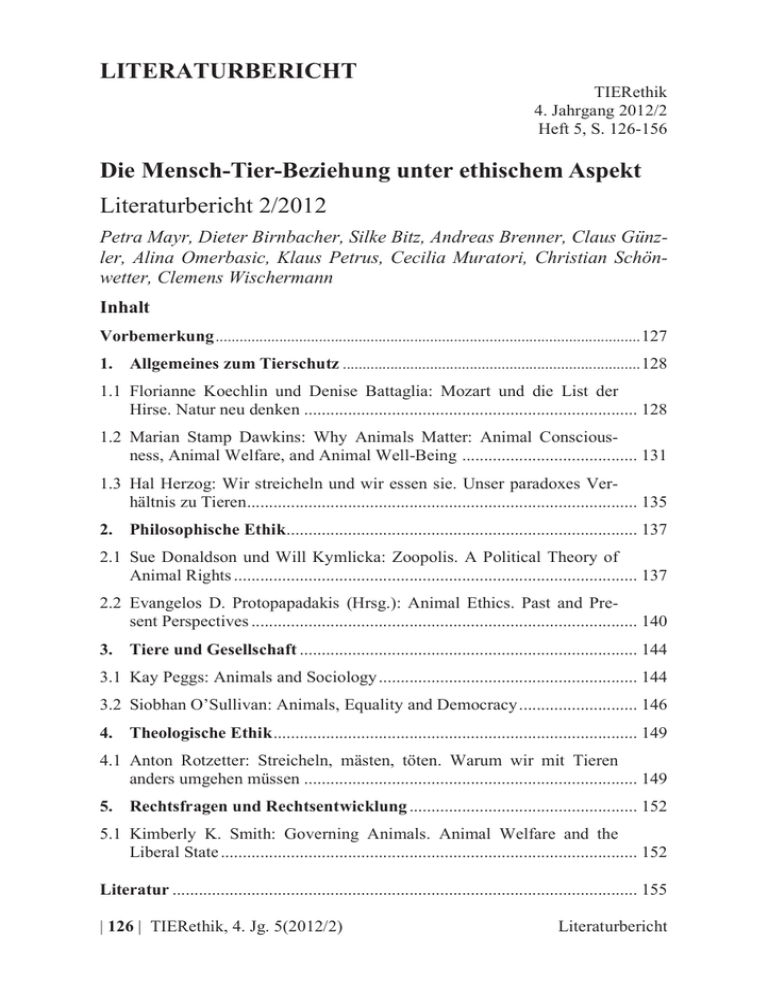
LITERATURBERICHT TIERethik 4. Jahrgang 2012/2 Heft 5, S. 126-156 Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt Literaturbericht 2/2012 Petra Mayr, Dieter Birnbacher, Silke Bitz, Andreas Brenner, Claus Günzler, Alina Omerbasic, Klaus Petrus, Cecilia Muratori, Christian Schönwetter, Clemens Wischermann Inhalt Vorbemerkung ........................................................................................................... 127 1. Allgemeines zum Tierschutz ........................................................................... 128 1.1 Florianne Koechlin und Denise Battaglia: Mozart und die List der Hirse. Natur neu denken ............................................................................ 128 1.2 Marian Stamp Dawkins: Why Animals Matter: Animal Consciousness, Animal Welfare, and Animal Well-Being ........................................ 131 1.3 Hal Herzog: Wir streicheln und wir essen sie. Unser paradoxes Verhältnis zu Tieren ......................................................................................... 135 2. Philosophische Ethik ................................................................................ 137 2.1 Sue Donaldson und Will Kymlicka: Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights ............................................................................................ 137 2.2 Evangelos D. Protopapadakis (Hrsg.): Animal Ethics. Past and Present Perspectives ........................................................................................ 140 3. Tiere und Gesellschaft ............................................................................. 144 3.1 Kay Peggs: Animals and Sociology ........................................................... 144 3.2 Siobhan O’Sullivan: Animals, Equality and Democracy ........................... 146 4. Theologische Ethik ................................................................................... 149 4.1 Anton Rotzetter: Streicheln, mästen, töten. Warum wir mit Tieren anders umgehen müssen ............................................................................ 149 5. Rechtsfragen und Rechtsentwicklung .................................................... 152 5.1 Kimberly K. Smith: Governing Animals. Animal Welfare and the Liberal State ............................................................................................... 152 Literatur .......................................................................................................... 155 | 126 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | Vorbemerkung Tierversuche haben in der Reihe der vielfältigen Tiernutzung offenbar einen Sonderstatus. Im Gegensatz zu anderen Formen der Verwendung von Tieren werden sie von sehr vielen Menschen aus ethischen Gründen abgelehnt. Das mag daran liegen, dass an ihnen die Verdinglichung von Tieren zum Objekt in offensichtlicher Weise praktiziert wird, vor allem aber daran, dass Tieren gezielt – wenn auch im Dienste der Wissenschaft – Leiden und Schmerzen zugefügt werden. Ausgehend von Tierversuchen lässt sich die Ambivalenz unseres Umgangs mit Tieren besonders gut verdeutlichen, was sich an der Verwendung derselben Tierart in allen Bereichen der Tiernutzung widerspiegelt. Ein Kaninchen kann sowohl als Versuchstier als auch zu Nahrungszwecken oder als Heimtier gehalten werden. Ähnliches gilt auch für andere Tierarten. Eben jenes eklatant ambivalente Verhältnis zu Tieren in unserer Gesellschaft ist in der Literatur zur Mensch-Tier-Beziehung zu einem Dauerthema geworden. Die australische Politikwissenschaftlerin Siobhan O’Sullivan kategorisiert in ihrem Buch Animals, Equality and Democracy jene Widersprüche als solche externer und interner Natur. Externe Widersprüche kennzeichnen dabei das Phänomen, dass in der Tierethik als Speziesismus bezeichnet wird, also die Tatsache, dass Menschen Tieren einen schlechteren moralischen Status gewähren als sich selbst, während unter internen Widersprüchen jene zu verstehen sind, wie sie oben benannt wurden, dass nämlich die gleiche Tierart eklatant unterschiedlich behandelt wird. Diese Ungleichheit gelte es zu beseitigen. Auch die Soziologin Kay Peggs thematisiert die Ungleichheit. Sie legt dabei aber einen anderen interessanten Schwerpunkt. In Animals and Sociology stützt sie sich auf die ihrem Fach zugrunde liegenden Kategorien von Ungleichheit, wie sie bei Menschen benannt werden, so etwa auf die Ungleichheit im Hinblick auf Geschlecht oder Klasse. Das hat zur Konsequenz, dass bei der Gegenüberstellung der Kategorien Mensch und Tier die Kategorie Mensch nicht mehr – wie bislang in tierethischen Ansätzen weitestgehend üblich – als homogene Gruppe betrachtet wird. Damit zerfällt die postulierte Gleichheit von Menschen an ihrer faktischen Ungleichheit bzw. Ungleichbehandlung. Peggs zufolge unterliegen sowohl Menschen als auch Tiere den gleichen Ausbeutungsmechanismen, die etwa wirtschaftlicher Natur sein können. Einen Ansatz, der die Staatsbürgerschaft für Tiere rechtfertigt, findet sich in Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights. Sue Donaldson und Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 127 | | Petra Mayr et al. Will Kymlicka, der sich vor allem als politischer Philosoph einen Namen gemacht hat, analysieren die Strukturen unseres Umgangs mit Tieren und kommen zu einem für die Tierethik einschneidenden Ergebnis. Gerade domestizierten Tieren, die in ganz besonderer Weise zu unserer Verwendung verfügbar gemacht wurden, schulden wir die Bürgerschaft, weil sie die Fähigkeit besitzen, ein subjektives Wohl zu haben und dieses mitzuteilen, und weil sie darüber hinaus fähig seien zu kooperieren. Donaldsons und Kymlickas Ansatz ist schon im Hinblick auf die Forderung nach Staatsbürgerschaft für domestizierte Tiere weitreichend. Mit einer Staatsbürgerschaft für domestizierte Tiere verbieten sich für menschliche Staatsbürger – das liegt auf der Hand – das Töten und der Fleischverzehr von Tieren. Noch bemerkenswerter erscheinen allerdings die für die „neuen Staatsbürger“ entstehenden Pflichten. Menschen seien nun dazu angehalten, domestizierten Tieren, soweit dies möglich sei, vegetarische Ernährungsalternativen anzubieten. Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights untersucht weder Interessen noch Fähigkeiten von Tieren, sondern vielmehr die verschiedenen Beziehungen, in denen die Gesellschaft zu Tieren steht. Aus eben jenen vielfältigen Beziehungen resultieren den Autoren zufolge unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen, die die Ambivalenzen im Umgang mit Tieren weitestgehend ausräumen könnten. 1. Allgemeines zum Tierschutz 1.1 Florianne Koechlin und Denise Battaglia: Mozart und die List der Hirse. Natur neu denken 233 S., Basel: Lenos, 2012, 23,90 EUR Dass Tiere soziale Wesen sind, wird, so sollte man meinen, niemand im Ernst bestreiten. Wie wenig ernst diese Aussage über die Tiere aber eigentlich genommen wird, zeigt ein Projekt am „Forschungsinstitut für biologischen Landbau“ (FiBL). Das FiBL in Frick, in der Nähe von Basel, ist ein mittlerweile international renommiertes Institut, das Alternativen zur etablierten Landwirtschaft erforscht. Koechlin und Battaglia haben für die Recherchen zu ihrem Buch weite Reisen unternommen, aber auch kurze, wie eben die zum FiBL nach Frick. Hier trafen sie Anet Spengler Neff. In ihrer Dissertation wies Spengler Neff nach, dass das physiologische und psychische Wohl| 128 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | befinden von Kälbern von den Kontakten mit Menschen beeinflusst wird. Wenn für die Kälber die erste und intensivste Begegnung mit dem Menschen während der Stanzung der Ohrmarke erfolgt, dann prägt sich diese schockhafte Erfahrung den Tieren ein. In Großställen aufgewachsene Kühe, die keine positiven Erfahrungen mit Menschen machen können, reagieren entsprechend aggressiv auf den Menschen. Für Spengler Neff ist die markante Zunahme von Fällen, in denen arglose Wanderer von weidenden Kühen angegriffen werden, auf dieses Manko an positiven Mensch-Tier-Begegnungen zurückzuführen. Spengler Neff und ihre Kollegin Johanna Probst wollten es daher genau wissen und untersuchten die Wirkung von Streicheleinheiten auf das Wohlbefinden der Tiere. Sie orientierten sich dabei an der von der kanadischen Verhaltensforscherin Linda Tellington-Jones entwickelten „Tellington-TTouch“-Methode. Tellington-Jones erprobte ab den siebziger Jahren an Pferden systematische Streichelbehandlungen. Diese gezielten Behandlungen wandten Spengler und Probst nun während einiger Wochen auch bei neugeborenen Kälbern an. Der Erfolg dieser Streicheleinheiten überzeugte: Gestreichelte Tiere erwiesen sich als eindeutig weniger nervös und sogar dem Menschen gegenüber zutraulich. Selbst auf dem Schlachthof fielen die gestreichelten Tiere durch ihre größere Ruhe auf, und bei Bluttests fand man bei den gestreichelten Tieren weniger vom stressanzeigenden Cortisol. Wissenschaftliche Untersuchungen dieser Art brauchen die WodaabeNomaden im Niger nicht. Die Biologin Florianne Koechlin und die Wissenschaftsjournalistin Denise Battaglia konnten sich selbst von dem innigen Verhältnis der Nomaden zu den Bororo-Zebus überzeugen. Die Wodaabe leben in enger Gemeinschaft mit ihren Tieren, sie reden viel mit den Zebus und teilen sogar das Essen mit ihnen: Die Wodaabe essen die gleiche Hirse wie ihre prächtigen Tiere, nicht selten sogar aus derselben Schüssel. Die Bororo-Zebus, die ihr Leben auf diese Art mit den Menschen teilen, sind so zahm, dass sogar sechsjährige Kinder als Hirten arbeiten und die großen Tiere mit ihren mächtigen Hörnern mühelos beaufsichtigen können. Wie eng die Beziehung zu ihren Zebus ist, zeigt sich auch darin, dass die Wodaabe den Stammbaum ihrer Tiere über viele Generationen im Bewusstsein haben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich mit jedem Zebu die Erinnerung an ein Kind verbindet: Zur Geburt erhält das Neugeborene ein weibliches Bororo-Zebu mit dem dann eine neue Herde aufgebaut wird. Beschreibungen wie diese ziehen sich durch das Buch von Koechlin/Battaglia und zeigen, dass es genug Gründe gibt, „Natur neu Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 129 | | Petra Mayr et al. (zu) denken“, wie es im Untertitel heißt. Die Biologin Koechlin, die sich vor Jahren in ihren Büchern Pflanzenpalaver und Zellgeflüster mit der Biokommunikation und Biosemiotik beschäftigt und die Pflanze als ein sehr waches und aktives Beziehungswesen zu sehen gelehrt hat, geht mit ihrem neuen Buch noch einen Schritt weiter und zeigt auf, dass man die Natur nur wirklich verstehen kann, wenn man sie in ihrer Gesamtheit betrachtet. Koechlin zieht hier mit ihrer begnadeten Co-Autorin Battaglia die Lehre aus Jacob von Uexkülls Umweltlehre: Natürliche Phänomene sind vollständig nur in ihrer Wechselwirkung mit anderen. Das zum Teil abgedroschene Wort von der Ganzheitlichkeit macht hier Sinn: Nur wenn wir die Wechselwirkungen von allem mit allem betrachten, werden die Ursachen unserer Probleme sichtbar. So hat man etwa am bereits erwähnten „Forschungsinstitut für biologischen Landbau“ (FiBL) nachgewiesen, dass natürlich gedüngte Böden als Kohlenstoffspeicher wirken, indem sie CO2 binden. Zusätzlich lockern die Regenwürmer, die in großer Zahl in solchen Böden vorkommen, durch ihre Tunnelbildung die Böden auf und leisten so einen Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit. Ganzheitlich betrachtet erweist sich dann auch das Argument, Kühe trügen mit ihren natürlichen Gasen zum Klimawandel bei, als falsch. FiBL-Direktor Urs Niggli rechnet vor, dass eine markant höhere Klimabelastung durch die intensive Viehwirtschaft und die dabei anfallende Gülle entsteht: Auf die Böden ausgebracht kann Gülle zur Freisetzung von Lachgas führen, das 300 mal klimaschädlicher ist als CO2. Zur Neubetrachtung etablierter Sichtweisen fordert auch der von Koechlin/Battaglia besuchte Gorilla-Forscher Jörg Hess heraus. Hess hatte während eines achtmonatigen Aufenthalts bei einer Familie von Berggorillas in Ruanda die Kommunikation von Gorillas erforscht. Während sich die Gorillas im Vergleich zum Menschen als bescheiden in der Lautbildung erweisen, beobachtete Hess, wie reich sie demgegenüber an anderen Kommunikationsformen sind: Neben der Mimik setzen die Gorillas Düfte, Gestik, Körperhaltungen, Bewegungen und Aktionen zu Kommunikationszwecken ein. Gemessen daran bezeichnet Hess den Menschen als einen „Sinnesrudimentler“. Das wohl spannendste an den vielen Naturbeobachtungen, die in diesem Buch geschildert werden und die unseren Blick auf die Natur verändern, ist wohl, dass das neue Weltbild sich fast von alleine ergibt. Wenn man einmal sieht, wie alles mit allem zusammenwirkt, erkennt man, dass das bisherige Denken, das stark von Hierarchien geprägt ist, geradezu widernatürlich ist. Statt der unzähligen Abgrenzungen, mit denen wir das Phänomen der Natur uns verständlich zu machen versuchen, erkennt man, | 130 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | dass das Denken in Verbindungen der Natur viel angemessener ist. Koechlin/Battaglia bringen diese Erkenntnis, die sie unter anderem auch in der riesigen ägyptischen Biolandwirtschaft Sekem erfuhren, die in der Wüste angelegt wurde, wie folgt auf den Punkt: „So wie ein Wald oberirdisch aus einzelnen Bäumen besteht, bildet er unterirdisch eine riesige, dicht vernetzte Lebensgemeinschaft.“ Andreas Brenner 1.2 Marian Stamp Dawkins: Why Animals Matter: Animal Consciousness, Animal Welfare, and Animal Well-Being 209 S., Oxford: Oxford University Press, 2012, 23,99 EUR Das neue Buch der Verhaltensbiologin Marian Stamp Dawkins gibt dem Leser den Eindruck, dass eine der einflussreichsten Debatten in der Geschichte der Philosophie noch nicht zu Ende ist: nämlich die Debatte über die Fähigkeit der Tiere zum bewussten Wahrnehmen. Sind sich die Tiere ihrer Wahrnehmungen bewusst, oder ist ihr Verhalten dem Funktionieren einer Maschine ähnlich? Das Ziel von Why Animals Matter ist es zu zeigen, dass das Problem des Bewusstseins keine Rolle im ethischen Umgang mit den Tieren spielen soll. Der Grund dafür sei, dass das Entziffern der Entstehung des Bewusstseins die Grenzen der heutigen Wissenschaft übersteige, so dass es nicht möglich sei, das Rätsel zu lösen, das schon Descartes’ Zeitgenossen für problematisch hielten: Sollten wir agnostisch bezüglich des Bewusstseins der Tiere bleiben? Es ist bekannt, dass Descartes’ Position schwerwiegende ethische Folgerungen hatte: In der Tat begleitete der Cartesianismus die Entwicklung der Vivisektion im 18. Jahrhundert als ihre philosophische Begründung. Stamp Dawkins meint dagegen, dass das Problem der Anerkennung des bewussten Handelns bei Tieren beiseitegelassen werden kann, ohne dabei auf eine tierethische Perspektive zu verzichten. Im Gegensatz dazu würde man dadurch die Zentralität eines anderen Arguments erkennen, nämlich dass das „Welfare“ der Tiere Hand in Hand mit dem strikt eigennützigen Interesse der Menschheit (z.B. dem Interesse an gesunden tierischen Speisen) gehe. Natürlich ist es in diesem Kontext von zentraler Bedeutung zu verstehen, was das Wort „Welfare“ bedeutet und in welchem Sinn die Menschen auf das „Welfare“ der Tiere achten sollen. Nach Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 131 | | Petra Mayr et al. Stamp Dawkins seien dabei die einzigen beiden leitenden Prinzipien, dass die Tiere gesund gehalten werden sollen und dass sie bekommen sollen, was sie wollen, nach dem im Buch (und selbst auf Stamp Dawkins’ Website: http://users.ox.ac.uk/~snikwad/index.html; Zugriffsdatum: 4. September 2012) wiederholten Motto: „Good welfare is achieved when animals are healthy and have what they want“. Aber was wollen die Tiere eigentlich? Stamp Dawkins plädiert dafür, dass die Neigungen und Präferenzen jeder Spezies (z.B. in Bezug auf die Nahrung) ‚wissenschaftlich‘ untersucht und bestimmt werden sollen um zu verhindern, dass man sich im Umgang mit den Tieren lediglich auf ‚anthropomorphe‘ Konzeptionen stützt, die sie virulent in ihrem Buch angreift (die Antwort von Marc Bekoff auf diesen Vorwurf ist hier exemplarisch dargestellt: www.huffingtonpost.com/marc-bekoff/animalconsciousness_b_1519000.html; Zugriffsdatum: 4. September 2012). Die Grundannahme scheint dabei zu sein, dass die ‚Wissenschaft‘ (und insbesondere die von Wissenschaftlern entworfenen Experimente) den Menschen einen ‚objektiven‘ Blick auf das innere Leben der Tiere, d.h. auf ihre Präferenzen, Neigungen, speziesgebundene Gewohnheiten und Charakteristika, ermögliche – und das scheint m.E. weit zu ‚optimistisch‘ zu sein: Letztendlich spiegeln sich immer die mentale Welt und die spezifische Art von Intelligenz, die Menschen besitzen, in der Konstruktion der Experimente und der Erwartung an die Ergebnisse (exemplarisch dafür sind die Beispiele, die Stamp Dawkins selbst im Kapitel ‚What Animals Want‘ schildert). Darüber hinaus scheint es vom ethischen Standpunkt unzureichend, das Leben der Tiere und das ethische Handeln auf nur diese beiden Prinzipien – gesundes Leben und spezifische Präferenzen – zu reduzieren. Hinter dieser Annahme könnte sich nämlich die Vorstellung verbergen, dass das Wohlbefinden, in diesem engen Sinn verstanden, das ganze Leben der Tiere ausmache: Es gäbe sozusagen nichts anderes im Leben eines Tieres als das. Wenn man zur selben Zeit behaupten will, dass die Wissenschaft die Geheimnisse der ‚animal consciousness‘ nicht durchdringen kann, ist dieser extreme ‚Reduktionismus‘ nicht haltbar. In der Tat, wie Stamp Dawkins selbst bemerkt, könnten diese Prinzipien auch für den Umgang mit Pflanzen geltend gemacht werden, und deshalb verwendet sie häufig im Buch Beispiele, die undifferenziert auf Pflanzen und Tiere appliziert werden können (exemplarisch auf Seite 125: „The skilled caretaker, whether of cows or tomatoes, will be able to spot the early warning and step in before any damage is done“). Hier ist die Tendenz bemerkbar, von einem tierethischen zu einem generellen | 132 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | umweltethischen Fokus überzugehen. Die einzige klare Grenze, die Stamp Dawkins zieht, ist diejenige zwischen Lebendigem und Nichtlebendigem. Obwohl die Autorin den Leser auf die Unterscheidung zwischen bewusster und unbewusster Wahrnehmung aufmerksam macht, tendiert sie letztendlich dazu, Bewusstsein und Wahrnehmung zu identifizieren, indem nicht nur das Bewusstsein, sondern auch die Wahrnehmung aus ihren Überlegungen ausgeschlossen werden. Die Folgerung ihrer Behauptung, dass man nicht versuchen soll, das Rätsel des Bewusstseins als Basis für ethisches Handeln zu verwenden, ist nämlich, dass weder die Zuschreibung des Bewusstseins noch die Fähigkeit der Wahrnehmung eine sichere Basis für die Begründung einer Tierethik anbieten – Pflanzen und Tiere enden damit auf der gleichen Ebene. Es gäbe als Folge keine sicheren Kriterien, um zwischen Pflanzen und Tieren oder zwischen verschiedenen Tierarten aus ethischer Perspektive zu unterscheiden. Der Mensch sollte einfach darauf achten, gesunde Tiere (oder Pflanzen) zu züchten, deren spezifische Lebeweise (wenn diese tatsächlich festzulegen möglich sei) nicht zu stark beeinträchtigt wird: Dieses Verhalten würde letztendlich die größten Vorteile für die Menschen bringen und – so lautet die These der Autorin – auch für die Tiere. Das kann mit dem Motto zusammengefasst werden „happy chickens are safer chickens“ (120) – es ist also offensichtlich, dass Stamp Dawkins keinen Widerspruch darin sieht, von der Gesundheit der Tiere auch in Bezug auf Zoos und Schlachthäuser zu sprechen, also Orten, wo der freien Entwicklung der Tiere strikte Grenzen gesetzt werden oder die sogar den Tod der Tiere als Zweck haben. Die Tiere sollen ‚happy‘ und gesund bleiben, bis wir entscheiden, dass wir sie essen wollen. Stamp Dawkins’ Überlegungen zum Tod (129) könnten darauf hinweisen, dass der Tod der Tiere in den Schlachthäusern kein ethisches Problem für sie darstellt, soweit Tiere ohne Quälerei getötet werden und sie bis zur Schlachtung ein gesundes Leben führen konnten: „As far as animals are concerned, ‚good welfare‘ is not generally taken to mean avoiding death […]. It is about what happens to them before they die. It is the journey, not the destination, that counts“. Eine praktische Anwendung dieses Kriteriums könnten die von Temple Grandin entworfenen Maschinen sein, um Tiere zu schlachten (sie nennt diese Prozedur „humane slaughter“; vgl. http://www.grandin.com/humane/rec.slaughter.html. Stamp Dawkins bezieht sich in ihrem Buch direkt auf Grandin, 178). Es ist darüber hinaus daran zu zweifeln, ob z.B. die Quadratmeter ‚wissenschaftlich‘ bestimmt werden können, die jedem Tier (z.B. in einem Zoo) zur Verfügung geLiteraturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 133 | | Petra Mayr et al. stellt werden sollten, um sein Leben gesund zu führen (oder, besser gesagt, damit die Tiere überleben?). Hinter solchen wissenschaftlichen Messungen könnte sich nämlich zwar keine anthropomorphe, aber wohl eine gefährliche anthropozentrische Konzeption verbergen: die Annahme, dass der Mensch mit seiner Wissenschaft belegen kann, wie das Leben jedes Tieres zu bestimmen sei, damit sich die größten Vorteile für den Menschen ergeben. Um von objektiven Vorteilen ‚für die Tiere‘ in diesem Rahmen zu sprechen, scheint zumindest eine tiefgründigere Argumentation nötig, die über die Applikation der erwähnten zwei Prinzipien hinausgeht. Wie schon Marc Bekoff bemerkt hat, könnte die Grundidee von Stamp Dawkins, nach der die ethische Behandlung von Tieren unabhängig von der Zuschreibung des Bewusstseins zu machen sei, interessante Perspektiven öffnen (vgl. im schon erwähnten Online-Artikel: „There is something to the argument that we can have animal welfare without consciousness […], but there is ample evidence that many other animals are conscious and care about what happens to them […]“). Die Anwendung im Sinne von Stamp Dawkins’ ‚zwei Prinzipien‘ scheint aber eine nicht begründete Limitierung des Lebens der Tiere auf das Wohlbefindens (in diesem engen Verständnis des Wortes) zu verbergen: Ist diese Reduktion letztendlich die Folge des Beiseitelassens des „BewusstseinsProblems“? Wenn Tiere nur vom Blickwinkel des menschlichen Interesses aus betrachtet werden, bleibt die Annahme unbegründet (und unwahrscheinlich), dass die Tiere davon profitieren werden. Der Leser könnte sich auch fragen, warum die Tatsache, dass die Anerkennung des Bewusstseins keine Rolle aus ethischer Perspektive spielen soll, keine Konsequenzen für den Umgang des Menschen mit anderen Menschen haben soll. Wie die Autorin selbst sagt, kann man sich eigentlich nur des eigenen bewussten Zustandes und nie dessen eines anderen Lebewesens sicher sein: Der ‚Sitz‘ des Bewusstseins sei nämlich wissenschaftlich unauffindbar, bei Menschen wie bei Tieren. Stamp Dawkins erklärt aber, dass die Analogie logisch erlaubt sei, nach der ich annehmen kann, dass mein Gehirn so wie das Gehirn aller anderen Menschen funktioniere. Man könne also schließen, dass die (meisten?) Exemplare der Gattung ‚Mensch‘ über bewusstes Denken verfügen, während man im Fall von anderen Tieren nicht zu diesem sicheren Schluss kommen dürfe. Aber warum sollte man eine solche Analogie nicht ziehen dürfen, die sich auf (größere oder kleinere) Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen und anderen Tierarten stützten könnte? Wenn man die Möglichkeit dieses Gedankens ausschließt, bleibt nur eine Art der Beziehung mit Tieren: Sie | 134 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | können nur noch als Erzeuger von Gütern gesehen werden, die der Mensch (aus)nutzt. Cecilia Muratori 1.3 Hal Herzog: Wir streicheln und wir essen sie. Unser paradoxes Verhältnis zu Tieren 320 S., München: Carl Hanser Verlag, 2012, 19,90 EUR Das paradoxe Verhältnis von Menschen zu Tieren wird dem Leser plastisch vor Augen geführt. Kaum ein Leser dürfte sich in einer der geschilderten Situationen nicht wieder finden. Die Wahrnehmung von Fleisch überschreibt der Anthrozoologe Hal Herzog in einem eigenen Kapitel mit „Lecker, gefährlich, eklig und tot“. Wie konträr die Ansichten zu Fleisch sein können, verdeutlicht er mit zwei Zitaten. So äußerte J.M. Coetzee: „Sie fragen mich, warum ich kein Fleisch esse. Ich dagegen bin erstaunt, dass Sie den Leichnam eines toten Tiers in den Mund nehmen, erstaunt, dass Sie es nicht eklig finden, einen zerhackten Körper zu kauen und den Saft aus toten Wunden zu schlucken.“ Dagegen symbolisiert Homer Simpson, eine der Hauptfiguren der Fernsehserie „Die Simpsons“, den Inbegriff des Stereotyps, das die allem Anschein nach nicht reflektierte und sicherlich bequemere Ansicht der breiten Masse widerspiegelt: „Alle normalen Menschen lieben Fleisch. Mit Salat macht man sich keine Freunde.“ (191) Mit viel Sachverstand und eigenen Erfahrungswerten führt uns der Autor Hal Herzog, Mitbegründer der Anthrozoologie und Professor für Psychologie an der Western Carolina Universität, in die Abgründe unseres Missverhältnisses zu Tieren. Auf der einen Seite empfinden viele Menschen Hahnenkämpfe als Tierquälerei; auf der anderen Seite wird an das grausame Schicksal, das das Huhn durchlebt hat, bevor es tot auf dem Teller liegt und verspeist wird, kein emotionaler Gedanke verschwendet. Den Ausführungen des Autors zufolge übt die Kultur den wichtigsten Einfluss darauf aus, ob wir ein Nahrungsmittel köstlich oder abstoßend finden. Das Tabu des Fleisches dieser Tiere basiert jedoch weniger auf tierschützerischen Aspekten als auf einem Vorteilsdenken des Menschen. So nimmt man an, dass Schweinefleisch für Muslime verboten ist, um sie vor Trichinen zu schützen. Die Verehrung der Kühe bei den Hindus in Indien könnte entsprechend darin begründet liegen, dass erkannt wurde, Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 135 | | Petra Mayr et al. dass die Kühe beim Pflügen der Felder mehr Nutzen erbringen als als Fleischlieferant. 1966 wurde in den USA der Animal Welfare Act (ein Tierschutzgesetz) verabschiedet. Nach Aussage des Autors sind die juristischen Winkelzüge dieses Gesetzes ein typisches Beispiel für die komplizierte Haltung des Menschen zu anderen Gattungen. Weiter wird ausgeführt, wie seltsam die an sich klare Frage: „Was ist ein Tier?“, gesetzlich geregelt wird. So heißt es in diesem Tierschutzgesetz „Mit dem Begriff Tier werden lebende oder tote Hunde bezeichnet, Katzen, nicht menschliche Primaten, Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen […], die zu Forschungsoder Lehrzwecken, für Tests, Experimente, Demonstrationszwecke oder als Haustier verwendet werden […] Die Bezeichnung schließt folgende Arten aus: Vögel, Ratten […] und Mäuse […], die für die Verwendung in der Forschung gezüchtet wurden“ (243f.). Der Autor merkt an, dass es aufschlussreich sei, wie das Tierschutzgesetz Tiere, die die meisten Menschen nicht mögen, im Vergleich zu unserem besten Freund, dem Hund, behandelt. Tote Hunde genießen demnach sogar mehr Schutz als lebendige Mäuse. Herzog geht der Frage nach, inwieweit sich Frauen und Männer tatsächlich in ihrer Neigung zur Tierliebe unterscheiden. Einerseits bestätigt sich das Klischee, dass Frauen in Teilen emotionaler bezüglich Tieren sind, darin, dass nach der Erfahrung des Autors alle aktiv an Hahnenkämpfen beteiligten Personen, die er kennenlernte, Männer und eine große Mehrheit der Tierschutzaktivisten Frauen waren. Bei näherer Betrachtung kam er jedoch zu dem Schluss, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Tierliebe geringer sind, als allgemein angenommen wird. Zur Verdeutlichung nennt er verschiedene Studien, denen zufolge in den Vereinigten Staaten etwa gleich viele Männer wie Frauen ein Haustier haben und die Neigung, diesen an Feiertagen Geschenke zu machen, vergleichbar ist. Einer Untersuchung von Anthrozoologen zufolge, die anhand eines standardisierten Fragebogens den Geschlechterunterschied wissenschaftlich erörtert haben, liegen Frauen in Sachen Tierliebe zwar etwas vorn, jedoch nur unerheblich. Auf dem Bucheinband heißt es über das Werk: „Ein Parforceritt durch das ethische Minenfeld der Mensch-Tier-Beziehungen. Nach der Lektüre dieses Buches denken Sie nicht nur anders über Tiere, sondern auch über sich selbst.“ Dabei straft der Autor nicht mit Vorwürfen oder mahnenden Worten; vielmehr ist es ihm gelungen, dazu anzuspornen, über banal erscheinende Alltagsbegebenheiten nachzudenken, die unseren – wie sich | 136 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | zeigt – oft gedankenlosen Umgang mit Tieren angehen, ja, sogar eine unterhaltsame Lesereise zu gestalten. Die Kombination des Offenlegens tiefgründiger Missverhältnisse von uns Menschen, das Lebensrecht der Tiere betreffend, mit einer ordentlichen Portion Humor erleichtert die Reflektion über das eigne Tun: eine insgesamt empfehlenswerte Lektüre, vor allem für die Menschen, denen bislang das menschliche Paradoxon in der Tier-Mensch-Beziehung nicht bewusst war. Jeder kann sich leicht in die geschilderten Beispiele hineinversetzen und seine eigene Einstellung zu Tieren überdenken und im Optimalfall im Alltag berücksichtigen. Aber auch diejenigen, die bereits eine Lebenseinstellung haben, bei der Tiere nicht in die Gruppen „lebensbzw. liebenswert“ oder „Gebrauchsgegenstand bzw. Genussmittel“ kategorisiert werden, finden reichlich Wissenswertes. Die zahlreichen Quellenangaben bieten die Möglichkeit, je nach eigenen Interessen bestimmte Fragen weiter zu vertiefen. Silke Bitz 2. Philosophische Ethik 2.1 Sue Donaldson und Will Kymlicka: Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights 329 S., New York: Oxford University Press, 2011, 24,00 EUR Inspiriert durch Jennifer Wolchs Idee der „Zoopolis“ weisen die Autoren Sue Donaldson und Will Kymlicka den Weg zu einer neuen, politischen Tierrechtstheorie. Die geteilte Annahme mit bisherigen Tierrechtspositionen besteht darin, dass Tiere als „vulnerable selves“ zu betrachten sind, die ein subjektives Erleben ihres Lebens in der Welt haben. Ihre Individualität gilt es anzuerkennen und durch unantastbare negative Rechte zu schützen. Demnach haben sie das Recht, nicht gequält, besessen, versklavt, eingesperrt oder getötet zu werden. Aber allein bei Forderungen nach Verboten von Zoohaltung, kommerzialisiertem Tierhandel und Tierexperimenten, den Hauptanliegen gegenwärtiger Tierrechtler, könne es nicht bleiben. Die üblicherweise geforderten universellen Rechte seien durch differenzierte, relationale Rechte zu ergänzen. Denn die Grundrechte von Tieren zu akzeptieren, heiße nicht, dass man alle Formen der Interaktion Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 137 | | Petra Mayr et al. zwischen Mensch und Tier stoppen müsse, geschweige denn könne. Bisherige Tierrechtstheoretiker haben es versäumt, unsere positiven Pflichten gegenüber Tieren anzuerkennen, welche sich aus der jeweiligen Art der Beziehung ergeben, so die Autoren. Natürlich bestehe der erste Schritt darin, jegliche Ausbeutung von Tieren zu stoppen; aber nun müssten wir uns fragen, wie nicht ausbeuterische Beziehungen zwischen Mensch und Tier aussehen könnten. Sehr bedacht erläutern die Autoren, wie Begriffe der politischen Theorie dabei helfen können, die unterschiedlichen Beziehungsformen, welche verschiedene Rechte und Pflichten implizieren, zu erfassen: Während domestizierte Tiere als Staatsbürger einer Mensch-Tier-Gesellschaft zu verstehen sind, leben Wildtiere in ihren eigenen souveränen Gemeinschaften. „Liminal animals“ hingegen leben als „denizens“ unter uns, ohne als vollwertige Bürger anerkannt zu werden. Sehr dezidiert räumen sie mit Klischees und Missverständnissen auf, die den Begriff der Staatsbürgerschaft betreffen, und zeigen, dass zumindest domestizierte Tiere die erforderlichen Fähigkeiten besitzen, um als eigenständige Akteure und Bürger aufgefasst werden zu können. Domestizierte Tiere seien in der Lage, ein subjektives Wohl zu haben und es mitzuteilen, sich aktiv in eine Gemeinschaft einzubringen und zu kooperieren. Darüber hinaus haben wir sie in unsere Gesellschaft gebracht, abhängig gemacht und ihnen somit andere Lebensformen entzogen. Demnach schulden wir ihnen nicht weniger als die volle Mitgliedschaft in unserer Gesellschaft. Die Bürgerschaft erweise sich als angemessenes konzeptuelles Rahmenwerk, um über relationale Rechte domestizierter Tiere nachzudenken. Diese umfasste dabei drei Kernelemente: Residenz, die Aufnahme in das souveräne Volk, dessen Interessen bei der Ermittlung des Allgemeinwohls zu berücksichtigen seien, und „agency“, d.h. die Möglichkeit, die Regeln des Zusammenlebens mitzugestalten. Aus dieser Mitgliedschaft ergeben sich weitere Rechte, wie das Recht auf Bewegungsfreiheit und Zutritt zu öffentlichen Plätzen. Demnach dürften wir sie nicht einsperren, und Verbotszonen seien abzuschaffen. Wir haben die Pflicht, ihnen sichere Räume und Wege einzurichten und sie vor Fressfeinden, Unwetter, Krankheiten und Unfällen zu schützen. Darüber hinaus sei die Nutzung tierischer Produkte auf das Maß zu beschränken, das die betreffenden Tiere selbst vorgeben, beispielsweise auf wenige Eier oder etwas Wolle. So hätten auch sie die Möglichkeit, ihren Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit zu leisten, aber eben nur so weit, wie sie können. Zumindest in westlichen Gesellschaften stelle der Verzicht auf die kommerzielle Nutzung tierischer Produkte kein Problem dar, da ge| 138 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | nügend Alternativen vorhanden seien. Die Autoren kommen zu dem erstaunlichen Schluss, dass man letztlich auch domestizierten Tieren Ernährungsalternativen schmackhaft machen müsse, denn ihr Bürgerschaftsstatus fordere, dass auch sie auf den Verzehr von Fleisch verzichten. Dies sei wiederum nur bei Katzen problematisch, da sie die einzigen Karnivoren unter unseren domestizierten Tieren seien. Das sind nur einige der weitreichenden Veränderungen, die mit der Zuschreibung der Bürgerschaft in einer gemischten Mensch-Tier-Gesellschaft einhergehen. Der Bürgerschafts-Ansatz habe den Vorzug, dass er die fundamentale Gleichheit aller Mitglieder der Gesellschafft betone und zeige, dass die Antwort auf die bisherige Situation nicht in der Reduktion von Fürsorge liegen könne – ganz im Gegenteil. Wildtiere hingegen seien unabhängig vom Menschen, und in der Regel suchen sie auch nicht seine Nähe. Dennoch bleiben auch sie von den Auswirkungen menschlichen Handelns nicht unberührt (Umweltveränderungen, Ausweitung von Acker- und Wohnflächen, Autobahnen, Flugund Schiffsrouten). Aufgrund dieses Einflusses erweise sich das von traditionellen Tierrechtlern proklamierte „let them be“ für den Umgang mit Wildtieren als ungeeignet. Durch den Souveränitäts-Ansatz würde ihnen das Recht zugesprochen, als autonome Gemeinschaft ein spezifisches Territorium zu bewohnen. Darüber hinaus verbiete die Anerkennung des Souveräns die Zerstörung ihres Lebensraumes und verpflichte uns dazu, angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu erarbeiten, um Schädigungen zu reduzieren (Verlagerung von Reiserouten etc.). Die Souveränität wilder Tiere zu respektieren, heiße, ihre Autonomie zu wahren und Raum zu bieten, in dem ihre Gemeinschaften wachsen und florieren können. Gleichzeitig grenze dies unsere Pflichten im Sinne von positiven Interventionen und Hilfeleistungen gegenüber Wildtieren ein. Es gebe durchaus akzeptable Formen der Intervention, die ihre Souveränität nicht verletzen, aber diese beschränken sich auf Hilfeleistungen für verletzte Tiere oder die Fütterung einzelner Individuen. In der Praxis sei noch viel zu klären, beispielsweise wie eine faire (Um-)Verteilung des Territoriums aussehen könne (dies erweist sich selbst im Fall menschlicher souveräner Gemeinschaften als Herausforderung) oder wie die Risiken bei überlappenden Territorien zu verteilen seien. Dennoch gebe es keinen Grund, Wildtiere nicht als souveräne Gemeinschaften aufzufassen und ihr Interesse an der Aufrechterhaltung ihres sozialen Gefüges und Territoriums nicht vor menschlichen Übergriffen zu schützen. Die bisherige Dichotomie zwischen domestizierten und Wildtieren ignoriere sogenannte „liminal animals“, also Wildtiere wie Mäuse, Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 139 | | Petra Mayr et al. Waschbären, Tauben und Eichhörnchen, die sich an ein Leben in menschlicher Umgebung angepasst haben und davon profitieren. Im Hinblick auf Nahrung, Unterschlupf und Schutz seien auch sie in verschieden starker Weise vom Menschen abhängig und durch sein Handeln verletzbar. Da jedoch kein kooperatives, kommunikatives und vertrauensvolles Verhältnis zwischen ihnen und Menschen bestehe, könnten sie nicht wie domestizierte Tiere als Bürger aufgefasst werden. Durch dieses lockere Verhältnis komme ihnen ein gewisser Hybridstatus zu, der mit entsprechend weniger Rechten und Verpflichtungen einhergehe. „Denizenship“ erfasse dieses Verhältnis in angemessener Weise: Wir haben nicht das Recht, sie zu sozialisieren oder zu regieren, und sie haben keinen Anspruch auf die Vorzüge der Bürgerschaft. Wir müssen akzeptieren, dass sie unter uns leben, und dürfen sie nicht einfach ausschließen oder töten. Dennoch könnten wir ihre Einwanderung in die Städte durch humane Mittel beschränken, beispielsweise durch Zäune oder aber indem man ihnen, etwas außerhalb, attraktivere Lebensräume schafft. Die hier ausgearbeitete Vision eines gerechten Zusammenlebens von Mensch und Tier fordert gerade dem Menschen viel ab, und dennoch könnte sich die „Zoopolis“, trotz tiefgreifender Veränderungen, letztlich als Bereicherung für beide Seiten erweisen. Sue Donaldson und Will Kymlicka haben mit diesem sehr gehaltvollen Buch jedenfalls einen bemerkenswerten Beitrag zur Tierethik geleistet und das überraschenderweise aus der sonst eher menschenfixierten politischen Philosophie. Alina Omerbasic 2.2 Evangelos D. Protopapadakis (Hrsg.): Animal Ethics. Past and Present Perspectives 295 S., Berlin: Logos Verlag, 2012, 29,00 EUR Der Band ist ungewöhnlich nicht nur dadurch, dass er zeigt, wie lebhaft inzwischen auch in Griechenland, dem Standort des diesjährigen Weltkongresses der Philosophie, tierethische Themen diskutiert werden. Er ist ungewöhnlich auch durch die Vielfalt der Themen (jeweils zur Hälfte historisch und gegenwartsbezogen), der Textsorten (von der systematischen Abhandlung [Warwick Fox] bis zum stilistisch geschliffenen Essay [Roger Scruton]), allerdings leider auch der intellektuellen Qualität: Manche der historischen Darstellungen gelangen kaum über die Niveau von Seminarreferaten hinaus; andere ergehen sich in ermüdenden kulturkritischen Rundumschlägen (Steven Best), während andere Beiträ| 140 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | ge konzise und anregende Argumentationen vortragen. Zu nennen sind hier insbesondere die akribische Analyse der Äußerungen Kants zum moralisch gebotenen Umgang mit Tieren von Filimon Peonidis (mit einer relativen Rehabilitation Kants gegen den pauschalen Vorwurf des Speziesmus) oder auch der Beitrag des Herausgebers zur (negativ beantworteten) Frage, ob und wie weit Tieren moralische Rechte zuerkannt werden können und sollen. Thematisch lassen sich die meisten Beiträge um die tierethischen Positionen von Peter Singer und Tom Regan herum anordnen, die beide jeweils mit repräsentativen Texten vertreten sind. Das Spektrum umfasst Begründungen für Vegetarismus und Veganismus (Gary L. Francione, Gary Steiner), Gründe, diese Gründe zu relativieren (Warwick Fox, Evangelos D. Protopapadakis), das Ausmaß, in dem (einige) Tiere in die moralische Gemeinschaft des Menschen aufgenommen werden sollten, aber auch innovative Grenzgänge, wie den Beitrag von Mark J. Rowlands, dem „Philosophen mit dem Wolf“, der die Frage diskutiert, wie weit Tieren Tugendbegriffe zugeschrieben werden können (hier wegen ihrer Nähe zur Tugendtheorie Aristoteles’ unter den historisch orientierten Beiträgen eingeordnet). Leider verweist Rowlands den Leser zur Begründung seiner zentralen These, dass Tiere sehr wohl moralische Tugenden (und entsprechend moralische Untugenden oder Laster) in einem nicht nur metaphorischen Sinn zugeschrieben werden können, auf eine andere Veröffentlichung, so dass der Leser mehr oder weniger raten muss, aus welchen Gründen er die aristotelische Forderung für überzogen hält, moralische Tugend setze nicht nur konsistente Verhaltens- und Motivationsmuster voraus, sondern auch die Fähigkeit, die fraglichen Motivationen bewusst zu steuern. Diese Fähigkeit ist ihrerseits nicht ohne Selbstbewusstsein und eine bestimmte – auf den Menschen beschränkte – Form von innerer Freiheit zu denken, mit der die Betätigung von Präferenzen aufgrund höher stufiger Präferenzen reguliert werden kann. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass Rowlands hierbei nicht zuletzt von den Bedeutungsunterschieden zwischen dem englischen „moral“ und dem deutschen „moralisch“ profitiert: „Moral“ erscheint sehr viel weniger an Reflexionsfähigkeit gebunden als „moralisch“. Auffällig an diesem Band ist nicht nur die enorme Diversität der tierethischen Positionen, sondern auch die Diversität der Auffassungen darüber, welche deskriptiven Sachverhalte für diese Positionen jeweils relevant sind. Während Vertreter radikaler tierrechtlicher Positionen wie Francione ausdrücklich bestreiten, dass sich dadurch, dass Tieren zwar Bewusstsein, aber kein Selbstbewusstsein zugesprochen wird, irgendetwas an ihrem Lebenswunsch im Sinne einer Präferenz für das WeiterleLiteraturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 141 | | Petra Mayr et al. ben ändert („conscious beings have an interest in not having consciousness end“, 260), entwickelt Warwick Fox in seinem sorgfältig argumentierenden Beitrag Gründe, hier differenzierter zu urteilen. Fox unterscheidet zwischen zwei Arten von Schädigungen, die bewusstseinsfähige Wesen durch Tod, Verletzung oder Krankheit erleiden können: Beeinträchtigungen ihres Wohlbefindens („pain and suffering“) und Verlust psychischer Fähigkeiten, wie der Fähigkeit zu einem zeitlich punktuellen oder zu einem zeitlich integrativen autobiografischen Selbstbewusstsein („temporally isolated sense of self-awareness“ bzw. „enduring temporally structured sense of self-awareness“, 201). Nicht nur dadurch können wir andere Wesen schädigen, dass wir ihnen eine Minderung ihres Wohlbefindens zufügen („affective harm“), sondern auch durch die Zerstörung oder Minderung ihrer Selbstbewusstseinsfähigkeit („autobiographical capacity harm“, sofern die Zerstörung oder Minderung das zeitlich integrative Selbstbewusstsein betrifft). Da die letztere Form von Schädigung allerdings nur bei Wesen möglich ist, die über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, kann bei Tieren, die in der Regel nicht darüber verfügen, die (schmerzlose) Tötung nicht als Schädigung zählen und deshalb auch nicht unter das Schädigungsverbot fallen. Wenn die Tötung von Tieren moralisch unzulässig ist, dann allenfalls aus indirekten Gründen wie der Wohlbefindensminderung bei Tieren im sozialen Umfeld des getöteten Tiers, etwa bei Menschenaffen, Meeressäugern und Elefanten (216). Von besonderem Interesse ist dabei die Argumentation, mit der Fox zu zeigen versucht, dass die Verfügung über ein autobiografisches Selbstbewusstsein an die Sprachfähigkeit als notwendige (aber nicht hinreichende) Bedingung gekoppelt sei, so dass damit ein empirisches Kriterium für die für sich genommen unbeobachtbare Selbstbewussteinsfähigkeit verfügbar werde. Anders als die entsprechende Argumentation von Jonathan Bennett in seinem Buch Rationality aus den 1960er-Jahren argumentiert Fox nicht begrifflich, sondern empirisch, indem er zwei (sehr kleine) Gruppen von Menschen in Augenschein nimmt: Menschen, die entweder taub geboren sind oder in früher Kindheit ertaubt sind und erst relativ spät (in Bezug auf die normale Sprachentwicklung) die Zeichensprache gelernt haben, und Menschen, die eine normale Sprachentwicklung durchlaufen haben, dann aber durch einen Schlaganfall ihre Sprachfähigkeit verloren und später so viel davon wiedergewonnen haben, dass sie über die Phase ohne Sprachfähigkeit Auskunft geben können. Das Ergebnis der Durchmusterung der Berichte von und über diese Menschen zeigt nach Fox, dass der Verlust der Sprachfähigkeit nicht nur | 142 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | die Äußerungsfähigkeit, sondern auch die Denkfähigkeit einschränkt und dabei vor allem das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, Vergangenes und Zukünftiges in einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Gegenwartserleben zu bringen. Durch den Ausfall der Fähigkeit zu einer symbolischen Bezugnahme mithilfe sprachlicher Zeichen auf nicht unmittelbar zugängliche Teile des eigenen Erlebnisstroms und zeitlich entfernte Wahrnehmungsobjekte seien das Selbstbewusstsein und die Reflexionsfähigkeit weitgehend auf die Bewusstmachung des jeweiligen Gegenwartserlebens eingeschränkt. Fox meint, diesen Zusammenhang auf Tiere extrapolieren zu können: Soweit Tiere nicht über Sprachfähigkeit verfügen, bedeute die Tötung für sie nicht die Zerstörung einer für sie ansonsten verfügbaren Fähigkeit und damit nicht die Zufügung eines ethisch substanziellen Schadens. Als die den vielen Beiträgen dieses Bandes gemeinsame Botschaft kann man vielleicht diese festhalten: Zu den wichtigsten Beiträgen, die die Philosophie in der Tierethik leisten kann, zählen die Kritik an pauschalierendem Denken und die Anmahnung von Differenzierung. Wie sich der biologische Artbegriff weit von der Vorstellung der biologischen Spezies als „natural kind“ wegbewegt hat (siehe den Beitrag von Stephen Clark zur „Ethik der Taxonomie“ in diesem Band, der u.a. zeigt, dass bereits Aristoteles diese Vorstellung relativiert), ist Differenzierung auch bei der Zuordnung von ontologischen und normativen Einstufungen von Tieren unterschiedlicher Entwicklungshöhe angesagt. Descartes’ dogmatische Zweiteilung der Welt, die ihn dazu brachte, allen Wesen, die nicht denken können, gleich auch die Empfindungsfähigkeit abzusprechen, darf in dieser Hinsicht als krasses Negativbeispiel gelten. Dieter Birnbacher Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 143 | | Petra Mayr et al. 3. Tiere und Gesellschaft 3.1 Kay Peggs: Animals and Sociology 177 S., Hampshire: The Palgrave Macmillan Animal Ethics Series, 2012, 81,99 EUR Die deutschsprachige Soziologie tut sich außerordentlich schwer mit dem Mitdenken von Tieren in sozialen Welten. Soziologie ist immer noch die Erforschung von Strukturen und Interaktionen der menschlichen Gesellschaft. Nun ist dies auch in der englischsprachigen Soziologie in der Regel nicht anders; auch dort ist die Soziologie in aller Regel auf den Menschen beschränkt. Wo sie soziale Differenzierungen thematisiert, geschieht dies vor allem im Blick auf die Abwertung bestimmter Gruppen von Menschen, während die Abwertung von Tieren als quasi naturgegeben akzeptiert wird. Dennoch gibt es in den letzten Jahren in der englischsprachigen Soziologie eine rasch wachsende, bei uns kaum bekannte Anzahl von Ansätzen theoretischer wie methodischer Art, denen es um die Einbeziehung von „other animals“ in die soziale Welt geht. Eine ausgezeichnete Einführung in dieses noch unabgeklärte neue Forschungsterrain vermittelt die britische Soziologin Kay Peggs in ihrem Buch Animals and Sociology. Animals, um mit der auf diesem Feld immer immens wichtigen Terminologie zu beginnen, sind bei Peggs Menschen und Tiere oder „human“ und „nonhuman animals“. Das ist in den Human-Animal-Studies gängiger Sprachgebrauch. Peggs zieht dennoch für Tiere den Begriff „other animals“ vor. Sie begründet dies damit, dass „nonhuman“ seinen Bezugspunkt eindeutig weiterhin beim Menschen nehme und damit die Tiere von vornherein in eine hierarchische Unterordnung geraten. Dies sei bei „other animals“ weniger der Fall, doch eine letztlich zufriedenstellende Terminologie sei auch das nicht. Die sprachlich bereits mitgeführten Definitionen und ihre Grenzziehungen bleiben schwierig. Erinnert sei an Jacques Derridas Versuch einer Neuschöpfung aus „animaux“ und „mot“ in „animot“. In der englischen Terminologie ist das Dauerproblem die Einbeziehung welcher Lebewesen unter welche Begriffe, wobei eine Entsprechung zum deutschen „Lebewesen“ (etwa „creature“) nicht diskutiert wird, damit natürlich auch Fragen pflanzlichen Lebens konsequent ausgeblendet bleiben. | 144 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | Peggs Einführung und Überblick entfalten sich in der Sprache klar und sehr gut lesbar, in der Sache systematisch aufgebaut und immer nachvollziehbar. Die Grundidee des Buches folgt keiner schlichten inhaltlichen Zusammenstellung von Forschungsfeldern, sondern entwickelt einen systematisch-kategorialen Zugang zu den Mensch-TierBeziehungen aus soziologischer Sicht. Deshalb führt Peggs zu Beginn jedes Hauptkapitels den Leser immer grundsätzlich in die jeweilige soziologische Kategorie ein (z.B. soziale Ungleichheit, Kriminalität, Raum etc.), um dann in mehreren Suchbewegungen zu fragen, wieso bislang in diesem Feld „other animals“ fehlen, was das in soziologischer Perspektive bedeutet, was es für Ansätze zur Überwindung dieser Ausblendung gibt und wie weit diese bislang in theoretischer und methodischer Hinsicht tragen. Um nur ein Beispiel zu geben, so sei auf Konzepte des symbolischen Interaktionismus verwiesen: Peggs leistet eine knappe Einführung in die Begründung der menschlichen Sprachgebundenheit seiner Grundannahmen, diskutiert die von einigen Soziologen vertretene Überwindung der Sprachgrenze in Richtung non-verbaler Kommunikation und stellt die sich daraus ergebenden methodischen Szenarien für die empirische soziologische Forschung vor. Animals and Sociology ist kein emotionaler Aufruf, sondern eine nüchterne Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in den entwickelten Industriestaaten (mögliche globale Unterschiede in Zeit und Raum werden allenfalls am Rande berücksichtigt). Diese Nüchternheit der soziologischen Perspektive ist vor allem auf einen durchgängigen Kunstgriff der Autorin zurückzuführen: Sie bricht systematisch die auch in den HumanAnimal-Studies noch weitgehend übliche Homogenisierung der „human animals“ zu den Menschen auf. Für soziale Analysen ist die Ebene der sozialen Ungleichheit zentral: Sie umfasst üblicherweise nur Menschen, diese aber in ihrem ungleichen Wert unter Kategorien wie „class“, „race“, „gender“ u.a. Wenn man die Untersuchung sozialer Ungleichheit nun um „other animals“ erweitert, dann, so fordert Peggs, muss man die Kategorien um „speciesism unequalities“ erweitern. Damit wird zweierlei erreicht: Erstens kommen auch andere Lebewesen als Menschen („other animals“, „non-human animals“) in die soziale Welt hinein. Zweitens wird die scheinbare Homogenität der Menschen aufgebrochen – „devalued“ sind nämlich nicht nur Tiere, sondern auch viele Gruppen unter den Menschen. Für alle gelten vergleichbare Mechanismen der Abwertung und Unterdrückung aus wirtschaftlicher Ausbeutung, politischer Beherrschung oder ideologischer Manipulation. Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 145 | | Petra Mayr et al. Animal and Sociology ist weit mehr als eine Zusammenfassung des Forschungsstandes, sondern vertritt selbst eine klare Idee, dass nämlich der Soziologie die „other animals“, die nichtmenschlichen Lebewesen fehlen. Peggs erläutert die Gründe, die zu diesem fehlenden Blick geführt haben, sowie die Konsequenzen und bleibt bei eindeutigem eigenem Standpunkt immer sachlich und unpolemisch. Was erstaunt, ist das weitgehende Fehlen der aktuellen Diskussion um Agency, Subjektivität und Selbst. Zu „Animal Selves“ gibt es gerade einmal eine Seite, aber die streift das eigentliche Problem nur. Während dem Einfluss des symbolischen Interaktionismus auf Mensch-Tier-Ansätze berechtigter Raum eingeräumt wird, kommen die Konsequenzen der empirischen Studien, nämlich die Etablierung eines tierischen Selbst, praktisch nicht vor. Dagegen argumentieren etwa Alger, Irvine oder Sanders, manche Tiere seien nicht nur zu symbolischer Interaktion mit Menschen fähig, sondern auch zur Entwicklung eines „Core-Self“ in Analogie zu Phänomenen der menschlichen Selbst-Bildung. Leider klärt uns die Autorin über die Gründe ihrer Selbst-Beschränkung, die einen gravierenden Tabubruch in der Subjektdefinition diskutieren könnten, nicht auf. Clemens Wischermann 3.2 Siobhan O’Sullivan: Animals, Equality and Democracy 213 S., Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011, 74,99 EUR Unser Umgang mit Tieren, so Siobhan O’Sullivan, werde von wenigstens zwei Ungereimtheiten geprägt. Die eine betrifft das Verhältnis zwischen uns Menschen und anderen Tieren. Dieser externe Widerspruch („external inconsistency“) kommt etwa dann zum Ausdruck, wenn wir gleichermaßen empfindungsfähige Wesen nur deshalb anders behandeln, weil einige von ihnen der Spezies homo sapiens angehören, die anderen dagegen bloß Tiere sind. Es sei diese Art von Ungereimtheit – üblicherweise auch „Speziesismus“ genannt –, mit der sich die Tierethik in den letzten Jahrzehnten besonders auseinandergesetzt hat. Allerdings mit bescheidenem Erfolg, wie O’Sullivan meint. Für sie ist die Vorstellung, dass sich der Mensch grundsätzlich von allen übrigen Tieren unterscheidet und daher moralisch mehr zählt als sie, derart tief in uns verankert, dass sich auf absehbare Zeit bezüglich des externen Widerspruchs nichts Grundsätzliches ändern wird. | 146 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | Die zweite Ungereimtheit bezeichnet O’Sullivan als internen Widerspruch („internal inconsistency“). Er betrifft die ungleiche Art und Weise, wie wir mit nichtmenschlichen Tieren umgehen. Auch das ist im Grunde ein längst bekanntes Phänomen: Während wir einige von ihnen hätscheln und vermenschlichen, sperren wir andere ihr Leben lang ein, mästen und schlachten sie. Dabei betrifft diese Ungereimtheit nicht bloß unterschiedliche Tierarten, die wir den (von Menschenhand gezimmerten) Kategorien „Haustiere“ und „Nutztiere“ zuordnen, wie etwa Hunde und Schweine. Vielmehr trifft sie auch unseren Umgang mit Tieren derselben Art, die in entsprechend unterschiedliche Rubriken fallen, wie zum Beispiel Hunde, die je nach dem als „Haustiere“ gehalten werden oder als „Labortiere“. Es ist dieser zweite Typus von internem Widerspruch, den O’Sullivan vor allem im Visier hat. Dabei geht es ihr in einem ersten Schritt um eine möglichst umfassende Liste von Kategorien, denen wir Tiere gemeinhin zuordnen (Kapitel 2). Das Spektrum reicht von „Wildtieren“ über „Versuchstiere“ und „Masttiere“ bis hin zu „Haustieren“. Wie O’Sullivan zu Recht hervorhebt, stehen hinter diesen Kategorien jeweils unterschiedliche Verwendungszwecke, die wir an Tiere herantragen. Von Bedeutung sind dabei offenbar der ökonomische sowie der soziale Nutzen, den wir uns von Tieren versprechen. Darin jedenfalls sieht O’Sullivan den zentralen Unterschied zwischen „(landwirtschaftlichen) Nutztieren“ und „Haustieren“ – ein Unterschied, der sich nicht zuletzt darin niederschlägt, dass wir erstere primär als Objekte betrachten und damit als mehr oder weniger anonyme Masse, die im Zuge der Industrialisierung für uns immer unsichtbarer wurde. Nach Ansicht von O’Sullivan gibt es nun zwischen dem Grad der Sichtbarkeit von Tieren und ihrer Stellung vor dem Gesetz einen klaren Zusammenhang (Kapitel 3): Während (die meisten) „Haustiere“ in unserer Gesellschaft auch medial in einer Art Rampenlicht stehen und juridisch einen vergleichsweise guten Status haben, sind Tiere, die ihr Leben hinter verschlossenen Türen in Zuchtanlagen oder Versuchslabors verbringen müssen, gesetzlich kaum oder nur unzureichend geschützt, wie die Autorin anhand zahlreicher Beispiele darlegt (Kapitel 4). Dabei ist sie sich bewusst, dass diese Unterscheidung Ausnahmen zulässt (so etwa Tiere, die für Wettkämpfe gebraucht werden). Das ändert allerdings nichts an O’Sullivans These, dass gerade dieser Zusammenhang zwischen Unsichtbarkeit und mangelndem Tierschutz Ausdruck des von ihr monierten internen Widerspruchs ist, der – wie oben angedeutet – darin bestehen kann, dass wir Hunde, die als „Haustiere“ Teil unserer Familie Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 147 | | Petra Mayr et al. sind, grundlegend anders behandeln als Hunde, an denen unsere Kosmetika getestet werden. Für O’Sullivan ist diese Art von Ungereimtheit nicht bloß in moralischer, sondern auch in demokratiepolitischer Hinsicht äußerst prekär (Kapitel 5). Denn gerade in liberalen Gesellschaften, die sich als Demokratien verstehen, stellt das Prinzip der gleichen Berücksichtigung („equal consideration“) eine Grundlage fairen Zusammenlebens dar. Interne Widersprüche wie der eben genannte unterminieren jedoch dieses Gleichheitsprinzip auf dermaßen eklatante Weise, dass BefürworterInnen der Demokratie nachgerade aufgerufen sind, sich grundlegend mit diesen Ungereimtheiten zu befassen. Gemäß O’Sullivan sollte diese Auseinandersetzung dazu führen, dass der Umgang, den wir typischerweise mit „Haustieren“ pflegen, zum Standard für alle Tiere wird, denen gegenüber der Mensch Nutzungsansprüche erhebt. O’Sullivans Buch besticht durch die Fallstudien, mit denen sie die unterschiedlichen Grade der Sichtbarkeit von Tieren in unserer Gesellschaft belegt. Nicht minder aufschlussreich ist ihre Analyse insbesondere der amerikanischen und australischen Tierschutzgesetze, die tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Unsichtbarkeit und mangelndem Schutz tierlicher Interessen nahelegen. (Ähnliches ließe sich wohl auch für die Tierschutzgesetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen.) Weniger überzeugend ist indes O’Sullivans Erklärungsanspruch bezüglich der unterschiedlichen Typen von Ungereimtheiten. So bleibt unklar, weshalb die Kategorisierung von Hunden etwa in „Haustiere“ und „Versuchstiere“ leichter aufzuweichen ist als jene von Hunden in „Haustiere“ und Schweinen in „Nutztiere“, wie O’Sullivan das anzunehmen scheint. Hier wie dort sind es institutionalisierte und damit auch gesellschaftlich akzeptierte Verwendungszwecke, die irgendwelche Tiere zu erfüllen haben und die insbesondere auch die emotionale Nähe festlegen, die wir gegenüber Tieren haben (dürfen). Gerade bei „Haustieren“ scheint viel dafür zu sprechen, dass es die persönliche Beziehung ist, die überhaupt erst eine moralische Verpflichtung konstituiert; um welche Art von Tier es sich dabei handelt, ist sekundär bzw. wiederum kulturell bedingt. Auch wäre zu fragen, wie scharf der Unterschied zwischen externem und internem Widerspruch in unserem Umgang mit Tieren tatsächlich ist. Sofern die interne Ungereimtheit maßgeblich darauf beruht, dass Tiere unterschiedlichen Rubriken zugeordnet werden, steht dahinter auch die Vorstellung des Menschen, dass es Sinn und Zweck der Tiere ist, für ihn da zu sein. Diese Idee wiederum gründet in einer Haltung, die sich über lange Zeit hinweg zu einer | 148 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | speziesistischen Ideologie verdichtet hat und die nicht zuletzt auch in dem von O’Sullivan so genannten externen Widerspruch zum Ausdruck kommt. Falls dem aber so ist, gibt es – anders, als O’Sullivan suggeriert – nur wenig Anlass zur Hoffnung, dass sich der interne Widerspruch aufheben lässt, ohne zugleich auch am externen Widerspruch zu rütteln. Klaus Petrus 4. Theologische Ethik 4.1 Anton Rotzetter: Streicheln, mästen, töten. Warum wir mit Tieren anders umgehen müssen 197 S., Freiburg, Basel, Wien: Verlag Herder, 2012, 14,99 EUR Bücher, die maßgebliche Fragen der Tierethik in einfacher Weise an das Alltagsbewusstsein herantragen wollen, haben seit einigen Jahren Konjunktur, und im Regelfall zielt ihre didaktische Absicht auf einen Einstellungswandel durch Aufklärung ab. Auch Anton Rotzetter verfährt so, tut dies in klarem Bekenntnis zum biblischen Schöpfungsgedanken und leitet daraus für sich den Vegetarismus als Lebensform ab. Prima facie klingt das dogmatisch, ist es aber nicht, denn im Anschluss an den Moraltheologen Franz Böckle geht Rotzetter von dem Grundsatz aus, dass es „im Bereich der Ethik keine unfehlbaren Entscheidungen des kirchlichen Lehramts geben könne“ und auch “die theologische Argumentation ebenso sachlich wie überzeugend sein“ müsse (76f.). An diesem Anspruch orientiert sich das Buch in dialogisch offener, kompromissfähiger Weise, wertet die Vertreter kontroverser Positionen nirgendwo ab und bemüht sich auch in der Behutsamkeit der Sprache um ein unaufdringliches Plädoyer für die christliche Dimension des Tierschutzes. Es verwundert nicht, dass Rotzetter sich als Kapuziner-Mönch und Mitbegründer des Instituts für theologische Zoologie an der KapuzinerHochschule in Münster schon im Vorwort auf Franz von Assisi als seinen Kronzeugen für den Respekt vor der Subjekthaftigkeit des Tieres beruft; doch zunächst einmal stehen nicht solche grundlegenden Orientierungen im Vordergrund, sondern repräsentative Beispiele für das moralische Versagen im Umgang mit Tieren, und die werden in eine Reihe kleiner Geschichten aus der eigenen Erfahrung des Autors verpackt. Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 149 | | Petra Mayr et al. Dieser narrative Ansatz wendet sich erklärtermaßen an den interessierten Laien, nicht an den Wissenschaftler, den der Autor auf seine einschlägigen akademischen Arbeiten verweist. Unter didaktischem Vorzeichen leuchtet diese elementarisierende Verfahrensweise ein, denn kleine, prägnante Geschichten haben den Vorzug, den nachdenklichen Leser in vertrauter Alltagssprache vom konkreten Fall zu dessen ethischem Kern hinzuführen. Allerdings gilt es dabei auch das Risiko zu meiden, um der didaktischen Intention willen die Komplexität der Sachverhalte in unzulässiger Weise zu verkürzen. Diese Gratwanderung gelingt dem in der Ich-Form abgefassten Buch nicht immer, wohl aber im ersten von vier Kapiteln, das unter dem Thema „Wie wir mit Tieren umgehen“ einen von konkreten Situationen ausgehenden Überblick über ethisches Fehlverhalten gegenüber Tieren bietet. Hier kommen die zentralen Fragen nach Tierversuch, Tierhaltung, Tiertransport, Schlachten, Schächten und Fleischkonsum ebenso zur Sprache wie der ökonomische Missbrauch ökologischer Argumente, so etwa bei neuerlichen Versuchen, das Verfüttern des verbotenen Tiermehls wieder zuzulassen, um den Anbau von Ersatzprodukten wie Soja einzustellen und so den tropischen Regenwald mitsamt der dortigen Bevölkerung zu schonen. Rotzetter deckt die Scheinheiligkeit solcher Argumente ruhig und klar auf, plädiert für „eine Rückkehr zu regionalen und naturnahen Produktionsabläufen“ (28) und postuliert folgerichtig eine drastische Absenkung des Fleischkonsums als allein tragfähige ethische Lösung. Ergänzt werden die einzelnen Themen jeweils durch instruktive Statistiken, aufbereitet von Annette Maria Forster, und so entsteht ein Kapitel, das den Leser mit klaren Fakten und intensiven Fragen in den Bann tierethischer Argumente hineinzieht. Leider vermag der Autor den Spannungsbogen, den er im Eingangskapitel aufbaut, in den drei nachfolgenden, weitaus knapperen Kapiteln nicht aufrechtzuerhalten, und dies hat seinen Grund erkennbar darin, dass sich der Erzählstil nicht bewährt, wo es um begriffliche Klarheit und systematische Linien geht. Der Versuch, im 2. Kapitel „einige Aspekte einer modernen Tierethik“ darzulegen (75), liest sich zwar flüssig und erläutert auch etablierte Termini wie den „ökologischen Fußabdruck“ oder das „virtuelle Wasser“, entbehrt aber einer deutlichen Unterscheidung divergierender tierethischer Ansätze, so zum Beispiel in der Frage nach dem Tier als Rechtsträger. Analog dazu werden auch unterschiedliche Positionen der Denkgeschichte (Aristoteles, Descartes, Kant, Bentham u.a.) in wenig markanter Weise vorgestellt, und ein Biozentriker wie Albert Schweitzer findet nur knappe Erwähnung (98, 122), obschon | 150 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | Rotzetter immer wieder auf die „Ehrfurcht vor dem Leben“ rekurriert und daher den argumentativen Hintergrund dieser plakativen Formel hätte verdeutlichen müssen. Hier wirkt manches oberflächlich und aneinandergereiht, das heißt, was eine moderne Tierethik ausmacht, wird nicht sachbezogen dargestellt, sondern erzählerisch an die eigene Erfahrung geknüpft. Auch die politische Frage nach einer lebens- und tierfreundlichen Gesellschaft (Kap. 3) zerrinnt in dieser Weise zu einer Addition von Informationen über Tierschutzorganisationen, über kirchliche Gruppen, regionale Initiativen und nicht zuletzt über den christlichen Beitrag zur Geschichte des Tierschutzes, wobei all dies mit dem Nachdruck von Texten unterfüttert wird, die der Autor für frühere Anlässe verfasst hat. Das alles ist nicht unwichtig, doch es fehlen die klaren gedanklichen Linien und vor allem konkrete Vorschläge für die Förderung des postulierten Mentalitätswandels. Wer in Elternhaus, Schule oder Jugendarbeit von der Thematik gefesselt ist, erhält nicht die Hilfe, die ein Buch bieten sollte, das sich mit didaktischem Anspruch an eine breite Öffentlichkeit wendet. Nicht zuletzt wird das täglich virulente Problem von schneller Forschung und langsamer Ethik ausgeblendet, die Frage also, wie die Ethik auf Forschungsresultate antworten soll, auf die sie nicht vorbereitet ist, und hier hätte dem Autor eine sorgfältige Aufarbeitung ethischer Prinzipien sicherlich helfen können. Einen von mehreren möglichen Ansätzen dazu bietet das vierte und letzte Kapitel unter dem Thema „Gott liebt die Tiere“. Hier zeigt Rotzetter exegetisch überzeugend auf, dass „die totale Verkommerzialisierung des Lebens dem Grundanliegen der Bibel“ widerspricht (163) und in die „spirituelle Depression“ führt (178). Demgegenüber schreibt er dem biblischen Schöpfungstext eine befreiende, das Dilemma der konsumistischen Industriegesellschaft überwindende Kraft zu, verweist nachdrücklich auf das Leitmotiv der Mitgeschöpflichkeit, auf die Zusammengehörigkeit und „geschwisterliche Verbundenheit aller Kreaturen“ (176) und fordert von den Kirchen überall dort eine maßgebliche Rolle, wo es um Menschen- und Tierrechte geht. Dieses Plädoyer für Empathie, Mitgefühl und Mitleiden erwächst bei Rotzetter aus Franz von Assisis Vision einer lebensfreundlichen und gewaltlosen Welt, und da er diese Vision in einem konzilianten, niemals polemischen Stil zu praktischen Postulaten verarbeitet, wird selbige auch ein Atheist - in Distanz zu den biblischen Sinnfundamenten - in einen vernünftigen Diskurs einbeziehen können. Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 151 | | Petra Mayr et al. Lesenswert ist dieses Buch also, weil es sich in vielen interessanten Detailfragen dem Alltagsdenken verpflichtet weiß und nach Antworten sucht, die diesem einleuchten. Außerdem bietet es ein reichhaltiges Spektrum an instruktiven Informationen, fördert damit das Wissen, das dem Werten vorausgehen sollte, und vermag so, das persönliche Nachdenken anzuregen. Seine Schwäche liegt darin, dass die Neigung zum Narrativen und wohl auch zur Selbstbezüglichkeit die begriffliche Klarheit überlagert, die gedankliche Struktur behindert und so gelegentlich den Eindruck eines eklektizistischen Potpourris hervorruft. Wer persönlich angesprochen werden will, ist hier gut aufgehoben; wer strukturierte Zusammenhänge sucht, eher nicht. Claus Günzler 5. Rechtsfragen und Rechtsentwicklung 5.1 Kimberly K. Smith: Governing Animals. Animal Welfare and the Liberal State 207 S., Oxford, New York: Oxford University Press, 2012, 30,99 EUR Wie viel Tierschutz verträgt der Staat? Oder anders gefragt: Inwieweit dürfen ethisch legitime Tierschutzziele im liberalen Rechtsstaat auch zwangsweise durch Gesetze durchgesetzt werden? Diese Fragen beleuchtet die Rechtshistorikerin Kimberly Smith aus der Sicht der liberalen Staatsphilosophie. Ausgangspunkt ist der rechtsstaatliche Grundsatz, dass der Staat Freiheitsrechte einzelner Bürger nur einschränken darf, soweit dies aus Gründen anderer Bürgerrechte oder zum Schutz überragender Gemeinwohlbelange geboten ist. Wie aber ist der Schutz der Tiere mit dieser Lehre vereinbar? Wenngleich westliche Verfassungen im Kern auf menschliche Interessen zugeschnitten sind, wurden von der Verantwortung für zukünftige Generationen bis hin zum ethischen Selbstzweck der Tiere verschiedene Wege gefunden, um Tiere zu schützen. Heute haben in allen westlichen Staaten Regeln zum Schutz der Tiere Eingang in die Gesetze gefunden, die die Grenzen zulässiger Haltung regeln. Die Frage nach der theoretischen Begründung versucht Smith mit einer modifizierten Vertragstheorie („social contract theory“) deskriptiv zu beantworten. Da die strengen Vertreter dieser Theorie (allen voran John Rawls) auf die freie Entscheidung vernünftiger und mündiger Bürger | 152 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | abstellen, um die Rechtsordnung im Staat zu rechtfertigen, scheint es zunächst widersprüchlich, auch Tiere als eigenständige Vertragspartner zu betrachten. Es bedürfe aber, so Smith, einer Erweiterung des Sozialvertragsbegriffes, um auch Lebewesen zu erfassen, die ihre Stimme nicht bei entsprechenden Verhandlungen abgeben können. Da im Rahmen dieser Theorie ohnehin nur eine fiktive Aushandlung demokratischer Kraftverhältnisse im Staat nachgezeichnet werden könne, sei es möglich und sogar geboten, hierbei auch nicht rechtsfähige Personen und Tiere mit ihren Interessen und Grundbedürfnissen zu berücksichtigen. So spielen Tiere als Wirtschaftsgüter ebenso wie als Sozialpartner eine wichtige Rolle im Spiel gesellschaftlicher Interessen. Daher seien, so die Autorin, jedenfalls vom Menschen gehaltene Tiere, also Heim- und Nutztiere, sowie zu Tierversuchen verwendete Tiere als soziale Akteure zu berücksichtigen. Durch diese Betrachtung seien auch leicht die faktisch vorhandenen Unterschiede im Schutzniveau zwischen den Kategorien gehaltener Tiere und Wildtiere zu erklären. Darüber hinaus fordert die Autorin eine tiefgehende Reform der bestehenden Mensch-Tier-Beziehung: Dies umfasst zum einen das Tier als Eigentumsgegenstand. Dabei trennen westliche Rechtssysteme streng zwischen Personen und Sachen. Dabei kommen nur menschliche Personen als Träger subjektiver Rechte in Frage, nicht aber Tiere. Die Autorin zeigt, dass es unsere besondere Beziehung zu Tieren gebietet, diese Aufteilung zu überdenken und Tiere als Sonderkategorie aufzufassen (vgl. erste Ansätze in § 90a BGB: „Tiere sind keine Sachen“). Derzeit werden Tiere mangels hinreichender Sonderregelungen weithin noch als Sachen behandelt, auch wenn vermehrt Aspekte des Tierwohls diskutiert werden, etwa die Zusprache eines Umgangsrechtes mit Haustieren bei Ehescheidungen (Umgangsrecht). Nach Ansicht der Autorin sollten hier mehr die Pflichten des Halters gegenüber dem Tier betont werden und das Tier als eine Art Sondereigentum qualifiziert werden, für das der Halter wie ein rechtlicher Betreuer einzustehen hat. Im deutschen Recht findet sich ein vergleichbarer Ansatz eines durch Tierschutzpflichten eingeschränkten Eigentumsrechtes, der allerdings weiter ausgebaut werden muss. Darüber hinaus ist die Stellung von Tieren in Rechtsstreitigkeiten zu stärken, die derzeit ja sprichwörtlich „nicht klagen“ können. Hier wäre eine Form der Repräsentation einzuführen. Smith leitet hier ein eigentumsähnliches Recht eines Tieres an sich selbst aus dem Common Law her („equitable self ownership“), wonach das Tier etwa Begünstigter eines Sondervermögens sein kann. Aus deutschsprachiger Sicht scheint aber eher ein Ausbau bzw. Transfer bereits existierender Institute richLiteraturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 153 | | Petra Mayr et al. tungsweisend, etwa die Ausstattung staatlich benannter Tierschutzbeauftragter mit einer Prozessstandschaft in bestimmten Verfahrenszweigen (vgl. als Modelle auch die Tierschutzobmänner in Österreich oder den ehemaligen Tieranwalt Zürichs). Alternativ könnte auch eine allgemeine Verbandsklage für Tierschutzorganisationen zu einer besseren Durchsetzung von Tierschutzinteressen führen. Ihren Höhepunkt erreicht die Arbeit, wo sie Lösungsansätze zu konkreten gesellschaftlichen Problemen anbietet: Anhand des Beispiels von Hundekämpfen und Tieropfern im religiösen Kontext wird dargelegt, dass härtere Strafen alleine erfahrungsgemäß nicht zu größerem Tierwohl führen. Wenn die Akzeptanz der Tiere als fühlende Wesen ausbleibe, werde es vielmehr weiterhin zu einem Aufrechnen von Tierwohl gegen menschliche Interessen kommen. Vorzugswürdig seien Modelle, die scheinbar gegenläufige Interessen gleichermaßen stärken und zu einer allgemeinen Verbesserung der Mensch-Tier-Beziehung führen. Dies wird eher durch Bildungsprogramme und andere Förderung erreicht als durch Zwang. Als Beispiel nennt sie Bildungsprogramme und die Verknüpfung mit sozialen Problemen, z.B. bei paralleler Tier- und Kindesmisshandlung in prekären Verhältnissen. Der Staat solle sich mehr auf die fördernden Aspekte beziehen, um den Tierschutz praktisch zu stärken. Es erscheint überzeugend, dass die Stellung des Tieres in der Breite gestärkt werden könnte, wenn der Staat auch hierfür aktiv werben würde, z.B. durch Verbraucherschutzempfehlungen, oder Tierschutzaspekte auch mit der Sozialarbeit verknüpfte, wie etwa bei der Problematik des „Animal Hoarding“. In Deutschland ist zumindest theoretisch mit der Aufnahme des Staatsziels Tierschutz im Grundgesetz ein Schritt in die Richtung gelungen, das Tierwohl als bedeutenden Gemeinwohlbelang in den Fokus zu bringen. Kritisch anzumerken ist der kulturell geprägte Standpunkt der Autorin. Der Ansatz, nur dem Menschen nützliche bzw. angenehme Tiere als Teil des Sozialkontraktes zu betrachten, ist aus ethischer Sicht fragwürdig. Letztlich führt er zu einer anthropozentrischen Aufteilung in drei Klassen: nützliche Tiere, Wildtiere und so genannte Schädlinge. Während Wildtiere als „Freiwild“ neutral zu behandeln sind, in den Grenzen des Artenschutzes aber der Jagd unterliegen, würden als gesellschaftsschädlich eingestufte Tierarten gänzlich aus dem Tierschutz herausfallen. Hier klingt die nationalsozialistische Verurteilung von „Volksschädlingen“ als unerwünschte Lebewesen mit. So wie heute eine unveräußerliche Würde für alle Menschen anerkannt ist, müssen alle fühlenden Lebewesen einen Mindestschutz vor unnötigem Leid genießen, der selbstverständlich auch | 154 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | vom Staat geschützt und verteidigt werden muss. Es handelt sich also nicht nur um eine reine „Moralobligation“, wie Smith es an dieser Stelle darstellt. Hier hätte man sich den Blick über die rein deskriptive Staatslehre hinaus gewünscht und ein klares Statement, dass die Ethik es grundsätzlich verbietet, Mitgeschöpfe außerhalb dieses Leidensschutzes zu stellen. Abgesehen davon sind die Ansätze zur besseren Integration des Tierschutzes im liberalen Staat weitgehend instruktiv. Der hohe ethische Standard im Rechtsstaat gebietet es danach, Tieren einen erhöhten Schutzstatus zu verleihen, der sich nicht in jedem Falle menschlichen Interessen zu beugen hat. Sicherlich eher an ein Fachpublikum gerichtet, verleiht die Arbeit Tierschutzfragen wissenschaftlichen Rang, beleuchtet aber zugleich auch Fragen, die im alltäglichen Leben für jedermann von großer Bedeutung sind. Insbesondere hinsichtlich der Förderung von integrativen Ansätzen liefert die Arbeit neue Ideen. Ein großes Verdienst ist es zudem, dass die Autorin ernsthaft versucht, auf dem Wege einer wissenschaftlichen Arbeit ein von mehr gegenseitigem Verständnis geprägtes Verhältnis von Mensch und Tier zu kreieren. Christian Schönwetter Literatur Donaldson, Sue und Kymlicka, Will (2011). Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights. New York: Oxford University Press, 329 p., ISBN-13: 978-0199599660, 24,00 EUR Herzog, Hal (2012). Wir streicheln und wir essen sie. Unser paradoxes Verhältnis zu Tieren. München: Carl Hanser Verlag, 320 S., 19,90 EUR Koechlin, Florianne und Battaglia, Denise (2012). Mozart und die List der Hirse. Natur neu denken. Basel: Lenos, 233 S., ISBN-13: 978-3857874246, 23,90 EUR O’Sullivan, Siobhan (2011). Animals, Equality and Democracy. Hampshire: Palgrave Macmillan, 213 p., ISBN-13: 978-0230243873, 74,99 EUR Peggs, Kay (2012). Animals and Sociology. Hampshire: The Palgrave Macmillan Animal Ethics Series, 177 p., ISBN-13: 978-0230292581, 81,99 EUR Protopapadakis, Evangelos D. (Hrsg.) (2012). Animal Ethics. Past and Present Perspectives. Berlin: Logos Verlag, 295 p., ISBN-13: 978-3832529994, 29,00 EUR Rotzetter, Anton (2012). Streicheln, mästen, töten. Warum wir mit Tieren anders umgehen müssen. Freiburg, Basel, Wien: Verlag Herder, 197 S., 14,99 EUR Smith, Kimberly K. (2012). Governing Animals. Animal Welfare and the Liberal State. Oxford, New York: Oxford University Press, 207 p., ISBN-13: 978-0199895755, 30,99 EUR Stamp Dawkins, Marian (2012). Why Animals Matter: Animal Consciousness, Animal Welfare, and Animal Well-Being. Oxford: Oxford University Press, 209 p., ISBN-13: 978-0199747511, 23,99 EUR Literaturbericht TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) | 155 | | Petra Mayr et al. Korrespondenzadresse Dr. phil. Petra Mayr Deisterstraße 25 B 31848 Bad Münder am Deister E-Mail: [email protected] www.TIERethik.net | 156 | TIERethik, 4. Jg. 5(2012/2) Literaturbericht