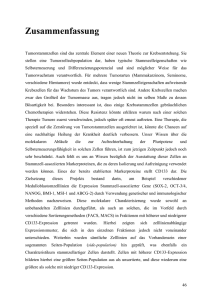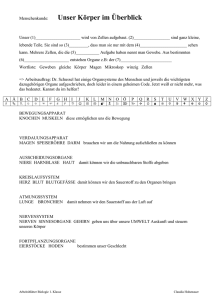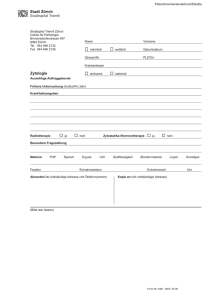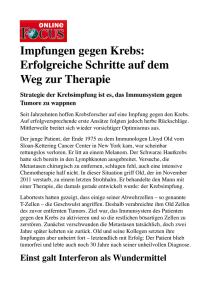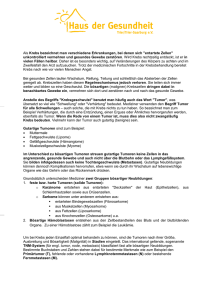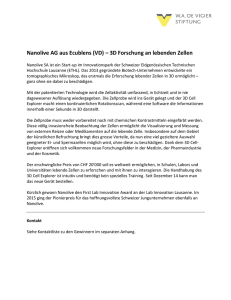ringen mit Krebs
Werbung

· MEdIZIn · HIrnforScHung ringen mit Krebs € 8,90 (D) · € 9,70 (A) · € 10,– (L) · sFr. 17,40 24524 · JAnuAr 2015 Etappensiege gegen die tückische Krankheit WUR zEl DES ÜBEl S DA S UNHEIl KoMMEN SEHEN gESCHUlTE KöRPER ABWEHR Verhängnisvolles Wirken von Krebsstammzellen neue Methoden zur früherkennung Behandlungserfolge mit gezielt abgerichteten Immunzellen www.spektrum.de 4 192452 408902 01 spezial Biologie · Medizin · HirnforscHung 1/15 B I o Lo g I E SPE Z I A L Unsere Autoren sind ausgezeichnet. manche mit dem Nobelpreis. Jet z t im Miniabo kennen lernen* und Pr ä mie sichern In Spektrum der Wissenschaft berichten Experten aus Wissenschaft und Forschung monatlich über die neuesten Erkenntnisse aus ihren Fachgebieten. *Drei aktuelle Ausgaben von Spektrum der Wissenschaft für nur € 5,33 je Heft (statt € 8,20 im Einzelkauf)! So einfach erreichen Sie uns: Telefon: 06221 9126-743 www.spektrum.de/miniabo Fax: 06221 9126-751 | E-Mail: [email protected] Oder QR-Code per Smartphone scannen und Angebot sichern! EDITORIAL Gerhard Trageser Redaktionsleiter Sonderhefte Mit Physik und den Waffen des Immunsystems A ls US-Präsident Richard Nixon 1971 den »Krieg gegen den Krebs« erklärte, schien das Ziel, die Krankheit in einem nationalen Kraftakt binnen 25 Jahren zu besiegen, nicht utopischer als John F. Kennedys Vorgabe von 1961, noch vor Ablauf des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen. Doch Krebs hat sich als hartnäckiger Gegner erwiesen. Trotz beachtlicher Fortschritte bei der Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung, die in jahrzehntelanger intensiver Forschung erreicht wurden, ist er immer noch die zweithäufigste Todesursache in den westlichen Industrieländern. Teilweise liegt das an einem an sich erfreulichen Trend: unserer stetig steigenden Lebenserwartung. Mit zunehmendem Alter häufen sich in unserem Körper Mutationen, die Zellen entarten lassen. Je länger also ein Mensch lebt, desto größer ist das Risiko, dass eine davon zu wuchern beginnt. Darum tritt Krebs in einer alternden Gesellschaft von Natur aus häufiger auf. Der Kampf gegen die Krankheit kommt aber auch deshalb nur schleppend voran, weil sich die Fülle an Erkenntnissen über ihre Ursachen nicht ohne Weiteres in Therapieansätze ummünzen lassen. So hat sich herausgestellt, dass einem ­Tumor oft nicht mehr als ein paar wenige entartete Stammzellen Grunde liegen, die im Gewebe versteckt sind, so dass sie sich kaum aufspüren und beseitigen lassen (S. 6). Solange sie aber nicht ausgemerzt sind, bilden sie den Tumor, auch wenn er chirurgisch, medikamentös oder radiologisch entfernt wurde, immer wieder neu. Eigentlich waren die Voraussetzungen für den Kampf gegen Krebs denkbar günstig. Auf dem Gebiet der Genetik und Molekularbiologie gab es in den vergangenen Jahrzehnten gewaltige Fortschritte, man denke nur an die DNA-Sequen­ zierung. Doch die neuen, enorm leistungsfähigen Analysemethoden zeigten nur immer klarer, wie komplex und vielfältig die Mechanismen sind, die zu unkontrollierter Zell­ wucherung führen. Was die Unmenge der damit gewonnenen neuen Einsichten dagegen nicht offenbarte, war ein einheitliches Grundprinzip, das einen Ansatz für ein allgemein anwendbares Therapieverfahren geboten hätte. Unter der Flut an Detailinformationen droht die Tumorbiologie deshalb WWW.SPEKTRUM.DE mittlerweile eher zu ersticken, als dass sie ihrem Ziel näher käme, eine durchschlagende Heilmethode zu liefern (S. 38). Vor diesem Hintergrund hat sich unlängst eine neue Richtung entwickelt: die physikalische Krebsforschung. Statt sich immer tiefer in molekulare Feinheiten zu verlieren, fahnden ihre Vertreter nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten im Verhalten von Tumorgewebe, etwa bei mechanischen Eigenschaften wie der Elastizität und Kontraktionsfähigkeit (S. 41). Und an Stelle der Aktivitäten von einzelnen wuchernden Zellen betrachten sie das Verhalten der Geschwulst als Gesamtsystem (S. 44). Dabei ziehen sie auch Computermodelle heran und führen mit ihnen virtuelle Experimente durch (S. 47). N och einen anderen Weg beschreiten Forscher, die Krebs mit den eigenen Waffen des Körpers zu bekämpfen suchen. Im Prinzip ist unser Immunsystem nämlich in der Lage, entartete Zellen zu erkennen und selbst zu beseitigen. Manchmal versagt es in dieser Wächterfunktion jedoch – etwa weil Krebszellen sich geschickt tarnen oder natürliche Mechanismen zum Zügeln der Körperabwehr ausnutzen. Immuntherapien zielen folglich darauf ab, solche Bremsen zu lösen (S. 55) oder die immunologischen Spürhunde gezielt auf die Tumorzellen zu hetzen (S. 62). Auch mit solchen Mitteln wird es allerdings wohl nicht gelingen, den Krebs in der Weise zu »besiegen«, dass er in allen seinen Formen und Stadien mit einer einzigen Standardmethode heilbar wäre. Stattdessen dürfte die Medizin im Ringen mit dem zähen Gegner weiter Boden gut machen – und einen schon bestehenden Trend fortsetzen, wonach sich bei einer wachsenden Zahl von Krebsarten die Heilungsaussichten stetig verbessern. Das sollte bewirken, dass die Krankheit allmählich ihren Schrecken verliert und immer weniger Grund dafür besteht, eine Krebsdiagnose – wie früher meist – als Todesurteil zu empfinden. Herzlich Ihr 3 I N H A LT 25 41 a UNIVERSITÄT ZÜRICH; MARKUS KNUST UND MARCO PRINZ, UNIVERSITÄT FREIBURG Tückische Invasoren Krebszellen verschaffen sich mit Botenstoffen Zutritt zu Blutgefäßen, um weitere Organe zu besiedeln. a FOTOLIA / JUAN GÄRTNER [M] Die Elastizität von Tumorzellen, die sich per Laser messen lässt, erlaubt Rückschlüsse auf den weiteren Krankheitsverlauf. ONKOGENESE Gerlinde Felix ANGIOGENESE 20 Krebs, Blutgerinnung und Stress Matthias W. Hentze und A. E. Kulozik Gefäßneubildung in Tumoren. 4 Robert Gatenby Hauptmerkmale der Entartung. TUMORMARKER 26 Verräterische Satelliten-RNA Gabi Warnke Genetisches Indiz für Bösartigkeit. BIOMECHANIK II 41 Krebszellen im Kräftespiel Erika Jonietz Tumore sind oft auffallend steif. VORSORGEUNTERSUCHUNG 28 Streit um die ProstatakrebsFrüherkennung David Stipp Alternde Zellen fördern Entartung. BIOMECHANIK I 38 Der Blick fürs Wesentliche FRÜHERKENNUNG ZELLULÄRE SENESZENZ TUMORPHYSIK 12 Krebsstammzellen im Visier 14 Unheil durch nicht mehr teilungsfähige Zellen Mathematische Modelle helfen Forschern, besser zu verstehen, wie sich Tumorzellen an ihre Umgebung anpassen. METASTASIERUNG INTERVIEW Andreas Trumpp Fatale Rolle der Krebsstammzellen. Virtuelles Tumorwachstum 25 Türöffner für Krebszellen 6 Wurzel des Übels ALEXANDER R. A. ANDERSON, INTEGRATED MATHEMATICAL ONCOLOGY, MOFFITT CANCER CENTER Steif und fest URSACHEN 47 MODELLENTWICKLUNG I Marc B. Garnick Schadet der PSA-Test mehr, als er nutzt? 44 Berechnung des Tumors DIAGNOSTIK 35 Das Unheil kommen sehen Cassandra Willyard Neue Methoden zum frühzeitigen Nachweis von Krebs. Neil Savage Simulation von Krebs im Computer. MODELLENTWICKLUNG II 47 Und nun zur aktuellen Krebsvorhersage … Katharine Gammon Mathematik verbessert Prognose. SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 55 62 NATIONAL CANCER INSTITUTE / PUBLIC DOMAIN Hemmungen abbauen »Checkpoints« zügeln die Immunabwehr. Ihren Missbrauch durch Tumoren gilt es zu unterbinden. ISTOCK / JUAN GÄRTNER Kaderschmiede für Immunzellen Beim adoptiven Zelltransfer entnimmt man einem Krebspatienten Immunzellen und verändert sie so, dass sie den Tumor angreifen. Danach werden sie vervielfältigt und zurück in den Körper gebracht. THERAPIEN CHEMOTHERAPIE 50 Nano-Arzneitransporter Katherine Bourzac Winzige Wirkstoffkapseln befördern ihre Fracht sicher zum Ziel­ gewebe. IMMUNTHERAPIE III 62 Auftragskiller der Körperabwehr INFOGRAFIK 68 Zelluläre Mobilmachung IMMUNTHERAPIE IV 70 Bakterien gegen Tumoren IMMUNTHERAPIE II Gerlinde Felix Aufheben des Stoppsignals für Fresszellen. WWW.SPEK TRUM .DE Katherine Bourzac Die Schlacht zwischen Immun- und Krebszellen direkt verfolgen. Karen Weintraub Die Blockade von körpereigenen Immun­reaktionen durch Krebs­ zellen lösen. 60 Den Schutzpanzer der Krebszellen ausschalten IMMUNTHERAPIE V 76 Liveschaltung zum Tumor Courtney Humphries Die Immunpolizei gezielt gegen den Tumor abrichten. IMMUNTHERAPIE I 55 Freie Fahrt fürs Immunsystem Sarah DeWeerdt Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. IMMUNTHERAPIE VI 80 Am Ort des Geschehens Elie Dolgin Impfimplantate wirken besonders lang und spezifisch. IMMUNTHERAPIE VII 84 Impfen gegen Krebs Eric von Hofe Erste erfolgreiche Vakzine. INTERVIEW 74 Eine Kettenreaktion, die den Tumor zerstört Thierry Boon Tumorantigene als Zielscheiben für die Körperabwehr. Editorial 3 · Impressum 26 · Vorschau 90 Titelmotiv: iStock / Juan Gärtner 5 INTERVIEW Wurzel des Übels Lange glaubten Mediziner, Tumoren bestünden aus mehr oder minder gleichrangigen Zellen. Doch immer mehr Belege deuten auf einen hierarchischen Aufbau hin. An der Spitze steht dabei eine entartete Stammzelle, die das Tumor­ gewebe hervorbringt und immer wieder erneuert. Was wissen Forscher heute über Krebsstammzellen? Ein Gespräch mit Andreas Trumpp vom Deutschen Krebs­ forschungs­zentrum in Heidelberg. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / PHILIPP ROTHE PROFESSOR DR. ANDREAS TRUMPP leitet die Abteilung »Stammzellen und Krebs« im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Zudem ist er Geschäftsführer des Heidelberger Instituts für Stammzell-Technologie und Experimentelle Medizin (HI-STEM). Medikamente oder Strahlen können eine Krebserkran­ kung in vielen Fällen wirksam zurückdrängen. Oft schlägt sie aber später erneut zu. Woran könnte das liegen? Andreas Trumpp: Es mehren sich die Hinweise darauf, dass so genannte Krebsstammzellen den Tumor zurückkehren lassen. Was muss man sich darunter vorstellen? Trumpp: Um das zu erklären, muss ich ein wenig ausholen. Wir alle haben in unserem Körper eine ganze Reihe verschiedener Stammzellen. Die adulten Stammzellen des erwachsenen Organismus sind lebenslang dafür zuständig, Gewebe und Organe zu erhalten. Sie bringen jeweils die Zellen des Gewebes oder Organs hervor, dem sie angehören. So produzieren Blutstammzellen mehr als ein Dutzend Zelltypen des Bluts, und aus epithelialen Stammzellen gehen alle Zelltypen der Haut hervor. Eine Haut- oder Blutstammzelle kann aber natürlicherweise keine Nervenzellen generieren. Denn adulte Stammzellen lassen immer nur ganz bestimmte reife Zelltypen entstehen – im Gegensatz zu embryonalen Stammzellen, die alle Zelltypen des Körpers erzeugen können. Für beide Stammzellsysteme gilt jedoch, dass sie hierarchisch aufgebaut sind. 6 Was heißt das genau? Trumpp: Es gibt stets eine Stammzelle an der Spitze der Rangordnung. Sie ist in der Lage, sich selbst zu erneuern. Wenn sie sich teilt, entstehen zwei Tochterzellen; eine davon bleibt Stammzelle, während sich die andere weiterentwickelt. Vom Blut bildenden System, dem bislang am besten untersuchten Stammzellsystem, ist bekannt, dass sich aus nur wenigen Stammzellen diverse Vorläuferzellen entwickeln, deren Abkömmlinge wiederum zu den verschiedenen Blutzelltypen ausreifen, etwa den weißen und roten Blutkörperchen. Auf diese Weise bringen die Stammzellen Milliarden von Töchtern hervor, obwohl sie selbst nur wenige Exemplare umfassen und entsprechend schwer auffindbar sind. Bei der Maus zum Beispiel kontrollieren nur etwa 1000 Blutstammzellen das gesamte System. Sie sitzen wie beim Menschen tief verborgen im Knochenmark, sind unter normalen Umständen wenig aktiv und teilen sich selten. Wenn aber frisches Blut gebraucht wird, beispielsweise nach einer Verletzung, können sie in kurzer Zeit die Produktion von Abermillionen neuen Blutzellen einleiten und kontrollieren. SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / MARTIN MÜLLER Die Gesundheit des Menschen hängt unter anderem von seinem Genom ab. So können Veränderungen im Erbgut Krebsstammzellen entstehen lassen, die Tumoren und Tochtergeschwülste (Metastasen) hervorbringen. WWW.SPEK TRUM .DE 7 Und was sind Krebsstammzellen? Trumpp: Unserer Meinung nach sind Tumoren nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut wie gesunde Körpergewebe – ein hierarchisch organisiertes System mit einer Zelle an der Spitze, die Stammzelleigenschaften besitzt. Das unterscheidet sich deutlich von der bisherigen Lehrmeinung. Trumpp: Richtig, bislang dachte man, ein Tumor sei eine ­Ansammlung mehr oder minder gleichrangiger Zellen. Das neue Konzept postuliert hingegen, dass aus wenigen Zel­ len mit Stammzelleigenschaften die Hauptmasse der Geschwulst hervorgeht. Was ergibt sich daraus für die Behandlung? Trumpp: Dass man die Krebsstammzellen treffen muss, um Krebs zu heilen. Wie entstehen diese Zellen eigentlich? Trumpp: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es könnte sein, dass das Erbgut von adulten Stammzellen mutiert. Sammeln sich die Veränderungen im Genom an, beginnt die Zelle irgendwann zu entarten und sich häufig und unkon­ trolliert zu teilen. Eine Stammzelle gibt ihre Mutationen an sämtliche Abkömmlinge weiter – eine Art Verstärkerkaskade. Was für Möglichkeiten gibt es noch? Trumpp: Erste genetische Veränderungen können sich auch schon im Fötus oder sogar in den embryonalen Stammzellen ereignen. Die Körperzellen, die aus ihnen hervorgehen, sind dann verletzlicher und werden im Lauf des Lebens womöglich schneller entarten. Vorstellbar ist auch, dass eine ausdifferenzierte Körperzelle Mutationen erfährt, die ihr erneut Stammzelleigenschaften verleihen. Man sagt dann, sie wird partiell reprogrammiert. Welcher dieser Varianten messen Sie die größte Bedeu­ tung bei? Trumpp: Unserer Meinung nach spielen zwei Prozesse zusammen, wenn aus einer normalen Stammzelle eine Krebsstammzelle entsteht, nämlich erste Mutationen in der Stammzelle und ihre partielle Reprogrammierung. Das Ergebnis ist ein Tumor, eine unglaublich komplexe Struktur, die wie ein Stammbaum organisiert ist. Das Gros der entarteten Zellen lässt sich mit Medikamenten und Strahlen zurückdrängen. Die Zelle an der Spitze der Hierarchie aber – die Krebsstammzelle – erweist sich oft als sehr resistent und produziert früher oder später erneut bösartige Abkömmlinge. Gibt es ein Beispiel aus der Medizin, das diese These stützt? Trumpp: Nehmen wir die chronische myeloische Leukämie, eine Blutkrebsart. Man ist sich heute ziemlich sicher, dass die erste Mutation, die so genannte BCR-ABL-Translokation, in einer einzigen Blut bildenden Stammzelle im Knochenmark geschieht. Diese gibt die Mutation an ihre Abkömmlinge, die Vorläuferzellen, weiter. Eine von denen erwirbt irgendwann eine weitere genetische Veränderung, hat jetzt also zwei davon, und gibt sie an ihre Tochterzellen weiter. Von diesen mutiert später erneut eine, die somit drei Mutationen trägt 8 und so weiter. Bis lebensgefährliche Leukämiestammzellen entstehen, haben sie außer der ursprünglichen BCR-ABLTranslokation noch mindestens ein halbes Dutzend weitere Genveränderungen eingefangen. Bei soliden Tumoren findet man typischerweise mehr als 50 solcher Mutationen. Was lässt sich daraus für die Therapie ableiten? Trumpp: Infolge der BCR-ABL-Translokation entsteht ein neues Eiweiß, eine so genannte Tyrosinkinase, die in normalen Zellen nicht existiert. Sie ist ständig aktiv und treibt die Zellen dazu an, sich wieder und wieder zu teilen. Seit gut zehn Jahren gibt es den Arzneistoff Imatinib, der zielgerichtet die BCR-ABL-Tyrosinkinase blockiert. Mit ihm und seinen Nachfolgepräparaten konnte die Behandlung der chronischen myeloischen Leukämie entscheidend verbessert werden. Die Zahl der Patienten, die fünf Jahre nach der Diagnose noch leben, liegt heute bei weit über 90 Prozent, und das bei sehr gemäßigten Nebenwirkungen. Leider jedoch greift Imatinib die Leukämiestammzellen nicht wirksam an. Wenn man das Präparat absetzt, kommt der Tumor in wenigen ­Wochen zurück. Man muss den Arzneistoff also lebenslang einnehmen, um die Nachkommen der Krebsstammzellen immer wieder zurückzudrängen. Es ist doch sicher kompliziert, Krebsstammzellen zu isolieren, um sie im Labor zu untersuchen. Trumpp: Das ist in der Tat schwierig, denn sie zeichnen sich nicht durch einheitliche Marker aus. Damit meinen wir Oberflächenmerkmale, die sie wie Flaggen kennzeichnen würden. Das Oberflächenprotein CD133 war einer der ersten heiß diskutierten Marker für Krebsstammzellen, später kamen weitere hinzu. Aber bis heute gibt es kein bekanntes Merkmal, anhand dessen man eine Krebsstammzelle verlässlich identifizieren kann. Einige Marker geben zwar Hinweise in diese Richtung, aber trauen kann man ihnen nur, wenn man sie an einen funktionalen Test koppelt. Wie geht das? Trumpp: Eine Zelle, die aussieht wie eine Krebsstammzelle, muss erst zeigen, dass sie tatsächlich Krebs erzeugen kann. Der bislang einzige sichere Nachweis besteht darin, die verdächtige Zelle zu isolieren, in ein Tier, meist eine Maus, zu transplantieren und dann zu schauen, was passiert. Bringt die Zelle dort wieder einen Tumor hervor, haben wir es sicher mit einer Krebsstammzelle zu tun. Die meisten Zellen eines Tumors sind dazu nicht in der Lage – sie stehen auf einer tieferen Hierarchiestufe als die Krebsstammzelle. Ein ziemlich großer Aufwand. Trumpp: Bei gesunden Blutstammzellen kennen wir mittlerweile rund zwei Dutzend Marker, die einen verlässlichen Nachweis erlauben. Mit ihrer Hilfe können wir die Stammzellen von den Blutzellen trennen, obwohl letztere 200 000fach zahlreicher sind. Bei Krebsstammzellen gibt es aber das Problem, dass sie viele Mutationen erworben haben und sich zudem permanent weiter verändern. Auch ihre Oberflächenmerkmale wandeln sich ständig ab, weshalb man sie eben nur in Zeit raubenden Transplantationsversuchen sicher identifizieren kann. SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Das Krebsstammzell-Konzept Tumor in der Brust Krebsstammzelle Strahlen- oder Chemotherapie Krebsstammzellnische Tumorzellen, hervorgegangen aus der Krebsstammzelle Die Therapie tötet die meisten Tumorzellen ab. Die Krebsstammzelle in ihrer schützenden Nische übersteht den Angriff jedoch. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / MARTIN MÜLLER Monate oder Jahre später: Die Krebsstammzelle teilt sich und bringt neue Tumorzellen hervor. Der Tumor kehrt zurück. Der Tumor findet Anschluss an das Blut­gefäßsystem. Krebszellen breiten sich mit dem Blut im Körper aus – unter ihnen auch Metastasen bildende Stammzellen. WWW.SPEK TRUM .DE 9 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / PHILIPP ROTHE »Man muss die Krebsstammzellen treffen, um Krebs zu heilen« Bei welchen Tumorerkrankungen wurden Krebsstamm­ zellen bislang nachgewiesen? Trumpp: In den späten 1990er Jahren hat man sie bei verschiedenen Arten von Blutkrebs gefunden, später auch in ­Tumoren der Brust, der Prostata, des Gehirns oder des Darms. Ob es Krebsstammzellen tatsächlich bei allen Krebsarten gibt, wissen wir nicht. Die bisherigen Erkenntnisse lassen aber darauf schließen, dass sie bei den meisten dieser Erkrankungen existieren. Die Fachzeitschriften »Nature« und »Science« haben kürzlich Studien über Krebsstammzellen veröffentlicht, die für Aufsehen sorgten. Was war das Besondere daran? Trumpp: Um Krebsstammzellen nachzuweisen, indem man sie in Mäuse überträgt, muss man das Immunsystem der Tiere ausschalten, damit es die menschlichen Zellen nicht sofort wieder abstößt. Kritiker haben immer bemängelt, dass Versuche mit immungeschwächten Mäusen wenig Rückschlüsse auf Tumorerkrankungen beim Menschen erlauben. Die Autoren der neuen Studien haben Krebsstammzellen in Tieren mit intaktem Immunsystem nachgewiesen, was diesen Einwand entkräftet. Zudem gelang beim Glioblastom – einem aggressiven Hirntumor – der Nachweis, dass eine Untergruppe von stammzellähnlichen Krebszellen den Tumor nach zunächst erfolgreicher Chemotherapie zurückkehren lässt. Meines Erachtens ist das ein weiterer gewichtiger Beleg für die Existenz von Krebsstammzellen. Haben Ihre eigenen Forschungen auch solche Hinwei­ se ergeben? Trumpp: Bei vielen Krebskranken lösen sich Zellen vom Primärtumor und wandern in Blut und Lymphe ab. Dies ist der erste Schritt der Metastasierung, also der Bildung von Tochtergeschwülsten. Wir haben Tumorzellen im Blut von Brustkrebspatientinnen untersucht und getestet, ob sie Metastasen hervorbringen konnten. Es zeigte sich, dass nur einige dazu fä10 hig waren, nämlich solche mit Stammzelleigenschaften. Ihr Anteil lag zwischen einem und rund 40 Prozent der zirkulierenden Tumorzellen. Wir vermuten daher, dass nur sie in der Lage sind, Fernmetastasen zu bilden. Lässt das auf eine therapeutische Möglichkeit hoffen, die bislang schwer behandelbaren Tochtertumoren anzu­ greifen? Trumpp: Unser nächstes Ziel ist es, neue Marker zu finden, die es erlauben, Metastasen bildende Zellen im Blut von Krebspatienten sicher nachzuweisen. Wir haben bereits drei Oberflächenmoleküle gefunden, die auf solche Zellen hinweisen. Sie könnten sich als nützliche Marker für die Diagnose, vielleicht auch als Ziele für neue Medikamente erweisen. Gemeinsam mit Andreas Schneeweiss vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg und Partnern aus der Industrie wollen wir Wirkstoffe entwickeln, die an Metastasen induzierenden Krebsstammzellen im Blut ansetzen und sie nachhaltig bekämpfen. Womöglich können wir auch bereits existierende Tochtergeschwülste ins Visier nehmen. Denn wir vermuten, dass diese nahezu vollständig aus Krebsstammzellen bestehen. Das würde erklären, warum sie so therapieresistent sind – und zugleich aufzeigen, wie sie eventuell bekämpft werden können. Normale Stammzellen überdauern an speziellen Orten im Körper, in so genannten Stammzellnischen. Könnte das auch auf Krebsstammzellen zutreffen? Trumpp: Wir gehen davon aus, dass es in jedem Organ und Gewebe unseres Körpers Nischen gibt, in denen Stamm­ zellen sitzen und bei Bedarf aktiviert werden – etwa die Blut bildenden Stammzellen, die gut geschützt in Höhlen im ­Inneren des Knochenmarks überdauern. An solchen Orten könnten sich auch Krebsstammzellen verstecken. Eines Ihrer ersten Projekte hatte zum Ziel, ruhende Krebsstammzellen aus ihren Schutzräumen zu locken und SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 so anfälliger für Medikamente zu machen. Was ist daraus geworden? Trumpp: Unsere Idee war, die ruhenden Leukämiestammzellen mit Interferon-alpha, einem Botenstoff des Immunsystems, aus ihrer Nische zu holen und anschließend mit zielgerichteten Medikamenten oder Chemotherapeutika zu zerstören. Wir arbeiten nach wie vor an diesem Ansatz, haben aber erkennen müssen, dass die Verhältnisse komplexer sind als gedacht. Die Methode kann funktionieren, aber womöglich ist Interferon-alpha nicht der bestmögliche Lockstoff und allein nicht effizient genug. Wir erproben bereits weitere Substanzen, die ebenfalls die Schläfer aufwecken können. Gibt es noch andere Beispiele für medizinische Ansät­ ze, die sich auf Erkenntnisse der Krebsstammzellforschung stützen? Trumpp: Das biopharmazeutische Unternehmen Apogenix, eine Ausgründung des Deutschen Krebsforschungszentrums, hat einen Wirkstoff entwickelt, der gerade erfolgreich eine klinische Phase-II-Studie bei Patienten mit einem Glioblastom durchlaufen hat. Der Wirkstoff lässt auf neue Behandlungsmöglichkeiten für diese tückische Krebserkrankung hoffen. Wie meine Kollegin Ana Martin-Villalba und ihre Mitarbeiter am Deutschen Krebsforschungszentrum kürzlich gezeigt haben, ist der Erfolg vermutlich darauf zurückzuführen, dass diese Substanz besonders die Krebsstammzellen des Tumors angreift. Die so genannte personalisierte Medizin geht davon aus, dass Patienten, die äußerlich an der gleichen Krebser­ krankung leiden, auf Grund molekularer Unterschiede ihrer Tumoren in Gruppen aufgeteilt und unterschiedlich behan­ delt werden müssen. Trumpp: Das gilt beispielsweise für das Pankreaskarzinom, den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wir haben die molekularen Eigenschaften der Krebsstammzellen von Pankreasadenokarzinomen – der häufigsten Variante – bestimmt und können anhand dieser Merkmale mindestens drei Gruppen von Patienten voneinander abgrenzen. Sie unterscheiden sich sowohl im Ansprechen auf die Therapie als auch hinsichtlich der mittleren Überlebenszeit. Bislang werden die Patienten jedoch meist einheitlich behandelt. Was genau kennzeichnet diese verschiedenen Erkran­ kungsarten? Trumpp: Vom Subtyp A wissen wir, dass die Krebszellen auf Gemcitabin – den herkömmlich verabreichten Arzneistoff – kaum reagieren. Bei den betroffenen Patienten stellt sich deshalb die Frage, ob die belastende Therapie für sie überhaupt sinnvoll ist. Bei den Subtypen B und C haben wir in Tierversuchen festgestellt: Wenn wir Gemcitabin zusammen mit neuen Medikamenten einsetzen, die zielgerichtet auf bestimmte tumorspezifische Moleküle einwirken, dann kann dies den Tumor stark hemmen oder sogar eliminieren. Einige der von uns getesteten Arzneimittel sind bereits für die Behandlung anderer Krebsarten zugelassen, werden bislang aber nicht gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs eingesetzt. Wir WWW.SPEK TRUM .DE wollen die Kombination von herkömmlichen Chemotherapeutika und neuen Medikamenten bald in einer klinischen Studie erproben. Gibt es noch weitere Hoffnungsschimmer für die Pa­ tienten? Das Pankreaskarzinom gehört ja nach wie vor zu den Krebserkrankungen mit schlechter Prognose. Trumpp: Zusammen mit unseren Kollegen am Deutschen Krebsforschungszentrum und am Universitätsklinikum Heidelberg sequenzieren wir gerade das Genom der unterschiedlichen Subtypen des Pankreaskarzinoms. Wir lesen die Erbinformation der Krebszellen also quasi Buchstabe für Buchstabe. Die genetischen Profile, die wir dabei finden, wollen wir den verschiedenen Patientengruppen zuordnen. Hoffentlich ergeben sich daraus Angriffspunkte für neue Therapien. Verschiedene Tumorarten haben ja manchmal überraschende molekulare Gemeinsamkeiten. So treten Mutationen, die bestimmte Signalwege durcheinanderbringen, in gleicher Weise bei völlig verschiedenen Krebs­ erkrankungen auf. Arzneistoffe, die auf solche Signalwege einwirken, können also möglicherweise mehrere Krebsarten angreifen. Entartete Zellen haben oft unzählige Mutationen er­ worben. Was bedeutet das für Ihre Forschung? Trumpp: Wir müssen herausfinden, welche der gestörten molekularen Signalwege wir blockieren müssen, damit ein Tumor zu Grunde geht. Welche von den vielen genetischen Veränderungen sind entscheidend? Keine einfache Frage. Aber ich glaube, dass uns das internationale Krebsgenomprojekt wertvolle Hinweise liefern wird. Es hat zum Ziel, die genetischen Besonderheiten der 50 häufigsten Tumorarten offenzulegen. Wird es sie eines Tages geben, die ersehnte Pille gegen Krebs? Trumpp: Sie meinen, dass man eine Art gordischen Knoten findet, den man mit einem Hieb durchschlagen kann? Das wäre schön. Aber daran glaube ich – noch – nicht, zumindest nicht bei soliden Tumoren. Dennoch: Im Moment ist sehr viel Bewegung in der Krebsforschung. Krebsstammzellen werden bei immer mehr Tumorarten nachgewiesen; es gibt bereits einige zielgerichtet ansetzende Medikamente; weitere sind in klinischer Erprobung; und die Entschlüsselung des Krebsgenoms lässt auf neue, medizinisch verwertbare Einsichten hoffen. Nimmt man all das zusammen, lässt sich eines Tages vielleicht auch für Krebserkrankungen erreichen, was bei anderen Leiden schon gelungen ist – beispielsweise bei Diabetes oder Aids, die unbehandelt tödlich verlaufen, sich bei guter medizinischer Betreuung aber in Schach halten lassen. Mit einem Arsenal verschiedener Therapien könnten die Mediziner künftig Krebs zu einer gut behandelbaren chronischen Erkrankung machen, mit der die Patienten über lange Zeit gut leben können. Das ist es, worauf ich persönlich hoffe. Ÿ Das Gespräch führte Claudia Eberhard-Metzger. Sie lebt und arbeitet als Wissenschaftsjournalistin in Maikammer an der Südlichen Weinstraße. 11 MIT FRDL. GEN. VON CÉDRIC BLANPAIN, UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES ONKOGENESE Krebsstammzellen im Visier Schon seit Längerem spekulieren Forscher über Krebsstammzellen als »Wurzel« von Tumorerkrankungen. Neue Ergebnisse untermauern am Beispiel von Hirn-, Haut- und Darmtumoren, dass diese Zellen tatsächlich eine entscheidende Rolle spielen. VON GERLINDE FELIX J eder Mensch hat Stammzellen. Sie schlummern in den Organen, können sich unbegrenzt teilen und zu verschie­ denen Zelltypen heranreifen. Bei Be­ darf liefern sie Nachschub an gesunden Zellen und helfen dem Körper so, sich ­zu regenerieren. Bis vor etwa 15 Jahren glaubten For­ scher, Tumoren bestünden aus einer Masse gleichartiger Zellen, die sich un­ gehemmt teilen­. Doch dann fiel kana­ dischen Genetikern auf: Wenn man menschliche Leukämiezellen in Labor­ mäuse überträgt, lässt nur eine Unter­ gruppe davon die Tiere an Krebs erkran­ ken. Bei ihnen musste es sich also um eine Art Masterzellen handeln, die als einzige in der Lage sind, neue Tumoren hervorzubringen – Krebsstammzellen. Seither haben Forscher weltweit neue Erkenntnisse dazugewonnen. Demnach sind Tumoren hierarchisch organisiert, vergleichbar einer Pyramide. Die Krebs­ stammzellen stehen dabei an der Spit­ ze: Sie erneuern sich selbst, bringen aber auch sämtliche anderen Zelltypen des Tumors hervor und bauen so die Geschwulst auf. Strahlen- und Chemo­ therapien lassen den Tumor zwar häu­ fig schrumpfen. Doch nach Monaten oder Jahren kehrt er oft zurück – und er­ weist sich diesmal als resistent gegen­ über der Behandlung. Nimmt man an, dass die Krankheit von Krebsstammzellen ausgeht, über­ rascht das nicht; denn sowohl die Strah­ lenbehandlung als auch die Chemothe­ rapie zerstören vorwiegend Zellen, die sich rasch vermehren. Krebsstamm­ zellen sitzen jedoch tief verborgen in schützenden Nischen, sind unter nor­ malen Umständen wenig aktiv und tei­ len sich selten. Zudem verfügen sie oft über effiziente Mechanismen, um Zell­ 12 gifte aus ihrem Inneren herauszubeför­ dern und Schäden am Erbgut zu repa­ rieren. Deshalb können die konventio­ nellen Therapien ihnen wenig anhaben. Das bedeutet aber auch, dass man Tumorerkrankungen bei der Wurzel ­packen kann, wenn man gezielt die Krebsstammzellen angreift. Genau die­ sen Ansatz erforschen Wissenschaftler nun seit Jahren. Doch mit jedem neuen Detail, das ans Licht kommt, wird deut­ licher, wie komplex das Geschehen auf zellulärer Ebene ist. »Es gibt wohl ver­ schiedene Arten von Krebsstammzel­ len, und alle sind hochgefährlich«, sagt Andreas Trumpp (siehe den Beitrag S. 6), Leiter der Abteilung »Stammzellen und Krebs« am Deutschen Krebsforschungs­ zentrum und Geschäftsführer des Hei­ delberger Instituts für Stammzelltech­ nologie und Experimentelle Medizin (HI-STEM). Gezielter Schlag gegen den Krebs Vor drei Jahren erschien im Fachblatt »Nature« eine Studie unter der Leitung von Luis Parada vom Southwestern ­Medical Center in Dallas, Texas (Nature 488, S. 522, 2012). Sie untermauerte das Krebsstammzellkonzept am Beispiel von Glioblastomen, aggressiven Hirntu­ moren bei Erwachsenen. An genetisch veränderten Mäusen, die spontan Hirn­ tumoren ausbilden, konnte Paradas Team zeigen, dass einige Tumorzellen Eigenschaften haben, die denen von Stammzellen ähneln. Von dieser speziel­ len Untergruppe stammen die übrigen Zellen des Tumors ab, wie die Unter­ suchungen belegten. Zudem beobachte­ ten die Forscher, dass genau diese Unter­ gruppe sehr resistent gegenüber Subs­ tanzen ist, die Zellwachstum und Zelltei­ lung hemmen. Sie kann eine Chemothe­ rapie also mit großer Wahrscheinlichkeit überleben und den Tumor nach der Be­ handlung zurückkehren lassen. Das Krebswachstum in der Maus lässt sich eindämmen, wenn man die stammzellähnlichen Tumorzellen ver­ nichtet. Parada und seinen Kollegen ge­ lang dies mit einem experimentellen Trick. Sie veränderten die Zellen so, dass jene, die für Stammzellen typische Oberflächenproteine trugen, sich mit dem Arzneistoff Ganciclovir zerstören ließen. Der Stoff wird normalerweise ge­ gen Herpesviren eingesetzt. Nachdem die Forscher die mutmaßlichen Krebs­ stammzellen mit Ganciclovir eliminiert hatten, beseitigten sie noch die meisten übrigen Tumorzellen mittels Chemo­ therapie. Diese kombinierte Behand­ lung führte zu einem dramatisch ein­ geschränkten Wachstum des Tumors. Allerdings stellt die Methode keinen Therapieansatz dar, sondern demonst­ riert nur die Bedeutung der stammzell­ ähnlichen Tumorzellen. Niederländische Forscher um Hans Clevers von der Universität in Utrecht haben ferner herausgefunden, dass Stammzellen bereits in Darmpolypen der Maus – einer möglichen Vorstufe für Darmkrebs – aktiv sind (Science 337, S. 730, 2012). Sie machen fünf bis zehn Prozent der Polypenzellen aus. Clevers und sein Team wiesen nach, dass die Polypen aus Zellen heranwachsen, in denen die gleichen Gene aktiv sind wie in normalen Stammzellen des Darms. Cedric Blanpain von der belgischen Université Libre de Bruxelles und sei­ nen Mitarbeitern gelang es zudem, auch in Mäusen, die an Hautkrebs erkrankt waren, eine Untergruppe von Tumor­ zellen mit Stammzelleigenschaften zu lokalisieren (Nature 488, S. 527, 2012). SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 MIT FRDL. GEN. VON BON-KYOUNG KOO, HUBRECHT INSTITUTE UMC UTRECHT Nachkommen einer Tumorstammzelle. Wissenschaftler der Université Libre de Bruxelles (Belgien) benutzten eine genetische Markierungstechnik, um Krebsstammzellen in Hauttumoren von Mäusen zu kennzeichnen. Alle Zellen, die auf dem Bild grün erscheinen, also große Teile des Tumors, stammen von einer einzigen Krebsstammzelle ab. Die Forscher kennzeichneten einzelne Krebszellen mit Hilfe einer genetischen Markierungstechnik und verfolgten ihre weitere Entwicklung während des Tumorwachstums. Dabei zeigte sich, dass Papillome – gutartige Geschwulste der Haut oder Schleimhaut, die eine Vorstufe von Hautkrebs darstellen kön­ nen – aus zwei Zelltypen bestehen. Der eine stellt das Wachstum nach gewisser Zeit ein, der andere hingegen kann sich unbegrenzt teilen und bringt die Haupt­ masse des Tumors hervor. Eine weitere Studie aus neuerer Zeit beleuchtet die Wechselwirkungen zwi­ schen Krebsstammzellen und Hormo­ nen (Oncogene 10.1038/onc.2012.275, 2012). Den Untersuchungen zufolge ist das Hormon Progesteron indirekt dazu in der Lage, Brustkrebszellen in einen stammzellähnlichen Zustand zurück­ zuversetzen. In diesem Status sind sie resistenter gegenüber Chemotherapie, was die Tumorerkrankung deutlich ge­ fährlicher macht. »Bei Leukämien und beim Prostata­ karzinom kommt es sogar vor, dass Krebsstammzellen die Nischen für adul­ te Stammzellen quasi überfallen und Schnitt durch einen Darmtumor der Maus. Zellen mit Stammzelleigenschaften sind blau angefärbt. Braun erscheinen hin­gegen die so genannten Paneth-Zellen: Drüsenzellen, die im Dünndarm, Mastdarm und Magen auftreten. Die PanethZellen bilden eine Nische für die Tumor­ stammzellen. einnehmen«, so Trumpp. Dort seien sie dann weit gehend gefeit vor therapeuti­ schen Eingriffen und lauerten auf ihre nächste Chance zur Tumorbildung. Zudem, so betont Trumpp, verän­ derten sich Krebsstammzellen im Lauf der Zeit. Je weiter eine Krebserkrankung fortschreite, umso mehr Mutationen sammelten sich in ihnen an. Das ließe neue Krebsstammzellen entstehen, die gegenüber ihren Vorgängern bestimm­ te Wachstums- oder Resistenzvorteile haben könnten, so dass sie sich besser vermehren als diese. »Neuere Erkennt­ nisse deuten an, dass es in einem fort­ geschrittenen Tumor nicht nur eine Gruppe von Zellen gibt, die von einem gemeinsamen Vorgänger abstammen, sondern viele solche Gruppen, die mit­ einander konkurrieren«, sagt Trumpp. »Es handelt sich um so genannte Sub­ klone, an deren Spitzen genetisch ver­ schiedene Krebsstammzellen stehen.« Laut Martin Sprick, einem Mitarbei­ ter von Trumpp am HI-STEM, können therapeutische Eingriffe diese Evolu­ tion der Krebsstammzellen in eine gänzlich unerwünschte Richtung len­ ken. »Vielleicht macht die Chemothera­ Woher kommen Krebsstammzellen? Noch ist unklar, ob Krebsstammzellen durch Entartung aus normalen Stammzellen entstehen oder aus bereits ausgereiften Zellen hervorgehen, die durch Mutationen erneut Stammzelleigenschaften erlangen. Andreas Trumpp vom Deutschen Krebsforschungszentrum und seine Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren das Blut bildende System untersucht und dabei Hinweise auf den ersten Mechanismus gefunden. Demnach können bestimmte genetische Veränderungen normale Stammzellen in Krebsstammzellen verwandeln. Eine wichtige Rolle dabei scheint das MYCGen zu spielen, das die Aktivität anderer Gene verstärkt. Wenn es mutiert ist, kann sich eine Blutstammzelle so verändern, dass sie unentwegt bösartige Tochterzellen ins Blut entlässt und Leukämie verursacht. pie die Krebsstammzellen erst richtig fit, weil sie per Selektion die wider­ standsfähigsten und am besten ge­ schützten begünstigt«, spekuliert er. Aus den Krebsstammzellen schei­ nen auch die Tochtergeschwülste (Me­ tastasen) des Tumors hervorzugehen. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass irgendwann in der Entwick­ lung des Tumors Metastasen bildende Krebsstammzellen entstehen. Sie sit­ zen zunächst in der Nähe des Primär­ tumors, und zwar auf der Innenseite von Blutgefäßen, die ihn versorgen. Dort lassen sie sich in geschützten ­Nischen aus gefäßauskleidenden Zellen (Endothelzellen), Immunzellen und Bindegewebskomponenten nieder und werden von den Endothelzellen mit ­Botenstoffen und Wachstumsfaktoren versorgt. Irgendwann verlassen die Me­ tastasen bildenden Stammzellen ihre Nische und wandern in andere Organe ein, um dort Tochtergeschwülste auf­ zubauen. Diese Fähigkeit haben »nor­ male« Krebsstammzellen nicht. All dies lässt es dringend geboten ­erscheinen, medizinische Verfahren zu entwickeln, die sich gezielt gegen Krebs­ stammzellen richten. Ein Ziel, auf das Trumpp schon lange hinarbeitet. Seine Mitarbeiterin Marieke Essers und er haben­ gezeigt, dass der körpereigene Botenstoff Interferon-alpha Leukämie­ stammzellen dazu bringen kann, ihre Nische zu verlassen und sich zu teilen. Das macht sie anfällig für eine Chemo­ therapie. Allerdings müsse diese Me­ thode noch weiterentwickelt werden, bevor man sie an Patienten anwenden könne, betont Trumpp. Gerlinde Felix ist freie Medizin- und Wissenschaftsjournalistin in Markt Wartenberg. WWW.SPEK TRUM .DE 13 ZELLULÄRE SENESZENZ Unheil durch nicht mehr teilungsfähige Zellen Auch Zellen setzen sich mit fortschreitendem Alter zur Ruhe. Sie hören auf, sich zu teilen. Früher interpretierten Mediziner dies als sinnvolle Vorkehrung gegen Krebs. Nun aber stellt sich heraus, dass solche seneszenten Zellen schädliche Stoffe abgeben. Dadurch beschleunigen sie nicht nur den körperlichen Verfall, sondern begünstigen sogar die Entstehung von Krebs. Von David Stipp E nde 2011 berichteten Jan M. van Deursen und seine Kollegen an der Mayo Clinic in Rochester (Minneso­ ta) über den gelungenen Versuch, Alterungsvorgän­ ge bei Mäusen zu verlangsamen. Ihr Trick war, dafür zu sorgen, dass in den Tieren alle Zellen, die ihre Fähigkeit zur Teilung einbüßten und damit in den Zustand der Senes­ zenz übergingen, sofort zerstört wurden. Van Deursens Er­ gebnisse bedeuteten einen Wendepunkt in der Altersfor­ schung; denn sie hauchten einer umstrittenen, schon mehr als ein halbes Jahrhundert alten Hypothese neues Leben ein. Demnach ist der Verlust der Teilungsfähigkeit von Zellen die Ursache für den allmählichen Verfall des Körpers im Alter. Zum negativen Bild der zellulären Seneszenz passen auch jüngste Erkenntnisse über ihre Rolle bei der Ent­ stehung von Krebs. Lange galt sie als Schutz davor, dass gealterte Zellen, in denen sich mutmaßlich viele schädliche Mutationen angehäuft haben, unkontrolliert zu wuchern beginnen. Wie sich nun zeigte, fördern solche Zellen in mancher Hinsicht jedoch das Tumorwachstum, indem sie ihre Nachbarn zur Teilung anregen. Diesen neuen Erkenntnissen zufolge könnte ein verlangsamter Eintritt der Körperzellen in die Seneszenz unter Umständen helfen, Krebs und an­ dere alterstypische Krankheiten hinaus­zuzögern. Zwar erscheint Seneszente Zellen, die ihre Teilungsfähigkeit verloren haben, lassen sich mit einem einfachen Farbtest erkennen: Bei Zusatz einer bestimmten Chemikalie verfärben sie sich blau. 14 SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 AUF EINEN BLICK VERBINDUNG ZWISCHEN ALTERN UND KREBS 1 In den 1960er Jahren erkannten Forscher, dass Körperzellen nach einer gewissen Zeit aufhören, sich zu teilen. In dieser zellulären Seneszenz sahen Mediziner lange die eigentliche Ursache für das Altern, da sie das Regenerationsvermögen von Gewebe beeinträchtigt. 2 Als biologischer Sinn der Seneszenz galt, dass sie Krebs vorbeugt. Denn sie hindert Zellen, die im Lauf des Lebens mutmaßlich viele Mutationen angehäuft haben, an der unkontrollierten Vermehrung. 3 Wie sich inzwischen herausstellte, bleiben die meisten Zellen jedoch lange genug teilungsfähig, um auch im hohen Alter noch eine Regeneration von Gewebe zu ermöglichen. 4 Zudem fördern seneszente Zellen Krebs, statt ihn zu verhüten: Sie sondern Stoffe ab, die ihre Nachbarn schädigen und zur Teilung anregen sowie Entzündungen auslösen. WWW.SPEK TRUM .DE Wurden sie im Tierversuch eliminiert, verlangsamte das den Alterungsprozess und linderte altersbedingte Gebrechen. ANATOMY BLUE 5 15 die Beseitigung seneszenter Zellen für Menschen in abseh­ barer Zeit nicht als realistische Option – erforderte sie bei den Mäusen des Mayo-Teams doch komplizierte genetische Ein­ griffe. Vielleicht führen einfachere Maßnahmen aber zum gleichen Ergebnis. Altern als Preis für Schutz gegen Krebs? Die Geschichte der Forschung über die zelluläre Seneszenz ist von Aufsehen erregenden Entdeckungen und spektaku­ lären Kehrtwendungen geprägt. Der US-Gerontologe Leo­ nard Hayflick erkannte schon 1961, dass menschliche Zellen nach rund 50 Teilungszyklen die Fähigkeit zur Vermehrung ein­büßen. Auf diesen Mechanismus führte er letztlich die ­Alterung des gesamten Körpers zurück: Das Abschalten der Zellteilung ­mache es unmöglich, geschädigtes Gewebe zu er­ neuern. Laut Hayflick sind Zellen darauf programmiert, nach einer festen Anzahl von Replikationszyklen in den Ruhe­ zustand überzugehen, damit sie sich nicht unkontrolliert vermehren und krebsartig wuchern können. Den Beitrag der zellulären Seneszenz zum Altern hielt der Forscher für den Preis, den wir dafür bezahlen, besser gegen Krebs geschützt zu sein. Untersuchungen ab den 1970er Jahren stützten diese Vorstellung. Demnach steckt eine molekulare Uhr hinter der »Hayflick-Grenze«. Jedes Mal, wenn sich eine Zelle teilt, verkürzen sich die so genannten Telomere. Dabei handelt es sich um Abschnitte am Ende der Chromosomen, die aus re­ petitiven DNA-Sequenzen samt den zugehörigen Proteinen bestehen. Sind sie unter eine bestimmte Länge geschrumpft, stellt die Zelle die Teilung ein. Spätere Studien weckten jedoch Zweifel an dieser Theorie. So berichteten mehrere Forschungsgruppen Ende der 1990er Jahre, dass die Fähigkeit von Hautzellen, sich zu vermehren, mit dem Alter nicht wesentlich nachlässt. Offenbar errei­ chen im Leben eines Menschen nicht genug Zellen die Hay­ flick-Grenze, um die Geweberegeneration deutlich einzu­ schränken. Im Einklang mit diesen Befunden fanden sich bei Mäusezellen sehr lange Telomere, was anscheinend verhin­ dert, dass ihre zelluläre Uhr abläuft, bevor sie sterben. 2001 16 erklärten die beiden Gerontologen Harriet und David Gershon vom Technion in Haifa (Israel) in einem Übersichtsartikel die Telomer-Theorie des Alterns deshalb für »irrelevant«. Damit rückte die zweite mögliche Funktion der zellulären Seneszenz ins Zentrum des Interesses: die Schutzwirkung gegen Krebs. Schon Anfang der 1990er Jahre war bekannt, dass bestimmte Arten von Zell­ schädigungen – insbesondere Mutationen – unkontrolliertes Wuchern und andere Veränderungen hervorrufen können, die für Tumoren typisch sind. Wie sich außerdem zeigte, lö­ sen solche gefährlichen Zellschäden in der Regel die Senes­ zenz aus – vermutlich, um die nicht mehr normal funktio­ nierenden Zellen daran zu hindern, bösartig zu werden. Bei­ spielsweise bewirkt die Zugabe mutagener Oxidationsmittel zur Nährlösung von Zellkulturen den Übergang in das Ruhe­ stadium. Passend dazu entdeckte 1997 die Arbeitsgruppe von Manu­ el Serrano, heute am spanischen nationalen Krebsforschungs­ zentrum in Madrid, dass auch eine lang anhaltende Stimula­ tion zur Teilung die Seneszenz auslöst. Mutierte Gene, die das Wachstum von Tumoren antreiben, sind bekannt dafür, sol­ che andauernden Teilungssignale auszusenden. Wie diese und weitere Entdeckungen nahelegten, gibt es eine Art Antikrebsmechanismus innerhalb der Zelle. Er bein­ haltet die kontinuierliche Suche nach Zeichen einer Schädi­ gung, die eine unkontrollierte Vermehrung in Gang setzen könnte. Wenn sich solche Hinweise häufen und einen Grenz­ wert überschreiten, wird in schweren Fällen das Apoptose­ programm gestartet, in dessen Verlauf sich die Zelle selbst auflöst. In anderen Fällen ist die Reaktion nicht so drastisch: Die entartete Zelle tritt in den Zustand der Seneszenz ein, in dem sie sich nicht mehr teilen kann. Das erlaubt ihr, quasi im Ruhestand weiterzuexistieren. Doch dann versetzten neue Befunde auch dieser Theorie einen schweren Schlag: Forscher entdeckten, dass seneszente Zellen zwar nicht selbst wuchern, aber trotzdem Krebs auslö­ sen können. Eine prominente Rolle spielte dabei Judith Cam­ pisi, die inzwischen am Buck Institute for Research on Aging in Novato (Kalifornien) arbeitet. Ihre Untersuchungen er­ schütterten die Vorstellung, wonach seneszente Zellen nur in aller Ruhe ihren Lebensabend verbringen, und lieferten Indi­ zien dafür, dass sie sowohl das Tumorwachstum fördern als auch weiteres Unheil in ihrer Umgebung anrichten können. Die ersten Hinweise auf eine solche heimtückische Wir­ kung tauchten in den späten 1990er Jahren auf. Es handelte sich um Befunde, wonach seneszente Zellen das umliegende Gewebe – ihre »Mikroumgebung« – schädigen könnten und es so in eine »üble Gegend« verwandeln, in der Tumoren ge­ deihen. 2001 erhärtete das Team von Campisi diesen Ver­ dacht. Wie eine bahnbrechende Studie zeigte, können senes­ zente Zellen in einer Zellkultur Nachbarn, die sich in ­einem Krebsvorstadium befinden, dazu anregen, außergewöhnlich aggressive Tumoren zu bilden, wenn man sie später Mäusen injiziert. SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Dieser schlechte Einfluss rührt offenbar von der Tendenz vieler alternder Zellen her, einen Mix potenziell gefährlicher Moleküle abzusondern. Einige davon begünstigen die unge­ hemmte Vermehrung oder lösen Proteine auf, welche die Zellen eines Gewebes umgeben und an ihrem angestamm­ ten Platz halten. Metastasierende Tumorzellen scheinen die­ selben abbauenden Enzyme einzusetzen, um sich gleichsam durch die Hülle des jeweiligen Gewebes zu fräsen. Zusammenhang mit der Wundheilung Campisi prägte für das Phänomen den Begriff »seneszenz­ assoziierter sekretorischer Phänotyp« oder kurz SASP. Wei­ tere Belege dafür, dass alternde Zellen unter bestimmten Umständen schädliche Moleküle abscheiden, veröffentlichte die Forscherin im Jahr 2008. Damit stürzte sie viele Wissen­ schaftler in große Verwirrung. Warum sollten Zellen in ei­ nem Zustand, der offenkundig zur Verhinderung von Krebs diente, ihn auf andere Weise aktiv fördern? Das schien kei­ nen Sinn zu ergeben. Doch Campisi lieferte eine mögliche Lösung des Rätsels, indem sie auf Untersuchungen zur Wundheilung verwies. Diese scheint nämlich in mancher Hinsicht dem Krebs zu ähneln. Beispielsweise sind Tumoren und teilweise geheilte Wunden mit Faserproteinen überzogen, die entstehen, wenn Vorläufer von Gerinnungsproteinen aus Blutgefäßen entwei­ chen und sich zu einem Maschennetz verbinden, das die Re­ paratur des verletzten Gewebes unterstützt. Unter dem Ein­ druck solch auffälliger Gemeinsamkeiten vermutete der Pa­ thologe Harold Dvorak von der Harvard Medical School in Boston schon 1986, dass Tumoren die Wundheilungsme­ chanismen des Körpers für ihr entartetes Wachstum miss­ brauchen. Sie wirken auf unseren Körper, so seine damalige Wie gute Zellen zu bösen wurden Ursprünglich galt Seneszenz bei Zellen – also der dauerhafte Verlust der Teilungsfähigkeit – als Ruhezustand mit einer positiven und einer negativen Seite (links unten): Einer­seits unterbindet sie die unkontrollierte Selbstvermehrung und beugt damit Krebs vor. Andererseits behindert sie die Regeneration von Gewebe, da diese teilungsfähige Zellen erfordert, und ist damit ein Grund für den Verfall des Körpers im Alter. Heute erscheint die zelluläre Seneszenz ausschließlich negativ (rechts). So hat sich gezeigt, dass seneszente Zellen schädliche Stoffe ausscheiden können. Diese fördern chronische Entzündungen, die vielen Alters­ erscheinungen zu Grunde liegen. Zudem regen sie Nachbarzellen zur Teilung an und teilungsunfähige fördern damit das Tumorwachstum. seneszente Zelle Neue Sicht sekretorische seneszente Zelle nichtsekretorische seneszente Zelle abgesonderte Moleküle Folgen Frühere Sicht schlecht: fördert Krebs in anderen Zellen Folgen gut: Die Zelle verhindert ihre eigene unkontrollierte Vermehrung. normale Zelle schlecht: Die zelluläre Seneszenz fördert die Alterung des Gewebes. präkanzeröse Zelle schlecht: verursacht Entzündungen präkanzeröse Zelle Tumor geschädigtes Gewebe Entartete Zellen bleiben ungefährlich, weil sie nicht wuchern können. WWW.SPEK TRUM .DE Die Zellen können sich nicht mehr teilen, was für die Erneuerung des Gewebes notwendig wäre. Die abgesonderten Stoffe regen Zellen zum Wuchern an. Chronische Entzündungen können zur Entstehung von Krebs sowie zu altersbedingten Erkrankungen wie Morbus Alzheimer, Diabetes oder Arteriosklerose beitragen. GERT NIELSEN aktivierte Entzündungszellen im Gewebe 17 VAN DEURSEN LABORATORY, MAYO CLINIC Aussage, wie »eine endlose Reihe von Wunden, die dauernd eine Heilung einleiten, aber nie wirklich abheilen«. Neueren Untersuchungen zufolge spielt die Zellalterung dabei eine Rolle. Wenn Gewebe verletzt wird, gehen Zellen im Wundbereich in den Zustand der Seneszenz über. Dadurch regen sie eine Entzündung an, die den Heilungsprozess an­ stößt. Unter anderem schütten sie dazu chemische Boten­ stoffe aus – so genannte Zytokine, die Immunzellen anlocken und aktivieren, um mögliche Infektionen zu bekämpfen so­ wie tote Zellen und Unrat zu entfernen. Später vermehren sich gesunde Zellen, um die verlorenen zu ersetzen. Schließlich sondern seneszente Zellen abbauende Enzyme ab, um Protein­ fasern, die zunächst ein Stützgerüst gebildet hatten, wieder zu zerlegen; dieser Abbau begrenzt die Narbenbildung. Indem Campisi alle diese Puzzleteile zusammensetzte, ­gelangte sie zu der Schlussfolgerung, dass die zelluläre Senes­ zenz im Verlauf der Evolution nicht nur dazu diente, übermä­ ßigem Wachstum geschädigter Zellen vorzubeugen, sondern zugleich eine Rolle bei der Wundheilung übernahm. Dadurch aber musste sie SASP in ihr Repertoire aufnehmen. Leider macht der sekretorische Betriebsmodus seneszente Zellen jedoch zu ausgezeichneten Komplizen für Tumoren, die den Wundheilungsprozess für ihr eigenes Wachstum ausnutzen. Außerdem kann die Fähigkeit solcher Zellen, eine Entzün­ dung auszulösen, letztendlich den gesamten Körper in eine »üble Gegend« verwandeln. Einiges spricht nämlich dafür, dass schwache Entzündungen nicht nur Krebs, sondern über­ dies Arteriosklerose, die Alzheimerdemenz, Typ-2-Diabetes und weitere altersbedingte Krankheiten begünstigen. Normalerweise schwindet mit dem Alter das Fettgewebe unter der Haut (unten). Bei genetisch veränderten Mäusen, die seneszente Zellen unverzüglich eliminieren, bleibt die Fettschicht, die hier weiß erscheint, dagegen erhalten (oben). Das spricht für eine Beteiligung der zellulären Seneszenz am Alterungsprozess. Wie seneszente Zellen zum Altern beitragen Nachdem die unrühmliche Rolle seneszenter Zellen bei der Entstehung von Krebs aufgedeckt war, begannen Forscher auch wieder nach Zusammenhängen mit dem Altern zu su­ chen. Dabei zeigte sich, dass die Ruheständler mit verdäch­ tiger Häufigkeit überall dort vorkommen, wo etwas schief­ gelaufen ist. Auch im alternden Körper insgesamt finden sie sich auffallend zahlreich. So gelang 2006 der Nachweis, dass sich die Immunabwehr bei betagten Mäusen im selben Maß abschwächt, wie die Seneszenz bei jenen Stammzellen zu­ nimmt, die normalerweise stetig die diversen Zelltypen des Immunsystems produzieren. Hilfreich für solche Experimente war die Entdeckung von Erkennungsmerkmalen für seneszente Zellen. Zu den wich­ tigsten solchen Seneszenzmarkern gehört die erhöhte Kon­ zentration eines Proteins namens p16, das von dem Gen p16Ink4a kodiert wird. David Beach von der Queen Mary Univer­ sity in London hat es 1993 entdeckt. Wie sich später heraus­ stellte, wirkt es dabei mit, Zellen an der Vermehrung zu hin­ dern, wenn bestimmte Arten von Schädigungen auftreten. Norman E. Sharpless und seine Kollegen von der Universi­ ty von North Carolina in Chapel Hill konnten mit einer Reihe von Untersuchungen bei Nagetier- und menschlichen Zellen einen statistischen Zusammenhang zwischen Alterung und p16-Spiegel nachweisen. Letzterer erhöht sich demnach mit 18 den Lebensjahren, während zugleich die Fähigkeit der Zellen abnimmt, sich zu vermehren und verletztes Gewebe zu repa­ rieren. Wie die Gruppe von Sharpless 2004 berichtete, gilt dies für fast alle Zelltypen. Interessanterweise lässt sich der p16-Spiegel durch verminderte Kalorienzufuhr senken. Das passt zu der seit den 1930er Jahren bekannten Tatsache, dass bei einer Reihe von Tierarten eine strenge Diät die Lebens­ spanne verlängern und ein gesundes Altern fördern kann. Im Jahr 2009 lieferte das Labor von Sharpless ein weiteres Puzzleteil. Demnach steigt auch in den T-Zellen des mensch­ lichen Immunsystems der p16-Spiegel steil mit dem Alter an. Besonders ausgeprägt ist dieser Anstieg bei Rauchern und körperlich wenig aktiven Menschen – ein Anhaltspunkt ­dafür, dass beide Verhaltensweisen die zelluläre Seneszenz begüns­ tigen. Sharpless ist ein jung aussehender Mann von 45 Jahren. Trotzdem hat er, wie er mir lachend erzählte, bereits einen doppelt so hohen p16-Spiegel wie seine Doktoranden. Das stellte er fest, nachdem sein Labor einen leicht anwendbaren Test zur Messung des Markers entwickelt hatte. Sharpless und seine Kollegen wiesen aber nicht nur eine statistische Beziehung zwischen dem p16-Spiegel und Merk­ malen des Alterns nach. Sie belegten mit einer Reihe von Un­ tersuchungen auch einen direkten kausalen Zusammen­ hang. Demnach ist die zelluläre Seneszenz nicht etwa eine SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 bloße Begleiterscheinung des Alterns von Geweben und des gesamten Organismus, sondern trägt aktiv dazu bei. Das ­ergaben Versuche, über die das Team 2006 berichtete. Dabei hatten die Forscher in betagten Mäusen das p16-Gen blo­ ckiert, so dass die Tiere nur in stark vermindertem Maß se­ neszente Zellen bilden konnten. Daraufhin vermochten die Nager abgestorbene Pankreaszellen nach einer Giftgabe fast genauso gut zu regenerieren wie jüngere Artgenossen. Au­ ßerdem waren sie besser als normale Gleichaltrige dazu im Stande, Nervenzellen in bestimmten Regionen ihres Gehirns zu erneuern. Und auch die Regenerationsfähigkeit der Blut­ stammzellen lag über dem alterstypischen Wert. Anderen Untersuchungen aus den letzten sieben Jahren zufolge liefern genetische Unterschiede in der Menge an p16, die verschiedene Menschen produzieren, möglicherweise ei­ nen Hinweis auf ihr persönliches Risiko, verschiedene alters­ bedingte Krankheiten wie Arteriosklerose oder Morbus Alz­ heimer zu entwickeln. Laut Sharpless haben diese Ergebnisse große Beachtung bei Medizinern gefunden, die sich mit sol­ chen Altersleiden befassen. Gibt es ein Mittel gegen den körperlichen Verfall? Noch aufregender sind die eingangs erwähnten Forschungs­ arbeiten an der Mayo-Klinik, die beweisen, dass sich durch Eingriffe in die zelluläre Seneszenz typische Alterserschei­ nungen hinauszögern lassen. Das Team von van Deursen er­ zeugte Mäusestämme, die gleich doppelt genetisch verändert waren. Zum einen hatten die Tiere einen Defekt im Erbgut, der in verschiedenen Geweben zu einer vorzeitigen zellulä­ ren Seneszenz führte. Zum anderen trugen sie ein Gen, das dafür sorgte, dass ein bestimmter Wirkstoff jede Zelle abtöte­ te, in der das p16-Gen angeschaltet wurde. Eine lebenslange Behandlung mit dieser Substanz entfernte also kontinuier­ lich sämtliche Zellen, die ins Seneszenzstadium übergingen. Das hatte eminente positive Auswirkungen, wie die For­ scher berichteten. Gewisse altersbedingte Störungen wie etwa grauer Star, die bei unbehandelten Mäusen schon in jungen Jahren eintraten, verzögerten sich deutlich. So blieb das Unterhautfettgewebe länger erhalten, und der Muskel­ abbau setzte nicht so früh ein. Selbst wenn die Behandlung später im Leben der Mäuse begonnen wurde, verlangsamte sich der altersbedingte Verlust von Fett- und Muskelgewebe. So spektakulär die Befunde des Mayo-Teams sind, ist da­ mit noch nicht gesagt, ob es generell – und auch bei uns Menschen – von Vorteil wäre oder sich lebensverlängernd auswirken könnte, seneszente Zellen regelmäßig aus dem Verkehr zu ziehen. Campisi weist etwa darauf hin, dass die Mäuse unter künstlich induziertem, vorzeitigem Altern litten, weshalb die Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf das normale Altern übertragbar seien. Zudem bewahrte das rasche Ent­ fernen der seneszenten Zellen die Nager keineswegs vor ihrer Haupttodesursache: vorzeitigem Herz-Kreislauf-Versagen. Deshalb lebten sie auch nicht wesentlich länger. Aber einmal angenommen, irgendwann käme der Beweis, dass eine Blockade der zellulären Seneszenz tatsächlich das WWW.SPEK TRUM .DE Altern bis zu einem gewissen Grad verlangsamen oder we­ nigstens gegen Falten wirken und andere altersbedingte Ge­ brechen lindern könnte – wie ließe sich diese Erkenntnis ­medizinisch nutzen? Das Verfahren der Mayo-Forschungs­ gruppe auf Menschen zu übertragen hieße, Genmanipula­ tionen an befruchteten Eizellen vornehmen zu müssen. Das erscheint aus ethischen Gründen ausgeschlossen. Das p16Gen medikamentös auszuschalten, wäre auch problema­ tisch. Dadurch stiege womöglich das Krebsrisiko. Dennoch bieten sich einige erstaunlich einfache Optionen. Da ist einmal die Erkenntnis, dass Raucher und Men­ schen mit Bewegungsmangel im Allgemeinen erhöhte p16Spiegel haben. Demnach könnten Abstinenz vom Glimm­ stängel und körperliche Bewegung helfen, jene Art moleku­ larer Schädigungen zu verhindern, welche die zelluläre Seneszenz fördern. Einen ähnlich positiven Effekt hätte wohl auch das Abnehmen. Wie van Deursen und sein Kol­ lege James Kirkland vermuten, können Vorläufer von Fett­ zellen, so genannte Präadipodizyten, bei übergewichtigen Menschen und Tieren einen Zustand auslösen, der dem be­ schleunigten Altern stark ähnelt. Eine große Anzahl dieser Zellen wird nämlich seneszent und fördert somit gemäß Campisis Theorie chronische leichte Entzündungen im ge­ samten Körper. Es gibt auch vorläufige Hinweise, wonach ein Wirkstoff namens Rapamycin der zellulären Seneszenz vorbeugen könnte, ohne Krebs zu begünstigen. Interessanterweise hat die Substanz die Lebensspanne von Mäusen verlängert, ­denen sie dauerhaft verabreicht wurde (siehe Spektrum der Wissenschaft 7/2012, S. 22). Wie die Forschungsgruppe von Campisi außerdem unlängst nachwies, unterdrücken einige entzündungshemmende Medikamente die Sekretion schäd­ licher Stoffe durch seneszente Zellen. Es scheint also nicht ausgeschlossen, dass sich irgendwann ein wirksames Mittel gegen das Altern und seine Beschwer­ den findet. Bis dahin aber rät Sharpless allen, die sich eines langen Lebens in Gesundheit erfreuen möchten: »Nicht rau­ chen, vernünftig essen und sich bewegen!« Ÿ DER AUTOR David Stipp ist Wissenschaftsjournalist, lebt in Boston und hat sich auf Gerontologie spezialisiert. Sein Buch »The Youth Pill: Scientists at the Brink of an Anti-Aging Revolution« erschien 2010 bei Penguin. Stipp schreibt einen englischsprachigen Blog zur Alternsforschung unter www.davidstipp.com. QUELLEN Baker, D. J. et al.: Clearance of p16Ink4a-Positive Senescent Cells Delays Ageing-Associated Disorders. In: Nature 479, S. 232 – 236, 2011 Rodier, F., Campisi, J.: Four Faces of Cellular Senescence. In: Journal of Cell Biology 192, S. 547 – 556, 2011 Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1184762 19 ANGIOGENESE Krebs, Blutgerinnung und Stress – eine pikante Ménage-à-trois Ein erhöhtes Krebsrisiko geht oft Hand in Hand mit einer verstärkten Neigung zu Blutgerinnseln. Die beiden verbindet ein bislang unbekannter Regulationsmechanismus bei der Bildung des Gerinnungsfaktors Prothrombin. Von Matthias W. Hentze und Andreas E. Kulozik A m Silvestertag 1866 entdeckte Armand Trous­ seau (1801 – 1867) in seinem linken Arm ein Blut­ gerinnsel. Der Pariser Internist hatte sich durch seine bahnbrechenden wissenschaftlichen Bei­ träge in ganz Frankreich einen ausgezeichneten Ruf erwor­ ben. Unter anderem hatte er einen Zusammenhang beob­ achtet zwischen dem häufigen Auftreten von Blutgerinnseln und Tumoren, insbesondere des Magens und der Bauch­ speicheldrüse. Die Krankheitskombination wurde nach ihm auch als Trousseau-Zeichen benannt. Auf Grund dieser Er­ fahrungen interpretierte Trousseau sein eigenes Blutgerinn­ sel als Hinweis auf eine Krebserkrankung, von der er bis da­ hin noch nichts wusste. Tatsächlich erlag er ihr schon im Sommer des folgenden Jahres. AUF EINEN BLICK ÜBERRASCHENDE ZUSAMMENHÄNGE 1 Krebspatienten leiden häufig an einer Neigung zu Blut­ gerinnseln. Umgekehrt haben Menschen mit einer verstärkten Blutgerinnung ein erhöhtes Krebsrisiko. 2 Geraten Zellen durch Entzündungsprozesse unter Stress – etwa bei Krebs –, blockiert ein Enzym namens p38-MAP-Kinase jene Proteine, die normalerweise die Produktion von Prothrombin drosseln. Dadurch entsteht dieser Blutgerinnungsfaktor im Übermaß. 3 Thrombin, die aktive Version von Prothrombin, trägt auch zur Bildung neuer Blutgefäße bei und kann den Kitt auflösen, der die Zellen zusammenhält. Möglicherweise erhöhen also Krebszellen ihre Prothrombinproduktion, um besser in gesundes Gewebe einzudringen und neue Blutgefäße herzustellen, welche die Tumorzellen versorgen. 4 Dabei bestimmt ein zuvor unbekannter Mechanismus, wie viel Prothrombin entsteht. Er beeinflusst die Umwandlung der Vorläufer-mRNA in die reife mRNA – den Bauplan für das Protein – und letztlich die Menge des gebildeten Prothrombins. 20 Es dauerte eineinhalb Jahrhunderte, bis nun endlich neue Forschungsergebnisse Licht ins Dunkel dieses mysteriösen Zusammenhangs zwischen Tumoren und der Neigung zur Bildung von Blutgerinnseln (Thrombose) bringen. Unter­ suchungen zu den Ursachen dieser so genannten Thrombo­ philie haben einen bislang unbekannten Mechanismus auf­ gedeckt, über den unser Körper die Produktion einzelner Proteine reguliert. Ihn nutzen auch Tumoren, um sich besser im Körper auszubreiten. Die zum Teil überraschenden ­Erkenntnisse erlauben nun sowohl neue Einblicke in die Prozesse, die bei Entzündungen ablaufen, als auch in die Entwicklung innovativer Behandlungsstrategien gegen Tu­ morerkrankungen. Zentraler Akteur des Dramas ist ein Protein namens Pro­ thrombin. Dessen Umwandlung in Thrombin, etwa bei Ver­ letzungen, stellt einen wichtigen Schritt bei der Blutgerin­ nung dar. Zu große Mengen von Prothrombin, das auch F2 (Gerinnungsfaktor II) genannt wird, stören die fein regu­ lierte Balance zwischen blutgerinnungsfördernden und -hemmenden Molekülen, was letztlich zu Thrombophilie führt. Wie alle Eiweiße besteht auch Prothrombin aus einer Ket­ te von Aminosäuren. Diese sind gemäß einem vorgegebenen Bauplan miteinander verknüpft – der Boten-RNA (mRNA für messenger RNA). Die mRNA besteht im Wesentlichen aus Ab­ folgen der basischen Moleküle Adenin (A), Cytosin (C), Gua­ nin (G) und Uridin (U) und beginnt ihr Dasein als direkte ­Kopie der in der DNA kodierten genetischen Information (siehe Grafik S. 23). Bevor sie jedoch als Blaupause für die ­Eiweißsynthese dienen kann, muss sie mehrere Reifungs­ schritte (»Prozessierung«) durchlaufen: ➤ Im mittleren Teil der Vorläufer-mRNA gehen oft zahlrei­ che Abschnitte verloren, so genannte Introns; ➤ das vordere Ende wird chemisch verändert, um die Stabi­ lität zu erhöhen; SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 ➤ Enzyme schneiden das hintere Ende an einem exakt fest­ gelegten Punkt ab und hängen dort eine Abfolge von rund 250 Adeninen an: den »Poly-A-Schwanz«. Dieser letzte Schritt ähnelt der Bearbeitung eines abge­ schnittenen Seils, das sonst ausfransen würde. Der Poly-ASchwanz spielt für die Funktionsfähigkeit der mRNA und auch für ihre Stabilität eine entscheidende Rolle. Letzteres ist wichtig, denn: Häufen sich größere Mengen einer mRNA an, entsteht im Allgemeinen mehr entsprechendes Eiweiß – so auch bei der Prothrombin-mRNA. Forscher um den niederländischen Biochemiker Rogier M. Bertina von der Universität Leiden hatten schon 1996 eine ungewöhnliche ererbte Mutation in der Prothrombin-mRNA entdeckt, die bei vielen Thrombophiliepatienten auftritt. Und zwar findet sich diese genau an jener Stelle des hinteren RNA-Teils, wo er vor Anfügen des Poly-A-Schwanzes abge­ schnitten wird. Die Entdeckung überraschte die Wissen­ schaftler, denn meistens wirken sich Veränderungen der RNA nur dann auf ihre Funktion aus, wenn sie die Amino­ säureabfolge des Eiweißes betreffen. Die Schnittstelle liegt jedoch hinter der Region, die den Bauplan dafür enthält. Zu­ dem geht die bei etwa ein bis zwei Prozent der nord- und westeuropäischen Bevölkerung vorkommende und damit vergleichsweise häufige Mutation nicht wie üblich mit einer AG. FOCUS / SCIENCE PHOTO LIBRARY / PIETRO MOTTA Die Blutgerinnung ist ein komplizierter mehrstufiger Ablauf, an dessen Ende sich ein Netzwerk aus Fibrinfasern bildet, in dem sich die roten Blutkörperchen verfangen. Ein wichtiger Schritt bei dieser biochemischen Reaktionskaskade ist die Umwandlung von Prothrombin in Thrombin. Normaler­weise hat die Blutgerinnung die Aufgabe, den Körper etwa bei Verletzungen vor über­mäßigem Blutverlust zu schützen. Eine zu große Menge an Prothrombin kann aber dazu führen, dass die Betroffenen vermehrt spontan Gerinnsel in den Blutgefäßen bilden. WWW.SPEK TRUM .DE 21 IC L UB AI M DO N P Der französische Mediziner Armand Trousseau (1801 – 1867) entdeckte einen Zusammenhang zwischen dem häufigen Auftreten von Blutgerinnseln und bestimmten Tumoren (genannt Trousseau-Zeichen). Ironie des Schicksals: Trousseau starb an einer Krebserkrankung, die er bei sich selbst auf Grund eines Blutgerinnsels im Arm diagnostizierte. eingeschränkten Funktion einher, sondern mit einer gestei­ gerten: Es entsteht dadurch mehr Protein. Wegen dieser ungewöhnlichen Situation betrachteten die Forscher die Veränderung zunächst gar nicht als wirklichen Auslöser der erhöhten Eiweißsynthese, sondern nur als ei­ nen genetischen Marker für eine bis dato noch unbekannte Ursache. Außerdem war man zu dieser Zeit allgemein der Auffassung, der Reifungsprozess am hinteren Ende der mRNA sei ein zwar notwendiger, aber kaum regulierter Schritt auf dem Weg vom Gen zum Protein. Zumindest wa­ ren damals noch keine Zusammenhänge zwischen Verände­ rungen an der Schnittstelle in der RNA und irgendwelchen Krankheiten durch gesteigerte mRNA-Produktion bekannt. Nachdem wir uns jedoch die Basenabfolge an dieser Stelle der Prothrombin-mRNA genauer angeschaut hatten, fiel uns auf: Bei Thrombophilie wird das normalerweise vorkom­ mende CG durch ein CA ersetzt. Nun enthalten aber die mRNAs der meisten anderen Proteine dort genau dieses CA und kein CG. Insofern bildet die Prothrombin-mRNA eine Ausnahme unter den RNAs. Daraus zogen wir zwei Schlussfolgerungen. Zum einen könnte der Reifungsprozess am hinteren Ende der Prothrom­ bin-mRNA davon abhängen, ob hier ein CG oder ein CA steht. Und zum anderen könnte der Wechsel von CG zu CA bei Thrombophilie möglicherweise die Reifung fördern und da­ mit zu mehr Prothrombin-mRNA führen, da CA ja eigentlich den Normalfall darstellt. Unsere folgenden Untersuchungen bestätigten diese Annahmen. Damit hatten wir ein grund­ sätzlich neues Prinzip etabliert, wie Genveränderungen Er­ krankungen auslösen können: indem sie die Prozessierung 22 der Vorläufer-mRNA fördern und dadurch die Menge an ge­ reifter mRNA erhöhen. Die Entdeckung warf jedoch sofort wieder neue Fragen auf: Weshalb hat das Prothrombin-Gen bei Gesunden ein ineffizientes Reifungssignal? Und wie schaffen es die Zellen, trotzdem ausreichende Mengen des Proteins zu produzie­ ren? Eine genauere Untersuchung des RNA-Strangs zeigte zunächst, dass an der hinteren Schnittstelle sogar noch ein weiteres Element fehlt, das normalerweise die Prozessierung des Moleküls fördert. Dieses DSE (Abkürzung für »downstream sequence element«) enthält sehr viel Uridin, was bei der Pro­ thrombin-RNA nicht der Fall ist. Dann entdeckten wir jedoch einen kurzen Abschnitt, den wir USE für »upstream sequence element« nannten und der die Effizienz von CG als Reifungssignal massiv erhöhen kann. Dieser »USE-Verstärker« funktioniert allerdings nicht nur im Zusammenspiel mit CG, sondern genauso bei einem CA-­ Signal, und führt dann zu einer überhöhten ProthrombinmRNA-Produktion. Genau das passiert bei Thrombophilie­ patienten. Aber warum hat sich überhaupt dieses komplizierte Sys­ tem aus einem abgeschwächten Element, das von einer an­ deren Sequenz verstärkt werden muss, im Verlauf der Evolu­ tion herausgebildet? Es wäre doch viel einfacher, wenn wie bei anderen RNAs ein einziges, ausreichend effizientes Signal die Aufgabe übernähme. Ein möglicher Zweck bestünde da­ rin, die mRNA-Produktion bei Bedarf erhöhen zu können, also regelbar zu machen. Um herauszufinden, wie der USEVerstärker beim Reifungsprozess mitwirkt, mussten wir uns näher mit jenen Proteinen beschäftigen, die an der Prozes­ sierung am Schwanzende von mRNAs beteiligt sind. Diese Eiweiße finden sich dabei teilweise zu größeren Komplexen zusammen und können sich erst dann an die mRNA anheften, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Wie wir he­ rausfanden, wird der Vorgang erleichtert, wenn sich an den USE-Verstärker einige weitere Proteine binden (mit den Be­ zeichnungen U2AF35, U2AF65 und PTB). Zellen unter Stress Von diesen Molekülen war bereits bekannt, dass sie eine Rol­ le spielen, sobald Zellen unter Stress geraten. Daher riefen wir als Nächstes bei Laborkulturen diesen Zustand durch Zu­ gabe der Substanz Anisomycin hervor. Ergebnis: Die Zellen bildeten vermehrt Prothrombin-mRNA. Wie lässt sich das er­ klären? Normalerweise kleben andere Proteine – genannt FBP2 und FBP3 – am USE und blockieren so den Zugang der Ver­ stärkerproteine U2AF35, U2AF65 und PTB. Bei zellulärem Stress lösen sich FBP2 und -3 jedoch ab, was den Verstärkern ermöglicht, sich an das USE anzuheften, worauf sich größere Mengen an stabiler mRNA bilden. Experimente, bei denen wir in kultivierten Zellen einerseits U2AF35, U2AF65 und PTB beziehungsweise andererseits FBP2 und FBP3 gezielt aus­ schalteten, untermauerten diese Vorstellung: Sie belegten, dass erstere drei Proteine für die Reifung der ProthrombinSPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 mRNA benötigt werden, während die beiden letzteren diesen Prozess blockieren. Schließlich entdeckten wir die entscheidende Rolle eines Enzyms namens p38-MAP-Kinase, von dem bereits bekannt war, dass es durch intrazellulären Stress aktiviert wird: Es hängt den USE-Blockierern FBP2 und -3 eine oder mehrere Phosphatgruppen an, die chemisch gesehen sauer reagieren. Das erklärt, warum sich die beiden Proteine dann nicht mehr an das USE der ebenfalls sauren mRNA binden – denn »sau­ er« und »sauer« stoßen sich ab. Damit fügten sich die vielen Puzzleteile zu einem Ge­ samtbild zusammen, das sowohl den ungewöhnlichen Bau­ plan der Prothrombin-mRNA und deren Rolle bei der Throm­ bophilie erklärt als auch ein ganz neues Regulationsprinzip für die Umsetzung genetischer Information in Proteine ent­ wirft (siehe Grafik S. 24): ➤ Die Reifung der Prothrombin-mRNA wird nicht wie üb­ lich recht unflexibel über hocheffiziente Signale in der Se­ quenz (CA) und das »downstream sequence element« (DSE) gesteuert, sondern über die Kombination eines deutlich ab­ geschwächten Signals (CG) ohne DSE mit einem regelbaren Verstärker, dem USE. ➤ Der Verstärker kann dann seine Aufgabe erledigen, wenn sich die Faktoren U2AF35, U2AF65 und PTB an ihn binden. Heften sich jedoch ihre Gegenspieler FBP2 und -3 an ihn, wird er ausgeschaltet. ➤ In gestressten Zellen sorgt die p38-MAP-Kinase dafür, dass sich die beiden FBPs nicht mehr an das USE anlagern. Folge: mehr Prothrombin-mRNA und entsprechend mehr Prothrombin, was die Blutgerinnung erleichtert. DNA ➤ Wirkt dieser Verstärkermechanismus auf Grund einer Mutation zusammen mit einem normal starken RNA-Rei­ fungssignal (CA) statt mit einem abgeschwächten (CG), so entsteht ein Übermaß an Prothrombin. Die Betroffenen nei­ gen dann zu Thrombosen. Diese Erkenntnisse helfen aber nicht nur, die Thrombo­ philie besser zu verstehen, sondern wirken sich auch auf ganz andere Bereiche der Medizin aus. Jeder Klinikarzt weiß, dass das Thromboserisiko bei Patienten mit entzündlichen Erkrankungen oder bei Stresssituationen wie Operationen ansteigt. Und wie eingangs beschrieben, wurde Armand Trousseau durch seine Thrombose im Arm bewusst, dass er womöglich Krebs hatte – obwohl der Tumor selbst noch kei­ ne Symptome verursachte. Interessanterweise lassen sich bei solchen Erkrankungen meist größere Mengen an Pro­ thrombin nachweisen, und die p38-MAP-Kinase ist in der näheren Umgebung von Entzündungen und Tumoren über­ durchschnittlich aktiv. Diese Zusammenhänge erforschten wir anhand von Tiermodellen sowie an Gewebeproben von Patienten. Zunächst nutzten wir die Tatsache, dass man bei Mäusen durch Einspritzen der bakteriellen Substanz LPS (Lipopoly­ saccharid) eine Entzündungsreaktion hervorrufen kann, die vor allem in der Leber die Prothrombinproduktion anregt. Wie wir feststellten, findet sich in solchen Mauslebern tat­ sächlich mehr reife Prothrombin-mRNA, und das Verstärker­ protein PTB neigt dort dazu, sich an das USE zu binden – des­ sen Gegenspieler FBP2 und FBP3 jedoch weniger. Ergänzend untersuchten wir Gewebeproben von Krebs­ patienten, denen Metastasen aus der Leber entfernt worden Transkription Vorläufer-mRNA Intron Intron Intron Prozessierung mRNA 5’-Ende proteinkodierender 3’-Ende Teil SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / ART FOR SCIENCE Translation Protein WWW.SPEK TRUM .DE Intron Die als DNA gespeicherte genetische Information für ein Protein wird zunächst in Vorläufer-mRNA übersetzt (Transkription), die dann in reife mRNA umgewandelt wird. Ein wesentlicher Teil dieser Prozessierung ist das Herausschneiden von Introns und das Zusammenfügen der so entstandenen Enden, aber auch Veränderungen am hinteren Ende der RNA, welche die Stabilität des Moleküls beeinflussen (siehe Grafik S. 24). Erst danach dient das Endprodukt als Bauanleitung für die Proteinsynthese (Trans­ lation). 23 Regulation der Prozessierung am hinteren Ende der Prothrombin-mRNA: Molekularer Schaltmechanismus waren. Es zeigte sich, dass diese Geschwulste im angrenzen­ den gesunden Lebergewebe die Prothrombinproduktion sti­ mulieren. Auch wenn hier streng genommen noch nicht be­ wiesen ist, dass der beschriebene Verstärkermechanismus via p38-MAP-Kinase und USE dafür verantwortlich ist, deutet gegenwärtig alles darauf hin. Damit die Blutgerinnung ordnungsgemäß ablaufen kann, muss das aus Prothrombin entstehende Enzym Thrombin andere Proteine zerschneiden. Wegen dieser Funktion als Ei­ weißschere kann es auch den Kitt zwischen den einzelnen Zellen – die extrazelluläre Matrix – auflösen und damit dem Tumor helfen, sich in gesundes Gewebe hinein auszubreiten. Außerdem ist noch eine zweite Funktion des Gerinnungsfak­ tors bekannt: Er kann an speziellen Schaltermolekülen auf verschiedenen Zellen andocken und dadurch unter anderem das Gefäßwachstum ankurbeln. Bei Krebs verbessert das je­ doch vor allem die Blutversorgung des Tumors. Auf diese Weise können Metastasen den beschriebenen Regulations­ mechanismus zu ihren Zwecken missbrauchen – aber damit auch einen neuen strategischen Angriffspunkt gegen die Tu­ moren liefern. So ließen sich Medikamente, die eigentlich die Blutgerinnung hemmen sollen, möglicherweise gegen Krebs einsetzen. Vermutlich gibt es eine Reihe weiterer mRNAs, die sich ebenfalls dieses bisher unbekannten Regulationsprinzips be­ dienen. Sind erst die entsprechenden Gene und Proteine identifiziert, dürften wir besser verstehen, wie Tumoren, Ent­ zündungen und vielleicht auch noch andere Stresszustände in das Steuerungsnetzwerk hineinspielen und wie sich da­ raus hilfreiche Behandlungsansätze für Patienten entwi­ ckeln lassen. 24 Prothrombin-mRNA Verstärkerproteine CG CA USE FBP 2/3 p38 MAPK P FBP 2/3 bei Reifung der mRNA Schnitt und Anhängen einer Poly-A-Sequenz Stress SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / ART FOR SCIENCE Die Vorläufer-mRNA wird hinter dem CG-Reifungssignal (bei Gesunden) beziehungsweise bei Thrombophiliepatienten hinter dem ­effizienteren CA-Signal abgeschnitten. Daraufhin wird dort ein Poly-A-Schwanz angehängt. Diesen Vorgang reguliert die Zelle über die Kombination des schwachen CG-Signals mit einem regelbaren Verstärker, dem USE (upstream sequence element). Der Verstärker wird dann tätig, wenn sich Verstärkerproteine wie U2AF35, U2AF65 und PTB an ihn binden. Dafür müssen aber erst ihre Gegenspieler FBP2 und -3 entfernt werden. Dies geschieht etwa, wenn die Zelle unter Stress gerät. Dann heftet die p38-MAP-Kinase an die FBPs einen Phosphatrest an, worauf diese sich vom USE lösen. Das führt zu mehr Prothrombin-mRNA und entsprechend mehr Prothrombin, was die Blutgerinnung erleichtert. Liegt auf Grund einer Mutation ein starkes RNA-Reifungssignal (CA) vor statt eines abgeschwächten (CG), entsteht Prothrombin im Übermaß. Die Betroffenen neigen dann zu Thrombosen. Bei dieser wissenschaftlichen Reise, die vor mehr als 150 Jahren in Paris begann, brachte uns die Veränderung eines einzelnen Bausteins des Prothrombin-Gens auf eine ent­ scheidende Spur. Sie hat zu ungeahnten Entdeckungen ge­ führt und ist nun auf bestem Weg, sogar wichtige Grundla­ gen des Tumorwachstums aufzuklären. Ÿ DI E AUTOREN Matthias W. Hentze (links) ist Direktor des Europäischen Laboratoriums für Molekular­ biologie (EMBL) und Pro­fessor für Molekulare Medizin an der Universität Heidelberg. Andreas E. Kulozik ist Professor für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin III am Universitätsklinikum Heidelberg. Die beiden Forscher gründeten 2002 die Molecular Medicine Partnership Unit (MMPU) der Universität Heidelberg und des EMBL, der sie gemeinsam vorstehen. QUELLEN Danckwardt, S. et al.: p38 MAPK Controls Prothrombin Expression by Regulated RNA 3’ End Processing. In: Molecular Cell 41, S. 298 – 310, 2011 Danckwardt, S., Hentze, M. W., Kulozik, A. E.: 3’ End mRNA Processing: Molecular Mechanisms and Implications for Health and Disease. In: EMBO Journal 27, S. 482 – 498, 2008 Gehring, N. H. et al.: Increased Efficiency of mRNA 3’ End Formation: A New Genetic Mechanism Contributing to Hereditary Thrombophilia. In: Nature Genetics 28, S. 389 – 392, 2001 Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1152344 SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 IM FOKUS: TÜRÖFFNER FÜR KREBSZELLEN Die überwiegende Mehrheit der Krebskranken stirbt nicht am Primärtumor, sondern an den Folgen von Tochter­ geschwülsten (Metastasen). Diese entstehen, wenn in der Blutbahn kursierende entartete Zellen in andere Organe eindringen. Schweizer Forscher konnten nachweisen, dass ihnen dabei ein Pförtner auf der Innenwand (dem Endothel) der Blutgefäße hilft. Dieser Rezeptor wird von einem tumoreigenen Botenstoff aktiviert und schleust, wie auf dieser nachträglich eingefärbten elek­ tronenmikroskopischen Aufnahme zu sehen ist, eine Krebszelle (blaugrün) zwischen den Endothelzellen einer Blutkapillare (rostrot) hindurch, indem er deren Zusam­ menhalt lockert. Seine Aufgabe im gesunden Körper ist noch unbekannt, wahrscheinlich beeinflusst er bei ­Immunreaktionen die Durchlässigkeit der Blutgefäße. Cancer Cell 22, S. 91 – 105, 2012 UNIVERSITÄT ZÜRICH; MARKUS KNUST UND MARCO PRINZ, UNIVERSITÄT FREIBURG TUMORMARKER Verräterische Satelliten-RNA Bestimmte RNA-Moleküle kommen in Tumorzellen weit häufiger vor als in gesundem Gewebe. Möglicherweise stellen sie einen zuverlässigen Hinweis auf die Erkrankung dar. VON GABI WARNKE K rebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland, jährlich sterben rund 200 000 Bundesbürger daran. Mit einem eindeutigen Marker, der die Erkrankung schon im Früh­stadium offenbart, ließe sich diese Zahl dramatisch senken. Doch bisher erschwert die verwirrende Vielfalt der Erscheinungsbilder eine sichere Diagnose. Denn Krebs ist nur ein Sammelbegriff für etwa 100 verschiedene Arten bösartiger Wucherungen im Körpergewebe. Ein wesentlicher Aspekt solcher Tumoren sind Veränderungen im Erbmaterial, etwa Schäden an der DNA oder eine ge- störte Regulation der Aktivität von Genen. Solche Hinweise nutzen Mediziner oft schon jetzt als »Marker«, um Krebs zu diagnostizieren. Als die Mitglieder des Humangenomprojekts 2003 die vollständige Sequenz des menschlichen Erbguts präsentierten, stellte sich heraus: Lediglich zwei bis drei Prozent der DNA sind Gene, die Proteine kodieren. Einige weitere Abschnitte regulieren die Aktivität von Genen – sie steuern also, wann, wo und wie oft diese in RNA übersetzt werden. Trotzdem schienen immer noch mindestens 60 Prozent der Erbsubstanz nutzlose »Schrott-DNA« zu sein. Doch vor einigen Jahren entdeckten Wissen­ schaftler die »pervasive transcription«, die allgegenwärtige Transkription. Demnach werden nicht nur die Gene, sondern fast alle Teile des menschlichen Genoms in RNA übersetzt, auch die vermeintlich nutzlosen Areale. Anscheinend erzeugt eine Zelle im Lauf ihres Lebens von praktisch jedem Abschnitt der DNA mindestens ein paar RNA-Kopien. Oft liest sie ihr Erbgut sogar in beide Richtungen ab. Die Funktion dieser zahllosen RNA-Schnipsel ist bislang jedoch noch unbekannt. IMPRESSUM Artikelnachweise: Wurzel des Übels SdW 2/2013 · Krebsstammzellen im Visier SdW 3/2013 · Unheil durch nicht mehr teilungsfähige Zellen SdW 4/2013 · Krebs, Blutgerinnung und Stress – eine pikante Menage-a-trois SdW 7/2012 · Türöffner für Krebszellen SdW 10/2012 · Marker für Krebs SdW 5/2011 · Streit um die Prostatakrebs-Früherkennung SdW 10/2012 · Das Unheil kommen sehen; Der Blick für das Wesentliche; Krebszellen im Kräftespiel; Berechnung des Tumors SdW 8/2013 · Und nun zur aktuellen Krebsvorhersage; Nano-Arzneitransporter SdW 9/2013 · Freie Fahrt durch das Immunsystem SdW 8/2014 · Den Schutzpanzer der Krebsstammzellen durchbrechen SdW 9/2012 · Auftragskiller der Körperabwehr; Zelluläre Mobilmachung; Bakterien gegen Tumoren SdW 7/2014 · Eine Kettenreaktion, die den Tumor zerstört SdW 8/2014 · Liveschaltung zum Tumor; Am Ort des Geschehens SdW 9/2014 · Impfen gegen Krebs SdW 3/2012 Chefredakteur: Prof. Dr. phil. Dipl.-Phys. Carsten Könneker M. A. (v.i.S.d.P.) Redaktionsleiter: Dr. Gerhard Trageser (Sonderhefte), Dr. Hartwig Hanser (Monatshefte) Redaktion: Mike Beckers, Thilo Körkel, Dr. Klaus-Dieter Linsmeier, Dr. Christoph Pöppe, Dr. Frank Schubert, Dr. Adelheid Stahnke; E-Mail: [email protected] Ständiger Mitarbeiter: Dr. Michael Springer Art Direction: Karsten Kramarczik Layout dieses Hefts: Sibylle Franz Übersetzer für dieses Heft: Dr. Markus Fischer, Ilse Tutter Schlussredaktion: Christina Meyberg (Ltg.), Sigrid Spies, Katharina Werle Bildredaktion: Alice Krüßmann (Ltg.), Anke Lingg, Gabriela Rabe Redaktionsassistenz: Barbara Kuhn Redaktionsanschrift: Postfach 10 48 40, 69038 Heidelberg, Tel. 06221 9126-711, Fax 06221 9126-729 Verlag: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 48 40, 69038 Heidelberg; Hausanschrift: Slevogtstraße 3–5, 69126 Heidelberg, Tel. 06221 9126-600, Fax 06221 9126-751; Amtsgericht Mannheim, HRB 338114 26 Geschäftsleitung: Markus Bossle, Thomas Bleck Herstellung: Natalie Schäfer Marketing: Annette Baumbusch (Ltg.), Tel. 06221 9126-741, E-Mail: [email protected] Einzelverkauf: Anke Walter (Ltg.), Tel. 06221 9126-744 Leser- und Bestellservice: Helga Emmerich, Sabine Häusser, Ute Park, Tel. 06221 9126-743, E-Mail: [email protected] Vertrieb und Abonnementverwaltung: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, c/o ZENIT Pressevertrieb GmbH, Postfach 81 06 80, 70523 Stuttgart, Tel. 0711 7252-192, Fax 0711 7252-366, E-Mail: [email protected], Vertretungsberechtigter: Uwe Bronn Die Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH ist Kooperationspartner der Nationales Institut für Wissenschaftskommunikation gGmbH (NaWik). NaWik ist ein Institut der Klaus Tschira Stiftung gGmbH und des Karlsruher Instituts für Technologie. Wissenschaftlicher Direktor des NaWik ist Spektrum-Chefredakteur Prof. Dr. Carsten Könneker. Bezugspreise: Einzelheft »Spezial«: € 8,90 / sFr. 17,40 / Österreich € 9,70 / Luxemburg € 10,– zzgl. Versandkosten. Im Abonnement € 29,60 für 4 Hefte, für Studenten gegen ­Studiennachweis € 25,60. Bei Versand ins Ausland werden die Mehrkosten berechnet. Alle Preise verstehen sich inkl. Umsatzsteuer. Zahlung sofort nach Rechnungserhalt. Postbank Stuttgart, IBAN DE52600100700022706708, BIC PBNKDEFF Anzeigen: iq media marketing gmbh, Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH; Bereichsleitung Anzeigen: Patrick Priesmann, Tel. 0211 887-2315, Fax 0211 887-97-2315; verantwortlich für Anzeigen: Annette Freistühler, Postfach 102663, 40017 Düsseldorf, Tel. 0211 887-1322 Druckunterlagen an: iq media marketing gmbh, Vermerk: Spektrum der Wissenschaft, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, Tel. 0211 887-2387, Fax 0211 887-2686 Anzeigenpreise: Gültig ist die Preisliste Nr. 36 vom 1. 1. 2015 Gesamtherstellung: L. N. Schaffrath Druckmedien GmbH & Co. KG, Marktweg 42–50, 47608 Geldern Sämtliche Nutzungsrechte an dem vorliegenden Werk liegen bei der Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH. Jegliche Nutzung des Werks, insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe oder öffentliche Zugänglichmachung, ist ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des Verlags unzulässig. Jegliche unautorisierte Nutzung des Werks berechtigt den Verlag zum Schadensersatz gegen den oder die jeweiligen Nutzer. Bei jeder autorisierten (oder gesetzlich gestatteten) Nutzung des Werks ist die folgende Quellenangabe an branchenüblicher Stelle vorzunehmen: © 2015 (Autor), Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg. Jegliche Nutzung ohne die Quellenangabe in der vorstehenden Form berechtigt die Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH zum Schadensersatz gegen den oder die jeweiligen Nutzer. Bildnachweise: Wir haben uns bemüht, sämtliche Rechteinhaber von Ab­bildungen zu ermitteln. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsin­haberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Bücher übernimmt die Redaktion keine Haftung; sie behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. ISSN 2193-4452 / ISBN 978-3-95892-002-6 SCIENTIFIC AMERICAN 75 Varick Street, New York, NY 10013-1917 Editor in Chief: Mariette DiChristina, President: Steven Inchcoombe, Executive Vice President: Michael Florek, Vice President and Associate Publisher, Marketing and Business Development: Michael Voss SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 JÖRG HOHEISEL UND ANDREA BAUER, DKFZ HEIDELBERG TING, D.T. ET AL.: ABERRANT OVEREXPRESSION OF SATELLITE REPEATS IN PANCREATIC AND OTHER EPITHELIAL CANCERS. IN: SCIENCE 331, S. 593–596, 2011, FIG. 3C; ABDRUCK GENEHMIGT VON AAAS / CCC Einige Forscher stellten nun einen Zusammenhang mit der Entwicklung von Krebs her, darunter David T. Ting vom Massachusetts General Cancer Center und Doron Lipson von der Helicos BioSciences Corporation in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts). Ting und Lipson untersuchten die Transkription von so genannter SatellitenDNA. Dies sind ebenfalls nicht kodierende Erbgutsequenzen, die aus 100- bis 1000-fachen Wiederholungen einer kurzen Abfolge der Bausteine des Erbguts bestehen. Obwohl sie durchschnittlich zehn Prozent eines Säugetiergenoms ausmachen, betrachteten Forscher auch die Satelliten ursprünglich als inaktive Schrott-DNA. Erst nachdem die allgegenwärtige Transkription bekannt wurde, stellte sich heraus, dass auch verschiedene Satelliten zumindest gelegentlich abgelesen werden. Die beiden Wissenschaftler analysier­ ten die gesamte RNA bösartiger Tumorzellen und entdeckten dabei eine ex­ Ein menschlicher Bauchspeicheldrüsentumor produziert viel mehr HSATII-RNA (rot) als gesunde Zellen (links im Bild). WWW.SPEK TRUM .DE Die Mikroskopaufnahmen zeigen den Unterschied zwischen klar geordnetem, gesundem Gewebe (links) und einem Tumor der Bauchspeicheldrüse (rechts). trem verstärkte Transkription jener Wiederholungssequenzen. Der Vergleich von Tumoren menschlicher Bauchspeicheldrüsen mit gesundem Gewebe zeigte: Erstere enthielten im Mittel 21-mal so viel Satelliten-RNA. Das markanteste Beispiel war der Satellit HSATII – seine Transkription war in den Krebszellen 131-mal stärker als normal. Auch in aggressiven Tumoren aus Lunge, Niere, Gebärmutter und Prostata war die Konzentration der HSATII-RNA deutlich erhöht. Weil dieser Satellit in gesundem Gewebe kaum transkribiert wird, betrachten ihn die Forscher nun als potenziellen Krebsbiomarker. Ihre Vermutung fanden sie bestätigt, als sie den umgekehrten Versuch durchführten: Alle Zellen der Bauchspeicheldrüse, in denen die Forscher HSATII-RNA fanden, waren Krebszellen. Die Methode funktionierte selbst bei Tumoren, die mit einer üblichen Form der Biopsie nicht nachgewiesen worden waren. Daraufhin wollten es die Wissenschaftler noch genauer wissen: Beeinflusst die Aktivierung der Satelliten möglicherweise weitere Gene? In bösartigen Tumoren suchten sie darum nach DNA-Sequenzen, deren Transkriptionsraten mit denjenigen der Satelliten korrelieren. Hierbei fanden sie vor allem so genannte Retrotransposonen. Diese »springenden Gene« können ihre Position in der DNA ändern, wofür die Zelle sie in eine RNA-Zwischenform transkribiert. Und tatsächlich: Die Forscher entdeckten in bösartigen Tumoren RNA- Abschriften des Retrotransposons LINE1 (langes verstreutes Kernelement 1, Long Interspersed Nuclear Element 1), und zwar vergleichbar häufig wie die Satelliten. Übersetzte eine Zelle mehr Satelliten-DNA in RNA, stieg also auch die Konzentration der LINE-1-RNA im selben Maß. Darüber hinaus wiesen Ting und Lipson nach, dass Krebszellen Gene häufiger ablesen, die sich auf der DNA direkt neben einer LINE-1-Sequenz befinden – und zwar umso mehr, je näher sie am Retrotransposon liegen. Ergeben all diese Befunde ein einheitliches Bild? Dass die Ableseraten von Satelliten- und RetrotransposonenDNA in Krebszellen gleichzeitig steigen, spricht für eine gemeinsame Regula­ tion. Dafür könnten so genannte epigenetische Mechanismen verantwortlich sein, welche die Aktivität größerer Bereiche des Erbguts zugleich beeinflussen. So werden Teile der DNA stillgelegt, indem diese fest an Proteine binden. Auch Satelliten-DNA liegt meist auf dieselbe Weise verpackt vor, weshalb sie in gesundem Gewebe kaum abgelesen wird. Die Daten von Ting und Lipson sprechen dafür, dass epigenetische Effekte in Tumorzellen größere Bereiche der DNA frei legen. Zahlreiche vorher inaktive Abschnitte werden dadurch ausgewickelt und können dann transkribiert werden; möglicherweise enthalten sie sowohl Satelliten als auch LINE-1. Gabi Warnke ist Diplombiologin und freie Wissenschaftsjournalistin in Heidelberg. 27 VORSORGEUNTERSUCHUNG Streit um die ProstatakrebsFrüherkennung Schaden PSA-Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs mehr, als sie nutzen? Eine wachsende Zahl von Studien lässt die ak­tuellen Vorsorgemaßnahmen fragwürdig erscheinen. Von Marc B. Garnick E nde 2011 ließ die amerikanische Preventive Services Task Force eine Bombe platzen. Das Expertengremium, das die US-Regierung in Gesundheitsfragen berät, empfahl gesunden Männern, nicht mehr an PSATests zur Früherkennung von Prostatakrebs teilzunehmen. Denn diese Messungen des Blutspiegels an prostataspezifischem Antigen (PSA) hätten als Instrument zur Krebsvorsorge nur wenig oder gar keinen Nutzen. Statt Leben zu retten, führten sie nur dazu, dass hunderttausende Männer unnötig operiert oder bestrahlt würden – mit Nebenwirkungen wie Impotenz, Inkontinenz und Rektalblutungen. Die amerikanischen Experten schätzten, dass seit 1985 mehr als eine Million Männer auf Grund eines positiven PSA-Tests an der Prostata behandelt worden waren. Mindestens 5000 von ihnen starben kurz nach dem Eingriff, weitere 300 000 wurden impotent, inkontinent oder beides. Kurz nachdem die Task Force diese alarmierenden Zahlen veröffentlicht hatte, hagelte es empörte Kommentare von medi­ zinischen Fachgesellschaften. Auch die American Urological Association, ein amerikanischer Berufsverband von derzeit mehr als 18 000 Urologen, äußerte Kritik. Die Kontroverse ist nicht neu – schon seit Langem debattieren Experten über den Nutzen des PSA-Tests. Trotzdem tendiert die öffentliche Meinung in den USA immer noch dahin, seinen massenhaften Einsatz zu befürworten. Als internistischer Onkologe, der sich auf Prostatakrebs spezialisiert hat, stimme ich der Einschätzung der Task Force jedoch in den wesentlichen Punkten zu. Vielen medizinischen Laien ist nicht klar, wie schwach die Belege sind, die für den PSATest als Instrument zur Krebsfrüherkennung sprechen. Er liefert zwar nützliche Informationen – aber erst, nachdem ein Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Zudem wissen nur wenige, dass bei der medizinischen Behandlung des Prosta28 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von Prostatakrebs­ zellen. Das Bild ist eingefärbt, um die ­Kontraste zu verstärken. SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 WWW.SPEK TRUM .DE 29 AG. FOCUS / SCIENCE SOURCE / PARVIZ M. POUR takarzinoms häufig Komplikationen auftreten, trotz ausgefeilter Therapieformen, die zumindest unter Befürwortern als besonders fortschrittlich gelten. Eine weitere Kontroverse betrifft die Frage, ob und wann diejenigen Patienten behandelt werden sollen, die unzweifelhaft an Prostatakrebs erkrankt sind. Auch hier sprechen die vorliegenden Daten für einen deutlichen Kurswechsel – weg von aggressiven Soforteingriffen und hin zu einem vorsichtigeren, individuell angepassten Vorgehen. Die Ursache für diesen Sinneswandel liegt in der Erkenntnis, dass eine Prostatakrebserkrankung von Patient zu Patient sehr unterschiedlich verlaufen kann. Die möglichst frühzeitige Therapie ist deshalb nicht das Patentrezept, für das viele Ärzte, ich einbegriffen, sie lange Zeit gehalten haben. Sowohl die PSA-Messung als auch die heutigen Therapien gegen Prostatakrebs sind mit grundlegenden Problemen behaftet. Eine Reihenuntersuchung zum frühzeitigen Erkennen von Krankheiten – ein so genanntes Screening – liefert im Idealfall nur bei den Patienten ein positives Ergebnis, die unbehandelt tatsächlich die Symptome der Erkrankung ausbilden würden. Dementsprechend sollte ein perfektes Prostatakrebs-Screening ausschließlich Tumoren identifizieren, die ohne medizinischen Eingriff zu gesundheitlichen Pro­ blemen führten. Die betroffenen Männer könnten anschließend therapiert werden, wobei der Eingriff im besten Fall sowohl hocheffektiv wäre als auch keine ernsthaften Nebenwirkungen hätte. Wenn beides vorläge – ideales Screening und ideale Therapie –, dann wäre es in der Tat angezeigt, so viele Männer wie möglich zu testen und alle zu behandeln, bei denen der Test positiv ausfällt. Doch davon sind wir weit entfernt. Ein positiver PSA-Test bedeutet nicht, dass der Patient ein Prostatakarzinom hat, sondern nur, dass er eins haben könnte. Das prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein Protein, das von der Prostata produziert und der Samenflüssigkeit beigemischt wird. Nor­ malerweise fällt seine Konzentration im Blut verschwindend gering aus. Sie kann aber aus verschiedenen Gründen ansteiAUF EINEN BLICK GEFÄHRLICHE VORSORGE? 1 Der PSA-Test lässt sich als Reihenuntersuchung an gesunden Männern einsetzen, um möglichst frühzeitig Prostatakrebs zu erkennen. Groß angelegte Studien lassen jedoch Zweifel daran aufkommen, ob hierdurch das Risiko, an Prostatakrebs zu sterben, wirklich sinkt. 2 Bei hunderttausenden Männern hat ein positives Testergebnis zu unnötigen Behandlungen mit schweren Nebenwirkungen geführt. Ärzte und Gesundheitsexperten streiten deshalb darüber, ob das PSA-Screening als Instrument der Krebsfrüherkennung sinnvoll ist. 3 Ein guter Kompromiss könnte darin bestehen, am Screening festzuhalten, die Therapie eines dabei entdeckten Prostata­ karzinoms jedoch so lange aufzuschieben, bis der Krebs sich als tatsächlich gefährlich erweist. 30 gen, etwa bei einer altersbedingten gutartigen Vergrößerung der Prostata, im Zuge einer Infektion, nach sexueller Aktivität – oder eben auf Grund des Wachstums eines bösartigen Prostatatumors. Wenn der PSA-Test wiederholt ein positives Ergebnis liefert, entnimmt der Arzt Gewebe aus der Prostata, um es zu untersuchen. Diese so genannte Biopsie ist unangenehm und bringt gewisse Risiken mit sich, stellt aber noch nicht das eigentliche Problem dar. Denn sie erlaubt es immerhin festzustellen, ob sich in der Prostata des Patienten ein bösartiger Tumor gebildet hat oder nicht. Das wirkliche Dilemma besteht darin, dass die Mediziner nicht erkennen können, ob ein so gefundener Tumor gefährlich ist oder ob er dem Betroffenen zeitlebens nie Probleme bereiten wird. Im fortgeschrittenen Alter erkrankt die Prostata fast immer Studien zufolge haben mehr als die Hälfte der amerikanischen Männer, die zwischen 50 und 60 Jahre alt sind, Prostatakrebs. Bei den Männern über 80 sind es sogar mehr als drei Viertel. Die Mehrzahl von ihnen stirbt jedoch nicht an dem Tumorleiden, sondern an anderen Erkrankungen. Bei wem ist eine Behandlung unbedingt geboten und bei wem völlig unnötig? Die Ärzte wissen es in der Regel nicht. Diese Unklarheit wäre hinnehmbar, wenn die Therapie keine Risiken mit sich brächte. Denn dann könnte man viele behandeln, um das Leben weniger zu retten. Leider sieht die Realität jedoch anders aus. Denn in unmittelbarer Nähe der Prostata liegen Enddarm, Harnblase und Penis. Das macht es schwierig, hier zu operieren oder zu bestrahlen, ohne die benachbarten Organe zu beschädigen. Eine chirurgische Entfernung der Prostata führt oft zu Inkontinenz, da der Arzt den Blasenausgang von der Harnröhre trennen muss. Zwar verbindet er die beiden Strukturen später wieder, doch kommt es während solcher Eingriffe immer wieder zu Schäden am Schließmuskel, der die Blasenent­ leerung kontrolliert. Zudem können die Nerven und Blutgefäße, die für die Erektionsfunktion verantwortlich sind, versehentlich durchtrennt werden, was den Patienten impotent macht. Angeblich treten solche Komplikationen bei roboter­ assistierten Operationen seltener auf, doch fehlen bislang große, unabhängige Studien, die das klar belegen. Auch eine Bestrahlung der Prostata kann Impotenz zur Folge haben. Zusätzlich lauert hier die Gefahr, dass Enddarm und Harnblase Schaden nehmen, da sie von der kaum vermeidbaren Streustrahlung getroffen werden. Blutungen aus dem Enddarm und ungewollter Stuhlabgang sind häufige Nebenwirkungen der Strahlentherapie, die generell zu selten dokumentiert werden. Sie treten auch nach dem Einbringen kleiner radioisotopenhaltiger Nadeln oder Körner, so genannter Seeds, in die Prostata auf, sowie nach chirurgischen Eingriffen. Schließlich stehen zur Behandlung des Prostata­ karzinoms noch diverse medikamentöse Verfahren zur Auswahl – Hormon-, Immun- und Chemotherapien –, die ebenfalls Nebenwirkungen haben. Dazu zählen der Verlust des SeSPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Ernüchternde Daten In den 1990er Jahren führte der verbreitete Einsatz des PSAScreenings zu einem dramatischen Anstieg der Tumordiagnosen in den USA (blau). Bald darauf ging die Zahl der Todesfälle durch Prostatakrebs zurück (rot). Doch das zeitliche Zusammentreffen dieser beiden Trends beweist noch keinen ursächlichen Zusammenhang. Tatsächlich zeigten zwei große, prospektive Studien aus dem Jahr 2009, dass das PSAScreening die Gefahr, an Prostatakrebs zu sterben, wenig oder überhaupt nicht senkt. Der Rückgang der Todesfälle könnte auf Veränderungen der Lebensgewohnheiten beruhen oder auf dem zunehmenden Einsatz von cholesterinsenkenden Arzneistoffen, so genannten Statinen. Deren entzündungshemmende Wirkung könnte vor Prostatakrebs schützen. JEN CHRISTIANSEN, NACH: SEER CANCER STATISTICS REVIEW 1975–2008, NATIONAL CANCER INSTITUTE Veränderungen in der Zahl der Protatakrebsdiagnosen und -todes­fälle in den USA (Anzahl Betroffener pro 100 000 Männer) 200 Tastuntersuchung, also dem Befühlen der Prostata durch den Arzt. Lieferten die Tests ein auffälliges Ergebnis, wurden Biopsien vorgenommen, und falls darin Krebszellen erkennbar waren, empfahl der Arzt in der Regel eine Therapie. Die zweite Gruppe bekam kein regelmäßiges Screening angeboten, erhielt jedoch die übliche medizinische Versorgung, falls notwendig. Wenn ein Mann aus dieser Gruppe etwa Probleme beim Wasserlassen hatte – ein möglicher Hinweis auf Prostatakrebs –, wurde er entsprechend inspiziert und behandelt. Am Ende des Untersuchungszeitraums analysierten die Forscher beide Gruppen im Hinblick auf folgende Aspekte: Lebten die Männer, die an regelmäßigen Vorsorgetests teilgenommen hatten, länger als jene der Vergleichsgruppe? Und starben sie seltener an Prostatakrebs als diese? Die erste Frage beantworteten beide Studien mit einem klaren Nein. Bezüglich der zweiten Frage fiel die Antwort mehrdeutig aus. Die europäische Erhebung ergab bei den Männern, die am Screening teilnahmen, ein um 20 Prozent geringeres Risiko, an Prostatakrebs zu sterben. Die US-Untersuchung hingegen zeigte auch in dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Viele unnötige Eingriffe 150 100 Diagnosen 50 Todesfälle 0 1975 1985 1995 2005 xualtriebs, Impotenz, Gewichtszunahme, Knochenschwund, Hitzewallungen sowie Störungen der Herz- und Leberfunk­ tion. Deshalb sollte der Arzt deshalb immer sämtliche Risiken sorgfältig gegen den möglichen Nutzen abwägen. Seit einiger Zeit mehren sich die Erkenntnisse, die gegen den Einsatz des PSA-Tests in der Krebsfrüherkennung sprechen. Bereits 2008 empfahl die Preventive Services Task Force, dass Männer über 75, die keine Prostatabeschwerden haben, nicht damit untersucht werden sollten. Denn die vorliegenden Daten hatten ergeben, dass Prostatakrebspatienten dieser Altersgruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an ihrem Tumorleiden sterben, sondern aus anderen Gründen. Nur ein Jahr später zeigten die Ergebnisse zweier sehr großer Erhebungen – der europäischen »ERSPC«- und der amerikanischen »PLCO«-Studie –, dass dies auch für jüngere Männer gelten könnte. In beiden Studien teilten die Forscher gesunde Männer zwischen 50 und 74 Jahren per Zufall in zwei Gruppen ein (insgesamt lag die Teilnehmerzahl bei rund 250 000). Die erste Gruppe nahm regelmäßig an Früherkennungstests teil, entweder mittels PSA-Messung oder mittels WWW.SPEK TRUM .DE In der europäischen Studie ermittelten die Forscher zudem, wie viele Patienten getestet und behandelt werden müssen, um einen Todesfall durch Prostatakrebs zu verhindern. Dieses Verhältnis zu kennen, ist sehr wichtig, um den Nutzen eines Screenings zu bewerten. Laut den Berechnungen ist es erforderlich, 1400 Männer zu untersuchen und 48 davon zu behandeln, um einem Todesfall vorzubeugen. Das bedeutet, dass 47 Patienten eine Therapie mit zweifelhaftem Nutzen erhalten, die bei vielen erhebliche Nebenwirkungen zeitigt. Zusätzlich fragwürdig erscheint das Screening, bedenkt man, dass sich die Gesamtsterblichkeit zwischen den regelmäßig untersuchten Männern und der Vergleichsgruppe nicht unterschied. Allerdings müssen wir Vorsicht walten lassen, wenn wir diese Studien interpretieren. Denn die Daten zeigen zwar recht eindeutig, dass die meisten gesunden Männer ohne Prostatabeschwerden keine regelmäßigen Früherkennungs­ untersuchungen benötigen. Doch bei Patienten mit einem Familienangehörigen, der vor dem 70. Lebensjahr an Prostata­ krebs gestorben ist, erscheint die regelmäßige Messung des PSA-Werts gerechtfertigt. Sie besitzen möglicherweise eine ererbte Veranlagung, die das Erkrankungsrisiko erhöht. In ­einigen Jahren wird es vielleicht möglich sein, besonders gefährdete Männer mit genetischen Tests zu identifizieren, um sie in einem speziellen Vorsorgeprogramm zu betreuen. Einer meiner Patienten, Herr H., nahm schon vor 19 Jahren den heutigen Standpunkt der Preventive Services Task Force ein. 1996 war bei ihm im Alter von 54 Jahren ein PSATest positiv ausgefallen und anschließend Prostatakrebs diagnostiziert worden. Er konsultierte viele Spezialisten, darunter auch mich, und alle rieten ihm zur Therapie. Trotzdem lehnte er jegliche Behandlung ab, denn nach dem Studium der verfügbaren Fachliteratur war er zu dem Schluss gekom31 men, es sei unwahrscheinlich, dass er in absehbarer Zukunft an dem Krebs sterben würde. Zudem ging er davon aus, dass nach einigen Jahren des Wartens neue, wirksamere Therapien zur Verfügung stehen würden. Er gewöhnte sich lediglich eine gesündere Lebensweise an und nahm ab. Jahr für Jahr, nachdem er diese mutige Entscheidung getroffen hatte, gab ich meinem Patienten erneut den Rat, sich behandeln zu lassen. Und jedes Mal lehnte er ab. Heute geht es dem inzwischen 73-Jährigen immer noch sehr gut. Weder wurde er operiert noch bestrahlt noch mit Medikamenten behandelt, trotzdem hat sein Tumor nicht gestreut. Sein PSA-Wert ist in dieser Zeit von 7 auf 18 Einheiten gestiegen – eine ausgesprochen gemächliche Zunahme, die darauf schließen lässt, dass der Krebs sehr langsam wächst. Der Verzicht auf eine Therapie war offenkundig richtig. Indem Herr H. sich ausführlich informierte und unsere Ratschläge kritisch hinterfragte, konnte er eine gut begründete Entscheidung treffen. So vermied er es, den ungewissen Nutzen einer frühzeitigen Behandlung mit ihren fast sicheren Folgeschäden zu erkaufen. Tatsächlich beruhten die ärztlichen Therapieempfehlungen zu der Zeit, als Herr H. erstmals in meiner Sprechstunde erschien, nicht etwa auf hochwertigen klinischen Studien, sondern auf falschen Vorstellungen vom Verlauf einer Prostatakrebserkrankung. Wir wussten, dass manche Tumoren nur langsam wachsen, andere hingegen sich sehr aggressiv entwickeln. Doch es galt als ausgemacht, dass die weitaus meisten irgendwann metastasieren und somit unheilbar würden. Einen Krebs im Frühstadium zu entdecken und sofort zu bekämpfen, erschien damals als praktisch gleichbedeutend damit, ein Leben gerettet zu haben. Diese Logik liegt auch dem heutigen Prostatakrebs-Screening zu Grunde. Tumorwachstum im Schneckentempo Doch die Sterblichkeitsstatistiken der letzten 25 Jahre zeigen, dass die Angelegenheit komplizierter ist. Seit den 1990er Jahren geht die Zahl der Männer, die an Prostatakrebs sterben, zurück. Die Befürworter von Früherkennungsprogrammen führen dies auf den massenhaften Einsatz des PSA-Tests zurück – doch wie wir an den beiden prospektiven Studien aus Europa und den USA gesehen haben, steht diese Annahme auf wackligen Füßen. Zudem hätte die Prostatakrebssterblichkeit viel schneller und deutlicher sinken müssen, wenn sie wirklich auf Grund des PSA-Screenings abgenommen hätte. Tatsächlich scheinen unsere früheren Überzeugungen nicht korrekt gewesen zu sein. Wie wir inzwischen wissen, wachsen viele Prostatakarzinome extrem langsam, oft sogar praktisch gar nicht. Forscher entdecken immer mehr Beispiele für Tumoren, die zunächst als bösartig eingestuft werden und doch so gemächlich wachsen, dass sie sich weder im Körper ausbreiten noch schwer wiegende klinische Symptome verursachen. Deshalb erwägen Mediziner bereits, ihnen eine besondere Bezeichnung zu geben – etwa »indolenter Tumor«, was soviel wie »träge Geschwulst« bedeutet. Dies soll unterstrei- Situation in Deutschland In der Bundesrepublik bieten die gesetzlichen Krankenkassen allen Männern ab 45 einmal jährlich eine Tastuntersuchung an, um Prostatakrebs möglichst früh zu erkennen. Dabei untersucht der Arzt die Genitalien und befühlt die Prostata, indem er einen Finger in den Enddarm einführt. Der PSA-Test ist nicht im gesetzlichen Früherkennungsprogramm enthalten – die Kosten dafür muss der Betroffene selbst tragen. Zur Bewertung des PSA-Screenings gibt es unterschiedliche Stimmen. Die Deutsche Krebshilfe kommt zur Einschätzung, dass bei ihm »das Verhältnis von Nutzen und Schaden bislang nicht ausreichend bekannt« ist. Männer über 40 sollten sich umfassend über die Prostatakrebsfrüherkennung informieren und nach Beratung mit ihrem Arzt entscheiden, ob sie den Test nutzen wollen. Auch die aktuelle ärztliche Leitlinie zum Thema Prostatakarzinom äußert sich bezüglich des PSA-Screenings ­zurückhaltend: »Ein Einfluss auf die Gesamtüberlebenszeit ist nicht nachgewiesen.« 32 Die Deutsche Gesellschaft für Urologie empfiehlt allen Männern ab 40 die Bestimmung des PSA-Werts und eine Tastuntersuchung mit dem Finger. Sei in der Familie des Mannes bereits eine Prostatakrebserkrankung aufgetreten, dann sei eine jährliche Untersuchung ab dem 40. Lebensjahr mit Bestimmung des PSA-Werts dringend angeraten. Der Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums urteilt, dass der PSA-Test nach wie vor umstritten ist: Es stehe noch nicht fest, ob Männer länger und vor allem besser leben, wenn sie diese Untersuchung regelmäßig durchführen. Sei ein Mann bereits an einem Prostatakarzinom erkrankt, helfe der Test dagegen, die Behandlung zu planen und ihren Erfolg zu kontrollieren. Zusammen mit der Krankenversicherung AOK und der Universität Bremen hat der KID einen Onlinetest erstellt, der Männern die Entscheidung für oder gegen einen PSA-Test erleichtern soll: www.psa-entscheidungshilfe.de SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 chen, dass die betroffenen Patienten für einen sehr langen Zeitraum unbehandelt bleiben können oder vielleicht sogar überhaupt keine Therapie benötigen. Zum Zeitpunkt der ersten Diagnose wissen wir zwar noch nicht, ob es sich um einen indolenten Tumor handelt, doch können wir seine weitere Entwicklung anhand seiner Eigenschaften recht gut abschätzen und in regelmäßigen Untersuchungen verfolgen. Zugegeben: Eingeübte Gewohnheiten zu ändern, ist in der Medizin genauso schwer wie in anderen Lebensbereichen. ­ icherlich wird es viele Ärzte und Patienten geben, die sich S nicht damit wohlfühlen, auf das PSA-Screening zu verzichten, nachdem jahrelang das Gegenteil empfohlen wurde. Einige Patienten sind überdies fest davon überzeugt, dass die Vorsorgeuntersuchung ihr Leben gerettet hat. Wir sollten ihre medizinische Betreuung jedoch umgestalten, um sie vor unnötigen Behandlungen zu bewahren. Dazu müssen wir bei einem diagnostizierten Prostatakarzinom die Therapieentscheidung nur so lange aufschieben, bis wir einiger- Mögliche Komplikationen Zur Behandlung des Prostatakarzinoms zerstören die Ärzte das Tumorgewebe mittels Bestrahlung, oder sie entfernen die Prostata bei einem chirurgischen Eingriff. Auch Immun-, Chemo- oder Hormontherapien werden eingesetzt. Wegen der anatomischen Lage des Organs kommt es dabei häufig zu ernsten Nebenwirkungen. Die Prostata, die einen Teil der Samenflüssigkeit produziert, sitzt direkt am Ausgang der Harnblase und unmittelbar vor dem Enddarm. Zudem ver- Blase laufen ganz in der Nähe Nervenstränge, die die Erektion steuern. Operation und Bestrahlung können deshalb zu Komplikationen wie Harninkontinenz und unkontrolliertem Stuhlabgang, Impotenz und rektalen Blutungen führen. Zu den Nebenwirkungen medikamentöser Therapien gehören der Verlust des Sexualtriebs, Impotenz, Gewichtszunahme, Knochenschwund, Hitzewallungen sowie Störungen der Herz- und Leberfunktion. Samenbläschen Harnröhre Prostata Samenleiter BRYAN CHRISTIE Enddarm WWW.SPEK TRUM .DE 33 Drüsengang Prostata prostataspezifisches Antigen Übergang ins Blut freies PSA ACT-gebundenes PSA MG-gebundenes PSA SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / BUSKE-GRAFIK Die Prostata produziert das prostataspezifische Antigen (PSA) und mischt es über ihre Ausführungsgänge dem Sperma bei. Aus verschiedenen Gründen – etwa bei Prostatakrebs – kann PSA auch ins Blut gelangen. Dort liegt es in freier Form vor oder ist an verschiedene Plasmaproteine gebunden, etwa an Antichymotrypsin (ACT) oder Makroglobulin (MG). maßen genau wissen, ob wir es mit einer aggressiven, potenziell tödlichen Erkrankung zu tun haben oder mit einem indolenten Tumor. Viele meiner Prostatakrebspatienten haben sich gegen einen sofortigen Eingriff entschieden und erhalten keinerlei Therapie. Stattdessen nehmen sie an einem Programm teil, das als »aktives Beobachten« bezeichnet wird – sie lassen ­regelmäßig ihren PSA-Wert messen und Prostatabiopsien durchführen. Eine Therapie kommt in Betracht, wenn der PSA-Wert rasch steigt, die Biopsie ein beschleunigtes Tumorwachstum anzeigt oder die Einordnung des Tumorgewebes gemäß der Gleason-Klassifikation ergibt, dass die Krebszellen deutlich aggressiver geworden sind. Kürzlich kamen Experten im Auftrag der National Institutes of Health zu der Einschätzung, das aktive Beobachten sei »eine brauchbare Option, die Patienten mit einem Niedrig­ risiko-Prostatakarzinom angeboten werden sollte«. Und eine in Kanada durchgeführte Langzeitstudie hat ergeben, dass etwa ein Prozent der Patienten, die sich für diese Option entscheiden, innerhalb von zehn Jahren an der Krebserkrankung sterben. Zum Vergleich: Bei der chirurgischen Entfernung der Prostata beträgt das Risiko tödlicher Komplikationen etwa 0,5 Prozent. Die Entscheidung gegen eine Therapie ist nicht endgültig. Operation, Bestrahlung und andere Therapien stehen auch später noch zur Verfügung, und die vorliegenden Studiendaten zeigen, dass der Aufschub der Behandlung das klinische Resultat nicht verschlechtert. Für die Patienten, bei denen irgendwann tatsächlich ein Eingriff erforderlich wird, eignen sich dann möglicherweise neue Behandlungsansätze, die nur den erkrankten Teil der Prostata entfernen und deshalb weniger Nebenwirkungen haben. Tragfähige Studien zum Vergleich mit konventionellen Verfahren sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Für die vier Prozent der amerikanischen Patienten, bei denen der Tumor bereits in die Knochen oder andere Organe 34 gestreut hat, gibt es noch keine Therapie, die zur vollständigen Heilung führt. Aber die verfügbaren Behandlungen werden allmählich effektiver. Gängige Eingriffe zielen darauf ab, die Wirkung des Testosterons zu unterbinden, um das Wachstum der Tumoren zu hemmen. Es gibt jedoch stets einige Krebszellen, denen es irgendwann gelingt, diese chemische Kastration zu überwinden. Deshalb hat die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) inzwischen zwei neue Therapieverfahren zur Behandlung des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms bewilligt. Bei dem einen handelt es sich um den therapeutischen Krebsimpfstoff Provenge, der die Immunreaktion gegen den Tumor verstärken soll. Die zweite neu zugelassene Therapie basiert auf dem Arzneistoff Abirateron, der die Tumorzellen selbst an der Produktion von Testosteron hindert. Studien zu beiden Behandlungsansätzen zeigen, dass sie die Überlebenszeit der Patienten im Mittel um vier Monate verlängern. Weitere Verfahren sind in der Entwicklung. In den knapp zwei Jahrzehnten, seit Herr H. sich gegen eine Therapie entschied, haben wir viel über Prostatakrebs gelernt. Das ermöglicht uns heute, die medizinische Betreuung an die individuelle Situation des Patienten anzupassen, statt alle Betroffenen gleich zu behandeln. Wir Ärzte sollten zudem die Botschaft mitnehmen, dass wir sowohl uns selbst als auch unseren Patienten stets klarmachen müssen, über welche gesicherten Erkenntnisse wir tatsächlich verfügen und was wir nicht wissen. Und wir sollten den Mut haben, uns an der besten wissenschaftlichen Evidenz zu orientieren, statt etablierten Glaubensgrundsätzen zu folgen. Ÿ DER AUTOR Marc B. Garnick ist Onkologe und Spezialist für Prostatakrebs. Er arbeitet an der Harvard Medical School und am Beth Israel Deaconess Medical Center, beide in Boston (USA). Gemeinsam mit Kollegen gibt er den Jahresbericht der Harvard Medical School über Prostataerkrankungen heraus. Der Autor berät außerdem mehrere Risikokapitalfirmen bei Investitionen in neu gegrün­ dete Unternehmen, die innovative Therapien gegen Prostatakrebs entwickeln. QUELLEN Chou, R. et al.: Screening for Prostate Cancer: A Review of the Evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. In: Annals of Internal Medicine 155, S. 762 – 771, 2011 Garnick, M. B., MacDonald, A. (Hg.): 2012 Annual Report on Prostate Diseases. Harvard Health Publications, 2012 McNaughton-Collins, M. F., Barry, M. J.: One Man at a Time – Resolving the PSA Controversy. In: The New England Journal of Medicine 365, S. 1951 – 1953, 2011 WEBLI N KS www.krebsinformationsdienst.de Das Deutsche Krebsforschungszentrum informiert ausführlich rund um Krebs und seine Früherkennung. Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1159803 SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 MIT FRDL. GEN. VON BACKMAN LABORATORY, NORTHWESTERN UNIVERSITY Krebszellen (links) weisen im Vergleich mit normalen Zellen (rechts) Dichteänderungen im Nanometerbereich auf (rot). DIAGNOSTIK Das Unheil kommen sehen Physiker entwickeln neue Techniken, um Tumoren zeitiger zu erkennen. Von Cassandra Willyard D er Physiker Peter Kuhn sieht sich und seine Kollegen vor allem als Erfinder und Problemlöser. Seit einiger Zeit versucht er – so wie viele andere Physiker auch – ein Problem zu lösen, das Biologen und Onkologen schon seit Jahrzehnten beschäftigt: nämlich wie sich Krebs möglichst früh erkennen lässt, um seine Ausbreitung im Körper zu verhindern. Kernspintomografie, Computertomografie und Positronen-Emissionstomografie sind heute unverzichtbare Methoden, um Krebsherde aufzuspüren und ihr Wachstum zu verfolgen. Nach wie vor arbeiten Physiker daran, diese bildgebenden Verfahren weiter zu verbessern und miteinander zu AUF EINEN BLICK EFFIZIENTE FRÜHWARNSYSTEME 1 Krebserkrankungen werden häufig erst in fortgeschrittenem Stadium erkannt, wenn es für eine wirksame Behandlung bereits zu spät ist. 2 Um das zu ändern, arbeiten Physiker an neuen Methoden zur Krebsfrüherkennung. So weisen sie entartete Zellen mit Hilfe magnetischer Nanopartikel, weiterentwickelter Mikro­ skopieverfahren und rechnergestützter Bildauswertung nach. WWW.SPEK TRUM .DE kombinieren, um noch aussagekräftigere Diagnoseergebnisse zu erhalten. Zunehmend schlüpfen sie aber auch in die Rolle von Pathologen, indem sie Techniken entwickeln, die ent­ artete Zellen in Blut- und Gewebeproben nachweisen. Diese Techniken – von Nanosensoren bis hin zu verbesserten Mikroskopen – könnten das Potenzial besitzen, Krebsherde viel früher zu entdecken, als man es bislang für möglich hielt. Aus soliden Tumoren lösen sich ständig Zellen, die in den Blutstrom gelangen und in andere Körperregionen wandern, wo sie sich festsetzen und Tochtergeschwülste bilden können. »Dieser Prozess ist bislang kaum verstanden«, sagt Kuhn, der am Scripps Research Institute in La Jolla (Kalifor­nien) arbeitet. Das liege unter anderem an der sehr geringen Zahl zirkulierender Tumorzellen: Mitunter fänden sich in der Blutprobe eines Krebspatienten nur einige wenige entartete Zellen unter vielen Milliarden normalen. »Wir stehen also vor einem klassischen physikalischen Problem: der Detektion eines seltenen Ereignisses«, erläutert der Physiker. Zum Nachweis der Krebszellen haben Kuhn und sein Team die Technik der so genannten Flüssigbiopsie entwickelt. Hierfür benötigen sie eine Probe von zwei Milliliter Blut. Daraus entfernen sie zunächst alle roten Blutkörperchen und übertragen den Rest als dicht gepackte, einlagige Schicht aus zehn Millionen Zellen auf einen Objektträger. 35 Effiziente Kameraüberwachung »Sobald verdächtige Zellen entdeckt sind, lässt sich die Probe genauso weiteruntersuchen wie jede normale Biopsie«, erklärt Kuhn. Seine Daten belegen, dass die Flüssigbiopsie mehr zirkulierende Tumorzellen nachweist als der verbreitete CellSearch-Test. Dieser isoliert Tumorzellen mit Hilfe von Antikörpern und Magneten aus dem Blut und wurde von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für die klinische Anwendung zugelassen. Momentan untersuchen die Wissenschaftler um Kuhn, ob sich aus der Zahl zirkulierender Tumorzellen ableiten lässt, wie eine bereits diagnostizierte Erkrankung weiter verlaufen oder auf eine Therapie ansprechen wird. Theoretisch eignet sich die Flüssigbiopsie aber auch selbst zur Diagnose. Wie das Team kürzlich nachwies, kann sie Tumorzellen im Blut von Patienten mit nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom aufspüren, und das bereits in frühen Stadien der Erkrankung. Um das volle diagnostische Potenzial der Methode auszuschöpfen, bedürfe es noch einiger Fortschritte, bemerkt Kelly Bethel, die als Pathologin am Scripps Research Institute mit Kuhn zusammenarbeitet. Sie will die Technik nutzen, um zirkulierende Tumorzellen bei Menschen mit hohem Krebsrisiko aufzuspüren – etwa bei Personen mit nicht näher charakterisierten Wucherungen in Lunge oder Bauchspeicheldrüse. Hier könnte der Nachweis solcher Zellen den Ärzten dabei helfen, gutartige von bösartigen Tumoren zu unterscheiden. Noch erlaubt die Flüssigbiopsie nicht, das Herkunftsorgan zirkulierender Tumorzellen zu bestimmen. Doch schon bald könnte sie diese Möglichkeit bieten. Die Forscher suchen bereits nach typischen Merkmalen von Zellen, die aus der Leber stammen. »Ich bin zuversichtlich, dass sich die Technik noch erheblich weiterentwickeln lässt«, sagt Bethel. Ein handlungsorientiertes Projekt zum Thema »Krebs« für die gymnasiale Oberstufe: kostenfrei unter www.wissenschaft-schulen.de/krebs 36 Diagnostik auf Einzelzellniveau Das Cell-CT-Verfahren erzeugt dreidimensionale Bilder von Einzelzellen und analysiert sie auf Gestaltmerkmale, die für bestimmte Tumorarten typisch sind. Kamera rotierendes Glasröhrchen Bildserie Zelle dreht sich 1. In ein Gel eingebettet werden Zellen einzeln durch ein feines Glasröhrchen transportiert. 2. Während das Röhrchen rotiert, fotografiert eine Kamera jede Zelle aus mehreren Blickwinkeln. 3. Aus diesen Aufnahmen erstellt ein Computerprogramm dreidimensionale Abbildungen der Zellen. 4. Das System analysiert, ob in den 3-D-Bildern ungewöhn­ liche Strukturen vorkommen, die auf Krebs hindeuten. 750 Kilometer weiter südöstlich forscht Sanjiv Gambhir ebenfalls über neue Ansätze der Krebsdiagnostik. Der Leiter der radiologischen Abteilung an der Stanford University (Kalifornien) ist frustriert darüber, dass bei vielen Krebspatienten die Krankheit erst erkannt wird, wenn es bereits zu spät ist. Entdecke der Arzt beispielsweise einen Brusttumor von der Größe einer Murmel, dann enthalte dieser bis zu drei Milliarden Zellen und habe wahrscheinlich bereits in andere Organe gestreut. Um es erst gar nicht dazu kommen zu lassen, will Gambhir die Geschwulste bereits dann aufspüren, wenn diese noch kleiner sind als ein Stecknadelkopf. Der Radiologe und sein Team haben einen briefmarkengroßen Microarraychip entwickelt, der Tumorproteine mit Hilfe magnetischer Nanopartikel nachweist. Auf der Oberfläche des Chips sind Antikörper fixiert, die an tumorspezifische Proteine binden. Trägt man einen Tropfen Blut oder andere Körperflüssigkeit auf den Chip auf, bleiben darin befindliche Tumorproteine an den Antikörpern hängen. Später geben die Forscher weitere Antikörper hinzu, die sich ihrerseits an die gefangenen Tumormoleküle heften. Im nächsten Schritt setzt das Team magnetische Nano­ partikel zu, die an einen der Antikörper koppeln. Sie lassen sich anschließend per Magnetfeldmessung nachweisen. Das ermöglicht es, die Proteine in einer bestimmten Probe zu identifizieren. Der Chip weist Tumorproteine in tausendfach niedrigerer Konzentration nach als ein Standard-ELISA, das am häufigsten eingesetzte Verfahren zum Aufspüren solcher Moleküle im Blut. Zurzeit ist Gambhir in der Lage, damit 256 verschiedene Tumorproteine zu detektieren. Um zu entscheiden, welche davon diagnostisch besonders wichtig sind, arbeitet das Team eng mit Biologen zusammen. »Diese TechSPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT, NACH WILLYARD, C.: PLAYING DETECTIVE. IN: NATURE 491, S. S64–S65, 2012 Dann fügen sie Fluoreszenzfarbstoffe hinzu: einen zum Anfärben der Zellkerne, einen Antikörper zum Markieren von Immunzellen und einen weiteren, der an Epithelzellen bindet. Anschließend nimmt eine digitale Mikroskopkamera etwa 10 000 Bilder der Zellschicht auf. »Diese Fotos gehen wir nun Stück für Stück durch«, beschreibt Kuhn. Er und sein Team verwenden einen Computeralgorithmus, der anhand der Fluoreszenzmuster bestimmte Epithelzellen erkennt, aus denen später einmal Tumoren hervorgehen können – etwa solche der Brust, der Lunge, des Darms, der Prostata, der Bauchspeicheldrüse und der Leber. nik hilft uns nur, wenn wir wissen, nach welchen Proteinen wir suchen sollen«, erklärt der Radiologe. Während Gambhir auf innovative Technologien setzt, arbeitet Peter Kuhn mit einem jahrhundertealten Gerät, dem Mikroskop. Doch obgleich betagt, lässt sich auch dessen diagnostisches Potenzial noch verbessern. Das amerikanische Unternehmen VisionGate etwa hat ein optisches Verfahren namens Cell-CT entwickelt, das dreidimensionale digitale Bilder von Zellen erzeugt. Hierfür werden die Zellen perlenschnurartig in einem dünnen, mit Gel gefüllten Glasröhrchen aufgereiht. Während das Röhrchen rotiert, fotografiert das Mikroskop jede Zelle aus verschiedenen Blickwinkeln. Ein Computerprogramm erzeugt daraus 3-D-Bilder, die ungewöhnliche Strukturen in Krebszellen erkennen lassen. »Manchmal sieht der Kern einer entarteten Zelle wie ein deformierter Wasserball aus«, berichtet der theoretische Physiker Paul Davies vom Center for the Convergence of Physical Science and Cancer Biology der Arizona State University (USA). Er und seine Kollegen haben mit Hilfe der 3-D-Aufnahmen kürzlich nachgewiesen, dass Zellen des Brustgewebes unterschiedliche Gestaltmerkmale zeigen – je nachdem, ob sie aus gesundem Gewebe, aus gut- oder bösartigen Tumoren stammen. Auf konventionellen zweidimensionalen Bildern sind diese Merkmale kaum zu erkennen. Bestechend genaue Abbildung Cell-CT gibt die Struktur der Zellen so präzise wieder, dass man daran Hunderte von unterschiedlichen Messungen vornehmen kann. Die resultierenden Daten lassen sich nach Mustern durchsuchen, die auf Krebs hindeuten. »Das Verfahren ist nicht auf die Expertise eines Pathologen ange­ wiesen, es funktioniert vollautomatisch«, erläutert Deirdre Meldrum, Elektroingenieurin und Leiterin des Center for ­Biosignatures Discovery Automation an der Arizona State University. Zurzeit entwickelt das Unternehmen VisionGate das Verfahren zu einer Früherkennungsmethode für Lungenkrebs weiter. Laut aktuellen Untersuchungen erlaubt sie, entartete Zellen im Atemwegssekret von Personen nachzuweisen, die ein hohes Erkrankungsrisiko tragen. Eine Mikroskopiemethode, die noch subtilere Krankheitszeichen aufspürt, hat Vadim Backman entwickelt, Biomedi­ ziningenieur an der Northwestern University in Evanston (Illinois, USA). »Die konventionelle Lichtmikroskopie kann nur Strukturen darstellen, die mindestens einen halben Mikrometer groß sind«, sagt er. Er habe jedoch Hinweise darauf gefunden, dass die frühesten Veränderungen, die im Zuge einer Entartung einsetzen, sich auf der Nanometerskala abspielen. Um solch winzige Details zu untersuchen, haben Backman und seine Kollegen ein Instrument entwickelt, das konventionelle Mikroskopie und Spektroskopie vereint. Das Partial Wave Spectroscopic Microscope (Partialwellen-Spektroskopiemikroskop) beleuchtet die fragliche Zelle und analysiert die Wellenlängen des reflektierten Lichts. Untersuchungen der Arbeitsgruppe zeigen: Die epigenetischen und genetischen Prozesse, die einer Entartung vorausgehen, verändern WWW.SPEK TRUM .DE die intrazelluläre Dichte auf Längenskalen im Nanometer­ bereich – obwohl die Zelle oberflächlich völlig normal wirkt. Je größer diese Abweichungen, desto näher steht die Zelle am Übergang zum Krebs. Die nanometergroßen Dichteveränderungen sind nicht nur am Ort des entstehenden Tumors nachweisbar, sondern beeinflussen auch benachbarte Zellen. Das macht die Partialwellen-Spektroskopiemikroskope zu einem wertvollen Instrument der Krebsfrüherkennung, meint Backman. So ließen sich Anzeichen für Lungenkrebs eventuell schon in einfachen Abstrichen der Wangenschleimhaut erkennen. Backman und sein Team benutzten die neue Mikroskopiemethode, um Enddarmzellen von mehr als 100 Patienten zu untersuchen, die sich einer Darmspiegelung unterzogen hatten. Dabei stellten sie einen deutlichen Zusammenhang fest zwischen Veränderungen der intrazellulären Dichte auf der Nanometerskala und dem Risiko für Darmkrebs. Die Physiker hoffen, dass solche Methoden den Onkologen dabei helfen werden, Krebs zeitiger zu entdecken – und zwar bevor er sich im Körper ausbreiten kann. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate beträgt beim Lungenkrebs 50 Prozent, sofern die Krankheit früh diagnostiziert wird. Doch das ist selten der Fall, da die Symptome meist erst in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien auftreten. Hat der Krebs sich erst einmal im Körper ausgebreitet, fällt die Überlebensrate auf ein Prozent. Bestenfalls würden die neuen Verfahren nicht nur die ersten Anzeichen des Entartungsprozesses registrieren, sondern auch zwischen mehr und weniger gefährlichen Veränderungen unterscheiden. Dies ist jedoch ein enorm schwieriges Unterfangen, das Kuhn und seine Wissenschaftlerkollegen noch lange beschäftigen wird. Ÿ DI E AUTORI N Cassandra Willyard ist Wissenschaftsjournalistin. Sie lebt und arbeitet in Brooklyn, New York. QUELLEN Damania, D. et al.: Nanocytology of Rectal Colonocytes to Assess Risk of Colon Cancer Based on Field Cancerization. In: Cancer Research 72, 2720 – 2727, 2012 Nandakumar, V. et al.: Isotropic 3D Nuclear Morphometry of Normal, Fibrocystic and Malignant Breast Epithelial Cells Reveals New Structural Alterations. In: PloS One 7, e29230, 2012 Wendel, M. et al.: Fluid Biopsy for Circulating Tumor Cell Identification in Patients with Early- and Late-Stage Non-Small Cell Lung Cancer: a Glimpse into Lung Cancer Biology. In: Physical Biology 9, 016005, 2012 Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1199283 © Nature Publishing Group www.nature.com Nature Outlook 491, S. 64 – 65 37 BIOMECHANIK I Der Blick fürs Wesentliche Molekularbiologische Analysen von Tumorzellen liefern eine gigantische, kaum noch zu überblickende Datenflut. Ist das der richtige Weg zu einer besseren Medizin, oder verlieren wir uns in Details? Von Robert Gatenby I n den zurückliegenden Jahren haben wir atemberau­ bende Fortschritte in der Genetik und Molekularbiolo­ gie erlebt. Technische Verfahren, etwa zur DNA-Sequen­ zierung oder zur Proteincharakterisierung, besitzen mittlerweile eine Leistungsfähigkeit, die noch vor 20 Jahren undenkbar schien. Diese Entwicklung hat viele Bereiche der Lebenswissenschaften revolutioniert, darunter die Tumor­ biologie. Tausende Forschungsarbeiten aus den aufstreben­ den Gebieten der Genomik, Proteomik und Metabolomik zum Thema Krebs zeugen davon. Die neuen Analysemethoden haben allerdings auch ge­ zeigt, wie enorm komplex Krebserkrankungen sind. Jede ­Tumorart zeichnet sich durch spezifische Merkmale aus, ­sowohl was ihre Physiologie als auch was ihre Genetik und Epigenetik betrifft. Ja, selbst Zellen innerhalb ein und dessel­ ben Tumors können sich erheblich voneinander unterschei­ den. Die Antwort darauf lautete bisher: noch mehr Geld in molekulartechnologische Verfahren investieren, um noch mehr Tumorproben zu analysieren. Doch führt das unauf­ hörliche Sammeln von Detailinformationen wirklich zu ­besseren Krebstherapien? Welchen Nutzen können wir aus dem gewaltigen Datenberg ziehen, den all die Sequenzierer, Microarrays und Massenspektrometer unablässig weiter aufhäufen? AUF EINEN BLICK WENIGER IST MANCHMAL MEHR 1 Die technischen Verfahren der Molekularbiologie sind mittlerweile enorm leistungsfähig. Beispielsweise lässt sich ein komplettes menschliches Genom binnen weniger Tage sequenzieren. 2 Krebsforscher nutzen die neuen Möglichkeiten, um tausende Tumorproben auf ihre molekularen Details zu untersuchen. Das führt zu einer enormen Datenflut. 3 Immer mehr Wissenschaftler befürchten, dass diese riesige Informationsmenge den Blick auf die wesentlichen Prinzipien von Krebserkrankungen verstellt. 4 Physiker versuchen daher, reduktionistische Ansätze für die Krebsmedizin zu entwickeln. Sie charakterisieren Tumorzellen etwa anhand weniger mechanischer Eigenschaften oder entwickeln theoretische Modelle des Tumorwachstums. 38 Nehmen wir einmal an, es hätte diese technologischen Entwicklungen nicht gegeben und wir wären insbesondere nicht in der Lage, die Genome von tausenden Tumorzellen zu sequenzieren. Natürlich hätten wir dann viel weniger In­ formationen darüber, welche genetischen Merkmale dieser oder jener Tumor hat. Aber wüssten wir auch weniger über die Biologie von Krebserkrankungen? Meines Erachtens lau­ tet die Antwort »nicht unbedingt«. Viele Forscherkollegen werden mir hier heftig wider­ sprechen. Die meisten Biologen und Onkologen halten es für selbstverständlich, dass die grundlegenden Mechanismen von Krebserkrankungen genetischer Natur sind. Viele ein­ schlägige Artikel beginnen mit dem Satz: »Krebs ist eine Krankheit der Gene.« Medizinstudenten lernen heute die ­typischen Mutationen der verschiedenen Krebsarten aus­ wendig – und nehmen implizit an, damit würden sie ein um­ fassendes Verständnis erlangen. Es ist an der Zeit, diese An­ nahme in Zweifel zu ziehen. Fragwürdige Zuversicht Es herrscht der optimistische Glaube, immer detailliertere molekularbiologische Analysen von immer mehr Tumor­ proben müssten letztlich zu Durchbrüchen in der Krebs­ medizin führen – vornehmlich in Form von zielgerichteten Therapien, die entartete Zellen hochspezifisch angreifen und wenig Nebenwirkungen haben. Doch die bisherigen Er­ fahrungen mit solchen »Targeted Therapies« lehren, dass diese im Allgemeinen nur vorübergehend wirken und die Krebszellen mit ihrer unerbittlich fortschreitenden Evolu­ tion letztlich die Oberhand gewinnen. Wir sollten uns also vielleicht nicht länger darauf verlassen, die steigende Raffi­ nesse unserer molekulartechnologischen Verfahren führe mehr oder weniger zwangsläufig zu wirksameren Behand­ lungen. Eine Alternative könnten Projekte bieten, die eine Brücke von der Tumorbiologie zur physikalischen Forschung schla­ gen. Von den Physikern können wir etwas Wichtiges lernen, nämlich die klare Trennung der experimentellen Beobach­ tungen von den Prinzipien des untersuchten Systems. Egal ob es um die Beschreibung von Planetenbewegungen, die Analyse atomarer Spektren oder die Suche nach subatoma­ SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 ren Teilchen geht: Physiker definieren ein System nicht an­ hand empirischer Daten. Vielmehr nutzen sie experimentel­ le Befunde, um theoretische Modelle zu prüfen, welche die grundlegenden Prinzipien des Systems abbilden. Mir scheint, wenn wir auch für die Tumorbiologie einen theoretischen Rahmen entwickeln wollen, sollten wir uns an ein Postulat des Evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky halten: dass nämlich Krebserkrankungen nur im Licht der Evolution sinnvoll erklärbar sind. Daher frage ich mich, ob das Sequenzieren von immer mehr Krebsgenomen ausreicht oder überhaupt notwendig ist, um die evolutionäre Dynamik von Tumoren und ihre Re­ aktion auf therapeutische Eingriffe zu verstehen. Darwin wusste nichts über Molekulargenetik. Sein Modell der biolo­ Physiker entwickeln neue Ansätze, um Tumorerkrankungen zu untersuchen und zu behandeln. Beispielsweise lässt sich mit Laserstrahlen messen, wie verformbar entartete Zellen sind (siehe Kasten S. 43). Das erlaubt Rückschlüsse auf den weiteren Krankheitsverlauf. FOTOLIA / JUAN GÄRTNER [M] WWW.SPEK TRUM .DE 39 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT, NACH: JANSSEN RESEARCH & DEVELOPMENT, LLC 2012 250 Zahl der zugelassenen Krebsmedikamente 5 28 4 200 3 150 8 100 0 1970 7 6 50 4 1980 1 4 2 1975 2 1985 1990 1995 2000 Budget des National Cancer Institute (Milliarden US-Dollar) altersstandardisierte Krebssterblichkeit in den USA (Todesfälle auf 100 000 Einwohner) 300 0 2005 gischen Evolution setzte lediglich einen nicht näher definier­ ten »Mechanismus der Vererbung« voraus. Fast 100 Jahre lang führten Evolutionsbiologen und Ökologen ihre Untersu­ chungen durch, ohne etwas von Genetik zu wissen – und er­ kannten dennoch die fundamentalen Prinzipien, nach denen komplexe biologische Gemeinschaften funktionieren. Dies war möglich, weil die evolutionäre Entwicklung sowohl ein­ zelner Arten als auch die von Artengemeinschaften davon ab­ hängt, wie ihre äußeren, phänotypischen Merkmale – und nicht ihre Genome – mit den Selektionsfaktoren der Umwelt zusammenwirken. Mit anderen Worten: Um die grundlegen­ den Funktionsprinzipien von Lebensgemeinschaften zu er­ kennen, braucht man nicht unbedingt die Genetik. Im Gegen­ teil, die exzessive Beschäftigung mit genetischen Merkmalen kann sogar den Blick für das Wesentliche verstellen. Vom Wesen der Fische lernen Dies lässt sich gut am Beispiel der Höhlenfische zeigen. Über­ all auf der Welt gibt es Unterwasserhöhlen, in denen diverse Fischarten leben. All diese Tiere haben sich an die ewige Dun­ kelheit angepasst, indem sie leistungsfähigere taktile Organe ausbildeten und ihre Sehfähigkeit und Hautpigmentierung verloren. Die heutigen höhlenbewohnenden Fische stam­ men von mehr als 80 verschiedenen Arten ab – ein beeindru­ ckendes Beispiel konvergenter Evolution. Würde man ihre Genome sequenzieren, erhielte man eine riesige Menge von äußerst heterogenen Informationen. Diese Daten würden nicht nur Unterschiede zwischen den Arten widerspiegeln, sondern auch die genetische Variabilität innerhalb der Spe­ zies. Sicher könnte man daraus interessante Erkenntnisse ­gewinnen, doch die grundlegenden Charakteristika dieser ­Fische – größere taktile Organe, Verlust des Sehsinns und der Pigmentierung – erschließen sich bereits durch simples Be­ trachten der Tiere. Es gibt den sprichwörtlichen Mann, der seinen Schlüssel unter einer Straßenlaterne sucht, obwohl er ihn ganz woan­ ders verloren hat – und zwar, weil er unter der Laterne mehr sieht. Ganz ähnlich fühlen auch wir Forscher uns zu Arbeits­ feldern hingezogen, die einen hohen Informationsertrag versprechen. Doch Datenfülle ist keine Garantie für wissen­ 40 Viele Wissenschaftler möchten neue Wege in der Krebsforschung beschreiten, etwa über eine verstärkt physikalische Herangehensweise. Denn die bisherigen Fortschritte im Kampf gegen Krebs sind oft enttäuschend. 1971 rief der damalige US-Präsident Richard Nixon den »War on Cancer« (Krieg gegen Krebs) aus. Die finanziellen Zuwendungen ans amerikanische National Cancer Institute stiegen in den Folgejahren dramatisch an (braune Linie) – verbunden mit dem Auftrag, ein Heilmittel gegen Tumorerkrankun­ gen zu finden. Tatsächlich hat die US-Arzneimittelbehörde FDA seither zahlreiche Krebsmedikamente zugelassen. Trotz alledem ist die altersstandardisierte Krebssterblichkeit in den USA seit den 1950er Jahren nur um elf Prozent gesunken (rote Linie). schaftlichen Erfolg. Dobzhansky schrieb einmal: »Viele Wis­ senschaftler hegen den naiven Glauben, sobald sie nur ge­ nügend Informationen über ein Problem zusammentragen hätten, würden diese sich schon irgendwie so zusammen­ fügen, dass eine überzeugende und wahrhaftige Lösung des Problems herauskommt.« Die enorme Datenmenge, die wir mit Hilfe der neuen molekulartechnologischen Verfahren anhäufen, ist zweifel­ los von großem Nutzen. Doch um ihretwillen haben wir andere Forschungsansätze vernachlässigt – darunter mög­ licherweise solche, die uns zu »echten« Lösungen führen würden. Würden wir die Evolution und Ökologie von Tumo­ ren verstehen, was bislang nicht der Fall ist, dann würden wir vermutlich auch klarer erkennen, dass die Aussagefähig­ keit dieser Daten begrenzt ist. Solange wir die grundlegen­ den Prinzipien von Krebserkrankungen nicht erfasst haben, erzeugen unser anhaltendes Vertrauen und unsere gewalti­ gen Investitionen in die Molekulartechnologie womöglich nur eine Fortschrittsillusion. Wenn wir in der Tumorbiologie echte Fortschritte machen wollen, brauchen wir ein tragfähiges theoretisches Gerüst. Ähnlich wie in der Gravitationstheorie oder der Quanten­ feldtheorie, müssen wir die Gesetzmäßigkeiten definieren, die dem komplexen molekularbiologischen Geschehen in Tumoren zu Grunde liegen. Das wird erst gelingen, wenn wir an der richtigen Stelle suchen. Ÿ DER AUTOR Robert Gatenby leitet die Abteilungen für Radiologie und Integrierte Mathematische Onkologie am H. Lee Moffitt Cancer Center in Tampa, Florida. Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1199280 © Nature Publishing Group www.nature.com Nature Outlook 491, S. 55 SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 BIOMECHANIK II Krebszellen im Kräftespiel Onkologen erforschen die mechanischen Wechselwirkungen zwischen Tumorzellen und ihrer Umgebung, um die Ausbreitung von Karzinomen besser zu verstehen – und eventuell zu stoppen. Von Erika Jonietz N och Ende des 19. Jahrhunderts wussten Ärzte kaum mehr über Karzinome, als dass sie fester sind als das umgebende Gewebe. Nach wie vor gibt meist das Ertasten eines Knotens bei Brustund Prostatakrebs den Anlass zu einer eingehenderen Dia­ gnostik. Seit etwa 30 Jahren zeichnet sich ab, dass die me­ chanischen Eigenschaften von Karzinomen – also von Geschwülsten, die aus Zellverbänden auf äußeren oder inneren Körperoberflächen hervorgehen – in der Tumorentwicklung eine große Rolle spielen. »Mechanische Kräfte bestimmen 150 675 1050 > 5000 WWW.SPEK TRUM .DE PASZEK, M.J. ET AL.: TENSIONAL HOMEOSTASIS AND THE MALIGNANT PHENOTYPE. IN: CANCER CELL 8, S. 241–254, 2005, FIG. 2C; ABDRUCK GENEHMIGT VON ELSEVIER / CCC Wenn gesunde Zellen entarten, wird das resultierende Tumorgewebe zunächst steifer, wie die Zunahme des Elastizitätsmoduls zeigt (Werte in Pascal). 41 maßgeblich, wie Zellen sich teilen und mit anderen wechselwirken, wie sie Signale verarbeiten und senden. Es sind auch Kräfte im Spiel, wenn bösartige Zellen in andere Gewebe eindringen, metastasieren und sich an Oberflächen anheften«, erklärt Muhammad Zaman, biomedizinischer Ingenieur an der Boston University in Massachusetts. Daher bilden mechanische Prozesse in der noch jungen physikalischen Krebsforschung einen Schwerpunkt – in der Hoffnung, neue Ansatzpunkte für Therapien und Diagnoseverfahren zu finden. Eine Grundfrage lautet: Sind die mechanischen Eigenschaften der Zellen solider Tumoren untereinander vergleichbar oder hängen sie maßgeblich von denen der jeweiligen Mikroumgebung ab, beispielsweise den Proteingerüsten und den einwirkenden Kräften? Im ersten Fall müssten universelle Gesetze die Mechanik von Tumoren beschreiben, im zweiten wäre eine Vielzahl mechanischer Konstellationen zu erforschen. Weichere Zellen dringen leichter in andere Gewebe Josef Alfons Käs, Zellbiophysiker, vertritt die erste These. Der Leiter des Labors für Soft Matter der Universität Leipzig ist davon überzeugt, dass einige Zellcharakteristika, die er bei Brust- und Gebärmutterhalskrebs findet, für alle Karzinome gelten. Während die Molekularbiologie ein immer komplexeres und damit schwerer zu interpretierendes Bild liefert, erlaubt die Physik seiner Ansicht nach eine klarere Sicht auf das Krankheitsgeschehen. »In der Systembiologie definiert man funktionelle Einheiten für das Netzwerk Zelle, das bringt Struktur hinein. Ein solches Modul ist die Biomechanik einer Zelle, also ihre Materialeigenschaften. Wie steif ist sie beispielsweise, und welchen Einfluss hat das darauf, wie gut sie sich teilen oder fortbewegen kann. Aus dieser Perspektive sind Zellen einfach Beispiele für weiche Körper, die dann derselben Physik gehorchen wie etwa Kolloide.« Käs hat etwa beobachtet, dass Brustkarzinomzellen – entartete Epithelzellen der Brustdrüse – weicher werden, wenn die Erkrankung voranschreitet. Die Erklärung dafür: Um das umliegende Gewebe zu befallen, müssen die Zellen durch Lücken im Proteingerüst der extrazellulären Matrix schlüpfen, was leichter gelingt, wenn sie sich verformen können. Dem AUF EINEN BLICK WEICHE KÖRPER, HARTE FAKTEN 1 Physiker sehen in lebenden Zellen »weiche Körper«, vergleich­bar Kolloiden. Im Lauf der Tumorentwicklung verändern Karzinomzellen mechanische Eigenschaften wie Verformbarkeit und Kontraktilität. 2 Krebsforscher diskutieren, ob die gemessenen Parameter auf alle Tumorarten verallgemeinerbar sind oder stark von der zellulären Mikroumgebung abhängen. Im ersten Fall könnten bald neue Ansätze für Diagnose und Therapie gefunden werden. 42 entspricht auch, dass der aus Keratin aufgebaute Teil des Zellgerüsts in bösartigen Krebszellen abgebaut wird. Im scheinbaren Widerspruch zur Verformbarkeit nimmt aber mit der Tumorentwicklung auch die Fähigkeit zu, sich bei mechanischen Reizen zusammenziehen zu können. Käs vermutet, dass sich diese Zellen dadurch einfacher aus dem Verband lösen und den Ursprungstumor verlassen können. »Eine sehr weiche Zelle könnte zwar leichter durch Lücken schlüpfen, um sich aktiv zu bewegen, muss sie jedoch zudem eine Kraft aufbringen können. Deshalb benötigen Tumor­ zellen beides, um in andere Gewebe vorzudringen und zu metastasieren: eine deformierbare Oberfläche und einen kontraktilen Körper.« Daher hat sein Team einen »optischen Zellstrecker« entwickelt, der mit zwei gegenläufigen Laserstrahlen die Verformbarkeit von 30 Zellen pro Minute vermisst (siehe Kasten rechts). Damit hofft der Physiker, die Wahrscheinlichkeit einer Metastasierung, vor allem aber die Existenz metastasierender Zellen, schonender als bislang bestimmen zu können – bevor Tochtergeschwulste entstehen. Umgekehrt sollte es möglich sein, die mechanischen Veränderungen von Krebszellen medikamentös zu stoppen und so der Metastasenbildung entgegenzuwirken. Käs kooperiert zurzeit mit einem Pharmaunternehmen, um geeignete Hemmstoffe zu identifizieren. Auch die Resistenz von Tumorzellen gegen Chemotherapien könnte sich physikalisch erklären lassen. Muhammed Zaman ist ihr mit Hilfe der Mikrorheologie auf der Spur. Bei diesem Verfahren zur Charakterisierung weicher Systeme injizieren Forscher den Zellen Nanopartikel und beobachten deren Bewegung im Inneren. Industrielabore messen auf diese Weise beispielsweise viskoelastische Eigenschaften von Kunststoffschäumen. Zaman gibt dabei dreidimensionalen Zellkulturen den Vorzug, da sie dem Umfeld eines echten Tumors eher entsprechen als konventionelle Kulturen in flachen Plastikschalen, die unter anderem viel empfindlicher auf Zellgifte ansprechen. Er pflanzt Krebszellen mal in eine steifere, mal in eine weichere Matrix und testet zudem verschiedene Konzentrationen von Chemotherapeutika, immer auf der Suche nach einer Korrelation zwischen mechanischen Parametern und Wirkstoffresistenz. Am Ende hofft Zaman vorhersagen zu können, ob ein Tumor behandelbar ist oder ob er eine Resistenz zu entwickeln droht. Die meisten Wissenschaftler der neuen onkologischen Disziplin bezweifeln allerdings, dass sich Karzinomzellen verschiedener Ursprungsgewebe wirklich physikalisch ähneln. Valerie Weaver, Bioingenieurin an der University of California in San Francisco, ist überzeugt: »Eine Tumorerkrankung bedeutet zwar immer eine Störung der Mechanik des Gewebes, doch wie sich diese im Einzelnen auswirkt, hängt von der Krebsart ab.« So würden mechanische Umgebungsreize über das Zellinnenskelett an den Zellkern weitergeleitet, wo sie Genaktivitäten beeinflussten. Als Folge könnten Enzyme gebildet werden, welche das Kollagen SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Der »optische Zellstrecker« des Labors für Zellbiophysik der Universität Leipzig misst die Elastizität und Kontraktionsfähigkeit von Krebszellen, um das Risiko der Bildung von Tochtergeschwülsten zu bestimmen. Laserstrahlen Kamera Messkanal Zellen bewegen sich durch den Messkanal elastisches Nachgeben 0,030 Rückkehr in den Ausgangszustand Brustkrebs Grad 3+ 0,025 Brustdrüsenzellen aus Kar­ zinomen lassen sich mit zunehmender Aggressivität (Malignitätsgrad G1 bis G3+) leichter dehnen, entspannen dann aber auch schnell wieder (Relaxation). Als Kontrollgruppe dienten gesunde Zellen dieses Gewebes. der extrazellulären Matrix verdauen, was es den Krebszellen ermöglichte zu proliferieren. Diese Prozesse dürften aber ihrer Ansicht nach in verschiedenen Geweben unterschiedlich ablaufen, weil deren mechanische Eigenschaften differieren. Zudem ist Weaver der Ansicht, dass die physikalischen Anpassungen der Krebszellen teilweise erst außerhalb des Ursprungstumors erfolgen, was die Zahl der möglichen Konfigurationen mechanischer Variablen vervielfachte. Ben Fabry, Biophysiker an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, verwendete Kollagenmatrizes mit eingebetteten fluoreszierenden Körnchen, um zu beobachten, wie Tumorzellen die umgebende Matrix beeinflussen, und um daraus ihre Kontraktionsfähigkeit zu berechnen. Dabei zeigte sich, dass Zellen invasiv wachsender Brustund Lungenkarzinome viel stärker kontrahieren können als solche nichtinvasiver Geschwulste. Das würde die Theorie von Käs bestätigen. Allerdings ergab sich kein einheitliches Bild: Ein im Ursprungsgewebe verbliebener Genitalkrebs lieferte die höchsten gemessenen Kontraktilitätswerte. Fabry verwundert das nicht: »Die Zellen unterschiedlicher Krebs­ arten nutzen verschiedene Invasionsstrategien. Manche setzen auf eine weichere, flexiblere Konsistenz, andere auf Steifigkeit oder Kontraktilität.« Die korrespondierenden molekularen Vorgänge sind noch kaum bekannt. »Wenn jemand behauptet, ein Phänomen sei rein mechanisch bedingt, kann man fast sicher sein, dass auch Biochemie im Spiel ist, und das gilt umgekehrt genauso«, erklärt Jan T. Liphardt vom Bay Area Physical SciencesOncology Center im kalifornischen Berkeley. WWW.SPEK TRUM .DE 0,035 relative Verformung Die Zellen bewegen sich durch einen flüssigkeitsgefüllten Kanal und werden zwischen zwei Laserstrahlen in der Schwebe gehalten (links). Während die Intensität des Laserlichts allmählich ansteigt, nimmt eine Kamera Serienbilder auf. Brustkrebs Grad 3– 0,020 0,015 0,010 Brustkrebs Grad 1 0,005 Kontrollzellen 0 0 1 2 3 4 5 Zeit (in Sekunden) Weaver erinnert sich, dass James Watson, der Entdecker der DNA-Helixstruktur, 2012 kritisierte: »Ich verstehe nicht, wie sich daraus Therapieansätze ergeben könnten.« Die Forscherin entgegnete damals: »Die einfachsten Signalsysteme sind mechanischer Art. Sie spielen eine so grundlegende Rolle für alle Lebensformen und insbesondere die vielzel­ ligen Systeme, dass sie beim Krebs nicht bedeutungslos sein können.« Doch Weaver räumt ein, dass Watson einen wunden Punkt getroffen hatte: »Neue Therapieformen sind vorerst nicht in Sicht. Der schwierige Teil unserer Arbeit beginnt gerade erst.« Ÿ DI E AUTORI N Erika Jonietz ist Wissenschaftsjournalistin in Austin (US-Bundesstaat Texas). QUELLEN Baker, E. L. et al.: Extracellular Matrix Stiffness and Architecture Govern Intracellular Rheology in Cancer. In: Biophysical Journal 97, S. 1013 – 1021, 2009 Fallica, B. et al.: Bioengineering Approaches to Study Multidrug Resistance in Tumor Cells. In: Integrative Biology 3, S. 529 – 539, 2011 Koch, T. M. et al.: 3D Traction Forces in Cancer Cell Invasion. In: PLoS One 7, e33476, 2012 Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1199281 © Nature Publishing Group www.nature.com Nature Outlook 491, S. 56 – 57 43 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT, NACH JONIETZ, E.: THE FORCES OF CANCER. IN: NATURE 491, S. S56–S57, 2012; DIAGRAMM NACH: JOSEF A. KÄS, UNIVERSITÄT LEIPZIG Diagnose auf Distanz MODELLENTWICKLUNG I Berechnung des Tumors Computermodelle von Geweben helfen, Krebserkrankungen besser zu verstehen. Zudem liefern sie neue Therapieansätze. Von Neil Savage A ls der Antikörper »Bevacizumab« vor elf Jahren für die Behandlung von Brustkrebs zugelassen wurde, hielten Ärzte und Forscher ihn für einen viel versprechenden Wirkstoff. Denn wachsende Tumoren benötigen zunehmend mehr Sauerstoff und sen­ den daher chemische Signale aus, um die Bildung neuer Blutgefäße anzuregen, die ins Tumorgewebe einsprossen. Bevacizumab hemmt diesen Prozess, schneidet die Ge­ schwulst damit von der Blutzufuhr ab und lässt sie schrump­ fen. Doch schon bald stellten die Mediziner fest, dass einige der so behandelten Patientinnen keineswegs von der The­ rapie profitierten, im Gegenteil: Ihre Brusttumoren wuch­ sen noch intensiver ins umgebende Gewebe ein. Eine ge­ naue Untersuchung des Phänomens bestätigte zwar, dass der Anti­körper wie vorgesehen das Wachstum neuer Blutge­ fäße unterbindet. Doch der daraus resultierende Sauerstoff­ mangel im Tumor führt zur verstärkten Aktivierung von Krebsstammzellen, was die Geschwulst aggressiver macht. Daher widerrief die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) Ende 2011 ihre Zulassung für das Me­ dikament. Diese Geschichte zeigt: Krebs ist eine komplexe Erkran­ kung. Tumoren setzen sich aus diversen Zelltypen zusam­ men, die sich in verschiedenen Zellzyklusstadien befinden und unterschiedliche chemische Signale aussenden und empfangen. Größere Geschwülste sind von Blutgefäßen durchzogen und treten in eine komplizierte Wechselwirkung AUF EINEN BLICK MIT DER KRAFT DER THEORIE 1 Computermodelle bilden ab, was in einem Tumor geschieht und wie sich Krebszellen verhalten. Sie erlauben unter anderem, die Entwicklung eines Tumors unter verschiedenen Bedingungen zu simulieren. 2 Mit Hilfe solcher Modelle wollen Forscher Ansätze für neue Krebstherapien finden. Berechnungen zeigten etwa, dass neu wachsende Blutgefäße so modifiziert werden können, dass sie im Gewebe »hängen bleiben«, statt den Tumor zur erreichen. 44 mit dem umgebenden Körpergewebe und den Organen, in die sie einwachsen. Zudem zeigen sie vielfältige Reaktionen auf Arzneistoffe, die sich gegen sie richten. DNA-Sequenzierungen und Proteincharakterisierungen machen es möglich, dass wir Tumorzellen heute genauer un­ tersuchen können als je zuvor. Sie liefern enorme Datenmen­ gen, die erst ansatzweise ausgewertet sind. Um diese Kom­ plexität zu durchdringen – etwa um zu verstehen, warum Arzneistoffe wie Bevacizumab nicht immer wie erwartet wir­ ken –, nutzen Forscher seit einiger Zeit Computermodelle. Diese machen sichtbar, wie Tumoren wachsen, liefern Ansät­ ze für mögliche Gegenmaßnahmen und simulieren, welche Folgen ein bestimmter medizinischer Eingriff hat. »Wir besitzen heute unvorstellbar viele Informationen über Krebserkrankungen«, sagt Jasmin Fisher, Neuroimmu­ nologin an der britischen Cambridge University. »Doch an­ gesichts der enormen Komplexität der Daten erkennen wir darin keine sinnvollen, systematischen Zusammenhänge.« Im Faktengestrüpp verfangen Auch der Biophysiker James Glazier, Direktor am Institut für Biokomplexität der Indiana University in Bloomington (USA), meint, die Informationsflut in der Krebsforschung berge die Gefahr, sich in Einzelergebnissen zu verlieren. On­ kologen konzentrierten sich immer mehr auf Gene und Pro­ teine, doch um eine Krebserkrankung zu verstehen und wirksam zu bekämpfen, müsse sie als ein System aufgefasst werden und nicht bloß als eine Menge bestimmter Zellaktivi­ täten. Glazier zufolge liegt der wissenschaftliche Fokus zu­ nehmend darauf, Genome und Signalübertragungswege von individuellen Zellen zu analysieren – was dazu führe, dass viele Forscher das Gesamtsystem aus dem Blick verlieren. »Selbst mit der genauesten Kenntnis darüber, was innerhalb einer einzelnen Krebszelle geschieht, lässt sich niemals vor­ hersagen, wie sich ein Tumorgewebe verhalten wird«, sagt der Biophysiker. »Die Komplexität von Geweben entsteht großteils durch die Wechselwirkungen der Zellen unterei­ nander und mit dem extrazellulären Umfeld.« Einer von denen, die Krebs als ganzheitliches System be­ trachten möchten, ist Philip Maini, Leiter des Zentrums für SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Simulierte Wucherung Wenn ein Tumor wächst, veranlasst er nahe gelegene Blutge­ fäße dazu, Ausläufer zu ihm hin zu entsenden. Dadurch be­ kommt er Anschluss ans Gefäßsystem – und somit Sauerstoff und Nährstoffe. Dieser Prozess, die »Angiogenese«, lässt sich im Tag 15 Computermodell abbilden. Unten sind die Ergebnisse einer sol­ chen Simulation gezeigt. Daraus geht hervor, dass der wuchern­ de Tumor zunehmend mehr Gefäße an sich zieht und dabei das Adernetzwerk in seiner Umgebung massiv verändert. Tag 75 Tag 30 800 600 Blutgefäße 400 Tumor neu gebildete Adern (lila) 200 0 500 0 200 400 600 entwickelter Tumor mit Anschluss ans Gefäßsystem 800 µm SHIRINIFARD, A. ET AL.: 3D MULTI-CELL SIMULATION OF TUMOR GROWTH AND ANGIOGENESIS. IN: PLOS ONE 4, E7190, 2009, FIG. 4 Mathematische Biologie an der University of Oxford (Eng­ land). Er versucht im Computermodell abzubilden, wie Arz­ neistoffe wirken, die sich gegen das Wachstum von Tumor­ blutgefäßen richten. Diese Medikamente entfalten ihren größten Nutzen dann, wenn sie mit einer Strahlenbehand­ lung oder einer weiteren Chemotherapie kombiniert wer­ den. Mainis Modell zeigt, dass ihre Effektivität wesentlich von der Dichte des Gefäßnetzes innerhalb des Tumors ab­ hängt. Computermodelle können nicht nur dazu dienen, die Wir­ kung eines Medikaments vorherzusagen, sie können auch mögliche Angriffspunkte für neue Arzneien aufzeigen. Da­ mit lassen sich medizinische Hypothesen prüfen, ohne Tier­ versuche durchzuführen, wie Forscher betonen. »Dieser For­ schungsansatz ist von großer Bedeutung, wenn wir verste­ hen wollen, wie Pharmaka bei komplexen Erkrankungen wirken«, sagt Adriano Henney von der Universität Heidel­ berg, Direktor des Deutschen Netzwerks Systembiologie der Leber, das sich zum Ziel gesetzt hat, Computermodelle des gesamten Organs zu entwickeln. Auf dem Weg hin zu solchen Modellen stellt Jasmin Fisher im Computer nach, welche relevanten Signal- und Stoff­ wechselwege in Zellen existieren, wie diese funktionieren und auf welche Weise ihre Wechselwirkungen untereinander das Schicksal der Zellen bestimmen. »Wir betrachten biologi­ sche Prozesse so, als wären es Computerprogramme. Wir fra­ gen also: Wie sieht der Algorithmus aus, der über das Verhal­ ten der Zelle bestimmt?« Fishers Modellierungsansatz setzt Erkenntnisse über zelluläre Prozesse in formale Instruktio­ nen um, die ein Computer ausführen kann. Stammzellen beispielsweise beschreiten unterschiedliche Differenzie­ rungswege, je nachdem ob sie sich zu Blut- oder Herzmuskel­ zellen entwickeln. Dabei laufen die Veränderungen teils si­ WWW.SPEK TRUM .DE multan ab und können über Rückkopplungssignale beein­ flusst werden, die eine Zelle während ihrer Reifung erhält. Fishers Programm erlaubt den Forschern, diese Prozesse vir­ tuell zu manipulieren – etwa indem sie die Abfolge von Er­ eignissen ändern oder bestimmte Signalstärken reduzieren – und anschließend zu prüfen, ob das so modifizierte Modell im Einklang mit experimentellen Befunden steht. Die große Herausforderung dabei lautet, so Maini, für jede Maßstabsebene den richtigen mathematischen Ansatz zu finden. So könne man intrazelluläre Vorgänge wie die Her­ stellung eines Proteins häufig am besten mit Differenzial­ gleichungen beschreiben, während sich Wechselwirkungen der Zellen untereinander eher mit regelbasierter Program­ mierung darstellen lassen. Kristallisieren und schäumen Um das Problem der verschiedenen Maßstabsebenen zu be­ wältigen, hat Glazier eine quelloffene Modellierungssoft­ ware namens CompuCell3D entwickelt. Sie behandelt sowohl Zellbestandteile als auch Zellen und ihre Verbände als diskre­ te Objekte. Der Anwender kann verschiedene Daten in ein Zellmodell einfließen lassen – etwa wie die Zelle auf chemi­ sche Reize reagiert oder wie stark sie an anderen haftet – und dann beobachten, wie sich diese Vorgaben auf das jeweils be­ trachtete System auswirken. Glazier hatte schon im Jahr 2000 mit der Entwicklung der Software begonnen. Sie basiert auf einer Vorgängerversion, die simulierte, wie bestimmte Kristallstrukturen wachsen. Dabei waren ihm Ähnlichkeiten zwischen dem Entstehen kristalliner Strukturen und der Blasenbildung in schäumen­ den Flüssigkeiten aufgefallen. Zudem stellte sich heraus, dass seine Software auch Wechselwirkungen zwischen Zellen in einem heranwachsenden Embryo beschreiben kann. 45 Die Modelle, die Glazier, Fisher und andere entwickelt ha­ ben, versetzen selbst Krebsbiologen mit geringen Program­ mierkenntnissen in die Lage, eigene Computersimulationen durchzuführen. »Mit unserer quelloffenen Software wollten wir von Anfang an erreichen, dass jeder Wissenschaftler da­ mit maßgeschneiderte Simulationen erstellen kann, die dann wiederum andere Forscher nutzen und an ihre jeweili­ gen Erfordernisse anpassen können«, erläutert Glazier. Eine Nutzeroberfläche mit vereinfachter Darstellung der zu mo­ dellierenden biologischen Prozesse sorgt dabei für leichte Bedienbarkeit. Der Anwender kann virtuelle Zellen, Proteine oder Gene per Mausklick auswählen und wie gewünscht in die Simulation einbauen. Der Computerwissenschaftler Nicholas Flann und der Biologe Gregory Podgorski, beide von der Utah State Univer­ sity (USA), modellieren mit Hilfe von CompuCell3D, wie ein Tumor die Bildung neuer Blutgefäße anregt. Sie wollen he­ rausfinden, wie man diese so genannte Angiogenese hem­ men und das Krebswachstum eindämmen kann. Schon mi­ kroskopisch kleine Tumoren sondern ein Protein namens VEGF ab (Vascular Endothelial Growth Factor, auf Deutsch etwa: Wachstumsfaktor für die innerste Zellschicht der Ge­ fäßwände). Es veranlasst nahe gelegene Blutäderchen dazu, in Richtung der Geschwulst auszusprossen. Im lebenden Or­ ganismus dauert dieser Prozess ein bis drei Tage – im Com­ puter spielt er sich binnen weniger Minuten ab. Hunderttausend Wege zum Aushungern Flann und Podgorski statteten ihr Modell mit 40 biochemi­ schen Parametern aus. Dazu gehörten etwa die Fähigkeit ­einer Zelle, einen bestimmten Wachstumsfaktor zu erken­ nen, oder die Stärke, mit der Ausläufer von wachsenden Blut­ gefäßen an Stromazellen im benachbarten Gewebe binden. Die Software wählte jeweils drei Parameter aus, modifizierte einen davon nach dem Zufallsprinzip und prüfte, ob diese Veränderung das Blutgefäßwachstum im Modell verstärkt oder abschwächt. Insgesamt ergaben sich 100 000 mögliche Kombinationen von Parametern, bei denen die Nährstoff­ versorgung des Tumorgewebes eingeschränkt ist. Um die Er­ gebnisse statistisch abzusichern, wurde jede Kombination 128-mal getestet. Die Berechnungen liefen parallel auf zwei großen Computernetzwerken der US National Science Foun­ dation und der US Air Force. Dass das Modell sinnvolle Ergebnisse liefert, zeigte sich zunächst daran, dass es auf bekannte Angriffspunkte des ­Tumors hinwies – nämlich auf Signalwege, für deren Hem­ mung es bereits Medikamente gibt. Es legte jedoch auch bis­ lang unbekannte Therapieansätze offen. Laut den Berech­ nungen kann etwa eine veränderte Haftwirkung zwischen dem Vorderende von aussprossenden Blutgefäßen und dem umgebenden Zellverband dazu führen, dass die Äderchen gewissermaßen im Gewebe hängen bleiben, statt in den Tu­ mor einzuwachsen. Möglicherweise ließen sich neue Medi­ kamente entwickeln, die genau darauf abzielen, meint Flann. 46 Angesichts des komplexen Geschehens im Tumor, an dem sich hunderte Zellen beteiligen, hätte die alleinige Kenntnis der Krebs auslösenden Genmutation oder bestimmter Stoff­ wechselwege in entarteten Zellen niemals zu dieser Entde­ ckung geführt – davon ist Flann überzeugt. Computermodelle ermöglichen virtuelle Experimente, deren Durchführung im Labor zu teuer und Zeit raubend wäre. Forscher können damit neue Hypothesen testen oder die Schritte nachvollziehen, die zu einem bestimmten biolo­ gischen Effekt führen. Doch die Modelle müssen experimen­ tell überprüft werden, weil sie nur von wissenschaftlichem Wert sind, wenn sie das reale Krankheitsgeschehen zutref­ fend abbilden. Maini warnt vor Computersimulationen, die sich auf unvereinbare Daten stützen – etwa aus Experimen­ ten mit Mäusen, Ratten und menschlichen Zellen. Sie könn­ ten die Forscher in die Irre führen. So hungern die angio­ genesehemmenden Arzneistoffe, die er untersucht hat, Tu­ moren bei Mäusen auf andere Weise aus als bei Menschen. Deshalb müsse man die entsprechenden experimentellen Befunde voneinander trennen und könne sie nicht in dassel­ be Modell einfließen lassen. Bei allen Bedenken sind sich die meisten Wissenschaftler darüber einig, dass Computermodelle neue Möglichkeiten eröffnen, um komplexe Tumorerkrankungen zu erforschen. »Sie erlauben es, mit den riesigen Datenmengen umzuge­ hen, die wir angesammelt haben – auf eine Weise, die unser Gehirn nicht beherrscht«, sagt der Mediziner und System­ biologe Adriano Henney. »Dabei wenden wir Verfahren aus den Ingenieurwissenschaften, der Physik, Chemie und dem Maschinenbau auf biologische Systeme an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir die Datenfülle der heutigen Lebens­ wissenschaften bewältigen sollen, wenn nicht mit den Prin­ zipien der Mathematik und Physik.« Ÿ DER AUTOR Neil Savage ist Wissenschafts- und Technologiejournalist. Er lebt in Lowell, Massachusetts (USA). QUELLEN Fisher J., Henzinger T. A.: Executable Cell Biology. In: Nature Biotechnology 25, S. 1239 – 1249, 2007 Stamper I. J. et al.: Modelling the Role of Angiogenesis and Vasculogenesis in Solid Tumour Growth. In: Bulletin of Mathemati­ cal Biology 69, S. 2737 – 2772, 2007 Swat, M. H. et al.: Multi-Scale Modelling of Tissues Using CompuCell3D. In: Methods in Cell Biology 110, S. 325 – 366, 2012 Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1199282 © Nature Publishing Group www.nature.com Nature Outlook 491, S. 62 – 63 SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 MODELLENTWICKLUNG II Und nun zur aktuellen Krebsvorhersage … Komplexe mathematische Modelle helfen Forschern zunehmend zu verstehen, wie sich Krebszellen und Tumoren evolutionär entwickeln. Damit liefern sie ihnen unter anderem neue Ansätze, Resistenzen gegen Chemotherapeutika zu überwinden. Von Katharine Gammon N icht nur bei Lebewesen, auch bei Tumoren kann man von Evolution und ökologischen Bedingun­ gen reden: Die Kräfte der Variation und Selektion, die auf Organismen in ihrer Umwelt einwirken, bestimmen ebenso die Entwicklung von Krebszellen in ih­ rem Inneren. »Viele Aspekte von Krebserkrankungen lassen sich mit der Evolutionstheorie erklären«, meint etwa Carlos Maley, Bioinformatiker und Evolutionsbiologe an der Uni­ versity of California in San Francisco. »Wenn wir in diesen Evolutionsprozess gezielt eingreifen, können wir ihn wo­ möglich aufhalten oder in eine Richtung lenken, wo er leich­ ter beherrschbar ist.« Zu diesem Zweck wildern nun zuneh­ mend Mathematiker auf ureigensten Gebieten der Biologen und entwickeln immer aufwändigere, detailgetreue Modelle der Ökologie und Evolution von Tumoren. Der wichtigste Grund für Rückschläge bei der Krebs­ therapie ist die Heterogenität der Zellen einer Geschwulst. Bei einer großen Population von sehr unterschiedlichen AUF EINEN BLICK KREBS IM COMPUTER 1 Mathematiker revolutionieren das Verständnis von Tumor­ erkrankungen: Ihre Modelle stellen grundlegende Vor­ stellungen zu den Krankheitsprozessen bei Krebs sowie zu den optimalen Therapien in Frage. 2 Die Simulationen helfen unter anderem, klinische Studien drastisch zu beschleunigen, und ermöglichen ein besseres Verständnis der biologischen Evolution von Tumorzellen und ihrer Anpassung an die Bedingungen ihrer jeweiligen Umgebung. 3 Damit lässt sich unter anderem die Entwicklung eines Krebses vorhersehen und sogar in gewünschte, leichter therapierbare Richtungen beeinflussen. WWW.SPEK TRUM .DE Krebszellen wird es immer einige geben, die eine Chemo­ therapie oder Bestrahlung überleben und die Erkrankung wiederaufflammen lassen. Daher erstellen Mathematiker Modelle, die berechnen sollen, in welche Richtung sich eine mutierende Tumorzelle entwickeln wird – in der Hoffnung, diese Evolution rechtzeitig aufzuhalten. Mit Hilfe solcher Modelle können Forscher inzwischen das Verhalten einiger der gefährlichsten Tumoren vorhersa­ gen. Bislang prognostizieren Ärzte etwa den Krankheitsver­ lauf beim malignen Gliom, einem aggressiven Hirntumor, auf Grundlage bildgebender Verfahren sowie der Untersu­ chung von Gewebeproben. Doch die Einstufung nach diesem System stimmte vielfach nicht mit der tatsächlichen Bösar­ tigkeit überein, die der Krebs dann zeigte. Daher entwickel­ ten Wissenschaftler der University of Washington in Seattle und vom Moffitt Cancer Center in Tampa, Florida, ein mathe­ matisches Modell, in das Zellteilungsrate, Invasionsneigung und Veränderungen der äußeren Erscheinung der Geschwüls­ te einflossen. Das Modell verknüpfte dazu Daten aus Studien mit bildgebenden Verfahren mit anderen Simulationen, die das Wachstum von Blutgefäßen und die direkte Umgebung des Tumors berücksichtigen. Damit war es nicht nur in der Lage, das Wachstumsmuster der Wucherung bei jedem Pati­ enten individuell nachzuvollziehen, sondern auch ihre wei­ tere Entwicklung zuverlässig vorherzusagen, womit sich das bisherige Einstufungssystem verbessern ließ. Solche Simulationen beginnen sich auf die klinische Pra­ xis auszuwirken. Alexander Anderson, ein Spezialist für ma­ thematische und Computermodelle am Moffitt Center, der an der Studie zum malignen Gliom mitarbeitete, nutzt das Modell dazu herauszufinden, wie sich Tumoren bewegen und ausbreiten. Seine Arbeitsgruppe entwickelte Computer­ modelle, die sich auf die Veränderungen einzelner Krebs­ 47 ALEXANDER R. A. ANDERSON, INTEGRATED MATHEMATICAL ONCOLOGY, MOFFITT CANCER CENTER Das Innere eines Tumors lässt sich per ­Computer visualisieren. zellen konzentrieren. Dazu griffen die Forscher auf klinische Daten von 650 Prostatakrebspatienten zurück: Sie unter­ suchten Dünnschichtschnitte jedes Tumors auf die Anwe­ senheit von 250 charakteristischen Molekülen hin – so ge­ nannten Markern. Aus den gewonnenen Daten baute Ander­ son dann ein Modell und erstellte damit digitale Versionen jeder einzelnen Biopsie. Wenn sein Team das Modellszenario zeitlich und räumlich weiterlaufen lässt, erhält es einen Er­ wartungswert zur Aggressivität des Tumors. Besonders gezielt wirkende Tumortherapien erhöhen die Gefahr von Resistenzen Die Gefährlichkeit der individuellen Geschwulst zuverlässig einschätzen zu können, ist gerade beim Prostatakarzinom wertvoll, denn viele dieser Tumoren werden unnötigerweise chirurgisch entfernt oder mit zu drastischen Mitteln thera­ piert (siehe den Beitrag ab S. 28). Um die Vorhersagefähigkeit des Modells zu ermitteln, testet Andersons Team es nun zu­ sammen mit einem Bio­logen an Mäusen. Falls es sich hier be­ währt, wäre es das erste Computermodell, das die Aggressivität eines Tumors vor ­Beginn der Therapie prognostizieren kann. Damit würde es Krebsmedizinern eine willkommene Hilfe­ stellung bei der Auswahl der geeignetsten Therapie geben. Daneben beeinflussen mathematische Modelle auch, wie manche Wissenschaftler über alternative Ansätze der Krebs­ therapie nachdenken. Denn aus den neuen Erkenntnissen zur Tumorevolution zogen manche Forscher einen auf den ers­ ten Blick überraschenden Schluss: Bei den meisten Krebser­ krankungen können die aktuellen »gezielten« Therapien gar nicht funktionieren. Wenn Wirkstoffe zum Einsatz kommen, die an ganz spezifischen mutierten Proteinen ansetzen, erläu­ tert Anderson, »müssen dem Modell zufolge unvermeidlich Resistenzen auftreten, weil es auch andere Wege gibt, die zu 48 denselben Merkmalen führen«. Zellen, welche die erste The­ rapie überleben, können sich so weiterentwickeln, dass sie am Ende genauso bösartig sind wie zuvor, jetzt aber unempfind­ lich gegen den eingesetzten Wirkstoff. Die Erkenntnisse zur evolutionären Dynamik von Tumoren legen nahe: Der Ver­ such, einen Krebs vollständig abzutöten, fördert zwangsläu­ fig Therapieresistenzen, was wiederum die Überlebenschan­ cen des Patienten reduziert. Die Computermodelle zeigen, dass es bessere Behandlungsstrategien geben könnte. Einige Forscher möchten etwa die Programmierung der Krebszellen verändern und gegen diese selbst wenden. Ro­ bert Gatenby, Onkologe am Moffitt Cancer Center, sucht nach grundlegenden Prinzipien, die sich in dem Sinn therapeu­ tisch nutzen lassen. Eine Möglichkeit, Angriffe auf Tumor­ zellen zu erleichtern, besteht darin, diese einander ähn­licher zu machen. Je mehr sich die Zellen in ihren Merkmalen glei­ chen, umso höher ist die Chance, dass die Behandlung an­ schlägt, und umso geringer das Risiko, dass sie therapie­ resistent werden. Kurz gesagt sucht Gatenby nach Tricks, die eine Entwicklung von Resistenzen verhindern. Mathemati­ sche Modelle ermöglichen es ihm und anderen Forschern, die richtigen Kombinationen von Wirkstoffen zu finden so­ wie die beste zeitliche Abfolge der Verabreichung, um das ­Risiko einer Resistenzbildung zu minimieren. In einer an Mäusen durchgeführten Studie zum so ge­ nannten tripelnegativen Brustkrebs legten die Forscher an­ hand von Computermodellen fest, wann sie welche Medika­ mente in welcher Reihenfolge einsetzen. Bei dieser schwer therapierbaren Tumorart fehlen den Zellen drei Rezeptor­ typen, und zwar solche für Östrogen, Progesteron sowie den Epidermiswachstumsfaktor. Die Ergebnisse der Studie legen nahe: Verabreicht man den Tieren Östrogen, beginnt sich der Krebs an eine Umgebung mit hoher Östrogenkonzentration SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 anzupassen und entsprechende Rezeptoren auszubilden. Durch diese zielgerichtete Beeinflussung der Tumorevolu­ tion wird der Krebs von Östrogen abhängig und so beispiels­ weise mit dem bewährten Medikament Tamoxifen, einem Antiöstrogen, behandelbar. Die Therapie einer Krebserkrankung wäre wesentlich ­einfacher, wenn die Onkologen genau vorhersagen könnten, wie diese auf bestimmte Medikamente anspricht. Nach wie vor müssen die Ärzte einen andauernden Kampf gegen ei­ nen sich fortlaufend weiterentwickelnden Feind führen, so Gatenby. Doch er sieht einen Ausweg: »Wir müssen die ge­ samte Vorgehensweise wie bei einem Schachspiel strategisch vorausplanen und mit der ersten Behandlung eine evolutio­ näre Reaktion der Krebszellen provozieren, wogegen die zweite Therapie wirkt.« Evolutionäre Schachzüge Gatenbys Team nutzt ein spieltheoretisches Modell, in dem jede Therapie ein Spielzug ist, der die wahrscheinlichste ­Reaktion des Tumors vorwegnimmt. Es zeigt, dass sich die Geschwülste zwar an die jeweilige Situation adaptieren, aber nicht zu vorausschauenden Anpassungen in der Lage sind. Das gibt den Onkologen einen entscheidenden Trumpf in die Hand: Sie können die Umwelt des Tumors so manipulieren, dass er sich leichter bekämpfen lässt. Das Computer­modell ermöglicht den Forschern, Therapien zu vermeiden, die zu mehr Resistenzen führen würden, und grenzt damit die ­Auswahl der Medikamente, Dosierungen und Behandlungs­ intervalle auf die erfolgversprechendsten ein. Das spieltheoretische Modell trug auch dazu bei, die Er­ gebnisse einer kürzlich durchgeführten klinischen Studie an Patienten mit aggressivem Lungenkrebs zu erklären, die wegen eines Rückfalls mit einer herkömmlichen Chemo­ therapie und zusätzlich mit einem Impfstoff gegen das ­Tumorsuppressorprotein p53 behandelt wurden. Diese über­ lebten etwa vier Monate länger als solche, die nur die Chemo­ therapie ohne Impfung erhielten. Der Anteil der Patienten, die mehr als ein Jahr überlebten, verdoppelte sich sogar. »Der Tumor reagierte zwar evolutionär erfolgreich auf die eine Therapie, doch diese Anpassung machte ihn empfindlicher gegen die andere Behandlung«, erläutert Gatenby. Diese Strategie bezeichnet man als evolutionäre Zwickmühle. »Wir behaupten nicht, dass sich das Spiel ewig weitertreiben lässt, doch wenn wir mit solchen Schachzügen die Überlebenszeit der Patienten um fünf oder zehn Jahre verlängern könnten, so wäre dies schon ein enormer Fortschritt.« Die mathematische Modellierung hilft zudem, die klini­ sche Erprobung von Medikamenten zu beschleunigen. Sämt­ liche verfügbaren Wirkstoffe in allen denkbaren Kombina­ tionen, Dosierungsvarianten und Reihenfolgen zu prüfen, würde Millionen verschiedener Studien erfordern. So viele Probanden und Geldmittel stehen gar nicht zur Verfügung. Stattdessen verwenden die Forscher Simulationen, mit de­ nen sie die gleichen Informationen aus lediglich einer Hand voll Experimenten gewinnen. Solche Modelle berechnen die WWW.SPEK TRUM .DE Mutationsrate und das Risiko einer Resistenzbildung und schätzen sogar die Wahrscheinlichkeit des Ansprechens indi­ vidueller Tumoren auf eine Therapie ab. Franziska Michor, Biostatistikerin an der Harvard School of Public Health in Boston, Massachusetts, hat ein Modell er­ stellt, das optimale Dosierungen für die Therapie von Lun­ genkarzinomen berechnet. Sie berücksichtigte dafür die Ver­ mehrungs- und Absterberaten verschiedener Zelltypen, ihre Mutationsneigung sowie die Geschwindigkeit, mit der das Medikament abgebaut wird. Ihr Computermodell bestimmt daraus die Wahrscheinlichkeit der Resistenzbildung für ver­ schiedene Dosierungsstrategien. »Letztlich werden wir die Daten durch Experimente mit Mäusen und Untersuchungen mit Patienten überprüfen müssen, doch die Pilotstudien können wir am Computer durchführen«, erläutert Michor. Das Modell kann alle denkbaren Kombinationen in wenigen Sekunden prüfen. »Das ist der große Vorteil der Mathema­ tik«, sagt sie. »Eine Reihe klinischer Studien dauert eine Ewig­ keit, auf dem Computer geht alles sehr schnell.« Ende 2013 startete das Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York die erste klinische Studie, die auf Michors Modellrechnungen fußt. Die Forscher prüfen dabei Dosie­ rungskombinationen, die laut Simulation am besten geeig­ net sind, eine Resistenzbildung beim nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom zu vermeiden oder zumindest hinaus­ zuzögern. Diese Form des Lungenkrebses kann man in man­ chen Fällen zunächst mit so genannten EGFR-Tyrosinkinase­ hemmern gut behandeln; jedoch nimmt die Wirksamkeit meist etwa ein Jahr nach Beginn der Therapie dramatisch ab. Laut Michors Modell lässt sich die Resistenzbildung mit Hilfe eines optimierten Dosierungsschemas immerhin um ein weiteres Jahr verschieben. Ÿ DI E AUTORI N Katharine Gammon ist freie Wissenschafts­ journalistin in Santa Monica, Kalifornien. QUELLEN Basanta, D. et al.: Exploiting Evolution to Treat Drug Resistance: Combination Therapy and the Double Bind. In: Molecular Pharmaceutics 9, S. 914 – 921, 2012 Chmielecki, J. et al.: Optimization of Dosing for EGFR-Mutant Non-Small Cell Lung Cancer with Evolutionary Cancer Modeling. In: Science Translational Medicine 3, 90ra59, 2011 Swanson, K. R. et al.: Quantifying the Role of Angiogenesis in Malignant Progression of Gliomas: In Silico Modeling Integrates Imaging and Histology. In: Cancer Research 71, S. 7366 – 7375, 2011 Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1201689 © Nature Publishing Group www.nature.com Nature 491, S. 66 – 67 49 CHEMOTHERAPIE Nano-Arzneitransporter Konventionelle Chemotherapien haben mitunter schwere Nebenwirkungen. Nanopartikel bieten möglicherweise einen Ausweg: Sie können althergebrachte Wirkstoffe an neue Zielorte bringen und so das gesunde Gewebe schonen. Von Katherine Bourzac W enn Joseph DeSimone Medikamente mittels Nanotechnik herstellt, vergleicht er sich gern mit einem Bäcker. Er mischt Pharmaka mit chemischem »Kuchenteig«, füllt die Mixtur in winzige »Backformen«, lässt sie aushärten und löst anschließend die fertigen Stücke aus der Fassung. Er kann ihnen verschiedenste Formen geben: Scheiben, Würfel, lange Stäbchen, Kringel oder auch eine pollen-, viren- oder erythrozytenähnliche Gestalt. Einen Unterschied gebe es jedoch zum Bäcker, sagt DeSimone, Chemieingenieur an der University of North Carolina in Chapel Hill: Sämtliche Partikel, die er in einem Fertigungsprozess herstelle, seien untereinander völlig identisch – unabhängig vom jeweiligen Rezept. Materialwissenschaftler und Chemiker, die mit Nanotechnologie arbeiten, sind kreativ und pedantisch zugleich. Die Möglichkeit, Partikel nach beinahe beliebigen Vorgaben auf den millionstel Millimeter genau herzustellen, versetzt sie in die Lage, die Funktionen der Teilchen äußerst präzise zu kontrollieren. DeSimones vielgestaltige Partikel können sich beispielweise durch Blutgefäßwände quetschen oder ins Innere AUF EINEN BLICK MEDIKAMENT IN DER MINIVERPACKUNG 1 Nanopartikel als Träger von Arzneistoffen haben großes medizinisches Potenzial. Sie können so gestaltet werden, dass sie ihre Fracht nur in bestimmten Geweben – etwa Tumoren – freisetzen. 2 Nanoverkapselte Wirkstoffe bewähren sich bereits im klinischen Einsatz und zeigen deutlich weniger Nebenwirkungen als in herkömmlicher Darreichung. 3 Forscher arbeiten daran, noch effektivere und gezielter wirkende Nanomedikamente zu entwickeln. Ein viel versprechender Ansatz ist das Stilllegen krebsrelevanter Gene mittels RNA-Interferenz. 50 eines Tumors hineinbohren. Und die Form ist nur eine von vielen Eigenschaften, die sich exakt vorgeben lassen. Nano­ partikel mit spezifischer stofflicher Zusammensetzung, Größe oder Oberflächenladung können Wirkstoffe an bisher nicht erreichbare Orte transportieren und sie damit für neue Anwendungen zugänglich machen. Solche Wirkstoffträger dringen hochselektiv in Tumorgewebe ein oder schützen ihre therapeutische Fracht davor, noch vor dem Erreichen des Ziels abgebaut zu werden. Damit haben Medikamente auf Basis von Nanotechnik das Potenzial, eines der größten Probleme der Krebsmedizin zu lösen: hinreichende Mengen eines Arzneistoffs an die gewünschte Stelle im Körper zu bringen, und zwar möglichst ohne Nebenwirkungen oder Resistenzen hervorzurufen. Je mehr die Forscher über das Mikromilieu von Tumoren herausfinden und je besser sie lernen, Trägerpartikel im Nanometermaßstab zu entwickeln und herzustellen, desto näher kommen sie diesem Ziel. Dabei setzen sie manchmal Ansätze um, die bisher unrealisierbar schienen – etwa Wirkstoffe, die ihre Eigenschaften verändern, je nachdem, wo im Körper sie sich befinden. Oder Präparate, die auf ein Zielprotein wirken, das zuvor als pharmakologisch nicht beeinflussbar galt. Einige Labors arbeiten daran, Prinzipien aus der Robotertechnik und den Computerwissenschaften auf Medikamente zu übertragen. So sollen Nanopartikel mit Arzneimittelfracht untereinander kommunizieren, mit dem Ziel, dass sie sich stärker im Tumor anreichern. Medizinische Verfahren auf Basis von Nanotechnologie haben sich in der Krebsmedizin bisher vor allem dadurch bewährt, dass sie potenziell giftige Wirkstoffe von gesundem Gewebe fernhielten, meint Rakesh Jain. Der Tumorbiologe arbeitet am Massachusetts General Hospital in Boston (USA) und ist an verschiedenen Pharmafirmen beteiligt. Viele Arzneien, erläutert Jain, seien zu giftig, um sie in höheren Dosen zu verabreichen oder mit anderen ebenfalls toxischen Sub­ SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Ein rekonstruiertes 3-D-Bild zeigt, wie sich 30 Nanometer große Nanopartikel (grün) in einem Tumor der Bauch­ speicheldrüse anreichern. CABRAL ,H IN: NAT . ET AL.: ACCU URE N MULA ANOTE CHNO TION OF SUBLOGY 6, 100 NM S. 815– POLYM 823, 20 ERIC M 11, FIG. ICELLE 4D S IN POORL Y PERM EABLE TUMO URS DEPEN DS ON SIZE. stanzen zu kombinieren. Obwohl sie möglicherweise bestimmte molekulare Zielstrukturen hochspezifisch angreifen, wirken sie kaum gewebeselektiv – sie beeinflussen sowohl gesundes als auch entartetes Gewebe, was schwere Nebenwirkungen verursachen kann. Mit Nanopartikeln lässt sich dieses Problem umgehen. Der Wirkstoff Doxorubicin beispielsweise wird mit Erfolg gegen verschiedene Krebsarten eingesetzt, kann jedoch lebensbedrohliche Schäden am Herzmuskel hervorrufen. Einen ihrer ersten Triumphe erlebte die Nanomedizin, als 1995 das Medikament »Doxil« zugelassen wurde. Dabei handelt es sich um nanometergroße Hüllen aus Fettmolekülen, die Doxorubicin enthalten. Sie verhindern sehr effizient, dass der Stoff in den Herzmuskel eindringt. Bereits Mitte der 1980er Jahre erkannten Forscher: Partikel mit einem Durchmesser von rund 100 Nanometern sind zu groß, um die Wand gesunder Blutgefäße zu passieren. Sie treten jedoch oft aus Tumorblutgefäßen aus, denn diese Adern sind überwiegend unreif, chaotisch strukturiert und entsprechend löchrig. Die Erkenntnis gab den Anstoß dafür, das Medikament »Doxil« zu entwickeln. Um den Herzmuskel zu schützen, verpacken die Forscher den Wirkstoff in Lipidbläschen mit einem Durchmesser von etwa 100 Nanometern. Hierfür schütteln sie die Lipide zusammen mit dem Wirkstoff in wässriger Lösung, so dass sich die Fettmoleküle kugelförmig um das Doxorubicin herum anordnen. Um diese Partikel vor dem Zugriff des Immunsystems zu schützen, hüllen die Forscher sie in einen Mantel aus Polyethylenglykol. Die so modifizierWWW.SPEK TRUM .DE ten Partikel sammeln sich nach dem Verabreichen im Tumor des Patienten an, wo das Medikament allmählich aus ihnen entweicht und nahe gelegene Zellen angreift. Das Risiko einer eingeschränkten Herzfunktion mit Blutstau beträgt bei der Doxil-Therapie nur etwa ein Drittel desjenigen bei der Gabe von unverkapseltem Doxorubicin. »Für die Patienten bedeutet das eine grundlegende Verbesserung der Lebensqualität«, sagt Rakesh Jain. Doch Wirkstoffe aus gesunden Geweben fernzuhalten, ist meist deutlich einfacher, als sie gezielt in erkrankte hineinzubekommen. Die Doxil-Partikel werden auf Grund ihrer Größe passiv daran gehindert, in gesundes Gewebe einzutreten – doch sie sind nicht in der Lage, aktiv in den Tumor einzudringen. Stattdessen sammeln sie sich in den Randzonen der Geschwulst an. Das sei der Grund dafür, so Jain, dass nanopartikelverkap­ selte Medikamente die Überlebenszeit der Patienten bislang nur geringfügig verbesserten, verglichen mit konventionellen Darreichungsformen. Mittlerweile werden deutlich raffiniertere Nanomedikamente entwickelt als Doxil, auch wenn viele davon die Grundkonstruktion einer kugelförmigen Hülle mit eingeschlossenem Pharmakon beibehalten. Um die Freigabe des Wirkstoffs am Zielort zu verbessern, bemühen sich Unternehmen wie BIND Therapeutics (Cambridge, Massachusetts) darum, weitere Eigenschaften der Partikel zu optimieren, etwa deren elektrische Ladung, chemische Zusammensetzung und Form. Geschäftsführer Scott Minick beschreibt die Arbeitsweise von BIND als »medizinisches Nanoingenieurswesen«. Im Gegen51 satz zu Doxil, das einfache Lipidmoleküle als Trägersubstanz nutzt, funktionieren die Nanomedikamente von BIND auf Basis von Polymeren, deren Eigenschaften leichter zu modifizieren sind. Dadurch lassen sich die wirkstoffbeladenen Hüllen besser an bestimmte Zielorte dirigieren, und es wird möglich, zu kontrollieren, wie schnell sie ihre Fracht freisetzen. Zudem greifen die Polymerpartikel Krebszellen gezielt an, indem sie an deren Oberflächenmoleküle binden. Das am weitesten fortgeschrittene Präparat des Unternehmens, BIND-014, besteht aus 100 Nanometer großen Polymerkügelchen, die mit Docetaxel beladen sind – einem Wirkstoff, der Zellen während der Teilung abtötet. Wie bei Doxil sorgt auch bei BIND-014 die Größe dafür, dass die Partikel nur Wände von Tumorblutgefäßen passieren. Anders als bei Doxil ist jedoch das Innere der Kügelchen so konstruiert, dass sie das Medikament kontrolliert freisetzen. Ihre Außenhülle enthält zwei zusätzliche Bestandteile: Polyethylenglykol als Tarnkappe gegenüber dem Immunsystem sowie Moleküle, die sich spezifisch an Oberflächenstrukturen von Tumorzellen binden (siehe Kasten S. 54). Unerwarteter Erfolg Die ersten Ergebnisse einer klinischen Phase-I-Studie mit BIND-014 seien viel versprechend, meint Scott Minick. »Die Patienten in dieser Studie sind im Endstadium ihrer Krebserkrankung, und wir waren eigentlich nicht davon ausgegangen, bei ihnen eine nachweisbare Wirkung des Medikaments festzustellen.« Dennoch hätten sich die Tumoren bei 2 von 17 Patienten nach Gabe des Präparats verkleinert. Nanomedikamente zu entwickeln, die Wände von Tumorblutgefäßen passieren können, ist nur einer von vielen Schritten beim Transport von Wirkstoff in die Geschwulst hinein. Obwohl sich ein Partikeldurchmesser von 100 Nanometern in vielerlei Hinsicht bewährt hat, ist dies keine optimale Größe. »Wenn ein so großes Teilchen den Blutstrom verlässt, bleibt es schnell im umgebenden Gewebe stecken, dringt also kaum in den Tumor ein«, sagt Jeffrey Hubbell, Chemieingenieur an der Eidgenössischen Polytechnischen Hochschule in Lausanne, Schweiz. Kleinere Teilchen wären mobiler und böten speziell im Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs und einige Brusttumoren einen Vorteil. Diese Geschwulste sind von einem widerstandsfähigen Netz aus Kollagenfasern durchzogen, das sich für Wirkstoffpartikel als schwer passierbar erweist. Doch Polymernanopartikel mit verlässlichen Eigenschaften herzustellen, die deutlich kleiner sind als 100 Nanometer, ist schwierig. Kazunori Kataoka, Materialwissenschaftler an der Universität von Tokio, entwickelte den ersten Medikamententransporter auf Polymerbasis bereits Mitte der 1980er Jahre. Sein Unternehmen NanoCarrier in Kashiwa hat kürzlich ein Verfahren ausgearbeitet, um 30 Nanometer große Polymerpartikel herzustellen, die Cisplatin transportieren – ein sehr verbreitetes Mittel zur Hemmung der Zellteilung. Zurzeit durchläuft das Nanomedikament eine klinische Phase-II-Studie an Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Cisplatin ist hochgiftig für die Nieren, weshalb die damit behandelten Patienten enorm viel trinken müssen. Kataoka zufolge ist das bei der nanoverkapselten Variante nicht nötig, weil sich die Partikel auf Grund ihrer geringen Größe im Tumor ansammeln statt in der Niere. »Das Nanomedikament hat in unseren klinischen Versuchen bereits viel versprechende Wirkungen gezeigt«, sagt er. In einer kleinen Phase-IStudie habe es die mittlere Überlebenszeit der Patienten mehr als verdoppelt: von fünf auf über zwölf Monate. Auch der Chemieingenieur DeSimone in North Carolina verfolgt ähnliche Ziele: Er sucht nach der optimalen Größe und Form, mit denen seine Nanopartikel möglichst tief in den Tumor eindringen können. »Wir möchten verstehen, wie Tumorzellen an Orte gelangen, wo sie nicht hingehö­ren – und ihnen das nachmachen«, sagt er. Die neu entwickelten Nanopartikel werden in einen Tumor eingebracht. In zielgerichtet applizierten elektromagnetischen Feldern heizen sie sich auf und erwärmen ihre Umgebung. Die Reaktion des Gewebes darauf bewirkt, dass andere, wirkstoffbeladene Partikel sich bevorzugt im Tumor anreichern. 52 1. Einbringen von Gold-Nanostäbchen in die Geschwulst Tumor 2. Verabreichen elektromagnetischer Felder 3. Die Nanostäbchen erwärmen sich und den Tumor. 4. Der Hitzestress löst eine Signal­ kaskade aus, die das Blut gerinnen lässt. Blutgefäß 5. Wirkstoffbeladene Partikel, die im Blutstrom wandern, reichern sich ­daraufhin an der Stelle an. SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT, NACH BOURZAC, K.: CARRYING DRUGS. IN: NATURE 491, S. S58–S60, 2012, FIG. 2 Indirekt kommunizierende Körnchen Übersicht: Laufende klinische Studien zur Nanomedizin Unternehmen Therapeutikum Zusammensetzung Entwicklungsstand Beschreibung Calando Pharmaceuticals CALAA-01 Nanopartikel aus Polymeren, enthalten RNA-Fragmente, die Gene inaktivieren Phase I Die in den Partikeln enthaltene RNA legt in soliden Tumoren Gene still, welche für die Zellteilung benötigt werden. BIND Biosciences BIND-014 Nanopartikel aus Polymeren, enthalten den Wirkstoff Docetaxel und binden spezifisch an Tumorzellen Phase II Die Wirkstoffträger koppeln an ein prostataspezifisches Membranprotein und wirken damit sowohl gegen solide Prostatatumoren als auch deren Metastasen. Nippon Kayaku NK105 Nanopartikel aus Polymeren, enthalten den Wirkstoff Paclitaxel Phase III Ermitteln des progressionsfreien Überlebens (Zeit ohne Fortschreiten der Erkrankung) nach Behandlung von Patientinnen mit metastasierendem oder wiederkehrendem Brustkrebs NanoCarrier Nanoplatin (NC-6004) Nanopartikel aus Polymeren, enthalten den Wirkstoff Paclitaxel Phase I / II abgeschlossen Kombinierte Gabe von Nanoplatin und Gemcitabin, um Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasierendem Bauchspeicheldrüsenkrebs zu behandeln. Ziel: weniger Nierenschäden, verglichen mit einer reinen GemcitabinTherapie Cerulean Pharma CRLX101 säureempfindliche Nanopartikel aus Polymeren, setzen den Wirkstoff Campthotecin im sauren Mikromilieu von Krebszellen frei Phase II In verschiedenen Studien wird geprüft, ob sich CRLX101 zur Behandlung des fortgeschrittenen, nichtkleinzelligen Bronchialkarzinoms beziehungsweise von Eierstockkrebs eignet. Medikamente müssten in der Lage sein, den Tumorzellen überallhin zu folgen. DeSimone hat sich beim Herstellen seiner Nanopartikel von der Halbleiterindustrie inspirieren lassen, die Milliarden winziger Transistoren fertigt. Mit seiner eigenen patentierten Herstellungsmethode kann er gezielt jeweils eine einzige Eigenschaft der Nanopartikel verändern, etwa deren Steifigkeit, und anschließend untersuchen, wie sie durch den Körper wandern. So lässt sich etwa die Frage klären, ob weichere Nanopartikel besser ins Innere von Geschwülsten eindringen. Erbanlagen ausschalten Eine der meistversprechenden Anwendungen für nanoverkapselte Wirkstoffe ist das Abschalten (»Silencing«) von Genen. Dabei werden kleine RNA-Schnipsel verabreicht. Sie blockieren die Aktivitäten von Genen, die für das Tumorwachstum wichtig sind, indem sie deren Boten-RNA abfangen; der Vorgang wird als RNA-Interferenz bezeichnet. Theoretisch können die Forscher RNA-Schnipsel herstellen, die jedes beliebige Gen ausschalten. Noch fehlen aber geeignete Transportvehikel zum Einbringen in den Organismus. Das hat die Entwicklung wirksamer RNA-Therapien bislang verzögert, erklärt William Hahn, Onkologe an der Harvard Medical School in Boston, Massachusetts. Nanopartikel könnten sich als geeignete Träger erweisen und so dem Gen-Silencing zum medizinischen Durchbruch verhelfen. Nanometergroße Vehikel für therapeutische RNA-Stücke zu entwickeln, ist jedoch eine knifflige Angelegenheit. Diese müssen nämlich bis ins Innere der Krebszellen gelangen. Oft werden die Partikel bereits in der Leber aus dem Blutstrom gefiltert. Überwinden sie dieses Hindernis, wartet bereits das nächste auf sie: Sobald sie an die Oberfläche der Tumorzellen binden, stülpt sich die Zellmembran dort nach innen und bildet ein Endosom, ein Membranbläschen, dessen Inneres mittels Protonenpumpen stark angesäuert wird. In dem entstehenden Milieu zersetzen sich die meisten Verbindungen. WWW.SPEK TRUM .DE Die Forscher arbeiten an verschiedenen Tricks, um diese Todesfalle zu umgehen. Der Chemieingenieur Mark Davis vom California Institute of Technology (USA) hat Polymer­ partikel entwickelt, die im Inneren der Endosomen positive Ladungen absorbieren. Dies erhöht den osmotischen Druck im Endosom und lässt es platzen, so dass die therapeutischen RNA-Schnipsel im Zellplasma ankommen, statt vorher abgebaut zu werden. Herkömmliche Arzneistoffe entfalten ihre Wirkung oft, indem sie an Proteine binden und diese inaktivieren. Leider kodieren die meisten krebsrelevanten Gene für Proteine, die mit den verfügbaren Methoden nicht angreifbar sind. Einige dieser Eiweißstoffe »verstecken« sich im Inneren der Tumorzellen, wo sie für therapeutische Antikörper unerreichbar bleiben. Andere bieten auf Grund ihrer äußeren Gestalt kaum pharmakologische Angriffspunkte. Die Nanotechnologie, sagt Davis, könnte helfen, diese Resistenzen zu durchbrechen. Mit geeigneten Trägerpartikeln für therapeutisch wirksame RNAFragmente wäre es nicht mehr erforderlich, die Proteine anzugreifen, da diese gar nicht mehr hergestellt würden. Zudem ließen sich Partikel mit unterschiedlicher RNA-Fracht applizieren, was mehrere krebsrelevante Gene gleichzeitig inaktivierte. »Damit würden wir den Tumor an mehreren Stellen simultan treffen und es ihm somit erschweren, eine Resistenz zu entwickeln«, erläutert Davis. Falls einige Krebszellen während der Therapie mutierten, könnten die Ärzte auf Partikel mit entsprechend angepasster RNA-Fracht umschwenken, so dass auch die neu veränderten Gene stillgelegt würden. Manche Wissenschaftler wollen noch fantasievollere Therapieverfahren entwickeln, indem sie auf Methoden aus der Robotik und Computertechnik setzen. Ein Team um George Church von der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, hat den Prototyp einer molekularen »Schließkassette« entwickelt, die mit Wirkstoff gefüllt ist. Sie besteht aus DNA und gibt ihren Inhalt frei, nachdem sie eine logische Operation ausgeführt hat, ähnlich jenen in der Digitaltech53 Bei dem Nanomedikament BIND-014 handelt es sich um Polymerpartikel, die den zellteilungshemmenden Wirkstoff Docetaxel transportieren und am Zielort freisetzen. Der Überzug aus Polyethylenglykol (PEG) schützt die Partikel vor Angriffen des Immunsystems. Ligandenproteine auf ihrer Oberfläche koppeln an Oberflächenstrukturen von Tumorzellen. nik. Church und seine Kollegen wählten das Erbmolekül als Baustoff, da es vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Mit Hilfe einer Faltungstechnik, die als DNA-Origami bezeichnet wird, nimmt die DNA selbstständig eine fassähnliche Struktur an. Das entstehende Nanogefäß verfügt über molekulare Schlösser und Angeln und öffnet sich, sobald es mit den richtigen Schlüsseln in Kontakt kommt, etwa bestimmten Oberflächenmolekülen auf Krebszellen. Church nennt sein Wirkstoffvehikel aus DNA einen Na­ nobot (verkürzt von Nanoroboter). Bekommt es zwei Eingangssignale präsentiert, nämlich zwei krebsspezifische Zell­ oberflächenmoleküle, generiert es das Ausgangssignal »Öffnen« und setzt den Wirkstoff frei. Kürzlich testete das Team entsprechende DNA-Zylinder, die einen Arzneistoff gegen Krebszellen enthielten. Diese Nanobots verfügten jeweils über zwei »Schlösser«; jedes davon wurde von einer bestimmten Proteinsorte auf der Oberfläche aggressiver Leu­ kämiezellen aktiviert. Die Forscher zeigten, dass die Vehikel bei Kontakt mit Blutkrebszellen aufklappen und ihre Fracht entlassen, nicht jedoch bei Kontakt mit gesunden Zellen. Zwei Schlösser bringen mehr Sicherheit als eins Mit dem Einsatz logisch operierender Nanobots lösen die Wissen­schaftler womöglich ein grundlegendes Problem der Krebstherapie: Die meisten zielgerichteten Therapien nehmen lediglich eine einzige Sorte von Zelloberflächenmole­ külen ins Visier. Das birgt die Gefahr, auch gesunde Zellen zu schädigen, die das entsprechende Oberflächenmerkmal ebenfalls besitzen. Nanopartikel wie die von Church und seinem Team wirken selektiver, da sie von mehreren Zielstrukturen gleichzeitig aktiviert werden müssen, und könnten sich somit als deutlich schonender erweisen. Von der klinischen Anwendung sind sie jedoch noch weit entfernt; schon das Herstellen ausreichender Partikelmengen gestaltet sich schwierig. Logische Operationen sind nicht das Einzige aus der Informationstechnologie, von dem sich Krebsmediziner inspirieren lassen. Die Biomediziningenieurin Sangeeta Bhatia vom Massachusetts Institute of Technology möchte Prinzipien aus der Natur und der Robotik nutzen, um »intelligente« Nanopartikel zu entwickeln, die im Schwarm nach Tumoren suchen. »90 Prozent der krebsbedingten Todesfälle gehen auf Metastasen zurück«, erläutert sie. Diese Tochtergeschwülste zu finden sei schwierig, besonders wenn sie noch klein sind. Bhatia und ihr Team arbeiten daher an therapeutischen Par54 Docetaxel Polymer PEG tikeln, die in der Lage sind, Metastasen aufzuspüren, und diese Information an andere Partikel weitergeben, so dass jene sich am entsprechenden Ort ansammeln. Erste Experimente mit verschiedenen Partikelarten, die indirekt kommunizieren, ergaben eine überdurchschnittliche Wirkstoffanreicherung im Tumor (siehe Kasten auf S. 53). Bhatia möchte diese Strategie ausweiten, in dem sie Gestaltungsprinzipien aus der Robotik nutzt. Wie Ameisen, die einzeln nur zu simplen Tätigkeiten in der Lage sind, in der Masse jedoch einen komplexen Ameisenhügel errichten, lassen sich auch Roboter so programmieren, dass sie gemeinsam eine kollektive Leistung erbringen. Mit Hilfe einfacher Regeln, etwa »halte den größtmöglichen Abstand zu all deinen Nachbarn«, ist es Robotikern gelungen, Minidrohnen wie Bienen im Schwarm fliegen zu lassen. Gelänge es, therapeutisch wirksame Nanopartikel auf ähnliche Weise zu dirigieren, ließe sich die Wirkstoffanreicherung im Tumor vielleicht noch weiter steigern. Die Fähigkeiten der Forscher, Nanopartikel zu produzieren und an neue Anwendungen anzupassen, erweitern sich stetig, und damit die Möglichkeiten der Krebstherapie. Sie könnten eines Tages dazu beitragen, die Behandlung von Krebserkrankungen einerseits weniger belastend und andererseits wirksamer zu gestalten. Ÿ DI E AUTORI N Katherine Bourzac ist Journalistin in San Francisco, Kalifornien. QUELLEN Douglas, S. M. et al.: A Logic-Gated Nanorobot for Targeted Transport of Molecular Payloads. In: Science 335, S. 831 – 834, 2012 Hrkach, J. et al.: Preclinical Development and Clinical Translation of a PSMA-Targeted Docetaxel Nanoparticle with a Differentiated Pharmacological Profile. In: Science Translational Medicine 4, 128ra39, 2012 Jain, R. K., Stylianopoulos, T.: Delivering Nanomedicine to Solid Tumors. In: Nature Reviews Clinical Oncology 7, S. 653 – 664, 2010 von Maltzahn, G. et al.: Nanoparticles that Communicate in vivo to Amplify Tumour Targeting. In: Nature Materials 10, S. 545 – 552, 2011 Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1202112 © Nature Publishing Group www.nature.com Nature 491, S. 58 – 60 SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 BOURZAC, K.: CARRYING DRUGS. IN: NATURE 491, S. S58–S60, 2012, FIG. 3 Ligandenproteine Ein Winzling als Arzneitransporter IMMUNTHERAPIE I Freie Fahrt fürs Immunsystem Tumoren sind in der Lage, die gegen sie gerichtete Immunreaktion zu blockieren. Neue Therapieverfahren sollen diese Bremsen lösen. Von Karen Weintraub Mediziner versuchen, dem Immunsystem freie Fahrt zu verschaffen, damit es gegen Krebs vorgehen kann. Hierfür lösen sie die Bremsen der Immunabwehr mit Hilfe bestimmter Arzneistoffe, so genannter Immuncheckpoint-Inhibitoren. FOTOLIA / MARIA PAZ BOBÓ; BEARBEITUNG: SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT WWW.SPEK TRUM .DE 55 Z uerst war es nur eine Patientin, die wider Erwarten AUF EINEN BLICK am Leben blieb. Sharon, so ihr Name, litt an einem malignen Melanom, also an bösartigem Hautkrebs. DIE HEMMUNG DER HEMMUNG Die Ärzte rechneten mit ihrem baldigen Tod – doch Das Immunsystem verfügt über Mechanismen, um überschieder trat nicht ein. Weitere Melanompatienten kamen hinzu, ßende Abwehrreaktionen zu verhindern – so genannte Checkpoints. Tumoren »missbrauchen« diese Mechanismen, um die deutlich länger lebten, als auf Grund ihrer Diagnose zu die gegen sie gerichtete Immunreaktion zu stoppen. erwarten stand, und nicht nur das: Ihre Geschwülste verklei­ Spezielle Arzneistoffe, die Immuncheckpoint-Inhibitoren, setzen nerten sich dramatisch oder verschwanden sogar ganz. die hemmenden Mechanismen außer Kraft und versetzen Als sich die Erfolgsmeldungen häuften und in klinischen die Körperabwehr so wieder in die Lage, den Tumor anzugreifen. Studien niederschlugen, begann der Onkologe Antoni Ribas Immuncheckpoint-Inhibitoren haben sich in klinischen Studien allmählich zu akzeptieren, dass seine Immuntherapie tat­ als wirksam gegen verschiedene Krebsarten erwiesen. Forsächlich wirkte. Am Anfang hatte nur etwa jeder zehnte scher arbeiten jetzt daran, darauf basierende Therapieverfahren zu entwickeln und zu optimieren. Krebspatient von dem Verfahren profitiert, doch als der Medi­ziner und seine Kollegen es kontinuierlich weiterent­ wickelten, erhöhte sich die Erfolgsquote. Ribas forscht an der University of California in Los Angeles über Tumorimmuno­ logie. Er behandelt dutzende Melanompatienten; viele von Jedd D. Wolchok, Onkologe am Memorial Sloan-Kettering ihnen müssten früheren Prognose zufolge eigentlich schon Cancer Center in New York City, knüpft große Hoffnungen an seit Jahren tot sein. diese Medikamentenklasse. Im Jahr 2013 hätten umfang­ Die Arzneistoffe, die der Onkologe einsetzt, werden als reiche Studien bestätigt, dass Immuncheckpoint-Inhibito­ ­Immuncheckpoint-Inhibitoren bezeichnet. Sie richten sich ren Lungenkrebs eindämmen können. Und auch gegen Tu­ gegen eine tückische Strategie von Tumoren, nämlich das moren der Prostata, Brustdrüse, Niere, des Darms und ande­ Außerkraftsetzen der Immunabwehr. Das Immunsystem rer Organe schienen sie zu wirken. verfügt über eine Reihe von Mechanismen (so genannte Diese viel versprechenden Befunde warfen eine Reihe Checkpoints), die verhindern, dass seine Zellen außer Kon­ weiterer Fragen auf: Wenn bereits die Gabe eines einzigen trolle geraten und gesundes Körpergewebe angreifen. Sie Checkpoint-Inhibitors solche Effekte zeitigen kann, lässt funktionieren etwa wie die Bremsen eines Autos: Versucht sich dann der Behandlungserfolg durch Verabreichen meh­ die Körperabwehr, bestimmte Immunzellen, die T-Lym­ rerer solcher Sub­stanzen noch verbessern? Was geschieht, phozyten, zu aktivieren, un­ wenn man parallel dazu terdrücken die Checkpoints auch noch Chemotherapien, Es nützt wenig, aufs Gaspedal des das. Tumoren können diese genetische Eingriffe oder Mechanismen für ihre Zwe­ ­andere Immuntherapien an­ Immunsystems zu treten, ohne cke benutzen, um Angriffe wendet? »Die Krebsimmun­ gleichzeitig die Bremsen zu lösen der T-Lymphozyten zu ver­ therapie dürfte ihr Potenzial hindern. Immuncheckpointkaum ausschöpfen, wenn sie Inhibitoren wiederum blockieren die Checkpoints, lösen also sich auf die Gabe einzelner Arzneistoffe beschränkt«, meint gewissermaßen die Bremsen der T-Zellen und ermöglichen Lawrence Fong, Tumorimmunologe an der University of Ca­ es ihnen, den Tumor anzugreifen. lifornia, San Francisco. »Vielmehr wird man sie wohl in Kom­ Die Erfolge, die Ribas verzeichnete, indem er bösartigen bination mit verschiedenen anderen Behandlungsformen Hautkrebs mit Immuncheckpoint-Inhibitoren behandelte, einsetzen müssen.« machten seine Fachkollegen aufmerksam. Doch ob sich die Seit mehr als 100 Jahren versuchen Forscher die Fähig­ Arzneistoffe auch gegen andere Krebsarten einsetzen lassen keiten des Immunsystems für die Krebsmedizin zu nutzen würden, erschien zweifelhaft. Das maligne Melanom sei ein (siehe den Beitrag auf S. 70). Doch zahlreiche therapeutische Sonderfall, argumentierten die Mediziner, und es sei be­ Fehlschläge haben gezeigt, dass Tumoren die gegen sie ge­ kannt, dass das Immunsystem bei dieser Krebsart eine wich­ richtete Immunreaktion unterbinden können. Die meisten tige Rolle spiele. heutigen Immuntherapien sollen die Körperabwehr dazu Vor drei Jahren setzte allerdings ein Um­denken ein. In ei­ befähigen, Krebszellen zu erkennen und anzugreifen (siehe ner Studie hatte sich ein Immuncheckpoint-Inhibitor als den Beitrag auf S. 62). Auch der therapeutische Impfstoff wirksam gegen das Nierenkarzinom erwiesen: Bei 31 Prozent ­Sipuleucel-T, Handelsname »Provenge«, zielt darauf ab. Er der damit behandelten Patienten besserten sich die Sympto­ wurde im Jahr 2010 von der US-Arzneimittelbehörde FDA für me deutlich. Von dem Arzneistoff profitierten außerdem 18 die Behandlung von Prostatakrebs zugelassen, was damals Prozent der Lungenkrebspatienten, denen er verabreicht große Hoffnungen weckte. Doch die klinischen Erfolge dawurde. Das war der Beweis für Forscher und Pharmaunter­ mit erwiesen sich als insgesamt enttäuschend, denn nur ein nehmen, dass Immuncheckpoint-Inhibitoren gegen mehre­ kleiner Teil der Patienten profitierte von der Impfung mit re Tumor­arten wirken. ­Sipuleucel-T. 1 2 3 56 SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Fehlschläge wie dieser führten zu einer Erkenntnis: Es nützt wenig, auf das Gaspedal des Immunsystems zu treten, wenn man nicht gleichzeitig die Bremsen löst. Und hier kommen die Immuncheckpoint-Inhibitoren ins Spiel. Schon vor 19 Jahren beobachtete James Allison, damals an der Uni­ versity of California in Berkeley, dass ein Checkpoint-Prote­ in namens CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4) TLymphozyten offenbar davon abhält, Tumoren anzugreifen. Also blockierte Allison die Aktivität von CTLA-4 bei Labor­ mäusen mit verschiedenen Tumorerkrankungen, darunter Hautkrebs. Zu seiner Überraschung bildeten sich die Tumo­ ren bei einigen Tieren vollständig zurück. Ein unerwartet wirksamer Antikörper gegen Melanome Im Jahr 2011 erteilte die FDA die Zulassung für einen Arznei­ stoff, der CTLA4 hemmt – den Antikörper Ipilimumab (Han­ delsname Yervoy). Er war auf der Grundlage von Allisons For­ schungsergebnissen entwickelt worden und stellte seinen klinischen Nutzen schon bald unter Beweis. Es war dieser An­ tikörper, der etlichen von Antoni Ribas’ Patienten das Leben rettete. Das sorgte für Überraschungen, denn vorangegan­ gene Tierexperimente hatten vermuten lassen, dass Ipili­ mumab nur zusammen mit anderen Arzneistoffen deut­ liche Behandlungseffekte erzielen würde. Doch bei mensch­ lichen Krebspatienten erwies sich die Substanz als wirksamer als bei Mäusen. Eine 2013 publizierte Langzeitstudie untersuchte den Nutzen von Ipilimumab bei der Behandlung des fortge­ schrittenen Melanoms. Gut 400 von den 1861 Patienten, die den Antikörper verabreicht bekamen, lebten nach der Diag­ nose noch mindestens drei Jahre lang. Mehr als 300 Patien­ ten waren sogar sieben Jahre später noch am Leben. Das ist beachtlich, da die mittlere Überlebenszeit bei herkömmli­ Das maligne Melanom, auch als »schwarzer Hautkrebs« bezeichnet, ist ein Tumor der Pigmentzellen. Er neigt dazu, früh Meta­ stasen zu bilden, und ist daher sehr gefährlich. Pro Jahr sterben in Deutschland etwa 1500 Männer und 1200 Frauen daran. NATIONAL CANCER INSTITUTE / PUBLIC DOMAIN WWW.SPEK TRUM .DE 57 chen Therapieformen sechs bis neun Monate beträgt. Wird der Antikörper mit anderen Arzneistoffen kombiniert, lässt sich die Wirkung sogar noch verbessern. So scheint sich Ipilimumab sehr gut mit einem weiteren Antikörper namens Nivolumab zu ergänzen, der das Check­ point-Protein PD-1 hemmt. Anfang 2013 erschien eine Stu­ die, in der bei 53 Prozent jener Melanompatienten, welche die höchste noch tolerierbare Dosis beider Sub­stanzen er­ hielten, der Tumor um 80 Prozent oder mehr schrumpfte. Al­ lerdings erlitten etwa 20 Prozent der Versuchsteilnehmer schwere, wenngleich behandelbare Nebenwirkungen. Dazu gehörten funktionelle Beeinträchtigungen der Bauchspei­ cheldrüse und Leber, juckende Hautausschläge sowie Lun­ gen- und Augenentzündungen. Pharmaunternehmen halten solche Nebenwirkungen für beherrschbar und entwickeln mit großem Engagement weitere Immuncheckpoint-Inhibitoren. So testet die Firma Merck einen PD-1-Inhibitor namens Lambrolizumab (MK3475) in sieben klinischen Studien an insgesamt 3000 Pa­ tienten mit Blasen- und Darmkrebs, Kopf-Hals-Tumoren, Melanomen, Lungen- und Brustkrebs. In den meisten dieser Studien kommt MK-3475 allein zum Einsatz. »Dennoch sind wir besonders an Kombinationen mit anderen immun­ modulatorischen Substanzen interessiert«, sagt Eric Rubin, leitender Krebsforscher bei Merck. Das Unternehmen prüft daher auch die gemeinsame Verabreichung mit verschiede­ nen Chemotherapeutika, darunter Carboplatin, Cisplatin und Pemetrexed. Auch das Pharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb untersucht, wie sich Immuncheckpoint-Inhibitoren mit anderen Wirkstoffen ergänzen lassen. Unter anderem ver­ abreichen die Forscher den Antikörper Ipilimumab zusam­ men mit dem Krebsimpfstoff Sipuleucel-T. Experimente mit Mäusen deuten darauf hin, dass sich diese Kombination bewähren könnte. Und die gemeinsame Gabe von Ipilimu­ mab und dem Antikörper Nivolumab, die bereits viel ver­ sprechende Ergebnisse erbracht hat, prüft das Unternehmen derzeit in klinischen Phase-II- und Phase-III-Studien mit Me­ lanompatienten. Doch die Forscher hegen keine übertriebe­ nen Erwartungen. »Wir müssen darauf gefasst sein, dass sich dies möglicherweise nicht als optimale Kombination er­ weist«, sagt Nils Lonberg, leitender Wissenschaftler bei Bris­ tol-Myers Squibb. MEHR WISSEN BEI FOTOLIA / SEBASTIAN KAULITZKI Unser Online- Dossier zum Thema »Krebs – der Feind im eigenen Körper« finden Sie unter www.spektrum.de/krebs 58 Lonberg zufolge prüft das Pharmaunternehmen die ge­ meinsame Verabreichung von Ipilimumab, Nivolumab und Lirilumab, einem menschlichen Antikörper, der die Anti­ tumoraktivität natürlicher Killerzellen fördert. Hierzu lau­ fen Phase-I-Studien mit Patienten, die an verschiedenen Krebsarten leiden. Das Ziel lautet, sowohl die angeborene Immunabwehr (in Form der unspezifisch wirkenden natür­ lichen Killer­zellen) als auch die adaptive Immunabwehr (in Form spezifisch wirkender T-Zellen) auf den Tumor zu het­ zen. »Möglicherweise kommt es dabei zu einer gegenseiti­ gen Verstärkung dieser beiden Arme des Immunsystems«, sagt Lonberg. Es ist aber jetzt schon erkennbar, dass die optimale Arz­ neistoffkombination von vielen Faktoren abhängt: der Art des behandelten Tumors, aber auch von Alter, Geschlecht, Abstammung und genetischer Ausstattung des Patienten. Jahrelanges Experimentieren wird erforderlich sein, um he­ rauszufinden, welche Kombination bei welcher Patienten­ gruppe am besten wirkt – ein Prozess, der sowohl für die Pa­ tienten als auch die Pharmaunternehmen Risiken birgt. So könnte sich herausstellen, dass bestimmte Chemotherapien das Immunsystem unterdrücken und so die Immuntherapie konterkarieren, warnt Keith Flaherty, Onkologe an der Har­ vard University, der auf die Behandlung von Melanomen spezialisiert ist. Versuch und Irrtum? Riskant! Großes Potenzial sieht Flaherty jedoch in der gemeinsamen Anwendung von Immuncheckpoint-Inhibitoren und Thera­ pieverfahren, die gegen spezifische Krebsmutationen wir­ ken – etwa gegen die BRAF-Mutation, die bei Melanompatienten häufig vorkommt. »Hier besteht die Möglichkeit, gezielt jene Mechanismen zu überwinden, mit denen der Tu­ mor der Immunüberwachung entgeht.« Flaherty kritisiert, dass die Forscher auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapie teilweise planlos vorgingen. Einige Pharmaunternehmen, sagt er, testeten Arzneistoffkombina­ tionen, ohne die beteiligten Wirkmechanismen verstanden zu haben. »Das ist eine ziemlich unwissenschaftliche Heran­ gehensweise.« Ein solches Versuch-und-Irrtum-Verfahren gefährde die Patienten, berge ein hohes Risiko des Scheiterns und könne die gesamte Krebsimmuntherapie unnötig in Misskredit bringen. Da derzeit kaum Biomarker zur Verfügung stünden, an­ hand derer sich voraussagen lasse, welche Patienten am ehesten von Immuncheckpoint-Inhibitoren und anderen Immuntherapien profitieren, ließen sich Wirkstoffkombina­ tionen vielleicht noch gar nicht sinnvoll testen, meint Fla­ herty. »Ich fürchte, dass wir derzeit über keine wissenschaft­ lich fundierte Strategie verfügen, um kombinierte Krebs­ immuntherapien zu entwickeln«, sagt er. Das bedeute aber nicht, dass solche Entwicklungsarbeiten grundsätzlich un­ sinnig seien. Gelänge es, aussagefähige Biomarker zu finden, könnten die Mediziner für jeden Patienten die am besten geeignete SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Immuntherapie festlegen – sei es ein einzelnes Behandlungs­ T-Lymphozyten und andere Abwehrzellen massenhaft zum verfahren oder eine Kombination aus mehreren verschiede­ Ort des Geschehens wandern. »Ärzte, die Immuntherapien nen. So deuten beispielsweise einige Befunde darauf hin, einsetzen, müssen über dieses Ansprechverhalten sehr gut dass Patienten, deren Tumoren das immundämpfende Pro­ im Bilde sein«, unterstreicht Topalian. »Es kann eine ganze tein PD-L1 produzieren, gut auf Inhibitoren des Checkpoint- Weile dauern, bis die Wirkung eintritt – was die Entscheidung Proteins PD-1 ansprechen. Das berichtet Suzanne Topalian, erschwert, ob die Behandlung fortgesetzt oder abgebrochen Onkologin an der Johns Hopkins University in Baltimore, werden soll.« Maryland (USA). Der beobachtete Zusammenhang, sagt sie, Derzeit weiß niemand genau, wie lang Immuncheck­ sei plausibel – denn die Gegenwart von PD-L1 zeige an, dass point-Inhibitoren verabreicht werden müssen, bis ein sicht­ der Tumor auf genau jene barer klinischer Erfolg ein­ Bremse des Immunsystems treten kann. Ribas behandelt Wegen der Erfolge mit Immuncheck- viele seiner Patienten mit trete, die sich mit PD-1-Inhi­ Inhibitoren wenden sich Krebs­ bitoren lösen lasse. MK-3475. Sie erhalten alle Trotz insgesamt durch­ forscher vom Konzept der rein gene- zwei bis drei Wochen eine In­ wachsener Behandlungser­ fusion mit dem Antikörper. tisch bedingten Erkrankung ab folge haben Immuncheck­ Es ist geplant, jeden Patien­ point-Inhibitoren in einigen ten zwei Jahre lang zu behan­ Fällen so gut gewirkt, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA deln und dann eine Therapiepause einzulegen, um den wei­ vor zwei Jahren den Antikörper MK-3475 als bahnbrechen­ teren Krankheitsverlauf zu beobachten. den Therapieansatz bezeichnete. Sie bescheinigte dem An­ »Auf Grund der derzeit verfügbaren Daten können wir tikörper, er könne die Krebsbehandlung möglicherweise nicht entscheiden, wann wir die Therapie beenden können – deutlich verbessern. Die FDA arbeitet mit Wissenschaftlern oder ob wir sie immer weiter fortsetzen müssen«, erklärt Ri­ und Pharmaunternehmen zusammen, um die Entwicklung bas. Die Mediziner hoffen, dass das Immunsystem der be­ von Therapieverfahren auf der Basis von MK-3475 zu be­ handelten Patienten irgendwann dazu übergeht, den Tumor schleunigen. selbstständig zu bekämpfen – und Krebs entweder definitiv besiegt oder zumindest dauerhaft in Schach hält. Topalian Nicht nur eine Sache der Erbanlagen wagt sogar die hoffnungsvolle Spekulation, wonach Patien­ Seit Jahren konzentrieren sich Onkologen verstärkt auf die ten, die eine erfolgreiche Immuntherapie durchlaufen ha­ Genetik von Krebserkrankungen, um Arzneistoffe zu ent­ ben, möglicherweise für den Rest ihres Lebens vor einer wickeln, die spezifischen Mutationen entgegenwirken. Nun Rückkehr des Tumors geschützt sein könnten – ähnlich wie sei es an der Zeit, das Blickfeld zu erweitern, meint Ira Mell­ manche Impfungen im Kindesalter lebenslange Immunität man, Krebsforscher bei dem Biotechnologieunternehmen verleihen. Ÿ Genentech. »Wir wissen heute, dass Krebs nicht nur eine Krankheit der Gene ist, denn wir verfügen über zahlreiche DI E AUTORI N Arzneistoffe, die auf Onkogene abzielen – und dennoch sind Karen Weintraub ist Wissenschaftsjournalistin viele Krebs­erkrankungen nach wie vor nicht heilbar.« Die Er­ und lebt in Cambridge, Massachusetts. folge mit Immuncheckpoint-Inhibitoren hätten dazu ge­ führt, dass ­etliche Krebsforscher sich allmählich vom Kon­ zept der rein genetisch bedingten Erkrankung abwendeten. Dieser Perspektivwechsel sei notwendig, sagt Mellman, denn sonst werde sich kein Fortschritt einstellen und ließen sich die Möglichkeiten der Krebsimmuntherapien nicht voll aus­ QUELLEN schöpfen. Hamid, O. et al.: Safety and Tumor Responses with Lambrolizumab Auch die behandelnden Ärzte müssen ihre klinischen (Anti-PD-1) in Melanoma. In: The New England Journal of Medicine Strategien anpassen, um Immuncheckpoint-Inhibitoren und 369, S. 134 – 144, 2013 andere immunologische Behandlungsansätze möglichst ef­ Topalian, S. L. et al.: Safety, Activity, and Immune Correlates of AntiPD-1 Antibody in Cancer. In: The New England Journal of Medicine fektiv einzusetzen. Denn Patienten sprechen auf Immun­ 366, S. 2443 – 2454, 2012 therapien oft ganz anders an als auf konventionelle Behand­ Wolchok, J. D. et al.: Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Melungsmethoden, wie die Onkologin Suzanne Topalian be­ lanoma. In: The New England Journal of Medicine 369, S. 122 – 133, 2013 tont. Gängige Chemotherapien und gezielte Krebstherapien führen, wenn sie erfolgreich sind, normalerweise zu einem relativ raschen Schrumpfen des Tumors. Bei Immunthera­ Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1298013 pien hingegen kann es mehrere Monate dauern, bis die © Nature Publishing Group Geschwulst­sich merklich zurückzubilden beginnt. Mitunter www.nature.com nimmt die Tumorgröße anfangs sogar zu, wenn nämlich Nature 504, S. S6 – S8 WWW.SPEK TRUM .DE 59 IMMUNTHERAPIE II Den Schutzpanzer der Krebszellen ausschalten Wissenschaftler der Stanford University haben einen neuen Therapieansatz für Krebs entdeckt: Ist ein von Tumoren ausgehendes Signal blockiert, können Immunzellen sie attackieren. VON GERLINDE FELIX 60 das auf die Fresszellen wie ein Stoppzeichen wirkt. In einer Studie neueren kamen ­Stephan B. Willingham und Jens-Peter Volkmer aus Weissmans Team und Kollegen dann zu dem Ergebnis, dass sich die meisten menschlichen Krebsarten dieses Tricks bedienen (PNAS 109, S. 6662 , 2012). »So produzieren fast alle Krebszellen das Oberflächenprotein CD47 in einer Menge, die durchschnittlich etwa das Dreifache jener von gesunden Zellen beträgt«, sagt Volkmer. Die Zahl der CD47-Moleküle bestimmten die Forscher mit der so genannten Durchflusszytometrie. Des Weiteren entnahmen sie Gewebeproben von menschlichen Brust-, Eierstock-, Prostata-, Blasen-, Leber- und Hirntumoren und transplantierten sie in speziell gezüchtete Mäuse, die menschliches Tumorgewebe nicht abstoßen. Ein paar Wochen später injizierten sie dann einen gegen CD47 gerichteten Antikörper in die Tiere. »Der Antikörper dockte bei allen untersuchten Krebsarten an CD47 an und blockierte auf diese Weise das ›Don’t eat me‹nach 2 Wochen nach 4 Wochen Signal«, so Volkmer. Daraufhin attackierten die Fresszellen die Tumoren. Allerdings zeigte sich, dass Krebszellen zusätzlich noch eine andere Struktur auf ihrer Oberfläche haben müssen, die Makrophagen zum Mahl einlädt. Denn: Wurden die deutlich seltener auftretenden CD47-Proteine auf der Oberfläche gesunder Zellen mit dem Antikörper blockiert, war dies allein noch kein Startsignal für die Fresszellen, sich diese Zellen einzuverleiben. Als Müll markiert Schon Ende 2010 beschrieben Mark Chao und Ravindra Majeti vom Weiss­ man-Team, dass auf Krebszellen nicht nur ein »Don’t eat me«-Signal zu finden ist, sondern als Gegenspieler auch ein »Eat me«-Signal: das Oberflächenprotein Calreticulin (Science Transla­ tional Medicine 2: 63 ra94, 2010). Solange CD47 und Calreticulin ihre Signale ungestört senden können, wird eine Krebszelle offenbar nicht gefressen. Ist jedoch von den beiden Proteinen selektiv das CD47 blockiert, attackieren die Immunzellen. nach 6 Wochen nach 8 Wochen MIT FRDL. GEN. VON JENS-PETER VOLKMER, UNIVERSITÄT DÜSSELDORF CD47-Antikörper war hat die Krebstherapie in vielen Bereichen inzwischen eindrucksvolle Fortschritte zu verzeichnen, doch immer noch lassen sich manche Tumorformen kaum oder gar nicht heilen. Um entscheidende Verbesserungen zu erreichen, sind wohl auch grundsätzlich neue Ansätze erforderlich. Irving Weissman und seine Mitarbeiter von der Stanford University konzentrieren sich daher auf ein bestimmtes Protein auf der Oberfläche von menschlichen Krebszellen, genannt CD47. Dieses verhindert nämlich, dass das Immunsystem Tumorzellen als Störenfriede erkennt und vernichtet. Die Bildung von CD47-Proteinen ist an sich ein normaler Schutzmechanismus von Körperzellen, um Angriffen durch Fresszellen (Makrophagen) zu entgehen. Daher reichern etwa Blutstammzellen, die vorübergehend ihre sichere Nische im Knochenmark verlassen haben und im Blutkreislauf zirkulieren, CD47 auf ihrer Oberfläche an. Das hatten Weissman und seine Kollegen schon 2009 herausgefunden (Cell 138, S. 271 , 2009). Ferner erkannten die Forscher, dass bei bestimmten Blutkrebserkrankungen – der myeloischen Leukämie und Lymphomen – die Tumorzellen ebenfalls mehr CD47 aufweisen. Ihre Schlussfolgerung: Krebszellen nutzen diesen Schutzmechanismus, um nicht von Fresszellen vernichtet zu werden. Dabei bindet sich das CD47 kurzzeitig an ein Protein namens SIRP-a (sig­ nalregulatorisches Pro­tein alpha) auf den Makrophagen. Der Kontakt löst in diesen eine Kette biochemischer Reaktionen aus, woraufhin die Krebszelle verschont wird. Die Forscher sprechen vom »Don’t eat me«-Signal des CD47, Kontrollgruppe Z Antikörper gegen das Oberflächenprotein CD47 halten in Mäuse eingepflanztes menschliches Tumorgewebe in Schach (oben). Ohne die Behandlung würden die Tiere bald dem Krebs zum Opfer fallen (unten). Blau markiert schwaches, rot starkes Tumorwachstum. SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 STOP Makrophage SIRP- DIE WELT IM KOPF Phagozytose Makrophage Doch warum sollten Krebszellen überhaupt »Eat me«-Signale aussenden, um sich den Fresszellen als Häppchen anzubieten? Vermutlich hilft Calreticulin normalerweise, beschädigte Zellen zu entfernen. Für diese Annahme spricht, dass gesunde Zellen kein Calreticulin zeigen. Werden sie aber geschädigt, taucht das Protein plötzlich auf ihrer Oberfläche auf. Es scheint die Zelle für Makrophagen als »Müll« zu markieren. »Bei Krebs könnte die Cal­ reticulinexpression auf der Oberfläche die kranke Zelle dazu anregen, vermehrt CD47-Proteine auszubilden, um eine Phagozytose durch Fresszellen doch noch abzuwenden«, erläutert Mark Chao von der Stanford School of Medicine. Dass Calreticulin bei gesunden Zellen fehlt, erklärt, warum eine Therapie mit einem gegen CD47 gerichteten Antikörper nur vergleichsweise wenig schädliche Nebenwirkungen hat, einmal abgesehen von einer vorübergehenden Blutarmut. »Das Blockieren des ›Don’t eat me‹-Signals unterdrückte das Wachstum nahezu jedes menschlichen Krebsgewebes in den von uns getesteten Mäusen, mit minimaler Toxizität für den ­Organismus«, führt Weissman aus. Innerhalb einiger Wochen nach der Antikörpertherapie schrumpfen die implantierten Tumoren in den Tieren, was Biolumineszenzaufnahmen zeigen (Bild links). Abhängig von der Ausgangsgröße des Tumors verschwindet WWW.SPEK TRUM .DE CD47Antikörper CD47 CD47 Tumorzelle SIRP- MIT FRDL. GEN. VON JENS-PETER VOLKMER, UNIVERSITÄT DÜSSELDORF Tumorzelle CD47 auf der Oberfläche von Tumorzellen bindet sich an SIRP-a auf Fresszellen (Makrophagen), was auf Letztere wie ein Stoppsignal wirkt. Ver­ hindert ein Antikörper diese Interaktion, kann die Fresszelle den Krebs ungehindert angreifen. der Krebs entweder ganz oder bildet zumindest keine Tochtergeschwülste mehr. Zirkulierende Krebszellen dürften ebenfalls effektiv beseitigt werden. Die CD47-Antikörpertherapie scheint umso besser zu wirken, je kleiner der Tumor ist und je früher die Therapie beginnt. Allerdings hat bei einigen Mäusen mit implantiertem Brusttumorgewebe der neue Therapieansatz nicht zum erhofften Erfolg geführt. Woran dies liegt, ist bislang unklar. Die aggressivsten Krebstypen haben übrigens die größte Zahl an Calreticulinmolekülen auf ihrer Oberfläche. Damit sollte die Antikörpertherapie bei diesen auch am durchschlagendsten wirken. Die an der Studie beteiligten Wissenschaftler sind sich ziemlich sicher, dass erste klinische Untersuchungen in ein oder zwei Jahren starten werden. Weissman könnte sich vorstellen, den Tumor vorab mittels Operation oder Radiotherapie zu verkleinern, um die Antikörperbehandlung noch effektiver zu machen. Bei einer Kombination mit Chemotherapie oder antientzündlicher Behandlung sei allerdings Vorsicht geboten, so der Wissenschaftler. Durch den dabei auftretenden Zellstress besteht das Risiko, dass gesunde Zellen plötzlich vermehrt »Eat me«-Signale aussenden – und dann ebenfalls ein Opfer der Fresszellen werden. Gerlinde Felix ist freie Medizin- und Wissenschaftsjournalistin in Markt Wartenberg. JETZT IM MINIABO KENNEN LERNEN: Alles über die Erforschung von Ich und Bewusstsein, Intelligenz, Emotionen und Sprache. Drei aktuelle Ausgaben von Gehirn und Geist für nur € 5,10 je Heft (statt € 7,90 im Einzelkauf). So einfach erreichen Sie uns: Telefon: 06221 9126-743 gehirn-und-geist.de/miniabo Fax: 06221 9126-751 E-Mail: [email protected] 61 IMMUNTHERAPIE III Auftragskiller der Körperabwehr Immunzellen lassen sich genetisch so verändern, dass sie Tumoren im Körper eines Krebspatienten angreifen. Dieses bislang wenig beachtete Verfahren rückt zunehmend in den Blick der Pharmaforschung. Von Courtney Humphries N och vor wenigen Jahren erntete Michel Sadelain vor allem Skepsis, wenn er vor Kollegen darüber sprach, dass man die Krebsmedizin um den adoptiven Zelltransfer (ACT) erweitern könne. Sein Vorschlag, einem Krebspatienten Immunzellen zu entnehmen, diese genetisch so zu verändern, dass sie den Tumor des Erkrankten attackieren, und anschließend dem Patienten zurückzugeben, stieß auf große Zweifel. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, vor wie vielen leeren Sälen ich über diese Methode referiert habe«, erzählt Sadelain, ­Direktor am Center for Cell Engineering am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Der adoptive Zelltransfer erlaubt den Medizinern, sich die Schlagkraft des Immunsystems zu Nutze zu machen, indem­ sie die körpereigenen T-Zellen (T-Lymphozyten) für ihre Zwecke einsetzen. T-Zellen wandern durch den Orga­ nismus und »halten Ausschau« nach potenziell gefähr­ lichen Objekten, etwa eingedrungenen Krankheitserregern oder pathologisch veränderten Körperzellen. Das tun sie mit Hilfe von Erkennungsmolekülen, so genannten Rezeptoren. Bakterien oder Krebszellen tragen auf ihrer Ober­ fläche häufig andere Proteine als gesunde Körperzellen – Antigene heißen solche fremden Oberflächenproteine in der Fachsprache. Trifft nun eine T-Zelle auf ein Bakterium oder eine Krebszelle, deren Antigen zu ihrem Rezeptor passt, dann wird sie aktiv und startet eine Attacke gegen den Schädling. Krebszellen besitzen vielfach stark veränderte Oberflächenproteine und geben damit eigentlich ideale Angriffsziele für T-Zellen ab. Doch leider sind Tumoren in der Lage, sich gegenüber der Immunabwehr abzuschirmen. Das Ziel des adoptiven Zelltransfers besteht deshalb darin, die T-Zellen durch gezielte Eingriffe derart »scharf« zu machen, dass sie den Schutzschild des Tumors durchbrechen können. Sadelain nennt die so modifizierten T-Zellen »lebende Arzneistoffe«. In den zurückliegenden Jahren hat es eine Reihe von Pilotstudien zum adoptiven Zelltransfer gegeben, die viel ver62 sprechende Resultate erbracht haben. Seither wächst die Zahl der Mediziner, die sich für diesen Behandlungsansatz interessieren, und sie haben dutzende klinische Studien gestartet, um seine Möglichkeiten ausloten. Es gibt Berichte über Patienten mit aggressiven Krebserkrankungen, deren Tumoren binnen Tagen oder Wochen verschwanden, nachdem sie dem Verfahren unterzogen worden waren. Allerdings ist die Zahl der insgesamt damit behandelten Krebskranken noch sehr klein. Trotzdem: Angesichts der Tatsache, dass Krebsmediziner es vielfach schon als Durchbruch feiern, wenn ein Therapieverfahren die durchschnittliche Überlebenszeit der Patienten um einige Wochen oder Monate verlängert, erregt die komplette Rückbildung von Tumoren erhebliches Aufsehen, auch wenn sie nur bei wenigen Betroffenen zu beobachten ist. Neues Interesse an alter Methode Sadelain spricht nun nicht mehr vor leeren Sitzreihen. Plötzlich, so berichtet er, schlägt der adoptive Zelltransfer sowohl Wissenschaftler als auch Vertreter von Pharmaunternehmen in ihren Bann. Ganz so, als handle es sich um ein komplett neues Verfahren – und nicht um ein Konzept, das Forscher schon seit 20 Jahren kontinuierlich weiterentwickeln. Noch stehen einer breiteren Anwendung mehrere Hürden im Weg. Eine große Herausforderung liegt darin, die Aktivität der Immunzellen so zu kontrollieren, dass sie Krebszellen vernichten, ohne gesundes Gewebe anzugreifen. Das ist nicht einfach, denn oft sind vermeintlich tumorspezifische Antigene auch auf normalen Körperzellen zu finden. Unklar erscheint zudem, wie es gelingen kann, den adoptiven Zelltransfer in ein wirtschaftlich tragbares Behandlungsverfahren zu überführen. Lebende Immunzellen aus dem Patienten zu entnehmen und zu kultivieren, erfordert weit mehr Zeit und Wissen, als ein fertiges Medikament zu verabreichen – und entsprechend höhere Kosten. Das ist vor allem deshalb problematisch, weil – wie bei jedem neuen klinischen Verfahren – umfangreiche Studien mit Beteiligung zahlreicher Kliniken nötig sind, um die Wirksamkeit des SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 AUF EINEN BLICK MIT DEN WAFFEN DES KÖRPERS 1 Beim adoptiven Zelltransfer entnehmen Mediziner einem Krebspatienten Immunzellen, vervielfältigen sie, verändern sie manchmal auch und geben sie dem Kranken anschließend zurück. Das Ziel lautet, die Zellen so zu selektieren und gegebenenfalls zu modifizieren, dass sie den Tumor angreifen. 2 Noch vor wenigen Jahren wurde das Verfahren kaum im ­klinischen Alltag eingesetzt, da es sehr komplex ist und die Gefahr tödlicher Nebenwirkungen birgt. 3 Seit einigen Jahren berichten Mediziner jedoch vermehrt über Erfolge mit diesem Verfahren, weshalb sich auch Pharmaunternehmen zunehmend dafür interessieren. Jetzt laufen die ersten größeren klinischen Studien an. ISTOCK / JUAN GÄRTNER Menschliche T-Lymphozyten (blau) attackieren eine Krebszelle (gelb). Es handelt sich um eine nachträglich eingefärbte rasterelektronen­ mikroskopische Aufnahme. WWW.SPEK TRUM .DE 63 ­ doptiven Zelltransfers anhand großer Patientengruppen zu a belegen. Doch um solch groß angelegte Untersuchungen durchzuführen, muss man erst die Möglichkeiten schaffen, Zellen in aus­reichender Menge zu manipulieren, zu kultivieren und zu vertreiben. Die damit verbundenen hohen Investitionen werden die Unternehmen erst tätigen, wenn sie da­ rauf hoffen können, entsprechende Therapieverfahren langfristig profitabel zu vermarkten. Befürworter des adoptiven Zelltransfers betonen, das Verfahren biete die Chance, lebensbedrohliche Tumoren auszumerzen – und diese Aussicht sei es wert, sich den Herausforderungen zu stellen. Sie verweisen auf jüngere Erfolgsmeldungen, die eine überraschende Effizienz der Methode belegen. Bisher existieren drei grundlegende Strategien beim adoptiven Zelltransfer (siehe Kasten rechts), wobei die einfachste davon am weitesten entwickelt ist. Das einen Tumor umgebende Gewebe enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Immunzellen, deren Aktivität gegen den Tumor gerichtet ist. Mediziner entnehmen deshalb eine Probe dieses Gewebes und versuchen, daraus entsprechende T-Zellen zu isolieren. Gelingt das, kultivieren sie die Zellen anschließend im Labor, bis diese sich hinreichend vermehrt haben. Sodann geben die Mediziner dem Patienten die kultivierten T-Zellen in den Körper zurück, und zwar gemeinsam mit dem T-Zell-Wachstumsfaktor Interleukin-2 (IL-2), der die weitere Vermehrung der Immunzellen fördern soll. Allerdings verfügt das körpereigene Abwehrsystem über hemmende Mechanismen, die Immunreaktionen unter Kontrolle halten. Sie verhindern oft, dass die rückübertra­ genen Immunzellen den Tumor wirksam angreifen. Daher müssen die Patienten zusätzlich noch Medikamente oder Strahlenbehandlungen erhalten, die das Immunsystem und seine Hemmmechanismen schwächen, so dass die rückübertragenen T-Zellen Fuß fassen und sich im Organismus verbreiten können. Fachleute bezeichnen dieses Verfahren als Therapie mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL). Es ist bisher erst bei einer einzigen Krebsart erfolgreich angewendet worden: dem metastasierten Melanom. Bei dieser Krebsart wandern die T-Zellen in den Tumor ein, was es relativ leicht macht, sie aus tumornahen Gewebeproben zu extrahieren. In den zurückliegenden 25 Jahren haben Wissenschaftler um Steven Rosenberg gezeigt, dass die TIL-Therapie Melanome zurückdrängen und bei einem beträchtlichen Teil der Patienten sogar vollständig und lang anhaltend ausmerzen kann. Rosenberg forscht über Immuntherapien und leitet die chirurgische Abteilung am National Cancer Institute in Bethesda (Maryland, USA). Auch gegen die Tochtertumoren wirksam T-Zellen, deren Aktivität sich gegen einen bestimmten ­Tumor richtet, können offenbar auch dessen Tochtergeschwulste (Metastasen) vernichten, wie Rosenbergs Studien belegen. Bei etlichen Melanompatienten, die sich mit der TIL-Therapie nachhaltig erfolgreich behandeln ließen, hatten die Tumoren bereits stark gestreut, weshalb andere Behandlungsmethoden keine Wirkung mehr zeigten. So wie die TIL-Therapie derzeit zugeschnitten ist, weist sie allerdings noch zwei wesentliche Nachteile auf. Zum einen müssen die Patienten vier bis sechs Wochen warten, bis sich ihre Immunzellen unter Kulturbedingungen so weit vermehrt haben, dass die Therapie beginnen kann. Zum anderen er­fordert das Verfahren, spezielle Zentren zur Zellzüchtung einzurichten – mit Personal, das darin geschult ist, Zellen zu kultivieren. Forscher arbeiten zurzeit daran, die Vermehrung der Immunzellen zu beschleunigen, so dass sie nur noch Tage statt Wochen in Anspruch nimmt. Zudem hat ein Team um Cassian Yee, Tumorimmunologe am University of Texas MD Anderson Cancer Center (Houston, USA), eine Methode entwickelt, um T-Zellen mit Antitumoraktivität aus dem Blut zu gewinnen. Das ermöglicht es vielleicht, auch sol- In den klinischen Alltag Zurzeit bieten nur wenige Behandlungszentren adoptive Zelltherapien gegen Krebs an. Pharma­ unternehmen arbeiten daran, diese Therapien für den breiteren Einsatz verfügbar zu machen. 64 Unternehmen Therapieform Partnerschaften und Studien Adaptimmune T-Zell-Rezeptor-Therapie (TCR) Sponsert neun Pilot- und Phase-I-Studien an verschiedenen Behandlungszentren in den USA Novartis Therapie mit chimären Antigenrezeptoren (CAR) Lizenzierungsvertrag mit der University of Pennsylvania, um Krebsimmuntherapien zu entwickeln; organisiert weltweit klinische Studien über eine T-Zell-Therapie gegen die akute lymphoblastische Leukämie, das so genannte CTL019-Programm Lion Biotechnologies Therapie mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL) Lizenzierungsvertrag mit dem National Cancer Institute in den USA, um eine TIL-Therapie zu entwickeln, mit der sich das fortgeschrittene metastasierte ­Melanom behandeln lässt Kite Pharma TCR, CAR Zusammenarbeit mit dem National Cancer Institute, um entsprechende Therapieverfahren zu entwickeln und zu vermarkten SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Beim adoptiven Zelltransfer (ACT) attackieren ­Mediziner den Tumor mit Hilfe von tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL) oder genetisch veränderten T-Zellen. Letztere werden entweder so modifiziert, dass sie auf ihrer Oberfläche einen bestimmten T-Zell-Rezeptor tragen (dann spricht man von TCRTherapie), oder so, dass sie ein spezielles antikörperähnliches Molekül ausprägen, einen so genannten chimären Antigenrezeptor (CAR). Beide Methoden führen dazu, dass die T-Zellen aktiv werden, wenn sie auf ein bestimmtes Tumorantigen treffen. Gewinnung von T-Zellen aus einer Gewebeprobe oder dem Blut genetische Veränderung der Zellen TIL Isolierung und Vermehrung von tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL) TCR oder Einführen eines Gens, das für einen T-Zell-Rezeptor (TCR) kodiert, der ein bestimmtes Tumorantigen erkennt CAR Einführen eines Gens, das für einen chimären Antigenrezeptor (CAR) kodiert, der ein bestimmtes Tumorantigen erkennt Tumorzelle Tumorantigen Dämpfung des Immunsystems per Chemotherapie oder Bestrahlung, damit die rückübertragenden T-Zellen sich im Körper des Patienten ausbreiten und vermehren können. T-ZellRezeptor Tumorzelle MHCKomplex präsentiert den T-Zellen Antigene. Tumorantigen CAR T-Zelle CD3-Komplex übermittelt ein Aktivierungssignal. Aktivierung der T-Zelle T-Zelle Kostimulatorische Moleküle verstärken die T-Zell-Antwort. Aktivierung der T-Zelle Rückgabe der Zellen in den Körper des Patienten, wo sie dessen Tumor attackieren che Tumoren mit der TIL-Therapie zu behandeln, bei denen die Entnahme von Gewebeproben sehr schwer fällt oder bei denen sich die Immunzellen nicht in der Umgebung der Geschwulst anreichern. Maßgeschneiderte Killerzellen Die Erfolge der TIL-Therapie bei der Behandlung des metastasierten Melanoms lassen sich momentan nicht auf andere Krebsarten übertragen, weil es dort deutlich schwieriger ist, ­T-Zellen mit Antitumoraktivität zu gewinnen. Forscher ­arbeiten daher an einem weiteren Verfahren des adoptiven Zelltransfers. Sie wollen (unspezifische) T-Zellen genetisch so verändern, dass diese die Fähigkeit erlangen, den Tumor zu attackieren. Diese Strategie hat erstens den Vorteil, dem ­Pa­tienten keine tumorspezifischen T-Zellen entnehmen zu müssen, und zweitens, dass man den Immunzellen mittels des genetischen Eingriffs ganz bestimmte Eigenschaften verleihen kann. Hierbei verfolgen die Forscher mehrere Ansätze. Bei der ­T-Zell-Rezeptor-Therapie (TCR-Therapie) bringen sie Gene in die Immunzellen ein, die für bestimmte Rezeptormoleküle kodieren. Haben die Zellen diese Rezeptoren dann hergestellt, erkennen sie die dazu passenden Tumorantigene. Durch gezieltes Optimieren des eingepflanzten Genmate­ WWW.SPEK TRUM .DE SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / ART FOR SCIENCE, NACH: NATURE 504, S. S13–S15, 2013 Angriff der T-Zellen rials lassen sich die Bindungseigenschaften der Rezeptoren gegebenenfalls verbessern. Um Zellen für die TCR-Therapie herzustellen, gewinnen die Ärzte zunächst T-Zellen aus dem Blut des Patienten und schleusen in diese dann das gewünschte Genmaterial mit veränderten Viruspartikeln ein. Dabei lassen sich die Zellen in vielfältiger Weise verändern – etwa so, dass sie sich im Körper besser vermehren und länger dort bleiben oder Signalmoleküle ausschütten, die andere Zellen zum Angriff auf den Tumor veranlassen. In bisherigen Anwendungen der TCR-Therapie gelang es bei einigen Patienten, den Tumor zu verkleinern – beim metastasierten Melanom, bei Dickdarmkrebs und bei Sarkomen der Gelenkschleimhaut. Das Problem bei diesem Behandlungsansatz: Die Rezeptoren, deren genetische Blaupause man in die T-Zellen einbringt, müssen auf das Immunsystem des Patienten abgestimmt sein. Eine flexiblere Strategie, die Therapie mit chimären Antigenrezeptoren (CAR), umgeht jene Schwierigkeit. Dabei verwenden die Mediziner ein Gen, das für ein künstliches, antikörperähnliches Protein kodiert. Es bindet zwar ebenfalls an Antigene auf den Tumorzellen, muss aber nicht dem Immunsubtyp des Patienten entsprechen. Chimäre Antigenrezeptoren bestehen aus drei Teilen: einem Antikörper, der an ein häufiges Tumorantigen bindet; 65 einem Rezeptorfragment, das die T-Zelle aktiviert; und ­unterstützenden Substanzen, so genannten kostimulatorischen Molekülen, zur besseren Vermehrung und längeren Verweildauer der T-Zellen im Körper. Wird ein CAR-Gen in eine T-Zelle eingebaut und abgelesen, funktioniert das entstehende Molekülkonstrukt wie ein Schalter: Sobald es an ein passendes Tumorantigen koppelt, versetzt es die Zelle in den Angriffsmodus. Obwohl schon in den späten 1980er Jahren konzipiert, haben CAR-Therapien erst in neuerer Zeit zu positiven Er­ gebnissen im Rahmen kleinerer klinischer Studien geführt. Bisher zielen sie allesamt auf das CD19-Protein ab, das Blutkrebszellen sowie entartete Zellen des Lymphgewebes auf ihrer Oberfläche tragen. CD19 findet sich allerdings auch auf gesunden weißen Blutkörperchen. Das bedeutet, die genetisch veränderten T-Zellen bei der CAR-Therapie greifen mitunter auch normale weiße Blutkörperchen an, doch deren Verlust lässt sich medizinisch kompensieren. Letzte Rettung bei hochaggressivem Blutkrebs Vor vier Jahren berichtete ein Team um Carl June vom Abramson Family Cancer Research Institute in Philadelphia (USA) über die erfolgreiche Anwendung einer CAR-Therapie, die auf CD19 abzielte. Drei Leukämiepatienten waren zuvor erfolglos mit Chemotherapien behandelt worden; nach der CAR-Therapie hingegen bildeten sich ihre Krankheitssym­ ptome zurück und verschwanden bei zwei Patienten sogar ganz. In einer anderen Studie aus dem Jahr 2013, an der ­Michel Sadelain beteiligt war, wendeten Forscher ebenfalls eine gegen CD19 gerichtete CAR-Therapie bei Leukämie­ patienten an. Diesmal verschwanden bei drei von fünf Betroffenen die Krebszellen vollständig. Das ist insbesondere deshalb spektakulär, weil die Betroffenen an akuter lym­ phatischer Leukämie (ALL) gelitten hatten, einer äußerst aggressiven Erkrankung, und es bei ihnen auch schon mehrfach zu Rückfällen nach Chemotherapie gekommen war. Forscher untersuchen nun, ob CAR-Therapien auch gegen solide Tumoren wirken. Nun, da kleinere klinische Studien gezeigt haben, dass man bestimmte Krebserkrankungen wirksam mit genetisch veränderten T-Zellen behandeln kann, geht es um die Optimierung dieser Ansätze. Wie Sadelain betont, zeigen die Studien, dass die konkrete Ausgestaltung der Therapie – etwa die Art der stimulatorischen Moleküle – großen Einfluss auf den klinischen Erfolg hat. Zumindest bei CAR-Therapien ­bestimmen diese Randfaktoren maßgeblich darüber, gegen welche Krebsart die Behandlung wirkt. Es gilt daher, sowohl bei TCR- als auch bei CAR-Therapien die optimalen Angriffsziele sowie die bestmögliche Zusammenstellung von ko­ stimulatorischen Molekülen zu finden. Ganz wichtig ist es, den Angriff der veränderten Immunzellen so zu lenken, dass er sich nicht gegen gesundes Körpergewebe richtet. Hierfür müssen die Forscher Antigene auf den Tumorzellen identifizieren, die hinreichend spezifische 66 Unser Dossier »Neue Strategien gegen Krebs« berichtet über Präventions­ maßnahmen, Virotherapien, das Krebsgenomprojekt, Ansätze gegen Tumor­ stammzellen sowie Krebs­ impfungen. Ziele abgeben. Das könnte schwieriger werden als erwartet. Viele Tumorantigene finden sich auch in normalem Gewebe. Der Rezeptor HER2 beispielsweise, auf den der therapeutische Antikörper Trastuzumab (Handelsname Herceptin) abzielt, kommt auch auf Herzmuskelzellen vor. Vor dem Einsatz einer adoptiven Zelltherapie muss also für sämtliche Körpergewebe geklärt werden, ob sie das entsprechende Antigen ausprägen, und wenn ja, in welchem Ausmaß. Neuere Arbeiten haben gezeigt, was passieren kann, wenn T-Zellen unerwartet normale Köperzellen attackieren. In einer klinischen Studie behandelten Forscher vom National Cancer Institute neun Krebspatienten mit einer TCR-Therapie, die auf ein Tumorantigen namens MAGE-A3 gerichtet war. Zwei der Patienten fielen ins Koma und starben. Es stellte sich heraus, dass die genetisch veränderten T-Zellen nicht nur auf MAGE-A3 losgegangen waren, sondern auch auf ein weiteres Antigen aus der MAGE-A-Familie, das – wie die Forscher erst später feststellten – in geringen Mengen im Hirngewebe vorkommt. Ein anderer TCR-Therapieansatz, der ebenfalls auf MAGE-A3 zielte, führte bei zwei Patienten zu tödlichem Herzversagen. Hier hatten die veränderten Immunzellen das Protein Titin attackiert, das in Herzmuskel­ zellen zu finden ist. Das Unternehmen Adaptimmune, das seinen Sitz nahe dem britischen Oxford hat und maßgeblich an der Entwicklung dieses Therapieverfahrens beteiligt war, hat seine Sicherheitstests stark ausgeweitet, um solche katastrophalen Nebenwirkungen künftig zu verhindern. Einer der größten Vorteile des adoptiven Zelltransfers ist der rasche Wirkungseintritt: Die Behandlungseffekte zeigen sich binnen Tagen oder Wochen, viel schneller als bei anderen Immuntherapien. Allerdings kann eine Behandlung, die solch durchschlagende Wirkungen zeitigt, auch gefährlich werden. Unlängst verstarb eine Darmkrebspatientin während einer CAR-Therapie an unkontrollierbaren Immunreaktionen, die Mediziner als »Zytokinsturm« bezeichnen. Die ­rasche Zerstörung von Tumorgewebe kann auch zum so genannten Tumorlyse-Syndrom führen. Es tritt auf, wenn sich Bestandteile abgestorbener Tumorzellen massenhaft über den Kreislauf im Körper verteilen. »Unser Organismus ist nicht darauf ausgelegt, Tumoren mit einer Masse von drei bis acht Pfund in kürzester Zeit abzubauen«, sagt Bruce Levine, Direktor an der Einrichtung für klinische Zell- und Impfstoffproduktion der University of Pennsylvania. Doch genau SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 dies geschehe, wenn adoptive Zelltherapien innerhalb weniger Tage zur Zerstörung großer Tumoren führten. Sowohl TCR- als auch CAR-Therapien durchlaufen zurzeit klinische Studien, in denen ihre Wirkung gegen verschiedene Krebsarten getestet wird. Das sind Eierstock- und Bauchspeicheldrüsenkrebs, Glioblastome (Hirntumoren) und Mesotheliome (Brust-, Bauchfell- und Herzbeuteltumoren). Die Ergebnisse dieser Studien werden zeigen, ob sich die genannten Therapieansätze für einen breiteren Einsatz eignen. Hier sind noch viele Fragen offen, etwa, weshalb manche Patienten stärker vom adoptiven Zelltransfer profitieren als andere. Einer der Gründe hierfür ist sicher die Variabilität der Immunzellen. Die T-Zellen mancher Patienten sind möglicherweise in ihrer Funktionalität stärker beeinträchtigt oder vermehren sich schlechter als die Zellen an­derer Betroffener. Es erscheint daher dringend nötig, Biomarkermoleküle zu finden, anhand derer man funktionsfähige Immunzellen erkennen kann. Diese Marker könnten dazu dienen, den Erfolg der Therapie vorher abzuschätzen, nur die »besten« Immunzellen für die Therapie auszulesen oder den Behandlungsfortschritt zu überwachen. Die momentan verfügbaren adoptiven Zelltherapien sind Spezialverfahren, die weltweit nur an wenigen universitären Behandlungszentren praktiziert werden. Bislang wurden sie fast ausschließlich in kleinen Pilotstudien getestet – an Patienten, deren Tumorerkrankungen bereits weit fortgeschritten waren und die auf Chemotherapien nicht mehr ansprachen. Mittlerweile laufen die ersten größeren Studien an. Da es mehreren Forscherteams in den zurückliegenden Jahren gelang, den klinischen Nutzen dieser Therapieverfahren zu bestätigen, erfährt die adoptive Zelltherapie zunehmend Aufmerksamkeit seitens der Pharmaindustrie (siehe Kasten S. 64). Wenn man freilich Patienten in großem Stil mit genetisch ver­änderten Zellen behandeln will, braucht man kostengünstigere, schnellere und stärker automatisierte Verfahren, um Immunzellen zu modifizieren und zu kultivieren. Was ist die beste Strategie? Derzeit zielen die Pharmaunternehmen mit ihren adoptiven Zelltherapien auf häufige Tumorantigene wie CD19 und MAGE-A3. Nicht alle Forscher halten dies für den richtigen Ansatz. Rosenberg etwa glaubt, die besten Erfolgsaussichten habe eine vollständig personalisierte Therapie, bei der man die Immunzellen so verändert, dass sie auf Krebsantigene abzielen, die sich nur auf den Tumorzellen des jeweiligen ­Patienten finden und nirgendwo sonst. Eine solche Behandlung, erläutert Rosenberg, setze eine umfassende genetische Analyse der Tumorzellen voraus, um deren spezifische Mutationen und Antigene zu finden. Dieser Ansatz sei zwar sehr aufwändig, doch »wir sollten erst einmal eine funktionierende Heilungsmethode finden, auch wenn sie sehr kompliziert ist, und uns später darum kümmern, sie breiter anwendbar zu machen«. Vor drei Jahren stellten zwei amerikanische Organisationen – das gemeinnützige Cancer Research Institute in New WWW.SPEK TRUM .DE York sowie die Entertainment Industry Foundation in Los Angeles – zusammen sechs Millionen Dollar zur Verfügung, um die Möglichkeiten des adoptiven Zelltransfers auszu­ loten. Mit dem Geld sollen renommierte Krebsforscher he­ rausfinden, ob sich die Therapie mit einem anderen Behandlungsansatz kombinieren lässt, der ebenfalls große Hoffnungen unter Medizinern weckt: dem Einsatz von so genannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Das sind Arzneistoffe, die körpereigene Abwehrreaktionen gegen Tumorzellen intensivieren, indem sie ­immunhemmende Signale unterdrücken (siehe die zwei voranstehenden Artikel). Diese beiden Therapiemethoden sollten sich in ihrer Wirkung gegen den Krebs gegenseitig verstärken, was vorläufige Studienergebnisse zu bestätigen scheinen. Trotz ungeklärter Fragen halten viele Forscher und Ärzte den adoptiven Zelltransfer für einen viel versprechenden Behandlungsansatz. Sie lässt sich sehr gut auf die individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Patienten abstimmen und flexibel an methodische Fortschritte anpassen. »Das ist nicht bloß der nächste kleinmolekulare Arzneistoff oder die nächste Antikörpertherapie«, meint Sadelain, »das ist ein grundlegend neues Verfahren.« Ÿ DI E AUTORI N Courtney Humphries ist Wissenschaftsjourna­ listin in Boston, Massachusetts. QUELLEN Brentjens, R. J. et al.: CD19-Targeted T Cells Rapidly Induce Molecular Remissions in Adults with Chemotherapy-Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia. In: Science Translational Medicine 5, 177ra38, 2013 Kalos, M. et al.: T Cells with Chimeric Antigen Receptors Have Potent Antitumor Effects and Can Establish Memory in Patients with Advanced Leukemia. In: Science Translational Medicine 10, 95ra73, 2011 Robbins, P. F. et al.: Tumor Regression in Patients with Metastatic Synovial Cell Sarcoma and Melanoma Using Genetically Engineered Lymphocytes Reactive with NY-ESO-1. In: Journal of Clinical Oncology 29, S. 917 – 924, 2011 Rosenberg, S. A.: Cell Transfer Immunotherapy for Metastatic Solid Cancer – what Clinicians Need to Know. In: Nature Reviews Clinical Oncology 8, S. 577 – 585, 2011 WEBLI N KS Diesen Artikel, weitere Literatur und weiterführende Informationen finden Sie im Internet: www.spektrum.de/artikel/1286303 © Nature Publishing Group www.nature.com Nature 504, S. S13 – S15 67 INFOGRAFIK ZELLULÄRE MOBILMACHUNG Forscher verstehen die Biologie des Immunsystems sowie von Tumoren immer besser. Mit diesen Erkenntnissen erkunden sie neue Wege, um Krebs mit körpereigenen Waffen zu schlagen. Natürliche Immunantwort Effektorzelle fördert die Vermehrung von B-Zellen, die Antikörper herstellen. Zu Beginn der spezifischen Immunantwort des Körpers präsentieren spezialisierte Zellen in den Lymphknoten unreifen Immunzellen Bruchstücke körperfremden Materials, so genannte Antigene. unreife T-Zelle Gedächtniszelle ermöglicht eine raschere Antwort, wenn das Antigen noch einmal auftritt. Vermehrung Reifung Umherwandernde dendritische Zellen (DC) nehmen Fremdmaterial auf und zerlegen es. DC präsentieren das fremde Antigen unreifen T-Zellen. Regulatorische T-Zelle produziert Zytokine, welche die Immunreaktion im Zaum halten. Aktivierte T-Zellen setzen Zytokine frei, was eine Immunantwort auslöst, darunter die Vermehrung und Reifung von T-Zellen. Killerzelle erkennt und tötet körperfremde Zellen. Therapeutische Vorgehensweisen Die derzeitigen Krebsimmuntherapien gehören zu einem der folgenden drei Grundtypen: Unspezifische Immuntherapien Zytokine und weitere Stoffe, die eine allgemeine Immunantwort hervorrufen, eignen sich auch als Hilfsstoffe (Adjuvanzien) für andere Therapien, etwa Impfungen. Künstlich hergestellte Zytokine fördern die Vermehrung von Immunzellen. Immunzelle Monoklonale Antikörper Impfstoffe Diese Proteine heften sich an spezifische Antigene an der Oberfläche von Krebszellen. Impfstoffe lassen sich aus Krebszellen, Zellteilen oder Antigenen herstellen. mögliche Anwendungen: einer der derzeit getesteten Ansätze: Medikamente zu den Zielzellen bringen DC eines Patienten werden ihm zusammen mit einem krebsspezifischen Antigen wieder gespritzt. Krebszelle Antigen Medikament DC Zellen für Zerstörung markieren SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / ART FOR SCIENCE, NACH: NATURE 504, S. S2, 2013 Die DC präsentieren das Antigen anderen Immunzellen. Helfer-T-Zelle biochemischen Signalweg blockieren, um Wachstum oder Vermehrung zu stoppen Krebszelle 68 Immunzellen attackieren die Krebszellen und töten sie. Antigen unreife T-Zelle Aktivierte T-Zellen erkennen Tumoren, reifen und vermehren sich. Killerzelle Krebszelle SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Suche nach Synergien Einzelne Immuntherapien für sich genommen waren bisher nur mäßig effektiv. Daher suchen Forscher geeignete Kombinationen von Behandlungen, die ihre Wirksamkeit gegenseitig verstärken. Das Schema zeigt das Konzept eines zukünftigen idealen Ansatzes, der bereits funktionierende Therapien mit Substanzen kombiniert, die sich noch in klinischen Studien befinden oder sogar nur theoretisch existieren. 1 Direkte Umgebung des Tumors Medikamente blockieren Apoptose (programmierten Der erste Therapieabschnitt macht die Zelltod) in Tumorzellen und Krebszellen verwundbar gegenüber hemmen regulatorische einer Immunattacke. T-Zellen. Gezielt veränderte Viren dringen in Krebszellen ein und zerstören sie, was die angeborene Immunabwehr aktiviert. Antigenpräsentierende Zellen (APC) tragen Tumorantigene auf der Oberfläche. DER LANGE WEG ZUR IMMUNTHERAPIE 1891 Als der Chirurg William Coley liest, dass der Tumor eines Patienten nach einer Bakterieninfektion verschwand, beginnt er, Krebspatienten Bakterien zu spritzen (siehe Artikel ab S. 70). 1909 Der Biologe Paul Ehrlich vermutet, dass Immunzellen den Körper nach Krebszellen absuchen, um deren Wachstum zu verhindern. 1953 Mäuse mit Tumoren zeigen auch noch nach deren Entfernung eine Immunreaktion gegen Krebszellen, was auf die Existenz tumorspezifischer Antigene hindeutet. 1957 Entdeckung von Interferon, einem immunstimulierenden Zytokin, das später in unspezifischer Krebsimmuntherapie eingesetzt wird 2 Impfstoff Killerzellen setzen Toxine frei, die Tumorzellen töten können. Enthält krebsspezifische Antigene, unspezifische Adjuvanzien und andere Moleküle, die das Immunsystem ankurbeln. APC-aktivierende Moleküle Zytokine aktivieren T-Zellen. 4 Blutbahn Aktivierte T-Zellen gelangen zum Tumor. tumorspezifische Antigene Antikörper fördern die T-Zell-Aktivierung und verhindern ihre Hemmung. 1959 Bacillus Clamette-Guérin (BCG), ein Tuberkuloseimpfstoff, hemmt Tumorwachstum bei Mäusen. 1973 Ralph Steinman und Zanvil A. Cohn beschreiben die dendritischen Zellen, die als antigenpräsentierende Zellen im Immunsystem dienen. 1983 Entdeckung der T-Zell-Rezeptoren, die von anderen Immunzellen präsentierte Antigene erkennen und daraufhin die Immunantwort verstärken 1986 Die ersten humanisierten Antikörper werden von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. gegen Krebs, Tituximab, wird von der FDA für die Behandlung des Non-HodgkinLymphoms zugelassen. Killerzelle Helfer-T-Zelle 2008 3 Lymphknoten APC präsentieren Antigene aus dem Impfstoff unreifen T-Zellen, worauf diese ausreifen und sich vermehren. WWW.SPEK TRUM .DE Der erste therapeutische Krebsimpfstoff, Oncophage, wird in Russland zur Behandlung von Nierenkrebs eingesetzt. 2010 Die FDA genehmigt den Krebsimpfstoff Provenge gegen Prostatakrebs. Diese Grafik im Internet: www.spektrum.de/artikel/1286304 69 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / ART FOR SCIENCE, NACH: NATURE 504, S. S3, 2013 1997 Der erste monoklonale Antikörper IMMUNTHERAPIE IV Bakterien gegen Tumoren Vor mehr als einem Jahrhundert entdeckte der Arzt William Coley einen Weg, das menschliche Immunsystem für den Kampf gegen Krebs ­einzuspannen. Jetzt wollen Forscher an damalige Erfolge anknüpfen. Von Sarah DeWeerdt A MIT FRDL. GEN. VON DON MACADAM n einem Herbsttag im Oktober 2005 stieg Donald MacAdam die Treppen hinab in die Archive der Yale University in New Haven, USA, wo er über 100 Jahre alten Krankenakten brütete und zwi­ schendurch immer wieder handschriftliche Notizen machte. Währenddessen versuchten seine Mitarbeiter im Labor des kanadischen Unternehmens MBVax Bioscience gerade, ei­ nen alten Bakterienstamm aus einem Patienten, der 1924 an Scharlach gestorben war, zu kultivieren, und experimen­ tierten dabei auch mit Techniken aus angestaubten Lehr­ büchern. Unter anderem züchteten sie die Mikroben auf ­Rinderhackfleisch, wie es im 19. Jahrhundert durchaus gän­ gig war. Wozu der Blick in die Vergangenheit? Die Forscher arbei­ teten daran, eine durchschlagende Krebstherapie zu entwi­ ckeln. Hierfür versuchten sie ein therapeutisches Verfahren zu rekonstruieren, das ein junger amerikanischer Arzt na­ mens William Coley gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwi­ ckelt hatte – und mittlerweile weit gehend in Vergessenheit geraten war. Coley hatte Bakterien benutzt, um das Leben seiner Krebspatienten zu verlängern. Im Jahr 1890 starb eine seiner ersten Patientinnen an einem Sarkom, einem Tumor des Stützgewebes. Tief erschüttert durchforstete der Arzt die me­ dizinische Literatur, um irgendein Behandlungsverfahren Ein historisches Bakterienpräparat (links), daneben die moderne Version. 70 gegen Krebs zu finden. Er stieß auf einen Bericht über einen Patienten, dessen Sarkom nach einer bakteriellen Infektion der Haut verschwunden war. Coley gelang es, den Mann aus­ findig zu machen, und stellte fest, dass der Patient – sieben Jahre nach der Infektion – immer noch tumorfrei war. Und offenbar handelte sich nicht um einen Einzelfall. Schon bald fand der Arzt weitere Dokumente, die teils Jahr­ hunderte zurückreichten und über spontane Rückbildungen von Tumoren nach einer Infektion berichteten. Daraus lei­ tete er die Vermutung ab, die Konfrontation mit Krankheits­ erregern könne das Immunsystem von Krebspatienten dazu anregen, den Tumor zu bekämpfen. Er isolierte jene Keime, mit denen sich der von ihm aufgesuchte Mann angesteckt hatte, bevor sein Sarkom verschwand. Es handelte sich um das Bakterium Streptococcus pyogenes, eine kugelförmige Mikrobe, die Infektionen des Rachenraums und der Haut verursacht. Damit infizierte Coley einen seiner eigenen Sar­ kompatienten – mit durchschlagendem Erfolg: Binnen Wo­ chen bildeten sich die Symptome von dessen Krebserkran­ kung in dramatischer Weise zurück. Besser als heutige Therapien In den folgenden 40 Jahren behandelte Coley hunderte wei­ tere Patienten mit Bakterienpräparaten, wobei er ständig ­daran arbeitete, die Therapie zu verbessern. Bald ging er dazu über, durch Hitze abgetötete Bakterien statt lebender zu ver­ wenden, um die Risiken der Behandlung zu verringern. Auch versuchte er, die Wirksamkeit der Therapie zu erhöhen, in­ dem er seine Patienten mit zwei unterschiedlichen Bakte­ rienspezies infizierte. Der damit erzielte klinische Erfolg ist selbst nach heutigen Maßstäben beachtlich. Etwa jeden vierten Sarkompatienten, den Coley behandelte, konnte er heilen. Zudem therapierte er etliche Menschen mit anderen bösartigen Tumoren, von denen einige ebenfalls genasen. Im Jahr 1999 verglichen Forscher die dokumentierten Daten von 128 Patienten Coleys mit denen von 1675 Krebskranken, die moderne The­ rapien durchlaufen hatten. Das verblüffende Ergebnis: Der Arzt erzielte mit seiner Behandlung eine mittlere (genauer: mediane) Überlebenszeit der Betroffenen von 8,9 Jahren, ver­ SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 CANCER RESEARCH INSTITUTE / PUBLIC DOMAIN Der amerikanische Onkologe William Coley (Mitte) entwickelte vor 100 Jahren die erste immunologische Tumortherapie. glichen mit 7,0 Jahren bei heutigen Patienten. Die Hälfte von Coleys Sarkompatienten hatte nach der Behandlung noch mindestens zehn Jahre gelebt; unter heutigen Patienten sind es nicht einmal 40 Prozent. Auch bei Betroffenen mit Nierenund Eierstockkrebs verbesserte Coley die 10-Jahres-Über­ lebensraten. Trotzdem geriet sein immuntherapeutischer Ansatz bald aus dem Blick der Mediziner. Um die Mitte des 20. Jahrhun­ derts herum entwickelten sich stattdessen Strahlen- und Chemotherapie zu den gängigen Behandlungen bei Krebs. Das hatte gute Gründe: Während sich die modernen Ver­ fahren relativ leicht standardisieren lassen, musste Coley sei­ ne Methode noch sorgfältig auf jeden einzelnen Patienten abstimmen. Zudem schien die Bakterienkur bei anderen ­Krebsarten nicht so gut zu wirken wie bei Sarkomen. Es war unbekannt, auf welchem Mechanismus die Therapie basier­ te, und obendrein scheiterten mehrere Ärzte daran, Coleys klinische Erfolge zu reproduzieren. Vielleicht erleben wir aber schon bald eine Renaissance seines Therapieansatzes. Denn heute verstehen die Forscher viel besser als damals, wie das Immunsystem funktioniert. Auch der Zusammenhang zwischen Infektionen und Tumor­ rückbildungen ist gründlicher untersucht, ebenso wie einige Details von Coleys Arbeiten, die früher unbeachtet blieben. WWW.SPEK TRUM .DE Während seines langjährigen Wirkens als Arzt arbeitete Coley mit zahlreichen Bakteriologen zusammen, woraus mehr als 20 verschiedene Versionen seines Bakterienprä­ parats hervorgingen. »Einer Bakteriologin namens Martha Tracy gelang die Herstellung jener Variante, mit der die größ­ ten klinischen Erfolge erzielt wurden«, schildert Stephen Hoption Cann von MBVax. Um daran anzuknüpfen, ver­ suchen die MBVax-Forscher, das Präparat mit modernen La­ bortechniken nachzubilden. Ihre Version des Medikaments besteht aus abgetöteten Bakterien der Sorte Streptococcus pyogenes, die bereits Coley verwendet hatte, sowie Serratia marcescens, leuchtend roten, stäbchenförmigen Bakterien, die einen Farbstoff namens Prodigiosin mit immunstimulie­ renden Eigenschaften enthalten (siehe Bilder S. 73). Bisher hat MBVax noch keine kontrollierten Studien mit dem Präparat durchgeführt. Dennoch erhielten zwischen 2007 und 2012 etwa 70 Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen die Mixtur. Die Betroffenen litten an Melanomen, Lymphomen oder bösartigen Tumoren in der Prostata, der Brust oder den Eierstöcken. Nach Angaben des Unternehmens schrumpften die Geschwulste bei etwa 70 Prozent der Patienten und verschwanden bei 20 Prozent voll­ ständig. Andere Teams forschen über ähnliche Bakterienpräpa­ rate. 2012 testeten deutsche Wissenschaftler eine Mischung aus wärmebehandelten Streptococcus pyogenes und Serratia marcescens in einer klinischen Phase-I-Studie mit zwölf Krebspatienten. Sie verzeichneten bei den Betroffenen eine vermehrte Ausschüttung von Zytokinen – Botenstoffen, wel­ che die Immunreaktion verstärken. Bei einem Patienten bil­ dete sich der Tumor sogar zurück, obwohl die Studie gar nicht auf dieses Ziel hin ausgelegt gewesen war. Doch sprechen offenbar nicht alle Patienten auf die The­ rapie an. Die Gründe dafür möchten die Wissenschaftler bei MBVax als Nächstes herausfinden. Bevor sie eine klinische Studie durchführen können, um diese Frage zu beantworten, muss das Unternehmen allerdings erst einmal eine mehrere Millionen Dollar teure Produktionsanlage errichten, die amerikanischen und europäischen Vorgaben für die Medika­ mentenherstellung genügt. AUF EINEN BLICK SPIEL MIT DEN KEIMEN 1 Vor gut 100 Jahren entwickelte der Arzt William Coley am New York Cancer Hospital eine Krebstherapie, die aus heutiger Sicht ungewöhnlich anmutet: Er behandelte seine Patienten mit Bakterienpräparaten. 2 Coley erzielte damit beachtliche Erfolge, so konnte er etwa jeden vierten Sarkompatienten heilen. In mancher Hinsicht war sein Behandlungsansatz heutigen Krebstherapien überlegen. 3 Forscher versuchen derzeit, Coleys Bakterienkur nachzuahmen und weiterzuentwickeln – und melden erste Erfolge dabei. Zudem klären sie den Wirkmechanismus immer weiter auf. 71 Zahlreiche weitere Hürden stehen einer Rückkehr von Coleys Immuntherapie im Weg. »Es ist sehr schwierig, von den zuständigen Behörden die Zulassung für einen Bakte­ rienextrakt zu erhalten«, erläutert Uwe Hobohm, Biologe und Bioinformatiker an der Technischen Hochschule Mittel­ hessen in Gießen, der sich ebenfalls dafür einsetzt, Coleys Therapieverfahren neu zu beleben. Die Zulassungsbehörden bevorzugen Einzelsubstanzen mit definiertem Wirkmecha­ nismus an Stelle von Bakterienpräparaten mit vielfältigen aktiven und inaktiven Molekülen sowie einer großen mög­ lichen Bandbreite an Mechanismen. Hobohm hält es daher für besser, die Wirkungen der Bak­ teriengemische erst genau aufzuklären und dann Medika­ mente zu entwickeln, die wie Coleys Präparate bakterielle Wirkstoffe enthalten, jedoch in gereinigter und standardi­ sierter Form, um ihre Zulassung zu erleichtern. Er vermutet, dass der klinische Erfolg von Coleys Bakterienkur auf eine bestimmte Gruppe von Molekülen zurückzuführen ist, näm­ lich jene, die sich an »pattern-recognition receptors« (PRR, zu Deutsch: Mustererkennungsrezeptoren) heften. Bakteri­ en produzieren eine Vielzahl solcher PRR-Liganden, darunter Lipopolysaccharide, bestimmte Proteine und DNA. Diese Moleküle aktivieren die so genannten dendritischen Zellen, welche die frühen Phasen einer Immunreaktion einleiten, indem sie anderen Zellen der Körperabwehr Bestandteile von Krankheitserregern präsentieren. Früher vermuteten viele Forscher, das Immunsystem greife Tumoren häufig deshalb nicht an, weil es sie nicht als fremd erkenne. Doch Hobohm hält dies nur für die halbe Wahrheit. Eine dendritische Zelle, postuliert er, müsse erst auf einen PRR-Liganden treffen, bevor sie andere Immun­ zellen (vor allem T-Lymphozyten) voll aktivieren könne. Da jedoch Krebszellen keine PRR-Liganden erzeugen, gelinge es den dendritischen Zellen nicht, eine wirksame Immunreak­ 72 tion gegen den Tumor in Gang zu setzen. »Zwar attackiert die Körperabwehr den Tumor für gewöhnlich, doch meist zu schwach«, meint Hobohm. »Den dendritischen Zellen feh­ len einfach PRR-Liganden, um die Abwehrmaschinerie hin­ reichend anzukurbeln.« Dauerbombardement mit bakteriellen Substanzen Hobohm prüfte diese Hypothese, indem er Mäusen mit künstlich erzeugten Tumoren eine Mischung kommerziell erhältlicher PRR-Liganden aus Bakterien spritzte. Zuvor hat­ ten andere Forscher in ähnlichen Experimenten nur einzel­ ne PRR-Liganden verabreicht oder, falls sie mehrere Ligan­ den kombinierten, nur wenige Dosen der Mixtur gegeben. Coley dagegen gab die Bakterienpräparate über mehrere ­Wochen und teils über Monate hinweg, und zwar mindes­ tens ein- bis zweimal wöchentlich. In Anlehnung an Coleys Methoden spritzte Hobohm über einen Zeitraum von drei Wochen hinweg insgesamt zehnmal eine Mischung aus drei verschiedenen PRR-Liganden. Hinterher waren vier von fünf Mäusen tumorfrei. Eine der in der Studie verwendeten Substanzen, MistelLektin, nutzen europäische Mediziner schon länger zur un­ terstützenden Therapie von Krebserkrankungen. Erst vor Kurzem stellte sich heraus, dass es sich um einen PRR-Ligan­ den handelt. Laut Hobohm ähnelt die Struktur des Moleküls verblüffend der eines Giftstoffs, den das Bakterium Shigella dysenteriae erzeugt. Vermutlich löst Mistel-Lektin also – ebenso wie das bakterielle Gift – eine Immunreaktion aus. Auch der Wirkstoff Imiquimod, den Ärzte gegen einen be­ stimmten Hautkrebstyp, das Basaliom, einsetzen, dürfte ein PRR-Ligand sein. Hobohm vermutet, die Wirksamkeit beider Substanzen ließe sich durch kombiniertes Verabreichen zu­ sammen mit anderen PRR-Liganden steigern. Therapien auf der Basis von PRR-Liganden erzeugen aller­ dings häufig Fieber bei den Behandelten, ganz ähnlich wie die Bakterien, aus denen die Stoffe ursprünglich stammen. Da Fieber in der Regel eine Infektion anzeigt, gilt es in Stu­ dien zur Medikamentenentwicklung als unerwünschte Nebenwirkung. Tatsächlich starben einige von Coleys ­Patienten an Infektionen, als der Arzt anfänglich noch ­lebende Bakterien einsetzte. Andererseits überlebten ­solche Patienten, die nach dem Verabreichen seiner Prä­ parate hohes Fieber entwickelt hatten, insgesamt länger als jene, bei denen keine oder nur eine geringe Temperatur­ erhöhung zu verzeichnen gewesen war. Laut unveröffentlichten Daten erkranken Empfänger des MBVax-Präparats seltener an Infek­ tionen als andere Krebspatienten, und zwar trotz therapiebedingten Fiebers. Demzufolge scheint das Präparat nicht zu schaden. Doch die Vorbehalte gegenüber erhöh­ ter Körpertemperatur erschwe­ ren es manchen Wissenschaftlern, SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 BRUDERSOHN / CC-BY-SA-3.0 (CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/3.0/LEGALCODE) CDC / MELISSA BROWER Bakterielle Infektionen mit Streptococcus pyogenes (links) und Serratia marcescens (rechts, eine Kolonie auf Agar-Nährboden) können Tumorerkrankungen zurückdrängen. Geldmittel für ihre Studien zu erhalten, wie Stephen Hop­ tion Cann erläuternd hinzufügt. Andere Forscher stellen in Frage, ob Fieber für den Hei­ lungserfolg notwendig ist. »Brauchen wir die Temperatur­ erhöhung wirklich, oder ist sie nur eine Begleiterscheinung der Therapie?«, fragt Simon Sutcliffe von der Firma Qu Biolo­ gics in Vancouver, Kanada. Sein Unternehmen verfolgt einen anderen, ebenfalls von Coley inspirierten Ansatz und erzielt damit bereits viel versprechende Behandlungserfolge bei Krebspatienten im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium – ohne Fieber zu verursachen. Für jedes Organ der richtige Keim Hal Gunn, der Gründer und Direktor von Qu Biologics, ent­ deckte in Coleys Daten einen Zusammenhang, der anderen zuvor entgangen war. Coleys Therapie wirkte immer dann am besten, wenn die Tumoren in denjenigen Geweben sa­ ßen, die am anfälligsten gegenüber dem Bakterium Streptococcus pyogenes sind. Jede krankheitserregende Mikrobe in­ fiziert nämlich bevorzugt bestimmte Organe oder Körper­ regionen. »In mir keimte der Verdacht, die Wirkung der Bakterienkur könne auf einer gewebespezifischen Immun­ reaktion beruhen«, erinnert sich Gunn. Qu Biologics hat seit­ dem eine Reihe von Immuntherapeutika entwickelt, und zwar jeweils aus Bakterienspezies mit einer bestimmten Or­ ganpräferenz: Escherichia coli für den Darm, Klebsiella pneumoniae für die Lunge und so weiter. Gunn bezeichnet sie als »site-specific immunomodulators« (SSI; deutsch: ortsspezi­ fische Immunmodulatoren). Gunn und seine Kollegen vermuten, dass die SSI das Im­ munsystem auf die Bekämpfung von Krebszellen einstellen, WWW.SPEK TRUM .DE indem sie am Ort des Tumors eine Infektion nachahmen. Insbesondere beeinflussten SSI-Moleküle wohl die Aktivität von Makrophagen: Immunzellen, die sich an frühen Phasen der Abwehrreaktion beteiligen. Die SSI, so Gunn, program­ mieren Makrophagen derart um, dass diese verstärkt dazu übergehen, abnorme Zellen zu zerstören. Mehr als 250 Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren wurden bereits mit SSI-Präparaten von Qu Biologics behan­ delt. Zwar liegt bisher keine randomisierte Vergleichsstudie vor, doch eine unabhängige Auswertung der Daten ergab, dass die SSI-Therapie die mediane Überlebenszeit von Patien­ tinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs um 20 Monate ver­ längert hatte. Bei anderen Tumoren in einem späten Stadi­ um betrug der Vorteil rund zwölf Monate. Qu Biologics plant für 2014 eine klinische Studie mit Lungenkrebspatienten. Die Befürworter von Coleys Therapieansatz halten die Zeit für gekommen, die historischen Therapieerfolge end­ lich mit handfesten Untersuchungen zu belegen. »Nur kli­ nische Studien können beweisen, dass diese Form der Im­ muntherapie den Krebspatienten tatsächlich nützt«, sagt Stephen Hoption Cann. »Und erst dann werden Therapien nach Coleys Vorbild auf dauerhaftes Interesse stoßen.« Ÿ DI E AUTORI N Sarah DeWeerdt ist Wissenschaftsjourna­listin in Seattle, Washington, USA. Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1286305 © Nature Publishing Group www.nature.com Nature 504, S. S4 – S5 73 INTERVIEW: THIERRY BOON 1991 entdeckten Forscher um Thierry Boon die erste Struktur an der Oberfläche von Krebszellen, die von Immunzellen erkannt wird – ein Durchbruch, der die molekulare Grundlage für die Krebsimpfung schuf. Die Arbeiten von Boon und seinem Team trugen maßgeblich dazu bei, die Rolle des Immunsystems bei Tumor­ erkrankungen aufzuklären. Wir fragten ihn, wie es zu dieser Entdeckung kam, was man daraus über Tumor­ erkrankungen lernen kann und wohin seiner Meinung nach die Krebsimmuntherapie steuern muss. Professor Boon, Sie haben das erste Tumorantigen entdeckt – also die erste molekulare Struktur auf Krebszellen, die von der Körperabwehr als fremd erkannt und attackiert wird. War das der Durchbruch Ihrer Karriere? Boon: Die Wende war für mich eigentlich schon 20 Jahre früher gekommen, als ich im Labor von François Jacob am Institut Pasteur in Paris arbeitete. Ich forschte damals über die Embryonalentwicklung von Mäusen, denen wir Zellen aus sehr speziellen Tumoren einsetzten, nämlich aus Tera­ tokarzinomen. Das sind embryonale Tumoren, die pluripo­ tente Stammzellen enthalten und sich daher in die unter­ schiedlichsten Körpergewebe ausdifferenzieren können. Dabei entstehen zum Beispiel Geschwülste, die Zähne oder Haare enthalten. Ich versuchte, die Tumorzellen so zu ver­ ändern, dass sie sich nicht mehr ausdifferenzieren. So woll­ te ich Gene finden, die maßgeblich an der Embryonalent­ wicklung mitwirken. Wie kam da die Immunologie ins Spiel? Boon: Durch einen Zufall. Wir hatten ein merkwürdiges Phänomen beobachtet: Wenn wir die Tumorzellen mit ei­ ner Substanz behandelten, die viele Mutationen im Erbgut verursacht, bildeten sie zwar nach wie vor Tumoren im Kör­ per der Mäuse. Doch in einigen Fällen wucherten die Ge­ schwülste nach zwei Wochen nicht mehr weiter und fingen stattdessen an, sich zurückzubilden. Das Immunsystem der Tiere war also dazu übergegangen, sie zu bekämpfen. Mich machte das stutzig, und ich setzte den Tieren, die die mu­ tierten Tumorzellen abgestoßen hatten, auch Zellen aus dem originalen tödlichen Tumor ein. 74 LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH (LICR) BRÜSSEL »Eine Kettenreaktion, die den Tumor zerstört« Thierry Boon ist Genetiker und war bis 2011 Direktor am Ludwig Institute for Cancer Research in Brüssel. Seit 2009 ist er Mitglied der National Academy of Science (NAS) in den USA. Mit welchem Ergebnis? Boon: Einige Wochen, nachdem ich die Tumorzellen in die Mäuse verpflanzt hatte, untersuchte ich die Tiere. Und fand keinen Tumor! Da spürte ich, dass ich auf etwas Wichtiges gestoßen war. Offenbar hatte die erfolgreiche Auseinander­ setzung mit den veränderten Tumorzellen dazu geführt, dass die Körperabwehr der Mäuse jetzt auch den originalen Tumor abwehren konnte. Es war, als ob ihr Immunsystem nun etwas sehen konnte, was es vorher ignoriert hatte ... ... nämlich ein Antigen auf den entarteten Zellen. Boon: Das wussten wir damals nicht. Es sollte noch mehre­ re Jahre dauern, bis wir es herausfanden. Zusammen mit dem Immunologen und Zellbiologen Jean-Charles Cerottini in Lausanne testeten wir, wie Mauslymphozyten auf Pro­ teinbruchstücke reagieren, die Krebszellen auf ihrer Außen­ seite tragen. Es stellte sich heraus: Einige mutierte Tumor­ varianten, die von den Mäusen abgestoßen worden waren, hatten stark veränderte Proteinbruchstücke auf ihrer Ober­ fläche. Das war offenbar der Grund gewesen, warum das Im­ munsystem sie als fremd eingestuft und angegriffen hatte. Der originale Tumor dagegen präsentierte Bruchstücke aus normalen Proteinen, allerdings aus solchen, die üblicher­ weise nur in Keimzellen vorkommen. Die Auseinanderset­ zung mit den mutierten Tumorzellen hatte die Körperab­ wehr quasi darauf gestoßen, dass mit den Zellen des Origi­ naltumors etwas nicht stimmte. Funktioniert das auch beim Menschen? Boon: Ende der 1980er Jahre begannen wir, an menschli­ chen Tumorzellen zu forschen. Alexander Knuth aus Mainz SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 hatte mich kontaktiert wegen einer Patientin, die unheilbar am metastasierten Melanom erkrankt war. Es war ihm ge­ lungen, ihre Tumorzellen zu kultivieren, und er kam mit ih­ nen im Gepäck zu uns nach Brüssel. Wir veränderten die Zel­ len genau so, wie wir es bei der Maus gemacht hatten, und Knuth verabreichte sie der Patientin zurück. Und obwohl die Frau eigentlich nicht mehr auf Besserung hoffen durfte, passierte etwas Erstaunliches: Zunächst wuchsen ihre Meta­ stasen weiter, dann aber begannen sie sich zurückzubilden und verschwanden schließlich, bis die Patientin völlig aus­ heilte und nach Hause geschickt werden konnte. Das Immunsystem der Patientin hatte also den Krebs angegriffen. Konnten Sie herausfinden, wogegen der Angriff gerichtet war? Boon: 1991 entdeckten wir auf den originalen – also unver­ änderten – Krebszellen der Patientin das Proteinbruch­ stück Mage-1. Die Abkürzung steht für »Melanoma Antige­ ne 1«. Wie bei der Maus stammt es aus einem normalen Protein, das aber üblicherweise nur Keimzellen produzie­ ren. Sein Vorhandensein auf den Tumorzellen hatte das Im­ munsystem der Patientin nach unserem Eingriff offenbar dazu bewogen, die Zellen als fremd einzustufen. Wir hatten die Idee, mit diesem und anderen kleinen Proteinbruchstü­ cken Patienten zu impfen, um ihre Lymphozyten zu einem Angriff auf den Tumor anzustacheln. Vielleicht, so dachten wir, ließe sich damit der Umweg vermeiden, die Tumorzel­ len zu entnehmen, künstlich zu verändern und wieder in den Körper der Patienten zurückzubringen. Hatten Sie Erfolg? Boon: Die ersten Versuche verliefen erstaunlich gut. Bei drei oder vier geimpften Patienten bildeten sich die Tumo­ ren stark zurück. Allerdings ließ der Erfolg mit der Zeit nach: Je mehr Patienten wir behandelten, desto kleiner wurde der Anteil, der von dem Eingriff profitierte. Heute führt die therapeutische Impfung bei etwa einem von zwölf Patienten zu einer spürbaren Besserung. Wie ist diese kleine Zahl zu erklären? Boon: Anfangs dachten wir, bei den Patienten, die nicht hin­ reichend auf die Impfung ansprechen, klappe die Immuni­ sierung nicht – die Impfung schalte also gewissermaßen zu wenig Abwehrzellen scharf, um den Tumor zurückzudrän­ gen. Vor einigen Jahren jedoch, als neue Beobachtungsergeb­ nisse vorlagen, haben wir unsere Meinung revidiert; die Sa­ che ist offenbar deutlich komplizierter. Umfassende Immun­ reaktionen gegen den Tumor sind vielfach schon vor der Impfung nachweisbar – allerdings laufen sie ins Leere, als würde der Körper sie hemmen. Eine erfolgreiche Krebsimp­ fung führt dazu, dass die Lymphozyten nun nicht mehr ins Leere stoßen, sondern effektiv gegen den Tumor vorgehen. Wie wir jedoch überrascht feststellten, werden die dabei wirk­ samen Lymphozyten nicht direkt durch die Impfung produ­ ziert. Vielmehr richten sie sich gegen andere Antigene als das geimpfte. WWW.SPEK TRUM .DE Haben Sie eine Ahnung, warum? Boon: Wir glauben, dass die meisten Krebspatienten spon­ tan eine Immunreaktion gegen ihren Tumor entwickeln. Doch der Tumor bildet eine Umgebung um sich herum, die die Immunantwort unterdrückt. Wir nennen diesen Effekt Immunsuppression, und er ist je nach Patient mehr oder weniger stark ausgeprägt. Eine erfolgreiche Krebsimpfung führt vermutlich dazu, dass wenigstens ein paar aktivierte Lymphozyten an den Ort des Tumors gelangen und diesen stark genug angreifen, damit bestimmte Signalmoleküle, so genannte Zytokine, ausgeschüttet werden. Diese Moleküle heben die Immunsuppression lokal auf. Das wiederum gibt anderen Lymphozyten, die bis jetzt nicht wirken konnten, freie Bahn, den Tumor anzugreifen. Es setzt eine Ketten­ reaktion ein, die, wenn sie stark genug wird, bis zur Zerstö­ rung des Tumors führen kann. Die Herausforderung bei ei­ ner Krebsimpfung besteht also unserer Meinung nach nicht darin, massenweise aktive Lymphozyten zu produzieren, die ein ganz bestimmtes Antigen erkennen. Vielmehr reicht es, wenn einige wenige Immunzellen die Schutzumgebung des Tumors durchbrechen – und so einen Funken erzeugen, der einen globalen, viel massiveren Angriff in Gang setzt. Die Wahl des Impfantigens ist also nicht so wichtig? Boon: Sie ist wahrscheinlich nicht das K.-o.-Kriterium, inso­ fern dass andere Lymphozyten als jene, die durch die Imp­ fung aktiviert werden, den größten Teil der Arbeit leisten. Der entscheidende Punkt scheint zu sein, die suppressive Umgebung des Tumors zumindest punktuell zu durchbre­ chen, um den initialen Funken überhaupt zu ermöglichen. Deshalb befürworten wir Krebsimpfungen, die nicht nur auf einen einzigen Impfstoff setzen, sondern noch andere Maßnahmen einbeziehen – zum Beispiel eine lokale Verab­ reichung von Zytokinen, um die Immunhemmung am Ort des Tumors zu reduzieren oder gar auszuschalten. Wie sieht Ihrer Meinung nach die Krebsimmuntherapie der Zukunft aus? Boon: Die Zeit ist gekommen, die Arbeitsweise des Immun­ systems nachzuahmen. Bei einer viralen oder bakteriellen Infektion beschränkt sich unsere Körperabwehr keineswegs auf einen einzigen Mechanismus. Um uns vor schädlichen Mikroorganismen zu retten, die uns in wenigen Tagen um­ bringen können, verfolgt unser Immunsystem Dutzende oder Hunderte von Strategien gleichzeitig. Das Ganze ist eine Art heuristisches Verfahren nach dem Prinzip Versuch und Irrtum, wobei unser Körper sich ständig anpasst – und in den meisten Fällen triumphiert. Auch in der Onkologie wird es keinen Königsweg geben, den Krebs zu besiegen. Wir werden unterschiedliche Komponenten des Immunsystems gleichzeitig beeinflussen müssen, um Tumorerkrankungen erfolgreich zurückzudrängen. Ÿ Das Gespräch führte Emmanuelle Vaniet, promovierte Biologin und Wissenschaftsjournalistin in Darmstadt. 75 IMMUNTHERAPIE V Liveschaltung zum Tumor Die Schlacht zwischen Immunsystem und Krebszellen verläuft oft anders, als Experimente mit Zellkulturen vermuten lassen. Mit raffinierten Mikroskopen verfolgen die ersten Forscher nun direkt im Körper, wie ihre Therapien wirken. Von Katherine Bourzac A uf seinem Computerbildschirm bewegt sich Mark Headley durch eine Landschaft aus Lungen­ zellen einer Maus. Das Tier lebt, es atmet. Eine Steuerungssoftware korrigiert fortwährend die Einstellungen des Mikroskops und hält die Bilder trotz der raschen Bewegungen des Körpers scharf. Headley ist Immu­ nologe an der University of California in San Francisco (UCSF). Er erklärt die Strukturen auf dem Monitor: Rundliche schwarze Bereiche sind luftgefüllte Lungenbläschen, Struk­ turproteine erscheinen als blau leuchtende Fäden in den Zel­ len, dank fluoreszierender Farbstoffe. Gruppen von Blut­ plättchen, ebenfalls farbmarkiert, formen rötliche röhrenar­ tige Gebilde in den Gefäßen. So weit, so normal. Dann schiebt sich plötzlich wie ein Monster ein unförmi­ ger neongrüner Klumpen ins Bild: eine Krebszelle. Die Krea­ tur streckt sich. »Offenbar versucht die Zelle, das Blutgefäß zu verlassen«, erläutert der Leiter von Headleys Arbeitsgrup­ pe, Matthew Krummel. Grüne Fragmente lösen sich. Krum­ mels Team kann noch nicht erklären, was hier gerade ge­ schieht – vielleicht stirbt die Krebszelle ab oder sendet Signa­ le an das Immunsystem. Oder sie tut etwas völlig anderes. Krummel und andere Immunologen machen Filme sol­ cher Vorgänge, um besser zu begreifen, wie das Immunsys­ tem auf Krebszellen reagiert. Das anhand der üblichen Ein­ zelbilder verstehen zu wollen, wäre wie der Versuche, die Fußballregeln aus einem Schnappschuss von Spielern auf AUF EINEN BLICK EINSICHT AN ORT UND STELLE 1 Der Weg zu besseren Krebstherapien beginnt meist in der Petrischale, wo Forscher Tumorzellen mit neuen Wirkstoffen oder Immunzellen konfrontieren. 2 Mitunter verhalten sich Krebszellen und die Bestandteile des Immunsystems im Körper jedoch völlig anders als erwartet, und die Therapien scheitern. 3 Moderne Techniken gestatten Immunologen Beobachtungen im Organismus und ermöglichen neue Erkenntnisse und Therapieansätze. 76 dem Rasen abzuleiten, bemerkt Thorsten Mempel vom Mas­ sachusetts General Hospital in Boston. Indem sie Zellen und Moleküle mit bewegten Bildern darstellen, beginnen die For­ scher, ihr Zusammenspiel zu verstehen. Sie sehen nicht nur, wie stark ein Tumor wächst oder schrumpft, sondern alles, was dazu führte. »Wenn wir die Spielregeln verstehen«, er­ klärt Mempel, »können wir den Verlauf der Partie zu unseren Gunsten beeinflussen.« Heilen ohne Augenbinde Therapien, die Tumoren mit der Hilfe von Immunzellen be­ kämpfen sollten, gab es bereits, bevor Krummel und andere Forscher die Videomikroskopie einsetzen konnten. Die Im­ munologen konnten jedoch nicht verfolgen, ob die Zellen im Körper des Patienten tatsächlich taten, was sie sollten. »Oft enttäuschen Immuntherapien, weil ihre Entwickler im Grun­ de blind waren«, sagt Christopher Contag, Immunologe an der Stanford University im kalifornischen Palo Alto. Im Lauf der letzten rund zehn Jahre gelang es den For­ schern, diese Augenbinde allmählich abzulegen. Inzwischen beobachten sie mit raffinierten mikroskopischen Techniken an lebenden Tieren, wie Immuntherapien auf Tumorzellen wirken. Dabei erkannten sie, dass Experimente mit Zellkul­ turen, die oft den ersten Schritt bei der Entwicklung solcher Behand­lungen darstellen, äußerst irreführend sein können. Vieles, was Zellen in der Petrischale bewerkstelligen, funktio­ niert im Organismus nicht. »Wenn wir unsere Vorstellungen vom Verlauf einer Krankheit unter dem Mikroskop überprü­ fen, stoßen wir stets auf Unerwartetes«, berichtet Contag. Eine der ersten ernüchternden Erkenntnisse war, dass sich Immunzellen im Körper viel Zeit nehmen. In der Petrischale tötet eine so genannte zytotoxische T-Zelle eine Krebszelle binnen weniger Minuten. Im Körper einer Maus hingegen sieht das ganz anders aus, wie Philippe Bousso, Immunologe am Institut Pasteur in Paris, feststellte. Dort benötigt eine TZelle durchschnittlich sechs Stunden. Bousso war einer der ersten Forscher, die solche Prozesse in lebenden Tieren mit der so genannten MultiphotonenFluoreszenzmikroskopie beobachteten. Damit sehen Wis­ senschaftler bis zu 400 Mikrometer unter die Hautoberflä­ SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 che. Sie verwenden hierfür Infrarotlicht, das deutlich weiter als das sichtbare Licht konventioneller Mikroskope in das Ge­ webe eindringen kann. Diese 400 Mikrometer reichen aus, um in lebenden Mäusen Tumoren der Brustdrüse, der Pros­ tata und der Haut zu erkennen. Die Multiphotonenmikroskopie ermöglichte Bousso völ­ lig neue Einblicke in die Vorgänge beim so genannten adop­ tiven Zelltransfer (siehe den Beitrag ab S. 62). Bei dieser The­ rapie entnehmen Biologen körpereigene T-Zellen, trainieren sie für Angriffe auf Krebszellen, vermehren sie und injizieren sie schließlich wieder den Erkrankten. Die Therapie wirkt oft aber nicht so gut wie erhofft. Boussos Beobachtungen zufol­ ge könnte es daran ­liegen, dass die T-Zellen wesentlich lang­ samer arbeiten als erwartet und solide Tumoren immerhin aus einer riesigen Zahl von Krebszellen bestehen. Für eine ef­ fektive Therapie müsste die Dosis an T-Zellen also möglicher­ MATTHEW KRUMMEL & JOHN ENGELHARDT, UCSF; MIT FRDL. GEN. VON MATTHEW KRUMMEL Zwei verschiedene Typen von Immunzellen – hier grün und violett eingefärbt – sammeln sich in der Umgebung und an den Oberflächen von Krebs­zellen (rot). Diese Mikroskopaufnahme ist ein Standbild aus einem Video. Mit solchen Bildern beobachten Forscher in hoher zeitlicher und räum­ licher Auflösung, wie das Immunsystem auf Tumoren reagiert. WWW.SPEK TRUM .DE 77 78 Fluoreszenzmikroskopie Tumorzelle Superresolutionsmikroskopie Immunzelle SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT / MIKE BECKERS weise viel größer sein. Anhand von Zellkulturen können Krebsforscher das therapeutische Potenzial eines neuen An­ satzes also kaum einschätzen, solange er sich nicht auch in Tierversuchen bewährt. »Was im Organismus passiert, ist schwer vorherzusagen«, kommentiert Bousso. Überhaupt neigen Immunzellen im Körper offenbar eher zum Trödeln. Krummel untersuchte etwa T-Zellen, die sich in der Umgebung von Brustdrüsentumoren bei Mäusen auf­ hielten. Die T-Zellen interagierten dort zwar mit anderen Ab­ wehrzellen, so genannten dendritischen Zellen, drangen je­ doch nicht wie erwartet in den Tumor ein. Angesichts solcher Wechselwirkungen wollen manche Forscher inzwischen mehr als nur die Bewegung einzelner Zellen betrachten. Sie brauchen detailliertere Einblicke auf subzellulärer und molekularer Ebene. Dieser Wunsch nach noch mehr Details bedeutet große technische Herausforderungen. So gibt es nur wenige unter­ schiedliche Fluoreszenzfarbstoffe, wodurch es schwierig ist, verschiedene Strukturen gleichzeitig abzubilden. Noch vor einigen Jahren waren gerade einmal vier Markierungen gleichzeitig möglich. Um das zu ändern, baute Krummels Team an der UCSF sein eigenes Mikroskop. Es verfügt über zwei Infrarotlaser mit einem Stückpreis von 150 000 US-Dol­ lar. Die Wissenschaftler regen damit zwei Fluoreszenzfarb­ stoffe an, die auf unterschiedliche Wellenlängen ansprechen. Die Marker emittieren dann zwar Licht ähnlicher Farben. Dennoch gelingt es den Forschern, die Signale zu unterschei­ den, indem sie die Laser abwechselnd feuern lassen und die Zellen zugleich mit hoher Bild­rate beobachten. Mit dieser Methode kann das Team insgesamt sechs verschiedene Fluo­ reszenzmarkierungen simultan sichtbar machen. Während Krummel also auf rasche Bildwiederholung setzt, gewinnen andere Forscher Erkenntnisse aus Aufnah­ men mit besonders hoher Auflösung. Die so genannte Super­ resolutionsmikroskopie ermöglicht es ihnen, einzelne Pro­ teinmoleküle auf der Oberfläche und im Innern einer Zelle darzustellen. Die enorme Leistungsfähigkeit dieser Technik scheint den physikalischen Gesetzen der Optik zu widerspre­ chen. Konventionelle Linsensysteme können nämlich Licht nicht besser fokussieren als auf einen Punkt vom Durchmes­ ser der halben Wellenlänge. Neue Techniken durchbrechen diese »Beugungsgrenze« jedoch und stellen noch kleinere Strukturen dar. Daniel Davis aus Großbritannien nutzte als einer der Ers­ ten die Möglichkeiten der Superresolutionsmikroskopie für die Immunologie. Er baute ein Gerät, das mit zwei Lasern ­arbeitet. Einen davon nutzt er, um die Fluoreszenzmarker anzuregen, mit dem anderen überlagert er den ersten Strahl mit einer ringförmigen Beleuchtungszone und verhindert, dass die Farbstoffe in dieser Region ansprechen (siehe Illus­ tration rechte Seite). Ein herkömmliches Konfokalmikroskop erreicht Auflösungen um 200 Nanometer. Davis’ Mikroskop engt den Durchmesser des anregenden Laserpunkts auf nur 10 bis 20 Nanometer ein. Damit kann sein Team nun einzelne Proteinmoleküle sichtbar machen. Links: Ein Laser (blau) regt fluoreszenzmarkierte Proteine zum Leuchten an. Rechts: Engt ein zweiter, ringförmiger Strahl (rot) dessen Wirkungsbereich ein, werden einzelne Moleküle sichtbar. Dank dieser enormen Auflösung beobachtete Davis, wie natürliche Killerzellen (NK-Zellen) ihre Ziele angreifen. NKZellen sind Teil des angeborenen Immunsystems, jener un­ spezifischen Abwehrphalanx gegen Krebszellen und Krank­ heitserreger. Sie vernichten Zellen mit abnormen Merkma­ len und tragen so dazu bei, dass Krebserkrankungen bei vielen Menschen gar nicht erst entstehen. Die NK-Zellen ver­ abreichen ihren Zielzellen membranumhüllte »Granula« voller todbringender Proteine. Da das Innere der NK-Zellen jedoch ein dichtes Geflecht aus Strukturproteinen enthält, fragte sich Davis, wie es den Zellen eigentlich gelingt, diese Giftpakete zur Oberfläche zu bringen und auszuschleusen. Tiefe Einsichten – bis auf die Molekülebene Mit seinem Mikroskop konnte Davis schließlich dabei zu­ sehen. Unmittelbar unter der Zellmembran, im Bereich der »immunologischen Synapse«, die eine Brücke zwischen Kil­ ler- und Zielzelle bildet, öffnen die Strukturproteine eine Passage. Durch sie kann das Granulum die Killerzelle verlas­ sen. Das ist zunächst eine recht allgemeine biologische Er­ kenntnis, doch Davis hofft, dass sich mit dieser Methode auch neue Angriffspunkte für Tumortherapien finden lassen. Und die Möglichkeiten sind noch lange nicht ausgeschöpft: »Wir wollen sehen, wo genau sich jedes einzelne Oberflächen­ protein auf einer Zelle aufhält.« Dies sei der Schlüssel zum Verständnis der Entscheidungen, die auf zellulärer Ebene fallen­ und letztlich den Verlauf der Erkrankung bestimmen. Immunzellen müssen eine immense, oft widersprüchliche Signalvielfalt interpretieren, bevor sie eine Entscheidung über Leben und Tod eines ihrer Ziele treffen. Von den mo­ lekularen Details dieser Vorgänge hängen nach Davis’ Auf­ fassung letztlich die individuellen Unterschiede ab – ob je­ SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 mand beispielsweise überhaupt an Krebs erkrankt und wie er auf eine Therapie anspricht. Die Techniken, um Zellen im lebenden Organismus zu un­ tersuchen, stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung. Der mögliche Nutzen ist groß. Das Immunsystem derart akri­ bisch zu überwachen, könnte Therapieforschern helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, meint Christopher Contag aus Stanford. Seine Arbeitsgruppe hat im Lauf der letzten zehn Jahre auf diese Weise eine Therapie entwickelt und kürzlich einen Antrag gestellt, eine Studie an Tumorpatienten durch­ führen zu dürfen. Contags Team setzt nicht auf Immunzellen, die bestimm­ te Proteinstrukturen auf Tumoren erkennen, sondern ver­ wendet natürliche Killer-T-Zellen (NKT-Zellen), nicht zu ver­ wechseln mit den NK-Zellen in Davis’ Studie. Es belädt sie mit Viren, die Tumoren abtöten. NKT-Zellen, so Contag, sind Ex­ perten im Aufspüren von Krebszellen, brauchen jedoch sehr lange, um sie zu bekämpfen. Die Viren hingegen sind allein zwar kaum in der Lage, Tumoren zu finden – Contag bezeich­ net sie als »ziemlich dumme Partikel«. Doch wenn die NKTZellen sie zum Ort des Tumors bringen, vermehren sich die Viren dort millionenfach und verleihen den Abwehrzellen so eine enorme Vernichtungskraft. Den Tumorspürhunden sol­ che Killerviren mitzugeben, das klingt nach einem raffinier­ ten Plan. Viele Forscher nahmen ihn jedoch erst dann ernst, als Contag ihn im Tierexperiment umsetzte und sein Gelin­ gen mit hochauflösenden Mikroskopen dokumentierte. Das geringe Interesse an dieser Strategie war plausibel, da noch bis vor Kurzem zu wenig über das Verhalten von NKTZellen bekannt war. Im schnellen Kreislaufsystem der Maus, so nahmen viele Wissenschaftler an, würden NKT-Zellen ei­ nen Tumor schon nach zwei Stunden erreichen – viel zu früh, um bereits etwas gegen den Krebs auszurichten. Denn bis ein tumortötender Virus in einer NKT-Zelle ausgereift und an­ griffsbereit ist, dauert es zwei ganze Tage. In der Zwischen­ zeit kann einiges schiefgehen, zum Beispiel könnten andere Reize aus der Umgebung des Tumors die NKT-Zellen wieder von ihrer Arbeit abbringen. Mit ihren Mikroskopaufnahmen zerstreuten die Forscher diese Bedenken. Das Timing, mit dem die Viren in der Maus freigesetzt wurden, erwies sich als geradezu ideal. Aus noch unbekannten Gründen sammelten sich die meisten virus­ tragenden Zellen erst 48 Stunden nach der Injektion am Tu­ mor an und nicht wie vermutet bereits nach zwei Stunden. Contags Videoaufnahmen zeigten, wie sich alle Tumorzellen praktisch gleichzeitig mit grün fluoreszierenden Viren füll­ ten. Deren exponentielles Wachstum ließ den Tumor auf­ leuchten – und nach kurzer Zeit wie einen undichten Ballon kollabieren. Allmählich verbesserten die Viren sogar die Im­ munabwehr der Mäuse und verhinderten ein Wiederauf­ flammen der Krebserkrankung. Ähnliche Effekte hofft Contag bei seiner geplanten Studie bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs zu se­ hen. Bestenfalls würde sich nicht nur – wie sonst so oft – der Tumor vorübergehend zurückbilden, bevor es letztlich doch WWW.SPEK TRUM .DE zum Wiederauftreten kommt, sondern es gäbe eine Heilung mit anhaltender Immunität. Er vermutet, dass während der Immunreaktion auf die Virusinfektion Gedächtniszellen entstehen, die es dem Immunsystem ermöglichen, erneut auftretende Tumornester frühzeitig zu erkennen und zu ver­ nichten. Bei seinen Mäusen gab es kaum Rückfälle. Contag hofft, dass dies bei den Patientinnen ebenso sein wird. Contags Forschergruppe entwickelt inzwischen auch ein implantierbares Mikroskop, um Tumoren tief im Körperin­ neren beobachten zu können. Das Team testet ein solches Gerät bereits an Tieren. Es empfängt und sendet Lichtstrah­ len durch ein Kabel mit Licht leitenden Fasern, die in den Körper hineinführen. Zwar ist die Auflösung nur halb so gut wie bei einem konventionellen Mikroskop. Dafür müssen die Mäuse nicht mehr betäubt, aufgeschnitten und auf einem Objektträger fixiert werden. Zudem können die Forscher die Prozesse im Körperinneren viel länger dokumentieren. Contag möchte diese Möglichkeiten jetzt auch in der kli­ nischen Forschung nutzen. Im Moment stellt er eine Version seines Mikroskops her, die ohne Eingriff auskommt. Das Ge­ rät sieht aus wie ein Laserpointer mit Kabelanschluss. Der Arzt könnte es beispielsweise auf die Haut des Patienten hal­ ten und die Zellen untersuchen, die durch oberflächennahe Gefäße strömen. So ließen sich im Blutkreislauf zirkulieren­ de Tumorzellen nachweisen, die ein Indiz für einen Rückfall oder die Bildung von Metastasen sind. Detaillierte Livebilder aus dem Körper ermöglichen Im­ munologen allmählich, die Spielregeln der Körperabwehr ge­ gen Tumoren zu verstehen und raffiniertere Therapieansät­ ze zu entwickeln. Im Kampf gegen Krebserkrankungen könn­ ten diese neuen Einsichten einen entscheidenden Zeitvorteil bringen. Ÿ DI E AUTORI N Katherine Bourzac ist Wissenschaftsjournalistin und lebt in San Francisco, Kalifornien. QUELLEN Breart, B. et al.: Two-Photon Imaging of Intratumoral CD8+ T Cell Cytotoxic Activity during Adoptive T Cell Therapy in Mice. In: Journal of Clinical Investigation 118, S. 1390 – 1397, 2008 Engelhardt, J. J. et al.: Marginating Dendritic Cells of the Tumor Microenvironment Cross-Present Tumor Antigens and Stably Engage Tumor-Specific T Cells. In: Cancer Cell 21, S. 402 – 417, 2012 Pageon, S. V. et al.: Superresolution Microscopy Reveals NanometerScale Reorganization of Inhibitory Natural Killer Cell Receptors upon Activation of NKG2D. In: Science Signaling 6, S. ra62, 2013 Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1303098 © Nature Publishing Group www.nature.com Nature 504, S. S10 – S12 79 IMMUNTHERAPIE VI Am Ort des Geschehens Impfstoffimplantate, die das Immunsystem gezielt gegen Tumorzellen stimulieren, zeigen bei Tests an Menschen und Tieren erstaunliche ­Wirkung – ein viel versprechender Weg in der Krebstherapie, der biologisches und materialwissenschaftliches Wissen vereint. Von Elie Dolgin A us einer hydraulischen Presse in seinem Labor fällt eine kleine weiße Scheibe in die Hand von Ed Doherty. Das tablettengroße Implantat könnte die Therapie von Krebserkrankungen revolutionieren: Es lockt Immunzellen an und stimuliert sie dann, gezielt Krebszellen im Körper eines bestimmten Patienten anzugreifen. Seine Fertigung ist so einfach, dass eine neue Ära der personalisierten Krebsmedizin bevorstehen könnte. »Die Geräte zur Herstellung der Implantate lassen sich ohne Probleme an jedem Krankenhaus im Land bereitstellen«, erläutert der Biomaterialforscher vom Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering der Harvard University in Boston, Massachusetts. Jedes der Implantate enthält Zellwachstumsfaktoren, DNA und Fragmente von gefriergetrockneten Zellen aus dem Tumor des Patienten. Diese Substanzen sind in eine Matrix eingebettet, die sich im Körper im Verlauf von etwa sechs Monaten auflöst. Da der experimentelle Impfstoff keine lebenden Zellen enthält, können die Forscher mehrere Implantate in einem einzigen Produktionsprozess herstellen. Dagegen müssen bei anderen Krebsimpfstoffen, die auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten sind, lebende Immunzellen für jede Behandlungsrunde separat aufbereitet werden, in ­tagelanger Laborarbeit. Ein Beispiel ist Sipuleucel-T, die vom AUF EINEN BLICK UNTER DIE HAUT 1 Immuntherapien gegen Krebs haben häufig nicht den gewünschten Effekt: Die Vakzine bleiben nur kurze Zeit im Körper des Patienten aktiv und richten sich auch gegen gesunde Zellen. Impfimplantate könnten Abhilfe schaffen. 2 Pflanzt man sie unter die Haut, locken sie Immunzellen an und programmieren sie gezielt auf den Kampf gegen Krebs. Der Vorteil: Ihre Wirkung hält länger an und ist auf die erkrankten Organe beschränkt. 3 Während die Wirksubstanzen bislang auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten sind, suchen die Forscher auch nach Wegen, die Implantate zu standardisieren, um sie in großem Maßstab produzieren zu können. 80 Biotechnologieunternehmen Dendreon aus Seattle, Wash­ ington, unter dem Handelsnamen Provenge vermarktet wird. Bevor die Zellen im Körper eine Immunreaktion gegen den Krebs stimulieren können, müssen ausreichend viele davon in einem aufwändigen Verfahren hergestellt werden. Das von Doherty und seinen Kollegen entwickelte implantierbare Vakzin nutzt den Patienten selbst als Fabrik für die Zellen. Die Tablette in Dohertys Hand ist für einen Test an Mäusen vorgesehen. Ein paar Straßen weiter aber, am Dana-Farber/ Brigham and Women’s Cancer Center, fabrizieren Kollegen von Doherty ähnliche Vakzinimplantate, die bereits zur experimentellen Behandlung von Menschen dienen. In der bislang einzigen klinischen Studie dieser Art werden sie an Patienten erprobt, die an einem fortgeschrittenen malignen Melanom erkrankt sind. Glenn Dranoff, Tumorimmunologe am DanaFarber Cancer Center und Mitentwickler das WDVAX genannten Vakzins, findet es faszinierend, Materialwissenschaften und neue Erkenntnisse aus der Immunologie von Tumor­ erkrankungen miteinander zu kombinieren: »Das ist eines der aufregendsten Projekte in meiner Forscherlaufbahn!« Gemeinsam mit Biologen entwickeln Materialwissenschaftler auch zahlreiche andere Vehikel, die Immuntherapeutika gegen Krebs in den Körper bringen – von Nano­ partikeln bis zu injizierbaren Gelen. Ihre Ansätze sollen die bisherigen grundlegenden Probleme lösen, etwa dass die Immunreaktionen nicht nur Tumorzellen erfassen, die Behandlungen gefährliche Nebenwirkungen haben und die Vakzine nur kurze Zeit im Körper des Patienten aktiv bleiben. Dank neuer Trägermaterialien lassen sich Immuntherapeutika nun gezielt in bestimmte Organe befördern und führen zumindest im Tierversuch zu kontrollierteren und länger anhaltenden Antitumorreaktionen. »Derzeit geht es vor allem darum, diese Systeme so weiterzuentwickeln, dass sie verschiedene Arten immunmodulatorischer Agenzien verlässlich an ihren Wirkort transportieren«, erklärt Tarek Fahmy, Ingenieur für biomedizinische Technik an der Yale Univer­ sity in New Haven, Connecticut. Die erfolgversprechendsten Daten zu biotechnischen Immuntherapien stammen bislang noch aus Experimenten mit Mäusen. WDVAX wirkte derart überzeugend, dass die sich SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 nun anschließende klinische Studie große Aufmerksamkeit auf sich zieht. »Die vorliegenden biologischen und tierexperimentellen Ergebnisse rechtfertigen es absolut, jetzt weiterzumachen«, sagt der Onkologe Stephen Hodi vom Dana-Farber Cancer Center, der die Studie leitet, »und die Sicherheit und Wirksamkeit des Ansatzes bei Menschen zu ermitteln.« Die seit August 2013 laufende und auf zwei Jahre angelegte Phase-I-Studie wird 25 Patienten mit metastasiertem Melanom umfassen. Jeder von ihnen soll über einen Zeitraum von mehreren Monaten je vier Vakzinimplantate erhalten. Die Idee zu WDVAX stammt von Dranoff und dem Harvard-Bioingenieur David Mooney. Im Inneren des Implantats, so der Grundgedanke, sollen Immunzellen auf die Zer- störung von Tumorzellen programmiert werden. Dazu enthält es eine Matrix aus resorbierbarem Kunststoff, beladen mit einer Mischung aus den gleichen drei Komponenten, die auch Doherty benutzt: gefriergetrocknete Tumorproteine, ein Wachstumsfaktor und DNA-Moleküle. Alles gemeinsam wird unter Hochdruck aufgeschäumt, bis ein stark poröses Material entsteht. Das fertige Implantat fühle sich an »wie ein ausgestanztes Stückchen Küchenschwamm«, sagt Doherty, in das Immunzellen einwandern können, sobald man es unter die Haut pflanzt. Nachdem sich WDVAX bei Mäusen als wirksam erwiesen hat, muss das Vakzin nun zeigen, dass es am Menschen sicher angewendet werden kann. Die Forscher erwarten keine WYSS INSTITUTE, HARVARD UNIVERSITY Dieses tablettengroße Impf­ implantat enthält unter anderem Wachstumsfaktoren und DNA aus dem Tumor des Patienten. Pflanzt man es unter die Haut, wandern Immunzellen in das poröse Material ein und werden dort gezielt auf den Kampf gegen den Krebs programmiert. WWW.SPEK TRUM .DE 81 PRAVEEN R. ARANY, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH ET AL. großen Probleme. Für sich genommen sind alle vier Bestandteile »bekanntermaßen ungefährlich«, sagt Mooney, »selbst noch in viel größeren Mengen, als wir sie in WDVAX einsetzen«. Die Kunststoffmatrix besteht aus Polylactid-co-glykolid, einem üblichen Grundstoff für resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial. Der Wachstumsfaktor GM-CSF (Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor) kommt unter der Bezeichnung Sargramostim (Handelsname: Leu­ kine) bereits bei Tumorpatienten zum Einsatz, deren Leukozytenbildung er stimuliert. Seine Aufgabe bei WDVAX ist es, dendritische Zellen des Immunsystems in das poröse Innere des Implantats zu locken. Die synthetischen DNA-Moleküle schließlich – so genannte CpG-Oligonukleotide, die als immunstimulierende Hilfsstoffe bereits in großen klinischen Studien geprüft wurden – täuschen eine bakterielle Infek­ tion vor und regen so die eingewanderten Zellen an. Die einzige neuartige Komponente ist der Extrakt aus zerkleinertem Melanomgewebe des Patienten. Die dendri­ tischen Zellen machen die darin enthaltenen Antigene für andere Bestandteile des Immunsystems »sichtbar«, wodurch diese lernen, die Tumorzellen als fremd zu erkennen und zu bekämpfen. Da der Extrakt aus patienteneigenem Gewebe stammt, lässt er sich nach Mooneys Auffassung ohne Risiko verabreichen. Gemeinsam mit einem vom damaligen Harvard-Doktoranden Omar Ali geleiteten Team konnten Mooney und ­Dranoff 2009 an Mäusen nachweisen, dass dendritische Zellen, die durch das Vakzinimplantat aktiviert worden waren, in Lymphknoten in der Umgebung der Tumoren einwanderten. Dort brachten sie T-Zellen dazu, ihre zerstörerischen Kräfte auf Krebszellen zu richten, worauf sich der Tumor ­zurückbildete. Das zielgerichtete Verfahren vermeidet die ­Nebenwirkungen unspezifischer Therapien und hat sich bei In poröse Materialien wie dieses (mikroskopische Aufnahme) können Zellen eindringen. Impfimplantate, die Zellen des ­Immunsystems modifizieren, besitzen eine ähnliche Struktur. 82 Mäusen mit aggressiven Melanomen als hochwirksam erwiesen. Ohne Therapie sterben die Tiere binnen etwa drei Wochen. Neun von zehn Mäusen jedoch, die vor der Injek­ tion von Melanomzellen Vakzinimplantate bekommen hatten, überlebten mindestens drei Monate lang. Gute Erfolge erzielten die Forscher auch bei Tieren, die erst dann zwei Implantate erhielten, wenn sich schon Tumoren gebildet hatten. Der Tumorimmunologe Willem Overwijk, der am MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas, an der Entwicklung von Melanomvakzinen arbeitet, zeigt sich von den Ergebnissen beeindruckt. »Die immunologischen Daten sind überzeugend und die Antitumoreffekte ziemlich ausgeprägt«, sagt er. »Dieser Therapieansatz hat meines Erachtens echte Chancen.« Synergien beim Zurückdrängen der Tumoren Die Forscher kombinierten ihr Vakzin auch mit Antikörpern gegen die Proteine CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen4) und PD-1 (programmed death-1). Beide Rezeptoren hemmen die Immunreaktion, weshalb ihnen derzeit das Interesse der pharmazeutischen Industrie gilt. Bei Mäusen verlangsamte ein einzelnes Vakzinimplantat das Wachstum bereits bestehender Melanome, brachte den Krebs jedoch nicht zum Verschwinden. Die Antikörper gegen CTLA-4 oder PD-1 brachten für sich genommen ebenfalls wenig Besserung. Hingegen eliminierte die Kombination von Implantat und Antikörper bei etwa der Hälfte der behandelten Tiere die Geschwülste komplett. »Möglicherweise gibt es in diesem Fall gewisse Synergien beim Zurückdrängen der Tumoren«, sagt Mooney. Andere Forscher entwickeln statt Implantaten injizierbare Impfstoffe, die entweder im Tumor selbst oder in den nahe gelegenen Lymphknoten Immunzellen aufspüren. Darrell ­Irvine, Bioingenieur am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, will mit seinem Verfahren Tumor und Lymphknoten gleichzeitig ins Visier nehmen. Wie die ­WDVAX-Entwickler verfolgt auch er das Ziel, dass dabei nur Tumorzellen erfasst werden, gesunde Zellen jedoch verschont bleiben. Sein Team konzentriert sich auf zwei Signalproteine, die T-Zell-Antworten gegen vielerlei Arten von Tumoren stimulieren, möglicherweise aber auch schwere Entzündungsreaktionen hervorrufen, die für die Mäuse tödlich sein könnten. Die Forscher fixierten sie auf kunststoffumhüllten Fetttröpfchen von etwa 200 Nanometer Durchmesser, die sie direkt in Melanome von Mäusen injizierten. Im Tumorgewebe und in den Lymphknoten blieben sie dann gewissermaßen gefangen. Bei etwa zwei Dritteln der mit den Nanopartikeln behandelten Tiere bildeten sich die Tumoren vollständig zurück, und zwar ohne Anzeichen einer Entzündungsreaktion. »Wir lösen eine starke Immunreaktion gegen die Tumoren aus«, erläutert Irvine, »und vermeiden toxische Effekte, weil sich die Wirkstoffe nicht im Körper verteilen können.« Fahmy und seine Kollegen von der Yale University stellen noch kleinere und ebenfalls wirkstoffbeladene Nanopartikel her, die sowohl das adaptive als auch das angeborene ImmunSPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 NEPHRON / CC-BY-SA-3.0 (CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/3.0/LEGALCODE) Die mikroskopische Aufnahme einer eingefärbten Gewebe­ probe belegt die Erkrankung eines Patienten an einem B-Zell-Lymphom. Forscher testen derzeit Vakzingele an Mäusen mit dieser Form von Blutkrebs. WWW.SPEK TRUM .DE bor untersuchte er Mäuse mit B-Zell-Lymphomen, einer Art von Blutkrebs. Injizierte er ihnen ein mit immunaktivierenden Komponenten beladenes Gel, verstärkte es die gegen Tumoren gerichtete Aktivität von T-Zellen. Für Mooney liegt genau darin die Schönheit vieler Immuntherapien, die auf materialwissenschaftlichen Erkenntnissen basieren: Tumorbiologen erscheine die Herstellung der neuen Werkzeuge vielleicht komplex, wenn sie mit den Technologien noch nicht vertraut seien – Ärzten jedoch bereite ihre praktische Anwendung keinerlei Schwierigkeiten. »Sie ist«, sagt Mooney, »verblüffend einfach.« Ÿ DER AUTOR Elie Dolgin ist leitender Nachrichtenredakteur bei »Nature Medicine« in Cambridge, Massachusetts. DON ERHARDT system stimulieren. Bringt man sie in den Körper ein, bleiben sie in Blutkapillaren rund um Tumoren stecken und entladen dort ihre Fracht. Die Bioingenieure Melody Swartz und Jeffrey Hubbell von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne wiederum verankern CpG-Moleküle an der Oberfläche winziger Partikel von nur 30 Nanometer Durchmesser. Nach Injektion in die Haut von Mäusen sammeln sich diese in den Lymphknoten, wo die CpG-Moleküle als Immun­ adjuvans wirken, also die körpereigene Immunabwehr gegen Tumorzellen verstärken. »Sie aktivieren T-Zellen, die mit dem Lymphstrom hereingespült werden«, erklärt Swartz. Nachdem WDVAX das Stadium der klinischen Prüfung erreicht hat, ist Mooney wieder ins Labor zurückgekehrt, um weitere Anwendungen für implantierbare Vakzine zu untersuchen. Zusammen mit der Firma InCytu aus Lincoln, Rhode Island, arbeitet Mooneys Team an einer Immuntherapie gegen maligne Gliome, eine Form aggressiver Hirntumoren. Ein Vakzinimplantat mit Gliom-Antigenen, implantiert in den Schädel erkrankter Mäuse, führt zu einer Rückbildung der Tumoren. Um die Wirksamkeit ihrer Strategie auch gegen Brustkrebs zu untersuchen, erhielten Mooney und Dranoff zudem Forschungsmittel. Statt Tumorextrakten werden sie dabei möglicherweise ein einzelnes Antigen wie HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) verwenden. Die Wirkung des Vakzinimplantats würde sich dann zwar nicht spezifisch gegen den individuellen Tumor der jeweiligen Patientin richten, ließe sich dafür aber standardisieren und im großen Maßstab produzieren. »Wir untersuchen das Potenzial unserer Technologie jetzt auf viel breiterer Basis«, sagt Mooney. Bei allen Vakzinimplantaten, die Mooney bisher entwickelt hat, bedarf es eines kleinen chirurgischen Eingriffs. Er sucht daher nach Möglichkeiten, die Impfstoffe auf weniger belastende Weise zu verabreichen. Beispielsweise lassen sich in einem Gel suspendierte, mikroporöse Partikel unter die Haut spritzen, wo sie verklumpen und ein Depot von Immunstimulanzien bilden. Krishnendu Roy, Ingenieur für biomedizinische Technik am Georgia Institute of Technology in Atlanta, bestätigt: »Im Vergleich zu Implantaten ließen sich solche Gele einfacher verabreichen.« In seinem eigenen La- QUELLEN Ali, O. A. et al.: Infection-Mimicking Materials to Program Dendritic Cells in Situ. In: Nature Materials 8, S. 151 – 158, 2009 Kwong, B. et al.: Localized Immunotherapy via Liposome-Anchored Anti-CD137 + IL-2 Prevents Lethal Toxicity and Elicits Local and Sys­te­mic Anti-Tumor Immunity. In: Cancer Research 73, S. 1547 – 1558, 2013 Park, J. et al.: Combination Delivery of TGF-b Inhibitor and IL-2 by Nanoscale Liposomal Polymeric Gels Enhances Tumour Immunotherapy. In: Nature Materials 11, S. 895 – 905, 2012 Thomas, S. N. et al.: Targeting the Tumor-Draining Lymph Node with Adjuvanted Nanoparticles Reshapes the Anti-Tumor Immune Response. In: Biomaterials 35, S. 814 – 824, 2014 WEBLI N KS Dieser Artikel und Links auf weitere Publikationen im Internet: www.spektrum.de/artikel/1303099 © Nature Publishing Group www.nature.com Nature 504, S. S16 – S17 83 IMMUNTHERAPIE VII Impfen gegen Krebs Im Sommer 2010 wurde der weltweit erste therapeutische ­Krebs­impfstoff in den USA zugelassen. Der Vakzine gegen Prostatakarzinome könnten bald andere folgen. Von Eric von Hofe O peration, Chemotherapie, Bestrahlung – das wa­ ren bisher die drei Hauptwaffen gegen Krebs. De­ ren oft schwere Nebenwirkungen lassen sich dank des inzwischen immer gezielteren und besser auf den einzelnen Patienten abgestimmten Vorgehens begren­ zen, bei gleichzeitig größerem Therapieerfolg. Es gibt zudem heute schon einige Medikamente, die recht spezifisch die entarteten Zellen angreifen und nicht zu den Chemothe­ rapeutika im engeren Sinn zählen: etwa Herceptin (Trastu­ zumab), das insbesondere bei einer bestimmten Form von Brustkrebs eingesetzt wird; oder Glivec (Gleevec / Imatinib), womit Ärzte unter anderem eine Leukämieart bekämpfen. Überlebte vor 30 Jahren die Hälfte der Patienten mit invasiv wachsenden Tumoren länger als fünf Jahre, so sind es heute immerhin zwei Drittel. Allerdings haben viele von ihnen noch immer keine normale Lebenserwartung. Seit Langem schon überlegen Forscher, dass sich die Aus­ sichten von Krebskranken deutlich verbessern würden, wenn es gelänge, ihr Immunsystem gezielt anzustacheln – als zu­ sätzliche Maßnahme neben den bewährten Behandlungen, die außerdem selbst keine schweren Nebenwirkungen haben dürfte. Doch die Studien der letzten Jahrzehnte enttäuschten meist. Vorübergehend hatten Mediziner beispielsweise gro­ ße Hoffnung auf das Immunmolekül Interferon gesetzt. Es sollte die körpereigene Abwehr anregen und damit helfen, viele oder sogar alle Krebserkrankungen zu besiegen. Diese hohe Erwartung schwand in den 1980er Jahren bald wieder. Interferon hat zwar in der Krebstherapie inzwischen seinen festen Platz – aber es ist kein Allheilmittel. Auch in den letz­ ten zehn Jahren gab es zahlreiche klinische Studien zu den unterschiedlichsten Ansätzen, einen bestehenden Krebs durch – therapeutisches – Impfen zu behandeln. Keiner da­ von überzeugte. Die eine Wunderwaffe haben Forscher zwar immer noch nicht gefunden. Aber die Phase des blinden Vortastens und vergeblichen Probierens könnte bald überwunden sein. Im Sommer 2010 ließ die US-Behörde FDA (Food and Drug Ad­ ministration) den weltweit ersten therapeutischen Krebs­ impfstoff für fortgeschrittene Prostatakarzinome zu: Pro­ venge (Sipuleucel-T). Zwar heilt auch dieses Medikament nicht. Doch einige hundert schwer krebskranke Männer, die 84 es zusammen mit einer üblichen Chemotherapie erhielten, gewannen dadurch immerhin ein paar zusätzliche Lebens­ monate. Die Wende kam, als Forscher einige Grundannahmen zur Immunabwehr von Krebszellen einerseits und zu deren Ge­ genmanövern andererseits überprüften. Die Ergebnisse die­ ser Arbeiten bewerten die Experten inzwischen vorsichtig optimistisch. Mit dem neuen Wissen könnte es nun doch endlich gelingen, sehr spezifisch wirksame immunverstär­ kende Therapien zu entwickeln, die sich routinemäßig zu­ sammen mit den klassischen Behandlungsmethoden einset­ zen lassen. Und die Nebenwirkungen sollten höchstens den Symptomen eines heftigen grippalen Infekts ähneln. Die meisten herkömmlichen Impfungen werden vorbeu­ gend verabreicht. Sie zielen darauf ab, Infektionskrankheiten und deren mitunter verheerende Langzeiteffekte von vorn­ herein zu unterbinden – wie die bleibenden Schäden einer Kinderlähmung, Hirndefekte durch Masern oder Leberkrebs infolge einer Hepatitis-B-Infektion. Eine so genannte thera­ peutische Impfung indessen richtet sich gegen eine schon bestehende Erkrankung. Im Fall von Krebs wäre das Ziel, das Immunsystem darauf zu trainieren, die unerwünschten Zel­ len überall im Körper zu erkennen und anschließend zu zer­ stören, und das selbst noch Jahre später. Bei vielen vorbeugenden Impfungen bildet unser Im­ munsystem schlicht Antikörper gegen den Erreger. Gewöhn­ lich genügt das, um die betreffende Infektionskrankheit zu verhindern. Die Antikörper lagern sich dann beispielsweise an Grippeviren an, und diese können sich nun nicht weiter vermehren. Um Krebszellen abzutöten, reichen Antikörper­ reaktionen jedoch gewöhnlich nicht aus. Vielmehr muss das Immunsystem dazu seine T-Zellen – T-Lymphozyten – rekru­ tieren. Bei diesen weißen Blutkörperchen unterscheiden die Forscher unter anderem zwei Haupttypen: CD4- und CD8Zellen, so benannt nach bestimmten Rezeptorproteinen außen­ auf den T-Zellen. Gerade CD8-Lymphozyten können Ein T-Lymphozyt (eine Klasse von Immunzellen, gelb) attackiert eine Krebszelle. Er erkennt sie an bestimmten Molekülen – Antigenen – auf ihrer Oberfläche. SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 Krebszellen effektiv und direkt vernichten – vorausgesetzt, sie sind dafür geschult, solche Zellen als entartet zu erkennen (siehe Kasten S. 88). Frühe Versuche mit Bakteriengiften Allerdings entstand der Wunsch, Krebs mit Impfung zu be­ kämpfen, lange bevor solche Feinheiten entdeckt wurden. Als »Vater der Krebsimmuntherapie« gilt der amerikanische Arzt William B. Coley (1862 – 1936). Schon Ende des 19. Jahr­ hunderts, als noch keine Rede von irgendwelchen T-Zellen war, verabreichte er Krebspatienten Bakterientoxine. Denn er hörte von Kranken, deren bösartige Wucherungen nach e­ iner schweren bakteriellen Infektion offenbar verschwan­ den. Das versuchte er mit Impfreaktionen nachzuahmen. Coley verwendete ein Präparat von zwei lebensgefährlichen und deswegen abgetöteten Erregern. Davon bekamen die Pa­ tienten sehr hohes Fieber. Sie erhielten täglich eine höhere Dosis des Toxingemischs injiziert, denn der Forscher vermu­ tete, die Fieberattacken könnten die darniederliegende Im­ munabwehr der Kranken reaktivieren und dazu bringen, auch die Krebsgeschwülste als unerwünscht zu erkennen und zu bekämpfen. Bei einem beachtlichen Teil der Patien­ ten zeitigte diese drastische Behandlung tatsächlich sehr gu­ ten Erfolg. Coleys Ansicht, die Impfung mit den Bakterien­ AG. FOCUS / EYE OF SCIENCE / MECKES & OTTAWA WWW.SPEK TRUM .DE 85 AUF EINEN BLICK GEZIELT DIE KÖRPERABWEHR EINSPANNEN 1 Dank Verbesserungen der konventionellen Krebsbehandlung – mit Operation, Chemotherapie und Bestrahlung – sind die Überlebensaussichten von Krebspatienten in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. Dennoch haben viele der erfolgreich Behandelten noch immer keine normale Lebenserwartung. 2 Deswegen möchten Mediziner nun das Immunsystem gezielt mit in die Therapie einbeziehen. Neben Immunstimulanzien untersuchen sie zu dem Zweck auch therapeutische Impfstoffe. 3 Nach manchen Fehlschlägen in den letzten zehn Jahren scheint sich nun die Wende anzubahnen. Der erste Impfstoff zur Behandlung von Prostatakrebs wurde in Amerika zugelassen, und eine neue Generation von therapeutischen Krebsvakzinen wird erprobt. 86 Langer Weg zum Erfolg Seit mehr als 100 Jahren versuchen Forscher, das Immunsystem gegen Krebs anzustacheln. 1890er Jahre William B. Coley injiziert Krebspatienten einen Extrakt aus abgetöteten Bakterien. BERLINER ILLUSTRIERTE ZEITUNG, 1910 / PUBLIC DOMAIN toxinen hätte den Heilungsprozess ausgelöst, war wohl durchaus berechtigt. Doch es gab auch Widerstand gegen die Methode seitens der Fachkollegen. Andere Behandlungsmöglichkeiten kamen auf, etwa Anfang des 20. Jahrhunderts die Bestrahlung. Als Chemotherapien in den 1950er Jahren immer konsistentere Therapieergebnisse erzielten, verloren Mediziner vollends das Interesse an Coleys Ansatz. Überhaupt geriet die Idee, Krebs durch Impfen zu bekämpfen, völlig in den Hintergrund. Wissenschaftliche Studien zur Bedeutung des Immunsys­ tems bei Krebs gab es jedoch weiterhin. Mit solchen For­ schungen erkannten Mediziner nun auch, dass der deutsche Arzt Paul Ehrlich (1854 – 1915) wohl 1909 mit seiner These Recht gehabt hatte, wonach die Abwehr normalerweise stän­ dig darüber wacht, ob irgendwo im Körper Krebszellen auf­ treten. Diese Vorstellung bekam in den 1980er Jahren zusätz­ lichen Rückhalt, als klar wurde, wie oft bei Zellen im Körper potenziell gefährliche Spontanmutationen auftreten. Dem­ nach müsste Krebs eigentlich sehr viel häufiger vorkommen, als es tatsächlich der Fall ist. Nach den Beobachtungen bleibt das Immunsystem tat­ sächlich auch dann nicht untätig, wenn ihm einmal ein Tu­ mor durchschlüpft. Nur kann es später oftmals nicht mehr genug erreichen. Pathologen sagen manchmal, Tumoren sei­ en »Wunden, die nicht heilen« – wissen sie doch schon lange, dass Krebsgeschwülste oft mit Immunzellen durchsetzt sind. Weitere Untersuchungen ergaben aber auch, dass, je größer ein Tumor wird, er umso mehr Substanzen freisetzt, mit de­ nen er die Aktivität von T-Lymphozyten regelrecht unter­ drückt. Könnten Krebsimpfungen an dieser Stelle ansetzen? Wie ließen sich die Kräfteverhältnisse so beeinflussen, dass T-Zellen doch noch die Oberhand gewinnen? Im Jahr 2002 rückte eine Lösung näher. Damals erkannte ein Forscherteam um Steven Rosenberg am amerikanischen National Cancer Institute in Bethesda (Maryland): Höchst be­ deutsam für die Krebsabwehr sind neben den CD8- auch die CD4-Lymphozyten. Sie fungieren gleichsam als Generäle des Immunsystems und erteilen der Fußtruppe, die das Töten 1975 Gezielte Herstellung monoklonaler Antikörper; das liefert hochspezifische Immunwaffen. 1909 Paul Ehrlich (Bild) vertritt die These, das Immunsystem könne Tumorwachstum unterdrücken. übernimmt, genaue An­ griffsbefehle – in diesem Fall den CD8-Zellen (siehe Kasten S. 88). Das Team um Rosenberg gewann T-Lymphozyten von 13 Patienten, die an einem Melanom (schwarzen Hautkrebs) lit­ ten und schon Metastasen hatten. Diese Immunzellen wur­ den in Kulturgefäßen so aktiviert, dass sie zugegebene Mela­ nomzellen erkannten und abtöteten. Anschließend ver­ mehrten die Forscher die aktivierten T-Zellen massiv und verabreichten sie wieder den Patienten. Solche Verfahren, ei­ gene Immunzellen außerhalb des Körpers scharf zu machen, zu vermehren und dann dem Kranken zurückzugeben, be­ zeichnen Forscher als adoptive Immuntherapie (siehe hierzu den Artikel von Rosenberg in Spektrum der Wissenschaft 7/1990, S. 56, und den Beitrag ab S. 62). Bei einer Krebsimp­ fung hingegen würde das Immunsystem die besonderen Ab­ wehrzellen selbst im Körper herstellen. Vorangegangene Behandlungsversuche von Melanom­ patienten im Sinn einer adoptiven Immuntherapie allein mit CD8-Lymphozyten waren wirkungslos geblieben. Erst als das Rosenbergteam auch noch CD4-Zellen hinzufügte, gab es bessere, teils eindrucksvolle Resultate. Die Tumoren von 6 der 13 Patienten schrumpften erheblich. Zwei von ih­ nen bildeten über ein Dreivierteljahr nach Behandlungs­ ende noch immer wirksame krebsspezifische Abwehrzel­ len. Auf die Prozedur selbst reagierten die Kranken meist vorübergehend mit grippeähnlichen Symptomen. Vier der so Behandelten zeigten allerdings zudem eine komplexe Autoimmunreaktion mit teilweisem Verlust der Hautpig­ mentierung. Weil diese Versuche bewiesen, dass eine gezielte Krebs­ behandlung mittels T-Zellen möglich sein sollte, fanden An­sätze zu Immuntherapien gegen die fatale Krankheit un­ ter Medizinern endlich mehr Akzeptanz. Jedoch erforderte das beschriebene Vorgehen von Rosenbergs Gruppe eine Rie­ SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 1980 Mit Bakterien, in die das Gen für Interferon eingeschleust wurde, lässt sich das immunstimulierende Protein unbegrenzt produzieren. GENENTECH INC. AG. FOCUS / EYE OF SCIENCE / MECKES & OTTAWA 1997 USA: Zulassung des ersten monoklonalen Antikörpers gegen Krebs – Rituximab (Rituxan) beim Non-HodgkinLymphom 1986 USA: Zulassung von Interferon für Haarzell­ leukämie als erstem nachweislich wirksamem Krebsimmuntherapeutikum 1998 USA: Zulassung des monoklonalen Antikörpers Trastuzumab für metastasierenden Brustkrebs senanzahl an manipulierten Lymphozyten: pro Patient über 70 Milliarden CD8- und CD4-Zellen, was einigen hundert Milli­litern Zellsuspension entspricht. Deswegen suchten die Forscher nun nach einfacheren Verfahren, die trotzdem ebenso gute Ergebnisse erzielen. Sie wollten Immunzellen direkt im Körper dazu bringen, die ge­ wünschten Eigenschaften zu entwickeln und sich stark zu vermehren – eben das, was nach einer erfolgreichen Imp­ fung geschieht. Suche nach geeigneten Tumorantigenen Wir Forscher bei der Firma Antigen Express freuten uns über Rosenbergs Befund, wonach ein Krebsimpfstoff zu­ gleich CD4- und CD8-Lymphozyten aktivieren muss. Auf Grund eigener Tierversuche hatten wir dies schon vermutet und die Zukunftspläne unseres Unternehmens wesentlich danach ausgerichtet. Für die Entwicklung eines Krebsimpfstoffs sind von vorn­ herein drei Aspekte entscheidend. Zum einen kommt es ­darauf an, auf welches molekulare Element – Antigen ge­ nannt – des Tumors man das Immunsystem überhaupt an­ setzen möchte. Auch muss man erarbeiten, wie man dem Immunsystem die Vakzine am besten darbietet, damit es gut darauf anspricht. Ebenso ist es wichtig zu wissen, für welche Krebspatienten der Impfstoff in Frage kommt, und auch, in welchem Krankheitsstadium man ihn effektiv einsetzt. Mitarbeiter von Firmen, die sich mit solchen Entwick­ lungen befassen, haben in den letzten Jahren viele Proteine und auch Peptide, also kürzere Proteinfragmente, von Tu­ moren auf ihre Eignung als Impfstoffantigene hin unter­ sucht. Von Vorteil ist in dem Zusammenhang, dass dieselben genetischen Veränderungen, die Krebszellen ungehemmt wachsen lassen, sie auch dazu bringen, bestimmte Proteine wesentlich mehr zu bilden als gesunde Zellen. Rund zehn Unternehmen, darunter unseres, arbeiten bereits an ver­ schiedenen Peptiden. WWW.SPEK TRUM .DE 2002 Nachweis, dass eine Krebstherapie mittels T-Zellen möglich ist und sowohl CD8- als auch CD4-Zellen erfordert (Foto: T-Zellen attackieren eine Krebszelle, rot) 2010 USA: Zulassung von Provenge für fortgeschrittenen Prostatakrebs als erstem Impfstoff gegen einen bestehenden Krebs Man könnte für den gleichen Zweck auch DNA-Stücke mit Krebsgenen verwenden oder selbst ganze Krebszellen, die durch Bestrahlung ungefährlich gemacht wurden. Aber Pep­ tide bieten sich unter anderem deshalb an, weil sie recht klein, kostengünstig zu produzieren und insbesondere leicht manipulierbar sind. Mit ihnen kann man daher relativ ein­ fach Impfstoffe entwerfen und in größerer Menge herstellen. Ein weiterer Vorteil: Ein und dieselbe Vakzine müsste sich für verschiedene Krebs­arten eignen. Denn soweit bisher unter­ sucht, scheinen die gleichen Peptide immer wieder vorzu­ kommen. Eine zellbasierte Immuntherapie würde dagegen individuell angepasste Präparate erfordern. Nicht zuletzt verursachen sämtliche bisher getesteten Peptidimpfstoffe vergleichsweise geringe Nebenwirkungen, wie vorüberge­ hende Reizungen an der Injektionsstelle oder mitunter Fie­ ber und andere grippeähnliche Symptome. Vor zehn Jahren hatten Wissenschaftler von Antigen Ex­ press ein Peptid umgebaut, das zuvor schon in einem experi­ mentellen Impfstoff gegen Brustkrebs verwendet worden war. Es stammte aus dem HER2-Protein, dem Angriffsziel des eingangs erwähnten Trastuzumab – eines monoklonalen Antikörpers, mit dem bestimmte Formen von Brustkrebs be­ handelt werden. Als sie dieses Peptid um nur vier Aminosäu­ ren verlängerten, steigerte das seine Stimulationskraft für CD4- und CD8-Lymphozyten enorm, die HER2 produzieren­ de Brustkrebszellen angreifen. Dies war das oben erwähnte Ergebnis, auf das unsere Firma setzte. Uns bestärken jetzt auch kürzlich veröffentlichte vorläufige Befunde anderer Forscher, die unseren Impfstoff mit zwei anderen Peptidvak­ zinen verglichen, welche nur auf CD8-Zellen abzielen. Die einzelnen Unternehmen verfolgen unterschiedliche Ansätze. Dendreon etwa, der Hersteller des vorne genannten, inzwischen auch in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffs Provenge gegen Prostatakrebs, sowie einige weite­ re Firmen manipulieren die dendritischen Immunzellen: die wichtigsten »Wachhunde« des Immunsystems (siehe den 87 Drei Impfstrategien Das Immunsystem erkennt Krebszellen nicht ohne Weiteres als fremd oder gefährlich. T-Zellen – bestimmte Immunzellen – von Patienten lassen sich aber im Labor hierzu veranlassen, dann vermehren und zurückübertragen. Noch praktischer wäre ein therapeutischer Impfstoff, bei dem dies im Körper selbst geschieht. Medizinforscher entwickeln hierzu drei verschiedene Ansätze. Die natürliche Immunreaktion auf Krebszellen Dendritische Immunzellen verschlingen Tumorzellen und präsentieren Bestandteile (Antigene) davon CD4- und CD8-Zellen. CD4-Zellen setzen nun Zytokine frei, welche CD8-Zellen aktivieren helfen. Diese attackieren dann Zellen mit dem betreffenden Antigen, also Krebszellen. Nur ist diese Reaktion oft nicht stark genug, um einen ganzen Tumor zu vernichten. Krebszelle krebsspezifisches Antigen ➊ unreife dendritische Zelle Ganzzellimpfstoff CD4-Zelle reife dendritische Zelle Zytokine aktivierte CD8-Zelle CD8-Zelle Komplette Tumorzellen ➌ Dem Patienten werden Krebszellen entnommen. In diese schleust man Gene ein, die dem Immun­ system deren Erkennung erleichtern. Vor der Rückgabe werden die Zellen mittels Bestrahlung abgetötet. Sie bieten der Immun­ abwehr zahlreiche Zielstruk­turen. Tumor Dendritische Zellen Dendritische Zellen des Patienten werden im Labor mit Tumorantigenen versetzt. Auf diese Weise wird auch der kürzlich in den USA zugelassene Impfstoff gegen Prostatakrebs hergestellt. ➋ Peptidimpfstoff Das Immunsystem erkennt krebsspezifische Antigene, die etwas verändert wurden, teilweise viel besser. Solche Fragmente oder Peptide sind leicht im Labor herstellbar und für viele Patienten geeignet. Impfstoff mit manipulierten dendritischen Zellen 88 SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 AXS BIOMEDICAL ANIMATION STUDIO Peptide Kasten links, rechts oben). Dendritische Zellen finden sich im gesamten Körper, doch vor allem dort, wo Kontakt mit der Außenwelt besteht, also besonders in der Haut und in der Schleimhaut des Verdauungstrakts. Diese Wächterzellen ge­ hören zu den ersten, die T-Lymphozyten alarmieren. Der Trick bei dem Prostataimpfstoff ist, dendritische Zel­ len im Labor mit Antigenen von Krebszellen zu beladen und sie dem Kranken zuzuführen – was die T-Zellen in Gang brin­ gen soll. Dazu muss man allerdings einigen Aufwand betrei­ ben. Immunzellen nehmen nur von genetisch gleichen Part­ nern Befehle entgegen. Deswegen werden dem Patienten dendritische Zellen entnommen, mit dem krebsspezifischen Protein versehen und ihm wieder injiziert. Eine vollständige Behandlung kostet derzeit fast 100 000 Dollar. Zu den Neben­ wirkungen gehören Schüttelfrost, Fieber und Kopfschmer­ zen, seltener auch ein Schlaganfall. Die US-Behörde ließ den Impfstoff zu, weil in einer Kurzzeitstudie damit behandelte Männer mit fortgeschrittenem Prostatakrebs im Durch­ schnitt mindestens vier Monate länger lebten als solche ohne diese Behandlung. Zeitverzögerte Reaktion auf Immuntherapie Für Krebsimpfstoffe scheint eine neue Zeit angebrochen – nicht nur wegen Provenge, denn auch eine Reihe anderer viel versprechender Impfpräparate ist derzeit in klinischen Tests. Je weiter wir auf dem Feld vordringen, desto deutlicher wird aber auch, dass an eine Immuntherapie andere zeitliche Maßstäbe anzulegen sind als an eine Chemotherapie oder Bestrahlung. Ob eine konventionelle Behandlung anschlägt oder nicht, pflegt sich in ein paar Wochen herauszustellen. Ist der Tumor dann nicht kleiner geworden, so hat die Maß­ nahme vermutlich nichts gebracht. Mit Krebsimpfungen ist das verschiedenen klinischen Studien zufolge anders. Offen­ bar kann es da bis zu einem Jahr dauern, bis das Immunsys­ tem das Tumorwachstum in den Griff bekommt. Das überrascht nicht wirklich. Die Abwehr benötigt eine Menge Überredung, damit sie gegen Krebszellen vorgeht, denn diese gleichen immunologisch normalen Körperzellen allzu sehr. Viren oder Bakterien zu attackieren, also wirkliche Fremdlinge, fällt ihr sehr viel leichter. Diese Toleranz für Kör­ pereigenes dürfte das größte Hindernis sein, das die Forscher bei Krebsimpfstoffen überwinden müssen. Nicht selten scheinen Tumoren nach dem Impfen zunächst sogar noch weiterzuwachsen. Doch wie Gewebeproben zeigten, kann die Zunahme auf eingewanderte Immunzellen zurückgehen, welche die Gesamtmasse der Geschwulst vergrößern. Sollte das Immunsystem auch weiterhin so schleppend auf die Impfreize ansprechen, wie es bisher der Fall zu sein scheint, würde daraus für Behandlungsstrategien in näherer Zukunft zweierlei folgen: Zum einen hätten Patienten mit frühen Krebsstadien vermutlich die besseren Chancen – solange nämlich die Tumoren nicht so groß sind, dass sie bereits das Immunsystem hemmen. Diesem Personenkreis bleibt auch genügend Zeit, eine Immunantwort abzuwarten. Zum ande­ ren müssten sich Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung WWW.SPEK TRUM .DE vor der Impfung zuerst konventionellen Behandlungen unter­ ziehen, die den Tumor zunächst verkleinern. Denn große, län­ ger bestehende Geschwülste vermögen das Immunsystem nun einmal besser zu schwächen und sogar zu unterlaufen als kleine, jüngere. Weil sie viel mehr Zellen enthalten, geben sie nicht nur mehr immunsupprimierende Substanzen ab, son­ dern auch eine größere Palette davon. Im Spätstadium der Er­ krankung kann selbst ein gesundes Immunsystem der Tu­ mormasse wohl einfach nicht mehr Herr werden. Auch wenn sicherlich noch einige Hürden bestehen, wis­ sen wir nun: Das Immunsystem lässt sich bei einer Krebsthe­ rapie erfolgreich einbeziehen. Diese Erkenntnis gab vielen Krebsforschern aus wissenschaftlichen Institutionen und der Industrie, die auf dem Gebiet arbeiten und allzu oft Rück­ schläge einstecken mussten, neue Zuversicht. Sogar manche Ergebnisse früherer klinischer Studien, die bisher als ge­ scheitert galten, werden jetzt neu auf übersehene Anzeichen von Immunreaktionen hin analysiert. Ein solcher Verdacht besteht etwa im Fall der potenziellen Prostatakrebsvakzine Prostvac. Dieser Impfstoff verfehlte damals das gesetzte Ziel, das Tumorwachstum aufzuhalten, und die kleine Firma, die ihn entwickelte, gab auf. Später stellte sich jedoch heraus, dass die Behandlung den Kranken mehr Lebenszeit schenkte. Glücklicherweise hatte sich ein anderes Unternehmen die Rechte an Prostvac gesichert und befasst sich nun damit. Wer in einem Pharmabetrieb auf diesem Feld forscht, lernt bald, keine zu schnellen Versprechen abzugeben. Den­ noch – immer mehr von uns sehen die therapeutische Krebs­ impfung als zukünftiges Standbein neben den drei klassi­ schen Verfahren Operation, Chemotherapie und Bestrah­ lung. Für einige der häufigsten Krebsarten könnte sie in absehbarer Zeit Wirklichkeit werden. Ÿ DER AUTOR Eric von Hofe ist Präsident der Firma Antigen Express mit Sitz in Worcester, Massachusetts. Seine wissenschaftliche Arbeit widmete er der biotechnologischen Entwicklung neuer Krebstherapeutika. QUELLEN Perez, S. et al.: A New Era in Anticancer Peptide Vaccines. In: Cancer 116, S. 2071 – 2080, 2010; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20187092 Vergati, M. et al.: Strategies for Cancer Vaccine Development. In: Journal of Biomedicine and Biotechnology 2010; www.hindawi. com/journals/jbb/2010/596432 LITERATURTIPP Neue Strategien gegen Krebs. Spektrum der Wissenschaft, Dossier 3/2009 Ausgewählte Artikel von »Spektrum der Wissenschaft« zum Thema Krebs Dieser Artikel im Internet: www.spektrum.de/artikel/1139700 89 Vorschau Spezial Biologie · Medizin · Hirnforschung 2/2015 ab 17. 4. 2015 im Handel CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC) Seuchen – Geißel der Menschheit Verheerendes Ebolafieber Der jüngste Ebola-Ausbruch in Westafrika mit vielen tausend Opfern schreckte die Welt auf. Die Erkrankung verläuft in bis zu 90 Prozent der Fälle tödlich und lässt sich wie die meisten Virusinfektionen nicht ursächlich behandeln. Immerhin hat die fieberhafte Suche nach einem Impfstoff einige viel versprechende Kandidaten erbracht. Rückkehr der Pocken? ARMY MEDICINE, RANDAL J. SCHOEPP / CC-BY-2.0 (CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/2.0/LEGALCODE) NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES (NIAID) Weil die Blattern als ausgerottet gelten, wurden die flächendeckenden Impfungen dagegen eingestellt. Doch damit ging auch die Immunität gegen die Erreger der nah verwandten Affen- und Kuhpocken verloren, mit denen sich daher immer mehr Menschen anstecken. Vormarsch der Tuberkulose Mehr als eine Million Menschen stirbt jedes Jahr an der Schwindsucht. Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung ist latent infiziert. Die Tuberkelbakterien werden immer aggressiver und ver­ breiten sich besonders in Regionen mit schlechten Lebensbedingungen. Neue Waffen gegen Malaria Zutritt für HIV verboten Die vergessenen Seuchen Die Tropenkrankheit, unter der 300 bis 500 Millionen Menschen leiden, fordert jährlich fast eine Million Opfer. Bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Malaria gab es immer wieder herbe Rückschläge. Neue Hoffnung weckt nun eine Vakzine, die sich bereits im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Prüfung befindet. Aids ist noch immer unheilbar und mit über drei Millionen Neuinfektionen im Jahr eine der gefährlichsten Epidemien. Immerhin lassen sich die Symptome mit Medikamenten inzwischen lange unterdrücken. Durch eine Gen­ therapie wollen Mediziner jetzt das Immunsystem von Betroffenen gegen das HI-Virus wappnen. Chagas-Krankheit, Leishmaniose und Schlafkrankheit sind in den Tropen weit verbreitet. Dennoch wurden sie von Pharmafirmen und staatlichen Gesundheitssystemen lange so gut wie ignoriert. Nun will eine von mehreren Organisationen gestartete internationale Initiative die Entwicklung von Wirkstoffen anstoßen. 90 SPEZIAL BIOLOGIE – MEDIZIN – HIRNFORSCHUNG 1/2015 spe z i a l Biologie · Medizin · Hirnforschung Jetzt im Abo Bestellen und 15 % sparen Die Spektrum Spezial-Reihe BMH erscheint viermal pro Jahr – im Abonnement für nur € 29,60 inkl. Inlandsporto (ermäßigt auf Nach­weis € 25,60). Noch vor Erscheinen im Handel erhalten Sie die Hefte frei Haus und sparen dabei über 15 % gegenüber dem Einzelkauf! So einfach erreichen Sie uns: Telefon: 06221 9126-743 www.spektrum.de/spezialabo Fax: 06221 9126-751 | E-Mail: [email protected] Oder QR-Code per Smartphone scannen und Angebot sichern! Das Rechercheportal für herausragende Wissenschaftlerinnen AcademiaNet ist ein einzigartiger Service für Entscheidungsträger aus Wissenschaft und Industrie ebenso wie für Journalisten und Veranstalter von Tagungen und Kongressen. Hier finden Sie hoch qualifizierte Akademikerinnen, die neben ihren hervorragenden fachlichen Qualifikationen auch Führungserfahrung und Managementfähigkeiten vorweisen können. AcademiaNet, das europäische Rechercheportal für herausragende Wissenschaftlerinnen, bietet: • Profile hoch qualifizierter Akademikerinnen aller Fachrichtungen – ausgewählt von Vertretern renommierter Wissenschaftsorganisationen und Industrieverbände • Individuelle Suchmöglichkeiten nach Fachrichtungen, Arbeitsgebieten und weiteren Kriterien •A ktuelle Beiträge zum Thema »Frauen in der Wissenschaft« Eine Initiative der Robert Bosch Stiftung in Zusammenarbeit mit Spektrum der Wissenschaft und der nature publishing group www.academia-net.de