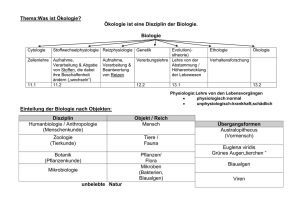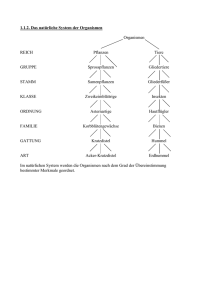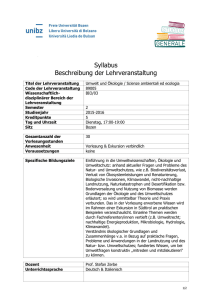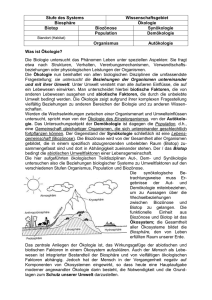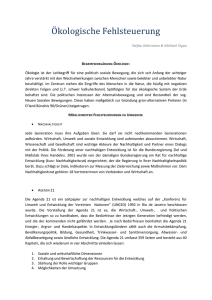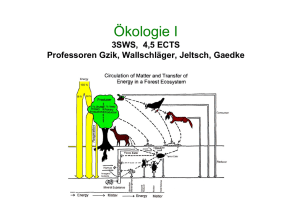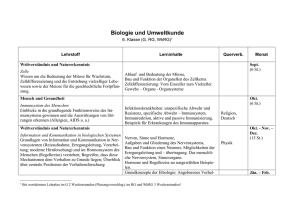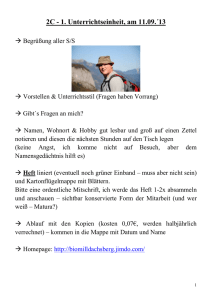Einführung in die Ökologie
Werbung

Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Einführung in die Ökologie Zusammenfassung von Marcus Jenal Inhaltsverzeichnis 1 Naturschutz ..............................................................................................................................7 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Grundlagen...............................................................................................................................7 Was ist Ökologie und was nicht...........................................................................................7 Hierarchischer Aufbau der Lebewelt ...................................................................................7 Holismus und Reduktionismus: wichtige Konzepte ............................................................8 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Die Konzepte Umwelt, Umweltschutz und Mitwelt................................................................8 Umwelt.................................................................................................................................8 Umweltschutz.......................................................................................................................9 Definitionen im Bereich der Biosphäre ...............................................................................9 1.3 1.3.1 1.3.2 Ökosystem: Ein wichtiges Konzept der Bioökologie ..............................................................9 Merkpunkte zum Leben ökologischer Systeme ...................................................................9 Typologie der Ökosysteme aufgrund des Einflusses des Menschen .................................10 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Biodiversität der Erde und der Schweiz.................................................................................11 Bekannte und geschätzte Artenzahlen weltweit.................................................................11 Bekannte und geschätzte Artenzahlen in der Schweiz.......................................................11 Methoden zur Abschätzung der globalen Biodiversität an Arten ......................................11 Genetische- und Ökosystemare Biodiversität ....................................................................11 1.5 1.5.1 1.5.2 Naturschutz und Biodiversität................................................................................................11 Warum Naturschutz?..........................................................................................................11 Wodurch Arten bedroht werden.........................................................................................12 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 Stichworte zu Naturschutz in Mitteleuropa ...........................................................................13 Was ist Naturschutz? Wieso Naturschutz? ........................................................................13 Gefährdung von Arten, Lebensgemeinschaften und Naturprozessen................................14 Ökosystemtheorie in der Landschaft, Inseltheorie und Naturschutz .................................16 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 Naturschutzexkursion Greifensee ..........................................................................................18 Hochstammobstgärten........................................................................................................18 Hecken und Waldrand........................................................................................................18 Entstehung der heutigen Riedgebiete, Veränderung der Landschaft.................................19 Riedvegetation ...................................................................................................................19 Vögel..................................................................................................................................20 Amphibien..........................................................................................................................20 Renaturierung: was für Naturschutzgebiete sollen geschaffen werden? ...........................20 Seite 1 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 2 Grundlagen der Ökologie – terrestrische Ökosysteme ..........................................................21 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Einführung .............................................................................................................................21 Was ist Ökologie................................................................................................................21 Was ist eine Art..................................................................................................................21 Verbreitung von Arten .......................................................................................................21 Vielfalt der Arten ...............................................................................................................21 Vielfalt der Faktoren ..........................................................................................................21 Ökologische Interaktionen .................................................................................................22 Seltene Arten......................................................................................................................22 Invasive Arten ....................................................................................................................22 Zukünftige Probleme..........................................................................................................22 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Wasser als limitierende Ressource.........................................................................................22 Klima..................................................................................................................................22 Wasser als Ressource .........................................................................................................23 Wasserverfügbarkeit ..........................................................................................................23 Anpassungen an Trockenheit .............................................................................................24 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 Strahlung (Photosynthese) .....................................................................................................24 Strahlungsklima .................................................................................................................24 Strahlung als Information...................................................................................................25 Strahlung als Energiequelle ...............................................................................................25 Photosynthese und Wachstum ...........................................................................................25 Anpassungen ans Schwachlicht .........................................................................................26 Anpassungen ans Starklicht ...............................................................................................26 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 Temperatur .............................................................................................................................27 Limitierende Faktoren........................................................................................................27 Thermik in Gewässern .......................................................................................................27 Temperaturen bei Pflanzen ................................................................................................27 Photosynthese und Temperatur..........................................................................................27 Temperaturen bei Tieren....................................................................................................27 Adaptation und Akklimatisation ........................................................................................28 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 Nährstoffe...............................................................................................................................28 Nährelemente und Nährstoffe ............................................................................................28 Boden-pH und Nährstoffangebot .......................................................................................28 Mykorrhiza.........................................................................................................................28 Standorte – Nährstoffgradient............................................................................................29 Nährstofflimitierung bei Tieren .........................................................................................29 Zersetzung und Abbau .......................................................................................................29 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 Störungen ...............................................................................................................................29 Grundlegendes zu Störungen .............................................................................................29 Mechanische Störungen .....................................................................................................29 Feuer...................................................................................................................................30 Habitatfragmentation .........................................................................................................30 Seite 2 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 Intraspezifische Konkurrenz-Populationen............................................................................30 Grundlegendes zur Konkurrenz .........................................................................................30 Dichte der Population.........................................................................................................30 Grösse der Individuen ........................................................................................................31 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 Populationen...........................................................................................................................32 Grundlegendes zu Populationen.........................................................................................32 Lebenszyklen .....................................................................................................................32 Lebenstafeln .......................................................................................................................33 Überleben und Mortalität ...................................................................................................33 Räumliche Prozesse ...........................................................................................................34 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 Interspezifische Konkurrenz ..................................................................................................34 Typen interspezifischer Konkurrenz..................................................................................34 Konkurrenz bei Pflanzen....................................................................................................34 Konkurrenz bei Tieren .......................................................................................................35 Komplexere Interaktion .....................................................................................................35 Konkurrenz vs Koexistenz .................................................................................................35 2.10 Positive Interaktionen ............................................................................................................35 2.10.1 Mutualismus.......................................................................................................................35 2.10.2 Symbiose............................................................................................................................35 2.10.3 Mutualismus vs Parasitismus .............................................................................................35 2.11 Koexistenz und Nische...........................................................................................................37 2.11.1 Fundamentale Nische.........................................................................................................37 2.11.2 Realisierte Nische ..............................................................................................................37 2.11.3 Charakterverschiebung.......................................................................................................37 2.11.4 Räumliche Differenzierung................................................................................................37 2.11.5 Zeitliche Differenzierung...................................................................................................37 2.12 Strategie .................................................................................................................................37 2.12.1 Was ist eine Strategie.........................................................................................................37 2.12.2 Funktionelle Pflanzentypen................................................................................................38 2.12.3 Trade Offs ..........................................................................................................................38 2.12.4 Strategien und Habitate......................................................................................................38 Seite 3 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie 3 ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Grundlagen der Ökologie – aquatische Ökosysteme .............................................................40 3.1 Einführung .............................................................................................................................40 3.1.1 Wasser als Lebensraum......................................................................................................40 3.1.2 Stehende Gewässer ............................................................................................................40 3.1.3 Fliessgewässer....................................................................................................................40 3.1.4 Funktionen des Wassers.....................................................................................................40 3.1.5 Ausdehnung der Ozeane ....................................................................................................40 3.1.6 Eigenschaften des Wassers ................................................................................................41 3.1.7 Löslichkeit von Gasen im Wasser......................................................................................41 3.1.8 Wichtige Wasserinhaltsstoffe ............................................................................................41 3.1.9 Osmotische Regulation ......................................................................................................41 3.1.10 Quellen ...............................................................................................................................42 3.1.11 Interstitial-/Grundwasser- und Höhlenbewohner...............................................................42 3.1.12 Fliessgewässer....................................................................................................................42 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 Strahlung und Thermik ..........................................................................................................42 Einstrahlung .......................................................................................................................42 Reflexion an der Wasseroberfläche ...................................................................................42 Absorption in der Wassersäule ..........................................................................................42 Spektrale Transparenz........................................................................................................43 Schichtungsverhalten eines Sees........................................................................................43 Thermische Schichtung im Meer .......................................................................................43 Thermik eines Fliessgewässers ..........................................................................................44 3.3 Nährstoffe als limitierende Ressource ...................................................................................44 3.3.1 Stoff- und Energietransfer..................................................................................................44 3.3.2 Minimum-Gesetz nach Leibig (Minimumsgesetz der Ökologie) ......................................44 3.3.3 Stabile Zusammensetzung Biomasse – Speicherung von limitierenden Stoffen...............44 3.3.4 Essentielle Nährstoffe ........................................................................................................44 3.3.5 Stöchiometrie des Wassers.................................................................................................44 3.3.6 Eignung des Wassers als Nährlösung ................................................................................45 3.3.7 Abhängigkeit von Wachstums-/Konsumrate vom Angebot ..............................................45 3.3.8 Dosis-Response-Beziehung ...............................................................................................45 3.3.9 Photosynthese-Licht-Beziehung ........................................................................................45 3.3.10 Nicht substituierbare Ressourcen.......................................................................................45 3.3.11 Substituierbare Ressourcen ................................................................................................46 3.3.12 Stickstoff ............................................................................................................................46 3.3.13 Sauerstoff als limitierende Ressource ................................................................................46 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 Mechanische Wirkung von Wasser........................................................................................46 Strömungsarten ..................................................................................................................46 Grossflächige Strömungen – Corioliskraft ........................................................................46 Vertikale Strömungen ........................................................................................................47 Oberflächenwellen .............................................................................................................47 Gezeiten .............................................................................................................................47 Fliessgewässer....................................................................................................................47 Gerinneformen von Fliessgewässern .................................................................................47 Anpassungen von Wasserorganismen an gerichtete Strömungen......................................48 Anpassungen der Planktonorganismen ..............................................................................48 Seite 4 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Verteilung in Zeit und Raum, Ausbreitung............................................................................48 Arten-Areal-Kurven ...........................................................................................................48 Mosaik-Struktur – Mosaik-Zyklus-Konzept......................................................................48 Inseltheorie.........................................................................................................................49 Ökologisches Gleichgewicht..............................................................................................49 Sukzession..........................................................................................................................49 3.6 Aquatische intraspezifische Interaktionen .............................................................................50 3.6.1 Wechselwirkungen in der Natur ........................................................................................50 3.6.2 Wechselbeziehungen..........................................................................................................50 3.6.3 Biologische Wechselwirkungen.........................................................................................50 3.6.4 Konkurrenz-Ausschlussprinzip..........................................................................................51 3.6.5 Faktoren innerartlicher Konkurrenz...................................................................................51 3.6.6 Intrinsisches Populationswachstum ...................................................................................52 3.6.7 Zeitverzögertes Wachstum und Überschiessen der Kapazität ...........................................52 3.6.8 Chaos..................................................................................................................................52 3.6.9 Dichteabhängige Entwicklung der Population...................................................................52 3.6.10 Revierverhalten ..................................................................................................................52 3.6.11 Schwarmverhalten..............................................................................................................53 3.6.12 Konkurrenzvermeidungsstrategie ......................................................................................53 3.6.13 Brutpflege...........................................................................................................................53 3.6.14 Wanderung .........................................................................................................................53 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.7.8 Nahrungsnetze, Nahrungsketten, Nahrungspyramiden..........................................................53 Trophiestufen .....................................................................................................................54 Nahrungsnetz .....................................................................................................................54 Nahrungsketten ..................................................................................................................54 Pyramiden ..........................................................................................................................54 Energiefluss........................................................................................................................55 Futtereffizienz – Bergmannsche Regel ..............................................................................55 Räuber-Beute .....................................................................................................................55 Beutevermeidungsstrategien ..............................................................................................55 3.8 Ökologische Nische und Einnischung ...................................................................................56 3.8.1 Definition ...........................................................................................................................56 3.8.2 Eindimensionale Nische.....................................................................................................56 3.8.3 Ökogramme........................................................................................................................56 3.8.4 Fundamentale Nische – realisierbare Nische .....................................................................56 3.8.5 Nischenseparation ..............................................................................................................56 3.8.6 Wiederbesetzung einer Nische nach Störung.....................................................................56 3.8.7 Vermeidung von Konkurrenz.............................................................................................57 3.8.8 Adaptive Radiation ............................................................................................................57 3.8.9 Konvergenz ........................................................................................................................57 3.8.10 Funktionelle Gruppen ........................................................................................................57 3.8.11 River-Continuum Concept .................................................................................................57 3.9 3.9.1 3.9.2 Lebenszyklus-Strategien im Wasser ......................................................................................58 Strategien des Überlebens..................................................................................................58 Trichopteren Emergenz – lunare Periodizität ....................................................................58 Seite 5 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 3.10 Störungen der aquatischen Systeme.......................................................................................58 3.10.1 Ökomorphologie ................................................................................................................58 3.10.2 Qualitative und quantitative Bedrohung der Gewässer......................................................58 3.10.3 Restwasser..........................................................................................................................59 3.10.4 Abfluss, Abflussregime......................................................................................................59 3.10.5 Eutrophierung.....................................................................................................................59 3.10.6 Selbstreinigung...................................................................................................................60 3.10.7 Biologische Beurteilung: Makroindex ...............................................................................60 3.10.8 Saprobienindex...................................................................................................................60 3.10.9 Abwasserreinigung.............................................................................................................60 3.10.10 Belüftung des Hüttenersees............................................................................................60 3.10.11 Begasung mit reinem Sauerstoff ....................................................................................61 Seite 6 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 1 Naturschutz 1.1 Grundlagen 1.1.1 Was ist Ökologie und was nicht Bioökologie (Umweltbiologie): Ökologie im klassischen und engeren Sinn; Naturwissenschaft von den Beziehungen der Lebewesen untereinander und zur unbelebten Umwelt (inkl. Einflüsse des Menschen). ‡ Nicht normativ! Systemanalyse, Gesamtheitsbetrachtung: Lehre von den Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen bzw. Prozessen; Vernetzungen, Systemtheorie. ‡ Nicht normativ! Philosophische Ökologie: Betrachtung der Beziehung Mensch-Natur im philosophischen Sinn; Ganzheitsbetrachtung. ± Normativ Naturschutz: Gesamtheit der Massnahmen zur Erhaltung von Tieren und Pflanzen wildlebender Arten, ihrer Lebensgemeinschaften und –grundlagen. ‡ Normativ Umweltschutz: Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensräumen gegen schädliche Einwirkungen, sowie Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. ‡ Normativ Ökologismus, Ökologische Bewegung: Politische Weltanschauung, die sich auf Bioökologie beruft. ‡ Normativ Zusammenhänge: Der Naturschutz holt sich oft die Motivation für seine Arbeit bei der Bioökologie, wobei zwischen diesen beiden oft etwas wie eine Personalunion besteht (Umweltbiologen oft auch im Naturschutz tätig ‡ know-how). Naturschutz, Umweltschutz und z.T. auch Ökologismus haben eine gemeinsame ethische Komponente. 1.1.2 Hierarchischer Aufbau der Lebewelt Die Lebewelt besteht aus verschiedenen Organisationsstufen, wobei jeweils die höchst organisierte Stufe wiederum die Grundlage der nächsten Stufe ist. Dabei steigt der Organisationsgrad jeweils folgendermassen an: Bausteine, Verbände gleichartiger Bausteine, funktionelle Einheiten und schliesslich Ganzheit, wobei dieser letzte Schritt zu einer Emergenz neuer Eigenschaften führt. Ganzheit Zelle Organismus Lebewelt der Erde (Biosphäre) Landschaftsökosysteme Mizelle (Mebra- Gewebe nen...) Lebensgemeinschaft (Biozönose) Funktionelle Artengruppen bzw. funkt. Populationsgruppen Populationen bzw. Arten Funktionelle Einheiten Organelle Organe Verbände gleichartiger Bausteine Bausteine Makromoleküle Organismen Lebensgemeinschaften (Ökosystem) Zellen Formationen Einteilung der Ökologie: • Organisationsstufe Seite 7 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Systematische Gruppe (Tier, Pflanze, Insekt ...) Ökosystemtyp (Wald, Meer ...) Zeit (Pläoökologie, Evolution ...) Funktion (Keimungsökologie ...) Massnahme (Renaturierungsökologie, Bauökologie, Naturschutzökologie ...) Je nach Organisationsstufe bedeutet gleicher Einfluss ganz verschiedenes. Zum Teil können Massnahmen auf der Ebene von Biotop- und Ökosystempflege ausreichen, z.T. müssen Massnahmen auf internationaler bzw. kontinentaler Ebene durchgeführt werden, um zum Erfolg zu führen. 1.1.3 Holismus und Reduktionismus: wichtige Konzepte Holismus: Ganzheit nur auf der Stufe der Ganzheit verstehbar, Ganzes mehr als die Summe seiner Teile (Emergenz). Reduktionismus: Aus der Eigenschaft der Teile ist auch das Ganze verstehbar. Iteratives und interaktives Vorgehen. Holismus enthüllt den Sinn ohne Angabe über dessen Verwirklichung, Reduktionismus Beschreibt die Mechanismen die alleine keinen Sinn ergeben. 1.2 Die Konzepte Umwelt, Umweltschutz und Mitwelt 1.2.1 Umwelt Einige Begriffe aus verschiedenen Definitionen: Eigenwelt: individuelle Welt des Organismus’, nicht bloss durch Umgebung, sondern auch durch die jeweiligen Sinnesorgane und Sinnesleistungen des Organismus gegeben ist Merkwelt: Organismus in seiner Eigenwelt Wirkwelt: alles, was ein bestimmtes Tier in seiner Umgebung an Veränderungen aktiv zu bewirken vermag Mitwelt: die Gesamtheit der Faktoren, welche innerhalb eines Organismenkollektivs auf dessen Glieder und auf das Kollektiv als Ganzes einwirken. Autökologische Betrachtungsweise: Gesamtheit aller Faktoren, die effektiv auf den individuellen Organismus einwirken, betrachtet alle Faktoren, die die Verbreitung und Häufigkeit einer bestimmten At beeinflussen (Individuum im Zentrum). Demökologie: Population im Zentrum Synokologie: Lebensgemeinschaft im Zentrum (=Biozönose) Definitionen: Lexikalisch: Aggregat der umgebenden Dinge, Bedingungen und Einwirkungen. Heutige Definition: Gesamtheit aller ökologischen Faktoren, die effektiv auf einen Organismus oder Organismen einwirken. Kritikpunkte am Begriff „Umwelt“ • der Begriff „Umwelt“ setzt automatisch den Menschen in den Mittelpunkt • einst aus der Einsicht entstanden, dass der Mensch mit dem Rest der Welt etwas zu tun hat und dass diese ihm sein Verhalten heimzahlen kann • Erkenntnis reift, dass der Mensch gar nicht der Mittelpunkt ist: die Natur brauch ihn nicht, um zu überleben • Alternative: „Mitwelt“ unterstreicht die Gleichberechtigung der anderen Lebewesen auf die Lebensräume der Erde • Mensch ist Teil der untrennbaren Ganzheit seiner Mitwelt Seite 8 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 1.2.2 Umweltschutz Gesamtheit der Massnahmen zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Gesundheit des Menschen, einschliesslich ethischer und ästhetischer Ansprüche vor schädigenden Einflüssen von Landnutzung und Technik. a) Biologischer Umweltschutz (= ökologischer Umweltschutz, ≠ Naturschutz) b) Technischer Umweltschutz: Einsatz technischer Massnahmen zur Vorbeugung und Verminderung schädigender Einflüsse der Technik auf die natürlichen Lebensgrundlagen und die Gesundheit des Menschen. 1.2.3 Definitionen im Bereich der Biosphäre Ökologie (Haeckel E., 1866: Generelle Mophologie der Organismen 2): Oecologie ist „die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinn alle Existenz-Bedingungen rechnen können“. Abgeleitet aus dem Griechischen: oikos = Haus, Wohnung, Haushalt; logos = Wort, Lehre, Wissenschaft. Ökosystem (moderne Definition): Funktionelle Einheit der Biosphäre als Wirkungsgefüge aus Lebewesen, unbelebten natürlichen und vom Menschen geschaffenen (anthropogenen) Bestandteilen, die untereinander und mit ihrer Umwelt in energetsichen, stofflichen und informatorischen Wechselwirkungen stehen. Beispiele: Hochmoor, Weiher, alpine Rasen, Düngewiesen, Weizenacker, Hochstamm-Obstgarten, Dorf ... 1.3 Ökosystem: Ein wichtiges Konzept der Bioökologie Ein Ökosystem (Biogeozönose) umfasst einen Biotop (Lebensort, Habitat, abiot. Standort) und eien Organismen- bzw. Lebensgemeinschaft (Biozönose). Es wird beeinflusst von unabhängigen, ökosystembildenden Faktoren wie Grossklima (Strahlung, Niederschläge, Wind), Relief, Muttergestein (Boden, Nährstoffe, Wasser/Luft), Zeitfaktor, Mensch und auch von den Organismen. Artenzahlen in einem Bestand (einige ha) in Laubmischwald in ebener Lage auf Mischgestein im Schweizer Mittelland: Tiergemeinschaft, Zoozönose 2000 Pflanzengemeinschaft, verschiedene Algen Phytozönose 100 100e Mikroorganismen-Gemeinschaft Pilze Bakterien 800 viele 100 Arten in einigen 10 km2 Landschaft ohne Stadt und See im Schweizer Mittelland: Fauna ≥10’000 Flora 1’000 versch. Algen 1’000e Pilzflora einige 1’000 Protistenflora viele 100 Definition Sukzession: Entwicklungsreihe von Pflanzen- oder Tiergesellschaften am gleichen Ort, die durch Änderung der Umweltverhältnisse (z. B. Klimaänderungen, menschliche Einflüsse) oder durch die Gesellschaft selbst verursacht wird. 1.3.1 Merkpunkte zum Leben ökologischer Systeme 1 Offenheit bezüglich Energie, Stoffen und Information 2 Erhaltung von Energie und chemischen Elementen 3 Energiefluss (nicht Kreislauf) ‡ mit Kohlenstoffkreislauf gekoppelt (Photosynthese und Atmung) ‡ Biosysteme schaffen Ordnung; anorganische Systeme zunehmende Entropie! Seite 9 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 ‡ Energie wichtig auch als Wärme, Wind, Steuerung von ökol. Prozessen etc. 4 Stoffkreislauf ‡ durch Energiefluss angetrieben ‡ grosse Stoffmengen in Reservoiren, nur geringe im Umlauf ‡ Kreislauf offen oder geschlossen, je nach Stoff und Grenze 5 Vielzahl von Teilen und Prozessen 6 Wechselwirkungen zwischen Teilen, Interdependenz ‡ meist gegenseitige Abhängigkeiten (Rückkoppelung) 7 Veränderung der Arten (Teile) selbst im Laufe der Zeit durch Mutation, Selektion, usw. ‡ Zeitabhängigkeit, Geschichtlichkeit und Einmaligkeit biologischer Systeme! 8 Hierarchischer Aufbau 9 Entstehung von ökologischen Systemen: ‡ Sukzession (Tage bis Jahrhunderte): gerichtete Abfolge verschiedener Ökosysteme am gleichen Ort (kann auch zyklisch sein) ‡ Evolution und Koevolution (Jahre bis Jahrmillionen), d.h. genetsiche Veränderungen der Arten. 10 Das Ganze ≠ Summe seiner Teile ‡ Es entsteht grundsätzlich Neues mit neuen Eigenschaften, welche nicht alle aus den Eigenschaften der Teile voraussagbar sind. 1.3.2 Typologie der Ökosysteme aufgrund des Einflusses des Menschen Um welche Ökosystemtypen kümmert sich der Naturschutz? Ökosystemtypen und ihre Gliederung unter dem Gesichtspunkt menschlicher Beeinflussung und Nutzung: A Bio-Ökosysteme – Überwiegend aus natürlichen Bestandteilen aufgebaute und durch biologische Abläufe gekennzeichnete Ökosysteme: 1. Natürliche Ökosysteme. Vom Menschen nicht oder kaum beeinflusst. Selbstregelungsfähig ‡ Auenwald, Schlucht-Wald, Hochmoor, gewisse Bannwälder, Altholzinsel 2. Naturnahe Ökosysteme. Vom Menschen beeinflusst oder genutzt, doch den natürlichen Ökosystemen ähnlich; ändern sich bei Aufhören der Nutzung kaum. Selbstregelungsfähig ‡ Artenreicher, naturnaher Wirtschaftswald 3. Halbnatürliche Ökosysteme. Durch menschliche Nutzung aus Typ 1 oder 2 hervorgegangen, aber nicht oder nicht bewusst geschaffen; ändern sich bei Aufhören der Nutzung. Begrenzt selbstregelungsfähig ‡ Flachmoor, Magerwiesen, Halbtrockenrasen, alte Hecke 4. Agrar- und Forst-Ökosysteme sowie Teiche („Nutz-Ökosysteme“). Vom Menschen bewusst geschaffen und völlig von ihm abhängig. Selbstregelung wird weitgehend durch Steuerung von aussen (unter Energiezufuhr) ersetzt ‡ Hochstamm-Obstgarten, gepflanzte Hecke, Ackerrandstreifen B Techno-Ökosysteme – Überwiegend aus technischen Strukturen und Funktionen bestehende, vom Menschen bewusst geschaffene Ökosysteme für kulturell-zivilisatorisch-technische Aktivitäten. Nicht selbstregelungsfähig, völlig von Aussensteuerung (unter hoher Energiezufuhr) und von umgebenden und sie durchdringenden Bio-Ökosystemen abhängig. Unterteilung in Dorf-, Stadt-, Grossstadt-, Industrie-, Verkehrs- u.a. Ökosysteme ‡ Klingnauer-Stausee, Kieswand in Kiesgrube, Kiesfloss Seite 10 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 1.4 Biodiversität der Erde und der Schweiz Biodiversität ist die Vielfalt an biologischen Einheiten: ökosystemare Diversität, Arten-Diversität, Genetische Diversität (Rassen) 1.4.1 Bekannte und geschätzte Artenzahlen weltweit Bekannte Artenzahl Pflanzen Tiere Gesamtartenzahl Geschätzte Artenzahl 248’535 1'273’075 1'646’240 450’000 22'013’830 28'013’830 Andere Schätzungen gehen von Gesamtartenzahlen zwischen 5 und 50 Mio aus. 1.4.2 Bekannte und geschätzte Artenzahlen in der Schweiz Arthropoda Chordata Total wildlebende Tiere Total Arten Gefässpflanzen Total Arten Moose Total Arten Fungi Gesamte Artenzahl in der Schweiz Bekannte Artenzahl 19’590 376 20’000 2’696 1’030 24’000 80'000-100’000 Geschätzte Artenzahl 33’700* 376* 40’431 * nicht Prüfungsstoff 1.4.3 • • • • • Methoden zur Abschätzung der globalen Biodiversität an Arten Artenzahlen und Proportionen zwischen ihnen Artenzahlen Ökosystemstrukturen und Artenzahlverhältnisse Grössenvergleich (Artenzahl steigt umgekehrt proportional zur Körpergrösse) Abschätzung mittels Hochrechnen von Käferarten auf einer tropischen Baumart 1.4.4 Genetische- und Ökosystemare Biodiversität Genetische Biodiveristät: Biodiveristät unterhalb der Stufe der Art: • Rassen von Tieren • Cultivars von Getreide-Arten • Genotypen innerhalb einer Population • Apfelsorten Ökosystemare Biodiversität: Biodiversität auf der Stufe Ökosystem bzw. Lebensgemeinschaft: • Ca. 30 Pflanzengesellschaften im Feuchtgebiet Greifensee • 235 Lebensraumtypen in der Schweiz • 10 Vegetationszonen auf der Erde 1.5 Naturschutz und Biodiversität 1.5.1 Warum Naturschutz? • Problem des Aussterbens von Arten durch Menschlichte Aktivitäten (Jagd, Habitatszerstörung, Umweltverschmutzung, usw.) • Erkennen, was es zu schützen gibt. Genaue Definition von des Begriffes Biodiversität Seite 11 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Grössenordnung des Problems ermitteln. Festlegen von Artenzahlen, Aussterberaten (mit und ohne anthropogenen Einfluss) ‡ Ausgehend von einer globalen Artenzahl von 10 Mio. und einer durchschnittlichen Überlebensdauer (jede Art stirbt irgendwann aus) einer Art von bis zehn Mio. Jahren liegt die momentane Verlustrate für Vögel und Säugetiere von etwa 1% um einen Faktor 100 bis 1'000 über der „natürlichen“ Hintergrundaussterberate. Dies deutet auf ein bevorstehendes Massenaussterben hin. Um die Natur politisch schützenswert zu machen, muss man ihr einen ökonomischen Wert zuordnen können. Es gibt drei mögliche Grundlagen für die ökonomische Einschätzung: 1. der unmittelbare Produktwert, 2. der indirekte wirtschaftliche Wert und 3. der ethische Wert. Um erfolgreichen Naturschutz zu betreiben, muss man Ziele setzen und Gebiete identifizieren, in denen sich diese Ziele am besten erreichen lassen. 1.5.2 Wodurch Arten bedroht werden Unterscheidung des Aussterberisikos: • Empfindlich: Wahrscheinlichkeit der Auslöschung der Art in den nächsten 100 Jahren bei 10% • Gefährdet: Wahrscheinlichkeit der Auslöschung der Art innerhalb der nächsten 20 Jahre oder 10 Generationen bei 20% • Kritisch: Wahrscheinlichkeit der Auslöschung der Art innerhalb der nächsten fünf Jahren oder zwei Generationen bei 50% • Bedroht: Arten fallen in eine der oben aufgeführten Kategorien Definition von „Seltenheit“: • Intensität: Populationsdichte innerhalb einzelner Besiedlungsgebiete • Prävalenz: Anzahl und Grösse der insgesamt zur Verfügung stehenden Lebensräume • Kategorien der Häufigkeit und Seltenheit: Es werden acht Kategorien unterschieden: Prävalenz Geografische \ Verbreitung Intensität Habitatspezifität Grosse lokale Populationen Kleine lokale Populationen weit breit eng schmal breit schmal Von diesen acht Kategorien kann nur eine als nicht selten definiert werden, jene nämlich mit weiter geografischer Verbreitung, breiter Habitatspezifität und grossen lokalen Populationen. • Oft tendieren Arten mit einem engen Verbreitungsgebiet zu lokal niedrigen Populationsdichten ‡ zweifache Gefährdung Menschlich bedingte Risikofaktoren: • Übermässige Ausbeutung (Ausrottung) • Habitatveränderung. Negative Beeinflussung auf dreierlei Weisen: 1. Teilweise Zerstörung des Habitats zur urbanen und industriellen Erschliessung von Landflächen oder zur Gewinnung von Nahrungsmitteln und Nutzholz. 2. Habitatsverschmutzung in einem für bestimmte Arten nicht mehr tolerierbaren Ausmass. 3. Störung des Habitats zum Nachteil einiger ansässiger Arten Seite 12 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 o Waldrodungen sind die häufigsten Ursachen für Habitatszerstörungen o Degradation von Lebensräumen durch Pestizide, sauren Regen bis hin zu globalen Klimaveränderungen o Habitatsstörungen nicht weitreichend wie Zerstörung oder Degradation, einige Arten aber sehr empfindlich • Einführung von Arten ‡ Häufig bewirken eingeführte Arten eine Abnahme der Biodiversität • Populationsgenetische Geschichtspunkte o Genetische Variabilität: Produkt aus natürlicher Selektion und genetischer Drift o Effektive Populationsgrösse (Anzahl der den Genpool beeinflussenden Individuen) oft deutlich kleiner als die tatsächliche. o Erhalt der Genetischen Variabilität notwendig, um Adaptationsprozesse an sich ändernde Umweltbedingungen zu ermöglichen. o Problem der Inzucht Oft ist es mehr als ein Faktor, welcher zum Aussterben einer Art führt (Aussterbestrudel). Auch gibt es das so genannte sekundäre Aussterben, bei dem das Aussterben einer Art eine andere mit sich reisst. Die Ursachen für das Aussterben der ausgerotteten Arten liegen etwa bei einem Viertel an der Habitatszerstörung, bei einem weiteren Viertel an der übermässigen Ausbeute und bei einem dritten Viertel an der Einführung fremder Arten. Mehr als die Hälfte der vom Aussterben bedrohten Arten leidet unter Habitatszerstörung, ein Viertel unter übermässiger Ausbeute und ein Viertel unter der Einführung fremder Arten. 1.6 Stichworte zu Naturschutz in Mitteleuropa 1.6.1 Was ist Naturschutz? Wieso Naturschutz? Definition Naturschutz: Gesamtheit aller Massnahmen zur Erhaltung von Pflanzen, Pilzen und Tieren wildlebender Arten, ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensgrundlagen. Liste von Massnahmen, die für den Naturschutz ergriffen werden müssen: • Naturwissenschaftliche Grundlagen erarbeiten • Politisch-planerische Aspekte berücksichtigen • Praktisches Anwenden der naturwissenschaftlichen Grundlagen • Finanzierung • Gesetze anwenden • Ethisch-psychische Aspekte ernst nehmen Naturschutz schützt nicht nur unberührte Natur, sondern ebenso halbnatürliche Ökosysteme und anthropogene Ökosysteme (siehe auch Abschnitt 2.3.2). Es genügt allerdings nicht, Natur- bzw. Kulturschutzgebiete einfach zu schützen, sondern sie müssen auch entsprechend ihrem Charakter gepflegt werden (Mähen von Rasen, Schneiden von Bäumen etc.) Argumente für den Naturschutz: • Ethisches Argument • Kulturhistorisches Argument • Ästhetisches Argument • Medizinisches Argument • Psychohygienisches Argument Seite 13 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Pädagogisch-wissenschaftliches Argument Argumente des praktischen Nutzens, d.h. wirtschaftliche Argumente Politisches Argument Gesetzliche Aufgabe des Staates Argumente gegen den Naturschutz • Ökonomische Nachteile • Einschränkung der Freiheit und Bequemlichkeit • Nur emotionale und ideelle Werte, nicht quantifizierbar • Nützt Naturschutz der Natur (noch)? • Resignation • Vehikel für politische (gesellschaftskritische) Aktivitäten • Menschenrechte vor Naturschutz (wichtigere Probleme) • Tradition • Pseudo-Religiosität („Macht euch die Erde Untertan“) • Die Natur ist ein evolutiver und selbst erhaltender Prozess • Naturschutz ja, aber nicht bei mir (Nimby-Syndrom – not in my backyard) • Naturschützer selber uneinig • Naturschutz mischt sich überall ein 1.6.2 Gefährdung von Arten, Lebensgemeinschaften und Naturprozessen Gründe für die Gefährdung (siehe Abschnitt 2.5) Viele Gebiete sind von Naturlandschaft (Früher) über eine naturnahe Kulturlandschaft (Gestern) zu einer naturfernen Kulturlandschaft, einer Zivilisationslandschaft umgestaltet worden. Folgende Ökosysteme konnten im Mittelland vor der starken Beeinflussung des Menschen beobachtet werden: • Sumpf- und Moorwälder • Laubmischurwälder • Seeufer • Hochmoore • fluss- und Bachläufe • Bachtobel • Naturweiher, Quelen, Grundwasseraufstösse • Felsfluren Ursachen und Verursacher der Dezimierung von Pflanzen-, Vogel, und Tagfalter-Arten in der BRD (analog CH): Ursachen des Rückgangs von Fran- und Blütenpflanzen • Änderung der Nutzung • Aufgabe der Nutzung • Beseitigung von Sonderstandorten • Auffüllung, Bebauung • Entwässerung • Bodeneutrophierung • etc. Verursacher des Rückgangs von Fran- und Blütenpflanzen • Landwirtschaft • Forstwirtschaft & Jagd Seite 14 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Tourismus und Erholung Rohstoffgewinnung, Kleintagbau Gewerbe, Siedlung & Industrie Wasserwirtschaft etc. Gefährdungsfaktoren der Vogelarten • Landbewirtschaftung • Industrie, Gewerbe • Störung • Wasserwirtschaft • Waldwirtschaft • Besiedlung • etc. Verursacher des Rückgangs gefährdeter Tagfalterarten • Landwirtschaft • Forstwirtschaft • Kleintagebau • Sammler • Siedlung und Verkehr • Abfallbeseitigung • etc. Schätzungen der Grössenordnungen der Veränderung von Artenzahlen in der Umgebung ZH Landschaftstyp Ursprünglich Mittelalter Naturlandschaft Pflanzenarten 300 Tierarten 70 Gründe für Veränderungen +400 +30 wegen Land/Forstwirtschaft, später auf fremden Kontinenten Gestern Naturnahe Kulturlandschaft Mitte 20 Jhd 690 100 -200 -30 wegen Intensivierung von Land-/Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Tourismus usw. Heute Naturfremde Kulturlandschaft (Zivilisationslandschaft) 490 70 Rote Listen der direkt oder indirekt ausgerotteten und der gefährdeten Tierarten und Pflanzenarten der Schweiz: • politisches und wissenschaftliches Instrument des Naturschutzes • zeigt an, welche Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz stark abgenommen haben oder durch heute wirksame oder voraussehbare Ursachen gefährdet sind • Hauptkriterium für Aufnahme in Rote Liste ist der Gefährdungsgrad (neben Seltenheit, Attraktivität, Bedeutung für den Menschen sowie der Kenntnisstand in der Schweiz) • Gefährdungskategorien der Schweizer RL: o 0 ausgestorben o 1 vom Aussterben bedroht Seite 15 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 o 2 stark gefährdet o 3 gefährdet o 4 potentiell gefährdet o – nicht autochthon vorkommend o n nicht gefährdet Gefährdungskategorien IUCN: o Ex: extinct (0) o E: endangered (1 und 2) o V: vulnerable (3) wichtige Aufgabe der Liste ist das Hinweisen auf die grossen Lücken der faunistischen Kenntnisse in der Schweiz (40'000 Arten werden geschätzt, erst gut die Hälfte ist tatsächlich festgestellt worden) Blaue Listen • Aufzeigen von Erfolgen im Naturschutz • erfasst werden Arten der Roten Listen, deren Bestand sich im Testgebiet gesamthaft stabilisiert oder sogar erhöht hat • etwa ein Drittel der noch nicht ausgestorbenen Rote-Liste-Arten sind auch auf den Blauen Listen vertreten, für ein weiteres Drittel der RL-Arten sind Förderungstechniken lokal erfolgreich erprobt worden • Einer der Gründe für die Stabilisierung der Arten ist das Anwenden geeigneter Natur- und Umweltschutztechniken, diese werden erfasst und weiterentwickelt 1.6.3 Ökosystemtheorie in der Landschaft, Inseltheorie und Naturschutz Inseltheorie und moderner Naturschutz: • Landschaft ist durch für Tier- und Pflanzenarten unüberwindbare Hindernisse (Verkehrswege, Siedlungen, natürliche Gewässer, grosse Wälder) in natürliche oder anthropogene Biotopinseln unterteilt • Je grösser Biotopinsel, desto grösser im allgemeinen die Artenzahl (Zusammenhang mit dem Minimalraum einzelner Arten und Anteil der Randzone) • Verdoppelung der Artenzahl erfordert eine Verzehnfachung der Fläche der (homogenen) Biotopinsel! • Die meisten naturschützerisch wertvollen Arten kommen nur in grossen Biotopinseln vor • Wichtig: neben Grösse auch Erreichbarkeit und Form der Biotopinsel (Inseltheorie von MacArthur und Wilson) • Forderung: Nicht nur isolierte einzelne Schutzgebiete, sondern naturnahe Landschaft, Korridore und so genannte Trittsteine zwischen ihnen • Modifikation der Inseltheorie für inhomogene Biotopinseln sowie für Tiere, welche Grenzen (Waldrand, Ufer) oder mehrere Biotope benötigen • Inseltheorie gilt für Pflanzen nur beschränkt • Mögliche Biotopversinselungen: o Isolierte Berggipfel o Isolierte Gewässer o Strasse isoliert Wälder o Nadelwald isoliert Laubwälder Stichworte zu Ursachen für grossen Raumbedarf vor allem bei Tieren: • Grosser Nahrungsbedarf bei sehr grossen Tieren Seite 16 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Nahrung dünn verteilt Andere unerlässliche ökologische Nische dünn verteilt, z.B. Sitzwarte, Bestäuber, Übergangsbiotop Biotopwechsel, z.B. bei Amphibien, Vögeln (Neuntöter), Tagfaltern Ethologische Gründe, z.B. Territorialverhalten, Fluchtdistanz, Randeffekte Population braucht bestimmte Grösse und somit bestimmten Raum Langfristig sind grosse Populationen und somit grosser Raumbedarf von Vorteil (genetische Vielfalt für evolutive Anpassung an Umweltveränderungen) Dynamik und Gleichgewicht der Artenzahlen eines Gebietes (Biotopinsel): • Faktoren o Einwanderung o Aussterben verbunden mit Auswandern o Art-Neubildung (gering) • Gleichgewicht der Artenzahlen (Einwanderung vs. Aussterben) wird durch Grösse Isolation eines Biotops extrem beeinflusst (geringere Einwanderung, höhere Aussterberaten bei kleinen, isolierten Biotopen) • SLOSS-Problematik (single large or several small) Artenzahl vor allem an Tieren kleiner grösser Naturschutzwert i. allg. geringer kleine Fläche bei gleicher Gesamtfläche getrennt fern Strasse/Bahn trennt Inseln Inseln in einer Linie i. allg. grösser grosse Fläche zusammen nahe Inseln nur räumlich getrennt alle Inseln gleich weit voneinander entfernt (Dreieck) Gesamte Linie eine Insel (ungetrennt) Inseln mit Korridor vernetzt Inseln in einer Linie Inseln getrennt • Ausnahmen (Tierarten, bei denen obige Punkte nicht zutreffen): o Randbewohner o Arten mit Biotopwechsel o Tiere mit kleinem Flächenbedarf o in kleineren Gebieten geringeres Risiko für Ausbreitung von Parasiten, Krankheiten Anwendung der Inseltheorie im Naturschutz muss vorsichtig und artbezogen geschehen: • Unterschiedliche Bedürfnisse der Tiere bezüglich Biotopgrösse/-art/-homogenität/-vielfalt • Arten, die auf Übergangsgebiete zwischen verschiedenen Ökosystemen angewiesen sind (Ökotone) Umgebungszone um Naturschutzgebiet: • nicht oder nur indirekt gedüngt • keine Veränderung des Bodenwasserhaushaltes • keine schädliche Immissionen • keine Pestizide • Beschattung beachten • ungehinderte Möglichkeit zum Ein- und Auswandern bestimmter Tiere (Inseltheorie) Seite 17 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • 1.7 ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Naturnahe Korridore zu benachbarten NSG erhalten oder einrichten Sichtschutz für Tiere wichtig Naturschutzexkursion Greifensee 1.7.1 Hochstammobstgärten Vorteile: Nachteile: • Bereicherung der Landschaft • geringer Verdienst • Erholungsraum • Früchte weniger genormt • lebendes Kulturgut • volle Erträge erst nach ca. 10 Jahren • Windschutz • grosse Ertragsschwankungen • Schattenspender für Mensch und Tier • schwieriger Schnitt, Ernte • vielfältiger Lebensraum (Arten-Biodiversität) • schwierige Umstellung bei Marktänderungen • unzählige Obstsorten (Genetische Biodiver• Flächen darunter nicht als Acker nutzbar sität) • Wieso darunter schwierig zu mähen • doppelte Landnutzung (Obst, Weide) • Jungpflanzungen durch Mäuse stark geschä• Erntearbeit im Herbst, nicht Sommer digt • Diversifizierung des LW Betriebes • Viele alte Obstsorten mit Nachteilen • benötigt weniger Pflege als Niederstämme (schlechte Resistenzen, Lagerfähigkeit, etc.) • weniger Insektizide • Ökobeiträge • Als Ökoausgleichsfläche anrechenbar Gründen für den Rückgang der Hochstamm-Obstgärten: • Überbauungen • Politik (Prämien für Fällen von Hochstämmen in den 50er und 60er Jahren) • Konsumverhalten (Südfrüchte vor Äpfeln, andere Getränke vor Most) • Bewirtschaftungsmethoden Der ökologische und landschaftliche Wert der Hochstamm-Obstgärten wird heute wieder höher eingeschätzt, auch Bund und Kantone setzen sich für deren Erhaltung ein. 1.7.2 Hecken und Waldrand • Hecke: dichter, schmaler Gehölzstreifen, der mit Sträuchern und allenfalls mit Bäumen bestockt ist, zu jeder Hecke gehört ein Krautsaum. • Unterscheide: Niederhecke (2-3m hoch), Hochhecke (Schichten niederer und höherer Sträucher, kleiner 6m), Baumhecke (Hochhecke mit Bäumen, höher 6m) • Hecken sind eigene Biotope, in Feldhecken wurden bis zu 900 Tierarten festgestellt, überwiegend Insekten. Bedeutung der Hecken: • bremsen den Wind • Erhöhen Boden- und Luftfeuchtigkeit • verhindern Rutschen von Lawinen, bremsen Wassererosion • Tierische Artenvielfalt stabilisiert Ökosystem • Verschönerung des Landschaftsbildes, heimatkundlicher Wert Bewirtschaftungsgrundsätze für Hecken: • nie Kahlschlag, alle 10-15 Jahre abschnittweise selektiv auf Stock setzen Seite 18 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • 1.7.3 • • • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Krautsaum alle 1-2 Jahre schneiden 2-3m Platz für Krausaum lassen Waldrand gestuft machen Entstehung der heutigen Riedgebiete, Veränderung der Landschaft Greifensee entstand während der letzten Eiszeit ursprüngliche Ausmasse weit grösser, Vegetation um See überwiegend Wald Einfluss der Siedler: Rodung und Bewirtschaftung ‡ Entstehung vielfältiger Kulturlandschaft (Äcker, Weiden, Wiesen, Obstgärten, Rebbergen, etc.) Später: Umwandlung der Riedflächen durch Entwässerung und Düngung zu Landwirtschaftsland, wertvolle Standorte zerstört ‡ deutliche Abnahme der Vielfalt Bevölkerungszahl stieg stark an ‡ Bis 1976 sind über 80% der Feuchtgebiete verschwunden, über die Hälfte der Sumpf- und Wasserpflanzen sind gefährdet. Mögliche Massnahmen zum Schutz der Natur am Greifensee: • Verbesserung der Kläranlagen • Einsetzen von Jungfischen • Renaturierung der Ufervegetation • keine weitere Entwässerungen, evtl. Vernässung • Pufferzonen • Einrichten von Sperrzonen • Zusammenführen von Schutzzonen (Inseltheorie) ‡ Badi Egg 1.7.4 Riedvegetation Natürliche Abfolge der Verlandungsvegetation an Mittellandsehen: 1. Schwimmblattgesellschaften 2. Röhricht (Schilf) 3. Gross-Seggenried 4. Weidegebüsch 5. Schwarzerlen-Moorwald 6. Eschenmischwald 7. Buchenwald Regelmässiger Schnitt im Herbst führt zu: 1. Schwimmblattgesellschaften 2. Röhricht (Schilf) 3. Gross-Seggenried 4. Kleinseggenried 5. Pfeifengraswiese Düngung und Schnitt bzw. Verbrachung: 1. Schwimmblattgesellschaften, ev Algenwatten 2. Röhricht (Schilf) 3. Gross-Seggenried 4. Hochstaudenflur 5. wechselnasse Fettwiese Düngeeinfluss und Pufferzonen Seite 19 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Eintrag von Nährstoffen hat erheblichen Einfluss auf Artenzusammensetzung Rückentwicklung ist – wenn überhaupt – nur noch sehr langsam möglich (Nährstoffanreicherung im Boden, neue Pflanzen haben sich etabliert, wachsen auch mit weniger Nährstoffen) Einschwemmung von Nährstoffen kann durch Pufferzonen verhindert werden 1.7.5 Vögel • Greifensee als bedeutendes Überwinterungs- und Durchzugsgebiet (60 Brutvogelarten, insgesamt 219 Vogelarten) • wertvollste Gebiete: Uferbereiche mit breiter Verlandungszone ‡ nur ein Drittel des Ufers müsste abgesperrt sein, um fast die ganze Vielfalt zu erhalten 1.7.6 Amphibien • Ansprüche einzelner Amphibienarten sehr verschieden • Am Greifensee wurden viele im Kanton Zürich vorkommende Amphibienarten nachgewiesen • wichtigste Lokalität: Kiesgrube und Riedgebiet 1.7.7 Renaturierung: was für Naturschutzgebiete sollen geschaffen werden? Ziele unberührte Natur; Prozessschutz Massnahmen Natur von selbst zurückkehren lassen Ursprüngliche Natur vor Standortsbedingungen dem Eingreifen des Men- wiederherstellen, Tiere schen und Pflanzen wiederansiedeln Heutige potentielle Natur Ansiedlung der entspre(Natur aus zweiter Hand) chenden Tier und Pflanzengesellschaften Mangel-Ökosystem der Standortbedingungen, Natur, das es am Ort nie Ansiedlung von Tier und gab (Natur aus zweiter Pflanzenarten, Pflege Hand) (Mangel-)Ökosystem der Standortbedingungen, traditionellen Kulturland- Ansiedlung von Tier und schaft Pflanzenarten, Pflege Gefährdete Arten in Standortbedingungen, künstlichem Ökosystem, Ansiedlung von Tier das es an Ort nie gab und/oder Pflanzenarten, Pflege Vernetzungs- oder Tritt- Standortbedingungen, stein Ökosystem Ansiedlung von Tier und Pflanzenarten, Pflege Seite 20 Erläuterungen Natur wird, wie sie bei den heutigen Umständen wird, nicht unbedingt wie früher Ziel kaum erreichbar da Flächen zu klein, Tiere z.T. ausgestorben Beispiele Verhochstaudung, Verbuschung, Wiederbewaldung Erreichung des Ziels möglich Laubmischwald Erreichung des Ziels möglich Vegetationsarme Flachwasserseen Erreichung des Ziels möglich Pfeifengrasried, evtl. Hochstamm-Obstgarten Erreichung des Ziels möglich Gefährdete Pflanzen Erreichung des Ziels möglich Angepflanzte Hecke, ausgedolter Bach (Auen)Wald © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 2 Grundlagen der Ökologie – terrestrische Ökosysteme 2.1 Einführung 2.1.1 Was ist Ökologie • Begründer der Ökologie, Ernst Haeckel, sah vor allem die Untersuchung der Interaktion zwischen Organismen und ihrer Umwelt als Aufgabe der Ökologie. • Neuere Ansichtsweise: Untersuchen der Interaktionen zwischen Organismen und zwischen Organismen und ihrer Umwelt als Erklärungsfaktoren für deren Verbreitung und Häufigkeit. • Betrachtungsebenen und Teilgebiete der Ökologie: o Synökologie (Gemeinschaften, Ökosysteme) o Population o Ökologische Genetik o Evolutions-Ökologie o Autökologie (Individuen) 2.1.2 Was ist eine Art • Kleinste Einheit: Individuum, zusammengefasst in Arten, welche wiederum in einer taxonomischen Hierarchie zu höheren Gruppen zusammengefasst werden. • Eine Art ist eine Gruppe sich tatsächlich oder potentiell kreuzender natürlicher Populationen, wobei die Individuen in ihren wesentlichen Merkmalen untereinander übereinstimmen. 2.1.3 Verbreitung von Arten • Vorkommensgebiet von Organismen (Areal) mehr oder weniger beschränkt. Aufgabe der Ökologie ist es, Faktoren zu finden, die diesem Verbreitungsmuster zugrunde liegen. • Trend: je weiter verbreitet, desto häufiger. 2.1.4 Vielfalt der Arten • Heute bekannt ca. 1,4 Mio. Tierarten, Schätzungen wirkliche Artenzahlen: 3-30 Mio. • Im Vergleich zu Tieren sind Artenzahl an Pflanzen gering und doch spielen letztere eine dominante Rolle als strukturbestimmende Bestandteile der meisten Ökosysteme. • Vielfalt der Arten zeigt sich auch in den z.T. ganz unterschiedlichen morphologischen, physiologischen und allg. funktionellen Unterschieden zwischen den Arten • Artenzahl wichtiger Bestandteil der Biodiversität (neben Haufigkeitsverhältinissen, morphologischen, funktionellen und genetischen Variabilitäten, etc.) • Biome: Grosslebensräume, charakteristisch für Hauptklimagebiete der Erde, unterscheiden sich in Wuchsform der Pflanzen und Vegetationsdichte, ebenso in klimatisch- und bodenbedingten Landnutzungen und haben daher jeweils eine charakteristische Flora und Fauna ‡ hohe biogeografische Vielfalt auf der Erde. 2.1.5 Vielfalt der Faktoren • Die vielfältigen biotischen und abiotischen Faktoren beeinflussen direkt oder indirekt Häufigkeit und Verbreitung der Organismen (b: Konkurrenz, Symbiose, Parasitismus etc; a: Strahlung, Temperatur, Nährstoffe etc.) • Faktoren variieren in ihrer relativen Bedeutung zwischen Arten aber auch innerhalb von Arten und ändern ihre Intensität oft in räumlicher und zeitlicher Hinsicht oder beeinflussen sich gegenseitig. Seite 21 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 2.1.6 Ökologische Interaktionen • Bsp: Räuber-Beute System 2.1.7 Seltene Arten • Seltene Arten: Untersuchungen über Gründe der Seltenheit aber auch Suche nach Massnahmen zum Schutz der gefährdeten Arten. Hauptgründe für die Gefährdung von Arten: Veränderung und Zerstörung vieler Habitate und Landnutzung. • Natürliche Seltenheit: Arten mit spezifischem Lebensraum (oder Lebensraum wurde durch Klimaänderung spezifisch) und kleinen Populationen (Endemiten, Relikte). • Aussterbende Arten hat es schon immer gegeben (Massenaussterben). Von allen je existierenden Arten sind heute noch 1% erhalten. Aber: in jüngerer Zeit Anstieg der Aussterberate v.a. bei Vögeln und Säugetieren zu Beginn des letzten Jhd. Jetzt wieder sinkend. • Achtung mit den Raten: viele (tropische) Arten sind nicht berücksichtigt und Art gilt erst als ausgestorben, wenn sie 50 Jahre nicht gesichtet wurde. 2.1.8 Invasive Arten • Arten, die (bewusst oder unbewusst) durch den Menschen in neue Gebiete (Kontinente) verschleppt wurden, die sie natürlicherweise nicht erreicht hätten und in denen sie sich mehr oder weniger stark ausbreiten konnten. • Anteil und Bedeutung der invasiven Pflanzen von sehr vielen Faktoren abhängig. 2.1.9 Zukünftige Probleme • „Global Change“: die vom Menschen verursachten Umweltveränderungen und ihre Auswirkungen auf ökologische Prozesse. o Anstieg der Treibhausgase o Akkumulation von Umweltgiften o Zunehmender Ressourcenverbrauch durch wachsende Weltbevölkerung o Homogenisierung der Biota ‡ Rückgang der Biodiversität • Entwicklung mathematischer Modelle aufgrund ökologischer Untersuchungn für ein eingehenderes Verständnis von Zusammenhängen und zum Vorhersagen zukünftiger ökologischer Entwicklungen. Aber: schwierig, das nötige Wissen über das Entwickeln der Modellparameter zu finden ‡ Modelle führen zu sehr unterschiedlichen Resultaten (Klimaerwärmung). 2.2 Wasser als limitierende Ressource 2.2.1 Klima • Klima: mittlerer Zustand der Atmosphäre über einem Gebiet und der für dieses Gebiet charakteristische Ablauf der Witterung. Wichtigste Elemente: Temperatur, Luftdruck, Windrichtung und –stärke, Niederschläge, Luftfeuchtigkeit, Bewölkung und Sonnenscheindauer. • Unterscheide: Jahreszeitenklima (Tagesschwankungen gering, Jahresschwankungen gross) und Tageszeitenklima (Tagesschwankungen gross, Jahresschwankungen gering). • Wichtige Klimaelemente für belebte Natur: Verdunstung, Abkühlung etc. Seite 22 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 • Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse in Diagramm nach Walter: • Starke lokale Klimabeeinflussung durch Faktoren wie topografische Strukturen, Nähe zu einem See, Stadt etc (Mikroklima). 2.2.2 Wasser als Ressource • Wasser Umweltfaktor (Temperaturhaushalt, mechanischer Faktor, Lebensraum) und Ressource (macht den grössten Teil der lebenden Biomasse fast aller Organismen aus). • Transpiration als wichtiger Kühlungsmechanismus, kann aber auch zu Wasserdefizit im Körper führen. • Extrazonale Standorte haben durch besondere edaphische (den Erdboden betreffende) und mikroklimatische Faktoren Charakteristika, die nicht den sonstigen Gegebenheiten der Vegetationszone entsprechen. • Problem: steigender Süsswasserverbrauch durch den Menschen. 2.2.3 Wasserverfügbarkeit • Wasserverfügbarkeit für Pflanzen im Boden abhängig von der Art des Bodens (Porengrösse, Kolloidgehalt). Feldkapazität des Bodens (FC): maximale Wassermenge, die der Boden gegen die Schwerkraft halten kann; permanenter Welkpunkt (PWP): ab einem bestimmten Wasserpotential hält der boden das Restwasser so fest, dass die Pflanze es nicht mehr aufnehmen kann. Seite 23 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Wasser Voraussetzung für Photosynthese. Wenn aber Photosynthese betrieben wird, müssen Spaltöffnungen der Blätter offen sein, was wieder zu Transpiration führt. Pflanzen haben sich je nach Standort mehr oder weniger an diesen Umstand angepasst. Verschieden angepasste Pflanzen (Anpassungsmechanismen oft mit einem erhöhten Energieverbrauch verbunden): o C3-Pflanzen: „normale“ Photosynthese o CAM-Pflanzen (Crassulacean Acid Metabolism): CO2 wird nachtsüber assimiliert und tagsüber bei geschlossenen Stomata intern freigesetzt und im normalen Photosyntheseweg verarbeitet o C4-Pflanzen: CO2 Assimilation durch aktive Anreicherung von CO2 in Bündelscheidezellen. 2.2.4 Anpassungen an Trockenheit • Verschiedene Anpassungen, um übermässigen Wasserverlust zu verhindern: o Ruhepause o Laubabwerfen während der Trockenperiode o Immergrüne mit geringer Transpiration o Unterschiedliche Blattformen während Trocken- und Regenzeit • Die weisse Heideschnecke kriecht an Pflanzenstängel hoch, um Hitzetod am Boden zu entgehen. • Flechten sind poikilohydre Organismen (wechselfeucht) und tolerieren somit das Austrocknen, sind im ausgetrockneten Zustand sogar hitze- und kälteresistent. • Torfmoos wächst an feuchten bis nassen Standorten. Es wächst ständig weiter, während es weiter unten in der anaeroben Zone abstirbt. Wasser und Mineralstoffe transportiert es kapillar bis in die Triebspitzen. • Flechten, die an nassen Standorten wachsen, können auch unter behindertem Gasaustausch leiden, wenn das Gewebe wassergetränkt ist. Sie haben spezielle Rinden zum raschen Aufnehmen oder Abgeben von Wasser, Poren oder hydrophobe Durchlüftungsgewebe. 2.3 Strahlung (Photosynthese) 2.3.1 Strahlungsklima • Primäre Energiequelle für fast alle Ökosysteme der Erde ebenso wie Informationsquelle für Organismen. • Beeinflussung des Strahlenklimas: o Jahreszeitrhythmus (unterschiedliche Tages- und Nachtlängen und unterschiedlicher Sonnenstand) auf globaler Ebene o Unterschiede in horizontaler und vertikaler Hinsicht (Nebel) auf regionaler Ebene beeinflusst durch das Wetter o Strukturkomponenten der Biosphäre oder des Reliefs bedingen kleinräumige Unterschiede im Strahlungsklima • Weg der extraterrestrischen Strahlung: o Reflexion an Wolken, Boden und Wasseroberfläche (Albedo) o Absorption in der Atmosphäre, im Boden und Wasser o Absorption durch Partikel (Algenpigmente im Wasser) o Streuung in Atmosphäre und Hydrosphäre o Fluoreszenz (Umwandlung von kurzwelligem zu langwelligem Licht) • Energiefluss wird je nach Bewölkung von ca. 1.4 kWm-2 auf ca. 0.9 kWm-2 (Meeresniveau) reduziert beim Durchgang durch die Atmosphäre, ebenso wird das Sonnenspektrum modifiziert. Seite 24 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Anpassung der Photosynthese auf Spektrum von 400 bis 700 nm (sichtbar), da davon am meisten durch die Wolken dringt. Die Gesamtbilanz von Einstrahlung und Ausstrahlung ist null. Ein Teil des Lichts wird auf glattem Wasser reflektiert, je mehr, desto tiefer die Sonne sinkt (Tage unter Wasser kürzer). Die Abnahme des Lichts im Wasser mit der Tiefe folgt einem exponentiellen Verlauf. 2.3.2 Strahlung als Information • Strahlung wird von vielen Organismen als Informationsquelle (z.B. Zeitgeber) genutzt (Periodizität – Blühen, Eierlegen; Keimung – Hemmung durch Dunkelrotstrahlung) • Photochromsystem: Pigmentsystem, das je nach Lichtqualität in zwei verschiedenen Zuständen vorliegen kann dient zur Steuerung verschiedener Prozesse (Richtungswachstum, Keimung etc.) • Licht für Stoffwechsel der Tiere kein notwendiger Faktor, z.T. wichtig für die Vitaminbildung. Wichtige Rolle aber als Zeitgeber (Dunkelaktivität da höhere Luftfeuchtigkeit). 2.3.3 Strahlung als Energiequelle • Photosynthese abhängig von Lichtintensität, steigt zunächst linear, nähert sich dann aber asymptotisch der Lichtsättigung an. Beim Lichtkompensationspunkt hebt sich die CO2 Aufnahme durch die Photosynthese und die CO2 Abgabe durch Photorespiration (Aufnahme von O2 mit Hilfe des Lichtes) und Dunkelatmung gerade auf. • • An unterschiedliche Standorte adaptierte Pflanzen unterscheiden sich oft in der Lage des Lichtkompensationspunkts und in der sättigenden Lichtstärke. Bei gut angepassten Pflanzen (C4-Pflanzen) folgt der Tagesverlauf der CO2-Aufnahme der Strahlungsintensität, während andere Pflanzen (C3-Pflanzen, Schattenpflanzen) die Lichtsättigung früher erreichen. Schattenpflanzen können frühmorgens und abends mehr CO2 aufnehmen als Sonnenpflanzen, tagsüber aber sehr viel weniger. 2.3.4 Photosynthese und Wachstum • Beleuchtungsstärke als ein möglicher limitierender Faktor des Pflanzenwachstums (je stärker eine Pflanze beschattet wird, desto weniger wächst sie pro Jahr). Seite 25 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Allgemein können sich stark unterschiedliche Ressourceverfügbarkeiten in grossen intraspezifischen Unterschieden im Wachstum niederschlagen. Photosynthese unter Schnee spielt wichtige Rolle in der Tundra-Vegetation (20-30%) 2.3.5 Anpassungen ans Schwachlicht Generelle Eigenschaften Blattdicke Samengrösse Blütezeit Photosynthese Kompensationspunkt Max. Photosyntheserate Lichtsättigung Dunkelatmung Wachstum bei schwachem Licht Etiolement (schnelles in die Höhe Wachsen) Plastizität Blattform (Anpassungen an versch. Situationen) Resistenz Pilzinfektionen Reaktion auf Beschattung Keimung Blütenbildung klein gross früh tief tief tief tief nein gross stark ja ja 2.3.6 Anpassungen ans Starklicht Generelle Eigenschaften Blattdicke Samengrösse Blütezeit Photosynthese Kompensationspunkt Max. Photosyntheserate Lichtsättigung Dunkelatmung Wachstum bei schwachem Licht Etiolement (schnelles in die Höhe Wachsen) Plastizität Blattform (Anpassungen an versch. Situationen) Resistenz Pilzinfektionen Reaktion auf Beschattung Keimung Blütenbildung • • gross klein spät hoch hoch hoch hoch ja gering schwach nein nein Unterschiede zwischen Sonnenblatt (kleiner) und Schattenblatt (grösser, höhere Lichttransmission da weniger Zellschichten) An sonnigen (v.a. im Gebirge) entwickeln Pflanzen spezielle Mechanismen und Strukturen, um sich vor Übertemperaturen und Strahlungsschäden zu schützen. Seite 26 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie 2.4 ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Temperatur 2.4.1 Limitierende Faktoren • Die Vitalität von Organismen kann je nach Intensität relevanter Umweltfaktoren stark schwanken. Bei gleichzeitigem Einfluss verschiedener Faktoren ist der Faktor von dessen Intensitätsänderung die Vitalität des Organismus entscheidend abhängt der limitierende Faktor. • Oft korrelieren Verbreitungsgrenzen und Isothermen. Dies ist aber kein Beweis dafür, dass die Verbreitung durch die Temperatur limitiert wird (nur ein Hinweis). • Frost ist ein Temperaturereignis, das die Verbreitung einer Pflanze limitieren kann. 2.4.2 Thermik in Gewässern • Siehe Teil aquatische Ökologie 2.4.3 Temperaturen bei Pflanzen • Das Mikroklima einer Pflanze ist die sie direkt am Wuchsort beeinflussende Strahlung, Temperatur, etc. Dieses kann selbst noch zwischen verschiedenen Regionen des Körpers variieren. 2.4.4 Photosynthese und Temperatur • Die Photosynthese ist auch von der Temperatur abhängig. Die Abbildung zeigt eine C3Pflanze unter natürlicher CO2-Konzentration und bei optimalem Lichtgenuss: 2.4.5 Temperaturen bei Tieren • Entwicklungsrate ektothermer Tiere ist entscheidend von der Temperatur abhängig. Viele Insekten benötigen für die Entwicklung einen bestimmten Betrag an physiologischer Zeit, d.h. ein konstantes Produkt aus der Temperatur und der Zeitdauer, über die die Temperatur besteht. • Endotherme Tiere regulieren ihre Körpertemperatur durch eigenproduzierte Wärme (Sauerstoffverbrauch steigt mit sinkender Temperatur). • Ektotherme Tiere sind auf externe Wärmequellen angewiesen. Sie suchen durch Verhaltensreaktionen bevorzugt den Temperaturbereich des physiologischen Optimums auf. Einige ektotherme haben gewisse Regulationsmöglichkeiten (Flugmuskulatur). Seite 27 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Weitere Regulationsmöglichkeiten oder Anpassungen der Tiere an zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperatur: o Transpiration, Hecheln o Winterschlaf, Torpor o Zugverhalten (Vögel) o Viviparie (z.B. Reptilien) 2.4.6 Adaptation und Akklimatisation • Anpassung derselben Arten an unterschiedliche Temperaturverhältnisse können auf verschiedene Weise erfolgen (z.B. arktischer Ökotyp/Gebirksökotyp, Wüstenklon/Küstenklon). 2.5 Nährstoffe 2.5.1 Nährelemente und Nährstoffe • Die Elemente in der Biomasse stehen in einem stöchiometrischen Verhältnis zueinander. Das in Bezug zu diesem Bedarf am wenigsten verfügbare Element bestimmt die Höhe des Ertrags (Minimumsgesetz). 2.5.2 Boden-pH und Nährstoffangebot • Tonpartikel bilden zusammen mit anderen Bestandteilen (Quartz, organisches Material etc.) wichtige Strukturkomponenten des Bodens. • Weniger als 0.2% der Nährstoffpartikel sind im Bodenwasser gelöst, 98% sind in organische Verbindungen, schwerlösliche anorganisch Verbindungen oder Minerale eingebaut. 2% sind an Bodenkolloide sorbiert (z.B. Tonpartikel, Nährstoffe werden an geladenen Oberfläche austauschbar angelagert. • Der pH-Wert im Boden wirkt sich auf die Bodenstruktur, auf Verwitterung, Humifizierung und vor allem auf die Nährstoffmobilisierung im Boden aus: • Bestimmte Pflanzen gelten als Zeiger für saure Böden, andere für eher basische Böden. 2.5.3 Mykorrhiza • Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Nährstoffaufnahme besteht in einer Symbiose von Pflanzen mit Pilzen, der Mykorrhiza. Der Pilzmantel an der Wurzeloberfläche ersetzt Wurzelhaare. • Unterscheide: o Ektomykorrhiza: Bilden an der Zelloberfläche das sog. Hartigsche Netz und dringen nur in den interzellulären Raum vor Seite 28 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 o Endomykorrhiza: Pilzhyphen dringen in Wurzelzellen ein, wachsen aber auch in Interzellularen, ohne ein Hartigsches Neutz zu bilden (die meisten krautigen, viele Gehölze und auch Farne und Mosse sind VA-mykorrhiziert) VA-Mykorhiza v.a. für Phosphataufnahme von Pflanzen von Vorteil (P kann aus grösserer Entfernung aufgenommen werden) ‡ vor allem kleine Pflanzen profitieren. 2.5.4 Standorte – Nährstoffgradient • Hochmoor ist extrem nährstoffarmer Standort verbunden mit Nässe. Anschluss an mineralreiche Grundwasser durch ständiges Wachstum der Tormoose verloren. • Blockhalden, Felsköpfe etc. ressourcenarme Standorte (ausser Licht). Substrat für höhere Pflanzen muss erst noch gebildet werden. • Lägerflur: Stellen besonders mastigen Pflanzenwuchses innerhalb rasenartiger Alpenweiden. • Das Wachstum unterschiedlicher Pflanzenarten kann ja nach Standortanpassung auf steigende Nährstoffverfügbarkeit ganz unterschiedlich reagieren. • Niedriger pH entspricht niedrigem Nährstoffgehalt • Charakteristische Eigenschaften von Pflanzen nährstoffarmer Standorte: o kleine Grösse o ausdauernde, ledrige Blätter (Xeromorphie) o hohes Wurzel zu Spross Verhältnis o Symbiose mit Stickstoff fixierenden Bakterien (Fabaceae) o zusätzlicher Stickstoff von gefangenen Insekten (Drosera sp.) 2.5.5 Nährstofflimitierung bei Tieren • Tiere beziehen Stickstoff und andere Nährstoffe aus organischem Material • Stickstoffkonzentration in Pflanzen variiert stark ‡ Futterspektrum des Tieres grossen Einfluss auf Nährstoffgehalt seiner Nahrung. • Wachstumseffizienz (Biomassezunahme/Biomasseaufnahme) steigt linear mit der zunehmenden N-Konzentration im Gewebe der Nahrungspflanzen. 2.5.6 Zersetzung und Abbau • Der Nährstoffgehalt und die strukturelle Zusammensetzung von totem organischem Material bestimmt die Zersetzungsrate desselben. 2.6 Störungen 2.6.1 Grundlegendes zu Störungen • Störungen sind sehr wichtige Standortsfaktoren der meisten Ökosysteme • Eine Anzahl Organismen aufgetragen gegen die Störungsintensität führt zu einer Optimumskurve, da Störungen zu einem (kurzfristigen) Anstieg von Ressourcen führen. 2.6.2 Mechanische Störungen • Mechanische Störungen können sowohl natürliche als auch anthropogene Ursachen haben • Beispiele mechanischer Störungen ihre Folgen: o Lavinen: können Aufkommen von Gehölzen verhindern, verzögern Vegetationsentwicklung im Ausflussbereich durch lange Schneebedeckung o Grosse Schneelasten: können Anpassung in der Wuchsform erzwingen bzw. fördern niederliegende und kriechende Gehölzpflanzen o Frosteinwirkung: durch Frost (im Tages- oder jahreszeitlichen Rhythmus kann der Oberboden mehrere cm angehoben werden und die Wurzeln brechen. Seite 29 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 o Starkwindereignisse: können ganze Wälder vernichten, ändert Struktur und Zusammensetzung des Waldökosystems sehr stark, teilweise sogar auf Dauer. Wind als mechanischer Faktor auch wichtig für Fernausbreitung vieler Organismen. 2.6.3 Feuer • Feuer gehört zu den wichtigsten und grossflächigsten natürlichen oder anthropogenen Störungsereignissen. • Viele Arten haben spezielle Anpassungen ans Feuer entwickelt o Resistenz o Regenerationsfähigkeit o spezielle unterirdische Speicherorgane o Freisetzung von Samen nach dem Durchgang eines Feuers • Einflüsse von Feuer auf das Ökosystem sind: o Freisetzung von Nährstoffen aus verbrannter oberirdischer Biomasse o Erleichterung der Keimlingsetablierung durch Vernichtung der Streuauflage o Brechung der Dormanz (Zeitraum mit stark reduzierter Aktivität) o Vernichtung von allelopathischen (wachstumshemmenden) Substanzen an der Bodenoberfläche • Kontrollierte Lauffeuer zum Hemmen des Wachstums invasiver feuersensitiver Pflanzen und zur Verhinderung von Streuakkumulation (spätere zerstörerische Wildfeuer verhindern). • Problematisch: Brandrodung von Tropenwäldern (Zerstörung von artenreichem Ökosystem und Anstieg des CO2-gehalts der Atmosphäre). 2.6.4 Habitatfragmentation • Zerschneiden und Zurückdrängen von ursprünglich grösseren, zusammenhängenden Habitaten in kleinere, meist isolierte und entfernte Habitatinseln durch zunehmende urbane bzw. agrarische Flächennutzung. • Verringert Populationsgrösse und genetische Variabilität von betroffenen Arten, so dass sie lokal vom Aussterben bedroht sein können. 2.7 Intraspezifische Konkurrenz-Populationen 2.7.1 Grundlegendes zur Konkurrenz • Konkurrenz ist die Wechselbeziehung zwischen Individuen bzw. Arten durch gemeinsamen Anspruch auf begrenzte Ressourcen. • Intraspezifische Konkurrenz (innerhalb einer Art) besonders stark wegen nahezu identischen Standortansprüchen. • Konkurrenzphänomene gehören zu den wichtigsten Faktoren, die das Populationswachstum beeinflussen bzw. limitieren. 2.7.2 Dichte der Population • Unter verschärften Konkurrenzbedingungen einer hohen Populationsdichte reguliert frühzeitige Mortalität die Populationsdichte nach unten. • Gesetz des konstanten Endertrags: Verhältnis Halm-Rest der Pflanze ist schlussendlich immer etwa gleich, egal wie gross die Populationsdichte war Seite 30 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Die intraspezifische Konkurrenz um Nahrung der Fruchtfliege hat unterschiedliche Auswirkungen auf larvale Mortalität und Gewicht der adulten Weibchen. 2.7.3 Grösse der Individuen • Intraspezifische Konkurrenz kann auch die Grösse von Individuen gleichen Alters stark beeinflussen. Beispiel Linum usitatissimum: Aussaht in drei verschiedenen Dichten und Ernte zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Die durchschnittlich erreichte Biomasse pro Pflanze nimmt mit zunehmender Biomasse ab. In der dichten Population entsteht eine Grössenhierarchie mit sehr wenigen grossen Pflanzen und einer mit geringen werdender Grösse stetig zunehmenden Zahl von Pflanzen. • Der Zusammenhang zwischen Pflanzengrösse (w) und Populationsdichte (d) wird bei Erreichen der Kapazitätsgrenze des Populationswachstums durch das –3/2 Potenzgesetz oft gut beschrieben: log w = log c – 3/2 log d Seite 31 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie 2.8 ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Populationen 2.8.1 Grundlegendes zu Populationen • Eine Population ist eine Gruppe von Individuen einer Art, die im selben Raum und zur gleichen Zeit vorkommt. • Die Populationsökologie beschäftigt sich mit dem Studium der Grösse (und Verbreitung) von Populationen und der Prozesse (vor allem der biologischen), die diese Parameter bestimmen. • Die vier fundamentalen Prozesse, die der Populationsentwicklung zugrunde liegen, sind Geburt, Tod, Einwanderung und Auswanderung. Populationsökologie untersucht die biotischen und abiotischen Faktoren, die diese Prozesse beeinflussen. • Grundlegende Gleichung der Populationsentwicklung: Nt = Nt-1 + G – T + E – A • Ein- und Auswanderung als wichtige populationsdynamische Prozesse. Z.B. Auswanderung bei hoher Populationsdichte, z.T. mit Ausbildung von Wanderformen (Heuschrecken) oder durch den Import von Samen aus vitalen Populationen (Felsenbeere). • Unterscheide: o unitare Organismen: Entwicklung und Form weitgehend festgelegt, Anzahl Individuen klar festgelegt und kann prinzipiell leicht erfasst werden. o modulare Organismen: aus Modulen zusammengesetzt (Kolonien), weder Entwicklung noch Form festgelegt. • Die meisten Pflanzen zeigen modulares oder klonales Wachstum. Aufbau: o Genet (Klon): alles, das aus einer einzelnen Zygote entstanden ist (eine einzelne Pflanze) ‡ Population der Klone o Ramet: Modul des Klons, kann als eigenes Individuum angesehen werden (z.B. eigene Blüte) ‡ Klon als Population von Rameten o Blatt als Modul des Rameten. ‡ Blattpopulation einer Pflanze 2.8.2 Lebenszyklen • Der Lebenszyklus ist die Abfolge morphologischer Stadien und physiologischer Prozesse, welche eine Generation mit der nächsten verbindet und umfasst Wachstum, Differenzierung, Speicherung, Reproduktion und Überleben. • Es gibt verschieden komplizierte Lebenszyklen: o praktisch nur vegetative Vermehrung o Vermehrung überlappende Generationen o Abwandlungen: Überdauernde Samen, sexuelle Reproduktion nur in manchen Jahren oder jährlich, zusätzlich vegetative Vermehrung, überlappende Generationen etc. Seite 32 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 2.8.3 Lebenstafeln • Enthalten Überganswahrscheinlichkeiten zwischen verschiedenen Altersstufen, Mortaltiätsmuster und Fekunditäten. • • Lebenstafeln, Überlebenskurven und Fekunditätsmuster als Voraussetzungen zum Verständnis der Populationsentwicklung. Zwei Analyseverfahren: o Untersuchung der Kohorte (Gruppe von gleichalten Individuen) – besser o Betrachtung der gesamten Population in einem best. Zeitsegment 2.8.4 Überleben und Mortalität • Verschiedene Typen von Überlebenskurfen: o Typ I (konvex): Mortalität nimmt erst im Alter stark zu o Typ II (linear): Mortalitätsrate relativ konstant o Typ III (konkav): hohe Mortalitätsrate bei jungen Organismen (typisch) Seite 33 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 2.8.5 Räumliche Prozesse • Populationsausbreitung im Raum kann nach verschiedenen Mustern ablaufen: o diffusive Ausbreitung ‡ homogene Auffüllung des zur Verfügung stehenden Raumes o Front-Ausbreitung ‡ zentrifugale Auffüllung des Raums (räumlicher Altersgradient) • Metapopulation: totale Population eines Gebiets, durch das Standorts-Mosaik in mehrere Subpopulationen unterteilt, jede Subpopulation hat eigene Dynamik (Migration, Aussterben, neu Entstehen (Kolonisation), ...). • Stabilität der Metapopulation: Verhältnis von Kolonisationsrate und Aussterbetrate der Subpopulationen. 2.9 Interspezifische Konkurrenz 2.9.1 Typen interspezifischer Konkurrenz • Interspezifische Konkurrenz: Konkurrenz zwischen zwei Arten • Verschiedene Typen: o Direkte Interaktion o Indirekte Interaktion (Ausnutzung einer gemeinsamen Ressource) • Indirekte Effekte offensichtlicher Konkurrenz: o Gemeinsamer Fressfeind: Wachstum einer Populatin begünstigt Feind und erhöht Räuberdruck auf andere Population. o Spezifischer Mutualist: Begünstigt den einen Konkurrenten 2.9.2 Konkurrenz bei Pflanzen • Nachweis und Analyse der Stärke interspezifischer Konkurrenz durch sog. Ersetzungskriterien (Konkurrenzexperimente mit zwei Arten in Mischkultur) • Viele Arten haben eine breite ökologische Amplitude. Bei Monokulturen bilden sie eine Sogenannte Optimumskurve. • Bei interspezifischer Konkurrent in Mischkultur können die starken Arten die anderen im Optimalbereich jedoch stark unterdrücken und an den Rand drängen. Seite 34 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 2.9.3 Konkurrenz bei Tieren • Um nachzuweisen, ob zwei Tierarten mit überlappendem Nahrungsspektrum sich konkurrenzieren, entfernt man die Arten selektiv und misst die Nahrungsdichte. 2.9.4 Komplexere Interaktion • Konkurrenzeffekte können durch Interaktion mit anderen Faktoren (z.B. Frass, Krankheitserreger) verändert werden. 2.9.5 Konkurrenz vs Koexistenz • Zwei konkurrierende Arten, die von zwei verschiedenen essentiellen Ressourcen limitiert werden, können je nach Verhältnis der einen zur anderen Ressource einander verdrängen oder in Koexistenz zueinander leben: 2.10 Positive Interaktionen • Interaktionen zwischen Individuen oder Populationen, die das Wachstum, die Entwicklung bzw. die Fitness auf der Ebene von Individuen oder Populationen steigern. • Können intra- und interspezifisch sein: o Intraspezifisch: Schutzstelle für sich etablierende Jungpflanzen unter der Mutterpflanze oder anderen Arten • Kommensalismus: Profitieren von einer Art, ohne dass diese beeinflusst wird. 2.10.1 Mutualismus • Mutualismen mit den dramatischsten ökologischen Auswirkungen sind diejenigen der menschlichen Landwirtschaft (Nahrung vs. Pflege und Verbreitung). • Wichtigster und vielfältigster Mutualismus: zwischen Bestäubern und Blütenpflanzen. 2.10.2 Symbiose • Enges Zusammenleben zwischen Individuen verschiedener Arten, die für beide Partner nützlich, in der Regel sogar lebensnotwendig ist. • Hochdiverse Gesellschaften mikrobieller Symbionten in Verdauungssytemen von Tieren 2.10.3 Mutualismus vs Parasitismus • Parasiten leben in enger Assoziation mit einem oder wenigen Organismen einer anderen Art, von denen sie Ressourcen beziehen. Die Wirtsorganismen werden dabei geschädigt, aber nicht direkt getötet. • Mutualisten spielen für die Struktur und Funktion der Ökosysteme die weit grössere Rolle (Mykorrhiza, Bestäubung), obwohl es mehr Parasiten gibt. • Oft Unterschied zwischen Mutualist und Parasit nur schwer zu erkennen. Wechselt oft im Verlauf der Entwicklung eines Organismus (zuerst Parasit, dann Mutualist). Seite 35 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Hemiparasiten beziehen einen Teil ihrer Ressourcen vom Wirt (Wasser und Nährstoffe), erzeugen aber auch einen Teil selber (Photosynthese). Flechtensymbiose wirklich Symbiose? These: Pilz parasitiert Alge oder Alge profitiert zumindest nicht vom Pilz. Algen wurden auch schon frei lebend gefunden. Parasiten spezialisieren sich zunehmend, um sich an entwickelnde Abwehrmechanismen von Pflanzen anzupassen ‡ Parasitismus fördert evolutive Entwicklung Seite 36 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Vergleich zwischen Mutualisten und Parasiten: Mutualisten Relativ wenige Arten, da meist wenig auf bestimmte Arten spezialisiert Mutualisten brauchen keine besondere Ausbreitungsstrategie (pflanzen sich teilweise gemeinsam fort) Sexuelle Vorgänge sind in Mutualisten oft vollständig unterdrückt (einfacher Lebenszyklus) Parasiten Sehr viele, oft wirtsspezifische Arten Das Überleben von Parasiten ist abhängig von effizienter Ausbreitung (Übertragung auf und Infektion von neuen Wirten) Für Parasiten ist sexuelle Reproduktion sehr wichtig, um die genetische Variabilität aufrecht zu erhalten im ‚ökologischen Wettrüsten’ mit ihren Wirten 2.11 Koexistenz und Nische 2.11.1 Fundamentale Nische • Die ökologische Nische ist ein n-dimensionaler Faktorenraum (n = Anzahl relevanter Umweltfaktoren) innerhalb dessen ein Organismus leben und sich vermehren kann. 2.11.2 Realisierte Nische • Fundamentale Nische oft viel grösser als aktuelle Verbreitung der Arten ‡ in Anwesenheit von Konkurrenten sind Arten auf realisierte Nische beschränkt (abhängig von anwesenden konkurrierenden Arten). • Je nach Nutzung bzw. Vorhandensein von Ressourcen ergibt sich unterschiedlich hohe Artendiversität. 2.11.3 Charakterverschiebung • Charakterverschiebung: physischer Unterschied zwischen zwei verwandten Arten entstanden durch natürliche Selektion infolge Konkurrenz. • Oft können konkurrierende Arten durch Nischendifferenzierung koexistieren. • Charakterverschiebungen können auch über Konkurrenzsituationen hinaus bestehen bleiben 2.11.4 Räumliche Differenzierung • Besetzung unterschiedlicher physikalischer Räume • Auch diese Differenzierung kann nach entfallen der Konkurrenzsituation als evolutiver Fortschritt bestehen bleiben. 2.11.5 Zeitliche Differenzierung • Zeitliche Nischenverschiebung (früher im Jahr, später im Jahr) • Z.B. Verschiebung der Hauptblütezeit von Pflanzen infolge Konkurrenzdruck um den Bestäuber. 2.12 Strategie 2.12.1 Was ist eine Strategie • Bestimmtes Aktivitätsmuster ausgesucht aus einer Reihe von Alternativen (Investition in zusätzliche Samenanlagen oder in zusätzliche Pollen). • Auszahlung der Strategie messbar an der Fitness der Population • Strategie als komplexe Anpassung an Umweltbedingungen Seite 37 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Unterschiede bei Strategien bei Pflanzen werden auch als unterschiedliche ‚funktionelle Pflanzentypen’ bezeichnet. Unterscheidung unterschiedlicher Strategien bzw. funktioneller Typen hängt vom geographischen bzw. taxonomischen Massstab ab ‡ generell gültige Strategiekonzepte sind infolge der Vielfalt an Habitaten und Arten grob und ungenau. Evolutionär Stabile Strategie (ESS): in Populationen, in denen ESS vorherrscht, können sich keine Mutationen und andere Genotypen entwickeln und durchsetzen (Evolution bestimmt die Strategie: sind Ausbreitungsarten evolutionär stabiler, heisst die ESS Ausbreitung) 2.12.2 Funktionelle Pflanzentypen • Einteilung der Pflanzen nach Lebensformen bzw. Lebenszyklusstrategien (entsprechen sich in etwa) ‡ Einteilung nach Lage der überdauernden Organe in fünf Gruppen • Verschiedene Strategien, gewonnene Ressourcen in Wachstum oder Reproduktion zu stecken: kurzes Wachstum, viel Energie für Reproduktion dafür grosse Mortalität nach Reproduktion oder längeres Wachstum und mässige Energie für Reproduktion dafür mehrfache Reproduktion, ebenso Mitteldinger • Wichtige Eigenschaften im Lebenszyklus einer Art (in der Lebensgeschichte eines Individuums): o Wachstums- und Entwicklungsrate: schnell vs. langsam (Dauerstadien?) o Grösse des Organismus: gross vs. klein o Speicherung: niedrig vs. hoch o Ausbreitung: Fern- vs. Nahausbreitung, passive vs. aktive Ausbreitung o Aufwendung für Reproduktion: niedrig vs. hoch, grosse Anzahl Nachkommen vs. kleine Anzahl Nachkommen, frühe Reproduktionsphase vs. späte Reproduktionsphase 2.12.3 Trade Offs • Investition in eine bestimmte Funktion geht auf Kosten einer anderen Funktion, weil die von beiden Funktionen benötigten Ressourcen limitiert sind (Flug vs. Fekundität) ‡ Kompromiss • Optimierung der Fitness des Individuums bzw. der Art: bestmöglicher Kompromiss der Ressourcenallokation für alle bestehenden Trade-Offs finden. 2.12.4 Strategien und Habitate • Erkenntnisse der beobachteten Unterschiede im Lebenszyklus zwischen Organismen: r/K Konzept: o r-selektierte Organismen reproduzieren sich rasch, Population bricht aber vor erreichen der Kapazitätsgrenze zusammen o K-selektierte Organismen sind fähig, Populationen an ihrer Kapazitätsgrenze aufzubauen und dort zu halten • r- oder K-Selektion kann auch innerhalb einer Art geschehen (in Abhängigkeit vom Habitat): o instabiles, gestörtes Habitat: eher r-Strategie o stabiles, ungestörtes Habitat: eher K-Strategie • Es gibt auch Organismen mit intermediären Stellungen • Erweiterung des r/K Konzepts: das CSR-Konzept mit drei Habitat Dimensionen: o Konkurrenzintensität o Stress (abiotisch bedingte Ressourcenlimitation) o Störungen (physikalische Schädigung der Vegetation) • Entsprechende Lebenszyklusstrategien zum CSR-Konzept: Seite 38 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 o Competitive Strategie o Stress-tolerante Strategie o Ruderale Strategie Seite 39 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 3 Grundlagen der Ökologie – aquatische Ökosysteme 3.1 Einführung 3.1.1 Wasser als Lebensraum • Besonderes am Wasser als Lebensraum: Stockwerkartige Lebensräume, riesige Dimensionen (3D) • grosse Vielfalt primärer und sekundärer Wasserorganismen • Ozeane sind sehr stabile, gepufferte Systeme (Oxystaten und Carboxystaten) ‡ sind für das Klima von grosser Bedeutung. • Produktion der Meere limitiert: zwar grosse Primärproduktion, lange Nahrungsketten, aber für Mensch vergleichsweise wenig Nahrung (aber dies ohne Investitionen) • Wasser ist in erster Linie Lebensraum für Plankton, Nekton (Fische, etc.) und Benthos. • Trotz stabiler chemischer und physikalischer Verhältnisse riesige Zahl von Meeresbewohner (nicht wenige dominante Arten) • Lebensraum im Wasser immer offen, nicht Nischenbesetzung durch den Erstdagewesenen. 3.1.2 Stehende Gewässer • Süswasser nur gerade 6% der Wasserreserven (2/3 Grundwasser, 1/3 Eiskappen, Seen weniger als 0.01%) • Alter von Seen sehr limitiert, in alten Seen aber doch viele endemische Arten. • Inseltheorie: Seen als isolierte Biotope • Plankton der Seen gleicht sich auf der ganzen Welt, Ausbreitung von Sporen/Dauerstadien durch Vögel von grosser Bedeutung 3.1.3 Fliessgewässer • Fliessgewässer als Blutgefässsystem der Landschaft (Verteilung von Nahrung, Wegtransport von Abfall, etc.) • Flusslandschaft: Einheit von Fluss, Interstitial (Verbindung zum Grundwasser) und terrestrisches Umfeld • gesundes Fliessgewässer braucht viel Platz, mehr als man ihm heute zugesteht • Auengewässer besonders reich an ökologischen Nischen • Grundwasser konstant in chemischen wie physikalischen Faktoren, tiefe Temperatur und Sauerstoffgehalt • Wasser durch langen Aufenthalt in Grundwasser gefiltert und gepuffert ‡ steht im GG zu den festen Stoffen im Untergrund • Energie im Grundwasser durch Infiltration von der Oberfläche bzw. Chemosynthese (z.B. mit CH4 und O2) 3.1.4 Funktionen des Wassers • Grosse Siedlungen an Flussläufen ‡ Trinkwasserversorgung, Transportwege, Nahrung, etc. • beliebt waren Siedlungsstandorte mit natürlichen Regulierungen (z.B. Ausfluss aus See) 3.1.5 Ausdehnung der Ozeane • Ozean: offene Wasserfläche, Pelagial und ufernahe Schelfgebiete • Euphotische (von Pflanzen bewachsene) Zone mehr als 200m tief, tiefer zu wenig Licht für ausgeglichene Bilanz von Produktion und Respiration. • in Seen euphotische Zone oft auf wenige Meter beschränkt (ausser in ultraoligotrophen Seen ‡ bis 100m), da Licht durch organische Wasserinhaltsstoffe stark abgeschwächt wird Seite 40 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Zonierung des marinen Lebensraumes: o Benthal: Boden, besteht aus Litoral bzw. Phytal (Flachmeer), Bathyal (Kontinentalabhänge), Abyssal (Tiefseeboden) und Hadal (Tiefseegräben). Bewohner: Benthos o Pleustal: Meeresoberfläche. Bewohner: Neuston. o Pelagial: offener Ozean, besteht aus Epiplegial (bis ca. 200m Tiefe), Mesoplegial (bis ca. 1000m Tiefe) und Bathypelagial (Tiefsee). Bewohner: Plankton oder Nekton. (Epipelagial enthält Eplimnion, Metalimnion und Hypolimnion des Meeres) Zonierung von Seen (beruht auf Schichtung): o Epilimnion: warme Oberflächenschicht o Metalimnion: Sprungschicht o Hypolimnion: kalte Tiefenwasserschicht Küste ist eine mehr oder weniger lineare Übergangszone (Oekoton), geprägt durch mechanische Wirkung des Wellenschlages und osmotische Wechselwirkungen. Zonierungen des Litorals aufgrund des Salzgehaltes: o Sublitoral, schwarze Zone, Wellenschlag o Eulitoral, graue Zone, Spritzwasser o Supralitoral, weisse Zone, Sprühwasser 3.1.6 Eigenschaften des Wassers • Wasser ist für Plankton eine viskose (zähflüssige) Flüssigkeit, es wird durch Reibung gebremst • Wasser hat grosse Wärmekapazität ‡ langsame Abkühlung ‡ transportieren von riesigen Energiemengen (Golfstrom), noch grösser Verdampfungs- und Schmelzenergie. • Dichteanomalie des Süsswassers (bei Salzwasser niedrigste Dichte unter Nullpunkt) • im Wasser bilden sich Grenzschichten aus 3.1.7 Löslichkeit von Gasen im Wasser • atmosphärische Gase sind im Wasser abhängig von ihrem Partialdruck in der Atmosphäre verschieden stark gelöst • im Tiefenwasser können Gase aus dem Erdinnern sehr hohe Konzentrationen erreichen (je nach Druckverhältnisse) 3.1.8 • • • • • • • Wichtige Wasserinhaltsstoffe Konzentration abhängig von der Löslichkeit des Stoffes Zusammensetzung des Wassers ist ein Spiegelbild der Einzugsgebiete Unterscheide: Durchfluss-Systeme mit beschränkte Aufenthaltszeit und kein DurchflussSysteme (Anreicherung der Stoffe: Salz im Meer) Gelöste Gase kommen aus Luft, geologischen Quellen oder sind biotischer Herkunft (O2) Stoffe im Wasser befinden sich in einem Kreislauf, der aber nicht total geschlossen ist (Sedimentation, Verdampfung) – Stoffe kreisen durch die Stufen der Nahrungspyramide Löslichkeit vieler Stoffe stark vom pH abhängig. Konzentrationsänderung in die Tiefe stark von Schichtung abhängig (v.a. bei Seen), Partikel können jedoch Dichteschichtung des Metalimnions durchbrechen. 3.1.9 Osmotische Regulation • Drei Arten von Wasserbewohnern: o Süsswasserarten, ertragen kaum 0.3% Salz o Meeresbewohner, angepasst auf 3.4% Salz o euryhaline Organismen mit Toleranzbereichen von 0.5-11% (Brackwasserformen) • Brackwasserformen brauchen schnelle osmotische Regulation. Seite 41 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 3.1.10 Quellen • Quellen als Lebensraum zu wenig geschützt, werden oft schon einige Meter unter Oberfläche gefasst • Quellbewohner sind an Chemie der Quelle adaptiert (Ausgasen von CO2, Verkalkung) 3.1.11 Interstitial-/Grundwasser- und Höhlenbewohner • Grundwasserbewohner sind auf Leben in Porenräumen angepasst, meist farblos und blind, wurmförmige Gestalt für optimale Fortbewegung • Nahrungsbasis äusserst dünn ‡ nur wenige Organismen pro Kubikmeter, oft Krebstiere oder Würmer • in eigentlichen Höhlensystemen auch grössere Organismen • Höhlenbewohner sehr selten und oft bedroht • können nicht abwandern ‡ Veränderungen der Nährstoff- oder Sauerstoffsituation schwerwiegend 3.1.12 Fliessgewässer • stetiges Ändern des Lebensraumes • grosse Ströme im Vergleich zu Bächen im Unterlauf relativ stabile chemische und physikalische Bedingungen • Tieflandströme oft genug gepuffert, um grössere Katastrophen abzufangen, in kleinen Bächen Wiederbesiedelung aus benachbarten ähnlichen Systemen leicht möglich • In Tieflandströme heute Organismen durch anthropogene Einflüsse besonders stark gefährdet, da sie nicht so leicht wieder einwandern können (wenig ähnliche System in Reichweite) • innerhalb eines Flussquerschnittes gibt es je nach Substrat (Schlamm, Sand/Feinkies, Grobkies, Ton) verschiedene Organismen • Charakterisierung von Flussabschnitten durch typische Leitfische 3.2 Strahlung und Thermik 3.2.1 Einstrahlung • siehe Teil „Strahlung“ im Kapitel terrestrische Ökosysteme 3.2.2 Reflexion an der Wasseroberfläche • Anteil vom Wasser reflektiertes Licht nimmt mit abnehmenden Einfallswinkel der Sonne zu ‡ Tag unter Wasser ist kürzer als in der Atmosphäre • Reflexion bei Wind stärker als bei ruhigem Wasser (Einfallswinkel ändert sich im Wellental) 3.2.3 Absorption in der Wassersäule • Licht nimmt mit zunehmender Tiefe exponentiell ab (sofern Wassersäule homogen), sowohl Wasser als auch Partikel absorbieren das Licht, in 5m Tiefe fast dunkel • Absorption ändert sich im Laufe des Jahres je nach Menge und Art der Inhaltsstoffe • Durch den exponentiellen Verlauf der Lichtstärke (Absorptionsgleichung: Iz = I0 e-ez) lassen sich verschiedene Typische Messgrössen ableiten: o Halbwertstiefe o Kompensationstiefe (Bilanz Photosynthese Atmung ausgeglichen) ‡ etwa bei 1% der Lichtstärke an der Oberfläche • je nach Inhaltsstoffen ändert sich der Auslöschungskoeffizient e. • auch Streuung läuft Exponentiell, ist aber weniger wichtig als Absorption Seite 42 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • 3.2.4 • • • • • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Absorption und Streuung ergeben zusammen Lichtattenuation (Lichtabschwächung) Spektrale Transparenz blau-grünes Licht ist gut durchgängig ‡ taucht am tiefsten ab eutrophe Seen haben viele Partikel ‡ erscheinen ockerfarbig bis grün dystrophe (fehlernährte, pH tief) Gewässer haben weniger Partikel aber viele humöse Stoffe gelöst‡ erscheinen braun oligotrophe oder ultraoligotrophe Seen erscheinen blau rotes Licht nimmt im sauberen Wasser schneller ab als grün-blaues ‡ tiefere Zonen erscheinen blaugrün blaues Licht nimmt schnell ab in Seen mit hoher Biomasse (Absorptionsmaxima des Chlorophylls im roten und blauen Bereich) ‡ am tiefsten eindringendes Licht in eutrophen Seen ist grün Lichtstärke jeder Wellenlänge nimmt (in homogener Wassersäule) exponentiell mit konstantem Extinktionskoeffizienten ab 3.2.5 Schichtungsverhalten eines Sees • Dichtemaximum des Wassers durch Salzgehalt und hydrostatischen Druck verändert (in 100m Tiefe ca. 3.9° C, in 250m ca. 3.4° C) ‡ es sammelt sich selten so kaltes Wasser an, da 3.4° C kaltes Wasser an der Oberfläche auf dem 4° C kalten Wasser schwimmt, taucht es nicht von selbst in die Tiefe • Dichteunterschiede im Bereich von 1-7° C aber gering ‡ Zerstörung von thermischen Schichtungen durch wenig kinetische Energie zu erreichen • Thermik stehender Gewässer in erster Linie durch Einstrahlung und Verdunstung bestimmt ‡ aufgrund der Absorption des Lichts müsste Temperaturverlauf exponentiell sein. Aber: • Wärme bleibt nicht dort, wo sie absorbiert wurde ‡ wird von turbulenter Diffusion verfrachtet • Oberfläche: Verlust von Energie durch Verdunstung, Einstrahlung wärmt nur am Tag ‡ Oberflächenzirkulation • Zirkulation greift im Herbst immer tiefer, umfasst mit der Zeit den ganzen Wasserkörper • Wasserkapazität des Wassers sehr hoch (cp (15° C) = 4.819 kJ kg-1) Wärme wird sehr langsam abgegeben • Flache Seen mit guter Windexposition in unseren Breiten: dimiktisches Klima (zirkulieren zweimal) • Tiefe oder windgeschützte Seen: monomiktisch oder oligomiktisch (zirkulieren nur einmal im Februar/März oder noch weniger) • Seen die nie bis zum Grund mischen ‡ Tiefenschicht mit anderer chem. Zusammensetzung (Monimolimnion) 3.2.6 Thermische Schichtung im Meer • gemässigte Ozeane: an der Oberfläche analog zum See saisonal geschichtet (bis ca. 200m Tiefe), permanente thermische Schichtung in rund 500m Tiefe • in polaren oder tropischen Zonen fehlt die eine oder andere Schichtung • Dichte des Wassers abhängig von Temperatur und Salinität ‡ Schichtet sich Süsswasser über Salzwasser, ergibt sich stabile thermohaline Schitung, auch wenn kaltes Süsswasser auf wärmerem Meerwasser • Tauchtiefe (Einschichtung) des von Flüssen einfliessendes Wasser hängt auch von den Inhaltsstoffen des einfliessenden Wassers ab ‡ wenn diese sedimentieren, schichtet sich Wasser neu ein Seite 43 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 3.2.7 Thermik eines Fliessgewässers • grundwassergespiesene Fliessgewässer oder Gletscherbäche ‡ sehr geringe Temperaturschwankungen an Quelle • im Laufe der Fliessstrecke wird Wasser abgekühlt oder aufgewärmt ‡ friert im Winter nie total durch • Verschiebung der Kalt- und Warmphase in Jahresverlauf gegenüber der Strahlung um ein bis zwei Monate 3.3 Nährstoffe als limitierende Ressource 3.3.1 Stoff- und Energietransfer • Energie durchfliesst Ökosysteme in Einbahnstrasse ‡ Wertigkeit der Energie nimmt ab • Energie wird weder produziert noch vernichtet ‡ langfristig kann eine Stufe der Nahrungspyramide nicht grösser sein als Vorhergehende • durch Umwandlung von hochwertigen Energie in Wärme wird Entropie frei (Zunahme von Entropie in geschlossenen Systemen) • zur Aufrechterhaltung eines geordneten Zustandes (Strukturen von intakten Zellen) muss Arbeit geleistet werden ‡ Ökosysteme halten ihre innere Ordnung aufrecht durch Export von Entropie (offene, von Energie durchflossene Systeme wirken als Entropie-Pumpen) • Recycling von Energie nicht möglich • Photosynthese (z.T. Chemosynthese) liefert Energie für die Biosynthese 3.3.2 • • • • Minimum-Gesetz nach Leibig (Minimumsgesetz der Ökologie) Zu jedem Zeitpunkt begrenz immer ein Element das Wachstum Ertrag lässt sich nur steigern, wenn fehlendes Element erhöht wird im Jahresverlauf ändert Dominanz einzelner Ökofaktoren in Seeoberflächenzone ‡ Winter Temperatur/Strahlung, Sommer knappe Nährstoffe stehende Gewässer sind Systeme mit knappen Ressourcen (v.a. Ozeane) 3.3.3 Stabile Zusammensetzung Biomasse – Speicherung von limitierenden Stoffen • mit der Zeit hat sich eine stabile Zusammensetzung der Biomasse bezüglich der limitierenden Nährstoffe ergeben: C:N:P = 106:16:1 in Plankton, C:N in Pflanzen oft 40:1 (wenn weder N noch P limitierend) • wird ein Stoff, der traditionellerweise knapp ist, gedüngt, findet Vorratshaltung statt • Vorratshaltung ermöglicht Überleben an Extremstandorten (Wasserspeicherung an trockenen, heissen Standorten) 3.3.4 Essentielle Nährstoffe • essentielle Nährstoffe sind nicht substituierbar • substituierbar sind nur solche Stoffe, die dasselbe Element enthalten ‡ verschiedene Nahrungsquellen möglich, wenn sie in der Summe die essentiellen Nährstoffe enthalten • Essentielle Nährstoffe sind C, O, H, N, S, P und in Spuren Cu, Co, Mo, Zn, B, Mn • Pflanzen nehmen Nährstoffe einzeln auf, Tiere meist als Paket mit der Nahrung 3.3.5 • • • • Stöchiometrie des Wassers Chemie des Wassers sehr abhängig von Art des Wasservorkommens See ohne Abfluss hat höheren Salzgehalt als Durchfluss-See, noch mehr haben Salzseen Häufigkeitskurven von Ca+ und Cl- erstrecken sich über grössere Konzentrationsbereiche als z.B. Kohlenstoffkomponenten, welche im GG mit Atmosphäre und Kalk stehen Spurenelemente in vielen Gewässern kaum nachweisbar Seite 44 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 im Wasser sind Elemente hoch verdünnt gelöst ‡ Einführung der Aktivitätskoeffizienten notwendig, ebenso Kinetik von Lösungsreaktionen Konzentration im Wasser abhängig von: Gas-Atmosphäre via Henry-Gesetz, fester Lithosphäre via Löslichkeitsgleichgewicht 3.3.6 Eignung des Wassers als Nährlösung • natürliches Wasser schlechte Nährlösung für Algen ‡ natürliche Seen und Ozeane arm an Biomasse • je grösser Eutrophierung durch Landwirtschaft oder Abwasser umso höher die Produktion • Michaelis Menten Kinetik: die Aufnahmerate eines Nährstoffes als Funktion seiner Konzentration im Wasser und dem Bedarf der Organismen an diesem Stoff ‡ Wachstum ist nicht unendlich, bei erreichtem Maximum nützt auch weitere Nährstoffzufuhr nichts 3.3.7 Abhängigkeit von Wachstums-/Konsumrate vom Angebot • bei Überangebot kommt es zu einer Sättigung, da dann andere Prozesse Wachstumsgeschwindigkeit bestimmen (z.B. Verarbeitungsrate) • wenn Jagd nach Beutetieren energieaufwändig ist (z.B. bei kleinen Beutetieren), braucht es eine Schwellenkonzentration für eine lohnenswerte Jagd • Algen-Population zeigt erst Wachstum, wenn nötige Zellquote erreicht ist (Wachstumsrate einer Zelle erhöht sich mit steigender Zellquote) ‡ Wachstum kann noch weitergehen, wenn ausserhalb der Zelle Substrat längst aufgebraucht, stationärer Zustand, wenn zellinterne Konzentration (Zellquote) wieder beim kritischen Wert angelangt ist. 3.3.8 Dosis-Response-Beziehung • Auftreten von Salzen oder Schwermetallen in toxischer Konzentration ‡ Limitierung des Wachstums bei zunehmender Konzentration • Toxizität bei Schwermetallen kann schon im ppm- oder ppb-Bereich erreicht sein, je nach Stoff und Speziation (komplexiert oder nicht) • Bakterien können einige Substrate in hohen Dosen nutzen, andere sind toxisch, einige Substrate zeigen bei niedrigen Dosen positive Wachstumsraten, bei hohen sind sie toxisch • Erhöhung der Azidität (pH) wirkt sich auf drei Arten aus: o direkt durch Störung der Osmoregulation, der Enzymaktivität oder des Gasaustausches o indirekt durch erhöhte Konz. toxischer Metalle o indirekt durch Qualitätsverringerung der Nahrung oder Verknappung des verfügbaren Kohlenstoffes 3.3.9 Photosynthese-Licht-Beziehung • Lichtoptimum mit maximaler Umsatzrate bei Photosynthese sehr gering (im Gegensatz zu oft sehr breitem Optimum bei Nährstoffen) • im 3D-Wasserkörper gibt es verschiedene Nischen für unterschiedlich lichtbenötigende bzw. –empfindliche Pflanzen 3.3.10 Nicht substituierbare Ressourcen • essentielle Nährstoffe sind nicht substituierbar • bei Tieren und Bakterien decken Ressourcen Bedarf des Baustoffwechsels und liefern Energie für den Betriebsstoffwechsel • autotrophen Organismen benötigen Aufbaustoffe (Biosynthese) und Energie separat, Quelle der Energie verschieden (Photosynthese, Chemosynthese) Seite 45 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 neben autotrophen Pflanzen gibt es auch autotrophen Bakterien, sie verwenden als Energiequelle reduzierte Stoffe, welche sie zur Energiegewinnung oxidieren. nicht substituierbare Ressourcen: C, P, N 3.3.11 Substituierbare Ressourcen • Form von Stickstoff substituierbar (Nitrat, Ammonium oder elementarer Stickstoff bei Spezialisten) • Abbauprozesse sind mit Redox-Reaktionen verbunden. Sauerstoff als Reduktionsmittel kann durch Nitrat, Sulfat etc. ersetzt werden 3.3.12 Stickstoff • Pflanzen bevorzugen Ammonium als Stickstoffquelle, fehlt dieses, wird unter Energieaufwand Nitrat reduziert • elementarer Stickstoff kann nur von Spezialisten fixiert werden: Cyanobakterien, Knölchenbakterien. Dazu sind stark reduktive Verhältnisse nötig welche neben Photosynthese (wegen O2) erreicht werden ‡ Reduktion nachts oder in spezialisierten Zellen 3.3.13 Sauerstoff als limitierende Ressource • Sauerstoffgehalt in Wasser bescheiden ‡ grössere Produktion zehrt Sauerstoffinhalt einer grossen Wassersäule vollständig auf • Sauerstoffminimum im Metalimnion, da dort vermehrt Abbaureaktionen stattfinden • bei der Photosynthese wird genau so viel Sauerstoff an die Umgebung abgegeben, wie beim Abbau bzw. Respiration gebraucht wird, im Wasser gast dieser Sauerstoff aber wegen schnell erreichter Sättigungsgrenze rasch aus ‡ Defizite in der Nacht 3.4 Mechanische Wirkung von Wasser 3.4.1 Strömungsarten • rhythmische und arhythmische Wasser-Bewegungen für Gewässersysteme prägend • Oberflächenwellen erst im Uferbereich wichtig, da sie dort ihre volle Energie entfalten ‡ Anpassungen der Uferbewohner • Strömungen ‡ weiträumige Verdriftung der Organismen und Erosion (Formung der Landschaft) • Walzenbewegungen (Winter-Zirkulation im See) transportieren Partikel in der Vertikalen und Horizontalen • Langmuir-Spiralen an der Oberfläche ‡ Anreicherung von Plankton in Streifenmuster • Schaukelbewegungen (Seiches) und Gezeiten ‡ zeitweises Trockenfallen von Uferabschnitten, horizontale Verfrachtung riesiger Wassermassen • Turbulenz ‡ verantwortlich für Schwebefähigkeit von Plankton, Verteilung gelöster Wasserinhaltsstoffe und der Temperatur 3.4.2 Grossflächige Strömungen – Corioliskraft • Grossflächige Strömungen werden von der Erdrotation hervorgerufen ‡ Riesige Wasserwirbel, im Uhrzeigersinn auf der Nord- bzw. im Gegenuhrzeigersinn auf der Südhalbkugel • Bedeutung für Meeresströme für Landklima enorm gross (Golfstrom) • Zirkuläre Ströme, die um die Weltkugel herum laufen, sind wegen Landbarrieren auf Pole beschränkt ‡ nur kälteresistente Arten überleben Transport von Pazifik in Atlantik • auch Wasser in Seen wird durch die Corioliskraft abgelenkt ‡ Strömungen im Uhrzeigersinn auf der NHK, doch Wasser wird uferparallel weitergeführt, was zu Strömung im Gegenuhrzeigersinn führt Seite 46 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Geschwindigkeiten in Seen: ca. 100m bis Kilometer pro Stunde Transporte für Besiedlung eines Raumes durch Schwebeorganismen sehr wichtig in Buchten und einzelnen Seebecken gibt es auch gegenläufige Wirbel 3.4.3 Vertikale Strömungen • vertikale Strömungen finden in homothermen Seen statt, sind aber ausgeprägt in den Ozeanen zu verzeichnen: in polaren Zonen sinkt das kalte Wasser ab (Dichteanomalie fehlt im Salzwasser), auftauchende Ströme sind in der Antarktis, aber auch vor der Küste Perus vorhanden ‡ Upwelling ist so stark, dass es die warme Oberflächenzone zurückdrängt • El Nino Effekt: alle 2-8 Jahre reicht die Kraft nicht aus, um Oberflächenwasser zurückzudrängen und warme Zone dehnt sich bis zur Küste aus ‡ Veränderung des Klimas weltweit 3.4.4 Oberflächenwellen • innerhalb von Oberflächenwellen beschreiben Teilchen Trochoidenbahn ‡ keine Verdriftung • Amplitude nimmt mit der Tiefe ab: pro l/9 auf die Hälfte (l Wellenlänge) • Oberflächenwellen (durch Stürme oder Gezeiten generiert) für Organismen des offenen Wassers bedeutend: starke mechanische Wirkung in Ufernähe • Küstenerosion jährlich 0.3 bis 20 m (je nach Küste) 3.4.5 Gezeiten • Mond und Sonne bewegen Wasser gegen Zenith, Wasser folgt den Gestirnen verzögert • Starke Wirkung bei Neumond und Vollmond, da Kräfte zusammenwirken (Springtiden), Kräfte normal zueinander bei Neumond (Nipptiden) 3.4.6 • • • • • Fliessgewässer in Fliessgewässer sind gerichtete Strömungen wirksam Transportkraft direkt proportional zum Gefälle oder umgekehrt proportional zur Tiefe. Gefälle nimmt von Quelle bis Mündung ab, Tiefe nimmt zu ‡ grosse Fraktionen (Steine, Felsbrocken) werden nur im Oberlauf mittransportiert ‡ raue Sohle mit viel Reibungswiderstand, Rauhigkeit im Unterlauf gering mittlere Strömungsgeschwindigkeit nimmt gegen Mündung zu (Bergbach oft geringere mittlere Geschw. als Strom) Fliessgewässer sind Transportsysteme ‡ transportieren jährlich Millionen von Tonnen suspendierter Partikel in die Meere ‡ oft bilden sich Deltas 3.4.7 Gerinneformen von Fliessgewässern • Oberlauf (Headwaters): Gerinneverlauf relativ gerade und eng (Bachtobel) • Mittellauf: Bach bildet sich zu verzweigter Schwemmebene aus, Bachbett instabil und wird stetig umgelagert ‡ drei Typen von Kanälen: o Hauptkanäle o Seitenkanäle o Verbindungskanäle • bei Schneeschmelze/Hochwasser kommt Wasser kaum mit Untergrund in Kontakt, bei Niedrigwasser oder Grundwasserspeisung Elektrolytgehalt viel höher • Unterlauf: typische Gerinneform ein Mäander ‡ durch Umlagerung entstehen immer wieder Totarme oder „Hufeisenseen“ • Breite überschwemmter Auengebiete nimmt gegen Mündung stetig zu • Gewässersohle im mäandrierenden Bereich wandernd: Erosion am Prallhang, Ablagerung am Gleithang (nach Korngrösse sortiert) Seite 47 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 aufgrund der Viskosität des Wassers entsteht über jedem angeströmten festen Körper eine laminare Grenzschicht ‡ Strömung sinkt mit zunehmender Nähe zum Körper gegen Null. Mikrogrenzschicht: nur laminare Strömungen Makrogrenzschicht: durch Rauhigkeit der Sohle entstandene Tot- und Hinterwasserzonen, in der Wasser turbulent ausgetauscht wird, aber nicht strömt ‡ hier sedimentieren viele organische Partikel ‡ Nahrungsangebot für benthische Tiere 3.4.8 Anpassungen von Wasserorganismen an gerichtete Strömungen • rheophile Tiere: an Strömung angepasst, zum Teil von ihr abhängig • Morphologische Anpassungen o Flacher Körperbau o Stromlinienförmiger Körperbau (auch im Benthos) o Grenzschichtbewohner klein o Festhaltemöglichkeit o Beschwerung mit Ballast • bei starker Strömung Sauerstoffgehalt des Wassers kein Problem ‡ Tiere haben unbewegliche Tracheenkiemen • Anpassungen an organisch Belastete oder an strömungsarme Bereiche: o Ventilation der Tracheenkiemen o haemoglobin-haltiges Blut 3.4.9 • • • • • • 3.5 Anpassungen der Planktonorganismen wichtigste einwirkende Kraft: Schwerkraft ‡ dauernder Kampf gegen das Absinken Zooplankter sind mit effizienten Fortbewegungsorganellen ausgerüstet Algen fehlen solche Organellen (ausser Flagellaten mit Geissel), sie entwickeln z.B. Gasvakuolen kleine Formen ‡ gutes Schwebeverhalten Photosynthese der Algen nur in lichtdurchfluteten obersten Wasserschicht möglich ‡ wenig Zeit zur Reproduktion da schnell sedimentierend ‡ Verdoppelungszeit relativ kurz Relation Oberfläche zu Volumen begünstigt Kleinformen bei der Nährstoffaufnahme Verteilung in Zeit und Raum, Ausbreitung 3.5.1 • • • • • • Arten-Areal-Kurven Arten-Areal-Kurven zeigen die Individuenzahl in Abhängigkeit von der Biotopfläche auf zum Überleben brauchen Organismen eine Mindestfläche mit jeder Stufe der Nahrungskette nimmt Bedarf an Raum (Nahrung) zu Revierverhalten besonders unter grossen Räubern ausgeprägt ‡ Elimination von Schlüsselräubern kann Biozönose dramatisch verändern viele Arten treten innerhalb definierter Geografischer Grenzen auf, diese entstanden durch Selektion oder Rückzug aus ehemals grösserem Gebiet je grösser die Stichprobenfläche, desto grösser Arten- und Individuenzahl, zunehmende Artdiversität auch von Pol 3.5.2 Mosaik-Struktur – Mosaik-Zyklus-Konzept • viele Arten schützen sich vor Konkurrenz und Extinktion, indem sie Nischen bewohnen • Organismen, welche nicht auf eine Verbreitung via Wind, Wasser oder Tiere zählen können, zeigen eine Mosaik-Struktur in der Arten-Areal-Kurve (im log-log-Massstab) Seite 48 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • 3.5.3 • • • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 winzige Arten lassen sich sehr schlecht ausrotten, da sie sich schnell anpassen können, während grosse Organismen durch direkte Einwirkung (Raub) und durch stärkere Konkurrenz (da mehr Raum benötigt) doppelt bedroht sind Mosaik-Zyklus-Konzept beschreibt dynamische Entwicklung naturnaher Biotope und Landschaften viele Waldlandschaften z.B. zeigen nicht nur gesunde Bäume, sondern auch knorrige alte Baumruinen, Totholz und Jungwuchs ‡ Wald bildet ein stabiles System von Zyklen einzelner Standorte, die Abfolge nach einer Störung entspricht sekundärer Sukzession (ohne Aufbau des Bodens) Inseltheorie viele Tierarten brauchen grossflächige, strukturreiche und Störungsfreie Lebensräume Gesamtlebensraum setzt sich oft aus verschiedenen Biotopen zusammen Verdoppelung der Arten bei verzehnfachung der Fläche durch zunehmende Distanz vom Festland nimmt Immigration auf einer Insel bei gleich bleibender Extinktionsrate ab Faktoren, die die Artenzahlen auf einer Insel beeinflussen: Häufigkeit der Einwanderung und Extinktion o kleine Insel: grössere Extinktion, da weniger Ressourcen, Nischen, höhere Konkurrenz, o grosse Insel: grössere Zuwanderungsrate, da Wahrscheinlichkeit bei grosser Uferlinie an Land zu treffen grösser 3.5.4 Ökologisches Gleichgewicht • ökologisches Gleichgewicht entspricht nicht statischem Ruhen, sondern dynamischem Auf und Ab • in der Natur besteht als Folge von Zuwachs und Verlust ein Fliessgleichgewicht • Störungen sind verantwortlich, dass nicht nur Klimaxgesellschaften auftreten, sondern verschiedene Übergangsgesellschaften als Sukzessionsstadien • durch die Aufgabe der Nutzung sind viele Ökosysteme bedroht (z.B. Riedlandschaft) 3.5.5 Sukzession • zeitliches Nacheinander von verschieden zusammengesetzten Pflanzenbeständen an demselben Wuchsort (Entwicklungsreihe von Pionier zu Klimaxgesellschaft) • Sukzessionsrichtung: o primär progressiv (oder kurz primär) o sekundär progressiv (Regeneration) o regressiv o discessiv = richtungsneutral • je nach Heftigkeit der Störung beginnt Sukzession mit primär progressiver Abfolge (nach Vulkanausbruch) oder als Sekundärsukzession (z.B. nach Windwurf im Wald) • Verlandung eines Sees: Zonierung bleibt erhalten, verschiebt sich aber durch Torfbildung immer weiter Richtung offene Wasserfläche ‡ typische Sukzession an gegebenem (nicht wanderndem) Standort • Artdiversität zu Beginn der Sukzession gering (Pionierpflanzen), wächst aber durch Zukommen von Spezialisten im Verlauf der Sukzession an • Artenvielfalt im Klimaxstadium oft geringer als im Stadium davor, da nur noch Spezialisten Seite 49 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • Vereinfachte Eigenschaften von Skuzessions- und Endstadien der Ökosystementwicklung: Charakteristikum des Ökosystems Produktion/Biomasse-Verhältnis Artendiversität Nischenbreite der Arten Lebenszyklus Selektionsbedingungen tierische Gem. dominiert durch 3.6 ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Entwicklungsstadien während der Sukzession hoch meist niedrig eher breit oft einfach r-Selektion Herbivoren (bei autotropher Sukzession) oder Detritivoren (heterotrophe Sukzession) End- oder Reifestadien (Klimaxvegetation) niedrig meist hoch eher eng oft komplex K-Selektion Herbivoren und Detritivoren, Carnivoren Aquatische intraspezifische Interaktionen 3.6.1 Wechselwirkungen in der Natur • abiotische Wechselwirkungen: o signalwirkung, Orientierung o modifizierende Wirkung o limitierende Wirkung o mutagene Wirkung • biotische Wechselwirkungen: o Signale, Reize o Koexistenz o Detritivorie o Kooperation o Konkurrenz o Raub, Parasitismus 3.6.2 Wechselbeziehungen • Auftreten von Organismen in Raum und Zeit (Demökologie) ist Resultat von autökologischen Ansprüchen und biologischen Wechselwirkungen (Synökologie) ‡ allein auf Grund von vorhandenen autökologischen Bedingungen kann eine Art nicht erwartet werden • evolutives Überleben einer Art hängt vor allem von der Anpassung an die unbelebte Natur und die biologischen Wechselwirkungen ab • Einteilung des Niveaus der Wechselwirkungen: 1. Faktoren, die Vorgänge Steuern ohne direkt Population zu limitieren oder zu fördern, Signal- oder Orientierungshilfen (Lichtgradient, saisonale Temperaturschwankungen, etc.) 2. Faktoren, die modifizierend wirken (Wechsel der Haut-/Fellfarbe, Winterpelz, etc.) 3. Faktoren mit limitierender Wirkung, Beeinflussung der Population von der Nahrungsbasis her 4. Faktoren, die das Erbgut verändern (Chemikalien und radioaktive Stoffe) 3.6.3 Biologische Wechselwirkungen • Interspezifische Konkurrenz: selektioniert die Arten in der Evolution, erfordert immer neue Anpassungen und Spezialisierungen, nicht erfolgreiche Arten sterben aus • Intraspezifische Konkurrenz: steuert Fitness der Population, bringt diese aber nicht zu aussterben (Sieger der Rivalenkämpfe ist von derselben Art), starke Konkurrenz, da gleiche Bedürfnisse aufgrund gleichen Erbgutes, spielt aber nur eine Rolle, wenn Populationsdichte hoch bzw. Kapazitätsgrenze überschritten ‡ die schwächsten Individuen sterben Seite 50 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Analyse der Wechselwirkungen: Wechselwirkung Neutralismus Konkurrenz Amensalismus Parasitismus Raub Kommensalismus Mutualismus Protocooperation Art1 0 + + + + + Art 2 0 0 0 + + Bedeutung keine Beeinflussung gegenseitige Hemmung Hemmung, Toxine Räuber kleiner als Wirt Räuber grösser als Wirt Schmarotzer obligatorische Symbiose Zusammenwirken positiv aber fakultativ • Unterschied Herbivoren (als Räuber der Pflanzen), Prädatoren und Parasiten liegt in den Grössenverhältnissen zum Wirt und in der Vollständigkeit des Frasses o Carnivoren: Beute wird getötet und mehr oder weniger vollständig gefressen o Herbivoren: ernähren sich meist nur von einem Teil der Pflanze, Wurzel bleibt erhalten und kann bei überdauernden Pflanzen wieder treiben o Parasiten: viel kleiner als Wirt und schaden diesem als Einzelindividuum nicht, erst bei Massenbefall (da klein schnelle Vermehrung) 3.6.4 • • • • Konkurrenz-Ausschlussprinzip Interspezifische Konkurrenz verschlingt viel Energie („Rüstungsindustrie“) kann direkt via Konfrontation oder indirekt via gemeinsamer Ressource erfolgen Konkurrenz hat Auswirkungen auf Fortpflanzung, Wachstum und Mortalität Zwei Arten, welche exakt die gleiche ökologische Nische besetzen, können auf die Dauer nicht koexistieren ‡ Spezialisierung von Arten im Laufe der Evolution, um nebeneinander leben zu können ohne energieraubende Konkurrenzsituationen (Steigerung der Artenvielfalt durch Konkurrenz) Konkurrenz wird erst bedeutungsvoll, wenn die Ressourcen knapp werden: exploitive Konkurrenz (Ausschluss durch Konkurrenz) entsteht, wenn eine Ressource von min. zwei Arten genutzt wird, aber die eine unter den geg. Bedingungen immer besser ist Die unterlegene Art kann ist bei anderen Bedingungen überlegen (sonst gäbe es sie nicht mehr) • • 3.6.5 Faktoren innerartlicher Konkurrenz • dichteabhängige Faktoren o Nahrungsqualität/-verbrauch o Ausbreitung von Krankheiten o Sterblichkeit o Fruchtbarkeit o Wanderung, Territorialität • dichteunabhängige Faktoren o Klima, abiotische Umwelt o interspezifische Konkurrenz o Sterblichkeit durch nicht ansteckende Krankheiten • bei hoher Dichte wird ein Wandertrieb ausgelöst, wobei nicht klar ist, ob die Organismen, welche auswandern eine genetisch fixierte Wanderlust haben und die anderen nicht Seite 51 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 3.6.6 Intrinsisches Populationswachstum • einfacher Ansatz: exponentielles Wachstum basiert auf konstante Vermehrungs- und Todesraten • beim logistischen Wachstum geht man von beschränkter Kapazität des Lebensraumes aus • Einwirkung von fremden Arten kann in einem weiteren Term eingeschlossen werden, dieser Einfluss hängt mit der Trefferwahrscheinlichkeit von erster und zweiter Art zusammen 3.6.7 Zeitverzögertes Wachstum und Überschiessen der Kapazität • Futtersituation vor Ablage der Eier entscheidend über die Menge an Nachkommen ‡ Futtersituation beim Schlüpfen kann grundlegend anders sein • zeitverzögerte Reaktion auf die Dichte führen zu Populationsschwankungen, die auch über die Kapazität schiessen können • bei Organismen mit längerer Generationszeit wird Zeitverzögerung sehr wichtig • Risiko-Verteilung führt zu ungleichgrossen Eigelegen ‡ ist genügend Nahrung vorhanden und werden viel Eier abgelegt, kann es bei einem plötzlichen Umsturz der Nahrungssituation zu Unterernährung aller kommen (oder einige werden vor anderen bevorzugt), wo bei kleineren Eigelegen die noch zur Verfügung stehende Nahrung für alle ausreicht 3.6.8 Chaos • Ein System kann nur vier Zustände annehmen: 1. es strebt einem konstanten Zustand zu 2. es vollzieht regelmässige Schwingungen 3. es strebt dem unendlichen zu 4. es ist chaotisch • das Auftreten von Chaos ist von fundamentaler Bedeutung in der Naturwissenschaft • Chaos kommt ohne extreme äussere Bedingungen durch rel. einfache Ansätze zustande • Experimente, in denen Chaos auftritt, sind nicht reproduzierbar 3.6.9 Dichteabhängige Entwicklung der Population • Mortalität und Natalität sind von der Populationsdichte abhängig • bei zunehmender Dichte gibt es einen Schnittpunkt der Natalitäts- und der Mortalitätsrate ‡ Tragfähigkeit des Systems (in Wirklichkeit ist die natürlich ein Bereich von Werten) • dichteabhängige Mortalität: hohe Populationsdichten an Organismen begünstigen den Ausbruch von ansteckenden Krankheiten und fördern eine Störung des Verhaltens (Brutpflege) • Ausbreitung einer Krankheit hängt von Zahl der Kontakte und Inkubationszeit ab • wandernde oder eingeführte Tiere können zur tödlichen Gefahr einheimischer Tiere werden • in grossen stehenden Gewässern ist die Möglichkeit der Begegnung von Geschlechtspartnern sehr gering, deshalb findet oft Klonbildung durch Parthenogenese statt 3.6.10 Revierverhalten • Funktion von Revieren o Sicherung von ausreichender Ernährung unabhängig von natürlichen Schwankungen (Arealgrösse nicht von aktueller Futtermenge abhängig) o Schutz der Jungtiere o Zugang zu Sexualpartnern o Zugang zu sicheren Unterschlupfen • Revierinhaber kennen ihr Revier gut, die gejagten Aussenseiter ohne Revier werden häufig in Kämpfe verwickelt und brauchen viel Energie Seite 52 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 3.6.11 Schwarmverhalten • Fischschwarm: Schutz versus Nahrungsvorteil (im Innern Schutz aber wenig Nahrung) • Mückenschwärme: Zusammenhalten des Schwarms durch Versuch, immer ins Zentrum zu gelangen • Bei Bienen Staatenbildung mit der Königin im Zentrum des Schwarmes während neuer Standort für Bienenstock erkundet wird • Geklumpte Verteilung bietet viele Vorteile: Arbeitsteilung in Insektenstaaten, Schutz durch Verwirrung der Feinde, gemeinsame Jagd • Zusammenwirken vieler Denkprozesse führt zu neuen Leistungen, Jungtiere profitieren von Erinnerungen älterer Tiere, bei Zugvögeln können auch neue„Ferienbekanntschaften“ getroffen werden ‡ wirkt der Inzucht entgegen • gegenüber grossflächig jagenden Carnivoren bietet das Schwarmverhalten keinen Vorteil • Crowding effekt (Gedrängewirkung: o Verhalgensstörungen wie gesteigerte Aggresivität, Kannibalismus, Unterlassen der Versorgung der Jungen o Anstieg des Blutdruckes ‡ Tod durch Nierenversagen o Selbstregulation durch Ovulationshemmer, Resorption der Embryonen im Mutterleib, vermehrte Geburten von Männchen • selbst in dichten Schwärmen braucht das Individuum eine private Umgebung ‡ erbliche Codierung dieser innerhalb des Schwarmes, ergibt sich in der Praxis durch den Radius, der verteidigt werden kann 3.6.12 Konkurrenzvermeidungsstrategie • innerartliche Variabilität: verschiedene Nischen für verschiedene Entwicklungsstadien (z.B. Insekten, die aquatische Phasen beibehalten haben) 3.6.13 Brutpflege • Brutpflege vermindert die Mortalität der Jungen erheblich • Brutpflege ist auch im Wasser sehr verbreitet, selbst bei Tieren, die keine inneren Organe für die Embryonalphase haben • Eier werden mit energiereichem Aufbaumaterial versehen, um möglichst schnell und unabhängig vom Nahrungsangebot in der Natur zu wachsen • Viele Eier werden auch im Litoral an Pflanzen angeheftet, weil es dort mehr Verstecke und genug Futter gibt 3.6.14 Wanderung • Vorteile der Laichwanderung der Lachse: o Laichvorgang im Kies o hohe Futterdichte für Jungtiere o Jungtiere und Adulte kommen sich nicht in die Quere o keine Geschütze Räume im Meer oder an der Uferzone ‡ diese können jedoch in den Oberläufen von Flüssen gefunden werden • Nachteile: o Gefahren an zwei Standorten und auf der Wanderung o macht Anpassung an Veränderungen an allen Standorten nötig • Wanderung kann auch als Konkurrenzverminderung angesehen werden 3.7 Nahrungsnetze, Nahrungsketten, Nahrungspyramiden • der biogene Stoffumsatz lässt sich in Produktion, Konsumation und Destruktion gliedern Seite 53 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 einzelne Organismen lassen sich je nach Herkunft der genutzten Energie in Primäsproduzenten, Konsumenten oder Destruenten einteilen Destruenten nutzen abgestorbene organische Substanz (Detritus) als Energiebasis Konsumenten sind heterotroph, sie nutzen pflanzliche Primärkonsumenten oder tierische Nahrung 3.7.1 Trophiestufen • Primärproduzenten sind autotroph, Biosynthese aus Grundstoffen wird mittels Photosynthese oder Chemosynthese ermöglicht • Sekundärkonsumenten, Tertiärkonsumenten: Nahrung ist gleichzeitig Energielieferant und Stofflieferant für die Biosynthese • Unterschiede der Trophiestufen im Wasser und an Land o Herbivoren an Land fressen Pflanzen nur teilweise, dadurch können sie weiterwachsen, kleine Planktonalgen im Wasser werden normalerweise vollständig aufgefressen ‡ Primärproduktion muss von den nicht erwischten Exemplaren getragen werden o Beuteerwerb im Wasser meist mittels Filtrierung, an Land muss üblicherweise jedes einzelne Beutetier gefangen werden o Verwertung von pflanzlicher Nahrung im Wasser vielfach besser als an Land (Algen enthalten viel Eiweiss ‡ hochwertige Nahrung; Landpflanzen enthalten vorwiegend Zellulose und Lignin ‡ eher schlecht verwertbar • Diese Faktoren erlauben eine längere Nahrungskette im Wasser 3.7.2 • • • • • Nahrungsnetz Nahrungsbeziehungen sind vielfältig und wirken stabilisierend kaum ein Konsument lebt nur von einer Beuteart verschiedene Lebens-Stadien erfordern zusätzlich eine wechselnde Nahrungsbasis saisonale Abfolgen verändern Nahrungsnetz dauernd Nahrungsketten, Trophiepyramiden ‡ vereinfachte Formen des Nahrungsnetzes, Zusammenfassung koexistierender Formen in grössere Einheiten 3.7.3 Nahrungsketten • Nahrungskette: Auflösung des Nahrungsnetzes in linearer Anordnung von Primärproduzenten zu Konsumenten • Carnivoren/Herbivoren-Kette, Parasitenkette und Detrivorenkette • einzelne Nahrungsketten vielfach miteinander verzahnt • bei den Carnivoren nimmt Individuengrösse von Stufe zu Stufe zu, bei der Parasitenkette nimmt sie ab 3.7.4 Pyramiden • Zuordnung der Organismen zu einer Trophiestufe (Produzenten, Konsumenten x-ter Ordnung) als weitere Vereinfachung des Nahrungsgefüges ‡ nicht immer sehr genau, da viele Organismen in mehrere Stufen gehören • Folgende Daten werden in Pyramiden dargestellt o Zahl der Individuen auf der gleichen Fläche o deren Biomasse (meist in g/m2 Trockengewicht) o Energie, welche von Stufe zu Stufe fliesst • Energiepyramiden stehen nie auf dem Kopf (Thermodynamik), Zahlen- (insbesondere bei Parasitenketten) und Biomassenpyramiden können sehr wohl auf dem Kopf stehen • auf dem Kopf stehende Pyramiden heissen nicht, dass nicht genug Nahrung vorhanden ist: Algen (Produzenten) benötigen oft nur wenige Stunden bis Tage um sich zu verdoppeln, Seite 54 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • 3.7.5 • • • • • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 d.h. dass auch eine relativ kleine Algenbiomasse innerhalb der Regenerationszeit des Zooplanktons von immerhin 60 Tagen eine enorme Nahrungsproduktion aufweist Qualität der Nahrung mitverantwortliche für Form der Pyramide Energiefluss Einbahnkette durch das Ökosystem zur Photosynthese wird 1, höchstens 5% der Strahlungsenergie genutzt die Hälfte wird von den Pflanzen veratmet, der Rest geht ins Wachstum bzw. steht den Nachfolgeglieder der Nahrungskette zur Verfügung bei jedem Übergang von einer Stufe zur Nächsten geht Energie verloren, z.T. geht diese an die Detrituskette, welche von Sekundärproduzenten wieder genutzt werden kann Trophischer Wirkungsgrad: Anteil Energie, welche in Form von Wachstum bei der nächsthöheren Stufe messbar wird im Vergleich zur aufgewendeten Energie für das eigene Wachstum 3.7.6 Futtereffizienz – Bergmannsche Regel • gleiche Menge Futter bringt im Schnitt ca. gleiche Sekundärproduktion • Grösse der Organismen, die dieses Futter fressen für die Geschwindigkeit des Umsatzes wesentlich, grosse Tiere haben eine bessere Relation von Oberfläche zu Volumen ‡ Wärmeverlust ist proportional zur Oberfläche ‡ kleine Tiere müssen pro Zeit mehr fressen als grosse • Bergmann’sche Regel (Grössenregel): Die Körpergrösse von Tieren gleicher systematischer Kategorie nimmt zu den Polen hin zu • Körperoberfläche von Tieren in warmen Gebieten wird „künstliche“ vergrössert: z.B. grosse Ohren, längere Körperanhänge; in Polargebieten ist das gegenteilige der Fall 3.7.7 Räuber-Beute • Lotka-Volterra (again) • Grössenverhältnisse Räuber-Beute o grosse Beute, kleine Räuber: Parasiten o eher ausgeglichene Grössenverhältnisse: Rudeljäger, Webspinnen o Beute eher kleiner als Räuber: Vögel, jagende Spinnen o Räuber deutlich grösser als Beute: Filtrierer • insbesondere Jäger sind nicht in der Lage, ihre Beutepopulation nachhaltig zu kontrollieren (Lotka-Volterra), hingegen können Parasiten und Filtrierer die Beutepopulationen entscheidend dezimieren • Wachstumsverhältnisse der Beute ändert durch Intensität der „beraubung“: wird viel Beute gemacht, hat diese weniger intraspezifische Konkurrenz und die Individuen werden grösser und umgekehrt; im mittleren Bereich gibt es dabei ein Maximum 3.7.8 Beutevermeidungsstrategien • viele morphologische, physiologische und verhaltensmässige Anpassungen zum Schutz vor Raub o grössere Individuen konkurrenzstärker als kleine o kleine Individuen können sich besser verstecken o morphologische Schutzeinrichtungen: Stacheln, Panzer, Nesselkapseln etc. o Tarnung: kryptische Tracht, Mimikry (Nachahmung von gefährlicheren Tieren), Durchsichtigkeit, etc. o chemische Abwehr, meist kombiniert mit Warnfärbung o Schleimabsonderung oder Tintensekret Seite 55 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie 3.8 ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Ökologische Nische und Einnischung 3.8.1 Definition • Individuen einer Art stellen bezüglich ihrer Umweltfaktoren bestimmte Ansprüche • Nische einer Art: das n-dimensionale Hypervolumen, innerhalb welchem sie lebensfähige Populationen erhalten kann ‡ kein real existierender Ort sondern abstraktes Konzept • n Dimensionen nicht nur räumliche Ausdehnung sondern auch andere Umweltfaktoren ‡ spezifische Lebensweise einer Art in einem bestimmten Lebensraum, der nur durch diese Form genutzt wird 3.8.2 Eindimensionale Nische • stenök: gegenüber ändernde Umweltfaktoren intolerant (stenohalin: nur bei eng umgrenzter Salinität lebensfähig); euryök: tolerant gegenüber ändernden Umweltfaktoren • für jeden Umweltfaktor existiert i.d.R. ein optimaler Bereich ‡ Darstellung der eindimensionalen ökologischen Nische durch die Glockenkurve • Bereiche der Glockenkurve: o Optimum: maximale Aktivität (Optimum des Faktors und Vitalzone der Population) o Pejus: Organismus kann mit Einschränkungen existieren und sich fortpflanzen (Vitalitätsbereich des Faktors, Vitalzone der Population) o Pessima: Bereiche in der Nähe der Grenzwerte, Bedingungen sind nicht tödlich, doch nimmt die Population doch ab, da die Fortpflanzung die Todesrate nicht kompensiert (Toleranzbereich des Faktors, aber Letalzone für die Population) 3.8.3 Ökogramme • zeigen Ausdehnung einer Population bezüglich zweier Faktoren (z.B. Nahrungsangebot und Wassertiefe) • Überlappung in Ökogrammen weist auf Konkurrenz hin, dies wird wenn möglich vermieden 3.8.4 Fundamentale Nische – realisierbare Nische • fundamentale Nische: beschreibt den durch abiotische Umweltfaktoren definierte ndimensionale Raum, in welchem eine art potentiell lebensfähige Populationen erhalten kann • realisierte Nische: der entsprechende Teilraum, der bei Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen den Lebwesen besetzt wird 3.8.5 Nischenseparation • Köcherfliegenlarven bauen unterschiedlich dichtmaschige Netze und können so in verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten hausen • altertümliche und wenig konkurrenzstarke Arten konnten sich nur auf abgelegenen Inseln erhalten • Entwicklung neuer Arten auf Inseln bei geringerer Konkurrenz besser mögliche • auf grossen Kontinenten die meisten Nischen schon besetzt ‡ zu Beginn meist noch unvollkommene Mutante werden deshalb eliminiert, bevor sie sich zur konkurrenzstarken Form entwickeln kann • bei Invasion von Spezialisten kommt es zur Ausrottung einheimischer Arten 3.8.6 Wiederbesetzung einer Nische nach Störung • Insektenlarven in einem Fluss driften tendenziell abwärts (Unfalldrift während Aktivität und Flucht bei ungünstigen Bedingungen, Nahrungsmangel) ‡ Nischen im Flussoberlauf werden leer Seite 56 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 • Kompensation: Larven wandern aufwärts, Imagines zeigen allgemeinen oder gerichteten Verbreitungsflug (gerichtet zur Quelle ist eher die Ausnahme, es genügt, wenn die zufällig in diese Richtung fliegenden Weibchen dort ihre vielen Eier ablegen) 3.8.7 • • • • • Vermeidung von Konkurrenz unterschiedliche Aktivitäten zu bestimmten Zeiten (tagaktiv, nachtaktiv) unterschiedliche Fortpflanzungszeiten unterschiedliche Nutzung des Nahrungsangebots im Lebensraum unterschiedliche Lebensräume Saisonalität ‡ Nischen sind immer besetzt, aber abwechslungsweise durch verschiedenen Arten 3.8.8 Adaptive Radiation • Entstehung vieler neuer Arten aus einer Stammform durch Einnischung in erdgeschichtlich kurzer Zeit; oder: Aufspaltung einer Gründerart in viele Arten durch Anpassung an verschiedenen Umweltbedingungen • Durch Nahrungsvielfalt und fehlende Konkurrenz kommt es zu starker Vermehrung ‡ grosse genetische Vielfalt (Mutationen), Vermehrung führt zu Konkurrenz um Raum und Nahrung, Selektionsdruck führt zu Spezialisierung beim Nahrungserwerb ‡ neue Ökologische Nischen 3.8.9 Konvergenz • Zunehmende Ähnlichkeit zweier phylogenetisch unabhängiger Linien bei gleichem Selektionsdruck (z.B. bei gleichen Bedingungen auf versch. Kontinenten oder in versch. Regionen ‡ Stellenäquivalenz) • Konvergenz bei grabenden Larven: nach oben gerichtete, bewegliche Tracheenkiemen in verschiedenen Gattungen • Konvergenz bei Eintagsfliegenlarven: abgeplattete Formen, die in der Grenzschicht leben können in verschiedenen Gattungen 3.8.10 Funktionelle Gruppen • saisonale und räumliche Besetzung der Nischen erfolgt oft nach funktionellen Kriterien (Konvergenzen) ‡ anstelle von systematischen Einheiten werden funktionelle Strukturen vergleichen (z.B. abfolge unterschiedlicher Schwebetypen im Plankton im Laufe des Jahres, Filtrierer, Räuber, Sammler, etc.) 3.8.11 River-Continuum Concept • Schematische Darstelung eines Flusses als Kontinuum von ökologischen Faktoren und Lebensgemeinschaften (bestimmte Zusammensetzung funktioneller Gruppen) • Lebensgemeinschaften entlang der Fliessstrecke eines Flusses ändern sich gesetzmässig • oberster Abschnitt (enger, gestreckter Abschnitt): allochtone Zufuhr von Nahrung von aussen (Laub), primärproduktion gering, aber trotzdem vorhanden (sehr gute Nahrungsqualität), Organismen primär Sammler und Zerkleinerer • weiter unten (Gerinne öffnet sich): grössere autochtone Produktion via Photosynthese ‡ vermehrt Weidegänger • in grösseren Strömen mitgedriftetes organ. Feinmaterial wichtigste Nahrungsquelle • einzelne Prozesse eines Kreislaufes lösen sich im Flieswasser in Spiralen auf (Ort der Produktion stimmt nicht mit Ort des Abbaus überein) Seite 57 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie 3.9 ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 Lebenszyklus-Strategien im Wasser 3.9.1 Strategien des Überlebens • r-Strategie: o grosse Wachstumsrate o kurzlebige Generationen o viele Nachkommen o schnelle Nutzung der kurzzeitig vorhandenen Ressourcen o meist kleine Organismen o grosses Verbreitungspotential • K-Strategie: o geringe Wachstumsrate o langlebige Generationen o wenige Nachkommen o viele Anpassungen zur effizienten Nutzung der Ressourcen o meist grosse Organismen o geringes Verbreitungspotential o elterliche Fürsorge (bei Tieren) • r-Strategen vor allem in Habitaten mit stark schwankenden Bedingungen (Wasserpfützen, Überschwemmungsflächen), Überleben bei Verschwinden des Habitats durch trockenresistente Eier oder durch Abwanderung • bei stabilen Habitaten bringt ständige Überbelastung der Umwelt keinen Vorteil, vorhandene Kapazitäten müssen optimal genutzt werden ‡ K-Strategen • Plankton im Vergleich zu Meeressäugern alles r-Strategen, untereinander aber weiter differenzierbar • bei hohem Nahrungsangebot eher r-Strategen, bei kleinem Nahrungsangebot eher KStrategen 3.9.2 Trichopteren Emergenz – lunare Periodizität • Emergenz: die Menge ausgewachsener flugfähiger Wasserinsekten, die auf einer begrenzten Wasserstrecke im Jahr entsteht. • Adulttiere müssen nicht nur aus der Puppe schlüpfen, sondern gleichzeitig vom Wasser an Land wechseln 3.10 Störungen der aquatischen Systeme 3.10.1 Ökomorphologie • in der CH sind 95% der ehemaligen Feuchtgebiete verschwunden und viele Bäche eingedohlt worden • die grösseren Gewässer sind reguliert und hydrologisch verändert • mehrere tausend Kilometer Gewässer müssten renaturiert werden, bloss einige wenige Kilometer werden pro Jahr revitalisiert 3.10.2 Qualitative und quantitative Bedrohung der Gewässer • qualitative Bedrohung: o häusliche Abwasser (Fäkalstoffe, Waschmittel, etc.) o gewerbliches und industrielles Abwasser (verschiedene organische und anorganische Inhaltsstoffe) o Abwasserinhaltsstoffe werden in vier Kategorien zusammengefasst Seite 58 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie • ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 1. leicht abbaubare organische Stoffe: Ökosysteme sind auf solche Stoffe angepasst, Endprodukte oft anorganische Bausteine in oxidierter oder reduzierter Form 2. schwer abbaubare organische Stoffe: oft schädliche Inhaltsstoffe, Abbau benötigt längere Anpassungszeit, schränken Nutzung des Wassers schon in geringen Mengen stark ein, reichern sich in Nahrungskette an 3. eutrophierende Stoffe: führen zur Steigerung pflanzlicher Produktion, direkt zugeführt oder aus Abbau von 1 4. nicht abbaubare Stoffe: anorganische Stoffe, insbesondere Salze o in industrialisierten Ländern konnten die Probleme der qualitativen Verschmutzung nach und nach gelöst werden, in Schwellenländer kommen alle Probleme zusammen (kommunales Abwasser, industrielles Abwasser, Nährstoffe, MikroVerunreinigungen) qantitative Bedrohung: Resultat von Nutzungskonflikten (Strassenbau, Drainierungen, Uferverbauungen) ‡ Seeufer für viele Organismen wichtig als „Kinderstube“ 3.10.3 Restwasser • Elektrizitätswerke, die zu viel Wasser entnehmen, müssen bis 2007 saniert werden, zunächst müssen sie aber in dem Mass für mehr Fliesswasser sorgen, in dem ihre Nutzungsrechte nicht tangiert werden. Sind die Gebiete besonders schützenswert, müssen die Nutzungsrechte geschmälert und entsprechende Entschädigungen gezahlt werden. • Ermittlung der Abflussmenge Q347: Die Werte der gemessenen Wassermengen werden der Reihe nach geordnet, Q347 entspricht dabei dem 10. kleinesten Wert, diese natürliche Niedrigwassermenge wird um ein fünftel gekürzt und ergibt dann den Restwasserwert. 3.10.4 Abfluss, Abflussregime • rund ein Drittel des Niederschlagswassers gelangt in die Bäche • das Abflussregime ist beeinflusst durch die Hydrologie des Einzugsgebietes • kurzfristige, extreme Schwankungen in lokalen Einzugsgebieten verwischen sich in grossen Gewässern • langfristige Abflussmengen folgen der saisonalen Entwicklung der Niederschläge bzw. Schneeschmelze etc. • natürliches Abflussregime bei vielen Gewässern durch Wasserkraftnutzung mit Speicherbetrieb überlagert • extreme Hochwassersituationen werden durch Regulierungen durchflossener Seen aufgefangen • Wasserschloss Schweiz: mit den bestehenden Wasserkraft-Projekten verbleiben kaum mehr natürliche Fliessgewässer 3.10.5 Eutrophierung • Limitierende Wirkung des Phosphor wird durch den anthropogenen Eintrag beseitigt • Seen mit ihren grossen Wassermassen reagieren extrem Träge auf diese Einträge, sie wirken aber auch entsprechend nachhaltig • frühe Kläranlagen waren noch nicht für die Entfernung des Phosphors eingerichtet, so dass 70% im gereinigten Wasser verblieb • Beurteilung eines Gewässers: Zielsetzung (gemessen an Urzustand) muss politische und wissenschaftliche Aufgaben definieren • Massnahmen an der Quelle: wichtigste Gewässerschutzmassnahme ist die Herabsetzung der Belastung (Klärtechnik, Verbot von P-haltigen Textilwaschmitteln etc.) Seite 59 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 3.10.6 Selbstreinigung • Autolyse: in Zellen abgestorbener Organismen werden Enzyme frei, die eine Art Selbstverdauung durchführen • mikrobieller Abbau: die übrigen organischen Reste dienen Kleinlebewesen als Nahrung • aerobe Zersetzung (Mineralisation): bei genügendem Sauerstoff oxidieren Nitritbakterien das bei der Zersetzung freiwerdende Ammonium zu Nitrit, dieses wird von Nitratbakterien zu Nitrat umgesetzt, dieses und andere freigewordene Stoffe (CO2, Sulfat, Phosphat, etc.) dienen den Pflanzen als Nahrung. • anaerobe Zersetzung (Fäulnis): anaerobe Bakterien zersetzen organische Substanzen zu CO2, Dihydrogenphosphat und Methan, Ammoniak und Schwefelwassertoff (für viele Organismen giftig), diese Stoffe können dann aber auch mit verschiedenen Reaktionen abgebaut werden 3.10.7 Biologische Beurteilung: Makroindex • Beurteilung beruht v.a. auf die Präsenz oder Absenz der empfindlichen Stein- und Köcherfliegenlarven. Fehlen sie ganz oder teilweise, müssen durch Einbezug der Erkenntnisse über die Wasserqualität, die Ökomorphologie und die Abflussverhältnisse mögliche Ursachen eingegrenzt werden. 3.10.8 Saprobienindex • Beurteilung der Gewässer nach Saprobiegrad • Polysaprobe Gewässer müssen mehr abbauen als die mittels Primärproduktion aufbauen • hypertrophe Seen produzieren mehr als das System abbauen kann 3.10.9 Abwasserreinigung • Technik der ARA ahmt weitgehend natürliche Vorgänge nach (Selbstreinigung) • die notwendige Reinigungsleistung ergibt sich aus dem Gewässer, in welches das gereinigte Abwasser eingeleitet wird, darüber hinaus müssen die technischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden (Vorsorgeprinzip) • erste Generation der ARAs war auf Eliminatin von org. abbaubaren Stoffen optimiert, an Seen kam dann Phosphatfälung und später Flockungsfiltration hinzu. • Stufen der Abwasserreinigung: o 1. Stufe: Mechanische Reinigung (Rechen, Öl/Sandfang, Sedimentation im Vorklärbecken) o 2. Stufe: Biologische Reinigung, Abbau organischer Stoffe durch Mikroorganismen unter Abscheidung von Nitrat (Nitrifikation) in belüfteter Zone, in unbelüfteter Zone ebenfalls Abbau organischer Verbindungen und Umwandlung von Nitrat in Luftstickstoff (Denitrifikation) o 3. Stufe: Chemische Reinigung, Phosphat-Elimination durch Fällmittel o 4. Stufe: Filtration 3.10.10 Belüftung des Hüttenersees • Tiefenwasser wird durch ein Steigrohr mittels Injektion von Luft nach oben transportiert, wo es sich mit Sauerstoff aus der Luft anreichert. • im Sommer wird das sauerstoffreiche Wasser wieder in die Tiefe geleitet, um das Oberflächenwasser durch die Belüftung nicht zu beeinflussen • im Winter wird es an der Seeoberfläche zurückgeleitet, um die Zirkulation zu unterstützen Seite 60 © Marcus Jenal Zusammenfassung Ökologie ETH Zürich, 1. VD Herbst 2002 3.10.11 Begasung mit reinem Sauerstoff • Sauerstoff wird mit reinem Sauerstoffgas im Sommerbetrieb in den See eingetragen, dabei darf es nicht zu Umwälzungen kommen, der Sauerstoff wird am Seegrund feinblasig eingetragen, das Tiefenwasser kann wegen der Druckverhältnisse viel Sauerstoff lösen, so dass die Blasen nicht ins Metalimnion gelangen können, wo sie eine Beschleunigung des Nährstoffkreislaufs bewirken würden • Im Winter wird mit Druckluft eine intensivierte Zirkulation erreicht, wobei auch hier Sauerstoff in die Tiefe gelangt • das Mähen von Unterwasserpflanzen ist eine kosmetische Massnahme, die keine wirkliche Nährstoffentlastung bringt. Seite 61 © Marcus Jenal