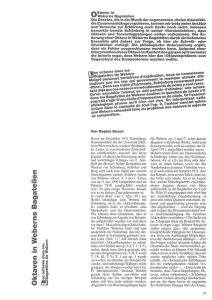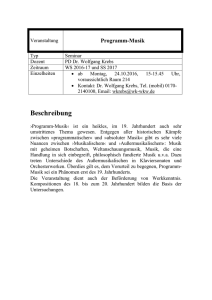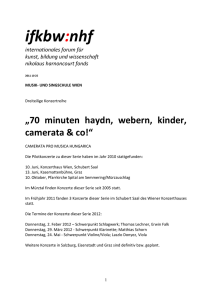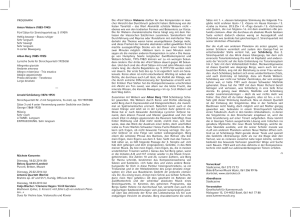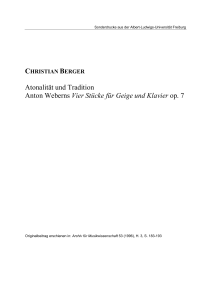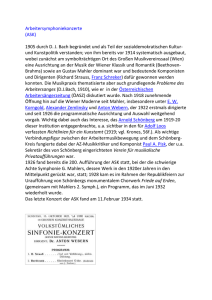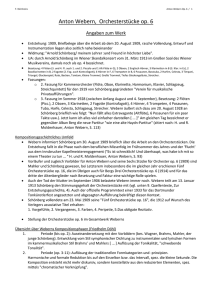BALAN E
Werbung

E 1. K A M M R KO N Z E RT E BAL ANLC INIEN UND P UNK TE 0 UHR 012, 19.3 2 SA A L V O N . 7 MOZ A RT , E L L A LIEDER H E B E R N 7 – 2 8) A N T ON W (19 2 IE OP. 2 1 N S Y MP H O ND CHREIT E S IG H U 1. R : T IONEN 2. VA RIA HIG S E HR RU . A M E H T ER E BH A F T VA R. 1 L HAF T EHR L EB SIGER VA R. 2 S S DER M Ä IE W 3 . R UHIG VA SER S T R S U Ä 4 . VA R HAF T EN E HR L E B ICH T EIL N . IG S VA R. 5 S S Ä A R S CHM VA R. 6 M A S BREIT ER TW VA R. 7 E CO D A – PAUSE – DEU S M NG A M A 61 OZ A R T WOLFGAE NR. 10 B-DUR K V 3 D – 8 4) SEREN A A« (178 3 IT T R A P » GR A N LTO GR O M O E L L A – I – II 1. L A R G O O – T RIO T T E U N 2 . ME RIO I – II IO E T T O) T R G E 3. A D A G L L A T TO – E T TO ( L L EG R E A – IO 4. ME NU G A NZE ( A D 5. R O M A EN RIAT ION A V IT M A DAGIO) N T E) A ( A N D A L L E G R O) 6. T HE M OA E (MOLT L A IN F . 7 7 E BAL ARNICCK HAHN VON PAT Gemeinsam mit ihrem neuen Generalmusikdirektor Sylvain Cambreling loten die Musiker des Staatsorchesters in diesem Konzert die Grenzen der Kammermusik aus. Weberns Symphonie op. 21 ist sein erstes Orchesterwerk auf Grundlage der Zwölftontechnik, in dem er eine völlig neuartige, von punktuellen Ereignissen und »nackten Tonlinien« geprägte Musik schuf. Von Pausen durchsetzt, trägt sie den sinfonischen Anspruch von Größe und Monumentalität nur noch als albtraumhafte Erinnerung in sich und sucht in ihren zwei Sätzen nach einer neuen Ausdrucksbalance. Auch Mozarts Bläserserenade fasziniert durch die vielschichtigen Abstufungen von Hintergrund und Vordergrund, die der Komponist zwischen den 13 Blasinstrumenten herstellt. Abgedunkelt durch den tiefen Klang von Hörnern, Bassetthörnern und Kontrafagott lässt Mozart aus pulsierenden Begleitfiguren unendlich sehnende Melodien erstehen. 8 1. KAMMERKONZERT E A N T ON W S Y MP H O BER N NIE OP. 21 »Die Wurzel ist eigentlich nichts anderes als der Stengel, der Stengel nichts anderes als das Blatt, das Blatt wiederum nichts anderes als die Blüte, Variationen desselben Gedankens.« Als Anton Webern 1929 von seinem Komponistenkollegen Alban Berg Goethes Farbenlehre zum Geschenk erhielt, dankte er ihm überschwänglich und voll Begeisterung. Denn Goethes Vorstellung, dass sich die Mannigfaltigkeit der blühenden Vegetation auf eine Urpflanze zurückführen ließe, traf sich mit Weberns kompositorischer Entwicklung: Seit der Symphonie op. 21, die er 1928 vollendete, legte er seinen Werken jeweils eine einzige Zwölftonreihe zugrunde, aus der das ganze Werke wie aus einem Keim oder einer Urpflanze hervorgeht. Seitdem Arnold Schönberg – dessen Schüler Anton Webern war – 1909 die Kraftfelder der tonalen Musik hinter sich gelassen hatte, waren die Komponisten in einen neuen Freiraum eingetreten, in dem Spannung und Entspannung, Melodie und Bewegung, Rhythmus und Form nicht mehr von der harmonischen Tonartenfolge bestimmt wurden. Ein wesentlicher »Dünger« war den Komponisten dadurch abhanden gekommen – beziehungsweise sie verzichteten im Sinne eines »organischen« Wachstums freiwillig darauf. Um 1923 entwickelte Schönberg seine Methode der »Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen«. Sie schenkte den Komponisten ein neues, nichttonikales Organisationsprinzip, das größere Formen wieder möglich machte. Webern übernahm diese Technik um 1924/25 und setzte sie in seinen Werken ab den Volkstexten und Liedern op. 17 – 19 ein. Die Grundlage einer Zwölftonkomposition ist die sogenannte Reihe: eine festgelegte Abfolge der zwölf Töne einer Oktave. Zur kompositorischen Verarbeitung dieser Reihe stehen dem Komponisten sämtliche Möglichkeiten des Kontrapunkts und der Variation zur Verfügung: Umkehrung, Krebs und Krebsumkehrung, zeitliche Stauchung oder Dehnung. Während Schönberg und Berg diese neue Methode tatsächlich wieder zur Gestaltung größerer Formen nutzten, darf man sich durch den Titel von Weberns Symphonie nicht über deren Umfang täuschen lassen. Ungefähr zehn Minuten dauert das zweisätzige Werk, das auch in der Besetzung keineswegs »sinfonisch« im Sinne des 19. Jahrhunderts ist. Webern schrieb es für Klarinette und Bassklarinette, zwei Hörner, Harfe und Streichquartett. In seiner Verwendung der Zwölftontechnik ist Webern radikaler als seine Kollegen. Ab der Symphonie op. 21, so Adorno, »wird […] nicht mehr mit Zwölftonreihen […] komponiert, sondern diese sollen virtuell selber komponieren.« Die Komposition der Reihe selbst ist also bereits der zentrale Akt: die genetische Züchtung der Urpflanze, aus der das Stück schließlich wächst. Diese neue Kompositionsweise, wie sie in der Symphonie op. 21 erstmals sichtbar wird, ließ Webern zu einem Vorbild für eine spätere Komponistengeneration werden. »Zum wesentlichen und allein wichtigen Teil ist Weberns Musik hart und dünn, klar und genau, sensibel im Ausdruck und von minuziöser Bestimmtheit der Form«, schreibt Herbert Eimert, ein Wegbereiter der Nachkriegsavantgarde, »kein Destillat aus verflüchtigten Espressi- BALANCE 9 vodünsten, sondern weit eher vergleichbar der Feinheit und spielenden Stärke von beweglichen Drahtplastiken – […] ein Wunder der Subtilität und der strengen Formphantasie, die sich nicht am Dämon oder Frohgefühl des Inhalts berauscht, sondern die Form […] aus dem Unhörbaren struktureller Maßbezüge heraufholt.« Die konstruktiven Wunder von Weberns Symphonie offenbaren sich rasch dem Blick in die Partitur: Aus der Tonfolge F-As-G-Fis-B-A /Es-E-C-Cis-D-H ist alles abgeleitet. Die Tonreihe ist bereits in sich symmetrisch: die zweite Hälfte der Reihe ist der Krebs der ersten (also eine horizontale Spiegelung derselben). Solche Symmetrie prägt den gesamten ersten Satz, der von horizontalen und vertikalen Spiegelungen durchdrungen ist und in dem jeder Vorschlagsnote und jedem Flageoletton strukturelle Bedeutung zukommt. Die historischen Bauformen des Sonatenhauptsatzes, wie Webern sie in seine Konstruktion aufgenommen hat, erschließen sich allein dem Studium des Notentextes. Für das Ohr spinnt sich ein feines Netz aus nackten Tonlinien und getupften Punkten. Eine motivische »Fanfare« des Horns markiert einen deutlichen Ankerpunkt für den Hörer, der das Gefühl hat, einem Zerfallsprozess beizuwohnen, der am Ende in einen irrealen Raum mündet, wo der Ton bereits an das Geräusch rührt. Der zweite Satz ist eine Folge von sieben Variationen. Zu Beginn wird die Tonreihe »exponiert«. Auch die sieben Variationen sind äußerst symmetrisch gestaltet. Die IV. Variation schließlich ist der »Kristallisationspunkt aller Spiegelbeziehungen« und Webern unterstreicht, »von da aus geht alles wieder zurück. […] Was Sie hier sehen […] ist nicht in dem Sinne zu nehmen, dass es ›Kunststückerln‹ sind – das wäre lächerlich! – Möglichst viele Zusammenhänge sollen geschaffen werden […]!« Zusammenhänge, die ein »denkendes Beschauen« verlangen, wie Goethe es in seiner Italienischen Reise schildert: »Es ist erfreuend und belehrend, unter einer Vegetation umherzugehen, die uns fremd ist. Bei gewohnten Pflanzen sowie bei andern längst bekannten Gegenständen denken wir zuletzt gar nichts, und was ist Beschauen ohne Denken?« WOL F BL Ä T S MOZ ARTITA« U E D A M AR GR A N P GA NG A EN A DE SER SER B- D U R » In seiner Untersuchung über das Verhältnis von Konstruktion und Ausdruck in den Werken Anton Weberns gelangt Reinhard Schulz zu dem Schluss, dass Webern seine »formal innerliche Folgerichtigkeit« durch »Abkehr von jeglicher Äußerlichkeit und letztendlich auch Veräußerbarkeit« bezahlte. »In diesem Sinne spiegelt Webern die Tragik des bürgerlichen Künstlers am weitestgehenden konsequent wieder.« Das Schaffen von Wolfgang Amadeus Mozart steht am Wendepunkt zu jener Epoche, die als bürgerliche bezeichnet wird – und ist doch ohne die aristokratische Schau- und Hörlust nicht zu denken. So ist auch das Genre der sogenannten »Harmoniemusik« ursprünglich aristokratischer Feierlaune entsprungen. Harmonien nannte man Bläsergruppierungen, die aufgrund des geringeren Aufwands, höherer Mobilität und – gerade bei Freiluftveranstal- 10 1. K AMMERKONZERT tungen vonnöten – größerer Lautstärke zunächst vorwiegend an kleineren Höfen vorhanden waren. »Das Repertoire deutet«, wie Alfred Einstein schreibt, »bereits im Namen weniger auf die Auseinandersetzung mit kompositorischen Strukturen als vielmehr – musikalisch – auf den homogenen (harmonischen) Zusammenklang und, im wörtlichen Sinne, auf die harmonia der Aufnehmenden.« Als Kaiser Joseph II. 1782 ein Bläseroktett an seinem Hof einführte, war eine wahre Harmonie-Mode an den Wiener Adelspalais die Folge. Schon in der Besetzung geht Mozarts Bläserserenade in B-Dur KV 361 über das »Normmaß« der fürstlichen Harmoniemusik hinaus: Zwei Oboen und zwei Klarinetten werden durch zwei Bassetthörner in der Tiefe verstärkt (ein Instrument der Klarinettenfamilie mit zartem, dunkel eingefärbten Klang, den Mozart sehr schätzte und den er hier erstmals verwendet), die Hörner werden auf vier erweitert, zu den zwei Fagotten tritt ein Kontrabass oder – in der heutigen Aufführung – ein Kontrafagott hinzu. Der Klangraum dieses Blasorchesters scheint einer Sinfonie stellenweise näher zu stehen als Weberns ausgedünntes »Orchester«. Und auch der zeitliche Umfang von beinahe fünfzig Minuten dieser »großen blasenden Musik von ganz besonderer Art« als die sie bei ihrer Uraufführung angekündigt war, sprengt den Rahmen einer kleinen »Gartenmusik«. Vollends überschreitet die Musik, die Mozart für diese einmalige Besetzung geschrieben hat, die Dimensionen einer plätschernden Klangtapete. Was Webern sich für seine Symphonie wünschte, gestaltete auch Mozart: »möglichst viele Zusammenhänge«. Sei es in der ebenfalls symmetrischen Anlage, im beständigen Wechsel von Soli und Tutti, in der »fortdauernden Festlichkeit neuer Kombinationen, [und] ›Verschränkung‹ aller Klanglichkeiten«, die Einstein beschrieben hat: »kein Instrument ist eigentlich konzertant geführt, aber jedes kann sich, will sich auszeichnen; und jedes wahrt seinen Charakter, so wie in einem Buffofinale Mozarts jede Person ihren Charakter wahrt – die Oboe ihre Kantabilität, das Fagott neben seiner Kantabilität auch – in schnatternden Triolen – seine Komik. Die beiden Hörnerpaare liefern die Grundierung des Klangs.« Zu den magischen Momenten dieser »großen Partita« zählt der dritte Satz, ein Adagio, das der Mozartforscher Einstein als »eine Romeoszene unter Sternenhimmel« erlebt, »in der sich dem klopfenden Herzen des Liebenden Sehnsucht […] wie ein Hauch« entringt. Das klopfende Herz schiebt sich in den walzenden Begleitfiguren heran. »Darüber aber schwebt«, so Hermann Abert, »ein Gesang von unbeschreiblicher Tiefe der Empfindung und von zauberhafter Klangschönheit, aus Sehnsucht, holder Schwärmerei und zarter Wehmut zusammengewoben«. Wie Mozart sein Thema immer neu einfärbt, lässt von fern die Idee der Klangfarbenmelodie erahnen. Und wie jede der Stimmen in das Gesamtensemble integriert ist und doch ihre Eigenständigkeit wahrt, trifft sich mit dem Ideal Anton Weberns, wie er es einer Freundin nach Abschluss seiner Symphonie schrieb: »Ich verstehe unter ›Kunst‹ die Fähigkeit, einen Gedanken in die klarste, einfachste, das heißt, ›faßlichste‹ Form zu bringen … Und deswegen habe ich […] mich [nie] in einen Gegensatz zu den Meistern der Vergangenheit gestellt, sondern mich immer nur bemüht, es diesen gleich zu machen: das, was mir zu sagen gewährt ist, so klar als möglich darzustellen.« Mozart wie Webern ist es dadurch gelungen, den »Gesellschaftston« ihrer Zeit zu verlassen und zu uns herüber zu rufen. BALANCE 11