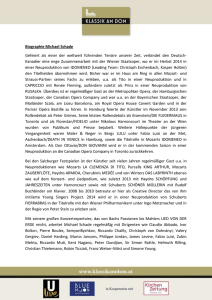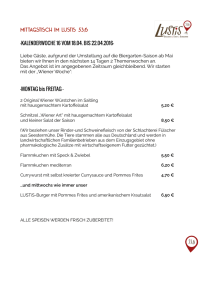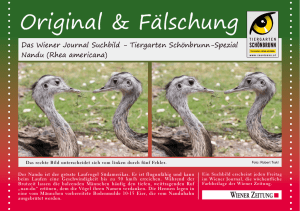Stretta Apr11 - Freunde der Wiener Staatsoper
Werbung

Stretta April 2011 Elı-na Garanča am 10. April in der Wiener Staatsoper © DG/Gabo In eigener Sache Liebe Opernfreunde! Unsere Staatsoper hat sich in den letzten Monaten wieder verstärkt um die Mozartpflege bemüht. Franz Welser-Möst hat uns im Gespräch zu Beginn seiner Tätigkeit als Generalmusikdirektor gesagt, wie wichtig ihm dieses Anliegen ist, hat aber auch betont, es werde Jahre dauern, eine Linie in die Mozartpflege zu bringen. Wohl zu Recht hat er darauf hingewiesen, dass diese aus der Mozartpflege in der Wiener Tradition entwickelt werden müsse, und vor kurzem hat er in einem Interview in den Salzburger Nachrichten darauf hingewiesen, dass es auch eine Tradition des Mozartspieles des Orchesters gibt; das könne man nicht zur Seite schieben, im Gegenteil, man müsse es pflegen und verfeinern. Karl Korinek © Achim Bieniek Die Figaro-Premiere, und noch mehr die 2.Vorstellung, waren musikalisch ein Schritt in die von Welser-Möst verfolgte Richtung. Eine aufmerksame Begleitung seiner Bemühungen und alle gute Wünsche für diese sind ihm sicher. In den nächsten Tagen erwarten wir den Belcanto-Höhepunkt der Saison, und die letzten beiden Monate werden im Zeichen zweier Werke von Leos Janacek stehen (darüber wird in den nächsten Ausgaben unserer Stretta näher berichtet werden), aber auch das sonstige Angebot ist in seiner Vielfalt und dem zu erwartenden Niveau höchst interessant. Ich glaube, wir können uns freuen, dass wir in unserer Oper ein breites Repertoire und wichtige Höhepunkte erleben können meint Ihr Karl Korinek (Präsident) INHALT 04/11 VERANSTALTUNGEN Matinee: Musical meets Opera II So. 8.5., 11.00 Uhr/ S. 19 Künstlergespräch: KS Agnes Baltsa Sa. 14.5., 11.00 Uhr/ S. 21 Veranstaltungen auf einen Blick/ S. 34 PORTRÄT Sophie Koch/ S. 22 Agnes Baltsa SCHWERPUNKT I. Anna Bolena Die historische Anne Boleyn (Manfred Draudt)/ S. 6 Auf den Schwingen des Erfolgs – Donizettis Durchbruch mit Anna Bolena (Odo Aberham)/ S. 9 Anna Bolena (Christian Springer)/ S. 12 Anna Bolena-Rezeption (Rainhard Wiesinger)/ S. 14 Diskographie (Richard Schmitz)/ S. 15 II. Ballett Tatort Bühne – Béjarts Tanz-Krimi in Wien (Verena Franke)/ S. 16 KOLUMNEN con brio/ S. 18 Misterioso/ S. 26 Chronik/ S. 33 SERVICETEIL Spielpläne/ S. 24 Radio, TV/ S. 28 Tipps/ S. 30 3 Forum/ Chronik Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Opernfreunde! Dominique Meyer © Wiener Staatsoper/ Michael Pöhn Publikumsgespräch mit Direktor Dominique Meyer und Thomas Platzer Sa. 16. April 2011 10.30 Uhr Marmorsaal In memoriam Claus Helmut Drese Claus Helmut Drese © Wiener Staatsoper/ Axel Zeininger 4 Fortsetzung S. 6 Von vielen lang erwartet, ist es nun soweit: Während ich diese Zeilen schreibe, finden auf der Eberhard Waechter-Probebühne die intensiven Vorbereitungen für unsere nächste Premiere – Gaetano Donizettis Anna Bolena – statt. Es ist ein spannendes Projekt! Zunächst, weil Anna Bolena ein wichtiger Markstein in der kompositorischen Entwicklung Donizettis war: Mit dieser Oper erreichte er eine neue Reife, schuf facettenreiche Charaktere, mit dieser Oper gelang ihm sein großer Durchbruch. Weiters handelt es sich um eine Erstaufführung im Haus am Ring, denn, so erstaunlich das auch klingen mag, dieses Belcanto-Juwel wurde bei uns noch niemals seit der Eröffnung des Hauses gegeben. Und ich freue mich ganz besonders, dass Anna Netrebko und Elina Garanca bei uns erstmals in einer Produktion gemeinsam auf der Bühne stehen! Ebenso glücklich bin ich über Ildebrando D’Arcangelo als Enrico VIII., über Elisabeth Kulman als Smeton, Francesco Meli als Percy, über unseren Hausdebütanten Eric Génovèse (Regie) und über Evelino Pidó, der mit dieser Produktion seine erste Premiere an der Wiener Staatsoper übernommen hat. Stolz dürfen wir auch sein, dass all das neben dem „normalen“ Repertoire-Alltag stattfinden kann. Denn abgesehen von Anna Bolena bieten wir im April einen kompletten Ring, Opern von Puccini, Strauss, Gounod, Mozart, Donizetti und Verdi, Kinderoper, Liedmatinee, Ballett ... Ihr Dominique Meyer Claus Helmut Drese wurde am 25. Dezember 1922 in Aachen geboren und studierte Germanistik, Geschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft in Köln, Bonn und Marburg/Lahn. Vor seiner Karriere als Regisseur war Drese zunächst als Dramaturg und Schauspieler tätig. Ab 1952 wirkte er für sieben Jahre als Chefdramaturg und Regisseur am Nationaltheater in Mannheim. Danach wurde er bis 1963 als Intendant nach Heidelberg verpflichtet und übernahm im Anschluss daran die Leitung des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. 1968 trat er sein Engagement als Generalintendant für Oper und Schauspiel in Köln an, 1975 das als Direktor der Zürcher Oper. In seine Zürcher Ära fallen u. a. ein äußerst erfolgreicher Monteverdi-Zyklus von Jean Pierre-Ponnelle und Nikolaus Harnoncourt sowie der von ihm realisierte Umbau des Opernhauses. Mit Saisonbeginn 1986 wurde Claus Helmut Drese vom damaligen österreichischen Unterrichtsminister Helmut Zilk zum Direktor der Wiener Staatsoper berufen. Claudio Abbado war bis zum Ende seiner Direktion 1991 der Musikdirektor an seiner Seite. Mit seinem Anspruch, „Ansätze zu einer neuen Ästhetik des Musiktheaters" zu bieten, ver- buchte Drese eine Reihe von Erfolgen. Neben aufsehenerregenden Projekten wie etwa Il viaggio a Reims fallen in seine Direktionszeit Produktionen, die sich bis heute im Repertoire der Wiener Staatsoper gehalten haben, wie beispielsweise L'Italiana in Algeri, Un ballo in maschera, Elektra, Don Carlo oder Wozzeck. Drese selbst inszenierte im Haus am Ring Glucks Iphigénie en Aulide und Mozarts La clemenza di Tito. Besondere Erwähnung verdienen auch die Premieren von Dvoraks Rusalka, Mussorgkys Chowantschina, Debussys Pélleas et Mélisande sowie von Franz Schrekers Fernem Klang, die auch zugleich die Erstaufführung des Stücks an der Staatsoper bedeutete. Die Förderung junger Talente war auch Drese ein zentrales Anliegen, was sich an der Errichtung eines Opernstudios zeigte. Claus Helmut Drese erhielt im April 1991 die Ehrenmitgliedschaft der Wiener Staatsoper und beendete seine Direktionszeit mit einer euphorisch akklamierten Otello-Vorstellung mit Plácido Domingo in der Titelpartie. In Wien trat Drese letztmals im September 2008 anlässlich einer Lesung aus seinem Buch „Erlesene Jahre“ öffentlich in Erscheinung. rw Liebe Freunde, KS PLÁCIDO DOMINGO im Gespräch mit Thomas Dänemark Palmsonntag, 17. April 15.00 Uhr Der Opernsalon. Von Opernfreunden für Opernfreunde. Aus dem Veranstaltungsprogramm der Freunde der Wiener Staatsoper präsentieren wir ab sofort einmal im Monat Highlights und Gespräche mit Legenden und Lieblingen des Wiener Opernpublikums. Der Opernsalon auf Radio Stephansdom. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15.00 Uhr. Klassik verpflichtet. www.radiostephansdom.at Die historische Anne Boleyn Anne Boleyn Zweite der sechs Ehefrauen von Henry VIII. und Mutter von Elizabeth I. Heinrich VIII. Gemälde von Hans Holbein d. J. Mary Boleyn, Annes ältere Schwester 6 Während in Donizettis Oper der letzte Akt von Anne Boleyns Leben im Zentrum steht, ist für das Verständnis der historischen Figur die Vorgeschichte von wesentlicher Bedeutung. Schon die allererste Ehe von Henry VIII. war außerhalb der Norm: Nach dem Tod seines 15-jährigen Bruders Arthur - nach nur wenigen Wochen Ehe - heiratet er dessen 17-jährige Witwe Catherine of Aragon (Katharina von Aragonien, die Tante Kaiser Karls V.) – allerdings erst nachdem Catherine versichert hatte, dass die Ehe nie vollzogen worden war und der Papst wegen des biblischen Eheverbots mit einer Schwägerin seine Dispens erteilt hatte. Catherine gebar ihm Mary, die später als Königin mit dem wenig schmeichelhaften Beinamen „bloody“ bedacht wurde, weil sie im Zuge der Gegenreformation hunderte Protestanten verbrennen ließ. Weitere Töchter und Söhne aus dieser Ehe starben bei oder unmittelbar nach der Geburt, wodurch das englische Erbfolgeproblem akut wurde. Kompliziert wurde die Situation weiters durch Henrys Zerwürfnis mit Karl V., der eine Aufhebung der ursprünglichen Dispens durch den Papst und somit eine Trennung von Catherine verhinderte, sowie durch das Entflammen des Königs für Catherines Hofdame Anne Boleyn. Anne, deren Vater Diplomat war – der Name Boleyn wurde ‚Bullen’ ausgesprochen und auch öfters so geschrieben war gemeinsam mit ihrer Schwester Mary blutjunge Zofe bei Erzherzogin Margarete von Österreich (der Tochter Maximilians I.) in den Niederlanden gewesen. Anschließend, am französischen Hof, prägten französische Etikette, Kultur, Philosophie und Mode ihre Erziehung. Obwohl sich die Zeitgenossen bezüglich ihrer Attraktivität, auch wegen ihres dunklen Teints, nicht ganz einig waren, bezauberte sie jeden, der ihr begegnete. 1522 nach England zurückgerufen, sollte sie ur- sprünglich ihren irischen Cousin heiraten; aber nach ihrem Debüt bei Hofe, wo sie in einem Maskenspiel als vollendete Tänzerin gemeinsam mit der Schwester des Königs auftrat, wurde sie bald wegen ihrer geistreichen und schlagfertigen Konversation, wegen ihrer Eleganz und ihren vielseitigen Begabungen auch in Musik und Gesang von zahlreichen jungen Männern umworben. Mit Henry Percy, dem Sohn des Earls von Northumberland – in der Oper einfach ‚Lord Percy’ -, war sie kurzzeitig heimlich verlobt, und auch der verheiratete Dichter-Diplomat Sir Thomas Wyatt war ihr verfallen. In einem Sonnet auf sie nimmt er resignierend Bezug auf den Vorrang des Königs: „noli me tangere - for Caesar’s I am [- denn ich gehöre Caesar]“. Annes ältere Schwester Mary war unmittelbar nach ihrer Hochzeit des Königs Mätresse geworden und hatte möglicherweise auch ein oder zwei Kinder von ihm, die Henry allerdings nie anerkannte. Nach Beendigung dieser Affäre verliebte sich der König 1526 schließlich in Anne, die sich allerdings äußerst selbstbewusst weigerte, in die Fußstapfen ihrer Schwester zu treten. Ihre standhafte Verweigerung über etliche Jahre hinweg fachte jedoch des Königs Leidenschaft nur umso mehr an, wovon 17 schmachtende Liebesbriefe Henrys beredtes Zeugnis ablegen (Dass er für sie das Lied Greensleeves komponiert haben soll, ist aber bloße Legende). Ehrgeizig, berechnend oder vielleicht bloß auf ihre Absicherung bedacht, hatte Anne (möglicherweise auch ihr Vater) stets die letztendliche Legitimierung ihrer Beziehung im Auge, was Henry nötigte, die Annullierung seiner Ehe zu betreiben. Doch obwohl er einen Gewissensgrund vorschob, das erwähnte biblische Verbot einer Ehe mit einer Schwägerin, weigerten sich sowohl Catherine als auch der Papst, eine Annullierung ins Auge zu fassen. Manfred Draudt Anne Boleyn Katharina von Aragón als junges Mädchen, Gemälde von Michel Sittow Das Signal Kaiser Karls V., dass eine Trennung von Catherine zumindest kein Kriegsgrund sein würde, ermutigte den König, Anne bei Hofe als de facto Ehefrau und Königin zu behandeln. 1531 musste Catherine den Hof verlassen, und Anne bezog ihre Räume. Ein Jahr später begleitete Anne - offenbar im Hinblick auf die bevorstehende Eheschließung zur Marchioness of Pembroke erhoben - den König sogar zu einem Treffen mit Franz I. nach Calais, wodurch sie offiziell auch von Frankreich anerkannt wurde. Spätestens danach wird sie Henrys Werben endlich nachgegeben haben, denn er heiratete die offensichtlich schwangere Anne im Jänner 1533. Weil der König aber noch immer verheiratet war, musste die Trauung geheim stattfinden. Durch ihre Schwangerschaft und in - falscher Erwartung eines männlichen Thronfolgers war der König zum raschen Handeln gezwungen, um den Nachkommen zu legitimieren. Er machte den Familienkaplan der Boleyns, Thomas Cranmer, zum neuen Erzbischof von Canterbury, und dieser erklärte - entgegen der Weisung des Papstes - im Mai zuerst die Ehe mit Catherine für ungültig und anschließend jene mit Anne für gültig, womit der Bruch mit Rom unumkehrbar wurde. Nach der päpstlichen Banndrohung folgte schließlich die endgültige Exkommunikation von Henry VIII., der sich daraufhin durch die Suprematsakte von 1534 zum Oberhaupt der anglikanischen Kirche machte. Nachdem Catherine der Titel ‚Queen’ aberkannt wurde, wurde im Juni 1533 Anne in einer grandiosen Zeremonie mit anschließendem Festbankett gekrönt. Im September kam Elizabeth auf die Welt, die später die größte Monarchin Englands werden sollte; doch Henry war so schwer enttäuscht, wieder keinen männlichen Thronfolger bekommen zu haben, dass er das zur Taufe geplante Turnier absagte. Die 17-jährige Prinzessin Mary, nun zum Bastard erklärt, weigerte sich, Anne, die sie als ‚Mätresse des Königs’ (‚my father’s mistress’) bezeichnete, als Königin an- zuerkennen. Anne, die sich durch eine verschwenderische Hofhaltung hervortat und die Zahl ihrer persönlichen Bedienten auf 250 aufblähte, machte sich auch sonst wenig Freunde bei Hof. Ihre Widersacher, der Kanzler Thomas More (Morus) und der Bischof von Rochester wurden hingerichtet, weil sie die Ehe nicht anerkannt hatten; aber auch der König selbst begann sie mit der Zeit mit anderen Augen zu sehen, denn ihre scharfe Intelligenz und Schlagfertigkeit, Eigenschaften die er an der Geliebten geschätzt hatte, waren bei der Königin nun nicht mehr gefragt. Ein weiterer Grund für die zunehmende Entfremdung war zumindest eine Fehlgeburt (1534) und die Frustration, noch immer keinen männlichen Erben zu haben. Doch solange Catherine of Aragon, seine erste Frau, am Leben war, war Anne, seine zweite, sicher, auch wenn Henry bereits mit der Hofdame Jane Seymour die nächste Gattin ins Auge gefasst hatte, denn die erste Ehe sollte keinesfalls wieder Gültigkeit erlangen. 1536 spitzten sich die Ereignisse dramatisch zu: Catherine starb, und Anne hatte, möglicherweise wegen des Schocks, weil Henry bei einem Turnier schwer gestürzt und stundenlang bewusstlos war, eine weitere Fehlgeburt. Bald danach erklärte Henry, er sei von Anne getäuscht und verhext worden und übersiedelte Jane Seymour Giovanna in der Oper - in Annes Gemächer. Da eine Annullierung dieser zweiten Ehe nicht möglich war und seinen Ruf ruiniert hätte, war eine andere Strategie von Nöten, um Anne loszuwerden, und zwar durch eine Anklage, auf die ein sicheres Todesurteil stand. Möglicherweise hatte Annes früherer Unterstützer und späterer politischer Widersacher, der Schatzkanzler Thomas Cromwell, ihren Sturz geplant, vielleicht war er aber auch nur ausführendes Instrument des Königs. Jedenfalls sollte sein Sohn später Elizabeth Seymour, die Schwester der nächsten Königin, heiraten; Cromwell selbst aber ereilte nur 4 Jahre Fortsetzung S. 8 7 Manfred Draudt Jane Seymour, Gemälde von Hans Holbein d. J 8 später nach einem politischen Desaster, für das er die Verantwortung trug, dasselbe Schicksal wie Anne Boleyn. Zuerst wurde ein gut aussehender flämischer Musiker und Sänger in ihren Diensten, Mark Smeaton – in der Oper Smeton – verhaftet. Nach anfänglichem Bestreiten gestand er schließlich unter Folter, Annes Geliebter zu sein (ein Detail, das bei Donizetti in veränderter Form wiederkehrt). In der Folge wurden fünf weitere Höflinge, darunter auch Wyatt, wegen sexueller Beziehungen zu ihr angeklagt, am Ende sogar ihr enger Vertrauter, ihr Bruder George – Lord Rochefort in der Oper –, wegen Inzests mit ihr. Schließlich wurde auch Anne selbst in den Tower gebracht und des mehrfachen Ehebruchs angeklagt, zudem wegen Inzests und Hochverrats, weil sie geplant hätte, den König umzubringen. Ihre Verhaftung als Unschuldige und der offensichtlich vom König gesteuerte Prozess, in dem sogar ihre Schwägerin, Lady Rocheford, falsch gegen sie aussagte,1 bewirkten einen plötzlichen Umschwung in der öffentlichen Meinung. Von nun an schlug ihr Sympathie entgegen, die sich nach dem Tod Henrys und der Gegenreform von Mary I. so weit steigerte, dass sie schließlich zur Märtyrerin des Protestantismus erhoben wurde. Nachdem Annes Ehe von Erzbischof Cranmer für ungültig und auch Prinzessin Elizabeth zum Bastard erklärt wurden, wurde sie selbst, zwei Tage nach ihrem Bruder, nach Mark Smeaton und drei weiteren der Verurteilten, am 19. Mai hingerichtet. An Stelle der für diese Vergehen vorgesehenen Verbrennung ließ der König einen besonders geschickten Scharfrichter aus Calais kommen, der sie im französischen Stil, aufrecht kniend, mit dem Schwert hinrichtete (nicht mit der Axt am Block) – eine tragische Reminiszenz ihrer Liebe zu Frankreich. In ihrer Abschiedsrede auf dem Schafott, in der Verurteilte üblicherweise die Wahrheit sagten, bekannte sie sich in keiner Weise für schuldig, vermied es aber gleichzeitig, den König anzuschuldigen, wohl um ihre Tochter Elizabeth und ihre Dienerschaft nicht in Gefahr zu bringen. Zehn Tage nach der Enthauptung von Anne heiratete Henry in Wiederholung seines früheren Verhaltensmusters ihre Hofdame Jane Seymour. Sie gebar ihm 1537 den heiß ersehnten Erben, Edward VI., der jedoch nur 6 Jahre regieren sollte, da er 16-jährig verstarb; Jane selbst starb kurz nach seiner Geburt. Um eine protestantische Allianz zu schmieden, verehelichte sich Henry 1540, auf Rat Cromwells und ohne die Braut je vorher gesehen zu haben, mit der Schwester des Herzogs von Jülich-Kleve-Berg, Anna, vollzog aber mit ihr nie die Ehe, sondern annullierte diese ein halbes Jahr später, weil er die neue Gattin gänzlich reizlos fand. Noch im selben Jahr heiratete er Anne Boleyns Cousine, die Hofdame Catherine Howard, die nach nur zwei Jahren das-selbe Schicksal wie ihre glücklose Verwandte erlitt – diesmal allerdings zu Recht, da sie den König tatsächlich mehrfach betrogen hatte. Henrys sechste Ehefrau (1543-47), die zweifache Witwe Catherine Parr, die ihn wieder mit seinen Töchtern Mary und Elizabeth versöhnte, überlebte ihn nur um ein Jahr - in dem sie allerdings mit ihrer eigenen vierten Eheschließung Henrys sechs Ehen recht nahe kam. 1 Bevor Lady Rocheford 6 Jahre später selbst hingerichtet wurde, gestand sie, ihren Bruder fälschlich des Inzests mit Anne Boleyn beschuldigt zu haben; dafür verdiene sie den Tod. Prof. Dr. Manfred Draudt Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien Auf den Schwingen des Erfolgs – Donizettis Durchbruch mit Anna Bolena D Gaëtano Donizetti, Lithographie von Joseph Kriehuber, 1842 onizetti beschrieb im Jahr 1843 in einem Brief an seinen Jugendlehrer und Mentor Giovanni Simone Mayr, den Anfang seine Daseins: „Meine Geburt war mehr versteckt, da ich unter der Erde in Borgo Canale geboren wurde. Man musste über eine Kellertreppe hinuntersteigen, wohin niemals ein Lichtschein drang. – Und wie eine Eule begann ich meinen Flug, mit mir bald traurige, bald glückliche Erwartungen nehmend“. Das Geburtshaus steht in einem Vorort des historischen Zentrums der Stadt Bergamo und ist heute als Museum zu besichtigen. In einem ähnlich gleichnishaften Bild wollen wir auch Donizettis Erfolgsgeschichte betrachten. Im gängigen Katalog der musikdramatischen Werke steht Anna Bolena an 35. Stelle in Donizettis Schaffen, in der revidierten Aufstellung von Dr. Thomas Lindner (herausgegeben von den DonizettiFreunden in Wien), die die Studienwerke sowie die unvollendeten Opern ausklammert, ist es jedoch erst das 29. Opus. In jedem Fall ist das eine erstaunliche Anzahl, wenn man bedenkt, dass der Komponist erst 33 Jahre alt war. Bis dahin war er auf Grund einiger größerer Erfolge, vor allem in Neapel, bereits zu Ansehen gelangt – der internationale Durchbruch war ihm jedoch noch nicht gelungen. Eine Gruppe vermögender Adeliger und Kunstfreunde in Mailand plante für das Jahr 1830 eine glanzvolle Karnevalsstagione am relativ kleinen CarcanoTheater als bewusste Konkurrenz zu La Scala. Die berühmtesten Komponisten wurden dafür verpflichtet, und da sich Rossini bereits vom Opernschaffen zurückgezogen hatte, waren dies Vincenzo Bellini und Gaetano Donizetti. Der mehrjährige Vertrag des Letzteren mit dem Impresario Domenico Barbaja lief im Sommer 1830 ab. Eine neue Vereinbarung sah vor, dass er in Mailand eine Opera seria zur Saisoneröffnung, die traditionell am 26. Dezember stattfand, aufführen sollte. Das Buch zur neuen Oper sollte Felice Romani verfassen, der schon mehrere Erfolgsstücke geschrieben hatte. Für Donizetti hatte er bis dahin erst wenig getan: Wenn man von einer nicht sicher zu beweisenden Zusammenarbeit bei der studentischen Komposition mit dem Titel L’ira d’Achille (Der Zorn des Achill) absieht, waren es bis dato lediglich zwei Textbücher: Chiara e Serafina (Mailand 1822) und Alina, regina di Golconda (Genua 1828) – beiden war kein Erfolg beschieden. Romani stammte aus Genua, war dort 1788 geboren worden, studierte zunächst Rechtswissenschaften, später mit wesentlich mehr Impetus Literatur. Danach unternahm er ausgedehnte Reisen durch mehrere europäische Länder und lernte deren Kultur kennen. Er ließ sich in Mailand nieder, wurde Literaturkritiker und schließlich Hauslibrettist am Teatro alla Scala. Er war mit Mayr befreundet, der ihn zur Abfassung erster Textbücher heranzog. Im Endeffekt verfasste er an die hundert Libretti, die qualitativ über die häufig mediokren Texte seiner zeitgenössischen Kollegen hinausgingen. Romani wurde der angesehenste Opernautor der Epoche zwischen dem zweiten und fünften Jahrzehnt des italienischen Ottocento. Zusammen mit Donizetti schuf er Spitzenwerke wie L’elisir d’amore, Parisina d’Este und Lucrezia Borgia. Romani starb als berühmter Mann 1865 im Badeort Moneglia an der ligurischen Küste. Bei aller Fähigkeit, gute Operntexte zu schreiben, haftete Romani der Makel an, seinen Verpflichtungen oft nicht pünktlich nachzukommen. Bei Anna Bolena lag die Situation jedoch anders der Dichter war vom Stoff, der auf mehreren Stücken über Heinrich VIII. und dessen zweite Ehefrau, nicht jedoch auf Shakespeares Drama King Henry VIII., das eine andere Episode aus dem Leben der Königin zum Inhalt hat, fußte, so fasziniert, dass er rasch und ohne größere Unterbrechungen den Text schrieb und ihn nur mit geringfügiger Verspätung ablieferte. Fortsetzung S. 10 9 Auf den Schwingen des Erfolgs – Donizettis Durchbruch mit Anna Bolena Felice Romani Es wurde eines seiner anerkannt besten Libretti, an dem vor allem der strukturierte Handlungsablauf und die geschickte Steigerung der Dramatik hervorzuheben sind. Donizetti hatte trotzdem nur einen Monat Zeit für die Kreation seiner großen, dreistündigen tragischen Oper. Das grandiose Ergebnis, das in seinem vollen Umfang heute im internationalen Opernbetrieb wieder eine starke Wirkung auf das Publikum ausübt, beweist Donizettis entwickeltes Gespür für Theaterdramatik und bereits gekonnte belcanteske Ausdrucksformung, die seine späten Werke so unvergleichlich auszeichnen. Oftmals wird behauptet, dass er in der Anna Bolena erstmals künstlerisch zu sich selbst gefunden und mit diesem Werk eine radikale Zäsur in seinem Ouvre gesetzt habe. Nach heutiger Analyse ist diese Annahme zu oberflächlich, da sie eine gar nicht vorhandene strikte Zweiteilung seines Bühnenschaffens in eine Epoche unwesentlicher Jugendwerke und eine solche genialer Meisterwerke zu Gunde legt. In der Gestaltung der Anna Bolena treffen vielmehr erstmals bereits ausgereifte traditionelle Fähigkeiten auf den unbändigen Willen Donizettis, neue kompositorische Wege im Dienste des Dramas und seiner Charaktere einzuschlagen. Für den Schaffensakt zog er sich an den Comer See in die Villa der Sopranistin Giuditta Pasta zurück, weshalb ihm bis heute ein amouröses Verhältnis zu der Sängerin nachgesagt wird, das freilich nicht belegt ist. Die Pasta war ein führender Star unter den Interpretinnen ihrer Zeit. Ihre zweieinhalb Oktaven umfassende, wohlklingende und nuancenreiche Stimme begeisterte das Publikum und begründete ihren Ruf als italienische Primadonna assoluta, wobei sie in Giulia Grisi und Maria Malibran durchaus ebenbürtige Konkurrentinnen hatte. Sie wurde 1797 in Saranno bei Mailand, wo ihre Stimme ausgebildet wurde, geboren. Während ihrer relativ kurzen Karriere war sie nicht nur die erste Anna Bolena, sondern kreierte ein Jahr danach auch Bellinis Norma bei deren Ur- 10 aufführung. Nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn zog sie sich in ihre Villa im norditalienischen Seengebiet zurück, wo sie 1865 verstarb. Nach der Fertigstellung der Anna BolenaPartitur verblieben für die abschließenden Arbeiten, die Einstudierung und die Proben noch gut zwei Wochen, eine für heutige Verhältnisse unmachbar kurze Frist. Aber pünktlich am 26. Dezember 1830 hob sich der Vorhang und die allererste Aufführung ging unter der Stabführung des Komponisten, wie das zu dieser Zeit gefordert war, über die Bühne. Ebenso war es üblich, dass der Librettist für die Inszenierung verantwortlich zeichnete, was aber nicht als Regie im heutigen Sinne zu verstehen ist, sondern sich weitestgehend auf das optische Surrounding auf der Bühne beschränkte – das Musikwerk und seine Wiedergabe standen wesentlich mehr im Vordergrund. Die Uraufführung bescherte dem Komponisten einen grandiosen Triumph. Anna Bolena wurde für Donizetti im gleichen Maße der Durchbruchserfolg, wie etwa Tancredi für Rossini (1813) oder Nabucco für Verdi (1842). Er wurde mit einem Schlag zum beliebtesten und gefragtesten Opernkomponisten neben Bellini. Diesem war die zweite Premiere am Teatro Caracano zugedacht worden, ebenfalls eine Oper mit einem Textbuch von Romani. Dafür wählten sie als Vorlage ein Drama von Victor Hugo, das Opus sollte den Titel Ernani tragen. Die habsburgische Zensur in Norditalien beeinspruchte das Stück jedoch schon vorweg und Romani war zu den geforderten Abänderungen nicht bereit, sondern wandte sich lieber willig einem neuen Libretto mit einer romantischen Liebes- und Eifersuchtsgeschichte im ländlichen Milieu zu – am 6. März 1831 fand die Erstaufführung von La sonnambula statt. Neben Giuditta Pasta als Anna Bolena waren die weiteren Hauptrollen ebenso mit Trägern klangvoller Namen besetzt: Odo Aberham Im Teatro Carcano in Mailand fand am 26. Dezember 1830 die Uraufführung der “Anna Bolena” statt Im deutschen Sprachraum ging das Werk zum ersten Mal am 26. Februar 1833 am k. k. Hoftheater in Wien über die Bühne. Elisa Orlandi war Giovanna Seymour, Enrichetta Laroche der Page Smeton, Filippo Galli der englische König Heinrich VIII. und ein weiterer Superstar ragte aus dem Ensemble hervor: Giovanni Battista Rubini als Lord Percy. Am Beginn des 19. Jahrhunderts verschwanden in Italien recht rasch die Kastratensänger von den Bühnen. Ein neuer tenoraler Gesangsstil begann sie zu beherrschen und wurde in kurzer Zeit äußerst populär. Rubini, 1795 in der Kleinstadt Romana di Lombardia geboren, prägte diesen Stil entscheidend. Er begann seine Laufbahn in Bergamo, später wurde er von Barbaja nach Mailand und Neapel engagiert. Im Ausland trat er vor allem in Wien, Paris und London auf. Nach einer Konzertreise zusammen mit Franz Liszt sang er mit großem Erfolg in St. Petersburg, wo er von Zar Nikolaus I. ausgezeichnet wurde. Er musste Russland jedoch wegen des Klimas, das seiner Stimme schadete, bald wieder verlassen. In seiner Heimat wurde er mit dem Herzogstitel geadelt und ließ sich in seiner Geburtsstadt ein Schloss errichten, in dem sich heute eine ihm gewidmete Gedenkstätte befindet. Rubini war zu seiner Zeit so berühmt wie später Caruso. Sein enormer Tonumfang, seine mit Leichtigkeit gesungenen Töne in höchsten Registern waren legendär. Die Opernschaffenden schrieben für ihn Notierungen, deren Intonation heute schwer zu erfüllende Anforderungen stellt. Bei all dem müssen wir berück- sichtigen, dass zu seiner Zeit das Singen mit reinem Brustton noch nicht gängig war, sondern die Tenöre sich einer Mischtechnik aus pektoraler Resonanz und im Kopf gesungenen Falsetts bedienten. Donizetti selbst berichtete in einem Brief an seine in Rom weilende Gattin Virginia – übrigens dem einzigen erhaltenen Schreiben an sie – vom glückhaften Erfolg der Anna Bolena: „Erfolg, Triumph, Delirium; es schien dass das Publikum verrückt wurde. Alle sagen, dass sie sich nicht erinnern, jemals bei solch einem Triumph dabei gewesen zu sein.“ und weiter: „Stell dir vor, ich war so glücklich, dass ich zu weinen begann!“ Dieser Brief zeigt außer dem Glücksgefühl des Komponisten über seinen großen Erfolg in der weiteren Folge auch dessen tief empfundene Liebe zu seiner Ehefrau, die 1837 im jungen Alter von nur 29 Jahren starb, was ihn in eine tiefe Lebenskrise stürzen sollte. Tatsächlich geriet das Premierenpublikum außer Rand und Band, Komponist und Textdichter wurden bejubelt und gefeiert. Dabei ist anzumerken, dass zweifelsfrei die überragenden sängerischen Leistungen, von denen jeder Erfolg eines neuen Werks abhängig war, ihren Teil dazu beigetragen haben. Die Kritiken in den Zeitungen stimmten nicht ganz so euphorisch in den Jubel ein. Zwar bescheinigten sie dem Werk vor allem im zweiten Akt eine intuitive, dramatisch erfüllte und melodisch schöne Musik, jedoch bemängelten sie die Gesamtlänge der Oper, die ungewöhnlich groß dimensionierten weiblichen Hauptpartien und die dementsprechend eingeschränkt geratenen männlichen Rollen. Nicht alle erkannten sofort richtig, dass mit dieser Anna Bolena ein neuer Abschnitt in Donizettis Schaffen einsetzte, in dem sich der Komponist von allen Vorbildern befreite und zu seiner individuellen und unverwechselbaren Kunst zu finden begann. Selbst Mayr würdigte seinen Schüler ab diesem Zeitpunkt mit dem Titel „Maestro“. Anna Bolena verbreitete sich in Windeseile über die Theater der Apenninenhalbinsel und über deren Grenzen hinaus bis nach Übersee. Reflektierend auf das eingangs erwähnte Briefzitat mit dem Eulenflug trug diese Oper Donizettis Genie und Erfolg gleichsam auf Schwingen in die ganze Welt hinaus. Odo Aberham ist Vorstand der DonizettiFreunde in Wien 11 Anna Bolena A Giuditta Pasta, Lithographie von Josef Kriehuber, 1829 Giovanni Battista Rubini, Lithographie von Josef Kriehuber, 1828 ls Gaetano Donizettis Tragedia lirica Anna Bolena am 26. Dezember 1830 zur Eröffnung der Karnevalsspielzeit am Teatro Carcano in Mailand uraufgeführt wurde, handelte es sich nicht um die erste Beschäftigung des 33jährigen Komponisten mit der Geschichte der Tudors. Er hatte sich bereits ein Jahr zuvor mit der Figur der Königin Elizabeth I. auseinandergesetzt, in dem Melodramma serio Elisabetta al castello di Kenilworth (UA Neapel, 1829). Fünf Jahre später sollte die Tragedia lirica Maria Stuarda (UA Teatro alla Scala, 1835) folgen, weitere zwei Jahre danach die Seria Roberto Devereux (UA Neapel, 1837). In beiden stand Elizabeth I. im Zentrum des Geschehens. Der Zusammenhang der drei Opern wurde deutlich, als Beverly Sills in den 1970er Jahren in allen Werken von Donizettis „Tudor-Trilogie“ an der New York City Opera auftrat. Das Interesse von Autoren des Prosatheaters und der Oper für englische Stoffe war im 19. Jahrhundert groß. Italienische Dichter wie Alessandro Ercole Graf Pepoli beschäftigten sich mit der zweiten Frau Heinrichs VIII. (Anna Bolena, 1788). Sein Werk diente dem Librettisten Felice Romani ebenso als Vorlage für die Oper wie das Bühnenstück Henri VIII (1791) von Marie-Joseph de Chénier, dem Bruder von André Chénier, das Ippolito Pindemonte 1816 ins Italienische übersetzte. 1884 verfaßten die deutschen Schriftstellerinnen Carmen Sylva und Mite Kremnitz gemeinsam das historische Trauerspiel Anna Boleyn. 1947 brachte der Pulitzer-Preisträger Maxwell Anderson das Theaterstück Anne of the Thousand Days auf die Bühne. Schon ab 1905 gab es zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen des Stoffes. Donizetti standen für die Uraufführung einige der bedeutendsten Sänger seiner Zeit zur Verfügung: Giuditta Pasta für die Titelrolle, Filippo Galli für Enrico VIII, Giovanni Battista Rubini für Lord Percy und Elisa Orlandi für Giovanna Seymour. 12 Giuditta Pasta (Saronno 1797 – Blevio 1865) besaß eine Stimme, die als soprano sfogato bezeichnet wurde, einen Sopran mit den Eigenschaften eines Mezzosoprans: eine dunkel timbrierte Stimme mit starker Mittellage und Tiefe, die aber in der Höhe bis zum Cis und D reichte, Koloraturfähigkeit besaß, für das dramatische Fach hervorragend geeignet war und sich in der Sopran-Tessitura ebenso wie in jener des Mezzosoprans wohlfühlte. Was den soprani sfogati allenfalls abging, war jene stimmliche Homogenität, die manchen mehr stimm- als ausdrucksorientierten Hörern als höchstes Ideal erschien. Diese Eigenschaften wurden der ausdrucksstarken und darstellerisch eindrucksvollen Giuditta Pasta ebenso zugeschrieben wie später Maria Callas, die die Anna genauso eindringlich und glaubhaft gestaltete wie die Pasta. Es ist kein Zufall, daß Pasta und Callas als Norma und Amina (La sonnambula) gleich erfolgreich waren. Eine plastische Bescheibung der Privatperson Pasta verdanken wir George Sand und ihrer Geschichte meines Lebens (Band IV): Auf der Bühne erschien die Pasta noch immer jung und schön. Sie war klein, dick und hatte zu kurze Beine, wie viele Italienerinnen, deren herrliche Büste nicht zu den übrigen Körperverhältnissen paßt. Aber dennoch gelang es der Künstlerin durch den Adel ihrer Bewegungen und die Feinheit ihrer Gestikulation groß und majestätisch zu erscheinen. Ich war sehr unangenehm überrascht, als ich ihr am folgenden Tage begegnete. Sie stand in ihrer Gondel und war mit jener übertriebenen Sparsamkeit gekleidet, welche die Hauptsorge ihres Lebens geworden war. [...] in ihrem alten Hut und Mantel hätte man die Pasta für eine Logenschließerin halten können. Als sie jedoch eine Bewegung machte, um dem Gondelführer den Platz zu bezeichnen, wo sie landen wollte, lag darin die ganze Majestät der Königin oder Göttin. Christian Springer Filippo Galli (Rom 1783 – Paris 1853) war nach Luigi Lablache (Neapel 17941858) der bedeutendste italienische Bassist seiner Zeit. Er war ein RossiniSpezialist und trat in etlichen Uraufführungen von Werken dieses Komponisten auf. Seine Stärken waren neben seiner Koloraturtechnik die stimmliche Ausdrucksfähigkeit und die große Gestaltungsintensität, für die er gerühmt wurde. Lablache wäre wegen seiner hünenhaften Erscheinung und seiner an das HolbeinGemälde von Heinrich VIII. gemahnenden Korpulenz für die Figur des TudorKönigs besser geeignet gewesen, doch sang er die Rolle erst 1831 in London, wo er mit seiner Darstellung Aufsehen erregte. Maria Callas als Anna Bolena, Mailänder Scala 1957 Bühnenbild-Ausschnitt der “Anna Bolena”-Produktion der Mailänder Scala 1957 Giovanni Battista Rubini (Romano bei Bergamo 1794-1854) war der romantische Tenor seiner Epoche. Ich habe an dieser Stelle bereits öfter über ihn geschrieben, es genügt also, wenn gesagt wird, daß dieser überragende Sänger, der nicht nur als Bellini-Tenor Berühmtheit erlangt und oft mit der Pasta gesungen hatte (so in der Uraufführung von La sonnambula), eine Idealbesetzung für den Lord Percy war. Rubini konterkariert übrigens einen heutigen, selbsternannten „Rollenweltrekordhalter“: Dieser sang in seiner Karriere 156 Rollen, Luigi Lablache sogar über 200 Rollen. Elisa Orlandi (Macerata 1811 – Rovigo 1834) hat wegen ihres tragisch frühen Todes (sie kollabierte und starb, als sie gerade die Bühne betreten wollte, um die Adalgisa in Bellinis Norma zu verkörpern) keine tiefen Spuren in der Gesangsgeschichte hinterlassen. Sie sang sowohl Mezzo- als auch Sopranpartien, verfügte über Koloraturgewandtheit und schien eine große Karriere vor sich zu haben. Donizettis Anna Bolena, die seinen Weltruhm begründete, wurde u.a. 1832 in Neapel, 1833 in Rom und 1834 in Venedig nachgespielt. 1831 erschien die Oper in London und Paris, 1832 in Graz und Madrid, 1833 in Wien, 1834 in Lissabon, Dresden und Havanna, 1839 in New Orleans, 1841 in Berlin usw. Ab 1880 geriet sie allmählich in Vergessenheit. Am 30. Dezember 1947 wurde sie am Gran Teatre del Liceu in Barcelona aufgeführt, allerdings nicht wegen des Werks an sich, sondern weil dieses Theater 100 Jahre zuvor mit Anna Bolena eröffnet worden war. Bei dieser Gelegenheit sangen Sara Scuderi die Titelrolle (die Sängerin ist aus dem berührenden Film Il bacio di Tosca von Daniel Schmid (1984) bekannt), Giulietta Simionato die Giovanna und Cesare Siepi den Enrico. Danach wurde es abermals ruhig um die Oper. Erst 1956 wurde sie in Donizettis Geburtsstadt Bergamo wieder aufgeführt. Der Donizetti-Spezialist Gianandrea Gavazzeni sah die Aufführung, erkannte die Bedeutung des Werks und seine Eignung für Maria Callas, die damals auf dem Höhepunkt ihres Könnens stand, und veranlaßte, daß Anna Bolena 1957 unter seiner Leitung in einer Inszenierung von Luchino Visconti am Teatro alla Scala herauskam. Wie man anhand von Tondokumenten überprüfen kann, handelte es sich um eine herausragende Produktion mit exzellenten Interpreten – neben der großen Callas (sie sang die Rolle in ihrer Karriere nur 12 Mal) war Giulietta Simionato eine exzellente Giovanna, Nicola Rossi-Lemeni ein ausdrucksstarker, wenngleich vokal unausgeglichener Enrico und Gianni Raimondi ein herzhafter Percy. Durch diese Aufführung entstand ein neues Verständnis für den Seria-Komponisten Donizetti, der im frühen 20. Jahrhundert vorwiegend als Autor komischer Opern bekannt war. Diese Produktion gab den Anstoß zur definitiven Wiederentdeckung des Werks. Primadonnen von Leyla Gencer, Renata Scotto und Montserrat Caballé bis hin zu Edita Gruberová machten sich die Titelrolle zu eigen und sorgten für Interesse an dieser Oper, die heute fester Bestandteil des Donizetti-Repertoires ist. Christian Springer lebt in Wien als freischaffender Übersetzer und Verfasser von musikwissenschaftlichen Publikationen 13 Anna Bolena-Rezeption Rainhard Wiesinger N Anna Netrebko: Wiens neue Anna Bolena © Felix Broede / DG Elina Garanca: Wiens neue Giovanna Seymour © Gabo / DG achdem die Renaissance des Werks dank Maria Callas eingeleitet worden war, erschien Anna Bolena immer wieder im Zusammenhang mit zugkräftigen Primadonnen auf den Spielplänen. Um nur einige, wenige Beispiele anzuführen: So wurde das Stück etwa im Sommer 1965 in Glyndebourne mit Lelyla Gencer aufgeführt. Ein Jahr später gab es in der New Yorker Carnegie Hall konzertante Aufführungen mit Elena Souliotis (Anna Bolena) und Marilyn Horne (Giovanna Seymour) und Plácido Domingo (Percy). 1975 gingen in Dallas und Philadephia konzertante Aufführungen mit Renata Scotto über die Bühne. 1982 brachte die Scala di Milano eine mit Monteserrat Caballé (Titelrolle) und Elena Obrastzova (Giovanna Seymour) glamourös besetzte Produktion heraus. In den 70er-Jahren zählte das Werk zu den Glanzpartien der amerikanischen Sopranistin Beverly Sills, auch Joan Sutherland und Edita Gruberova sangen die Anna Bolena häufig. Apropos Montserrat Caballé: Auch SaintSaëns hat sich mit seinem 1883 in Paris uraufgeführten Henri VIII. dem Stoff gewidmet. 2002 war das so gut wie nie gespielte Werk in Barcelona mit der Künstlerin als Katherina von Aragon zu sehen. In Österreich konnten Donizettis-Fans Anna Bolena etwa Ende der 70er Jahre in einer wenig erfolgreichen Produktion in Graz sowie später bei den Bregenzer Festspielen in Top-Besetzung erleben: Giuseppe Patané dirigierte hier am 22. Juli 1986 eine von Giancarlo del Monaco szenisch betreute Premiere, in der Katia Ricciarelli die Titelrolle, Stefania Toczyska die Giovanna, Francisco Araiza den Percy und Jewgenij Nesterenko den Enrico VIII. sangen. In Wien bot sich die Gelegenheit, das Werk im Herbst 1994 in zwei konzertanten, von Elio Boncompagni dirigierten Aufführungen zu hören: Edita Gruberova begeisterte in der Titelrolle, Delores Ziegler sang deren Gegenspielerin Giovanna Seymour, José Bros den Lord Percy, Stefano Palatchi den Enrico und Helene Schneiderman den Smeton. Die Aufführungen wurden damals auch mitgeschnitten und auf CD veröffentlicht. 14 Vor vier Jahren widmete das Konzerthaus Anna Bolena nochmals eine konzertante Aufführung, in der Elena Mosuc in der Titelrolle sowie Ruxandra Donose als Giovanna zu hören waren. Roberto Saccà gab an diesem Abend den Percy, Kwangchul Youn den Enrico und Nadia Krasteva den Smeton. Am Dirigentenpult des ORF Radio-Symphonieorchester Wien stand sein damaliger Chefdirigent Bertrand de Billy. Eine besondere Erwähnung verdient zudem eine wiederum konzertante Aufführung, die im April 2003 im niederösterreichischen Ternitz über die Bühne ging: Als Veranstalter fungierte der Verein „Amici del belcanto“, dem es auch hier gelang, eine Besetzung internationalen Zuschnitts zu gewinnen: So konnte man Nelly Miricioiu für die Titelrolle sowie Marianne Cornetti als Giovanna verpflichten. In der laufenden Saison ist Anna Bolena in einigen Neuproduktionen auch außerhalb Wiens zu erleben: Die Dallas Opera brachte im Herbst eine Neuinszenierung mit Hasmik Papian und Denyce Graves heraus. In Barcelona hatte bereits im Jänner eine, den Kritiken nach zu schließen, szenisch extravagante Produktion mit Edita Gruberova und Elina Garanca Premiere. Im Mai ist Donizettis Stück auch an der Züricher Oper als Wiederaufnahme zu erleben: Eva Mei wird dort die Titelpartie, Elina Garanca die Giovanna Seymour, Carlo Colombara den Enrico sowie Celso Albelo den Percy singen. Eine Neuproduktion ging auch vor wenigen Tagen am Theater von Luzern über die Bühne. Auch im Theater von St. Moritz wird das Stück ab Juni siebenmal zu sehen sein. Die Metropolitan Opera New York wird die nächste Spielzeit mit Donizettis Werk als Eröffnungspremiere beginnen, auch dort werden Anna Netrebko und Elina Garanca zu hören sein, als Percy und Enrico hat man dort Stephen Costello beziehungsweise Ildar Abdrazakov engagiert. Anna Bolena Richard Schmitz, Foto: Jungwirth Diskographie Dr. Richard Schmitz begleitet das Programm der Wiener Staatsoper bei Radio Stephansdom (“per opera ad astra”) Gaetano Donizettis erste Erfolgsoper, Anna Bolena, war fast ein Jahrhundert in Vergessenheit geraten. Erst Maria Callas machte sie 1957 wieder zum Erfolg. Leider ist der Mitschnitt dieser Aufführung derzeit in Wien nicht erhältlich. Sie ist eine Primadonnenoper, die weitgehend von der Besetzung der Titelfigur abhängt. Da Felice Romani in seinem Textbuch der englischen Geschichte genau nachgeht, gewinnen aber auch die anderen Figuren Kontur und sind entsprechend zu besetzen. Von den beiden Aufnahmen unter Julius Rudel ist mir der Live-Mitschnitt aus Philadelphia vom Dezember 1975 lieber. Er atmet den Reiz eines Opernabends. Man spürt die Bühne und das Publikum. Die Interpretation von Renata Scotto ist hochdramatisch, manchmal auf Kosten der Genauigkeit bei den Koloraturen, doch die Gefühle der Titelfigur kommen berührend heraus. Susan Marsée bleibt da im Schatten der Titelfigur. Samuel Ramey verleiht der Figur des enttäuschten Königs Intensität und wird damit zum Gegenspieler der Königin. Stanley Kolk als Percy kann da nicht ganz mithalten. Julius Rudel geht hier noch einen Schritt in der Musikgeschichte weiter. Santuzza lässt grüßen. (Gala GL 100.596) Die DVD zeigt einen Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1984 aus Toronto. Lotfi Mansouri bietet einen überladenen Kostümschinken. Die psychologischen Verstrickungen und damit das Sensationelle des Textbuches von Felice Romani gehen da ganz unter. Technisch merkt man die Entstehungszeit der Aufnahme leider an. Joan Sutherland steht hier unbestritten im Mittelpunkt. Sie gestaltet eine gebrochene Frau. James Morris sieht nicht nur aus wie Heinrich VIII, er ist es auch. Ein Erlebnis ist das von Brio und Dramatik getragene Dirigat von Richard Bonynge. Da merkt man, dass er mehr ist als der Begleiter einer großen Sängerin. Interessant ist die DVD vor allem für Gesangsschüler, die die Mundstellung der Sutherland und die Lage des Gaumensegels genau studieren können. Unvoreingenommene Zuschauer freut das weniger. (DVDVAI AI 4203) 1987 hat dann Richard Bonynge mit Joan Sutherland die Oper im Studio realisiert. Die Sutherland ist am Höhepunkt ihrer Kunst. Susanne Mentzer hält tapfer dagegen. Samuel Ramey gestaltet den herrischen Henry, Jerry Hadley bringt neben etwas engen Spitzentönen ein schönes Melos mit. Bonynge zeigt wieder sein Einfühlungsvermögen und seine Gestaltungskraft. (Decca 475 7910) Eine gelungene Aufnahme entstand 1994 in Wien. Mitgeschnitten bei einem Konzert, das Edita Gruberova in bester Verfassung zeigt. Sie hat in Delores Ziegler eine ebenbürtige Freundin und Gegenspielerin. Beste Belcanto-Tradition bietet gestochene Koloraturen, lässt aber die Gefühlsregungen nicht unberücksichtigt. Beide Sängerinnen verkörpern die komplexen Figuren mit Hingabe. Stefano Palatchi besteht als Henry und José Bros überrascht mit seinem hellen Tenor durch schöne Phrasen. Elio Boncompagni steuert die notwendige Italianità und eine schöne Legatokultur bei. Das Booklett bietet auch ein deutsche Übersetzung des Textes. (Nightingale CD: NC 070565-2) Live vom Donizetti-Festival in Bergamo stammt ein Mitschnitt aus dem Jahr 2000. Dimitra Theodossiou ist eine liebende Frau, die unter dem Verlust der königlichen Treue leidet. Die Belcanto-Koloraturen gelingen etwas beiläufig, doch macht der Ausdruck vieles wett. Sonia Ganassi besteht neben ihr. Andrea Papi stellt als Henry seinen profunden Bass in den Vordergrund. Tiziano Severini dirigiert engagiert und arbeitet die Feinheiten der Partitur einfühlsam heraus. (Dynamic CDS 370/1-3) In der DVD Produktion aus dem Jahr 2006, ebenfalls aus Bergamo, ist Dimitra Theodossiou in die Rolle hineingewachsen. Sie singt eine erschütternde Boleyn. Allerdings fallen die anderen Protagonisten etwas ab. Sofia Solviy ist kaum Gegenspielerin und Riccardo Zanelotti wenig Herrscher, mehr Intrigant. Das liegt auch an der Inszenierung von Francisco Esposito, der die Geschichte in einem Parlamentarischen Rund aus Stahlrohrgerüsten spielen lässt. Nur wer die Untertitel mitliest, kann der Handlung folgen. Technisch ist die Aufnahme auf dem letzten HD-Stand. (DVD 33534) 15 Tatort Bühne – Béjarts Tanz-Krimi in Wien Z Maurice Béjart © AFP ufall macht den Meister. Denn dass Maurice Béjart zu einer Zentralfigur des klassischen Balletts wurde und mit seinen umstrittenen Choreographien fast 50 Jahre lang Tanzgeschichte schrieb, war eigentlich nur Zufall. Nach einem Unfall in jungen Jahren wurden ihm als Therapie Übungen in klassischem Tanz verschrieben. Und so wurde die Tanzleidenschaft eines der später bedeutendsten Künstler des neoklassischen Balletts geweckt. Seine Karriere verlief wie aus einem Bilderbuch: Der Sohn des Philosophen Gaston Berger wurde am 1. Jänner 1927 in Marseille geboren. Die multikulturelle Hafenstadt sollte sein Werk ebenso prägen wie der Beruf des Vaters: Philosophien und Religionen von Nietzsche über Buddhismus bis zum Islam flossen ebenso in seine späteren Choreographien ein wie Bewegungsfolgen vom südamerikanischen Tango bis zum fernöstlichem Kampfsport. Béjarts eigene Ballettkompanie gilt als eine der erfolgreichsten und bekanntesten weltweit © Associated Press Doch zuvor rebellierte er gegen seinen Vater: Parallel zum Philosophiestudium nahm er Tanzunterricht und wandte sich damit der unbürgerlichsten aller Künste zu. Seine Karriere begann er mit 14 Jahren an der Opéra National de Paris. Nach dem Lizenziat legte er den Familiennamen Maurice-Jean Berger ab und ersetzte ihn mit dem Namen von Molières Geliebten Béjart. Sein Debüt als Tänzer gab Béjart mit 18 Jahren an der Oper Marseille. 1951 zeigte er seine erste Choreographie L’Inconnue (Der Unbekannte) in Stockholm. 1955 kreierte er den existenzialistischen Pas de deux Symphonie pour un homme seul (Symphonie für einen einsamen Menschen) für seine Pariser Kompanie Ballet de l’Etoile in Paris. Seinen Durchbruch schaffte er 1959 mit der legendären Brüsseler Inszenierung von Igor Strawinskys Le Sacre du Printemps. Ein Jahr später holte ihn Maurice Huismann als künstlerischen Direktor des Théâtre de la Monnaie nach Brüssel und beauftragte ihn mit der Gründung 16 des Ballet du XXe siècle (Ballett des 20. Jahrhunderts) mit dem er auf zahlreiche Welttourneen ging und die Besucher mit seinem spectacle total (Totaltheater) in den Bann zog, indem er Sprache, Musik, Tanz und Regie zu einem Gesamtkunstwerk verschmolz. Als der Kompanie 27 Jahre später die geforderten Mittel nicht mehr bewilligt wurden, zog sie zum Entsetzen ganz Belgiens nach Lausanne weiter und wurde zum Béjart Ballet Lausanne (BBL). Am 22. November 2007 verstarb der von Choreographen-Kollegen John Neumeier als Ekstatiker, Popkünstler und Klassiker bezeichnete Béjart während der Probenzeit zur Tour du Monde en 80 minutes-Show. Doch der Mann mit dem markanten Kinn- und Oberlippenbart wurde nicht immer gefeiert. „Das ist ein pornografisches Kostüm“, beschrieb Béjart das Tutu, das traditionelle Ballettkostüm aus Tüll, und steckte seine Tänzer in Jeans. Das Bildungsbürgertum war über diese „profane“ Degradierung der Hochkultur schockiert, es sollte aber nur der Anfang des Aufstands sein. Béjart stellt ferner den Tänzer – als einen unverwechselbaren, kraftvollen Typus - in den Vordergrund und nicht die Ballerina. Die Abkehr Béjarts vom klassischen Ballettrepertoire und sein Interesse für komplizierte atonale Kompositionen wie die von Iannis Xenakis oder die konzeptuelle Musik eines Pierre Boulez stießen vor allem die Pariser Ballettfreunde vor den Kopf. Das Publikum pfiff den choreographischen Avantgardisten gnadenlos aus. Bejart galt zeitlebens als wandelndes Lexikon. Er verfügte über eine riesige Allgemeinbildung, breite Sprachkenntnisse und eine enormes Wissen über fremde Mythen und Kulturen. Vieles floss in sein Schaffen ein: Gesang, japanischer Kampfsport, atonale Musik, modernes Theater - Dinge, die er auch an seinen Schulen (Mudra in Brüssel und Rudra in Lausanne) lehrte. Er hatte den Zen-Buddhismus studiert und war zum Islam übergetreten. Verena Franke Er wollte nicht nur den Körper, sondern auch den Geist schulen - seinen eigenen ebenso wie den seiner Eleven. Szene aus „Prayer and Dance” © AP Le Concours Volksoper Wien Premiere So. 17. April 2011 Reprisen 19., 21. April 2011 10., 15., 20., 22. , 25. Mai 2011 “Le Concours”: Manuel Legris als Polizeiinspektor in der Produktion der Pariser Oper 1999 © Volksoper Wien Béjart wurde oft mit Wagner und Fellini verglichen: Auch er liebte die große Geste, die üppige Fantasie, das ewige Gefühl, das Gesamtkunstwerk. Dass er vor allem in späteren Jahren keine Berührungsangst vor kitschnahen Elementen hatte, wurde ihm vor allem in den USA vorgeworfen. Auch wurde er vor allem nach den großen Wandeln der Tanzszene in den vergangenen Jahrzehnten für einen nicht mehr zeitgemäßen Stil kritisiert. Hingegen trug er durch seine bildkräftigen, unmittelbar zugänglichen Themen maßgeblich dazu bei, dass das Ballett ein breiteres Publikum erreichte: Béjart suchte für seine mehr als 200 Choreographien nach neuen Aufführungsorten und fand sie schließlich im Zirkus und in Sporthallen. All seine Werke zeichnen sich durch einen ganz speziellen Stil aus. Literarische Gestalten und historische Persönlichkeiten beleben seinen gestalterischen Kosmos, aber auch Themen wie Liebe, Tod, Erotik und Entfremdung, Konsumgesellschaft, Spiritualität und Politik. Sie blieben die Konstanten in einem umfangreichen Oeuvre, das sich musikalisch wie auch technisch zwischen Klassik und Avantgarde bewegt, Techniken des Modern Dance mit der Tanzkunst außereuropäischer Kulturen verbindet und immer wieder Béjarts geistige Nähe zur 68erBewegung und zur Popkultur reflektiert. Nicht alle Choreographien gelten als Meisterwerke, auch wenn er mit vielen Stadien füllen konnte. Neben Le sacre du printemps (1959) gingen etwa Boléro (1961), L’oiseau de feu (1970), Notre Faust (1975) und Le presbytère n’a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat (1997) in die Tanzgeschichte ein. In Wien und Innsbruck wurden immer wieder Choreographien Bejarts gezeigt, zum Mozart-Jahr 1991 gelangte an der Wiener Volksoper ein Auftragswerk der Stadt Wien zur Aufführung: Tod in Wien W.A. Mozart, ein puzzleartiges Werk, das als unchronologische „Reise in die MozartZeit“ angelegt war. Eine Béjart-Reise in die Ballettwelt, nämlich jene für Außenstehende eher Unbekannte der harten Wettbewerbe, zeigt nun die Volksoper ab 17. April: Manuel Legris, Chef des Wiener Staatsballetts, holt das Krimi-Ballett Le Concours (Der Wettbewerb) nach Wien. Die Tragikomödie, bereits 1985 für das Ballet du XXe siècle geschaffen, ist eine witzige Collage – halb Melodram, halb Show – und lebt vom Wechsel zwischen klassischem und modernen Tanz sowie der zynischen Persiflage von Balletttanzwettbewerben. Schauplatz der Detektivgeschichte ist ein internationaler Wettbewerb, bei dem Ada, die aussichtsreichste Kandidatin, erschossen wird. Sechs Personen stehen unter Mordverdacht, darunter die Mutter der Ballerina, die selbst einmal Tänzerin war, ein ausgeflippter Pop-Star, ein Zauberer und eine ehrgeizige Tanzlehrerin. Während der Polizeiinspektor mit Trenchcoat und Hut seine Ermittlungen anstellt (Legris trat 1999 in der erstmaligen Aufführung dieses Stückes an der Pariser Oper in der Rolle des Detektivs auf), läuft die Ausscheidung unerbittlich weiter. Wie in einem Film erzählt Béjart in Rückblenden Episoden aus dem Leben der jungen Ballerina. Der widersprüchliche Grundgedanke zwischen modernem und klassischem Tanz ist auch in der Musik zu erkennen: Sie stammt von Hugues Le Bars. Er verband rockige Klänge mit Motiven des Ballett-Repertoires wie Dornröschen und Schwanensee. Gil Roman, nach Béjarts Tod der Chef des Béjart Ballet Lausanne, bringt die Sehenswürdigkeit dieses Spektakels in einem früheren Programmheft treffend auf den Punkt: Es gebe wenige Stücke Béjarts, die ein so breites Spektrum von szenischer und theatralischer Imagination, von choreografischer Phantasie und Kommunikationsbegabung zeugten. Mag. Verena Franke ist Redakteurin im Feuilleton der „Wiener Zeitung“ mit Schwerpunkt Tanz und Theater 17 con brio Ein Herr mit aufrechtem Gang E Heinz Irrgeher, (c) Foto Fayer Eines der letzten Photos von Claus Helmut Drese 18 r war der erste Direktor der Wiener Staatsoper, der seinen Logensessel (damals war die Direktionsloge noch die Sechser im ersten Rang rechts) mitnehmen konnte – die FREUNDE hatten Drese diesen bei der Abschiedsfeier geschenkt und ihn darauf hinausgetragen. Drese bezeichnete diese Feier später in seinem Buch Palast der Gefühle als „überraschend phantasievoll und herzlich“. Dieses Buch entstand aus dem, was Drese selbst als das Betreiben psychischer Hygiene bezeichnete: immer wieder machte er sich regelmäßig Notizen über Vorkommnisse, deren Beobachtung ihn zum Nachdenken gebracht hatten: künstlerische, politische, menschliche; sei es, ob sie ihn direkt selbst betrafen oder auch nur betroffen machten. Seine so geschulte kritische Beobachtung und der ehrliche und geradlinige Umgang mit sich selbst prägte auch sein Verhalten zu seiner Umwelt, aber auch seine Erwartungshaltung ihr gegenüber. Ersteres war für die, die mit ihm zu tun hatten, angenehm oder auch unangenehm, je nachdem wie seine Offenheit sie traf. Seine aus seinem eigenen Verhalten resultierende Erwartungshaltung gegenüber seiner Umwelt allerdings konnte für ihn in einer Umwelt, die seinen Abgang schon vorbereitete, noch bevor er angefangen hatte, und zwar nicht in, wie es Schnitzler ausdrückte, selbstloser, sondern eben nicht selbstloser Gemeinheit, nur nachteilig ausgehen. Auch die Umstände der Zeit waren für ihn, den noch dazu Wien-Unerfahrenen, nicht wirklich günstig. Der mit der Szene vertraute Seefehlner hatte ihn noch damit beruhigt, dass er für den Fall, dass er mit dem Geld nicht auskomme, lediglich zum Minister zu gehen brauche, der dann ein Budgetüberschreitungsgesetz beschließen lassen würde. Es kam anders: bereits der zweite Minister (Drese hatte in seinen fünf Jahren deren vier) schrieb ihm höhere Einnahmen bei gleichbleibender Subvention vor. Drese reagierte mit Sponsoren (Jacobs-Café für Otello, die CA für die Gluck-Iphigenie, für eine Saison die Raika NÖ), nicht zur Kenntnis genommenen Einsparungen und einem ausgeglichenen Budget, was die nächste Ministerin nicht hinderte, von Sorgen über die Oper zu reden. Diese war es auch, die ihm nach 20 Monaten Amtszeit das eröffnete, was intern längst feststand und bis zu seinem Musikdirektor Abbado schon alle wussten, nämlich dass er nicht mehr verlängert werden würde. Was Drese nicht daran hinderte, weiterhin solidarisch zu Abbado, der dann – im Gegensatz zu Dieter Roser – seine Tätigkeit in der neuen Direktion fortsetzte, zu stehen und ihm seine Engagement- und Probenwünsche zu erfüllen. Trotz Aufforderung durch Gen. Sekr. Jungbluth, Produktionen zu streichen, das Opernstudio aufzulösen und keine zusätzlichen Spielstätten zu bespielen (Künstlerhaus mit Weißer Rose und Nachtausgabe, Odeon mit Beat Furrers Die Blinden, Ronacher mit Kehraus um St. Stephan u.a.m.) zog er sein Programm entsprechend seinem Verständnis für Verantwortung durch: nur der Ring unterblieb mangels Vertragsverlängerung. Drese war mit zwei Zielen angetreten: dem Musiktheater eine „neue Ästhetik“ zu geben und aus dem Wiener „altgierigen“ Publikum eine „neugieriges“ zu machen. Letzteres ist auch ihm nicht wirklich gelungen, Ersteres eher schon, auch wenn niemand konkret zu definieren wusste, was er damit meinte. Der Stil seiner Inszenierungen lässt sich aus der Erinnerung an einige seiner Produktionen rekonstruieren: Die Schwarze Maske, Werther, Idomeneo, Rusalka, Arabella, Fierrabras, Otello, Die tote Stadt, Pélleas et Melisande, Der ferne Klang, Samson und Dalila, Chowantschina, Elektra und das Wagnis eines neuen Wozzeck, ein teilweise im Theater an der Wien produzierter acht Werke umfassender Mozart-Zyklus. Das Meiste davon, wie z.B. die unvergessliche Viaggio a Reims, verschwand nach seinem Abgang. Drese war es auch, der als erster Direktor begann, im 50sten Jahr nach dem „Anschluss“ dem damaligen Verschwinden von Mitgliedern des künstlerischen und nichtkünstlerischen Personals der Wiener Staatsoper nachzugehen und darüber eine eigene Matinee abhielt. Anlässlich seiner Buchpräsentation Erlesene Jahre am 15. September 2008 trafen wir noch einmal zusammen, im Anschluss daran gingen wir noch im kleinen Kreis Abendessen. Plötzlich fühlte man wieder die Ambivalenz dieser fünf Jahre und auch die Betroffenheit darüber, wie man mit ihm umgegangen war, war eine gemeinsame. In das von mir erworbene Buchexemplar schrieb er mir noch „Für den lieben Opernfreund Dr. Heinz Irrgeher“ hinein, danach haben wir uns von einem Menschen verabschiedet, dessen Tod wir aufrichtig betrauern und der uns als ein hochanständiger, geradliniger, hochgebildeter, kompetenter und liebenswerter Herr in achtungsvoller Erinnerung bleiben wird. Matinee Musical meets Opera II Besondere Erfolge verlangen nach einer Fortsetzung. Tanz der Vampire Drew Sarich (Graf von Krolock) und Marjan Shaki (Sarah) © VBW So war es nach der ersten Matinee Musical meets Opera klar, dass ein Termin für ein Encore gefunden werden muss. Gemeinsam mit den Vereinigten Bühnen Wien feiern wir als Opernfreunde in Kooperation mit dem Unterrichtsministerium deshalb am 8. Mai um 11.00 Uhr im Ronacher eine weitere Vermählung der beiden Genres. Musical meets Opera II Zu Gast bei den Vampiren Eine Kooperation mit den Vereinigten Bühnen Wien So. 8. Mai 2011 11.00 Uhr Ronacher Moderation: Thomas Dänemark Für Mitglieder: € 10,Nichtmitglieder: € 15,Karten ab 12.4. im FREUNDE-Büro Alle Hauptdarsteller der Vampire haben sich spontan bereit erklärt, wieder mitzumachen und auch seitens der Oper ist die Begeisterung, dabei sein zu können ungebrochen vorhanden. So wird diesmal neben Clemens Unterreiner auch Adam Plachetka mitwirken und im Quartett mit Drew Sarich und Robert D. Marx, den beiden Darstellern der Titelpartie aus dem Musical die berühmte Arie des Grafen von Krolock im Quartett singen. Selbstverständlich warten auch noch andere musikalische Überraschungen auf Sie - insbesondere die bekanntesten Melodien aus dem Musical Tanz der Vampire und Mozarts Don Giovanni. Über 8.000 mal wurden über die Internetplattformen youtube und Facebook die Videoausschnitte der letzten Matinee aufgerufen und der Wunsch nach einer Fortsetzung geäußert. Somit findet auch die Oper über dieses, vor allem von jungen Menschen genutzte Medium, Verbreitung. Noch bis Ende Juni habe Sie die Möglichkeit in die schaurig-schöne Welt der Vampire einzutauchen und sich verzaubern zu lassen. Am Abend des 8. Mai findet in der Wiener Staatsoper die Aufführung von Mozarts Don Giovanni statt, der ja das inhaltliche Vorbild des Musicals ist – eine bessere terminliche Verflechtung ist wohl kaum möglich. Wenn man aus der ersten Matinee Musical meets Opera etwas lernen konnte, dann dass die beiden Genres mehr Gemeinsamkeiten haben, als man denkt und dass beides wert ist, entdeckt zu werden, wenn es nur gut gemacht ist. Ein Vormittag, der auch für die jüngere und jüngste Generation der Opernfreunde geeignet ist: also frei nach dem Motto: „Bring your family.“ thd Matinee: Musical meets Opera I links: der etwas andere Herbert-Walzer, Lukas Perman und Marc Liebisch © Cserjan oben: Schlussensemble - Lisa Koroleva, Alexander di Capri, Gernot Kranner,Clemens Unterreiner, Lukas Perman, Martin Planz, Barbara Obermeier, Marc Liebisch © Josef Gallauer 19 Rückblick: Faschingsbrunch mit Michael Birkmeyer M ichael Birkmeyer ist quasi ein Synonym für Ballett auf höchstem Niveau und Gespräche mit ebenso hohem Unterhaltungswert, wie auch der heurige Faschingsbrunch zeigte. Michael Birkmeyer und Thomas Dänemark beim FREUNDE-Brunch Künstlerisch geprägt wurde der Künstler durch Rudolf Nurejew: „Wenn man mit solchen Menschen arbeitet, und ich hatte das Glück mein ganzes Tänzerleben hindurch mit ihm zusammenzuarbeiten, dann hat man ein Problem, wenn man in das ‚normale‘ Leben zurückkehrt: Man findet dann nämlich nicht mehr alles toll, wovor andere niederknien, weil man weiß, dass es das Gesehene auch anders gibt.“ Birkmeyer stammt aus einer Familie, die bereits sechs Generationen an Tänzern, aber noch nie Tänzerinnen hervorgebracht hat: „Wir sind ja schon eine komische Familie! Die einen sind Ärzte, die anderen Tänzer. Die Frauen in unserer Familie sind einfach immer zu unbegabt für eine Karriere gewesen. Ballett soll man nur machen, wenn alles stimmt, und selbst dann ist es noch mühsam. Wenn ich dann heute in der Ballettschule höre, ich müsse mehr motivieren, sage ich dann immer, dass ich schließlich kein Animateur eines Ferienclubs bin. Wer in die Ballettschule kommt, muss das wirklich wollen. Auch ich wollte am Anfang nicht Tänzer werden und wurde von meinem Vater gezwungen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in den Garderoben einmal mit Abschminke ‚Ballett ist Scheiße!‘ an die Wand geschrieben habe. Leider hat mich dabei jemand gesehen und es meinem Vater erzählt…“ 20 Gespräche mit Birkmeyer zeigen immer, dass er ungeschminkt seine Meinung äußert: „Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker, so eine Art Michael Kohlhaas, was mir immer schon sehr geschadet hat. Gamsjäger hat zu mir gesagt: ‚Birkmeyer, Sie brauchen keine Feinde, Sie haben ja sich!‘ Aber man muss sich eben nicht alles gefallen lassen, wobei ich immer sage: Der Schlüssel zur Freiheit ist deine Qualität, die man nur durch sehr viel Arbeit erreichen kann. Und Ballett wird ja erst dann interessant und spannend, wenn man - wie auch beim Singen - über die technische Bewältigung hinaus kommt und mit diesem Fundament dann Geschichten erzählt. Und dass ist auch nicht leicht, da ja die Balletthandlungen oft einfach nur blöd sind. Das Furchtbare beim Tanzen ist ja auch, dass man zu alt für den Beruf ist, wenn man weiß wie es geht.“ Seine ersten Opernerfahrungen machte der Künstler als Statist: „Ich kann mich noch an eine ‚Alceste‘ mit Christl Goltz erinnern, bei der ich als Sechsjähriger das Kind spielte. Und in der Emotion hat sie mich eine ganze Szene lang sehr fest an ihren Busen gedrückt und ich habe nur mehr gehofft, da wieder lebend rauszukommen. Dadurch, dass ich viel statierte, habe ich auch viel Oper gesehen. Das war damals auch eine Zeit, in der es keine schlechten Sänger an der Oper gab. Und ich dachte immer, das gehört so, wie wir das von Nilsson, Corelli, Schwarzkopf oder di Stefano gehört haben, und war dann oft sehr enttäuscht, wenn ich die Sachen dann später mit anderen gehört habe. Als Statist konnte man mich allerdings nur für Rollen einteilen, bei denen man sich nichts merken musste, da ich immer so abgelenkt war.“ Künstlergespräch KS Agnes Baltsa E Agnes Baltsa Künstlergespräch KS Agnes Baltsa Sa. 14. Mai 2011 11.00 Uhr Gustav Mahler-Saal Moderation: Richard Schmitz Für Mitglieder: € 6,Nichtmitglieder: € 12,Karten ab 3.5. im FREUNDE-Büro Als Isabella in “L’Italiana in Algeri” © Wiener Staatsoper/ Axel Zeininger s war kein geringerer als Herbert von Karajan, der die 1944 auf der griechischen Insel Lefkas geborene Agnes Baltsa als "eine der herausragendsten dramatischen Mezzosopranistinnen unserer Zeit" bezeichnete. Als Karajan auf die Künstlerin im Rahmen eines Vorsingens für eine Platteneinspielung von Beethovens Missa solemnis aufmerksam wurde, war deren Karriere gerade am Beginn: Baltsa gab ihr Operndebüt 1968 mit der Partie des Cherubino in Mozarts Oper Le Nozze di Figaro an der Oper Frankfurt, wo sie bis 1972 im Ensemble blieb. Von Karajan gefördert ging Baltsas Karriere nun steil nach oben: Es folgten Engagements an der Deutschen Oper Berlin, verschiedenen Opernhäusern in den USA (inklusive der Metropolitan Opera in New York), an der Bayerischen Staatsoper in München, der Covent Garden Opera in London, dem Opernhaus Zürich, der Opéra de Paris und der Wiener Staatsoper. Agnes Baltsas kam übrigens schon früh mit der klassischen Musik in Berührung und erhielt ihren ersten Klavierunterricht als sie sechs Jahre alt war. Ihre Gesangsausbildung absolvierte sie am Konservatorium von Athen, wo sie 1965 graduierte. Im selben Jahr gewann sie das Maria Callas-Stipendium, welches ihr die Möglichkeit gab, ihre Studien in München fortzusetzen. An der Wiener Staatsoper, wo die Künstlerin bisher 25 verschiedene Rollen an etwa 400 Abenden gesungen hat, debütierte sie 1970 als Oktavian im Rosenkavalier von Richard Strauss. Ihre hier am häufigsten gesungene Partie ist – wie nicht anders zu erwarten – die Carmen, gefolgt von der Isabella in Rossinis L’Italiana in Algeri (43x). Gerade das Wiener Publikum hatte regelmäßig die Möglichkeit, seinen Liebling in neuen Rollen zu erleben. So war sie etwa 1995 die Herodiade in Massnets gleichnamiger Oper, 1999 sang sie in der Premiere von Meyerbeers Le prophète die Fidés, 2002 in der neuen Jenufa die Küsterin. 2007 gab sie ihr Rollendebüt als Klytämnestra in Elektra von Richard Strauss. Agnes Baltsas Verbundenheit zur Wiener Staatsoper zeigt sich auch darin, dass sie seit 1980 Österreichische Kammersängerin ist und 1988 zum Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ernannt wurde. Von Agnes Baltsas wichtigsten Rollen sind nur einige auf Platte dokumentiert: Dazu zählen Carmen und Oktavian (beide unter Karajan) Isabella (Abbado), Dalila (Colin Davis), Rosina (Marriner) sowie Santuzza (Sinopoli). Unter ihrem Mentor Herbert von Karajan spielte Agnes Baltsa neben der bereits erwähnten Missa solemenis auch die Donna Elvira, Herodias (Salome), Amneris, Verdis Messa da requiem sowie Beethovens 9. Symphonie und Bruckners Te Deum ein. Abseits vom klassischen Opern-Repertoire machte sich Agnes Baltsa auch einen Namen als Interpretin griechischer Folklore, u. a. von Werken der Komponisten Mikis Theodorakis und Manos Hadjidakis. Ihr darstellerisches Können zeigte die Künstlerin auch vor der Filmkamera: 1992 entstand ein Krimi des ORF mit dem Titel Duett. An der Seite von Otto Schenk und Karlheinz Hackl spielt Baltsa eine ungarische Sängerin, die aufgrund früherer Geheimdiensttätigkeit erpresst wird. Bei den Opernfreunden war die Künstlerin bereits 1990, 1994 und 2004 bei Künstlergesprächen zu Gast. rw Als Küsterin in “Jenufa” © Wiener Staatsoper/ Axel Zeininger 21 Porträt Sophie Koch Sophie Koch © Patrick Nin Als Octavian im “Rosenkavalier” © Wiener Staatsoper/ Axel Zeininger Frau Koch, Ihre Karriere dauert nun etwa 15 Jahre, in Wien kennen wir Sie seit 1999, als Sie im Rosenkavalier als Octavian debütierten. Mittlerweile haben Sie Ihr Repertoire um Partien wie die Charlotte, Fricka und Brangäne erweitert. Hat sich Ihre Stimme in diesen eineinhalb Jahrzehnten so entwickelt, wie sie gehofft haben? Oh, ja! Ich habe vor drei Jahren mit Mozart aufgehört und singe nun vor allem Partien des romantischen Repertoires und werde auch in den nächsten Spielzeiten weiter in diese Richtung gehen. So kommen Glucks Alceste, die Dido in Berlioz' Les Troyens, die Leonore in Donizettis Favorite sowie die Giulietta in Les Contes d’Hoffmann auf mich zu. Außerdem bereite ich meine erste Venus vor, die für mich, wie die Brangäne, wahrscheinlich eine Zwischenstation auf dem Weg zu Kundry sein wird. Ein ganz positives Erlebnis war für mich auch das Debüt als Adalgisa in Norma. Das klingt beinahe so, als ob Ihnen der Abschied von Mozart leicht gefallen wäre. Nein, ich habe mich von Mozart schweren Herzens getrennt, da mir Rollen wie Cherubino, Zerlina und Dorabella immer sehr leicht gefallen sind. Ich könnte diese Rollen, technisch gesehen, noch immer singen, es ist die Stimmfarbe, die sich von diesen Rollen wegentwickelt hat. Ich bin jetzt Anfang 40, da würde sich bei Mozart noch der Sesto oder der Idamante anbieten, aber man muss ja auch bedenken, dass man von Operndirektoren und auch vom Publikum mit einem bestimmten Repertoire in Beziehung gebracht wird, und das ist bei mir nun die romantische Epoche. Außerdem wird von SängerInnen heute immer erwartet, sich in neuen Partien zu präsentieren. Bevor man eine neue Rolle präsentieren kann, muss man sie zunächst einstudieren. Lernen Sie schnell? Nicht wirklich. Ich beginne in der Regel ein Jahr vor einem Rollendebüt mit den 22 Vorbereitungen, wobei ich immer alleine mit der Partitur und dem Klavierauszug studiere. Aus Interesse höre ich mir dabei auch CDs an oder schaue mir etwa auf Youtube andere Interpretationen an. Die vorhin erwähnte Alceste ist eigentlich nicht dem romantischen Repertoire zuzurechnen. Wenn Sie an die Arie der Titelfigur denken, hat man es hier mit einer Rolle zu tun, die Berlioz stilistisch näher steht als Mozart. In der aktuellen Saison werden Sie die Charlotte auch noch in Madrid und London singen. Wie sehen sie den Charakter dieser Figur? Die Charlotte ist für mich eine rein romantische Figur, weshalb ich es für sinnlos halte, die Geschichte aus dem zeitlichen Kontext zu lösen, wie es etwa in der Wiener Produktion geschehen ist. Es ist doch unglaubwürdig, dass sich eine Frau in den 60er Jahren so verhalten hätte wie Goethes Charlotte, die sich durch ihre Erziehung quasi verbietet, ihrer Seele freien Lauf zu lassen. Das heißt aber nicht, dass ich grundsätzlich gegen moderne Regiekonzepte bin. Von Werther existiert, was die Titelrolle betrifft, auch eine von Massenet selbst autorisierte Fassung für Bariton. Ich habe diese Version insofern kennengelernt, als Jonas Kaufmann während der Proben in Paris krank wurde und Ludovic Tézier, der als Albert angesetzt war und die Titelpartie bereits in Brüssel gesungen hatte, nun den Werther sang. Ehrlich gesagt, finde ich die Version mit Tenor musikalisch interessanter, da bei der Kombination Mezzosopran-Bariton zu wenig farblicher Kontrast besteht. Zahlreiche Mezzosopranistinnen haben versucht, während Ihrer Karriere auch Sopranrollen zu singen. Ich hoffe, Sie werden auch in Zukunft nicht zu diesen zählen. Nein, das habe ich wirklich nicht vor! Rainhard Wiesinger Schließlich möchte ich auch in mehr als zehn Jahren noch hier sitzen können und über meine Pläne sprechen. Im Lauf der Zeit habe ich Angebote etwa für die Elvira in Don Giovanni erhalten, dieses Angebot aber nicht angenommen, da mir einfach die Arie des zweiten Akts "Mi tradi quell'alma ingrata" zu hoch liegt und ich mich nicht in eine transponierte Fassung flüchten wollte. Als Rosina in “Il barbiere di Siviglia” © Wiener Staatsoper/ Axel Zeininger Haben Sie den Eindruck, dass Operndirektionen beim Erstellen von Besetzungen auf solche nicht unerheblichen Feinheiten Rücksicht nehmen? Heute ist es doch so, dass Werbung, Werbung und nochmals Werbung im Vordergrund steht, damit man eine Produktion optimal vermarkten kann. Damit hängt doch auch zusammen, dass bei Engagements oft die Optik das entscheidende Kriterium ist. Sie haben gerade das Thema Marketing angesprochen. Sie sind medial eigentlich kaum präsent, haben keine Homepage und nutzen keine Plattformen wie etwa facebook. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Natürlich spielen die Medien eine wichtige Rolle, aber mir ist es wichtig, dass ich mich frei fühle und mein Leben und meine Karriere führen kann, wie ich möchte. Als Komponist in “Ariadne auf Naxos” © Wiener Staatsoper/ Axel Zeininger Im Musikverein haben Sie vor einigen Jahren als Einspringerin einmal einen Liederabend gegeben. Leider war dies in Wien die bisher einzige Möglichkeit, Sie als Konzertsängerin zu erleben. Das Interesse für das Repertoire abseits der Opernbühne wäre aber schon vorhanden? Selbstverständlich! Leider wird das Publikum für diese ganz unspektakuläre Kunstgattung immer weniger, sodass die Veranstalter immer weniger Liederabende ansetzen. Kommen wir noch auf den Beginn Ihrer Karriere, der mit dem Universitäts-Chor zu tun hat. Ich habe für den Chor der Pariser Sorbonne vorgesungen, wurde aber nicht genommen. Rückblickend muss ich sagen, dass dies sogar gut war, denn so habe ich Gesangsstunden genommen. Meine Lehrerin hat mich dann als sehr begabt angesehen und mich ermutigt weiter zu machen, und so kam ich dann an das Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ich stand aber auch schon vor dieser Zeit auf der Bühne, nämlich im Kinderchor, und habe so schon im Alter von 13 Jahren an einer Oper mitgewirkt, aber zu dieser Zeit war Singen einfach ein Hobby. Als Kind war ich schon von Jessye Norman fasziniert und las Artikel über Operndiven. Die Opernwelt war mir daher nie fremd. Ich habe an mich selbst immer hohe Ansprüche gestellt und versuche, das Beste zu geben, sehe mich aber natürlich nicht als Diva. Wenn man Ihre Biographie durchliest zeigt sich, dass sie schon am Beginn Ihrer Karriere an ersten Opernhäusern sangen, aber nie Mitglied eines Ensembles waren. Haben Sie dieses Zugehörigkeitsgefühl nie vermisst? Das Gefühl der künstlerischen Heimat hatte ich in Dresden, wo ich ja sehr viel gesungen habe. Heute ist für mich auch das ständige Reisen nicht mehr so belastend, da ich einen Mann und eine Tochter habe, die mich begleiten. Als Charlotte mit Jonas Kaufmann (Werther) © Wiener Staatsoper/ Michael Pöhn 23 Spielpläne Staatsoper April Staatsoper *Fr. 1.4., 19.30 B: Don Quixote, Abo 5, García Calvo/ Konovalova, Sarkissova, Golibina, Alati, Avraam, Firenze, Sawai, Shishov, Peci, Quiroga *Sa. 2.4., 19.00 Anna Bolena, P, Pidò/ Netrebko, Garanca, Kulman; Meli, D’Arcangelo So. 3.4., 11.00 M: Junge Stimmen 6, Mars; Woldt *19.00 Madama Butterfly, Abo 24, Soltesz/ Cedolins; Talaba, Caria *Mo. 4.4., 20.00 Elektra, Abo 16, Schneider/ Baltsa, Baird, Dussmann; Roider *Di. 5.4., 19.00 Anna Bolena wie 2.4. *Mi. 6.4., 19.30 Das Rheingold, Ring-Zykl., Welser-Möst/ Schuster, Larsson; Uusitalo, Eröd, Konieczny *Do. 7.4., 17.30 Die Walküre, Ring-Zykl., Welser-Möst/ Haller, Johansson, Schuster; Ventris, Anger, Uusitalo *Fr. 8.4., 19.00 Anna Bolena wie 2.4. *Sa. 9.4., 20.00 L’elisir d’amore, García Calvo/ Kurzak; Demuro, Caria, Maestri *So. 10.4., 7.00 Siegfried, Ring-Zykl., Welser-Möst/ Johansson; Gould, Uusitalo, Pecoraro *Mo. 11.4., 19.00 Anna Bolena wie 2.4. *Di. 12.4., 20.00 L’elisir d’amore wie 9.4. *Mi. 13.4., 17.00 Götterdämmerung, Ring-Zykl., WelserMöst/ Johansson; Gould, Halfvarson *Do. 14.4., 19.00 Anna Bolena wie 2.4. *Fr. 15.4., 19.00 Tosca, Abo 6, Halász/ Serafin; Lee, Vratogna Sa. 16.4., 10.30 Publikumsgespräch mit Direktor Marmorsaal Dominique Meyer und Thomas Platzer *19.00 Faust, Altinoglu/ Reinprecht; Alagna, Schrott, Eröd *So. 17.4., 19.00 Anna Bolena wie 2.4. *Mo. 18.4., 19.00 Tosca, Zyklus 6, wie 18.4. *Di. 19.4., 19.00 Faust, Abo 1, wie 16.4. *Mi. 20.4., 20.00 Tosca, Abo 10, wie 15.4. Do. 21.4., 17.30 Parsifal, Zyklus 5, Metzmacher/ Meier; Struckmann, Selig, Ventris Fr. 22.4. Geschlossen Sa. 23.4., 19.00 Faust wie 16.4. So. 24.4., 17.30 Parsifal wie 21.4. Mo. 25.4., 19.30 B: Don Quixote, Florio/ Wang, Poláková, Konovalova, Shepelyeva, Hashimoto, Wallner-Hollinek, Kusch, Cherevychko, Teterin, Dato Di. 26.4., 19.00 Faust, Zyklus 4, wie 16.4. Mi. 27.4., 17.30 Parsifal, Abo 11, wie 21.4. Do. 28.4. Keine Vorstellung Fr. 29.4., 19.00 Nabucco, López-Cobos/ Kushpler, Guleghina; Nucci, Anger, Ilincai 24 Sa. 30.4., 19.00 Don Giovanni, Welser-Möst/ Nylund, Hartelius; D’Arcangelo, Breslik,Bankl Mai Staatsoper *So. 1.5., 19.00 B: Don Quixote wie 25.4. *Mo. 2.5., 20.00 Nabucco, Zykl. 1, wie 29.4. *Di. 3.5., 19.30 Hommage an Jerome Robbins: Glass Pieces, In the Night, The Concert, P, Zykl. Ballettpremieren *Mi. 4.5., 19.00 Don Giovanni, Welser-Möst/ Nylund, Hartelius; D’Arcangelo, Breslik, Bankl *Do. 5.5., 19.30 Hommage an Jerome Robbins *Fr. 6.5., 19.30 Nabucco, Abo 8, wie 29.4. *Sa. 7.5., 20.00 Hommage an Jerome Robbins, Zykl. Meisterchor., Kessels/ So. 8.5., 11.00 M: Junge Stimmen 7, Houtzeel; Ernst *16.00 Don Giovanni, Nachm.Zykl., wie 4.5. *Mo. 9.5., 19.30 Jenufa, WA, Jenkins/ Baltsa, Denoke; Silvasti, Talaba *Di. 10.5., 19.30 Nabucco wie 29.4. *Mi. 11.5., 19.00 Don Giovanni, Abo 9, wie 4.5. *Do. 12.5., 19.30 Jenufa, Abo 17, wie 9.5. *Fr. 13.5., 19.30 L’Italiana in Algeri, Abo 5, Campanella/ Genaux; Pertusi, Camarena *Sa. 14.5., 19.30 Hommage an Jerome Robbins, Zykl. Vielfalt des Balletts *So. 15.5., 19.00 Jenufa, Abo 21, wie 9.5. Mo. 16.5., 19.30 L’Italiana in Algeri, Abo 14., wie 13.5. Di. 17.5., 19.30 Manon, López-Cobos/ Amsellem; Alagna, Dumitrescu, Yang Mi. 18.5., 18.30 Mahler-Vortrag Gilbert Kaplan 20.00 Konzert: 9. Symphonie (Mahler), Gatti Do. 19.5., 19.30 Jenufa, Abo 19, wie 9.5. Fr. 20.5., 19.30 L’Italiana in Algeri, Abo 6, wie 13.5. Sa. 21.5., 19.30 Manon wie 17.5. So. 22.5., 11.00 Christa Ludwig: Meine Komponisten 19.00 Jenufa, Abo 23, wie 9.5. Mo. 23.5., 19.30 L’Italiana in Algeri, Abo 15, wie 13.5. Di. 24.5., 19.00 Simon Boccanegra, Abo 2, Chung/ Cedolins; Nucci, Scandiuzzi, Meli Mi. 25.5., 19.30 Manon, Abo 11, wie 17.5. Do. 26.5., 19.00 L’Italiana in Algeri, Abo 18, wie 13.5. Fr. 27.5., 19.00 Simon Boccanegra wie 24.5. Sa. 28.5., 19.30 Manon wie 17.5. So. 29.5., 14.00 Hommage an Jerome Robbins 20.00 Hommage an Jerome Robbins Mo. 30.5., 19.00 Simon Boccanegra, Abo 16, wie 24.5. 31.5. Keine Vorstellung * OPER LIVE AM PLATZ Übertragung auf den Herbert von Karajan-Platz Spielpläne Staatsoper Juni Staatsoper *Mi. 1.6. Hommage an Jerome Robbins, Abo 10 *Do. 2.6. Simon Boccanegra wie 24.5. *Fr. 3.6. Salome, Zykl. 4, Schneider/ Kulman, Naglestad; Siegel, Stensvold *Sa. 4.6. Eugen Onegin, Güttler/ Kovalevska, Krasteva; Mattei, Brenciu, Anger *So. 5.6. Die Walküre, Welser-Möst/ Merbeth, Johansson, Schuster; Ventris, Anger, Konieczny *Mo. 6.6. Salome wie 3.6. *Di. 7.6. Eugen Onegin, Abo 1, wie 4.6. *Mi. 8.6. B: Giselle, Abo 9 *Do. 9.6. Keine Vorstellung *Fr. 10.6. Eugen Onegin, Abo 5, wie 4.6. *Sa. 11.6. L’elisir d’amore, García Calvo/ Novikova; Németi, Yang, Maestri So. 12.6., 11.00 M: Katja Kabanova *abends Die Walküre wie 5.6. *Mo. 13.6. Eugen Onegin, Nachm.-Zykl., wie 4.6. *Di. 14.6. B: Giselle *Mi. 15.6. Die Zauberflöte, Bolton/ Novikova, Hartig; Zeppenfeld, Bruns, Plachetka *Do. 16.6. B: Giselle, Zykl. Ball.klassiker Fr. 17.6. Kátja Kabanová, P, Welser-Möst/ Magee; Bankl, Voigt, Talaba Sa. 18.6. So. 19.6. Mo. 20.6. Di. 21.6. Mi. 22.6. Do. 23.6. Fr. 24.6. Sa. 25.6. So. 26.6., vormittags abends Mo. 27.6. Di. 28.6. Mi. 29.6. Do. 30.6. B: Giselle Die Zauberflöte, Abo 23, wie 15.6. Kátja Kabanová, Abo 15, wie 17.6. Cavalleria rusticana/I Pagliacci, Abo 3, Jenkins/ Baechle, Pendatchanska; Cura, Maestri Die Zauberflöte wie 16.5. Kátja Kabanová wie 17.6. B: Giselle, Abo 7 Cavalleria rusticana/I Pagliacci wie 21.6. Matinee Ballettschule Wiener Staatsoper B: Giselle, Abo 24 Kátja Kabanová, Abo 14, wie 17.6. B: Nurejew Gala 2011 Cavalleria rusticana/I Pagliacci, Zykl. 6, wie 21.6. Kátja Kabanová, Abo 20, wie 17.6. FREUNDE -Kontingente fett gedruckt weitere Infos www.wiener-ataatsoper.at * OPER LIVE AM PLATZ Übertragung auf den Herbert von Karajan-Platz April 2011 im Theater an der Wien DAS MEDIUM Monodrama von Peter Maxwell Davies | „Miniaturoper in der Hölle“ Regie: Peter Pawlik | Mezzosopran: Annette Schönmüller Premiere: 5. April, 20.00 Uhr | Aufführungen: 7. & 9. April OSTERKLANG ’11 ASRAEL von Josef Suk | Biblische Lieder von Antonín Dvořák Wiener Philharmoniker | Peter Schneider | Magdalena Kožená Freitag, 15. 4., 19.30 Uhr | Theater an der Wien MASS von Leonard Bernstein Eine Produktion der Neuen Oper Wien in Koproduktion mit OsterKlang ’11 17. / 19. / 22. / 25. 4., 20.00 Uhr | Semper-Depot DIE LEGENDE VON DER HEILIGEN ELISABETH Oratorium von Franz Liszt | Wiener Akademie | Martin Haselböck | Wiener Singakademie Mittwoch, 20. 4., 19.30 Uhr | Theater an der Wien LA GIUDITTA Oratorium von Alessandro Scarlatti | Concerto italiano | Rinaldo Alessandrini Karsamstag, 23. 4., 19.30 Uhr | Theater an der Wien DIALOGUES DES CARMÉLITES Dirigent: Bertrand de Billy | RSO Wien | Regie: Robert Carsen Mit Patricia Petibon, Deborah Polaski, Heidi Brunner, Michelle Breedt, Hendrickje van Kerckhove, Yann Beuron, Jürgen Sacher u. a. Premiere: 16. April, 19.00 Uhr | Aufführungen: 18., 21., 24., 27. & 29. April Einführungsmatinee: 10. April, 11.00 Uhr www.theater-wien.at Tageskasse: Theater an der Wien 1060 Wien Linke Wienzeile 6 Täglich 10 - 19 Uhr KLAVIERKONZERTE MOZART VI Klavier & Musikalische Leitung: Stefan Vladar | Wiener KammerOrchester 28. April, 19.30 Uhr 25 Spielpläne Volksoper/ Misterioso April Volksoper 1., 8, 12.4. 2/6/9/11/16/26/29.4. 3/5/13/18/25.4. 4/14/20/24/27.4. 7/ 10.4. 15.4. 17. (P), 19., 21.4. 22.4. 23/30.4. 28.4. Juni Volksoper Die Fledermaus Das Land des Lächelns Die Csárdásfürstin Rigoletto Turandot Tannhäuser in 80 Minuten B: Le Concours Geschlossen My Fair Lady Die Zauberflöte 1/8/11/13/19/23.6. 2., 6., 12., 20.6. 3., 4., 10.6. 5/9/17/21/24/27.6. 7/18/22/26/29.6. 14., 28.5. 15.6. Die lustige Witwe B: Carmen My Fair Lady Der Evangelimann Die lustigen Nibelungen Die Fledermaus Heute im Foyer: Künstler und andere Tiere 16.5. Keine Vorstellung 25., 30.6. Tosca Mai Volksoper 1., 6., 11., 14., 30.5. My Fair Lady 2.5. Tannhäuser in 80 Minuten 3., 4.5. Heute im Foyer: Schon geht der nächste Schwan - Eine Liebeserklärung an die Oper in Anekdoten (Wagner-Trenkwitz) 5/8/12/17/23/26.5. Der König Kandaules (Wiederaufnahme) 7.5. Rigoletto 9.5. operettts 10/15/20/22/25.5 B: Le concours 13., 16., 27.5. Die Fledermaus 18.5. Werkeinführung: Die lustige Witwe 19. (P), 21., 24.5. Die lustige Witwe 28.5. Die Zauberflöte 29.5. Der Evangelimann (Wiederaufnahme) 31.5. Volksoper Tierisch Ballett Premiere im April 17. (P), 19., 21.4. Le Concours (Béjart – Le Bars u. a.) Le Concours, 1985 von Béjarts eigener Kompanie in Paris uraufgeführt, behandelt auf unterhaltsame Weise Probleme, die zum Leben eines Tänzers gehören: Ihre beruflichen und gefühlsmäßigen Beziehungen, aber auch ästhetische Fragen wie der Gegensatz von klassischer Tanzsprache und zeitgenössischen Ausdrucksformen. siehe S. 16 Tatort Bühne – Béjarts Tanz-Krimi in Wien (Verena Franke) weitere Infos www.volksoper.at FREUNDEKontingente fett gedruckt Misterioso Diesmal zu gewinnen: 1) „Man weiß, um welcher Tugend willen Anna von Boleyn das Schafott bestiegen!“ sagt wer zu wem bei Schiller? 2) Welche Persönlichkeit der englischen Geschichte verbindet Anna Bolena, Maria Stuarda und Roberto Devereux? 3) Welcher aus Deutschland stammende Maler war der Hofmaler Heinrichs VIII? ACHTUNG: ALLE 3 Fragen müssen richtig beantwortet werden! Schriftliche Einsendungen per Post, FAX oder e-mail [email protected]! Einsendeschluss: 10.4.2011 26 Auflösung vom letzten Mal 1) Bei Larina findet ein Ball statt. In welcher Oper? Eugen Onegin 2) Welcher „Opernball“ brachte es nie zu Staatsopernehren? Die Operette von Richard Heuberger 3) „No,no, ballar non voglio“ – wer will nicht tanzen? Masetto („Don Giovanni”) Gewinner: Wolfgang Endler, Margit Kraker, Gertrude Lemberg erhalten Franz Schubert: Winterreise/ Adrian Eröd, Eduard Kutrowatz (zur Verfügung gestellt von Gramola) sabtours-Reise Wagners “Ring des Nibelungen” in Helsinki 8 Tage OPERN-FLUGREISE Mo. 5.9. - Mo. 12.9.2011 Finnische Nationaloper, Helsinki Preis pro Person: € 1.650,Einzelzimmerzuschlag: € 395,4 Opernkarten (Parkett): Preis in Ausarbeitung Anmeldeschluss: 15.6. Fachreiseleitung: Rudolf Wallner Hafen von Helsinki Darauf haben viele unserer Musikfreunde schon gewartet! Endlich nimmt die finnische Nationaloper Wagners Tetralogie wieder in den Spielplan auf! Bereits zweimal hatten wir die grandiose Inszenierung von Götz Friedrich im Programm unserer Musikreisen. Und jeder, der diesen Zyklus gesehen hat, wird es bestätigen: Das ist der „Ring aller Ringe“! (Dirigent: Leif Segerstam, Terje Stensvold/Wotan, Catherine Foster/ Brünnhilde, Matti Salminen/Hagen). Natürlich verbinden wir auch diesmal wieder den Besuch der vier Aufführungen mit einem umfangreichen Besichtigungsprogramm in Helsinki und den schönsten und interessantesten Stellen Südfinnlands. Eine Reise der musikalischen, kulturellen und landschaftlichen Höhepunkte – unter kompetenter musik-, landes- und sprachkundiger Leitung! Reiseprogramm Mo. 5.9.: Flug Wien -Helsinki (ab Wien Schwechat 10.45 Uhr an Helsinki 14.10 Uhr Ortszeit), Bustransfer ins Hotel. Abends Besuch der Finnischen Nationaloper: DAS RHEINGOLD. Di. 6.9.: Riihimäki (finn. Glasmuseum), Hämeenlinna (Geburtsstadt von Sibelius), Mittagspause in Hattula, Rückfahrt nach Helsinki über die Sibelius Villa Ainola in Järvenpää. Mi. 7.9.: Vormittags Stadtrundfahrt Helsinki, Nachmittag zur freien Verfügung, Abends Besuch der WALKÜRE Do. 8.9.: Morgens Fahrt nach Turku, älteste Stadt des Landes, anschließend über Häfsund nach Parainenin, per Autofähre auf die Insel Nauvo, Bootsfahrt durch die Schären zur Insel Gullkrona. Gegen Abend Rückfahrt nach Nauvo. Typisch finnisches Abendessen, Übernachtung in Navo. Fr.9.9.: Nach dem Frühstück Rückfahrt aufs Festland nach Naantali (Rundgang und Mittagspause), Rückfahrt nach Helsinki, abends Besuch des SIEGFRIED. Sa. 10.9.: Tagesausflug Tampere, am späteren Nachmittag Rückfahrt nach Helsinki. So. 11.9.: Morgens kurze Fahrt nach Porvoo, Mittagspause und anschließend Rückfahrt, abends GÖTTERDÄMMERUNG. Mo. 12.9.: Morgens Besuch der Museumsinsel Seurasaari, Aufenthalt in Helsinki, nachmittags Transfer zum Flughafen (16.45 Uhr Abflug mit FINNAIR nach Wien, Ankunft um 18.15 Uhr Lokalzeit) Leistungen * Flug Wien - Helsinki - Wien (FINNAIR) * Taxen & Gebühren (€ 47,-) * 6x NF im **** Hotel in Helsinki * 1x HP im *** Hotel in Nauvo * Rundfahrten und Besichtigungen laut Programm (ohne Eintritte) * Schiffsausflug zur Insel Gullkrona * Einführungen mit Musikbeispielen zu allen vier Teilen des RINGS Beratung & Buchung bei sabtours Buchungstelefon: 0732 / 734000 Willkommen in unserer Welt des mediterranen Genusses. Im Novelli verbinden sich Lebensfreude und Begeisterung für kulinarische Genüsse. A-1010 Wien, Bräunerstraße 11 Öffnungszeiten: Mo-Sa 11°° - 01°°,Feiertag 11°° - 01°° Sonntag geschlossen Ideal nach dem Besuch der Oper! Telefon: +43 (0) 1/514 42 00 Fax: +43 (0) 1/512 37 52-50 e-mail: [email protected] www.novelli.at 27 Radio, TV Der Opernsalon der FREUNDE auf 107,3 Volksoper auf 107,3 jeden 1. Samstag im Monat, 14.00 Plácido und Marta Domingo mit Thomas Dänemark am 12. Dezember im Theater an der Wien jeden 3. Sonntag im Monat, 15.00-16.30 Uhr 17.4.: KS Plácido Domingo im Gespräch mit Thomas Dänemark (12. Dezember 2010, Theater an der Wien) Radio Stephansdom www.radiostephansdom.at Solfeggio Fr. 22.00, Wh. Mo. 23.00 1.4. ...und trotzdem noch ein SchumannLiederabend: Schnitzer, Seiffert 8.4. Mozart hat immer Saison! Lenneke Ruiten und Christoph Prégardien singen Konzert-Arien 15.4. Love Songs! Anne Sofie von Otter mit Liebesliedern von und mit Brad Mehldau 22.4. O Tod wie bitter bist du: ein Liederabend zum Karfreitag Robert Holl singt Vier ernste Gesänge (Johannes Brahms) 29.4. Canto a Sevilla Lucia Duchonová - das Opernprogramm auf 107,3/87,7 (Telekabel Wien) 94,5 (Kabel Niederösterreich)/104 bzw. 466 (Salzburg) Ö1 Operngesamtaufnahmen Di/Do/Sa 20.00 Uhr Sa. 2.4. Rossini: L’Italiana in Algeri, Zedda/ Gonzalez, Regazzo (2008) Di. 5.4. Gluck: Orphée et Euridice, López-Cobos/ Flórez, Garmendia, Marianelli (2008) Do. 7.4. Händel: Acis und Galatea, Haselböck/ Bleeke, Perillo, F. Boesch (2007) Sa. 9.4. Mozart: Die Zauberflöte, Jacobs/ Behle, Petersen, Im, Schmutzhard (2009) Di. 12.4. Traetta: Antigona, Rousset/ Bayo, Panzarella, Allemano (2000) Do. 14.4. Verdi: Macbeth, Callegari/ Altomare, Zhuravel, Kudinov (2007) Sa. 16.4. Puccini: Tosca, Quadri/ dall’Argine, Scattolini, Colombo (1951) Di. 19.4. Ditters von Dittersdorf: Giob, Max/ M. Schäfer, Lichtenstein (2000) Do. 21.4. Wagner: Parsifal, Gergiev/ Lehmann, Nikitin, Pape, Urmana (2009) Di. 26.4. Tschaikowsky: Pique Dame, Rostropovich/ Vishnevskaya, Resnik, Gougaloff (1977) Do. 28.4. Verdi: La Traviata, Mehta/ Harteros, Beczala, Gavanelli (2006) Sa. 30.4. Mozart: Le nozze di Figaro, Harnoncourt/ Bonney, Margiono, Lang, Murray, Scharinger, Hampson (1983) Melange mit Dominique Meyer jeden 1. So. im Monat, 15.00 Lieblingsaufnahmen aus dem Archiv des Staatsoperndirektors 3.4. Barockmusik Per Opera Ad Astra (Richard Schmitz) Sa., 14.00, Wh. Mi., 20.00 9.4. Poulenc: Les Dialogues des Carmélites 28 http://oe1.orf.at Gesamtoper Sa. 2..4 Donizetti: Anna Bolena, Pidò/ Netrebko, 19.00 - ca. 22.00 Garanca, Kulman, Meli, d’Arcangelo (LIVE aus der Wiener Staatsoper) Sa. 9.4. Rossini: Le Comte Ory, Benini/ Damrau, 19.30 - ca. 22.00 DiDonato, Resmark, Flórez, Degout, Pertusi (LIVE aus der MET New York) Sa. 16.4. Händel: Rodelinda, Harnoncourt/ de Niese, B. Mehta, Streit, Wolff, Ernman, Rexroth (Theater an der Wien, März 2011) Sa. 23.4. Strauss: Capriccio, Davis/ Fleming, 19.30 - ca. 22.00 Connolly, J. Kaiser, Braun, Larsen, Rose (LIVE aus der MET New York) Sa. 30.4. Smetana: Der Kuß, Kyzlink/ Pribyl, 19.30 – 22.00 Matshikiza, Berger, Baransky u.a. (Opernhaus Wexford, 30. Oktober 2010) Apropos Oper Di/Do/So, ab 15.05 Uhr So. 3.4. Di. 5.4. So. 10.4. Di. 12.4. So. 17.4. Di. 19.4. So. 24.4. Mo. 25.4. Di. 26.4. Die Opernwerkstatt Adrianne Pieczonka Franco Corelli (90. Geburtstag) Oper aus Österreich Aus den Archiven der MET Giuseppe Sinopoli (10. Todestag) Leonard Warren (100. Geburtstag) Das Wiener Staatsopernmagazin Apropos Musik Neu auf CD Stimmen hören Do, ab 19.30 Uhr 7.4. 14.4. 21.4. 28.4. Fidelio: Wien 1805, 1955 - Luzern 2010 Nemorino erotico Im Fokus: Theater an der Wien Zubin Mehta (75. Geburtstag) Radio, TV Ö1-Klassiktreffpunkt Samstag, 10.05 - 11.40 Uhr 2.4. Martin Haselböck 9.4. Elisabeth Orth BR-KLASSIK www.br-online.de/br-klassik Sa. 2.4., 19.00 Donizetti: Anna Bolena (LIVE aus der Wiener Staatsoper) Fr. 8.4., 14.05 Cantabile Franco Corelli (zum 90.Geb.) ORF 2 http://tv.orf.at/ http://presse.orf.at/ So. 3.4., 10.06 Vom Thron zum Schafott Der Lebensweg der Anne Boleyn Di. 5.4., 20.15 Donizetti: Anna Bolena, Pidò/ Netrebko, Garanca, Kulman, Meli, d’Arcangelo (LIVE aus der Wiener Staatsoper) So. 10.4., 10.00 Jerome Robbins - The Concert, Ballett 3sat www.3sat.de Kulturzeit täglich 19.20 (20’) Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SF und ARD Sa. 9.4., 9.50 Donna Leon: Venedig (Wh. von 1997) 20.15 Haydn: Il monde della luna, Harnoncourt/ Genaux, Henschel u.a. (Theater an der Wien, 2009) 23.00 Ein Tenor in Hollywood - Mario Lanza (Wh. von 2009) TW1 www.tw1.at KulturWerk jeden letzten So., 19.45 (20’) Kultur im Gespräch So. 19.45 NEUER KULTURSENDER FÜR ÖSTERREICH! Ab 1. Mai hat Österreich einen neuen Kultursender: "ORF 3- artinfo" heißt der neue Spartenkanal des ORF, der ausschließlich Kultur und Information bringt! Damit ist der frühere Wetter-und Sportkanal TW1 endgültig den Leidenschaften der Kulturfreunden gewidmet und die Opernfreunde werden dabei bestens bedient. Und, besonders erfreulich für Opernfreunde, jeden Sonntag abend ist Opernabend! Der Senderstart ist hochkarätig - bis Anfang September werden alle 22 Mozart-Opern gespielt. Sämtliche Aufnahmen stammen von den Salzburger Festspielen vom Mozartjahr 2006, darunter Sensationsaufführungen mit Stars wie Anna Netrebko, Elina Garanca, Thomas Hampson, Nikolaus Harnoncourt, Ricardo Muti, Michael Schade, Diana Damrau u.v.a.m. KulturWerk Mit Barbara Rett Mo. 2.5., 19.45 Erwin Schrott ATV www.atv.at Highlights jeden So., 19.00 (20’) Mit Erna Cuesta und Franz Zoglauer 3.4. Anna Bolena (Wiener Staatsoper)/ Blackbird (Theater in der Josefstadt) 10.4. Jordan-Mahler-Hampson (Musikverein/ B. Strauß: Das blinde Geschehen (Burgtheater) 17.4. Salome (Osterfestspiele Salzburg)/ Martina Serafin als Tosca (Wiener Staatsoper) 24.4. Triest zwischen Nostalgie und Zukunft arte www.arte-tv.com So. 3.4., 19.15 Liederabend Anna Netrebko (Salzburg ‘09) Di. 5.4., 20.15 Donizetti: Anna Bolena (LIVE aus der Wiener Staatsoper) Mo. 11.4., 22.20 Portrait Georges Pretre (2008) Mo. 18.4., 21.55 Portrait André-Modestre Grétry 22.50 John Neumeiers Hamburg Ballett So. 24.4., 18.05 Marc Minkowski dirigiert Berlioz CLASSICA auf Sky www.classica.de Sa. 2.4., 20.15 Gounod: Roméo et Juliette, Villazón, Machaidze (Salzburger Festspiele) Mo. 4.4., 21.10 Puccini: Tosca, Kabaivanska, Domingo Mi. 6.4., 20.50 Alfano: Cyrano de Bergerac, Domingo, Radvanovsky (Valencia) Mi. 13.4., 20.15 Verdi: Luisa Miller, Renzetti/ Cedolins, M. Álvarez, Nucci (Parma) Do. 14.4., 21.25 Puccini: La Bohème, Karajan/ Freni, G. Raimondi, Panerai (Zeffirelli-Film) Fr. 15.4, 21.05 Verdi: La Traviata, Levine/ Stratas, Domingo, MacNeil (Zeffirelli-Film) Sa. 16.4., 20.15 Donizetti: Roberto Devereux, Haider/ Gruberova, Aronico (München) Do. 21.4., 20.45 Mozart: Lucio Silla, Netopil/ Saccà, Bacelli, Massis, Cangemi (Salzb. Festsp.) Sa. 23.4., 20.15 Busoni: Doktor Faust, Jordan/ Hampson, Kunde, Trattnigg, Groissböck (Zürich) Mo. 25.4., 21.15 Verdi: La forza del destino, Mehta/ Stemme, Licitra, C. Ávarez (Wiener Staatsoper) Di. 26.4., 21.00 Verdi: Nabucco, Oren/ Nucci, Guleghina, Sartori (Verona) Mi. 27.4., 20.15 Beethoven: Fidelio, Mehta/ Meier, Seiffert, Uusitalo (Valencia) Sa. 30.4., 20.15 Lehár: Die lustige Witwe (Auszüge), Thielemann/ Fleming, Maltman (Dresden) 23.15 Così fan tutte, Fischer/ Persson, Leonard, Petibon, Lehtipuu, Bosch, Skovhus (Salzburger Festspiele) 29 Tipps Wien Wiener Musikverein 30 Konzerthaus Bösendorferstrasse 12, 1010 Wien Tel. 505 81 90, www.musikverein.at Mo 4. April, 19.30 Großer Saal Jongen: Symphonie concertante Janácek: Glagolitische Messe Orgonásova, Vermillion, Schade, Holl, Latry (Orgel), ORF RSO Wien Dirigent: Cornelius Meister Do 7. April, 19.30 Großer Saal Mahler: Lieder/ Symphonie Nr. 1 D-Dur Hampson, Gustav Mahler Jugendorchester, Dirigent: Philippe Jordan Fr 8. April, 19.00 Gläserner Saal/ Magna Auditorium Die Presse “Musiksalon” Wilhelm Sinkovicz im Gespräch mit Adrian Eröd Fr 8. April, 19.30 Großer Saal Mahler: Symphonie Nr. 10 Fis-Dur 1.Satz / Das Lied von der Erde Fritz, Hampson, G. Mahler Jugendorchester, Dirigent: Philippe Jordan Sa 9. April, 15.30 Großer Saal Mahler: Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn"/ Symphonie Nr. 1 D - Dur Hampson, Gustav Mahler Jugendorchester, Dirigent: Philippe Jordan Lothringerstr. 20,1030 Wien Tel. 242 002, www.konzerthaus.at So 3. April, 19.30 Mozart-Saal Mozart: Requiem d-moll Rilke: Requiem Schönberg: Dreimal tausend Jahre Brahms: Warum ist das Licht gegeben I. Raimondi, Leutwyler, Bieck, Claessens; Schwab (Rezitation); Junge Philharmonie Wien, Studio Vocale Dirigenten: Michael Lessky, Markus Pfandler So 3. April, 11.00 Di 12. April, 19.30 Mozart-Saal Stefan Mickisch: Ludwig van Beethoven: Fidelio Stefan Mickisch: Klavier, Moderation Mo 11. April, 19.30 Großer Saal Johannespassion von J.S. Bach Petersen, Engeltjes, Lichdi, Mertens The Amsterdam Baroque Orchestra The Amsterdam Baroque Choir Dirigent: Ton Koopman Do 28. April, 19.30 So 1. Mai, 11.00 Mozart-Saal Stefan Mickisch: Ludwig van Beethoven: Missa solemnis Stefan Mickisch: Klavier, Moderation Di 3. Mai, 19.30 Großer Saal CS Wiener Walzer Benefizkonzert A. Reinprecht, Krasznec; Mitglieder der Wiener Symphoniker Dirigent: Martin Kerschbaum Strauß, Lehár, Stolz, Kálmán u.a. Sa 9. April, 20.00 Gläserner Saal/ Magna Auditorium Liederabend Adrian Eröd Klavier: Charles Spencer Liszt, Schumann, Rossini, Kodály und französische Lieder So 10. April, 19.30 Großer Saal Ildikó Raimondi Gábor Boldoczki, Trompete Iveta Apkalna, Orgel Albinoni, Bach, Purcell, Händel u.a. Cineplexx Opera Oper im Kino Für FREUNDE: Reichsbrücke: 269 00 00 Wienerberg: 607 70 70 an der Kinokasse: Euro 27,- statt 30,www.cineplexx.at Mi 13. April, 19.20 Brahms-Saal Barbara Moser, Klavier Giordano, Liszt, Rossini, Viardot, Bizet, Busoni, Verdi Gounod Sa 9. April, 19.00 New York/ Met französisch mit dt. Untertiteln Sa 16. April, 15.30 So 17. April, 11.00 Großer Saal Dvorák: Biblische Lieder Suk: Asrael. Symphonie c-Moll Kozená, Wiener Philharmoniker Dirigent: Peter Schneider Le Comte Ory von Gioachino Rossini Flórez, Damrau, DiDonato, Resmark, Degout Musikal. Leitung: Maurizio Benini Produktion: Bartlett Sher Mi 27. April, 19.30 Do 28. April, 19.30 Brahms-Saal Schubert: Die schöne Müllerin Christian Gerhaher Klavier: Gerold Huber So 1. Mai, 19.30 Großer Saal Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln Breslik, Holl, Langmayer, Haselböck, Petryka, Haumer, Kovács; Arnold Schoenberg Chor, ORF RSO Wien Dirigent: Erwin Ortner Mo 2. Mai, 20.00 Gläserner Saal/ Magna Auditorium The Clarinotts, Angelika Kirchschlager Klavier: Christoph Traxler Beethoven, Strawinsky, Händel, Mozart, Gounod, Ponchielli, Verdi u.a. Sa 30. April, 19.00 New York/ Met italienisch mit dt. Untertiteln Il trovatore von Giuseppe Verdi Radvanovsky, Zajick, M. Alvarez, Hvorostovsky Musikalische Leitung: James Levine Produktion: David McVicar Sa 14. Mai, 18.00 New York/ Met deutsch mit dt. Untertiteln Die Walküre von Richard Wagner Voigt, Kaufmann, Westbroek, Blythe, Terfel, König Musikal. Leitung: James Levine Produktion: Robert Lepage So 29. Mai, 17.00 Ballett: Coppelia von Leo Delibes Choreographie: Sergei Vikharev Tipps Haus Hofmannsthal bis 27. Mai Mo-Mi: 10.00-18.00 Di 5. April, 19.30 Reisnerstr. 37, 1030 Wien Tel.: 714 85 33 www.haus-hofmannsthal.at Ausstellung “100 Jahre Rosenkavalier” Sopranisticated - Von Monteverdi bis Strauss/ Theiss-Eröd, Schullern Klavier: Arabella Cortesi Lea Moderation: Ursula Magnes Do 7. April, 19.30 Freud und Leid auf den Bühnen der Welt - Anekdoten, Geschichten aus dem Musiktheater/ Huber (Sprecher), Foschiatto (Sopran), de Marchi (Klavier) Fr 15. April, 19.30 Walzerklang und Revolution - Präsentation mit Musikwerken u. Bilddokumenten aus dem Wiener Biedermeier Moderation: Helmut Reichenauer Di 26. April, 19.30 Er ist’s! - Was uns Lieder über Blumen und die Liebe erzählen Emà Camie (Sopran), Nemmer (Klavier) Schubert, Schumann, Strauss, Wolf Do 28. April, 19.30 Sylvia Geszty, Königin der Koloratur Markus Vorzellner im Gespräch mit Sylvia Geszty Kunst und Kultur ohne Grenzen Für FREUNDE Tel.: 581 86 40 [email protected] immer 10% Ermäßigung Mi 6. April, 20.30 Stephansdom Mozart Requiem Diamond, Blackwell, Lundy, Caruthers; Baker (Orgel); Youth Performing Arts School Touring Concert Choir Leitung: S. Timothy Glasscock Sa 9. April, 20.30 Stephansdom J.S. Bach: Johannespassion Steinberger, Hölzl, Ernst, Lebeda Domchor St. Stephan Domorchester St. Stephan Dirigent: Dkpm Markus Landerer Fr 15. April, 20.30 Stephandom J. Haydn: Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze Fastenzeitliche Lesung mit Musik Brigitte Karner & Peter Simonischek Solisten des Wiener KammerOrchesters So 24. April, 23.00 Stephansdom Bolschoi Don Kosaken Leitung: Prof. Petja Houdjakov Der Chor aus Opernsolisten spannt einen Bogen vom österreichischen zum russisch-orthodoxen Osterfest Bachgemeinde Wien Sa 9. April, 19.00 Minoritenkirche 1., Minoritenplatz Wiener Volksliedwerk www.bachgemeinde.at J.S. Bach: Johannespassion Kyu Lee, Bankl, Stegmaier, Aldrian, Puhrer; Scholz (Orgelpositiv) Chor der Bachgemeinde Wien, Singkreis Krieglach, Leitung: Ernst Wedam Gallitzinstrasse 1, 1060 Wien Karten und Infos: 0664/ 383 60 96 Mo 11. April, 19.30 Wiener Abend Schrammelmusik, Wiener Lieder, Anekdoten präsentiert von KS Alfred Sramek und dem Wr. Thalia-Quartett Europäische Händel Gesellschaft Karten: Tel.:942 36 43 [email protected] Do 28. April,19.30 Altes Rathaus 1.,Wipplinger Str. 8 20,- (inkl. Empfang) Liebe in zwei Tempi Altmann-Althausen, Raunig Karner (Lesung), Teraoka (Klavier) Liebes -Lieder, Arien, Duette, Gedichte Tirol Tiroler Landestheater Rennweg 2, 6020 Innsbruck Tel.: 0512/ 520 74-0 www.landestheater.at 1.,8.,15. April, 19.30 La fanciulla del West von G. Puccini Musikal. Leitung: Nicholas Milton Regie: Thaddeus Strassberger Prem.: 2. April, 19.30 10.,30. April, 19.30 Elektra von Richard Strauss Musikal. Leitung: Georg Fritzsch Regie. Brigitte Fassbaender 3. April, 11.00 Künstler im Gespräch: Brigitte Fassbaender zum 50jährigen Bühnenjubiläum 6.,14. April, 19.30 Die verkaufte Braut von F. Smetana Musikal. Leitung: Alexander Rumpf Regie: Brigitte Fassbaender 7.,28. April, 19.30 Mein Herr, Othello Tanzstück von Yuki Mori Libretto von Serge Honegger nach William Shakespeare 9. April, 18.00 17. April, 19.30 Eine Nacht in Venedig von J. Strauß Musikal. Leitung: Jan Altman Regie: Dale Albright 31 Tipps Kärnten Stadttheater Klagenfurt 6.,12.,19. April, 19.30 17. Aprl, 15.00 17. April, 11.00 Prem.: 5. Mai, 19.30 Steiermark Theaterplatz 4, 9020 Klagenfurt Tel.: 0463/ 540 64, Fax: /504 663 www.stadttheater-klagenfurt.at Miss Saigon von C.M. Schönberg Musikal. Leitung: Michael Brandstätter Regie: Matthias Davids Matinee: Le nozze di Figaro Le nozze di Figaro von W.A. Mozart Musikal. Leitung: Peter Marschik Regie: Josef E. Köpplinger Grazer Oper 1.,30. April, 19.30 3.,17. April, 15.00 Der Vogelhändler von Carl Zeller Musikal. Leitung: Burkert/ Parise Inszenierung: Michael Schilhan 2.,8.,14.,29. April, 19.00 10. April, 15.00 Faust von Charles Gounod Musikal. Leitung: Evans/ Burkert Inszenierung: Mariame Clement Prem.: 9. April, 19.00 13.,16.,28. April, 19.00 Oberösterreich Landestheater Linz 3.,10.,25. April, 15.00 8. April, 19.30 4.,6.,7. , 11.00 (moderierte Fassung) 29. April, 19.30 7.,12.,16. April, 19.30 2.,23. April, 19.30 6.,13.,24. April, 19.30 Promenade 39, 4020 Linz Tel.: 070/ 7611-400 www.landestheater-linz.at Das schlaue Füchslein von Leos Janácek Musikal.: Leitung: Dennis Russell Davies / Daniel Linton-France Inszenierung: Matthias Davids La Cenerentola von G. Rossini Musikal. Leitung: Marc Reibel/ Takeshi Moriuchi/ Borys Sitarski Inszenierung: Adriana Altaras Lakmé von Léo Delibes Musikal. Leitung: Drcar/ Ingensand Inszenierung: Aurelia Eggers Anna Karenina von S. Rachmaninoff Ballett von Jochen Ulrich Musikal. Leitung: Ingo Ingensand Die Winterreise Ballett von Jochen Ulrich, Musik von Heinz Winbeck nach Franz Schubert Salzburg Salzburger Landestheater Prem.: 3. April, 19.00 9.,30. April, 19.00 5.,13.,28. April, 19.30 19. April, 15.00 Schwarzstr. 22, 5020 Salzburg Tel.: 0662/ 871 512-222, Fax: -290, www.salzburger-landestheater.at Kiss me Kate von Cole Porter Musikal. Leitung Peter Ewaldt Insz.: Andreas Gergen/ Christian Struppeck, Chor.: Simon Eichenberger 23. April, 19.30 24. April, 18.00 12.,15.,20.,29. April, 19.30 32 Don Giovanni von W.A. Mozart Musikal. Leitung: Hussain/ Kelly Inszenierung: Jacopo Spirei L’elisir d’amore von Gaetano Donizetti Musikal. Leitung: Leo Hussain Inszenierung: Nina Kühner Lady Macbeth von Mzensk von Dmitri Schostakowitsch Kooperation mit der Wr. Staatsoper Musikal. Leitung: Johannes Fritzsch Inszenierung: Matthias Hartmann Singin' in the Rain Musik & Songtexte von Arthur Freed & Nacio Herb Brown Niederösterreich Grafenegg Tel.: 02735/ 5500 www.grafenegg.at Sa 9. April, 19.30 Auditorium Die jungen Tenöre - Benefizkonzert zugunsten von “Rettet das Kind NÖ” Hitzeroth, Schmid, Martin So 24.April, 18.30 Auditorium Osterkonzert Haydn: Symphonie C-Dur “Alleluja” Bach: “Jauchzet Gott in allen Landen” Brahms: Serenade Nr. 1 D-Dur Karg, Tonkünstler-Orchester NÖ Dirigent: Bruno Weil Kulturverein Neunkrichen www.kultur-nk.at Kartenvorverkauf: Raiffeisenbanken im Bezirk Neunkirchen Fr 15. April, 19.30 VAZ, Würflacherstr. 1 2620 Neunkirchen Natalia Ushakova Klavier: Christian Koch Violine: Rainer Salzgruber Festspielhaus St. Pölten Franz Schubert-Pl. 2, 3109 St. Pölten Tel.: 02742/ 90 80 80-222 www.festspielhaus.at 9. April, 19.30 Großer Saal J.S. Bach: Johannespassion Freiburger BarockConsort Heilmann, Hunter, Potter, Kamphues, Mammel, Kramer, Hartkopf, Bittner Einführung mit Gottfried Kasparek 18.30, Großer Saal 10., 23. April, 19.00 17. April, 15.00 21.,27. April, 19.30 Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz Tel.: 0316/8000, www.theater-graz.com 11. April, 19.30 Großer Saal 18.30, Großer Saal Charles Ives: The Unanswered Question/ Gustav Mahler: Symphonie Nr. 6 a-moll "Tragische" Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Dirigent: Andrés Orozco-Estrada Einführung mit Reinhold Kubik Chronik KS Alfred Šramek zum 60. Geburtstag Als Bartolo in “Il barbiere di Siviglia” © Wiener Staatsoper/ Axel Zeininger E r kann verschmitzt und ungeheuer witzig sein, ist schlagfertig und ein ganz, ganz großer Komödiant. Dass sich die Wiener Staatsoper in der Bohème offenbar nicht jeweils einen Sänger für den Benoit und den Alcindor leisten kann und Šramek beide Rollen singen lässt, wäre an sich ein Armutszeugnis, ist aber ein besonderes Zuckerl für das Publikum. Er kann wunderbar Anekdoten erzählen, aber er kann auch besonders berühren, was er in der Billy Budd-Wiederaufnahme erneut überzeugend unter Beweis gestellt hat. In den letzten Jahren hat er viel durchgemacht, aber er kam wieder und hat nichts von seinen Qualitäten verloren. Und wenn er einmal nicht angesetzt ist, wird dies von Publikum und Kritik stets ausdrücklich bedauert. 1975 wurde er von der Wiener Staatsoper als Solist engagiert, wo er als 8. Meister und 5. Kapellsänger (Palestrina) debütierte. Sein Repertoire umfasst rund hundert Partien. In einigen Rollen tritt er würdig in die Fußstapfen von Erich Kunz (Mesner in Tosca) und Giuseppe Taddei (Dulcamara), und wir rufen ihn als eines der liebenswürdigsten und verlässlichsten Ensemblemitglieder der Wiener Staatsoper an seinem runden Geburtstag am 5. April lautstark vor den Vorhang! Ad multo annos, lieber Alfred!! evb Als Dansker mit Bo Skovhus (Billy Budd) © Wiener Staatsoper/ Axel Zeininger Kammersänger Alfred Šramek stammt aus Mistelbach, wo er auch heute wieder wohnt, und erhielt seine erste musikalische Ausbildung als Mitglied der Mozartsängerknaben. Er setzte sein Gesangsstudium am Konservatorium der Stadt Wien bei KS Hilde Zadek und KS Peter Klein fort. Zahlreiche Gastspiele führten ihn u. a. zu den Salzburger und Bregenzer Festspielen. Darüber hinaus trat er an der Wiener Volksoper auf und gastierte regelmäßig in Spanien, Deutschland und in den USA. L A B O R DR. D O S T A L Ärztlicher Leiter: Univ. Prof. Dr. Viktor Dostal 1190 WIEN, SAARPLATZ 9 Öffnungszeiten: Mo – Do 7°° - 16³° , Fr 7°° - 16°° Blutentnahme (ohne Voranmeldung): Mo – Fr 7°° - 11°° EKG HAUSBESUCHE ALLE KASSEN Hormonanalytik, Untersuchungen des Immunsystems, Redox-Provokationsanalyse (Nachweis von Regulationsstörungen incl. individueller Rezeptur für fehlende Spurenelemente, Vitamine, Aminosäuren), Fettsäurestatus, Nahrungsmittelunverträglichkeitstests, Darmökologie u.a. TELEFON: 01/368 24 72 FAX: 01/369 12 69 e-mail: [email protected] Alle Veranstaltungen auf einen Blick April Di. 5. ODER Mo. 11.4., 19.00 Uhr Gaetano Donizetti: Anna Bolena Wiener Staatsoper Reservierte Karten im FREUNDE-Büro Juni So. 12.6., 11.00 Uhr Matinee: Katja Kabanova Wiener Staatsoper 1 Karte pro Mitglied, Bestellschluss: 28.3., Karten ab 3.5. im FREUNDE-Büro So. 10.4., 11.00 Uhr Künstlergespräch: Elina Garanca Wiener Staatsoper Karten ab 29.3. im FREUNDE-Büro Do. 23.6., abends Leos Janacek: Katja Kabanova Wiener Staatsoper Franz Welser-Möst/ Emily Magee, Deborah Polaski; Klaus Florian Vogt, Marian Talaba, Wolfgang Bankl (Neuinszenierung: André Engel) 1 Karte pro Mitglied, Bestellschluss: 28.3., Karten ab 3.5. im FREUNDE-Büro So. 10.4., 19.00 Uhr Giacomo Puccini: Turandot Volksoper Reservierte Karten im FREUNDE-Büro Mai So. 8.5., 11.00 Uhr/ o bestellt Matinee: Musical meets Opera II Ronacher (1010, Seilerstätte 9) Karten ab 12.4. im FREUNDE-Büro Juli Do. 14. - So. 17. Juli 2011 FREUNDE-Reise in die Provence Anmeldeschluss: 28.2. Sa. 14.5., 11.00 Uhr/ o bestellt Künstlergespräch: KS Agnes Baltsa Gustav Mahler-Saal Karten ab 3.5. im FREUNDE-Büro Offenlegung nach §25 Mediengesetz Unternehmensform: Unternehmensgegenstand: Herausgabe und Vertrieb des Monatsprogrammes: Erklärung über die grundlegende Richtung: Freunde der Wiener Staatsoper A-1010 Wien, Goethegasse 1 Telefon (+43 1) 512 01 71 Telefax (+43 1) 512 63 43 Verein der Freunde der Wiener Staatsoper, Goethegasse 1, A-1010 Wien Verein Information und Wahrnehmung der Interessen der Freunde der Wiener Staatsoper Freunde der Wiener Staatsoper Mitglieder über die Tätigkeit des Vereins zu informieren IMPRESSUM Chefredakteur Redaktion Elisabeth Janisch (Serviceteil) Dr. Hubert Partl (Lektorat) Redaktionelle Gestaltung Layout / Konzeption: Öffnungszeiten Mo/Mi 15.00 - 17.00 Uhr Di/Do 15.00 - 19.00 Uhr Fr/Sa 10.00 - 12.00 Uhr Dr. Rainer Wiesinger (Schwerpunktbeiträge, Porträt, Rezeption, Schon gehört), Dr. Richard Schmitz (Diskographien), Mag. Eva Beckel (Misterioso, Chronik, Lektorat), [email protected],www.opernfreunde.at ZVR Zahl: 337759172 Dr. Heinz Irrgeher Litho und Druck: Bildnachweis: Mag. Michaela Zahorik factory vienna; creative „agensketterl“ Druckerei GmbH, 3001 Mauerbach AFP, AP, Associated Press, Decca, DG/ Felix Broede/Gabo, Foto Fayer, Patrick Nin, Volksoper Wien, Wiener Staatsoper GmbH/ , Michael Pöhn, Axel Zeininger, Gedruckt auf Hello silk 135/170 gr/m≈, der PTV Paper Trade Vienna GmbH geliefert von 34 Redaktionsschluss: 1.3.11, Besetzungs- und Programmänderungen, Druckfehler vorbehalten
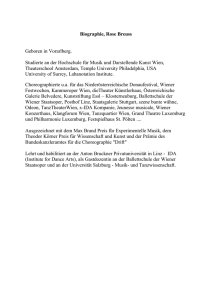

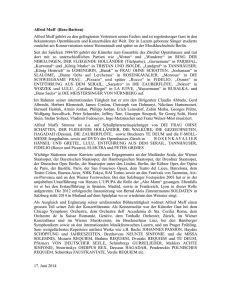
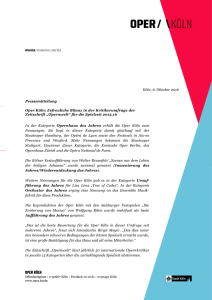

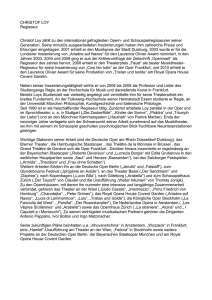
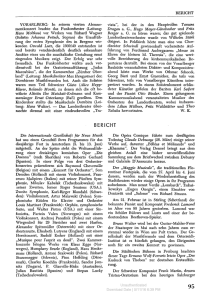

![alpines museum newsletter [januar- februar 2016]](http://s1.studylibde.com/store/data/001004943_1-01612c27e56c494f0cac36031d1926fb-300x300.png)