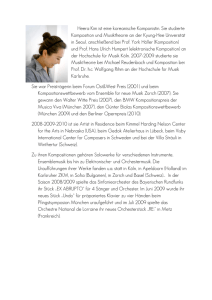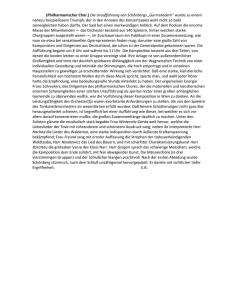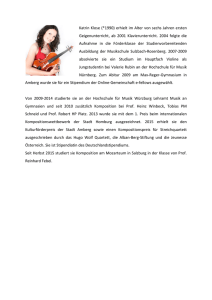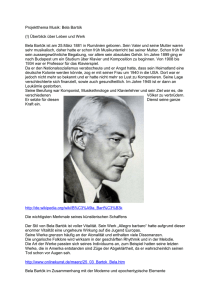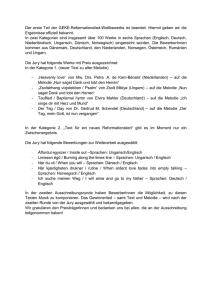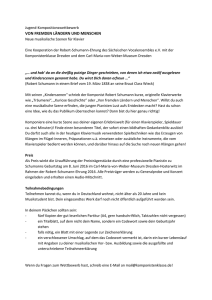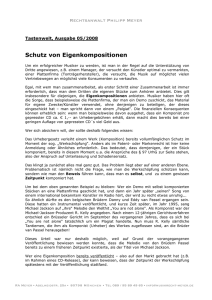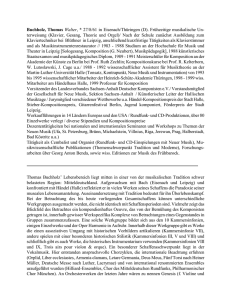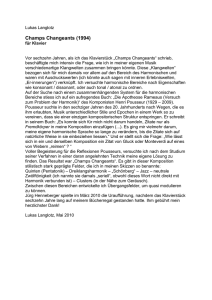Haas: Gute Stücke?
Werbung
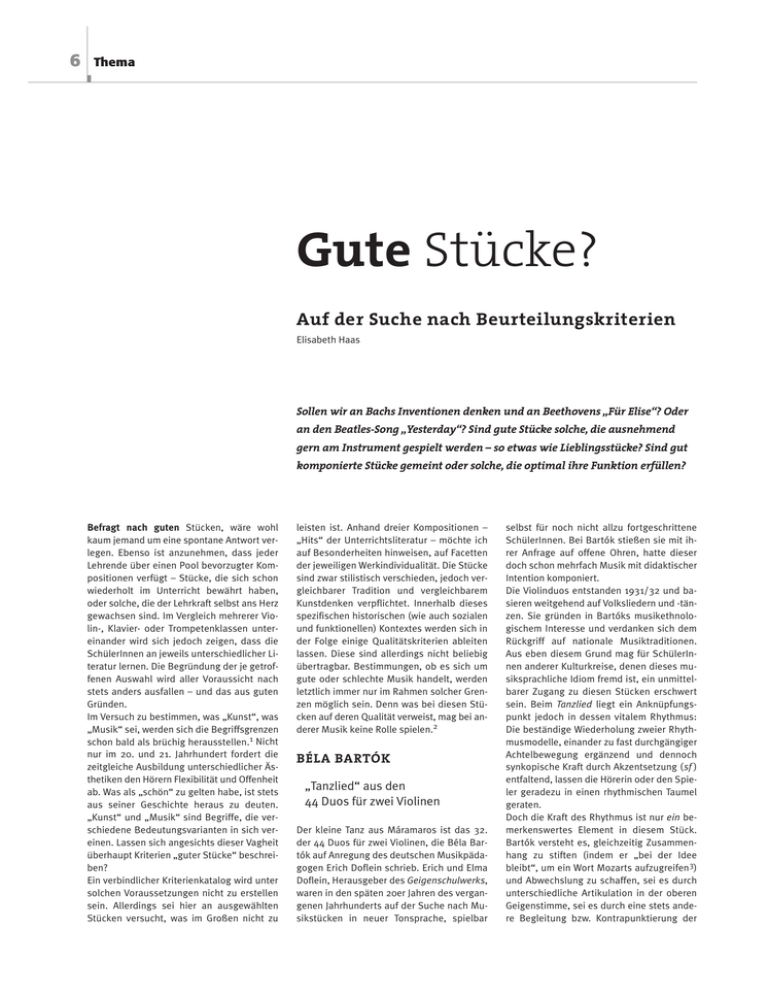
6 Thema Gute Stücke? Auf der Suche nach Beurteilungskriterien Elisabeth Haas Sollen wir an Bachs Inventionen denken und an Beethovens „Für Elise“? Oder an den Beatles-Song „Yesterday“? Sind gute Stücke solche, die ausnehmend gern am Instrument gespielt werden – so etwas wie Lieblingsstücke? Sind gut komponierte Stücke gemeint oder solche, die optimal ihre Funktion erfüllen? Befragt nach guten Stücken, wäre wohl kaum jemand um eine spontane Antwort verlegen. Ebenso ist anzunehmen, dass jeder Lehrende über einen Pool bevorzugter Kompositionen verfügt – Stücke, die sich schon wiederholt im Unterricht bewährt haben, oder solche, die der Lehrkraft selbst ans Herz gewachsen sind. Im Vergleich mehrerer Violin-, Klavier- oder Trompetenklassen untereinander wird sich jedoch zeigen, dass die SchülerInnen an jeweils unterschiedlicher Literatur lernen. Die Begründung der je getroffenen Auswahl wird aller Voraussicht nach stets anders ausfallen – und das aus guten Gründen. Im Versuch zu bestimmen, was „Kunst“, was „Musik“ sei, werden sich die Begriffsgrenzen schon bald als brüchig herausstellen.1 Nicht nur im 20. und 21. Jahrhundert fordert die zeitgleiche Ausbildung unterschiedlicher Ästhetiken den Hörern Flexibilität und Offenheit ab. Was als „schön“ zu gelten habe, ist stets aus seiner Geschichte heraus zu deuten. „Kunst“ und „Musik“ sind Begriffe, die verschiedene Bedeutungsvarianten in sich vereinen. Lassen sich angesichts dieser Vagheit überhaupt Kriterien „guter Stücke“ beschreiben? Ein verbindlicher Kriterienkatalog wird unter solchen Voraussetzungen nicht zu erstellen sein. Allerdings sei hier an ausgewählten Stücken versucht, was im Großen nicht zu leisten ist. Anhand dreier Kompositionen – „Hits“ der Unterrichtsliteratur – möchte ich auf Besonderheiten hinweisen, auf Facetten der jeweiligen Werkindividualität. Die Stücke sind zwar stilistisch verschieden, jedoch vergleichbarer Tradition und vergleichbarem Kunstdenken verpflichtet. Innerhalb dieses spezifischen historischen (wie auch sozialen und funktionellen) Kontextes werden sich in der Folge einige Qualitätskriterien ableiten lassen. Diese sind allerdings nicht beliebig übertragbar. Bestimmungen, ob es sich um gute oder schlechte Musik handelt, werden letztlich immer nur im Rahmen solcher Grenzen möglich sein. Denn was bei diesen Stücken auf deren Qualität verweist, mag bei anderer Musik keine Rolle spielen.2 BÉLA BARTÓK „Tanzlied“ aus den 44 Duos für zwei Violinen Der kleine Tanz aus Máramaros ist das 32. der 44 Duos für zwei Violinen, die Béla Bartók auf Anregung des deutschen Musikpädagogen Erich Doflein schrieb. Erich und Elma Doflein, Herausgeber des Geigenschulwerks, waren in den späten 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf der Suche nach Musikstücken in neuer Tonsprache, spielbar selbst für noch nicht allzu fortgeschrittene SchülerInnen. Bei Bartók stießen sie mit ihrer Anfrage auf offene Ohren, hatte dieser doch schon mehrfach Musik mit didaktischer Intention komponiert. Die Violinduos entstanden 1931/32 und basieren weitgehend auf Volksliedern und -tänzen. Sie gründen in Bartóks musikethnologischem Interesse und verdanken sich dem Rückgriff auf nationale Musiktraditionen. Aus eben diesem Grund mag für SchülerInnen anderer Kulturkreise, denen dieses musiksprachliche Idiom fremd ist, ein unmittelbarer Zugang zu diesen Stücken erschwert sein. Beim Tanzlied liegt ein Anknüpfungspunkt jedoch in dessen vitalem Rhythmus: Die beständige Wiederholung zweier Rhythmusmodelle, einander zu fast durchgängiger Achtelbewegung ergänzend und dennoch synkopische Kraft durch Akzentsetzung (sf ) entfaltend, lassen die Hörerin oder den Spieler geradezu in einen rhythmischen Taumel geraten. Doch die Kraft des Rhythmus ist nur ein bemerkenswertes Element in diesem Stück. Bartók versteht es, gleichzeitig Zusammenhang zu stiften (indem er „bei der Idee bleibt“, um ein Wort Mozarts aufzugreifen3) und Abwechslung zu schaffen, sei es durch unterschiedliche Artikulation in der oberen Geigenstimme, sei es durch eine stets andere Begleitung bzw. Kontrapunktierung der 8 Thema Béla Bartók: „Tanzlied“ aus den 44 Duos für zwei Violinen © 1933 by Universal Edition A. G., Wien/UE 10452 A/B dass die Freude an der Bewegung auch spieltechnisch umgesetzt werden kann, muss kaum betont werden. Dabei wird Instrumententypisches letztlich auch in musikalischen Sinn umgewandelt, wie die einleitenden Quinten zeigen. ROBERT SCHUMANN *** aus dem „Album für die Jugend“ op. 68 Melodiestimme. Harmonisch bewegt sich das Stück in zwei Sphären, D und A. Somit legitimiert sich der musikantische Anfang im Sinn einer „Stimm-Geste“ – die Quinte d'-a' – im Rückblick als harmonischer Keim. Die Komposition ist im Ganzen gesehen auf kontinuierliche Steigerung hin angelegt: Nach zweistimmigem Beginn (beide Instrumente spielen den Doppelgriff d-a in identischer Lage) entwickelt sich der Satz zur Dreiund Vierstimmigkeit. Ein kanonartiger Abschnitt, gebildet aus dem synkopischen Rhythmus-Motiv, verflüssigt die in sich geschlossene viertaktige Melodie-Struktur, die mit Elementen des Öffnens und Schließens an die klassische Periode gemahnt. Reprisenartig wird die Tanzmelodie wieder aufgenommen, allerdings mit veränderter Gegenstimme: Statt Synkopenrhythmus ist nun eine Kette nachschlagender Achtel gesetzt – dem „festen“ Zustand der Melodie wird durch eine drängende Begleitung gegengesteuert. Der Schlussabschnitt verdichtet sich zur Fünfstimmigkeit, ein weiteres Mal erscheint das Synkopenmotiv als rhythmischer Kanon. Im letzten Takt wird mit der halben Note a' die sich ständig steigernde rhythmische Bewegung vehement angehalten, um deren geballte Energie in der abschließenden Synkope zu entladen, in welcher – nach dynamischer Zurücknahme im Reprisen- und anschließenden Schluss-Teil – der kraftvolle Ton des Anfangs wiederkehrt. Dem beschriebenen kompositorischen Beziehungsreichtum entspricht eine Ausdrucksund Erlebnisintensität, der sich kaum jemand zu entziehen vermag: unbändige Bewegungsenergie sowie Freude am spielerischen Umgang mit Klang. Dass die gesamte Komposition auch geigentechnisch gut „liegt“, Die Nummer 21 aus Schumanns Album für die Jugend ist eines jener Stücke, in welchen ein konkreter Titelhinweis ausgespart bleibt; wofür die drei als Titel gesetzten Sterne stehen könnten, darüber schweigt selbst Clara Schumann.4 Gemeinsam sind diesen Klavierstücken ein ruhiges Grundtempo und eine verhaltene Lautstärke. Am Gesang orientierte Melodiestrukturen lassen an Lieder ohne Worte denken. In der Tat erinnert der Anfang der Nummer 21 an das Eingangslied aus Schumanns Liederzyklus Dichterliebe, „Im wunderschönen Monat Mai“. Bernhard Appel dagegen sieht den Stückbeginn in einem Zusammenhang mit dem Terzett „Euch werde Lohn in bessern Welten“ aus Beethovens Fidelio.5 Beherrschendes Thema ist eine kantable Melodie, die mehrfach beinahe unverändert wiederkehrt. Sie spannt einen großen Bogen über die ersten vier Takte; dabei zeigt das aufstrebende Melodie-Motiv des Anfangs (a'h'-c'') öffnenden Charakter, der zweite Melodieteil (T. 3/4) – im Wesentlichen fallend – führt zu melodischem Abschluss. In harmonischer Hinsicht erreicht man nach festgefügtem Anfang – die ersten beiden Takte ruhen, getragen von einer Kadenz (II-V-I), in sich – über einen Sekundakkord der II. Stufe die Dominante. Wollte man die ersten vier Takte im Sinn einer Periode deuten, wäre an dieser Stelle von einem Halbschluss zu sprechen; allerdings entzieht die weitere harmonische Entwicklung dieser Deutung jeglichen Sinn. Es ist insbesondere die Harmonik, die diesem Stück seinen Reiz und seine unverwechselbare Eigentümlichkeit gibt. Das lässt sich in Takt 3 bereits einem winzigen Detail entnehmen: Überraschend mag hier das Auflösungszeichen vor f ' anmuten,6 war doch bislang der Ton f noch nie zu fis erhöht worden. Dieser zweite Melodieteil trägt tatsächlich eine starke Tendenz zu einer Modulation nach G in sich; der Sekundakkord als Dur-Klang würde nach G-Dur führen. Dass Schumann Thema üben&musizieren 5 11 Robert Schumann: *** aus dem „Album für die Jugend“ op. 68 Epilog vorgesehen hatte, gebildet aus viermaliger Wiederholung des ersten Melodieteils.8 Dieses Nachspiel war sogar noch in der Stichvorlage vorhanden. Schumann könnte die Notwendigkeit eines solchen Epilogs aus der doch sehr starken Verkürzung des mittleren Abschnitts abgeleitet haben. Auffallend ist, dass der Melodieverlauf hier zwar geringfügige Abweichungen aufweist, die Schlüsse jedoch nicht wie auf vorhergehende Art in jeweils andere harmonische Sphären führen. Dieses zwar souverän komponierte, jedoch nicht vollständig den Verlauf der Komposition erfüllende Ende wurde von Schumann schließlich verworfen; wahrscheinlich wäre die Anfangsidee durch dieses Ende nachträglich relativiert worden. CAMILLE SAINT-SAËNS „Der Schwan“ aus „Karneval der Tiere“ dieser Möglichkeit hier so starke Bedeutung zumisst und ein Auflösungszeichen setzt, legitimiert sich aus dem Folgenden. An jeweils vergleichbarer Stelle wird eine für diese Komposition wesentliche Entwicklung in Gang gesetzt: Die Schlusswendungen werden stets in neuem Sinn harmonisiert (a-Moll in T. 6; E-Dur in T. 8). Fast traumwandlerisch gelangt man so in immer neue Klangsphären, das Vertraute kann unter jeweils anderem Blickwinkel wahrgenommen werden.7 In der Reprise (T. 13 ff.) wird diese Tendenz noch verstärkt; der erste Melodieteil findet zu keinem Tonikaschluss mehr, C – nunmehr als dominantischer Quintsextakkord – strebt zum Folgeklang F. Die Verbindung der beiden Melodieteile wird gleichzeitig durch ein neu eingeführtes (wenngleich aus Früherem ableitbares) chromatisches, rhythmisch prägnantes Dreiton-Motiv unterstrichen. Der vier- taktige thematische Anfangsteil ist hier auf sechs Takte gedehnt, die eingefügten Takte lassen infolge ihrer kontrapunktischen Setzweise die Verlängerung in Dichte und Komprimierung umschlagen. Zwischen Anfangsteil und Reprise, beide in sich fest gefügt, verflüssigt sich der Satz. Ein aus den melodischen Strukturen des Themas gewonnenes Motiv, geprägt durch das Intervall der Sexte, wird mehrfach sequenziert. Die Sequenzen bleiben aber auf den Motivkopf beschränkt, der Ablauf ist an dieser Stelle gerafft (darin liegt auch einer der Gründe des nun drängenden Charakters). Die Raffung allerdings bereitet die Dehnung des nachfolgenden Teils vor – den Proportionen wird durch solche Methoden ihr rechtes Maß gegeben. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass Schumann zunächst einen weitläufigen Saint-Saëns’ zoologische Fantasie verdankt ihre Ausarbeitung einer Faschingsveranstaltung des Jahres 1886, welcher diese 14 kleinen Stücke zugedacht waren. Nach einigen Aufführungen distanzierte sich der Komponist allerdings von dieser Komposition und verbot weitere öffentliche Darbietungen zu seinen Lebzeiten. Einzig Der Schwan – bereits im Folgejahr der Uraufführung publiziert – blieb von diesem Verdikt ausgenommen. Die Beliebtheit dieses Stücks dauert bis heute ungebrochen fort; nicht nur Generationen von jüngeren und älteren CellistInnen erprobten und erproben ihr Können an der weit strömenden Melodie, die sich über fließender Harmonik ausbreitet, sondern ebenso SpielerInnen anderer Instrumente, die auf eine stattliche Anzahl von Bearbeitungen zurückgreifen können. Wahrscheinlich ist das Studium bearbeiteter Versionen sogar Standard: Ursprünglich für zwei Klaviere und Violoncello solo geschrieben, wird die Komposition im Musikschulalltag vermutlich nur selten in ihrer Originalfassung zu hören sein. Dennoch sei hier zunächst vom Original ausgegangen. Die im Karneval skizzierten Tiere scheinen einem „dicken Pinsel“ entsprungen zu sein: Suggestiv in Klang umgesetzt, treten die im Titel angekündigten Hühner und Hennen, Kängurus und Esel geradezu bildhaft vor unsere Augen. Saint-Saëns’ Stücke stehen in einer Tradition von Capriccios und Fantasien, die spätestens mit den musikalischen Tier- 9 10 Thema Camille Saint-Saëns: „Der Schwan“ aus „Karneval der Tiere“ imitationen Jean-Philippe Rameaus, François Couperins oder Alessandro Pogliettis in Mode gekommen sind. Dass neben Cancan tanzenden Schildkröten auch Fossilien und Pianisten den Saint-Saëns’schen zoologischen Garten bevölkern, zeugt von Humor, der einer Capriccio-Form durchaus entspricht. Das Bild des Schwans, das Saint-Saëns klanglich zeichnet, strahlt Ruhe, beinahe Lautlosigkeit aus; mit majestätischer Gelassenheit zieht der edle Vogel seine Spur durch die stille Wasseroberfläche. Wie gelingt es Saint-Saëns, einer solchen Ruhe musikalisch zu entsprechen? Durch ausgewogene Proportionen zwischen den einzelnen Stückteilen wird ein Zustand innerer Balance erreicht; die Musik weist eine klar strukturierte Formung auf. Nach einem Einleitungstakt, in welchem sich die Harmonie des TonikaKlangs fluktuierend ausbreitet, entfaltet sich die Melodie in acht Takten, periodenhafte Züge aufweisend, in wesentlichen Punkten jedoch nicht einer Periode entsprechend (wie beispielsweise ein Verhältnis von Öffnen und Schließen nicht erfüllt ist). Sequenzierung und (leicht variierte) Wiederholung bestimmen die folgenden acht Takte, bis in der Reprise die Form geringfügig gedehnt und die Komposition zu ihrem Abschluss gebracht wird. Die Harmonie entwickelt sich zunächst über einem Orgelpunkt (als probatem Mittel des Beharrens und Auf-der-Stelle-Tretens), wobei in den ersten Takten eine Kadenz (I-II-V7-I) das Stück, kaum dass es begonnen hat, gleich wieder zu seinem Ende zu bringen droht. Wäre in der Melodiestimme in Takt 5/6 der Leitton fis in den Grundton und nicht – wie bei Saint-Saëns – in die Terz weitergeführt, wäre es wohl schwer, überhaupt Bewegung in das musikalische Geschehen zu bringen. Dass dieser Anfang enge Berührungspunkte mit dem berühmten C-Dur-Praeludium Johann Sebastians Bachs aufweist, ist wohl kein Zufall. Vielleicht war es sogar Charles Gounods 1853 erfolgte Umformung dieses Praeludiums zum Welthit Ave Maria, die einen Initialimpuls zu Saint-Saëns’ Komposition gab.9 Saint-Saëns’ Melodie ist jedoch kleinräumiger artikuliert und beansprucht kaum einen vergleichbar großen Raum wie Gounods Méditation. In klanglicher Hinsicht zieht sich ein Bogen über das gesamte Stück: Stückbeginn und -ende sind – die Lage betreffend – identisch. In der Melodiestimme wiederum herrscht ein Streben nach Gleichgewicht in den Bewegungsrichtungen vor. Tonleiterstrukturen lie- Thema üben&musizieren 5 11 gen modellhaft der Melodie zugrunde; in den ersten beiden Takten befinden sich die Bewegungsrichtungen im Ausgleich: Einem fallenden Tetrachord ( g'-fis'-e'-d', T. 2) wird mit einem steigenden Tetrachord geantwortet ( ga-h-c', T. 2/3). Insgesamt bleiben allerdings im ersten Teil (bis T. 9) die steigenden Tendenzen in der Überzahl. Anders in der Reprise: Hier gewinnen die fallenden Tendenzen breiteren Raum, steigende und fallende Kräfte gleichen einander fast vollständig aus.10 Ist es die Funktion des Anfangs, die Komposition in Bewegung zu bringen – in melodischer, harmonischer und rhythmischer Hinsicht (auf das Steigen der Melodie in die Terz h' in T. 5 als Bewegungsimpuls wurde zuvor schon hingewiesen; harmonisch bewegt sich der Anfangsteil nach h-Moll, das sich allerdings nicht längerfristig als neue Tonika etablieren kann) –, so ist dem nachfolgenden Teil Instabilität angemessen. Der zweite Teil bleibt ohne konkreten harmonisch-tonalen Bezug: Zunächst sind durch Sequenzierung festgefügte harmonische Zustände aufgegeben; schließlich reduziert sich die Musik – in bloßem harmonischen Schwanken – auf den Wechsel zwischen D und A, in stets anderem Licht ausgeleuchtet (T. 14-17). Erneute Stabilisierung zu schaffen, steht dem Schlussteil zu. Über fünf Takte breitet sich am Ende die Tonika G aus, unter kurzer Berührung der Dominante, mit e als Sixte ajoutée angereichert. In rhythmischer Hinsicht erreicht die Melodie in Takt 4 durch kleinere Notenwerte größere Beweglichkeit; dieser Teil bleibt ab Takt 22 ausgespart. Die beiden Klavierstimmen der Originalfassung beschränken sich weitgehend auf die Ausbreitung eines klanglichen Gewebes. Durch die raschere Aufeinanderfolge der Töne der arpeggierten Klänge des zweiten Klaviers – zum Teil die Mittellage des ersten Parts übersteigend – funkeln in der gleichmäßig fließenden Begleitung Blitzlichter auf, gleich plötzlichen Reflexionen des Lichts auf der Wasseroberfläche. Im Mittelteil reduziert sich die Stimme des zweiten Klaviers im Wesentlichen auf bloße Tonwiederholungen in Oktaven, zunehmend durch mehr Pausen unterbrochen. Schließlich verdichtet sich der Satz in beiden Klavieren vorübergehend (T. 22), wodurch sich das Fluktuieren im Inneren eines (halbtaktig) stehenden Klangs verstärkt. Diese Verdichtung bereitet den zum Abschluss führenden Wiedereinsatz der Tonika vor. In bearbeiteter Fassung für Klavier und Violoncello ist der Klavierpart zumeist auf die erste Klavierstimme beschränkt. Dadurch bleiben der harmonische Ablauf und der musikalische Fluss zwar gewahrt, allerdings gehen aufhellende, kolorierende Details verloren. Problematischer als der Verzicht auf die zweite Klavierstimme ist jedoch eine Bearbeitung für andere, die Lage des Violoncellos übersteigende Instrumente. Die Melodie, im Original tonhöhenmäßig in die Begleitung eingewoben, überlagert diese nun. Ein solcher Eingriff verändert den klanglichen Eindruck wesentlich. Ebenso prekär ist der abgeänderte Tempohinweis, wie er in der Ausgabe für Violine oder Flöte und Klavier der Edition Durand gedruckt steht: Im Notentext findet sich die Vorschrift „Adagio“ statt des originalen „Andantino grazioso“. Ist der anmutig gleitende Schwan hier ins PathetischSentimentale gekippt? QUALITÄT IM JEWEILIGEN KONTEXT Musik artikuliert sich auf unterschiedliche Art und Weise: Differenzierende Beurteilung ist daher notwendig. Schon die letzten Hinweise zeigen, wie Veränderungen die Stimmigkeit einer Komposition gefährden können. Sofort wird spürbar, dass ein kompositorisch vollkommener Zustand in einen weniger vollkommenen übergeht. Zweifellos lässt sich daran ein Qualitätsverlust erkennen. Insofern kommen wir dem Versuch, Qualität zu bestimmen, einen Schritt näher. Aber auch positiv lassen sich Qualitätsmerkmale formulieren: In allen drei Stücken bleibt die Folgerichtigkeit des inneren musikalischen Sinns vom Beginn bis zum Ende gewahrt, tragen Details der Komposition zu deren stimmigem Ganzen bei. Bei allem Streben nach Zusammenhang wird jedoch auch gleichzeitig Abwechslung durch variativen Umgang mit Einzelheiten geschaffen. Proportionen werden gewahrt, Funktionen der einzelnen Abschnitte erfüllt. Die eingesetzten kompositorischen Mittel entsprechen dem intendierten Ausdruck; oder besser gesagt: Sie machen Ausdruck überhaupt erst möglich. Stücke wie diese sind komplexe, keine eindimensionalen Gebilde. Was hier bei Kompositionen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts – artifizieller Musik mit ästhetischem Anspruch – Gültigkeit besitzt, wird selbst bei Musik aus eben dieser Zeit, wenn sie jedoch anderen Bedürfnissen, Funktionen oder Zwecken zu entsprechen hat, völlig oder zumindest zum Teil ohne Relevanz sein.11 Gute Stücke? Sie sind be- schreibbar, allerdings nur unter Berücksichtigung jenes spezifischen Kontexts, in welchem die Musik jeweils steht. 1 Zur Problematik der Bestimmung ästhetischer Grundbegriffe siehe u. a. Ulrich Pothast: „Krise der ästhetischen Grundbegriffe? Bemerkungen zu einem nur scheinbar neuen Problem“, in: Marie-Agnes Dittrich/ Reinhard Kapp: Anklaenge 2010. Wiener Jahrbuch für Musikwissenschaft, Wien 2011, S. 181-189. 2 Grundsätzliche Überlegungen zur Problematik der Abgrenzung zwischen guter und schlechter Musik siehe: Hans Heinrich Eggebrecht: „Gute und schlechte Musik“ sowie Carl Dahlhaus: „Gute und schlechte Musik“, in: dies.: Was ist Musik?, Wilhelmshaven 1985, S. 79-87 und S. 88-100. 3 Wolfgang Amadeus Mozart, Brief an seinen Vater vom 14. Mai 1778, in: Mozarts Briefe, nach den Originalen hg. von Ludwig Nohl, Salzburg 1865, S. 155-158; zit. nach www.zeno.org/nid/20007764758 (18.7.2011). 4 Zu Robert Schumanns Album für die Jugend siehe Bernhard R. Appel: Robert Schumanns „Album für die Jugend“. Einführung und Kommentar, Zürich/Mainz 1998; zur Nummer 21 siehe S. 131-133. 5 ebd., S. 132. 6 Das Auflösungszeichen findet sich in der zweiten Auflage der Erstausgabe von 1850, die – von Schumann durchgesehen und korrigiert – als Endfassung gilt. Zur Bedeutung der Druckfassung von 1850 als Quelle siehe Ernst Herttrich: „Bemerkungen“ (= Kritischer Kommentar) zu Robert Schumanns Album für die Jugend op. 68, München 2007, S. 84 f. 7 Das Verfahren, stets neue Schlusswendungen bei (nahezu) identischer Melodie herbeizuführen, wandte Schumann z. B. auch in der Träumerei aus Opus 15 an. 8 s. Appel, S. 132. 9 Die erste Fassung von Gounods Méditation sur le 1er prélude de piano de J. S. Bach ist für Klavier, Violine/ Violoncello und Orgel/Violoncello ad libitum gesetzt. Die Textunterlegung und Umarbeitung zur Vokalfassung erfolgte erst 1859. Die Erstfassung könnte in Anlage und Instrumentation unmittelbaren Einfluss auf die Komposition des Schwans genommen haben – dies umso mehr, als der Karneval der Tiere vermutlich bereits auf die Zeit von Saint-Saëns’ Tätigkeit als Klavierlehrer an der École Niedermeyer (1861-65) zurückgeht, somit also in zeitlicher Nähe zur Entstehung der Méditation steht. Immerhin ist Gounods Einfluss auf den Opernkomponisten Saint-Saëns belegt. Siehe dazu auch Peter Jost: Art. Saint-Saëns, (Charles-)Camille, in: Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil Bd. 14, Sp. 804 und 816 sowie Manuela Jahrmärker, Art. Gounod, Charles François, in: Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil Bd. 7, Sp. 1434. 10 Gleichwohl schließt die Melodie in einem (schematisch gesehen) stufenweisen Anstieg zum Grundton. Auf diese Weise wird die Klanglichkeit des Anfangs erreicht. Die aus den höchsten Klavierlagen absteigende Begleitstimme bringt das Stück jedoch in einem Gestus des Schließens zu Ende. 11 vgl. beispielsweise Überlegungen zur Qualität von Salonmusik im 19. Jahrhundert, in: Eggebrecht, S. 82-85. Dr. Elisabeth Haas ist Leiterin einer Wiener Musikschule, Autorin und Herausgeberin von Unterrichtsliteratur sowie Lehrbeauftragte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. 11