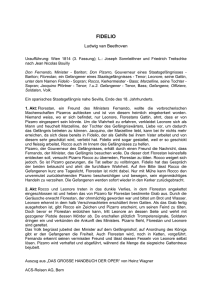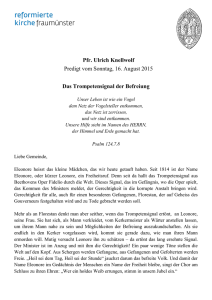fidelio - Musikverein Graz
Werbung
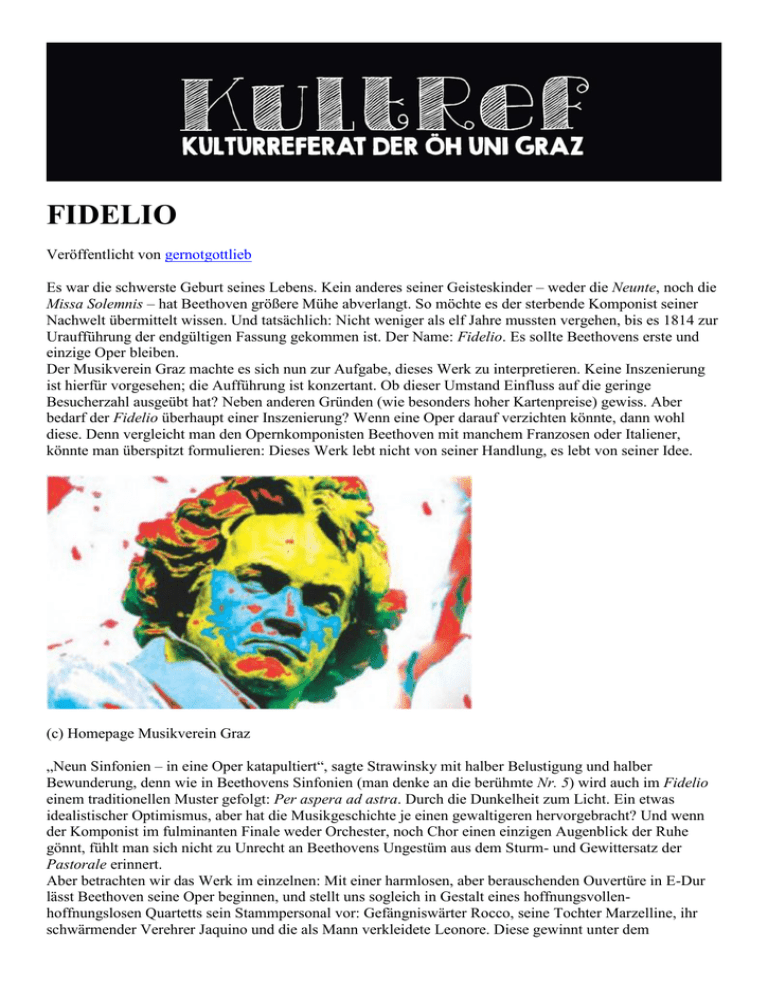
FIDELIO Veröffentlicht von gernotgottlieb Es war die schwerste Geburt seines Lebens. Kein anderes seiner Geisteskinder – weder die Neunte, noch die Missa Solemnis – hat Beethoven größere Mühe abverlangt. So möchte es der sterbende Komponist seiner Nachwelt übermittelt wissen. Und tatsächlich: Nicht weniger als elf Jahre mussten vergehen, bis es 1814 zur Uraufführung der endgültigen Fassung gekommen ist. Der Name: Fidelio. Es sollte Beethovens erste und einzige Oper bleiben. Der Musikverein Graz machte es sich nun zur Aufgabe, dieses Werk zu interpretieren. Keine Inszenierung ist hierfür vorgesehen; die Aufführung ist konzertant. Ob dieser Umstand Einfluss auf die geringe Besucherzahl ausgeübt hat? Neben anderen Gründen (wie besonders hoher Kartenpreise) gewiss. Aber bedarf der Fidelio überhaupt einer Inszenierung? Wenn eine Oper darauf verzichten könnte, dann wohl diese. Denn vergleicht man den Opernkomponisten Beethoven mit manchem Franzosen oder Italiener, könnte man überspitzt formulieren: Dieses Werk lebt nicht von seiner Handlung, es lebt von seiner Idee. (c) Homepage Musikverein Graz „Neun Sinfonien – in eine Oper katapultiert“, sagte Strawinsky mit halber Belustigung und halber Bewunderung, denn wie in Beethovens Sinfonien (man denke an die berühmte Nr. 5) wird auch im Fidelio einem traditionellen Muster gefolgt: Per aspera ad astra. Durch die Dunkelheit zum Licht. Ein etwas idealistischer Optimismus, aber hat die Musikgeschichte je einen gewaltigeren hervorgebracht? Und wenn der Komponist im fulminanten Finale weder Orchester, noch Chor einen einzigen Augenblick der Ruhe gönnt, fühlt man sich nicht zu Unrecht an Beethovens Ungestüm aus dem Sturm- und Gewittersatz der Pastorale erinnert. Aber betrachten wir das Werk im einzelnen: Mit einer harmlosen, aber berauschenden Ouvertüre in E-Dur lässt Beethoven seine Oper beginnen, und stellt uns sogleich in Gestalt eines hoffnungsvollenhoffnungslosen Quartetts sein Stammpersonal vor: Gefängniswärter Rocco, seine Tochter Marzelline, ihr schwärmender Verehrer Jaquino und die als Mann verkleidete Leonore. Diese gewinnt unter dem Decknamen Fidelio die Gunst und Liebe Marzellines, hoffend, auf diesem Wege, ihren zu Unrecht inhaftierten Mann Florestan befreien zu können. Dafür wagt Leonore sogar, in die finsterste Tiefe des Staatsgefängnisses von Sevilla abzusteigen, ängstlich, aber entschlossen singend: „Ich bin es nur noch nicht gewöhnt.“ Florestan selbst tritt erst zu Beginn des zweiten Aktes auf. Ausgemergelt und mit letzten Kräften ruft er: „Gott! Welch Dunkel hier!“ und beschert dem Publikum ein tief ergreifendes Hörerlebnis. Schlussendlich kann Leonore ihren Liebsten befreien und das Werk endet in einem großen Aufmarsch der Freude. Erster nachweisbarer Theaterzettel einer Bonner Aufführung aus dem Jahr 1830 – (c) Wikipedia Wie in anderen Werken Beethovens ist auch im Fidelio der Atem der Revolution von Anfang bis Ende spürbar. So wird dem Publikum im Zuge einer zweistündigen Aufführung der überwältigende Sieg der Liebe und Brüderlichkeit über die Tyrannei und politische Willkür vorgeführt – ein Idealismus, der dem Werk oftmals zum Vorwurf gemacht worden ist. Zumal der christlich-symbolische Einfluss nicht ausbleibt. Am deutlichsten tritt dieser Einfluss in jener Szene auf, in der Leonore ihrem ausgehungerten Florestan Brot und Wein reicht. Dennoch wirkt der Fidelio nicht verstaubt, denn seine Hoffnung nach dem idealen Zustand auf Erden ist auch heute nicht erfüllt. Und als Dirigent Ádám Fischer im Anschluss an seine Interpretation vom Grazer Musikverein feierlich zum Ehrenmitglied erhoben wurde, sprachen Staatsopern-Intendant Dominique Meyer und Honorarkonsul Franz Harnoncourt-Unverzagt nicht ohne Berechtigung von einem „Konzert der Menschenrechte“. Dieses ist dem Musikverein aufs Glanzvollste gelungen. (c) DR Der geehrte Ungar Ádám Fischer dirigierte das Orchester der Wiener Staatsoper trotz seiner 65 Jahre mit überschwänglichem Einsatz, und die Sympathie des Publikums war ihm bereits nach wenigen Minuten sicher, als Fischer mit größter Leidenschaft den die Allmacht des Goldes besingenden Bass Wolfgang Bankl still mitsingend begleitete. Im Rahmen der anschließenden Ehrenverleihung gab sich der Dirigent wohltuend bescheiden: „Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie auf der falschen Körperstelle.“ Sowohl gesanglich, als auch darstellerisch wussten aber vor allem – trotz sprachlicher Ungereimtheiten – Camilla Nylund (Leonore) und Paul Groves (Florestan) zu überzeugen. Noch 2004 sang Nylund an der Seite eines gesanglich überwältigenden, schauspielerisch enttäuschenden Jonas Kaufmann. Fehlte damals noch das notwendige Gefühl, ist es elf Jahre später unüberhörbar: Rufen Nylund und Groves bei ihrem großen Wiedersehen die „namenlose Freude“ an, ist man aufs Tiefste gerührt. Die Liebenden haben sich gefunden, sie sind wieder vereint. Und ein berauschender Abend geht mit tobendem Applaus zu Ende. Link: https://kultrefgraz.wordpress.com/ 22. April 2015