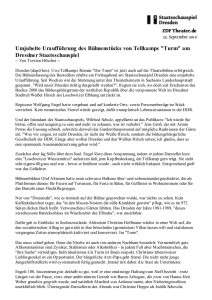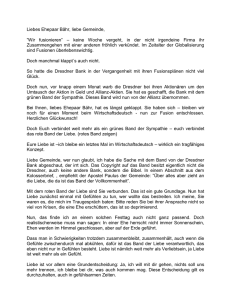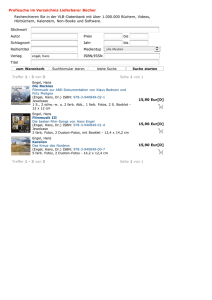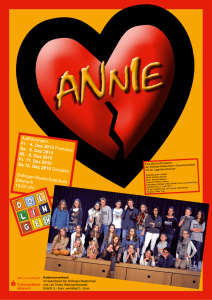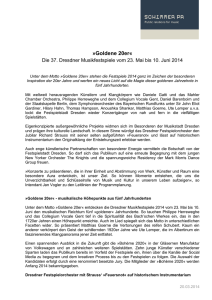Gelungene Uraufführung von Tellkamps „Turm“ in Dresden
Werbung

Focus Online 25. September 2010 Gelungene Uraufführung von Tellkamps „Turm“ in Dresden Dresden hat ein neues Theaterstück – über sich und für sich. Die Übertragung von Uwe Tellkamps preisgekröntem Roman „Der Turm“ auf die Bühne ist gelungen. Die Theaterfassung seiner „Geschichte aus einem versunkenen Land“ wurde am Freitagabend im Dresdner Schauspielhaus gefeiert. Nach der mehr als dreistündigen Uraufführung bedachte das Publikum die Darsteller und das Team um Regisseur Wolfgang Engel mit viel Beifall und „Bravo“-Rufen. Engel und der sichtlich gerührte Schriftsteller Tellkamp beglückwünschten sich gegenseitig auf der Bühne. „Ich habe erst gedacht, das wird schiefgehen“, hatte ein etwas misstrauischer Autor noch im Vorfeld bekannt. Staatsschauspiel-Dramaturg Jens Groß und Regisseur Armin Petras machten aus seinem knapp Tausend-Seiten-Roman eine hundertseitige Textbuchfassung. In dem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Werk beschreibt Tellkamp die Endzeitstimmung in den letzten DDR-Jahren am Beispiel des Dresdner Bildungsbürgertums. Groß schien vielen die Gefahr, dass dieser hermetische Kosmos aus Figuren, Orten und Stimmungen auf ein DDR-Panoptikum á la „Good Bye Lenin“ zusammenschnurren müsste, um auf der Bühne überhaupt fassbar zu werden. Regisseur Engel hat sich in seiner 100. Inszenierung daher für einen Kunstgriff entschieden: Er zeigt die allmähliche Besitznahme des epischen Textes durch das handelnde Theater direkt auf der Bühne. In die Szenerie führt ein deklamierender Bürgerchor ein, als humorvolle Reverenz an den Autor mit Winzermützen geschmückt. Der erste Blick geht den Hügel hinauf zum „Sybillenhof“, wie das nach wie vor beliebte Ausflugslokal im Buch heißt. Der erste Teil des Stückes ist der Beschwörung der „süßen Krankheit Gestern“ durch Worte, Sätze, ganze Passagen gewidmet, die die Schauspieler sich im baulich abstrakt gehaltenen Bühnenbild vorsprechen. M it dem Protagonisten Christian Hoffmann treffen die Zuschauer auf der Geburtstagsfeier seines Vaters, des Chirurgen Richard Hoffmann, ein. Der Vorhang hebt sich dabei so knarrend wie die Standseilbahn, die Christian hinein in die hermetisch abgeriegelte Geisteswelt der „Türmer“, der gut situierten Bewohner des Dresdner Nobelviertels „Weißer Hirsch“, trägt. Parallel trifft sich der Parteisekretär mit Schriftstellern und Verlegern – stalinistische Hardliner stehen jungen hoffnungsvollen Idealisten gegenüber. Der Bogen spannt sich später über Christians Armeejahre, seine Verurteilung ins M ilitärgefängnis nach dem Aufbegehren gegen einen Vorgesetzten und die spätere Abordnung in eine Karbidfabrik. Parallel dazu wird das Leben auf dem „Hirsch“ weitererzählt: Grüppchen auf Balkonwaben deuten verschiedene Szenen und Dialoge an, dann schweift der Blick weiter und man hört einer anderen Partei zu. Ein DJ im Dachgeschoss spielt mit Erinnerungs- und Assoziationsfetzen, mixt Schuberts „Unvollendete“ mit DDRLiedern, würzt das Repertoire der damaligen Klein- mit dem der Bildungsbürger. Das Stück reißt Charaktere an, führt sie zusammen, dringt tiefer in sie ein. Bis zu diesem Punkt ist die Inszenierung auch eine Verneigung vor der Tradition des Sprechtheaters der DDR. Im zweiten Teil dann verknappt sich der Text zunehmend – und endlich dürfen die Schauspieler auch spielen. Dabei geht es um Liebe, Verrat und Sterben. Das Theater übernimmt die Regie, die Kostüme befreien sich aus dem vorrangig staubgrauen DDR-Chic und kulminieren auf einem wilden Tanzfest der „Türmer“.