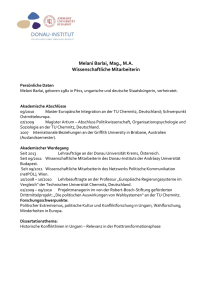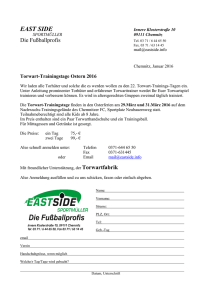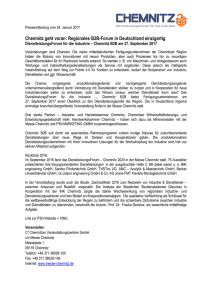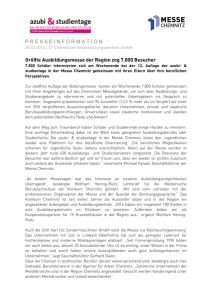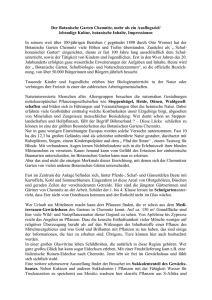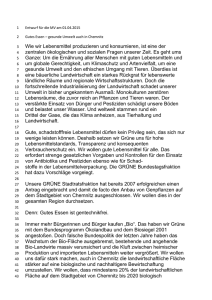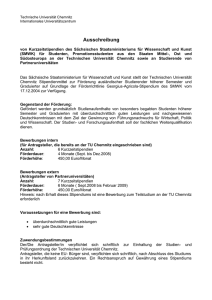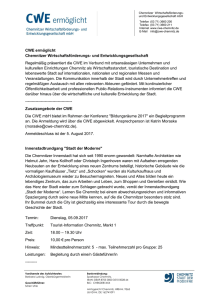393089470X_leseprobe3
Werbung
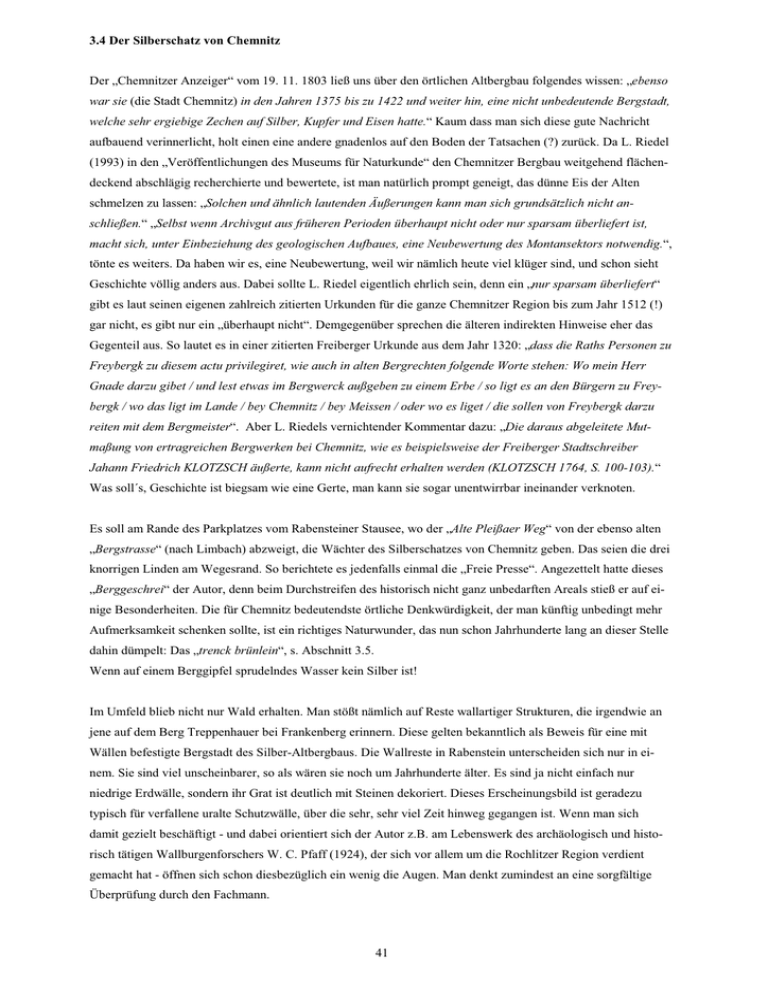
3.4 Der Silberschatz von Chemnitz Der „Chemnitzer Anzeiger“ vom 19. 11. 1803 ließ uns über den örtlichen Altbergbau folgendes wissen: „ebenso war sie (die Stadt Chemnitz) in den Jahren 1375 bis zu 1422 und weiter hin, eine nicht unbedeutende Bergstadt, welche sehr ergiebige Zechen auf Silber, Kupfer und Eisen hatte.“ Kaum dass man sich diese gute Nachricht aufbauend verinnerlicht, holt einen eine andere gnadenlos auf den Boden der Tatsachen (?) zurück. Da L. Riedel (1993) in den „Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde“ den Chemnitzer Bergbau weitgehend flächendeckend abschlägig recherchierte und bewertete, ist man natürlich prompt geneigt, das dünne Eis der Alten schmelzen zu lassen: „Solchen und ähnlich lautenden Äußerungen kann man sich grundsätzlich nicht anschließen.“ „Selbst wenn Archivgut aus früheren Perioden überhaupt nicht oder nur sparsam überliefert ist, macht sich, unter Einbeziehung des geologischen Aufbaues, eine Neubewertung des Montansektors notwendig.“, tönte es weiters. Da haben wir es, eine Neubewertung, weil wir nämlich heute viel klüger sind, und schon sieht Geschichte völlig anders aus. Dabei sollte L. Riedel eigentlich ehrlich sein, denn ein „nur sparsam überliefert“ gibt es laut seinen eigenen zahlreich zitierten Urkunden für die ganze Chemnitzer Region bis zum Jahr 1512 (!) gar nicht, es gibt nur ein „überhaupt nicht“. Demgegenüber sprechen die älteren indirekten Hinweise eher das Gegenteil aus. So lautet es in einer zitierten Freiberger Urkunde aus dem Jahr 1320: „dass die Raths Personen zu Freybergk zu diesem actu privilegiret, wie auch in alten Bergrechten folgende Worte stehen: Wo mein Herr Gnade darzu gibet / und lest etwas im Bergwerck außgeben zu einem Erbe / so ligt es an den Bürgern zu Freybergk / wo das ligt im Lande / bey Chemnitz / bey Meissen / oder wo es liget / die sollen von Freybergk darzu reiten mit dem Bergmeister“. Aber L. Riedels vernichtender Kommentar dazu: „Die daraus abgeleitete Mutmaßung von ertragreichen Bergwerken bei Chemnitz, wie es beispielsweise der Freiberger Stadtschreiber Jahann Friedrich KLOTZSCH äußerte, kann nicht aufrecht erhalten werden (KLOTZSCH 1764, S. 100-103).“ Was soll´s, Geschichte ist biegsam wie eine Gerte, man kann sie sogar unentwirrbar ineinander verknoten. Es soll am Rande des Parkplatzes vom Rabensteiner Stausee, wo der „Alte Pleißaer Weg“ von der ebenso alten „Bergstrasse“ (nach Limbach) abzweigt, die Wächter des Silberschatzes von Chemnitz geben. Das seien die drei knorrigen Linden am Wegesrand. So berichtete es jedenfalls einmal die „Freie Presse“. Angezettelt hatte dieses „Berggeschrei“ der Autor, denn beim Durchstreifen des historisch nicht ganz unbedarften Areals stieß er auf einige Besonderheiten. Die für Chemnitz bedeutendste örtliche Denkwürdigkeit, der man künftig unbedingt mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, ist ein richtiges Naturwunder, das nun schon Jahrhunderte lang an dieser Stelle dahin dümpelt: Das „trenck brünlein“, s. Abschnitt 3.5. Wenn auf einem Berggipfel sprudelndes Wasser kein Silber ist! Im Umfeld blieb nicht nur Wald erhalten. Man stößt nämlich auf Reste wallartiger Strukturen, die irgendwie an jene auf dem Berg Treppenhauer bei Frankenberg erinnern. Diese gelten bekanntlich als Beweis für eine mit Wällen befestigte Bergstadt des Silber-Altbergbaus. Die Wallreste in Rabenstein unterscheiden sich nur in einem. Sie sind viel unscheinbarer, so als wären sie noch um Jahrhunderte älter. Es sind ja nicht einfach nur niedrige Erdwälle, sondern ihr Grat ist deutlich mit Steinen dekoriert. Dieses Erscheinungsbild ist geradezu typisch für verfallene uralte Schutzwälle, über die sehr, sehr viel Zeit hinweg gegangen ist. Wenn man sich damit gezielt beschäftigt - und dabei orientiert sich der Autor z.B. am Lebenswerk des archäologisch und historisch tätigen Wallburgenforschers W. C. Pfaff (1924), der sich vor allem um die Rochlitzer Region verdient gemacht hat - öffnen sich schon diesbezüglich ein wenig die Augen. Man denkt zumindest an eine sorgfältige Überprüfung durch den Fachmann. 41 Leider wurden von eifrig herbei gerufenen Vertretern des Landesamtes für Archäologie nach flüchtiger Inspektion vor Ort alle Illusionen genommen. Den Silberschatz von Chemnitz habe es nie gegeben! Oder doch? Hartnäckig bohrten die ketzerischen Gedanken weiter. Schließlich sind die historischen Hinweise auf örtlichen Altbergbau geradezu erdrückend und wissen doch die Annalen über manches bekannte und anerkannte Altbergbaufeld viel weniger zu berichten. Wir befinden uns am nördlichen Auslauf des Berges Totenstein, und gleich nebenan befindet sich der Silberberg (!) auf Pleißaer Flur. Namensgebungen sind für Philologen und Historiker stets Stoff für die Ewigkeit. So sei an die nicht abgeschlossene Odyssee der Herkunftserkundung des Namens Kaßberg erinnert. Viele namhafte Chemnitzer Fachleute haben sich daran beteiligt, denn der Kaßberg hat nachweislich seit dem 16. Jahrhunderts die Gemüter bewegt. Selbst Georgius Agricola griff ein und brachte ja sogar die unschuldigen Jungfrauen als „Katschen“ ins Spiel. Keiner ging jedoch je darauf ab, dass es nebenan auf Reichenbrandter Flur auch einen Kaßberg gibt. Wenn das nicht der Diskussion eine erneute Wendung geben könnte! Halten wir es mit den wirklichen Fachleuten, und hier dominieren schließlich die Bergbauhistoriker, die im Wort den eigentlichen Sinn erkennen. „Goldborn“, „Silberstrasse“ und „Wismutkumpel“ werden wohl für alle Zeiten Zeugen der erfüllten menschlichen Begehrlichkeiten am Schoß der Erde bleiben. Dass es keiner unserer Nachkommen wagt, daran herumzudoktern! Und ist nicht „Silbersee“ die beste Garantie für ein Schatzvorkommen? Das weiß doch jeder richtige Junge. Ausgerechnet hier im historischen Chemnitzer Westen sollen aber die Wünsche unerfüllt geblieben sein? Die Sage vom Berg Totenstein sagt nein, denn beim Schürfen soll der Bergmann kein Silber gefunden haben, sondern nur totes Gestein. Der Bestand jenes dazu Anlass gebenden Stollenfragmentes ist übrigens eine der romantischsten Impressionen, die Chemnitz überhaupt zu bieten hat. Wir erkennen aber, dass im Totenstein (um 1621 der „Grose todt Stein“) tatsächlich gegraben worden ist. Sagen haben nach Schätzungen einschlägiger Historiker doch „mindestens 50 % historisch verwertbaren Wahrheitsgehalt“. Wenn also die Sage kein Scherz ist, belegt sie zumindest ein Bemühen des alten Bergmannes, den Schatz an dieser Stelle zu heben. Es dürfte allerdings schwierig sein, in der Realität den Beweis für das ehedem „tote Gestein“ zu führen. Wenn, wie im Bestand erkennbar, Quarzgestein im Spiel ist, muss selbst der Fachmann aufhorchen. Könnte nicht doch ein winziges Erzvorkommen an dieser Stelle ausgebeutet worden sein? Wenn ja, dann besteht höchste Wahrscheinlichkeit für die Fündigkeit eines ausgedehnteren Umfeldes, und schon fängt der Silberrausch wieder an. Er wird ohnehin genährt durch die Aktenlage. Die Urkunde zum Jahr 1226, H. Ermisch (1879), gab ja dem Benediktiner-Kloster bereits das Recht, Bodenschätze im eigenen Landstrich zu gewinnen und zu verwerten (Bergwerksregal). Das Gebiet wurde in der Urkunde mit Zschopau im Osten, Würschnitz im Süden, Mulde im Westen und „Lozthaha“ im Norden umgrenzt. (Die nahe liegende, weil sonst alternativlose Identifikation von „Lozthaha“ mit „Lostatawa“ bei Thietmar von Merseburg (1957) bzw. „Lostataua“ in einer von König Heinrich II. im Jahr 1004 (!) ausgestellten Urkunde und daher mit dem heutigen Ort Lastau nördlich von Rochlitz, W. Pfau (1924), war jedoch H. Ermisch „bedenklich, da zu weit“. Zur Ausdehnung des alten (10. Jhd.) Merseburger Bistums könnte das Ganze jedoch recht gut passen, s. auch Abschnitte 2 und 12. Erneut war dem Historiker ein historischer Fakt aus unerfindlichen Gründen mehr als suspekt, und der Sachverhalt wurde übergangen. Allmählich könnte man einen gewissen belustigenden Gefallen finden an dem unglaublichen Bemühen der Fachleute, für sich die „zeitliche Lücke“ zu tabuisieren. Wir lassen uns dadurch jedenfalls nicht eine Basis nehmen, die Wallburgen und Burgenvorgänger der Chemnitzer Region mit Thietmar von Merseburg´s Heinrichsburg (?) 42 „Titibutzie“ in Verbindung zu bringen, auf die höchst wahrscheinlich der faszinierende Rest einer Wallburganlage auf dem „Burgberg“ bei Lastau zurück geht.) Nicht minder berühmt ist die Urkunde zum Verkauf der Herrschaft Rabenstein an das Kloster Chemnitz aus dem Jahr 1375. Auch sie nennt unmissverständlich und sicher nicht grundlos die Bergrechte, insbesondere „steyngruben ysengruben calcgruben unde mit allerleye erczgruben“ im Bestand. Mit Chemnitz in der Mitte „versprach“ die Urkunde zudem „in fodinis auri argenti“, also den Schatz in Gold und Silber in seinem ureigentlichen Sinne. Und noch Jahrhunderte später ging es im Erzgebirge und seinem Vorland ganz klar nicht um irgendein Erz. Nein, es ging hauptsächlich um Silbervorkommen. Insofern schließt sich der gedankliche Bogen wieder. In einem vom Bergarchiv Freiberg aufbewahrten Meilenblatt, das im Jahr 1791 aufgenommen worden ist, findet sich nördlich des alten Pleißaer Weges, d.h., noch Totensteinmassiv, der handschriftliche Vermerk „Brauneisenstein“. Auch der Zimmermann´sche Riss aus dem Jahr 1621, s. Abschnitt 3.5, spricht Bände mit dem Bach „eisen flößel“ südlich des „trenck brünlein“. Also doch wenigstens Eisenerz im Klosterareal! Gerade der Brauneisenstein ist aber oft vergesellschaftet mit Silbererz. Sein Vorkommen fiel übrigens jüngst auch beim Bau der Ferngastrasse auf, die alte „Bergstrasse“ (nach Limbach), vormals „die Pleyßner Stras uf Wallenburgk“, jenseits der Autobahn A4 kreuzt. Ist man ungeduldig und phantasiebegabt, so wird man nun im Dreieck TotensteinTränkbrünnlein-Silberberg gleich ein ganzes Netzwerk verlassener Stollen tief in der Erdkruste vermuten. Beim Altbergbau muss das aber nicht so sein. G. Agricola hat uns für seine Zeit eines besseren belehrt und in seiner „De re metallica“ (1555) unmissverständlich aufgezeigt, wie oberflächennah damals die Silberadern angestanden haben. Wie war es doch in Christiansdorf (Freiberg) um 1170 mit dem scharrenden Pferd bzw. mit dem knarrenden Wagenrad, die den örtlichen Bodenschatz verrieten? Und wie könnten es die Rabensteiner Herrschaft (Johannes von Waldenburg) und, nach dem Liegenschaftskauf, der Chemnitzer Abt Heinrich von Donin erlebt haben, was ja 200 Jahre früher war? Vielleicht konnte man die oberflächennahen Gänge gediegenen Silbers tatsächlich gleich mit offenen Gräben im Boden aufwältigen, die nach der Verfüllung kaum Spuren hinterließen. Im übrig gebliebenen Busch jenseits der Autobahnzufahrt Rabenstein in Richtung Erfurt und auch noch hinter der neuen Ferngastrasse, also in Richtung auf Kändler zu, hat es fast den Anschein danach. Die Rabensteiner Fehde hinterließ schließlich auch viele Rätsel. So war es schon ungewöhnlich, wenn der Schwiegersohn des Waldenburgers, der mächtige Burggraf Albrecht IX. von Leisnig, im räuberischen Handstreich den Kaufvertrag zeitweise rückgängig machte. Warum stritten sich auch noch später zwei der ehemaligen „Spießgesellen“, die „von teuflischem Geiste besessenen“, E. Weinhold (1906), nämlich der Burggraf und Veit von Schönburg, ausgerechnet um die Dörfer Rabenstein, Pleißa und Kändler. „Wir wissen´s nicht“, schrieb E. Weinhold, und meinte die Gründe für die Beteiligung der Städte Zwickau und Oederan. Aber wir ahnen es; hatten nicht beide Städte längst den angenehmen Geruch des Silbers in der Nase, der sie gierig machte? Es könnte also allen Beteiligten doch um´s Eingemachte der Rabensteiner Mutter Erde gegangen sein. Damit stehen die „Wächter des Silberschatzes von Chemnitz“ wieder mitten drin im Geschehen. Dort - am Mysterium des „trenck brünlein“ - gehören sie auch hin, denn eine weitere, die euphorischste Schürfe am vermeintlichen Silberbraten des Chemnitzer Stadtgebietes schlug nachweislich gründlich fehl. Wir müssen nur den Schauplatz wechseln. Das Ratsarchiv lässt - wenngleich als „unsichere Nachricht“ - nach Recherchen von O. P. Happach (1955) „die Gruben in unmittelbarer Stadtnähe, am sogenannten Hüttenberge, d.h. dem Rücken, den die Stollberger Straße benützt, nach dem Chemnitzfluß hinab, schon 1422 fündig werden.“ Fündig auf Silber, bitte schön! Das hat in der Literatur für einige Verwirrung gesorgt, weil sich die Aussage als nicht überprüfbar herausstellte. Der erfahrene und sicher gut informierte G. Agricola hat schließlich in seinen einschlägigen, wenig später erschienenen 43 Büchern und Schriften, die maßgeblich in Chemnitz entstanden sind, auch keinen Hinweis auf Bergbau in seiner Stadt gegeben. Man „einigte“ sich auf die Version einer Verwechslung im Zusammenhang mit der Tatsache, dass es dort u.a. nach der Chronik von C. W. Zöllner (1888) z.B. um 1770, Saigerhütten und Kupferhammer gegeben hat. (Die verarbeiteten Erze sind ja auch tatsächlich von außerstädtischen Förderorten heran transportiert worden.) Im Bereich der Baustelle Innerer Ring, s. Abschnitt 7.2, glaubt der Autor übrigens mögliche Hinweise auf einen Hüttenstandort gefunden zu haben. Beginnend im künftigen Fahrbahnbereich mit sehr schmalen, aber vielschichtigen und viel versprechenden Horizonten, die u.a. sehr alte Dachziegelreste und eisenhaltige Schlacke enthielten, zog sich eine schwarz durchfärbte, zur auslaufenden Beckerbrücke hin sehr viel mächtiger werdende Zone hin. Es könnten freilich auch Folgen des Luftangriffes vom 5./6. März 1945 gewesen sein, der auch hier fürchterlich wütete, doch sprechen die Fundstücke eine ganz andere Sprache. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde es aber nachweislich ernst mit dem neuerlichen Chemnitzer Berggeschrei, und zwar laut O. P. Happach nachdem die „zweifellos zusammengebrochenen alten Gänge am Hüttenberge“, die „wohl zwei Jahrhunderte geruht hatten“, durch die Sage „mit Gold- und Silberschimmer umwoben“ worden sind (50 % Wahrheitsgehalt?). Auch mag das für die damaligen Menschen vorhandene, bestimmt rätselhafte Gangsystem im Bestand eine Anregung dazu gegeben haben. Mussten sie nicht annehmen, dass ihre Vorgänger vor langem bereits Bergbau betrieben haben? Es war die Zeit von 1709 bis 1718, und der Schauplatz war also kein geringerer als der Kapellenberg, alias Nikolai-Berg, alias Hüttenberg u.s.w., in den man jetzt richtig vorgestoßen ist. Nicht die Wünschelrutengänger, die „nach alten Überlieferungen reiche Beute verheißen hatten“, sind allerdings schuld am Desaster, wie O. P. Happach schrieb, denn er kam abschließend und relativierend zu einem anderen Schluss: „Selbst der Rutengänger konnte für die alten, niedergebrochenen Orte keinen Gewinn versprechen.“ Damals stellte man nämlich ein weiteres Stück Chemnitzer Unterwelt her, und die Gesamtlänge der Suchstollen betrug um 1718, dem letzten der archivarisch nachweisbaren Jahre bergmännischer Aktivitäten, rund 900 m (!), die sich gemäß Tabelle 3.1 auf die „Fundgruben“ verteilten. Tabelle 3.1: Jahr 1709 1709 bis 1716 1711 1716 1710 bis 1718 Suchstollen auf Silber am Kapellenberg zu Beginn des 18. Jahrhunderts „Fundgrube“ St. Johannis zum Reichen Trost Rote Fundgrube St. Georgen Länge des Stollenvortriebs ca. 200 m ca. 96 m ca. 260 m ca. 312 m Ergebnis „dürre Klüfte“ „nicht bauwürdig“ „nur schmales Trümmergestein“ Die Bergleute sind doch im Eifer oder durch vorzeitigen Rückzug nicht womöglich am Silberschatz vorbeigeschrammt, der nun noch auf seine Hebung wartet? Die Gier nach Reichtum per Edelmetall setzte jedenfalls einmal mehr alles in Bewegung, doch die erhoffte reiche Beute bzw. die „edlen Gänge“ blieben aus. So bedurften die berühmten und viel zitierten Grundsätze des Landesfürsten, Herzog Georg, auch fürderhin keiner Korrektur: „Leipzig die beste, Chemnitz die feste, Freiberg die größte, Annaberg die liebste.“ Er hätte allerdings mit 44 Sicherheit auch Chemnitz geliebt, wenn dort neuerlich Silber gefunden worden wäre. Einstweilen musste er sich jedoch auf die Fundgruben im hohen Erzgebirge verlassen. Alternativ dürfte er auch auf die Alchimisten gesetzt haben, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuten. Selbst Erwin, den Mönch aus Chemnitz, hatte es gepackt. Doch dessen traurige Geschichte lassen wir seinen Geist in Abschnitt 3.8 erzählen. Für die Zeit nach 1750, als sich das neue (dritte?) „Silberfieber“ in der Stadt längst gelegt hatte, stellte O. P. Happach fest: „Die Gänge brachen zusammen, kein Auge vermag heute (um 1950) den Platz zu finden, wo einst der Bergmann in die Tiefe stieg.“ Wir dürfen, im Gegensatz zu O. P. Happach´s Äußerung, sicher sein, dass diese Stollen noch im Untergrund stehen. Wir wissen nur nicht wo. Nach aller Erfahrung haben die vorhandenen historischen Hohlräume - auch die nicht ausgebauten - im Sediment und im Porphyrtuff die Jahrhunderte gut überdauert. Es sind, gemessen am großen Gesamtbestand in Chemnitz, nur relativ wenige Tagesbrüche bekannt geworden, s. Abschnitt 5.7. Auf den bergbaulichen Bestand deutet nur der Tagesbruch (?) aus dem Jahr 1803 hin, der praktisch von sich aus stattgefunden haben kann oder sich durch die sogenannte „kesselförmige Vertiefung“ möglicherweise nur als Setzungspinge eines Mundloches in Erinnerung brachte. Die Stollen sind nämlich bestimmt schon damals wieder verfüllt worden, so dass man heute nicht auf offene Hohlräume im Berg stoßen muss. Übrigens, seitdem neuerdings Euba zu Chemnitz gehört, kann sich die Stadt sogar eines ehemaligen Goldschatzes brüsten. „Die Eibenbach“ war einst ein echter Goldbach. Doch heute schaut der Autor durch das Fenster seines Hauses in Niederwiesa genau auf dieses wieder lebendige Wasser trotzdem mit etwas Sorge: Wie geht künftig trotz aller abdeckenden Kunststoffolien und Lehmschichten - den Wasser hat einen spitzen Kopf der Geist des Beutenberges mit dem Zustrom aus der Deponie „Weißer Weg“ um, s. auch Abschnitt 8.3? 45 Die Wächter des Silberschatzes von Chemnitz? Reste wallartiger Strukturen beim „trenck brünlein“, die irgendwie an eine befestigte Bergstadt des SilberAltbergbaus erinnern 46 Das Geheimnis des Totensteins: Rudiment eines Silberstollens? Das „Brauneisenstein Lager“ und die alte „Schäferei“ in „Ober Rabenstein“ (Meilenblatt um 1791) 47 Fundstelle (u.a. Schlacken und Reste sehr alter Dachziegel) am südlichen Rand der künftigen Strasse Innerer Ring in Höhe der nach Westen zu auslaufenden Eisenbahnbrücke: Das bunte „Relief“ an den Bohrpfählen markiert eine relativ mächtige Kulturablagerung auf dem ursprünglichen Hang. 48 3.5 Das „trenck brünlein“ Der Zimmermann´sche „Riß vom Jahre 1621“, der die Region nach R. Weber (1936) westlich von Chemnitz darstellt, macht an der Gabelung der alten Wege von Chemnitz nach Pleißa (einst „drescher weg“) bzw. Kändler (früher jene „Pleyßner Stras uf Wallenburgk“) im Rabensteiner Wald auf das „trenck brünlein“ aufmerksam. Diese Quelle sprudelt heute noch. Sie ist mit Ziegelbauwerk und Rohrleitung gefasst sowie teilweise von merkwürdigen Erdwällen umgeben, doch ist der heutige Nutzer vorerst noch unbekannt. Auch sonst hat man sie offenbar ganz einfach vergessen. Der Standort ist die höchste Erhebung im größeren Umfeld, so dass kaum Zweifel bestehen: Es handelt sich um eine Tiefenwasser-, sprich Mineralwasserquelle! Stehen wir womöglich vor einem bereits in historischen Zeiten bedeutsamen Naturwunder? War es vielleicht einst eine heilige, weil Heilquelle? Falls sich tatsächlich gemäß Abschnitt 3.4 in deren Umgebung der Ort des einstigen Silberschatzes von Chemnitz befindet, so könnte man einen solchen Zusammenhang leicht konstruieren. Zur Eigenart bergmännisch erschlossener Felder im Erzgebirge - und nicht nur hier - gehörte früher die Heilige Quelle, deren Wasser über Heilkräfte verfügte. Es wurde zudem berichtet, dass im Bergbau manchmal Heilquellen plötzlich aufgetaucht und auch ebenso geheimnisvoll wieder versiegt sind. Warum ist das so? Die Geophysik hat das Rätsel schon lange gelöst. Wenn man sich mit der Realstruktur der Erdkruste beschäftigt, fallen die tief reichenden Risse auf, die eben auch heute noch Tiefenwasservorkommen erschließen. (Vulkane sind unbestreitbar ein weiterer überzeugender Hinweis auf ihre teilweise Durchgängigkeit bis zum Erdmantel.) Risse in der Erdkruste sind der eigentliche Grund für das Wunderland Erzgebirge. Als der Autor im Jahr 1998 am Gymnasium Flöha einen Vortrag zu diesem Thema hielt, konnten einige Lehrer diese trockene Begründung einfach nicht verkraften. (Eine Dame verließ brüskiert den vollen Saal vorzeitig und rief fauchend im Hinausgehen: „Ich dachte, es geht um das Erzgebirge, und Sie reden über Risse!“ Auch der an verklärten Klischees leidende Schuldirektor bekam einen Anfall.) Man muss doch aber den Tatsachen ins Auge sehen können. Wie der Name sagt, leitet sich hier oben alles vom Erz ab, auch das Kunsthandwerk und die Folklore. Selbst die Natur wurde grundlegend verändert. Nichts erinnert mehr an den einstigen Urwald, Halden konkurrieren mit natürlichen Formationen, Siedlungen sind dort, wo der Bergmann fündig wurde. Was macht somit das eigentliche Wunder aus? Es sind dies die tief in die Erdkruste reichenden Risse, in denen man - als Geschenk der Natur - das Erz letztlich vorgefunden hat!! Mit den einst heißen Tiefenwässern stiegen wie heute noch z.B. in Karlsbad in den klüftigen Rissen die Ionen und Moleküle auf, die dann nach Abscheidung - wohlgemerkt wiederum meist innerhalb der Risse - die anstehenden Erze und Metalle ausmachten, wunderbarerweise Gold und Silber ganz oben, Uran tief unten. Vom tauben Ganggestein reden wir nicht, denn das lagerte sich zum Leidwesen der Bergleute an gleicher Stelle noch viel häufiger ab. Auch so manche Wunder- bzw. Heilquelle verdankt ihr Dasein diesem Umstand. Manche verschwand auch wieder, weil der Bergmann, dem gleichen Riss folgend, unterirdisch und ungewollt eine Umleitung des Wassers besorgt hat. Auch für das plötzliche Auftauchen einer Quelle zeichnete er hin und wieder verantwortlich, indem er beim Vortrieb oder Abbau den natürlichen Verschluss einer entsprechenden Kluft öffnete. Wenn man sich übrigens genauer damit befasst, so stellt man zudem überrascht fest, dass selbst das Leben in der Biosphäre am Seidenfaden der Risse in der Erdkruste und der damit korrelierenden Feinstruktur der natürlichen 49 irdischen Kernstrahlung zu hängen scheint. Doch das ist hier nicht unser Thema, obgleich schon Georgius Agricola in seiner „De re metallica“ anhand seiner präzisen Naturbeobachtungen, z.B. der Bäume, diesen realen Zusammenhang im Prinzip hergestellt hat. Ähnliche und noch ältere Hinweise zitierte E. Czaya im Jahr 1990 in seinem Buch über den Silberbergbau. Mit Bezug auf die Erkundung im Bergbau des 12. Jahrhunderts heißt es u.a.: „Der Bergmann nahm den Abbau dort auf, wo das Erz gewissermaßen zutage trat.“ Fast folgerichtig verrät eine andere Stelle im Text: „... findet er (der Bergmann) den Schatz: bevorzugt unter dem Moos oder verborgen im Wurzelwerk eines Baumes, der damit zum Schatzbaum wird.“ Zugegeben, den angeführten Zusammenhang verstehen so richtig nur die Insider. Doch wertvolle Hinweise für Schatz- und Gängesucher, was z.B. angesichts der zahlreichen Vorkommen von Bernsteinzimmern gemäß Abschnitt 10.2 kein Unterschied ist, sind das allemal. Wer noch mehr wissen möchte, interessiere sich für die Schriften der alten Schatzsucher. Auch in Chemnitz gab es übrigens Schatzbäume, worauf in Abschnitt 8.1 einzugehen ist. Wir wissen über manche historische Siedlung, übrigens nicht nur des Altbergbaus, dass in ihre Kirche eine Heilquelle (mit ihrem in die Tiefe reichenden Erdkrustenriss) integriert war, die anscheinend sogar das eigentliche Heiligtum ausmachte. Ob aber die Ausrichtung der Annaberger St. Annenkirche nach ausgebeuteten Silbergängen, die sich unter ihr befinden, ein Zufall ist? Wenn nun das Tränkbrünnlein ursprünglich die gleiche Funktion inne hatte, nämlich das Zentrum eines bergmännischen Heiligtums zu sein? Was die Heilkraft einer Mineralwasserquelle betrifft, so müssen wir nicht zu skeptisch sein. Die Historie der Menschheit ist in allen Sprachen und Regionen der Welt voller Beispiele für wundervolle örtliche Wirkungen dieses Wassers, das aus den Tiefen der Erdkruste kommt. Und verdankt nicht fast jedes deutsche Heilbad ursprünglich diesem seltsamen Phänomen seine Existenz? Somit mag es mit rechten Dingen zugehen, wenn die „Frischborn-Quelle“ im Crimmitschauer Wald und die „Heimatquelle“ im Sternmühlental noch heute unter dem Heilkraft-Verdacht stehen. Und das „trenck brünlein“? Viel zu wenig wissen wir über die anderen berühmten Quellen von Chemnitz, die allerdings vor allem der Trinkwasserversorgung gedient haben. Wer kennt schon die klangvollen Namen des „Blauborn“ und des „Goldborn“? Man kann einige ihrer ehedem so zahlreichen Quellstandorte immerhin am Beutenberg noch ausmachen, s. aber auch Abschnitt 8.2. Allerdings sind die meisten im Morast versunken und mischen ihre Wässer wohl eher im Untergrund und zudem mit denen des alten „Falschborn“. Doch die einst so wichtige „Kaßbergquelle“, noch im Jahr 1602 erwähnt, und auch die sogenannte „Schloßbergquelle“ sind gänzlich verschollen. Inwieweit letztere identisch war mit einer alten ergiebigen Brauereiquelle im Schlossgelände ist ebenso wie deren Standort unbekannt. Machen wir uns doch auf die Suche nach einem der wichtigsten aller Chemnitzer Bodenschätze. „Wenn offene Quellen nicht emporfliessen, dann müsste man diese unterirdisch suchen vor Sonnenaufgang. An den Stellen, wo man suchen müsse, würden sich kräuselnde und in die Luft aufsteigende feuchte Dünste steigen, dort solle man graben.“ So machte uns bereits vor 2.000 Jahren der römische Baumeister und Schriftsteller Vitruvius Pollio in seiner „De architectura“ gemäß der Bearbeitung von S. Schuler (1999) den nötigen Mut zur Lösung schwierigerer Aufgaben im gegebenen Zusammenhang. Wir folgen aber zunächst auszugsweise einer Beschreibung von C. G. Kretschmar aus dem Jahre 1822, in der es um den Ursprung und den Verlauf der Röhrwässer ging. Der „Goldbrunnen“ mit 7 Quellen befand sich „an den Thornstein-Anhöhen gegen Nordost im Zeißig-Wald“. Die Röhren liefen „von der Waldecke an der Freyberger Straße“ nach „Findewirths Vorwerk“, dem Pulverturm zu, 50 über den Anger, durch den Gablenzbach, durch die „Findeisenschen und Richterschen Gärten“, neben der „Kühgasse“, in die „Grabenvorstadt“, durch den Stadtgraben, in Schleusen unter der Stadtmauer, zum Markt, am „Plan“ und an der Hauptwache vorbei. Der „Blaubrunnen“ mit 3 Quellen speiste die Röhrentrasse entlang der „Freyberger Straße“ nach „D. Freytags Garten“, an den Lindenteichen vorbei nach der „Spielgaßbrücke“, durch den „Stadtgraben am Johannisthor“, bis zum Markt. Sie enthielten „1 Gran salzsaures Natron, 2,8 Gran kohlensaures Kalk, 4 Kubikzoll Kohlensäure“. Die „Quelle vor der Pforte am Kaßberge“ enthielt „wenig kohlensaures Kalk, viel salzsauren Kalk und fest gebundene Kohlensäure“. Sie war „klar und ziemlich kalt“. Die „Schloßbergquelle“ „mit starkem Mineralgehalt“ (auch Eisen) befand sich „im Graben unterm Schloß“ und verursachte dort eine „sumpfig-moorige Stelle“. Im Jahr 1575 hieß es zudem „Müssen das Röhrwasser vom Engelborn der im Dorff Hilbersdorf gelegen, in´s Kloster leiten“. Sprudelt der „Engelborn“ in Hilbersdorf nicht noch immer am alten Ort und heißt jetzt „Wiesenquell“? Die z.T. lebenswichtigen Quellen befanden sich somit alle außerhalb der schützenden Stadtmauer. Diesen strategischen Nachteil hatten die meisten historischen Städte der Welt, doch einige - angefangen vielleicht im jordanischen Khirbet ez-Zeraqon vor 5000 (!) Jahren mit seinem in 60 m Tiefe „durch ein verästeltes System unterirdischer Gänge“ erschlossenen Quellwasser, K. Grewe (1998) - wussten sich durch künstliche unterirdische Wasserführung zu helfen. Wie im Abschnitt 9.2 angedeutet, sollen die Chemnitzer sogar rechtzeitig, nämlich schon im 14. Jahrhundert (s. auch Abschnitt 9.3), mit viel Aufwand einen wasserführenden unterirdischen „Stolln“ gebaut haben. Doch welche tragweitige Fehlentscheidung! Der Verlauf wurde komplett außerhalb der Mauer in den Boden geschürft. Sind denn die Chemnitzer erneut von allen guten Geistern verlassen gewesen, nachdem schon die Lageplanung der Stadtmauer ein Missgriff war, wie wir leider im Abschnitt 5.9 aufzeigen müssen? Fast könnte man schon an dieser Stelle auf den Gedanken kommen, dass der Stollen ein unterirdischer Gang war, den Menschen für einen völlig anderen Zweck zu einer Zeit gegraben haben als sie noch nicht einmal an die Zukunft der Stadt zu glauben wagten. Das Schicksal nahm trotzdem seinen Lauf. Luft und Wasser sind nun einmal die Lebenselixiere des Menschen. Sie sind damit auch zugleich seine entscheidenden Schwachstellen. Das wussten eigentlich die Militärs (und auch die Richter) aller Zeiten. Daraus folgte übrigens die Erfindung der Guillotine, aber eben auch manche Kriegslist. In Chemnitz gab es diesbezüglich trotzdem keine Zukunftsidee, denn man lief hier genau so ungeschützt in das Messer. Die Luft blieb zwar vorerst unberührt, ihr fatales Schicksal blieb späteren Zeiten vorbehalten. Doch auf das Röhrenwasser senkte sich einst das Fallbeil, und zwar ausgerechnet in dem Augenblick als sich die Chemnitzer dem Feind gegenüber am stärksten fühlten und somit am störrischsten verhielten. Es war im Jahr 1632, da schlossen Sachsens Kurfürst Johann Georg und der Schwedenkönig Gustav Adolf einen folgenschweren Bund, der Wallenstein in Nürnberg derart aufregte, dass er seinen Feldherrn Holck sofort „zum Rachezug nach Sachsen“ schickte, E. Weinhold (1906). So geriet Chemnitz in den katastrophalen Strudel des 30jährigen Krieges. Chemnitz, „die Feste“, stand unvermittelt vor einer Bewährungsprobe und glaubte sich gerüstet. Selbst also Kanonenbeschuss vom Kaßberg aus, s. Abschnitt 5.9, führte nicht schnell genug zum Öffnen der Tore. Da kam Holck die Idee mit dem Röhrwasser. Als der Gegner aber mit der Zerstörung der Röhren begann, übergab man die Stadt sofort. Wie gesagt, erst viel später traf es auch die Luft. Dies wird uns erstmals überzeugend und einmal mehr vom Schicksalsberg dieser Stadt übermittelt. Des Kantors J. F. Stahlknecht „reine Luft“ in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts ist die Botschaft, die wir gerade noch herausfiltern konnten, denn unten in der Stadt war soeben 51