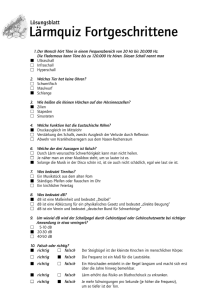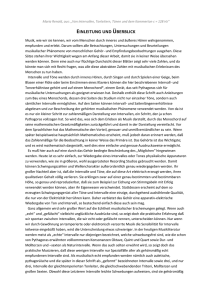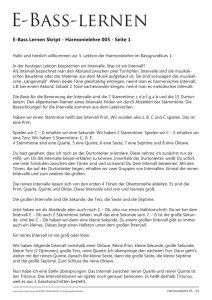Glaube und Komposition Glaube und Komposition
Werbung

© by SINFONIA SACRA e.V. 2006 ___________________________________________________________ Glaube und Komposition Zum Verhältnis von Religion und musikalischem Schöpfertum von Alfred Koerppen ___________________________________________________________ Über religiöse Gegenstände nachzudenken, ist jedermann befugt und durch ein inneres Bedürfnis auch aufgefordert und angehalten. Wer aber über sie öffentlich-verantwortlich reden will, sollte sich um theologische Bildung bemüht haben. Kunstwerke fordern jedermanns Stellungnahme ganz selbstverständlich heraus, und auch wenn Beruf und Bildungsgang den Musen fernstehen und man sich selbst, aus Gewissenhaftigkeit oder mangelndem Fachwissen, keine Bewertung gestattet, so kann doch niemandem die Kompetenz bestritten werden, sein subjektives Urteil zu treffen. Will man aber über Geschmack und Mode hinausgelangen und eine mehr objektive Wertung erreichen, wird man die Kunstwissenschaften nicht außer acht lassen, denn Objektivität ist nur auf der Basis der Vernunft und also durch Wissenschaft zu gewinnen. Religion und Kunst ähneln sich demnach darin, daß sie für jedermann offen sind, ganz gleich, wie es um die religiöse oder künstlerische Begabung bestellt ist oder wie hoch der theologische oder kunsttheoretische Wissensstand reicht. Die fromme Bauersfrau ist für ihr Glaubensleben nicht auf die Lektüre der Summa des Thomas von Aquin angewiesen, und eine funktionsharmonische Analyse des TristanVorspiels wird den Opernbesucher im Verständnis dieses Werkes nicht notwendig fördern. Die Beherrschung der kognitiven Disziplinen, die sich um Religion, Kunst und Musik ausgebildet haben, ist keine Voraussetzung, um ein rechtmäßiges und fruchtbares Verhältnis zu diesen Phänomenen zu gewinnen. Andererseits sollten aber, wenn mit einiger Verbindlichkeit über sie gesprochen wird, die zuständigen Wissenschaften nicht unbefragt bleiben. Für das Gebiet der Musik - für Musiktheorie, Musikästhetik, Musikgeschichte - glaube ich mich hinreichend gerüstet; als Kompositionslehrer ist man immer auch genötigt, das Spektrum der Musikwissenschaft im Auge zu behalten. Auf dem Gebiet der Theologie bin ich Dilettant. Wenn ich es trotzdem nicht vermeiden kann, theologisches Terrain zu betreten, so bewege ich mich in den Bahnen eines -2möglicherweise altmodischen Katechismus, jedenfalls in der Tradition theologischer Aussagen, wie sie in der Kirche allgemeine Gültigkeit gefunden haben. „Glaube und Kirchenmusik“ ist das Thema. Das „und“ im Titel behauptet einen Zusammenhang und setzt Religion und Kunst in eine Verbindung, die auf unterschiedlichste Art tatsächlich nachzuweisen wäre: z.B. historisch, indem man auf die vorgeschichtlichen gemeinsamen Wurzeln verweist; die Höhlenmalerei des Eiszeitmenschen erlaubt eine magischreligiöse und künstlerische Interpretation oder ästhetisch-hermeneutisch, indem man darstellt, wie Glaubensinhalte sich in musikalische Gestalten verwandeln, wie es in den rhetorischen Figuren und Wort-Ton-Vokabeln der Barockmusik geschah - oder biographisch, indem man an Person und Leben großer Komponisten unter dem Gesichtspunkt ihres Christseins betrachtet, ihre Glaubensbekundungen in Zitaten vorstellt, wie es Ernst Frankenberger in der kleinen Schrift „Gottesbekenntnisse großer Forscher“ für die Naturwissenschaft gemacht hat. Es ließe sich dann nachweisen, daß es schlechterdings keinen großen Komponisten gegeben hat, der nicht gläubig gewesen wäre. Nur müssen verbale Äußerungen von Komponisten im Zusammenhang mit ihrem eigentlichen Metier gesehen werden. Man darf sie nicht auf den Prüfstand strenger Begrifflichkeit stellen. (Die Fähigkeit, sich in der Art unserer Talkshows gescheit zu äußern, ist ein Talent, das den Meistem selten zu eigen war, und in der Regel sind auch ihre Erklärungen zur eigenen Musik lakonisch und unter dem Niveau ihrer Werke. Das Denken und Meinen von Musikern ist allgemein weniger rational geklärt als das von Schriftstellern und Philosophen. Auch durchschauen sie nicht immer theologische Implikationen; wenn Mozart eine Kantate „Dir, Seele des Weltalls“ komponierte, darf man nicht daraus schließen, daß er dem Deismus anhing oder ihm sein Freimaurertum ein Gottesverständnis vermittelt hätte, das nicht christlich war.) Dies alles wäre möglich darzustellen, wenn man über die Beziehungen zwischen Glaube und Musik nachdenkt. Ich gestatte mir, das Thema subjektiv, nämlich aus meiner Komponiererfahrung heraus zu erörtern und den Akt des Komponierens, insbesondere den Beginn der musikalischen Hervorbringung in Parallele und Analogie zum Glaubensakt zu setzen. Zuerst sehe ich ab vom Subjekt „Komponist“, seiner eigenen Disposition zum Komponieren, davon, wie sich sein psychischer Aggregatzustand beim Komponieren verändert und sich von der Normalbefindlichkeit unterscheidet, von den kurzen Momenten von Ergriffenheit und seltsamer Hellsichtigkeit, von den als „geschenkt“ empfundenen Erfindungen, die man Einfall nennt. Ich versuche nur zu beschreiben, was objektiv vorliegt, was an musikalischen Vorgaben vorhanden, was das Gegebene ist, mit dem man zu rechnen und auszukommen hat. -3Es ist zuerst die „Natur der Musik“, die Welt der Klänge. Wo Materie schwingt und Wellen bewegt, entsteht Klang. Es ist müßig, sich auf die Frage einzulassen, ob Musik nicht erst dann entsteht, wenn strukturierter Klang auf menschliche Ohren trifft. Die Gesetze der Akustik wären auch in einer menschenleeren Welt gültig, wo Töne entstünden, erklängen auch Obertöne, Durdreiklänge zuerst, ungehörte, so wie das Sonnenlicht im Regenbogen ungesehene Farbenspiele inszenierte, l’art-pour-l’art-Vorstellungen der Natur. Aber in diesen Phänomenen scheint doch eine Ordnung zu wirken, die zum Menschen hin offen ist, oder, genauer, auf ihn wie auf einen Adressaten hinzielt, nach einer Korrespondenz verlangt und, fehlt der Korrespondenzpartner, ihren Sinn nicht finden kann. Dieses Gegebene darf man mit Recht „Natur der Musik“ nennen, und ich will einige der dem Tonmaterial innewohnenden Ordnungen anführen, die kompositorisch wirksam sind. (Wenn ich Tonmaterial und nicht Klangmaterial sage, so beschränke ich mich und schließe das Geräusch aus, obwohl es auch zum Material des Komponisten gehört. Der Riesenkosmos der Geräusche - oder ist es ein Chaos? - der Gemische und Konglomerate zahlreicher Töne von unstabiler Schwingung ist auch akustisch strukturiert, doch sind die Strukturen kompliziert, und es ist noch immer der Ton, der die Musik macht, ungeachtet der kompositorisch interessanten Übergangsfelder vom Ton zum Geräusch.) Es ist üblich, unter den gegebenen Phänomenen immer zuerst die Naturtonreihe zu nennen. Sie diente im Für und Wider um die Atonalität als Argumentenbeschafferin und steht im Vordergrund der musiktheoretischen Überlegungen Paul Hindemiths. Ihre ersten und einfachsten Teiltöne ergeben zusammen mit dem Grundton bekanntlich einen Durdreiklang. Der Durdreiklang ist also eine Naturerscheinung wie der Regenbogen. Auf ihren Zahlenverhältnissen 1:2, 2:3, 3:4 usf. hat Hindemith seine Tonsatzlehre aufgebaut und gezeigt, daß es eine natürliche, vorkompositorische, tonale Gravitation gibt, die die zwölf Töne in einem hierarchisch gestuften System anordnet, das ganz analog zum Kräftespiel gesehen werden kann, das im Sonnensystem herrscht. Aus den Verhältnissen der Naturtonreihe gewinnt Hindemith die sogenannte Reihe I, in der er den zwölf Tönen einen festen Platz zuweist. Im Stellenwert der Töne ist die zunehmende Entfernung vom Grundton bzw. die Stärke und nachlassende Anziehungskraft des Grundtons ausgedrückt. Auch die Funktionstheorie der Harmonielehre war imstande, obwohl vom diatonischen System ausgehend, die zwölf Töne in ihrem Verhältnis zum Grundton der Tonart zu erklären. So wären z.B. in C-Dur die nichtdiatonischen Töne fis als Terz der Doppeldominant, b als Sept des Dominatseptakkords zur Subdominante musikalisch und begrifflich „geortet“. Ihr Verhältnis zu C ist aber ein mittelbares, d.h. über Dominante oder Subdominante vermitteltes, so wie das des Mondes zur Sonne über die Erde vermittelt wird. Hindemiths Reihe I ermöglicht nun aber einen unmittelbaren Bezug sämtlicher Töne auf einen Grundton. Ein -4Grundton C übt auf G die stärkste Anziehungskraft aus, einen Magnetismus, der sich über elf Grade hin abschwächt und im Fis den entferntesten Punkt erreicht. Diese Kräfte und Verhältnisse sind kompositorisch in verschiedener Hinsicht wirksam und nicht dispensierbar. Z.B. kann aus dem von der Reihe I abgeleiteten Grundtongang die Selbstverständlichkeit, Geschmeidigkeit, Farbigkeit, Ungewöhnlichkeit oder Unbrauchbarkeit von Akkordverbindungen abgelesen werden. Im allgemeinen wird die Analyse vom Ohr bestätigt. Differenzen zwischen Höreindruck und Analyse gibt es allerdings dann, wenn historische Umdeutungen im Sonanzwert auftreten, Umprägungen, die Hindemiths Theorie, da sie auf Physik fußt und ahistorisch konzipiert ist, nicht erfassen kann. Kurz gesagt: Die Mikrostruktur des Tons ist tonal. „Atonale Musik“ wäre eine contradictio in adjecto, denn die Natur der Töne läßt nur Organisationen zu, die die musikalische Schwerkraft anerkennen. Atonalität wäre utopisch, sie käme dem Versuch gleich, aus Steinen ein Luftschloß zu bauen. Das Ganze kann nicht im Widerspruch zu den Eigenschaften existieren, die in seine Bestandteile gelegt sind. Der Komponist kann das Auffinden von Tonalität nur erschweren, nicht verhindern, ebenso wie die Schwerkraft. durch die Fliehkraft zeitweise kompensiert, aber nicht dispensiert werden kann. In diesem Grundgedanken ließe sich die der Hindemithschen Tonsatzunterweisung hinterliegende „naturalistische“ Ästhetik zusammenfassen. Hier muß ein Einwand Platz finden, der Gewicht hat und auch für das Folgende gilt. Natur und Natürlichkeit sind einerseits normschaffend für jede künstlerische und außerkünstlerische Tätigkeit, doch ist der Sinn für Normen beim Menschen außerordentlich irritierbar und leicht außer Kraft zu setzen. Dem Ethiker ist es nichts Neues, wie leicht die „Stimme des Gewissens“, diese autonome Instanz, die zur natürlichen Ausstattung des Menschen gehört, durch Sitte, Mode, Erziehung, „Zeitgeist“ verbogen, verdrängt oder zum Schweigen gebracht werden kann. Doch bleibt bestehen, daß sich die vielen Abirrungen und Unordnungen immer wieder durch die Normen des Natürlichen zurechtrücken lassen und auch die Kunst sich an ihnen regenerieren kann. „Naturam expellas furca, tamen usque recurret“, „du kannst die Natur mit der Gabel vertreiben, sie kommt immer wieder zurück“, sagt Horaz. Aber auch eine ästhetische Idee, die im Widerspruch zum Material steht, ist nicht von vornherein unkünstlerisch. Die Baumeister der Gotik haben die Schwere und Dichte des Steins aufgelöst, die Wände durchbrochen, die Türme in Kraftlinien und die Turmhauben in Spitzengewebe verwandelt und so das Material gezwungen, gegen seine eigene Natur zu zeugen und auszusagen. Trotzdem waren Schwere und Dichte nicht aus der Welt zu schaffen und das heißt, das Problem der Statik mußte gelöst werden und auch lösbar bleiben. So wurde das Stützgerüst der Strebepfeiler und bögen erforderlich. Deshalb kann es keine atonale Musik geben, wohl aber -5eine antitonale. Das „a“ will ja ausdrücken, daß Tonalität abwesend, von der Musikgeschichte eliminiert sei, es leugnet die Schwerkraft und befindet sich damit im Irrtum. Im „anti“ wird die Anziehungskraft zwischen den Tönen anerkannt, aber der Komponist stört, die natürliche Tonalität mit einer antitonalen Kompositionstechnik und auf Grund eines ästhetischen Postulats, das ihm befiehlt, der Natur zu widerstreben. Fragt man nach Motiven für diese unklassische Ästhetik - Klassik ist veredelte Natur - so ließe ich anführen, daß gerade durch die Störung des Magnetismus, der zwischen den Tönen wirkt, ein Stimulus auf den Hörer ausgeübt wird, der ihn zwingt, die verborgene Tonalität aktiv aufzuspüren, wie man das beim öfteren Anhören von Werken Schönbergs oder Weberns erleben kann. Es ist das ein Motiv, von anderen später. Hindemiths „Naturalismus“ würde dieses Argument wahrscheinlich nicht gelten lassen. (Seine „Unterweisung“ zeigt aber auch da Grenzen, wenn, wie schon gesagt, in der Analyse historische Umstellungen, z.B. im Sonanzwert der Intervalle, Hindemiths Reihe II, nicht berücksichtigt werden. Eine Musiktheorie, die ausschließlich auf der Basis der Akustik errichtet ist, wird vieles, was zur „Natur der Musik“ gehört, richtig beschreiben, aber die historischen Überformungen, die ästhetischen Postulate des Stils übersehen. Ihr analytisches Instrumentarium erfaßt das Spezifische der Epoche nicht.) An der Obertonreihe lassen sich noch eine Anzahl weiterer Beobachtungen machen, die als „Natur der Musik“ auf die Komposition Einfluß nehmen. Da ist die Oktave, das Verhältnis 1:2, das uns viel zu selbstverständlich ist, als daß man sich über das Phänomen noch zu wundern imstande wäre. Und doch ist die vollständige Identität von Tönen in verschiedenen Tonräumen sehr merkwürdig, eine Identität, die auch den primitivsten Musikkulturen bewußt ist. Der Ton wird in seiner Oktavierung zu einem Klang wie zwischen zwei Spiegel gestellt, sich in Abständen wiederholend, und oktavidentische Töne wirken wie Marksteine und Grenzpfähle, in einen ansonst noch amorphen Tonraum gesetzt. Die verschiedenen Wege, den Oktavraum auszufüllen, führen zum strukturierten Tonmaterial, je nachdem, ob man die gezirkelte Quinte, das Verhältnis 2:3 zum Maß nimmt oder die Oktave in gleiche Distanzen, „distanzproportional“ einteilt. Wieso kann man von einem „Tonraum“ sprechen, von auf- und abwärts im Tonraum? Hoch und tief sind zuerst nur Unterschiede der Tonfrequenz, der schnellen und langsameren Schwingung der Luftwellen. Ist „hoch“ und „tief“ nur eine Metapher, eine kulturkreisspezifische Absprache, um Frequenzen räumlich zu deuten und zu verstehen? Aber in außereuropäischen Musikkulturen benutzt man ganz ähnliche Begriffe. In Afrika nennt man die hohen Töne „dünn“ und die tiefen „dick“. Auch „leicht“ und „schwer“ bezeichnen den Gegensatz, oder „hell“ und „dunkel“, alles sinnverwandte Wörter, die den Symbolcharakter dieses Antagonismus’ verdeutlichen. Läßt sich eine physikalische Analogie dafür ausmachen? Aber dann müßten „heiß“ und „kalt“ auch oder zuerst -6vorkommen, denn Wärme ist schnelle Molekülbewegung. Doch dieses Gegensatzpaar fällt uns bei hoch und tief nicht automatisch und wie dazugehörig ein. Es bleibt bei räumlichen Vorstellungen, bei Größe, Gewicht und Helligkeitsgrad. Daß solches Gegebene kompositorisch Bedeutung hat, soll ein Beispiel illustrieren. Schnelle Bewegung ist in hohen Tonlagen viel natürlicher als in tiefen, während „tief“, „schwer“, „dunkel“ sich lastend verhält und es Kraft braucht, Tiefes zu bewegen. Nicht von ungefähr sind die Klaviaturen so angelegt, daß die ungeschicktere linke Hand die tiefen Töne übernehmen kann. Entscheidet sich der Komponist „gegen die Natur“ und schreibt schnelle Baßbewegungen, so wird die Bedeutung der Töne aber auch deutlicher, in dem sie sich jetzt von der Norm abheben. Die Musik macht eine Aussage, sie sagt: Um Schweres zu bewegen, wird Kraft gebraucht. Es scheint so zu sein, daß immer dann, wenn Gegebenes provoziert, Normen überschritten und Konventionen verletzt werden, der Sprachcharakter der Musik in seiner Präzision zunimmt. Die hoch-tief-Polarität oder Helligkeitsskala diente auch dazu, die Höraufmerksamkeit auf „das Wichtige“, die Substanz und Essenz der Musik, auszurichten. In der Monodie zu Beginn des 17. Jahrhunderts wird „das Wichtige“ als Melodie und Baß (Hindemiths „übergeordnete Zweistimmigkeit“) an den Rand des Satzes gelegt, ganz analog der helldunkel-Symbolik in der Malerei dieser Zeit - während das Mittelalter Bedeutendes durch Größe hervorhebt, sei es auf der Bildfläche, sei es in den langen Tönen des Cantus firmus, in der Zeitdimension. Weiter: Es gibt im Blick auf die Obertonreihe eine Spekulation, die bestechend ist. Sie sagt, daß Tonbewegungen, die von einem ungeraden Oberton zu einem geraden fortschreiten, finale Wirkung haben, also einen Punkt setzen, umgekehrte aber einen Doppelpunkt oder ein Fragezeichen. Der Schritt 3 → 2 oder 3 → 4 entspricht Dominante → Tonika, der Kadenz. Der Schritt 5 → 6 der Terzklausel des 15. Jahrhunderts. 11 → 12 entspräche (ungenau) dem Leittonschritt. Wenn dies so ist, so wären solche zentripedalen oder zentrifugalen Tonbeziehungen entschieden kompositorisch bedeutsam. Ferner: Die Obertonreihe hat einen pyramidenförmigen, sich nach oben verjüngenden Aufbau. Nach ihrem Vorbild sind Harmonien klanggünstig gebaut, wenn die weiten Intervalle nach unten, die engen nach oben gelegt werden. So ist die Tektonik des Klanges gut gegründet, andernfalls wäre sie kopflastig wie der eiserne babylonische Götze, der auf tönernen Füßen stand. Ferner: Die Klangfarbe ist ein Produkt der Obertonreihe und des Einschwingvorganges. Sie ist im Obertonprisma deponiert. Ein Ton kann obertonreich oder -arm sein, die geraden oder ungeraden Teiltöne hervortreten lassen oder unterdrücken und, je nach dem, eine „schöne“ -7oder „charakteristische“ Physiognomie annehmen. Kompositorisch wird dieses Faktum in der neuen Musik bewußt genutzt, und diese Gegebenheit, sei sie an ein Instrument oder ein Register gebunden oder wird sie durch Instrumentation, Registrierung oder wie in der Elektronenmusik direkt manipuliert, ist entschieden kompositorisch relevant. Ferner: Tonwellen besitzen neben der Frequenz auch eine Amplitude, die die Lautstärke bestimmt. Laut und leise gehören zur „Natur der Musik“. Die Dynamik kann den Klangquellen gleichsam architektonische Bedeutung geben, z.B. in der Gegenüberstellung von Vorsänger und Chor, Solist und Orchester. Sie kann Bedeutung vermitteln; leise kann „Entfernung“, „Schwäche“, „Zartheit“, „Finesse“, „Eindringlichkeit“ usf. ausdrücken. Wenn bis jetzt vom elementarsten Material der Musik, dem Ton und seiner Mikrostruktur die Rede war, soll jetzt die Zeit, die eigentlich musikalische Dimension betrachtet werden. Ist sie real? Kann sie „leer“ gedacht werden? Ereignet sie sich nicht erst dann, wenn Veränderung an Dauer vorüberzieht? Jedenfalls muß sie vorausgesetzt werden, wenn Musik erklingen soll. Sie ist ihre spezifische Dimension, so wie Architektur sich im dreidimensionalen Raum darstellt und ein Gemälde sich zweidimensional ausdehnt. Im Unterschied zum Bild, das optische Realität imitieren kann und damit einen „Inhalt“ hat, der zu Material und Dimension als Drittes hinzukommt, haben Architektur und Musik gemeinsam, daß sie ihre Dimensionen thematisieren und also zum Inhalt machen können. Das meint wahrscheinlich Goethes Wort von der Architektur als einer „gefrorenen Musik“. Wie kann Musik Zeit gestalten? Sie kann sie langsam und schnell verfließen lassen, je nachdem, ob viele oder wenige Klangereignisse auftreten. Sie kann sie an einen Pulsschlag binden, der ihr Tempo bestimmt und vor diesem Hintergrund längere und kürzere Werte spielen lassen, so daß Tempo und Rhythmus, das eine durch das andere, mehr Kontur gewinnen. Sie kann die Zeit durch „schwer“ und „leicht“ periodisch strukturieren, einen Takt schaffen und den Zeitstrang in drei Ebenen teilen: in einen Hintergrund, der das Metrum, somit das Tempo angibt, in einen Mittelgrund, der „schwer“ und „leicht“, den Takt also akzentuiert, in einen Vordergrund, der ausgeglichene, gestaute, fließende, abrupte, synkopische, also den Akzent auf „leicht“ setzende oder wie immer beschaffene Rhythmen zeigt. Die Zeit kann durch Themen, Motive, charakteristische Figuren, die geformt genug sind, um einen Erinnerungswert zu besitzen, also vom Gedächtnis festgehalten werden können, in einen Zeit"raum" verwandelt werden. Der Moment auf der Zeitstrecke wird so mit Vergangenheit und Zukunft verklammert, daß, der Idee nach, alle Ereignisse des Werks in diese Gegenwart hinein wirken und präsent sind, so daß strömende Dauer -8herrscht und der stehende Augenblick, nunc stans, eine relative Realität gewinnt. In ihr überwindet die Musik ihre eigene Dimension. So kann Zeit, ihr Verfließen auf dem Hintergrund von Dauer, erfahren und aufgehoben werden - aufgehoben in dem schönen Hegelschen Doppelsinn. Eine weitere Gegebenheit ist es, daß die Zeit einsinnig ist; sie fließt wie ein Fluß in einer Richtung. Grund und Folge sind nicht vertauschbar, der Krebsgang hat nur Sinn, wenn es keine Folgerichtigkeit gibt, also im musikalischen Palindrom. Im anderen Fall verstößt der Komponist gegen Kausalität und Prozeßcharakter. Wenden wir uns dem Intervall zu. Intervalle sind nicht nur quantitative Größen, sie sind nicht ausreichend beschrieben, wenn Schwingungsdifferenzen gezählt werden, wie man meinte, als es galt, „Atonalität“ zu verteidigen und den Begriff „Intervall“ durch „Tondistanz“ zu ersetzen suchte. Das Intervall besitzt Eigenschaften, die sich benennen lassen. 1. hat das Intervall einen bestimmten Platz auf der Sonanzskala (Hindemiths Reihe II). Sie ordnet die Intervalle tonpsychologisch nach ihrem abnehmenden Verschmelzungsgrad und arithmetisch nach der zunehmenden Kompliziertheit der Zahlenverhältnisse. Daß dies möglich ist, beweist, daß zwischen Akustik und Psychologie eine Korrespondenz besteht. Am Anfang der Reihe steht das konsonanteste Intervall mit dem einfachsten Schwingungsverhältnis, die Oktave. Dann, über Quint und Quart weitergehend, werden die Intervalle zunehmend spaltklanglicher und rechnerisch komplizierter. Diese Sicht der Sonanzreihe relativiert den Dissonanzbegriff; z.B. ist die große Terz gegenüber der Quinte dissonanter, gegenüber der Sekunde konsonanter. Vom Tritonus, am Ende der Reihe stehend, läßt sich freilich nicht sagen, daß er stark-dissonant sei. Er kann nicht unter dem Gesichtspunkt wachsender Trennschärfe subsumiert werden. Er fällt aus der Ordnung und sein physiognomisches Profil beherrscht eine unstillbare Bewegungsenergie, die gleichwohl nicht weiß, wohin sie will und einen dritten Ton braucht, der ihm den Weg weist und zu einer Lösung verhilft. Dieser bestimmte Platz, den die Intervalle auf der Sonanzreihe einnehmen, ist „Gegebenheit“, „Natur der Musik“, kompositorisch relevant und, solange sich distinkte Töne zum Tonsatz zusammenfinden, unaufhebbar. (Man könnte gegen die Gegebenheit der Sonanzreihe einwenden, daß die Quarte im klassischen Kontrapunkt zu den Dissonanzen gezählt wird, obwohl sie in der Reihe an dritter Stelle und noch vor der Terz auftritt. Das hat nun mehr mit der eigentümlichen Kopflastigkeit dieses Intervalles zu tun. Es trägt den schweren Grundton oben und ist deshalb harmonisch labil, melodisch, als Quartsprung, aber stabil. Sein Verschmelzungsgrad galt zu allen Zeiten als hoch. Daneben können stilspezifische Überformungen, wie schon gesagt wurde und noch zu zeigen ist, das Gegebene zeitweise außer Kraft setzen. -92. besitzen mindestens die konsonanteren Intervalle, Quinte, Quarte, große Terz, einen Grundton, was sich aus dem Kombinationstonphänomen ergibt. Hindemith zieht diese Erscheinung dazu heran, um auch komplizierteren, vieltönigen, nicht mehr umkehrbaren und nicht aus dem Terzenaufbau hervorgehenden Akkorden einen Grundton zuzusprechen. Der Gang der Grundtöne zeigt dann, wenn er an der Reihe I gemessen wird, die Selbstverständlichkeit, Geschmeidigkeit, Farbigkeit, Sprödigkeit oder Härte harmonischer Fortschreitungen. 3. sind Intervalle umkehrbar, und die reziproken Intervalle besitzen untereinander Familienähnlichkeit, z.B. Terzen und Sexten. 4. besitzen Intervalle Physiognomien und transportieren „Bedeutung“; so etwa wenn die Quinte Elementares, leeren Raum, Reinheit, Kälte, Festigkeit aussagt, oder wenn die Terzen emotional changierend wirken. Ob solche Bedeutung apriori gegeben oder aposteriori durch Tradition und kulturimmanente Absprachen den Intervallen zugewachsen ist, ist schwer zu entscheiden. 5. Denkt man sich über einem gehaltenen Ton ein aufwärts geführtes Glissando, so erfolgt der Umschlag von einem Intervall zum nächsthöheren, in einigen Fällen plötzlich und auf einem Punkt, bei anderen gibt es einen Toleranzbereich, in dem es schwer ist, z.B. zu entscheiden, ob man eine zu tiefe große Terz oder eine zu hohe kleine Terz hört. Im Bereich der Sekunden, Terzen und Septimen können „irrationale“, getrübte, unentschiedene Intervalle, verborgen sein. Zwischen Quinte und kleiner Sexte hingegen gibt es kein musikalisches Intervall. (Dieses Faktum sollte genügen, um alle, die mit Drittel- oder Vierteltonsystemen experimentieren, mißtrauisch gegen jeden Distanzenschematismus zu machen.) Aus alledem folgt, daß Intervalle natürliche Eigenschaften besitzen, die kompositorisch bedeutsam sind. Der Ton und die Naturtonreihe, das Intervall und die Kombinationstöne, die Zeitdimension und die Kategorien der Zeitverwaltung bilden die natürliche Grundlage, auf der Musik aufruht. Ihre bedingenden Strukturen werden zu keiner Epoche und unter keinen Umständen ungültig. Andererseits kann auf Grund von kulturimmanenten Umwertungen und Verschiebungen, von aposteriori getroffenen Setzungen und Absprachen das jeweilige Schöne in Konflikt geraten mit der Natur. Es gibt einen Manierismus, der bis in die Wurzeln der menschlichen Existenz reicht, und es ist meine Überzeugung, daß er mit dem Sündenfall zusammenhängt. Wer Kunst und Sitten primitiver Völker vor Augen hat und sie ohne Romantik und ohne die Nostalgie unserer späten Zivilisation betrachtet, die Dämonenmasken, die künstlich verzerrten „maskierten“ Stimmen der Sänger, die Trommelseancen, der hypnotisch wirkende Wiederholungszwang, die rituellen Verstümmelungen, die Lust am - 10 Grotesken, die wuchernde Phantastik der religiösen Vorstellungen und Erzählungen, wird nicht umhin können, die Künstlichkeit und Naturferne gerade der Naturvölker zu konstatieren. Inzwischen scheut man sich, durch Schlagworte wie „Eurozentrismus“ verunsichert und durch den seltsamen Masochismus, der die Kirche zusammen mit der ganzen westlichen Welt erfaßt hat, gehindert, diese Erscheinungen „heidnisch“ zu nennen, wie das früher selbstverständlich war. Die obersten ästhetischen Werte einer Zeit, das Schöne der Gotik, des Barock, das Schöne bei Claude Lorrain oder Dali, Bruckner oder Strawinsky, das einmal und in näherer Bestimmung „Vollkommenheit“ oder „Erhabenheit“ oder „Glanz der Wahrheit“ oder „Traum“ sein kann, ist immer eine Setzung. Solche Setzungen, seien sie von der Epoche als geltender Stil und Schönheitskanon diktiert oder vom einzelnen Künstler als Ideal geschaut, können von diesem uralten Manierismus berührt werden und sich dann über „das Gegebene“ eine zeitlang hinwegsetzen. Hier wird nun ein Überblick über eine zweite Schicht nötig: die „Kultur der Musik“ und was sie an Gegebenem für den Komponisten bereit hält. Die Bedingungen, die eine etablierte Musikkultur stellt, sind einerseits nicht so verpflichtend wie die der „Natur“, andererseits aber auch enger, hilfreicher, wenn sie den Kompositionsakt vorformen. Da ist zuerst der Tonvorrat zu nennen, die Tonsysteme, Skalen und Modi, die pentatonischen, diatonischen, chromatischen, distanzproportionalen oder künstlich gebildeten Skalen, wie es z.B. die Modi Messiaens sind. Zugleich das Repertoire an Elementarfakturen und -formen; zuerst die gleichsam graphischen Fakturen, die Töne und Klänge darstellen können: der Punkt, die Linie oder Welle, das Flächen- oder Blockartige. Dann die „Stimme“, die durch einheitliche Tonfarbe den Zusammenhang der Linie, die Melodie stiftet. Sodann die tonräumlichen Relationen, die Bewegungsarten, die zwischen Stimmen möglich sind: die Parallel-, Gegen- und Seitenbewegung. Sodann die Satzfakturen, die ein- und mehrstimmigen, die homophonen, polyphonen, heterophonen und monophonen Anlagen. Zugleich das Repertoire der Formen. Unter ihnen wäre zuerst zu unterscheiden zwischen Formen, die anheben, verlaufen und zu Ende kommen, also auf Finalität angelegt sind und solchen, die ein währendes Strömen, eines, der Idee nach endlosen Prozesses im Ausschnitt repräsentieren. Dann die Formen, die als „tönende Prosa“ keine Wiederholungen und korrespondierenden Teile besitzen und ihr Gegensatz, die „gereimten“, die eine zyklische Wiederkehr bieten. Dann die drei Formideen, in denen sich drei charakteristische Organisationsformen der Materie spiegeln und wiederfinden: die statischkristallinische, die eine Struktur wiederholt und multipliziert, Härte und Dauer besitzt und bei kleinster Veränderung zerfällt (Bachs zweistimmige Inventionen) - die dynamisch-organische, die atmet, sich spannt und entspannt und auf eine Klimax ausgerichtet ist (Beethovens Symphonik) - - 11 die amorph-diffuse, der Nebelfleck, der in verschwommenen, unempfindlichen Grenzen „west“, in dem Ton und Intervall als Einzelnes untergehen und die sich nur in Dichte, Ausdehnung, Farbe und Lautstärke artikulieren (Ligetis „Athmosphère“). Dann die epischen, monothematischen Formen und die dramatischen, die ihre Dramatik aus einem dialektischen Antagonismus gewinnen (Fuge und Sonatenform). Schließlich das ganze Formen- und Gattungsrepertoire im engeren Sinne; Sonaten- und Rondoform, Symphonie, Oper, Messe usf. All das liegt vor und kann kompositorisch genutzt, weitergebildet, überhöht oder gesprengt werden. Daneben bietet die Musikkultur einen umfangreichen Apparat zur Realisierung des Komponierten an; ein Instrumentarium und Interpreten, die es bedienen - ein „Gegebenes“, dessen die Komposition bedingende Formkraft nicht überschätzt werden kann. Wie sehr ist z.B. der Klaviersatz abhängig und bestimmt vom Greifvermögen des Pianisten, von den zehn Fingern und ihrer Spannweite, von dem Faktum, daß er in der Tiefe und Höhe eng gelegene Akkorde in großem Abstand voneinander spielen kann und es deshalb naheliegt, den im Vorbild der Naturtonreihe gegebenen Pyramidenaufbau von Harmonien zu vernachlässigen. Hier gerät ein aus der Natur abgeleitetes Prinzip in Widerspruch mit der Kulturschicht, mit dem Körperbau des Spielers. Man denke an die vielen tiefen, enggesetzten Akkorde in Beethovenschen Klaviersonaten, die man aber - und das beweist wieder die Leichtigkeit, mit der Umwertungen gelingen oder hingenommen werden - sehr bald als „charakteristisch“ zu goutieren lernt. Wie strikt bedingend das Instrument „menschliche Stimme“ auf die Komposition wirkt und wie sehr es sich rächt, wenn sich der Komponist hier nicht auskennt, liegt auf der Hand. Man muß wissen, daß dem Chorbaß auf dem großen F kein Fortissimo zuzumuten ist, daß Stimmkraft mit Stimmlage zusammenhängt, daß der Beweglichkeit der Stimme Grenzen gesetzt sind usf. Schließlich wären noch die musikalischen Einrichtungen und Institute zu nennen, die soziale Ortsbestimmung, die die Komposition beeinflußt; es ist nicht gleichgültig, ob sie für die Oper, fürs Konzert, für „Tage der neuen Musik“, für die Musikschule oder für den Gottesdienst gedacht ist. Jedesmal hat der Komponist ein anderes Publikum mit unterschiedlicher Mentalität und unterschiedlichen Erwartungen vor Augen. (Und es liegt hier ein Grund für die Unsicherheiten und Hemmungen, mit denen Komponisten neuer Musik zu kämpfen haben, denn für wen schreibt man und welches Publikum stellt man sich vor? Haydn wußte, daß er für den musikliebenden, verständigen Adel am Hofe Esterhazy komponierte, Schubert dachte, wenn er seine Lieder schrieb, an seinen biedermeierlichen Freundeskreis, Brahms an den Salon des Arztes Billroth oder an die großbürgerliche Gesellschaft, die die symphonischen Konzerte besuchte. Die amorphe Masse der modernen Industriegesellschaft bietet wenig Anhalt, um den Komponisten zur Orientierung zu dienen.) - 12 Endlich - und damit will ich diesen Rundumblick auf die bedingenden und formenden Kräfte, die vor dem Kompositionsbeginn liegen, beschließen endlich führt die Tradition infolge eines die Vergangenheit immer mehr übersehenden und zum Leben erweckenden Geschichtsbewußtseins uns eine wunderbare Fracht an Meisterwerken zu, ein Gegebenes, das unseren Ehrgeiz fordert und anspornt und mit dem sich unsere Arbeit zu messen hat und in Vergleich setzen muß, wenn wir uns nicht frei- und mutwillig dem „Zahn der Zeit“ überantworten und in Oswald Spenglers Nachkultur, ins „Fellachenstadium“ fallen wollen. Alles Gesagte zusammengefaßt, ergibt sich Folgendes: Was den Komponisten gegeben und dem Kompositionsakt vorausgesetzt ist, sind zwei ordnungsspendende Kategorien verschiedener Provenienz: 1. Die „Natur der Musik“ und 2. die Musik als Kulturereignis. Die Natur der Musik enthält Ordnungskategorien, die unveränderlich sind. Diese Ordnungen sind „sprechend“, auf den Menschen gerichtet, sie übertragen verständliche Bedeutung (z.B. schnelle Schwingung = hoch, Dissonanz = gespalten). Das läßt vermuten, daß es zwischen den Ordnungen der Akustik und dem „Apperzeptionsapparat des Menschen“, der auf Empfang gestellten Seele, ein psychophysischer Parallelismus besteht. Musik als Kulturereignis überliefert und bietet einen unübersehbar reichen Vorrat an Formen, Instrumentarien, Institutionen und Realisationsweisen an, die ebenfalls bedingend oder verpflichtend sind. Sie sind veränderlich und können Prinzipien, die sich aus der Natur herleiten, überformen und vorübergehend dispensieren. Doch lehrt die Musikgeschichte, daß sich Musik immer wieder an ihrer Natur regeneriert und orientiert. Es gibt zwei Beweggründe, die die Abweichung von den Normen, seien sie natürlich oder Konventionen der Musikkultur, zu erklären vermögen. Einmal erhöht sich die Sprachkraft der Musik, die Präzision ihrer Anmutungen, die sie auslöst. Ich erinnere an das Beispiel der schnell bewegten Töne in der Tiefe. Schnelligkeit kann vielerlei Sinn vermitteln: daß der Fluß der Zeit reißend geworden ist, weil das Bett der Tonalität sich verengt hat (Stretta) - daß alle Widerstände ausgeräumt sind (Mozarts Allegro aperto) - daß Freude oder Übermut den Pulsschlag beschleunigen daß Gefahr und Angst eine Fluchtbewegung auslösen usw. Rasche Figuren in der Tiefe würden aber die Anmutung „freie Fahrt“ und „keinerlei Widerstand“ verbieten, denn der ausgesprochen materielle Charakter, das Lastende dieser Töne bietet Widerstand. Ein anderes Beispiel: Viele kräftige Stimmen und Instrumente korrespondieren selbstverständlich mit Forte. Werden sie im Piano, also gegen ihre Natur, eingesetzt, verbietet sich die Bedeutung „Kraft“, „Überwältigung“ usw., die Anmutung wird - 13 nuancierter und läßt vielleicht nur noch die Vorstellung von „Entfernung“ zu; von der großen Kurmusik, die hinten im Park spielt, von den Materiewolken entfernter Galaxien, deren Licht uns nur noch „leise“ erreicht. Nuancierter und genauer werden also Bedeutungen immer dann, wenn nicht-korrespondierende musikalische Elemente miteinander verbunden werden. Es gibt noch einen zweiten Beweggrund, der Komponisten dazu bestimmen kann, die Natur zu überhören und die Überlieferungen abzuwerfen. Es ist das die zentrale Maxime einer Ästhetik, die die Autonomie, die in jeder Hinsicht freie Selbstbestimmung des Künstlers fordert - das Glaubensbekenntnis des größten Teiles der Künstler, die repräsentativ für die moderne Kunst und Musik sind. Man glaubt, daß Kunst, wenn sie Kunst sein will, eo ipso künstlich sein muß, im Widerspruch zur Natur und überlieferter Kultur stehen kann oder soll, „daß der Mensch in der Musik auch noch die letzten Elemente selbst schafft und seinem Geist unterwirft“, wie Otto Weininger sagt. Von daher liegt es nahe, sich in die Tradition des Manierismus zu begeben, der, so alt wie die Kunst selbst, eine Gegengröße von großer Faszination darstellt. Mit dieser Gesinnung befreit sich die Ästhetik aber auch von der Ethik, das Schöne vom Wahren und Guten und eröffnet einen Raum eigenmächtiger Zuständigkeit, die Kunst des l’art pour l’art. Ihr weltanschaulicher Hintergrund ist der Nihilismus, wie es Gottfried Benn erkannt und in heroischer Attitüde gepriesen hat. Dieser autonomen Kunst kommt eine menschliche Eigenschaft zugute, durch die es gelingt, Schönheitskategorien mit leichter Hand umzustoßen und neue, „freischwebende“, selbstbestimmte Schönheit zu etablieren - letztlich auch nur ein Symptom für die Verfassung der menschlichen Natur, deren Bindungen und Fesseln zwar vorhanden aber locker genug sind, um Freiheit zu ermöglichen. Insofern erfährt der Komponist die Bedingtheiten seines Materials nicht als Zwänge, nur als Geneigtheiten, denen er folgen kann aber nicht folgen muß. Über Verbildungen lassen sich schnell neue, in sich stimmige Ästhetiken errichten. Und das Talent, sich schnell umund einzugewöhnen, eine neue Hör- und Sehweise zu entwickeln, Sinn in Unsinniges zu projizieren und - und damit betrete ich religiöses Gebiet dem vermessenen Zug des Herzens zu folgen und ex nihil zu schaffen, ermöglicht, daß das Unternehmen „autonome Kunst“ eine Strecke weit gelingt. Es ist das kein Faktum, das erst durch die moderne Kunst aufgekommen und sichtbar geworden wäre. Es war schon vom Urmanierismus die Rede. Daß die Moderne sich von Primitivismen und Exotismen angezogen fühlt, ist überall zu beobachten - man denke an die minimal music eines Steve Reich, die direkt von der Musik der Westafrikaner abstammt - von der Neigung, die Stimme zu entstellen, wie sie dem Jazz und den meisten außereuropäischen Musikkulturen gemeinsam ist. Dieser tief eingewurzelte, uralte Manierismus, das „Antiklassische“, läuft quer durch alle Epochen der Kunstgeschichte. Er zehrt vom Widerspruch und von der - 14 Zersetzung des Klassischen und ist vielleicht ein Reiz und ein Ferment, welches hilft, neuer klassischer Größe Raum zu schaffen - ein Gedanke, den man nicht verwerfen soll, der aber auch nicht widerlegt, daß große Kunst immer nur klassisch sein kann, und dies durch alle Epochen hindurch, denn auch Klassik besitzt viele Ausprägungen. Inzwischen bieten sich so viele Verbindungslinien zur Religion und zum Glaubensakt an, daß ich einige davon unsystematisch und mit der für einen theologischen Laien gebotenen Diskretion nennen möchte. Wer als Komponist sich dazu anhält, auf das Gegebene in Natur und Kultur zu hören, weiß, daß er dabei ganz ähnliche Erfahrungen macht, wie wenn er auf die „Stimme des Gewissens“ hört. Dieses „du sollst“ ist in jedermann vorhanden, und es spricht deutlich. Es ist nicht aus „Mitmenschlichkeit“ zu begründen und nicht auf sie beschränkt. Kant hat es an den Anfang seines Gottesbeweises gestellt. Aber diese Stimme des Gewissens ist auch leicht zu beschwichtigen, zu betäuben, skrupulös zu deformieren, von der Moral an die Sitte auszulagern - man kann ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn man Kartoffeln mit dem Messer schneidet - durch Erziehung und jede Art von Kulturdruck zu verändern und schließlich gänzlich zum Schweigen zu bringen. Das natürlich gegebene Material der Musik, Ton, Intervall, Tonraum, Zeitraum erscheint ohne menschliches Zutun geordnet. Diese Ordnung ist der Vernunft erkennbar. Sie ist zudem eine sprechende, auf den Menschen zielende Ordnung, indem sie psychische Inhalte vorgibt, die über den physikalischen Tatbestand hinausgehen; daß Schwingungsverhältnisse von Konsonanten einfach sind, erklärt noch nicht, warum sie als einheitlich, aus verschmelzenden Komponenten bestehend, auch erfahren werden. Es ist das ein Faktum, in sich evident. Das Erste Vatikanum hat zur gesicherten, Glaubensaussage erklärt: „Gott kann mit dem natürlichen Licht der Vernunft mit Sicherheit erkannt werden“. Wenn man hinzufügt „aus seinen Werken“ und wenn Gott durch Jesus Christus als dem „Wort“ dem Wort, „durch das, alles gemacht ist“, spricht, so reden auch seine Werke zu uns. Diese Erkenntnis aus natürlicher Vernunft gehört zum praeambulo fidei, zum Vorspiel des Glaubens, sie ist dem Kompositionsakt ebenso voraus gestellt wie dem Glaubensakt. Sie berührt sich mit dem kosmologischen Gottesbeweis Thomas von Aquins, der besagt, daß Ordnung und Zielstrebigkeit in der Welt nicht ohne überlegenen Ordner denkbar sind: „Die Fülle von objektivem Geist, der in der Welt steckt, kann ohne subjektiven Geist, der dem Ganzen vorausgeht, nicht erklärt werden“, was logisch auf den Satz vom zureichenden Grund hinausläuft. Diese Erkenntnis ist aber nicht in der Weise evident, daß es unausweichlich wäre, sie anzunehmen. Gottesbeweise erzeugen den Glauben nicht, sie sollen ihn bestätigen. So schränkt das Vatikanum ein: - 15 „Faktisch ist die Vernunft vielen Trübungen ausgesetzt, so daß echte Gewißheit nur durch Offenbarung zustande kommt.“ Das heißt, daß auch ein „immer mehr“ an Erkenntnis noch nicht ausreicht, um auf vorgebahntem Weg zum Glauben zu gelangen, sondern daß es des Willens bedarf, besser, eines „Entscheidungssprunges“, in dem Gnade und eigener Wille, psychologisch nicht mehr zu scheiden, zusammenwirken. Auch die Vorgaben von Natur und Kultur der Musik sind nicht derart deutlich und verpflichtend, als daß sie vor Irritationen und Verkehrtheiten bewahren könnten. Es sind Neigungen des Materials und hilfreiche Konventionen, die übersehen und geleugnet werden können. Um sich ihnen anzuvertrauen, ist, heute mehr als in früherer Zeit, ein Entscheidungssprung nötig, der Mut erfordert, weil er in einem Zeitklima getan werden muß, in dem die totale Selbstbestimmung von Kunst und Künstler allgemein akzeptierter Glaube ist. Es wäre noch von der Gnade zu reden, die neben der vernünftigen Einsicht und der Willensentscheidung zum praeambulo fidei gehört, von jenem Urvertrauen, das den Glaubensinhalten vorausgeht. Den Gnadenstand zu beanspruchen, wenn von kompositorischer Erfahrung die Rede ist, scheint mir allerdings aus dem Munde eines, der diesen Beruf „Komponist“ betreibt, degoutant. So viel will ich sagen: daß das Vertrauen, das man in die Natur der Musik setzt und das Zutrauen, das man zu den Maßstäben unserer Musikkultur faßt - es ist die des christlich geprägten Europas große Sicherheit gewährt. Sie sind wie Quell- und Brunnenwasser in einem Obstgarten, der uns seine Früchte anbietet und unsere Arbeit fruchtbar macht. Es mag jetzt nahe liegen, Glaube, Gnade und musikalische Inspiration in Beziehung zu setzen. Dazu ein paar nüchterne Worte zu einem ans Mystische grenzenden Phänomen. Ich behaupte, Inspiration und Einfall sind real, sie sind keine Erfindung von Romantikern sondern wirkliche Erfahrung. Woran erkennt man aber den Einfall? Zuerst an dem sicheren Gefühl, etwas gefunden, nicht erfunden zu haben. Sodann an der hochgestimmten Emotionslage, dem kreativen Enthusiasmus, der seinen Auftritt begleitet: Durchblick, Überblick, Zusammenschießen von Elementen, alles unabhängig von Umständen. Dann die Kürze der Erscheinung, sowohl des Zustandes, in dem sich der Komponist befindet, als auch des Produktes; es gibt keine durch längere Zeit anhaltende, noch eine längere Strecke des Weges beherrschende „Erleuchtung“. Hindemith vergleicht den Einfall mit einem Blitz, der eine nächtliche Landschaft erhellt. Danach muß sich das kompositorische Handwerk bewähren. Doch ist der Einfall auch nicht Frucht und Ergebnis von Arbeit. Arbeit kann den Boden lockern, in den er fällt, sie kann ihn aber nicht hervortreiben. Der Einfall ist aber nicht nur eine subjektive, deshalb bezweifelbare Erfahrung, die der Komponist macht. Er ist auch von anderen im Hörerlebnis zu bemerken und kann in der Analyse festgemacht werden, insofern er immer mit einem - 16 Konventionsbruch verbunden ist. Durch die Abhebung von der Konvention, vom musikalisch Erwartbaren, wird er auch dem Hörer auffällig. Im Einfall erneuern sich die Elemente: Ton, Pulsschlag, Intervall, Vibrato, Crescendo oder was immer, können dann „wie neu“ erlebt werden. Die Quinte gehört zur allerältesten Mitgift jeder Musikkultur. Trotzdem wird sie zu Beginn von Beethovens Neunter Symphonie wie die erste Begegnung mit einem elementaren Naturereignis erlebt. Fortschritt in der Musik bedeutet zuerst, daß Längstbekanntes in einem Zusammenhang auftritt, der ihm einen neuen, frischen, „unerhörten“ Aspekt eröffnet. Insofern ist der Einfall auch eine Wertkategorie. Doch ist nicht alle Musik, sieht man auf ihren Rang, auf den Einfall angewiesen. Die Musik Palestrinas findet ihren Wert nicht in der Sprengung oder Erweiterung einer Konvention, sondern in der Erfüllung einer Funktion, in der Bestätigung und vollkommenen Erfüllung des liturgischen Kanons. Der Eindruck liegt auf der Hand, daß der Einfall, wenn er wie ein Geschenk, unprovoziert und unvorhersehbar auftritt, an religiöse Erfahrungen erinnert, die in der Sprache des Glaubens Offenbarung heißt. Trotzdem schiene es mir verwegen und unstatthaft, Religion und Mystik zur Erklärung des musikalischen Einfalls heranzuziehen und die Sphäre des Numinosen zu bemühen, (so wie Pfitzner es in seiner Oper „Palestrina“ tut). Die moderne Psychologie wird hier vieles natürlich erklären können; z.B. sind die eigentümlichen Bekanntheitsgefühle, die man haben kann, der Eindruck, etwas bereits Vorhandenes, Präexistentes empfangen zu haben, psychologisch mit dem Déja-vu in Zusammenhang gebracht worden, dem nicht seltenen Phänomen, daß uns eine Gegend, in der wir noch nie gewesen sind, als bekannt erscheinen läßt. Es wäre, wie gesagt, vermessen, wollten die Künstler sich auf ein Gottesgnadentum berufen, und würde ich das behaupten, würden meine Kollegen - unter denen auch Leugner des Einfalls sind - mich mit Recht zum unzünftigen Träumer erklären. Künstlern macht zur Zeit jede Art von Weihrauch Kopfschmerzen, und ihnen fromme Motive für ihre Veranstaltungen zu unterstellen, würde ihrem Selbstverständnis zuwiderlaufen. Trotzdem darf man eine formale Parallele zwischen künstlerischer Inspiration und gnadenhafter Offenbarung versuchsweise in Betracht ziehen. Und vielleicht ist auch dies alles ein Gegenstand des Glaubens, und man kann auf sechserlei Art dazu Stellung nehmen: Ich weiß, daß es nicht so ist. Ich glaube, daß es nicht so ist. Ich bezweifle, daß es so ist. Ich meine, daß es so sein könnte. Ich glaube, daß es so ist. Ich weiß, daß es so ist. „Glaube und Komposition“ war mein Thema. Einsicht, Wille und Gnade begründen den Glauben. Einsicht in die Natur und Kultur der Musik sind vom Komponisten gefordert. Dazu der Wille, gegebene Ordnung anzunehmen, auch dann, wenn das Eingesehene nicht zwingende Konsequenz verlangt und Entscheidungen nicht abnimmt. Und die Gnade hier sollte man das Divinatorische, Einfall und Inspiration, auf sich beruhen lassen. Wohl aber ist das musikalische und kompositorische Talent eine Gnade, denn es ist ohne Verdienst gegeben, es ist nicht - 17 erwerbbar, nur im Rahmen seiner Kapazität ausbildbar. Für ein Talent soll man danken, doch darf man auch auf Grund eines Talentes „an sich selber glauben“, das ist rechtens und nicht gegen die christliche Demut. Ein streitbares Nachwort aus gegebenem Anlaß Glaube und Kirchenmusik: Ich habe mir gestattet, trotz der brennenden Aktualität kirchenmusikalischer Fragen und trotz des desolaten Zustandes, in dem sich die Kirchenmusik vielerorts befindet, ein Thema von großer Allgemeinheit, ja Abstraktheit zu erörtern. Um so notwendiger erscheint es mir, zur derzeitigen Lage Stellung zu nehmen. Wir leben in einer Zeit, in der viele Maßstäbe verloren gegangen sind, im sozialen Gefüge, in Glaubensdingen, in der Kunst und eben auch in der Kirchenmusik. Vom Kirchenmusiker wurde schon immer die Einsicht verlangt, daß weder ein ungebundener Ästhetizismus, die Verführung durch ein absolut gesetztes „Schönes“, noch die Anbiederung an Vulgärmusik, an heruntergekommene „Kultur“, an Schund und Kitsch, dem Glauben und der christlichen Verkündigung dienen (wenn es auch wahr ist, daß ein starker Glaube zusammen mit ästhetischer Robustheit und Unempfindlichkeit, Kitsch unbeschadet erträgt und in Besitz nehmen kann.) Die Gefahr des Ästhetizismus hat schon Romano Guardini in dem Traktat „Vom Geist der Liturgie“ mit großer Klarheit beschrieben. Diese Deformation religiöser Kunst wird man im Gottesdienst kaum noch antreffen. Dagegen ist der massive Einbruch eines kindisch-seichten oder bösartigen Musikidioms in die Liturgie nicht mehr zu überhören, und wer ihm entgehen und seelische Verrenkungen vermeiden will, wird sich Sonntags auf eine lange Suche durch städtische und ländliche Pfarreien begeben müssen. Die Gründe dafür sind offensichtlich; pastoraler Populismus, „Zeitgeist“ und Unbildung haben ein Klima geschaffen, in dem für fortschrittlich gilt, was von Übel ist. Ist man unter dem stetigen Druck einer aus allen akustischen Vervielfältigungsmaschinen strömenden Vulgärmusik so taub und stumpfsinnig geworden, daß man nicht mehr bemerkt, was diese Musik eigentlich verkündet? Denn sie „spricht“ ja auch wie jede Musik. Aber diese „message“ hat mit dem Glauben der Kirche nichts zu schaffen, ja, sie ist oft dediziert antichristlich. Soll man noch argumentieren, soll man begründen und beweisen, daß es Musik gibt, die das Attribut „bösartig“ verdient? Ich meine, gegen die epidemische Verbreitung eines degenerierten Musikidioms in der Kirche ist derzeit mit Argumenten und wahrscheinlich auch mit Verboten nichts auszurichten. Das Bündnis zwischen pastoralem Pragmatismus, man kann auch sagen „die Suche nach dem Weg des geringsten Widerstandes“, und den Experimenten der Liturgiereform, man kann auch sagen „die neue Bilderstürmerei“, ist sehr solide. Man glaubt ein Hinlängliches getan zu haben, wenn man dem engagierten Kirchenmusiker eine „kirchenmusikalische Stunde“ einräumt, wo er dann aufführen mag, was ihm durch das Kunstverdikt im Gottesdienst verwehrt wird. Auf wieviele klingende Zeugnisse des Glaubens, wahre Monumente des Glaubens, hat man verzichtet! Welche - 18 lebenden, ausgewiesenen Komponisten schreiben noch für die Kirche? Sie haben dieses Feld den klampfenden Patres und den Szenenmatadoren aus der Jesusbar überlassen müssen. Glaubt man wirklich, mit Combomusik und Tanzeinlagen die Verbreitung der Sekten in Südamerika aufzuhalten? (Womit das große Problem, wie liturgische Musik in der Dritten Welt beschaffen sein muß, nicht beiseite gestellt werden soll. Es sollten wenigstens nicht die industriell gefertigten Schablonen der Vergnügungsindustrie sein.) Die Kirche ist für die Menschen da, sie geht ihnen entgegen, aber sie steht auch vor Gott, dem Verherrlichung gebührt durch große Kunst und große Musik, mit allen Mitteln, die der menschliche Geist, wenn er zur Verherrlichung Gottes gerufen ist, aufzubieten vermag. Andernfalls ist die Kirche nur ein Dienstleistungsunternehmen zum Wohle der Gesellschaft, wie es auch andere gibt. Wer in der Liturgie das Ungekonnte, Läppische, Obszöne duldet oder fördert, in der Hoffnung, Seelen zu gewinnen, heiligt gewiß nicht diese Mittel, denn er verfehlt auch den Zweck. Die Kirche ist für Menschen gemacht, sie geht ihnen entgegen, auch dahin, wo sie in Dumpfheit und Schmutz befangen sind, aber doch nicht bis zum Hals und bis zur Selbstaufgabe. „Das gequälte Lächeln der Bischöfe und das versteinerte Gesicht des Bundespräsidenten“ - so beobachtet es ein Berichterstatter vom Schlußgottesdienst des Berliner Katholikentages - sind das einfach nur „die Alten“, die „Amtskirche“, das „konservative Establishment“? Machen wir uns nicht lächerlich. Die Kirche hat schon oft in ihrer Geschichte gegen die Zeit stehen müssen, in der sie verkündete. Sie sollte sich zu ihrer Musik bekennen, zum Choral, zum komponierten lateinischen Ordinarium, zu einer tausendjährigen Tradition und einem Schatz von Meisterwerken, zum Kunstwerk im emphatischen Sinne, denn es ist ein Abglanz der Herrlichkeit, und es kann mithelfen, daß in einer immer wüster und platter werdenden Welt Liebe, Glaube und Hoffnung überleben. - (Der Verfasser war bis 1992 Professor für Komposition an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover.)