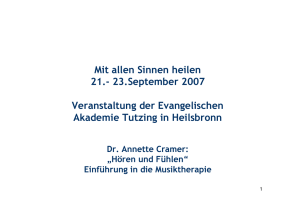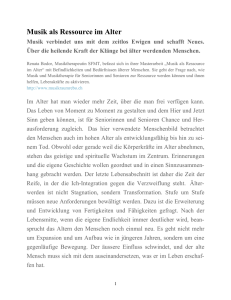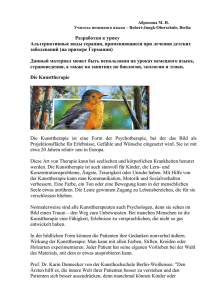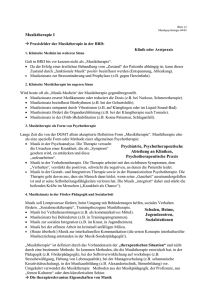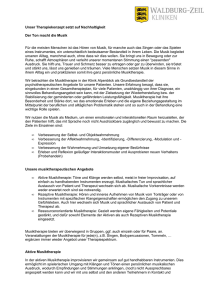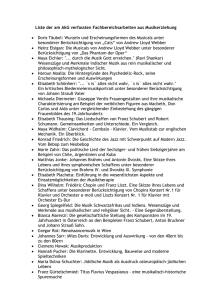Schnupperartikel - Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft
Werbung

Online Almut Seidel Standort oder Streitpunkt? Zur Rolle der Musik und zur musikalischen Tätigkeit des Therapeuten in den Fallstudien der Musiktherapie Immer wieder sehe ich mich vor die Aufgabe gestellt, einem fachfremden, aber interessierten und häufig auch der Musik nahestehenden oder sie selbst praktizierenden Menschen erklären zu müssen, was Musiktherapie ist und wie ein Musiktherapeut arbeitet und sein Handwerkszeug, die Musik, einsetzt. Ich versuche mir in solchen Zusammenhängen vorzustellen, welches Bild dieser Mensch insbesondere in Bezug auf das Musikalisch-Tätigwerden des Therapeuten entwickeln würde, wenn nicht ich die Chance hätte, ihm dies zu erläutern und gegebenenfalls auch vorzumachen, sondern er andere Kontexte zu seiner Information heranziehen müsste. Er würde vielleicht die „Kasseler Thesen“ im Internet aufsuchen; sie sind ein offizielles Statement, das als schulenübergreifender Konsens nicht nur berufspolitische Ziele verfolgte, sondern auch darauf abzielte, eine wenn auch knappe, so aber doch präzise und umfassende Information über Musiktherapie als Psychotherapie vorzulegen. Eine gute Quelle also für unseren Informationssuchenden! Hier heißt es zur Rolle der Musik und zu ihrer konzeptionellen Anwendung: „In der Musiktherapie ist Musik Gegenstand und damit Bezugspunkt für Patient und Therapeut in der materialen Welt. An ihm können sich Wahrnehmungs-, Erlebnis-, Symbolisierungs- und Beziehungsfähigkeit des Individuums entwickeln. Rezeption, Produktion und Reproduktion von Musik setzen intrapsychische und interpersonelle Prozesse in Gang und haben dabei sowohl diagnostische als auch therapeutische Funktion. Das musikalische Material eignet sich, Ressourcen zu aktivieren und individuell bedeutsame Erlebniszusammenhänge zu konkretisieren, was zum Ausgangspunkt für weitere Bearbeitung genommen wird“ (Kasseler Konferenz 1998, S. 232). Von „Musik“ ist die Rede, vorsichtig auch als „musikalisches Material“ bezeichnet; es dient als Entwicklungshilfe für „Wahrnehmung, Erleben, Symbolisieren und Beziehung“ und wird angewandt in „Rezeption, Produktion und Reproduktion“. Um welche Art von Musik aus dem überaus reichen Spektrum musikalischer Formen, Stile und Genres es sich handelt und wie sie rezeptiv, aktiv oder reproduktiv angewandt wird und vor allem durch wen, das bleibt in dieser notwendigerweise verknappten Form offen. Unser noch nicht mit Musiktherapie vertrauter, aber nun gerade an solchen Fragen interessierter Mensch muss diesbezüglich also andere Quellen aufsuchen. Bleiben wir einmal bei dem Strang „aktive Musiktherapie“, um die Komplexität ein wenig zu reduzieren. Unser suchender Noch-nicht-Kenner wird möglicherweise ein Lehrbuch, ein Lexikon, Monographien oder Fachzeitschriften befragen. Er erfährt, dass beim aktiven Musizieren mit dem Patienten / Klienten unterschieden wird zwischen strukturierter und freier Improvisation. Was die letztere anbelangt, so scheint sie ins Herz psychotherapeutischen Arbeitens zu treffen und sehr klar der obigen Beschreibung aus den Kasseler Thesen zu folgen, weil hier „Therapeut und Klient mit Hilfe improvisierter Musik das Innenleben des Klienten zu erforschen und dessen Wachstumsbereitschaft zu fördern versuchen“ (Priestley 1983, zit. Weymann 1996, S. 134). Diese besondere Form des Erforschens und Förderns mit Hilfe der Musik, also in ihr selbst und vermittelt über sie, wird möglich, wenn sich therapeutisches Basisverhalten in der improvisierten Musik mitteilt – so jedenfalls liest man es beispielsweise bei Hoffmann (1991), wenn es im Anschluss an eine Aufzählung von 17 Variablen des therapeutischen Basisverhaltens (wie Integrität des Therapeuten, differenzierte Wahrnehmung der eigenen Gefühle, Wahrnehmung von Übertragung und Gegenübertragung etc.) heißt: „Das bedeutet, dass Musiktherapeuten alle geforderten Psychotherapeutenfähigkeiten selbstverständlich und souverän in ihrer improvisierten Musik kommunizieren und dass sie die Musik des Patienten hören, wahrnehmen, speichern und ‚verstehen’ in der oben geforderten Weise“ (Hoffmann 1991, S. 236; Hervorhebung A.S.). © April 09 Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft e.V. (DMtG), Libauer Straße 17, 10245 Berlin Internetredaktion [email protected] Online Beide Zitate machen deutlich, dass die freie Improvisation in aller Regel das gemeinsame Werk von Therapeut und Patient / Klient ist, in welchem dem Therapeuten die besondere Aufgabe zufällt, das wie auch immer zutage tretende Anliegen des Patienten, seine Not, seine geheimen Wünsche, seine Visionen etc. musikalisch ausarbeiten zu helfen. „Das Spiel des Therapeuten ist in der therapeutischen Improvisation insofern auf das Patientenspiel ausgerichtet, als hier nicht eigene Ausdruckswünsche realisiert werden (Abstinenz). Er stellt gleichsam seine Spielfähigkeit in den Dienst des Patienten, indem er in einer Art ‚schwebender Aufmerksamkeit’ einerseits wie ein ‚Resonanzkörper’ die oft rudimentären Gestaltungsansätze des Patienten aufnimmt und entfaltet, sie aber auch weiterführt und bearbeitet“ (Weymann 1996, S. 136). Suchspiel musikalische Praxis Es ist von Improvisation die Rede, jener Musizierform, in der aus dem Augenblick heraus Musik gestaltet wird. Wir können den Zitaten entnehmen, dass es um eine enorm wichtige, wenn nicht die zentrale therapeutische Technik geht, in der alles Wissen um das Leid (man müsste technisch sagen: Krankheitsbild) des Patienten, alle Situationsdeterminanten und Therapiezielsetzungen und die besondere Beziehungsqualität therapeutischen Handelns eine Synthese mit der Musik bzw. in der Musik eingehen – welch enormer Anspruch an die musikalische Kompetenz des Therapeuten, und wie spannend muss es für einen Außenstehenden sein, dieses gemeinsame musikalische Tun von Patient und Therapeut verstehen zu lernen! Genau an diesem Punkt setzt nun aber die fachliche Verantwortung einer gesamten Berufsszene an, denn dieser Anspruch an das Wirken des Musiktherapeuten, was seine musikalische Fachlichkeit anbelangt, muss auch kommuniziert werden – und das kann ausreichend nur geschehen, wenn es über theoretische Erklärungen hinaus als Praxis dargestellt wird. Wie genau sich dieser Teil der musiktherapeutischen Fachlichkeit also in der Praxis darstellt, erfährt der interessierte Mensch wohl am besten, wenn er mitten hinein geht in ebendiese (musikalische!) Praxis des Musiktherapeuten – und wie ginge das besser, als wenn er sich mit musiktherapeutischen Fallstudien beschäftigt? Denn anders als bei theoretischen Abhandlungen sind Fallstudien und Fallvignetten eine besonders gute Informationsquelle, da das Wissen aus der unmittelbar nachvollziehbaren Praxis herausgezogen wird und in der Folge in verarbeiteter – reflektierter, interpretierter, abstrahierter – Form erscheint. Fallstudien möchten idealtypisch die Berufsrealität so, wie sie sich wirklich vollzogen hat, zunächst dokumentieren, um sie dann im reflexiven Nachvollzug fachlich zu interpretieren. Die Dokumentation der rein musikbezogenen Anteile, die unseren fiktiven Informationssuchenden interessieren, findet hier in unterschiedlicher Weise ihren Niederschlag, und es ist in gewisser Weise ein Suchspiel, wenn man wirklich strikt und einseitig nach den musikalischen Kompetenzen des Therapeuten forscht, was ich im Folgenden tun möchte1. Man kann Folgendes entdecken: Rein quantitativ kommen Hinweise zur gemeinsamen Musik von Patient und Therapeut in der Regel nur in vergleichsweise geringem Umfang vor (Ausnahmen bestätigen die Regel). Das gilt für die Dokumentation einer einzelnen Sitzung ebenso wie für die ganzer Therapieverläufe. Es werden den Rahmenbedingungen, der Beschreibung des Krankheitsbildes, der Vorstellung des Patienten (Anamnese, Krankenverlauf), der Methodik samt deren theoretischem Hintergrund sowie der Diskussion des Therapieverlaufs und der Ergebnisdarstellung etc. ungleich mehr Raum gegeben. Das hat seine fachliche Logik, die hier nicht zur Diskussion steht. Es kann dieser Sachverhalt aber nicht verhindern, dass sich das Bild des Verfahrens Musiktherapie, das seine zwei Wort-Bestandteile ja doch nicht zufällig hat, einseitig zugunsten des Psychotherapeuten im Musiktherapeuten verlagert. Wenn auch hier berufspolitische Gründe vorherrschend sein mögen, wird dennoch 1 Ich möchte so weit wie irgend möglich darauf verzichten, die zu benennenden Gegebenheiten durch Beispiele zu veranschaulichen und zu untermauern, denn es würde damit wohl leicht die Gefahr entstehen, dass nicht mehr modellhaft argumentiert werden könnte, sondern es so scheint, als würden Einzelfälle diskutiert. Auch könnte dies möglicherweise als Kritik an Kollegen verstanden werden, was es durchaus nicht sein will. © April 09 Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft e.V. (DMtG), Libauer Straße 17, 10245 Berlin Internetredaktion [email protected] Online schlicht verhindert, dass sich bezüglich der zentralen Tätigkeit des Musiktherapeuten, nämlich seiner musikbezogenen Interventionen, ein ausreichend informatives und klärendes Bild einstellen kann. Jenseits einer Frage von mehr oder weniger Quantität gibt es offensichtlich auch kein einheitliches Verständnis darüber, worin die letztlich erkenntnisleitenden und entwicklungsfördernden Potentiale liegen: in der Musik selbst, in den „kunstanalogen Mitteln“ (vgl. Weymann 1996, S. 136) oder im anschließenden Gespräch, im Anknüpfen an biografisch-anamnestische Daten, im Wahrnehmen der Gegenübertragungen, dem Reflektieren des Therapieverlaufs oder wo auch immer. Denn es gibt auf der einen Seite Fallstudien, die durchgängig von der Darstellung und Analyse des klanglich-musikalischen Materials ausgehen, dort die (musikbezogene) Entwicklung des Patienten bzw. die Impulse des musikalisch begleitenden, stützenden, konfrontierenden, seinen Gegenübertragungen Gestalt gebenden etc. oder wie auch immer spielenden Therapeuten aufsuchen und Ergebnisse im musikalischen Material selbst sichern. Daneben stehen aber andere Studien, in denen alles therapeutisch Entscheidende, die Wendungen, Erkenntnisse etc. verbal im Anschluss an eine Improvisation zu passieren scheinen; die Musik selbst scheint lediglich den Impuls gegeben zu haben, um dann der verbalen Aufarbeitung Raum zu geben, die sich nicht mehr unbedingt auf die Musik beziehen muss. Sie macht sich an diesem Punkt im Nachhinein überflüssig, so könnte man – zugegebenerweise sehr hart - schlussfolgern. Besonders deutlich stellt sich dieser Eindruck bei den sog. themenorientierten Improvisationen, Dialog- oder Rollenspielen ein, bei denen bereits im Thema ein Vorgriff auf das zu Erlebende und Interpretierende gegeben zu sein scheint. Musik – von wem? Wenn aber von aktiv gestalteter Musik die Rede ist, ist oft nicht klar, wer sie macht, wie dies in der These 5 der Kasseler Thesen besonders deutlich hervorsticht. Vielfach ist nur von der Musik des Patienten die Rede; was der Therapeut spielt, bleibt unbenannt, so als wäre er (musikalisch) nicht da. Dass „das Heilende“ in der Musik nicht allein dieser, also der Musik des Patienten, sondern regelhaft dem Zusammenwirken von fachlich abgesichertem musiktherapeutisch-musikalischem Handwerk des Therapeuten geschuldet ist (dafür ist er – neben all seiner therapeutischen Befähigung - ausgebildet!), bleibt bisweilen nicht ersichtlich. Häufig scheint auch etwas verwechselt zu werden, was die musikalische Rolle des Therapeuten als Träger und Garanten der therapeutischen Beziehung anbelangt. Denn da, wo die so oft zu hörende Forderung besteht, dass „das gemeinsame Spiel in der Dyade (Therapeut – Patient) ein partnerschaftliches Spiel ermöglichen“ (Meyer 2006, S. 44) soll, also Verhältnisse von musikalischer Ungleichheit, Überlegenheit, Macht etc. um der Beziehung willen vermieden werden sollen (das scheint häufig unter dem Stichwort „Abstinenz“ verstanden zu werden), kann das ja nicht heißen, dass das Spiel des Therapeuten sich musikalisch nicht von dem des Patienten unterscheiden kann, soll und auch muss. Den Instrumenten (genauer: ihrer Appellstruktur und Symbolik) gebührt eine hohe Aufmerksamkeit; es macht den Eindruck, als wäre allein die Wahl eines Instruments und der auf ihm produzierte Klang für sich genommen schon etwas Heilsames, auch ohne dass der Therapeut noch musikalisch interveniert oder beteiligt ist. Dass es dabei zu Pauschalisierungen und Schablonisierungen und am Ende zu einer Klischeebildung kommt, bleibt nicht aus. In der Regel werden unterschiedliche Erlebens- und damit Wirkweisen des Instruments nicht thematisiert. Wenn es sich dabei zudem noch um Elementarinstrumente wie Trommeln, Ocean Drums, Klangschalen etc. handelt, wird noch viel weniger deutlich, warum zu deren Bereitstellung ein (auch!) Musikstudium notwendig ist. Wie verkürzt damit Fachlichkeit erscheint, wird offensichtlich nicht mitreflektiert. Die Rede ist hier nicht – das sei noch einmal betont – von der außerhalb der Musik oder des Klingenden sich vollziehenden gesprächspsychotherapeutischen Aufarbeitung! Hie und da wäre es auch nicht verwunderlich, wenn sich ein Laie vorstellt, so oder so könne er doch auch spielen, singen, eine CD einlegen oder Instrumente bereitstellen, wenn etwa die Rede von wenigen Trommelschlägen, dem Trällern eines Kinderliedes, einem einzelnen Schlag auf einen © April 09 Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft e.V. (DMtG), Libauer Straße 17, 10245 Berlin Internetredaktion [email protected] Online Bordunstab etc. die Rede ist (die Beispiel sind gegriffen). Allzu leicht gerät hier aus dem Blickfeld, dass solchen Tätigkeiten musikbezogen eine lange und differenzierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Musikerleben, eine instrumenten- und spielbezogene Selbsterfahrung und eine Beschäftigung mit der entsprechenden wissenschaftlicher Literatur vorausgeht. Denkbar ist auch, dass derlei Gedanken sich deshalb einstellen, weil häufig gar nicht die Rede von „Musik“ ist, sondern von „Klang“, so als könne man musikologisch beides einfach gleichsetzen. Mit Klängen kommunizieren, wie es häufig heißt, ist sprachlich und terminologisch etwas anderes als Musik machen – und man fragt sich: wie geht ein Laie mit dieser Differenz um? Was diejenigen Studien anbelangt, in denen die von Patient und Therapeut gemeinsam gestaltete Musik dokumentiert wird, so hat man bisweilen das Glück, dass sie in Verbindung mit Transkriptionen des musikalischen „Textes“ gebracht werden, also mit einer Reproduktion des musikalischen Geschehens in Notenform verbunden sind. Man findet Transkriptionen leider nicht sehr häufig, denn sie sind außerordentlich schwer herzustellen, da improvisierte Musik leicht die Grenzen der tradierten Notationsregeln überschreitet. So schwer sie aber auch sind, so ist man aber doch desto dankbarer, wenn es sie gibt. Denn sie haben – nimmt man die musikprofessionelle Seite ernst – eine eindeutige Wichtigkeit. Nur so nämlich kann der Leser (als Musiktherapie-Experte), der des Notenlesens im Sinne eines inneren Hörens fähig ist, die zugehörigen verbal beschriebenen Abläufe besser verstehen und für sich selbst reproduktiv-nachschaffend verklanglichen. Aber mehr noch: nur so ist die musikalisch-methodische Kompetenz des Musiktherapeuten als Kernstück seiner therapeutischen Praxis wirklich verifizierbar. Papier ist geduldig, sagt man – Worte, Musik beschreibende Worte ebenfalls, möchte man ergänzen, und man denkt dabei sofort an all die Schwierigkeiten, Musik in Sprache zu übersetzen, über die so viel schon nachgedacht worden ist. Ersatzweise gibt es in den Fallstudien oder Fallvignetten Musikbeschreibungen, die auch ohne Übertragung in einen Notentext den (innerlich) hörenden Nachvollzug der Musiken ermöglichen, weil sie sich einer musikologischen Terminologie bedienen. Sie stehen aber neben den quantitativ weitaus häufigeren, die den musikalischen Vorgang direkt mit dem eigenen (jetzt eben nur psychischen) Erleben des Therapeuten bzw. seinen Gegenübertragungen, Kognitionen oder seinem theoretischen Denken in Verbindung bringen, ohne das musikalische Material als solches ausreichend oder überhaupt zu benennen. Damit enthält das Letztere in der Versprachlichung aber bereits ein Umbenennen der musikalischen Phänomene in eine psychologische Terminologie oder Modellvorstellung und kennzeichnet damit den ersten Schritt zu einer Interpretation und Ergebnissicherung – in meinen Augen viel zu früh und damit tendenziell nicht mehr nachvollziehbar.2 Oft gerät eine solche Erlebnisdimension aber auch zu einer mystischen Verschwommenheit. Man glaubt wieder und gern an die Himmelsmacht Musik ... Ein Identitätskonflikt der Musiktherapie? In meinen Augen zeigt sich in den genannten Phänomenen ein oder besser der Grundkonflikt, unter dem die musiktherapeutische Fachlichkeit aus musikbezogener Sicht steht und der für erhebliche Irritationen sorgen kann, wenn er nicht hinreichend geklärt wird. Denn ich frage mich und wünschte mir im Fachdiskurs zugleich eine differenzierte Klärung dieser Fragen: wie viel Darstellung darf, soll oder muss die Musik, genauer gesagt: die gemeinsame Musik von Therapeut und Patient qualitativ wie quantitativ als Fachlichkeit einnehmen, welche Eigendynamik darf, soll oder muss sie entfalten und wie weit darf sie sich dabei von einer noch möglichen Einordnung in das Terrain der 2 „immer lauter und schneller trommeln mit Ende = kathartische Triebabfuhr“, „Extremes Trommelschlagen ohne Ende = aggressiver Triebdurchbruch in einer malignen Regression“, „Melodie Hänschen klein ging allein = Angst vor oder Wunsch nach Autonomie bei enger Mutterbindung“, „Während Gruppenimprovisation als einzige nicht spielen = a) Coping durch Ich-Demarkation zum Schutz vor Selbstauflösung b) Probehandlung für Autonomie im Familiengefüge ...“ (Oberegelsbacher in: Decker-Voigt, Oberegelsbacher, Timmermann 2008, S. 293, Kursivschreibung im Original). © April 09 Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft e.V. (DMtG), Libauer Straße 17, 10245 Berlin Internetredaktion [email protected] Online Psychologie und Psychotherapie (fachsprachlich, qua Interpretationsmodell etc.) entfernen, um (nur noch) im musikalischen Werk und als musikalisches Werk verstanden werden zu können? Und als weitergehende Frage: wie zwingend notwendig zum Verständnis des genuin musiktherapeutischen Procederes ist die Darstellung der musikalischen Interventionen des Therapeuten in der gemeinsamen Musik? Es ist dies also mehr und etwas Anderes als nur eine Frage von Versprachlichung und Darstellung überhaupt und rührt in meinen Augen zutiefst an das Selbstverständnis, aber auch die Chancen der Profession. Denn für einen Außenstehenden und Fachfremden – so die Schlussfolgerung – wird nicht deutlich, welche Rolle die Musik denn nun in Feinheit spielt und wie in spezifischer und je Situation einmaliger Weise der Therapeut in seinem musikalischen Tun dazu beiträgt. Es bleibt ein gewisses Geheimnis, sich vorzustellen, welche musikalische Kompetenz letztendlich wofür gebraucht wird. Nicht verwunderlich wäre also, wenn sich primär Vorstellungen über die psychotherapeutische Qualifikation, aber sehr viel weniger über die (musikalisch-) musiktherapeutische einstellen. Ich frage mich dann allerdings mit einiger Besorgnis, ob es denn im Interesse der Profession sein kann, das Herzstück ihrer Wirkmächtigkeit so sorgfältig zuzudecken – oder noch deutlicher gefragt: muss man gar vermuten, dass es da gar nicht so viel zu zeigen gibt? Ich frage mich dies umso mehr, als Musiktherapie unstreitbar zu den Musikberufen zählt, innerhalb derer sie eine herausragend wichtige Rolle hat, und ich frage mich dies auch angesichts der Tatsache, dass Musiktherapeuten als Musiker diesen entscheidenden Teil ihrer Persönlichkeit und Fachlichkeit meiner Meinung nach viel zu wenig in die (öffentliche) Waagschale werfen, wie es die Fallstudien zeigen, aber durchaus nicht nur diese (vgl. dazu auch Seidel 2009). Zwar gibt es, was die Rolle der Musik anbelangt, unverkennbar und unübersehbar theoretisch einen großen Fundus an Erkenntnissen, angefangen von anthropologischen und musikhistorischen Bezügen über eine spezielle musiktherapiebezogene Instrumentenkunde, die Ausarbeitung einer musiktherapeutischen Kunst der Improvisation bis hin zu musikpsychologischen und neurowissenschaftlichen Fachaspekten. Eine gewisse Schwierigkeit besteht aber bereits hier, wenn immer wieder sehr pauschal von „der“ Musik – ohne weitere Differenzierung – die Rede ist, was zwar angesichts der methodischen Vielfalt im Einbezug von Musik wohl unvermeidbar ist, dennoch eine nicht unerhebliche Grundspannung erzeugt. In Bezug auf die praktische Seite allerdings, also die Darstellung dessen, was sich musikalisch-technisch in einer Therapie-Situation ereignet, wird die Informationsbasis schnell schmal und brüchig und in der Tendenz diffus und widersprüchlich. Was als Grundkonflikt benannt und zunächst noch rein äußerlich und technisch als eine Frage von qualitativ-inhaltlichem und quantitativ-anteiligem Versprachlichen von musikalischen Sachverhalten in den Fallstudien gesehen wurde, ist – so möchte ich meinen Standpunkt jetzt zuspitzen – in meinen Augen ein fundamentaler Identitätskonflikt, der mit den vielen Jahren berufspolitischer Entwicklung der Musiktherapie an Beachtung verloren hat und den Verlust eines Diskurses darstellt, der die Entwicklung der Profession in ihren Anfängen entscheidend beflügelt und vorangetrieben hatte. Zu einem Zeitpunkt, wo mit der Gründung der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft (DMtG) zumindest vorläufig und kompromisshaft der berufspolitische Alltag eine gewisse Beruhigung erfahren hat, könnten neue Kräfte freiwerden und genutzt werden, um sich einer alten Frage anzunehmen. Ich möchte mit meiner Sicht auf die Problemlage einen Impuls zu einem hoffentlich recht lebhaften und kritischen Streitgespräch setzen und bin so gesehen gern „Stein des Anstoßes“! Literatur Decker-Voigt, H.-H., Knill, P., Weymann, E. (Hg.) (1996): Lexikon Musiktherapie. Göttingen: Hogrefe. Decker-Voigt, H.-H., Oberegelsbacher, D., Timmermann, T. (2008): Lehrbuch Musiktherapie. München: Ernst Reinhard Verlag. Hoffmann, E. (1991): „Wer ist der Beste?“ Das Zulassungsverfahren im Ergänzungsstudiengang Musiktherapie an der Hochschule für Musik Berlin. In: Musiktherapeutische Umschau Band 12, 234242. Kasseler Konferenz – Musiktherapeutische Vereinigungen in Deutschland (1998): © April 09 Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft e.V. (DMtG), Libauer Straße 17, 10245 Berlin Internetredaktion [email protected] Online Musiktherapeutische Umschau 19, 232 – 235. Meyer, Judith (2006): Musikalische Kompetenz des Musiktherapeuten. Diplomarbeit, Fachhochschule Heidelberg 2006. Seidel, A. (2009): Musik – Biografie – Therapie. Musiktherapiestudierende auf dem Weg ihrer Professionalisierung. Wiesbaden: Reichert Verlag. Weymann, E. (1996): Improvisation. In: Decker-Voigt: H.-H., Knill, P., Weymann, E.(1996): Lexikon Musiktherapie. S. 133-136. Göttingen: Hogrefe. Autorin: Prof. Dr. Almut Seidel, Cheshamerstr. 51d, 61381 Friedrichsdorf, Email: [email protected] Redaktion der „Musiktherapeutischen Umschau“: Standpunkte sollen: Anregen zur Diskussion. Eine inhaltliche Auseinandersetzung ermöglichen. - Streitpunkte argumentativ aufbereiten. - Eine historische Sicht wieder ermöglichen. - Meinung wieder geben. Lassen Sie sich vom Standpunkt Almut Seidels einladen mit ihr der Frage nachzugehen - wo und wie musikalische Beiträge des Therapeuten beschrieben und vermittelt werden; - warum eine Zurückhaltung zu verzeichnen ist bei der Darstellung von Therapeutenmusik. Die provokante Frage lautet: Lassen sich hier möglicherweise Hinweise finden auf Identitätsprobleme? Diskutieren Sie mit. Tragen Sie mit Kommentaren und Argumenten zur Antwort auf diese Frage bei. Schreiben Sie uns: [email protected] © April 09 Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft e.V. (DMtG), Libauer Straße 17, 10245 Berlin Internetredaktion [email protected]