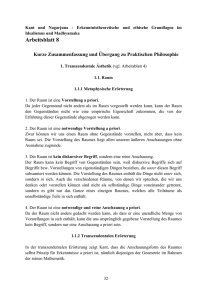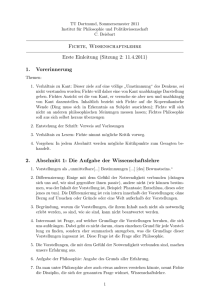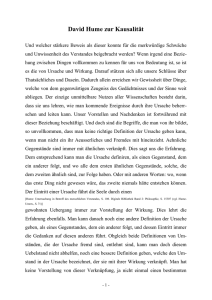Der Ausgangspunkt der Metaphysik IV. Kantscher und
Werbung

MUSEUM LESSIANUM – PHILOSOPHISCHE SECTION Joseph Maréchal S. J. Doktor der Wissenschaften Philosophieprofessor am Philosophischen und Theologischen Kolleg der Gesellschaft Jesu in Louvain. DER START-PUNKT der METAPHYSIK Übersetzung und Internetbearbeitung von Otto Schärpf S.J. 2017 s HEFT IV Das idealistische System bei Kant und nach Kant 1. Auflage 1947 1 De licentia Superiorum Ordinis IMPRIMATUR : Mechliniae, die 11 Martii 1946 † L. Suenens, Vic. gen. i Weitere Texte von Josef Maréchal SJ 1. Cahier I, premier edition 2. Cahier I, deuxieme edition 3. Heft I, 2.Auflage, französisch und deutsch 4. Cahier II 5. Heft II, deutsch 6. Cahier III 7. Heft III 2,Auflage, deutsch 8. Cahier IV 9. Cahier V 10. Heft V, 2.Aufl.1948, Thomismus usw. Deutsch 11. Etudes 12. Studien zur Psychologie der Mystiker, Band 2. deutsch ii Inhaltsverzeichnis Einleitendes Vorwort der Herausgeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 I. Teil I: Idealistisches System bei Kant 5 Buch I: Kritik und System Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 1: Die „Kritik der reinen Vernunft“: Erinnerung an die wesentlichen Züge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §1.– Das Ausgangsdatum der Kritik . . . . . . . . . . . . . . . §2.– Die kantsche Formulierung des Problems der Kritik. . . . . §3.– Die Apriorität, Bedingung der Objektivität. . . . . . . . . §4.– Die Untersuchung der Apriorität: die transzendentale Methode der Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §5.– Die Stufen des Apriori in einem diskursiven Verstand . . . §5a) Deduktion der Formen a priori der Sinneswahrnehmung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §5b) Deduktion der Kategorien . . . . . . . . . . . . . . §6.– Die Ideen der Vernunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §6a) Prinzip der Ableitung der Ideen . . . . . . . . . . . §6b) Die Unterscheidung der transzendentalen Ideen . . §6c) Geltung der transzendentalen Ideen . . . . . . . . . §7.– Zusammenfassung der oben in Erinnerung gerufenen, kritischen Folgerungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. . . . . . . . . . . . §1.– Das leibnitzsche Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §2. – Das systematische Ideal bei Kant . . . . . . . . . . . . . . 1. Echos auf Leibniz in den Werken von Kant . . . . . . 2. Die kantsche Idee des „Systems“ . . . . . . . . . . . . Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §1.–„Man tut recht daran, vom Feind zu lernen“: die ersten Widersacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 10 10 10 11 12 14 14 15 20 21 22 23 23 24 24 36 36 47 51 52 iii Inhaltsverzeichnis §2.– Schwankungen in der Lehre? . . . . . . . . . . . . . . . . . 1˚ Analyse und Synthese . . . . . . . . . . . . . . . . . 2˚ Die zwei Einleitungen der Kritik . . . . . . . . . . . . 3˚ Die doppelte Deduktion der Kategorien . . . . . . . . 4˚ Die zwei „Ich“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5˚ Die Bipolarität des „Objekts“ . . . . . . . . . . . . . §3. – Fortschritte des dynamischen Prinzips . . . . . . . . . . . 1˚ Formartige Subsumtion und synthetischer Akt . . . . 2˚ „Transzendentale“ Bedeutung der Bewegung . . . . . 3˚Auf eine idealistische Metamorphose der leibnizschen „reinen Idee“ zu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4˚ Rückblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §4.– „Die praktische“ Anwendung der Vernunft . . . . . . . . . 1˚ Heuristische Rolle der „Ideen“ . . . . . . . . . . . . . 2˚ Die moralischen Postulate, das Reich der Ziele und die Transzendenz des Objekts. . . . . . . . . . 3˚ Die Freiheit und die Transzendenz des Subjekts. . . . Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. . . . . §1.–Kant zieht Bilanz (gegen 1793) . . . . . . . . . . . . . . . . §2.– Kant und Beck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §3.– Meine hyperkritischen Freunde . . . . . . . . . . . . . . . 10 Reinhold und seine „Theorie des Vorstellungsvermögens“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 Maimon gegen das „Ding an sich“. . . . . . . . . . . . 30 Der „Standpunkt“ des Sigismund Beck. . . . . . . . . 40 Die radikale Opposition des Enesidem-Schulze. . . . . 50 Kant und Fichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 58 60 64 70 78 88 88 96 98 103 108 108 113 127 132 132 143 157 157 163 165 171 172 Buch II: Das „Opus postumum“ 183 Kapitel 1: Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Kapitel II: Was „der Übergang“ ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 §1.– Seine allgemeine Formulierung . . . . . . . . . . . . . . . . 187 §2.–Der Terminus a quo: die „Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 §3.–Der Terminus ad quem; die Physik . . . . . . . . . . . . . . 190 Kapitel III: Prinzip und wesentliche Linien des „Übergangs“ . . . . . 191 K.4: „Übergang“ und Präzisierung einiger Begriffe der Kritik . . . . . 197 §1.– Das Phänomen (die „Erscheinung“) . . . . . . . . . . . . . 197 §2.– Erfahrung und Wahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . 200 §3.–“Affizieren“ und „Selbstaffizieren“ . . . . . . . . . . . . . . . 204 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ . . . . . . . . . . . 211 §1.– Verallgemeinerung des Problems des Übergangs . . . . . . 212 iv Inhaltsverzeichnis §2.– Die Dreiheit „Gott, Ich, Welt“ . . . . . . . . . . . . . . . . §3.– „Setzung und Selbstsetzung“ . . . . . . . . . . . . . . . . . §4.– Die Person (das moralische Subjekt) . . . . . . . . . . . . §5.– Die Realität des Dings an sich. . . . . . . . . . . . . . . . §6.– Existenz Gottes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II . . . . . . . . . . . §1. – Das System des „Opus postumum“: Seine Kohärenz und Tragweite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1˚ Seine logische Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . 2˚ Metaphysische Tragweite des „Opus postumum“ . . . §2.– Der kantsche Begriff von „transzendentaler Philosophie“ . . §3.– Wissen und Weisheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 218 222 225 234 241 241 241 246 251 257 II. Teil II: Transzendentaler Idealismus in der Zeit nach Kant 261 Kap. 1; Wichtigste Interpretationstypen des Kantismus 265 0 1 Phänomenalistische Interpretation (formaler, dualistischer Idealismus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 0 2 Psychologische Interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 30 Logischer Transzendentalismus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 40 Absoluter Idealismus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 271 I.–Der Skandal des „Dings an sich“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. . . . . . . . . . . . . 273 §1.–Die systematische Forderung und die idealistische Voraussetzung bei Fichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 §2.–Auf der Suche nach dem absoluten Prinzip . . . . . . . . . 276 §2.a) Die großen Linien der Methode . . . . . . . . . . . 276 §2.b) Anknüpfungspunkte im Kantismus . . . . . . . . . 286 §3.–Die Wissenschaftslehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 §3.a) Die drei fundamentalen Prinzipien . . . . . . . . . 293 §3.b) Die Bedingungen der Aktualität des theoretischen Ich: Deduktion der Funktionen des Bewusstseins oder der Kategorien . . . . . . . . . . . . 298 §3.c) Die Evolution des theoretischen Ich oder die Deduktion des bewussten Objekts . . . . . . . . . 308 §3.d) Die rationale Funktion des praktischen Ich . . . . 319 §3.e) Gesamtschau der Wissenschaftslehre . . . . . . . . 326 v Inhaltsverzeichnis III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte . . . . . . . §1.–Der Begriff des absoluten Ich . . . . . . . . . . . . . . . . §2.–Monismus oder Dualismus? . . . . . . . . . . . . . . . . . §2.a) Psychologischer Monismus oder Dualismus? . . . §2.b) Dualismus oder absoluter Monismus? . . . . . . 2b.1˚ Das „Phänomen des Absoluten“ . . . . . . . . . 2b.2˚ Das religiöse Objekt und das moralische Objekt. 2b.3˚ Auf die absolute Einheit zu. . . . . . . . . . . . 2b.4˚ Theismus oder Pantheismus? . . . . . . . . . . . Zusammenfassung und Schlussfolgerung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 328 331 331 334 335 339 342 347 353 Kapitel 3. Die großen idealistischen Systeme 357 §1.–Der Idealismus von Fichte, Schelling und Hegel. . . . . . . . . . 357 §2.–Der Finalismus im nach-kantschen Idealismus . . . . . . . . . . . 366 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries 369 §1.–Fundamentaler Gesichtspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 §2.–Kritik der modernen epistemologischen Systeme durch Fries und seine Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 §3.–Hauptsächliche Diskrepanz zwischen der thomistischen Epistemologie und dem Kritizismus von Fries. . . . . . . . . . . . . . 383 vi Einleitendes Bemerkung des Übersetzers: Die Nummern am Rand sind die ursprünglichen Seitenzahlen im französischen Text. Die Seiten-Verweise im Text beziehen sich auf diese. Zu den bei der Übersetzung befolgten Grundsätzen siehe Heft V Randnummer 608 der deutschen Übersetzung. Vorwort der Herausgeber 7 8 In der Schlussfolgerung des Hefts II seines Werks schrieb P. Maréchal: „Es wäre verfrüht, schon jetzt die positiven Lösungen zu skizzieren, die unser Heft V darlegen wird. Wir halten es für nützlich, zuvor die unmittelbare Umgebung davon zu klären – zuerst durch eine direkte Kritik des Prinzips selbst des kantschen Idealismus – und dann durch die Untersuchung der großen, auf diesem Prinzip errichteten und für unseren Gesichtspunkt umso interessanteren transzedentalistischen Systeme, da sie in den Rahmen der kritischen Philosophie einen Ausweg zur umfassendsten Metaphysik fanden : wir werden uns im Heft IV damit befassen, diese historisch evidente und wohlbekannte, aber logisch ein wenig verwirrende Herkunft ins Licht zu setzen“. Diese Zeilen legten seit dem Jahr 1923 das allgemeine Ziel des Heft IV fest und kündigten die Veröffentlichung in einer sehr nahen Zukunft an. Leider hat Heft III, die Kritik Kants, gewissen Missverständnissen Anlass gegeben. Um sie zu zerstreuen, veröffentlichte der Autor, ohne länger zu warten, das Heft V, Der Thomismus vor der kritischen Philosophie. Das ist der erste Anlass, der die Herausgabe des Heft IV verzögerte. In den folgenden Jahren absorbierten andere Aufgaben wohl oder übel seine literarische Aktivität. Dennoch verfolgte P. Marechal die Redaktion des gegenwärtigen Hefts nicht weniger und es ist wahrscheinlich, dass dieses etwas früher ans Licht gekommen wäre, wenn nicht der Brand des Hauses in Eegenhoven im Mai 1940 einen Teil der zu seiner Komposition notwendigen Notizen zerstört hätte. Während des Krieges nahm der Autor seine Arbeit mit Einsatzbereitschaft wieder auf und er erreichte es, seinen ersten Teil abzuschließen, als der Tod ihn ganz plötzlich am 11, Dezember 1944 dahinraffte. Seit dem Jahr 1922, in der Ankündigung in der ersten Auflage des Hefts I, nach dem Inhaltsverzeichnis, der „Inhaltsangabe der folgenden Hefte“ gab P. Marechal in einer Vorankündigung für das Heft IV eine Einteilung in fünf 1 Einleitendes 9 Bücher mit folgenden Titeln: 1. Vorläufige Diskussion der Kritik Kants. 2. Der transzendentale Idealismus von Fichte : Ursprung, Methode, Geist. 3. Die „Wissenschaftslehre“ 4. Kritische Bemerkungen über den Idealismus von Fichte. 5. Der Idealismus von Schelling und von Hegel. Die Redaktion folgte, so scheint es, einem anderen Plan, denn das Inhaltsverzeichnis des Manuskripts von 1944 unterscheidet nicht mehr als zwei „Teile“: Das idealistische System bei Kant; Der transzendentale Idealismus nach Kant. Nur der erste wurde zu einem guten Ende gebracht. Hat Pater Marechal auf die „direkte Kritik des Prinzips des kantschen Idealismus“ verzichtet, die er früher angekündigt hatte? Seine Notizen verraten nicht seine Absichten über diesen Punkt. Was es auch immer damit auf sich hat, diese Kritik ist nicht aufgeführt in diesem „ersten Teil“. Wie es das Inhaltsverzeichnis davon anzeigt, hat sich der Autor einfach darum bemüht, die Entwicklung des Denkens von Kant darzustellen während der Periode, die der Publikation der Kritiken folgte. Einen wichtigen Platz nimmt dort das Opus posthumum ein. Eine besonders scharfe Genauigkeit der Analysen gibt dieser Studie einen von dem der anderen, mehr allgemeinen Hefte sehr verschiedenen Charakter. Aber gerade dadurch wird sie, unter einem besonderen Titel die Historiker der Philosophie interessieren. Wir haben gesagt, dass dieser erste Teil eine komplette Vollendung erhalten hat. Dennoch müssen wir uns Rechenschaft geben von einem Hinweis, den der Autor hinterlassen hat. Am 3. Dezember 1944, als er zweifellos sein Ende sehr nahe fühlte, schrieb P. Marechal die folgenden Zeilen in seiner klaren Schrift, die vollkommen fest geblieben war: „Dieses Manuskript ist noch nur eine erste vorläufige Redaktion, dessen ganze literarische Toilette noch zu machen bleibt: Satzkorrektur, Flüchtigkeiten im Stil, Hervorhebung der hauptsächlichen Zeilen, Unterdrückung von Wiederholungen, vielleicht auch bemerkenswertere Überarbeitungen und hie und da Vollendung der Idee. Die Erschöpfung und Ermüdung im Kopf zwingt mich, mich mit diesem Zwischenzustand des Manuskripts abzufinden“. Gibt uns dieser Hinweis das geringste Recht auf irgendwelche Verbesserungen, selbst in der einfachsten Form? Wir haben das nicht geglaubt. Die Leser haben also den ganz authentischen Text vor Augen, skrupulös erhalten, aber sie mögen sich wohl erinnern an die Mahnung des Autors in der Beurteilung, die sie über den gegenwärtigen Zustand seines Werks äußern. Dieser erste Teil bildet ein Ganzes für sich selbst. Was den zweiten betrifft, der transzendentale Idealismus nach Kant, so ist in dem Manuskript nur der Titel angezeigt und wir wissen woanders her, dass der Autor die Ausführung nicht einmal angefangen hat. Müssen wir von daher seinen Lesern jede Hoffnung verweigern, jemals sein Denken über diese großen Systeme nach Kant kennenzulernen? Es besteht ein gewisses Interesse, es aufzuzeigen. Sein Werk „Der Ausgangspunkt der Metaphysik“ hat in seiner Gesamtheit einen ersten Zustand der Redaktion durchlaufen, wo das Thema 2 Vorwort der Herausgeber 10 11 noch nicht verteilt war auf sechs Hefte sondern auf drei Bücher. Diese alte Redaktion (sie geht zurück auf die Jahre 1917 und 1918) existiert noch als Manuskript. Nun aber ist sie wenigstens nicht unvollendet geblieben und wir finden dort mehrere Kapitel, die genau die Nachkantianer behandeln. Darüber hinaus hat P. Marechal, indem er 1930 und 1931 Vorlesungen über die Geschichte der modernen Philosophie hielt für seine Studenten vom philosophischen Kolleg von Eegenhoven, für diese sehr sorgfältig, wie immer, einige Seiten verfasst über verschiedene Interpretationen des Kantismus. Es stellte sich also für uns die Frage: Sollen wir diese schon weit zurückliegenden Texte veröffentlichen, die der Autor durch den aktuellen Stand der Forschungen für überholt hielt? Wir haben lange Zeit gezögert, geteilt zwischen der Partei des Schweigens und dem Wunsch nach Veröffentlichung, der von einigen guten Schiedsrichtern und Freunden ausgedrückt wurde. Schließlich haben diese letzteren gewonnen und so kam es, dass wir den Lesern drei Studien bieten, die aus den alten Manuskripten extrahiert sind: Die erste, die die neueste ist (1930, 1931) gibt die „verschiedenen Interpretationen des Kantismus“ wieder. Wir präsentieren sie als ganz natürliche Einleitung zu den drei anderen, genommen aus der ersten Redaktion des „Ausgangspunkts“ (1917, 1918) und die jeweils erklären „den transzendentalen Idealismus von Fichte“, die „großen idealistischen Systeme“ und den „Kritizismus der Schule von Fries“. Streng genommen könnte diese letzte Studie nicht unter dem allgemeinen Titel des zweiten Teiles aufgeführt werden: Der transzendentale Idealismus nach Kant. Dennoch sind wir genügend autorisiert, ihn dahin zu platzieren, aus Gründen der direkten Verknüpfung des Kritizismus von Fries mit dem kantschen Idealismus. Und das besondere aktuelle Interesse, es zu publizieren, ist das folgende: Die jüngste Phänomenologie von Husserl ordnet sich, wegen seines Begriffs der „kategorialen Intuition“, bewusst ein in die Nachbarschaft der „unmittelbaren rationalen Erkenntnis“ von Fries: so dass, wie P. Marechal bemerkt, die Ideen von Fries also nicht so sehr antiquiert sind: durch seine Vermittlung ist es ein wenig Husserl selbst, den der Autor der Hefte erklärt und beurteilt. So haben wir versucht, dieses Heft IV zu vervollständigen, eine fehlerbehaftete Fertigstellung, zweifellos, sehr zurückbleibend hinter dem Grad von Perfektion, den P. Marechal erreicht hätte. So wie es ist, hoffen wir trotzdem, wird es seinem Andenken nicht schaden. 3 Teil I. Das idealistische System bei Kant 5 12 7 Buch I: Kritik und System Einleitung 13 „Die reine Vernunft – so lesen wir auf den ersten Seiten der Kritik – umfasst die Prinzipien, die erlauben, etwas ganz a priori zu erkennen1 “ „Ein organon der reinen Vernunft wäre die (geordnete) Gesamtheit all dieser Prinzipien2 “. „“Die ausgeführte Anwendung des organon würde ein System der reinen Vernunft 3 liefern 1 KRV, Ausg. B, Einleitung VII, S.24. – Die Abkürzung KRV, B oder KRV Ausg. B bezeichnet die Kritik der reinen Vernunft, 2.Auflage 1787, in Kants gesammelten Schriften der Akademie von Berlin, Band III, 1911; KRV, A = 1.Auflage, 1781, ebenda Band IV, 1911; KPV – Kritik der praktischen Vernunft, ebenda Band V, 1913; Kr.U.= Kritik der Urteilskraft, ebenda. Wir zitieren die Seitenangabe des Originaltextes der drei Kritiken, die in dieser Auflage der Akademie von Berlin reproduziert ist 2 Ebenda 5 Ebenda S.25 Kant behält sich vor, „später das komplette System einer Philosophie der reinen Vernunft darzustellen4 “; 4 Ebenda S.26 er begnügt sich vorübergehend mit einer Propädeutik: „Wir können als Propädeutik des Systems der reinen Vernunft eine Wissenschaft betrachten, die sich beschränkt, ein Urteil über die Vernunft selbst, über ihre Quellen und ihre Grenzen zu äußern. Diese Wissenschaft müsste nicht den Namen Lehre haben, sondern Kritik der reimen Vernunft. Ihr Nutzen unter dem Gesichtspunkt der Spekulation wäre wirklich nur negativ; sie dient nicht dazu, unsere Vernunft zu erweitern, sondern sie zu klären, sie vor jedem Irrtum5 zu bewahren“. 14 5 Ebenda S. 25 So bekannt diese Erklärungen auch sein mögen, wir halten es nicht für überflüssig, kritisch auf sie hinzuweisen in der Kopfzeile einiger Kapitel, wo häufig die Frage nach der Methode des kantschen Idealismus auftaucht. Tatsächlich, seit 1755 wenigstens6 , haben die „systematische“ Beschäftigung und die „kritische“ Beschäftigung nicht aufgehört, den Geist Kants unter sich zu teilen. Bald war die eine bald die andere vorherrschend. Wenn zunächst die erste dominierend war, so ließ sie alsbald der zweiten den Vortritt und nahm schließlich das Übergewicht an. 6 15 Zeuge dafür: die Erinnerung in der Habilitation von Kant an der Universität Königsberg: Principiorum primorum cognotionis metaphysicae nova dilucidatio, 1755 9 Buch I: Kritik und System Kapitel 1: Die „Kritik der reinen Vernunft“: Erinnerung an die wesentlichen Züge. Die Leser, die Kenntnis nehmen konnten von unserem Heft III1 , finden hier die wesentlichen Linien des kantschen Kritizismus erklärt und, wenn nötig interpretiert, nach der Kritik der reinen Vernunft (2.Auflage, 1787). Wir können nicht, in einer so kurzen Zusammenfassung, dem Text der Kritik Schritt für Schritt folgen; Aber wir werden desto aufmerksamer sein, exakt das Denken des Philosophen auszudrücken. 1 Der Ausgangspunkt der Metaphysik Heft III; Die Kritik Kants, Bruges-Paris, 1923 (3.Auflage Nrüssel-Paris, 1944) §1.– Das Ausgangsdatum der Kritik 16 Objektive Inhalte des Bewusstseins (was auch immer es wäre), abstrahiert von jedem „Subjekt an sich“ und von jedem „Objekt an sich“: von solcher Art ist das Ausgangsdatum – man könnte auch sagen: von solcher Art ist das erste Postulat – der Kritik von Kant2 2 Vergl. Heft III,1.Aufl. S.58 (ohne Intuition leer), 75,78 (Ausgangspunkt), 94 (sinnliche Intuition, Phänomen), 107, 111, 115, 117 (Kategorien) 3.Aufl. S. 81, 109-112, 123-124, 141-143 16 Wir verstehen unter Inhalt des Bewusstseins alles das, was die Eigenschaft besitzt, gemeinsam „dem Bewusstsein gegenwärtig zu sein“, mit anderen Worten alles das, was an der formartigen Einheit des Bewusstseins partizipiert. Ein Inhalt des Bewusstseins wird objektiv genannt, wenn seine Beziehung zur Einheit des Bewusstseins sich ebenfalls im Bewusstsein repräsentiert findet; denn diese Relation enthält das Minimum der logischen Operation, das notwendig ist, um das begriffliche Paar Subjekt-Objekt auftauchen zu lassen und um die Frage nach der „Geltung“ zu eröffnen, die die Kritik stellt. Geben wir uns vorübergehend zufrieden mit dieser notwendigen Bedingung, die vielleicht nicht hinreichend ist. Wir müssen später den Sinn des Begriffs des Objekts bei Kant diskutieren: als Ausgangspunkt einer Kritik enthält sie wenigstens diese Elemente, die wir hier unterstrichen haben. Der objektive Inhalt des Bewusstseins erzwingt sich, alles zusammen genommen, als ein unmittelbares psychologisches Faktum und (im Rahmen des Problems der Erkenntnis) als eine Voraussetzung von Rechtswegen: Sonst hätte man tatsächlich eine Kritik ohne eine zu kritisierende Materie. §2.– Die kantsche Formulierung des Problems der Kritik. Das kritische Problem der Erkenntnis stellen, besteht im Wesentlichen darin, zu fragen, wie die Inhalte des Bewusstseins, nach dem bevorzugten Ausdruck Kants, „sich auf Objekte beziehen können“. 10 Kapitel 1: Die „Kritik der reinen Vernunft“: Erinnerung an die wesentlichen Züge. 17 Die Zweideutigkeit dieser allgemeinen Formel ist die Zweideutigkeit des kantschen Begriffs des Objekts selbst. An dem Punkt, wo wir noch stehen, kann die Aussage, an die wir gerade erinnern, die drei folgenden Bedeutungen annehmen: 10 Wie ist das Objektiv–Erscheinen gewisser Inhalte des Bewusstseins möglich, das heißt, durch welchen Mechanismus entsteht es? 20 Wie sind wirklich objektive Inhalte des Bewusstseins möglich, wenigstens in dem Sinn, dass es durch seine zwei Terme zu tun hat mit einer dem Bewusstsein immanenten Beziehung der Objektivität (Übereinstimmung des Geistes mit sich selbst)? 30 Wie sind wirklich objektive Inhalte möglich, das heißt bezogen auf „Objekte an sich“ außerhalb des Bewusstseins (Überinstimmung des Gedankens mit der Realität an sich)? Von diesen drei Fragen, verwerfen wir die erste. Sie stützt sich auf die unbestreitbare Tatsache unserer Repräsentationen der Objekte; aber indem sie die Erklärung dieser objektiven Erscheinung verlangt (oder nach ihr frägt), stellt sie noch nur ein psychologisches Problem, nicht das logische Problem der Erkenntnis. Das logische Problem stellt sich erst in dem Moment, wo man sucht, ob wirklich dem objektiven Anschein, den man feststellt, eine objektive Geltung entspricht. Kant stellt niemals jede objektive Geltung in Frage: seine kritische Untersuchung setzt die objektive Wahrheit gewisser Inhalte des Bewusstseins voraus1 . 1 Zum Beispiel: die synthetischen Urteile a priori der Mathematik und der reinen Physik; die „Urteile der Erfahrung“ Aber muss dann die kantsche Formel des kritischen Problems den Sinn der zweiten oder der dritten der oben unterschiedenen Fragen annehmen? wir müssen nicht schon jetzt zwischen diesen Aussagen wählen, obwohl die dritte zweifellos die Form darstellt, unter der das Problem sich zuerst im Geist von Kant andeutete2 . 2 Brief an Karkus Herz vom 21, Nov. 1772 (siehe Heft III, 1.Aufl. S.53-58 3.Aufl. S.77-81) Wir kommen auf diesen Punkt zurück. Immerhin, die Frage von Kant: „Wie können sich Repräsentationen auf Objekte beziehen?“ wird für uns wenigstens das bedeuten: Wie können Inhalte des Bewusstseins im Denken nicht nur (für den psychologischen Gesichtspunkt) einen Schein der Objektivität annehmen, sondern (logisch gesprochen) eine Geltung eines Objekts? §3.– Die Apriorität, Bedingung der Objektivität. Die Inhalte des Bewusstseins, Materie der Kritik, präsentieren eine innere Vielfalt. Von zwei Dingen gilt nur eines: entweder lässt sich diese Vielfalt „a priori ableiten“, das heißt, leitet sich logisch von einer Bedingung a priori ab, oder diese Vielfältigkeit ist, unter irgendeiner Beziehung, irreduzibel auf 11 Buch I: Kritik und System 18 19 jede Bedingung a priori, und stellt in diesem Maße also für das Bewusstsein eine ursprüngliche (primitive) „Gegebenheit“ dar, ohne rationale Notwendigkeit, rein kontingent, partikulär. Der erste Fall ist der eines für sein Objekt schöpferischen Gedankens, das heißt, nach der Terminologie von Kant, eines Denkens, das der intellektuellen Intuition fähig ist. Der zweite Fall ist der der diskursiven Erkenntnis – die unsere – einzige Erkenntnis, mit der eine Kritik sich beschäftigen muss. Wegen des Fehlens der intellektuellen Intuition ist also die menschliche Erkenntnis gezwungen, sich auf eine irrationale, kontingente und partikuläre Gegebenheit zu stützen, auf ein „empirisches“ Gegebenes. Da nun aber eine derartige Gegebenheit als solche jeder logischen Grundlage entbehrt, unfähig selbst absolut ihre eigene Negation auszuschließen, kann sie nicht durch sich selbst im Bewusstsein eine objektive Repräsentation konstituieren. Aber sie würde diese Grundlage erwerben, wenn sie in einer wenigstens hypothetischen Beziehung zu irgendeiner „notwendigen und universellen“ Bedingung repräsentiert wäre, folglich zu irgendeiner „Bedingung a priori“. Weil jede Bedingung a priori eine wesentliche Beziehung zur Einheit des Bewusstseins einschließt, kann man genau so sagen, dass die objektive Repräsentation des Gegebenen nichts anderes ist als die Repräsentation seiner Relation mittelbar oder unmitelbar zu dieser Einheit. Zusammengefasst: keine Erkenntnis für uns ohne empirische Daten, aber auch nicht Objektivität ohne Apriorität. Definitionen:10 Mit Kant nennen wir Aufnahmefähigkeit die Eigenschaft, die das Bewusstsein besitzt, von einem ursprünglichen, exogenen Datum beeinflusst zu werden, das heißt von einem Datum, das im Bewusstsein nicht von irgendeinem Prinzip a prioti herrührt. 20 Und wir wollen Sinneswahrnehmung oder “Sinnes Fakultät“ die rezeptive Funktion des Bewusstseins nennen. 30 Das transzendentale Subjekt oder das „transzendentale Ich“ wäre die Gesamtheit der Bedingungen a priori der Möglichkeit der Objekte im Bewusstsein. 40 Die Fähigkeiten bezeichnen für uns die verschiedenen Niveaus der Apriorität des transzendentalen Subjekts. §4.– Die Untersuchung der Apriorität: die transzendentale Methode der Analyse Es ist in den im Bewusstsein gegenwärtigen Objekten, wo sich die Struktur desselben offenbaren muss. Die analytische Reflexion, die sich an den objektiven Inhalten des Bewusstseins vollzieht, legt darin nicht nur gemeinsame, mehr und mehr allgemeine Attribute frei (gewöhnliche logische Analyse) son- 12 Kapitel 1: Die „Kritik der reinen Vernunft“: Erinnerung an die wesentlichen Züge. dern auch eine Hierarchie von Beziehungen, die diese Inhalte des Bewusstseins mit Bedingungen a priori verknüpfen, die ihre Möglichkeit im erkennenden Subjekt Grund legen (transzendentale Reflexion). Auf den Höhepunkt der Bedingungen a priori stellt sich, mit aller Notwendigkeit die formartige Einheit des Bewusstseins, die universelle Einheit des „Ich Denke“. Die Repräsentation, wenigstens konfus, einer Beziehung des „Ich Denke“ auf das „Ich“ begleitet jede objektive Erkenntnis. Nennen wir „analytische Einheit der Apperzeption1 “ die Repräsentation dieser Beziehung in dem, was sie an absolut Universellem hat, das heißt, des allen Inhalten des Bewusstseins Gemeinsamen. Das heißt, dass sich uns die höchste Einheit des Bewusstseins als „analytische Einheit der Apperzeption“, zuerst offenbart ausgehend von der Vielfachheit der Objekte. 1 Siehe KRV Aufl.B S.133 (§16) Aber, so wiederholt Kant, die „analytische Einheit der Apperzeption ist mur möglich unter der Voraussetzung irgendeiner synthetischen Einheit“, die ihr zugrunde2 liegt. 2 KRV Aufl.B §16 S,133. Vergl B, §15 S.130; §16, S.135 Dieses Theorem wendet eine absolut allgemeine Korrelation an auf die apperzeptive Einheit: jede analytische Einheit (folglich jeder universelle Begriff) beruht im Bewusstsein auf einer synthetischen Einheit. Tatsächlich „um eine Repräsentation als verschiedenen Dingen gemeinsam zu konzipieren [das ist der Fall für jede «analytische Einheit»], muss man sie als zu den Dingen gehörig betrachten, die trotz dieses gemeinsamen Charakters, noch etwas Verschiedenes haben; folglich muss man sie konzipieren als eine synthetische Einheit bildend mit anderen Repräsentationen (und wären sie auch nur mögliche)3 “ 3 KRV, Aufl.B §16, S.133 Anmerkung 20 Eine analytische Einheit unterscheiden heißt also, durch diese Tatsache selbst, sich „die synthetische Einheit einer Mannigfaltigkeit“ bewusst machen, das heißt, eine „Verbindung“ von verschiedenen Elementen analysieren. Nun gilt aber, der Bemerkung von Kant zufolge „dort wo der Verstand nichts verbunden hat, kann er auch nichts auflösen (analysieren)4 “. Die analytische Zergliederung wird also, auf der ganzen Erstreckung des Denkens, das unterscheidende Zeichen einer vorausliegenden synthetischen Aktivität. 4 KRV, Aufl.B, §15, S.130 Um von da auf die Apperzeption zu kommen: „Nur unter der Bedingung in einem Bewusstsein eine Mannigfaltigkeit von gegebenen Repräsentationen verbinden zu können, ist es für mich möglich, mir die Identität des Bewusstseins in diesen Repräsentationen selbst vorzustellen5 “ 13 Buch I: Kritik und System 5 KRV, Aufl.B, §16, S.133 Die analytische, universelle Einheit der Apperzeption hat also selbst einen Vorläufer durch die Ausübung einer universellen Kraft (Fähigkeit) zue Synthese, das heißt durch „einen Akt der (reinen) Spontaneität“ des Subjekts6 6 KRV, Aufl.B, ll.cc. Zusammenfassend: „Die synthetische Einheit des Bewusstseins [das heißt: die synthetische Einheit der Apperzeption] ist eine objektive Bedingung [eine Bedingung der Objektivität] jeder Erkenntnis; ich brauche sie nicht nur, um ein Objekt zu erkennen, sondern jede Intuition kann für mich nur ein Objekt werden unter dieser Bedingung; anders gesagt, ohne diese Synthese, würde sich die Vielfalt [die Daten in einer Intuition] nicht vereinigen in einem Bewusstsein1 “ [das Objekt, dank der Intuition, wäre in mir seiner Materie nach, aber es wäre nicht „Objekt für mich“]. 1 KRV, Aufl.B, §17, S.138 §5.– Die Stufen des Apriori in einem diskursiven Verstand 21 Wie wir weiter oben gesagt haben, repräsentieren die in einem Bewusstsein anwesenden Elemente für dieses Bewusstsein nur etwas, das heißt konstituieren „objektive Erkenntnisse“ nur in dem Maße, in dem ihre Beziehung zur Einheit des Bewusstseins repräsentierbar wird. Man könnte auch sagen, indem man eine Terminologie verwendet, die von Fichte ebenso wie von Kant inspiriert ist: in dem Maße wie die Reflexion über diese Elemente des Bewusstseins sie zeigt, als in Verbindung gebracht mit der Einheit des transzendentalen Ich. Da die Zugehörigkeit zum Bewusstsein immer einen Grad der Vereinigung mit sich bringt, wollen wir sehen, welcher Grad der Vereinigung des anfänglich Gegebenen erforderlich ist dafür, dass diese Bedingungen einer objektiven Erkenntnis verwirklicht sind. §5a) Deduktion der Formen a priori der Sinneswahrnehmung. Das Anfangsdatum ist, in sich selbst, im Hinblick auf das vereinheitlichende Bewusstsein eine reine Vielfalt. Nun aber konstituiert der erste Grad der Vereinheitlichung einer reinen Vielfalt nur eine konkrete Einheit der Materie und der Form, noch nicht eine synthetische Einheit und bietet also dem Bewusstsein nur ein kontingentes, partikuläres Produkt, eine rohe Repräsentation, nicht eine „Erkenntnis“ des Objekts. 14 Kapitel 1: Die „Kritik der reinen Vernunft“: Erinnerung an die wesentlichen Züge. 22 Stellen wir hier einige Definitionen zusammen: Kant nennt: 10 sinnliche Intuition den ersten Grad der Vereinheitlichung, verwirklicht im Bewusstsein durch die Aufnahme des ursprünglichen Gegebenen. 2.0 Phänomen, das konkrete Produkt dieser Vereinheitlichung (Wir sprechen vom „Phänomen“ im ersten Grad, der „Erscheinung“, noch nicht versehen mit objektiven Bestimmungen). 30 Formen a priori der Sinneswahrnehmung, die allgemeinen Arten der sinnlichen Rezeptivität; anders gesagt, die Arten der unmittelbaren Teilnahme des Sinnesdatums an der Einheit des Bewusstseins. Korollare: 10 Jede sich durch Rezeption eines Gegebenen vollziehende diskursive Erkenntnis, muss die „Formen a priori der Sinneswahrnehmung“ haben; dass diese Formen der Raum und die Zeit sind, leitet Kant nicht ab, sondern er stellt es fest, wie er am Anfang seiner Untersuchung die Existenz eines nicht intuitiven Denkens festgestellt hat. Zum zweiten mal also greift er zurück auf eine faktische Gegebenheit. 20 Die sinnliche Intuition ist ihrer Materie nach eine „empirische Intuition“. In ihrer Form a priori betrachtet, nach Abstraktion des Gegebenen, ist sie reine „Intuition“. Tatsächlich konstituieren die Formen von Raum und Zeit im transzendentalen Subjekt eine Mannigfaltigkeit a priori, die nicht nur eine funktionale Mannigfaltigkeit ist, sondern ein mannigfaltiger Inhalt. 30 Ab sofort formuliert Kant1 eine erste kritische Schlussfolgerung: Die Idealität von Raum und Zeit und folglich der Phänomene im allgemeinen. Tatsächlich, als „reine (metempirische) Intuitionen“ drücken der Raum und die Zeit direkt eine Disposition des Bewusstseins aus, nicht die Realität der Dinge: als „Formen a priori“, konstitutiv für das Phänomen, führen sie diese ein in die „ideale“ Ebene der Immanenz des Subjekts. Diese „transzendentale Idealität“ der Phänomene lässt die „empirische Realität“ fortbestehen, die sie vom Gegebenen erhalten, aber stellt sie jeder „Realität an sich“ entgegen. 1 KRV Ausg.B Transzendentale Ästhetik, §3 und §8, II-III, Heft III 1.Aufl.S.94 ff 3.Aufl.S.132-135 §5b) Deduktion der Kategorien 23 Die Begegnung des rohen Gegebenen mit dem vereinheitlichenden Bewusstsein lieferte als erstes Produkt eine konkrete Einheit der Materie und der Form: das Phänomen. Im auf die Vereinheitlichung folgenden Grad ist das Phänomen wiederum auf seine Weise eine Funktion von vereinheitlichter Materie, allerdings nicht von reiner Materie, denn es besitzt schon im Bewusstsein seine eigene Form. Die Vereinheitlichung der Phänomene ist also, im strengen Sinn, eine „Synthese“, das heißt eine Vereinigung von definierten Elementen; und sogar eine „Synthese a priori“, das heißt eine Synthese, die die Spontaneität des transzendentalen Subjekts ins Spiel bringt: die Synthese der Phänomene 15 Buch I: Kritik und System 23 24 kann tatsächlich diese nur auf ein höheres Niveau der Einheit erheben, indem sie die sie konstituierenden Formen a priori beherrscht. Diese Synthese a priori, von Kant als „Synthese des Verstandes“ bezeichnet, erreicht also nur indirekt das partikuläre und variable Gegebene. Sich direkt auf die Formen a priori von Raum und Zeit beziehend – a priori auf a priori –, gibt sie ein unmittelbares synthetisches Produkt, das in seiner Ordnung nur universell und notwendig sein kann. Sieht man sich die permanente Struktur des Bewusstseins abzeichnen? In der Zone des a priori, im rein „Formalen“, das heißt im Inneren des transzendentalen Subjekts sind alle funktionalen Beziehungen und folglich alle Staffelungen der Einheit bis zur höchsten Einheit des Bewusstseins einschließlich a priori, universell und unveränderlich. Die Gegenwart des Gegebenen versetzt diese formartigen Relationen in den Akt, ohne sie zu verändern. Ein genaues Inventar von diesen ist also im Prinzip möglich. Bevor wir da weitermachen, wollen wir noch einmal erinnern an einige kantsche Definitionen: 10 Betrachtet unter dem Punkt ihrer Einfügung in der Ebene der Sinne, als a priorische Bestimmende [Determinanten] der imaginativen Konstruktion, markieren die funktionalen Beziehungen, über die wir gerade sprechen, die verschiedenen möglichen Arten, irgend ein Gegebenes unter den Formen von Raum und Zeit einzuordnen: in dieser imaginativen Funktion, nehmen sie den Namen der „transzendentalen Schemen“ an oder der „reinen Schemata“ (wobei das Schema im allgemeinen die Vorstellung des formartigen Typs einer Operation ist). 20 In sich selbst betrachtet, auf der Ebene über der konkreten Ebene der Sinneswahrnehmung, das heißt als apriorische Aufteilung der reinen Einheit des Bewusstseins (reine apperzeptive Einheit), konstituieren diese funktionalen Beziehungen und die entsprechenden formalen Typen, die Kategorien oder die reinen Begriffe des Verstandes. 30 Diese Kategorien oder reinen Begriffe sind nicht mehr, im eigentlichen Sinne, unmittelbare „Formen“ einer Materie, sondern Gesetze oder universelle Regeln der Synthese. Das ist es, warum der Verstand, die „Fakultät der Begriffe“ in gleicher Weise von Kant „Fakultät der Regeln 1 “ genannt wird. 1 KRV Aufl.B S.356 Die kantsche Deduktion der Kategorien verwickelt zwei Probleme in einander: 1. Die Existenz und die Erfassung der Kategorien; 2. Die Bedingungen ihrer objektiven Geltung. Absolut gesprochen könnte das erste dieser Probleme gelöst werden durch die eine oder die andere der zwei folgenden Methoden: 10 Analytisch deduzieren aus der universellen Einheit des Bewusstseins (reine apperzeptive Einheit) die sekundären Einheiten oder Kategorien, in denen sie sich ausdrückt; 20 Aufsteigen von den transzendentalen Schemata der Vorstellung zu den Kategorien wie zu ebenso vielen, die Schemata kommandierenden Einheiten a 16 Kapitel 1: Die „Kritik der reinen Vernunft“: Erinnerung an die wesentlichen Züge. priori. Die zwei Wege, aufsteigend und absteigend, müssen erfolgreich abgeschlossen werden mit derselben Tafel der Kategorien. Aber sind diese Wege für uns praktikabel? Kant hat den ersten Weg versucht in seiner metaphysischen Deduktion der Kategorien 2 . 2 25 KRV Aufl.B, §9-10 Vgl. Heft III 1.Aufl. S.110 ff 3.Aufl. S.145-149 Die synthetischen Funktionen, aus denen unsere Begriffe hervorgehen, vollziehen sich unter der Schwelle des Bewusstseins (“per modum naturae [in der Weise der Natur]“ würden die Scholastiker sagen), und sind nur unterscheidbar durch Reflexion über ihre Endprodukte, die Begriffe, die uns explizit bewusst sind. Dieses explizite, aktuelle Bewusstsein der Begriffe erwerben wir im Urteil. Kant zeigt, dass die „reinen logischen Formen“ des Urteils notwendig zusammenfallen mit den Kategorien; denn die einen und die anderen sind die allgemeinen Funktionen der Einheit unserer Repräsentationen: Die Urteile bringen klar zum Ausdruck und ordnen hierarchisch die konstitutiven, formartigen Einheiten der Begriffe. Infolgedessen, wenn wir – ausgehend von den Begriffen, von denen wir die Erfahrung haben – die absolut letzten und irreduziblen Formen der „Fakultät des Urteilens“ bestimmen, nach Abstraktion der Natur der Inhalte, die durch diese Fakultät ins Werk gesetzt wird, werden wir ein System von „Funktionen der Einheit“ erhalten, anwendbar auf „das Objekt im allgemeinen“ und nicht weniger notwendig als der Verstand selbst. Die logische Geltung dieses Vorgehens kommt nach der Einschätzung Kants, der apodiktischen Geltung gleich, die die allgemeine Logik der Aufteilung eines Begriffes zuschreibt, wenn diese adäquat und als einzig möglich bewiesen ist. Dass das der Fall ist für die zwölf reinen Formen des Urteils, die vom Autor der Kritik herausgearbeitet wurden, das ist ein Punkt, der kontrovers ist. In jeder Hypothese gibt es „ebensoviele reine Begriffe [oder Kategorien] des Verstandes, die sich a priori anwenden auf Objekte der Intuition, wie es ... reine logische Funktionen gibt in allen möglichen Urteilen; denn diese Funktionen erschöpfen vollständig den Verstand und bilden ein exaktes Maß seiner Fähigkeit.1 “ 1 KRV, Aufl.B, §10, S.105 Eine zweite Methode der Bestandsaufnahme der Kategorien kann man undeutlich sehen in den Entwicklungen, die von Kant der „transzendentalen Deduktion“ und dem „Schematismus“ gewidmet sind. Während bei der ersten Methode der Akzent auf die Möglichkeit gesetzt war, die reine Einheit des Bewusstseins zu analysieren durch adäquate Aufteilung in sekundäre Einheiten, ist hier der Akzent auf die allgemeinen Möglichkeiten der Synthese gelegt, angeboten der höchsten Einheit des Bewusstseins durch die Mannigfaltigkeit a priori der Sinneswahrnehmung. 17 Buch I: Kritik und System Unter diesem synthetischen Gesichtspunkt betrachtet definiert sich das Urteil: „Eine Art und Weise gegebene Erkenntnisse [das heißt „die verschiedenen Elemente einer Intuition“] zu reduzieren auf die objektive Einheit der Apperzeption2 “ 2 KRV, Aufl.B, §19, S.141 Die Urteile werden also betrachtet als die synthetischen Funktionen a priori, die die verschiedenen Inhalte des Bewusstseins auf die universelle Einheit desselben beziehen. Die Kategorien bezeichnen also „diese selben Funktionen des Urteils, insofern der unterschiedliche Inhalt einer Intuition bestimmt ist durch Bezug auf sie3 “ 3 26 KRV, Aufl.B, §20, S.143 Die empirische Verschiedenheit kann irgendwie sein, es bleibt keine andere intuitive Verschiedenheit in Frage, als die Verschiedenheit a priori der „reinen Intuitionen“ des Raumes und der Zeit. Wenn man nicht die absolute Unveränderlichkeit aller funktionalen Verknüpfungen im inneren des Apriori vergisst4 , versteht man leicht, dass die vollständige Aufzählung der möglichen Weisen, in der Zeit eine räumliche Gegebenheit (irgendwelche, hypothetisch) zu repräsentieren, und uns so die Tafel der transzendentalen Schemata zu liefern, uns die exakt korrespondierende Tafel der Kategorien liefern muss. 4 vgl. KRV, Aufl.B, §15, S.129-131; §10, S.102-103 In Wirklichkeit kümmert sich Kant, nachdem er schon durch metaphysische Deduktion im Besitz der Tafel der Kategorien ist, kaum darum, sie ein zweites Mal im Lauf der transzendentalen Deduktion durch eine verschiedene Methode aufzustellen. Indem er die Theorie des Schematismus weiter erklärt, gibt er sich damit zufrieden, die reinen Schemata aufzuzählen ausgehend von den Kategorien, ohne zu versuchen, von den ersteren zu den zweiten aufzusteigen. Das hindert nicht daran, dass das Prinzip der systematischen Untersuchung des Bewusstseins durch eine aufsteigende Bergung der Synthese ausgehend von der Vielfalt der reinen Intuitionen der Sinneswahrnehmung nicht in mehreren Anläufen in den Seiten, die über die Deduktion handeln, vorgemerkt ist. Man wendet vielleicht ein, dass die Kategorien, die nur identifizierbar sind vermittels der transzendentalen Schemata, die eines diskursiven Verstandes sind, gebunden an eine raum-zeitliche Sinneswahrnehmung, aber nicht notwendig die eines jeden diskursiven Verstandes. Zweifellos. Trotzdem, diese Einschränkung (die eine strenge Deduktion der Raum-Zeit, ausgehend von der reinen Einheit des diskursiven Verstandes auslöschen würde), ist nicht von großer Bedeutung, wenn man wie Kant glaubt, in der metaphysischen Deduktion analytisch die reinen Formen des Urteils bewiesen zu haben, und folglich auch die „Kategorien des reinen Verstandes“. Die „Deduktion der Kategorien“ muss, sagten wir weiter oben, ein zweites Problem lösen: das ihrer objektiven Geltung. Dieser eigentlich kritische Aspekt der kantschen Argumentation bildet das vorherrschende Thema der 18 Kapitel 1: Die „Kritik der reinen Vernunft“: Erinnerung an die wesentlichen Züge. transzendentalen Deduktion1 . Wir können uns darauf beschränken, diese letztere sehr kurz zusammenzufassen, wovon Kant selbst die wesentliche Gedankenführung in den kurzen Paragraphen 20 und 22 (Auflage B) markiert hat. 1 KRV B §13 ff. vergl Heft III 1.Aufl.S.114-138, 3.Aufl. S.149-174 „Erklären wie Begriffe a priori sich beziehen können auf Objekte, das ist es gerade, was ich die transzendentale Deduktion der Kategorien nenne2 “ 2 KRV, Aufl.B, §13, S. 117 27 Diese „Erklärung“ gibt in der Kritik der reinen Vernunft (Aufl.B) zwei korrelative Aspekte: 10 Kein Inhalt des Bewusstseins kann objektive Erkenntnis werden, wenn er nicht gedacht ist durch Vermittlung von Begriffen a priori oder von Kategorien (B,20). 20 Die Kategorien haben objektive Verwendung nur angewandt auf empirische Intuitionen, auf Inhalte der Erfahrung (B,22) Die erste dieser zwei Schlussfolgerungen erhält man mittels des folgenden Beweises: „Die in einer sinnlichen Intuition gegebene Mannigfaltigkeit gehört notwendig zur ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption, da die Einheit der Intuition nur möglich ist durch diese synthetische apperzeptive Einheit (§17)1 . Nun aber ist der Akt des Verstandes, durch den sich die Vielfalt der gegebenen Repräsentationen (Intuitionen oder Begriffe) auf eine Apperzeption im Allgemeinen reduziert, die logische Funktion der Urteile (§10)2 . Die ganze in einer empirischen Intuition gegebene Verschiedenheit geht also eine bestimmte Beziehung ein zu irgendeiner der logischen Funktionen zu urteilen, die die Vielfalt reduziert auf die Einheit des Bewusstseins. Nun aber sind die Kategorien nichts anderes als genau diese Funktionen des Urteils, insofern wie eine Vielfalt der Intuition bestimmt ist durch Beziehung zu ihnen [den Kategorien]. (§13) Die [wahrgenommene] Vielfalt in einer gegebenen Intuition ist also notwendig den Kategorien unterworfen3 “ 1 Siehe oben §4 2 Siehe oben §5, b 3 KRV, Aufl.B, §20, S. 143 Dieser Schluss scheint unbestreitbar, wenn man die behauptete Entsprechung zulässt zwischen der logischen Funktion und der transzendentalen Funktion der Urteile4 . 4 Siehe oben §5, b, Seite 8-9 Die zweite Schlussfolgerung scheint ebenso evident in den Augen Kants: 19 Buch I: Kritik und System „Ein Objekt denken und ein Objekt erkennen ist nicht exakt das gleiche. Tatsächlich setzt die Erkenntnis zwei Elemente voraus: zuerst den Begriff, durch den ein Objekt im allgemeinen gedacht wird (die Kategorie) und anschließend die Intuition, durch die ein Objekt gegeben ist5 “ 5 KZV, B, §20, S.143 28 Beim Fehlen einer Intuition, die sie vollendet, wäre der Begriff „wohl ein Gedanke der Form nach“, aber ohne reales oder mögliches Objekt, worauf es sich beziehen würde. Nun aber „gibt es in uns keine andere Intuition als die sinnliche Intuition6 “. Diese staffelt sich in „reine Intuition von Raum und Zeit“ und in „empirische Intuition“. Die erste bringt den reinen Begriffen einen Inhalt a priori und erlaubt die Erarbeitung von „reinen Wissenschaften“, wie der Mathematik; trotzdem „sind die mathematischen Begriffe noch nicht eigentlich durch sie selbst Erkenntnisse; sie werden es in dem Maße, wie die Existenz der Dinge vorausgesetzt wird, deren Repräsentation in uns die Form der reinen sinnlichen Intuition annehmen muss.7 “, das heißt in dem Maße, in dem die Existenz der in einer „empirischen Intuition“ gegebenen Dinge vorausgesetzt wird. Alle in allem, die Kategorien liefern also nur objektive Erkenntnis „soweit sie anwendbar sind auf die empirische Intuition: sie dienen nur dazu, die empirische Erkenntnis möglich zu machen8 “. In der spekulativen Ordnung überschreitet unsere objektive Erkenntnis ganz und gar nicht das Feld der „möglichen9 Erfahrung“. 6 loc.cit. 7 ebenda 8 ebenda 9 Ebenda §6.– Die Ideen der Vernunft 29 Aufsteigend von den primitiven (ursprünglichen) Gegebenheiten zur höchsten Einheit des Bewusstseins, ließ uns die transzendentale Reflexion auf eine erste Linie von Bedingungen a priori stoßen – die Formen von Raum und Zeit, – die durch ihre Anwendung auf die Gegebenheiten die Phänomene konstituieren. Danach konstituiert eine zweite Linie von Bedingungen a priori – die Kategorien – durch ihre Vereinigung mit den Phänomenen, die ersten im Bewusstsein anwesenden objektiven Einheiten. Objektive Einheiten, weil ihre Formen im diskursiven Verstand die unveränderlichen, universellen und notwendigen Typen repräsentieren, unter denen die kontingente Veränderlichkeit der Raum-zeitlichen Gruppierungen klar werden. Ein (phänomenales) Objekt ist für Kant tatsächlich nichts anderes, als eine Gruppierung von Phänomenen, 20 Kapitel 1: Die „Kritik der reinen Vernunft“: Erinnerung an die wesentlichen Züge. betrachtet unter seiner dauernden Möglichkeit, gegeben zu sein, entsprechend der Bedingungen a priori der sinnlichen Subjektivität1 . 1 Siehe z.B. KRV B Seite 523-524: „— diese Vorstellung (der Gegenstände) ist nichts anderes als der Gedanke von einer möglichen Erfahrung in ihrer absoluten Vollständigkeit“; oder weiter oben S.345: „... die Gegenstände, d.i. mögliche Anschauungen“- §6a) Prinzip der Ableitung der Ideen 30 Zwischen dem von den Kategorien besetzten Niveau und der höchsten Einheit des Bewusstseins erstreckt sich ein Intervall, wo vielleicht Platz bleibt für reine Einheiten, niedriger als die absolute Einheit aber höher als die Kategorien: lassen die Kategorien, „Regeln der Synthese der Phänomene“, sich nicht reduzieren auf eine kleinere Zahl von übergeordneten Begriffen? In der Tat, diese Begriffe existieren, es sind die „Ideen der Vernunft“: aber sind sie einer Deduktion zugänglich? Kant bringt diese neue Deduktion zur Sprache und erinnert3 noch einmal an die Korrelation zwischen „analytisch“ und „transzendental“, die den Knoten für die Deduktion der Kategorien bildete: um die Kategorien zu erhalten, hatte es genügt, die „[logische] Form der Urteile zu zeigen, umgewandelt in Begriff der Synthese der Intuitionen4 “: eine legitime Umwandlung, da in einem ganz allgemeinen Sinn, „die einfache logische Form unserer Erkenntnis“ mit formaler Äquivalenz „mit dem reinen Begriff a priori “ übereinstimmt, das heißt mit der formalen Repräsentation der Synthese a priori, die die logische Form hervorbringt5 . Versuchen wir auf einer höheren Ebene auf den Verstand diese allgemeine Korrelation der Logik und des Transzendentalen anzuwenden. 3 transzendentale Dialektik, Buch I, Sektion 2 KRV, B, Seite 377-378 4 Ebenda 5 Ebenda Wir wissen schon, dass die analytische (abstrakte) Reduktion der Begriffe als letztes Residuum „die universelle analytische Einheit des Bewusstseins“ lässt. Aber diese Abstraktion, auf einen Schlag bis zu seiner äußersten Grenze gebracht, verbirgt uns die Fährte oder Spur von Zwischen-Unterscheidungen, wenn sie existieren. Außerdem rekurriert Kant im vorliegenden Fall, ohne den Boden der allgemeinen Logik zu verlassen, auf eine regressive Methode, die eine wahrhafte Methode des Findens ist, gründend auf der klassischsten Struktur des Syllogismus. Tatsächlich zeigt jeder Syllogismus, reduziert auf seine perfekte Form ein Bedingtes (Gaius ist sterblich), indem er in den Prämissen die bestimmende Bedingung setzt (Jeder Mensch ist sterblich, und Gaius ist ein Mensch)- Aber die Bedingung selbst, wenn sie nicht durch sich selbst evident ist, muss, um intelligibel zu werden, sich einer allgemeineren Bedingung unterwerfen, von der sie das Bedingte wird in einem neuen Syllogismus, der „Prosyllogismus“ genannt wird. Und so weiter: die Reihe der Prosyllogismen strebt gegen eine Grenze, wo die Bedingung nicht mehr bedingt ist1 , auf das 21 Buch I: Kritik und System von Platon. Noch kürzer: ein Bedingtes setzen, heißt gleichzeitig die logische Forderung einer Bedingung des Bedingten setzen, eine Forderung, die nur das reine und einfache „Unbedingte“ vollständig erfüllen würde. nupìjeton 1 KRV, B, Seite 364, Vgl. Heft III, 1.Aufl. S.169-172 3.Aufl. S.221-222 Definitionen: 10 Die „Vernunft“ (in ihrer transzendentalen Bedeutung) ist die Fähigkeit die Urteile systematisch unter metakategorialen Prinzipien zu ordnen. 20 Die „Ideen der Vernunft“ sind „Merkmale“, die den reinen Begriffen des Verstandes übergeordnet sind, oder noch präziser, sind der begriffliche Ausdruck der Grenze, gegen die die regressive Verknüpfung der in den Urteilen ausgedrückten Bedingungen strebt. §6b) Die Unterscheidung der transzendentalen Ideen 31 Die Entwicklung in eine Reihe von bedingten Bedingungen, die auf die unbedingte Bedingung hin tendiert, kommt in der Ebene des Verstandes in Gang und entnimmt ihre Form notwendig von den Kategorien. Nur die „Kategorien der Relation“ eignen sich, eine geordnete, fortschreitende oder rückläufige Abfolge von Urteilen darzustellen. Die rückläufige Abfolge von kategorischen Urteilen [A=A], entsprechend dem kategorialen Typ Substanz-Akzidens strebt auf eine Grenze zu, die ein Subjekt ist, das nur als Subjekt denkbar ist (ein absolutes Subjekt); die rückläufige (regressive) Abfolge von hypothetischen Urteilen [wann A B ist, ist B], entsprechend dem kategorialen Typ UrsacheWirkung, strebt gegen eine Grenze, die eine unverursachte Ursache ist (eine unbedingte Bedingung); die Abfolge von disjunktiven Urteilen [A=B oder C oder D...], entsprechend dem kategorialen Typ der totalisierenden Zusammengehörigkeit strebt nach einer Grenze, die die absolute Gesamtheit der Bedingungen der Möglichkeit der gedachten Objekte wäre (die höchste Bedingung jeder objektiven Möglichkeit). Diese drei Grenz-Einheiten sind uns nur gegeben als „Serien Gesetze“. Trotzdem drängt sich uns ihre begriffliche Vorstellung unwiderstehlich auf mittels der sublimierten Kategorien der Substanz, der Ursache und der Reziprozität und erzeugt so den „Anschein“ von ebensovielen transzendentalen Objekten: des Ich als denkendes Subjekr; der Welt als Abschluss der kausalen Reihen der Phänomene; Gottes, „Sein des Seins“, als „absoluter Einheit aller Objekte des Denkens im allgemeinen1 “ 1 KRV, B S.364 vgl.Heft III, 1.Aufl. S.169-172 bis Ende 3.Aufl. S.221-222 Man erkennt die wesentlichen Themen der traditionellen Metaphysik: : bis zu welchem Punkt zieht ihre unleugbare subjektive Notwendigkeit ihren objektiven Wert vor der „theoretischen Vernunft“ nach sich? 22 Kapitel 1: Die „Kritik der reinen Vernunft“: Erinnerung an die wesentlichen Züge. §6c) Geltung der transzendentalen Ideen 32 Wenn man Begriffe und Urteile unter dem Idealtyp der absoluten Einheit anordnet, vollenden die transzendentalen Ideen sicherlich die Vereinheitlichung des Inhalts des Bewusstseins, aber nur als subjektiver Inhalt. Tatsächlich weit davon entfernt, wie die Kategorien am inneren Aufbau der empirischen Objekte teilzunehmen, setzen sie im Gegenteil voraus, dass diese Objekte schon konstituiert sind: sie sind also nicht die Bedingungen a priori der Möglichkeit; sie haben in der spekulativen Ordnung keine „objektive“ Deduktion; allerhöchstens bezeichnen sie „problematische“ Objekte. Und das ist noch zu viel gesagt, da sie nicht in eigentümlicher Form die Züge irgendeines transzendenten Objekts repräsentieren, wäre es auch nur hypothetisch, lassen sie die idealen Höhepunkte eines „Systems“ von Urteilen nur symbolisch ausdrücken, mittels der Kategorien der Erfahrung; ihr „transzendentaler Schein“ metempirischer Objekte deckt in Wirklichkeit nur eine Konvergenz subjektiver Prozesse ab. Ebenso lassen die „Ideen“ nach Kant uns weder transzendentes Objekt noch empirisches Objekt im eigentlichen Sinne erkennen; ihre ihnen eigen Funktion ist methodologisch – heuristisch oder regulierend – sagt er. Sie betrifft die rechte Anweisung des Denkens selbst. Trotzdem, wenn es sich ereignet, dass metempirische Objekte von woandersher unserem Glauben auferlegt würden (vergl. die praktische Vernunft), könnten die transzendentalen Ideen uns dazu dienen, diese Objekte analog zu „denken“, das heißt, sie uns zu repräsentieren durch etwas anderes als durch sich selbst. §7.– Zusammenfassung der oben in Erinnerung gerufenen, kritischen Folgerungen. 33 10 Die kantsche Kritik sucht vor allem die Bedingungen der objektiven Geltung unserer Erkenntnisse: das Hauptproblem, untrennbar verbunden mit dem Problem der apriorischen Struktur dieser Erkenntnisse. 20 Wegen des Fehlens intellektueller Intuition (die uns fehlt) setzt jede Erkenntnis die Aufnahme (Rezeption) eines Gegebenen voraus unter Formen a priori (beim Menschen die von Raum und Zeit), mit anderen Worten, sie setzt das Spiel einer Sensibilität voraus. 30 Die Phänomene, unmittelbares Produkt der Aufnahme des Gegebenen unter den Formen a priori der Sensibilität, sind in sich selbst auf dieser Stufe nur rohe Repräsentationen, überhaupt noch nicht „objektive Erkenntnisse“. 40 Nur die Synthese a priori der Phänomene konstituiert diese als Objekt in und für das Bewusstsein. Diese Synthese wird tatsächlich bewirkt entsprechend den formalen Typen der Einheit oder Kategorien, die, einerseits adäquat die universelle Einheit des Bewusstseins aufteilen (vergleiche die metaphysi- 23 Buch I: Kritik und System 34 sche Deduktion) und andererseits a priori die rezeptive Funktion a priori der Sensibilität selbst bestimmen (vergl. die transzendentale Deduktion); die kategoriale Synthese bezieht also die Phänomene auf die notwendige Einheit des Bewusstseins, das heißt auf die objektive Einheit der Apperzeption. 50 Die Kategorien erscheinen also fähig für einen legitimen objektiven Gebrauch, soweit sie eintreten mit den sinnnlichen Phänomenen in die Konstitution der Objekte der Erfahrung. Außerhalb davon sind sie nur leere Formen unseres Denkens, in sich selbst unfähig irgend ein Objekt, was auch immer es sei, zu repräsentieren. 60 Der Prozess der Vereinigung der Inhalte des Bewusstseins vollzieht sich selbst über dem Niveau der kategorialen Synthese. Aber die metakategorialen Prinzipien der Einheit, die transzendentalen Ideen begegnen keinem intuitiven Inhalt, der ihnen entspricht und können also, trotz ihrer subjektiven Notwendigkeit keine objektive Verwendung in der theoretischen Ordnung haben: ihre Funktion beschränkt sich darauf, immanente schon konstituierte Objekte zu koordinieren, oder, in einer allgemeineren Weise, systematisch den Inhalt des Denkens zu organisieren. 70 Diese kritischen Regeln zu vergessen, wird bestraft mit (findet eine Sanktion in) der Unmöglichkeit ohne ihre Beachtung die „Paralogismen“ und die „Antinomie der reinen Vernunft“ zu vermeiden. Wir kommen später auf diesen Gegenstand zurück. Erinnern wir uns hier nur, dass Kant, indem er so seine Epistemologie den Beweis der Antinomie überwinden lies, glaubte, einen indirekten Beweis geliefert zu haben der fundamentalen kritischen These, schon direkt bewiesen in der Analytik, nämlich: „Die empirische Realität der Phänomene“ (insofern sie „Gegebene“ sind), und ihre „transzendentale Idealität“ (entsprechend ihrer konstitutiven „Bedingungen a priori“). Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. 35 §1.– Das leibnitzsche Modell Um das Ideal der systematischen Einheit in seiner ganzen Breite einzuschätzen, das das Denken Kants nicht ruhen ließ, muss man aufsteigen über den Wolffianismus eines Martin Knutzen oder eines Baumgarten hinaus bis zur ursprünglichen Lehre von Leibniz, in der Kant immer einen Bezugspunkt gesucht hat, um seine eigene Lehre einzuordnen. Wir erinnern also kurz an die Struktur-Prinzipien des Leibnitzianismus, indem wir dabei darauf achten, das nicht zu übersehen, was Kant direkt oder indirekt davon gekannt haben könnte. Ein System besteht aus rationalen Zusammenhängen; es ist wesentlich das 24 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. Werk der Vernunft. Aber was ist dabei die „Vernunft“? Im IV-ten Buch der Nouveaux Essais im Kapitel 17 hat der Dialog zwischen Philalethe, der den Semi-Empirismus von Locke repräsentiert, und Theophil, dem Sprachrohr von Leibniz, die „Vernunft“ in besondererer Weise zum Gegenstand: 36 „Wir können, sagt Philalethe, in der Vernunft diese vier Stufen betrachten; 10 Beweis[-schritte] entdecken; 20 Sie anordnen in einer Reihenfolge, die bewirkt, dass man ihre Verknüpfung sieht; 30 Die Verknüpfung in jedem Teil der Deduktion wahrnehmen; 40 die Schlussfolgerung daraus ziehen. Und man kann diese Stufen in den mathematischen Beweisen beobachten1 “ 1 Nouveaux Essais, IV, Kap. 17, §1, G.V, S.457 – Die Abkürzung G bezeichnet in diesem Paragraphen die Ausgabe Gerhardt der philosophischen Schriften von Leibniz. Theophil antwortet darauf sofort, indem er die Frage vertieft: „Die Vernunft [Raison im Sinne von Begründung] ist die erkannte Wahrheit, deren Verknüpfung mit einer anderen, weniger bekannten, uns unsere Zustimmung zur letzteren geben lässt. Aber besonders und in hervorragenderer Weise nennt man sie Vernunft [Raison im Sinne von Grund a priori], wenn sie die Ursache ist nicht nur unseres Urteils sondern auch der Wahrheit selbst, etwas was man auch Ratio, Grund a priori nennt; und die Ursache im Bereich der Dinge entspricht der raison [im Sinne von Grund] bei den Wahrheiten. Das ist es, warum die Ursache selbst oft Ratio [Grund] genannt wird und besonders die Finalursache. Schließlich wird die Fähigkeit, die diesen Zusammenhang der Wahrheiten wahrnimmt, oder die Fähigkeit zum vernünftigen [im Sinn von diskursivem] Denken ebenfalls Vernunft [raison] genannt und das ist der Sinn, den du hier anwendest1 “ 1 zit.loc. 3 [Anmerkung des Übersetzers: Leibniz schreib französisch und benützt hier die verschiedenen Bedeutungen von raison, die im Deutschen nicht genauso mit dem selben Wort Vernunft bezeichnet werden können, angedeutet durch die Kommentare in eckigen Klammern.] Theophil, nicht damit zufrieden, die Vernunft als Fähigkeit, vernünftig zu denken, zu beschreiben, das heißt, Funktionen und Akte in der subjektiven Ordnung ins Auge zu fassen, verwurzelt diese Fähigkeit in einer objektiven Ordnung der „Wahrheiten“, die die ontologische Ordnung der Ursachen ausdrückt. Wo Philaleth-Locke nur eine beschreibende Klassifizierung anbietet, legt Theophil-Leibniz die Basis eines Systems. Sehen wir, wie das leibnitzsche System die drei zusammenhängenden Bedeutungen – subjektiv, logisch, ontologisch – des Wortes „ratio, Vernunft“ auf die zweite Bedeutung abstützt, die aus der Vernunft vor allem eine „ratio a priori [Grund a priori]2 “ macht, das heißt die „Bedingung a priori“ einer Wahrheit. 25 Buch I: Kritik und System 2 37 zit.Loc. In dieser letzten Bedeutung des Wortes „ratio, Vernunft“, wäre ein „rationales System“ eine Gesamtheit von Wahrheiten, die einander logisch auslösen, und schließlich von einer oder mehreren Wahrheiten abhängen, die von sich selbst her intelligibel sind. Um ein solches System zu konstituieren, muss die Vernunft, betrachtet als Fähigkeit, fähig sein, eine dreifache Operation zu vollziehen: Die materieartigen Inhalte des Systems entdecken; die Urteile zu diesem Thema aussagen; die Urteile untereinander anordnen. Ohne logischen Zusammenhang der Wahrheiten untereinander, das heißt ohne „Beweis“, gibt es überhaupt kein System, das ist von sich aus klar. Und um Wahrheiten unter einander zu verknüpfen, muss man zuerst in unseren Ideen das Wahre vom Falschen unterscheiden, das heißt, Urteile bilden. Tatsächlich erscheint uns die Wahrheit oder die Falschheit der Ideen in der urteilenden Affirmation und nicht anderswo. „Wenn die Ideen wahr oder falsch genannt werden, erklärt Philaleth, gibt es irgendeinen stillschweigenden Satz oder eine Affirmation“ [“über ihre Übereinstimmung mit etwas“]. Das greift Theophil auf, weniger um zu widersprechen als um diese Behauptung zu erweitern: „... Ich ziehe es vor, die Ideen wahr oder falsch zu nennen in Bezug auf eine andere stillschweigende Affirmation, die sie alle einschließt, nämlich die der Möglichkeit. So sind die möglichen Ideen wahr und die unmöglichen Ideen sind falsch 3 “ 3 Nouv. Essai, II, Kap. 32 G, V, S.249-250 Schließlich, um sich wahre Urteile und verknüpfte Demonstrationen zu erwerben, muss die Vernunft das Geheimnis besitzen, Wahrheiten zu finden und „Beweise zu entdecken, (die Kunnst des Einfalls)“ „Indem man an dieser Fähigkeit der Vernunft teilhat, glaube ich, dass man gut daran tut, zwei Teile davon zu kennen, indem man einem sehr üblichen Gefühl folgt, das das Auffinden [den Einfall] und das Urteil unterscheidet4 “ 4 N.E. IV, Kap. 17, G. V, S.457 Man weiß, welchen wichtigen Platz in der Leibnitzschen Philosophie die „Kunst des Erfindens, des Einfalls“ oder die „Logik der Erfindung, des Einfalls“ einnimmt im Gegensatz zur „Kunst des Beweisens“ oder der „Logik der Demonstration1 “ G VII, S.183 usw. 1 Siehe z.B. Aes combinatoria (1666) Titel G IV S.27 und später, Erörterung betreffs der Methode der Sicherheit und der Kunst der Erfindung, des Einfalls Jeder dieser drei rationalen Tätigkeiten – Erfindung [Einfall], Urteil und Beweis – drückt sich die eigentümliche Markierung des leibnitzschen Systems auf. Man muss das mehr aus der Nähe betrachten. 26 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. 10 Zuerst die Erfindung, der Einfall. Wie „Beweise entdecken“ für einen gegebenen Satz? Außer dem natürlichen oder durch Übung erworbenen Scharfsinn gibt es eine Kunst, die vermittelnden Ideen (das Mittlere 2 ) zu finden und diese Kunst ist die Analyse... Man kommt [auch] oft zu guten Wahrheiten durch die Synthese, indem man vom Einfachen zum Zusammengesetzten geht; aber wenn es sich darum handelt, gerade das Mittel zu finden, um das zu machen, was sich vorschlägt, genügt die Synthese gewöhnlich nicht und oft wäre es eher das Meer leer trinken wollen, als alle erforderlichen Kombinationen machen zu wollen... Es ist also Sache der Analyse, uns einen Faden zu geben in diesem Labyrinth, wenn es das gibt3 . 38 2 Die „mittleren Terme“ des syllogistischen Beweises 3 N.E, IV Kap. 2 G V S.348-350 Obwohl die Analyse und die Synthese alle beide beitragen können zum 4 Einfall 4 Vergl. die Ars combinatoria (G II), analytische Suche der „einfachen Begriffe“ ausgehend von komplexen Gegebenheiten, und wieder Synthetisieren des komplexen, ausgehend vom Einfachen. – Leibniz hat oft Beziehungen der Analyse und der Synthese behandelt mit der Demonstration und dem Einfall, zum Beispiel im Diskurs bezüglich der Methode der Sicherheit und der Kunst zu Erfinden (G VII S.183), in der Dissertation Über die Synthese und universale Analyse oder der Kunst zu erfinden und zu urteilen (G VII S.292-298), in den mathematischen Fragmenten, veröffentlicht von Couturat (Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Paris, 1903 S.572-573) usw. Es ist kaum wahrscheinlich, dass diese letzteren Arbeiten, die Manuskripte blieben und viel später publiziert wurden als die Edition Dutens, Kant unter die Augen gekommen sind; aber die allgemeinen Prinzipien, die sich dort erklärt finden, können ihm zugetragen worden sein, entweder durch andere Schriften von Leibniz oder auch durch Vermittlung von wolffschen mathematischen Schriften (die inspiriert sind zugleich von Leibniz als auch durch unabhängige Quellen) ist also der Hauptprozess der Kunst des Einfalls die Analyse, die ihre logische Rechtfertigung mit sich bringt, während die Synthese kein sicheres Produkt liefert außer unter gewissen Bedingungen, die sich finden zum Beispiel in der Mathematik: immer dennoch, selbst bei den Geometern, wäre eine analytische Kontrolle der Entdeckung zu wünschen5 “ 5 N.E. Kap.17 G V, S.458 Bis zum Ende vorgetrieben, muss die Analyse die primitiven (urspünglichen) – formartigen und materieartigen – Elemente des zu errichtenden Systems liefern. Leibniz sagte, dass sie identische Axiome 6 und Definitionen 7 liefern muss: 6 Die identischen Sätze – die Kant „analytisch“ nennen wird – sind die, deren Wahrheit sich gründet auf der formalen Identität des Subjekts und des Prädikats. 7 Die Definitionen „sind nichts anderes als eine distinkte Erklärung der Ideen“ [N.E. I Kap. 2 G V S.73] 39 „das, was die Terme bezeichnen, das heißt die Definitionen in Verbindung mit den identischen Axiomen, stellt die Prinzipien aller Demonstrationen1 dar.“ 1 N.E.IV Kap. 8 G V S.413 27 Buch I: Kritik und System Die nicht identischen Sätze, ob sie angeborene Wahrheiten oder selbst Axiome, wie die Axiome des Euklid, sind, sind alle rechtfertigbar durch diese analytische Reduktion: „man muss versuchen, sie zu reduzieren auf erste Prinzipien, das heißt, auf identische und unmittelbare Axiome durch das Mittel der Definitionen, die nichts anderes sind als eine distinkte Erklärung der Ideen2 “ 2 N. E. I K.2 G V S.92 0 2 Der rationale Prozess des Auffindens [des Einfalls] muss also, durch eine immer schärfere Analyse der Begriffe und der Urteile sie einem idealen Punkt unendlich annähern, wo ihre vollkommene „Klarheit und Distinktheit“ erlauben würde, sie auszudrücken durch „identische Sätze“. Die Identität, siehe da, für Leibniz die gemeinsame Grenze der Axiome und der Definitionen in einem rationalen System. Es ist von sich aus klar, dass ein solches System nicht andere „Wahrheiten“ zulässt als die formal oder virtuell identischen Sätze. Das Fragment, das wir wiedergeben, fasst die Lehre von Leibniz über diesen Punkt zusammen « Generaliter omnis propositio vera (quae identica sive per se vera non est) potest probari a priori ope Axiomatum seu propositionum per se verarum, et ope defmitionum seu idearum. Quotiescumque enim praedicatum vere affirmatur de subjecto, utique censetur aliqua esse connexio realis inter praedicatum et subjectum, ita ut in propositione quacumque : A est B (seu B vere praedicatur de A), utique B insit ipsi A, seu notio ejus in notione ipsius A aliquo modo contineatur, idque, vel absoluta necessitate in propositionibus aeternae veritatis vel certitudine quadam ex supposito decreto substantiae liberae pendente in contmgentibus, quod decretum nunquam omnimode arbitrarium et fundamenti expers est, sed semper aliqua ejus ratio (inclinans tamen, non vero necessitans [h. e. inclinans infallibiliter, licet nulla ponatur in re necessitas]) reddi potest, quae ipsa ex notionum analysi (si ea semper in humana potestate esset) deduci posset et substantiam certe omnisciam omniaque a priori ex ipsis ideis suisque decretis videntem non fugit. Constat ergo omnes veritates etiam maxime contingentes probationem a priori seu rationem aliquam cur sint potius quam non sint habere. Atque hoc ipsum est quod vulgo dicunt, nihil fieri sine causa, seu nihil esse sine ratione3 » . 40 „Allgemein kann jeder wahre Satz, (der nicht identisch oder per se wahr ist) a priori mit Hilfe von Axiomen oder per se wahren Sätzen und mit Hilfe von Definitionen oder Ideen bewiesen werden. Sooft nämlich ein Prädikat wirklich von einem Subjekt affirmiert wird, wird doch wenigstens festgestellt, dass ein realer Zusammenhang zwischen dem Prädikat und dem Subjekt besteht, so dass in irgendeinem Satz: A ist B (oder B wird wahrhaft ausgesagt von A), wenigstens B in A wäre, oder ihr Begriff im Begriff von A selbst auf irgendeine Weise enthalten ist, und das entweder mit absoluter Notwendigkeit in Sätzen von ewiger Wahrheit, oder mit irgendeiner Sicherheit aus einem vorausgesetzten Dekret, das abhängt von einer freien Substanz bei kontingenten Dingen, welches Dekret niemals unter jeder Rücksicht willkürlich und einer Grundlage entbehrend ist, sondern immer irgendein Grund davon (der 28 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. jedoch geneigt macht aber nicht nötigt [das heißt unfehlbar geneigt macht, wenn auch keine Notwendigkeit in der Sache gesetzt wird]) angegeben werden kann, die selbst aus der Analyse der Begriffe (wenn sie immer in der menschlichen Macht wäre) abgeleitet werden könnte, und einer sicher allwissenden und alles a priori aus den Ideen selbst und seinen Dekreten a priori sehenden Substanz, nicht entgeht. Es steht also fest, dass alle Wahrheiten, auch die kontingentesten, einen Beweis a priori, oder einen Grund, warum sie eher sind als nicht sind, haben. Und das selbst ist es, was man gewöhnlich sagt, dass nichts ohne Ursache geschehe oder nichts ohne Grund sei.3 “ 3 Fragment ohne Titel in G VII Philosophische Abhandlungen Nr. X Seite 300-301 Aus diesem Text ergeben sich die wesentlichen Linien eines Systems, dessen Schlussstein die göttliche Vollkommenheit wäre, der intelligible Grund aller Dinge: «ultima ratio rerum1 » 1 41 De rerum originatione radicali (G VII, S.302) 0 3 Vielleicht sieht man schlecht, wie diese rein logische Behandlung von Axiomen und Definitionen die ontologische Ebene der Realität betreffen kann. Und ist es nicht überhaupt da, wo die „Demonstration“ hinführen muss? Es ist wahr: ausgehend von einer nominalen Definition interessieren die analytischen Sätze, die die totale oder partielle Identität zwischen definiertem Objekt und seinen konstitutiven Noten affirmiert, nur hypothetisch die Ordnung der aktuellen oder möglichen Existenz. Andererseits hat in der Definition, die „real“ genannt wird, die Realität an sich des Objekts für uns, so scheint es, kein anderes mögliches logisches Fundament als unsere Erfahrung seiner Existenz; aber „quoad nos [= für uns]“ bleibt diese empirische Realität kontingent; müsste sie nicht, um in eine „Demonstration“ einzugehen, als sie selbst in irgendeiner Beziehung notwendig werden? Der Einwand, den wir gerade lesen, empfängt eine vollständige Lösung im Discours de Métaphysique (1686), in der Korrespondenz von Leibniz und in mehreren handschriftlichen Manuskripten. Unabhängig von diesen Quellen, noch unveröffentlicht zu Lebzeiten Kants, konnte dieser in den schon publizierten Werken wenigstens die Prinzipien der leibnizschen Lösung finden. So war der Weg zu dieser Lösung reichlich gebahnt durch einen bedeutenden Artikel der Acte eruditorum (1684), der die Eigenschaften der „adäquaten Begriffe oder Definitionen“ freilegt. Eine Definition, die nur distinkt ist in ihren äußeren Konturen, in ihrem globalen Gegensatz zu anderen konzeptuellen Gesamtheiten, bliebe inadäquat; das Adäquat-Sein schließt jedes Indistinktsein aus. «Cum vero id omne quod notitiam distinctam ingreditur, rursus distincte cognitum est, seu cum analysis ad finem usque producta habetur, cognitio est adaequata, cujus 29 Buch I: Kritik und System cxemplum perfectum nescio an homines dare possint ; valde tamen ad eam accedit notitia numerorum2 ». „Da aber alles das, was in die distinkte Kenntnis eingeht, wiederum distinkt erkannt ist, oder wenn man eine bis zum Ende durchgeführte Analyse hätte, wäre die Erkenntnis adäquat, aber ich weiß nicht, ob Menschen davon ein perfektes Beispiel angeben können; sehr jedoch nähert sich ihr an die Kenntnis der Zahlen2 “ 2 Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis (Acta eruditorum, Lipsiae, 1684) G IV S.423 Und hier die interessante Eigenschaft der adäquaten Definitionen: « ... Quandocumque habetur cognitio adaequata, habetur et cognitio possibilitatis a priori ; perducta enim analysi ad finem, si nulla apparet contradictio, utique notio possibilis est3 » . „.. Wann immer man eine adäquate Erkenntnis hat, hat man auch eine Erkenntnis der Möglichkeit a priori; denn, wenn kein Widerspruch aufscheint, führt eine so bis zu Ende durchgezogene Analyse zu einem real mögliches Merkmal3 “ 3 Ebenda S. 425 Zwei Bemerkungen von Leibniz offenbaren in dieser Sache den Grund seines Denkens: Zuerst bezieht er die adäquate Definition auf die „kausalen Definitionen“, die die Möglichkeit ihres Objekts a priori erkennen lassen, indem sie „die Art und Weise, sie zu produzieren“ zeigen; wohlverstanden: seine Strukturformel, seine exemplarische Idee, – die „idea factive [=sich auf ein Machen beziehende Idee [siehe Bemerkungen zur Übersetzung in Heft V]]“ der Thomisten – Alle Produkte unserer Aktivität, seien sie ideal, seien sie äußerlich, sind für uns erkennbar in der Weise und in dem Maße, indem wir davon die Autoren sind1 : 1 Es ist vielleicht interessant, diese leibnizsche Position zu vergleichen mit dem allgemeinen Prinzip der „Wissenschaft“ (im eigentlichen Sinne), formuliert wenig später von Vico: „Die Bedingung zur Erkenntnis einer Sache aus ihrer farla“ denn „das Wahre und das Faktische sind vertauschbar“ Vergl. B Croce, La filosofia di Giambattista Vico, Bari 1911 S.5 « Possibilitatem... rei a priori cognoscimus..., cum notionem resolvimus in sua requisita, seu in alias notiones cognitae possibilitatis, nihilque in illis incompatibile esse scimus ; idque fit inter alia, cum intelligimus modum, quo res possit produci, unde prae caeteris utiles sunt Definitiones causales2 ». „Die Möglichkeit .. von etwas erkennen wir a priori .. wenn wir den Begriff auflösen in seine Requisiten oder in andere Begriffe von bekannter Möglichkeit und dass wir wissen, dass in ihnen nichts inkompatibles ist; und das geschieht unter anderem, wenn wir die Art und Weise erkennen, wie die Sache hervorgebracht werden kann, weshalb vor allem kausale Definitionen nützlich sind2 “. 2 30 G. IV loc. sup. cit. Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. 42 Der ontologistische Parallelismus zwischen Ursache und logischem Grund erklärt die Tragweite dieser Bemerkung: die „kausale Definition“ offenbart etwas von der eigentlichen Intelligibilität des verursachten Objekts, seiner „ratio a priori [a priorischen Grund]3 “ 3 Siehe oben S.35-36 Wenn dem so ist, versteht man leicht eine zweite Bemerkung von Leibniz. „Kausale Definitionen“, die nicht mehr allein eine Regel der Konstruktion in der Ebene des Werdens ausdrücken würden, sondern ein Gesetz der Schöpfung in der absoluten Ebene des Seins, wären im perfekten Sinn des Ausdrucks „adäquate Definitionen“. Da die schöpferische Kausalität sich vollendet mit den individuellen Realitäten, würde die perfekt adäquate Definition außer den wesentlichen Noten alle partikulären Bestimmungen einschließen, alle Prädikate, selbst kontingente, der Individuen: „Der Begriff einer individuellen Substanz schließt ein für alle Male alles das ein, was ihr jemals zustoßen kann, (in der Weise), dass indem man diesen Begriff betrachtet, man darin sehen kann alles das, was wirklich von ihm ausgesagt werden kann4 “ „Gott, wenn er den individuellen Begriff von Alexander sieht, sieht darin zu gleicher Zeit das Fundament und den Grund von allen Prädikaten, die man von ihm in Wahrheit sagen kann, wie z. B. dass er Darius und Porus besiegen würde, bis dahin dass er a priori (und nicht durch Erfahrung) erkennt, ob er eines natürlichen Todes oder durch Gift gestorben ist5 “ 4 Discours de Métaphysique, XIII Vgl. G IV, S. 436 5 op.cit. S.433 Beim Fehlen so ausdrücklicher Erklärungen, sagen die (Kant bekannten) Nouveaux Essais, das metaphysische Prinzip aus, aus dem sie hervorgehen: „In strenger Metaphysik,...gibt es überhaupt keine vollständig äußere Bezeichnung (denominatio pure extrinseca) wegen der realen Verknüpfung aller Dinge6 “ 6 43 N.E II Kap. 25 G V S.211 Wenn es wahr ist, dass alle Dinge und alle Ereignisse untereinander verknüpft sind durch ein Band unfehlbarer logischer Notwendigkeit, wird keine Benennung irgendeines Seins „rein äußerlich“ sein und folglich auch nicht total fremd zur Definition dieses Seins. Nun aber, das wissen wir, leitet diese unfehlbare logische Notwendigkeit, keineswegs unvereinbar mit der metaphysischen Kontingenz oder der Freiheit, Leibniz ab aus der höchsten moralischen 31 Buch I: Kritik und System Regel aller Schöpfung: dem „Gesetz des Maximums des Seins“ oder „des Besseren“. Gesetz der Vollkommenheit, das im Inneren der ersten Ursache, die unendliche Weisheit der absoluten Potenz auferlegt, sie begründet die wahrhafte Möglichkeit der Dinge, die, welche in Wahrheit verlangt, in den Akt überzugehen: « Possibilia sunt quae non implicant contradictionem. Actuaha nihil sunt quam possibilium (omnibus comparatis) optima ; itaque quae sunt minus perfecta, ideo non sunt impossibilia ; distinguendum est enim inter ea quae Deus potest, et ea quae vult : potest omnia, vult optima1 » . „Möglich ist, was keinen Widerspruch enthält. Wirkliches ist nichts anderes als das Beste der Möglichen (nach Vergleich aller); deshalb, was weniger vollkommen ist, ist deshalb nicht unmöglich; man muss nämlich unterscheiden zwischen dem, was Gott kann und dem, was er will: er kann alles, er will das Beste1 “ 1 Leibniz an Bernoulli, 21. Febr. 1699. G, Die mathematischen Schriften L’s III, S.574 44 An sich – „quoad se“ – muss der Prozess der Analyse, angewandt auf inadäquate Definitionen, sie unendlich annähern an adäquate Definitionen. Im Grenzfall, das heißt am idealen Punkt, wo man die adäquate Definition der Dinge besäße, würde man gerade durch diese Tatsache die Totalität ihrer absoluten und relativen Prädikate kennen: alle Sätze würden analytisch, „identisch“, weil sie jedem Sein die Merkmale seiner eigenen Definition zuschreiben würden, und würden erlauben, dank des Gesetzes des Besseren, unter den möglichen die zu unterscheiden, die wahrhaft zur Existenz gerufen werden. Leibniz wird uns das erklären, was mit Recht „quoad se“ ein rationales System des Objekts sein würde. Bis zu welchem Grad ist diese systematische Perfektion in unserer menschlichen Erkenntnis, „quoad nos“, realisierbar? Sie ist zweifellos realisierbar – wir haben es weiter oben zu verstehen gegeben – überall wo unser Geist selbst das Objekt konstruiert hat, das er betrachtet, zum Beispiel in der Mathematik. Da sind tatsächlich die Analyse und die Synthese streng reziprok und sie müssen also, wenn man genügend Nachdruck gibt, ein gemeinsames Prinzip finden, auf dem sie beruhen. Trotzdem, selbst in der Mathematik, übernimmt diese analytico-synthetische Suche häufig die Abkürzung von „Hypothesen“: Die Schlussfolgerung, die synthetisch die Struktur des mathematischen Objekts ausdrückt, bleibt so bedingt, untergeordnet der Geltung der verwendeten Hypothese. Aber man kann „die Voraussetzungen oder Hypothesen verifzieren, wenn daraus sehr viele Schlussfolgerungen hervorgehen, deren Wahrheit von woandersher bekannt ist, und manchmal gibt das eine vollkommene Gegenleistung, die ausreicht, die Wahrheit der Hypothese zu beweisen1 “ [...] 32 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. 1 In Wirklichkeit ist eine Hypothese nie allein durch die Verifizierung ihrer Konsequenzen vollkommen bewiesen: ab antecendente ad consequens, non autem e converso, illatio valet [vom Antezedens zum Konsequens, nicht umgekehrt, gilt die direkte Schlussfolgerung]. Es gibt nur eine „vollkommene Gegenleistung“ und folglich „Beweis“ des Antezedens, im singulären Fall, wo die Gesamtheit der Konsequenzen, streng abgeleitet von diesem Antezedens, einer vollständigen logischen Aufteilung der Eigenschaften von dieser gleichkommt. Die Beziehung zwischen dem Antezedeens und dem System seiner Konsequenzen wird also „konvertibel“ (nicht kraft der Form sondern bezüglich der Materie), und der Beweis, wenn er vervollständigt oder vollendet ist, kehrt zurück zum analyrischen Typ Die Analyse bedient sich [in der Mathematik] der Definitionen und anderer reziproker Sätze, die die Möglichkeit geben, die Gegenleistung zu liefern und synthetische Beweise zu suchen2 2 N.E. IV Kap. 12 G V, S.431-432 „Die Analyse der Alten bestand, nach Pappus, darin, das zu nehmen, was man suchte und daraus Konsequenzen zu ziehen bis zu dem Punkt, wo man zu etwas Gegebenem oder Bekannten kommt. Ich habe bemerkt, dass es dafür nötig ist, dass die Sätze reziprok seien, damit die synthetische Demonstration noch einmal den Spuren der Analyse nach von hinten abgespielt werden kann, aber immer dadurch dass man Konsequenzen zieht. Es ist indessen gut, hier zu bemerken, dass in den astronomischen und physikalischen Hypothesen der Rückweg nicht stattfindet; aber auch der Erfolg beweist nicht die Wahrheit der Hypothese. Es ist wahr, dass er sie wahrscheinlich macht3 ...“ 1 45 N.E. IV Kap. 17 G V S.400 Der letzte Satz des Texts oben fordert unsere Aufmerksamkeit bezüglich der nicht mathematischen Objekte, deren Existenz sich nicht verwechselt (vermischt, verschmilzt) mit ihrer idealen Konstruktion. Sie sind, in Wahrheit, wie die mathematischen Objekte, der analytischen Demonstration unterworfen, gültig für alle Objekte gleichermaßen4 4 Die antike Syllogistik erhält von Leibniz nur Verbesserungen im detail, vgl. N.E. IV Kap. 17, §4 G V S.460-463, 469 usw. Aber diese Demonstration führt nicht hinaus über formale Beziehungen des Einschlusses und der Zugehörigkeit zu einer gegebenen Wesenheit: die reale oder mögliche Existenz entkommt ihr5 . 5 Ausgenommen vielleicht die notwendige Existenz des unendlichen Seins, analytisch abgeleitet ausgehend von der objektiven Möglichkeit dieses Seins: „...ich will nicht das wiederholen, was von uns diskutiert wurde über die Ideen und die angeborenen Wahrheiten, unter die ich die Idee Gottes zähle und die Wahrheit seiner Existenz“ (N.E. IV Kap.10 G V S,416 Siehe die Überlegungen, die nachher S.418-419 entwickelt wurden über das ontologische Argument und über die Ergänzung, die es verlangt.) Nun aber schließt das leibnitzsche System die Existenz seiner Objekte ein. Diese ist ergriffen durch die Erfahrung und durch die Demonstration: „Philalethes: ...Wir kennen unsere Existenz durch die Intuition, die Gottes durch Demonstration und die der anderen durch 33 Buch I: Kritik und System Sinneswahrnehmung... Theophil: Ich bin völlig einverstanden mit all dem, und ich füge hinzu, dass die unmittelbare Apperzeption unserer Existenz und unserer Gedanken uns die ersten Wahrheiten a posteriori oder der Tatsachen liefert, das heißt die ersten Erfahrungen, wie die Identitätssätze die ersten Wahrheiten a priori oder der Vernunft enthalten, das heißt die ersten Erleuchtungen1 “ 1 N.E. IV, Kap. 9 G V S.415 Dennoch können die Wahrheiten der Tatsachen (oder der kontingenten Erfahrung) als sie selbst in ein rationales System nur eingehen, indem sie sich stützen auf die logische Notwendigkeit der Prinzipien: „Was die Metaphysik betrifft [das heißt das objektive System der „Wesenheiten“ oder „Possibilien“], behaupte ich, davon geometrische Demonstrationen zu geben, indem ich beinahe nur zwei grundlegende Wahrheiten voraussetze, nämlich an erster Stelle das Kontradiktionsprinzip, denn sonst wenn zwei Kontradiktorische wahr sein könnten zu gleicher Zeit, würde jeder Beweis unnütz werden; und an zweiter Stelle, dass nichts ohne Grund ist, oder dass jede Wahrheit ihren Beweis a priori hat, entnommen aus dem Begriff der Terme, auch wenn es nicht immer in unserer Gewalt ist, zu dieser Analyse zu gelangen.2 “ 2 Leibniz an Arnauld, Juni 1686, G II S.58 46 Wir wissen, wo Leibniz das Prinzip der metaphysischen Geltung der kontingenten Tatsache suchte: Seine Lehre vom Optimismus zeigt uns, in der unendlichen Weisheit, den letzten und unfehlbaren Grund der Realisierung des Besseren. Dennoch ist diese globale Aufwertung der rohen Erfahrung noch weit weg davon entfernt, ein konkretes metaphysisches System des Endlichen zu konstituieren, das heißt ein System von „adäquaten Definitionen“ der Dinge. Das Problem, das zu lösen bleibt, ist genau das, von den experimentellen, mehr oder weniger konfusen Merkmalen, der Frucht einer immer unvollständigen Analyse, überzugehen zu wahrhaft adäquaten Definitionen, wie sie im göttlichen Denken gegenwärtig sind. Unfähig, den Übergang zu machen, ersetzen wir diese unzugängliche Wissenschaft durch Approximationen, die danach streben, sie asymptotisch zu erreichen. Leibniz verbindet eine extreme Wichtigkeit mit „der Kunst, die Wahrscheinlichkeiten (verisimilitudes) abzuschätzen, [einer Kunst] nützlicher ... als ein guter Teil unserer demonstrativen Wissenschaften3 “ 3 N.E. IV Kap. 2 G V S.353 Das, was uns in der Analyse der endlichen Objekte eine größere Nützlichkeit auszudrücken scheint oder eine größere Wahrscheinlichkeit, kurz, was uns als 34 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. besser erscheint, hat eine Chance, es tatsächlich zu sein und die rationale wahre Definition anzunähern. Es gibt, so zu sagen eine Wissenschaft des Wahrscheinlichen, oder besser des Grads der Wahrscheinlichkeit (quoad nos): „... Die Verknüpfungen sind selbst notwendig, wenn sie nur eine Meinung hervorbringen, wenn nach einer genauen Untersuchung die Prävalenz der Wahrscheinlichkeit, soviel man darüber urteilen kann, bewiesen werden kann in der Weise, dass es da also Demonstration gibt, zwar nicht der Wahrheit der Sache, aber der Partei, dass die Klugheit will, dass man sie nimmt4 “ 4 47 N.E. Kap.17 G V S.457 Zusammenfassend: Der logische Knoten des Systems von Leibniz ist die Identität: Identität der „adäquaten Definition“ mit sich selbst und folglich, da die adäquate Definition das reelle Wesen ausdrückt, unfehlbar der Existenz versichert, der Identität des Seins mit sich selbst. Auf diese vollkommene Identität hin muss jede objektive Erkenntnis konvergieren, sowohl die menschliche wie die göttliche, wenn man zulassen muss: 10 dass die „Identitätssätze“ (oder analytischen Sätze) unmittelbar evident sind: 20 dass die wahren Sätze alle „identisch“ sind oder reduzierbar sind auf „identische“ (formaliter vel virtualiter identicae). Und wenn es so ist, schließt die rationale Wahrheit eines nicht identischen Satzes notwendig das Komplement der Intelligibilität ein, das dieser Satz erfordert, um ein identischer Satz zu werden: das ist bei Leibniz der ursprüngliche Sinn des „Prinzips des hinreichenden Grundes1 “ 1 Siehe den Text, der weiter oben S.39-40 zitiert wurde. Ebenso Heft II, dritte Auflage, S.134 Fußnote und Precis d’Histoire de la Philosophie mederne t.I S.174-175 Findet man im System von Leibniz „synthetische Sätze“ vergleichbar mit den Synthesen, wie sie Kant anerkennt? Sicherlich und nicht nur empirische Synthesen, sondern (vorzeitig zur Wortbildung) Synthesen a priori. Die letzteren sind von zwei Arten: a) die immanenten Konstruktionen der Mathematik, Synthesen a priori, deren formale Notwendigkeit der vollständigen analytischen Reduktion fähig ist2 ; 2 Siehe oben S.43-44 b) Alle nicht identischen Sätze, betrachtet in ihrer rationalen Wahrheit, das heißt als Vorausnahmen der notwendigen Identität; mit anderen Worten: alle Anwendungen des Prinzips des hinreichenden Grundes auf nicht analytische Wahrheiten3 . Die rationale Synthese (a priori) ist also durchaus nicht abwesend im leibnitzschen System, aber sie schreibt sich streng ein in die Identität. 3 Die konkreten Anwendungen des Prinzips des hinreichenden Grundes kommen zur Geltung in den Methoden des Infinitismus von Leibniz als ebensoviele „Übergänge zur Grenze“. Siehe Heft II, 3.Auflage S.161-163 Was die empirischen Synthesen betrifft (a posteriori), treten sie ein in das System wie das konfuse und mehr oder weniger entfernte Stadium ebensovieler 35 Buch I: Kritik und System 48 rationaler Einheiten: „Definitionen“ oder „reine Ideen4 “, die die Wahrheit der sinnlichen Erfahrung5 a priori begründen. [Diese Sicht ist evident inkompatibel mit der Theorie der Sinneswahrnehmung, wie sie dem Kritizismus Kants der klassischen Periode eigen ist] 4 Die reinen Ideen... die ich den Phantomen der Sinne gegenüberstelle (N.E. I Kap. 1 G V S.73) 5 Siehe weiter oben S.45-46 §2. – Das systematische Ideal bei Kant Die im ersten Paragraphen dieses Kapitels gruppierten Elemente des leibnitzschen Systems haben zu Lebzeiten Kants eine genügende Publizität empfangen, um von daher für jeden Philosophen des Metiers zugänglich zu sein. Waren sie wirksam bekannt für Kant? Mehrere Anzeichen lassen uns glauben, dass, auch wenn dem Denker von Königsberg keine irgendwie wesentliche These von Leibniz entgangen ist, von ihm hingegen die tiefe logische Einheit, die die verschiedenen Aspekte des Leibnizianismus verbindet, nicht klar wahrgenommen war. Wir möchten das kurz zeigen. 1. Echos auf Leibniz in den Werken von Kant 49 Uns interessieren hier nur die Punkte, die die organische Struktur der Lehre von Leibniz steuern. Die folgenden Seiten sind nicht eine Verdopplung von Buch I von Heft III, wo an die „wolffschen“ Anfänge von Kant erinnert wird. Die Habilitationsschrift Kants an der Universität von Königsberg 1755 (Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio) erwähnt mehrfach die Ars combinatoria und die Caracteristique 1 : zwei Teile des Werks von Leibniz, die einige beherrschende Linien seines Systems sehr hervorheben, unter anderen die ersten Prinzipien seiner Analytischen Methode und seines Mathematismus. „Lege characteristica ita exigente [da das charakteristische Gesetz es so fordert]“ bemerkt Kant zur Unterstützung eines Beweises2 ; und ein wenig weiter3 : „zum Beispiel, sagt er, ... in der charakteristischen Kombinationskunst“. Er adoptiert andererseits, vor den immensen Horizonten, die der Autor der Combinatoria erahnte, eine zurückhaltende Einstellung, ja sogar eine ein wenig spöttische. Sicherlich, in privilegierten Fällen findet die kombinatorische Methode ihre Anwendung: 1 Siehe unser Précis d’Histoire de la Philosophie moderne t. I Louvin 1933 S. 161-164 2 Nova dilucidatio, sect. I, Prop 1, Edit. Ak. Bd. I S.389 3 Ebenda Scholion « Equidem, si ad principia absolute prima perventum est, non infitior aliquem artis characteristicae usum licere, cum notionibus atque adeo terminis simplicissimis ceu signis utendi copia sit4 » . 36 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. „Freilich wenn man zu den absolut ersten Prinzipien gelangt ist, behaupte ich nicht, dass eine Verwendung einer charakteristischen Kunst verlangt wird, da es eine Menge von Anwendungen von Begriffen und sogar einfachsten Termini oder Zeichen gibt4 “ 4 zit. Op. S.390 Aber wenn es sich handelt um komplexe Objekte, wird die Schwierigkeit der Verwendung unentwirrbar (“inextricabili difficultate impeditur5 “). Will man wissen, fügt er hinzu, was er von dieser berühmten Kunst, die kaum ihren Erfinder überlebt hat, denkt: « de hac arte, quam postquam Lcibnizius inventam venditabat, eruditi omnes eodem cum tanto viro tumulo obrutam conquesti sunt6 » ? [“von dieser Kunst, die Leibniz, nachdem er sie erfunden, feilbot, die alle Gelehrten mit dem so großen Mann als mit dem gleichen Erdhügel bedeckt beklagt haben6 “?] Er hätte nicht besser antworten können, als durch die Erinnerung an den Arbeiter, der seinen Söhnen einen in den Feldern versteckten Schatz vererbt, aber hinscheidet, bevor er den genauen Ort des Verstecks angegeben hatte; die Hoffnung, ihn zu finden, beschäftigte die Erben, unermüdlich den Boden umzugraben: Statt des Schatzes erhielten sie reichere Ernten1 5 Ebenda 6 zit.Op. S.389 1 Ebenda S.390 Er war hierbei vielleicht ein wenig unbekümmert, sich des Problems zu entledigen. Trotzdem, das Geheimnis der weitreichenden leibnitzschen Konstruktion besaß Kant, wenigstens virtuell, denn er spricht selbst das Prinzip aus, das ihm zugrunde liegt und seine Kohärenz sicherstellt: « Omnis nostra ratiocinatio in praedicati cum subjecto vel in se vel in nexu spectato identitatem detegendam resolvitur 2 » . „Unsere ganze Beweisführung besteht darin, die Identität des Prädikats mit dem Subjekt in sich oder in der betrachteten Verknüpfung zu entdecken2 “ 2 Nova dilucidatio, Sekt. I Satz III, Scholion. Ak. Bd.I S.391. Der Ausgangspunkt IV. 4 50 Und, so zweifelt er, der sich schon von Wolff losgelöst hat, bis zu welchem Punkt er noch im Kielwasser ihres gemeinsamen Meisters navigiert, denn er stellt die göttliche Erkenntnis der unseren gegenüber in diesen Ausdrücken: « ... Hinc videre est : Deum non egere ratiocinatione, quippe, cum omnia obtutui ipsius liquidissime pateant, quae conveniant vel non conveniant, idem actus repraesentationis intellectui sistit, neque indiget analysi, quemadmodum, quae nostram intelligentiam obumbrat nox, necessario requirit3 » . 37 Buch I: Kritik und System „... Daher muss man sehen: Gott brauche keine Beweise, zumal ja alles seinem Blick ganz klar bekannt ist, was es gibt oder nicht gibt, steht im selben Akt der Repräsentation für den Intellekt fest, und er braucht nicht die Analyse, die irgendwie die unsere Intelligenz umschattende Nacht notwendig braucht.3 “ 3 Ebenda Das ist genau, was Leibniz sagen wollte, indem er erklärt, dass die kontingenten Sätze, um ihre rationale Evidenz zu zeigen, „unendliche Analysen Gottes brauchen, die nur Gott überwinden kann4 “: Denn die Integration einer „unendlichen Analyse“ kommt nicht zur Vollendung, es sei denn in der einfachen Einheit eines perfekten intuitiven Aktes. 4 Leibniz, Phlosophische Schriften, Ausgabe Gerhardt, t. VII S. 200 Es lohnt sich auch, die allgemeine These anzuführen, an die sich diese Erklärungen Kants anknüpfen: „In der Verknüpfung der Wahrheiten gehört die Priorität dem (positiven) Prinzip der Identität, nicht dem (negativen) Prinzip des Widerspruchs5 “. Wir werden bei passender Gelegenheit sehen, was im Verlauf der weiteren Entwicklung des Denkens von Kant aus diesem absoluten Vorrang des Identischen wird. 5 Vergl. zit Op. S. 390: Prop III.“Principii identitatis ad obtinendum in veritatum subordinatione principatum prae principio contradictionis praeferentiam ulterius stabilire.“ [Vorrang des Identitätsprinzips, um die Unterordnung der Wahrheiten zu erhalten vor dem Prinzip des Widerspruchs, ist der Vorzug weiter festzustellen] Der Autor der Nova dilucidatio (1755) gab sich sicherlich Rechenschaft darüber, dass die Reduktion jeder metaphysischen Evidenz auf die der Identität, nicht nur von uns eine unendlich mühsame Analyse verlangen würde, sondern die Kräfte unserer Vernunft überstiege. Seine Zurückhaltung in diesem Punkt wird ausdrücklicher, wenn möglich, in dem Werkchen mit dem Titel: Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral (1764), wo er unterstreicht den Kontrast zwischen der synthetischen (konstruktiven) Methode der Mathematik und der analytischen Methode der Metaphysik1 . 1 51 Siehe Heft III, 3.Auflage S.38-39 (1.Aufl. S.21-22) Der Traum einer Metaphysik, aufgebaut durch eine Aneinanderreihung von Synthesen hörte auf, illusorisch zu sein an dem Tag, wo die Analyse der objektiven Daten vollendet wurde; es fehlt noch sehr viel, bis man damit soweit ist: „Es wird noch viel Zeit vergehen, bevor die Metaphysik synthetisch vorgehen kann; Um das möglich zu machen, wie in der Mathematik, eine Synthese, die die zusammengesetzten Erkenntnisse ableitet aus einfachen Erkenntnissen, müsste die Analyse zuvor uns vollkommen in allen ihren Teilen distinkte Begriffe geliefert haben2 “. 38 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. 2 Über die Deutlichkeit, usw. Ak. Bd. II, S.290 Was können wir in Erwartung dessen in der Zwischenzeit machen, außer die unmittelbaren Daten der Erfahrung sammeln, um darin zu unterscheiden, • beim Fehlen von absolut ersten Elementen a priori, aus denen sich adäquate Definitionen zusammensetzen würden, • wenigstens irgendwelche objektiv reell mit Bezug auf uns erste Inhalte: „elementare Begriffe“ und „unbeweisbare Urteile3 “? Eine Metaphysik a posteriori, experimentell und analytisch, siehe da, so glaubt er, das was wir in jedem Fall anstreben4 können. 3 zit. Op. S.284, 286 und vgl. Heft III 3.Aufl. S.35 (1.Aufl. S.19) Das wäre wirklich, nach Kant, eine „Metaphysik“ deren Sicherheit sich verschlüsselte wie die Sicherheit der Mathematik. Das Privileg der Mathematik beruht auf der Tatsache, dass das mathematische Objekt, da es total von uns konstruiert ist, in seiner Definition uns vollkommen klar und distinkt ist, während der metaphysische Begriff, unserem Geist von außen auferlegt, von Dunkelheit behaftet bleibt. Wenn die Analyse des metaphysischen Begriffs vorgetrieben werden könnte bis zur Verbannung jeder Spur von „Wirrwar“, würde die Methode der Physik mit einem Sprung die der Mathematik einholen (vgl. Über die Deutlichkeit, usw. zitierte Ausg. S.291) 4 52 Zwei Jahre später, in den Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik (1766), ist dieser Glaube, dessen Unsicherheit man deutlich merkt, an eine Metaphysik der Erfahrung stark erschüttert; und es ist selbst nicht einmal mehr die Frage, die vage und ferne Möglichkeit einer synthetischen Metaphysik entsprechend dem leibnitzschen Ideal nach Art einer Hypothese beizubehalten. Trotzdem, würde man nicht wagen zu behaupten, dass dieses Ideal sich jemals vollständig aus dem Denken Kants ausgelöscht hätte. Auf dem Höhepunkt der kritischen Periode hat die Perspektive der Gesamtheit der theoretischen Vernunft sich bei ihm noch geregelt über einen Grenzpunkt, eine höchste Vollendung, wo die regressive Analyse per Identität sich vereinigen würde mit dem unbedingten Prinzip der notwendigen synthetischen Strukturen, den „adäquaten Definitionen“: was auch immer das Feld des „objektiven“ Wissens ist, das „problematische“ Ideal des Systems bleibt bei Kant konform mit dem mathematischen Ideal von Leibniz. Die Indizien dafür fehlen nicht: wir werden ihnen weiter unten begegnen. Eine davon figuriert in den zwei ersten Ausgaben der Kritik der reinen Vernunft. In Umkehrung dessen, was in der Mathematik vor sich geht, „krönt und vollendet die [eigentümliche] Definition die philosophische Forschung mehr, als dass sie sie eröffnet1 “: Die Philosophie tendiert gegen die perfekte Identität der Definition und dem definierten Objekt. 1 KRV, Metodenlehre, I, 1: A, S.731; B, S.739 „Die Philosophie wimmelt von fehlerhaften Definitionen, vor allem von denen, die gewisse Elemente der [wahren] Definition, aber noch nicht die Totalität dieser Elemente einschließen...[Dennoch] 39 Buch I: Kritik und System kann man — sehr nützlich unvollständige Definitionen verwenden, das heißt Sätze, die noch nicht eigentlich Definitionen sind, aber die andererseits wahr sind, und folglich solche annähern 2 . Für die Mathematik ist die Definition eine Bedingung des Seins (esse); für die Philosophie eine Bedingung des besser Seins (melius esse). Sie ist schön, aber oft sehr schwierig zu ihr zu gelangen3 “ 2 Hervorhebung von uns zit. Op. und loc, Fußnote 1. Vergl. mit der leibnitzschen Lehre der „Wahrscheinlichkeiten“, hypothetische Vorausnahmen, mehr oder weniger wahrscheinlich, der rationalen Wahrheit. Vergl. Heft II, 3.Aufl. S.162-163 und oben S.45-46 3 53 Selbst in der kritischen Periode hat also das systematische Ideal Kants nicht aufgehört, leibnitzisch zu sein: die Analyse kontrolliert die Synthese; die Identität steuert letztlich. Das ist es – bei Kant ebensosehr wie bei Leibniz und bei Wolff – die Identität ist nicht nur die ideale Krönung des Systems, sondern vor allem der einzige unbestreitbare Stützpunkt des Beweises. Indem wir sie feststellen, denken wir nicht nur an eine Art wiederholter Erklärung an verschiedenen Orten der Kritik, zum Beispiel an die Paragraphen 16 und 17 (der zweiten Auflage): dass die Behauptung der Synthese a priori gegründet ist auf die Analyse; dass „der Satz, der aus der synthetischen Einheit die Bedingung des ganzen Denkens macht, selbst analytisch ist4 “; dass „das Prinzip der notwendigen Einheit der Apperzeption selbst identisch ist und sich also durch einen analytischen Satz ausdrückt, und noch dazu dass er die Notwendigkeit einer Synthese ausdrückt der in einer Intuition5 gegebenen Mannigfaltigkeit“; wir denken auch an Bemerkungen über ein weniger abstraktes logisches Vorgehen und von einer reell weiter ausgedehnten Tragweite: so, wenn Kant sich entschließt zu einer völlig neuen Epistemologie, die jede Bestimmung a priori des Objekts in das Subjekt verschiebt, ist der Grund, der ihn zu dieser Umkehrung der klassischen Perspektive bewegt, so sagt er, die Möglichkeit die Erkenntnis a priori der Objekte auf der Fortdauer eines identischen Subjekts zu gründen: 4 4 KRV B, S.138 KRV B S. 135 „Wenn unsere Intuition der Dinge sich regeln muss über ihre Struktur [außerhalb von uns], sehe ich nicht, wie wir davon irgendetwas a priori erkennen könnten, aber ich begreife sehr wohl, wenn das Objekt, als Objekt der Sinne, sich regelt über die Struktur unserer intuitiven Fähigkeit1 “ 1 KRV, Vorrede B S. XVII Will man „einen exzellenten Stein der Weisen, um das einzuschätzen, was ich für eine komplette Umkehr unserer Art zu denken halte? Hier ist er: wir erkennen a priori nur Dinge, die wir selbst da hinein versetzt haben2 “ 40 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. 2 54 Evidenterweise verschwindet das Mysterium des Apriori, und nimmt die Evidenz einer Identität an, wenn unsere Erkenntnis der Objekte im Voraus nichts anderes ist als die Erkenntnis unserer aktiven Teilnahme an ihrer Struktur. Leibniz ging mit derselben logischen Forderung der Identität noch weiter bis zu einer höchsten ontologischen Identität. Trotzdem ließ er nicht mehr notwendige Erkenntnisse zu als die, die entspringen aus der tiefen Spontaneität der Monade, entsprechend dem konstitutiven Gesetz dieser selbst. So oder so, die nächste Möglichkeit der Erkenntnis a priori wird gemessen an der vorausgehenden Präsenz des Inhalts dieser Erkenntnis in den Virtualitäten des Subjekts. 3 55 zit. Op. S. XVIII Siehe weiter unten S.127-130 Muss man daran erinnern, dass dieses Angeborensein der Repräsentationen bei Leibniz sich sehr über das kantsche Apriori hinaus erstreckt, das sich begrenzt auf die formartige Struktur des immanenten Objekts? Weil er in die Virtualitäten jeder intellektuellen Monade das ganze Feld der Repräsentation der „Possibilien“, Materie und Form alles zusammen, einschloss, behielt Leibniz quer durch die gestaffelten Niveaus der Erkenntnis, angefangen mit der äußeren Sinneswahrnehmung bis zur höheren Vernunft eine grundsätzliche Homogenität bei und konnte sich schmeicheln, adäquaten Definitionen näher zu kommen durch einen allmählichen Übergang von „konfus“ zu „distinkt“: Daher die Erweiterung, die er versuchte, von den Vorgehensweisen „des Kalküls des Unendlichen [der Infinitesimalrechnung]“ auf die Metaphysik. Im Gegensatz dazu anerkannte Kant (wie andererseits Wolff) zu allen Zeiten in unserem Verstehen, den heterogenen Beitrag einer wirklichen äußeren Erfahrung. Er ging damit sogar gegen 1764-1766 so weit, keinen anderen Inhalt unseres Denkens zuzulassen als die Daten der Erfahrung, das heißt ein Element, das mit dem rationalen Objekt inkommensurabel ist. Wenn er 1770, auf Leibniz momentan zurückkommend, versucht, die Metaphysik auf total apriorische „reine Ideen“ zu fundieren, gibt er fast gleich danach (ab 1772 vielleicht, aber sicher 1775) die Hoffnung auf, die objektive Geltung dieser Ideen zu begründen: Der Dualismus der Materie und der Form unserer Erkenntnisse taucht wieder auf, total und irreduzibel. Trotzdem, so groß blieb die leibnitzsche Attraktivität, sehen wir Kant selbst in der Folge, etwas von „reinen Ideen“ unter der Form von „Data a priori“, restaurieren, reinen Produkten einer reinen Aktivität, vollzogen in Gegenwart eines empirisch Gegebenen3 , sogar der Name „acquisitio originaria“, von Kant dieser kontingenten Emergenz [=plötzliches Auftauchen] reiner Ideen zugeschrieben, ist hergenommen vom großen Initiator des deutschen Rationalismus. 3 siehe weiter unten S.127-130 1790 in einem langen Artikel als Antwort auf den wolffschen Philosophen 41 Buch I: Kritik und System Eberhard, wurde Kant dazu gebracht, seine eigene Lehre mit der von Leibniz zu konfrontieren, was er zurückführt auf die drei folgenden Punkte: 1. Das Prinzip vom hinreichenden Grund 2. Die Monadologie; 3. Die prästabilierte Harmonie1 . 1 Über eine Entdeckung nach der alle neue Kritik der Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll. Königsberg 1790. Vgl. Ak. Bd. VIII, S. 390-394 Etwas später, gegen 1792-1793, in einer Studie über „Die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolff2 “, 2 Über die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolff, veröffentlicht von F.T.Rink auf Wunsch Kants, 1804 begrenzt er wie folgt „den originalen Beitrag von Leibniz in der Metaphysik“: „Das Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren, das Prinzip vom hinreichenden Grund, das System der prästabilierten Harmonie und schließlich die Monadologie3 “ 3 zit. Op., Erster Entwurf, 2.Abteilung. Vgl. Ak. Bd.XX (1942) S.285 oder Ausg. Cassirer, Berlin 1922 Bd.VIII, S.167 Diese Kardinalthesen der leibnitzschen Metaphysik waren Kant vertraut seit den wolffschen Anfängen seiner philosophischen Karriere4 . 4 Wie die Schriften der vorkritischen Periode das bezeugen, Siehe Heft III, Buch I – Kant kannte auch den leibnitzschen Gegensatz des „Reichs der Natur“ und des „Reichs der Gnade“: Er selbst verknüpfte das „Reich der Gnade“ mit dem praktischen Bereich der Vernunft, das heißt mit der Metaphysik des „hüchsten Gutes“ und der „moralischen Postulate“. Siehe z. B. KRV, B (Methodologie II,3), S.84 56 Wenn sie gegen 1790 von neuem seine Aufmerksamkeit auf sich zogen, entgeht ihm immer ihre enge Kohärenz mit dem notwendigen Ideal der Identität. Dieses unvollkommene Verstehen verrät sich hier und da, in der Entdeckung und in den Fortschritten, und wäre das auch nur wegen der Unkenntnis der der Infinitesimalität gewährten Rolle im leibnitzschen System. Trotzdem in einem Punkt ist Kant nicht weit davon, den Knoten des ganzen Problems der Methode zu begreifen, das uns beschäftigt, nämlich, letzten Endes die Beziehung zwischen Synthese und Identität. Eberhard bezweifelte die Originalität des Begriffs des „synthetischen Urteils a priori“, wesentliches Stück der Kritik der reinen Vernunft. Die kantsche Einteilung der notwendigen Urteile in „analytische Urteile“ und „synthetische a priori“ sei nur in anderen Ausdrücken zu wiederholen die leibnitzsche Einteilung derselben Urteile in „identische“ und „nicht identische“. Darauf antwortet Kant, dass der negative und konfuse Ausdruck „nicht identische Urteile“ nichts vermuten lässt von dem, was er vor allem wissen möchte: die mögliche Beziehung ihrer Struktur zu ihrer Funktion der Apriorität. Anders steht es damit bei dem Ausdruck „synthetisches Urteil a priori“, die auf ein präzises Problem hinweist5 . 5 Entdeckung, usw. Ak. Bd. VIII S. 244 (Zeile 27-37) Der Bemerkung fehlt nicht ein gewisse Stichhaltigkeit Eberhard gegenüber. Vielleicht hätte man trotzdem nicht ganz vergessen dürfen, dass die „nicht identischen Urteile“ in einem sehr positiven Sinn bei Leibniz „virtuell identische Urteile“ sind, und durch diese logische virtuelle Erweiterung, sich ganz 42 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. ebenso ein wenig den kantschen synthetischen Urteilen a priori annäherten. Die einen und die anderen haben gemeinsam, überhaupt nicht auf der bloßen Analyse zu beruhen, die wir aktuell machen können über sie, sondern für die Rechtfertigung ihrer Wahrheit, ein anderes Fundament (Grund) als diese Analyse zu verlangen1 . 1 zit. Op. S.245 (Zeile 10-17) Ein anderes Fundament: Welches? Hier wurde die Abweichung unvermeidlich. Versuchen wir, sie zu messen. In den Augen von Leibniz liegt die höchste Bedingung, die für die Wahrheit der nicht identischen Sätze erfordert ist, im schöpferischen Gedanken, wo jede existierende Realität ihre „adäquate Definition“ findet: Das heißt in der transzendenten Quelle jeder Intelligenz, „in der Unendlichkeit“ der [unendlichen] Reihen endlicher Terme, ist es, wo sich das universelle Reich des Gesetzes der Identität affirmiert. Kant auf seiner Seite, hat uns hinterlassen, unter seinen vorbereitenden Anmerkungen für den Artikel gegen Eberhard, einige instruktive Zeilen: 57 „...(Im logischen Sinn bezeichnet das Prinzip des hinreichenden Grundes, dass jeder Satz, der nicht rein problematisch ist, seinen intelligiblen Grund hat; dennoch, dieser Grund ist nicht Grund der aufgefassten Sache, sondern nur unserer Apprehension [Erfassung] der Sache) [Das Prinzip vom hinreichenden Grund] kann auch in folgender Weise verstanden werden, und ganz ohne Zweifel hat Leibniz es so verstanden: jeder mit einem anderen Begriff verknüpfte Begriff, ohne es kraft des Kontradiktionsprinzips zu sein, setzt irgendein Fundament [seiner Verknüpfung] voraus, verschieden selbst vom Begriff, mit dem es assoziiert ist (...). Leibniz wollte wahrscheinlich auf diese Weise nicht nur ein partikuläres synthetisches Urteil formulieren, sondern das [allgemeine] Prinzip synthetischer Urteile2 “ 2 Vorarbeiten zur Schrift gegen Eberhard (Hndschr. Nachlass, Bd. VII) Ak.Bd.XX S.363-364 Diese Zeilen von Kant treffen in sehr weitem Maße das wirkliche Denken von Leibniz. Bei diesem letzteren ist tatsächlich der hinreichende Grund ursprünglich, das wissen wir, eine Forderung der logischen Ordnung: sie deckt ab die Lücke zwischen „virtuell identisch“ bis „formal identisch“ in den nicht identischen Urteilen (synthetisch im kantschen Sinne). Diesen hinreichenden Grund, dieses rationale Fundament (den Grund ), suchen unsere zwei Philosophen zuerst in einer objektiven Vollkommenheit des Gedankens selbst. Für Leibniz wäre das die vollkommene Intuition der Wesenheiten durch die schöpferische Weisheit. Für Kant wird das in gleicher Weise eine Intuition sein: „Folglich ist [das Fundament der Möglichkeit von nicht analytischen Urteilen] nichts anderes als die Intuition; Intuition a priori, 43 Buch I: Kritik und System wenn der Satz a priori ist; empirische Intuition, wenn der Satz empirisch ist3 “ 3 Zit. loc. (in der Klammer, angedeutet oben durch einige Punkte) Dieselbe Interpretation ist eingegangen (a passé) in den Text der Entdeckung: die synthetischen Urteile, sagt man uns, bieten diese Besonderheit, dass sie „nur möglich sind vermittels einer Intuition, die dem Begriff ihres Gegenstandes zugrunde liegt4 “, 4 58 Entdeckung, usw. Ak. Bd. VIII, S.241 vgl. S.245 empirische Intuition oder Intuition a priori, je nach Fall. Die synthetische Einheit eines Subjekts und eines Prädikats findet also immer das Prinzip und das Maß seiner Geltung in seiner totalen oder partiellen Identität mit einem Inhalt einer Intuition. Der Kritizismus Kants, nicht andere Intuitionen kennend als die der Sinnlichkeit, kennt auch eine gültige objektive Synthese nur in den Grenzen des sinnlichen Objekts. Scheint es nicht, dass die Meinungsverschiedenheit zwischen Kant und Leibniz sich weniger auf die logische Form unserer Urteile erstreckt als auf den Inhalt, den sie einschließen kann? In jedem Fall verkompliziert sich die Meinungsverschiedenheit hier durch ein zusätzliches Missverständnis. Fragen wir Kant selbst. Das was er hauptsächlich der Methode von Leibniz vorwarf, lässt sich erraten vermittels eines präzisen Vorwurfs, den er formulierte gegen die Interpretation der synthetischen Urteile a priori durch Eberhard1 : 1 Darin Echo von Baumgarten: „Eberhard exponiert seinen Baumgarten“. Vergl. Vorarbeiten usw. zit. Ausgabe und Bd. S.365 man übersah, versichert Kant, die wahre Natur dieser Urteile und ihres Unterschieds von den analytischen Urteilen, wenn man das Problem des Apriori darstellt „in Ausdrücken der reinen Logik; diese Wissenschaft muss sich tatsächlich überhaupt nicht beschäftigen mit der Möglichkeit der Erkenntnis bezüglich ihres Inhalts, sondern nur bezüglich ihrer Form, soweit es sich handelt um eine diskursive Erkenntnis: jede Untersuchung über die Erkenntnis a priori von Objekten muss exklusiv der transzendentalen Philosophie2 reserviert (vorbehalten) werden.“ 2 Entdeckung, usw. Ak. Bd. VIII, S.344 – Leibniz, sagt Kant irgendwo in den Fortschritten, hat geglaubt, Metaphysik zu machen, während er nur Logik machte Wir denken, dass die Lehre der Identität, erste Basis der Mathesis universalis von Leibniz, wirklich, selbst in der Intention ihres Autors und nicht nur durch ein Missverstehn von ihm, den Rahmen einer rein formalen Logik überstieg3 : Kant wird den Leibnitzianismus vermittelt durch seine wolffsche4 Deformation gesehen haben. 3 Wenigstens von dem Moment ab, wo Leibniz in seiner universalen Mathematik den „Kalkül des Unendlichen“ einführte; er hielt sich zuvor an die unmittelbarere Nachbarschaft der logischen Arithmetik von Hobbes, ohne jedoch den extremen Nominalismus von diesem zu teilen. 44 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. 4 Man wird sich erinnern, dass Wolff glaubte, die Lehre von Leibniz zu verbessern, indem er versuchte, das Prinzip vom hinreichenden Grund zurückzuführen auf das Kontradiktionsprinzip durch ein einfaches Spiel der Substitution von Begriffen. 59 Aber im Grunde hat er Recht, zu behaupten, dass die Logik des Urteils, bei Leibniz, Problemen ausgesetzt ist, die, später, reserviert sein werden für eine „transzendentale Philosophie“, sorgfältig unterschieden von der reinen formalen Logik; und er hatte nicht Unrecht zu vermuten, dass in der Zeit vor dieser (korrekten oder nicht korrekten) Spaltung der reinen Logik und des Transzendentalen, die absolute Universalität der Form der Identität den Ontologisten von vor der Kritik, als mit logischer Notwendigkeit eine gleiche Universalität der möglichen „Inhalte“ der Erkenntnis mit sich bringend erscheinen musste,. Besser informiert über die verschiedenen Aspekte des leibnitzschen Systems, werden wir heute leicht die noch zögernde, aber im Ganzen nicht allzu ungenaue Exegese zu Ende führen, die Kant die folgenden Beurteilungen inspirierte: wir begnügen uns, sie niederzuschreiben: „Dass Leibniz es für notwendig hielt, dem Kontradiktionsprinzip das des hinreichenden Grundes hinzuzufügen, im Glauben, dadurch sehr viel Licht über die Metaphysik zu werfen, könnte man nicht verstehen, wenn er unter [hinreichendem] Grund, eine analytische [Rechtfertigung] verstanden hätte, was darauf zurückkäme, trotzdem das Widespruchsprinzip als einziges Prinzip aufzustellen. Er wollte sagen, dass man überdies ein Prinzip von synthetischen Erkenntnissen a priori zulassen müsse, weil in Wirklichkeit irgendetwas sich als Prinzip der Synthese einmischt in der Bestimmung der Objekte; aber es ist ihm nicht gelungen, sich davon eine klare Idee zu bilden (nur er konnte sich dieses nicht deutlich machen)1 “ 1 60 Vorarbeiten usw., Ausgabe und Band zitiert (Ak, Bd XX) S.366 „Wahrscheinlich zielte Leibniz mit seinen zwei Prinzipien des Widespruchs und des hinreichenden Grundes auf nichts anderes ab, als auf die [fundamentale] Differenz zwischen analytischen Urteilen und synthetischen Urteilen a priori. Denn das erste dieser Prinzipien ist, in den affirmativen Sätzen, gerade das der Identität, [auf dem jede Analyse beruht]; was das zweite betrifft, es verlangt, außer den Begriffen [die den Satz bilden], noch ein anderes Fundament [dieses da]... Unter dem Namen des Prinzips des Grundes, wollte Leibniz wahrscheinlich das Prinzip bezeichnen, das ihm unbekannt blieb, nämlich das der synthetischen Urteile a priori (beachte, dass in einem Urteil, das was nicht aus den Begriffen abgeleitet ist kraft des Widerspruchsprinzips, woanders ein logisches Fundament haben muss; außerhalb der Begriffe gibt es nur die Intuition; siehe da, zweifellos, das von Leibniz an die Basis der Erkenntnisse a priori gesetzte, angeborene Element). Das 45 Buch I: Kritik und System Fundament (der Synthese a priori), er begreift es als ein Prinzip der Kontingenz, das heißt [ein Prinzip betreffend] die Phänomene; und er dachte folglich, dass die synthetischen Sätze a priori nur gelten für die Phänomene: Denn tatsächlich sind alle Phänomene als solche kontingent und sie allein können das Objekt synthetischer Urteile sein.2 “ 2 zit. Op. S.376. Vergl. bei Leibniz, die Theorie der „vérisimilitudes“ und des rationalen Fundaments der kontingenten Urteile Zwischen den Methoden der zwei Philosophen – wir sagen nicht zwischen ihren Schlussfolgerungen – tendiert der Abstand sich in singulärer Weise zu vermindern. Zum Abschluss wollen wir schließlich hervorheben, gegen 1791 in den ersten Briefwechseln zwischen Kant und J.S.Beck, seinem alten Schüler, ein neues Anzeichen von wieder auflebendem Interesse, das der alternde Meister an systematischen Aspekten bei Leibniz nahm. Am 9. Mai 17911 beglückwünscht er Beck zu den von diesem der Universität von Halle eingereichten Dissertation beigefügten Thesen: Sie bezeugen, sagt er, eine ausgezeichnetes Verständnis der kritischen Philosophie. 1 Kant an J.S.Beck, 9. V. 1791 (Briefwechsel, II2) Ak„ Bd. XI S.256 Mehrere dieser Thesen betreffen direkt die Fragen der Methode, die sich stellen im Grenzbereich des Kantismus und des Leibnitzianismus. Zum Beispiel die These I: „Logica pura est doctrina analytica [Die reine Logik ist eine analytische Lehre]“; die These III: „Mathesis est disciplina, quae conceptuum constructione conficitur [Mathematik ist eine Distiplin, die durch Konstruktion von Begriffen zustande gebracht wird]“; die These IV: „Analysis finitorum et infinitorum non est scientia analytica [Analysis des Endlichen und Unendlichen ist keine analytische Wissenschaft]“; die These VI: „In dijudicanda quaestione utrum metaphysica a Leibnitii tempore usque ad Kantium progressus fecerit, omnia in definitione metaphysices posita esse videntur [Um die Frage zu entscheiden, ob die Metaphysik von Leibnizens Zeit bis zu Kant Fortschritte machte, scheint alles in die Definition der Metaphysik gelegt zu sein]“; die These X: „Synthetica et analytica unitas eandem originariae apperceptionis unitatem denotant2 [Die synthetische und analytische Einheit bezeichnen dieselbe Einheit der ursprünglichen Apperzeption]“ 2 61 Briefwechsel IV, Anmerkungen, Ak. Bd. XIII S.298-299 Diese Thesen formulieren den Gesichtspunkt von Kant, aber mit dem Bemühen, würde man gern sagen, in engem Kontakt zu bleiben mit der Methodologie von Leibniz. Diese Besonderheit ist Kant nicht entgangen. Seinen früheren Schüler, einen guten Mathematiker, dazu bewegen wollend, die kritische Philosophie3 zu pflegen, schreibt er ihm am 27. September 1791: 3 Diese Bemühungen werden zu den drei Bänden der Erläuterungen von Beck führen. Wir werden darüber weiter unten zu sprechen kommen. 46 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. „... Ich verliere nicht ganz die Hoffnung, dass, wenn das Studium [der Kritik] nicht unmittelbar die Mathematik klären kann mit einem neuen Licht, diese letztere dafür durch tiefere Reflexion über ihre eigenen Methoden und über ihre heuristischen Begriffe ...nicht entdecken könnte, für die Kritik der reinen Vernunft und für deren Triangulation, neue Perspektiven, ja sogar der Vernunft neue Mittel der Erklärung ihrer abstrakten Begriffe verschaffen oder sogar – wer weiß? – etwas Ähnliches wie die ars universalis characteristica combinatoria von Leibniz4 “ 4 Kant an I. S. Beck, 27. IX. 1791 (Briefwechsel, II2) Ak. Bd.XI S.290 2. Die kantsche Idee des „Systems“ Die fortschreitende Verwirklichung der systematischen Einheit in der Lehre Kants beschäftigt uns weiterhin. Für den Augenblick möchten wir uns nur Rechenschaft geben von der Idee, die er sich theoretisch machte von dieser Einheit und den Forderungen, die sie auferlegt. Noch als Anfänger hat er in der Schule des Wolffianismus die Notwendigkeit gelernt, die Kohärenz der Philosophie durch strenge formale Verkettungen sicherzustellen. Er nahm zuerst die Hindernisse, die ihm bald die Umsetzung dieses Ideals in die Praxis so mühsam machen werden, nicht wahr. Wir sind im Heft III der „vorkritischen“ Entwicklung seines Denkens Schritt für Schritt gefolgt und haben durch die Tatsache selbst die ersten Schwankungen seiner Methode festgehalten. Wenn er seit 1755 beginnt, sich von Wolff frei zu machen, ist das nichtsdestoweniger unter Berufung auf das fundamentale Prinzip des leibniz-wollfschen Rationalismus, die Identität1 . 1 62 Siehe Heft III, 3.Aufl.,S. 32-35 (1.Aufl., S. 16-18). 1762-1763 muss er sich auseinandersetzen mit den „unbeweisbaren Urteilen“ (unerweisliche Urteile). das heißt mit den nicht analytischen Wahrheiten, nicht reduzierbar auf die Identität2 . 2 Siehe Heft III, 3.Aufl.,S. 35 (1.Aufl., S. 19). Danach entdeckt er die Unmöglichkeit, auf die Metaphysik die konstruktive, analytico-synthetische Methode der Mathematiker, zu übertragen: die Metaphysik muss von der Erfahrung ausgehen.3 3 Siehe Heft III, 3.Aufl.,S. 38-39 (1.Aufl., S. 21-22). 1766 erschien ihm die legitime Verwendung der menschlichen Vernunft noch strenger begrenzt durch die experimentellen Gegebenheiten4 4 Siehe Heft III, 3.Aufl.,S. 42-44 (1.Aufl., S. 24-26). Die Dissertation von 1770 bringt ihn zurück zur Metaphysik aber zum Preis einer Verwerfung, eines Bruchs zwischen Sensibilität und Verstand5 . 5 Siehe Heft III, 3.Aufl.,S. 66 ff. (1.Aufl., S. 44ff.). 47 Buch I: Kritik und System Von nun an wird sein hatnäckiges Streben nach der systematischen Einheit des Wissens im Schach gehalten durch die Heterogenität der zwei Quellen unserer Erkenntnisse. Und schon, wenigstens seit 1766 nimmt in seinem Geist ein neuer Gegensatz Gestalt an: der der theoretischen Vernunft und der praktischen Vernunft, alle beide autonom6 . 6 Siehe Heft III, 3.Aufl.,S. 42, 45-46 (1.Aufl., S. 24, 27) Trotzdem setzt er die radikale Einheit der Fakultäten des Geistes nicht in Zweifel. In dieser Überzeugung, die er an mehreren Stellen ausdrückt, wurde er zur Not bestätigt durch die Psychologie von Tetens (Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung. Leipzig 1777), wo er nicht nur die verschiedenen spekulativen Fakultäten sondern selbst die aktiven Fakultäten auf eine gemeinsame Quelle zurückgeführt fand,. Am 20. August 17777 , vor oder nach seinem ersten Kontakt mit Tetens, das wissen wir nicht, schrieb er an Markus Herz diese Zeilen, die seine intellektuelle Hauptsorge genau in dem Moment verraten, wo er sich imstande glaubte, demnächst die Kritik der reinen Vernunft zu vollenden. 7 Kant an M.Herz, 20.VIII,1777 (Briefwechsel, I 2), Ak. Bd. X S.213 „Seit der Zeit unserer Trennung voneinander haben meine, zuerst nur lückenhaften, Forschungen über jede Art philosophischer Themen die Gestalt eines Systems angenommen und haben mich nach und nach zu dieser Idee von allem gebracht, ohne die es unmöglich ist, über die Geltung und den gegenseitigen Einfluss der Teile zu urteilen. All meinen Versuchen, meine Arbeiten in diesem Sinn weiterzubringen, widersetzt sich leider wie ein Hindernis mitten auf dem Weg, das Werk, das ich die Kritik der reinen Vernunft nenne: seine Vollendung beschäftigt mich gegenwärtig ausschließlich und ich hoffe, diesen Winter damit vollständig zu Ende zu kommen8 “ 63 8 Diese Hoffnung, wie man weiß, konnte sich nicht vor 1781 verwirklichen Die Kritik der reinen Vernunft (1. und 2. Auflage) kommt in mehreren Anläufen1 auf die Idee des „Systems“ in der Philosophie. Die Sichtweisen Kants zu diesem Thema haben nichts sehr originelles; wir halten es trotzdem für nützlich, hier irgendwie daran zu erinnern, um bei dem kritischen Philosophen die Fortdauer einer Voreingenommenheit zu unterstreichen, die sich während der konfusen Jahre des Opus posthumum noch akzentuieren werden. 1 Siehe z.B. KRV, A, Vorrede S.XX-XXI; B, Vorrede S.XXII-XXIV; Einleitung, A S. 11-13; B S. 25-26; Methodenlehre, III, A, S.832-848; B, S. 860-875 Das Kapitel III der Methodologie hat den Titel: „Architektonik der reinen Vernunft“. „Ich verstehe unter Architektonik die Kunst der Systeme. Wie die systematische Einheit das ist, was das vulgäre Wissen in Wis- 48 Kapitel 2: Die Idee eines „Systems“ der Vernunft. senschaft umwandelt, das heißt, das was ein einfaches Aggregat von Erkenntnissen zu einem System macht, ist die Architektonik also die Theorie von dem, was an Wissenschaftlichem in unserer Erkenntnis im allgemeinen ist2 “ 2 KRV B, S.860 „Nun aber verstehe ich unter System die Einheit der verschiedenen Erkenntnisse unter einer Idee. Diese Idee ist der rationale Begriff der Form eines Ganzen, insofern die Gesamtheit der gruppierten Elemente und die jeweilige Platzierung der Teile dabei a priori bestimmt sind. Der rationale wissenschaftliche Begriff enthält also den Zweck und die Form von allem, was mit ihm übereinstimmt3 “ 3 Ebenda „Die Idee braucht, um verwirklicht zu werden, ein Schema, das heißt, eine wesentliche und geordnete Mannigfaltigkeit der Teile, die a priori bestimmt sind nach dem Prinzip des Zwecks4 “ 4 64 zit. Op. S.861 Hören wir nicht in der folgenden Bemerkung ein Echo der Erfahrungen des Forschers selbst: „Es ist unerfreulich, dass das nur, nachdem man viel Zeit verbracht hat mit der Suche einer tief in uns verborgenen Idee, nachdem man zusammenhanglos viele auf diese Idee bezogene Erkenntnisse, wie genau so viele Materielien, zusammengetragen hat, und selbst nachdem man sie mehrfach technisch angeordnet hat, dass es endlich möglich sei, eines Tages die Idee klarer zu sehen und architektonisch eine Gesamtheit zu skizzieren, entsprechend den Zielen der Vernunft5 “ 5 zit.Op. Link zu S.860-869 S.862-863 [original Kant:] Es ist schlimm, daß nur allererst, nachdem wir lange Zeit, nach Anweisung einer in uns versteckt liegenden Idee, rhapsodistisch viele dahin sich beziehenden Erkenntnisse, als Bauzeug, gesammelt, ja gar lange Zeiten hindurch sie technisch zusammengesetzt haben, es uns dann allererst möglich ist, die Idee in hellerem Lichte zu erblicken, und ein Ganzes nach den Zwecken der Vernunft architektonisch zu entwerfen. Kant fährt weiter, indem er diese Begriffe auf die Philosophie anwendet: „Das System der gesamten philosophischen Erkenntnis ist die Philosophie1 “ 1 zit. OP. S.866 „Es gibt einen rein schulischen [scholastischen] Begriff der Philosophie, nämlich der eines Systems der Erkenntnis, die nur gesucht wird als Wissenschaft, ohne dass man als Ziel irgendetwas hat, was mehr ist als die systematische Einheit dieses Wissens, und folglich die logische Vollkommenheit der Erkenntnis. Aber es gibt auch 49 Buch I: Kritik und System noch [von der Philosophie] einen kosmischen Begriff2 (conceptus cosmicus)“ 2 Der conceptus cosmicus (“Weltbegriff“), von dem Kant spricht, hat nichts von einem „kosmologischen“ Begriff. Das ist, wie es eine Bemerkung auf S.868 sagt, ein Begriff von universellem Interesse, ein Begriff, der niemand unbeteiligt sein lassen kann. Die Begriffe der Schule (“Schulbegriffe“) geben Antwort auf das Interesse partikulärer Gruppen. Eine analoge Unterscheidung, Erbe von Wolff, wird gemacht zwischen Philosophie, betrachtet als „Weltweisheit“ und der Philosophie der Schule. Wir werden sehen, dass das von Kant in seinen letzten Jahren verfolgte Ideal (siehe weiter unten das „Opus postumum“) mehr als je eine integrale Weltweisheit, die alle spekulativen und praktischen Interessen des Menschen als solchem umfassen. der immer darunter liegend unter dieser Bezeichnung war, vor allem wenn er in irgendeiner Weise personifiziert wurde und typisch repräsentiert wurde in dem Ideal des Philosophen.Für diesen Gesichtspunkt ist die Philosophie die Wissenschaft der Beziehung jeder Erkenntnis zu den wesentlichen Zielen der menschlichen Vernunft (teleologia rationis humanae), und der Philosoph ist nicht mehr nur ein Handwerker im Dienst der Vernunft sondern der Gesetzgeber der menschlichen Vernunft3 “ 3 KRV B S.866-867 „Der Mathematiker, der Physiker, der Logiker, was auch immer Bemerkenswertes ihr Fortschritt sein konnte, die einen in der rationalen Erkenntnis im allgemeinen, die anderen mehr im Besonderen in der philosophischen Erkenntnis, sind immer nur Virtuosen der Vernunft. Es gibt aber noch, [über ihnen], ein Meister im Ideal, der sie alle verwendet, indem er sich ihrer bedient als Instrumenten um den wesentlichen Zielen der menschlichen Vernunft zu helfen [dienen]. Dieser Meister allein [Gott] müsste Philosoph genannt werden; aber da man ihm selbst nirgends begegnet, während die Idee seiner Gesetzgebung sich überall in jeder menschlichen Vernunft findet, werden wir uns darauf beschränken, diese Idee zu betrachten, um mit mehr Präzision zu bestimmen, welche Art von systematischer Einheit die Philosophie, im kosmischen Sinn dieses Ausdrucks vorschreibt unter dem Gesichtspunkt der Ziele. Die wesentlichen Ziele sind dafür noch gar nicht die höchsten Ziele. Die perfekte systematische Einheit der Vernunft umfasst nur ein einziges höchstes Ziel. Auch ein wesentliches Ziel ist immer entweder das letzte Ziel oder irgendein untergeordnetes Ziel, notwendig als Mittel zur Erreichung des Endziels. Dieses Endziel ist nichts anderes als die totale Bestimmung des Menschen, und die Philosophie, die das behandelt, nennt sich die Moral. Wegen dieser Vorrangstellung der Moral-Philosophie vor jeder anderen Erwerbung der Vernunft bezeichneten die Alten auch, ja sogar hauptsächlich mit dem Namen des Philosophen den Moralisten1 “ 65 1 50 zit.Op.S.867-868 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 „die Gesetzgebung der menschlichen Vernunft (die Philosophie) hat zwei Objekte: Die Natur und die Freiheit; und folglich umfasst sie das physische Gesetz ebenso wie das moralische Gesetz, zuerst in zwei partikulären Systemen und dann schließlich in einem einzigen philosophischen System2 “ 2 66 zit.Op. S.868 Das „System“ der Philosophie ist also erst komplett in dem Moment, wo sie unter einer einzigen dominierenden Idee nicht nur die verschiedenen Niveaus der spekulativen Erkenntnis organisieren wird, sondern selbst die Beziehung der theoretischen Vernunft und der praktischen Vernunft3 . In welchem Maße nähert sich die kantsche Philosophie diesem Ideal der systematischen Einheit, die3 sie sich vornimmt? Die Kritik der Urteilskraft unterstreicht sehr die Idee des „Systems“, verstanden unter den zwei Aspekten der Vernunft. Siehe zum Beispiel Einleitung, IX (Ak, Bd.V S.LIII-LVII). Man darf nicht vergessen, dass, im Bereich der spekulativen Vernunft die perfekte systematische Einheit nach Kant, weder eine Forderung der Objekte noch eine Forderung des Verstandes als Fakultät der objektiven Erkenntnis ist, sondern nur die ideale Grenze eines subjektiven Strebens der Vernunft, als der Organisatorin der Begriffe: siehe z.B. KRV A, S.645-648 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 67 Lange vor der Veröffentlichung der Kritik der reinen Vernunft zwang die Ausarbeitung dieses Hauptwerks, das von seinem Autor als eine notwendige „Propädeutik“ für jede rationale Organisation des Wissens betrachtet wurde, Kant, die metaphysische Konstruktion aufzuschieben, die er sich zuerst vorgenommen hatte. Dann kamen die durch die erste Kritik hervorgerufenen Kontroversen; sie bewirkten die Herstellung der Prolegomena (1783). Bald darauf erweiterte sich, wie es normal war, das Feld der kritischen Untersuchungen von der spekulativen Vernunft auf die praktische Vernunft (1785, 1799) und auf die Gesamtheit der Fakultät zu urteilen (1790). Erst dann konnte sich, nachdem die Grundlagen „der zukünftigen Metaphysik“ gelegt waren, das erahnte Gebäude erheben. In Wahrheit kommt, seit der Periode der Kritiken, die metaphysische Konstruktion, so wie sie Kant verstand, in Gang1 mit den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft (1786). 1 1785 projektiert Kant, den Metaphysischen Anfangsgründen der Körperlehre einen Anhang betreffend die „(Anfangsgründe) der Seelenlehre“ hinzuzufügen. Siehe Brief an C.G.Schütz, 13. Sept. 1785, Ak, Bd. X (Briefwechsel, I2), S.406. Der versprochene Anhang erscheint nicht unter den Publikationen von 1786. 68 Aber das ist noch nichts anderes als nur eine Einleitung in die wahre „Metaphysik der Natur“, die selbst nie veröffentlicht werden wird. Die Metaphysik der Sitten wird zum Teil die Ausführung des dreiteiligen Programms sicherstellen, 51 Buch I: Kritik und System das seit 1772 entworfen (geplant) ist: Propädeutik (Kritik), Metaphysik der Sitten, Metaphysik der Natur2 . 2 KRV, B, Methodologie, S.869 Man wird jedoch bemerken, dass in dem Maße, wie die eigentliche „Kritik“ sich detaillierte und nach und nach alle Bereiche der geistigen Tätigkeit umfasste, die Abgrenzung zwischen Propädeutik und System der Vernunft3 darauf abzielte, zu verschwinden. 3 Vgl. KRV A, S. 13-14; B S.27-28 Die Werke Kants, die ausdrücklich den Titel „Metaphysik“ tragen, können eher wie Anhänge oder Anwendungen der „Kritik“ erscheinen als wie Höhepunkte oder das wahre Ziel des kantschen Werks: das heißt, dass die „Kritik“ schon „die fundamentalen Begriffe des Systems4 “ enthält, wenn nicht gar selbst etwas mehr. 4 Ebenda Wir möchten in der Lehre der Kritik von 1781 bis 1793 einige Anzeichen einer fortdauernden Bemühung nach einer immer engeren systematischen Einheit hervorheben. §1.–„Man tut recht daran, vom Feind zu lernen“: die ersten Widersacher. 69 Die Entwicklung der kantschen Philosophie, seit 1781 kann unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten ins Auge gefasst werden: dem Gesichtspunkt der Geschichte und dem der Logik. Einerseits gibt es tatsächlich kaum Fortschritte oder bemerkenswerte Verbesserungen des Systems der Kritik von Kant, die nicht als gelegentlich erscheinen könnten, ich möchte sagen, die nicht den Anschein einer Antwort haben, wenigstens indirekt, auf irgendeinen kurz zuvor von einem Freund oder von einem Gegner formulierten Einwand. Andererseits gehorcht die Entwicklung der Lehre der Kritik in ihren großen Zügen wirklich einem inneren Gesetz der Organisation, bei weitem unabhängig von historischen Kontingenzen (Zufällen). Diese zwei Gesichtspunkte schließen sich einander nicht aus. Häufig zeigen die gegen Kant eingewandten Objektionen in seinen Werken wahrhafte Dunkelheiten, Lücken, methodische Bedenken, Zweideutigkeiten der Lehre oder des Ausdrucks, Mängel an systematischer Einheit, kurz keineswegs imaginäre Unvollkommenheiten, die der Philosoph, sich selbst überlassen, nach und nach hätte korrigieren können, kraft gerade seiner philosophischen Intuition, die seine erste Redaktion inspiriert hatte. Gewöhnlich haben diese Einwände eine Entwicklung beschleunigt oder selbst manchmal ausgerichtet, die auch ohne sie zustande kommen konnte. Für jemand, der sich bemüht, das Denken Kants genau zu verstehen1 ist ihr Interesse trotzdem unbezweifelt. 52 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 1 Wir haben zu diesem Thema eine detaillierte Dokumentation gesammelt, die dem Brand vom Mai 1940 zum Opfer gefallen ist [siehe Vorwort der Herausgeber]. In Ermangelung der Möglichkeit, sie zu rekonstruieren, begnügen wir uns damit, in wenigen Worten an die hauptsächlichen Einwände zu erinnern, auf die Kant in seinen philosophischen Schriften von 1781 bis etwa 1793 reagierte. Für eine vollständigere Erklärung dieser Einwände, siehe vor allem: J.E. Erdmann, Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neueren Philosophie, III. Abteilung, Bd.1 (Leipzig 1848), Faksimile Neudruck, Stuttgart, 1931, §§12-21. – Benno Erdmann, Kant’s Kritizismus in der ersten und in der zweiten Auflage der KRV, Leipzig, 1878. – H.J. De Vleeschauwer, La déduction transcendentale dans l’oevres de Kant, tomes II et III, Anvers et Paris, 1936-1937. Siehe die sehr vollständigen alphabetischen Tabellen am Ende von tome III- – H. Vaihinger, Commentar, Bd.I, S.16, 19-20, 59-66; Bd. II, S. 531-540. Siehe unter anderem den Hinweis auf die Kontroversen im Textkommentar selbst, auf den verschiedenen Seiten der zwei Vorreden A und B der Einleitung und der transzendentalen Ästhetik, wo allgemeine Probleme der Kritik berührt werden. Zu bemerken sind insbesondere die „Excursus“ des Band I (S.209-292, 384-450) und von Band II (S. 35-55. 46-88, 89-111, 142-151, 399-410, 436-441). – Für alles, was das moralische Problem bei Kant, bei seinen Zeitgenossen und bei seinen Kommentatoren betrifft, muss man erinnern an die reichhaltigen Hinweise, verteilt im Text und in den Anmerkungen eines Werks, das klassisch bleibt: V. Delbos, La philosophie pratique de Kant, Paris, 1905 (2.Aufl. 1921) 70 Die Kritik der reinen Vernunft fand eine sehr reservierte Aufnahme: nichts von einem Erfolg, mit Recht von einem Autor erhofft, der das Bewusstsein vom außerordentlichen Wert seines Werkes hatte. Die Neuheit davon brachte aus der Fassung, seine Dunkelheit stieß ab. Wohlwollend oder nicht, der Großteil der abgegebenen Beurteilungen bezeugen vor allem ein tiefes Nicht-Verstehen. Das ging soweit, dass Kant beinahe sofort das Projekt einer kürzeren und leichter zugänglichen Abhandlung hegte. Man kann in allen Geschichtsbüchern der modernen Philosophie den Bericht eines Vorfalls lesen, der eine lange Ära der Kontroversen eröffnete. Die Göttinger gelehrten Anzeigen haben im Januar 1782 eine Rezension des Buchs von Kant veröffentlicht, geschrieben vom wolfianisierenden Philosophen Garve, aber gekürzt und retuschiert durch Feder, Professor in Göttingen, Direktor der Zeitschrift. Dieser sehr ablehnende Rechenschaftsbericht beruhte auf den merkwürdigsten Missverständnissen. Kant war heftig darüber verärgert, dass ihm, trotz seiner Affirmation der „Dinge an sich1 “, ein Idealismus ähnlich dem von Berkeley vorgeworfen wird. Es ist hauptsächlich, um diesen Vorwurf des Idealismus zurückzuweisen und in der Hoffnung, viel klarer das wesentliche der Kritik hervortreten zu lassen, dass die Prolegomena (1783) verfasst wurden. Die Unterschiede zwischen diesen und der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft betreffen weniger die Grundlagen als die Form2 ; insbesondere ist die Existenz des „Dings an sich“ von neuem affirmiert, aber dieses Mal indem er es ausdrücklicher verknüpft mit dem Begriff des Phänomens (der Erscheinung)3 1 In der KRV, Ausgabe A und B (vgl. Heft III, Buch IV, Kapitel 1). Siehe die Bemerkungen von Kant im Anhang der Prolegomena (Ak. Bd. IV, vor allem S. 373-375) bei Gelegenheit der Buchbesprechung von Gare . 2 Siehe die Einleitung von B. Erdmann zu seiner Ausgabe der Prolegomena (Leipzig, 1877) 3 Zum Beispiel: Prolegomena §13, Anmerkung II, Ak. Bd.IV, S.289. – „Kann man dieses wohl Idealismus nennen? Es ist ja gerade das Gegenteil davon“ betont der missverstandene Realist (ebenda). Eine nicht weniger kategorische Erklärung machte er 1785 in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ak, Bd.IV, S.451): Vaihinger unterstreicht gerade dessen vollkommene Klarheit (Kommentar, II, S. 21) 53 Buch I: Kritik und System 71 Seltsame Sache, der Vorwurf des Idealismus, über den sich Kant als eine Verleumdung empörte, wird ihn noch lange nach dem Protest in den Prolegomena verfolgen. Tatsächlich genügte es nicht, „Dinge an sich“ zu affirmieren, es war auch nötig, sich nicht des Rechts beraubt zu haben, das zu tun. Für viele musste die Frage des Dings an sich weniger einfach erscheinen als für den Protestierenden. Zum Beispiel in einer Besprechung der Prolegomena 1784 verwechselt Pistorius auf der ganzen Linie Schein (trügerische Erscheinung) und Erscheinung (Phänomen), und überträgt auf das Niveau der inneren Sinne und der Erkenntnis des Ich das Bedenken selbst, das Garve und Feder von der „Phänomenalität“ der äußeren Sinne abgelenkt hat. Pistorius erhob andererseits andere Schwierigkeiten bezogen auf die Deduktion der Kategorien. Im selben Jahr findet Tiedemann, ein Eklektiker mit skeptischer Einstelllung, im Gegenteil, den kantschen Idealismus noch zu dogmatisch und vergreift sich an der Unterscheidung zwischen analytischen Urteilen und synthetischen Urteilen a priori. Eine analoge Kritik wird 1799 formuliert von dem berliner Mediziner G.S. Selle, der sich zu einer empiristischen Philosophie bekennt. Ein anderer Mediziner, dessen Name bei den Psychologen nicht ganz unbekannt ist, E. Platner, taxiert die Kritik im ersten Faszikel (2. Aufl., 1784) seiner Philosophischen Aphorismen des verkappten4 „Dogmatismus“, aber in seinem Kurs an der Universität von Leipzig erklärt er ganz im Gegenteil übertrieben den „Skeptizismus“ der Kantianer. 4 Platner hat die Einschätzung nicht aufrecherhalten. Vergl. Brief von Schütz an Kant, 18. II. 1785 (Ak, Bd. X, Briefwechsel I2, S.399) 72 Siehe da also, Kant zwischen zwei Feuer geraten. Wenn seine Einstellung ihn so divergierenden Vorwürfen aussetzte, war das vielleicht nicht allein, weil sie die Mitte zwischen entgegengesetzten Tendenzen einnahm: Später werden von Jacobi die zueinander im Gegensatz stehenden Einwände des Idealismus und des Dogmatismus geschickt untereinander artikuliert als die zwei Zweige eines Dilemmas, in gleicher Weise verhängnisvoll für die Kritik. Immerhin, es ist nicht nur in den Augen von Platner, dass Kant als Skeptiker dasteht. Seit 1783 war unter der Hand eine Beurteilung von Hamann, seinem einstigen Schüler, der ihn (in einem Brief an Herder) „preußischen Hume“ nannte. im Umlauf. Musste für einen Leser der Prolegomena, wo Hume fast ebenso gelobt wird, wie ihm widersprochen wird, dieser geistreiche Scherz so übertrieben erscheinen? 1785 ließ Mendelssohn, ohne persönliche böse Absicht, gegen den kritischen Neuerer im Vorwort seiner Morgenstunden ein Wort vom Stapel, das gut ankam: „den alleszermalmenden Kant“. Reimar bedauert wiederum 1787 den „Skeptizismus“ der Kritik. Der herrschende Wolfianismus war in Deutschland eine Art Rationalismus des gesunden Menschenverstandes geworden, eine „Popularphilosophie“ vermischt mit Empirismus: von dieser Seite hatte Kant nicht viel Sympathie zu erwarten; zwei Professoren von Göttingen zeichneten sich gegen 1786-1787 54 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 durch ihre Feindseligkeit aus: C.Meiners, der den kantschen Idealismus mit der Sophistik vergleicht, und der einstige Verbündete von Garve, J.G. Feder, der, nachdem er die Kritik der reinen Vernunft näher studiert hatte, behielt seine Anklage des Skeptizismus bei. Bis nach 1790 erhoben sich noch lebhafte Kritiken aus der leibniz-wolfschen Gruppe: Flatt (Tübingen), Schwab (Stuttgart), Maass (Halle), Eberhard (Halle)1 verurteilen den Subjektivismus der transzendentalen Ästhetik, die Lehre der Kategorien, die Theorie des synthetischen Urteils a priori, die der Antinomien usw.. 1 Es ist dieser Eberhard, auf den Kant antwortet in seinem Artikel von 1790: „Über eine Entdeckung ... usw.“, von der wir weiter unten sprechen werden. An anderer Stelle wird der „skeptische Subjektivismus“ von Kant im Namen der Moral und der Religion bekämpft, sowohl durch den Katholiken Benedikt Stattler (in seinem Anti-Kant, München 1788), als auch durch den Gründer des „Ordens der Erleuchteten“, Adam Weishaupt (1788 und folgende), und durch andere. Die Einwände kamen auch von Philosophen, die durchaus nicht systematisch gegen den Kantismus waren. Der beachtlichste war J. A. H. Ulrich, Professor in Jena, dessen Institutiones logicae et metaphysicae (Jena 1785), Kant vorgelegt in einem vollkommen höflichen Brief2 , adoptierte einen Teil der Positionen von ihm und weckte die Hoffnung einer vollständigeren Zustimmung. 2 73 Brief von Ulrich an Kant, 21, IV. 1785 (Ak. Bd.X, Briefwechsel I2, S.402) Zufällige Umstände verhinderten dieses Einverständnis. Man kann glauben, dass der Rückzug, auf den sich Ulrich bald darauf zurückzog, als tieferen Grund weniger persönliche Empfindlichkeiten hatte, als vielmehr ein anfängliches Missverständnis über den wahren Sinn des kritischen Idealismus, besonders über den notwendigen Rückgriff auf die Erfahrung als Prinzip der Begrenzung der Realgeltung der Kategorien: Ulrich hatte die „transzendentale Deduktion“ überhaupt nicht begriffen. Über J.F. Abel, Professor in Tübingen, mehr ein Sympatisant als ein Gegner, schreibt Kant selbst: „wenn der erstere [Feder] alle Erkenntnis a priori1 verwirft, will der zweite [Abel] eine Erkenntnis, die eine mittlere Stellung einnimmt zwischen der empirischen Erkenntnis und der Erkenntnis a priori2 “. 1 Feder konzipierte das Apriori nur im psychologischen Sinn: der logische Begriff des Transzendentalen entging ihm. 2 Brief Kants an Schütz, 25. VI. 1787 (Ak., Bd.X, Briefwechsel I2, S.490) J. H. Abicht, Professor in Erlangen, kann schon als Kantianer gelten; seine Vorbehalte erstrecken sich auf die Theodizee (1788): Er lässt nicht gelten, dass das moralische Argument der einzige Beweis der Existenz Gottes ist. Unter seinen Freunden und treuesten Anhängern, musste Kant hier und da auch ein Missverständnis oder eine Meinungsverschiedenheit feststellen. Zum Beispiel bei K. C. E. Schmid (1786), der ein wenig zu sehr das kantsche Apriori den angeborenen Ideen annähert und nicht sieht, dass die Kategorien dem Urteil der Erfahrung mehr als eine subjektive Notwendigkeit verleihen 55 Buch I: Kritik und System können. oder auch bei Schütz (Professor in Jena wie der vorhergehende), der, in einer Rezension der Kritik 1785 die Schwierigkeit unterstrich, eine Konstruktion a priori des Raumes zu konzipieren, da sie eine „Bewegung a priori3 “ voraussetzen würde. Salomon Maimon, viel hartnäckiger als Schütz, wird später (1790, 1794) dieselbe Bemerkung machen. 3 74 Wir werden auf diesen Punkt zurückkommen. Vgl. Vaihinger, Kommentar, II, S. 438-439 Eine Sonderstellung in der Parade der Gegner kommt den drei originellen Denkern zu, die man die „Philosophen der Gläubigkeit“ (Glaubensphilosophen) genannt hat: Hamann, Herder, Jacobi. Alle drei mehr oder weniger hitzköpfig, wie es in seiner Art der junge Fichte sein wird, hatten sie, in den Wirbeln der Vorromantik – des „Sturm und Drang“, dieser leidenschaftlichen Reaktion, mehr litterarisch als philosophisch gegen den starren Klassizismus – kaum etwas Gemeinsames mit Kant, höchstens ein gleiches Abstand-Nehmen von den Beschränktheiten des Empirismus und von der konzeptuellen Idololatrie der Aufklärung. Hamann (1730-1788), der „Magier des Nordens“, ganz das Gegenteil eines systematischen Geistes, hatte sich in Königsberg angesiedelt und unterhielt mir Kant gute und häufige Beziehungen. Er pflichtete dem letzteren bei, die Synthese der Sinneswahrnehmung und des Verstandes zu versuchen, warf ihm aber vor, sich mit dieser unvollkommenen Einheit zu Begnügen, ohne bis zur einzigen Wurzel der beiden Fakultäten hinabzusteigen. Er erhob sich im übrigen auf eine allgemeine Weise gegen die künstlichen Distinktionen der Schule – Sinne und Verstand, Materie und Form, Realismus und Idealismus – von denen eine bessere Erkenntnis der Psychologie der Sprache die Nichtigkeit und Eitelkeit aufscheinen lassen würde. Herder (1744-1803), Schüler von Kant von 1762 bis 1764, danach sehr engagiert in der Bewegung „Sturm und Drang“, blieb lange in herzlichen Verhältnissen zu seinem alten Meister, ohne ihm jedoch in seiner kritischen Entwicklung zu folgen. Zwischen dem Schüler, begeistert vom historischen Empirismus, und dem Meister, der sehr viel mehr dem rationalistischen Geist treu war, unterstrichen sich die intellektuellen Gegensätze in dem Maße, wie die persönlichen Arbeiten des einen und des anderen immer mehr divergierten. Die nicht signierte Besprechung, die Kant im Januar 1785 erscheinen ließ, des ersten Teils der Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (Riga, 1784) von Herder, rief bei diesem eine lebhafte Unzufriedenheit hervor, die sich alsbald im zweiten Teil des Werks (1785) verriet. Aber es ist in der Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft (Band I von Verstand und Erfahrung, Leipzig, 1799), wo die vollständige Aufzählung der schon seit langem existierenden theoretischen Divergenzen zur Schau gestellt werden. Kant trennt nach der Meinung von Herder zu sehr die „Vernunft“ von den anderen Fakultäten des Menschen; er verkennt die notwendige Rolle der Sprache in der Ausarbeitung des Gedankens: Da die Sprache von der Erfahrung abhängt, ist eine syntheti- 56 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 75 sche Erkenntnis a priori radikal unmöglich. Raum und Zeit sind experimentelle Begriffe. Die kantsche Gegenüberstellung von Materie und Form, die Trennung von Sinneswahrnehmung und Verstand müssen überwunden werden. Jacobi (1743-1819), schon berühmt durch seine Briefe Über die Lehre des Spinoza (1785), schrieb 1787, in seinem Werkchen David Hume über den Glauben den häufig zitierten Satz, der seine Haltung dem kantschen Kritizismus gegenüber zusammenfasst: „Ohne die Voraussetzung [eines Dings an sich],kann ich nicht in dieses System eindringen, noch mit ihm darin bleiben1 “ Zwischen Kant und ihm, siehe2 hier die Haupt-Berührungs-Punkte: 1 Jacobis Werke, Bd. II, Leipzig 1815, S. 304 2 Nach J.E. Erdmann, op. oben zitiert, S.329 ff. 0 76 1 Der eine und der andere hat den Einfluss der englischen Empiristen erfahren vor allem von Hume: daher ihre Zurückhaltung bezüglich jedes diskursiven Beweises transzendenter Objekte und ihr Widerstand gegen den Rationalismus der Aufklärung. 20 Beim Fehlen einer Wissenschaft des Metasensiblen, macht der eine und der andere einen Platz für den Glauben. Aber hier beginnen die Divergenzen: 10 Vor den Dingen an sich scheint die kantsche Position für Jacobi inkohärent: die Prinzipien der Kritik führen logisch zum totalen Idealismus, gegen den Kant sich verteidigt. 20 Nach Jacobi kennt unsere Vernunft das Ding an sich durch einen notwendigen und unmittelbaren Akt des Glaubens. Kant lässt gelten, das ist wahr, die notwendige Geltung eines „praktischen Glaubens“, der als Gegenstand die Postulate der moralischen Verpflichtung hat. Aber diese „praktische“ Gläubigkeit, ohne „theoretische Bedeutung“, zwingt uns nur zu handeln „als ob“ ihr Objekt real wäre. Dagegen ist der Glaube von Jacobi eine direkte Zustimmung der theoretischen Vernunft zum transzendenten Objekt: Das ist ein Glaube, der uns nicht nur das, was sein soll, diktiert, sondern das was ist. Zusammenfassend: Wenn man die Einwände beiseite schiebt, die sich erstrecken auf partikuläre Punkte zum Beispiel auf die Existenz einer Kategorie der Reziprozität, stellen wir fest, dass diese ersten Kritiken, entstellt durch zu viele Missverständnisse, sich dennoch damit vertragen, im System von Kant die Schwäche der zwei hauptsächlichen Artikulationen zu verraten: a) die Beziehung der „Dinge an sich“ auf ein rezeptives Subjekt, das sie „treffen“; b) die Beziehung der Synthese a priori und der Kategorien zu Objekten – sowohl zu Objekten der Erfahrung als auch zu metempirischen Objekten. – Um die erste der zwei Beziehungen herum gravitieren die Vorwürfe des Idealismus und subsidiär die des Skeptizismus. Der ganze Kritizismus Kants ist tatsächlich aufgebaut auf dem Dualismus der Dinge an sich und des Subjekts. Entgeht die Affirmation der Dinge an sich der kritischen Reflexion? Ist sie damit, im Gegenteil, rechtfertigbar? Im ersten Fall: Wie kann sie sich legitimieren? Im zweiten Fall: wie ist sie zu versöhnen mit der Einschränkung der 57 Buch I: Kritik und System 77 Kategorien auf Phänomene? In den beiden Fällen, führt sie nicht auf allen Stufen der Erkenntnis einen fremdartigen Faktor ein, irrational, undurchdringlich für die kritische Deduktion? Und dieses nicht resorbierbare Element, spielt es eine logische Rolle, entweder als Term oder wenigstens als äußerlicher Orientierungspunkt in der “Beziehung zum Objekt“ (Beziehung zum Gegenstand), die jedes Urteil einschließt? Wenn Ja, ist das nicht die Wiedereröffnung der Aporien des vorkritischen Realismus? Wenn Nein, dann siehe da, so scheint es, sind wir Gefangene des extremsten Subjektivismus: die Erscheinung, unmittelbarer Reflex der „Dinge an sich“ in einem Subjekt, wird ein Schein, ein inneres Bild, das vielleicht nur sich selbst repräsentiert? Um die zweite Beziehung herum, die oben angedeutet ist, die der Synthese a priori und der Kategorien zu den Objekten, gruppieren sich die polemischen Argumente, die danach streben, Kant zurückzuführen entweder auf den Empirismus von Hume (indem wir die logische Geltung der Synthese a priori anzweifeln), oder auf die transzendente Metaphysik von Leibniz (indem wir verweigern, die synthetischen Urteile a priori zu unterscheiden von den analytischen Urteilen, wenigstens bezüglich der objektiven Geltung der einen und der anderen). Diese erste Unklarheit der Einwände gegen die Kritik kommt im Grunde darauf zurück, dort in mehreren Punkten einen Mangel an systematischer Einheit zu verraten. Mangel an Einheit, die in der Nachfolge von Reinhold 1789 und in den folgenden Jahren die Gegner von Kant mehr und mehr evident machen werden – und die auszugleichen, die „hyperkritischen Freunde“ des Philosophen sich mehr oder weniger glücklich anstrengen werden. – Bevor wir diese zweite Welle von Einwänden betrachten, wollen wir sehen, wie von 1781 bis 1793 ungefähr, trotz Schwankungen und Wiederholungen das Denken Kants, verwirrt und angestachelt zugleich durch die erfahrenen Einsprüche, die ersten Phasen einer Entwicklung durchmacht, die sie annähern muss an die perfekte systematische Einheit, angepriesen in der Methodologie. §2.– Schwankungen in der Lehre? 1˚ Analyse und Synthese Die Vorgeschichte der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft 1 1 Wir haben sie dargelegt im Heft III, Buch I macht das doppelte Ziel evident, das seine Komposition inspirierte und nicht aufhörte, das Denken von Kant zu beherrschen: eine kritische Absicht im Dienst einer systematischen Absicht. Genauer, die Kritik musste in der Absicht ihres Autors nicht nur die für eine Metaphysik oder ein „System der Vernunft“ unerlässliche „Propädeutik“ konstituieren, sondern schon die grundlegenden Elemente des Systems organisieren. 58 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 Dieses doppelte Ziel lässt sich kaum konzipieren ohne eine ebensolche Verdopplung der Methoden. Tatsächlich ist eine „Kritik“ im streng logischen Sinn, wie sie Kant verstand, an sich regressiv und analytisch. Nun aber kann die Analyse, da sie ausgeht von einem formalen „Ganzen“ und sich darauf festlegt, statisch genannt werden. Ein „System“ dagegen baut sich durch Synthese auf, und die Synthese hat die Tendenz, ein formales „Ganzes“ zu konstituieren und ist so dynamisch. Die Zweiheit der Methoden erweist sich als ein Gegensatz von Methoden. 78 Bei Leibniz, das ist wahr, vereinigen sich Synthese und Analyse in ihrem Höhepunkt, der Unendlichkeit. Die Synthese gründet mit Recht auf der perfekten Identität, ihrem letzten Grund; das analytische Prinzip beherrschte uneingeschränkt das Zusammentreffen der ganzen logischen Ordnung und der ganzen realen Ordnung. Bei Kant bleibt das analytische Prinzip – Identitätsprinzip oder Kontradiktionsprinzip – das erklärte Instrument des kritischen Beweises. Aber wenn es auch seine extensive Universalität behält als formale Regel der Urteile, so hat es doch diese unbegrenzte virtuelle Inhaltlichkeit verloren, diese Forderung absoluter Fülle, die nach Leibniz die Realität eines transzendenten „Ortes“ der Wesenheiten bezeichnete: Analyse und Synthese begegnen sich nicht mehr in einem gemeinsamen Höhepunkt, wo sich ihr Gegensatz auslöscht. Nun aber, wenn man die Kritik der reinen Vernunft (Ausgabe A, 1781) so nimmt, wie sie ist, nicht so wie man sich vorstellt, dass sie hätte sein können oder sein müssen, zögert man nicht zu bemerken, dass die agnostischen Schlussfolgerungen dort auf einer eng statischen und formalen (analytischen) Konzeption der objektiven Erkenntnis beruhen, während das System der im selben Werk entworfenen transzendentalen Philosophie hauptsächlich dynamische (syntheische) Relationen ins Werk setzt, das heißt, im gegenwärtigen Fall, von Forderungen a priori, deren Punkt der Erfüllung sich im Unendlichen verflüchtigt, über jede formale Definition hinaus. Suchen wir unter den wesentlichen Themen der ersten Kritik irgendwelche Symptome eines latenten Konflikts zwischen den zwei Denkrichtungen zu erkennen, deren Koexistenz und Gegensatz wir gerade festgestellt haben. Kein Zweifel, dass dieser verborgene Konflikt nicht am Anfang vieler Unschlüssigkeiten und offensichtlicher Widersprüche gewesen ist, die die Historiker gerne in der Lehre von Kant unterstrichen haben. Zum Ausgleich dafür hat gerade dieser immer wieder aufkommende Konflikt die Lehre Kants vor einer voreiligen Festlegung bewahrt. Wiederholt, 1770, 1781, 1787, 1790 glaubte der Philosoph, das endgültige Gleichgewicht seines kritischen Werks erreicht zu haben. Jedes Mal sieht man ihn dennoch wieder anfangen auf eine vollständigere systematische Einheit hin. Unter den Schwankungen seines Denkens erahnt man eine dauernde Entwicklung, die nach 1790 offenkundig wird. 59 Buch I: Kritik und System 2˚ Die zwei Einleitungen der Kritik 79 Eine Kritik kann nicht vom absolut Leeren ausgehen. Sie erfordert nicht nur eine logische Norm, sondern auch einen Anfangsinhalt. Bei Kant schwankt der Ausgangspunkt und folglich auch der letzte Bezugspunkt des kritischen Beweises zwischen zwei Positionen, die er materiell für identisch hält, obwohl sie Perspektiven von ungleicher Weite eröffnen: die Möglichkeit der Erfahrung und die Möglichkeit des objektiven Gedankens. Die erste dieser beiden Positionen wird in der allgemeinen Einleitung der Kritik und in den Prolegomena durch die Feststellung der Tatsache dargestellt, nämlich der Existenz von „reinen Wissenschaften“ (Mathematik und reine Physik)1 . 1 Siehe Heft III, 3.Auflage S.105-107 Das kommt im Kontext darauf zurück, zu sagen: es existiert ein unwiderlegbares System von synthetischen Urteilen a priori, das die notwendige Armatur jeder Erfahrung2 konstituiert. 2 Diese Interpretation – die weniger klar aus der Ausgabe A der Kritik als aus der Ausgabe B und den Prolegomena hervorgeht – ist andererseits in ihren zwei Teilen umstritten (vgl. Vaihinger, Kommentar I, S. 384-404). Mehr als ein Kommentator glaubt, dass die Existenz von „reinen Wissenschaften“ hier nichts anderes bedeuten kann (und auf jeden Fall in der Ausgabe A nichts anderes bedeutet) als ihren Anspruch auf die logische Geltung wahrhafter Wissenschaften; andere glauben, nach unserer Meinung mit mehr Recht, dass diese logische Geltung selbst von Kant vorausgesetzt wird, was die Mathematik und die reine Physik betrifft. Was die Beziehung der zwei letzten Wissenschaften zur möglichen Erfahrung betrifft (das heißt bezüglich ihres objektiven Wertes im eigentlichen Sinn), ist das stillschweigend eingeschlossen in der Affirmation ihrer logischen Geltung als „Wissenschaften“. 80 Anderswo, zum Beispiel in der „Analytik der Prinzipien“, misst sich die Möglichkeit der objektiven Erkenntnis ausdrücklicher an der Möglichkeit der Erfahrung, betrachtet als vereinigte Totalität, als verbundene Gesamtheit von empirischen Synthesen: Diese Möglichkeit muss man evidenterweise nicht von einer „endlichen Gesamtheit“ verstehen, sondern von einer indefiniten Reihe von eventuellen Synthesen, unbegrenzte Reihe wie die Zeit und der Raum selbst. Die Möglichkeit der Erfahrung, in dieser Weise ins Auge gefasst, greift auf die Zukunft voraus, und kommt also zurück auf die Existenz von Bedingungen a priori, die universell die Synthese der Phänomene im Raum und in der Zeit sicherstellt. Dieser Gesichtspunkt ist nicht grundsätzlich verschieden vom Gesichtspunkt, der in der Einleitung adoptiert wurde. Ab sofort müssen in diesem Anfang des kritischen Unternehmens zwei Besonderheiten unterstrichen werden. Zuerst, dass die Existenz von „reinen Wissenschaften“, anerkannt als absolut universelle Bestimmungen a priori der Erfahrung, Bedingungen der Rechtmäßigkeit einschließt, und sich also nicht als eine reine Tatsache hinstellen lässt. Welche privilegierte Evidenz genießt sie? Schon S. Maimon, dieser scharfsinnige Bewunderer von Kant, hielt die primitive Basis der Kritik 3 nicht für unerschütterlich. 60 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 3 S.Maimon, Kritische Untersuchungen über den menschlichen Geist, Leipzig 1797. Siehe vor allem S. 134, S. 148 ff. – Diese Bemerkung war von Maimon seit 1790 formuliert worden in seinem Versuch über die transzendentale Philosophie, Leipzig. 81 Man könnte Kant leicht vorwerfen, dass er seinen Anfang nicht genügend absichert, wenn er nicht später, in der „transzendentalen Analytik“ von der Wurzel her das ganze Problem des Apriori und des Objekts wiederaufnehmen gemusst hätte. Schenken wir ihm Glauben bis dahin. An zweiter Stelle muss man bemerken, dass, wenn die Kritik als ersten Gang nur die Möglichkeit der Erfahrung hat und als logische Norm (entsprechend dem rationalistischen Vorurteil) nur die Analyse, ist es nicht sehr erstaunlich, dass sie die objektive Erkenntnis beschränkt auf sinnliche Phänomene, eingeordnet in Raum und Zeit. Und so, soweit die restriktive Voraussetzung gilt, so weit gilt die negative Schlussfolgerung. Aber noch einmal, wenn man sich daran halten würde, würde man die wirkliche Tiefe des Denkens von Kant verkennen. Tatsächlich besitzt die Kritik der reinen Vernunft eine zweite Einleitung, ausführlicher, an der Schwelle der „transzendentalen Deduktion der Kategorien“: das ist (in den Grenzen unseres diskursiven Verstandes) die Notwendigkeit des objektiven Denkens im allgemeinen oder die Möglichkeit von Objekten als solchen (das heißt: die Notwendigkeit von im Denken objektivierten Inhalten). Auf dieser erweiterten Basis rechtfertigt das Problem der Erkenntnis gerade durch seine Glieder, dass das Problem sich mit Recht stellt. Am Anfang der Kritik könnte tatsächlich ein Empirist (der die scheinbare logische Notwendigkeit jeder Synthese auf eine psychologische Gewohnheit reduziert, die Terme sich zu assoziieren) noch, ohne seinen Geist auf die totale Unfähigkeit zu reduzieren, sich weigern, das Problem der Synthese a priori ins Auge zu fassen. Und ein Ontologist, Inneist oder Intuitionist könnte seinerseits, ohne seine Hauptposition zu ruinieren, ebenso wie selbst ein Empirist, die rationale Rechtfertigung der sinnlichen Erfahrung opfern: Das, wenigstens bis zu dem Moment, wo man, in der Haltung des einen und des anderen, eine latente Inkohärenz gezeigt hätte; aber die Existenz von objektiven Inhalten des Bewusstseins in uns leugnen oder verkennen, das wäre gleichbedeutend damit, der kritischen Reflexion jede kritisierbare Materie zu entziehen. Wie ist uns ein Bewusstsein des Objekts möglich? Von solcher Art ist also das fundamentale Problem, ausdrücklicher unterstrichen in der Analytik, obwohl es schon eingeschlossen war in den Erklärungen der allgemeinen Einleitung und der Transzendentalen Ästhetik. Aus dieser Staffelung in der kritischen Problemstellung – wie ist eine Struktur a priori der Erfahrung möglich? Wie sind Objekte in einem diskursiven Bewusstsein möglich? – entsteht eine Schwierigkeit der Interpretation, die den Kommentatoren des Kantismus nicht entgangen ist. Wir betrachten sie unter dem Winkel, der unserem Thema entspricht, ohne uns zu belasten mit Fragen von literarischer Vorgängerschaft. 61 Buch I: Kritik und System 82 Der „formale“ Unterschied zwischen den beiden Weisen, den Startpunkt der Kritik auszudrücken, muss in der Absicht von Kant etwas bedeuten. Er bedeutet zuerst, dass die „materielle“ Koinzidenz der objektiven Sphäre mit der der Erfahrung in uns nicht behandelt werden kann wie eine einfache Voraussetzung des Kantismus, sondern beweisbar sein muss durch die allgemeinen Charakterisierungen der menschlichen Erkenntnis. Ist dieser Beweis peremptorisch durchgeführt? Ja, wenn wirklich festgestellt ist: 10 Dass der menschliche Geist der intellektuellen Intuition (im Sinne von Kant) unfähig ist, das heißt einer Intuition, die a priori die Existenz selbst seines Objekts bestimmt; 20 Dass beim Fehlen der intellektuellen Intuition die Materie oder der Inhalt einer objektiven Repräsentation ganz hervorgehen muss allein aus der sinnlichen (rezeptiven) Intuition. Wenn es damit so steht, hat die Deduktion der Kategorien als legitimen Schluss die Beschränkung des Objekts unseres Verstandes auf die Welt der Phänomene: denn die Beziehung auf eine entweder intellektuelle oder sinnliche Intuition, ist ja dann für das Objekt wesentlich. Nun aber beweist Kant nicht, weder absolut für jeden Erkennenden, noch selbst nur in dem, was den Menschen betrifft, die Unmöglichkeit eines Zwischen-Terms zwischen den Extremen der Disjunktion: Sinneswahrnehmung oder schöpferische Intuition. Sein Geist bleibt blockiert, seit 17721 durch das ins Auge springende und einseitige Dilemma, das seitdem seine „kopernikanische Revolution“ ankündigte: entweder produziert das Objekt die Idee, oder die Idee produziert das Objekt (das ist gleichbedeutend damit, zu sagen: kein Mittleres zwischen sinnlicher Intuition und intellektueller Intuition). 1 Siehe Heft III, 1. Auflage S.53-58, 3.Aufl. S.78-80 (Brief an Herz, vom 21. Feb. 1772). Unter den Versuchen einer vor Kant vorgeschlagenen mittleren Lösung, fasst dieser nur den ontologistischen Inneismus der kartesischen Gruppe ins Auge oder noch einen sehr rudimentären realistischen Dogmatismus. Er scheint die wahre Bedeutung der scholastischen Theorien der Analogie nicht zu kennen, die um so mehr eine Diskussion verdienen würden, da sie, wie Kant, den Knoten des Problems der Erkenntnis in die Mitwirkung der sinnlichen Intuition mit den metasensiblen a priorischen aber nicht streng intuitiven Bedingungen verlegen. Die formale Distinktion, eingeführt zwischen Objekt als solchem und Objekt der Erfahrung, trotz ihrer materiellen Koinzidenz in uns, bedeutet auch (ist nicht gerade hier im kritischen Agnostizismus ein erster Riss, der sich erweitern könnte?) dass Kant sich nicht im Voraus weigerte, im menschlichen Verstand eine Zone metempirischer Repräsentationen anzuerkennen, subjektiv notwendig und hypothetisch (problematisch) objektiv – mittlere Zone zwischen voller Objektivität, die der Erfahrung und totaler Inobjektivität, wie es die des transzendentalen Scheins oder der rohen Produkte der Assoziation wären –. Es ist möglich (einzelne isolierte Texte erlauben diese Vermutung), dass am Anfang der kritischen Periode Kant sein berühmtes Axiom zu sehr buchstäblich 62 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 83 genommen habe: „Ohne die Sinnlichkeit wäre uns kein Objekt gegeben; ohne den Verstand wäre kein Objekt gedacht. Gedanken ohne Materie sind leer, Intuitionen ohne Begriffe sind blind2 “. 2 KRV A, S.51 Seine noch ganz frische Entdeckung des funktionalen vereinheitlichenden Charakters der reinen Begriffe, „ohne Inhalt“ konnte ihn dazu verführen, im Aufbau unserer empirischen Begriffe, jeden anderen Inhalt als den Beitrag sinnlichen Ursprungs nicht zu beachten. Aber eine so exklusive These verträgt sich schlecht mit der von Kant selbst etwa um die Epoche, wo die zweite Auflage der Kritik der reinen Vernunft erschien, beibehaltenen Sprache. Schwerwiegende Anzeichen, die wir weiter unten wieder aufgreifen, würden uns glaubhaft machen, dass der leibnizsche Begriff der „reinen Idee“, in der Dissertation von 1770 adoptiert, noch gegen 1772 überlebt und sich in der Folge nicht total – oder wenigstens hoffnungslos – den Augen Kants verschlossen hat. Gegen 1787 hielt noch etwas durch oder erstand wieder von den „reinen Ideen“ von 1770: sicher nicht ihr logisches Privileg der transzendenten Objektivität, aber ihre transzendentale Geltung eines „Inhalts a priori“ des Bewusstseins. Wir kommen zurück auf diese partielle Treue Kants zu Leibniz: denn, vielleicht am Anfang unbewusst, schlecht in Harmonie mit dem zuerst vorherrschenden empiristischen Geist in der Kritik, orientierte sie unmerklich das kantsche Denken auf neue Wege zu, deren Ergebnis eine Art idealistische Übertragung der leibnizschen Metaphysik sein konnte. Aber greifen wir nicht vor. Mit der Annahme von „Inhalten a priori“ im subjektiven Denken, die die Objekte der Erfahrung überschreiten, duldete Kant eine Dualität von Aspekten, die sehr viel gefährlicher war für die Einheitlichkeit seines Systems, als sie es nicht war für die Einheitlichkeit des leibnizschen Systems: die Dualität der reinen Ideen und der konfusen Perzeptionen, reduzierbar auf die ersteren durch Analyse. Tatsächlich überlagerte sich diese Dualität bei Kant einem tiefliegenden Dualismus, den der kritizistische Philosoph gar nicht vollständig reduzieren konnte – und vielleicht nie wollte – : der Dualismus des „transzendentalen Subjekts“ und des „Dings an sich1 “. 1 84 Siehe Heft III, 1.Aufl.S.160-166 3.Auflage S.211-218, besonders S.216-218 Die kantsche Konzeption des Dings an sich ist auf den ersten Blick alles das, was es an Plausibelstem und selbst Einfachstem gibt: Erzwungen durch den Sensus communis, ist es bestätigt durch die reflektierende Vernunft. „Reelles an sich“ muss existieren, denn sonst wäre alles relativ; nun aber weigert sich die Vernunft (notwendiges Instrument der Kritik ) nur ausschließlich Relatives zu behaupten; das „Reale an sich“ existiert also. Aber dieses Reale kann nur erkennbar sein auf zwei Weisen: entweder kraft einer intellektuellen Intuition, die es erschafft; oder kraft einer sinnlichen Intuition, das heißt mittels einer rezeptiven Fakultät, „affiziert“ durch es, also „phänomenal“. In einem diskursiven Verstand wie dem unseren, dem intellektuelle Intuition vollkom- 63 Buch I: Kritik und System men fehlt, schließen die objektiven Konstruktionen immer ein fremdes Element ein, irrational, irreduzibel auf jede Bedingung a priori: ein reines „Gegebenes“. Da die Erfahrung bei Kant unweigerlich rohes Gegebenes einschließt, hört sie durchaus nicht auf, trotz aller Versuche der Reduktion, sich in irgendetwas den Prinzipien a priori entgegenzustellen, die nur rein Gedachtes definieren2 würden. 2 Die Wurzel dieses Gegensatzes (die Existenz des Dings an sich) bleibt auch 1790 unausrottbar (Endpunkt der in diesem Kapitel III untersuchten Periode) wie sie es 1772, 1781 oder 1783 (Prolegomena) schon sein konnte. Man liest tatsächlich in der Antwort an Eberhard (Über eine Entdeckung...usw, 1790): „(Wie auch immer das Hervorgehen aus der sinnlichen Materie beschaffen wäre, „Man muss dabei auf die Dinge an sich kommen“). Das ist genau das, was die Kritik immer behauptet hat; sie verlegt diesen Grund des materiellen Elementes der sinnlichen Repräsentationen zurück, nicht in die Dinge an sich, die etwa dann folglich Objekte der Sinne wären, sondern nur in etwas Metasensibles, als Grund der sinnlichen Repräsentationen, obwohl selbst außerhalb der Reichweite unserer Erkenntnis. Die Kritik sagt: Die Objekte als Ding an sich liefern die Materie der empirischen Intuitionen ... aber sie sind nicht selbst diese Materie“ (zit.Op. Ak, Bd.VIII, S.215) 3˚ Die doppelte Deduktion der Kategorien 85 Wir haben weiter oben (S.79, Anmerkung 2) eine Anspielung gemacht auf einen unter den hauptsächlichen Kommentatoren der Kritik besonders zwischen Vaihinger1 und Adickes2 umstrittenen Punkt: 1 Kommentar I, S.186-189, 225-227, 386-412 Die bewegenden Kräfte in Kants philosophischer Entwicklung, in den Kant Studien, Bd.I, 1897 besonders S.41-50 2 Ist die kritische Hauptaufgabe, angekündigt in der Einleitung, festzustellen dass synthetische Urteile a priori, die eine objektive Geltung haben, möglich sind, oder, wenn sie als möglich vorausgesetzt werden, zu erklären, wie und in welchen Grenzen sie das sein können? Offensichtlich war die persönliche Überzeugung von Kant zum Voraus zur Realität der Erkenntnisse a priori erworben. Wenn man dennoch bestreitet, dass er aus dieser Überzeugung im Voraus das Anfangspostulat seines Beweises gemacht hat, wird man in der ganzen Kritik der reinen Vernunft das Problem des dass für fundamental halten: „Gibt es eine wirkliche synthetische Erkenntnis a priori?“ Wenn man dagegen seit der Einleitung die logische Geltung der synthetischen Urteile a priori der Mathematik und der reinen Physik für unbestreitbar affirmiert hält, ist die Frage der Möglichkeit (des DASS) schon entschieden, und das Hauptproblem der Kritik wird das des „WIE“. Diese Unsicherheit der Exegese, nach der die ersten Seiten der Kritik verlangen, konnte nicht ohne Rückwirkung bleiben auf die Interpretation der Deduktion der Kategorien. Da belegt tatsächlich das „WIE“ entscheidend das Proszenium (die Vorderbühne): „Wie können reine Begriffe die Geltung von Objekten annehmen?“ Es ist wahr, dass die Aufhellung des „WIE“ genau die Bedingungen der Möglichkeit und die logische Geltung der Synthesen a priori beweist: das WIE bringt das DASS mit sich. Letzt endlich, welches der zwei Probleme war in der Absicht Kants, das hauptsächliche? 64 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 86 87 Bevor wir auf diese Frage antworten, die überflüssig erscheinen könnte, bemühen wir uns, ihre allgemeine Tragweite abzuschätzen. Zu wissen, ob synthetische Erkenntnisse a priori möglich sind und welche, das ist in aller Strenge ein Problem der Kritik. Es ist einer analytischen Lösung zugänglich und einer synthetischen Lösung. Die analytische Lösung würde wesentlich darin bestehen, die synthetische Einheit a priori zu erkennen als implizit enthalten in dem einzigen „Objekt“, das die Kritik voraussetzt: dem Objekt der sinnlichen Erfahrung. Man sieht leicht, dass ein so strenges analytisches Vorgehen im Voraus die affirmativen Lösungen des Objekts im Umfang des „Phänomens“ einschließen würde: jedes Element, jeder psychologische Prozess, der den Anspruch erheben würde, die Grenzen des Phänomens zu überspringen, könnte nur reine Illusion sein oder subjektive Regel der Methodologie oder im Höchstfall asymptotisch ein unzugängliches „Ding an sich“. Dieser erste Weg, wo das Problem des DASS gestellt ist und im Voraus zum Problem des Wie entschieden ist, erlaubt nicht, das ahnt man, über einen relativen und methodologischen Transzendentalismus nach Art des Neukantianismus von Marburg hinauszukommen: sie würde äußersten Falls zu einem abstrakten und „rationalisierten“ Bild der positiven Wissenschaften führen. Was die synthetische Lösung für das Problem des DASS betrifft, vermischte sie sich mit Abfolge der notwendigen Phasen der objektiven Konstruktion, ausgehend von den einfachen Materialien, gegeben in den Anfangspostulaten der Kritik : Sie zeigte zum Beispiel, unter welchen Bedingungen es tatsächlich möglich ist, mittels des rohen empirischen „Gegebenen“ eine Repräsentation zu konstituieren, die die logischen Eigenschaften eines Objekts zeigt. Diese synthetische Methode schließt auf das DASS auf dem Umweg des WIE; darin stimmt sie praktisch überein mit dem Gesichtspunkt der Interpreten des Kantismus, die das Haupt-Ziel der Kritik in die Suche nach dem „WIE“ verlegen. Direkt oder indirekt bildet also die Geltung der Synthese a priori den Gegenstand eines Beweises. Es ist jedoch nicht gleichgültig zum Erfolg dieses Beweises mit der analytischen oder mit der synthetischen Methode zu kommen. Die synthetische Methode lenkt die Kritik auf eine systematische Organisation ihres Inhalts hin, das heißt tatsächlich, auf ein positives System des Idealismus, wo sich früher oder später neue Gesichtspunkte ankündigen werden, schwer versöhnbar mit den formalistischen Beschränkungen eines statischen Kritizismus. Wenn man trotzdem den Forderungen des synthetischen Prinzips gehorcht, wird sich das System von sich selbst aus, so scheint es, bis zu seinem Punkt eines Gleichgewichts entwickeln, dem absoluten Idealismus. Zwischen einem überängstlichen Rückzug auf einen methodischen Transzendentalismus hin, analog dem Neukantianismus von Marburg und einem kühnen Vormarsch auf die absolute Idee von Hegel zu, zwischen einem nüchternen Rationalismus und einem schöpferischen Rationalismus bleibt Platz für dazwi- 65 Buch I: Kritik und System schenliegende Ausrichtungen, alle, das ist wahr, behaftet mit dem Dualismus. Wo müssen wir Kant situieren? Kommen wir zurück zur Deduktion der Kategorien. Die Unterscheidung zwischen einer „metaphysischen Deduktion“ und einer „transzendentalen Deduktion“ wurde gemacht angefangen mit der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft und noch klarer in der zweiten Auflage. Kant hat sicher seine metaphysische Deduktion der Kategorien (seinen „Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe“) nicht als eine reine Bestandsaufnahme betrachtet, erstellt auf der Grundlage einer psychologischen Induktion1 1 Siehe Heft III, 3.Aufl. S.145-149 Seinen Erklärungen zufolge gehen die Tafel der zwölf elementaren Formen des Urteils und also auch die zwölf entsprechenden Kategorien analytisch aus der objektiven Einheit des Verstandes als solchem, oder aus dem Objekt im allgemeinen hervor, unabhängig von jeder Einschränkung durch die Schemata einer Sinnlichkeit2 2 „Wenn wir von allem Inhalt eines Urtheils überhaupt abstrahieren und nur auf die blosse Verstandesform darin achtgeben, usw.“ (KRV B, §9, S.05), so erscheinen die „Stammbegriffe des reinen Verstandes“ (KRV B, §10, S.107) 88 Ganz im Gegenteil dazu, schließt die transzendentale Deduktion wesentlich diese Einschränkung durch Schemata unter die Bedingungen ein, die die transzendentale Struktur der Kategorien definieren sollen und steuern ihre objektive Geltung. Wir finden dabei in der Bedeutung jeder Kategorie, die Einstufung in zwei mögliche Ebenen wieder, der wir schon weiter oben begegneten: der Ebene des Denkens im allgemeinen und der Ebene der Erfahrung im allgemeinen. Nun aber lässt das unvollkommene logische Zusammenspiel dieser zwei Ebenen fundamentale Fragen in der Schwebe. Man wird zweifellos zuerst fragen, wie in der metaphysischen Deduktion der Kategorien, diese ihre Bestandsaufnahme entsprechend den abstrakten Formen unserer Urteile die analytische Notwendigkeit einer unmittelbaren, formartigen Aufteilung der reinen Einheit des Denkens annehmen kann. Kant bemüht sich, zu beweisen, dass seine Aufteilung vollständig ist und die einzig mögliche ist. Sei es so, aber selbst so: Welche ist die zunächst aufgeteilte Einheit? Die reine Einheit des Denkens (“die bloße Verstandesform“, „die Funktion des Denkens, ... des reinen Verstandes“), behauptet er, diesen einzigen Grund vorschützend, dass die zwölf allgemeinen Formen unseres Urteils „von jedem partikulären Inhalt abstrahieren“, anders gesagt, angewandt werden können auf jeden konzipierbaren Inhalt. Um diese Schlussfolgerung zu rechtfertigen, müsste man außerdem zeigen, dass diese allgemeinen Formen unserer Urteile jede strukturelle, den Forderungen des „Schematismus“ zuordenbare Differentiation, verloren haben. Wenn das fehlt, könnte man immer vermuten, dass sie nicht die reine Einheit des Verstandes, sondern die Einheit des Verstandes vermittelt durch die „transzendentalen Schemata“ unmittelbar aufteilen, differenziert durch die transzendentale Relation zu dem Apriori 66 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 unserer Sinneswahrnehmung1 . 1 Unsere konkreten Urteile, im Bewusstsein formuliert, sind immer „schematisiert“; denn jedes Objekt, selbst ein metempirisches oder ein einfach ideales, ist in uns repräsentiert entsprechend irgendeiner der Kategorien: Realität, Substanz, usw., deren Anwendung den Rückgriff auf Schemata erfordert. 89 Unter noch anderen Gesichtspunkten erscheint die Argumentation Kants vielen extrem anfechtbar. Wenn man trotz allem ihre Resultate gelten lässt, ist für eine vertiefte Prüfung der verschiedenen Kategorien viel Verwirrendes zu erwarten. Zum Beispiel: die Kategorien der Modalität, deren „kategoriale“ Funktion schon nicht leicht zu verstehen2 ist, scheinen in den zwei Deduktionen, sagen wir nicht, verschiedene Wertungen bei der Anwendung „pro subjecta materia [je nach zugrundeliegender Materie]“ anzunehmen, was man verstehen kann, sondern eine formal mehrdeutige Bedeutung. 2 Tatsächlich repräsentieren die Kategorien der Modalität nicht die interne Struktur des Objekts, sondern seine Beziehung zu den erkennenden Fakultäten, das heißt eine logische Qualität des transzendentalen Aktes, ausgedrückt durch die Copula der Urteile; Kant selbst unterstreicht die Besonderheit: „Die Modalität der Urteile ist eine ganz besondere Funktion derselben, die das Unterscheidende an sich hat, dass sie nichts zum Inhalte des Urteils beiträgt..., sondern nur den Wert der Copula in Beziehung auf das Denken überhaupt angeht“(KRV B, S.100-101) Einerseits muss tatsächlich in der metaphysischen Deduktion die Kategorie der „Notwendigkeit“ von sich selbst her eine absolute Notwendigkeit bezeichnen, die welche einer Behauptung die Geltung eines apodiktischen Urteils verleiht, das heißt eines „durch [die] Gesetze des Verstands selbst bestimmten und daher a priori behauptenden“ Urteils3 3 KRV A, S.76; B §9, S.110 Andererseits kann in der transzendentalen Deduktion der Begriff der „Notwendigkeit“ nur eine relative Notwendigkeit bezeichnen, das heißt, abhängig von Bedingungen (denen des Schematismus), die, bezogen auf den Verstand als solchen, sich „kontingent“ nennen müssten. So lange tatsächlich die Zeit und der Raum und folglich die transzendentalen Schemata nicht deduziert sind aus der reinen Einheit unseres Denkens, bleiben sie, logisch gesprochen, eine kontingente Bestimmung von diesem. Und wie können wir dann eine absolute, apodiktische Sicherheit haben, wenn die Übereinstimmung mit den allgemeinen, durch den Schematismus implizierten Bedingungen des Raumes und der Zeit, unweigerlich die Möglichkeit oder die Notwendigkeit jedes eventuellen Objekts unseres Denkens regulieren muss? Nun stellt Kant in der Kritik der reinen Vernunft (Ausgabe A und B) die Formen a priori von Raum und Zeit als eine Tatsache fest, ohne zu behaupten, sie aus der reinen Einheit des Bewusstseins abzuleiten; er erklärt sich für unfähig, zu beweisen, dass sie die einzig möglichen Formen einer Sinneswahrnehmung seien. Was für eine Bedeutung haben in diesem Fall exakt die Regeln der Möglichkeit, der Unmöglichkeit, der Notwendigkeit, die dem Objekt der menschlichen Erkenntnis durch die transzendentale Deduktion auferlegt werden1 ? 67 Buch I: Kritik und System 1 Diese Schwierigkeit scheint eher verstärkt in der Auflage B, §24, durch die Distinktion der „intellektuellen Synthese“ (Kategorie + Intuition im allgemeinen) und der „figurierten Synthese“ (Kategorie + rein raum-zeitliche Intuition) Vergl. §23 90 Der Autor der Kritik ahnte selbst voraus, dass die Prinzipien der Modalität alte Probleme wieder erwecken würden, wobei er sich den Anschein gibt, das zur Seite zu schieben als unpassende, der „analytischen“ Domäne des Beweises fremde Fragen. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es nützlich, die Stelle aus der Analytik der Prinzipien nachzulesen, die mit folgender Phrase beginnt: „Was das Wissen betrifft, ob das Feld der Möglichkeit weiter ist als das gesamte Feld des Realen, und wenn dieses letztere auf seine Weise größer ist als die Gesamtheit von allem Notwendigen, siehe da, interessante Probleme, die nach einer synthetischen Lösung rufen, aber nur im Zuständigkeitsbereich der rationalen Dialektik2 “ 2 KRV A, S.230; B, S.282(im Link zweiter Abschnitt) [Original Kant:] Ob das Feld der Möglichkeit größer sei, als das Feld, was alles Wirkliche enthält, dieses aber wiederum größer, als die Menge desjenigen, was notwendig ist, das sind artige Fragen, und zwar von synthetischer Auflösung, die aber auch nur der Gerichtsbarkeit der Vernunft anheimfallen; Die Interpretation der kategorialen Struktur des Verstandes oszilliert also zwischen zwei Gesichtspunkten, die – wir insistieren darauf – sehr verschiedene epistemologische Perspektiven eröffnen. Wenn einerseits die Kategorien sich tatsächlich analytisch aus der reinen Einheit des Verstandes herleiten, haben sie Teil an der absoluten formalen Notwendigkeit dieser Einheit, und sie bieten den festen, unerschütterlichen Stützpunkt, den Kant braucht, um das Gegebene zum Rang des Objekts zu erheben. Und mit dem gleichen Schlag zeigt ihre Abhängigkeit von einem nicht intuitiven Verstand, dass sie „nur logische Form von Begriffen sind“ (“nur die logische Form zu einem Begriff3 “), und nicht, eigentlich gesprochen, „Begriff“ von irgendeinem Objekt, welchem auch immer4 . 3 HRV A, S.95 4 Ebenda So ist der Schluss der metaphysischen Deduktion zustande gekommen: Die reinen Kategorien, notwendig und in ihnen selbst unveränderlich, aber „leer“, werden nicht objektive Bestimmungen, außer indem sie sich beziehen auf einen möglichen Inhalt der Erfahrung, auf eine „mögliche Erfahrung“. Statt so unsere Kategorien von den Höhen des Absoluten aus zu betrachten, kann man die Perspektive umkehren und (wie es Kant in der transzendentalen Deduktion macht und in der Theorie des Schematismus), das Problem angehen auf dem aufsteigenden Weg der Synthese der Phänomene. Wenn es so erscheint, dass die Mannigfaltigkeit der allgemeinen Formen des Urteils in Bezug auf die Mannigfaltigkeit das kombinierte Spiel der Intuitionen a priori der Sinnlichkeit widerspiegelt, scheint es dann nicht, dass die behaupteten „Kategorien des reinen Verstandes“ Kategorien sind eingeschränkt durch die 68 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 91 92 Schemata, „schematisiert“, noch rein, aber nur in dem Sinn, dass sie überhaupt keine empirische Bestimmung einschließen? Daraus ergibt sich eine wichtige Konsequenz, was die logische Geltung der Deduktion betrifft: Die Notwendigkeit einer Vielfalt von Kategorien und von dieser Art von Vielfalt von Kategorien für den Vollzug des objektiven Denkens, beruht nicht auf den logischen Bedürfnissen des reinen Verstandes, sondern auf der Assoziation von diesem (Verstand) mit den Funktionen a priori einer Sinnlichkeit in der physischen Einheit eines erkennenden Subjekts. Diese Notwendigkeit, abhängig von partikulären Bedingungen unserer Sensibilität, kann also in letzter Analyse nur eine Naturnotwendigkeit sein, eine hypothetische Notwendigkeit. Wenn ein nicht intuitiver Verstand verbunden wäre mit einem anderen Typ von Sensibilität (einer Voraussetzung, die Kant 1787 noch nicht für absurd hielt), wäre die kategoriale Funktion im gleichen Verhältnis modifiziert (eine Konsequenz, die unverträglich ist mit der metaphysischen Deduktion, die die Tafel der Kategorien ins Absolute abklatscht.) Es war genau eine Schwierigkeit von dieser Art, die die logische Geltung der Kategorien betrifft, die gewisse Sympathisanten in der Ablehnung des Kritizismus von Kant verharren ließ, so etwa Ulrich in seinen Institutiones Logicae et Metaphysicae, so auch den Autor einer Rezension dieses Werks in der Allgemeinen Literatur-Zeitung Nr. 295. Kant bemüht sich, ihre Skrupel zu beruhigen durch die lange und kuriose Anmerkung der Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786. Vgl. Vorrede, gegen Ende), wo er, nicht daran zweifelnd, seine transzendentale Deduktion auf den Felsen der formalen Analyse errichtet zu haben, erklärt, dass die transzendentale Deduktion keineswegs unerlässlich ist, um die hauptsächliche Schlussfolgerung der Analytik sicher zu stellen, „Dass (die Erfahrung) bloß durch jene Begriffe [die Kategorien] möglich sei“, siehe da, sagt er, das Wesentliche und das, was die metaphysische Deduktion peremptorisch [=unwiderlegbar] beweist; aber das „WIE“ dieser Möglichkeit (das „wie möglich“, von dem die transzendentale Deduktion handelt) könnte, ohne größere Inkonvenienzen, nicht die selbe unabweisbare Evidenz haben. Es ist kaum wahrscheinlich, dass Kant 1786 ernsthaft die perfekte Strenge der tranzendentalen Deduktion selbst in Frage gestellt hätte, auf deren Publikation im folgenden Jahr unter einer neu aufgelegten Form er sich vorbereitete. Was wahr ist, das ist, dass in der transzendentalen Deduktion von 1787, wie in der vorausgehenden, das Dass und das Wie sich ineinander schlingen und dass, was auch immer man über das Wie denken wolle, das Dass sich stützt im Grunde auf die Koinzidenz zwischen den auf dem Weg der Synthese ausgehend von der „Gegebenheit“ (sind es mit Recht die Stammbegriffe des Verstandes?) entdeckten Kategorien und den „Kategorien des reinen Verstandes“, analytisch bewiesen, glaubt man, in der metaphysischen Deduktion. Diese letztere bleibt also, bis hierhin, ein unerlässliches Stück der Beweisführung Kants. 69 Buch I: Kritik und System Die relative Wichtigkeit der zwei Deduktionen würde sich modifizieren an dem Tag, wo die transzendentale Deduktion zusammenträfe in ihrer eigenen Linie mit einem absoluten Prinzip der Synthese, das zugleich kraft derselben deduktiven Notwendigkeit, die Begriffe a priori des Verstandes und die Intuitionen a priori der Sinnlichkeit steuert (kommandiert): nur dann entkäme die Entsprechung zwischen den „reinen Kategorien“ und den „schematisierten Kategorien“ jeder Kontingenz. Und die Kritik würde eine stabile Gleichgewichtsposition erreichen. Wir werden weiter unten in der transzendentalen Deduktion von 1787 die ersten Anzeichen einer noch unbewussten Vorbereitung auf dieses kühne „Wiederherstellung“ sammeln. 4˚ Die zwei „Ich“ Das empirische Ich steht zum transzendentalen Ich in der selben Beziehung wie die „empirische Apperzeption“ zur „reinen oder ursprünglichen Apperzeption1 “ [Apperzeption=Wahrnehmung]. Das erste ist konstituiert durch die konkreten Bestimmungen des „inneren Sinns2 “. Die zweite vermischt sich mit dem „ich denke“, der höchsten Einheit a priori jeder bewussten Repräsentation. Die erste reiht sich ein in die Zeit und gehört folglich zur Reihe der Phänomene: es ist der einzige objektive Ausdruck des zweiten, das in sich selbst reine Spontaneität bleibt. 1 Vergl. Heft III,1.Aufl. S.118-120, S.125 ff. 3. Auflage S. 159-160 Der „innere Sinn“ ist die „Gesamtheit aller Repräsentationen (der Inbegriff aller Vorstellungen)“ (KRV A, S.177) 2 93 Die Lehre, die wir gerade wieder aufnehmen, wirft einen Strauß von Problemen auf: Das wichtigste Problem betrifft die Einheit dieser zwei „Ich“ in und für das Bewusstsein3 : suchen wir eine erste Formulierung davon in den Texten von Kant selbst: 3 vergl. B. Erdmann, Kants Kritizismus..., S. 52 ff.; P. Lachièze-Rey, Der kantsche Idealismus, Kap. III, S.149-209; H.J. De Vleeschhauwer, Deduction transcendentale, t. II et III, soweit die transzendentale Deduktion interessiert ist am Problem der Struktur des „Ich“: siehe die alphabetische Tafel von Band III „Es ist sowohl nötig, dass die [ursprüngliche] Apperzeption und ihre synthetische Einheit identisch seien mit dem inneren Sinn [dem Sitz des empirischen Ich], als auch im Gegensatz dazu, als Quelle jeder Verbindung4 , die erste sich bezieht, unter dem Namen der Kategorie, zur Vielheit der Intuitionen im allgemeinen, 4 Erinnern wir uns, dass die Verbindung ein Akt der Spontaneität des Subjekts ist, der „die Repräsentation der synthetischen Einheit der Vielheit bewirkt“. Vergl. Heft III, 1.Auflage S.105, 115, 151 3.Auflage, S.173-174 [und folglich selbst] vor jeder sinnlichen Intuition, auf Objekte im allgemeinen1 70 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 1 Der Text der französischen Übersetzung Kants rief hier nach einer Retusche. Die Lesart, die der Übersetzung von Barni entspricht erscheint uns unwahrscheinlich, wir korrigieren nach der Lesart von Görland, von Erdmann, von Vaihinger (gilt für den rückübersetzten Text, nicht für den deutschen Originaltext in den Fußnoten) [Original Kant:] Die Apperzeption und deren synthetische Einheit ist mit dem inneren Sinne so gar nicht einerlei, daß jene vielmehr, als der Quell aller Verbindung, auf das Mannigfaltige der Anschauungen überhaupt unter dem Namen der Kategorien, vor aller sinnlichen Anschauung auf Objekte überhaupt geht, während, [durch sich selbst], der innere Sinn nur die Form der Intuition enthält ohne irgendeine Verbindung des vielen Verschiedenen, das in ihr ist, und folglich noch nicht irgendeine bestimmte 2 Intuition einschließt. 2 gesamter Zusammenhang in folgendem Link nachlesbar (Ende, nach den *** Symbolen) KRV B, §24, S.154 [Original Kant:] dagegen der innere Sinn die bloße Form der Anschauung, aber ohne Verbindung des Mannigfaltigen in derselben, mithin noch gar keine bestimmte Anschauung enthält, welche nur durch das Bewußtsein der Bestimmung desselben durch die transzendentale Handlung der Einbildungskraft, (synthetischer Einfluß des Verstandes auf den inneren Sinn) welche ich die figürliche Synthesis genannt habe, möglich ist. „Der Verstand findet also nicht [toute faite = schon vorgeformt] im inneren Sinn diese Verknüpfung des Vielfachen; es ist er, der sie hervorbringt, indem er den Sinn affiziert. Aber wie kann das Ich des ich denke verschieden sein vom Ich, das sich selbst schaut [das empirische Ich]... und trotzdem mit ihm nur eines und dasselbe Subjekt bilden? Mit anderen Worten, wie kann ich sagen, dass ich, als denkende Intelligenz und Subjekt, mich nur kenne als gedachtes Objekt... nur auf die Art und Weise, in der ich die anderen Phänomene kenne, [das heißt] nicht so, wie ich vor dem Verstand bin [nach meiner metasensiblen Realität], sondern so wie ich mir erscheine [als Phänomen, im inneren Sinn]3 ?“ 3 zit. Op, S.155 [original Kant:] Der Verstand findet also in diesem nicht etwa schon eine dergleichen Verbindung des Mannigfaltigen, sondern bringt sie hervor, indem er ihn affiziert. Wie aber das Ich, der ich denke, von dem Ich, das sich selbst anschaut, unterschieden (indem ich mir noch andere Anschauungsart wenigstens als möglich vorstellen kann) und doch mit diesem letzteren als dasselbe Subjekt einerlei sei, wie ich also sagen könne: Ich, als Intelligenz und denkend Subjekt, erkenne mich selbst als gedachtes Objekt, sofern ich mir noch über das in der Anschauung gegeben bin, nur, gleich anderen Phänomen, nicht wie ich vor dem Verstande bin, sondern wie ich mir erscheine, hat nicht mehr auch nicht weniger Schwierigkeit bei sich, als wie ich mir selbst überhaupt ein Objekt und zwar der Anschauung und innerer Wahrnehmungen sein könne. „Diese Frage, fährt Kant fort, ruft nicht mehr und nicht weniger Schwierigkeiten hervor als die, zu wissen, wie ich im allgemeinen für mich selbst, ein Objekt sein kann, und im einzelnen ein Objekt der Intuition und der inneren Wahrnehmung4 “ 4 zit.Op. S.155-156 [Original Kant:] hat nicht mehr auch nicht weniger Schwierigkeit bei sich, als wie ich mir selbst überhaupt ein Objekt und zwar der Anschauung und innerer Wahrnehmungen sein könne 94 71 Buch I: Kritik und System Sieht man sich die Aporie abzeichnen? Auf der einen Seite wird das empirische Ich in den Rang der Phänomene versetzt, das ist ein Ich als Objekt. Nun aber ist der unmittelbare Grund des Phänomens nichts anderes als das Ding an sich. Würde sich das gründende, transzendentale Ich, Prinzip und Stütze des empirischen Ich, unter dieser Rücksicht mit dem Ding an sich vermischen? Wäre es „Subjekt an sich“? Bezeichnet dasselbe Wort: „affiziert werden“ nicht in der Kritik die Beziehung des inneren Sinns zum transzendentalen Ich, das ihn a priori bestimmt, und die Beziehung der Sinnlichkeit zum Ding an sich, das sie von außen her verändert? Auf der einen Seite setzt Kant immer eine Relation der Identität voraus zwischen dem transzendentalen Ich und dem empirischen Ich, entsprechend ihrer gemeinsamen Subjektivität (er markiert gerade da, zwischen dem transzendentalen Ich und dem Ding an sich, das total Nicht-Ich ist, eine radikale Distinktion): Das empirische Ich, das heißt, der innere Sinn, beherrscht durch das transzendentale Ich, das ist das Ich „affiziert“ durch sich selbst5 : 5 „Ich sehe nicht, wie man solche Schwierigkeiten finden kann, zuzulassen, dass der innere Sinn affiziert wird durch uns selbst. Jeder Akt der Aufmerksamkeit kann uns davon ein Beispiel liefern“ (KRV B, §24, S. 56, Anmerkung. Vergl. auch Prolegomena, Ak. Bd. IV, S. 134, Anmerkung) Das „bestimmende Ich“ und das „bestimmbare Ich“ sind zwei Aspekte desselben „Ich“. Bleibt dann aber das empirische Ich, wenn es in mir als „meines“ ist – und noch mehr, wenn es als „meines“ wahrgenommen ist – reines Phänomen? Um mehr als nur irgendeine Gruppierung von Phänomenen als ein Ich zu erscheinen, muss es dann nicht, außer den konkreten Repräsentationen des inneren Sinns, dem unmittelbaren Bewusstsein, in einer Art reflexer Wahrnehmung äquivalent einer intellektuellen Intuition, das höhere, ursprüngliche und determinierende Ich anbieten? Hören wir die Antwort Kants. Sie lehnt die intellektuelle Intuition ab, aber nicht jedes metempirische Erfassen des Ich: „... In der ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption [der höchsten Funktion des transzendentalen Ich], habe ich Bewusstsein des Ich, aber nicht so, wie ich mir erscheine, noch so wie ich in mir selbst bin [das heißt weder als Phänomen noch als Ding an sich]: Ich habe nur Bewusstsein, dass ich bin. Diese Repräsentation ist ein Gedanke, nicht eine Intuition. Aber wie die Erkenntnis von uns selbst außer dem Akt des Gedankens, der die verschiedenen Elemente jeder möglichen Intuition auf die Einheit der Apperzeption reduziert, ein bestimmter Modus der Intuition verlangt, durch den diese verschiedenen Elemente gegeben sind, ... die Bestimmung meiner Existenz kann nur stattfinden entsprechend der Form des inneren Sinns und nach der besonderen Art, wovon die verschiedenen Elemente, die ich verbinde, gegeben sind in der inneren Intuition; infolgedessen erkenne ich mich keineswegs, 95 72 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 wie ich bin sondern nur wie ich mir selbst1 erscheine“ 1 KRV B, §25, S.157-158 „Ich existiere also als eine Intelligenz, die einfach Bewusstsein von ihrer Fähigkeit der Synthese hat [Hervorhebung von uns], die aber, bezüglich der Mannigfaltigkeit, die sie verknüpfen muss, als einer einschränkenden Bedingung, innerer Sinn genannt, unterworfen, diese Verknüpfung nicht wahrnehmbar machen kann, als nur so, dass sie den Beziehungen der Zeit Folge leistet, die ganz und gar außerhalb der eigentlichen Verstandes-Begriffe liegen2 “ 2 KRV B, S.158-159 Beim Lesen dieser Erklärungen von Kant, frägt man sich, wie eine Existenz, die jeder „wesentlichen“ Bestimmung beraubt ist, direkt oder indirekt, positiv oder negativ, wahrgenommen werden könnte. Um zu wissen, dass ich bin, muss ich dazu nicht das wissen, so verschwommen es auch wäre, was ich bin – wenigstens so sehr, dass ich in der Existenz das Ich vom Nicht-Ich unterscheiden kann? In Wahrheit schließt der Text der Kritik aus der meta-sensiblen Wahrnehmung unserer eigenen Existenz nicht jede formale Bestimmung des Wesens aus: „Die Intelligenz ... hat einfach nur Bewusstsein von ihrer Fähigkeit zur Synthese 3 “; das heißt, dass die Intelligenz sich selbst wahrnimmt, sicher nicht als permanente Quelle der Einheit – was gleichbedeutend wäre mit einer Erkenntnis der Substanz des Ich4 – aber als transzendentaler Akt der Synthese, einem Akt höher als die Zeit, der sie a priori bestimmt beim Aufbau des empirischen Ich. „Ich weiß, dass ich bin, entsprechend dem, was ich wahrnehme, vermittels der raum-zeitlichen Gruppierungen des empirischen Ich, dem aktuellen Vollzug einer Synthese a priori.“ 96 3 oben zit. loc. 4 Vgl. KRV B, S.407-410 Aber genügt dieses Bewusstsein der Synthese a priori (im aktiven Sinn des Wortes „Synthese“) dafür, eine Grenzlinie zu ziehen zwischen dem Ich und dem Nicht-Ich und die Gesamtheit der Phänomene des inneren Sinns auf das Ich zurückzuführen? Vielleicht muss man vor allem dem Wort „Ich“ einen bestimmten Sinn zuordnen, ... und dieser Konvention treu bleiben. Man wäre versucht, aus dem Wort Ich in einem logischen Sinn sogar die Einheit des Bewusstseins zu machen: „Ich: einfache Repräsentation, von sich selbst her leer von jedem Inhalt, von der [dieser Repräsentation] man selbst nicht sagen kann, dass sie ein Begriff ist, die aber ein einfaches Bewusstsein ist, das alle Begriffe begleitet [Hervorhebung von uns]. Mit diesem Ich, mit diesem es oder mit diesem dasda (dieses Ding) das denkt, 73 Buch I: Kritik und System repräsentiert man sich nichts weniger als ein transzendentales Subjekt der Gedanken1 “ 1 KRV B, S.404 [Original Kant:] Zum Grunde derselben können wir aber nichts anderes legen, als die einfache und für sich selbst an Inhalt gänzlich leere Vorstellung: Ich; von der man nicht einmal sagen kann, daß sie ein Begriff sei, sondern ein bloßes Bewußtsein, das alle Begriffe begleitet. Durch dieses Ich, oder Er, oder Es (das Ding), welches denkt, wird nun nichts weiter, als ein transzendentales Subjekt der Gedanken vorgestellt So verstanden schließt das Ich alle Phänomene ein und nicht nur die des inneren Sinnes. Denn alle Phänomene gehören, angefangen mit ihrem plötzlichen Auftauchen (ihrer Emergenz) zur universellen Einheit des Bewusstseins. Wenn man in dieser Zugehörigkeit Grade unterscheidet: den Grad der äußeren Sinneswahrnehmung, der des inneren Sinnes, der der Begriffe des Verstandes, entspricht keiner dieser Unterschiede des Grades der Aufteilung Ich, Nicht-Ich2 2 Das sind in Wirklichkeit Grade der Reflexion des Ich. Vgl. Anthropologie, §4, Endnote (Ak. Bd.VII. S.141) 97 Es ist also im Bannkreis des Bewusstseins und sozusagen des Ich selbst, wo man den Gegensatz Ich, Nicht.Ich entdecken muss, der also den Charakter eines inneren Gegensatzes von Subjekt zu Objekt annimmt. Will man mit mehr Strenge das Ich (als denkendes Subjekt) durch die Synthese a priori (im aktiven Sinn des Wortes „Synthese“) definieren, verwirft man im Nicht-Ich das sogenannte „empirische Ich“ (Produkt der Synthese a priori) mit all den anderen Phänomenen gleichermaßen. Zieht man es im Gegenteil vor, der Idee des Ich den gesamten logischen Umfang der Idee des Apriori zu geben (“Synthese a priori“ und einfache „Form a priori“)? Man lässt also in das Ich jede durch die Raum-Zeit geformte Repräsentation eintreten, das heißt jedes Phänomen, was auch immer es sei. Das einzige Nicht-Ich wäre das rohe „Gegebene“, insofern es herrührt vom Ding an sich; und das globale Ich unterschiede sich überhaupt nicht von der formalen Struktur der Erfahrung. Welche Bedeutung nimmt in dieser letzteren Hypothese, (die die weiter oben gemachte Hypothese von einem einfach als Bewusstsein definierten Ich in Ausdrücke der „Funktion a priori“ transponiert) das empirische Ich an? Nennen wir es Ich, weil es eine erste Etappe in der subjektiven Ver-Einigung des „Gegebenen“ markiert? Das ist zu viel gesagt, scheint es; denn am Beginn der kritizistischen Periode behält das theoretische Statut der Formen a priori der Sensibilität durch Bezug auf die Synthese a priori eine gewisse Zweideutigkeit. Kant wagt noch gar nicht, von der ursprünglichen Einheit der Apperzeption in direkter Linie die Kategorien und die Intuitionen a priori der Sensibilität herabsteigen zu lassen, wie ebensoviele gestufte Grade einer synthetischen Funktion selbst. Er ist daran gehindert durch die Unmöglichkeit,ausgehend von einer Einheit des Bewusstseins, die Formen des Raumes und der Zeit logisch zu deduzieren. Er beschränkt sich darauf, ihre Zugehörigkeit zum Bewusstsein und die notwendige Unterordnung ihres objektiven Gebrauchs unter die Gesetze des Verstandes festzustellen. Dieser 74 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 Dualismus, unvollkommen reduziert, vom sinnlichen Apriori und dem Apriori des Verstandes besteht weiter, selbst in der zweiten Auflage der Kritik, wo trotzdem die vorauseilenden Zeichen einer homogeneren Theorie erscheinen. Herr Lachièze-Rey, der bevorzugt in seiner Studie des „kantschen Idealismus“ das Problem der Konstruktion des Ich ins Auge fasst, fasst wie folgt die Aporien zusammen, deren Komplexität wir oben versucht haben, erahnen zu lassen: „So scheint die Verknüpfung [der zwei Ich, empirisch und transzendental] nicht realisierbar, weder durch einen direkten Bezug der Empfindung [der des inneren Sinns] auf das Objekt-Ich1 , da die Empfindung blind ist und nicht dazu dienen kann, den Term zu spezifizieren, den wir ihr korrespondieren lassen, 1 Das „Ich an sich“ ist durch die innere Sinneswahrnehmung nicht besser „bestimmbar“, als das Ding an sich durch die äußere Sinneswahrnehmung 98 – noch durch eine Anleihe beim bestimmenden Ich [Ich der reinen Apperzeption] betrachtet als Objekt, weil das System, das wir gerade im Begriff sind zu konstruieren und das wir empirisches Ich nennen, nicht das Phänomen des bestimmenden Ich sein kann2 , 2 Denn das bestimmende Ich ist das transzendentale Subjekt und nicht ein „Subjekt an sich“ – noch durch eine Berufung auf das allgemeine System der Erfahrung, denn dieses System kann wohl dazu führen, die Existenz des Objekts des inneren Sinns zu setzen, aber nicht dazu, es als Ich zu bezeichnen3 , 3 Das heißt als mit dem transzendentalen Ich ein einziges und selbes Subjekt bildend. 4 – noch durch einen Rückgriff auf einen den zwei anderen äußeren Term und den die zwei anderen offenbaren würden, jeder auf seine Weise, denn die Einheit wäre so zurückverwiesen in die Übersinnlichkeit, von der wir nichts affirmieren können, 4 Das heißt äußerlich sowohl zum empirischen Ich als auch zum tranzendentalen Ich – noch schließlich durch die Zulassung von zwei auf regressivem Wege5 erreichten Bedingungen, denn es müsste dann noch die Einheit dieser zwei Bedingungen bewiesen werden und ihr Recht auf dieselbe Benennung [der des Ich]6 gerechtfertigt werden.“ 5 Vergl. Lachièze-Rey zit.Op. S.168 6 P.Lachièze-Rey, zit.Op. S.163-164 Die „Vereinigung der zwei Ich“ in und für das Bewusstsein des Subjekts ist also nicht ein so leicht zu lösendes Problem. Recht und gut, Kant hat begonnen, in Übereinstimmung mit dem gesunden Menschenverstand, das Problem als gelöst zu betrachten. Er setzt auf Anhieb den Ablauf der kritischen Reflexion in den Rahmen eines individuellen noch nicht ungeteilten Ich. Er behauptet und bekräftigt ohne Beweise die radikale Einheit des sensitivo-rationalen Subjekts. In einer schon späten Epoche schreibt er: „Kann der der Veränderungen [seines Denkens] bewusste Mensch 75 Buch I: Kritik und System sich noch sehen als nur eines und dasselbe Subjekt (bezogen auf die Seele)? Die Frage ist ohne Nachdruck; denn er ist sich dieser Veränderungen nur bewusst geworden, indem er sich sich selbst vorstellt als ein in der Mannigfaltigkeit seiner Zustände identisches Subjekt. Das Ich des Menschen ist sicherlich ein doppeltes1 bezüglich der Form (das heißt, was den Modus der Repräsentation betrifft, den man sich davon macht), jedoch nicht bezogen auf die Materie2 “ 1 Empirisches Ich und transzendentales Ich 2 Kant, Anthropologie, §4, Endnote (Ak, Bd. VII S.141-142) 99 Um in aller kritischen Strenge diesen Satz, (der etwas behauptet, was mehr ist als die logische Einheit des Bewusstseins), muss man in der intuitiven Aktivität des empirischen Ich voraussetzen eine direkte oder indirekte Erfassung des ursprünglichen synthetischen Prinzips (in anderen Ausdrücken, des bestimmenden Ich), das sie steuert. Wir haben weiter oben gesagt (S.94-95), was zu diesem Thema das Denken Kants war und welche Schwierigkeiten sich daraus ergeben. Im übrigen – und das ist vielleicht hier die Wurzel des ganzen Problems3 – 3 In diesem Sinn, wenn auch nicht in diesen Ausdrüvken, entwickeln sich die scharfsinnigen Bemerkungen von B. Erdmann (Kritizismus, S. 220-221) und von De Vleeschauwer (Deduction transcendentale passim, vor allem II, S.408 ff., 592-593 und III, S.228-229) wenn man selbst zulässt, dass die Identität des „Ich“, als universeller apperzeptiver Index, analytisch gegeben ist in der ursprünglichen Relation, die sich knüpft zwischen den bewussten Elementen, insofern sie bewusst sind4 4 „Denn das stehende und bleibende Ich (der reinen Apperzeption) macht das Correlatum aller unserer Vorstellungen aus, so fern es bloss möglich ist, sich ihrer bewusst zu werden...“ (KRV A, S. 123) 100 wie ist dann kritisch zu beweisen, dass dieser abstrakten Einheit, der logischen Einheit des „Objekts“, notwendig die ursprüngliche (=primitive) funktionale Einheit eines transzndentalen „Subjekts“, absoluter Höhepunkt in der Stufenfolge der konstitutiven Bedingungen a priori des Objekts entsprechen müsste? Wenn man aufsteigt vom empirisch Gegebenen zum Objekt, scheint die für die Objektivierung (für die Universalisierung des Gegebenen) erforderliche synthetische Einheit schon realisiert auf dem Niveau der Kategorien: das transzendentale Ich, verstanden jenseits der Kategorien als ursprüngliche Spontaneität, als höchste Bedingung a priori, einzig und unbedingt, könnte strenggenommen in sich nur eine problematische Interpretation der abstrakten Einheit des Bewusstseins als solchem (vom „Bewusstsein überhaupt“) sein, in subjektiven Ausdrücken; etwas wie eine ideale Grenze, unwirklich, der Konvergenz von kategorialen Funktionen, ein „transzendentaler Schein“, ein trügerisches Analogon der logischen Einheit. In diesem Fall ergibt sich die Frage: Könnte die transzendentale Einheit des Ich als Subjekt, als funktionaler Gipfel des Bewusstseins, wenn es existiert, sich unserem Bewusstsein anders aufzwingen als 76 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 in einer Art primitiver Intuition des Ich durch sich selbst? Muss man so die metasensible Wahrnehmung interpretieren – die uns Kant zuschrieb (siehe oben S. 94-95) – der Existenz des „denkenden Ich“ insofern es höchste „Fakultät der Synthese“ ist? Im bejahenden Fall müsste das transzendentale Ich konzipiert werden nicht mehr nur wie eine logische Einheit unserer partikulären Apperzeptionen, noch nur als Schlussstein des Baus der Bedingungen a priori, sondern neben anderem als ein Denken fähig, sich selbst zu begreifen, in seiner Ordnung, entsprechend dem wesentlichen Attribut, das aus ihr ein ursprüngliches Prinzip der Synthese macht. Sagen wir, in Vorausnahme der Terminologie von Fichte oder von Hegel, dass das transzendentale Ich konzipiert werden müsste, nicht nur als „Gedanke“, sondern als „Geist“. Auf der Ebene selbst des „ich denke“ (unter Ausschluss der Ebene des „Dings an sich“ und der Phänomene), würde das „ich bin“, Wesen und Existenz alles zusammen hier in die transzendentale Philosophie hinein gleiten. Aber diese hypothetische Interpretation übersteigt offensichtlich die in der Kritik der reinen Vernunft festgehaltene Lehre1 . 1 Aber urteilen wir nichts voraus über das, was uns vielleicht die zwei anderen Kritiken und die weiteren Arbeiten des Philosophen lehren werden. Eine letzte Schwierigkeit. Das Bewusstsein das wir nach Kant nehmen werden vom transzendentalen Ich als reine Existenz, muss sich übersetzen in eine Affirmation. Wird diese Affirmation kategorial oder metakategorial sein? Sie könnte nur kategorial sein, wenn die behauptete Existenz repräsentiert wäre in der Zeit, als Phänomen (aber das wäre so die Existenz eines empirischen Ich, nicht eines transzendentalen Ich). Es bleibt nur, dass die Kritik uns die metakategoriale Affirmation einer Existenz unterbreitet, beraubt jeder kategorialen Bestimmung des Wesens und der Modalität. Kant wird in diesem Sinn gegen 1793 schreiben: 101 „Vom Ich nach seiner ersten Bedeutung (das heißt vom apperzeptiven Subjekt) des logischen Ich insofern es Repräsentation a priori ist, gibt es nichts mehr zu erkennen: weder sein Wesen, noch seine natürliche Zusammensetzung (Konstitution). Dieses Ich ist [für uns] etwas Analoges zu [dem, was] die Substanz [wäre], beraubt aller Akzidentien, die ihr inhärent wären, und beraubt also absolut jeder weiteren Erkenntnis, weil die Akzidenzien genau das wären, was sie uns erkennbar machen würden.2 “ 2 Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolff, Ak. Bd.XX, S.270 Nun aber, so das Ich erkennen, unter Abstraktion von jeder partikulären Bestimmung, das ist, fügt er hinzu, „das Subjekt, wie es an sich ist im reinen Bewusstsein, keineswegs als Rezeptivität, sondern als reine Spontaneität3 “ 77 Buch I: Kritik und System 3 Ebenda – Hier ist das „reine Subjekt“ gedacht als „Subjekt an sich“ wenige Jahre später, im Opus postumum, wird es die Funktion des „Dings an sich“ annehmen Nach diesem Fragment wird also das Bewusstsein des transzendentalen Ich erhalten durch eine Art von „phänomenologischer Reduktion“ ausgehend vom Ich-Objekt (des empirischen Ich). Wie ist vom kantschen Gesichtspunkt aus das Urteil, in dem es als Residuum dieser Operation behauptet würde, zu bezeichnen? 5˚ Die Bipolarität des „Objekts“ Die vorausgehenden Seiten haben uns ständig vor den kantschen Begriff des Objekts zurückgebracht. 1772 in einem wichtigen Brief von Kant an Markus Herz1 1 Siehe Heft III, 1.Aufl. S. 53, 3.Auflage S.77-81 hatte das kritische Problem die folgende Formulierung erhalten: „Auf welchem Fundament beruht die Beziehung zwischen dem, was man in uns Repräsentation (Vorstellung) nennt, und dem Objekt2 ?“ 2 Kant an M. Herz, 21.Feb. 1772, Ak. Bd.X (Briefwechsel I2) S.121 Die Beziehung zum Objekt (“die Beziehung auf den Gegenstand“) bezeichnete hauptsächlich die Beziehung auf das Objekt an sich, auf das „Ding an sich“. Wir sagen: „hauptsächlich“, weil die Aufmerksamkeit Kants sich auch auf das mathematische Objekt erstreckte, immanentes Produkt der konstruktiven Aktivität des Subjekts3 , aber um es außer Frage zu setzen. 3 102 Ebenda, S. 125 Es wäre interessant, aber es ist überhaupt nicht unsere Aufgabe, in den Jahren, die der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft vorausgingen, die Veränderung der Verinnerlichung des kantschen Begriffs des Objekts und die parallele Transformation des Begriffs der Wahrheit zu beobachten. Diese Verlagerung scheint vollendet, oder es fehlt nicht viel daran, gegen das Jahr 4 1775 4 Wenn man dem Duisburgschen Nachlass Glauben schenkt. Siehe Th. Haering Der Duisburgsche Nachlass und Kants Kritizismus um 1775, Tübingen 1910, S.122 ff. und H.J.Vleeschhauwer La Deduction transcendantale t. I, Anvers-Paris, 1934, S.263-265 1781 präsentiert sich in der Kritik das Problem der logischen Wahrheit ganz entschieden als das Problem der Teilhabe der Begriffe a priori an der Konstitution des immanenten Objekts. Dennoch bleibt immer das Ding an sich einklagbar für den Ursprung der Sinneswahrnehmung, und die sinnliche Anschauung bringt nur die rohen Materialien, aus denen das Objekt konstruiert werden wird. Lesen wir die ersten Zeilen der transzendentalen Ästhetik 5 5 KRV A, S.19 „Auf welche Weise und durch welche Mittel auch immer eine Erkenntnis sich auf Objekte beziehen kann, der Modus durch den 78 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 sie sich unmittelbar auf sie bezieht ... ist die Intuition (Anschauung). Aber diese Intuition findet nur statt, soweit das Objekt uns gegeben ist, und das Objekt wiederum kann uns nur gegeben werden (wenigstens uns anderen Menschen, fügt die Ausgabe B hinzu) unter der Bedingung, dass sie den Geist auf eine bestimmte Weise affiziert. Die Fähigkeit aufzunehmen (die Aufnahmefähigkeit der Repräsentationen) vermittels der Weise in der wir durch die Objekte affiziert werden, nennt sich Sinneswahrnehmung6 “ 6 Unterstreichung von uns – Die wiederholte Verwendung des Wortes Ich „Objekt“ in der Sprache des gesunden Menschenverstands, das heißt von „Ding an sich“; oder aber, wenn er diesem Wort eine technische Bedeutung gibt, versteht er unter „Objekt“, in der ersten Phrase die immanenten phänomenalen Objekte und in den folgenden Sätzen die Dinge an sich, die die Sinneswahrnehmung affizieren. Siehe zu diesem Thema Vaihinger, Commentar, I, S.6-9 [Originaltext von Kant:] Auf welche Art und durch welche Mittel sich auch immer eine Erkenntnis auf Gegenstände beziehen mag, es ist doch diejenige, wodurch sie sich auf dieselbe unmittelbar bezieht, und worauf alles Denken als Mittel abzweckt, die Anschauung. Diese findet aber nur statt, sofern uns der Gegenstand gegeben wird; dieses aber ist wiederum nur dadurch möglich, daß er das Gemüt auf gewisse Weise affiziere. Die Fähigkeit (Rezeptivität), Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Keine objektive Erkenntnis ohne eine Anschauung, durch die uns ein Objekt gegeben wird. Dieselbe Erklärung findet sich am Anfang der transzendentalen Logik 1 : 1 103 KRV A, S.50-51 Um ein Objekt zu erkennen genügt es nicht, es zu denken (durch Begriffe), man muss davon die Anschauung haben. Diese Lehre ist ebenso die der zweiten Auflage, wo die Stellen, die wir gerade zitieren, ohne Veränderung wiederkehren2 . 2 KRV B, S.33, und 74-75 Und hier jetzt die klassische Definition des Objekts nach Kant: „Das Objekt ist das, wovon der Begriff die verschiedenen Elemente einer gegebenen Anschauung vereinigt [wörtlich: das im Begriff, wovon die Mannigfaltigkeit einer gegebenen Intuition vereinigt ist]3 “ 3 KRV B S.137 [Original Kant:]Objekt aber ist das, in dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist. Um eine objektive Erkenntnis zu konstituieren, muss also ein intuitiver Inhalt – beim Menschen ein Inhalt der (rezeptiven) sinnlichen Intuition – in einem Begriff vereinigt sein, das heißt, vermittels irgendeiner der Kategorien bezogen werden auf die Einheit des Bewusstseins. Selbst ohne einzutreten in eine detaillierte Analyse, kann man sehen, dass die kantsche Definition das Objekt des Bewusstseins zwischen zwei festen Punkten aufhängt und sozusagen 79 Buch I: Kritik und System 104 zwischen zwei entgegengesetzten Polen: auf der einen Seite, durch die Kategorien, der höchsten Einheit des Ich, auf der anderen Seite durch die sinnliche Anschauung, das „Ding an sich“, undurchdringlicher Hintergrund (Grund ), der die Relativität der phänomenalen Gegebenheiten verrät. Hat dieser Begriff des Objekts einen präzisen Sinn? Ja, wenn jedes seiner konstitutiven Elemente in der kantschen Epistemologie einen definierten und konstanten Wert behält. Stellen wir uns zuerst eine einfache Frage, eine so natürliche, dass Kant nicht verfehlen konnte, sie sich zu stellen, wenigstens eine entsprechende: Welches von den in der Definition des bewussten Objekts gruppierten Elementen bestimmt in spezieller Weise die Objektivität dieses Objekts? Ist es die Beziehung des Inhalts des Bewusstseins zur formellen Einheit von diesem? Ist es der intuitive Ursprung des Inhalts des Bewusstseins, – mit oder ohne Konnotation des „Dings an sich“? Viele Texte – wir haben welche weiter oben zitiert – schreiben im gegenwärtigen Fall der Intuition (Anschauung) eine entscheidende Rolle zu. Man muss hier mehr aus der Nähe zusehen. Am Anfang der transzendentalen Logik werden Daten der Intuition und formaler Gedanke in gleicher Weise gefordert und klar unterschieden im Inneren des Objekts: „Unsere Natur will, dass die Intuition nie [für uns] anders als sinnlich sein könne, das heißt nichts anderes enthalten könne als die Materie, von der wir durch die Objekte affiziert werden4 ...“ 4 Es handelt sich offensichtlich hier um „Objekte an sich“. Siehe weiter oben S.102, Anmerkung 3 „Ohne die Sinnesfähigkeit wäre uns kein Objekt gegeben; ohne Verstand wäre keines gedacht. Gedanken ohne Materie sind leer; Anschauungen ohne Begriffe sind blind5 “. 5 KRV A, S. 52; B S.75 [original Kant] Unsere Natur bringt es so mit sich, daß die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann, d. i. nur die Art enthält, wie wir von Gegenständen affiziert werden. Dagegen ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, der Verstand. Keine dieser Eigenschaften ist der anderen vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Indem er also die Anschauung dem formalen Denken gegenüberstellt, scheint Kant weniger daran zu denken, sie jeweils zu charakterisieren durch die Gegenwart oder Abwesenheit eines Vorstellungs-Inhalts als eine gewisse Qualität der Evidenz zu unterstreichen, den sie durch den Anschuungsinhalt kraft ihres Ursprungs selbst besitzt. In der intellektuellen Intuiton, wenn sie uns möglich wäre, würde sich der Inhalt (vollkommen a priori bestimmtes Wesen und Existenz) apodiktisch aufzwingen, als autonome Produktion des Subjekts. In der sinnlichen Intuition ist der Inhalt primitiverweise „gegeben“: er zwingt sich noch auf, aber von außen, durch undurchsichtigen Zwang. Von beiden 80 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 105 Seiten stellt die Intuition also ursprünglich einen lebendigen Kontakt her, ein „existenzielles“ Band zwischen formalem Bewusstsein und etwas Absolutem, Indiskutablen, das wohnt entweder über oder außerhalb der Hierarchie der Formen. Die sinnliche Intuition wäre also Faktor der Objektivität, weniger als einzige Lieferantin des Inhalts, als wie eine Abnehmerin der Realität, als subjektiver Reflex (Erscheinung) eines „Dings an sich“. Diese Interpretation verschiedener Texte von Kant ist plausibel unter der Bedingung, das Ding an sich nicht als Term in die Beziehungen der objektiven Wahrheit einzuführen, von der die Kritik Kenntnis haben kann. Aber nichts hindert daran, dass diese immanenten Beziehungen einen äußeren und absoluten Anknüpfungspunkt haben im Ding an sich. Leider – das ist eine erste Schwierigkeit, die unsere Exegese unsicher macht, ohne ihr jede Wahrscheinlichkeit zu nehmen – zeigt sich dem Leser der Kritiken der Begriff des „Dings an sich“ mit einem halben Dutzend von Bedeutungen, von denen mehrere kaum die oben angeführte Hypothese unterstützen. Stellen wir fest, dass man bei Kant nicht allzuschnell unter den kleinsten Varianten des Ausdrucks Verschiebungen der Idee annehmen muss. Dennoch bleiben, so scheint uns, in der Kritik der reinen Vernunft zwei entgegengesetzte Weisen, das Band des Dings an sich mit dem Subjekt zu verstehen: – entweder ist die Affirmation von „Dingen an sich“ abgeleitet von der inneren Relativität der Phänomene; das Ding an sich ist für unser Bewusstsein eine logische Abhängigkeit vom Phänomen; – oder die Affirmation von „Dingen an sich“ ist primitiv und a priori; sie geht ursprünglich über in einen transzendentalen Anspruch nach objektivem Absolutem, welcher dem rohen Phänomen begegnend uns dessen Relativität aufdeckt, indem es dieses [Phänomen?] übersteigt und „begrenzt“. In der ersten Hypothese, die direkt aus der Relativität des Phänomens eine Relativität ad extra = nach außen macht, die Theorie der Affinität, von Kant entworfen, würde nach Adickes1 eine „transzendentale Affektion“ des Ich erfordern, durch das Reale an sich an jedem Punkt des plötzlichen Auftauchens (der Emergenz) von einem phänomenalen Gegebenen. 1 E. Adickes Kants Lehre von der doppelten Affektion unseres Ich, Tübingen, 1929. Vergl. besonders (2. Abschnitt), die Unterscheidung zwischen „die transzendentale Affektion“ und „die empirische Affektion“. In der zweiten Hypothese, wo die entscheidende Rolle in der Affirmation von Dingen an sich der Spontaneität des Subjekts zugeteilt ist, ist die Frage der Natur und des Ursprungs der Phänomene durchaus nicht dadurch entschieden und es bleibt möglich, jede „Affektion“ des Ich (das heißt jede Erwerbung eines partikulären Inhalts der Repräsentation) auf einen immanenten Prozess zu reduzieren; aber heißt das nicht gerade, den ersten Schritt zu machen auf einen ganz radikalen Idealismus zu? Zu Gunsten der einen und der anderen Hypothese können Texte der Kritik angeführt werden. Eine zweite Schwierigkeit, der die Hypothese einer objektivierenden Rolle 81 Buch I: Kritik und System 106 der Intuition als Empfängerin der Realität begegnet, entwickelt sich aus einer Reihe von Texten, die darauf abzielen, die Rolle der aktuellen Intuition zu verringern und folglich den indirekten Einfluss des Dings an sich in der Konstitution des Objekts als Objekt zu vernachlässigen. Zuerst diese merkwürdige Stelle der ersten Auflage, hervorgehoben und unterschiedlich eingeschätzt von den besseren Kommentatoren: „Wenn die Objekte, mit denen sich unsere Erkenntnis beschäftigt, Dinge an sich wären, könnten wir davon keine Begriffe a priori haben. Woher könnten wir sie tatsächlich beziehen? [...] Dagegen, wenn wir es überall nur mit Phänomene zu tun kriegen, ist es nicht nur möglich sondern notwendig, dass gewisse Begriffe a priori der empirischen Erkenntnis der Objekte vorausgehen. Tatsächlich konstitutieren sie als Phänomene ein Objekt, das nur in uns existiert, da eine reine Modifikation unserer Sinnlichkeit sich nur in uns, keineswegs außerhalb von uns befindet [Hervorhebung von uns]. Nun aber lässt gerade diese Betrachtung, nämlich dass alle diese fraglichen Phänomene und folglich alle Objekte, mit denen wir uns befassen können, in mir residieren, das heißt, Bestimmungen meines identischen Ich sind, die Notwendigkeit einer vollkommenen Einheit dieser Phänomene in einer einzigen und selben Apperzeption von neuem hervortreten. Aber in dieser Einheit der möglichen Erkenntnis [Hervorhebung von uns] besteht genau die Form jeder Erkenntnis der Objekte (das wodurch die Mannigfaltigkeit gedacht wird als zu einem Objekt gehörend). Die Art nach der die Vielfalt der sinnlichen Repräsentation (Intuition) zur Einheit eines Bewusstseins gehört, geht also jeder objektiven Erkenntnis voraus, wie etwas, was die intellektuelle Form davon ist, und konstituiert selbst eine formartige Erkenntnis a priori aller Objekte im allgemeinen, insofern sie gedachte Objekte (Kategorien) sind. [...] Reine Begriffe des Verstandes sind also a priori möglich, – und selbst, bezogen auf die Erfahrung notwendig, – aus diesem einzigen Grund, weil unsere Erkenntnis nur Phänomene enthält, deren Möglichkeit in uns liegt, deren gedanklicher Zusammenhang und Einheit (in der Repräsentation eines Objekts) sich nur in uns findet, und folglich jeder Erfahrung vorausgehen muss, indem sie diese zuerst, was die Form betrifft, möglich macht1 “ 1 KRV A S.129-130 [original Kant:] Wären die Gegenstände, womit unsere Erkenntnis zu tun hat, Dinge an sich selbst, so würden wir von diesen gar keine Begriffe a priori haben können. Denn woher sollten wir sie nehmen? Nehmen wir sie vom Objekt (ohne hier noch einmal zu untersuchen, wie dieses uns bekannt werden könnte) so wären unsere Begriffe bloß empirisch, und keine Begriffe a priori. Nehmen wir sie aus uns selbst, kann das, was bloß in uns 82 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 ist, die Beschaffenheit eines von unseren Vorstellungen unterschiedenen Gegenstandes nicht bestimmen, d. i. ein Grund sein, warum es ein Ding geben solle, dem so etwas, als wir in Gedanken haben, zukomme, und nicht vielmehr alle diese Vorstellung leer sei. Dagegen, wenn wir es überall nur mit Erscheinungen zu tun haben, so ist es nicht allein möglich, sondern auch notwendig, daß gewisse Begriffe a priori vor der empirischen Erkenntnis der Gegenstände vorhergehen. Denn als Erscheinungen machen sie einen Gegenstand aus, der bloß in uns ist, weil eine bloße Modifikation unserer Sinnlichkeit außer uns gar nicht angetroffen wird. Nun drückt selbst diese Vorstellung: daß alle diese Erscheinungen, mithin alle Gegenstände, womit wir uns beschäftigen können, insgesamt in mir, d. i. Bestimmungen meines identischen Selbst sind, eine durchgängige Einheit derselben in einer und derselben Apperzeption als notwendig aus. In dieser Einheit des möglichen Bewußtseins aber besteht auch die Form aller Erkenntnis der Gegenstände, (wodurch das Mannigfaltige, als zu Einem Objekt gehörig, gedacht wird). Also geht die Art, wie das Mannigfaltige der sinnlichen Vorstellung (Anschauung) zu einem Bewußtsein gehört, vor aller Erkenntnis des Gegenstandes, als die intellektuelle Form derselben, vorher, und macht selbst eine formale Erkenntnis aller Gegenstände a priori überhaupt aus, sofern sie gedacht werden (Kategorien). Die Synthesis derselben durch die reine Einbildungskraft, die Einheit aller Vorstellungen in Beziehung auf die ursprüngliche Apperzeption gehen aller empirischen Erkenntnis vor. Reine Verstandesbegriffe sind also nur darum a priori möglich, ja gar, in Beziehung auf Erfahrung, notwendig, weil unser Erkenntnis mit nichts, als Erscheinungen zu tun hat, deren Möglichkeit in uns selbst liegt, deren Verknüpfung und Einheit (in der Vorstellung eines Gegenstandes) bloß in uns angetroffen wird, mithin vor aller Erfahrung vorhergehen, und diese der Form nach auch allererst möglich machen muß. 107 Der idealistische Ton dieser Entwicklung kann nicht verfehlen, zu verblüffen. Man versichert uns, nicht nur, dass das Objekt konstituiert ist aus Phänomenen und dass es, wie sie, dem Subjekt immanent ist, sondern dass die Bedingungen, die das Phänomen in der Immanenz des Subjekts zum Objekt aufbauen, dieselben sind, die diese Phänomene auf die Einheit des apperzeptiven Ich beziehen: die Phänomene werden Objekte, weil sie im bewussten Subjekt den (dauernden) Bedingungen a priori ihrer eigenen Möglichkeit als Phänomenen begegnen. „In der Einheit des möglichen Bewusstseins besteht die Form jeder Erkenntnis der Objekte, das heißt, das wodurch die Mannigfaltigkeit [der Sinneswahrnehmung] gedacht wird als zu einem Objekt gehörig1 “ 1 Zitierte Stelle – Für die empiristischen Philosophen war der Begriff des Objekts der einer dauernden Möglichkeit bestimmter Sinneswahrnehmungen. Kant spricht hier eine analoge Konzeption aus. Anderswo (KRV B, S.345) schreibt er: „Der (allgemein begangene) Irrtum ... besteht darin, zu glauben, dass die Objekte, das heißt die möglichen Intuitionen sich richten müssen nach den Begriffen und nicht die Begriffe nach den möglichen Intuitionen wie nach den einzigen Bedingungen, die ihre objektive Geltung grundlegen. (Das scheint uns zurückzuwerfen auf die Bedingungen der sinnlichen Intuition; aber lesen wir den Text weiter). Die Ursache dieses Irrtums wiederum ist, dass die Apperzeption und mit ihr der Gedanke jeder möglichen bestimmten Ordnung der Repräsentationen vorausgeht. Wir konzipieren also etwas im allgemeinen, und wir bestimmen es durch eine sinnliche Art, usw.“ Es scheint also, dass das immanente Objekt, obwohl es einen Inhalt von anschaulichem Ursprung verlangt, seine Form als Objekt einzig von der intellektuellen Spontaneität des Subjektes erhält. Wäre dieser Gesichtspunkt ein 83 Buch I: Kritik und System besonderer der ersten Auflage, die, wie wir wissen, des Idealismus verdächtig war? Nein zweifellos, denn man insistiert dort an anderen Stellen auf der objektiven Bedeutung der Intuition als solcher. Dem gegenüber enthalten die Prolegomena und die zweite Auflage der Kritik, trotz der sichtbaren Vorsicht den Vorwurf des Idealismus zu vermeiden, mehr als eine Stelle, die die Objektivität des Objekts in spezieller Weise verknüpft mit der höheren Einheit der Apperzeption. Zeugen dafür sind unter anderem diese zwei Texte2 : 2 Zitiert im Heft III, 3.Aufl. S.156 und Anmerkung 3 „Jede Erfahrung enthält außer der sinnlichen Intuition, durch welche etwas gegeben ist, den Begriff eines Objekts, [das gegeben ist] als Phänomen in dieser Intuition: es gibt also Begriffe von Objekten im allgemeinen [Hervorhebung von uns], die, wie eine Bedingung a priori, als Fundament für jede Erkenntnis von Erfahrung3 dienen“ 108 3 KRV A, S.93; B S.126 [original Kant] Unter den mancherlei Begriffen aber, die das sehr vermischte Gewebe der menschlichen Erkenntnis ausmachen, gibt es einige, die auch zum reinen Gebrauch a priori (völlig unabhängig von aller Erfahrung) bestimmt sind, „Im allgemeinen etwas als Objekt4 denken“: siehe da die Funktion der Begriffe a priori 4 Ebenda Auch definieren sich die Kategorien, als „die Begriffe eines Objekts im allgemeinen, mittels derer die sinnliche Intuition dieses Objekts betrachtet wird als bestimmt durch Beziehung zu einer der logischen Funktionen des Urteils5 “ 5 KRV B, S.128 [original Kant] Sie sind Begriffe von einem Gegenstande überhaupt, dadurch dessen Anschauung in Ansehung einer der logischen Funktionen zu Urteilen als bestimmt angesehen wird. So war die Funktion des kategorischen Urteils die des Verhältnisses des Subjekts zum Prädikat, Daraus scheint sich zu ergeben, dass der Verstand wesentlich eine objektivierende Funktion ist, das Objekt im allgemeinen setzend, während die sinnliche Intuition, rein materielle Erfassung einer Realität an sich. unserer Erkenntnis des „Objekts im allgemeinen“ nur eine komplementäre, partikularisierende Mannigfaltigkeit bietet1 . 84 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 1 Genauso, im objektiven Bewusstsein von uns selbst (Bewusstsein des „empirischen Ich“), „das was das Objekt konstituiert, das ist nicht das Bewusstsein des bestimmenden Ich, sondern nur das des bestimmbaren Ich, das heißt das meiner inneren Intuition, insofern als (das merken wir an), das Mannigfaltige, das sie enthält, der allgemeinen Bedingung, der Einheit der Apperzeption im Denken entsprechend, verbunden werden kann.“ (KRV B S. 407) [Original Kant:] Also erkenne ich mich nicht selbst dadurch, daß ich mich meiner als denkend bewußt bin, sondern wenn ich mir die Anschauung meiner selbst, als in Ansehung der Funktion des Denkens bestimmt, bewußt bin. Alle modi des Selbstbewußtseins im Denken an sich, sind daher noch keine Verstandesbegriffe von Objekten, (Kategorien) sondern bloße Funktionen, die dem Denken gar keinen Gegenstand, mithin mich selbst auch nicht als Gegenstand, zu erkennen geben. Nicht das Bewußtsein des Bestimmenden, sondern nur die des bestimmbaren Selbst, d. i. meiner inneren Anschauung (sofern ihr Mannigfaltiges der allgemeinen Bedingung der Einheit der Apperzeption im Denken gemäß verbunden werden kann), ist das Objekt. Zur Stützung dieser Bemerkung, könnte man noch die von Kant hergestellte enge Beziehung zwischen Objektivität und Universalität eines Inhalts des Bewusstseins anführen. Die sinnliche Repräsentation objektiviert sich, indem sie sich einem universellen Begriff unterordnet: die Universalität ist Zeichen der Objektivität. An die Zusammengehörigkeit dieser zwei Begriffe wird häufig erinnert. Aber wenige Stellen sind so instruktiv wie die Paragraphen 18 und 19 der Prolegomena. Unter den „empirischen Urteilen“ unterscheidet man die „Erfahrungsurteile“, die eine „objektive Gültigkeit“ besitzen, und die „Wahrnehmungsurteile“, deren Geltung nur „subjektiv“ ist (nur subjektiv gültig): 109 „Diese letzteren verlangen keinen reinen Begriff des Verstandes, sondern einzig die logische Verknüpfung, die die Wahrnehmungen in die Einheit eines denkenden Subjekts zusammenrückt. Die ersteren dagegen fordern immer außer den Repräsentationen der sinnlichen Intuition spezielle aus dem Verstand kommende Begriffe, die genau (präziese) bewirken, dass das Erfahrungsurteil objektiv gültig sei. Alle unsere Urteile sind zuerst einfache Urteile der Wahrnehmung, gültig für uns selbst, das heißt für uns, insofern wir Subjekte sind; danach nur versehen wir sie mit einer neuen Relation, – Relation eines Objekts – und wollen, dass [das Urteil] gültig sei, sowohl für uns selbst zu jeder Zeit und auch für jeden anderen. Tatsächlich, wenn ein Urteil sich mit einem Objekt verträgt, müssen alle Urteile, ausgesagt über dieses selbe Objekt, in gleicher Weise unter einander sich vertragen. So bezeichnet die objektive Geltung des Urteils der Erfahrung nichts anderes als die universelle und notwendige Geltung dieses Urteils. Aber umgekehrt, wenn wir irgendwelchen Grund haben, ein Urteil für universell und notwendig zu halten (diese Eigenschaften ergeben sich nie aus der Wahrnehmung, sondern aus einem reinen Begriff, unter dem die Wahrnehmung subsumiert ist), müssen wir durch die Tatsache selbst anerkennen, dass er objektiv ist, das heißt dass er nicht nur die Beziehung einer Wahrnehmung zu einem Subjekt 85 Buch I: Kritik und System ausdrückt, sondern eine konstitutive Bestimmung eines Objekts. Welchen Grund, tatsächlich, kann es geben dafür, dass die Urteile von anderen sich notwendig vertragen mit dem meinen, wenn nicht die Einheit des Objekts, auf welches alle sich beziehen und dessen Übereinstimmung mit jedem von ihnen auch die Übereinstimmung untereinander sicherstellt. §19. Objektive Geltung, notwendige Geltung und universelle (für jedes Subjekt), sind also vertauschbare Begriffe; und obwohl wir das Objekt an sich nicht kennen, unterscheiden wir dennoch, in der Universalität und folglich in der Notwendigkeit eines Urteils die objektive Geltung von diesem1 “ 1 110 Prolegomena, §§18 und 19, Ak. Bd. IV, S.298 Diesem Text fehlt es nicht an einem gewissen Interesse, denn er zeigt die jeweilige Geltung mehrerer, durch den kantschen Begriff des Objekts angebotener Züge: 10 Die Universalität und die Notwendigkeit eines Urteils; 20 Indem er die transsubjektive Geltung anmerkt, unabhängig von besonderen Subjekten; 30 Diese transsubjektive Geltung ist fundiert im transzendentalen Subjekt über die Apriorität, Quelle der Universalität; 40 Andererseits ist diese selbe transsubjektive Geltung gegründet außerhalb des Subjekts auf den „Dingen an sich“, dem einzigen konzipierbaren (ontologischen) Fundament der transsubjektiven Wahrheit der Urteile. Das Ding an sich erscheint also hier wie die „ratio essende [Seinsgrund]“, postuliert durch die Universalität des objektiven Begriffs. Merkwürdig ist, dass die objektivierende Eigenschaft der Intuition als unmittelbare Ergreifung einer Gegebenheit an dieser Stelle überhaupt nicht direkt geltend gemacht wird. Also, wir sehen mehr als einmal, dass im kantschen Begriff des Objekts eine Verschiebung des Schwerpunkts stattfindet gegen den höheren, apperzeptiven Pol hin. Diese Verschiebung erscheint im gleichen Maße von größerer Bedeutung, als die Objektivität des reinen Begriffs in der Kritik charakterisiert wird nicht nur durch die Beziehung des Begriffs zu einer möglichen empirischen Intuition sondern auch und noch näher daran durch die Beziehung des Begriffs zu den a priorischen Anschauungen des Raumes und der Zeit, logisch jeder empirischen Anschauung vorausliegend. Dieser Aspekt des Problems des sinnlichen Apriori muss uns weiter unten beschäftigen. Diese Betrachtung des niedrigeren Pols, des materiellen Pols des kantschen Objekts lässt also einen Zweifel an der exakten Rolle der sinnlichen Anschauung (und des Dings an sich) bei der Objektivierung bestehen. Die Unsicherheit wird nicht weniger, wenn man im höheren Pol des Objekts, der höchsten Einheit des Bewusstseins die „ursprüngliche Einheit der Apperzeption betrachtet.“ Die ursprüngliche apperzeptive Einheit offenbart sich der Reflexion zuerst 86 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 111 als eine analytische und formartige Einheit: genauer gesagt nicht eine abstrahierende Verallgemeinerung des materieartigen Inhalts des Bewusstseins sondern eine universelle Einheit, ununterschieden in den verschiedenen Inhalten des Bewusstseins, ihren gemeinsamen Verweis auf das Bewusstsein als solchem repräsentierend. Die ursprüngliche Einheit der Apperzeption öffnet also das unbegrenzte Feld des „ich denke“. Wie das kartesische „cogito (ich denke)“ schließt sie in ihrer logischen Ausdehnung genau so die rohen Repräsentationen der Sinneswahrnehmung ein, wie die Ideen der Vernunft, obwohl die ersteren und die zweiten durch sich selbst der objektiven Geltung beraubt sind. Die Apperzeption des Objekts wird häufig dargestellt, vor allem in der ersten Auflage der Kritik und in den Prolegomena als die Subsumtion des mannigfaltigen Inhalts des Bewusstseins unter die analytische universelle Einheit der Apperzeption1 . 1 Siehe z.B. Prolegomena, §§18 ff. Ak. Bd.IV, S.297 ff; KRV A S.68-69; B, S.93-94. Diese letztere Stelle, die sich in einem logischen und formalen Horizont entwickelt, führt ein in die metaphysische Deduktion der Kategorien. Mehrere Kommentatoren rücken sie zusammen mit den zwei ersten Seiten des Kapitels über den Schematismus (KRV A, S.137-140; B S. 176-179), in denen das Problem der Beziehungen zwischen empirischer Anschauung und reinen Begriffen gestellt ist in Ausdrücken der „Subsumption“- Kant macht uns andererseits darauf aufmerksam, dass es sich nicht um eine “formartige Subsumption“ der klassischen Logiker handelt, sondern um eine „transzendentale Subsumption2 “ 2 In einem Brief vom 11. X. 1797 an Tieftrunk (Ak, Bd. XII Briefwechsel III2, S.224-225), versucht Kant das zu erklären, was er eine „schwierige Stelle“ der Theorie des Schematismus nennt, durch die Unterscheidung zwischen „logischer Subsumption“, die „homogene“ Terme voraussetzt und unmittelbar ist, und der „transzendentalen Subsumption“, die, da sie „heterogene“ Terme vereinigt, die Vermittlung eines dritten Terms verlangt (hier die „transzendentale Bestimmung der Zeit“), der fähig ist, den Höhenunterschied der zwei Extreme wieder gut zu machen., (auszugleichen.) Gehen wir über diese Schwierigkeit hinweg, gut zu unterscheiden, wie die analytische (formartige) Einheit der Apperzeption im Bewusstsein, das wir davon nehmen, zuerst als universelle Form der Objekte3 für uns etwas sein kann, was mehr ist als ein vollkommen allgemeiner abstrakter Begriff von derselben Ordnung wie die, von Kant mit solcher Geringschätzung verworfenen, scholastischen “Transzendentalien“. 3 Die Art der Erkennbarkeit quoad nos der formartigen Einheit des Bewusstseins als universelle Form der Subsumption ist gar nicht so sehr evident; mindestens so wie der Satz: „Jedes bewusste Objekt bezieht sich auf die formartige Einheit des Bewusstseins“ nicht exakt denselben Sinn hat wie die Tautologie: „Jedes bewusste Objekt ist bewusst“. Aber so ist das Denken Kants nicht. In dieser Beziehung ist die Exegese der Stelle wie KRV B, §16, mit der Fußnote der Seite 134 vielleicht nicht so leicht, wie mehrere meinen. Wenn wir jedes Missverständnis hierzu als beseitigt voraussetzen, haben wir immer noch eine Klärung zu verlangen über einen Punkt, der uns hier direkter interessiert. Die apperzeptive analytische Einheit, betrachtet als universelle „Form“ der Subsumption, scheint nicht fähig, eigentlich objektive Repräsentationen zu konstituieren, es sei denn durch Vermittlung eines tatsächlich und dunkel schon mit einer objektivierenden Relation markierten Inhalts, wie die sinnlichen Daten. Anders nämlich wäre jeder Inhalt des Bewusstseins, bezogen 87 Buch I: Kritik und System 112 auf die Einheit von diesem „objektiv“, entgegen der Lehre der Kritik 4 . 4 Das ist im Grunde der Einwand, den sich Kant macht gegen den zu exklusiven subjektiven und „konstruierenden“ „Standpunkt“ von S. Beck (vgl. weiter unten, z.B. S.185, 209-211) Vor diesen Unsicherheiten der Interpretation, wagen wir nicht, zu behaupten, dass der kantsche Begriff des Objekts, weiter oben in Erinnerung gerufen, schon selbst im Denken Kants die vollkommene Stabilität erreicht habe. Er selbst hat das vage Gefühl einer Schwierigkeit: Wir werden weiter unten5 Notiz nehmen von dem Geständnis, das er darüber 1794 äußert gegenüber J.S.Beck, seinem Schüler und Korrespondenten. 5 Siehe Seite 192 §3. – Fortschritte des dynamischen Prinzips 1˚ Formartige Subsumtion und synthetischer Akt Die Geschichte des Problems des Objekts im kantschen Kritizismus ist die eines latenten Konflikts zwischen dem Standpunkt der „Form“ und dem Standpunkt des „Akts [=Handlung]“. Die erste Auflage der Kritik (1781) setzte die zwei Gesichtspunkte nebeneinander, ohne noch eine Versöhnung in der Tiefe zu versuchen: eine Theorie der Apperzeption-Subsumtion (objektive Deduktion, Gesichtspunkt der Form liegt dabei nebeneinander mit dem Versuch einer aufsteigenden Synthese des Objekts, der subjektiven Deduktion, dem Gesichtspunkt des Akts [Handlung])1 1 113 Vergl. Heft III, 1.Aufl. S.126 wichtige Anm. 3.Aufl. S. 154 b In den Prolegomena (1783), die die subjektive Deduktion weglassen, triumphiert, so scheint es, die Idee der Subsumtion, das heißt, eine wesentlich formartige und logische Konzeption des Transzendentalen, auf der ganzen Linie. Aber die transzendentale Deduktion der zweiten Auflage der Kritik nimmt das Thema der synthetischen Aktivität wieder auf und verstärkt es. Es wird gut sein, das Prinzip und die Tragweite dieses Umschwenkens zu untersuchen. Das Prinzip ist nichts anderes als dieser absolute Vorrang der Synthese gegenüber der Analyse, die, angefangen mit der Ersten Auflage der Kritik 2 behauptet wurde und danach ausdrücklicher formuliert wurde: jede analytische Einheit setzt eine entsprechende synthetische Einheit der Apperzeption voraus; die analytische Einheit der Apperzeption setzt eine synthetische Einheit der Apperzeption voraus; wenn die analytische Einheit absolut universell ist, ist die synthetische Einheit primitiv, ursprünglich3 . 2 KRV A S. 77-79, Stelle, die in B S.102-105 wiederaufgenommen wurde. KRV B §15, S. 120.131 mit Weiterklick zu folgenden §§; §16, S. 133-135; §17, S.135-138 Siehe Heft III, 3.Auflage, S.161, „Bemerkung“, und vergleiche mit den Seiten 156 und 173-174 (Die erste Ausgabe von Heft III, S.124-125 erklärt dieselbe Lehre, aber ohne den rechtfertigenden Text wiederzugeben). 3 Man ahnt die theoretische Wichtigkeit dieses Vorrangs der Synthese gegenüber der Analyse. 88 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 Die Synthese, um die es hier geht ist die synthetische Funktion, ins Auge gefasst entweder als aktueller Vollzug der Synthese oder als aktive Potenz der Synthese: der Sinn und der Buchstabe des Kontexts erlauben es nicht, die Bedeutung des Wortes „Synthese“ darauf zu beschränken, nur eine vollendete Synthese zu bezeichnen, ein formales Produkt der Synthese, eine Form der Einheit. In Wahrheit ist es das konkrete Produkt der Synthese, die zuerst unter das Bewusstsein fällt, das davon die Form der Einheit abstrahiert; aber diese Abstraktion – die eine Reflexion ist – wäre nicht möglich, wenn die Form der Einheit nicht in letzter Analyse resultieren würde aus einer rein synthetischen Bedingung a priori, die Kant nicht zögert, in der Sprache der Dynamik zu benennen: „Handlung“, „Aktivität des Verstandes“,“Akt der Spontaneität des Subjekts“ (Handlung; Verstandeshandlung; Aktus seiner [des Subjekts] Selbsttätigkeit)4 4 Zitierte Stelle. Einige Jahre später wird die Synthese, in diesem Sinne verstanden, ein Zusammensetzen genannt (und nicht ein „Zusammengesetzt sein“). Der Autor der Kritik gab sich vollkommen Rechenschaft über den von der ursprünglichen Funktion der synthetischen Einheit in der Hierarchie der Bedingungen a priori der Erkenntnis eingenommenen Platz. 114 „Er schreibt: die Kategorie setzt voraus die Verbindung“, das heißt „die Repräsentation der synthetischen Einheit der Verschiedenheit“. Tatsächlich „gründen alle Kategorien auf gewissen logischen Funktionen unserer Urteile. Nun aber ist in diesen schon eine Verbindung gedacht, und folglich eine Einheit der gegebenen Begriffe. Man muss also diese ... noch höhere Einheit suchen, da wo das Prinzip (der Grund ) der Einheit der verschiedenen Begriffe im inneren der Urteile residiert, anders gesagt: im Prinzip der Möglichkeit des Verstandes gerade im Gesichtspunkt seiner logischen Verwendung1 “ 1 KRV, B, §15, S.131 Die synthetische Funktion, von der wir sprechen, muss also alles zusammen beherrschen, die logische Verwendung und die transzendentale Verwendung des Verstandes: „Und so ist die synthetische Einheit der Apperzeption der höchste Gipfel, mit dem wir jede Verwendung des Verstandes, selbst die ganze Logik und nach ihr die transzendentale Philosophie verknüpfen müssen; denn diese [synthetische] Fähigkeit ist gerade der Verstand selbst2 “ 2 KRV, B, §16, S.133, Anmerkung Die Topographie der Funktionen des Verstandes mit dem synthetischen Akt auf dem Höhepunkt scheint also von Kant klar skizziert zu sein. Bevor wir 89 Buch I: Kritik und System darauf neue Entwicklungen abstützen, wird es dennoch klug sein, das einer aufmerksameren Prüfung zu unterziehen. Denn wir sind schon in der Kritik mehreren Ausdrücken begegnet, die ebenso einen „Höhepunkt“ unserer Erkenntnisfähigkeit bezeichnen. – Sind diese äquivalent? –: 1. Zuerst, die allgemeine logische Einheit, oder die logische Identität, Form des Denkens als solchem und nicht nur des diskursiven Denkens. Es kann dabei keine tiefere formale Einheit geben, weil es keine universellere gibt3 3 Vergl. KRV B, SS. 76-78, 82-85, 92-94; A, SS. 131, 398 Auf sie strebt wie auf eine Grenze zu „die logische Funktion des Urteils4 “. 4 KRV B, §20 S.143 diese Funktion, die die verschiedenen Repräsentationen (was auch immer sie seien, Intuitionen oder Begriffe) auf die Einheit eines „Bewusstseins im allgemeinen“ („zu einem Bewusstsein überhaupt5 “) bezieht. 5 115 Ebenda 2. Die reine objektive Einheit des Bewusstseins, verstanden als die Einheit auf die sich jede bewusste Repräsentation bezieht durch die Tatsache, dass sie bewusst ist. Das ist die Einheit des Ich im Ich denke 6 6 KRV A, S.398 3. Die ursprüngliche synthetische Einheit der Apperzeption, nach der wir weiter oben gefragt haben. Zu den schon angemerkten Charakterisierungen fügen wir hier noch hinzu: „Das Prinzip [der für die Apperzeption erforderlichen synthetischen Einheit] ist jedoch nicht anwendbar auf jeden möglichen Verstand, sondern nur auf den, dessen reine apperzeptive Aktivität, vollzogen in der Repräsentation des Ich bin noch nicht irgend einen mannigfaltigen Inhalt hervorbringt. Ein Verstand, in welchem das Mannigfaltige der Anschauung gegeben wäre durch das simple Bewusstsein seiner selbst, [mit anderen Ausdrücken] ein Verstand, wo die Repräsentation mit dem gleichen Schlag in der Existenz die Objekte dieser Repräsentation verwirklichen würde, ein solcher Verstand hätte keineswegs nötig einen partikulären synthetischen Akt, der das Vielfältige zur Einheit des Bewusstseins zurückführen würde1 ...“ 1 KRV, B, §17, SS. 138-139 Die synthetische Einheit der Apperzeption konstituiert also die höchste Einheit, nicht für jedes mögliche Bewusstsein, sondern für einen diskursiven, wesentlich auf einen sinnlichen Inhalt angewandten Verstand. Im übrigen wissen wir nicht, ob dieser Typ von Verstand assoziiert sein könnte mit einer von der unseren verschiedenen Sinnlichkeit oder nicht2 . 2 90 Ebenda S. 139 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 116 4. Die analytische Einheit der Apperzeption, das heißt die Form der Einheit, die die reine synthetische Einheit der Apperzeption ins Bewusstsein übersetzt. Diese zwei Einheiten, in uns zusammenhängende Aspekte der „objektiven Einheit“ des Bewusstseins, müssen gleichen Umfang haben, gleiches virtuelles Feld der Anwendung. Der Vergleich dieser vier parallelen Bezeichnungen lässt einige Fragezeichen auftauchen. Um von der analytischen Einheit aufzusteigen zur synthetischen Einheit der Apperzeption, sind zwei Wege durchführbar: a) Auf dem ersten Weg, die der Spur der Anmerkung von §16, S. 133 der Kritik (Ausgabe B) folgt, ist die Einheit, der man an erster Stelle begegnet, eine formartige Einheit. Tatsächlich, wenn man die analytische Einheit der Apperzeption mit den allgemeinen Begriffen vergleicht, macht Kant darauf aufmerksam, dass sie, wie diese, wahrgenommen im Inneren einer (möglichen oder wirklichen) Mannigfaltigkeit, von denen sie als gemeinsames Element erscheint; es ist in einem formartigen Produkt der Synthese, in einer Gruppierung von „Differenzen“, dass man der analytischen Einheit begegnet: „..Ich kann mir die analytische Einheit nur vorstellen unter der Bedingung, dass ich im Voraus eine mögliche synthetische Einheit konzipiere3 “ 3 KRV, B §16, S.133, Anmerkung Die analytische Einheit wird also immer sein die formartige Einheit von verschiedenen Elementen, repräsentiert – oder repräsentierbar – in unserem Bewusstsein; etwas wie die universelle des Platonismus: „die analytische Einheit des Bewusstseins verknüpft sich mit allen gemeinsamen Begriffen als solchen4 “ koinonÐa 4 tw̃n genw̃n Loc. cit. in letzter Analyse ergibt sie sich aus diesen; und folglich bleibt sie, nicht weniger als die differenzierte Menge, aus der sie sich ablöst, belastet mit einer notwendigen Relation zu einer Sinnlichkeit. Analyse und Synthese begrenzen sich hier gegenseitig; die objektive Einheit der Apperzeption, sowohl analytisch wie synthetisch, überschreitet hier nicht das Feld des kategorialen Seins (prädikamentales Seiendes der Scholastiker); sie zeigt sich wesentlich als die Einheit eines diskursiven Verstandes. b) Auf dem zweiten Weg, der dem Text der Paragraphen 15, 16 und 17 folgt, ist die synthetische Einheit der Apperzeption direkter deduziert als „Sponteneität“, als „synthetische Handlung“ kraft, so scheint es, einer (immanenten) Anwendung des „Prinzips der Vernunft1 “ 1 Siehe weiter oben S. 113-114, den zitierten Text: „Also müssen wir diese Einheit noch höher suchen, nämlich in demjenigen, was selbst den Grund der Einheit verschiedener Begriffe in Urteilen, mithin der Möglichkeit des Verstandes sogar in seinem logischen Gebrauche enthält“ (KRV, B, §15, S. 131) vergleichbar mit jenem, das uns schließen lässt auf Bedingungen a priori einer Repräsentation. Der erste Weg war analytisch; dieser ist „transzendental“. Erinnern wir nur an ein paar Texte; der erste betrifft die „Verbindung im 91 Buch I: Kritik und System allgemeinen“: „Die [Vernunft] ist ein Akt der Spontaneität der Fähigkeit zur Repräsentation; und da man diese Spontaneität Verstand nennen muss, um sie von der Sinnlichkeit zu unterscheiden, ist jede Verbindung – ob wir davon Bewusstsein haben oder nicht, ob sie verschiedene Elemente der Intuition oder verschiedene Begriffe einschließt und ob, im ersten Fall die Intuition sinnlich ist oder nicht – jede Verbindung, sage ich, ist ein Akt des Verstandes. Wir bezeichnen diesen Akt mit dem gemeinsamen Namen der Synthese, um dadurch verstehen zu machen, dass wir uns nichts als im Objekt verknüpft vorstellen können, ohne es vorher [im Verstand] selbst verknüpft zu haben, und dass, von allen Repräsentationen, die Verbindung die einzige ist, die uns nicht geliefert werden kann durch die Objekte, sondern nur durch das Subjekt selbst, weil es ein Akt von dessen Spontaneität ist. Es ist hier leicht zu bemerken, dass dieser Akt ursprünglich einer sein muss und sich in gleicher Weise auf jede Verbindung anwenden muss [Hervorhebung von uns], und dass die Zergliederung, die Analyse, die ihr Gegenteil zu sein scheint, sie immer voraussetzt; denn wo der Verstand nichts verbunden hat, kann er auch nichts herauslösen, denn es ist allein durch ihn, dass das verbunden werden konnte, was der repräsentativen Fähigkeit in solcher Weise gegeben ist2 “ 117 2 KRV, B, §15 S.129-130 Der zweite Text macht die Anwendung von dem, was vorausgeht: „Ich habe also ein Bewusstsein eines identischen Ich bezogen auf die Mannigfaltigkeit der Repräsentationen, die mir gegeben sind in einer Intuition, denn ich nenne mein alle diese Repräsentationen die daraus nur eine einzige [analytische Einheit] konstituieren. Nun aber kommt das darauf hinaus zu sagen, dass ich von einer notwendigen Synthese a priori dieser Repräsentationen Bewusstsein habe, und es ist darin das, was die ursprüngliche synthetische Einheit der Apperzeption konstituiert [Hervorhebung von uns], der alle die Repräsentationen unterworfen sind, die mir gegeben sind, aber auf welche sie zurückgeführt werden müssen durch das Mittel einer Synthese1 “. 1 KRV B, §16, S.135-136 Das letzte Glied des Satzes bedeutet, dass die Vorstellungen, nur durch die Tatsache, dass sie im Bewusstsein gegenwärtig sind, sich schon der ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption „unterworfen“ finden, aber dass 92 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 118 sie, um objektiv gedacht zu werden, unter anderem explizit „zurückgeführt“ werden müssen auf diese ursprüngliche Einheit in einer bewussten Synthese. Diese Synthese resultiert im Klartext, so scheint es, aus einer Reflexion des Verstandes auf den synthetischen Prozess, tief und dunkel, der zuvor die einfache Zugehörigkeit der Repräsentationen zum einen Bewusstsein sicherstellt. Von den zwei synthetischen Momenten – dem impliziten und dem expliziten – die der Text Kants unterscheidet, kann der zweite, der reflektierte Moment, der welcher sich formuliert als synthetischer Satz a priori, nicht teilhaben an der absoluten Priorität, von der wir weiter oben gesprochen haben; außerdem ist seine Tragweite beschränkt durch die Natur der schon gebildeten Vorstellungen, die sie „zurückführt“ auf die apperzeptive Einheit; sie ist also eingezwängt in dieselben Grenzen, welche die synthetische Einheit auf dem ersten Weg findet (weiter oben Seite 115-116). Aber der erste Moment, der primitive, direkte Moment umgibt sich mit anderen logischen Bedingungen. Indem er den Vorsitz führt bei der Emergenz selbst der Vorstellungen im Bewusstsein, situiert seine totale Apriorität ihn effektiv in den Ursprung jeder analytischen Operation, vor jeder formalen oder transzendentalen Logik; und seine Virtualität als Prinzip ist durchaus auch nicht innerlich begrenzt durch die Natur materieartiger Elemente, die er in uns gruppiert. Lassen wir uns hier nicht durch eine Illusion aufhalten, die ein zu sparsames oder zu schnelles Lesen der Schriften von Kant begünstigen könnte. Nach ihm, das wissen wir schon, haben die analytischen Urteile, die einzigen, deren Wahrheit eine äußere Rechtfertigung nicht nötig hat, als universelle, notwendige und hinreichende Regel das Widerspruchsprinzip, negative Form des Identitätsprinzips2 . 2 119 siehe KRV, A, S. 151; B, S. 191 Es würde also scheinen, dass dieses erste analytische Prinzip eine absolute Priorität genießen muss in unserem Denken, weit davon entfernt, selbst einem synthetischen Prinzip unterworfen zu sein. In Wirklichkeit ist, nach Kant, das Kontradiktionsprinzip (oder das der Identität), wenn es auch kein anderes Urteil voraussetzt, dennoch fundiert auf der Spontaneität des Subjekts, auf einer radikalen und universellen Fähigkeit der Synthese. Die Schriften Kants liefern uns dafür mehrere Anzeichen. Außer den weiter oben (Seite 113-114) zitierten Texten, die „die ganze Logik“ einer ursprünglichen synthetischen Aktivität unterordnen, siehe da, zum Beispiel, die allgemeine Affirmation, überall latent und manchmal formuliert, von einer gemeinsamen Wurzel für das „logische“ Element und dem „realen“ Element der Begriffe; siehe auch noch eine seltsame Bemerkung der Fortschritte 1 1 Ak, Bd. XX, S.278 die die analytischen Urteile nicht nur vom „Kontradiktionsprinzip“, sondern vom „Prinzip des Grundes“ (im logischen Sinn dieses Prinzips) und vom „Prinzip des ausgeschlossenen Dritten“ abhängen lässt; siehe schließlich eine ganz 93 Buch I: Kritik und System klare Bemerkung der zweiten Auflage der Kritik 2 2 KRV, B, §15, S.130, Anmerkung. – Bringe das in Verbindung mit der reinen „Relation der Identität“, definiert vom hl.Thomas (S. Th. I, 28, 1 ad 2) „Relatio quae importatur per hoc nomen idem ... non potest consistere nisi in quodam ordine quem ratio adinvenit alicuius ad seipsum secundum aliquas ejus duas considerationes“ (wir haben einnige Wörter hervorgehoben) [Die Beziehung, die durch dieses Wort „idem=identisch“ beibringt ... kann nur in einer gewissen Ordnung bestehen, den die Vernunft hinzuerfindet von irgendjemand zu sich selbst entsprechend irgendwelchen zwei Betrachtungsweisen von ihm] die die absolute Priorität der Synthese gegenüber der Analyse behauptet, selbst im Fall identischer Urteile; denn jedes Urteil bietet die Einheit einer repräsentierten Mannigfaltigkeit an: „Es ist hier nicht der Ort, so schätzt Kant, sich zu fragen, ob die [assoziierten] Repräsentationen identisch sind in der Weise, dass das eine gedacht werden könne durch simple Analyse des anderen. Unter der einfachen Beziehung der Verschiedenheit wird sich das Bewusstsein des einen trotzdem immer vom Bewusstsein vom anderen unterscheiden“. Das heißt erst recht, dass das Prinzip der Identität, das zwei nicht nur unterschiedene sondern verschiedene Apperzeptionen desselben Objekts gruppiert, eine synthetische Struktur besitzt, und sich daher aus einem höheren Prinzip der Einheit hervorhebt. Die ursprüngliche Synthese, von der wir sprechen, wird von Kant dem Verstand zugeschrieben. In der ersten Auflage der Kritik setzte die „synthetische Einheit von jeder möglichen intuitiven Mannigfaltigkeit3 “ voraus oder schloss ein eine „Synthese“, aber eine Synthese nur durch die Vorstellungskraft 4 . vollzogen. 3 KRV, A SS.116-117 Ebenda S. 118. – Diese Synthese muss a priori sein: „es kann aber nur die produktive Synthese der Einbildungskraft a priori stattfinden“ (Ebenda) 4 120 Die „transzendentale Einheit der Apperzeption“ oder die „reine Apperzeption“, ursprüngliches Prinzip der synthetischen Einheit, griff ein in die Synthesen der Vorstellungskraft wie eine Bedingung a priori der formartigen Ordnung, mit der sich verknüpfen musste wie eine höchste Regel, jede Verbindung von verschiedenen Elementen in einer Erkenntnis5 . 5 Ebenda und vgl. S.119 Es war ein Prinzip der Subsumtion, nicht ein synthetischer Akt. Die zweite Auflage der Kritik lässt, wie wir gesehen haben, den Akt der Synthese (oder der aktiven Verbindung) aufsteigen bis zum Verstand selbst6 . 6 Vergl. z.B. KRV, B, §15, S.130 Zusammenfassend: Die „allgemeine logische Einheit“ trägt in gleicher Weise, in jedem bewussten „Subjekt“, zu jedem beliebigen „Inhalt“ des Denkens (der cogitatio im Sinn von Descartes) bei. Genauso würde die Einheit des „Ich“, als universelles BezugsZentrum der Inhalte des Bewusstseins, ebensogut zu einem intuitiven Verstand gehören, wenn es einen gäbe, wie zu einem diskursiven Verstand. Demgegenüber sind die analytische Einheit und die ursprüngliche synthetische Einheit der Apperzeption, so wie sie die Kritik definiert, verknüpft mit dem Erwerb 94 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 121 eines vervielfältigbaren Gegebenen – folglich mit dem Vollzug einer Sinneserkenntnis – und können also nicht zusammenpassen mit einem intuitiven Verstand, der Schöpfer seines Objekts ist: die synthetische Funktion (nehmen wir das Wort „Synthese“ in seiner allgemeinsten Bedeutung), bleibt die Eigentümlichkeit eines diskursiven Verstandes; die synthetische Einheit, die sie hervorbringt, verrät den „phänomenalen“ Charakter des so vereinheitlichten Objekts. Dennoch: a) diese Diskursivität muss nicht mit absoluter Notwendigkeit, raum-zeitlich sein, obwohl sie es in der menschlichen Erkenntnis tatsächlich ist; b) Das Prinzip (der Grund) der synthetischen apperzeptiven Einheit selbst ist überhaupt nicht von sich aus beschränkt in seiner radikalen Tragweite durch irgendwelche Klasse von zu synthetisierenden Gegebenen; viel mehr, an sich Spontaneität (Akt) seiend, könnte es ohne logischen Widerspruch konzipiert werden, nicht als das simple dynamische Korrelativ der formartigen Einheiten der Synthese, die das „Gegebene“ umrahmen, sondern als der Sitz von höheren vereinigenden Eigenschaften, die jede Synthese der erworbenen Gegebenen übersteigt. Kant hat bis dahin uns nur ein einziges Beispiel dieser höheren Funktionen der Einheit vorgegeben, deren reine Möglichkeit, entweder in uns oder außerhalb von uns, sich gar nicht durch logische Notwendigkeit klären lässt: die intellektuelle Intuition. Diese würde auf der Ebene des Verstandes das mysteriöse Vermögen einer „Intuition a priori“ weiterführen, für die unser innerer Sinn einen niedrigeren Ersatz darstellt. Sicherlich, der kritizistische Philosoph fährt fort, uns jede Art intellektueller Intuition abzusprechen; aber wir sehen hier und jetzt besser. welcher Aspekt der synthetischen Funktion in Frage käme, wenn es jemals vorkommen sollte, dass er diese Verweigerung etwas mehr nuanciert. Solange1 die Apperzeption der Objekte vor allem zu bestehen schien in der Subsumtion der Phänomene unter die formartigen Bedingungen a priori, deren höchste die Einheit selbst des Bewusstseins war, wurde das Urteil betrachtet als die Repräsentation der bewirkten Subsumtion2 . 1 Siehe die Referenzen Seite 110, Fußnote 1 und S. 111 Fußnote 1 2 Dieser Gesichtspunkt herrscht noch vor in dem Abschnitt der KRV B, mit der Überschrift: „Von dem logischen Verstandesgebrauch überhaupt“, unmittelbar vor §9 Aber in dem Maße, wie die Idee der Synthese, zuerst eingeschränkt auf die Ebene der Vorstellungskraft, überquoll in das Niveau der Kategorien, der höheren Ebene der Apperzeption – in dem Maße wie die höchste apperzeptive Einheit sich zeigte als die ursprüngliche apperzeptive Handlung – im gleichen Maße wird das Urteil der Akt selbst der kategorialen Synthese der Phänomene, der Akt der sie bezieht auf die objektive Einheit des Bewusstseins. Die objektivierende Funktion konzentriert sich also im synthetischen Akt. Unter den Strukturelementen des Urteils ist es nunmehr Sache der Kopula allein, die transzendentale Bedingung auszudrücken, die die formartige Einheit der Terme eher „objektiv“ als „subjektiv1 “ macht: 95 Buch I: Kritik und System 1 „Subjektiv“: das heißt rein assoziativ, ohne irgendeine objektive Notwendigkeit „Die Funktion der Kopula ist besteht darin ... die subjektive Einheit zu unterscheiden. Dieses kleine Wort markiert tatsächlich die Beziehung dieser Repräsentationen zur ursprünglichen Apperzeption und ihre notwendige Einheit, auch wenn das Urteil empirisch ist und also kontingent2 “ 122 2 KRV B, §19, S.141-142 Wenn die Notwendigkeit eines Gegebenen der sinnlichen Anschauung dafür, ein Objekt zu bilden, nicht verneint wird, ahnt man, dass die objektive Geltung immer mehr gesucht werden wird in der universellen Notwendigkeit der Bedingungen a priori der Repräsentation und so weniger abhängen wird vom Ursprung des der Synthese unterworfenen Inhalts als von der absoluten Apriorität des synthetischen Aktes, der diesem Inhalt eine Form aufzwingt. Schon jetzt ist der Typ des Objekts dynamisch und die objektive Synthese des Gegebenen nimmt im immanenten Objekt den Charakter eines Werdens an. Hat Kant bemerkt, dass die ganze formartige Verwirklichung der synthetischen Einheit über der empirischen Ebene der Sinnlichkeit das Merkmal des Werdens in die „transzendentale“ Domäne einführt? Die beiden folgenden Abschnitte werden die Elemente einer Antwort auf diese Frage geben. 2˚ „Transzendentale“ Bedeutung der Bewegung Das „Werden“, das heißt, die Bewegung im weitesten Sinne, siehe da, ein sehr beunruhigendes Wort, wenn man es vom „kritischen“ Standpunkt aus betrachtet. Kant gesteht3 , dass er sich lange Zeit gefragt habe, ob das Merkmal der Bewegung zur transzendentalen Philosophie gehörte. Er macht darauf aufmerksam, dass dieses Merkmal in sich „Raum“ und „Zeit“ vereinigt; außerdem wollte man in dieser Synthese von Raum und Zeit „eine der Quellen der dialektischen Methode“ sehen, die von Fichte erfunden und von Hegel4 durchgeführt wurde“. 123 3 Reflexionen, Edit, B, Erdmann. Bd. II, n. 321, 325. 326 4 Vaihinger, Commentar, II, S. 437 Die Parallele würde kaum seriös erscheinen, wenn die Kritik der reinen Vernunft damit bei ihrer ersten Ausgabe stehen geblieben wäre. Tatsächlich wurde dort Aristoteles gerügt, in der Kategorientafel die Bewegung einbezogen zu haben, „die ihren Platz überhaupt nicht bei ihnen hat, da sie nur ein empirischer 5 Begriff ist. 5 KRV A. S.81; B. S.107 Sonst nichts. Es ist noch der wesentlich empirische Charakter der Bewegung, den 1783 die Prolegomena lehren6 Bei Gelegenheit der kritischen Bemerkun- 96 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 gen, die von Schütz 17857 veröffentlicht wurden, kommt Kant auf die Frage zurück; 6 Vergl. Prolegomena I, §10, Ak. Bd.IV S.283 Vergl. Vaihinger, op.cit. II, S. 438-439; De Vleeschauer, La Déduction transcendentale, t, II S. 117 und t. III S. 215-216 7 zuerst, ohne seine Haltung sehr zu verändern, in den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft (1786)1 1 Über die diskutierte Interpretation der Apriorität, die den synthetischen Prinzipien der „Allgemeinen Bewegungslehre zukommt“ (KRV, B, §5, S.49), siehe Vaihinger, op. cit. II S.387-389. Dann im folgenden Jahr, in der zweiten Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft, wo er eine neue Distinktion von großer theoretischer Bedeutung einführt: „Die Bewegung eines Objekts im Raum gehört nicht zu einer reinen Wissenschaft und folglich nicht zur Geometrie2 ; 2 Die Einwände von Schütz erstrecken sich genau auf die Möglichkeit der Geometrie als reine Wissenschaft und im besonderen auf die Möglichkeit einer Konstruktion a priori der „Linie“. denn wir können nicht a priori wissen, sondern nur aus der Erfahrung, ob etwas beweglich ist. Aber die Bewegung als Beschreibung eines Raumes ist ein reiner Akt der durch die produktive Vorstellungskraft sukzessiv ausgeführten Synthese zwischen den verschiedenen in der äußeren Intuition im allgemeinen enthaltenen Elementen, und (als solche) gehört sie nicht nur zur Geometrie, sondern noch zur transzendentalen Philosophie (Aber Bewegung als Beschreibung eines Raumes, ... , gehört nicht allein zur Geometrie, sondern sogar zur Transzendentalphilosophie)3 3 KRV, B, §24, S.155, Anmerkung; vergleiche die Anmerkungen der Seiten 156, 157, 160 124 Das will sagen, dass im Unterschied zur Bewegung der Körper, wir nicht nur eine empirische Repräsentation haben, die reine Synthese des Raumes entsprechend der Zeit, läuft in uns ab bei Gelegenheit jeder räumlichen Konstruktion, eine Bewegung von metempirischen Bestimmungen, deren Realität als transzendentale Bestimmungen des Subjekts uns „a priori gegeben4 “ ist. 4 Diese Produktion ist von derselben Ordnung wie die „ursprüngliche Erwerbung“, von der weiter unten die Rede sein wird. Kant spricht auch von „Daten a priori (der praktischen Vernunft)“, in der KRV, B Vorrede S.XXVIII-XXIX. Dieses Mal erhalten wir aus dem Mund von Kant selbst, das reflektierte Eingeständnis der soliden Realität der Bewegung, sicherlich nicht als ontologische Modifikation eines substanziellen Subjekts, sondern als notwendigen Prozess der Verwirklichung des transzendentalen Subjekts. Ist es der Mühe wert, danach noch andere Eingeständnisse zu suchen, weniger explizit wenn nicht gar weniger beweisend? Im Grunde ist jede Ausdehnung einer transzendentalen Bedingung a priori (lassen wir das analytische Apriori aus dem Spiel) auf einen kontingenten Inhalt, von sich aus eine Bewegung; denn sie entwickelt, selbst im Feld des Apriori, eine draufgängerische 97 Buch I: Kritik und System 125 Virtualität. Wir hüten uns andererseits, diese Bewegung der progressiven Verwirklichung, die eine reine Bestimmung der Zeit durch die Spontaneität des Subjektes ist, zu verwechseln mit der empirischen Repräsentation einer Aufeinanderfolge im inneren Sinn. Dann also teilt der Begriff der Bewegung„ wenn er von Kant nirgends mit einer Kategorie gleichgesetzt ist, trotzdem im oben erwähnten Fall die logischen Eigenschaften der „Daten a priori“ des erkennenden Subjekts. Das ist gleichbedeutend damit, zu sagen, dass eine gewisse Art von Werden beansprucht, als immanenter Prozess des transzendentalen Subjekts, die selbe Affirmabilität, die die a priorischen Begriffe des Verstandes und die Intuitionen a priori der Sinnlichkeit als formartigen Dispositionen dieses Subjekts beanspruchen. Aber diese „Bewegung“, der wir gerade auf der Stufe unterhalb der Bestimmungen a priori begegnen, bis wohin kann sie, bis wohin muss sie aufsteigen? Bleibt sie stehen auf der Ebene der Intuition a priori der Zeit, betrachtet als unmittelbares transzendentales Prinzip der Aufeinanderfolge von inneren Phänomenen? Oder auch: behält die Idee eines immanenten Werdens einen Sinn im Bereich des reinen Verstandes? Die direkt auf die Bewegung1 bezogenen Texte der Kritik (Ausgabe B) klären diese Frage nicht. Vielleicht finden wir etwas Besseres in den Texten, wo Kant metempirische Inhalte des Verstandes erwähnt. 1 Siehe oben 3˚ Auf eine idealistische Metamorphose der leibnizschen „reinen Idee“ zu Die zweite Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft 2 2 KRV B, Vorrede, S. XXVI-XXVII und Anmerkung von Seite XXVI unterscheidet klar zwischen „erkennen“ und „denken“, zwischen erkennen von Objekten (als Objekte der möglichen Erfahrung) und objektiv denken irgendwelcher Inhalte des Bewusstseins (allein unter der Bedingung ihrer logischen Kohärenz). Wenn die „gesamte spekulative Erkenntnis der Vernunft sich reduziert allein auf die Objekte der Erfahrung“, das heißt „wenn wir die Objekte nicht erkennen können als Dinge an sich, können wir sie wenigstens als solche denken. Anders gesagt, es würde der absurde Satz folgen, dass es Phänomen (Erscheinung) gibt ohne etwas, was erscheint3 “ 3 Loc. cit. Diese Unterscheidung setzt im diskursiven Denken nicht nur die habituelle und latente Gegenwart voraus, sondern die kontingente Produktion von Bestimmungen a priori der idealen Ordnung, deren metempirischer Inhalt, ohne sich auf irgendein bestimmtes Objekt zu beziehen, trotz alledem den Stoff einer analytischen Kette von Urteilen liefern und eine objektive „problematische“ Bedeutung annehmen könnte. Siehe da einige Beispiele dieser metempirischen 98 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 Bestimmungen – mehr unvollständig als fiktiv – von denen Kant eine hypothetische, logisch korrekte Verwendung anerkennt. Eine erste Reihe von Texten offenbart nicht direkt etwas anderes als die Möglichkeit, uns durch Ausarbeitung von empirischen Begriffen (zum Beispiel durch abstrahierende Verallgemeinerung ihres Inhalts) analoge Repräsentationen von Objekten an sich zu bilden. Diese Möglichkeit, die ein Problem über die der transzendentalen Analytik hinaus stellt, erlaubt Kant die folgende Erklärung: „Nach Erwerbung aller der Erkenntnisse, die die Dinge uns von sich selbst in der Erfahrung geben können, darf die Frage: – was sind also die Objekte dieser Erkenntnisse, insofern sie Dinge an sich sind? – in keiner Weise für sinnleer gehalten werden1 “ 126 1 Bemerkungen zu Jacobi’s Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden. Ak. Bd. VIII, S.154 Dieser Schluss zielt ab auf alle die, welche nach dem Beispiel von Mendelssohn die Möglichkeit anzweifeln, ein Ding an sich dort zu denken, wo die objektive Erkenntnis dieses Dings unmöglich ist. Kant hat zwanzig Zeilen vorher gezeigt, wie sich der metempirische Begriff der „wahren Realität“ oder der „Realität an sich“ bilden kann, im Gegensatz nicht nur zur reinen „Verneinung“, sondern zur „phänomenalen Erscheinung“; angewandt zuerst und notwendig auf Gott, fließt der Begriff der „Realität an sich“ von daher zurück, unter Erhaltung aller Proportionen, auf die endlichen Dinge2 . 2 Ebenda Siehe da also ein Begriff, ausgestattet mit einer positiven, metaphänomenalen oder noumenalen, keineswegs willkürlichen Bedeutung. Andere Texte lassen Anzeichen einer subjektiv korrekten wenn nicht gar objektiv gültigen „transzendentalen Verwendung“ der Kategorien3 sehen. 3 KRV, A, SS.253-254. 643 ff. oder sogar einer noumenalen Bedeutung des „transzendentalen Objekts“ und des Merkmals des „Dings“. Zum Beispiel definiert 1787 die Kritik der reinen Vernunft 4 4 127 B, S. 307 unsere notwendige Repräsentation des „Dings an sich“: „den ganz unbestimmten Begriff von einem Verstandeswesen als einem Etwas überhaupt außer unserer Sinnlichkeit“, also den positiven aber unbestimmten Begriff von „irgendwas“ im allgemeinen. Die weiteren Bestimmungen, die man auf das Etwas überhaupt anwenden würde, indem man eine transzendentale Verwendung der Kategorien macht, können nur eine problematische Objektivität annehmen; sie haben dennoch, selbst darin, ihren Teil der Wahrheit, wie man es sieht in der Theorie des „transzendentalen Ideals“, wahrhaftige hypothetische Theodizee; sie bilden ein verkettetes System, das, einmal an einem Punkt affirmiert (bejaht, behauptet), als ganzes ins Spiel kommt. 99 Buch I: Kritik und System Es ist im Wesentlichen dieselbe Konzeption, aber dieses Mal explizit dem leibnizschen Inneismus gegenübergestellt, was Kant in seiner Antwort an den Wolffianer Eberhard bekennt, 17905 veröffentlicht. 5 Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der r.V. durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll. Ak. Bd. VII, S.185-251 Eberhard hatte die Gelegenheit einer Annäherung, vollzogen durch C. C. E. Schmid6 , zwischen der Erkenntnis a priori der Kritik und den angeborenen Ideen der Nouveaux Essais benützt, die Originalität der Lehre von Kant im Blick auf die von Leibniz7 anzuzweifeln. 6 In seinem Wörterbuch zum leichteren Gebrauch der Kantschen Schriften, zum Wort „a priori“ (2.Auflage, Jena 1788, S. 9-16) 7 Dieses Thema des Vergleichens ist in der „Literatur“ des Kantismus bis auf unsere Tage klassisch geblieben. Siehe Vaihinger, Commentar II, S. 81-101 (“Wie verhält sich Kants A priori zum Angeborenen?“) 8 In seiner Antwort hütet sich Kant sehr wohl, die Ähnlichkeiten zu leugnen; 8 Siehe weiter oben SS.55-60 selbst da, wo er am lebhaftesten die Originalität seiner eigenen Lehre fordert, „nähert er sich sehr stark den Konzeptionen von Leibniz1 “ 1 So drückt sich M. De Vleeschauwer (Die transzendentale Deduktion ... Band III, 1937, S.434) aus, der neuesten Kritik, nach unserer Kenntnis, die eine vertiefte Studie der „Streitschrift“ gegen Eberhard gemacht hat. In einem Punkt nähert er sich sogar in einer Weise, die schon eine vollständigere Übertragung des leibnizschen Dynamismus auf die Ebene des Idealismus anzukünden scheint. Kant lässt tatsächlich, ohne uns jemals intellektuelle Intuition oder angeborene Ideen zuzuerkennen, dennoch unter den notwendigen Voraussetzungen jedes empirischen Begriffs, nicht nur die Existenz von Funktionen a priori der Synthese (Fakultäten) zu, sondern für jedes in Vollzugbringen dieser, die spontane Produktion von formartigen Repräsentationen, welche der objektiven konkreten Repräsentation vorausgehen und sie vorbereiten. Er gibt zuerst von dieser spontanen Produktion ein Beispiel, hergenommen von der sinnlichen Anschauung. Wie es die Kritik (Ausgabe B)2 2 128 B, S.155, siehe oben S. 122-123 anmerkte, verlangt die sinnliche Wahrnehmung außer der Existenz einer Sinnes-Fakultät (insofern sie „Fundament der Möglichkeit einer räumlichen Anschauung ist“), die Erweckung einer reinen formartigen Anschauung des Raumes (eine „formale Anschauung“), die nichts hernimmt vom empirischen Gegebenen ; diese geht als Emergenz a priori, als „ursprüngliche Erwerbung“, der konkreten räumlichen Repräsentation voraus, die eine „acquisitio derivativa [= eine abgeleitete Erwerbung]“ ist. Und Kant fährt fort, indem er diese leibnizsche Terminologie auf die reinen Begriffe ausdehnt : „Die Erwerbung [der partikulären Begriffe der Dinge] ist eine acquisitio derivativa [= eine abgeleitete Erwerbung] in dem Sinn, dass sie schon universelle transzendentale Begriffe des Verstandes voraussetzt, Begriffe die ganz klar erworben, nicht angeboren sind, 100 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 aber deren Erwerbung wie die der formartigen Anschauung des Raumes, ursprünglich ist und kein angeborenes Prinzip voraussetzt, außer den subjektiven Bedingungen der Spontaneität des Denkens (Konformität mit der apperzeptiven Einheit)3 “ 3 Entdeckung, usw. Ak. Bd. VIII, SS.222-223 Die transzendentalen Produkte der aquisitio originaria [= ursprüngliche Erwerbung] (reine Anschauungen der Sinneserkenntnis und Kategorien als „entworfene“ Begriffe) konstituieren also, im Voraus zur empirischen Apperzeption, wo sie sich einreihen, einen immanenten Ausdruck der Spontaneität des Subjekts, und in der Ordnung der objektiven Repräsentation, eine erste positive Phase; sie bieten dem Bewusstsein einen allgemeinen Inhalt an, in sich zu unbestimmt, um ohne die Ergänzung durch die sinnliche Wahrnehmung die aktuelle oder mögliche Realität definierter Objekte zu bezeichnen. Unter einem ein wenig verschiedenen Winkel, ist dieselbe Lehre von Kant erklärt in seinem Bericht (Memorandum) Über die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolff, geschrieben ungefähr um 1793, aber veröffentlicht erst nach dem Tod seines Autors. Zum Beispiel die Stelle über den Raum und die Zeit: „Raum und Zeit, subjektiv betrachtet, sind Formen der Sinneserkenntnis1 ; 1 Als „Formen der Anschauung“ eines vervielfachbaren Gegebenen 2 aber, um sie als Objekte der reinen Anschauung zu konzipieren (und wie könnte man von ihnen sprechen ohne das?), 2 129 Als „formartige Anschuungen“, nach der weiter oben gefundenen Terminologie braucht es im Voraus den Begriff einer Vereinigung von Verschiedenen (eines Zusammengesetzten) und folglich den Begriff der Synthese einer Verschiedenheit (der Zusammensetzung des Mannigfaltigen); um dieses Mannigfaltige zu verbinden, ist also auch die synthetische Einheit der Apperzeption erforderlich; der Reihe nach verlangt diese Einheit des Bewusstseins, entsprechend der Mannigfaltigkeit der Anschauungen von Objekten in Raum und Zeit, eine Mannigfaltigkeit von vereinheitlichenden Funktionen, die sich die Kategorien nennen, und die die Begriffe a priori des Verstandes sind. Diese letzteren genügen durch sich selbst gar nicht dazu, eine Erkenntnis des Objekts im Allgemeinen, aber wohl die Erkenntnis eines schon in der empirischen Anschauung gegebenen Objekts3 zu fundieren“ 3 Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolff. Ak, Bd. XX, S.276. Vergl. SS.268-270, 271-272. Siehe auch die Losen Blätter zu den Fortschritten der Metaphysik Ak, Bd. XX, S. 337, 1, 4-14; S. 339, 1, 18-33 bis S.249, 1, 1-24 101 Buch I: Kritik und System Muss man das theoretische Interesse einer Lehre unterstreichen, die Kant auferlegt wird durch die Notwendigkeit, seinen transzendentalen Apriorismus in gleicher Weise vom Inneismus und vom Semi-Empirismus Abstand zu halten? Funktionen a priori, die sich in der objektiven Ebene des Bewusstseins unveränderlich ausdrücken würden als formartige Bestimmungen a priori, latent oder nicht, würden wirklich „angeborene Ideen“ konstituieren (wenigstens virtuell); denn sie wären zugleich – um eine alte Terminologie zu verwenden – „in fieri“ und „in facto esse“, „naturantes“ et „naturatae4 “ 4 Eine ganz gleiche Unterscheidung findet sich häufig bei den modernen Philosophen mit idealistischer Tendenz. Zum Beispiel (sei es vor Kant, sei es bei diesem letzteren selbst): der subjektive Sinn und der formale Sinn des „cogito“ (le je et le moi); die „zählenden Zahlen“ und die „gezählten Zahlen“, der Raum und die Zeit als „Formen der Anschauung“ und als Objekte der „formartigen Anschauung“; der Raum als „verräumlichend“ und der Raum als „verräumlicht“; die Begriffe als „abstrahierend“ und die Begriffe als „abstrakte“; die reine Synthese als „synthetischer Akt“ und als „formartige Einheit der Synthese“. Ein Scholastiker wird sich erinnern, dass jede immanente Operation Akt und Qualität ist; und noch tiefer, dass jedes (endliche) Sein konzipiert ist als Sein (Akt) und als Wesen (Form). 130 Andererseits würden sich die Funktionen a priori der Vereinheitlichung, die im Bewusstsein keinen formartigen Ausdruck a priori hätten, sondern nur die materielle Gruppierung der sinnlich Gegebenen produzieren würden, nicht sehr viel von den Funktionen unterscheiden, die von Locke dem inneren Sinn zugeschrieben wurden. Der kantsche Apriorismus, der einen mittleren Weg einschlägt, vereint die reine und einfache Notwendigkeit der Funktionen a priori (der Fakultäten) mit einer gewissen Kontingenz der reinen Ausdrücke dieser Funktionen im objektiven Bewusstsein: „Begriffe a priori“ und „Intuitionen a priori“ sind tatsächlich, wir haben weiter oben daran erinnert, notwendig, was ihre Form betrifft, aber kontingent was ihre aktuelle Existenz, ihr Dasein 1 betrifft: 1 Fortschritte, usw. Ak. Bd. XX S.272 sie sind kontingent im logischen Sinne dieses Wortes, da sie in ihrem Dasein abhängen von einer nicht auf das Apriori der Fakultäten reduzierbaren Bedingung, und also logisch zurückbezogen sind auf das Konto des rohen Gegebenen der Sinne (“Eindrücke“, „Empfindungen“) In dieser mysteriösen immanenten Erzeugung bemerken wir vor allem, dass sie die logischen Wesensmomente eines „Werdens“ enthalten. Durch seine Fakultäten, die das „Fundament der Möglichkeit der aktuellen Erkenntnisse“ sind, ist das transzendentale Subjekt ein „bestimmbares Bestimmendes“, ein Akt in Potenz zu weiterer Aktuierung in der Existenz; die „acquisitio originaria“, die kontingente Produktion von Bestimmungen a priori, verwirklicht, entsprechend einer reinen Form die aktuelle Synthese dieses Aktes und dieser Potenz. Es ist von selbst klar, dass das „Werden“ hier ins Auge gefasst ist als Verkettung von rationalen Elementen, nicht als ontologische Realität2 . 102 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 2 Man könnte sich trotzdem fragen, ob diese „Autodeterminatio a priori“ des Subjekts, weil sie logisch vorausgeht der empirischen Intuition, nicht die Frage des „Subjekts an sich“ aufwirft, so wie sie aufwirft, zum Beispiel, nach dem Eingeständnis von Kant (KRV B S.429-431), unsere moralische „Spontaneität“ sich setzend „völlig a priori in Ansehung unseres eigenen Daseins als gesetzgebend“ (S.430). Aber der Parallelismus zwischen diesen beiden ist nicht genügend vollständig, dafür dass wir uns damit aufhalten, hier dafür die möglichen Konsequenten zu suchen. 4˚ Rückblick 131 Unsere Untersuchung über einige wichtige Artikulierungen des idealistischen Systems von Kant hat sich bis jetzt auf den spekulativen Horizont beschränkt. Unter diesem Gesichtswinkel haben wir mehr als einmal einen Abstand feststellen müssen zwischen der tatsächlichen Struktur der Kritik und dem Ideal der systematischen Einheit, die man dort vorgelegt findet. Hier und da jedoch schien es uns, dass der Abstand die Tendenz hatte, sich zu verringern, selbst im Lauf der Periode, die wir untersuchten. Wo stehen wir dabei genau? Eine vorläufige Klarstellung könnte nicht nutzlos sein, bevor wir unsere Aufmerksamkeit auf den zweiten der beiden großen Aspekte der Vernunft ausrichten, auf den „praktischen“ Aspekt. Die Punkte, wo sich in unseren Augen ein Zustand der Unfertigkeit, einem wahrscheinlichen Keim einer weiteren Entwicklung, verriet, können unter zwei Hauptpunkten gruppiert werden: 10 die jeweilige Rolle der Analyse und der Synthese im kritischen System; 20 Die systematische Nahtstelle zwischen den verschiedenen formalen Ebenen, die in der Erkenntnis unterschieden werden. 10 Die Analyse, so hat man gesagt, ist eher das besondere Vorgehen der Kritik und die Synthese (subsidiär verstärkt durch Analyse) das Vorgehen der systematischen Konstruktion. Dieser oberflächliche Gegensatz von zwei Methoden wird im ersten Augenblick wahrgenommen im Text von Kant. Aber er muss vertieft werden. Kant behauptet selbst, durch eine analytische Beweisführung, die Synthese a priori zu beweisen, die bei ihm alle anderen steuert: die synthetische Einheit der Apperzeption1 . 1 Siehe weiter oben, Seite 113-114, 118-120 Diese einfache Bemerkung würde genügen, den folgenden Satz zu begründen: Die kritische Reflexion, um die Bedingungen a priori des Wissens aufzudecken, setzt im Wesentlichen eine Gesamtheit von analytischen Vollzügen an der direkten Erkenntnis ins Werk. Sie geht also vor durch Anwendung des Prinzips der Identität (oder des Widerspruchs). Ist das nicht klar? Zweifellos, wenn es in der Philosophie nicht immer nötig wäre, den Wörtern zu misstrauen. Wir können nicht vergessen, dass Kant, dem Beispiel der großen Cartesianer folgend, die logische Anwendung des „Prinzips vom hinreichenden Grund“ für eine wahrhaftige „Analyse“ hält, das heißt die Beziehung eines jeden Inhalts des Bewusstseins zu dessen ganzen Bedingungen seiner Intelligibilität im Denken 2 . 103 Buch I: Kritik und System 2 132 Siehe oben S.116, 118-120, Vgl. Heft III, 1.Aufl. S.15 (BIIK3§2) und S.90f. 3.Auflage S.111-113 Außerdem, wenn er von der Synthese a priori behauptet, dass sie sich beweist durch eine analytische Beweisführung, kann diese Behauptung auf zwei sehr verschiedene Fälle abzielen (wir sind dafür S. 115-118 einem Beispiel begegnet): Einerseits, eine Analyse im strengsten Sinn, eine einfache analytische Zerlegung der Merkmale eines Begriffs; andererseits, eine Analyse im weiteren Sinn verstanden, fundiert auf der inneren Forderung der Intelligibilität jedes Inhalts des Denkens. Aber diese letztere Analyse, die aufsteigt zum logischen Wesen des Objekts, zu seinen Bedingungen a priori der Möglichkeit im Gedanken, fällt sie nicht zusammen mit dem transzendentalen Vorgehen der Analyse, deren Hauptmoment eine wahrhafte Synthese a priori ist3 ? 3 Denn das „Transzendentale“ ist nicht rein und einfach das „a priori“: es ist das „a priori“ betrachtet als Bedingung der Möglichkeit der Objekte im Denken. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass nach Kant selbst das Kontradiktionsprinzip, Fundament jeder Analyse in uns resultiert aus einer Synthese a priori, genau derjenigen, die die höchste Funktion des „transzendentalen Subjekts“ definiert, den reinen Verstand4 4 133 Siehe weiter oben S.113 Die analytische Reflexion bringt uns also schließlich dazu. uns eines Aktes der Synthese bewusst zu werden, nicht nur weil sie ihn am Ursprung der direkten Erkenntnis aufdeckt, sondern weil sie sich selbst anerkennt als hervorgegangen aus einer synthetischen Aktivität. Schon jetzt ist im Denken Kants das System des kritischen Idealismus ganz und gar aufgehängt an einer ursprünglichen (primitiven) Synthese. Man ist von daher weniger erstaunt über die gegenseitige Überlappung der Analyse und der Synthese, mit sehr gewundenem Erscheinungsbild, bei der Erklärung von Teil-Aspekten des Systems, zum Beispiel bei der „Deduktion der Kategorien“Diese kann, ins Auge gefasst unter einem gewissen Winkel, in ihrem Objekt, in ihren Voraussetzungen und ihrer Konsequenz, rein analytisch erscheinen. In der metaphysischen Deduktion der Kategorien sind die reinen Kategorien, abgeleitet von den allgemeinen Typen der Einheit der Urteile, wie Kant versichert, Funktionen des diskursiven Verstandes im Voraus zu jeder Einschränkung durch die Schemata einer Sinneswahrnehmung: als solche erstreckt sich ihr Anwendungsfeld also auf jeden Inhalt des Denkens und fällt zusammen mit dem universellen Feld der Analyse im strengen Sinn. Darüber hinaus sind, in der Einschätzung Kants, selbst die Tafel der allgemeinen Formen des Urteils und folglich die der Kategorien des reinen Verstandes erhalten durch ein analytisches Beweisverfahren, konform (in Übereinstimmung mit) den Gesetzen der klassischen Logik (formale Logik). Und die Schlussfolgerung der metaphysischen Deduktion – dass nämlich die reinen Kategorien die vollständige objektive Bestimmung nur durch Subsumtion einer sinnlichen Anschauung unter 104 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 sie erreichen können – diese Schlussfolgerung scheint gleichermaßen aus einer einfachen Analyse der Terme des Problems zu resultieren.1 . 1 Siehe Heft III, 1.Aufl. S.115, S.122 3.Aufl. S.148. Vergl. weiter oben SS.85-86, 90 Aber siehe da, das andere Gesicht der Frage. Selbst zugegeben, dass die metaphysische Deduktion analytisch die Notwendigkeit einer „formartigen Subsumtion2 “ der partikulären Inhalte unter die allgemeinen Formen des Urteils, und folglich unter die Kategorien des reinen Verstandes, beweist, 2 Siehe weiter oben SS.108-109, 116, vgl. S.99 beweist sie damit auch zugleich die Notwendigkeit einer „transzendentalen Subsumtion3 “ der empirischen Daten unter „schematisierte“ Kategorien, die identisch sind mit den reinen Kategorien? 3 134 Siehe weiter oben S.111 und Anmerkung 1 Dieser letztere Beweis scheint nur auf zwei Weisen möglich: 10 Indem man a priori beweist, dass es sich damit so verhalten muss in jedem diskursiven Verstand; das käme letzten Endes darauf hinaus, zu beweisen, dass jede „formartige Subsumtion“ auf einer „transzendentalen Subsumtion“ beruht, weil kraft des (logischen) Prinzips des Grundes jede analytische Einheit eine synthetische Einheit voraussetzt. 20 Indem man tatsächlich, unter den konkreten Bedingungen des Vollzugs des menschlichen Verstandes, die Identität der schematisierten Kategorien und der reinen Kategorien feststellt, das heißt die Koinzidenz zwischen den Typen a priori der aufsteigenden Synthese,gefordert für die apperzeptive Verknüpfung der Gegebenen (der Daten) und den begrifflichen Formen, erhalten durch eine umgekehrte logische Bewegung, absteigend, das heißt durch adäquate Aufteilung der reinen Einheit des Verstandes. Die erste Form des Beweises ist „transzendental“; die zweite könnte analytisch sein, wenn die zwei Reihen – rein und schematisiert – der kategorialen Einheiten in gleicher Weise beobachtbar und direkt vergleichbar wären. In Wirklichkeit sind uns sowohl die eine wie die andere Reihe bekannt durch einen direkten Schluss, wo sich die „transzendentale“ Forderung einer synthetischen Bedingung einschaltet. Das ist evident für die aufsteigende Reihe, die sich erhebt vermittels Schemata und Kategorien ausgehend von Sinnesdaten. Aber die absteigende Reihe, die analytisch die reine Einheit des Verstandes zerteilt, wie könnte sie uns zugänglich sein, wenn nicht in einer praktischen Abstraktion über unseren konkreten Urteilen, das heißt über synthetischen, von Schemata der Sinneswahrnehmung abhängenden Einheiten? Wüssten wir, dass die „allgemeinen Formen der Einheit“, die auf diese Weise erhalten wurden, eher Kategorien des reinen Verstandes darstellen (Stammbegriffe des reinen Verstandes) als sinnlose formartige Abstraktionen, wenn wir nicht schon wüssten, dass jede analytische Einheit gründet auf einer synthetischen Einheit und dass die universellste analytische Einheit eine „ursprüngliche Synthese“ voraussetzt, identisch mit dem Verstand selbst? Nun aber: Frage: wissen wir das durch eine direkte „transzendentale“ Schlussfolgerung (eine Inferenz), gestützt auf 105 Buch I: Kritik und System das Prinzip des Grundes, „Prinzip der synthetischen Urteile [a priori]1 “, wie sich Kant ausdrückt, indem er Leibniz interpretiert? 1 135 Siehe weiter oben SS.56-57 Wir sehen also, in der kritischen Beweisführung ebenso wie im Objekt der Kritik, wie die Synthese entschieden den Vorzug gegenüber der Analyse einnimmt. Diese absolute Vorrangstellung, weniger evident am Anfang der kritizistischen Periode, wird sich immer mehr behaupten in dem Maße, wie das idealistische System Kants sich immer massiver konzentrieren wird um die Einheit des „Ich“ herum. Zugleich wird immer mehr klar, dass die Beziehungen der analytischen Einheit und der synthetischen Einheit, die auf den vorausgehenden Seiten betrachtet wurden, nicht nur das Problem der gegenseitigen Begrenzung der zwei formartigen Einheiten stellen, sondern noch tiefer, das Problem der gegenseitigen Begrenzung des Aktes und der Form in der totalen Einheit des Bewusstseins. 20 Diese Einheit des Bewusstseins stuft Kant auf verschiedenen formartigen Ebenen ein: Ist er in der Kritik der reinen Vernunft dahin gelangt, sie untereinander durch ein Band der rationalen Notwendigkeit zu verbinden? Konfrontieren wir uns, wie er, zuerst mit dem „transzendentalen Subjekt“, einerseits und anderseits mit den „Dingen an sich“. Die Begegnung dieser mit dem Subjekt begründet im Bewusstsein eine erste Stufe von formartigen Bestimmungen: die qualitative Mannigfaltigkeit der Sinneswahrnehmungen. In der Folge des Erkenntnisprozesses, wird diese erste qualitative Mannigfaltigkeit konstant die Rolle des Objekts spielen, nie die des Subjekts. Heißt das, dass sie in uns Qualitäten des „Dings an sich“ repräsentiert? Das wäre zu viel behauptet; aber Kant gibt uns auch nicht das Recht, es ausschließlich vom Subjekt abzuleiten. Ein zweites Zwischenstadium in der Staffelung der formartigen Bestimmungen des Bewusstseins ist konstituiert durch die „Intuitionen a priori“ von Raum und Zeit, das heißt durch die reinen Formen der sinnlichen Rezeptivität, dem Bewusstsein objektiv angeboten, nach Art eines Inhalts a priori. Dieses Mal, zweifelloser als bei der Sinneswahrnehmung, ist es wohl das Ich, das sich teilweise selbst begreift. Aber wovon kommt diese Hinwendung zu sich? Warum nimmt sie die Form von Raum und Zeit an? Kant weiß, dass diese Formen, um in die objektive Erkenntnis einzutreten, sich der höchsten Einheit des transzendentalen Ich unterordnen müssen. Aber er deduziert sie nicht von diesem Ich: In Bezug auf das transzendentale Ich bleiben sie irgendeine kontingente Sache. Wir erreichen schließlich ein drittes Zwischenstadium: die reine apperzeptive Einheit, ausgemünzt in den Kategorien. In ihr allein offenbart sich das transzendentale Subjekt unmittelbar dem Bewusstsein als reiner Akt der Synthese. Diese drei überlagerten Ebenen: sinnliche Qualitäten, Intuitionen a priori 106 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 136 137 der Sinneswahrnehmung, Einheit der reinen Apperzeption, treffen im (immanenten) Objekt zusammen. Dafür geschieht von der Seite des Subjekts die Verbindung nicht sehr fest. Eine Verwerfung existiert auf zwei Ebenen: weder die reinen Intuitionen von Raum und Zeit, noch die Sinnesqualitäten leiten sich logisch ab von der ursprünglichen Einheit des Ich. Diese Unvollkommenheit in der systematischen Verkettung der formartigen Ebenen des Bewusstseins und vor allem die immer klaffende Dualität zwischen der apperzeptiven Einheit und dem Apriori der Sinneserkenntnis waren für viele Gegensätze, die wir weiter oben angeprangert haben nur schlecht aufgelöst: Gegensatz zwischen Objekt im allgemeinen und dem Objekt der Erfahrung, zwischen den reinen Kategorien und den schematisierten Kategorien, zwischen dem transzendentalen Ich und dem empirischen Ich. Diese Gegensätze wären vollständig aufgelöst, wenn es gelingen würde, die funktionale Einheit des Ich zu vervollkommnen, in der Weise dass man aus der Spontaneität des Verstandes jedes formartige Element unserer Repräsentationen ableitet von den reinen Begriffen bis zu den sinnlichen Qualitäten einschließlich. Man erahnt hier eine mögliche Entwicklung des Idealismus von Kant genau in die Richtung, wo die Behauptung des Primats des synthetischen Aktes zur Vollendung käme. Auch noch über andere Punkte haben wir im Idealismus von Kant sich eine Lehr-Entwicklung abzeichnen gesehen, deren Ausgang unsicher blieb. Das war zuerst die Existenz von „Inhalten a priori“ des Denkens. Ihr Vorkommen in der Kritik hat etwas ein wenig Verwirrendes; denn sie müssen sich zwischen die zwei als komplementär vorausgesetzte Terme, einem häufig von Kant unterstrichenen Gegensatz, einreihen, nämlich zwischen die „inhaltsleeren“ Formen a priori der Einheit und die „blinden“ sinnlichen Gegebenen, den, wie es scheint, einzigen möglichen Inhalten unseres Denkens. Zweifellos bleibt der objektive Wert dieser Inhalte a priori „problematisch“. Das sind keineswegs die „reinen Ideen“ von Leibniz. Sie zeigen jedoch die Existenz einer Mannigfaltigkeit von Repräsentationen im Inneren sogar des Verstandes, die durchaus nicht völlig der sinnlichen Erfahrung anrechenbar sind. Ihre objektive Bedeutung würde sich verstärken in dem Maße, in dem die Teilnahme der intellektuellen Spontaneität an der Konstruktion des immanenten Objekts wachsen würde. Es gibt noch mehr. Diese Inhalte a priori fügen sich in jedem Akt der objektiven Erkenntnis ein mit dem Charakter von „a priori Gegebenen“ (Data a priori): ihre kontingente Emergenz (acquisitio originaria) entweder in der Ebene der reinen Intuitionen oder in der des Verstandes führt ein aktives Werden im Inneren des Apriori ein. Obwohl äußerlich abhängig von einer Präsentation von empirischen Daten, affiziert diese „acquisitio originaria“ trotzdem direkt das transzendentale Subjekt, dessen Spontaneität durch sie den Rythmus der Sinneswahrnehmung annimmt. Man ahnt alles das, was diese Mobilisierung eines transzendentalen Inhalts vielleicht an theoretischen Konsequenzen impli- 107 Buch I: Kritik und System ziert, vor allem, wenn man im diskursiven Verstand den absoluten Primat des synthetischen Aktes gegenüber der formartigen Einheit für angenommen hält. Schließlich, wie offenbart sich gerade dieser Akt der Synthese dem Bewusstsein? Indirekt zweifellos, durch einen fundierten direkten Schluss (Inferenz), in letzter Analyse aus dem Prinzip des Grundes1 , aber vor diesem, nach Kant, durch eine unmittelbare metasensible Wahrnehmung, in der der Geist, ausgehend von sinnlichen Gegebenen, sich erkennt als „Fakultät der Synthese2 “, oder sogar als „reine Spontaneität3 “. 1 Siehe weiter oben SS.131-132 2 siehe weiter oben SS.94-95 3 siehe weiter oben SS.100-101 Der Text der Kritik verbietet es, dieses Begreifen des transzendentalen Ichs durch sich selbst „Intuition“ zu nennen. Im eigentlichen Sinne ist sie nichts als eine „transzendentale Reflexion“ über das „empirische Objekt“. Aber sie erreicht im transzendentalen Ich eine metempirische, positiv affirmierbare Bestimmung. Und sie realisiert also irgendeine Approximation des intuitiven Modus, eine Näherung über die eine vollständige Theorie des Wissens Rechenschaft geben müsste. Wird Kant diese Aufgabe auf sich nehmen? Er scheint von jetzt an allzusehr beschäftigt zu sein auf den Wegen der aktiven Synthese, oder wenn man so will, des dynamischen Transzendentalismus, um sich zu erlauben, sie damit aufzuhalten: entweder zurückschreiten auf das reine „formartige“ oder weiterzugehen, im Sinne des Dynamismus auf ein noch verhülltes Ziel, das ist nunmehr die einzige offene Alternative des kritischen Idealismus. Setzen wir unsere Untersuchung fort. §4.– „Die praktische“ Anwendung der Vernunft 138 1˚ Heuristische Rolle der „Ideen“ Die subjektive Deduktion der „Ideen“ in der „transzendentalen Dialektik“ erklärt, wie die Koordination und die Subordination unserer Urteile entsprechend ihrem formartigen Typ (kategorische, hypothetisch oder disjunktiv) der reflektierenden Vernunft drei große Auswege zu einem Unbedingten4 eröffnet. 4 Siehe Heft III, 2.Aufl. S.168-173 3.Aufl. S.220-225 Je nachdem, ob man in dieser Deduktion der Ideen einen subjektiven Prozess sieht, gesteuert durch das tiefliegende Bedürfnis der Einheit der Vernunft oder nur die Repräsentation einer logischen Staffelung unserer Urteile in drei konvergierende Reihen, jede symbolisiert durch eine ideale Grenze, spricht man entweder im eigentlichen Sinn von einer Bewegung der Organisation des Ich oder nicht. Die negativen agnostischen Schlüsse der transzendentalen Dialektik beruhen auf der zweiten Interpretation, wo es keinen wirklichen Begriff der 108 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 Bewegung gibt. Aber vielleicht genügt diese statische und minimalistische Interpretation schon nicht, um die positive – „regulierende“ oder „heuristische“ – Rolle in ihrer ganzen Weite zu erklären, die durch die Kritik selbst den Ideen der Vernunft zugeschrieben wird5 . 5 Siehe Heft III, 2.Aufl. S. 204-207; 3.Aufl. S. 267-269 „Ein Blick auf die Gesamtheit der Erkenntnisse des Verstandes zeigt, dass der zur Erkenntnis beitragende Anteil der Vernunft, das was sie sich zu realisieren bemüht, in der systematischen Organisation der Erkenntnis besteht1 “. 1 139 KRV B, S.673 5.Abschnitt im Verlinkten, Link umfasst B670-B678 Jedes System „steht notwendig unter der Leitung von einer Idee: die Idee der Form eines Ganzen der Erkenntnis 2 “. Weit davon entfernt „der Begriff eines Objekts“ zu sein, repräsentiert diese Idee direkt nur eine formartige, den (objektiven) Begriffen des Verstandes3 überlagerte Idee. 2 Ebenda – vergl. oben SS. 63-64 3 Ebenda Die Konstitution solcher Ideen geht ein, sagt Kant, in die „hypothetische Verwendung“ der Vernunft: „Wenn die Vernunft das Vermögen ist, das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten, dann gilt von folgenden zwei Dingen nur eines: entweder ist das Allgemeine schon gewiss in sich und gegeben; in diesem Fall fehlt nur mehr ein Urteil, um darunter [das Besondere] zu subsumieren, das dadurch notwendig bestimmt wird. Ich nenne das die apodiktische Verwendung der Vernunft. Oder der allgemeine (Begriff) ist zuerst nur problematisch angenommen, wie eine bloße Idee: (in diesem Fall) ist das Besondere als gewiss gegeben, aber die Universalität der Regel, von der es abhängt, bleibt ein Problem. Man macht also an mehreren partikulären Fällen, alle sicher, den Versuch der Anwendung dieser Regel, um zu sehen, ob sie sich daraus ergeben. Im affirmativen Fall, wenn es irgendeinen Anschein gibt, dass alle die partikulären Fälle, die sich präsentieren werden, gleicherweise daraus ableiten, schließt man auf die Universalität der Regel. Dann, von dieser aus, auf die Gesamtheit der Fälle, die in keiner Weise in sich selbst gegeben sind. Das ist es, was ich die hypothetische Verwendung der Vernunft nennen werde4 “ 109 Buch I: Kritik und System 4 KRV B, SS. 674-675 Link de facto B670-B678 Original Kant: Wenn die Vernunft ein Vermögen ist, das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten, so ist entweder das Allgemeine schon an sich gewiß und gegeben, und alsdann erfordert es nur Urteilskraft zur Subsumtion, und das Besondere wird dadurch notwendig bestimmt. Dieses will ich den apodiktischen Gebrauch der Vernunft nennen. Oder das Allgemeine wird nur problematisch angenommen, und ist eine bloße Idee, das Besondere ist gewiß, aber die Allgemeinheit der Regel zu dieser Folge ist noch ein Problem; so werden mehrere besondere Fälle, die insgesamt gewiß sind, an der Regel versucht, ob sie daraus fließen, und in diesem Falle, wenn es den Anschein hat, daß alle anzugebenden besonderen Fälle daraus abfolgen, wird auf die Allgemeinheit der Regel, aus dieser aber nachher auf alle Fälle, die auch an sich nicht gegeben sind, geschlossen. Diesen will ich den hypothetischen Gebrauch der Vernunft nennen. 140 Die „regulierende“ oder „heuristische“ Funktion der transzendentalen Ideen gehört zu dieser „hypothetischen Anwendung der Vernunft“. Offensichtlich setzt sie von Seiten des rationalen Subjekts eine wahrhafte dem Regime des Verstandes eingeprägte Ausrichtung voraus. Denken wir nicht an die Aktivität eines „Subjekts an sich“ und die Aktivität von psychologischen Fähigkeiten. Wenn man sich beschränkt auf die transzendentale Ebene, ist es erlaubt in voller Strenge von einer spontanen Bewegung der Vereinigung von Begriffen des Verstandes zu sprechen unter dem exemplarischen Typ der „regulierenden“ Idee. Zwischen dieser „Begriffs-Bewegung“ (wir werden sie in einem viel weiteren Kontext bei Hegel finden) und der Unbeweglichkeit eines transzendentalen Subjekts, das man voraussetzen würde als reduziert auf eine Staffelung von formartigen Bedingungen, scheint der Ausgleich zumindest schwierig zu bewältigen. Die transzendentale Dialektik noch mehr als die Analytik assoziiert also mit dem Merkmal des Subjekts das Merkmal eines gewissen inneren Dynamismus: Der Dynamismus einer Einheit, die sich macht und die sich darin von der reinen logischen Einheit auf Anhieb unterscheidet. Von Seiten des Objekts wirft die transzendentale Dialektik ein schwaches Licht, das noch nicht durchscheint durch die Schlussfolgerungen der Analytik. Registrieren wir betreffs dieses Punktes das Denken von Kant, ohne es abzuschwächen noch es zu übertreiben. In jeder Hypothese bleibt es in seinen Augen gesichert, dass die Ideen unserer Vernunft nicht „konstitutiv“ sind für irgendein wahrhaftes Objekt, weil sie nicht zur notwendigen Struktur von irgendeinem „möglichen Objekt der Erfahrung“ gehören. Heißt das, dass sie objektive Gültigkeit (“objektive Realität“) völlig entbehren? Kant glaubt im Gegenteil, dass ihr heuristischer Wert eine gewisse objektive Geltung zur Folge hat, selbst im Gesichtspunkt der theoretischen Vernunft. Tatsächlich besteht die positive Rolle dieser „Ideen“ vor allem darin, die Rechte der Einheit im objektiven Bereich der Erfahrung voranzubringen. Nun ist es aber für die innere Vollkommenheit der Erfahrung, für ihre Wahrheit der Gesamtheit nicht gleichgültig, eine mehr oder weniger vereinheitlichte Organisation zu präsentieren. Die Einheit auferlegt sich a priori, als ein fundamen- 110 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 tales Gesetz, auf alle Ebenen unserer Erkenntnisse, jeder einzelnen von ihnen entsprechend ihrem Grad. Wenn die Arten der Vereinheitlichung, die durch die „regulierenden“ Ideen eingeführt werden, hypothetisch bleiben in ihrem besonderen Ziel, reflektieren sie dafür eine absolute Notwendigkeit in ihrer allgemeinen Zielsetzung, insofern sie Näherungs-Ausdrücke einer Bedingung einer konstitutiven Einheit der Erfahrung selbst sind. Siehe da, wenigstens das, was man lesen kann in der Kritik. Sei es zum Beispiel die Hypothese, die die Kausalität von Substanzen auf „nur eine radikale Kraft“ zurückführt: „Es zeigt sich aber, wenn man auf den transzendentalen Gebrauch des Verstandes achthat, daß diese Idee einer Grundkraft überhaupt, nicht bloß als Problem zum hypothetischen Gebrauche bestimmt sei, sondern objektive Realität vorgebe, dadurch die systematische Einheit der mancherlei Kräfte einer Substanz postuliert und ein apodiktisches Vernunftprinzip errichtet wird1 .“ 1 KRV B, S.678 141 Das ist nicht etwa empirisch, indem man den Vorschlägen der Erfahrung folgt, auch nicht nur in den Grenzen jeder Substanz, sondern a priori und universell, „für jede Materie im allgemeinen, dass die Vernunft die systematische Einheit der verschiedenen Kräfte voraussetzt; denn die besonderen Gesetze der Natur sind allegemeineren Gesetzen untergeordnet. Und die Einsparung von Prinzipien ist nicht allein eine Maxime für die gute Anwendung der Vernunft sondern ein inneres Gesetz der Natur. Tatsächlich sieht man nicht, wie ein logisches Prinzip der rationalen Einheit sich einschalten könnte ... ohne die Voraussetzung eines transzendentalen Prinzips, das a priori diese systematische Einheit als notwendig und den Objekten selbst inhärent auferlegt ... Allerdings ist das Gesetz der Vernunft, das die Suche der [Einheit] auferlegt, notwendig, weil es ohne dieses Gesetz] keine Vernunft mehr gäbe, ohne Vernunft keine kohärente Verwendung des Verstandes, ohne diese regelmäßige Anwendung keine hinreichende Markierung der empirischen Wahrheit mehr – und dass wir folglich beim Betrachten dieser empirischen Wahrheit die systematische Einheit der Natur als objektiv geltend und notwendig voraussetzen müssen1 “ 111 Buch I: Kritik und System 1 KRV B. S. 678-679, Vergl. S.685-686 Link umfasst B679-B687 Original Kant: wo so gar viele, obzwar in gewissem Grade gleichartige, angetroffen werden, wie an der Materie überhaupt, setzt die Vernunft systematische Einheit mannigfaltiger Kräfte voraus, da besondere Naturgesetze unter allgemeineren stehen, und die Ersparung der Prinzipien nicht bloß ein ökonomischer Grundsatz der Vernunft, sondern inneres Gesetz der Natur wird. In der Tat ist auch nicht abzusehen, wie ein logisches Prinzip der Vernunfteinheit der Regeln stattfinden könne, wenn nicht ein transzendentales vorausgesetzt würde, durch welches eine solche systematische Einheit, als den Objekten selbst anhängend, a priori als notwendig angenommen wird. Denn mit welcher Befugnis kann die Vernunft im logischen Gebrauche verlangen, die Mannigfaltigkeit der Kräfte, welche uns die Natur zu erkennen gibt, als eine bloß versteckte Einheit zu behandeln, und sie aus irgendeiner Grundkraft, soviel an ihr ist, abzuleiten, wenn es ihr freistände zuzugeben, daß es ebensowohl möglich sei, alle Kräfte wären ungleichartig, und die systematische Einheit ihrer Ableitung der Natur nicht gemäß? denn alsdann würde sie gerade wider ihre Bestimmung verfahren, indem sie sich eine Idee zum Ziele setzte, die der Natureinrichtung ganz widerspräche. Auch kann man nicht sagen, sie habe zuvor von der zufälligen Beschaffenheit der Natur diese Einheit nach Prinzipien der Vernunft abgenommen. Denn das Gesetz der Vernunft, sie zu suchen, ist notwendig, weil wir ohne dasselbe gar keine Vernunft, ohne diese aber keinen zusammenhängenden Verstandesgebrauch, und in dessen Ermanglung kein zureichendes Merkmal empirischer Wahrheit haben würden, und wir also in Ansehung des letzteren die systematische Einheit der Natur durchaus als objektiv gültig und notwendig voraussetzen müssen.“ Kant fährt fort: „Was bei diesen [regulierenden] Prinzipien bemerkenswert ist, ... das ist, dass sie transzendental zu sein scheinen und dass sie, ohne etwas anderes zu enthalten als einfache richtungweisende Ideen im Hinblick auf eine empirische Verwendung der Vernunft (diese Verwendung bezieht sich noch nur asymptotisch auf die Ideen, das heißt angenähert, ohne sie jemals zu erreichen), besitzen sie nichtsdestoweniger als synthetische Prinzipien a priori eine objektive, zweifellos unbestimmte Geltung. Sie dienen als Regeln der möglichen Erfahrung. Sie werden selbst mit Erfolg angewandt als heuristische Prinzipien in der Ausarbeitung der Erfahrung2 ...“. 2 KRV B, S.691 Link umfasst B688-B696 Was bei diesen Prinzipien merkwürdig ist, und uns auch allein beschäftigt, ist dieses: daß sie transzendental zu sein scheinen, und, ob sie gleich bloße Ideen zur Befolgung des empirischen Gebrauchs der Vernunft enthalten, denen der letztere nur gleichsam asymptotisch, d. i. bloß annähernd folgen kann, ohne sie jemals zu erreichen, sie gleichwohl, als synthetische Sätze a priori, objektive, aber unbestimmte Gültigkeit haben, und zur Regel möglicher Erfahrung dienen, auch wirklich in Bearbeitung derselben, als heuristische Grundsätze, mit gutem Glücke gebraucht werden, ohne daß man doch eine transzendentale Deduktion derselben zustande bringen kann, welches, wie oben bewiesen worden, in Ansehung der Ideen jederzeit unmöglich ist. Kurz, sie unterwerfen die Objekte des Verstandes der universellen Forderung der Einheit, entsprechend der „schematischen“ Regel des „Maximums in der Teilung und in der Verknüpfung der intellektuellen Erkenntnis unter einem einzigen Prinzip3 “ 3 142 KRV B, S.693 Ihre objektiver Geltung ist also durchaus nicht die von wahrhaften Objekten sondern von wahren „Maximen“, die wirklich den Interessen der objektiven 112 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 Erkenntnis dienen, denn wir erfahren durch sie „die empirische und bestimmte [das heißt objektive] Verwendung des Verstands vollständig in Übereinstimmung mit sich selbst zu bringen, indem er sie so viel wie möglich verknüpft mit dem Prinzip der universellen Einheit, und sie davon ableitet4 “ 4 KRV B, S.693-694 De facto B688-B696 Man sieht also, dass die subjektiv notwendigen Ideen der reinen Vernunft als objektive Repräsentationen nur hypothetisch ("´problematisch“) sind, aber „kategorisch“ sind als Maximen, die unsere mentale Einstellung regulieren. Sie gebieten uns absolut „ jede Verkettung in der Welt zu betrachten nach den Prinzipien der systematischen Einheit, folglich als ob alle Dinge von einem einzigen Sein stammen würden, das alles umfasst wie von einer höchsten, völlig hinreichenden Ursache1 “ und „als ob diese Ursache alles hervorgebracht hätte, insofern sie die höchste Intelligenz ist, nach dem weisesten Plan2 “ 1 KRV B, S.714 Link von 713-728 2 KRV B. S.716 link von 713-728 Wir wissen nicht aus der theoretischen Wissenschaft, ob die „transzendentale Voraussetzung3 “, ausgedrückt in dem als ob, in sich selbst objektiv verwirklicht werden kann oder nicht, aber wir wissen, dass die waghalsige Anwendung dieser Voraussetzung auf die Erfahrung die empirische Erkenntnis zu ihrem Maximum der objektiven Geltung bringt. Ein geheimes Band verknüpft also a priori die ursprünglichen Bedingungen des Objekts des Verstandes (unser einziges authentisches Objekt) und die Regel der durch die Vernunft auferlegten Methode: Die Relativität des als ob behaftet die „rationale Maxime“ gar nicht mit einer Willkür. 3 KRV B. SS. 704ff. Link B697-B704 Sieht man im Bannkreis selbst der spekulativen Vernunft den oberflächlichen Gegensatz und den tiefen Zusammenhalt zwischen einer Wahrheit der Theorie und einer Wahrheit der Praxis dämmern? 2˚ Die moralischen Postulate, das Reich der Ziele und die Transzendenz des Objekts. 143 Jenseits der reinen Spekulation offenbart das subjektive Spiel der „reflektierenden Vernunft“, analysiert in seiner notwendigen Verknüpfung mit der moralischen, ästhetischen und technischen Aktivität des Menschen, ohne jeden 113 Buch I: Kritik und System 144 Zweifel, im Inneren des Ich eine aktive Bewegung von Bestimmungen, gelenkt durch ein höchstes Ideal der Einheit. Um unsere Untersuchung in diese Richtung weiter zu treiben, müssten wir eingehend die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft befragen. Aber ist das hier nicht überflüssig, da doch die dynamische Komponente des gesamten Lebens des Geistes so sehr offensichtlich ist, selbst nach den Angaben der zweiten und der dritten „Kritik“? Von den von Kant veröffentlichten Werken ist die Kritik der praktischen Vernunft die, wo der radikale Dynamismus der Vernunft sich in der ganzen Fülle ihrer unbedingten Ansprüche am offensichtlichsten betont. Als „kategorischer Imperativ“ wird die Vernunft unserer überlegten Handlung dasselbe Gesetz der universellen Einheit auferlegen, das sie als apperzeptiver Akt den objektiven Bestimmungen unseres Bewusstseins auferlegte. Es ist bedauerlich, dass der kritizistische Philosoph, statt die direkte Synthese dieser zwei Aspekte einer selben souveränen Setzung zu machen, sich damit zufrieden gab, sie äußerlich durch die Theorie der Postulate zu verknüpfen. Das ruft andererseits von unserer Seite nach einer aufmerksamen Prüfung, denn das stellt eine vollkommen bewusste und gewollte Flucht dar hin zur metaphysischen Transzendenz. Was die ganz von der Idee der kosmischen „Finalität“ durchdrungene Kritik der Urteilskraft betrifft, sie richtet das „problematische“ Feld des reflektierenden Urteils so gut ein, dass man versucht ist, in dem System der Finalität, das sie vorschlägt, etwas zu sehen, was mehr ist als die „Asymptote1 “ einer finalistischen Metaphysik des Objekts. Das verdient in gleicher Weise, geprüft und mit den Schlüssen der „praktischen Vernunft“ konfrontiert zu werden. 1 Der Ausdruck ist von Kant. Vgl. KRV B. S.691 Die Theorie der Postulate wurde kurz woanders2 erklärt. 2 Heft III, Buch I, Kap. 3, §§5 und 6 Nehmen wir hier einige Züge davon wieder auf, in der Hoffnung, so viel wie möglich, einen immer noch umstrittenen Punkt der Exegese Kants aufzuhellen. Bevor die Kritik der praktischen Vernunft (1788) erschien, hatte Kant im Verlauf von etwa zwanzig Jahren immer klarer die Ergänzungen vorausgesehen, die die praktische Vernunft beitragen könnte angesichts der Ohnmacht der theoretischen Vernunft den noumenalen Objekten gegenüber. Während der vorkritischen Periode drückt sich diese Ahnung durch Anspielungen aus, In der Kritik der reinen Vernunft (transzendentale Dialektik, Anhang und Methodologie, Kap. II, zweite Auflage) wird die Anspielung zu einem präzisen Grundriss eines Programms: Kant bittet da seine Leser vorläufig zuzulassen – und lässt sich später selbst darauf ein zu beweisen –, dass die transzendentalen Ideen, einfache Hypothesen auf der theoretischen Ebene, wo die Intuition fehlt, die sie objektivieren würde, trotz Fehlen der Intuition, in der praktischen Ordnung indirekte Garantien der objektiven Geltung finden können. Vom transzendenten Objekt der Ideen kann man nicht (direkt) beweisen, dass 114 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 es ist, aber man behauptet notwendig, dass es sein muss. Man „postuliert“ es als Bedingung a priori der Möglichkeit der moralischen Handlung, die selbst absolut verpflichtend3 ist. 3 Zum Beispiel KRV A. SS.633-634; B. 661-662 Nur hat diese objektive Behauptung, fundiert auf der „Praxis“, nur Geltung, sagt Kant, für die „Praxis“ (“in moralischer Absicht“). Die Notwendigkeit des Postulats ist durchaus nicht die des transzendenten Objekts, das sie repräsentiert, sondern die, wo das Subjekt findet, dass es handelt, als ob dieses Objekt real4 wäre. 4 145 KRV A. SS.672-673; B. SS. 700-701 (Link de facto B697-B704) In welchem Sinn muss man die rein praktische oder moralische Geltung des Postulats verstehen? Interessiert die Objektivität, die es von der praktischen Vernunft erhält, die theoretische Vernunft in keiner Weise – so dass handeln „als ob“ das Postulat wahr wäre, nicht bezeichnet (bedeutet): es für wahr halten weil die moralische Handlung das so fordert, sondern nur: in der Handlung die bestehen bleibenden Reserven der theoretischen Vernunft ignorieren wollen? Im ersten Fall vollzieht die praktische Vernunft eine Vertretung, einen Ersatz. Im zweiten Fall unterstützt sie eine Fiktion. Dieselbe Frage stellt sich beim Thema des Wortes „fürwahrhalten“ angewandt von der Kritik der praktischen Vernunft 1 und von der Kritik der Urteilskraft 2 , um die spekulative Haltung zu charakterisieren, die die moralischen Postulate von uns reklamieren. 1 KPV, SS. 6-7, 261 2 Kr. U, §§90-91 Die Frage hat eine gewisse Wichtigkeit. Sie stellt das Problem der mehr oder weniger vollständigen Abdichtung der zwei Arten von „Vernunft“, oder genauer das Problem der Beziehung zwischen dem praktischen Fundament der Postulate und der theoretischen Möglichkeit der postulierten Objekte. Im Grunde handelt es sich darum, zu wissen ob die Vernunft, vor jeder Trennung von ihr selbst in theoretische Vernunft und in praktische Vernunft schon eine allgemeine objektive Tragweite besitzt, wie es irgendwo Delbos sagt3 3 Die praktische Philosophie von Kant, Paris, 1905 S.444 Dass „die Prinzipien der reinen Vernunft, in ihrer praktischen Verwendung, das heißt in ihrer moralischen Anwendung, eine objektive Realität haben4 “: 4 KRV B, S.836 siehe da, zusammengefasst das, was uns die Kritik der reinen Vernunft bezogen auf die Postulate, lehrte. Um die Nuancen abzuschätzen, die durch die Kritik der praktischen Vernunft zu dieser Erklärung hinzukommen, wird es das Sicherste sein, Kant selbst sich darüber erklären zu lassen. Er sagt: „Ich verstehe unter dem Postulat der reinen praktischen Vernunft ... einen theoretischen Satz soweit dieses, theoretisch un- 115 Buch I: Kritik und System beweisbar, untrennbar verbunden ist mit einem praktisch a priori und unbedingt gültigen Gesetz5 “ 5 KPV, S. 220 Man darf die Postulate der praktischen Vernunft nicht verwechseln mit denen der reinen Mathematik: „Diese letzteren postulieren die Möglichkeit einer Handlung6 , deren Objekt im Voraus als möglich anerkannt ist mit der vollen Sicherheit einer theoretischen Erkenntnis a priori. Die ersteren postulieren die Möglichkeit eines Objekts selbst, ... kraft der Apodiktizität von praktischen Gesetzen und folglich nur im Dienst einer praktischen Vernunft7 “. 146 6 Zum Beispiel die, einen Kreis zu zeichnen, eine Senkrechte zu errichten auf einer Geraden, usw. 7 KPV, Seite 20 Anmerkung Sie erweitern also die Tragweite unserer Vernunft auf neue Objekte Aber „wie ist eine Erweiterung der reinen Vernunft unter dem praktischen Gesichtswinkel konzipierbar ohne eine entsprechende Erweiterung der spekulativen Erkenntnis8 ?“ 8 KPV, S. 241, Überschrift VII „Um eine reine Erkenntnis der praktischen Ordnung zu erweitern, ist es nötig, dass eine Absicht oder ein Ziel a priori gegeben sei in der Weise eines Objekts (des Wollens), und dass dieses Objekt, unabhängig von jedem theoretischen Prinzip, aber als Folge eines (kategorischen) Imperativs, der unmittelbar den Willen bestimmt, als praktisch notwendig repräsentiert wird. So hier das höchste Gut. Nun aber ist das nur möglich konzipierbar, indem man drei theoretische Begriffe voraussetzt...: die Freiheit, die Unsterblichkeit und Gott. Also postuliert das praktische Gesetz, das in einer gegebenen Welt die Verwirklichung des perfektest möglichen Gutes vorschreibt zugunsten von [problematischen] Objekten der reinen spekulativen Vernunft, die Möglichkeit, die objektive Realität, die diese Vernunft ihr nicht versichern kann. Dadurch empfängt zweifellos die theoretische Erkenntnis einen Zuwachs, der aber nur darin besteht: Begriffe, die sonst für sie nur problematisch wären (reine Objekte des Denkens) werden nun assertorisch eingeordnet unter die Begriffe, denen wahrhafte Objekte1 entsprechen.“ 1 KPV, SS.241-242 Weil die praktische Vernunft nicht darauf verzichten kann, nach dem höchsten Gut zu streben, 116 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 „findet sich die theoretische Vernunft [die das höchste Gut nur konzipiert als von gewissen objektiven Bedingungen umgeben], autorisiert, diese vorauszusetzen2 “ 2 147 Ebenda „Dieser Zuwachs der theoretischen Vernunft ist dennoch nicht eine Erweiterung der Spekulation selbst; Sie erlaubt nicht, daraufhin die postulierten Objekte zu theoretischen Zielen3 positiv zu verwenden“; 3 Ebenda tatsächlich „ist uns nichts gegeben“ über ihre wirkliche oder mögliche Intuition4 4 Ebenda Die drei transzendentalen Ideen, die nicht wären „noch nicht durch sich selbst Erkenntnisse, ... sondern nur (transzendente) nicht widersprüchliche Gedanken, sind nun, kraft eines praktischen apodiktischen Gesetzes, versehen mit objektiver Realität, ganz genau so wie notwendige Bedingungen der Möglichkeit des Objekts selbst [des höchsten Guts], das dieses Gesetz zu realisieren befiehlt; sagen wir es anders: es ist uns zu verstehen gegeben [durch das reine praktische Gesetz], dass diese Ideen Objekte haben, ohne dass irgendetwas uns anzeigt, wie ihr Begriff sich auf ein Objekt beziehen kann: und diese [Mitteilung ihrer Objerktivität] ist noch keine Erkenntnis dieser Objekte selbst [...] Es findet also dabei keine Bereicherung unserer Erkenntnis von gegebenen übersinnlichen Objekten statt, aber dennoch hat man dabei eine Erweiterung der theoretischen Vernunft und ihrer Erkenntnisse auf das Übersinnliche im allgemeinen hin, soweit die theoretische Vernunft sich gezwungen sah, die Existenz von dergleichen [übersinnlichen] Objekten zuzulassen, welche weiter zu bestimmen sie unfähig bleibt1 “. 117 Buch I: Kritik und System 1 KPV VII, SS.243-244 Original Kant: Die obigen drei Ideen der spekulativen Vernunft sind an sich noch keine Erkenntnisse; doch sind es (transzendente) Gedanken, in denen nichts Unmögliches ist. Nun bekommen sie durch ein apodiktisches praktisches Gesetz, als notwendige Bedingungen der Möglichkeit dessen, was dieses sich zum Objekte zu machen gebietet, objektive Realität, d.i. wir werden durch jenes angewiesen, daß sie Objekte haben, ohne doch, wie sich ihr Begriff auf ein Objekt bezieht, anzeigen zu können, und das ist auch noch nicht Erkenntnis dieser Objekte; denn man kann dadurch gar nichts über sie synthetisch urteilen, noch die Anwendung derselben theoretisch bestimmen, mithin von ihnen gar keinen theoretischen Gebrauch der Vernunft machen, als worin eigentlich alle spekulative Erkenntnis derselben besteht. Aber dennoch ward das theoretische Erkenntnis, zwar nicht dieser Objekte, aber der Vernunft überhaupt, dadurch so fern erweitert, daß durch die praktischen Postulate jenen Ideen doch Objekte gegeben wurden, indem ein bloß problematischer Gedanke dadurch allererst objektive Realität bekam. Also war es keine Erweiterung der Erkenntnis von gegebenen übersinnlichen Gegenständen, aber doch eine Erweiterung der theoretischen Vernunft und der Erkenntnis derselben in Ansehung des übersinnlichen überhaupt, so fern als sie genötigt wurde, daß es solche Gegenstände gebe, einzuräumen, ohne sie doch näher bestimmen, mithin dieses Erkenntnis von den Objekten (die ihr nunmehr aus praktischem Grunde, und auch nur zum praktischen Gebrauche, gegeben worden,) selbst erweitern zu können, Unter dem „praktischen“ Gesichtspunkt werden die Ideen aus transzendenten und regulierenden, die sie waren, „zu immanenten und konstitutiven das heißt dass sie die Möglichkeit grundlegen, das notwendige Objekt der reinen praktischen Vernunft (das höchste Gut) zu realisieren2 “ 2 148 Ebenda Die postulierten Objekte sind uns also gegeben durch die praktische Vernunft als wahre Objekte vom Standpunkt unseres Handelns aus. Und die theoretische Vernunft nimmt dieses Urteil der Objektivität auf. Sie treibt ihre Kollaboration sogar weiter voran, indem sie auf diese realen Objekte die Negationen3 und die Affirmatonen4 anwendet, mit denen die „regulierenden“ Ideen, bevor sie als Postulate aufgestellt sind, ihre hypothetischen Objekte umgaben. 3 KPV SS-244-245 4 KPV, SS.246-248 Noch besser: indem sie diese Prädikate anwenden entsprechend der ganzen intensiven Weite, die das moralische Absolute verlangt. Zum Beispiel, in der Hypothese der Existenz Gottes, beweist die spekulative Vernunft, dass der Autor und Organisator des Universums „unmessbar weise, gut, mächtig usw. sein muss5 “; 5 KPV S.251 sie kann nicht weiter gehen: „die Allwissenheit, die absolute Gutheit, die Allmacht usw.6 “ entgehen der rein physischen oder metaphysischen Beweisführung. 6 Ebenda Nichtsdestoweniger (und das ist sehr bemerkenswert, lässt Kant an der selben Stelle beobachten) der Begriff Gottes, insofern er durch das moralische Gesetz postuliert ist, empfängt von diesem Hauptpunkt nicht nur die rohe Objektivi- 118 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 tät, sondern selbst die Attribute der absoluten Vollkommenheit, die auf jedem anderen Weg unzugänglich sind: die theoretische Vernunft urteilt tatsächlich, dass Gott die Möglichkeit des „höchsten Gutes“ nicht gewährleisten könnte, wenn er nicht allweise, die Allmacht, die Allgegenwart, der Ewige, kurz das absolut vollkommene Sein wäre7 7 KPV S.252 Scheint es von daher nicht, dass, wenn einmal die absolute Verpflichtung des moralischen Handelns gegeben ist, alle in der Theorie der Postulate eingeschlossenen Beziehungen von logischer Ordnung, analytisch seien? Das ist jedoch nicht ganz exakt. Mit skrupulöser Sorgfalt beweist Kant die logische Qualität der hauptsächlichen Artikulierungen seiner Theorie. Und er nimmt von ganz oben her die ganze Frage wieder auf. „Ein Bedürfnis der reinen Vernunft in ihrem spekulativen Gebrauch führt nur zu Hypothesen; das Bedürfnis der reinen praktischen Vernunft führt zu den Postulaten8 “ 8 KPV, VIII, SS.255-256 Das theoretische Bedürfnis antwortet auf das Streben des Denkens nach seiner eigenen subjektiven Vollkommenheit; aber die anerkannte Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist für die Objektivität der Erkenntnisse, die ihr vorausgehen1 überhaupt nicht erfordert. 1 KPV VIII S.256 „Im Gegenteil dazu ist das Bedürfnis der reinen praktischen Vernunft fundiert auf dem Sollen, auf der Verpflichtung meinem Wollen ein Objekt (das höchste Gut) zuzuteilen, nach dem ich mit all meinen Kräften strebe; um das zu machen, muss ich die Möglichkeit dieses Guts und seiner [rationalen] Bedingungen voraussetzen, nämlich Gott, die Freiheit und die Unsterblichkeit2 “ 149 2 KPV VIII S.257 Nun aber erzwingt sich das Sollen „durch sich selbst mit einer apodiktischen Sicherheit“, ohne irgendeine spekulative Stütze zu benötigen3 . 3 Ebenda „Aber die subjektive Wirkung dieses Gesetzes [des Sollens], ich will sagen, die Absicht ... die Verwirklichung des höchsten Gutes anzustreben, setzt mehr oder weniger die Möglichkeit dieses letzteren [der Verwirklichung des höchsten Gutes] voraus. anderenfalls würde man sich stoßen an der praktischen Unmöglichkeit, nach einem Objekt eines Begriffes zu streben, das im Grunde leer wäre und ohne Gegenstand4 “ 4 Ebenda 119 Buch I: Kritik und System Denn die moralische Intention, weit davon entfernt, nur eine freiwillige Entscheidung zu sein, bestimmt durch kontingente Neigungen, ist der „Gehorsam gegenüber einem absoluten Gebot, objektiv fundiert auf der Natur der Dinge5 “ 5 KPV S.258 sie schließt also den Zweifel an der objektiven Möglichkeit des gebotenen Ziels aus6 6 150 KPV SS.258 und 259 Anmerkung Die intellektuelle Zustimmung zu den Postulaten, in dem Sinne, wie wir sie gerade definieren, wird von Kant „moralischer Glaube“ oder „reiner praktischer [=pragmatischer] rationaler Glaube7 “ genannt. 7 Einige Definitionen Kants: „Das Fürwahrhalten oder die subjektive Geltung des Urteils unter der Beziehung der Überzeugung (die zugleich objektive Geltung hat) weist die drei folgenden Grade auf: das Meinen, der Glaube und das Wissen. Das Meinen ist ein Fürwahrhalten begleitet vom Bewusstsein seines Ungenügens sowohl subjektiv als auch objektiv. Wenn das Fürwahrhalten subjektiv hinreichend zur gleichen Zeit als für objektiv ungenügend gehalten wird, nennt man es Glaube. Schließlich das Fürwahrhalten, das sowohl subjektiv wie objektiv hinreichend ist, nennt sich Wissen.“ (KRV B. Methodologie S.850 Link enthält B848-B859) – Im stregen Sinn „ist es nur unter dem praktischen Gesichtspunkt, dass man Glaube [foi] eine theoretisch ungenügende Zustimmung nennen kann. Dieser praktische Gesichtspunkt ist entweder der der Geschicklichkeit, (es ziemt sich) [kontingenter Gesichtspunkt, der nicht eine Sicherheit begründen kann] oder der Sittlichkeit [notwendiger, absolut verpflichtender Gesichtspunkt]“ (KRV B S.851). Der „moralische Glaube“ ist die subjektiv notwendige Zustimmung zu den Postulaten des moralischen Gebots (vgl. KRV B S.856). In der theoretischen Ordnung selbst begegnet man einer dem „moralischen Glauben“ analogen Zustimmung, den man auch „lehrhaften Glauben“ nennen kann; dieser, nur auf einem „Bedürfnis“ oder auf einem Übereinkommen (Anstand) der spekulativen Vernunft fundiert, ist mehr als eine Meinung und weniger als eine Sicherheit: im Unterschied zum „moralischen Glauben“ hat der „rein doktrinale Glaube etwas Wankendes an sich“ (KRV B, S.855) Link enthält B848-B859 also alle vorherigen Zitate Dieser Anmerkung Aber hier werden genauere Distinktionen notwendig. Wäre der Akt des moralischen Glaubens, durch den die Möglichkeit des höchsten Gutes anerkannt wird, selbst das Objekt des moralischen Gebotes? Nein; Kant urteilt mit Evidenz „Dass das Fürwahrhalten der Möglichkeit des höchsten Gutes gar nicht verpflichtend ist und dass keinerlei moralische Intention die Forderung dafür auferlegt, sondern dass es Sache der spekulativen Vernunft ist, dieses Fürwahrhalten anzunehmen, ohne sich dazu auffordern zu lassen. Was kann man tatsächlich ernsthaft vorschützen gegen die Möglichkeit an sich einer Entsprechung zwischen der Würdigkeit [Verdienst] vernünftiger Seiender, welche ihre Treue zum moralischen Gesetz würdig macht, glücklich zu sein, und dem effektiven Besitz einer dem entsprechenden Glückseligkeit? Ebenso, was die erste der zwei Komponenten des höchsten Gutes betrifft, die welche die Moralität krönt [die Tugend], genügt es, dass das moralische Gesetz uns eine Ordnung anweist [ein Gebot gibt]: denn zweifeln an der Möglichkeit dieser Komponente [das heißt zweifeln an der Möglichkeit, dem Sollen zu gehorchen], 120 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 käme darauf zurück, das moralische Gesetz selber in Zweifel zu setzen. Es verhält sich damit anders mit der zweiten Komponente, die welche eine vollkommene Verhältnismäßigkeit aufstellt zwischen dem Verdienst und dem Glück: um dessen Möglichkeit im Abstrakten anzunehmen, ist ein Gebot gar nicht nötig, denn die theoretische Vernunft hat dagegen keinen Einwand; bleibt dennoch dass die Art und Weise, in der wir uns diese [höhere] Harmonie der Naturgesetze mit den Gesetzen der Freiheit vorstellen müssen [ keineswegs so bestimmt ist, dass sie nicht] etwas unserer Wahl überlässt. Und in diesen Grenzen, da die theoretische Vernunft garnichts mit einer apodiktischen Sicherheit entscheidet, kann der entscheidende Anstoß durch ein moralisches Interesse gegeben werden1 “ 1 KPV S. 260-261 VIII [nach dem *] Um bei dem Gebrauche eines noch so ungewohnten Begriffs, als der eines reinen praktischen Vernunftglaubens ist, Mißdeutungen zu verhüten, sei mir erlaubt noch eine Anmerkung hinzuzufügen. - Es sollte fast scheinen, als ob dieser Vernunftglaube hier selbst als Gebot angekündigt werde, nämlich das höchste Gut für möglich anzunehmen. Ein Glaube aber, der geboten wird, ist ein Unding. Man erinnere sich aber der obigen Auseinandersetzung dessen, was im Begriffe des höchsten Guts anzunehmen verlangt wird, und wird man inne werden, daß diese Möglichkeit anzunehmen gar nicht geboten werden dürfe, und keine praktischen Gesinnungen fordere, sie einzuräumen, sondern daß spekulative Vernunft sie ohne Gesuch zugeben müsse; denn daß eine, dem moralischen Gesetze angemessene, Würdigkeit der vernünftigen Wesen in der Welt, glücklich zu sein, mit einem dieser proportionierten Besitze dieser Glückseligkeit in Verbindung, an sich unmöglich sei, kann doch niemand behaupten wollen. Nun gibt uns in Ansehung des ersten Stücks des höchsten Guts, nämlich was die Sittlichkeit betrifft, das moralische Gesetz bloß ein Gebot, und, die Möglichkeit jenes Bestandstücks zu bezweifeln, wäre eben so viel, als das moralische Gesetz selbst in Zweifel ziehen. Was aber das zweite Stück jenes Objekts, nämlich die jener Würdigkeit durchgängig angemessene Glückseligkeit, betrifft, so ist zwar die Möglichkeit derselben überhaupt einzuräumen gar nicht eines Gebots bedürftig, denn die theoretische Vernunft hat selbst nichts dawider: nur die Art, wie wir uns eine solche Harmonie der Naturgesetze mit denen der Freiheit denken sollen, hat etwas an sich, in Ansehung dessen uns eine Wahl zukommt, weil theoretische Vernunft hierüber nichts mit apodiktischer Gewißheit entscheidet, und, in Ansehung dieser, kann es ein moralisches Interesse geben, das den Ausschlag gibt. 151 So drückt sich also die theoretische Vernunft, gestützt auf die praktische Vernunft, a priori mit einer ganz objektiven Sicherheit für die Möglichkeit des höchsten Gutes an sich aus, das heißt, für die Notwendigkeit einer EndVersöhnung der perfekten Tugend und des höchsten Glücks. Dafür, dass diese Versöhnung sich nicht in irgendeiner Hypothese vollziehen kann allein durch das Spiel der Kräfte der Natur – dass sie unbedingt eine schöpferische Weisheit verlangt am Ursprung der zwei Reiche der „Natur“ und der „Moralität2 “, – wie beweisen wir uns das in Strenge, durch objektive Gründe? 2 KPV S.262 Wir stellen nur fest, dass keine ausschließlich „natürliche“ Interpretation die geringste Stütze in der Erfahrung findet, und dass der Rückgriff auf drei Postulate die einzige plausible Interpretation des höchsten Gutes vor unserer theo- 121 Buch I: Kritik und System retischen Vernunft bleibt.. Da diese sich unbedingt auferlegt als höchstes Ziel für unsere Handlung, gehorchen wir, indem wir frei die Postulate annehmen einer subjektiven Forderung der Kohärenz und der Einheit, die am besten den „moralischen Interessen“ dient, ohne selbst unter das absolute Gebot des moralischen „Imperativs“ zu fallen. „Das Prinzip, das unsere Affirmation der Postulate bestimmt, ist, um die Wahrheit zu sagen, subjektiv als Bedürfnis der Vernunft; gleichzeitig als Mittel, ein praktisches Ziel zu fördern, ist es objektiv und notwendig. Es ist ja das Fundament der Maxime, die in der moralischen Perspektive [gewisse Objekte, deren theoretische Demonstration unzureichend bleibt,] für wahr halten lässt1 “ 1 KPV S.263 – Man beachte, dass dieser Anfang des Satzes alle Vorbehalte anzeigt, mit denen die Kritik die Behauptung der Postulate umgibt: „[eine] Maxime des Fürwahrhaltens in moralischer Absicht“ Original Kant so ist das Prinzip, was unser Urteil hierin bestimmt, zwar subjektiv, als Bedürfnis, aber auch zugleich als Beförderungsmittel dessen, was objektiv (praktisch) notwendig ist, der Grund einer Maxime des Fürwahrhaltens in moralischer Absicht, d.i. ein reiner praktischer Vernunftglaube. Dieser ist also nicht geboten, sondern, als freiwillige, zur moralischen (gebotenen) Absicht zuträgliche, überdem noch mit dem theoretischen Bedürfnisse der Vernunft einstimmige Bestimmung unseres Urteils, jene Existenz anzunehmen und dem Vernunftgebrauch ferner zum Grunde zu legen, selbst aus der moralischen Gesinnung entsprungen; kann also öfters selbst bei Wohlgesinneten bisweilen in Schwanken niemals aber in Unglauben geraten. 152 Bevor wir aus diesem Paragraphen die Schlussfolgerung ziehen, werfen wir noch einen kurzen Blick in Richtung der dritten Kritik. „Die praktische Vernunft hat in uns ein absolutes Ziel entdeckt (das höchste Gut), das durch die Übereinstimmung unseres empirischen Handelns mit dem Gesetz unserer Freiheit zu verwirklichen, uns als Pflicht obliegt. Dieses letzte Ziel annehmen, wie wir es sollen, das heißt damit zugleich, zwischen unseren Fähigkeiten und der Welt der Phänomene den Maßstab der korrespondierenden voraus liegenden Übereinstimmung zuzulassen, die eine wirkliche Verfolgung des letzten Ziels ermöglicht. Diese voraus liegende Übereinstimmung ist notwendigerweise als herrührend von einer ordnenden Intelligenz konzipiert, die die Konstitution der Dinge nach den aktiven Bedürfnissen unserer praktischen Vernunft angepasst hätte.2 “ 2 Heft III, 2.Aufl. Buch V K.2, §3 S.226 3.Auflage Buch V, §3, S.292 Siehe da zusammengefasst, nach den Abschnitten II der Einleitung und IX der Einleitung in der Kritik der Urteilskraft die festen Anknüpfungspunkte, die diese letztere in der Kritik der praktischen Vernunft findet. Wie wir weiter oben gesehen haben, ist die apodiktische Notwendigkeit des moralischen Gesetzes indiskutabel; daraus ergibt sich für die theoretische Vernunft ein unmittelbares Korollar: die Möglichkeit der moralischen Handlung und wie diese Möglichkeit verstanden werden muss ihrer ganzen Weite des Gebots nach, schließt sie logisch die „Möglichkeit an sich“ des höchsten moralischen 122 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 153 Ziels ein, das heißt des höchsten Guts, wenigstens insofern es eine moralische Vollkommenheit repräsentiert. Bis dahin liefert die Allianz der praktischen Vernunft und der theoretischen Vernunft gewisse, objektiv gültigen Schlüsse in der übersinnlichen Ordnung der Noumene. Nach Ansicht Kants selbst muss diese absolute Sicherheit sich erstrecken, so scheint es uns, bis zur einklagbaren Harmonie zwischen der moralischen Vollkommenheit und der Seligkeit. Tatsächlich, obwohl der Wert der Moralität formell im guten Willen residiert und nicht in der äußeren Handlung, ändert das nichts daran dass Richtigkeit der äußeren Handlung das verpflichtende Objekt des guten Willens ist. Wenn diese Richtigkeit an sich unverwirklichbar wäre oder wenn die Wirksamkeit des moralischen Wollens in der Welt der Phänomene utopisch wäre, würde die ganze praktische Ordnung und selbst der kategorische Imperativ unintelligibel und widersprüchlich werden. Nun ist aber in der Welt der Phänomene die Handlung notwendig dem Wunsch nach Seligkeit unterworfen. Die End-Harmonie des Glücks und der Tugend muss also objektiv möglich sein, wenn es wahr ist, dass das moralische Gesetz nicht Widersprüchlichkeit in sich selbst duldet. Was die Notwendigkeit einer transzendenten Intelligenz betrifft, um die Harmonie der zwei Elemente des höchsten Guts zu fundieren, ist das eigentlich gesprochen nur ein praktisches „Postulat“, subjektiv notwendig in dem Sinn, dass unsere Vernunft, da sie nicht eine andere erklärende Hypothese sieht, aber nicht sich enthalten kann, irgendeine zu formulieren, ihrem „Bedürfnis“ nach systematischer Einheit nachgibt durch einen positiven Akt des Fürwahrhaltens, konform den Vorschlägen des „moralischen Interesses“. Wir müssen also, um logisch zu sein, in der Welt der Phänomene eine Struktur zulassen„ die geeignet ist für die Forderungen der moralischen Handlung. Wenn wir darüber hinaus einem dringenden Wunsch unserer Vernunft gehorchend, eine höchste Organisations-Weisheit postulieren, anerkennen wir a priori in der Welt nicht nur eine mechanische Verkettung von Ursachen und Wirkungen, sondern eine durch die Vorstellung von Wirkungen geleitete Kausalität, das heißt eine Ordnung von objektiven Zielen. Was wissen wir von diesen Zielen? Sie sind nicht objektiv in der Erfahrung gegeben, die nur Ursachen und Wirkungen kennt. Aber wissend, dass sie existieren und dass sie dem höchsten moralischen Ziel untergeordnet werden müssen, können wir, ausgehend von der Idee der „natürlichen Finalität“ sie „hypothetisch“ rekonstruieren im Rahmen eines „Systems der Erfahrung“, indefinit (unbestimmt, bis ins Unendliche) vervollkommenbar und dauernd kontrolliert durch die Handlung. Die Erarbeitung dieses „Systems“ ist das Werk der „Fähigkeit zu urteilen [der Urteilskraft]“ betrachtet „in ihrem reflektierenden Gebrauch“. Kant schreibt „Diese bietet uns in der Idee einer Finalität der 123 Buch I: Kritik und System Natur, das begriffliche Zwischenglied, [das für uns unentbehrlich ist] zwischen den Begriffen der Natur und den Begriffen der Freiheit, das heißt einen Begriff, der den Übergang möglich macht von der reinen theoretischen Domäne zur rein praktischen Domäne, von unnachgiebiger Regularität der Naturfinalität zur EndVollkommenheit der Begriffe der Freiheit1 ".’ 1 Kr. U., Einleitung S. IV. In dem Maße, wie sie sich vervollkommnet, muss unsere hypothetische Repräsentation der „Ziele in der Welt“ die wahrhaften Ziele der Natur enger umfassen und schließlich streben nach der totalisierenden Intuition, die die schöpferische Weisheit davon besitzt. „Vor dem reflektierenden Urteil, wenn nicht vor dem bestimmenden Urteil liefern uns die rationalen Prinzipien hinreichende Gründe, den Menschen nicht nur für einen Naturzweck zu halten, wie es alle anderen organisierten Seiende sind, sondern, selbst auf dieser Erde, für den letzten Zweck der Natur angesichts dessen alle anderen natürlichen Seienden ein System von Zielen bilden2 “ 154 2 Kr.U. §83, S.388 Aber über den Zielen der Natur gibt es die Ziele der Freiheit, die moralischen Ziele und unter ihnen das absolut letzte, „dessen Möglichkeit nicht bedingt ist durch irgend ein anderes Ziel1 “: nennen wir es „den Endzweck“, das „höchste Ziel“. 1 Kr. U. §84, S.396 Auf dieses ist die Natur radikal hingeordnet, jedoch unfähig durch sich selbst, es zu verwirklichen; der Mensch, frei Handelnder, kann es, indem er die Natur der „unbedingten Gesetzgebung“ der moralischen Ordnung unterwirft. Schon „Ziel der letzten Natur“, macht seine moralische Bestimmung „ihn fähig ebenfalls zu einem höchsten Ziel, dem die ganze Natur teleologisch untergeordnet ist2 “. 2 Kr. U. §84 S.399 Wie es die Kritik der reinen Vernunft gezeigt hat, antwortet die finalistische Interpretation der Natur in ihr selbst betrachtet, abstrahiert vom moralischen Imperativ zweifellos auf ein Bedürfnis unserer Vernunft, ohne jedoch die logische Geltung einer plausiblen Hypothese zu überschreiten; auf dieser Hypothese errichtete sich der „physiko-theologische“ Beweis, mehr überredend als schlüssig, zu Gunsten der Existenz eines sehr weisen und sehr mächtigen Schöpfers. Evidenterweise geht, nach den Prinzipien von Kant, diese ganze konstruktive Arbeit der Fakultät zu Urteilen (der Urteilskraft) aus der „regulierdenden“ oder „heuristischen“ Aktivität der Vernunft hervor und kann im 124 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 Höchstfall unter theoretischem Gesichtspunkt von uns eine Zustimmung von „doktrinalem Glauben“ wecken. Aber so wie es ist, bahnt es den Weg für die absoluten Forderungen der Freiheit für diesen Komplex apodiktischer Forderungen und theoretischer Postulate, die das Gerüst bilden für eine „EthikoTheologie“: „Die Physiko-Theologie ist eine schlecht verstandene physische Teleologie, brauchbar nur als Vorbereitung (Propädeutik) für die Theologie; sie kann nicht [direkter] beitragen zu diesem Ziel als dadurch dass sie sich verbindet, als Stützpunkt, mit einem völlig verschiedenen Prinzip [dem moralischen Prinzip]3 “ 155 3 Kr. U. §85 S.410 Sie wird also eine „Ethico-Theologie4 “ 4 vgl. Kr. U. §86 Objekt eines Aktes des „moralischen Glaubens“, dessen praktische Geltung der Sicherheit in ihrer Ordnung nicht geringer ist als die sichere Geltung spekulativer Evidenzen5 . 5 siehe Kr.U. §§87-91 Man kann glauben, dass die offensichtliche Neigung der theoretischen Vernunft, hypothetisch eine finalistische Interpretation des Universums zu formulieren und sich so wie instinktiv den absoluten Forderungen der praktischen Vernunft, dem Ergebnis der tiefliegenden Einheit der Vernunft als solcher zuzuwenden. Das ist es wohl, was in mehreren Anläufen die Erklärungen von Kant selbst insinuieren: trotz des Gegensatzes der zwei großen Sphären der rationalen Aktivität. „es gibt trotzdem nur eine einzige Vernunft: ob das der theoretische Gesichtspunkt ist oder der praktische Gesichtspunkt, sie urteilt nach Prinzipien a priori; und es ist also klar, dass, wenn ihre Fähigkeit nicht ausreicht im ersten Gesichtspunkt, die Affirmation gewisser Sätze zu rechtfertigen, die ihr andererseits nicht widersprechen, dennoch, sobald diese selben Sätze mit einem praktischen Interesse der reinen Vernunft verküpft erscheinen, sieht sie sich gezwungen, sie anzunehmen, sicher nicht als ein Produkt ihres eigenen Bodens, aber als einen fremden, genügend garantierten Beitrag; mehr noch, sie verpflichtet sich, sie zu vergleichen und sie zu verknüpfen, indem sie alle ihre Ressourcen der spekulativen Vernunft einsetzt1 “ 1 KPV S. 218 Die zwei Arten von „Vernunft“ sind also untereinander koordiniert; die eine ergänzt das Ungenügen der anderen. Das ist noch zu wenig gesagt, denn die 125 Buch I: Kritik und System einfache Koordinierung würde Konflikte erzeugen: sie sind einander untergeordnet unter dem Primat der praktischen Vernunft: „In der Vereinigung der spekulativen Vernunft und der reinen praktischen Vernunft angesichts der Erkenntnis, gehört der Primat der praktischen Vernunft... In letzter Analyse ist das ganze Interesse der Vernunft praktisch [moralisch]: das spekulative Interesse selbst ist bedingt und erhält seine Fülle nur in der praktischen [moralischen] Anwendung2 “. 156 2 KPV SS. 218-219 Schon die Methodologie der reinen Vernunft3 3 Siehe oben, Kap. II, §2, 2˚: „Die Idee des Systems bei Kant“. dehnte die systematische Vollkommenheit der Philosophie über die spekulative Domäne hinaus aus.: Da die wahre Philosophie „Weisheit“ ist, muss unsere Konzeption selbst der materiellen Welt, um vollständig zu sein, moralische Werte beachten. Ab sofort sehen wir unter der klaren Bejahung des Primats der praktischen Vernunft das metaphysische System, unlängst abstrakt durch die Methodologie wachgerufen, in seiner konkreten Physiognomie Gestalt annehmen. Die Metaphysik Kants wird also im Wesentlichen eine Metaphysik der praktischen Vernunft sein, ein moralischer Dogmatismus. Eine rein spekulative Metaphysik, eine Wissenschaft des Seins, könnte im Kantismus nur eine (wirkliche oder mögliche) Metaphysik der intellektuellen Intuition sein: die Kritik der reinen Vernunft verbietet uns jeden Anspruch unter dieser Rücksicht. Unserer menschlichen Natur kommt nur eine Metaphysik des Sein Sollens zu, ganz abhängig von den absoluten Anweisungen der „Freiheit“, und die Bedingungen der Möglichkeit einer verpflichtenden Aufgabe symbolisch übersetzend in Ausdrücke des Seins. Die notwendigen Behauptungen dieser „praktischen Metaphysik“ auferlegen unserer intellektuellen Zustimmung authentische noumenale Objekte: Die Objekte des moralischen Glaubens sind weder weniger sicher noch weniger real als die der theoretischen Wissenschaft; und wenn Kant die legitime Verwendung der ersteren auf „einen moralischen Zweck“ („nur in moralischer Absicht1 “) beschränkt 1 157 KPV S. 263 will er nur sagen, dass die theoretische Vernunft, sie adoptierend, sie selbst angesichts der Handlung ausarbeitend, dadurch nichts lernt über die Bedingungen ihrer möglichen Intuition. Eine letzte Bemerkung. Wenn die Metaphysik der Postulate eine Metaphysik des Objekts ist, schuldet sie das der singulären Setzung des rationalen Subjekts, in dem sich die zwei Welten der Natur und der Freiheit, des Phänomens und des Noumens vereinigen. Mehr und mehr wird der Mensch sich uns 126 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 offenbaren als der Schlüssel des kantschen Systems, als das Perspektivitätszentrum, von wo aus alles gesehen werden muss, um für unsere Augen seinen richtigen Wert anzunehmen. „Es existiert in der Welt nur eine Art von Sein, dessen Kausalität teleologisch ist, das heißt auf Ziele ausgerichtet, aber in solcher Weise, dass das Gesetz, das ihnen vorschreibt, Ziel zu suchen, durch sie begriffen wird als unbedingt, unabhängig von jeder natürlichen Knechtschaft und dennoch in ihr selbst notwendig. Der Mensch insofern er Noumenon ist, ist ein Sein dieser Art. Er ist das einzige Sein der Welt, in dem, von seiner natürlichen Konstitution her, es uns gegeben ist, eine übersinnliche Fähigkeit (die Freiheit) zu erkennen, nämlich [zu erkennen] alles zusammen das Gesetz der Kausalität mit seinem Objekt; denn dieses Objekt kann der Mensch sich vorsetzen als ein höchstes Ziel (als die höchste Realisierung des Guten in der Welt)2 “ 2 Kr. U, §84, S.398 Die weitere Entwicklung des Denkens von Kant wird den Menschen nicht absinken lassen von seiner privilegierten Situation, „in der Welt vernünftig zu sein“. 3˚ Die Freiheit und die Transzendenz des Subjekts. 158 Der vorausgehende Paragraph hat uns durch die Vermittlung des moralischen Subjekts zur Affirmation von noumenalen Objekten geführt. Wir werden nun, indem wir von Objekten abstrahieren, unsere Aufmerksamkeit auf das Subjekt selbst konzentrieren, betrachtet als „Freiheit“. Diese Betrachtung reiht sich ganz natürlich ein in die allgemeine, mehr dynamische als formartige Perspektive, die uns die Entwicklung des kantschen „Systems“ seit etwa 1787 aufgedeckt hat. Ganz neue Kommentatoren haben treffend insistiert auf dieser späten Orientierung des Kantismus. Delbos hatte sie vorher signalisiert in einem Satz, den wir gerne zitieren, weil er bei Kant einen aufkeimenden Gesichtspunkt sehr genau charakterisiert, der noch keine Theorie war. „Es ist eine Leitidee, die entsteht und die sich von nun an einbürgert zugleich als eine Kraft der Verbindung und der Erweiterung im Zentrum des kantschen Werks: ...die Idee, dass die Vernunft, die höchste Vernunft, für uns Handlung ist, nicht Repräsentation und dass sie ihre eigenen Begriffe nur zur Geltung bringen kann in Anwendungen, definiert durch die Bedingungen selbst unserer wissenschaftlichen Erfahrung und unserer praktischen Handlung 1 “. 1 V. Delbos, Die praktische Philosophie von Kant, Paris, 1905, S. 245. Wir heben einige Wörter hervor. Man ahnt – und wir bestätigen es weiter unten – die unwiderstehliche Assimilations-Kraft, ausgeübt von der Idee der Handlung. An dem Moment, zu 127 Buch I: Kritik und System dem wir gelangt sind, beginnt Kant kaum, den Antrieb zu erleiden. In seinem Denken stößt der Dynamismus der Handlung sich noch an den nicht überwundenen formartigen Grenzlinien, und bricht dort in Stücke. Die Kausalität des Dings an sich (Objekt an sich oder Subjekt an sich) bleibt ein Mysterium. Die Intuition a priori der Sinnlichkeit ordnet sich der synthetischen Fähigkeit des Verstandes unter: Aber wo kommt sie her? Der apperzeptive Akt unterscheidet sich gründlich vom freien Akt. Die regulierende Aktivität der theoretischen Vernunft kann die Interessen der praktischen Vernunft begünstigen, aber ihre jeweiligen Bereiche bleiben undurchlässig. Wenn wir uns diesen verschiedenen Ordnungen der Handlung unter der gemeinsamen Rubrik des Aktes oder des Dynamismus nähern, ist das Band der Einheit, das wir schaffen noch immer nur ein abstraktes Band. In Wahrheit eröffnet gerade die Möglichkeit einer Annäherung im Abstrakten Probleme, die Kant früher oder später aufgreifen muss. Unter diesen Vorbehalten kann man die Wichtigkeit nicht zu sehr unterstreichen, die für die kantsche Systematik die Idee der Freiheit schon annimmt. „Der Begriff der Freiheit, soweit seine reale Geltung bewiesen ist durch ein apodiktisches Gesetz der praktischen Vernunft, konstituiert den Grundpfeiler des ganzen systematischen Gebäudes der reinen Vernunft selbst der reinen spekulativen Vernunft; alle anderen Begriffe (die von Gott und der Unsterblichkeit), unhaltbar, solange sie in der Vernunft wie reine Ideen bleiben, werden sich verknüpfen mit dem Begriff der Freiheit und empfangen mit ihm, durch ihn, Stabilität und objektive Realität: das heißt dass ihre Möglichkeit bewiesen ist gerade durch die Tatsache, dass die Freiheit real ist2 “ 159 2 KPV, Vorrede S.4 Welche Freiheit verherrlicht Kant in diesen Ausdrücken? Ist die Freiheit nicht, ganz bescheiden, eine der drei Postulate des Sollens? Sicherlich, erklärt das Vorwort der Kritik der praktischen Vernunft, aber ein privilegiertes Postulat. „Die Freiheit ist die Bedingung des moralischen Gesetzes ... [während] die Ideen Gottes und der Unsterblichkeit nicht Bedingungen des moralischen Gesetzes sind, sondern nur Bedingungen des notwendigen Objekts eines Sollens, das durch dieses Gesetz bestimmt ist3 “. 3 KPV, Vorrede S.5 Um das noch zu präzisieren: „Die Freiheit ... ist ratio essendi [= Seinsgrund] des moralischen Gesetzes, wobei das moralische Gesetz die ratio cognoscendi [= Erkenntnisgrund] der Freiheit ist4 “. 128 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 4 KPV S.5 Anmerkung Auf der vorhergehenden Seite5 5 KPV Vorrede S.4 war diese Freiheit identifiziert worden als die „unbedingte Ursache“, deren Idee, einfache Hypothese der theoretischen Vernunft, erlaubte, die dritte kosmologische Antinomie aufzulösen1 . 1 Siehe KRV, transzendentale Dialektik, Kap. II, 3. Abschnitt („Anmerkung zur dritten Antinomie“) und 9.Abschnitt III. In den zwei Ausgaben A und B unterscheidet die Methodologie in derselben Ausgabe (A und B) „eine transzendentale Verwendung ... und eine praktische Verwendung des Begriffs der Freiheit“. Die transzendentale Freiheit bezeichnet hier die problematische Idee, die die dritte Antinomie auflöst; die praktische Freiheit oder der „freie Wille“ (KRV A, S.802) ist ein Wille, gesteuert durch die Repräsentation von übersinnlichen Beweglichen, ungeachtet der Anstöße der Sinnlichkeit. Wenn man zulässt, dass die Repräsentation der Beweggründe in unser Bewusstsein fällt, wird man sagen, dass „die praktische Freiheit durch Erfahrung bewiesen werden kann“ (vgl. KRV A. SS.801-802. Vergl. das mit Grundlegung der Metaphysik der Sitten, 1785, Ak, Bd.IV, SS.412-413). 160 Man muss dennoch zugstehen, dass sehr häufig, selbst meistens, die Freiheit, weit davon entfernt, diesen Ehrenrang einzunehmen, aufgezählt wird ebenbürtig mit den zwei anderen Postulaten, als Bedingung nicht eigentlich des moralischen Gesetzes sondern der Ausübung dieses Gesetzes, das heißt, als Bedingung der Handlung, die sich entwickelt im Rahmen der „Natur“, über der Anordnung des rein rationalen Imperatvs. Wir müssen hier nicht die – ein wenig schwankende – Terminologie von Kant verteidigen. Die meisten Schwierigkeiten die die Texte bieten, lösen sich leicht auf, wenn man drei Arten von Sinn unterscheidet, den in der Kritik und in den Grundlagen der Metaphysik der Sitten das Wort „Freiheit“ annehmen kann. 10 Die „transzendentale Freiheit“ der Kritik der reinen Vernunft 2 2 KRV A, S.534; B SS.561-562 das heißt die transzendente Kausalität, unbedingt, die man den empirischen Verkettungen von Ursachen und Wirkungen überlagern muss, um die dritte Antinomie aufzulösen. Diese transzendente hypothetische Kausalität, wirksam in der Welt der Phänomene, würde auf der noumenalen Ebene das hervorbringen, was Kant einen „intelligiblen Charakter“ nennt, der als er selbst auf der phänomenalen Ebene einen „empirischen Charakter3 “ bestimmen würde. 3 KRVB SS.566-569. – Der „Charakter“ einer Ursache ist „das Gesetz nach dem sich seine Kausalität vollzieht“ (KRV B S.567). In der so konzipierten Freiheit lädt Kant uns ein, einen positiven Aspekt, eigentlich „transzendental“ zu unterscheiden: die „Spontaneität“, oder „die Fähigkeit durch sich selbst einen Zustand einzuleiten“, ohne darin von irgendeiner anderen Ursache abzuhängen — und einen negativen Aspekt: die „praktische Freiheit“ oder die „Willensfreiheit“, das heißt die Unabhängigkeit „in Bezug auf den Zwang auferlegt durch die Neigungen der Sinnlichkeit4 “. 4 KRV B, S. 562. 0 2 Die Freiheit als „gesetzgeberischer Wille“, als „apodiktische Macht der praktischen Vernunft“, als „ratio essendi [= Seinsgrund] des moralischen Ge- 129 Buch I: Kritik und System setzes“. Von dieser Freiheit ist der kategorische Imperativ der direkte Ausdruck. Zum Beispiel in der Kritik der praktischen Vernunft: „das einzige Prinzip der Moralität, so lesen wir, besteht in der vollständigen Unabhängigkeit im Bezug auf den materialen Inhalt des Gesetzes (das heißt in Bezug auf jedes gewünschte Objekt), aber gleichzeitig in der Bestimmung der freien Fähigkeit durch die reine universelle gesetzgeberische Form, die so beschaffen ist, dass sie eine Maxime empfangen kann... Die Unabhängigkeit [in Bezug auf den materieartigen Inhalt] ist die Freiheit im negativen Sinn, aber die Fähigkeit der praktischen Vernunft, sich für sich selbst das Gesetz vorzuschreiben [Hervorhebung von uns], ist die Freiheit im positiven Sinn. Das moralische Gesetz drückt also nichts anderes aus als die Autonomie der reinen praktischen Vernunft, das heißt der1 Freiheit1 “. 0 161 KPV, SS.58-59; vgl. SS. 51, 53, 55 und Kr.U. S. 412 a. Siehe weiter oben 1 und S.159 Anmerkung 5 Das ist wohl zweifellos in dieser positiven und autonomen Freiheit, wo Kant die „Grundpfeiler [den Schlussstein]“ für jedes Gebäude der Vernunft sah. Er versöhnt sie selbst mit der „transzendentalen Freiheit“, aber, wie wir glauben, nur soweit wie diese durch die Kritik der reinen Vernunft der „praktischen Freiheit“ oder „dem freien Willen“ gegenübergestellt wird. 30 Die Freiheit als Wahlfreiheit oder als „freier Wille“ das heißt als Fähigkeit, dem moralischen Gesetz zu gehorchen, selbst trotz der entgegengesetzten Verlockung der „Neigungen“. Es ist diese Freiheit, die voraussetzt in den Subjekten des Gesetzes dessen verpflichtenden Charakter. Es ist in der Tat unmöglich, die moralische Verpflichtung zu konzipieren, ohne sich die Möglichkeit vorzustellen, ihr zu genügen. Nun aber setzt diese Möglichkeit des dem Gesetz Gehorchens, diese Möglichkeit, sich zu bestimmen, in der Welt der Phänomene entsprechend den rationalen Vorschriften wiederum bei dem Handelnden einen entsprechenden Grad von Unabhängigkeit in Bezug auf die Zwänge der Sinnenwelt voraus; auf der empirischen Ebene entspricht diese Unabhängigkeit einer Wahl zwischen verschiedenen möglichen Reihen von Phänomenen. Die Kritik der reinen Vernunft spricht häufig von der Freiheit in der Bedeutung, von der man gerade spricht; und es ist in diesem Sinne, mehr als im Sinne des „autonomen gesetzgeberischen Willens“, dass die Freiheit ein Postulat genannt wird. „Die Postulate sind die Unsterblichkeit, die Freiheit positiv betrachtet (als Kausalität eines Seins insofern es gehört zur intelligiblen Welt) und die Existenz Gottes... Das zweite [das Postulat der Freiheit] rührt her von der Notwendigkeit, die Unabhängigkeit [der moralischen Handlung] vorauszusetzen in Bezug auf 162 130 Kapitel 3: Evolution des kantschen Systems der Vernunft: von 1781 bis 1793 die Welt der Sinneswahrnehmung und der Fähigkeit, seinen Willen zu bestimmen nach dem Gesetz einer intelligiblen Welt, das heißt nach dem Gesetz der Freiheit2 “ 2 KPV SS.238-239 Von den drei Bedeutungen des Wortes „Freiheit“, findet sich die erste in den zwei anderen wieder aber die zweite und die dritte sind direkt von Kant selbst einander entgegengesetzt, wenn er sie unterscheidet zwischen der Autonomie des moralischen Imperativs und der Autokratie der moralischen Handlung in der3 Welt3 Diese Distinktion ist ausdrücklich formuliert in der Kritik der praktischen Vernunft und auch in den Fortschritten der Metaphysik seit Leibniz u. Wolff (Ak. Bd.XX, S. 295). Wir finden sie wieder im Opus pustumum. 163 doppelter Aspekt der noumenalen Kausalität eines freien Subjekts, fähig sich selbst zu befehlen und seinem eigenen Befehl zu gehorchen. Unter welchem Aspekt auch immer man andererseits die Freiheit betrachtet – als absoluter Imperativ des Bewusstseins oder als Fähigkeit zu antworten oder sich dieser Anordnung zu entziehen– in jedem Fall erscheint dem Prinzip der praktischen Vernunft eine aktive Spontaneität, innerlich noumenal, die sich souverän der Welt der Phänomene aufzwingt. Von dieser transzendenten Spontaneität hören wir Kant sagen, dass sie das Fundament der Postulate ist oder noch mehr „der Schlussstein des ganzen Gebäudes der Vernunft, selbst der spekulativen“. Aber diese letzte Erklärung hat uns noch nicht die Fülle des Sinnes geliefert, den sie birgt. Tatsächlich, trotz der Konvergenz der großen Linien, bleibt die Einheit des Systems der reinen Vernunft zu unvollständig, dass es möglich sei, darauf schon den „Schlussstein“ zu setzen. Wir beschränken uns darauf, drei gut sichtbare Anzeichen dieses Zustands der Unfertigkeit hervorzuheben. a) Zwischen der theoretischen Vernunft und der praktischen überschreiten die von Kant aufgezeigten Beziehungen bis jetzt nicht eine gewisse äußere Übereinstimmung, allerhöchstens eine natürliche Harmonie, die eine radikalere Einheit nahelegt. Aber diese hat keinen definierten Ausdruck in einem System, das im Gegenteil die totale Undurchlässigkeit der zwei Felder der rationalen Operationen mit Nachdruck behauptet. b) Zwischen der „Möglichkeit an sich“, die man wohl den postulierten Objekten zubilligen muss, und ihrer „theoretischen Möglichkeit“, das heißt der Möglichkeit ihrer „Intuition“, kann der Unterschied nicht ausgeglichen werden weder durch die zweite noch durch die dritte Kritik: Der Versuch der theoretischen Rekonstruktion dieser Objekte, versucht in der Kritik der Urteilskraft durch eine Methode der wachsenden Annäherung (die denken lässt an die leibnizsche Methode der „Wahrscheinlichkeiten“) liefert nicht nur niemals mehr als „Hypothesen“, sondern ist sogar unfähig, nach Kant, diesen einen Grad von 131 Buch I: Kritik und System wahrhafter „Wahrscheinlichkeit“ zu verleihen, sie zu erheben im theoretischen Gesichtspunkt zu einer „Meinung1 “. 1 164 Siehe Kr. U. §§90 und 91, 8, KRV b, §16, S.133, Anmerkung Man erinnert sich an die herausragende Position, die die Kritik der reinen Vernunft (2.Auflage) der ursprünglichen synthetischen Handlung des Bewusstseins zuschrieb: diese „synthetische Einheit“ wurde der Höhepunkt „der ganzen Logik und nach ihr der transzendentalen Philosophie“; mit einem Wort, sie wurde „der Verstand selbst“. Hier ist die Freiheit der Reihe nach erklärt zum „Schlussstein“ des Systems der reinen Vernunft. Sicherlich haben der apperzeptive Akt und die freie Handlung verschiedene Funktionen. Verzichtet man deshalb darauf, eine Brücke zu bauen zwischen den beiden Höhepunkten? Zu verschieden, um auf die Identität reduziert zu werden, bieten sie zu viele Analogien, um nicht ein Band von systematischer Einheit zwischen ihnen zu fordern. Nehmen wir diese nicht gelösten Probleme gut zur Kenntnis. Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 165 §1.–Kant zieht Bilanz (gegen 1793) 166 1790 machte die königliche Akademie von Berlin eine Ausschreibung, mit dem Fälligkeitstermin zum 1. Januar 1792, zu folgender Frage: „Welches sind die wirklichen Fortschritte der Metaphysik in Deutschland seit der Zeit von Leibniz und Wolff?“ Die Dauer der Ausschreibung wurde in der Folge bis zum 1. Juni 1795 verlängert. Von den vorgelegten Memoranden wurden drei eines Preises für würdig befunden, die von Schwab, von Reinhold und von Abicht. Kant scheint erst 1792 daran gedacht zu haben, selbst die vorgelegte Frage zu behandeln; er arbeitete daran sicherlich 1793. Später gab er das Unternehmen auf und hinterließ drei unvollendete Redaktionen als Manuskript; aber er vertraute diese Fragmente und einige Anhänge F. Th. Rink an mit der Auflage, sie in Ordnung zu bringen, und daraus wenn möglich eine Veröffentlichung zu machen. Diese fand statt 1804, kurze Zeit nach dem Tod von Kant. Wie verstand Rink seine Rolle als Editor? Wenn man seinem Vorwort glaubt, hat er die ihm anvertrauten Manuskripte vollständig veröffentlicht: seine persönliche Intervention hätte sich beschränkt auf lokale Umstellungen, strikt notwendig um die drei unvollständigen Versionen in einem einzigen miteinander zu einem einzigen harmonischen Ganzen zu verschmelzen; er verschob in einen Anhang die Fragmente, die in seiner Konstruktion keinen Platz finden konnten. Der größte Teil der Kritiken, die sich mit den Fortschritten beschäftigten, haben diese topographischen Reste hoch eingeschätzt und sogar gegen 132 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. Brink den Vorwurf erhoben, hier und da den Originaltext verändert zu haben. Die Manuskripte, die die Debatte zu entscheiden erlaubt hätten, waren nicht mehr auffindbar1 . 1 Die Herausgabe der Fortschritte durch K. Vorländer (Philosophische Bibliothek, Leipzig 1905) fügt der Veröffentlichung von Rink nützliche Verbesserungen hinzu. 167 Für die Verwendung, die wir hier von den Fortschritten machen müssen, haben die Mängel der Edition Rink kaum Bedeutung. Die Vorgehensweise der Lehre konnten nicht groß beeinflusst werden durch einige mögliche AusdrucksVarianten. Was die Anordnung des Gesamten betrifft, kann man damit nicht zufrieden sein; und wir hätten sicherlich die reine und einfache Reproduktion der Manuskripte vorgezogen. Aber ist es der Mühe wert, uns aufzuhalten mit diesen Streitereien, wenn es auf jeden Fall klar ist, dass Kant nur einen sehr mittelmäßigen Nutzen aus der Gelegenheit gezogen hat, die sich ihm bot, seine ganze Philosophie in einer kraftvollen Kurzfassung zusammenzutragen und damit selbst ihren Platz in der Geschichte der Ideen zu kennzeichnen? Trotzdem liefert uns sein unvollendetes Werkchen, beim Fehlen eines Meisterwerks, ein kostbares Dokument über die Konzeption, die er sich machte vom „System der reinen Vernunft“ zu dem Zeitpunkt wo – die Periode der drei „Kritiken“ abgeschlossen war – und sein Denken dazu überging, sich mit einer neuen und letzten Kehrtwedung zu befassen. In den Augen Kants erschien die Entwicklung der Metaphysik im Verlauf der Zeitalter gestaffelt in drei großen Phasen: die erste, wo sich ein spekulativer Dogmatismus organisiert („theoretisch-dogmatischer Fortgang“) noch voll vertrauend auf die Geltung der Vernunft, erstreckt sich vom Altertum bis Leibniz und Wolff; die zweite, verstanden vor allem in der Periode, die unmittelbar folgt auf Leibniz-Wolff, ist charakterisiert durch eine Art skeptische Aussetzung („skeptischer Stillstand“) unserer absoluten Zustimmungen, die durch die „Antinomien“ erschüttert waren; die dritte Phase ist nichts anderes als die kantsche Weichenstellung der Metaphysik auf die Wege eines „praktischen Dogmatismus“ („praktisch-dogmatische Vollendung“), wo die menschliche Vernunft, erleuchtet durch die Kritik, ihr definitives Gleichgewicht findet1 . 1 Siehe Fortschritte usw., Ausgabe Rink Ak. Bd. XX, SS. 281, 261-264 Sehen wir, worin nach Kant diese letzte Phase die beiden anderen wiederholt und worin sie sie überschreitet. Wir setzen zuerst den Sinn gewisser Terme fest. Die Metaphysik, sagt man uns, „ist die Wissenschaft, die erlaubt, auf rationalem Wege von der Erkenntnis des Sinnlichen zu dem des Übersinnlichen überzugehen2 “. 2 Op.zit. S. 260, Siehe auch Beylagen S.315-320 Ein Verstandes-Begriff, zum Beispiel der Begriff der Ursache, so lange er sich verkörpert in der einzelnen Repräsentation „einer möglichen Erfahrung“, hängt noch zusammen „mit dem Bereich des Sinnlichen3 “: er ist ein physischer Be- 133 Buch I: Kritik und System griff. Die Metaphysik liegt jenseits davon, sie ist transzendent. 3 Ebenda Die Ontologie, Teil der Metaphysik, ist „die Wissenschaft, die die Begriffe selbst und die Prinzipien des Verstandes in ein System einordnet, soweit sie auf eine allgemeine Weise durch die Sinne gegebene Objekte betreffen4 ...“ 4 Ebenda Sie erreicht in sich selbst überhaaupt kein übersinnliches Objekt, nur eine formartige Struktur von möglichen Objekten der Sinne und sie stellt also nur eine „Propädeutik“ zur eigentlichen Metaphysik dar. Man nennt sie auch „transzendentale Philosophie, weil sie die Bedingungen und die ersten Elemente alles dessen einschließt, von allem, was wir a priori5 erkennen können“. 5 Ebenda Wir definieren gerade die Metaphysik durch ihr Ziel, das Begreifen des Übersinnlichen; dieses Ziel andererseits ist vielleicht für unsere Vernunft nur zugänglich durch den Umweg über das Praktische. In den Schulen nimmt das Wort „Metaphysik“ eine engere Bedeutung an: „sie ist das System aller Prinzipien der reinen rationalen theoretischen Erkenntnis durch Begriffe oder kürzer das System der reinen theoretischen Philosophie1 “. 1 168 Op. zit. S. 261 Der dogmatische Realismus der Schulen – bis Leibniz und Wolff inklusive – schrieb der Metaphysik, das heißt „dem System der reinen theoretischen Erkenntnisse der Vernunft“ die Geltung einer objektiven Erkenntnis der „Noumene“ zu. Der offensichtlichste Zug des Idealismus von Kant ist dagegen die „Phänomenalität“ aller unserer objektiven Erkenntnis. Die Fortschritte bringen den Punkt der Lehre nachdrücklich zur Evidenz, der auf irgendeine Weise den kantschen Phänomenalismus wieder aufgreift: die Notwendigkeit einer „Intuition a priori der Sensibilität“: „Die Erkenntnis [im eigentlichen Sinne] besteht in dem Urteil, wo sich ein Begriff ausdrückt als mit objektiver Realität ausgestattet, das heißt, ein Begriff von dem ein entsprechendes Objekt in der Erfahrung gegeben sein kann. Nun aber besteht jede Erfahrung zugleich aus der Anschauung eines Objekts (das heißt einer unmittelbaren und einzelnen Erfahrung, durch die das Objekt gegeben ist als zu erkennendes Objekt) und zweitens einem Begriff (das heißt einer vermittelten Repräsentation, erlaubend, dieses Objekt zu denken vermittelt durch einen mehreren Objekten gemeinsamen Charakter). Von diesen zwei Arten von Repräsentationen genügt keine isoliert dazu, eine Erkenntnis zu konstituieren. Wenn es wirklich Erkenntnisse a priori gibt, muss es dabei ebenso Intuitionen a priori geben, wie es Begriffe a priori gibt....“ 134 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. „Um a priori möglich zu sein, kann eine Intuition nur die Form als Inhalt haben, unter welcher das Objekt sich ihr bietet, denn der Ausdruck: sich etwas a priori vorstellen, bedeutet: sich davon eine Vorstellung bilden selbst bevor der Wahrnehmung dieses Dings, bevor man davon empirisch Bewusstsein hat und unabhängig von diesem empirischen Bewusstsein ... Eine solche Intuition, die nur die Form erreicht, nennt sich reine Anschauung 2 “. 2 Op.cit. S.266, wir heben einige Wörter hervor „Andererseits ist es nicht die Form des Objekts, so wie es an sich ist, die die reine Intuition möglich macht, sondern die Form des Subjekts, das heißt die der dieser Vorstellung fähigen Sinnesfähigkeit. Die Subjektivität ist hier Bedingung der Apriorität. Man kann tatsächlich a priori wissen, wie und unter welcher Form die Objekte der Sinne wahrgenommen werden: Sie sind es entsprechend dem, was die subjektive Form der Sinnlichkeit umfasst (das heißt der Aufnahmefähigkeit des Subjekts in der Intuition solcher Objekte); und man müsste, um genau zu sprechen, nicht sagen, dass die Form des Objekts von uns in der reinen Intuition vorgestellt wird, sondern vielmehr, dass unsere Intuition a priori von gegebenen Objekten sich nur verwirklichen kann, indem sie einer formartigen und subjektiven Bedingung der Sinnlichkeit folgt1 “. 169 1 Op zit. S. 267. „Nun aber hat die Kritik der reinen Vernunft bewiesen, dass die Vorstellungen von Raum und Zeit genau die reinen Intuitionen sind, von denen wir gerade oben das Bedürfnis zeigen2 “ 2 Op. cit. SS. 267-268. Weil sie, alles das zusammen, nämlich Formen der Aufnahme des sinnlichen Gegebenen sind (Formen der empirischen Anschauung) und subjektive Formen, in sich selbst wahrgenommen als reine Anschauungen, begründen sie die Objektivität der Erkenntnis, das heißt, sie liefern unserem Bewusstsein die dauernden Bedingungen einer möglichen Erfahrung; aber mit dem gleichen Schlag bestätigen sie die Phänomenalität dieser Erkenntnis, weil der empirische Inhalt, was auch immer er sei, von dieser unvermeidlich die subjektive, raum-zeitliche Form unserer Sinnlichkeit annimmt3 3 Vergl. op.cit. SS. 268 ff. Zusammengefasst: In einem diskursiven Verstand gibt es keine objektive Erkenntnis ohne Intuition a priori einer Sinnlichkeit; aber keine Intuition a priori einer Sinnlichkeit ohne Phänomenalität der entsprechenden empirischen Intuition, das heißt ohne transzendentale Idealität der Form dieser empirischen Intuition; folglich in unserer Sinnlichkeit keine Intuition a priori ohne transzendentale Idealität des Raumes und der Zeit, den notwendigen Formen 135 Buch I: Kritik und System unserer empirischen Intuition des Gegebenen4 . 4 Die Fortschritte sammeln in einem Satz, bei dem jedes Wort wichtig ist, die oben erklärten Beziehungen: „Das Subjektive in der Form der Sinnlichkeit, welches a priori aller Anschauung der Objekte zum Grunde liegt, machte es uns möglich, a priori von Objekten eine Erkenntnis zu haben, wie sie uns erscheinen“ (Op.cit. S. 269). Durch ihre zentrale Stellung in der kantschen Theorie der objektiven Erkenntnis, erschien Kant die Intuition a priori als seine wahre persönliche Entdeckung, wie die Trennlinie zwischen seinem transzendentalen Idealismus und dem dogmatischen Realismus (von Leibniz-Wolff)5 170 5 Zitierte Stelle, und vgl. SS.281-282, 286, etc. Mit der reinen Intuition der Raum-Zeit ist die Möglichkeit des „empirischen Ich“ verbunden, das heißt die Möglichkeit für das Ich sich zum Objekt für sich selbst zu machen im empirischen Bewusstsein. Das heißt, weil es fähig ist, die Apriorität der raum-zeitlichen Form der Sinnesobjekte zu unterscheiden, kann das Ich in den Repräsentationen des inneren Sinns den phänomenalen Ausdruck von ihm selbst erkennen6 . 6 Op. cit. SS.269-270 Man spricht von einem „doppelten Ich“, dem des Gedankens und dem der Intuition des inneren Sinns, ja sogar von einer doppelten Subjektivität der „Person7 “. 7 Op. cit. S.268 Aber „man versteht darunter nicht eine doppelte Personalität: das Ich das denkt und anschaut konstituiert allein die Person. Was das Ich als Objekt meiner Intuition betrifft, so ist es Sache [Ding], wie alle anderen Objekte außerhalb von mir1 “. 1 Op.cit. S.270 Das Problem der zwei „Ich“, das wir weiter oben ohne Lösung gelassen haben (siehe SS. 92 ff.), ist an diesen Stellen der Fortschritte durchaus nicht gelöst. Aber man nimmt hier schon die Tendenz wahr, das Denken und die reine Intuition der Sinneswahrnehmung als die gestuften Manifestationen einer einzigen und selben Spontaneität der „Person“ zu betrachten. Diese Tendenz ist genau dieselbe, die Kant dazu bringt, zu versuchen, den allzu radikalen Dualismus zu verringern, der durch die Kritik der reinen Vernunft zwischen der transzendentalen Ästhetik und der transzendentalen Analytik gelassen wurde. Sein Bemühen der Vereinheitlichung ist symbolisiert, noch zaghaft, in den Fortschritten durch das neue Relief, das dem Wort Zusammensetzen gegeben wird. Um die Wahrheit zu sagen, ist Zusammensetzung nur die deutsche Übersetzung von Synthese. Aber die gewöhnliche Ersetzung des einen Terms durch den anderen ist begleitet von einer Vereinfachung, wenigstens verbal, in der Erklärung der kognitiven Synthesen; von daher ist die Formel offen: „Alle konstitutiven Repräsentationen einer Erfahrung müssen 136 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. auf das Konto der Sinnlichkeit gerechnet werden, mit Ausnahme einer einzigen, die des Zusammengesetzten als solchem2 “ 2 Op. cit. S. 275. 171 Es lohnt die Mühe, auf der unmittelbaren Tragweite dieser Erklärung zu insistieren: „Die subjektive Form der Sinneswahrnehmung, wenn sie sich einfügt in die sinnlichen Objekte als die ihr eigentümliche Form – so wie es die Theorie der Phänomenalität der Objekte der Sinne erfordert – führt in die Bestimmung dieser Objekte eine Repräsentation ein, die davon nicht getrennt werden kann, nämlich die [Vorstellung] des Zusammengesetzten. Denn wir können uns einen bestimmten Raum nur vorstellen indem wir ihn durchlaufen [buchstäblich; indem wir ihn zeichnen, das heißt, indem wir Raum zu Raum hinzufügen; und es gilt dasselbe für die Zeit3 ]“ 3 Op. cit. S. 271. Wenn man diese Zeilen liest, möchte man Kant nach der genauen Beziehung fragen, die er aufstellt zwischen der Repräsentation der Zusammensetzung (Zusammenbauen, Konstruktion, Synthese) und der reinen Intuition von Raum-Zeit. Sein Text bietet einige Elemente einer Antwort auf unsere Frage. Um diese gut zu verstehen, dürfen wir nicht vergessen, dass eine reine (nicht empirische) Intuition uns nur bewusst wird im Inneren einer empirischen Intuition, indem sie die Form als deren Form isoliert. Es ist also immer so, dass die reine Intuition der Formen a priori von Raum und Zeit von der konkreten Repräsentation von sinnlichen Objekten ausgehend, sich für unser Bewusstsein ergibt. Aber ist dann die (objektive) Intuition dieser Formen in ihnen selbst mit der Apriorität, die sie von der empirischen Mannigfaltigkeit, die sie vereinigt, unterscheidet, wirklich etwas anderes als die Apperzeption selbst dieser empirischen Mannigfaltigkeit, soweit sie uns räumlich und zeitlich zusammengetragen und geordnet (konstruiert, „zusammengesetzt“) erscheint? Kant schreibt dazu: 172 „Die Repräsentation eines Konstruierten als solchem ist nicht eine einfache Intuition; sie verlangt den Begriff einer Synthese (einer Zusammensetzung), die angewandt werden kann auf die raumzeitliche Intuition. Dieser Begriff (wie der seines Gegenteils, des Einfachen) ist durchaus nicht von den Anschauungen abstrahiert nach Art einer partiellen Repräsentation, die in dieser enthalten ist. Das ist ein Grundbegriff, ein Begriff a priori, schließlich ist es im diskursiven Verstand, der einzige Grundbegriff a priori, der sich ursprünglich an der Basis aller Begriffe sinnlicher Objekte findet1 “. 1 Op. cit. S. 271 137 Buch I: Kritik und System Raum und Zeit sind Formen der Sinnlichkeit; wäre die reine Intuition von Raum und Zeit eine Synthese des Verstandes? Kant wird uns das beantworten: „Als Begriff a priori gehört die Synthese (Zusammensetzung) nicht zur sinnlichen Rezeptivität sondern zur Spontaneität des Verstandes2 “ 2 Op.cit. SS 275-276. Andererseits „sind Raum und Zeit, subjektiv betrachtet, Formen der Sinnlichkeit; aber um sie objektiv zu verstehen, als Objekte der reinen Intuition (und wie könnte man davon sprechen ohne das?), braucht es im Voraus den Begriff eines Zusammengesetzten [einer synthetischen Struktur], und folglich auch den einer Zusammensetzung oder einer [aktiven] Synthese der Mannigfaltigkeit; das wiederum setzt voraus, dass die apperzeptive synthetische Einheit [an dieser Mannigfaltigkeit verwirklicht wird durch eine entsprechende Mannigfaltigkeit von Funktionen a priori, das heißt durch die Kategorien]3 “. 3 Op.cit. S.276 Kurz, die Formen a priori von Raum und Zeit – deren Ursprung Kant nicht erklärt – können sich nur objektivieren vor unserem Bewusstsein als reine Intuitionen durch den Begriff a priori der „Synthese“. Die reine Intuition von Raum und Zeit ist also nichts anderes als die Form a priori des Sinns, betrachtet nicht mehr in ihrer elementaren Funktion der Rezeption des rohen Gegebenen (Stadium der Wahrnehmung), sondern in seiner Teilhaftigkeit an der immanenten Konstruktion des Objekts der Erfahrung, als innere konstitutive Form dieses Objekts (Stadium der Erfahrung)4 4 173 Op. cit. S. 276 Und von dieser Teilnahme an der Konstruktion des Objekts sagt man gern, dass sie zugleich statisch ist als formartiges, strukturales Produkt der synthetischen Aktivität des Geistes, und dynamisch als Quasi-Exemplar-Ursache unaufhörlich bei der bewirkten Synthese den Vorsitz führend. Rund herum um die Intuition a priori der Sinne, gesteuert und vervollkommnet durch den Begriff a priori der Zusammensetzung können also die verschiedenen Begriffe gruppiert werden, die, in der Kritik der reinen Vernunft das Raster der transzendentalen Ästhetik und Analytik bilden. Betreffs der Kritik in den Fortschritten nehmen wir keine wahrhaften lehrhaften Unterschiede wahr; aber es ist leicht, eine Veränderung der Grundstimmung insgesamt festzustellen, die homogener geworden ist, und eine Verschiebung des Akzents im Sinn des Primats der Synthese gegenüber der einfachen formartigen Apriorität. Dennoch, diese zunehmende Bedeutung der Synthese realisiert noch nicht die perfekte systematische Einheit. Zum Beispiel besteht eine Schwierigkeit 138 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. weiter, die wir weiter oben erklärt haben (Seite 88-91, 132-134, 135-136): das Zusammensetzen, das „Konstruieren“ war von Kant präsentiert worden als ein ursprüngliches Einheits-Prinzip: woher kommt also die Pluralität der Kategorien? In der „ersten Redaktion“ der Fortschritte 1 lesen wir das, was sich in nichts abhebt von der Kritik der reinen Vernunft und den Prolegomena: 1 Op.cit. S. 272. „Diese Kategorien – man muss es anmerken – setzen keinerlei besondere Art von Intuition voraus; sie setzen, zum Beispiel, durchaus nicht die einzige dem Menschen mögliche Intuition voraus, die sinnliche Intuition von Raum und Zeit; aber sie sind Formen des Denkens, die auf den Begriff eines Objekts der Intuition im allgemeinen antworten, um welche Art von Intuition auch immer es sich handelt, wäre es auch eine übersinnliche Intuition, (von der wir uns andererseits keinen eigentlichen Begriff machen können)“. 174 Diese Kategorien müssen sich evident ableiten vom reinen Verstand, ohne Rücksicht auf die apriorische Vielfalt der reinen Intuitionen der Sinnlichkeit: die tatsächliche Entsprechung zwischen den ersteren und den zweiten (oder wie wir es im Vorausgehenden sagten, der reinen Kategorien und der schematisierten Kategorien) bleiben ein tiefes Geheimnis. Es ist wahr, dass dieselbe „Redaktion“ der Fortschritte einige Seiten weiter2 2 Op. cit. S. 278. jede Spezialisierung der reinen Zusammensetzung (oder der synthetischen Einheit der Apperzeption) direkt oder indirekt abhängen zu lassen scheint von der apriorischen Vielfalt der sinnlichen Intuitionen. Hier einige vielsagende Zeilen des Textes, dessen Anfang weiter oben (S. 172) zitiert wurde: „[Der Begriff der reinen Anschauung der Sinnlichkeit setzt den der Zusammensetzung voraus] und setzt folglich auch eine synthetische Einheit der Apperzeption in Verbindung mit der [sinnlichen] Vielfalt voraus: diese Einheit des Bewusstseins verlangt, entsprechend der Vielfalt der intuitiven Repräsentationen von Objekten im Raum und in der Zeit, nach einer Vielfalt von Funktionen, die sie vereinheitlichen könnten und die man Kategorien nennt1 “ 1 Op. cit. S. 276. Diese Stelle macht mehr, als nur die tatsächliche Entsprechung zwischen dem reinen Verstand und den formartigen Intuitionen von Raum und Zeit zu beschreiben; sie insinuiert mehr: wenigstens eine prästabilierte Harmonie, eine natürliche Affinität zwischen den zwei Ebenen der im Objekt überlagerten Repräsentation. 139 Buch I: Kritik und System Aber Kant liebt diese Art von den Elementen des Problems allzu äußerlichen Lösungen gar nicht. Seine Geisteshaltung und die allgemeine Bewegung seines Denkens in den Fortschritten richten sich eher auf eine andere Lösung aus, noch unformuliert aber vielleicht schon präsent: dass die Intuitionen a priori der Sinnlichkeit nicht weniger als die Kategorien hervorgehen aus einer einzigen und selben synthetischen Handlung des Subjekts, aus einem einzigen und selben Zusammensetzen (siehe weiter unten SS. 179 ff.) Die Intuition a priori der Sinnlichkeit ist also von Kant vorgestellt als originaler Beitrag der kritischen Philosophie zur Entwicklung der spekulativen Metaphysik, die nichts anderes sein kann als eine „Metaphysik der Natur2 “ 2 175 Op.cit. S. 293 Das „Übersinnliche“ ist dabei nicht erkannt als Objekt an sich: „noumenorum non datur scientia [= Es gibt keine Wissenschaft der Noumena]“, aber sie schleicht sich nichtsdestoweniger ein unter der „idealen“ Spezies der „Begriffe a priori“, formartiger Konstitutive von immanenten, phänomenalen Objekten3 . 3 Ebenda Ebenso rühmt sich der Kantismus, im Feld der theoretischen Vernunft zwei extreme Positionen zu vermeiden: gegen den skeptischen Empirismus behält er die Rechte einer transzendentalen Philosophie bei, das heißt einer „Ontologie“ der reinen Vernunft; aber gleichzeitig baut er die Ansprüche des ontologistischen Dogmatismus ab, der Quelle von Antinomien. Es gibt noch mehr zu sagen. Im Bereich der praktischen Vernunft wird die transzendentale Idee der „Freiheit“, Schlüsselbegriff der kantschen Position, Ausdruck einer subjektiven Ordnung von noumenalen Wirklichkeiten. Der Kantismus besitzt also neben einer formalen Ontologie, der Propädeutik jeder spekulativen Metaphysik, eine wahrhafte Metaphysik des praktischen Objekts, eine „Metaphysik der Sitten4 “ 4 Ebenda Hier lässt ein Einwand den Autor des Berichts einen Moment lang zögern5 5 Op. cit. S.293. bleibt die von ihm angeführte Lösung im Rahmen des Problems der Ausschreibung? „Fortschritte“ setzen ein zusammenhängendes Gebiet voraus, wo man die Schritte nach vorwärts markieren kann. Die ontologistischen Systeme, die in der spekulativen Metaphysik das rationale Fundament der praktischen Metaphysik finden, müssen nicht das Terrain wechseln, um den Übergang vom einen zum anderen zu machen. Aber nach dem Beweis des Kritizismus ist diese Kontinuität des Terrains unterbrochen: von einer „Metaphysik der Natur“ scheint es, dass kein Weg mehr zu einer „Metaphysik der Sitten1 “ führt. 1 Ebenda Wenn man dieses letztere verbindet, so kann das nicht durch einen regulären „Fortschritt“ geschehen wie in der klassischen Metaphysik sondern durch einen 2 plötzlichen Sprung auf eine andere Ebene, durch eine . metbasic eÊc llo gènoc 140 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 2 Ebenda Kant verwirft den Einwand. Zwischen Natur und Freiheit wirft die Finalität (die Zweckmäßigkeit) eine Brücke: „Unter den Begriffen, durch die wir die Natur erkennen... gibt es einen, der die Besonderheit bietet, nicht das, was zum Objekt gehört, sondern das, was wir selbst dahin setzen, intelligibel zu machen: dieser Begriff, ohne im eigentlichen integrierender Teil der objektiven Erkenntnis zu bilden, ist nicht weniger ein Mittel oder ein Prinzip von dessen Erkenntnis, ausgehend von der Vernunft; er ist sogar ein Prinzip der theoretischen Erkenntnis, dennoch nicht einer dogmatischen Erkenntnis3 “ 176 3 Ebenda Tatsächlich „ist der Begriff einer Teleologie der Natur begründet auf der Fähigkeit, die wir in uns entdecken, unsere Repräsentationen entsprechend einer Hierarchie von Zielen zu verknüpfen (nexus finalis)4 “ 4 Op.cit. S. 294 gekrönt durch ein Unbedingtes in der Reihe der Ziele, das heißt durch ein „letztes Ziel“ (einen Endzweck ). Nun aber ist das letzte Ziel, der Höhepunkt unserer problematischen Interpretation der Natur genau das „höchste Gut“, das durch die Phänomene zu verfolgen wir verpflichtet sind, verfolgt als ein Sollen, das sich unserer Freiheit5 aufzwingt, 5 Ebenda und folglich als ein (noumenales), objektiv notwendiges Ziel. Es gibt hier also insgesamt nicht Konstruktion einer praktischen Metaphysik, die in splenditer Isolation thront, sondern vielmehr unter der Führung von Gesetzen der Freiheit, Erweiterung der theoretischen Ordnung zur praktischen Ordnung, Verbindung der Naturordnung und der Sittenordnung. Man sieht die Mittlerrolle der Idee des Ziels. Die Analyse des Begriffs a priori des „letzten Ziels (Endzwecks)“ führt auf drei übersinnliche Objekte der Theorie der Postulate: das „Übersinnliche in uns“, das heißt die Freiheit als „Autonomie“ der praktischen Vernunft und als „Autokratie“ des Wollens: das „Übersinnliche über uns“, das ist Gott; das „Übersinnliche nach uns“ das heißt die Unsterblichkeit der Seele6 . 177 6 Op.cit. S. 295. Trotz des Nachdrucks, mit dem Kant seine Lehre von den moralischen Postulaten als einen wahrhaften metaphysischen Fortschritt darstellt, als die „Vollendung“ jeder menschlichen Metaphysik – drittes und letztes Stadium des metaphysischen Fortschritts – vergisst er nicht, dass der Titel dieser Metaphysik, von uns eine absolute Zustimmung zu fordern, nicht auf der theoretischen Konstitution der Objekte beruht, sondern auf den dynamischen Forderungen 141 Buch I: Kritik und System (Bedürfnissen) des Subjekts. Außerdem, so sicher er sie auch beurteilt, ist die Metaphysik der Postulate in seinen Augen nur ein „praktischer Dogmatismus“: nicht eine Wissenschaft, sondern ein Glaube 1 1 Op. cit. SS. 296-298. Und wir sehen selbst unter seiner Feder Ausdrücke wieder auftauchen, die buchstäblich genommen, besser zu einem skeptischen Pragmatismus als zu einem „praktischen Dogmatismus“ passen würden. Siehe da zum Beispiel, eine der verwirrendsten Formulierungen, weil sie die Affirmation der Postulate zu reduzieren scheint auf eine simple methodologische Fiktion: „In diesem Fall [einer praktischen Metaphysik] müssen wir nicht mehr das betrachten, was das übersinnliche Objekt in sich selbst ist, sondern nur, wie wir von unserer Seite, es denken müssen und uns seine Struktur vorstellen müssen, um uns fähig zu machen, das dogmatisch praktische Objekt der reinen Moralität zu verfolgen, das heißt das letzte Ziel, welches das höchste Gut ist. Es handelt sich nicht um Untersuchungen über die Natur der Dinge, die wir für uns selbst konstruieren, um einer praktischen Notwendigkeit zu gehorchen, und die vielleicht außerhalb der Idee, die wir uns davon machen, nicht existiert2 ...“ 2 Op. cit. SS. 296-297. Die in diesen Zeilen ausgedrückte Zurückhaltung ist in mehreren Anläufen wiederholt auf den folgenden Seiten des Werkchens3 . 3 Zum Beispiel op. cit. SS. 297, 299, 300. aber sie hat ihren Gegenzug. Zum Beispiel, die Existenz Gottes. Unter dem Gesichtspunkt der theoretischen Vernunft ist sie mehr als eine willkürliche Meinung (als ein „bloßes Meinen“), weniger als eine wahrhafte Wahrscheinlichkeit4 . 4 178 Op. cit. SS. 299-299. Dennoch erklärt uns Kant, ist die Affirmation dieser Existenz absolut sicher, vom praktischen Gesichtspunkt her gesehen: und so alles in allem bleibt sie absolut sicher, wenn nicht für den Verstand isoliert, so wenigstens „für den Menschen“: „Das moralische Argument könnte man also nennen ein Argument , gültig für jeden Menschen, insofern es vernünftig ist im 5 Universum “. 5 kat' njrwpon Op. cit. S. 306. - Das Argument ad hominem wird eine wirkliche Demonstration, entweder theoretisch oder praktisch, wenn es begründet ist, nicht auf irgendeinem Individuum im Besonderen sondern im „Menschen im allgemeinen“. Das berechtigte System der reinen Vernunft – anders gesagt, die in den drei Kritiken enthaltene Metaphysik – beginnt, sich abzuzeichnen. Von der alten Metaphysik, verlängert bis zu Leibniz und Wolff, behält Kant eine Wissenschaftslehre, [eine „Theorie der Wissenschaft“], die eine formale Ontologie ist. 142 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. – Von der auflösenden, zum skeptischen Phänomenalismus tendierenden Reflexion behält er eine Zweifellehre: die Dialektik der Antinomien mit ihrem negativen Aspekt (der Unerkennbarkeit der Noumene) und ihrem positiven Aspekt (die logischen Möglichkeit und die heuristische Funktion der Noumene). – in sich selbst präsentiert sich die kantsche Lehre als ein Realismus der praktischen Vernunft, befohlen durch die lebendige Idee der Freiheit: das ist eine positive Lehre der Weisheit, eine Weisheitslehre 1 , die einzig vom moralischen Sollen alles erhält, was sie Absolutes hat, die aber die „Analogie“ der spekulativen Vernunft um einen begrifflichen Ausdruck dieses Absoluten bitten muss, sagen wir es besser: der einzige uns mögliche begriffliche Ausdruck dieses Absoluten2 1 Op. cit. SS.272-273, vgl. S.281. 2 Siehe z. B. op.cit. SS. 306-307. Wenn die Metaphysik, wie wir weiter oben sagten, die rationale Erkenntnis ist, die Zugang gibt zum Übersinnlichen, kann Kant sich schmeicheln – und er verzichtet darauf nicht3 – 3 179 Siehe op. cit. SS. 310-311, Anhang. die Skizze der nach der Kritik einzig möglichen Metaphysik vollendet zu haben; die unvermeidlichen Stufen dafür sind klar gezeichnet; das sind: 1. das Übersinnliche als formale Struktur a priori einer Metaphysik der Natur (formale Ontologie). 2. Das Übersinnliche als noumenales problematisches Objekt (Auflösung der Antinomien). 3. Das Übersinnliche als durch die Handlung postulierte Existenz. §2.– Kant und Beck. Der Briefwechsel Kants mit seinem alten Schüler Jacob Sigismond Beck von 1791 bis 1796, enthält einen Reflex der neuen Beschäftigungen, die dem Geist des alten Meisters keine Ruhe ließen bezüglich einiger wichtiger Punkte des kritischen Systems. Bis 1795 bezeugt der Ton dieser Briefe bei Kant ein Wohlwollen und eine mehr als gewöhnliche Hochschätzung bezüglich seines jungen Korrespondenten, das offensichtlich dessen mathematisches Talent ihm gebot. Er lobt nicht nur die von Beck an der Universität von Halle präsentierte InauguralDissertation, sondern er fügt dieses damals besonders bezeichnende Zeugnis hinzu: „Ich sehe aus den Thesen, die ihrer Dissertation beigefügt sind, dass sie mein Denken genauer begriffen haben als viele meiner erklärten Anhänger4 “ 4 Kant an Beck, 9.V. 1791, Ak Bd. XI (Briefwechsel, II2), S. 256; vgl S. 255 Er erwartet von der Präzision und der Klarheit des Mathematikers einen ernsten Vorteil für die Metaphysik und für die Kritik5 . 5 Ebenda; vgl Kant an Beck, 27. IX. 1791 Ak. Bd. XI S. 290. Siehe oben S. 61. 143 Buch I: Kritik und System Von seiner Seite bekennt Beck gegenüber dem berühmten Greis eine liebevolle und anerkennende Ergebenheit. Er erklärt sich für überzeugt von der kantschen Philosophie: „Ich bin ihrer Philosophie wohlgewogen, weil sie mich überzeugt6 “ 6 Beck an Kant, 1. VI. 1791, Ak Bd. XI, S. 262. „Ich habe mit herzlichstem Interesse die Kritik der reinen Vernunft studiert und finde sie in gleicher Weise überzeugend wie mathematische Wahrheiten. Die Kritik der praktischen Vernunft ist seit ihrer Veröffentlichung meine Bibel1 “. 1 180 Beck an Kant, 6. X. 1791, Ak Bd. XI, S.294 Aber wenn er mit Eifer den Kantismus ergreift, mag Beck nicht ebenso die „Kantianer“. „Unter den lärmenden Freunden [ihrer Philosophie] sehe ich keinen, der mir gefällt2 “ 2 Beck an Kant 1. VI. 1791, Al Bd. XI, S. 262 Alle scheinen ihm geleitet durch andere Motive als die reine Liebe zur Wissenschaft. Selbst Reinhold findet keine Gnade3 : 3 Ebenda seine Theorie des Vorstellungsvermögens lässt sich nicht aufrecht halten. Beck plant unter anderen nächsten Arbeiten, sie einer niederreißenden Kritik zu unterziehen4 . 4 Beck an Kant, 6. X. 1791, Ak. Bd. XI SS.292, 293 Zu diesem Thema um Rat gefragt, lässt sich Kant erweichen: „Denn, so sagt er, Reinhold, im Übrigen ein sehr liebenswerter Mensch, hat sich so leidenschaftlich mit seiner Theorie identifiziert (die ich selbst noch nicht sehr gut verstehe)“, dass er leicht Anstoß nehmen könnte an einem Widerstand gegen seine Ansichten5 . 5 Kant an Beck, 27. IX. 1791, Ak. Bd.XI,S. 291 und 2. XI. 1791 S.304 Der Verleger Hartknoch war auf der Suche nach einem „kompetenten und geschickten Menschen, der nach seiner Weise und nach seinen persönlichen Ansichten eine fortlaufende Darlegung [der Kritik ] unternehmen wolle mittels Auszügen aus diesem Werk6 “; 6 Kant an Beck 27. IX. 1791, Ak. Bd. XI, S.289. Kant schlug ihm den Namen von J. S. Beck vor. Der Vorschlag, von Hartknoch weitergegeben, wurde definitiv angenommen, weil der Meister seine dringenden Bitten denen des Buchhändlers hinzufügte7 . 7 Ebenda SS. 280-290. Vgl. Beck an Kant, 11.XI. 1791, Ak Bd. XI, S.310. Beck fand sich so sehr ehrenhaft verbunden mit seinem früheren Professor, der von ihm etwas anderes und besseres erwartet zu haben schien als die Zusammenstellung eines banalen Flickwerks. Tatsächlich, kurz nach der Kritik der Urteilskraft (1790) täuschte sich Kant nicht mehr über die günstige Gelegenheit bemerkenswerter Verbesserungen in der Form seines transzendentalen Idealismus8 144 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 8 181 Siehe zum Beispiel Kant an Beck, 20. I. 1792 Ak Bd. XI, S. 313. und er stimmte dem im Voraus zu. Aber er war weit davon entfernt, bei seinem – für treu beurteilten – Schüler den Keim einer Abweichung zu vermuten, die die wesentliche Bedeutung der Kritik treffen musste. Dieser Keim, noch nicht aufgebrochen, ist uns heute leicht wahrnehmbar, latent schon auf dem Grund der unnachgiebigen Haltung von Beck gegenüber der Theorie der Repräsentation von Reinhold (dem er vorwarf, sich auf ein Realismus-Postulat zu stützen: wir kommen auf diesen Punkt zurück). Was auch immer es damit auf sich hat, die Arbeit, aufgenommen und rasch vorangebracht, hatte 1793 Erfolg mit dem ersten Band des Erläuternden Auszugs aus den kritischen Schriften des Herrn Prof. Kant; der zweite Band folgte bald. Kant zeigte sich mit dem Resultat zufrieden. Aber in der Zwischenzeit hatte der junge Autor ihm eine Reihe von gelegentlich unangenehmen Fragen gestellt, erstes Symptom des Missverständnisses, das sich zusammenbraute. Zuerst bezüglich des Begriffs der Intuition. „Die Kritik nennt Anschauung eine Repräsentation, die sich unmittelbar bezieht auf ein Objekt. Dennoch im eigentlichen Sinn wird eine Repräsentation nur objektiv durch ihre Subsumtion unter die Kategorien. Und da die Anschauung ihrerseits diesen objektiven Charakter nur annimmt mittels der Kategorien, würde ich vorziehen, Anschauung nicht zu definieren als eine Repräsentation die sich [unmittelbar] auf Objekte bezieht. Denn ich finde in der Intuition nicht mehr als eine Vielfalt bestimmt und begleitet von Bewusstsein (das heißt begleitet vom identischen Ich denke); es gibt darin noch nicht die Beziehung auf ein Objekt.Ich mag es auch nicht, dass man den Begriff nennt: eine Repräsentation, die sich mittelbar auf ein Objekt bezieht; sondern ich platziere den Unterschied zwischen Begriff und Intuition darin, dass diese letztere durchgängig bestimmt ist und jene unvollständig bestimmt ist. Tatsächlich erhält die Intuition wie der Begriff ihre Objektivität von der Funktion des Urteils, das sie subsumiert unter einen reinen Begriff des Verstandes1 “. 1 Beck an Kant, 11.XI. 1791, Ak, Bd. XI, S. 311. Der Brief enthält hier eine Anmerkung von Kant, der diesen letzteren Satz richtigstellt: „Die Fähigkeit zu urteilen schaltet sich ein, um den Begriff zu bestimmen mittels einer Anschauung, um Erkenntnis des Objekts zu werden, aber nicht um die Beziehung der Anschauung zu einem Objekt im allgemeinen2 zu verknüpfen“ 2 Ebenda S.311, Anmerkung von Kant. 145 Buch I: Kritik und System Einige Monate danach kommt Beck auf die Attacke zurück „Ich wünschte sehr, zu wissen ob ich ihr Denken gut zum Ausdruck bringe in dem, was folgt. Ich nehme an, dass man in der transzendentalen Ästhetik die Anschauung nicht erklären sollte dadurch, dass man sagt, dass sie die Repräsentation ist, die sich unmittelbar auf ein Objekt bezieht und die entsteht dann, wenn ein Objekt unsere Fakultäten (das Gemüt) affiziert, denn es ist nur in der transzendentalen Logik, dass man zeigen kann, wie wir objektive Repräsentationen erhalten. Schon die reine Intuition widerspricht, in sich allein der Erklärung [gegeben in der Ästhetik]. Ich sehe wirklich nicht, dass ich mich täusche, wenn ich sage: die Anschauung ist eine Repräsentation vollständig bestimmt relativ zu einer gegebenen Vielfachheit3 “. 182 3 Beck an Kant, 31.V. 1792, Ak. Bd. XI S. 338. Kant antwortet am darauffolgenden 3. Juli: „Was das betrifft, was sie sagen von ihrer Definition der Anschauung, ... so habe ich nur eine Bemerkung hinzuzufügen: nämlich dass die vollständige Bestimmung hier objektiv verstanden werden muss [das heißt insofern als das Objekt verknüpfend], und nicht insoweit als im Subjekt realisiert (wie könnten wir tatsächlich alle Bestimmungen eines Inhalts der empirischen Intuition bestimmen?); und so bezeichnet ihre Definition trotzdem nichts mehr als das: die Intuition ist die Repräsentation eines gegebenen Einzelnen1 “ 1 Kant an Beck, 3. VII. 1792, Ak, Bd. XI, SS.347-348 Kant schiebt also die Definition nicht absolut zur Seite, an der sich sein Schüler so fest klammert: schließlich kann eine „vollständig bestimmte Repräsentation“ nur eine „Repräsentation des Einzelnen“ bezeichnen und die Anschauung ist in seinen Augen wohl gerade das2 . 2 Wie er in seinem Kurs über Logik lehrte: „Ebenso wie nur die einzelnen Objekte oder die Individuen vollständig [durchgängig] bestimmt sind, so gibt es keine vollständig bestimmten Erkenntnisse als nur die Anschauungen, nicht die Begriffe: in diesen letzteren kann die logische Bestimmung nie als vollständig betrachtet werden“ (Logik, §15, Anmerkung Ak. Bd. IX, S.99) 183 Sie bleibt für ihn nicht weniger die „die unmittelbare Repräsentation des Objekts“. Nimmt er das wahre Motiv wahr, das seinen Korrespondenten dazu verleitet, es unter diesem Gesichtswinkel zu betrachten? Das Eingeständnis dieses Motivs könnte man herauslesen aus dem vorherigen Brief von Beck: „[Nach der transzendentalen Ästhetik ist die empirische Intuition] eine Repräsentation, die sich unmittelbar auf ein Objekt bezieht und die auftaucht, wenn ein Objekt [an sich?] unsere Fakultäten affiziert3 “; 146 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 3 Beck an Kant, 31. V. 1792, Ak, Bd. XI, S. 338 Es widerstrebte Beck, in seine Zusammenfassung der Kritik eine „transzendente Affektion“ der Sinneswahrnehmung durch „Dinge an sich“ einzuführen. Über die Funktion und selbst die Existenz des Dings an sich ist die Meinungsverschiedenheit mit seinem alten Meister schon total. Aber ermisst dieser letztere die Kluft, die sie trennt? In seinem Brief vom 3. Juli 1792 fuhr Kant gerade an der Stelle, wo wir unser Zitat beendeten, fort: „... Die Intuition ist die Repräsentation des einzelnen Gegebenen. Aber, da keine synthetische Repräsentation (kein Zusammengesetztes) gegeben sein kann als solches, da im Gegenteil wir es sind, die die Synthese von jeder gegebenen Vielfalt bewirken müssen, und da trotzdem diese Synthese, gezwungen sich dem Objekt anzupassen, nicht willkürlich sein kann; weil es folglich notwendig ist, dass a priori gegeben ist, wenn nicht die synthetische Repräsentation selbst, so wenigstens die einzig mögliche Form der Synthese der gegebenen Vielfalt, folgt daraus, dass diese Form selbst das rein subjektive (sinnliche) Element der Intuition konstituiert: Element a priori, sicherlich, das nicht gedacht werden kann (nur die Synthese, betrachtet als Handlung kann gedacht werden), aber das uns gegeben sein muss (Raum und Zeit) und wird also eine einzelne Repräsentation, nicht ein Begriff (eine repraesentaio communis [=gemeinsame (allgemeine) Repräsentation])1 “ 1 Kant an Beck, 3.VII. 1792, Ak. Bd. XI, SS. 347-348. Es folgt der Rat – ist das nicht schon bezeichnend? – sich nicht schon am Anfang der Arbeit damit aufzuhalten, elementare Begriffe zu vierteilen, die sich genügend klären werden durch die Verwendung selbst, die man im Folgenden2 davon machen wird. 2 184 Ebenda Liest man zwischen den Zeilen: der alternde Meister hat keine Lust mehr, sich freiwillig in ein Gewirr von „extremen Subtilitäten“ zu verwickeln (allersubtilste Zergliederung der Elementarvorstellungen). Vielleicht ahnt er auch hinter den besonderen Fragen, die ihm mit solchem Nachdruck gestellt werden, eine fundamentale, unendlich ungelegenere Frage. Was auch immer es damit auf sich hat, Kant hält sich zurück, bewusst oder nicht, der aufgeworfenen Frage auf den Grund zu gehen, das heißt, den unvermeidlichen Zusammenhang des Begriffs der Anschauung mit denen des Objekts und der objektivierenden Synthese zu präzisieren. Beck jedoch – sei es Arglosigkeit sei es Taktik – fragt zugleich nach diesen Begriffen vom Objekt und der synthetischen (objektivierenden) Handlung. 3 Ak. Bd. XI, S. 314 147 Buch I: Kritik und System Hier steigen ebenfalls die Antworten nicht bis zur Wurzel der Frage hinab. Kant schreibt am 29. Januar 17923 : folgendermaßen „Sie haben ganz richtig darauf hingewiesen: das Objekt, das ist der Inbegriff der Repräsentationen, und die Handlung des Geistes, durch die das Gesamte der Repräsentationen repräsentiert wird, das ist es, was man nennt, sie aufs Objekt beziehen. – Es bliebe nur noch sich zu fragen: Wie kann eine Sammlung, ein Komplex von Repräsentationen repräsentiert werden?“ Und der Philosoph wiederholt das, was wir ihn schon früher erklären hörten: ein zur Einheit zusammengefasster „Komplex“ kann nicht als solcher unserem Bewusstsein gegeben werden, sondern muss, um uns bewusst zu werden, konstruiert (zusammengesetzt) werden durch eine Handlung des Geistes, die sich a priori vollzieht an einer gegebenen Vielfalt (was auch immer diese sei). Es bedarf also zugleich einerseits einer Anwendung der „synthetischen Einheit“ des Bewusstseins auf die „gegebene Vielfalt, für den Effekt, uns diese „denken“ zu machen in einem Begriff „eines Objekts im allgemeinen“, und andererseits, eine „rein subjektive Disposition“, von der man uns sagt: „Die rein subjektive Disposition des der Erkenntnis fähigen Subjekts, soweit ihm eine Vielheit gegeben ist auf singuläre Weise (auf besondere Art), nennt sich die Sinnlichkeit und dieser singuläre Modus der Intuition, soweit er a priori gegeben ist, nennt sich die sinnliche Form der Intuition1 “. 1 Kant an Beck, 20. I. 1792, Ak, Bd. XI, SS. 314-315. – Der original Text ist hier durchaus nicht sehr klar. Unsere Übersetzung setzt die folgende Lesart voraus (Zeile 3): „ ... und diese Art (der Anschauung) a priori gegeben ...“ 185 Man erkennt hier wieder die Lehre von der „Intuition a priori“ der Sinne, erklärt um dieselbe Epoche in den Fortschritten (siehe oben Seite 168 ff.). Kant erlaubt also seinem Korrespondenten, auf sie eine rein immanente Deduktion des Objekts, ausgehend von der synthetischen Einheit der Apperzeption zu stützen. Diese Deduktion wird notwendig führen zu den „reinen Intuitionen“ der Sinnlichkeit, die ein wahrhaftes „Gegebenes a priori“ sind. Das Zugeständnis, wenn es da ein Zugeständnis gibt, so scheint es offensichtlicher als es wirklich ist, wenn man den unmittelbaren Kontext davon liest: „Durch die Anwendung der Kategorien auf die sinnliche Anschauung sind die Dinge uns nur bekannt als phänomenale Objekte, nicht insofern sie in sich selbst subsistieren; ohne Intuition in irgendeiner Art sind sie überhaupt nicht bekannt sondern nur gedacht [entsprechend ihrer reinen Möglichkeit]; und wenn man sich 148 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. nicht darauf beschränkt, von jeder partikulären Art von Intuition zu abstrahieren, sondern die Intuition als solcher ausschließt, dann umgibt also keinerlei Garantie der objektiven Realität mehr die Kategorien, man weiß nicht, ob sie noch irgendetwas repräsentieren und nicht nur leere Begriffe sind2 “. 2 Ebenda S. 315. Es wäre also sinnlos, den immanenten Ausdrücken der reinen synthetischen Handlung (der Zusammensetzung) eine objektive Geltung zuzuschreiben, wenn die niedrigere Stufe dieser nicht die unterscheidenden Charakteristiken einer Intuition präsentierten, wenigstens einer „Intuition a priori“, und nicht mehr die eines reinen Begriffs. Man kann wie Beck damit da stehenbleiben (provisorisch?), wenn man will. Aber Kant ist wohl überzeugt, dass wenn man die Deduktion bis zu einer „reinen Intuition“ der Sinnlichkeit weitertreibt, man implizit durch diese Tatsache selbst diese „Rezeptivität“ postuliert, diese „affectio ab extra“, die zu vermeiden man sich schmeichelte: 186 „Vielleicht können sie von Anfang an vermeiden, die Sinnlichkeit durch die Rezeptivität zu definieren, das heißt durch die Art und Weise, in der die Repräsentationen im Subjekt sind, insofern es affiziert ist durch die Objekte; sie würden also den unterscheidenden Charakter [der Sinnlichkeit] in das hinein platzieren, was im Inneren selbst einer Erkenntnis in spezieller Weise die Relation der Repräsentation zum Subjekt [das heißt in den rein subjektiven und partikulären Aspekt der Repräsentation] markiert, in der Weise dass die Form dieser Repräsentation, unter diesem Gesichtswinkel bezogen auf das Objekt der Intuition, nichts bietet zu erkennen als das Phänomen dieses Objekts. Nun aber, dass der genannte subjektive Aspekt nichts anderes ist als die Art und Weise in der das Subjekt affiziert wird durch die Repräsentationen, noch folglich durch etwas anderes als die reine Rezeptivität des Subjekts1 , das ergibt sich schon von der Tatsache allein, dass der Aspekt in Frage, nichts ist als eine [passive] Bestimmung des Subjekts2 “ 1 Also genau das wäre, was Beck anzuerkennen vermeiden wollte Ebenda S.315. Der Leser wird in den Texten von Kant zwei Auffassungen des Wortes „Subjekt, Subjektiv“ bemerkt haben, die diametral entgegengesetzt sind: einerseits das apperzeptive Subjekt, Quelle der Universalität und der Objektivität; andererseits das partikuläre Subjekt sinnlich, Prinzip der Passivität und der Relativität. 2 Die Beobachtungen, die man gerade liest, erheben offensichtlich den Anspruch auf eine „transzendentale Affektion“ der Sinnlichkeit durch Dinge an sich. Früher oder später, denkt Kant, muss Beck darauf kommen in seiner absteigenden Deduktion der kritischen Lehre. 149 Buch I: Kritik und System Wir bedauern es nicht, uns mit subtilen und komplizierten Begriffen aufgehalten zu haben: sie lassen uns Anzeichen dafür sehen, dass es neben Punkten, über die der Vater des Kritizismus große Abänderungen seines Werkes akzeptiert, andere Punkte gibt, wo sein Widerstand, zuweilen in Verlegenheit gebracht, dennoch niemals nachgibt: die Idee des „Dings an sich“, mit seinen Korollaren ist eine davon. Über die zu befolgende Methode, um die systematische Einheit des transzendentalen Idealismus zu verstärken, schien Kant zuerst in vollständiger Übereinstimmung mit seinem Schüler, den er selbst auf diesem Weg übertroffen hatte. Tatsächlich drückte seit der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft (1787) die von der Verbindung3 gespielte bestimmende Rolle in der Konstitution des Objekts der Erfahrung die wesentlichen Züge aus, die ihr, wie wir gesehen haben, die Fortschritte erhalten haben (siehe oben SS. 170 ff.): 3 Das heißt durch die „Repräsentation der synthetischen Einheit einer Vielfalt“ (KRV, B, §15, S.108) 187 Nur die Terminologie hat sich leicht verändert. Auch wenn im November 1791 Beck4 nach der Tragweite des Wortes „verbinden“ frägt, hat Kant in seiner Antwort5 ihn gelobt, diesem schwierigen Punkt der Theorie der Erfahrung nicht auszuweichen: 4 Beck an Kant, 11. XI. 1791, Ak, Bd. XI, SS. 311-312. 5 Kant an Beck, 20. I. 1792, Ak Bd. XI, SS. 313-314. er selbst hätte, sagt er, versucht, die Schwierigkeit in einem neuen Entwurf seines „Systems der Metaphysik6 “ zu formulieren: 6 loc.cit. um die Wahrheit zu sagen, er setzte die „reinen Intuitionen“ von Raum und Zeit voraus, Forderungen a priori eines „Gegebenen“, aber ging danach von oben nach unten (so wie Beck es zu tun träumte), indem er in den Kategorien die höheren, notwendigen, wenn nicht hinreichenden Bedingungen der Möglichkeit einer objektiven Erkenntnis und folglich die Elemente einer „Ontologie als [Wissenschaft des] immanenten Denkens“ zeigte. Von da stieg er abwärts, indem er jede transzendente Extrapolation der Vernunft auf eine „problematische“ Geltung reduzierte, durch die „Deduktion von Kategorien“ zu den Bedingungen a priori der Erfahrung wie zur Gesamtheit der niedrigeren (begrenzenden) Bedingungen, ohne welche die Kategorien unfähig bleiben, eine Erkenntnis vom Objekt zu konstituieren; nun aber werden diese Bedingungen, die die Möglichkeit der Erfahrung als nächstes steuern, in den „Intuitionen a priori der Sinnlichkeit“ wieder aufgenommen. Eine solche vertrauliche Mitteilung, wenn sie schon für Beck nicht jede Klärung brachte, die er forderte, konnte ihn dennoch in seinem Vertrauen auf eine absteigende Deduktion nur ermutigen. Er lies sich nicht abhalten, so zu tun und in seinem Brief vom 31. Mai 1792 richtete er noch kühner seine Spitze auf das Thema der empirischen Intuition (siehe oben S. 182). Aber im selben Brief 150 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 188 erklärte er einen Zweifel, der ihm blieb betreffs der objektivierenden synthetischen Handlung. Um ein Objekt zu bilden, sagt er1 , genügt die „Verbindung der Repräsentation in einem Begriff“ nicht, (zum Beispiel die „eines schwarzen Menschen“). Man muss dabei noch hinzufügen die spontane Bestimmung des Begriffs in einem Urteil (zum Beispiel „der Mensch ist schwarz“), das heißt eine „Handlung der objektiven Beziehung2 “; man wäre klar fixiert auf diese aktive Referenz, die das ganze Geheimnis der „Objektivität“ unserer Erkenntnisse enthält3 . 1 Beck an Kant, 31.V.1792, Ak Bd. XI, S. 339. 2 Ebenda 3 Ebenda Die Antwort von Kant am 3. Juli 1792 bestätigt die vorgeschlagene Interpretation: „Sie haben völlig Recht, zu sagen, dass die Einheit des Bewusstseins uns [nur] gegeben ist als subjektive in der synthetischen Einheit des Begriffs (in dem zusammengesetzten Begriff), aber dass sie objektiv gemacht wird in der aktiven Synthese der Begriffe (in der Zusammensetzung der Begriffe)4 “4 Kant an Beck, 3. VII. 1792 Ak. Bd. XI S. 347 Im ersten Fall machen wir noch nichts anderes als einen begrifflichen Inhalt denken, indem wir ihn uns „problematisch repräsentieren“; im zweiten Fall erkennen wir ihn als Objekt, indem wir „den Akt selbst denken, durch den wir den Begriff davon bestimmen (die Handlung meines Bestimmens dieses Begriffs)5 “. 5 Ebenda Indem er so spricht, fügt der Autor der Kritiken keinen neuen Zug zur Lehre hinzu, die er seit Jahren verkündete. In einem folgenden Brief insistiert er auf der Idee, ebenfalls nicht neu, dass die Einheit der Zusammensetzung von empirischen Begriffen nicht gegeben ist allein durch die Intuition, sondern verlangt, dass die „spontane Verbindung“ (selbsttätige Verbindung) der „intuitiven Vielheit“ in der Intuition wahrgenommen wird, das heißt eine Bedingung a priori, die befiehlt in einem „Bewusstsein im allgemeinen“ die Repräsentation eines „Objekts im allgemeinen6 “ 6 Kant an Beck 16. X. 1792, Ak. Bd. XI S. 376 Am 10. November 1792 unternimmt Beck noch einmal eine Kontrolle seines Denkens über die objektive Funktion des synthetischen Aktes: „Beim Nachdenken über die Bedingungen, die uns erlauben, Objekte zu denken, sieht man leicht, dass die Würde, die den 151 Buch I: Kritik und System Repräsentationen durch ihre Referenz zu Objekten zukommt, darin besteht, dass die Verbindung des Vielfachen als notwendig gedacht wird. Diese Bestimmung des Denkens ist der Funktion des Urteils eigentümlich. Angesprochen auf diese Tendenz hin, ist mir der Beitrag der Kategorie zu unserer objektiven Erkenntnis verständlich geworden; denn so sehe ich klar, dass die Kategorie der Begriff ist, durch den das Vielfältige einer sinnlichen Intuition vorgestellt wird als notwendig verbunden (als für alle gültig). Einige Verkürzer [Autoren von Zusammenfassungen?], so viel ich weiß, haben sich darüber unrichtig ausgedrückt. Urteilen, so sagen sie, heißt objektive Repräsentationen vereinigen. Die Kritik lehrt etwas ganz anderes: urteilen heißt Repräsentationen [Vorstellungen] der objektiven Einheit des Bewusstseins unterwerfen, wodurch man die Handlung, eine vorgestellte Verknüpfung als notwendig zu verknüpfen bezeichnet1 “ 189 1 Beck an Kant, 10. XI. 1792, Ak Bd. XI SS. 384-385 „Ein Objekt denken“ heißt also, sich die synthetische Einheit einer Mannigfaltigkeit als notwendig vorzustellen: über diesen Punkt ist man sich einig. „Ein Objekt Erkennen“ das heißt sich die Einheit einer in einer Intuition gegebenen Mannigfaltigkeit als notwendig vorstellen: Kant und Beck machen beide die Unterscheidung zwischen denken und erkennen 2 2 Vergl. z. B. Beck an Kant 24. VIII. 1793 Ak Bd. XI, S.443. Aber existiert die Übereinstimmung über die Natur der für das Erkennen geforderten Intuition? Weniger als je und die Meinungsverschiedenheit wird nicht lange darauf warten lassen, sich zu zeigen. Zum ersten Mal, noch mit ein wenig Zurückhaltung, eröffnet sich der Privatdozent aus Halle am 17. Juni 1794 Kant gegenüber über den Plan, den er hegt, bald zur Ergänzung der zwei Bände des Erläuternden Auszugs ein Werk zu veröffentlichen, das den wahren „Gesichtspunkt“ erklärt, von dem aus die transzendentale Methode von Kant ins Auge gefasst werden muss. Es handelt sich um den Band, der später den Titel tragen wird Einzig möglicher Standpunkt aus welchem die kritische Philosophie beurteilt werden muss (1796). Wahrscheinlich hat der Adressat dieses Schreibens nicht ohne ein wenig Staunen die folgenden Zeilen gelesen: „In ihrer Kritik der reinen Vernunft führen sie den Leser Schritt für Schritt bis zum höchsten Gipfel der transzendentalen Philosophie, bis zur synthetischen Einheit. Tatsächlich lenken sie seine Aufmerksamkeit zuerst auf das Bewusstsein eines Gegebenen; dann auf die Begriffe, durch welche irgendetwas gedacht wird; auf die Kategorien ebenso, sie stellen sie dar zuerst als Begriffe im 190 152 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. gewöhnlichen Sinn dieses Wortes; nur ganz am Ende führen sie ihren Leser dazu, zu sehen, dass die Kategorie im eigentlichen Sinne die Handlung selbst ist, durch die der Verstand sich ursprünglich den Begriff eines Objekts konstruiert und das Urteil erzeugt: ich denke ein Objekt. Gewöhnlich nenne ich diese Produktion der synthetischen Einheit des Bewusstseins: den ursprünglichen Akt der Zuweisung (die ursprüngliche Beylegung)1 “. 1 Beck an Kant 17. VI. 1794, Ak Bd. XII S.509. Beck vergleicht diese Art von spiritueller Erzeugung, dessen Frucht ein erstes synthetisches Urteil ist („ich denke ein Objekt“) mit den Postulaten der Geometrie, die sich die Möglichkeit eine Linie im Raum zu ziehen vorgibt, indem sie das realisiert; zum Beispiel wenn sie aussagt: gegeben sei das gleichseitige Dreieck AB-BC-CD; oder auch gegeben sei ein Kreis mit dem Radius r; oder kurz gegeben sei die Vorstellung eines Raumes. „Hier ebenso, so meine ich, wie das Postulat [der Geometrie]: sich in einem spontanen Akt der Zuweisung (durch ursprüngliche Beylegung) ein Objekt vorstellen, das ist das höchste Prinzip der ganzen Philosophie, darauf beruht die reine allgemeine Logik und die transzendentale Philosophie als ganze2 “ 2 Anspielung auf KRV B S. 134 Anmerkung: also nur vermöge einer vorausgedachten möglichen synthetischen Einheit kann ich mir die analytische vorstellen. Eine Vorstellung, die als verschiedenen gemein gedacht werden soll, wird als zu solchen gehörig angesehen, die außer ihr noch etwas Verschiedenes an sich haben, folglich muß sie in synthetischer Einheit mit anderen (wenngleich nur möglichen Vorstellungen) vorher gedacht werden, ehe ich die analytische Einheit des Bewußtseins, welche sie zum conceptus communis macht, an ihr denken kann. Und so ist die synthetische Einheit der Apperzeption der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und, nach ihr, die Transzendental-Philosophie heften muß, ja dieses Vermögen ist der Verstand selbst. Ich bin fest überzeugt, dass diese synthetische Einheit genau der Gesichtspunkt ist, aus dem man, wenn man sich zum Meister gemacht hat, vollkommen exakte Beobachtungen ernten kann zum Thema, nicht nur von dem was ein analytisches und ein synthetisches Urteil ist, sondern von dem was im allgemeinen a priori und a posteriori genannt werden muss3 ...“. 3 191 Brief zitiert l. c. Der Autor des Briefes zählt also mit einem grausamen Scharfblick die hauptsächlichen Punkte auf bezüglich derer das aufsteigende Vorgehen der Darstellung, das von Kant in der Kritik adoptiert wurde, einen Zweifel bestehen ließ. Diese zum Beispiel: – warum ist die Möglichkeit der geometrischen Axiome fundiert auf einer reinen „Intuition“? – auf welche Ursache ist die „Affektion“ zu beziehen, die in uns die Erfahrung einleitet: auf ein wahres „Ding an sich“ 153 Buch I: Kritik und System oder nur auf eine transzendentale Idee? – oder wäre dieser Punkt nicht eher zum empirischen Objekt oder dem Phänomen gehörig? – und so also begeht die Kritik einen circulus vitiosus oder nicht, wenn sie an die Basis des synthetischen Urteils a priori die Möglichkeit der Erfahrung platziert, ohne sich davor zu hüten, dass der Begriff dieser Möglichkeit selbst voraussetzt, dass das synthetische Urteil a priori der Kausalität zugelassen ist? – und was ist die Möglichkeit der Erfahrung für einen, der sie nicht betrachten kann vom einzigen Gesichtspunkt her, von dem alle diese Rätsel sich auflösen4 ? 4 Ebenda SS. 509-510. „Aber ihre Kritik führt den Leser nur nach und nach zu diesem Gesichtspunkt5 “. 5 Ebenda S. 510 [Und da die wahrhafte Bedeutung ihrer Methode nicht sofort zu Tage tritt, lässt sich sehr vieles verwirren oder missverstehen]. „Ein Beweis, dass selbst die Freunde der Kritik sich darin nur unvollkommen wiederfinden, beruht schon auf der Tatsache, dass sie nicht genügend wissen, wo sie das Objekt (den Gegenstand) zu situieren haben, der die Sinneswahrnehmung (Empfindung) hervorbringt1 “. [Siehe da, der entscheidende Punkt!] 1 Ebenda „Ich habe mir vorgenommen, dieses Thema von Grund auf zu behandeln (das des Standpunkts), das sicherlich das Wichtigste der ganzen Kritik ist, und ich arbeite an einem Werk, dessen Methode die Umgekehrte von der der Kritik ist. Ich beginne mit dem Postulat des ursprünglichen Aktes der Zuordnung (ursprüngliche Beylegung) usw. Was denken Sie über dieses Projekt2 ?“ 2 192 Ebenda Die Antwort Kants trägt das Datum vom 1. Juli 1794. Wenn ihr Ton noch freundlich bleibt, ist die Zustimmung zu dem Projekt von Beck weniger herzlich. In Wahrheit scheint der Philosoph, darin noch nur einen erträglichen Versuch zu sehen, in der Darstellung der kritischen Lehre die abwärts Richtung durch eine aufwärts Richtung zu ersetzen3 3 Wie Beck es ihm mitteilen wird in einem Brief vom 24. VI. 1797 (Ak Bd. XII S. 175): „Diese meine Methode, von dem Standpunkt der Kategorien abwärts zu gehen, so wie Sie in ihrem unsterblichen Werk aufwärts gehen“. ein wenig Sorge jedoch bricht durch in seinen Bemerkungen, vor allem in seinem Insistieren, auf die Begriffe der Intuition und des Objekts zurückzukommen: Zum Beispiel gefällt ihm der Ausdruck „ursprüngliche Beylegung“ nur mäßig. Er frägt nach dem lateinischen Äquivalent; er selbst versteht ihn wie folgt: 154 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. „Es ist die Beziehung einer Repräsentation als Bestimmung des Subjekts [merken wir uns das] für ein von ihm unterschiedenen Objekt, in der Weise, dass es eine Erkenntnis wird und nicht mehr nur [irgendeine Bestimmung des Subjekts] etwa ein Gefühl [das heißt ein subjektiver Zustand]4 “ 4 Kant an Beck, 1. VII. 1794, Ak Bd. XI S. 514 Er fügt folgende Schikane (Hindernis) hinzu: „Man kann eigentlich nicht sagen, dass eine Repräsentation hinzukomme zu irgendwas anderem sondern nur, dass zu dieser Repräsentation, um daraus eine Erkenntnis zu machen, eine Beziehung hinzukomme zu irgendetwas Anderem (seinem Subjekt der Inhärenz), kraft wessen es anderen Subjekten mitteilbar wird; anderenfalls würde es von der Ordnung des Gefühls bleiben ..., nicht mitteilbar. Aber wir können nicht verstehen und anderen mitteilen, als das, was wir selbst fähig sind zu konstruieren, was so verstanden wird [N.B.], dass die Weise der Intuition selbst, die uns die Elemente einer Repräsentation liefert, bei allen als identisch angenommen werden kann5 “ 5 Ebenda S. 515. Diese Betrachtung, so fährt Kant weiter, ist eingeschlossen in der Theorie der Zusammensetzung [der konstruktiven Spontaneität des Verstandes], nach der die zwei inversen Vollzüge der Synthese und der Analyse – Synthese der Repräsentation ausgehend von einer gegebenen Mannigfaltigkeit und Analyse dieser Repräsentation als Begriff – zu einem einzigen und selben Ergebnis führen. „Diese Übereinstimmung, die weder einzig auf der Repräsentation noch auf dem Bewusstsein beruht und dennoch für alle gültig (mitteilbar ) ist, ist streng bezogen auf irgendwelche universell gültige Bedingung, verschieden von jedem Subjekt. das heißt auf ein Objekt1 “ 1 193 Ebenda, Vergleiche die Prolegomena. Mühsame Erklärung, die eine eher erahnte als klar wahrgenommene Schwierigkeit noch nicht vollständig erfasst. Registrieren wir im selben Brief dieses Geständnis und diesen ebenso bezeichnenden Rat: „Ich bemerke, wenn ich das niederschreibe, dass ich mich selbst nicht genügend begreife ... So überfeine Spaltungen der Fäden sind nicht mehr für mich gemacht: es gelingt mir schon nicht genau, die Subtilitäten von Prof. Reinhild zu begreifen. Muss ein Mathematiker, wie Sie, lieber Freund, gewarnt werden, sich nicht jenseits der Grenzen der Klarheit auf Abenteuer einzulassen2 ?“ 2 Ebenda SS. 515-516. 155 Buch I: Kritik und System Der Rest von Nebel, der Kant die Tiefe seines eigenen Denkens verbirgt, ist nicht allein der Altersschwäche zuzuschreiben: in Wirklichkeit erwecken die Fragen, die seiner Beachtung zugeführt werden ein Problem3 , das er selbst zu lösen versucht hatte, abwechselnd mit zwei entgegengesetzten Methoden (aufwärts, abwärts), für die er nie klar die Lösung verwirklicht hat. 3 Siehe weiter oben, Kap. III, §2, 50, „Die Bipolarität des Objekts“, SS.101 ff. Nun ist er selbst in Verzug versetzt, entweder diese Versöhnung zu finden oder definitiv seine Unfähigkeit zu verkünden. Er erhofft noch irgendeine Frucht aus dem Versuch von Beck; bald wird er dessen theoretische Voraussetzungen besser wahrnehmen und wird dessen wohl verknüpfte aber einseitige Lösung verwerfen. Erstaunliche Tatsache, die wir weiter unten betrachten werden: Es ist er allein, trotz des Gewichts der Jahre, der schließlich durch eine eigensinnige Arbeit der Reflexion, die Form des Gleichgewichts entdecken wird, die die anfänglichen Gegebenen des kritischen Problems der idealistischen Konstruktion aufzwangen. Ein Brief von Beck vom 16. September 17944 4 194 Beck an Kant, 16. IX. 1794, Ak Bd. XI, SS. 523-525 kündigt die Einreichung zum Druck des zweiten Bandes des Erläuternden Auszugs an und greift ohne Anspielung auf die vorausgehende Antwort Kants von neuem das Thema des Standpunkts wieder auf. Dieses Mal lässt er keinen Zweifel an der Wichtigkeit der ins Auge gefassten Umkehrung: es ist das Aufgeben der erfolglosen didaktischen Fiktion einer Verbindung, die zwischen der Repräsentation und den behaupteten Dingen an sich1 existiert. 1 Ebenda SS. 524-525. Trotzdem er vortäuscht, das kantsche „Ding an sich zu behandeln“ als ein vorübergehendes Zugeständnis der Kritik gegenüber den Vorurteilen der noch nicht initiierten Leser, schien Beck nicht mehr so sicher, die Gefühle seines alten Meisters nicht verletzt zu haben: er bittet ihn, ihm in jedem Fall sein Wohlwollen zu erhalten. Schließlich am 17. Juni 1795 kündigt ein neuer Brief für die nächste Buchmesse (die Michaelimesse) einen dritten Band des Auszugs an unter dem speziellen Titel der Einzig mögliche Standpunkt etc. Durch eine bedauernswerte Verknüpfung der Umstände, die in Königsberg sehr Missfallen erregte, sicherte sich dieser Band wie die vorausgehenden ab mit der Erwähnung: „Auf Anraten Kants“, was nicht mehr wirklich angesagt war. Von da an können wir J. S. Beck unter diejenigen rechnen, die Kant „seine hyperkritischen Freunde2 “ nennen wird. 2 156 Vgl. Kant an Tieftrunk, 13.X. 1797, Ak Bd. XII S.207 bei Gelegenheit von Reinhold und Fichte Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. §3.– Meine hyperkritischen Freunde 195 Wir haben weiter oben die Einwände betrachtet, die die kantsche Philosophie von 1781 - 1790 angriffen (siehe SS. 67-77). In der Periode, die uns jetzt beschäftigt (von ungefähr 1790 bis gegen 1797) dauern dieselben fundamentalen Einwände fort, aber der Kredit des kritischen Idealismus hat sich bis zu dem Punkt gefestigt, dass die Angriffe der Gegner nunmehr weniger Bedeutung – und Interesse hatten als die unterschiedlichen Gesichtspunkte, die unter den Anhängern auftauchten. – In dem Maße, wie die Zahl dieser zunahm, wird es schwieriger für den alternden Meister, 1794 siebzigjährig, selbst die Produktionen so vieler wirklicher und angeblicher Schüler zu kontrollieren. Tatsächlich liest er sehr wenig (und das ist schade) die Werke, selbst die, die ihm zugesandt wurden in der Hoffnung, von ihm ein Wort der Wertschätzung zu erhalten. Bei seinen besten Freunden entschuldigt er sich dafür, indem er vorschützt entweder die Altersmüdigkeit, seine schweren akademischen Verpflichtungen und die Sorge der sich ohne Unterbrechung folgenden Publikationen. Sicherlich waren das nicht einfache Ausreden; man versteht, dass er geglaubt hat, dass er ausweichen müsse vor der wachsenden Aufdringlichkeit von Korrespondenten, die von ihm Erklärungen, Korrekturen, Bestätigungen erbaten. Seine Zurückhaltung erklärt sich andererseits noch durch einen anderen Grund: in einem Brief von 17943 3 Kant an Reinhold, 28. III. 1794 Ak. Bd. XI (Briefwechsel II 2) S.494. gesteht er, eine wachsende Schwierigkeit zu verspüren, in das Denken eines anderen einzudringen, besonders wenn dieses fremde Denken angibt, nur eine Vertiefung oder eine logische Weiterentwicklung seines eigenen zu sein. Diese wiederholten Inverzugsetzungen durch die Revisionen der Artikulierungen eines mühsam aufgebauten Systems durch ihn selbst, riefen in ihm ein offensichtliches Unbehagen hervor, ja eine taube Gereiztheit. Im allgemeinen schwieg er darüber. Aber sein hinausgezögertes Schweigen erzeugte im philosophischen Milieu eine Unsicherheit, auf die die großsprecherischen Beschwörungen des „Physiokraten“ Schlettwein ein pittoreskes Echo bieten: „Von all den Schreibern, [die sich Kantianer nennen und die sich untereinander verreißen,] welche haben ihr wahres Denken gefunden: ist es Reinhold? ist es Fichte? ist es Beck oder irgendwelche andere1 ?“ 1 Öffentlicher Brief von J. A. Schlettwein an Kant, 11. V. 1797. Ak. 13. XII (Briefwechsel III 2) S. 364 10 Reinhold und seine „Theorie des Vorstellungsvermögens“ Kant hat Karl Leonhard Reinhold, den dem Datum nach ersten „hyperkritischen“ Kantianer, immer mit sehr viel Schonung behandelt Er bewahrte ihm eine eigenartige Dankbarkeit für seine Aufsehen erregenden „Briefe über die 157 Buch I: Kritik und System 196 kantische Philosophie“, veröffentlicht im Deutschen Merkur, angefangen mit 1786, und für eine Serie von weiteren Artikeln „Über das bisherige Schicksal der Kantischen Philosophie, 1789“ Solange Reinhold, unterstützt durch den Schwung seiner ersten Initiation in die Kritik sich damit zufrieden gab, der überall gehörte Herold der neuen Lehre zu sein, trägt die zwischen dem Meister und dem neuen Anhänger ausgetauschte Korrespondenz den Reflex einer herzlichen Freundschaft ohne Wolken. Die Freundschaft blieb mehr oder weniger immer bestehen; aber die Wolken tauchten auf, als der brillante Publizist sich unterstand, eigenverantwortlich die kantschen Ideen zu vervollständigen und zu entwickeln, die zu verteidigen und zu verbreiten er sich zuerst begnügt hatte. Am 9. April 1789 kündigte er die Einreichung zum Druck einer Theorie der Fakultät der Vorstellung an, von der er ein Wunder dafür erwartete, die Ideen Kants2 ins rechte Licht zu setzen. 2 Reinhold an Kant, 9. IV. 1789, Ak Bd. XI, S. 18. Am 14. Juni desselben Jahres überreicht er dem Meister das erste Buch dieses Werks und gibt zu verstehen, dass das zweite Buch „die wirklichen Prämissen der [kantschen] Theorie der Erkenntnisfähigkeiten und den Schlüssel zur Kritik der Vernunft3 “ enthalten wird. 3 Reinhold an Kant, 14. VI. 1789 Ak Bd. XI, S. 60. Das angekündigte Werk erschien kurz darauf unter dem Titel: Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens (Jena 1789). Es fand bei den Anhängern von Kant eine weniger einheitlich günstige Aufnahme, als der Autor erwartet hatte4 . Die neue Theorie schien für mehrere, sich von der authentischen kantschen Philosophie zu entfernen, weit davon entfernt sie solider zu fundieren. 4 Siehe zum Beispiel den Brief von Kiesewetter an Kant, 15. XII. 1789 Ak Bd. XI, S. 115: „Über H. E, Reinholds Theorie des Erkenntnisvermögens ist das hiesige [Berlin] Publikum geteilt, ein Teil lobt das Buch außerordentlich, ein anderer Teil findet mehreres daran zu tadeln“. Er selbst formuliert einen grundlegenden Einwand. Was hielt Kant selbst davon? Den Empfang des kostbaren Bandes ankündigend, drückte er sein Bedauern aus, dass er noch nur einige Bruchstücke lesen konnte, sicher nicht genug um ein Urteil über das Gesamte zu formulieren; er rechnet damit, sich während der Weihnachtsferien dafür Zeit nehmen zu können. In der Zwischenzeit erhebt er Einspruch, dass diese Verzögerung, die seinen Freund schon beunruhigte, keineswegs Gleichgültigkeit verrate. „Wie können sie ein solches Gefühl vermuten bei jemand, der im Gegenteil Klarheit und Festigkeit von Ihren Überblicken erwartet, die lehrhafte Vollendung und die leuchtende Ausstrahlung, die er selbst seinen Arbeiten zu geben nicht fähig ist? Denn alt werden ist sehr widrig, etc. 1 “ 197 1 158 Kant an Reinhold, 1. XII. 1789 Ak Bd. XI, S. III Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. Zehn Monate später entschuldigt sich Kant gegenüber der wachsenden Ungeduld von Reinhold mit seinen Behinderungen, dass er noch nicht in einem Zustand sei, das endgültige Urteil abzugeben, das er versprochen habe. Er anerkennt ganz den Vorteil, den eine Analyse des aufwärts verlängerten Wissens bis zur ersten Quelle der Erkenntnis, der „Fähigkeit der Vorstellungskraft“ für die Kritik beitrüge: aber gewisse Punkte blieben dunkel; er bittet um einen neuen Aufschub, um das zu klären2 . Das alles, eingerahmt von bewundernden und liebevollen Formeln. 2 Kant an Reinhold 21. IX. 1781 Ak Bd. XI S.288-289 Wie sehr er befürchtete, die Empfindlichkeit Reinholds zu verletzen, konnten wir schon feststellen in dem Rat zur Mäßigung, den er Beck in diesem selben Jahr gegeben hat3 . 3 198 Kant an Beck, 27. IX. 1791 und 2. XI. 1791 Ak Bd. XI SS. 291 und 304. Mit den Ratschlägen vermischte er im Übrigen das offene Eingeständnis der Schwierigkeit, die er verspürte, die Theorie der Repräsentation zu verstehen. Seine Verlegenheit war nicht simuliert. Es war auch ernst, glauben wir, wenn er eine strengere systematische Einheit und eine evidentere Erklärung seiner ganzen Lehre für wünschenswert erklärte. Indem er in sich nicht mehr die physische Kraft fühlte, eine so ausgedehnte Erneuerung zu einem guten Abschluss zu bringen, widerstrebte ihm die Idee durchaus nicht, zu sehen, dass das durch einen hervorragenden Schüler unternommen wird. Von daher kommt ohne Zweifel sein Eifer (offenbar im Fall von Reinhold und von Beck) auf keinen Fall durch eine voreilige Opposition, interessante Initiativen zu lähmen. Diese Toleranz jedoch musste Schranken haben. Er riet einem nach dem anderen seiner „hyperkritischen Freunde“ von Versuchen ab, die er für irreführend hielt. Doch er selbst bleibt nicht stehen. Sein Denken, langsamer, vorsichtiger wird nicht aufhören, ihres Weges zu ziehen auf ihrer eigenen Linie auf eine letzte Grenze zu, die zu überspringen er sich weigern wird. Im März 1794 hat Kant immer noch nicht das Versprechen ausgeführt, das er Reinhold gegeben hatte vor nahezu drei Jahren4 ; 4 Kant an Reinhold 28. III. 1794 Ak Bd. XI. SS. 494-495. im Juli 1795 gesteht er definitiv, dazu nicht fähig zu sein5 . 5 Kant an Reinhold 1. VII. 1795 Ak Bd. XII S.27. Wir beginnen zu vermuten, dass die Motive der Gesundheit, auf die er sich mit Ausdauer beruft, vielleicht nicht der einzige Grund des Schweigens sind, das er hartnäckig einhält über die „Theorie der Repräsentation“. Vor der Alternative, Reinhold vor den Kopf zu stoßen durch offen formulierte Vorbehalte, oder ihm eine Anerkennung aus Gefälligkeit zu geben, die das Risiko mit sich brächte, die wahre Bedeutung der kritischen Philosophie zu verfälschen, nimmt er seine Zuflucht zur Enthaltung. Es ist um diese Zeit (Juni 1794), wo er im Geiste seines Schützlings S. Beck das Projekt des „wahren Standpunkts“ aufsprießen sieht, ein anderes Sorgen-Thema. Im Grunde findet er alle diese neuen Ereig- 159 Buch I: Kritik und System nisse sehr unbequem, die sich zu sehr beeilen, die Kritik zu verbessern. Wenn er von Salomon Maimon spricht, dessen ungewöhnlichen Scharfblick1 er zuerst gelobt hatte, mit dem ihn aber gar kein persönliches Band der Sympathie verbunden hat, macht er selbst eine Anspielung ganz und gar ohne Wohlwollen: 1 Kant an Markus Herz, 26. V. 1789, Ak Bd. XI S. 49: „Nicht nur hat keiner meiner Gegner mich so gut verstanden und die Hauptprobleme so gut verstanden, sondern auch wenige Menschen waren fähig, den so tiefen Problemen so viel Durchsichtigkeit zu geben wie M. Maymon“. „Nie, so schreibt er an Reinhold, ist es mir gelungen, das zu begreifen, was genau ein Maimon wollte mit seinen Nachbesserungen an der kritischen Philosophie (wohl jüdische Weise, sich den Schein der Wichtigkeit zu geben auf Kosten des anderen!); er muss wohl oder übel anderen die Sorge überlassen, sie [diese Retuschen] auf den Punkt zu bringen2 “ 2 199 Kant an Reinhold, 28. III. 1794, Ak Bd. XI S. 495. Nehmen wir für einige Momente die Theorie des Vorstellungsvermögens zur Hand. Die historische Wichtigkeit dieses Werkes liegt sehr viel mehr im vorgenommenen Plan, der es inspirierte, als in der Ausfertigung, die mehr oder weniger geglückt ist. Zum ersten Mal ist die transzendentale Philosophie vor allem als ein System ins Auge gefasst, gezwungen zu strengen Forderungen der Einheit. Kant, der geniale Initiator, leugnete im Abstrakten nicht die Weite dieser Forderungen (siehe weiter oben SS. 186 ff.), aber es ist ihm nicht gelungen, ihm vollständig Recht zu verschaffen. Nach Reinhold muss ein System in seinen verschiedenen Teilen sich ableiten von einem einzigen Prinzip; dieses Prinzip wiederum muss durch sich selbst unbestreitbar, frei von Voraussetzungen sein. Nun aber, was finden wir bei Kant? Zuerst, trotz der (unfruchtbar gebliebenen) Affirmation einer gemeinsamen Wiurzel der Fakultäten des Geistes, das Beharren eines nicht überwundenen doppelten Dualismus: den der theoretischen Vernunft und der praktischen Vernunft und, selbst in der theoretischen Vernunft den des Verstandes und der rezeptiven Sinneswahrnehmung. Dann das Fehlen einer ursprünglichen und unanfechtbaren Evidenz der kantschen Ausgangspunkte: tatsächlich, der Apodiktizität der Mathematik, Fundament der transzendentalen Ästhetik und der Möglichkeit von universellen Gesetzen der Erfahrung, Fundament der Analytik fehlt diese erste Evidenz, die die Zustimmung erzwingt. Man muss also aufsteigen über die Ausgangspunkte der Kritik hinaus bis zu einem wahrhaft ersten Prinzip, das sie rechtfertigt3 . 3 Vergl. Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens, Jena 1789: Vorrede SS. 58 ff.; – Beyträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen, Bd. I (das Fundament der Elementarphilosophie betreffend), Jena 1790; Bd. II Jena 1794 (siehe besonders den Bericht mit dem Titel: Systematische Darstellung der Fundamente der künftigen und der bisherigen Metaphysik. II SS.73-158). Gibt es nichts ursprünglicheres im Bewusstsein als die Funktion selbst des Bewusstseins, das sich ausdrückt in einer absolut „elementaren“ Tatsache des 160 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 200 Bewusstseins? Nun aber kann die elementarste Tatsache des Bewusstseins weder ein theoretischer Satz sein noch eine moralische Maxime noch irgendein besonderer Term. Was ist es also? Kant hat uns auf den Weg gebracht, wenn er, indem er in jeder objektiven Erkenntnis zwei verknüpfte Elemente unterscheidet: die Intuition und den Begriff, die erstere definiert : „eine unmittelbare Repräsentation“ und die zweite: „eine mittelbare Repräsentation“ des Objekts. hinter dem Gegensatz Intuition-Begriff übersetzt ihr gemeinsames, generisches Element, die Repräsentation als solche direkt, in der Ordnung der bewussten Tatsachen, die universelle Funktion des Bewusstseins. Diese ursprüngliche und irreduzible Tatsache, die Repräsentation, muss uns das Anfangsprinzip des kritischen Systems liefern, das heißt den Satz, aus dem die kantschen Anfangspunkte abgeleitet werden können. Jede Repräsentation unterscheidet sich als solche vom repräsentativen Subjekt und vom repräsentierten Objekt. Andererseits in sich selbst setzt sich jede Repräsentation zusammen aus einer Einheit und einem vereinigten Inhalt, einer „Form“ und einer „Materie“. Die Form kann nur hervorgehen aus dem Bewusstsein selbst, nämlich vom „Subjekt“; dagegen ist die Materie dem Bewusstsein „gegeben“, das auf diese Weise passiv gegen ein „Objekt“ erscheint, das verschieden ist von ihm1 : 1 Versuch, usw. Buch II, §§XV, XVI, SVII. „Die Repräsentation im Bewusstsein ist unterschieden vom repräsentierten Objekt und vom repräsentativen Subjekt, aber bezogen auf das eine und auf das2 andere2 ".‘ Beyträge, usw, Bd. I, IIe Abhandlung, S. 144. In dem folgenden Bericht der Beyträge wird das Prinzip formuliert mit einem Übergewicht, das seine Bedeutung nicht verändert: „Im Bewusstsein wird die Vorstellung durch das Subjekt vom Subjekt und Objekt unterschieden und auf beide bezogen“ (Op. cit., Bd. I Abh. III: Neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie, S. 167.) So wird das Anfangsprinzip, das man suchte, formuliert; Reinhold nennt es „Satz des Bewusstseins.“ Von da aus ausgehend, ist es nicht mehr zu beschwerlich, so glaubt er, sich den ersten Sätzen der Kritik anzuschließen3 . 3 Für das was folgt, siehe den Bericht von Reinhold Über das Verhältnis der Theorie des Vorstellungsvermögens zur Kritik der reinen Vernunft, in Beyträge, Bd. I, Abh. IV, SS. 257-358. Man sieht zuerst, welchen legitimen Sinn die Affirmation des „Dings an sich“ annimmt. Das Ding an sich, nur zugänglich vermittels der Materie der Repräsentation in einer Relation, die nicht die des Bildes zum Original ist, bleibt für uns unerkennbar, selbst unrepräsentierbar4 ; 4 „Der Gegenstand ist vorstellbar, inwiefern sich eine Vorstellung auf ihn beziehen lässt; er ist Ding an sich, inwiefern sich der bloße Stoff einer Vorstellung, und also keine Vorstellung auf ihn beziehen lässt; er ist also als Ding an sich nicht vorstellbar“ (Beyträge, Bd. 1, Abh. III, S. 186). 201 es teilt indirekt seine Existenz mit, ohne seine eigene Form zu liefern. Es ist nicht mehr und nicht weniger als das logische Fundament, erforderlich für ein „Affizieren“, das das Subjekt erleidet, ohne es produziert zu haben. Denn die „Affektionen“ des Subjekts, die die Materie der Repräsentation konstitu- 161 Buch I: Kritik und System ieren, können eine bestimmende Ursache haben, innerlich oder äußerlich zur repräsentierenden Fakultät: im ersten Fall muss das Objekt der Repräsentation gesucht werden in irgendeiner anderen Repräsentation, im zweiten Fall entspricht dieses Objekt dem Begriff des „Dings an sich“. Dieser Gesichtspunkt schwächt den Gegensatz ab, den die Kritik zwischen der Sinnlichkeit und dem Verstand zu setzen scheint: die Unterscheidung der zwei Fakultäten reduziert sich hier auf eine Stufung von Graden in einer einzigen und selben „repräsentativen Fakultät“, zugleich spontan und rezeptiv auf allen ihren Ebenen1 . 1 Versuch, usw. Buch II, §§XIX-XX. Auf dem niedrigeren Grad, wenn sie eine fremde Materie mit ihrer Form versieht („Repräsentation des ersten Grades“) nimmt sie den Namen Sinneswahrnehmung an; weiter oben in der Skala unter dem Namen Verstand oder Vernunft („Repräsentation des zweiten Grades“) hat sie als Materie die Form gerade der vorhergehenden Repräsentationen (Intuitionen oder Begriffe): ihre Materie ist also eine „reine“ Materie, „a priori“, subjektiv, weil jede „Form“ der Repräsentation a priori vom Subjekt hervorgeht.2 . 2 Versuch, usw. II, §§XXIX-XXXI So verbindet man die kantschen Begriffe der empirischen Intuition (unmittelbare Repräsentation), der reinen Intuition und auch des Begriffs (vermittelte Repräsentation des Objekts, Form der synthetischen Einheit), der Kategorien (fundamentale Typen der Begriffe), der objektiven Erkenntnis (Erkenntnis, Vereinigung von Intuition und Begriff)3 3 Versuch, usw. Buch III. Auf dieser Grundlage entwickelt Reinhold lang und breit eine Theorie der inneren und äußeren Sinnlichkeit und des Verstandes, eine Deduktion der Kategorien, eine Lehre vom Urteil, der Vernunft und der Ideen4 . 4 202 Siehe Versuch, Buch III. Wir halten uns nicht weiter in seiner Gesellschaft auf, denn wir können schon die zwei Punkte deutlich sehen, wo er sich wirklich als Vorläufer der nachkantschen idealistischen Systeme zeigte. 10 Es ist zuerst, über die bei Kant noch geduldeten Dualismen hinaus, die Forderung einer engen organischen Einheit, ausgehend von einem einzigen und wirklich ursprünglichen Prinzip. In Wahrheit ist das Ding an sich nicht eliminiert sondern nur festgemacht, absichtlicher als in der Kritik an einer Quelle von innerer Erkennbarkeit, dem erkennenden Subjekt, nämlich: an der wesentlichen Relativität der Repräsentation. 20 Es ist dann die Verschiebung jedes formartigen Elements der Repräsentation auf die Spontaneität des Subjekts. Vom „Ich“ als „Fähigkeit der Repräsentation“, als synthetische Einheit des Bewusstseins, fließen aus bezüglich ihrer Form, nicht nur die Kategorien sondern die reinen Intuitionen von Zeit und Raum und selbst die Sinnesqualitäten: reiner Raum und reine Zeit sind 162 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. auf den Fuß der Kategorien gestellt mit nur dieser Besonderheit, die fundamentalen Formen der intuitiven Vielfalt des inneren Sinnes und des äußeren Sinnes zu sein. Vielleicht wäre es angebracht, bei Reinhold eine dritte Vorausnahme der Entwicklung des nachkantschen Idealismus anzudeuten5 . 5 M. Nik. Hartmann (Die Philosophie des deutschen Idealismus, Bd. I, Berlin, 1923, SS. 13-15) hat das stärker betont, als die Historiker der Philosophie es gewohnheitsmäßig taten. K. Fischer zum Beispiel, der nicht weit davon entfernt ist darin eine reine Ergänzung zu sehen und folglich eine eingestandene Unfähigkeit der „Theorie der Vorstellung“ (vgl. Geschichte der neueren Philosophie. Neue Gesamtausgabe, Heidelberg, 1890, Band V, SS. 158-159.) 203 Die oben skizzierte „Theorie der Repräsentation“ geht aus von der Tatsache der Repräsentation, erklärt aber nur die Möglichkeit, nicht die wirkliche Realität von dieser im Bewusstsein. Welches ist die „Kraft“, die wirklich die Aktivität der „Fähigkeit zur Repräsentation“ in Schwung bringt? Das kann nur ein natürliches Streben sein – ein Instinkt (Trieb), der zum Objekt hat, die Repräsentation hervorzubringen; und da diese zusammengesetzt ist von Materie und Form, wird die entsprechende Tendenz alles zusammen „materieartiges Streben “, Instinkt zu erwerben, affiziert zu werden, und „formartiges Streben“ sein, das heißt, Neigung die Form hervorzubringen, Spontaneität die das Handeln befiehlt1 . 1 Vergl. Versuch, Buch III, SS. 523 ff., 560 ff. Wir sind nicht ganz sicher ob Kant, wenn er die letzten Seiten der Theorie der Repräsentation gelesen hat, diese Art, in die Repräsentation das Prinzip der „praktischen Vernunft“ einzuführen, sehr geschätzt hat. Dennoch von dieser Epoche an war, trotz der Unterschiede im Kontext, eine wesentliche These den zwei Philosophen gemeinsam: der eine und der andere bekannte den Primat der praktischen Vernunft gegenüber der theoretischen Vernunft. Die sehr verschiedenen Reaktionen, die das Essay von Reinhold hervorrief, sowohl im kantschen, orthodoxen oder nicht orthodoxen Milieu als auch im dem Kantismus feindlichen Milieu, beschäftigen uns nur in dem Maße, wie sie beitragen konnten zur weiteren Orientierung der kritischen Philosophie. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es nicht nur eine unbedeutende Vorspeise, zwei oder drei bezeichnendere Einschätzungen aufzuzeichnen, die sicherlich Kant zur Kenntnis gelangten und die also als mögliche Faktoren in die Geschichte seines Denkens eingehen. 20 Maimon gegen das „Ding an sich“. Samuel Maimon schreibt an Kant am 20. September 1791: „Nach aufmerksamer Prüfung hat [das Buch von Herrn Reinhold] meine Erwartung enttäuscht. Ich schätze ein System wegen seiner formalen Perfektion, kann es aber nur für gültig halten auf Grund 163 Buch I: Kritik und System seiner objektiven Wahrheit... Unter dem Gesichtspunkt der systematischen Form ist die Theorie der Vorstellungsfähigkeit mustergültig. Demgegenüber kann ich sein so als universell und universell gültig gepriesenes Prinzip absolut nicht zugeben, das Prinzip des Bewusstseins, und noch weniger mir viele Illusionen machen über seine Fruchtbarkeit. – Ich leugne ohne Umschweife, dass in jeder Bewusstwerdung (selbst in der einer Intuition oder einer Sinneswahrnehmung, wie sie Herr Reinhold erklärt), die Repräsentation durch das Subjekt vom Subjekt und vom Objekt unterschieden wird und das eine auf das andere bezogen wird. Nach meiner Meinung bezieht sich eine Intuition auf nichts außer ihr selbst [sie kann nur, neben anderen Intuitionen, eintreten in die synthetische Einheit, die man ein vorgestelltes Objekt nennt]... Aber, so sagt Herr Reinhold, von dieser Relation der Intuition zum Subjekt und zum Objekt hat man sicherlich nicht immer Bewusstsein: sie ist nicht weniger immer gegenwärtig. Was weiß er davon? Das was nicht vorgestellt ist in der Vorstellung, gehört nicht zu Vorstellung. Wie also behaupten, dass das Prinzip von Reinhold universal gültig sei als Tatsache des Bewusstseins? Ein anderes Bewusstsein zeigt vielleicht genau das Gegenteil. Dass die Intuition immer bezogen ist auf irgendein Substrat [was auch immer das sei], das ist eine Illusion der transzendentalen Vorstellungskraft: diese, tatsächlich gewohnt daran, jede Repräsentation gewordene Intuition auf ein reales Objekt zu beziehen (das heißt auf eine synthetische Einheit), schließt damit ab, sie zu beziehen nicht mehr auf ein reales Objekt sondern auf eine reine für dieses Objekt substituierte Idee 1 “ 204 1 Maimon an Kant, 20. IX. 1791 Ak Bd. XI SS. 285-286. Am 30. November 1792, nimmt Maimon, indem er den Inhalt seines, ohne Antwort gebliebenen, vorausgehenden Briefes zusammenfasst, den gegen das Essay von Reinhold vorgebrachten Klagepunkt wieder auf: „Das Prinzip des Bewusstseins, sagt es, setzt Ihre Deduktion [die von Kant] voraus und kann also nicht zur Grundlage dieser Deduktion gemacht werden als eine ursprüngliche Tatsache unserer Fähigkeit zu erkennen2 “. 2 Maimon an Kant, 30. III. 1792 Ak. Bd. XI. S. 390. Das behauptete systematische Prinzip ist nicht ursprünglich. Um seinen wahren Sinn zu verraten, muss dieser Einwand von Maimon auf den Hintergrund der diesem Philosophen eigenen Lehren projiziert werden, dessen eklektisches und originales Denken sich zugleich von Leibniz, von Hume und Kant inspiriert3 . 164 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 3 Siehe hauptsächlich, von Maimon: Versuch über die Transzendentalphilosophie (1790); Streitereien auf dem Gebiete der Philosophie (1793); Die Categorien des Aristoteles (1794); Kritische Untersuchungen über den menschlichen Geist (1797); Versuch einer neuen Logik, oder Theorie des Denkens (1798). 205 In seinen Augen ist das Ding an sich nicht nur unerkennbar, es ist unkonzipierbar, unintelligibel nach Art der „imaginären Größen“ in der Algebra. Daraus folgt, dass die Erkenntnis insgesamt, Materie und Form, erklärt werden muss ohne Ding an sich, nur durch das Bewusstsein allein: die sinnliche Anschauung ist also nicht mehr als ein Grad in der immanenten Aktivität des Subjekts, eine unvollkommen bewusste Ideenbildung; und das erkannte Objekt definiert sich durch das Bewusstsein der synthetischen Einheit der Intuitionen, gruppiert zu komplexen Repräsentationen. Kant waren diese Lehr-Vorurteile des jüdischen Publizisten nicht unbekannt. Ab 1789 hat er sich die Mühe gemacht, sie zu betrachten; in einem Brief an Markus Herz4 , 4 Kant an M. Herz, 26. V. 1789 SS.49-52. 54. indirekte Antwort an Maimon setzte er des Langen und Breiten dem Empirismus dieses letzteren den authentischen Phänomenalismus der Kritik der reinen Vernunft entgegen. Offensichtlich hing die Irreduzibilität zwischen den beiden Gesichtspunkten in letzter Analyse von einer unterschiedlichen Auffassung des Dings an sich ab. Für Maimon ist diese im Höchstfall die irrationale Grenze des Denkens, für Kant aber ein „Unbekanntes“ real Existierendes, unvermeidlicher Lieferant das ursprünglich „Gegebenen“30 Der „Standpunkt“ des Sigismund Beck. Wir haben en passant1 1 Siehe oben Seite 179-180. die feindliche Einstellung bemerkt, die S. Beck um dieselbe Epoche Reinhold gegenüber einnahm. Hier ist der Augenblick, ein wenig dabei zu verweilen. Diese Feindseligkeit stützte sich, wenn wir die persönlichen psychologischen Faktoren vernachlässigen, auf dieselben grundlegenden Vorwürfe wie der Einspruch von Maimon: 1. Das „Prinzip der Repräsentation“ ist nicht ursprünglich. 2. Da es die Existenz und die Kausalität des Dings an sich voraussetzt, ist es behaftet mit dem realistischen Dogmatismus. Der zweite Vorwurf berührte indirekt die Kritik der reinen Vernunft. Man versteht schwer, dass Kant beim Lesen der ersten Briefe von Beck darin nicht sofort den Einfluss einer allgemeinen Voreingenommenheit erkannt hat, identisch zu der, die er seit langem bei Maimon und bei anderen festgestellt hatte2 . 2 Zum Beispiel bei Jacobi 1787. Siehe oben Seite 75-76: Dieses berühmte Wort von Jacobi wird Kant in Erinnerung gerufen von Beck selbst in einem Brief vom 20.VI. 1797 (Ak Bd. XII S.165.) 206 Zweifellos drückte sich dieses Vorurteil auf den Seiten, die Beck ihm unterbreitete betreffs der Theorie von Reinhold3 noch nicht klarer aus; 165 Buch I: Kritik und System 3 Beck an Kant, 6. X. 1791, Ak Bd. XI S. 283. Da Kant im Voraus davon abgeraten hat, sie zu veröffentlichen, konnte er sich wirklich für dispensiert halten, sie zu lesen. Sie enthielten wahrscheinlich das Wesentliche der Einwände, die 1796 im Einzig möglichen Standpunkt entwickelt werden. In jedem Fall, die letzten Illusionen, die Kant behalten konnte über die tiefliegende idealistische Haltung seines jungen Mitarbeiters konnten auf Dauer dem überzeugten Akzent nicht widerstehen, mit dem sich dieser 1794 vornahm, „die totale Vergeblichkeit einer angeblichen Erkenntnis von Dingen an sich anzuprangern4 “. 4 Beck an Kant, 16. IX. 1794. Ak Bd. XI S. 524 – Wenn sechs Monate später Beck das baldige Erscheinen des Standpunkts ankündigt, geschieht das nicht ohne einen Hauch von Sorge, wenn er seinen Meister bittet, ihm sein Wohlwollen zu bewahren (Beck an Kant, 17. VI. 1795 Ak Bd. XII S. 26). Ein neuerlicher Brief gegen Ostern des folgenden Jahres bezog sich wahrscheinlich auf die Zusendung des Grundrisses der kritischen Philosophie (Halle, 1796), von Beck veröffentlicht gleichzeitig mit dem Standpunkt. Die Ankündigung des Empfangs ist datiert mit 19. XI. 1796: der Ton dieses Briefes, dem letzten von Kant an Beck, der uns erhalten blieb, bleibt herzlich, Aber am 20. VI. 1797 gibt es eine lange Verteidigungsrede von Beck mit dem Ziel, Missverständnisse zu zerstreuen und das – als feindselig aufgefasste – Urteil des Hausfreunds von Kant, Joh. Schulz, über den Standpunkt und den Grundriss zu neutralisieren (Beck an Kant, 20. VI. 1797, Ak Bd. XII SS. 162-171). Einige Tage nachher in einem weiteren Brief, versucht Beck seine Sache von der in Königsberg schlecht aufgenommenen von Fichte zu trennen (Beck an Kant, 24. VI. 1797. Ak Bd. XII, S.173-176). Die Aufregung, von der diese zwei Briefe Zeugnis geben, war hervorgerufen worden durch eine Mitteilung (von der wir den Text nicht besitzen), wo Kant streng den Missbrauch seines Namens bei der Veröffentlichung des Standpunkts ... als drittem Band des Auszugs ..., auf Anraten Kants rügte (vgl. Beck an Kant, 20. VI. 1797, Ak Bd. XII, S. 162; J. H. Tieftrunk an Kant, 20. VI. 1797, Ak Bd. XII, SS. 171-172). Worin bestand im Wesentlichen der Gesichtspunkt von Beck, dieser Standpunkt, für den Kant sich weigerte, die Schirmherrschaft zu übernehmen? Wir wollen drei beherrschende Aspekte darin betrachten: 1. Die Natur des Anfangsprinzips der Kritik. 2. Die Deduktion der Funktionen des Bewusstseins. 3. Den Begriff des Objekts1 . 1 207 Das Wesentliche des Standpunkts und des Grundrisses findet sich zusammengefasst in dem langen Brief von Beck an Kant vom 20. VI. 1797 Ak. Bd. XII, besonders SS. 164-166- 1. Das wahre und einzige Prinzip des ganzen Systems der TranszendentalPhilosophie kann nicht ein Satz sein, noch eine Definition noch ein Begriff, noch im Allgemeinen eine Tatsache des Bewusstseins, so elementar sie auch wäre, sondern nur die Tätigkeit selbst, diese elementare Tatsache des Bewusstseins hervorzubringen: folglich auch nicht die Feststellung einer „ursprünglichen Repräsentation“, sondern „das Postulat sich ursprünglich etwas vorzustellen2 “ (das Postulat ursprünglich vorzustellen). 2 Standpunkt usw., Abschnitt II, SS.123-124 Der Ausdruck „ursprüngliche Repräsentation“ bezeichnet hier nichts anderes als die objektive Einheit, die in der Ordnung der Vernunft, jeder gebildeten Repräsentation vorausgeht und sie bestimmt. Die „ursprüngliche Repräsentation“ übersetzt unmittelbar in das Bewusstsein die „ursprüngliche synthetische Handlung“ (die „Zusammensetzung“) die den Verstand charakterisiert3 . 3 Standpunkt Abschnitt II SS. 120 ff. – vergl. weiter oben SS. 189-192, das was gesagt wurde über die „ursprüngliche Beylegung“. 166 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 2. Die Kategorien sind nicht angeborene Ideen oder Begriffe a priori, schrieb Beck 17954 , 4 Beck an Kant, 17. VI. 1795, Ak Bd. XII, S.25. „dass die Kategorien der Verstandesgebrauch selbst sind“, die irreduziblen Typen des Vollzugs der „ursprünglichen Handlung der Repräsentation“, das heißt nur einer und derselben synthetischen ursprünglichen (primitiven) Handlung: sie sind buchstäblich „das ursprüngliche Vorstellen“. Unter diesen Kategorien begegnet man an erster Stelle der „Größe“, dem „Raum“ und der „Zeit“: „fundamentale Kategorien“, Formen der Synthese einer „homogenen5 “ Vielfalt. 5 Standpunkt SS.141 ff. Und da wegen des Fehlens des Dings an sich die Mannigfaltigkeit selbst des Gegebenen aus dem Subjekt hervorgehen muss, sind die „Phänomene“ insgesamt Produkte „der ursprünglichen Handlung der Repräsentation6 “. 6 208 Standpunkt SS. 145 ff. 3. In der kategorialen Funktion, in der reinen intuitiven Funktion und selbst in der Funktion der empirischen Intuition sieht Beck also nicht mehr, wie Kant, den Ausdruck verschiedener Fähigkeiten (Verstand, Sinne), sondern die Stufen einer einzigen ursprünglichen synthetischen Handlung. Der Vollzug dieser, um eine objektive Repräsentation zu erzeugen, muss sich festmachen, sich festlegen in einer formartigen Kontur (Umriss), unter dem die „Anerkennung“ möglich wird, das heißt das reflektierte Bewusstsein einer ursprünglichen Einheit der Synthese: „die Einheit der ursprünglichen Synthese und der ursprünglichen Anerkennung erzeugt die ursprüngliche synthetisch objektive Einheit des Bewusstseins, das heißt, den ursprünglichen Begriff eines Objekts [im allgemeinen]1 “. 1 Standpunkt S. 144. Wie von da übergehen zur Erkenntnis eines gegebenen Objekts? Im Bewusstwerden (das ist die „Anerkennung“) der aufgestellten Beziehung zwischen einer gegebenen empirischen Mannigfaltigkeit und einer Kategorie, durch Vermittlung einer allgemeinen Bestimmung der Zeit, anders gesagt durch Vermittlung eines dieser Kategorie entsprechenden „Schemas“. Man wird sich erinnern, dass die „empirische Mannigfaltigkeit“, die vom Subjekt ausgegangen ist, unter Ausschluss jeder Realität an sich, nichts anderes sein kann als die letzte Grenze der immanenten Ausdehnung der synthetischen Handlung des Bewusstseins. Beck schmeichelt sich, so den Standpunkt der Transzendentalphilosophie in seiner ganzen Reinheit freigelegt zu haben und folglich „die transzendentale Struktur der menschlichen Erkenntnis“ (das Transzendentale unserer Erkenntnis)2 . 2 Standpunkt S. 120. Er hat nur, so glaubt er, im System der reinen Vernunft die kantsche Idee der „ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption“ an ihren wahren Platz versetzt. Aber er hat gewagt, Konsequenzen zu ziehen, vor denen Kant 167 Buch I: Kritik und System 209 noch zögerte: trotz des Primats der Synthese über die Analyse mit ihrem Korollar: der ursprünglich funktionale und dynamische Charakter der Kategorien (einer Position von Kant selbst bereits vorher gesichert) führt zur Aufnahme der reinen Sinnlichkeit in den Verstand und und von der empirischen Mannigfaltigkeit zur konstruktiven Spontaneität. Indem er jede Rezeptivität von außen unterdrückt, jede „Affektion“ von Seiten des Dings an sich, befreite S. Back die Kritik von lästigen Problemen, besonders der enttäuschenden Aufgabe die regelmäßige Zuordnung zwischen den jeweiligen Rollen des Dings an sich, des sinnlichen Aprioris und dem kategorialen Verstand in der objektiven Erkenntnis zu erklären. Die idealistische Lösung von Beck zeigt gegenüber der von Kant den Vorteil einer größeren Einfachheit. Vielleicht selbst in einem Punkt – der Natur des empirisch Gegebenen – bleibt sie zu summarisch, um nicht ein wenig vage zu sein. Fichte 1794 war viel expliziter bezüglich dieses Themas. Als 1796 die Meinungsverschiedenheit zwischen Kant und Beck platzte, war J.H. Tieftrunk, Professor der Philosophie in Halle, einer der ersten, die sich damit befassten, die zwei Parteien einander anzunähern3 . 3 Vgl. Tieftrunk an Kant, 20. VI. 1797, S. 171 f. Er fing auf diese Weise einen Briefverkehr mit Kant an und unterbreitete ihm selbst ein kurzes Memorandum4 , das seine Weise, die Kritik der reinen Vernunft zu verstehen, erklärte. 4 5. XI. 1797: Ein Fragment davon ist reproduziert in Ak. Bd. XII, SS. 212-219 Diese Interpretation, verwandt mit der von Beck, wurde einer Antwort gewürdigt, die erlaubt, sehr gut zu unterscheiden, wo darin das Denken des alten Meisters in diesem besonders interessanten Moment seiner Entwicklung war. Kant knüpft in seiner Antwort an das zentrale Problem der „Anwendung der Kategorien auf Erfahrungen oder auf Phänomene an5 “; 5 Kant an Tieftrunk, 11. XII. 1797, Ak Bd. XII, S. 222. er glaubt, dafür eine befriedigendere Formulierung gefunden zu haben, die über einige Punkte der Kritik „ein neues Licht1 “ wirft. 1 Ebenda Diese Formulierung unterscheidet sich im Grunde gar nicht von der – etwas früheren – , die wir lesen konnten in den Fortschritten. Es ist dennoch der Mühe wert, sie von neuem zu betrachten; denn sie wird hier wiederaufgenommen mit der sehr gegenwärtigen Voreingenommenheit des Standpunkts von Beck. „Der Begriff des Konstruierten im allgemeinen (des Zusammengesetzten überhaupt), schreibt Kant, ist nicht eine partikuläre Kategorie, sondern ist enthalten (als synthetische Einheit der Apperzeption) in allen Kategorien. Tatsächlich kann das Konstruierte als solches nicht Objekt der Intuition sein (kann ... nicht angeschaut werden); es muss im Gegenteil den Begriff oder das Bewusstsein 168 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 210 der konstituierenden Handlung (des Zusammensetzens) schon besitzen, um sich das intuitiv gegebene Mannigfaltige zu repräsentieren. als verbunden in einem Bewusstsein; mit anderen Worten, um das Objekt als etwas konstruiertes zu denken. Das geschieht durch die Vermittlung des Schematismus der Fähigkeit zu urteilen: das heißt, dass die konstruktive Handlung sich bewusst vollzieht auf dem Niveau des inneren Sinns, indem es sich regelt einerseits an der Vorstellung der Zeit und indem es sich auch bezieht andererseits auf die in der Intuition gegebene Mannigfaltigkeit. Alle Kategorien wenden sich an auf einen a priori konstruierten Inhalt (auf ein Zusammengesetztes) ... [ob dieser Inhalt eine homogene Mannigfaltigkeit ist oder eine Verschiedenheit]2 “. 2 Zitierter Brief Ak Bd. XII. SS.222-223. „Herr Magister Beck – den ich bitte, von mir freundlich zu grüßen – könnte darin eine Basis finden, darauf seinen Standpunkt abzustützen, der die Phänomene verknüpft (als Intuitionen a priori) ausgehend von den Kategorien. [Unter jeder Hypothese] fordert die konstruktive Synthese der Mannigfaltigkeit eine Intuition a priori, die den reinen Begriffen des Verstandes ein Objekt liefert. Und diese Intuition ist der Raum und die Zeit. Aber in der Veränderung des Gesichtspunktes, [den man vorschlägt, das heißt in der Umkehrung des Gesichtspunktes, der durch den Standpunkt von Beck versucht wird3 ] 3 Diese Interpretation des Textes ist uns garantiert durch die Parallelstelle eines ersten, weiter entwickelten Entwurfs dieses Briefs. Dieser Entwurf ist in den Anmerkungen von Band IV der Korrespondenz reproduziert: vgl. Al Bd. XIII, SS. 468 und 471. bleibt der Begriff des Zusammengesetzten, Fundament aller Kategorien, durch sich selbst des Sinnes beraubt: man sieht nicht, dass irgendein beliebiges Objekt dem entsprechen muss4 ...“. 4 Zitierter Brief S. 223 – Das ist der Einwand der im Vorausgehenden von Kant gegenüber Beck selbst gemacht wurde: siehe weiter oben S. 185, „Dennoch, das ist eine Tatsache, es gibt synthetische Urteile a priori, die eine Intuition a priori (Raum und Zeit) als Fundament haben, denen also das Objekt einer nicht empirischen Repräsentation entspricht. – Wie sind sie möglich? – Nicht auf die Weise, dass diese Formen einer intuitiven Konstruktion1 das Objekt so repräsentieren, wie es an sich ist ... 1 Man wird sich erinnern, dass die logisch gültigen synthetischen Urteile eine Intuition entweder a priori oder a posteriori zum Fundament haben. 211 Bleibt also nur, dass diese Formen selbst, statt eine unmittelbare Repräsentation des Objekts zu sein, nur die subjektiven Formen der Intuition [dieses Objekts] sind. Ich will sagen, dass das Subjekt entsprechend seiner eigenen Natur, durch das Objekt affiziert wird, das heißt, dass das Objekt repräsentiert wird, nach dem, wie es uns 169 Buch I: Kritik und System erscheint (also indirekt) und nicht entsprechend dem, wie es in sich selbst ist2 ... “. 2 Brief zitiert SS. 223-224. – Wir haben einige Worte hervorgehoben Im übrigen hat Kant vor langer Zeit das erklärt, an was er hier erinnert: die Subjektivität der Formen der Intuition ist genau die einzige Art, die Möglichkeit von synthetischen Urteilen a priori zu rechtfertigen; aber das ist mit dem gleichen Schlag, das Anzeichen der Begrenzung dieser Urteile auf die Ebene der Phänomene: „Siehe da, das Fundament dieses kapitalen Theorems: dass die Objekte der Sinne (sei es des äußeren Sinns, sei es des inneren Sinns) von uns erkennbar sind, entsprechend dem, wie sie uns erscheinen [als Phänomene], nicht entsprechend ihrem an sich3 “ 3 Ebenda S. 224 Letzten Endes, großzügig hinweggehend über die jugendliche Annahme seines Schülers4 , 4 Siehe das Projekt vom Brief, der oben zitiert wurde, S. 210, Anmerkung 2, vbl. Ak. Bd. XIII, S. 471. 212 gab Kant zu, dass „Herr Magister Beck“ in seiner Erklärung der Kritik der reinen Vernunft die „analytische“, absteigende („abwärts“) Methode ersetzte durch die aufsteigende „synthetische“ Methode („aufwärts“). Tatsächlich schien diese Umkehrung der Perspektive möglich, ohne die tiefe Organisation des Systems der reinen Vernunft zu verändern. Aber man musste dabei gut beachten: 10 dass die erforderlichen Etappen, um überzugehen von der synthetischen ursprünglichen Handlung (oder den Kategorien) zur objektiven Erkenntnis einem intuitiven Inhalt a priori begegnen müssen; 20 dass die unvermeidlichen Intuitionen a priori (wobei die intellektuelle Intuition hier außer Frage steht) die einer Sinnlichkeit sein müssen, das heißt die (subjektiven) Formen a priori von möglichen empirischen Intuitionen. Das vorausgesetzt, wie ist die Idee einer wahrhaften „Rezeptivität“ des Subjekts, einer äußeren „Affektion“ der Sinnlichkeit und folglich eines begrenzenden Dings an sich zu verwerfen? Wenn man beim Erklären der Kritik der reinen Vernunft sich an die absteigende Methode halten kann und auf diese Weise, das vermeiden kann, was man eine Dualität der didaktischen Ordnung zu nennen wagte, bleibt trotzdem der tiefliegende Dualismus, der das Ding an sich dem transzendentalen Subjekt gegenüberstellt, trotz allem fortbestehen, so untrennbar ist er von der Phänomenalität der diskursiven Erkenntnisse. Solcher Art ist, wie wir glauben, das Denken Kants zu dieser Zeit (Ende des Jahres 1797). 170 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 40 Die radikale Opposition des Enesidem-Schulze. 213 Zurückgeführt auf diesen zentralen Punkt, seinen wahren „kritischen Punkt“, scheint die Uneinigkeit zwischen Kant und Beck die skeptischen Schlüsse des anonymen Dialogs zu rechtfertigen, die 1792 erschienen unter dem Titel: Aenesidemus oder die Fundamente der von dem Prof. Reinhold in Jena gelieferten Elementarphilosophie, nebst einer Verteidigung des Skeptizismus gegen die Anmaßungen der Vernunftkritik. Ihr Autor war, man hat es später erfahren, ein junger Dozent der Philosophie, G. E. Schulze, dem man den Beinahmen Enesidem-Schulze gab, um ihn von so vielen gleichlautenden zu unterscheiden. Sein Pamphlet oder die scharfen Bemerkungen verfehlten ihr Ziel nicht, zielten durch Reinhold auf Kant und auch direkt auf andere. In mehr als einem Punkt fallen die Vorbehalte von Schulze zusammen mit denen der „hyperkritischen Freunde“ von Kant: Dazu sagt uns Enesidem, dass Reinhold den Weg gezeigt, indem er mit Recht den Mangel an Einheit der kantschen Kritik rügte; aber das Mittel, das er darauf anwendet offenbart sich als vollkommen erfolglos, denn sein berühmtes „Prinzip des Bewusstseins“ abgesehen davon dass es nichts von einem absolut ersten Prinzip hat [was Beck und Fichte zugeben werden], entbehrt nicht einmal der Doppeldeutigkeit und es fehlt ihm sogar die absolute Universalität, die man ihm anzuerkennen behauptet. Vor allem erschwert das Prinzip von Reinhold mehr als es erleichtert den logischen Skandal, der von Anfang an das kritische Abenteuer verdarb: der Skandal des „Dings an sich“, notwendig behauptet, aber unerkennbar [auch hier noch werden Beck und Fichte mit Schulze einer Meinung]. Wenn man sich nicht damit abfindet, die Widersprüche sich stark vermehren zu sehen, muss man zurückgehen: entweder offen die Existenz und Erkennbarkeit der vom Subjekt unterschiedenen „Dinge“ annehmen, und das wäre die Rückkehr zum ontologischen Dogmatismus; oder offen verzichten auf die Fiktion von „Dingen an sich“; und das heißt zurückkehren zum skeptischen Phänomenalismus von Hume. In jeder Hypothese, mit oder ohne „Dinge an sich“ ist die kritische Philosophie verurteilt.. Enesidem-Schulze ordnet sich persönlich eher ins Gefolge von Hume ein. Das Dilemma des Enesidem erinnert an das Dilemma von Jacobi1 : 1 Siehe weiter oben S. 75. ohne das „Ding an sich“ ist es unmöglich, in die Philosophie Kants einzudringen; mit dem „Ding an sich“ ist es unmöglich, darin zu bleiben. So also nicht nur Jacobi, Maimon und Schulze, sondern Beck, Tieftrunk2 , Fichte und später Reinhold selbst (manchmal mit Fichte vereint), 2 Für den Gesichtspunkt von Tieftrunk über das „Ding an sich“ und die „Affektionen“ der Sinnlichkeit, siehe Tieftrunk an Kant, 5. XI. 1797, Ak Bd. XII. SS. 216-218, die einen Gegner, die anderen Anhänger von Kant, sehen in gleicher Weise in der behaupteten Existenz von Dingen an sich den Stein des Anstoßes der Kritik. 171 Buch I: Kritik und System 50 Kant und Fichte In diesem Konzert erhebt sich seit 1794 mit einem besonderen Glanz, die Stimme von Fichte: „Die Idee eines Ding an sich, welches an sich unabhängig von jeder Fähigkeit der Repräsentation die Existenz und gewisse konstitutive Merkmale besäße, ist eine Phantasie, ein Traum, ein Nicht-Gedanke1 “ 1 J.G.Fichte, Rezension des Aenesidemus, in der Allgemeinen Literaturzeitung, Iena, 1794. Vergl. Fichtes sämtliche Werke, herausgegeben von J.H.Fichte, Bd. I S.17 2 Viel besser als Beck weiß Fichte, das was er will und wohin er geht. Die Idee eines „kritischen Systems“, so erklärt er, schließt nicht nur nicht ein sondern schließt absolut aus die Idee eines Dings an sich3 2 Beck lässt als Postulat der praktischen Vernunft, ein absolutes Substrat der Natur zu – theoretisch unerkennbar – Man kann also nicht sagen, dass die Idee eines „Ding an sich“ ihm völlig fremd sei. Vergl. Beck an Kant, 20. VI. 1797, Ak. Bd. XII S. 166 3 Ebenda Ist das nicht exakt das Gegenteil von dem, was wir Kant gegenüber Tieftrunk 1794 insinuieren hörten4 ? 4 214 Vergl weiter oben S. 209-211 Zweifellos, auf beiden Seiten stehen sich die rohen Formulierungen gegenüber. Aber Fichte konzipiert das idealistische System mit einer Weite, die ihm erlaubt, insgesamt die kantsche Theorie des Dings an sich in einem absoluten und universellen Sinn genommen, anzufechten und sie dennoch für anwendbar zu halten auf ein partikuläres Niveau des Denkens. So entschuldigt er in seiner Rezension des Enesidem, die Ausdrücke Kants und selbst Reinholds: Diese, wenn sie die „Formen der sinnlichen Anschauung“ affizieren mit einer notwendigen Beziehung zu irgendeinem Objekt an sich, betrachten „die Formen einer menschlichen Fähigkeit der Repräsentation5 “; 5 Op. und Edit. zit. S.19-20 Nun aber hindert nichts daran, dass eine begrenzte Intelligenz wie die unsere, die Existenz von unerkennbaren noumenalen Objekten konzipiert und affirmiert, das heißt nur erkennbar durch einen höheren, intuitiven Verstand. In Wahrheit kann das hier in einem kritischen System nur ein partieller Gesichtspunkt sein: „Ein Ding an sich unabhängig von jeder Intelligenz wäre ein Unsinn6 “. 6 Ebenda Wir müssen im zweiten Teil den Idealismus von Fichte näher untersuchen. Versuchen wir inzwischen das einzugrenzen, was davon Kant anders als durch ein vages Gerücht zur Kenntnis gekommen sein kann. Sicherlich nicht sehr viel. Nehmen wir an – das ist nicht sicher – dass der Philosoph von Königsberg, Leser der Allgemeinen Literaturzeitung, 1794 die lange Rezension von Fichte des Enesidem überflogen hat: Er wäre dort begegnet, neben Vorbehalten dem Ding an sich gegenüber, neben der Forderung einer strengeren systematischen Einheit, sehr vielen Sätzen, die ein direktes Echo darstellen auf die Wissenschaftslehre, die gerade zu dieser Zeit Gestalt annahm. Zum Beispiel hätte 172 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 215 er lesen können: „dass den Einwänden von Enesidem gegen die Wahrheit an sich des Prinzips der Repräsentation [von Reinbold] das Fundament fehlt, aber dass sie dafür gegen dieses Prinzip sprechen, sobald man es als das erste der ganzen Philosophie betrachtet und als eine reine Tatsache; dass sie also die Notwendigkeit zeigen, dafür eine tiefere Rechtfertigung zu suchen“ 1 1 Op. cit. Werke, Bd. I, S.10 Dass im Übrigen ein allgemeineres Prinzip als das von Reinhold, ein zugleich die beiden Bereiche, den theoretischen und den praktischen, umfassendes Prinzip der Vernunft möglich ist2 . 2 Ebenda S. 4-6 Dass nur eine Tathandlung, nicht eine simple Tatsache einen solchen Ausgangspunkt konstituieren kann3 . 3 Ebenda S. 8 Dass „das absolute Subjekt, das Ich, überhaupt nicht gegeben ist in einer empirischen Intuition, sondern gesetzt durch eine intellektuelle Intuition4 “. 4 Ebenda S. 10 Dass der Gegensatz zwischen dem reinen, absoluten und unabhängigen Ich und dem Ich-Intelligenz, begrenzt durch das Nicht-Ich, sich auflösen muss in der Begrenzungs-Handlung des ersten am zweiten, Handlung unbestimmt tendierend auf eine letzte Grenze zu (ein „letztes Ziel“), die „ein Ich“ wäre, „dessen eigene Autodetermination auch jedes Nicht-Ich bestimmen würde5 “. 5 Ebenda S. 22-23 Dass der Glaube an dieses letzte Ziel (Glaube an Gott) nicht einen geringeren Grad an Sicherheit bietet als die Überzeugung selbst des „Ich bin6 “. 6 Ebenda Kant hatte damals ein sehr gutes Verhältnis zu Fichte, seinem Besucher in Königsberg 1791, dessen Talent als Philosoph und Schriftsteller er zu schätzen wusste. Er wusste, dass der junge Autor der Kritik aller Offenbarung (1791), angeregt durch seinen ersten Erfolg, plante das Feld seiner Forschungen zu erweitern auf die großen Probleme, die die Moral und das Recht beherrschen7 . 7 Vgl. Fichte an Kant, 2.IV. 1793, Ak, Bd. XI S. 418 und 451-452, und ebenso die Antwort Kants vom 12. V. 1793, Ak. Bd.XI S. 433-434 Er dachte überhaupt nicht daran, ihm davon abzuraten. Wenn er die Rezension des Enesidem überflogen hat, so zeigt nichts, dass er daran mehr Anstoß genommen hat als an den ersten Verwegenheiten von S. Beck. Aber er erhielt dann (1794) Schlag auf Schlag in einigen Monaten nicht nur das „Programm“ des Beginns der Seminare von Fichte in Jena8 8 Fichte an Kant 17. VI. 1794, Ak, Bd.XI S.511-512 und das Werkchen mit dem Titel: Begriff der Wissenschaftslehre9 9 216 Fichte an Kant, 6. X. 1794, Ak, Bd. XI, S. 526 sondern andere Publikationen, wie die fünf Vorlesungen Über die Bestimmung des Gelehrten und den Anfang der Grundlage der gesamten Wissenschafts- 173 Buch I: Kritik und System lehre. Das war sehr viel Lektüre auf einmal für einen alten Herrn, der eine zunehmende Schwierigkeit eingestehen musste, in das Denken anderer einzudringen. Auch ließ die Antwort Kants, versehen mit Entschuldigungen, die bei ihm schon gewohnt waren, bis zum Monat Dezember 1797 auf sich warten. Diese verspätete Antwort, so herzlich sie auch war, enthielt zwei Anspielungen, denen gegenüber der Empfänger nicht unempfindlich bleiben musste: sie unterstrich „in den allerneuesten Veröffentlichungen [von Fichte]1 “ 1 Fichte hat geglaubt darin eine Anspielung zu finden auf die Zweite Einleitung zur Wissenschaftslehre, von der Kant also Kenntnis genommen hätte. „die Entfaltung einer besonderen Gabe der lebendigen Erklärung, sehr angepasst an eine große Öffentlichkeit“ – wir würden heute sagen: eines bemerkenswerten Talents eines Popularisierers –und sie drückte die Hoffnung aus, „nachdem er nun die dornigen Pfade der Scholastik überschritten habe“, der junge Autor „es nicht mehr für nötig halte, sich noch weiter da zu betätigen2 “. 2 Kant an Fichte, Dezember 1797 [?] Ak. Bd. XII S. 222 Diese letztere Bemerkung enthielt etwas anderes, als eine unschuldige Banalität, vor allem nach dem einige Zeilen weiter oben formulierten, ein wenig ironischen Eingeständnis, dass er, Kant, selbst sich durch das Alter gezwungen sah, „anderen die Subtilitäten der theoretischen Spekulation in deren neuen und extremen Feinheiten zu überlassen, (was ihre neueren, äußerst zugespitzten Apices betrifft)3 “ 3 zitierter Brief S. 221. In seiner Antwort vom 1. Januar 1798 stellt Fichte, indem er so tut, als ob er sich für das ihm verliehene Lob für „seine Kunst der popularisierenden Erklärung“ bedankt, den Verzicht von Kant „den äußerst zugespitzten Apices“ gegenüber fest und erklärt, seinerseits „noch in keiner Weise daran zu denken, die Scholastik hinaus zu komplementieren4 “. 4 217 Fichte an Kant 1. I. 1798, Ak. Bd. XII,S.230-231 Trotz des korrekten Tons auf beiden Seiten waren die Beziehungen zwischen Kant und Fichte in zunehmendem Maße geschädigt durch den ein Wohlwollen entbehrenden Klatsch, der bei den unnachgiebigen Kantianern zirkulierte und in Königsberg zusammenfloss. Unter den häufigen Besuchern Kants war Johannes Schulz, wir wissen es durch einen Brief von Beck5 , den Ideen von Fichte nicht gerade wohlgesinnt. Und Beck selbst wehrte sich sehr, es zu sein6 5 Beck an Kant 24. VI. 1797, Ak. Bd.XII S. 172, S. 175 6 Ebenda Der Großteil der Korrespondenten von Kant, die von der Wissenschaftslehre sprechen oder von der Haltung ihres Autors, machen es in unfreundlichen Ausdrücken. Zum Beispiel, seit 1794 bekümmert sich Mellin „das Haupt einer gewissen Schule ["´so weit zu gehen, die Idee der Wissenschaft zu verkennen“ und ] versessen darauf, neues zu sagen, die kritische Philosophie einer Menge von Einwänden auszusetzen7 “. 174 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 7 Mellin an Kant, 12. IV. 1794 Ak. Bd. XI, S.498 „Das Naturrecht von Fichte, so schreibt J. B. Eberhard8 “ 8 Erhard an Kant, 16. I. 1797, Ak. Bd. XII, S. 144 hat sehr viel Gutes in seinem zweiten Teil, aber der Anfang ist reines Geschwätz. Aufs ganze gesehen ist es bedauerlich, dass Fichte sich verirrt in solche Unsinnigkeiten, um sich den Anschein zu geben, der tiefste von allen Denkern zu sein. Ich muss leider die Besprechung seiner philosophischen Schriften machen und weiß noch nicht genau, welche Tonart ich adoptieren soll. Auch Herr Beck hat sich im dritten Band seines Auszugs ganz passabel emanzipiert: ich konnte mich in meiner Rezension nicht zurückhalten, seine Arroganz zu korrigieren, ebenso wie ich den Unsinn von Schelling nicht geschont habe.“ Am 25. Juli 1797 ist es ein junger Mann von dreiundzwanzig Jahren, Christian Weiss, der seine Ratlosigkeit ausdrückt: sympatisierender Hörer der Seminarien von Fichte in Jena, erfährt er, dass der Professor Kant nur allein Herrn Schulz zugesteht, sein Denken authentisch weiterzuführen (mit Ausschluss also von Fichte). Andererseits weiß er, dass derselbe Kant die Theorie der Repräsentation von Professor Reinhold anerkannt und gerühmt hat: aber ist die Geltung dieses Werks nicht widerlegt durch die jüngste Kehrtwendung dessen Autors, der es verleugnet? Wo findet man den wahren Kantismus1 ? 1 Vergl. Weiss an Kant, 25. VII. 1797, Ak Bd. XII S.185-186. Siehe auch (dort S.245) die ablehnende Abschätzung von J. Richardson, am 21. VI. 1798 218 Das was Chr. Weiss von der von Joh. Schulz empfangenen Bestätigung schreibt, bezieht sich auf eine öffentliche Erklärung Kants vom 29. Mai 1797, erschienen im Intelligenzblatt der Allgemeinen Literaturzeitung vom 14. Juni 1797: kurze Erwiderung auf ein lange aufgeblasenes Kartell (auf eine „literarische Herausforderung“) adressiert an den Vater der kritischen Philosophie durch den deutschen „Physiokraten“ – J. A, Schlettwein, um ihn zu beschwören, sich endlich zu äußern in einer Entscheidung zwischen den divergierenden Interpreten seines Systems. „Darauf, so erklärte Kant, antworte ich ohne Zögern, das was folgt: [mein authentischer Sprecher] ist der verehrte königliche Prediger und Professor der Mathematik an dieser Univerität, Herr Schulz, dessen das kritische System betreffende Schriften den Titel tragen: Prüfung etc. und von Herrn Schlettwein konsultiert werden können ... Ich habe nur eine Klausel hinzuzufügen: Ich verstehe die von Herrn Schulz verwendeten Ausdrücke buchstäblich und nicht dem Geist nach, der sie angeblich inspirierte (und die jedermann dabei beliebig unterschieben könnte). Was auch immer die Ansichten sein könnten, die andere mit denselben Wörtern zu verbinden, für gut gehalten haben, verpflichten sie in keiner Weise weder mich selbst noch den Gelehrten, den ich zu meinem 175 Buch I: Kritik und System Vertreter mache:. Der Sinn der Ausdrücke, die er verwendet, kann nicht verfehlen aus dem Kontext seines Buches hervorzugehen2 “. 2 Erklärung zitiert, Ak. Bd. XII S. 367-368 Erinnern wir uns daran, dass im Oktober dieses selben Jahres 1797 Kant noch Tieftrunk empfahl „seine hyperkritischen Freunde, Fichte und Reinhold, mit all der Schonung zu behandeln, die die Dienste verdienen, die sie der Wissenschaft geleistet haben3 “. 3 Kant an Tieftrunk, 13. X. 1797, Ak, Bd. XII, S.207 Und doch verschlimmerte sich der latente Konflikt von Tag zu Tag. Kant beginnt sich wegen der Wissenschaftslehre zu beunruhigen, über die er gerade eine Rezension in der Allgemeinen Literaturzeitung 4 gelesen hat. 4 Allgemeine Literaturzeitung vom 8. I. 1798 über die wichtigsten Werke von Fichte, von 1794 bis 1595. Diese Rezension wird Erhard zugeschrieben. „Was denken sie, schreibt er an Tieftrunk am 5. April 1798 von der allgemeinen Theorie der Wissenschaft von Herrn Fichte? Es ist lange her, dass er sie mir zugesandt hat; aber da das Werk ganz schön umfangreich ist und weil seine Lektüre meine Arbeit peinlich unterbrochen hätte, habe ich das Buch zur Seite gelegt und ich kenne es bis jetzt nur durch die Rezension der Allgemeinen Literaturzeitung. Ich habe zurzeit nicht die Mittel, die Seiten von Fichte zur Hand zu nehmen; aber die Rezension (offensichtlich wohlwollend), die darüber gemacht wurde, gibt mir den Eindruck einer Art Phantom: wenn man glaubt, es ergriffen zu haben, findet man überhaupt kein Objekt vor sich, immer nichts als das Ich selbst, oder besser, im Ich nichts als die ausgestreckte Hand, um das Objekt zu ergreifen. Das reine Bewusstsein von sich und was dann! –nur betrachtet entsprechend der Form des Denkens, ohne Materie, also ohne dass die Reflexion, mit dem Anspruch, sich selbst über die Logik hinaus zu erheben, etwas vor sich hat, woran sie sich halte, alles das erzeugt beim Leser einen Eindruck der Seltsamkeit. Schon der Titel (Wissenschaftslehre) ruft nur mittelmäßige Erwartungen hervor: tatsächlich, weil jede systematisch durchgeführte Lehre eine Wissenschaft ist, muss das nicht bedeuten eine Wissenschaft von der Wissenschaft (Wissenschaftswissenschaft) und so weiter bis ins Unendliche1 ?“ 219 1 Kant an Tieftrunk, 5. IV. 1798, Ak Bd. XII, S.241 Unter einer noch weniger überwachten Form hat Kant sein Gefühl verraten im Lauf einer Unterredung (1. Juni 1798) mit J. F. Abegg, der ihm einen Brief von Fichte brachte: 176 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. „Nachdem er den Brief überflogen hatte, erzählt der Besucher, sagt er mir: Das alles ist schön und sehr höflich; andererseits schreibt Fichte immer mit Höflichkeit; aber zwischen den Zeilen fließt eine Woge von Bitterkeit, weil ich mich zurückhalte, mich über ihn zu äußern, nämlich zu seinen Gunsten ... Ich lese nicht all seine Schriften, aber ich habe vor kurzem die Rezension gesehen, die die Literaturzeitung von Jena darüber gegeben hat: Nach der ersten Lektüre konnte ich nicht exakt begreifen, was er wollte; ich fing noch einmal an, im Glauben, dabei diesmal irgendetwas zu verstehen, aber es war nichts damit. Fichte hält ihnen einen Apfel vor den Mund, hindert sie aber, davon zu kosten. Als ob er die Frage behandeln wollte: mundus ex aqua ... Er bleibt dauernd in den Allgemeinheiten, gibt nie ein Beispiel, und, was noch schlimmer ist, kann keines geben, denn das Objekt, das seine allgemeinen Begriffen entspräche, existiert nicht2 “ 2 220 Zitiert in Ak. Bd. XIII (Briefwechsel IV), S. 482 Ein Jahr später, am 7. August 1799, explodiert die berühmte Erklärung von Kant gegen Fichte, die bedeutet in harten Ausdrücken der Bruch jeder wissenschaftlichen Solidarität zwischen dem Meister und seinem behaupteten Fortsetzer. Lesen wir zuerst dieses Dokument, dessen exakte Tragweite für uns von gewissem Interesse ist. „Als Antwort auf die Einladung, die man mir machte im Namen der Öffentlichkeit durch den Autor einer Rezension des Entwurfs der Transzendental-Philosophie von Buhle in der Nummer 8 der Erlanger Literatur-Zeitung vom 11 Januar 1799, erkläre ich hier: dass ich die Wissenschaftslehre von Fichte für ein total unhaltbares System halte. Tatsächlich ist die reine Theorie der Wissenschaft nicht mehr und nicht weniger als die simple Logik, die von ihren Prinzipien her nicht bis zum materialen Element der Erkenntnis reichen kann, sondern insofern sie Logik ist, abstrahiert vom Inhalt dieser Erkenntnis. [Aus dieser Logik] ein reales Objekt extrahieren zu wollen, ist ein so vergebliches Unternehmen, dass es bis zum heutigen Tag noch nicht versucht worden ist. Denn im Falle der Transzendentalphilosophie müsste man sich zuerst bis zu einer Metaphysik erheben [zu einer Ontologie]1 “ 1 Der Sinn dieses Endes des Satzes kann geklärt werden durch die Lehre der Fortschritte über die Beziehungen der Metaphysik und der Tramszendentalphilosophie Was die Metaphysik betrifft, verstanden nach den Prinzipien von Fichte: Ich bin so wenig bereit, dafür die Verantwortung mit zu tragen, wie ich selbst, als Antwort seinem Autor gegenüber, ihm geraten habe, statt sich in sterilen Subtiltäten zu verlieren, sein 177 Buch I: Kritik und System gutes Talent zum Erklären zu pflegen, das er im Rahmen der Kritik der reinen Vernunft nützlich verwenden könnte; aber er hat meinen Vorschlag höflich abgelehnt mit den Worten „dass er trotzdem den scholastischen Blickpunkt nicht verlieren wolle“. So ist der Streitpunkt zu wissen, ob ich die Philosophie von Fichte für einen authentischen Kritizismus halte, von Fichte selbst entschieden worden, ohne dass ich mich über den Wert seiner Philosophie ausdrücken muss; denn es handelt sich hier nicht um [die Geltung des] beurteilten Objekts, sondern [um die Ansicht] des Subjekts, das zu beurteilen ist; unter diesem Gesichtspunkt ist es für mich genug, jede Teilnahme an dieser Philosophie verweigert zu haben. Ich muss hinzufügen, dass ich die unverschämte Behauptung unbegreiflich finde, dass ich nur eine Propädeutik in die Transzendentalphilosophie hätte schreiben wollen, nicht das System selbst dieser Philosophie. Niemals könnte mir eine solche Absicht in den Sinn kommen, da ich selbst aufmerksam machte, dass die totale Vollendung der reinen Philosophie, in der Kritik der reinen Vernunft, das beste Anzeichen für die Wahrheit dieser letzteren wäre. – Schließlich, weil der Autor der Besprechung versichert, dass die Kritik in dem, was sie ausdrücklich bezüglich der Sinnlichkeit behauptet, nicht dem Buchstaben nach zu nehmen ist, sondern dass, um ihn gut zu verstehen, es nötig ist, sich zuerst zum Meister des angemessenen Standpunkts zu machen (dem von Beck oder dem von Fichte) – weil der Buchstabe den Geist tötet im Kantismus nicht weniger als im Aristotelismus: hiervor erkläre ich, noch einmal mehr, dass die Kritik in jedem Fall wörtlich verstanden werden muss und vom einzigen Standpunkt einer allgemeinen Intelligenz, genügend geübt in dieser Art von abstrakten Untersuchungen.1 “. 221 1 Erklärung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre, 7. August 1799 im Intelligenzblatt der A. L. Z., Jena, Nr. 109 (28. VIII, 1799) (Ak, Bd. XII, S. 370-371) Der letzte Absatz der Erklärung – wir sehen davon ab, ihn wiederzugeben – fügt keine lehrhafte Klärung hinzu: die Unterscheidung, die er macht zwischen unbeholfenen und falschen Freunden verdeckt eine unangenehme Insinuation, deren Adressaten man errät. Man hat angezweifelt, dass dieses Stück der Polemik ganz und gar aus der Hand von Kant stammt. Seine Umgebung und ins besondere J. Schulz, wären davon nicht nur die Anstifter sondern die Autoren gewesen. Wir sehen keinen seriösen Grund, in Zweifel zu ziehen, dass Kant auf sich genommen hätte, in Kenntnis der Ursache, die vollständige Verantwortung für Hintergrund und Form seines Protestes – selbst wenn irgendjemand anderes die Feder gehalten hat. Die Gereiztheit des berühmten Alten verbirgt sich kaum. Man versteht 178 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. sie ein wenig, wenn man den respektlosen Bericht überfliegt, den der Schlag zum überlaufen brachte; man kann da zum Beispiel folgendes lesen: „Kant war der erste Professor (Lehrer ) der transzendentalen Philosophie und Reinhold der glückliche Popularisierer der kritischen Lehre; aber der erste wahrhafte Transzendental-Philosoph selbst, das ist unbestreitbar Fichte. Fichte hat den in der Kritik entworfenen Plan verwirklicht, er hat das System des von Kant entworfenen transzendentalen Idealismus vollendet. Infolgedessen wie sehr ist der Wunsch der Öffentlichkeit natürlich, den Gründer der Kritik sich offiziell ausdrücken zu sehen über das Werk seines würdigsten Schülers, des Schöpfers der transzendentalen Philosophie, usw.2 “ 2 Zitiert in Ak, Bd. XIII (Briefwechsel, IV), Anmerkungen S. 542-543 Oder das, was unseren Philosophen besonders empörte: „Seltsame Sache. Der Autor [Buhle], wie die meisten der Kantianer, will durchaus nicht daran glauben an den Gründer der Kritik, denn dieser behauptet, nur eine Propädeutik zur Transzendental Philosophie geschrieben zu haben, nicht das System selbst dieser Philosophie3 “. 222 3 Ebenda S. 546-547 Oder auch noch das: „Die Öffentlichkeit und die studierende Jugend waren zu lange der Tortur ausgesetzt durch die Exegese der Schriften von Kant und die Kantianer haben sich zu lange beschränkt in der Rolle von einfachen Repetitoren der Kritik: Der Beweis ist trotzdem ausführlich gemacht, dass der Buchstabe den Geist tötet, nicht weniger im Kantismus als im Aristotelismus1 “ 1 ebenda S.547. – Man findet in Ak, Bd. XIII S.542-550 noch andere Details über die Umstände, die vorausgingen oder folgten auf die Erklärung gegen Fichte. Das ist vielleicht genug, um die Explosion des lange zurückgehaltenen Unmuts zu verstehen, wenn nicht gar völlig zu entschuldigen. Fichte selbst gab das2 zu2 Vergl. Brief von Fichte an Schelling, 20. IX. 1799 (J. G. Fichte, Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe, herausgegeben von H.Schulz, Leiptig 1930, Bd. II, S.168). Siehe auch einen vorhergehenden Brief (Loc.cit. S.165-166) ohne sich jedoch dagegen zu verteidigen, in diesem Eklat eine berechnende und ganz schön machiavellische Haltung von Seiten Kants und seiner Umgebung zu vermuten, wie sie Schelling3 ihm unterstellte. 3 In einem Brief vom 12. IX. 1799 (Fichtes Briefwechsel, Bd. II, S.158-161) Es ist hier nicht am Platze, uns mit diesen biographischen Nebensächlichkeiten aufzuhalten. Das Ziel unseres Kapitels IV ist erreicht, wenn wir nun eine angenäherte Einschätzung versuchen können von dem, was in den wirklichen oder angeblichen Eigenwilligkeiten der „hyperkritischen“ Philosophen direkt 179 Buch I: Kritik und System 223 zur Kenntnis von Kant kommen und den Verlauf seines Denkens beeinflussen konnte. Fassen wir zusammen: 1. Kant hat nicht irgendeines der Werke vollständig gelesen, in denen sich die originalen Ansichten dieser Philosophen ausdrücken. Er kannte zweifellos besser die viel älteren Einwände von Jacobi (nach 1787) Wenn er sich damit abgefunden hat, auf die Empfehlung von Markus Herz das erste Essay von S. Maimon (1790) zu überfliegen, und wenn er in den paar Briefen, die er von ihm empfangen hat, weiteren Präzisionen begegnet ist, zeigt dafür sein hartnäckiges Schweigen den Fragen und Projekten des scharfsinnigen Essayisten gegenüber genügend, dass er die weiteren Publikationen nicht weiter näher studiert hat. Später zur Zeit seiner begeisterteren Freundschaft mit Reinhöld wusste er auch nicht, wie sich die Anstrengung aufzuerlegen, das wichtige Werk zu verstehen, durch welches dieser Autor die „hyperkritische“ Bewegung einleitete: den Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens (1789). Die Briefe von S. Beck offenbarten Kant dessen persönliche, keineswegs banalen, wenig zahlreichen und sehr festgefahrenen Ideen. Diese neue Methode ein vertrautes Problem zu lösen, hat nicht verfehlt seinen Geist zu beeindrucken. Es ist weniger wichtig für uns zu wissen, in welchem Maße der Text des Einzig möglicher Standpunkt (1796) und des Grundriss der kritischen Philosophie (1796) unter seinen Augen durchging. Das literarische Problem, das wir untersuchen, ist von größerer Bedeutung in dem, was Fichte betrifft. Dieser bietet zur Würdigung an, Schlag auf Schlag, seine ersten Publikationen über die Wissenschaftslehre (1794 und folgende), aber ohne die Vorsichtsmaßnahme zu ergreifen, gleichzeitig durch einen Brief, die wesentliche Idee zu erklären. Letztendlich konnte Kant von ihm die Rezension des Enesidem lesen, gesteht aber, dass er das wichtigste Stück, die Grundlage der Wissenschaftslehre (1794) nicht gelesen hat; wenn er versucht hätte, 1794 den Begriff der Wissenschaftslehre überhaupt zu verstehen, wäre er weniger aus der Fassung gebracht worden durch die Rezension der ersten Werke von Fichte in der Allgemeinen Literaturzeitung 17981 1 Siehe weiter oben S.218-219 2 Vielleicht, wie Fichte glaubt, 2 Vergl. Ak. Bd. XIII S. 546 hat er wirklich die Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre (1797) überflogen, wo die hauptsächlichen Mängel der Kritik aufgezählt sind, für die die Wissenschaftslehre Abhilfe schaffen soll. Das ist alles; und es ist wenig: dennoch genug, um einen korrekten allgemeinen Einblick zu nehmen in das Ziel und die Methode von Fichte, wenn nicht von seinem System. Unglückseliger 180 Kapitel 4: Am letzten Wendepunkt des kantschen Idealismus. 224 Weise hat Kant, nach seinem eigenen Eingeständnis nicht viel verstanden von der Rezension der Allgemeinen Literaturzeitung; und nichts deutet darauf hin, dass er mittels der Zweiten Einleitung, obwohl sie sehr interessant ist, das erraten konnte, was diese unangebrachte und „phantomale“ Wissenschaftslehre schließlich sein konnte 2. Dass die Einheit seiner Philosophie schärfer und enger gemacht werden könnte, wusste Kant so gut wie seine Kritiker: er selbst hat sich seit langem mit dieser Aufgabe befasst. Ohne Zweifel war er angespornt, nicht weniger als belästigt, durch die Einwände und die Ermahnungen von außen. Er hatte hingenommen neben der aufsteigenden „transzendentalen Deduktion“, die für ihn den Vorzug behielt, eine absteigende Deduktion der konstitutiven Bedingungen des Objekts, – wie sie Beck wollte – jedoch nur, wenn sie bis zur a priorischen Forderung einer empirischen Intuition durchgeführt wurde, Über die Natur der empirischen Daten zeigte er sich zurückhaltend. Was das Band der Einheit der zwei Vernünfte betrifft, der theoretischen und der praktischen, scheint Kant das Interesse nicht bemerkt zu haben, weder aus den Ansichten Reinholds noch aus denen Fichtes. Das ist um so mehr zu bedauern, als er selbst einen Schritt in diese Richtung gemacht hat, indem er den Primat der moralischen Freiheit proklamierte. 3. Unter den Einwänden seiner Gegner und seiner „hyperkritischen“ Freunde war eine einzige – die er seit langem kannte aber nicht freiwillig direkt zur Sprache brachte – und sie begegnet bei ihm einem verlegenen aber hartnäckigen Widerspruch: die angebliche Unmöglichkeit des „Dings an sich“. Die Existenz des „Dings an sich“ hat nie aufgehört für ihn unlösbar verbunden zu sein mit der kritischen Theorie der Sinnlichkeit als rezeptive Fähigkeit des rohen Gegebenen: „Dinge an sich“, passive „Affektion“ des Subjekts, „sinnenhafte Rezeptivität“, „reine Intuition der Sinneshaftigkeit“, „Begriffe a priori“ sind in seinen Augen so eng zusammenhängend, dass man keinen dieser Terme opfert, ohne die ganze Reihe zu ruinieren. Siehe da, das was er behauptet, einzubläuen wenn er fordert, in der Erklärung gegen Fichte eine „buchstäbliche3 “ Interpretation der Teile der Kritik, die sich mit der Sinneswahrnehmung befassen. 3 225 „"Nach den Buchstaben’ (Ak. Bd. XII, S.371) Wird er selbst der Vorschrift treu bleiben, die er seinen Schülern aufzwingen möchte? 181 Buch II: Das „Opus postumum“ 227 Kapitel 1: Vorbemerkungen Der unvollendete Bericht über Die Fortschritte der Metaphysik seit LeibnizWolff hat uns den Zustand der kantschen Epistemologie um 1793 gezeigt1 . 1 Siehe oben, S. 165-179 Die seit diesem Datum bis zum Tod des Philosophen (1804) veröffentlichten Werke sind nicht direkt von Interesse für den Gegenstand unserer Untersuchung. Im Übrigen gehört nur eines wirklich zum „System der reinen Vernunft“: die Metaphysik der Sitten 2 . 2 Metaphysik der Sitten, deren zwei Teile: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, und Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre erschienen 1797 Aber der epistemologische Gesichtspunkt darin geht in nichts hinaus über den der zweiten und dritten Kritik. Wir analysieren auch nicht das wichtige Werkchen über die Religion in den Grenzen der Vernunft3 . 3 228 Die Religion innerhalb den Grenzen der blossen Vernunft, 1793; 2.Aufl. 1794 Außerhalb des konstitutiven Rahmens der transzendentalen Philosophie gelegen, wendet es die schon woanders formulierten kritischen Prinzipien an, ohne sie weiter zu vertiefen. Außer einigen gelegentlichen, von unserem Thema noch weiter abgelegenen Arbeiten (zum Beispiel: Zum ewigen Frieden 1795; Der Streit der Fakultäten, 1798, usw.) gelang es Kant noch während der letzten Jahre des Jahrhunderts mehrere seiner Kurse erscheinen zu lassen, die Manuskripte geblieben waren. Er unternahm selbst die Veröffentlichung der Anthropologie 4 . 4 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798 Schülern und Freunden vertraute er die Herausgabe anderer Kurse an: seiner Logik, veröffentlicht von Jäsche 1800, seiner physikalischen Geographie, veröffentlicht von Rink 18025 . 5 Seine Vorlesungen über die Metaphysik (nach dem Handbuch von Baumgarten) wurden erst 1831 von Pälitz dem Druck übergeben. Wenn man diese Daten in Verbindung bringt mit dem Datum seines Todes am 12 Februar 1804 in seinem achtzigsten Lebensjahr hat man eine gewisse Idee der für dieses Alter keineswegs banalen intellektuellen Aktivität, die er sich bewahrte noch am Anfang des Jahres 1800. Aber dann beschleunigte sich das, schon seit drei oder vier Jahren spürbare, Nachlassen seiner physischen 183 Buch II: Das „Opus postumum“ Kräfte. Wir werden feststellen, dass das forschende Bemühen seines Denkens, erschwert freilich mehr und mehr durch die Last des Alters und der Krankheiten, seine Spannung nicht verlor bis in die allerletzten Monate seines Lebens1 . 1 Über das Privatleben und über den Gesundheitszustand von Kant während dieser Periode sind wir unterrichtet durch unmittelbare Zeugen. Man findet diese Einzelheiten in allen guten Biographien des Philosophen. 2 Es ist 1795 , wo man der ersten Erwähnung eines Werkes begegnet, 2 Alle historischen Informationen über die Redaktion und das weitere Schicksal des Manuskripts des O.P. (wir verwenden im Folgenden diese Abkürzung) sind zusammengestellt entweder bei Adickes (Kants O.P. dargestellt und beurteilt, Berlin, 1820, S.1-35), oder in der Einleitung von G. Lehmann zur Ausgabe des O.P. durch die Akademie von Berlin (Ak., Bd.XXI-XXII, S.751-789) das von Kant seit mehreren Jahren geplant war, und dazu bestimmt war, „Den Übergang von den ersten Fundamenten der Metaphysik der Natur zur Physik“ zu erklären (Übergang von den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik )3 3 229 Kiesewetter an Kant, 8.VI.1795. Ak, Bd. XII (Briefwechsel, III2), S.257 4 Drei Jahre später beklagt der Philosoph Garve gegenüber „Tantalus Qualen“ zu erleiden wegen des Zustands der Unfertigkeit seines Werkes. Trotzdem gibt er die Hoffnung nicht auf, damit zu Ende zu kommen. Seine Arbeit konzentriert sich im Augenblick auf den Übergang ... zur Physik, dessen Fehlen „eine Lücke im System der kritischen Philosophie5 “ lassen würde. 4 Kant an Garve, 21.IX.1798. Ak. Bd.XII (III2) S.257 5 Ebenda Kiesewetter vertraut er am 19. Oktober 1798 seine Absicht an, die kleine Summe der Kräfte, die ihm noch bleibt, dazu zu verwenden, einer Arbeit auf die Füße zu helfen, die sein kritisches Werk krönen soll, indem er eine letzte Lücke darin ausfüllt, des heißt den Übergang 7 . 6 Ak. Bd.XII, S.258 Da die Metaphysik der Sitten in diesem selben Jahr erschienen war, war das alte Programm von Kant fast ganz realisiert. Das hier angekündigte Ziel scheint nur noch den Übergang im eingeschränkten Sinn zu betreffen, nicht die Gesamtheit des O.P. 7 Er spricht gelegentlich mit seinen Besuchern über das Manuskript in Arbeit. In den letzten Jahren schwanken seine vertraulichen Mitteilungen (die sich, so scheint es, erstrecken über einen erweiterten Übergang), vom optimistischsten Urvertrauen in die Vollendung eines Werks, das, so sagt er, „sein Hauptwerk“ sein wird, bis zum über seine vielleicht definitive Unfähigkeit entmutigten Ausdruck, seine Idee zu verwirklichen. In diesen dunklen Augenblicken wünscht er sogar, dass nach seinem Tod das Manuskript verbrannt würde. Tatsächlich, wenn das Manuskript, im Zustand einer unvollendeten und sehr unausgeglichenen Skizze geblieben, nicht zur Vernichtung bestimmt worden ist, wurde es auch nicht von den Freunden des Verstorbenen für geeignet gehalten, veröffentlicht zu werden. So beginnt die lange und dramatische Geschichte eines Ensembles von großen Blättern, handschriftlich oder abgeschrieben, denen man den Namen „Üpus postumum“ gegeben hat. Sie sind aufgeteilt in dreizehn Bündeln (“XIII Convoluta“), in die einige getrennte Notizen eingefügt bleiben 184 Kapitel 1: Vorbemerkungen 230 (einige lose Blätter). Das ganze, zuerst den Erben von Kant übergeben, fand sich 1805 in den Händen von einem von ihnen, Christian Schoen, der sich einem Polemiker gegenüber öffentlich rechtfertigen musste, ein wichtiges Werk des verstorbenen Professors von Königsberg für sich zu behalten. Die Notiz der Rechtfertigung – ungefähr zwei Seiten in Oktavformat – von Schoen veröffentlicht, enthalten die erste summarische Beschreibung des Manuskripts und den ersten präzisen, aber extrem kurzen Hinweis auf seinen Inhalt. Danach entsteht das Schweigen bis 1854, wo die vergessene Schrift während einiger Stunden am Ende des Gutachtens unter die Augen des Biographen von Kant, F.W.Schubert gelangte. Es war zu wenig, um ein festes und vollständiges Urteil zu formulieren, trotzdem genügend, um das Interesse festzustellen, das dieser allzu-sehr verachtete Wust von Papier bieten könnte. Weder die befürwortende Erklärung von Schubert, noch eine andere, ähnliche, aufgenommen von R. Hayn in seine Preussische Jahrbücher scheinen die (öffentliche) Meinung erregt zu haben. Erst zehn Jahre später erhielt Rudolf Reicke von den Rechte-Inhabern, mit dem exakten Inventar der mysteriösen unveröffentlichten Werke die Autorisierung, sie zu publizieren. Er druckte sofort das Inventar in der Altpreussischen Monatsschrift (1863, Bd. I), begann aber die Publikation der Texte erst 1882 (Altpreus. Monatsschrift Bd. XIX). Er hatte sich der (anonymen) Kollaboration von E. Arnoldt versichert, der später die wenig befriedigende Art zu erkennen gab, in der diese Herausgabe erfolgt war, die andererseits unvollständig war1 . So oder so, sie stellte trotzdem bis 1936-1938 die einzige gedruckte Text Quelle dar, auf die sich die stützen mussten, die das Opus postumum untersuchten. 1 Sie umfasst in den Altpreussische Monatsschrift, die folgenden Seiten: Bd. XIX, 1882, S.69-127 (Konvolut XII), 256-308 (Konvolut X-XI), 425-479 (Konvolut X-XI), 569-629 (Konvolut X-XI); – Bd. XX, 1883 S.60-122, 344-373, 415-450 (Konvolut IX), 513-566 (Konvolut III); – Bd. XXI, 1884, S.81-159 (Konvolut V), 310-387 (Konvolut I), 380-420 (Konvolut I), 534-620 (Konvolut VII). Tatsächlich die einzige Textquelle. Denn man kann diesen Namen den Veröffentlichungen des Pastors Albert Krause2 nicht geben, trotz der aktiven Rolle, die ihm in der Erneuerung des Interesses zukommt, von dem der Übergang gegen das Ende des XIX-ten Jahrhunderts profitierte. 2 Alb. Krause, Imm. Kant wider Kuno Fischer, Lahr, 1884; Das nachgelassene Werk Im. Kants: Vom Übergange... populärwissenschaftlich dargestellt, Frankfurt am Main und Lahr, 1888; Die letzten Gedanken Imm. Kants. Der Transzendentalphilosophie höchster Standpunkt: Von Gott, der Welt u. dem Menschen, welcher beide verbindet, Hamburg 1902. 231 Krause, der beherzt diese „letzten Gedanken“ (“die letzten Gedanken I. Kants“) eines großen Philosophen gegen die herabsetzenden Beurteilungen von Kuno Fischer verteidigt hatte, bedauerte das Fehlen einer geschickten, absolut treuen Ausgabe des Manuskripts. Obwohl er sie sich besorgen konnte, hatte er die unpassende Idee, statt sie zu publizieren, so wie sie war, aufgeteilt in Konvolute, daraus durch Vermutung diejenige systematische Anordnung zu rekonstruieren, von der er vermutete, dass sie dem Plan Kants entspricht. Wenn er so einige Texte aufzeigt, die bei Reicke fehlen, und wenn er einige andere 185 Buch II: Das „Opus postumum“ 232 berichtigt, zwang hingegen sein allzu subjektives Prinzip der Reorganisation der Fragmente nur eine Auswahl von Auszügen beizubehalten, Dubletten zu opfern und die unzähligen (oft signifikanten) Varianten zu vernachlässigen, die von Kant selbst in seinen vielfältigen Versuchen der Redaktion gewisser Passagen eingeführt wurden. Die Darlegungen von Krause, belastet mit zu vielen anfechtbaren Elementen, fanden wenig Zustimmung. Um das Opus postumum also wirklich bekannt zu machen, war es nötig, dass 1916 E. Adickes – ein guter Kenner der handschriflichen Notizen Kants – autorisiert wurde, das Manuskript sorgfältig zu prüfen. Im kurzen Zeitraum von vier Wochen, stellte er mal aus gewissen Anzeichen, mal durch Wahrscheinlichkeitsvermutungen die Chronologie des Inhalts der verschiedenen Konvolute fest. Die kostbaren Resultate dieser Untersuchung begleitet von einer detaillierten Erklärung und einer kritischen Analyse des ganzen Übergangs füllen den dicken Band (XX-855 Seiten in Oktav), 1920 unter dem Titel: Kants Opus postumum, dargestellt und beurteilt (Berlin, 1920). Diese Arbeit von Adickes ist grundlegend und bleibt zweifellos unentbehrlich für das Studium der höchsten Phase des kantschen Idealismus. Man muss dennoch zugeben – das Gegenteil wäre sehr seltsam gewesen – dass die lehrhaften Interpretationen des Denkens von Kant darin in einem gewissen Maße beeinflusst sind durch die persönlichen Ansichten des Kommentators und folglich der Diskussion unterworfen sind, trotz ihrer Wahrscheinlichkeit. Alles zusammengenommen konnte diese so vollständige Monographie mit ihren überreichlichen rechtfertigenden Auszügen (am häufigsten zitiert nach Reicke) nicht die Stelle des originalen Textes vertreten, von dem Adickes selbst eine vollständige, streng exakte Ausgabe forderte. Es schien, dass diese Gesamt-Ausgabe normalerweise stattfinden musste in Kant’s gesammelten Schriften der Akademie von Berlin. Man war lange darüber verwundert, dass man sie nicht auf dem Programm der imposanten Kollektion aufgeführt fand. Die Ursachen für diese offensichtliche Ächtung interessieren uns kaum noch, jetzt wo die Bände XXI (1936) und XXII (1938) der berliner Ausgabe (Band VIII und IX des „Handschriftlichen Nachlasses“) jeweils die Bündel oder „Konvolute“ I bis VI und VII bis XIII des Opus postumum1 beherbergen. 1 Ihre Veröffentlichung wurde gemacht durch A. Buchenau nach den gewohnten philosophischen Regeln. Der Band XXII wurde bereichert, von Gerhard Lehmann, mit einer exzellenten alphabetischen Tabelle des Inhalts, die in einzigartiger Weise in der Zukunft die Suche und Verifikation im O.P erleichtern wird.: Wir bedauern, dass wir sie erst sehr spät zu unserer Verfügung gehabt haben. Niemand, so glauben wir, wird nunmehr die historische Bedeutung dieses unvollendeten Werkes in Zweifel ziehen. Es ist nicht mehr zulässig, davon wie von einem einfachen wirren Durcheinander von senilen Hirngespinsten zu sprechen. Bis in die letzten Blätter bezeugen viele durchdringende Reflexionen von einer noch intakten Fähigkeit der Unterscheidung. Um die Wahrheit zu sagen, 186 Kapitel II: Was „der Übergang“ ist 233 das was mehr und mehr fehlt, in dem Maße wie der Greis sich seinem Ende nähert, ist die erforderliche zerebrale Energie für das Durchhalten bei der Anstrengung einer längeren Synthese. Man wird andererseits diesbezüglich die Teile des Manuskripts, die vor 1800 redigiert wurden von denen unterscheiden, die aus den folgenden Jahren datieren. Die ersteren (1796-1799) bleiben zuerst vergleichbar in allen Punkten mit den vorausgehenden Werken des Philosophen. Dennoch verraten sie bald, durch die dauernden Wiederaufnahmen von identischen Themen, eine wachsende Ohnmacht der Komposition. Die zweiten (1800-1803) zeigen mehr die Spuren einer senilen Debilität, die das Denken erschwerten, ohne es zu verfälschen. Und selbst dann muss man sich darüber verwundern, dass es Kant gelungen ist, auf seine alten Tage in einer erweiterten Sicht die umfassendsten und schwierigsten Themen der Metaphysik in Angriff nehmend, mit Prägnanz in der genauen Fortsetzung seiner kritischen Ansichten, die großen Linien zumindest seiner eigenen Lösung für das gesamte Problem der Philosophie1 deutlich zu machen. 1 Das spezielle Ziel unserer Hefte erlaubt uns, unsere Aufmerksamkeit auf die Abschnitte des O. P. zu konzentrieren, welche die fundamentalen Probleme der Epistemologie eingehender behandelt haben. Das sind, entsprechend der chronologischen Ordnung von Adickes: In den Konvoluten X und XI (August 1799 bis April 1800), die auf Seite 295-409, 453-539, 425-452 der Ak. Bd. XXII reproduzierten Teile; – in den Konvoluten VII und X (April 1800 bis ungefähr Dezember 1800) die auf Seite 3-101, 101-131, 409-421 der Ak. Bd.XXII reproduzierten Teile; – im Konvolut I (Dezember 1800 bis Februar 1803), die auf Seite 9-139, 139-155, 155-158, 3-9 der Ak., Bd. XXI reproduzierten Fragmente 234 Nach einem summarischen Überblick über des Objekt und die wesentlichen Linien des Übergangs, wollen wir uns speziell mit einigen neuen Aspekten beschäftigen, die in den höchsten Seiten Kants seine kritische Epistemologie und sein System des transzendentalen Idealismus darstellen2 . 2 Der originale Text von Kant zeigt im Inneren der Sätze keine Andeutungen von Zeichensetzung. Für die Zeichen, dir wir in der Übersetzung der Stellen setzen, gelegentlich voller Schwierigkeiten, gilt dasselbe, was für unsere Interpretation selbst gelten kann. – Die hervorgehobenen Worte sind im Original hervorgehoben, ausgenommen bei ausdrücklicher Angabe des Gegenteils. – Die Klammern sind von Kant selbst. Die Ausrufezeichen in eckigen Klammern stammen von uns. – Außer den Abkürzungen, die schon im Vorausgehenden benutzt wurden (siehe Seite 7) erlauben wir uns die folgenden Abkürzungen: O.P. (Opus postumum); Konv. (Konvolut, Bündel); – N.W. (Naturwissenschaft); M. A. N. W. (Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft); – Tr.Ph. (Transzendentalphilosophie) Kapitel II: Was „der Übergang“ ist 235 §1.– Seine allgemeine Formulierung Nach der Kritik der reinen Vernunft können die Urteile der Erfahrung die logischen Eigenschaften der Universalität und der Notwendigkeit nur annehmen kraft synthetischer Prinzipien a priori. Nun aber gehören diese Eigenschaften nach Kant nicht nur zu den allgemeinen Gesetzen, die jeder Erfahrung gleichsam den Vorsitz führend vorgegeben sind, sondern zu den partikulären 187 Buch II: Das „Opus postumum“ 236 einzelnen Gesetzen, die die konkreten Erfahrungen, sie unmittelbar zwingend, umschließen, das heißt zu den Gesetzen der (newtonschen) Physik. Selbst die Physik, insofern sie „Wissenschaft“ ist, beruht so auf der apriorischen Armatur des Geistes. Um komplett zu sein, muss ein System der Erkenntnis also zeigen, wie das höchste Apriori des Bewusstseins, die apperzeptive Einheit, die materielle Vielfalt des empirischen Wissens verknüpfen und sie so in ein Gesetz reduzieren kann . Ein Teil dieser Aufgabe ist in der Kritik der reinen Vernunft (A 1781, B 1787) durch die „Deduktion der Kategorien“ und durch die Theorie des „Schematismus“ durchgeführt: Das Spiel der Vorstellungskraft beim Aufbau unserer konkreten Repräsentationen (Vorstellungen) erscheint dort a priori durch die transzendentale Aktivität des Verstandes in Gang gesetzt. Den allgemeinen Moden der Präsentation der räumlichen Daten in der Zeit („transzendentale Schemata“) entspricht kraft einer vorausliegenden Notwendigkeit die Anwendung von eben so vielen Kategorien. Aber es ist leicht zu sehen, dass die zwölf Formen – oder Gesetze – der transzendentalen Schematisierung, das ganze Feld der mathematischen und physikalischen Gesetze undifferenziert (unterschiedslos) lässt, das heißt sie noch nicht genügend bestimmt. In gewisser Hinsicht engt die Kritik der Urteilskraft (1790) die Mannigfaltigkeit der physikalischen Erfahrung stärker ein. Ausgehend von den schon bekannten Sinnes-Objekten, lässt sie auf der Ebene des „reflektierenden Urteils“ die Forderung eines durch Gattungen und Arten nach den Gesetzen der Finalität geordneten Universums auftauchen. Aber diese hypothetische Konstruktion überlagert sich der erworbenen Erfahrung, der konkreten Erfahrung, ohne dabei, wäre es auch nur hypothetisch, die innerlich konstitutiven Prinzipien zu durchdringen, lässt sie uns nur erahnen, wie die fraktionäre Erfahrung abzielen kann auf ihre vollkommene Integration (Eingliederung), ohne uns zuvor beizubringen, wie die Erfahrung überhaupt möglich ist1 1 In Wirklichkeit, in einer vollendeten Metaphysik wären die Bedingungen der vollkommenen Integration und die der ersten Konstitution korrelativ (siehe Heft V); aber die Kritik der Urteilskraft, so kühn sie auch ist, geht trotzdem nicht so weit, diese, obwohl erahnte, Korrelation zu beweisen. Um die Gesetze der Physik zu erreichen, die die konkrete Erfahrung erklären, bot sich Kant ein direkterer Weg an. Er hat sich damit seit 1786 beschäftigt in den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft. Und er glaubte damals sogar einen Moment, die Hierarchie der transzendentalen Bedingungen erschöpft zu haben, die aus der Physik eine „Wissenschaft“ im eigentlichen Sinn1 machen. 1 M.A,N.W. – Ak. Bd. IV S.473 Eine Lücke blieb dennoch bestehen, deren Existenz er bald feststellte. Von den M. A, N. W. zur Physik blieb ein letzter Schritt zu überwinden. Und dieser „Übergang“ verlangte, vom kritischen Gesichtspunkt aus eine volle rationale Rechtfertigung. Was stellte exakt in den Augen Kants der Terminus a quo und der Terminus 188 Kapitel II: Was „der Übergang“ ist ad quem dieses Übergangs dar? §2.–Der Terminus a quo: die „Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft“ 237 Dieser Terminus a quo bestand in den Schlussfolgerungen der M.A.N.W. Die allgemeine Wissenschaft der Natur, reine apodiktische Wissenschaft, deren Prinzipien auf die Kritik der reinen Vernunft zurückgehen, bringt ebensoviele sekundäre Wissenschaften hervor, wie Objektklassen in der Natur im allgemeinen abgegrenzt werden können. Wenn man zum Beispiel adäquat die natürlichen Objekte in (ausgedehnte) Körper und (unausgedehnte) Geister aufteilt, wird man fortfahren können, im Inneren jedes Glieds dieser Aufteilung, die apodiktische Deduktion der Bedingungen der Erfahrung und so neue Wissenschaften zu konstruieren, jede rein in ihrer Linie: eine „Wissenschaft der denkenden Natur“ und eine „Wissenschaft der körperlichen Natur2 . 2 M.A.N.W. – Vorrede. Ak, Bd. IV, S.467 ff. Knüpfen wir an an dieser letzteren Wissenschaft, die die eigentliche Physik ankündigt. Die „Wissenschaft der körperlichen Natur“ hat als eigentliches Objekt die (sinnliche) „Materie“. Das Ziel der M.A.N.W. war es, systematisch die Bestimmungen zu erklären, die a priori der Begriff der Materie verlangt. Nun aber „definiert sich die Materie als das, was im Raum3 beweglich ist“: 3 M.A.N.W. – Ak. Bd. IV S. 480. – Das O.P. bezieht sich ausdrücklich auf diese Definition, entnommen aus M.A.N.W. siehe Ak, Bd. XXII S.513 nicht nur „das, was räumlich ist“, sondern das im Raum, was unsere Sinne „affiziert“ entsprechend der Unterschiede der Zeit und so diese konkrete Synthese der Zeit und des Raumes realisiert, die man Bewegung nennt4 . Was kann man a priori wissen vom „sich räumlich Bewegenden“, das heißt von der Materie? 4 M.A.N.W. S. 476 – „Materia ist das, was den Raum zum Gegenstand der Sinne macht ... (die Definition, dass sie das Bewegliche im Raum sei, ist die Folge davon)“, wird das O.P. wiederholen (Ak. Bd.XXII S.535) 238 Um eine vollständige Liste der Prädikate a priori der Materie aufzustellen, untersucht Kant das, was der Begriff „beweglich im Raum“ bezeichnet, wenn man diesen Begriff sukzessiv mit den vier Gruppen der Kategorien konfrontiert: Die Kategorien der „Quantität“ offenbaren auf diese Weise die elementaren Gesetze einer reinen „Phoronomie“ (Kinematik), wo die Bewegung nur dargestellt ist durch die Beziehungen des Abstands1 . 1 M.A.N.W. S.477 und 484 Die Kategorien der „Qualität“ lassen die dynamische Bedingung hervortreten, die allein die Belegung des Raumes durch „Bewegliches“ konzipierbar macht, nämlich „die bewegende Kraft2 “; 2 M.A.N.W S.477 und 496 ff. Die Kategorien der „Relation“ regulieren die notwendigen Beziehungen, die 189 Buch II: Das „Opus postumum“ in der Einheit des Raumes die dynamischen materiellen Elemente untereinander eingehen, und sie setzen so die fundamentalen Prinzipien der „Mechanik3 “; 3 M.A.N.W. S.477 und 536 ff. Schließlich zeigen die Kategorien der „Modalität“ in der materiellen Bewegung etwas wesentlich Relatives, auf unsere sinnlichen Vorstellungen Bezogenes: Die Wissenschaft der „räumlichen Bewegung“ kann nur eine Phänomenologie der Bewegung4 sein. 4 M.A.N.W. S.477 und 554 f. Durch die Idee der Bewegung im Raum führen die M.A.N.W. also bis zur Idee der gewissen allgemeinen Axiomen unterworfenen „bewegenden Kräfte“. Aber die weiteren Spezifikationen dieser bewegenden Kräfte, in Beziehung zu den elementaren in der Physik erforschten Phänomenen, sind noch gar nicht deduziert in einer vollständigen und systematischen Weise. Es bleibt ein Stück des zu durchlaufenden Wegs, um den Terminus ad quem des Übergangs zu erreichen. Was verstand Kant eigentlich unter diesem Terminus ad quem, der „Physik“? §3.–Der Terminus ad quem; die Physik Davon siehe da im O.P. eine der am besten passenden Definitionen: „Die Physik ist eine systematische Erforschung der Natur durch empirisch gegebene materielle Kräfte, soweit diese Kräfte untereinander verbunden sind in der Einheit eines Systems5 .“ 5 O.P. Konvolut X, Ak Bd. XXII S.298 Das Wort „System“ muss unterstrichen werden: „Da, so erklärt man uns, die Physik ein System ist, und da wir ein System dafür nicht erkennen können, es sei denn in dem Maße, in dem wir selbst, nach apriorischem Prinzip die Gruppierung agregierter (verfestigter, zusammengefasster?) Elemente da einfügen – das was wir hier machten ausgehend vom Begriff der Bewegung – ist es nötig, dass die [strukturale] Aufteilung der Physik als Wissenschaft als höhere Etage einen Topos von bewegenden Kräften habe, analytisch abgeleitet in der Perspektive des zu errichtenden Systems [?]6 “ 239 6 O.P.ebenda S.299 – „... nach folgendem System:“: diese letzteren Worte der zitierten Stelle scheinen uns nach dieser Interpretation zu verlangen, entsprechend einer authentisch kantschen Idee, die anderswo wiederkehrt; anderen Falles könnte der Term „folgendem“ nur die unmittelbare Folge des Textes bezeichnen, das heißt eine vierteilige Aufzählung von materiellen Objekten, kaum geeignet, als „System“ qualifiziert zu werden. 190 Kapitel III: Prinzip und wesentliche Linien des „Übergangs“ 240 Aus diesem Text, der seine Erklärung in den folgenden Seiten findet, halten wir vor allem fest, dass eine Wissenschaft vom Übergang ... zur Physik möglich sein wird, wenn man a priori einen „Topos von bewegenden Kräften“ beweisen kann. Kapitel III: Prinzip und wesentliche Linien des „Übergangs“ 241 „Mit dem elementaren System der bewegenden Kräfte der Materie ist uns der Schlüssel geliefert, sagt Kant, der den Zugang gibt zum Übergang von den M.A.N.W. zur Physik: das heißt, dass dieser Übergang nicht empirisch vor sich geht, ausgehend von der Erfahrung, sondern a priori, ausgerichtet auf die Erfahrung; mit anderen Worten: dass der Verstand die Vielheit der Phänomene organisiert zu einer Physik, zu einem theoretischen System von elementaren Kräften, nicht durch bruchstückhafte Gruppierung der Phänomene sondern durch begriffliche Reduktion von diesen auf eine Einheit eines Ganzen, dem Werk des Verstandes selbst: indem er sie also reduziert auf ein Prinzip [a priori] der Erfahrung1 “ 1 242 O.P. KONVOLUT X, Ak Bd.XXII, S.393-394 An dieser Stelle und an mehreren anderen will Kant vor allem die methodologische Haltung einprägen, die das gestellte Problem verlangt. Durch einfache Induktion, ausgehend von der konkreten Erfahrung, erhält man nie universelle und notwendige Gesetze. Eine Physik als „Wissenschaft“ verlangt also, um möglich zu sein, dass man aufsteigt zu der Erfahrung voraus liegenden subjektiven Bedingungen, welche die Form dieser Erfahrung im Voraus bestimmen. Wenn es wirkliche physikalische Gesetze gibt, müssen sie die notwendigen Moden einer a priori ausgeübten Aktivität in der elementaren Wahrnehmung ausdrücken, „mit dem Ziel, die Erfahrung möglich zu machen“. „Die Wahrnehmungen sind Handlungen, die das Subjekt an sich selbst vollzieht, insofern dieses Subjekt Aggregat der Phänomene ist. Der Übergang zur Physik bewirkt sich durch Verbindung der Vielfalt in der empirischen Vorstellung [das heißt, von der Verschiedenheit der Wahrnehmungen] im Hinblick darauf, die Erfahrung möglich zu machen (zum Behuf der Möglichkeit der Erfahrung). Es handelt sich um eine Erfahrung, die, der Definition nach, nur eine und einzige sein kann und folglich nach dem Prinzip der Identität a priori das ganze Formartige des Systems einschließt, das sie konstituiert. Keine empirische Erkenntnis kann sich ursprünglich 191 Buch II: Das „Opus postumum“ herleiten von einer schon gemachten Erfahrung; die empirische Erkenntnis muss, im Gegenteil im Voraus durch die Möglichkeit der Erfahrung selbst geregelt werden, die aus dieser Erkenntnis hervorgeht; soweit wenigstens die Erfahrung nicht einfach gegeben ist sondern nach den Regeln des Prinzips einer Synthese a priori1 “ konstruiert = gemacht ist. 1 O. P. Konv.X S.3951−13 Wir sehen in einem neuen Kontext eines der logischen Postulate der transzendentalen Deduktion der Kategorien2 wieder auftauchen: 2 Siehe Heft III, 1.Aufl. S.88, 106, 126 (wichtige Fußnote), 135-138 3.Aufl. S.161, Anmerkung und S. 172-174 ein Postulat, das sich noch ausführlicher behauptet hat nach der Ära der Kritiken: zum Beispiel in der Theorie der Zusammensetzung, die die Fortschritte andeuteten. Nennen wir es, wie wir es weiter oben getan haben, „Prinzip der Konstruktivität“. Kraft dieses Prinzips müssen alle im Bewusstsein analytisch erkannten und in ein „System“ gruppierten Elemente zu diesem Zweck durch eine vorausgehende synthetische Aktivität organisiert sein: Die Form, unter der sie schließlich erscheinen als Teile des Systems, hat also die Geltung eines „synthetischen Apriori“. Das, wir wissen es schon seit langer Zeit; aber das O.P., auch wenn es nichts zur virtuellen Tragweite des Prinzips der Konstruktivität hinzufügt, treibt die Anwendung auf die Physik weiter mit einer neuen Kühnheit, die vor keiner Konsequenz zurückschreckt. Die Physik, elementares System der Erfahrung, will hier nur Formartiges erkennen; nun aber geht das Formartige dem Sein des Dings voraus und bestimmt es logisch: „Forma dat esse rei“, wiederholt Kant nach dem Vorbild der 3 Scholastiker . 3 243 Er spricht hier nicht von Dingen an sich sondern von diesen objektiven Phänomenen, die in der Physik die Rolle der „Dinge“ spielen: „Die Erscheinungen sind hier als Sachen an sich selbst zu betrachten“ O.P. Konvolut X, Ak. Bd. XXII S.31927−28 Es gibt da noch mehr. Die Terme und inneren Relationen eines Systems sind nicht nur Formen der Repräsentation (Vorstellung), sondern repräsentierte Formen als Formen, das heißt abstrahiert von der Pluralität (wenigstens potenziell) ihrer „Inferiora (= den Einzelnen dieser Form-Klasse),“ und folglich ihnen im Bewusstsein als ihre synthetische Einheit entgegengesetzt; sie fallen also unter das Gesetz des Prinzips der Konstruktivität4 . Die Abstraktion der Form ist ein „Wiedererkennen“ (Anerkennung) des Apriori. 4 Zum Beispiel:“Das Formale dieser Verbindung [das heißt der konstitutiven Relationen der Erfahrung] geht a priori vorher (forma dat esse rei) um eine Physik zu begründen, d.i. wir können nichts aus ihr herausholen, als was wir in sie hineingelegt haben, weil das Objekt der Physik – das All der bewegenden Kräfte der Natur – nur als in einem System (in der Natur) gegeben vorgestellt werden muss“ (O.P. Konv. X Ak, Bd. XXII S.30613−17 ). Die Physik als System muss also „mit dem Formalen der Erfahrung überhaupt zusammenstimmen; mithin [muss] ein formales Prinzip dieser Zusammensetzung zu einem System a priori zu Grunde liegen“ (ebenda S.3099−12 . vergl. ebenda S.308-309, S.3132027 , S.31924−28 , S.41620−25 , usw.) 192 Kapitel III: Prinzip und wesentliche Linien des „Übergangs“ Was ist dazu zu sagen? Fordern alle formartigen Elemente, die wir in der konkreten Erfahrung unterscheiden – Relationen von Raum und von Dauer und auch physikalische Qualitäten wie die Farbe, der Ton, die Wärme – einen subjektiven Ursprung a priori? Sicherlich; das kantsche Prinzip verlangt es, da die der Form als Form eigentümliche Funktion einer „synthetischen Einheit“ nur durch das Subjekt selbst wahrnehmbar ist, das sie vollzieht1 . Es handelt sich hier wohl im Denken von Kant um alle Bestimmungen, die sich als „Formen“ vom sinnlichen Inhalt der Erkenntnis ablösen: 1 In einer der zahlreichen Erinnerungen an dieses Prinzip, wovon das O.P. gespickt ist, nähert sich Kant dem „ursprünglichen Vorstellen“ von Beck (O.P. Konvolut X, Ak, Bd.XXII S.35321−22 ) „Aus den sinnlichen Repräsentationen (Vorstellungen), die die Materie der Erkenntnis bilden, können wir nichts herausheben als gerade das, was wir da eingeführt haben kraft des die Form betreffenden (= formalen) Prinzips der Synthese (Zusammensetzung) des empirischen Gegebenen auf der Basis der [elementaren] bewegenden Kräfte2 .“ 2 O.P. Konv. X, Ak Bd XXII S. 31924−27 244 Das, was vorausgeht, hilft uns, den Sinn der Erklärungen von folgender Art zu präzisieren: „Die Physik ist die Wissenschaft der Prinzipien, die uns veranlassen, in einem System der Erfahrung die bewegenden Kräfte der Natur miteinander zu verbinden. Zu dieser Wissenschaft gehören: 10 das materiale Element der empirischen Vorstellungen (das Dabile); 20 das formale Element, das die Mannigfaltigkeit dieser Repräsentationen in ein System gruppiert (das cogitabile)3 “ 3 zit. Op. S.31320−23 Müssen wir dann, wenn man so den ganzen Umfang, der von Kant dem formartigen Element gegeben wird, kennen, das so verstehen, dass das entgegengesetzte materiale Element, das Dabile eine Art von aristotelischer „Materia prima“ wäre, völlig indifferenziert, „nec quale nec quanta“? In Wahrheit, für das Bewusstsein in Anbetracht dessen – setzen wir das voraus – noch nichts sich ablöst als formale Einheit einer Vielheit, spielt das Dabile die Rolle einer indifferenzierten Materie. In sich jedoch, selbst in sofern es ein äußerlicher, jeder Deduktion a priori gegenüber widerspenstiger Beitrag ist, unterschiebt das Dabile unseren Analysen unter der formalen Armatur unserer Sinne, eine für sie undurchdringliche reine Mannigfaltigkeit, eine rohe qualitative Mannigfaltigkeit. Vielleicht würde diese materiale Mannigfaltigkeit, betrachtet unter dem ontologischen Gesichtspunkt, in ihrer Beziehung zum Unbewussten des „Subjekts an sich“ oder in ihrer Beziehung zu den metaphysischen äußeren Ursachen einem tiefer eindringenden Verstand als dem unseren eine Verbindung 193 Buch II: Das „Opus postumum“ 245 von definierbaren Formen in sich selbst darstellen. Aber diese Formen wären für uns, wie wenn sie nicht wären. Verwechseln wir nicht die Form „an sich“ und die Form „für uns“: die erstere beraubt sich der kritischen Reflexion; die zweite offenbart sich nur durch das synthetische Apriori des Subjekts. Auch der Übergang erstreckt sich logisch auf alle Formen, die das Objekt der Physik ausmachen. Ohne die hypothetische formale Struktur einer Welt an sich zu enthüllen, zeigt er, wie das phänomenale Bild dieser Welt a priori konstruiert werden müsste in uns und durch uns, um nicht ganz unintelligibel zu sein. Diese Konstruktion a priori der Form der Erfahrung kann deren Gesamtheit nur umfassen, indem sie in den bewussten Reihen aufsteigt bis zu den elementarsten Äußerungen, den Wahrnehmungen. „Ist das nicht seltsam? lässt Kant selbst beobachten. Es scheint ganz unmöglich a priori die Qualitäten zu erklären, die auf sinnlichen Wahrnehmungen beruhen (das heißt auf bewussten empirischen Repräsentationen (Vorstellungen)), zum Beispiel den Ton, das Licht, die Wärme1 “ 1 O.P. Konvolut XI, Ak., Bd.XXII, S. 4934−6 Und doch, ohne Eingreifen unserer konstruktiven Spontaneität im Ursprung dieser physikalischen Qualitäten, könnten sie nicht „objektiv2 “ vorgestellt werden. Das subjektive Apriori hat also die Leitung gehabt bei der Genese selbst schon der elementaren Wahrnehmungen. Wie? 2 Ebenda, Zeile 7-16 Um in dieses „Wie“ einzudringen, beruft sich das O. P. auf die „bewegenden Kräfte der Materie“, von denen die M.A.N.W. die Notwendigkeit bewiesen haben, um den unendlichen Raum mit Objekten zu möblieren (siehe weiter oben, S. 238, 241) „Alle sinnlichen Wahrnehmungen sind Wirkungen des Einflusses, ausgeübt durch die bewegenden Kräfte der Materie auf das Subjekt und auf seine sinnlichen Fähigkeiten. Auf diese [Kräfte in Tätigkeit] antwortet die [sinnliche] Aufnahme[fähigkeit] nach Art einer Reaktion auf das, was im Raum beweglich ist (das heißt auf die Materie), [indem sie sie erscheinen lässt] als äußeres Objekt der Sinne und als Bewegung dieses Objekts. Nur so ist es möglich, dass eine Repräsentation, die nicht aufhören kann, Objekt der Erfahrung zu sein und zur Physik zu gehören, zur gleichen Zeit unter die Etappen gerechnet wird. die weiterleiten zu dieser Wissenschaft ausgehend von den M.A.N.W.3 “ 194 Kapitel III: Prinzip und wesentliche Linien des „Übergangs“ 3 O.P. Konv. X, Ak. Bd.XXII S. 3895−11 . Wir merken beiläufig an, wie Kant seit der dritten Kritik sich mehr und mehr leiten lässt durch diese (den Metaphysikern des Altertums und des Mittelalters vertraute) Idee, dass jede „Form“, die unser Bewusstsein affiziert, dabei zwei sukzessive, rational verknüpfte Zustände durchläuft: um uns immanent zu werden als vollendete, bewusste, objektiv wahrgenommene Form, muss sie uns immanent sein zuerst als dynamische, subjektive Antizipation dieses objektiven Zustandes. 246 Jede sinnliche Aufnahme oder Wahrnehmung mit den Sinnen überträgt [und übersetzt] also, vermittels „Reaktion“ des Subjekts, irgendeine Kombination der „bewegenden Kräfte der Materie“ ins Bewusstsein. Wenn wir a priori das „elementare System dieser Kräfte4 “ bestimmen könnten, würden wir mit demselben Schlag die elementaren Formen der sinnlichen Wahrnehmung bestimmen, nämlich diejenigen, die Objekt der Physik5 sind. Zwischen den ersteren und den zweiten gibt es Korrelation: 4 O.P. Konv. X, Ak. Bd.XXII, S.35220 ; siehe den ganzen unmittelbaren Kontext. Diese Deduktion ist nach Kant durchführbar; und er versucht sich daran, vielleicht mit mehr Überzeugung als evidenten Ergebnissen. Über seine Methode, vergl. zum Beispiel zit. Werk S.35723−30 5 „Die sinnlichen Wahrnehmungen sind Wirkungen der bewegenden Kräfte der Materie, vollzogen in der Weise, dass sie die empirische Repräsentation im Bewusstsein plötzlich auftauchen [emergieren] lassen, die die Sinne1 affiziert.“ 1 O.P. Konv. X, Ak. Bd.XXII, S.40014−16 „Der aktive und reaktive Zustand der empirischen Vorstellung in der objektiven Wahrnehmung ist, dem Formalen nach, mit dem Subjektiven der Erscheinung des Gegenstandes identisch“ ebenda S.3859−11 Diese muss, alles zusammen, in seiner Form die notwendige Struktur der „bewegenden Kräfte“ widerspiegeln, die sich dem Subjekt aufzwingen und a priori aus der konstruktiven Spontaneität desselben Subjekts2 plötzlich auftauchen. 2 „Die Rezeptivität der Sinnes-Vorstellungen zu haben, setzt also eine relative Spontaneität voraus“ (0. P., Konv. XI, Ak., Bd. XXII, S. 49313−14 ) Vertiefen wir für den Augenblick nicht die ursprüngliche Passivität des Subjekts den „bewegenden Kräften gegenüber“, die es durchdringen. Das was auf jeden Fall notwendig ist, ist, dass die vollendete Repräsentation vom Subjekt ausgeht, insofern es „sich selbst affiziert“, aktiv, in seinen sinnlichen Fakultäten (vom sich selbst affizierenden Subjekt)3 , entsprechend den strukturellen Typen der Kräfte, die im Spiel sind. 3 247 (0. P., Konv. X, Ak., Bd. XXII, S. 39523−24 und anderswo Letzten Endes werden diese primitiven (=ursprünglichen) dynamischen Typen (was auch immer sie sind) durch ihren formalen Aspekt die elementaren Gesetze der Physik steuern, aber sie werden es nur tun, indem sie durch die spontane Aktivität des Subjekts, die sie in ihm erzwingt, hindurchgehen: „Die Möglichkeit der Erfahrung beruht: 10 auf den empirischen Repräsentationen (Vorstellungen) der Sinne, welche wieder auf ihre Weise als Fundament die bewegenden Kräfte haben. 20 auf dem Prinzip der synthetischen Einheit a 195 Buch II: Das „Opus postumum“ priori der sinnlichen Wahrnehmungen, als auf einem System dieser bewegenden Kräfte4 “ 4 Ebenda S.4059−12 Es ist deshalb, weil er diese zwei Ordnungen von Bedingungen vereinigt, dass „der Akt, durch den das Subjekt sich in der sinnlichen Wahrnehmung selbst bestimmt [sich affiziert] , das Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung enthält 5 “. 5 „Der Akt, durch welchen das Subjekt sich selbst in der Wahrnehmung affiziert, enthält das Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung“ Ebenda S.38726−27 Diese Formulierung, in der jedes Wort von Bedeutung ist, kondensiert (verdichtet) das Wesentliche des Übergangs; sie erklärt, warum die „Erfahrung nicht das Mittel ist, sondern das Ziel unserer Wahrnehmung von sinnlichen Objekten in den bewegenden Kräften, die sie konstituieren6 “ 6 O. P. Konv. XI, Ak., Bd. XXII, S. 49315−16 Die Erfahrung hat also als primitives (=ursprüngliches) Fundament eine Synthese a priori vollzogen durch das Subjekt an den bewegenden Kräften der Materie. Wir entdecken, dass es damit so ist, und wir errichten sogar das „System dieser bewegenden Kräfte“, nicht durch eine herumtappende Induktion nach der Weise der Empiristen sondern a priori; nicht etwa synthetisch sondern analytisch, „kraft der Regel der Identität7 “. 7 O.P. Konv. X, Ak. Bd. XXII S. 4086 Die Erfahrung bietet uns tatsächlich mehr als ein „Aggregat von Wahrnehmungen“; sie stellt dar, durch ihre Form, ein geordnetes System, in dem die einfache Analyse eine Struktur a priori freilegt, die jeden partikulären Inhalt, der sie verwirklicht, unendlich überschreitet1 . 1 Man wird sich erinnern, dass Kant, in der Kritik der reinen Vernunft und später auch noch, als „analytisch“ bezeichnet, als fundiert auf dem „Prinzip der Identität“, den Beweis, der in einem immanenten Objekt die Bedingung a priori aufdeckt, die es konstituiert. 248 Der Übergang ist also nur die analytische Theorie der Bedingungen, die a priori die Möglichkeit der Erfahrung steuern, betrachtet unter der Rücksicht der ganzen Weite seiner konstitutiven Formen oder Gesetze. Welche objektive Geltung kann eine Theorie von dieser Art fordern? Antwort: eine doppelte: 1. Eine „apodiktische“ Geltung (die einer Analyse) auf der idealen Ebene der Phänomene; 2. eine „problematische“ Geltung (die einer widerspruchsfreien, kohärenten Hypothese) auf der Ebene des An-Sich als Ausdruck der strukturellen Elemente eines „Universums an sich“: Zu 1.: „Alles das, was wir nur a priori und durch Synthese [das heißt kraft einer [im Ich immanenten] Konstruktion a priori] erkennen können, kann, für unsere Augen, auch nicht mehr sein als ein phänomenales Objekt, kein Objekt an sich; auch die Objekte der Erfahrung [die von einer derartigen Synthese abhängen], können uns, selbst bei der Tatsache einer Realität, nichts anderes liefern als die gegenseitige Beziehung von Phänomenen, die gruppiert sind in einer gleichen objektiven Einheit2 “. 2 196 O.P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S.37516−19 K.4: „Übergang“ und Präzisierung einiger Begriffe der Kritik Zu 2.: „Die Stufenleiter [der Bedingungen], die ein elementares System der bewegenden Kräfte der Materie der Physik auferlegt, wie auch die einfache Möglichkeit eines Übergangs zu dieser Wissenschaft eignet sich für eine a priori absolut vollständige, aber bloß problematische Darlegung, das heißt, ohne Garantie auch nur der realen Möglichkeit eines solchen Systems: es kann wenigstens ohne logischen Widerspruch gedacht werden3 .“ 3 O.P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S.37420−24 – Man findet weiter unten, Seite 303 ff, Kap.VI. ergänzende Klärungen dieser doppelten logischen Geltung des Systems des Übergangs. In der oben gezeichneten Skizze der hervorspringenden Linien des Übergangs wollen wir einige Punkte von speziellerem epistemologischen Interesse weiterführen. Kapitel IV: Beiträge zur Präzisierung einiger Begriffe der kritischen Philosophie durch den „Übergang“ 249 §1.– Das Phänomen (die „Erscheinung“) „Die Erfahrung findet die notwendigen Materien, um sich zu ihrem Höhepunkt zu erheben, nicht in der sinnlichen Wahrnehmung irgend eines Objekts (in der empirischen Repräsentation begleitet mit Bewusstsein); ich will sagen, dass sie diese nicht hernimmt von der Materie, die der Sinn empfängt, sondern von dem, was der Verstand mittels des formartigen Elements der sinnlichen Intuition konstruiert (macht)... Die Transformation eines Aggregats von Wahrnehmungen in ein System ist also autonom und nicht heteronom1 “ 1 250 O. P., Konv. XL Ak., Bd. XXII, p. 4473−11 . Diese Bemerkung zeigt uns, auf zwei Stufen der Ausarbeitung, die Phänomene, die eingehen in die Zusammensetzung der Erfahrung: sie sind zuerst nur primitives (=ursprüngliches) plötzliches Auftauchen einer Repräsentation im Bewusstsein (als zustoßende Vorstellung empfangen)2 ; in der zweiten Stufe sind sie aktiv ausgearbeitet (gemacht) und verdienen den Namen von „Phänomenen von Phänomenen“ (Erscheinung einer Erscheinung)3 . 2 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 32229 Denkt Kant hier an den Anstoß von Fichte? 3 Ebenda Eine solche Stufung ist ausgedrückt oder vorausgesetzt in vielen Texten, zum Beispiel: „Das Phänomen ist die subjektive Form der Intuition und es ist a priori gegeben4 “ 4 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 34525−26 197 Buch II: Das „Opus postumum“ „Das Phänomen [im allgemeinen] ist die subjektive Modifikation der Handlung, am Subjekt ausgeführt durch ein sinnliches Objekt5 “. 5 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, p. 32822−23 „Der phänomenale Ausdruck der Dinge im Raum (und in der Zeit) ist von zwei Sorten: 10 das Phänomen, das den Objekten entspricht, die wir selbst a priori in den Raum einführen, und diese Bedeutung ist metaphysisch; 20 das Phänomen, das uns empirisch gegeben ist (a posteriori) und diese Bedeutung ist physisch. Wir nennen diese letztere: direktes Phänomen; das erstere: indirektes Phänomen oder Phänomen von einem Phänomen. Das Objekt eines indirekten Phänomens ist das Ding selbst1 “ 1 251 O.P. Konv. X, Ak. Bd. XXII, S.31025−30 Das eine und das andere Phänomen schließt eine Relation a priori des Subjekts zu den „bewegenden Kräften“ ein. Diese Beziehung ist in den „indirekten Phänomenen“ vermittelt: „[Betrachten wir] die bewegende Kraft im räumlichen Phänomen im Gegensatz zu der bewegenden Kraft in sich selbst; [wir finden]: einerseits die Erscheinung von der Erscheinung [„das indirekte Phänomen“] [in welchem das Subjekt durch das Objekt] affiziert [modifiziert], [sekundär] durch sich selbst affiziert ist, und so eine Bewegung im Inneren des Phänomens produziert; und andererseits, die [elementare] bewegende Kraft des äußeren Sinns, indirekt ausgeübt in der Untersuchung der Natur: denn [gerade da] ist es das Subjekt, das bewirkt und verursacht die Bewegung, von der [diese Kraft?] affiziert ist (da das Subjekt diejenige Bewegung selbst macht und verursacht, durch welche sie [?] affiziert wird)2 ; und so ist das, was das Subjekt von außen empfängt, nicht weniger in es eingeführt, a priori, durch eine Bewegung, die [das Subjekt] sich selbst aufdrückt3 “ 2 Der Sinn dieses – wahrscheinlich inkorrekten – Textes scheint der folgende zu sein: „Denn es ist die Spontaneität des Subjekts, die in Bewegung setzt in diesem, die bewegende Kraft des äußeren Sinns“. Addickes schlägt vor zu lesen (in Linie 22) es statt sie, was nach sich zieht weiter unten Subjekt durch Objekt zu ersetzen und im Übrigen den Satz noch nicht vollständig auf die Beine stellt. In jeder Hypothese bleibt die allgemeine Bedeutung der Stelle die selbe. 3 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 32116−23 Das indirekte Phänomen – die Erscheinung der Erscheinung – Endzustand, begrifflich gefasst, der objektiven Veränderung des Sinns, gehört zur „metaphysischen“ Ordnung; das direkte Phänomen – die aktive Mobilmachung der elementaren Kräfte durch das Subjekt „das sich selbst affiziert“ – ist von „physiologischer Ordnung“ [psycho-physiologisch] oder „physisch4 “ 4 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 32015−20 und S. 3258−11 Bezieht sich das „direkte Phänomen“ auf etwas außerhalb Befindliches, ja oder nein, wie auf eine vorausliegende psycho-physische Bedingung? Lassen wir vorübergehend diesen Aspekt des Problems der „Dinge an sich“ beisei- 198 K.4: „Übergang“ und Präzisierung einiger Begriffe der Kritik te. Auf jeden Fall schließt das Phänomen im zweiten Grad, das „indirekte Phänomen“ (das, das wir im Heft III „phänomenales Objekt“ genannt haben), logisch in seiner objektiven Bedeutung die Idee eines „inkommensurablen Dings an sich“ ein (eines „Dings an sich = X“, nach der gewöhnlichen Bezeichnung des O.P.); wir werden weiter unten (Seite 284-291) insistieren auf der logischen Geltung dieses X; es ist jedoch unerlässlich, um einige Texte zu verstehen, die in der Zwischenzeit zitiert werden müssen, das hier und jetzt schon voraus zu nehmen: „Das Phänomen des Phänomens [das indirekte Phänomen], gedacht als Verbindung der Vielfalt, ist der Begriff des Objekts selbst5 “ 5 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, p. 3251−23 „Das Ding an sich (=X) bezeichnet nicht ein anderes Objekt als gerade das, nur als Phänomen ins Auge gefasst, was unserem Sinn angeboten1 ist“. 1 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 7118−19 . „Das Korrelative der als Phänomen repräsentierten Sache ist das Ding an sich; ich möchte sagen: ist das Subjekt selbst, aus dem ich ein Objekt mache2 “. 2 252 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 41217−18 . Tatsächlich, der allgemeinen Note des Phänomens entspricht, als sein rationales Fundament, der Begriff des Dings an sich: nun aber, welches ist das rationale Fundament des „indirekten Phänomens“? Kant wiederholt es bis zum Überdruss: das ist die immanente Aktivität des transzendentalen Subjekts: „Die Rezeptivität der Intuition, betrachtet unter ihrem formalen Aspekt – das heißt betrachtet im Phänomen – und die Spontaneität des Bewusstseins, in einem Begriff (apprehensio) die synthetische Einheit ergreifend , sind die Akte, die die synthetischen Sätze a priori der transzendentalen Philosophie fundieren: durch sie ist das Subjekt sich selbst a priori als Phänomen3 gegeben “ 3 ebenda S. 41212−16 Schlussfolgerungen: „Der Unterschied zwischen dem Begriff eines Dings an sich und dem eines Dings als Phänomen ist nicht objektiv sondern nur subjektiv4 “ 4 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, p. 2626−27 . Das ist ein Unterschied, nicht der Objekte, sondern von Gesichtspunkten, angenommen über ein gleiches Objekt5 5 „Nicht ein anderes Objekt, sondern eine andere Beziehung – respectus – der Vorstellung auf dasselbe Objekt“ Ebenda S. 2628−29 Denn letzten Endes „ist das Ding an sich das ens rationis [Gedankending] (=X), das die Setzung des Subjekts durch sich selbst ausdrückt entsprechend dem Prinzip der Identität6 in welchem das Subjekt Objekt des Denkens wird, soweit es sich selbst verändert und folglich entsprechend der Form [die es sich gibt], das heißt nur als Phänomen7 “. 199 Buch II: Das „Opus postumum“ 6 Das heißt: das das Subjekt ausdrückt, das sich selbst setzt, durch Identität, entsprechend der formalen Bedingung seines logischen Wesens. 7 ebenda S. 272−5 . Muss man schon unterstreichen die Annäherung zwischen diesem Gesichtspunkt und dem von Fichte? Diese Identifikation des Dings an sich (als „ens rationis [Gedankending] = X“) mit dem Subjekt (als ursprunggebendes synthetisches Prinzip) erlaubt Kant einen noch paradoxeren Ausdruck zu riskieren: „Das was die gegenseitige Kombination [der räumlichen Bedingungen und der zeitlichen Bedingungen] in einer Intuition bestimmt, das ist der Verstand, soweit er in einer allgemeinen Weise die Sinne verändert (affiziert) und das sinnliche Objekt darstellt als ein Phänomen. Das innere Prinzip für das Werk in dieser Darstellung ist das Unerkennbare (=X): es ist also das Ding, das sich selbst macht (wodurch das Ding sich selbst macht)1 “ 253 1 ebenda, S. 6926−29 – Hervorhebung der letzten Wörter von uns §2.– Erfahrung und Wahrnehmung „Die Erfahrung ereignet sich nicht so plötzlich und unerwartet ... als fertiges Ding; sie muss konstruiert werden2 “ 2 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, p. 32029−31 : „Erfahrung kommt nicht... von selbst, sondern muss gemacht werden“. 3 Sie ist nicht irgendein Aggregat sondern ein System . 3 „ein System empirischer Vorstellungen (nicht ein empirisches System, denn das wäre ein Widerspruch)“; ebenda S. 35923−25 Kant hat es uns schon gesagt und wieder gesagt. Sie ist „Werk des Verstandes, der die sinnlichen Wahrnehmungen zu einem Ganzen gruppiert, unter einem Begriff4 “. 4 „Ein Verstandesganzes von Wahrnehmungen überhaupt unter einem Begriffe“ ebenda S. 3615−6 Sie ist „eine begriffliche Synthese von Phänomenen, reguliert nach dem Prinzip der Affektion der Sinne und entsprechend den Kategorien5 “ 5 „Ein Verstandesbegriff von der Zusammensetzung der Erscheinungen, usw.“ O. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 47628−29 . Synthese des Verstandes, die Erfahrung muss eine sein und nicht viele: „Die Erfahrung ist die absolute subjektive Einheit des Mannigfaltigen der sinnlichen Repräsentation (Vorstellung. Man spricht nicht im Plural von Erfahrungen) sondern im Singular von der Erfahrung6 “ 6 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 9726−27 :“man spricht nicht von Erfahrungen sondern [von] der Erfahrung schlechthin“ Das muss man gut verstehen. 200 K.4: „Übergang“ und Präzisierung einiger Begriffe der Kritik „Insofern sie Addition konkreter, partikulärer Repräsentationen ist, ist die Erfahrung nie vollendet: sie zielt indefinit darauf, der absoluten Summe [der Terme] der empirischen Reihe gleichzukommen7 “ 7 ebenda S. 1042−3 254 Das ist gerade, warum die universellen und notwendigen Gesetze, „die Prinzipien der möglichen Erfahrung, nicht abgeleitet werden können von der Erfahrung selbst [das heißt von der getätigten Erfahrung], denn diese ist eine absolute Einheit, nur realisierbar durch Approximation (ist absolute Einheit, bei der nur Annäherung stattfindet)8 “ 8 ebenda S. 1066−7 Die Erfahrung als Gesamtheit ist nur begriffen in dem Bedürfnis a priori, das die Gruppierung der Wahrnehmungen auf sie hin orientiert: „nicht aus der Erfahrung, sondern zum Behuf der Erfahrung“, wie Kant es so häufig wiederholt. Die konkrete Erfahrung strebt nach der Einheit: Die fundamentale Verschiedenheit, die dieser Einheit sich im Bewusstsein widersetzt, ist die der elementaren Wahrnehmungen. Diese „materieartige Prinzipien der möglichen Erfahrung1 “ treten wie erste Elemente ein in das „kollektive Ganze 2 “, das die konkrete Erfahrung ist. 1 0. P., Conv. V. Ak. XXI, S. 58320 . 2 Op. cit., S. 5822! . In der Erfahrung einem höheren Akt der Synthese unterworfen, ist die einfache Wahrnehmung „selbst die Wirkung der bewegenden Kraft, durch das Subjekt in den Akt versetzt wenn dieser letztere sich a priori bestimmt angesichts der Repräsentation3 “. 3 0. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 43914−16 . Die subjektiven Inhalte der Wahrnehmung, das heißt die sinnlichen Qualitäten: „Schall, Licht, Wärme usw.4 “, konstituieren die „empirische Anschauung5 “. 4 Op. cit., S. 4936−8 . “Die empirische Anschauung als das Subjektive der Wahrnehmung der bewegenden Kräfte...“ 0. P., Konv. X. Ak. XXII, S. 3073−4 . 5 Diese „gibt auf der Ebene der Phänomene Anlass zu ebensovielen Arten von Wahrnehmungen, nicht mehr und nicht weniger, wie dafür erforderlich sind, um die [totale] Einheit der Erfahrung zu realisieren6 “ 6 255 Op. cit., S. 36610−12 . Das ist schon die Einheit der Erfahrung, die das plötzliche Auftauchen [die Emergenz] der Wahrnehmungen als Phänomenen in der empirischen Anschauung steuert7 . 201 Buch II: Das „Opus postumum“ 7 Op. cit., S. 36614−17 . Wir können hier begreifen den extremen theoretischen Erfolg bei Kant von einer Distinktion, formuliert in der Kritik der reinen Vernunft und jetzt bis in das O.P.: die Unterscheidung von Anschauung und von Begriff als notwendige konstitutive Elemente jeder objektiven Erkenntnis. Solange die Einheit von Anschauung und Begriff im Bewusstsein betrachtet werden konnte als eine Begegnung von getrennten Elementen, erhoben sich Zweifel über die Rolle, die jede von ihnen in der Objektivierung beanspruchte. Es konnte selbst scheinen, dass die eine oder die andere, je nach Gesichtspunkt, dafür genügte, die objektive Funktion sicherzustellen: die empirische Anschauung für das Postulat des „Ding an sich“, oder, im Gegenteil, in einer mehr idealistischen Theorie der Erkenntnis, das begriffliche Apriori (siehe weiter oben: Maimon, Beck, Enesidem). Im O.P. hat sich der Gesichtspunkt von Kant einzigartiger Weise dem von Beck angenähert (siehe oben Seite 181-186). „Jede Repräsentation [man beachte die Klammern] ist in uns entweder Anschauung (einzelne unmittelbare Repräsentation) oder Begriff (vermittelte Repräsentation durch irgendwelche universellen Attribute)8 “ 8 256 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 2428−29 . Kant lässt seit 1792 zu, dass dieses Merkmal der Anschauung, hergenommen von seinem Kurs über Logik, von Beck verwendet wurde zu einer rein „absteigenden“ Deduktion der transzendentalen Philosophie; aber er entschied dabei, dass dieser deduktive Prozess, der, ausgehend von der transzendentalen Einheit des Subjekts, die Notwendigkeit einer „einzelnen und unmittelbaren“ Repräsentation a priori einführt, unvollständig blieb, wenn er nicht bis zur Forderung eines wahrhaften äußeren „Gegebenen“ führte, das mit seiner materieartigen Mannigfaltigkeit die Zeit und den Raum füllt. Hier ist diese Zurückhaltung verschwunden. Die erforderliche Anschauung lässt sich sehr gut konzipieren ohne Beziehung auf irgendetwas dem Subjekt äußerliches. Was ist tatsächlich für die Anschauung wesentlich? Die Singularität und die Unmittelbarkeit. Nun aber „gibt es ein Sein [das Ich], das sich selbst als Objekt konstituiert, nicht nur als gedachtes Objekt (cogitabile), sondern als existierendes Objekt, gegeben (dabile) außerhalb der Repräsentation, die ich mir davon bilde; ein Sein, das sich a priori errichtet als Objekt vor sich selbst (Enesideme), und dessen Repräsentation zugleich und unmittelbar die des Subjekts und die des eigentümlichen Objekts dieses Subjekts ist, das heißt Anschauung ist1 “ 1 202 O.P. Konv.VII., Ak. Bd.XXII S. 10723−27 . K.4: „Übergang“ und Präzisierung einiger Begriffe der Kritik Wir haben gesehen, dass der Übergang aufgrund eines Beweises a priori, unter den Vorbedingungen der physischen Erfahrung, nicht nur die reine Anschauung der Zeit und des Raums bestimmt, sondern einen raumzeitlichen Inhalt – die elementaren sinnlichen Wahrnehmungen – aus denen die Materie, wenigstens zunächst, konstituiert ist durch die „Affektionen“, die das Subjekt sich selbst aufdrückt, indem es die „elementaren bewegenden Kräfte“ ins Werk setzt. Dass außerhalb des Subjekts „Dinge“ existieren oder nicht, war es also gar nicht nötig, aus dem erkennenden Subjekt hinauszugehen, um die kantsche Definition der reinen oder empirischen Anschauung verwirklicht zu finden. Das Bewusstsein ist virtuell und strebt danach, aktuell die totale Koinzidenz von Subjekt und von Objekt in einer Repräsentation zu werden. Die empirische Intuition markiert den ersten aktuellen Grad dieser fortschreitenden Konstruktion der Subjekt-Objekt Identität: den Grad, wo das Subjekt sich anfängt sich passiv sich selbst gegenüber zu machen. Die Bestimmung , die daraus für das Bewusstsein resultiert, hängt in der Ordnung der Repräsentation von keiner vorausgehenden Repräsentation ab: einzeln, ursprünglich (=primitiv), „unmittelbar“, führt sie Neues ein, aber ohne zu verlangen, bezogen zu sein auf irgendein äußeres Prinzip oder Subjekt. In ihr verwirklicht sich, durch subjektive „Identität“ die Synthese der Bedingungen a priori des Begriffs mit den partikulären Beiträgen der empirischen Anschauung (Intuition). Der folgende Text scheint uns eine präzise wenn auch nicht immer einleuchtende Zusammenfassung der oben analysierten Beziehungen zwischen der Wahrnehmung und der Erfahrung: 257 „Das materieartige Element der sinnlichen Repräsentation liegt in der Wahrnehmung, das heißt im Akt, durch den das Subjekt sich selbst affiziert, und in seinen eigenen Augen Phänomen eines Objekts wird. Das formartige Element [der Repräsentation] ist der Akt der Verknüpfung der sinnlichen Wahrnehmungen, zum Effekt, die Erfahrung im allgemeinen möglich zu machen, nach dem Vorbild der Tafel der Kategorien (Axiom der Anschauung, Vorausnahme der Wahrnehmung, Analogie der Erfahrung und geordnete Gruppierung dieser Prinzipien in ein allgemeines System der empirischen Erkenntnis).“ Die Wahrnehmung , in 203 Buch II: Das „Opus postumum“ deren Innerem das Objekt affiziert wird durch das Ding (vom Gegenstande) entsprechend dem genauen Vorbild, nach dem das Subjekt sich selbst affiziert entsprechend den Kategorien, diese Wahrnehmung organisiert das rohe Aggregat [die Materie] der Wahrnehmungen zu einem System der materiellen bewegenden Kräfte: Dieses System zeigt uns objektiv und a priori die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, präzise enthalten in diesen [ursprünglichen bewegenden] Aktionen und Reaktionen; diese alle zusammen schließen [tatsächlich] • durch ihre äußere Gruppierung in der räumlichen Anschauung • und innere Gruppierung in der Sinneswahrnehmung die dynamische Funktion ein, vermöge derer sich die [diversen] Momente konstituieren • von [denen wir wissen, dass sie einerseits] Voraussetzungen für die Erkenntnis der Objekte sind, angesichts einer Wissenschaft der Physik • und andererseits, Inhalte a priori, durch Identität, in dem System gewordenen empirischen Aggregat1 . 1 O. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 50212−20 bis 5031−2 . [Hervorhebungen und Aufgliederungen vom Übersetzer] N.B. Das Ende dieses Textes kann zwei Interpretationen haben, je nachdem man S.50225−26 liest. „welche ... ausmachen“ oder „welche ... ausmacht“. – Man wird bemerkt haben, dass die in diesen letzten Seiten erklärte Lehre, ein Echo darstellt, nicht nur auf Beck, sondern durch gewisse Elemente auf Reinhold und selbst auf Salomon Maimon. Halten wir dennoch fest, zu schließen aus einer materiellen Ähnlichkeit auf eine wahrhafte literarische Abhängigkeit: diese ist möglich, aber nicht, so scheint es, beweisbar. §3.–“Affizieren“ und „Selbstaffizieren“ 258 Die Idee eines „Affizierens“, oder passiven Veränderung des erkennenden Subjekts, ist impliziert in der kritischen Definition der Sinnlichkeit als „rezeptive“ Fakultät. In diesem Sinn wenigstens datiert sie seit den Anfängen der Kritik. Aber ihre Verwendung wird sehr häufig in den letzten Schriften von Kant. Schon mehrmals sind wir ihr auf den Seiten des Übergangs begegnet: es bleibt uns noch, sie klarer herauszuarbeiten. Die evidenteste Anwendung der Idee eines Affiziert-Werdens betrifft die Rolle der „elementaren bewegenden Kräfte“ in der sinnlichen Wahrnehmung: „Schon bei der einfachen äußeren oder inneren Wahrnehmung greifen die bewegenden Kräfte ein, sowohl die der Materie außerhalb von mir wie die der synthetischen Aktivität in mir2 “. 204 K.4: „Übergang“ und Präzisierung einiger Begriffe der Kritik 1 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 1813−15 . Nun aber besteht die Form der Wahrnehmung, wie wir wissen, in dem Akt, durch den das Subjekt über „Kräfte der Materie“ verfügt und in sich durch sie eine elementare „Affizierung“ bewirkt. Auf einem höheren Niveau werden die Wahrnehmungen selbst „bewegende Kräfte“ genannt: „Verglichen mit der Materie und den Kräften der Materie, die äußerlich das Subjekt affizieren und es also bewegen, sind die Wahrnehmungen an sich bewegende Kräfte verknüpft mit der subjektiven Reaktion [auf die rohen Sinnesdaten]; der Verstand bestimmt tatsächlich im Voraus (antizipiert) die Wahrnehmung nur entsprechend den von der Bewegung konzipierbaren Formen: Anziehung, Abstoßung Einschluss oder Einhüllung, gegenseitige Durchdringung1 “ 1 0. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 5023−8 . Erkennen wir hier wieder das allgemeine Thema des Übergangs: a priori zeigen, wie eine Vorausnahme des materiellen Inhalts selbst der Erfahrung möglich ist (“die Erfahrung quoad materiale zu antizipieren2 “) 2 0. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 50210 . Schließlich muss jede vom Bewusstsein erworbene Repräsentation als Urheber das Subjekt haben. Ist das nicht eigentlich ein Korollar des „Prinzips der Idealität der sinnlichen Objekte insofern sie Phänomene sind?“ 259 „Nach diesem Prinzip konstruieren wir uns die empirische Repräsentation selbst, das heißt, dass das Subjekt sich selbst verändert (sich selbst affiziert) und das wahrnimmt, was es für sich selbst in die empirische Intuition einführt: es ist selbst der Urheber seiner Repräsentation3 “ 3 0. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 47720−24 Vergl. Konv X S. 32116−23 : Text weiter oben zitiert S.251 Jede „Affizierung“ des Subjekts stellt also zugleich einen aktiven Aspekt dar und einen passiven Aspekt: nur der erste Aspekt – Ausübung einer Aktivität a priori – macht die Physik als „Wissenschaft“ möglich. „Es ist nicht in der Tatsache, dass das Subjekt empirisch durch das Objekt modifiziert wird (per receptivitatem), sondern in der Tatsache, dass das Subjekt sich selbst modifiziert (per spontaneitatem), worauf die Möglichkeit des Übergangs ... zur Physik beruht4 . “ 205 Buch II: Das „Opus postumum“ 4 O.P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 40514−17 . Vergessen wir trotzdem nicht, dass die Aktivität des Subjekts bezogen auf sich selbst im empirischen „Affiziert-Werden“ sich nur entfaltet, indem sie die gemeinsamen (oder allgemeinen) bewegenden Kräfte der „Materie“ mobilisiert (weckt): „Die Affektibilität des Subjekts als Phänomen hat als Korrelativ in der sinnlichen Wahrnehmung die Erregbarkeit der entsprechenden bewegenden Kräfte5 “ 5 O.P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 39614−17 . Welches sind also diese mysteriösen „bewegenden Kräfte der Materie“. „diese bewegenden Kräfte, die den subjektiven1 Aspekt der für die Möglichkeit der Erfahrung erforderlichen Wahrnehmungen konstituieren? Das sind die autonomen2 Akte, durch welche das Subjekt sich selbst modifiziert, sowohl in der empirischen Anschauung als auch in der Synthese der Phänomene, [das heißt] im Bewusstsein seiner eigenen Handlung [Aktion] entsprechend einer Form, die es sich a priori gibt, nicht indem es sie aus der Erfahrung bezieht sondern in Antizipation zur Erfahrung3 “ 1 Im Gegensatz zum Aspekt „objektiv“, phänomenal Die „Akte“, die subjektive Aktivität und nicht das formale Produkt dieser Akte, die Phänomene. Wagte man zu sagen, dass das der „Geist“ ist betrachtet „als Natur“ (ut natura) eher als „als Idee“? 3 Op. cit., S. 40410−16 . 2 260 Die Betrachtung der systematischen Einheit der Erfahrung zwingt uns tatsächlich, um sich zu vervollkommnen, aufzusteigen über die gegebenen empirischen Formen hinaus bis zu den autonomen, ursprünglichen (=primitiven) Akten der Auto-Determination, wo sie ihren Ursprung nehmen; mit anderen Worten: bis zu den „bewegenden Kräften, betrachtet als die Wirkursachen der Wahrnehmungen (als wirkende Ursachen der Wahrnehmung)4 “ 4 Op. cit., S. 4044−5 . Das Affizieren ist also auf allen Ebenen Selbst-Affizieren; man könnte es definieren: „das sich zum Objekt machende Subjekt5 “ 5 „Das Subjekt macht sich zum Objekt“:0. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 44327 das Subjekt das von sich selbst Bewusstsein nimmt entsprechend einiger partikulärer Bestimmungen, „das Bewusstsein von sich (Apperzeption) reduziert sich auf einen Akt, durch den das Subjekt sich auf eine allgemeine Weise zum Objekt macht6 “: 6 206 0. P., Lonv. X. Ak., Bd. XXII, S. 41311-12. K.4: „Übergang“ und Präzisierung einiger Begriffe der Kritik Diese Objektivierung des diskursiven Verstandes vor sich selbst umfasst weder eine totale Unbestimmtheit, noch einen definierten Inhalt; das ist eine reine Intuition, welche unter den Denominationen von Raum und Zeit [Hervorhebung von uns] nur die Form der Synthese enthält (coordinatio und subordinatio) des intuitiven Vielfältigen7 “. 7 Op. cit., S. 4I315-18. – Der Raum und die Zeit bei Kant streben danach, sich dem Raum und der Zeit von Leibniz anzunähern, ganz in dem Maße wie Kant dazu kommt, die Intuition a priori der Sinnlichkeit zu „intellektualisieren“ Auf ihre Weise sind Raum und Zeit, abstrahiert von jeder empirischen Bestimmung, nicht objektive Repräsentationen sondern transzendentale Funktionen; oder wie Kant sagt: „Der Raum (und die Zeit) ist nicht ein Objekt der Anschauung sondern die Anschauung selbst8 “, „nicht ein Objekt der Anschauung sondern eine Anschauungsart9 “. 8 Op. cit., S. 41021−25 . Vgl., zum Beispiel, Konv. VII, S. 1626 -175 . 9 0. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 43326−28 . „Der Raum und die Zeit repräsentieren also einerseits Akte der Spontaneität des Subjekts in der Anschauung und andererseits Affektionen der Rezeptivität [desselben Subjekts]1 “ 1 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 4229−30 261 Als „Affektionen“ des diskursiven Subjekts, messen sie die passive Kapazität: „subjektiv sprechend“ vermischen sie sich mit der konstitutiven Form des IchObjekt des rezeptiven Ich2 ; 2 “Der Raum ist ... das Subjektive der Art, affiziert zu werden“ 0. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 5244 . und gerade dadurch objektivieren sie sich in der konkreten Form der internen und externen3 empirischen Wahrnehmungen. 3 „Der Raum ist ... bloß die Form der äußeren Anschauung“: ebenda., S. 5243 . Man muss dasselbe von der Zeit sagen in Beziehung zur Intuition des „inneren Sinns“ Da der Raum und die Zeit – a priorische Formen der Phänomene – zur Hierarchie der transzendentalen Bedingungen gehören, die die objektive Apperzeption (Wahrnehmung) steuern, erstaunt es uns nicht, unter der Feder von Kant Formulierungen von folgender Art zu finden: „Der Raum ist ... das Phänomen des Objekts an sich (=X)4 “ 4 0. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 41[ 5 − 6]. Wie ist das zu verstehen? „[In der phänomenalen Repräsentation] ist das Objekt, das [die Sinne] affiziert ein unbestimmtes X. [Nun aber] besteht das formale Element des Phänomens in der Setzung des Objekts in der Zeit und im Raum5 “. 5 Op. cit., S. 3612−14 . Wenn man abstrahiert von der Materie des Phänomens, bietet dieses also nicht mehr als eine einfache Setzung des Objekts unter den allgemeinen Bestimmungen des Raumes und der Zeit; da diese selbst aber nicht konzipiert 207 Buch II: Das „Opus postumum“ werden können als „Dinge an sich“ bleiben sie, was sie sind, insofern sie reine Anschauung sind, eine Art von Phänomen des an sich unbestimmten Objekts (=X). Und das Objekt an sich, Ursache der Affektion der Sinne, unterscheidet sich nicht – wir haben es weiter oben gesagt – von der durch das Subjekt auf sich selbst vollzogenen Aktivität: „Der fundamentale Inhalt [der Erkenntnis, sein universelles id quod ], das Ding an sich, ist ein [undefinierbares] X: das ist die reine Repräsentation der eigenen Aktivität [des Subjekts]6 “ 6 362 Op. cit., S. 3710−12 . Wir erahnen hier, wie sich im Geist von Kant das für die ganze objektive7 Apperzeption erforderliche rätselhafte Zusammenwirken der Anschauung und des Denkens präzisiert. 7 Siehe weiter oben S. 254-255, 101 ff. Nur eines und dasselbe „ursprüngliche synthetische Prinzip“ einerseits krönt das logische Gebäude der apperzeptiven Einheit und produziert andererseits dumpf (heimlich) handelnd wie ein „Ding an sich“, in der empirischen „Affektion“, das elementare Material der Erkenntnis. Als „Ding an sich = Ursache der Affektion“ inauguriert (=feierlich eröffnet) das synthetische Prinzip – nennen wir es mit seinem Namen: das transzendentale Ich – die Aufgabe selbst, die sich vollenden würde auf dem letzten Gipfel der Apperzeptiom: Die Aufgabe, die Einheit der Erfahrung1 möglich zu machen. An der Wurzel der Erkenntnis zwingt sich also eine Art von „Sollen“ auf, ein spekulatives Sollen. 1 263 Vergl. zum Beispiel O.P. Konv. X, Ak, Bd. XXII S. 30027−28 Diese Feststellung öffnet Perspektiven, die bei weitem den Übergang überschreiten. Bevor wir davon den Ausdruck bei Kant feststellen, müssen wir noch einen Moment seinem eigensinnigen Bemühen folgen, bis zu seinem Innersten a priori den materiellen Inhalt der Erkenntnis zu erreichen. Diesen materiellen Inhalt führt die empirische Affektion ein in das Bewusstsein unter dem subjektiven Schein der elementaren physikalischen Qualitäten – „Das Licht, der Schall, die Wärme“, – die nichts anderes sind in ihrer „intelligiblen Realität2 “ als die fundamentalen Moden der Gruppierung der „bewegenden Kräfte der Materie“. Obwohl wir nicht a priori bestimmen können, welche partikulären Kombinationen der Kräfte in diesem oder jenem konkreten Experiment wirken, zeichnen wir a priori den Rahmen der Gesamtheit, in dem sich notwendig diese dynamischen Komplexe einordnen. 208 K.4: „Übergang“ und Präzisierung einiger Begriffe der Kritik 2 Kant behauptet nicht in ihrer subjektiven Spezifizität die konkreten Repräsentationen, von denen unsere Sinne affiziert werden, a priori zu deduzieren: insofern sie „empfunden“ oder „gefühlt“ sind, können sie nur in der Erfahrung selbst gegeben sein. Die Deduktion a priori kennt nur die intelligible Struktur eines Objekts. Nun aber reduzieren sich die sinnlichen Qualitäten in ihrer intelligiblen Natur für Kant – genausogut für ihn wie für Descartes, Locke und Newton und für die modernen Physiker – auf reine Moden der Bewegung. Man wird sich erinnern an die Distinktion der „ersten Qualitäten“ und der „zweiten Qualitäten“: Kant erklärt schon in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft warum diese letzteren ein kritisches Problem bilden; z.B. „Der Geschmack und die Farben [sekundäre Qualitäten] sind keineswegs notwendige Bedingungen, unter denen allein die Dinge für uns Objekte der Sinne werden können. Das sind nur Wirkungen der partikulären Organisation unserer Sinne, akzidentell mit den Phänomenen verknüpft“ KRV A, S.28-29 vgl. A, S. 28-30; B S. 44-45, 69-71 Aber wir möchten noch mehr. Was verbirgt, im Grunde, die „Materie“ hinter dem Vorhang der „bewegenden Kräfte“ durch die sie eintritt in Komposition mit dem a priori des Bewusstseins? Eine Sache scheint sicher: „Die Materie rational erklären ist nur möglich vermittels ihrer spezifischen bewegenden Kräfte, folglich vermittels ihrer dynamischen Relation zur Materie, und ohne dass diese unmittelbar konzipierbar wird in sich selbst. Zum Beispiel die fundamentale Realität der mineralischen Säuren wird nur ein etwas sein, in sich unbekannt, zugrundeliegend den charakteristischen Kräften der Säuren, wie es ein Substrat ihrer Aktivitäten (causa efficiens)3 sein könnte“ 3 O. P. Konv. VII Ak, Bd. XXII, S. 137−11 Was auch immer die innere Natur dieses „Substrats“ ist, erlaubt ihre dynamische Entsprechung zu den „bewegenden Kräften“ gewisse ihrer Charakterisierungen zu erahnen. 4 Nennen wir „Materie-Elemente“ (Stoffe, ), im Gegensatz zum „Gattungs-Begriff“ der Materie stoiqeĩa 4 Siehe z.B. Konv. XI (Ak, Bd.XXII S. 55334 -5546 ): „Der Stoff (materia ex qua) verschiedene Elemente der Materie Stoffe sind.. Urprinzipien [der Materie] – elementa primi ordinis primitiva – sind Urstoffe (στοιχει̃α)“. im Gegensatz zum „Gattungs-Begriff“ der Materie (Materie, die auch die bewegenden Kräfte einschließt), den Substraten „die gedacht werden müssen als qualitativ irreduzible Teile der Materie (qualitativ-unteilbare Teile der Materie)1 “. 1 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 136 . Nun aber kommt Kant im O. P. häufig zurück auf die Einheit der Materie, die er für das notwendige Korrelativ der formartigen Einheit der „Erfahrung2 “ hält. 2 264 Zum Beispiel: 0. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 43316−19 . Um die Einheit der Materie aufrecht zu erhalten, müssen, so glaubt er, die ursprünglichen Elemente (Stoffe), die untereinander „qualitativ irreduzibel sind“, trotzdem selbst auf der materiellen Ebene reduzierbar sein auf eine gemeinsame Einheit3 . 209 Buch II: Das „Opus postumum“ 3 Vergl. diesen Beweis unter seiner allgemeinsten Formulierung in O.P. Konv. XII, Ak, Bd. XXII S. 612-615, genauer S. 61420 -6157 Anmerkung des Übersetzers: dieses Problem ist heute, wo diese Elemente alle ineinander verwandelt werden können, auf eine andere Ebene verschoben: die Elementarteilchen, die Quarks, Gluonen, Leptonen, die auch wieder alle in einander umwandelbar zu sein scheinen. Äther und Wärmestoff braucht man dazu nicht mehr. Dafür gibt es neue Probleme mit der dunklen Materie und Energie. Aber auch die „bewegenden Kräfte“ liefern keine vollständige Lösung mehr, die Klassifizierung verwendet in der Physik heute Symmetrien und die zugehörige Lie-Algebra. Utopisch oder nicht, dieses Problem ist vom Autor des O. P. angeschnitten in seiner Theorie vom „Äther“. Ohne in die Einzelheiten einer ganz schön heiklen Exegese einzusteigen, begnügen wir uns, hier zwei oder drei Punkte von speziellerem methodologischem Interesse hervorzuheben. Nachdem er erinnert hat an die Einheit und Unendlichkeit der Materie, die den Raum ausfüllt (dem die Aufteilung dieser Materie in „Teile“ oder in „spezifisch verschiedene Arten“ zu widersprechen scheint), fährt Kant fort, indem er die einzelnen Eigenschaften von einem der „Materie-Elemente“ betrachtet (erwägt), von denen er weiter oben sprach: „Dasjenige dieser Materie-Elemente, dem eine steuernde Rolle reserviert wird, weil es als überall gegenwärtig und alles durchdringend angenommen wird, bleibt in sich selbst eine reine Hypothese: ich will hier vom Wärmestoff sprechen, der sich gut anbietet [als distinktes Element] zum Bewegen und zum wieder zurückkehren (weiterfahren) alle anderen Elemente, aber vielleicht auch nicht mehr ist als eine einfache Qualität der Bewegung4 “ 4 265 O. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 52525 -5264 . Dieser Text sucht einen Ausgleich zwischen der einen Materie und den vielfachen „Materie-Elementen“ in der Hypothese eines universellen Wärmestoffs. Hypothese nur in dem Sinn – nach Kant – dass die fundamentale Substanz dabei aufgeführt ist nach Analogie mit der Wärme; denn es gibt dabei, ganz auf dem Boden dieser physikalischen Hypothese, etwas konsistenteres (stichhaltigeres): die Forderung einer Basis Wirklichkeit (was auch immer das sei), die die Einheit der materiellen Elemente gewährleistet. Dieses ist nicht mehr eine plausible Hypothese sondern ein notwendiges Postulat. Wenn er bevorzugt diese logische Notwendigkeit ins Auge fasst, spricht Kant lieber vom „Äther“ als vom Wärmestoff oder er macht wenigstens darauf aufmerksam, von diesem letzteren Wort jede Erinnerung an eine Sinneswahrnehmung der Wärme5 fernzuhalten. 5 Zum Beispiel: O. P., Konv. XII. Ak., Bd. XXII, S. 60728−29 . Vgl. S. 60620−26 . Die fundamentale Materie – der Äther – trägt die Körper und ihren Mechanismus, ohne selbst ein Mechanismus zu sein: „Absolute materielle Totalität, in sich subsistierend, zuinnerst und ursprünglich bewegt und bewegend durch Anziehung und Abstoßung, unabhängig von mechanischen bewegenden Kräften1 und, 210 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ folglich konzipiert als unwägbar, nicht zusammendrückbar, der Kohäsion oder Exhaustion (Erschöpfung) nicht unterworfen, also alle Dinge durchdringend, postuliert (unter dem Namen des Wärmestoffs (Phlogiston) oder des Äthers, das ist unwichtig) als Basis des elementaren Systems der dynamischen bewegenden Kräfte2 , weit davon entfernt, nur eine erklärende Hypothese von Phänomenen zu sein, ... ist sie rational gefordert in einem System von ursprünglichen bewegenden Kräften, als Prinzip der Totalität der anfänglichen Bewegung, der unablässig erneuerten Erschütterung, [an dem dieses System nicht vorbeigehen kann]3 “ 1 „Mechanisch bewegende Kräfte sind die, welche die ihnen erteilte Bewegung anderen mitteilen. Dynamisch bewegend sind die, welche automatisch sind, z.B. Attraktion“ (Ebenda, S. 615[ 16 − 18]) 2 Siehe vorherige Anmerkung 3 Ebenda., S. 60810−21 . Vgl. S. 5993−10 . Adickes4 führt diese Eigenschaften des Äthers auf die vier folgenden zurück: 1. Er ist ein Kontinuum das den ganzen Raum ausfüllt. 2. Er durchdringt alle Dinge. 3. Er bewegt sich selbst in allen seinen Teilen 4. Diese spontane Bewegung ist ständig, dauernd. 4 Kants Opus postumum, S. 399, Nr. 174 Wir erreichen also die äußerste Grenze der Schlüsse, die Kant glaubt a priori formulieren zu können die Struktur der Materie betreffend: „Die Behauptung der Existenz des Äthers ist logisch das Echo auf [die Betrachtung der] Erfahrung als absolute Einheit [als Totalität]5 “ 5 O. P., Konv. XII. Ak., Bd. XXII, S. 615[ 3 − 4]. „Dieser Äther kann also nicht willkürlich in die Physik eingeführt werden, nach Art eines hypothetischen materiellen Elements, entsprechend irgendeiner partikulären Spezies von bewegenden Kräften, (z.B. der Wärme oder des Lichts): er gehört wirklich nicht zur [experimentellen Physik], sondern zum Übergang von den M. A. d. N. W. zur Physik 6 “ 6 Ebenda., S. 60523−26 . Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1“ 267 1 „Übergang zur Grenze alles Wissens“ (O.P. Konv.I, Ak, Bd. XXI, S. 99−11 ) 211 Buch II: Das „Opus postumum“ §1.– Verallgemeinerung des Problems des Übergangs 268 Der Übergang hat uns gezeigt, was die Materie der sinnlichen Wahrnehmung sein muss, um die Erfahrung möglich zu machen. Die Form der Wahrnehmung verlangt nach einer ähnlichen Untersuchung: von welcher Natur muss diese Form sein, das heißt, welchen Bedingungen a priori muss sie sich unterwerfen, um allen theoretischen Forderungen der Erfahrung zu genügen? Die allgemeine vom O. P. gegebene Antwort unterscheidet sich nicht substantiell von dem, was schon die Fortschritte und vielleicht selbst die Kritiken. enthielten. Die universelle Form der sinnlichen Anschauung (Räumlichkeit und Zeitlichkeit) muss konstruiert sein durch die Spontaneität des Subjekts; sie muss also a priori hervorgehen aus dem Verstand, entsprechend dem Prinzip der Synthese (Zusammensetzung) der Wahrnehmungen; dass sie „autonom“ ist, nicht „heteronom“; so beschaffen in einem Wort, dass das „Aggregat der Wahrnehmungen ein System konstituiert, das durch notwendige Identität EINES ist, das heißt, das in sich die absolute (unbedingte) Einheit2 einschließt“ 2 0. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 44710−20 . Vergl. den ganzen Kontext. Die höchste synthetische Einheit auferlegt also der ganzen Hierarchie der Formen a priori einschließlich der Form der sinnlichen Anschauung ihre Anforderungen. Nun aber führt diese synthetische Einheit in letzter Analyse sich zurück auf die Einheit des „ich bin“, der Synthese von Subjekt und Objekt im Selbstbewusstsein: „Das Selbstbewusstsein, das Anschauung und Denken vereinigt in einer einzigen Repräsentation (Vorstellung), konstituiert die Erkenntnis im eigentlichen Sinn. Der Imperativ, dem der Verstand sich unterwirft (das nosce teipsum = erkenne dich selbst) auferlegt dem Subjekt, das schon zum Objekt der Anschauung gemacht ist, das Prinzip, das es zum [Objekt eines] Begriffs erhebt, anders gesagt, das Prinzip, welches das intuitive Objekt dem begrifflichen Objekt unterwirft3 “. 3 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 225−10 . Die elementare Wahrnehmung gehorcht also einer Art theoretischem Imperativ, der abzielt auf die absolute Einheit des Bewusstseins von sich selbst (“nosce teipsum“), und der seine Rolle spielt in einem „Ganzen“, beherrscht in letzter Instanz durch den moralischen Imperativ: „Die Erfahrung stellt das Ganze der fortschreitenden Reihe dar, die das empirische Bewusstsein in einer unaufhörlichen Annäherung abspult. Als Gesamtheit ist sie absolute Einheit; wenn es erlaubt ist, von den Wahrnehmungen im Plural zu sprechen, ist es das nicht, von Erfahrungen im Plural zu sprechen... Es existiert 212 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ eine Natur, die alles umschließt, was den Raum und die Zeit besetzt: in dieser Natur trägt die Vernunft alle physischen Relationen zusammen in einer Einheit. Es ist da eine höchste (souveräne) Wirkursache, die in Freiheit in den mit Vernunft begabten Seienden wirkt; und mit ihnen [gibt es dabei] einen kategorischen Imperativ, universelles Band zwischen ihnen; und mit diesem Imperativ, [gibt es] ein erstes Sein, allen Dingen aktiv gegenwärtig (allbefassend), Autor des moralischen Gebots. Einen Gott1 “ 2 269 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII S.1042−12 Diese Erweiterung des im Übergang von den M.A.N.W. zur Physik gestellten Problems nach oben, wird das beherrschende Objekt der Beschäftigung Kants erst in unmittelbarer Nähe des Jahres 1800. Gibt es zwischen den zwei Gruppen von Fragen, die so durch den Unterschied des Datums der Konvolute, wo sie erscheinen, begrenzt sind, irgendein tieferes Band als die chronologische Abfolge? Unter den Kritikern, deren Ansicht heute noch zählt, hält Vaihinger die jüngsten epistemologischen Entwicklungen des O. P. für ein zweites Werk, von Kant geplant unabhängig vom Übergang ... zur Physik. Die Überzeugung von Krause, die sich auch an die Idee von zwei völlig verschiedenen Werken anknüpft, von denen das zweite, kaum konzipierbar vor der Vollendung des ersten, als Objekt gehabt hätte, das System der kantschen Metaphysik zu krönen durch die schließlich verwirklichte Synthese der theoretischen und der praktischen Vernunft. Die Hypothese von zwei unabhängigen Traktaten hat sehr viel von ihrer Wahrscheinlichkeit verloren. Aber muss man im entgegengesetzten Sinn so weit gehen wie Adickes und beinahe ausschließlich die abschließenden epistemologischen Ansichten des O. P. auf eine „Erweiterung der primitiven Ebene“ des Übergangs zur Physik2 beziehen? 2 Adickes, Kants Opus postumum S. 722 ff. Wir wagen es nicht, das zu behaupten. Andererseits hat diese Frage der literarischen Komposition für uns nur ein Interesse in dem Maße, wo sie logische Beziehungen aufdeckt. Nun aber scheint es uns: 10 Einerseits, entsprechend den Ansichten von Adickes, würde die neue Skizze des transzendentalen Systems voraussetzen, • dass die Hauptthese des Übergangs zur Physik feststeht, das heißt, der synthetische Ursprung a priori der ganzen qualitativen Mannigfaltigkeit in der empirischen Anschauung, unterscheidbar als formartiges Element: • tatsächlich wird nur die Form erkannt als Form, geeignet dafür, in den apriorischen Rahmen eines „Systems der Welt“ eingeführt zu werden. 213 Buch II: Das „Opus postumum“ 270 20 Andererseits – darin schwächen wir die These von Adickes ein wenig ab – • waren die epistemologischen und metaphysischen Schlüsse, durch die sich das O. P. vollendet, schon latent, implizit postuliert in den Aporien, die dem Geist Kants keine Ruhe ließen seit der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft1 : 1 Siehe oben S. 138-221 • Dazu dass diese Schlüsse sich in ihrer ganzen Weite einem Philosophen aufdrängen, der mehr und mehr angetan ist von einer „systematischen Ganzheit“ musste sicher ein letztes Kettenglied geschmiedet werden: – es war nötig zu zeigen die grundlegende Rationalität der empirischen Mannigfaltigkeit, eröffnet im „System der Welt“. – Von dem Augenblick ab, wo diese Mannigfaltigkeit rational erschien, abhängig vom Apriori des Subjekts, war das letzte Hindernis für die perfekte Einheit der kritischen Metaphysik im Prinzip zerstreut. Der Übergang von den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik macht möglich (ohne ihn logisch zu fordern) einen Übergang zur Grenze aller Wissenschaft2 . 2 Siehe den Titel dieses Paragraphen S.267 Aber das Projekt des zweiten Übergangs scheint zunächst eine gewisse Unabhängigkeit in Beziehung zum ersten gehabt zu haben. Tatsächlich fehlt es nicht an Texten, wo ein direkter Weg gezeichnet ist, der von den M.A.d.N.W. zur „oberen Grenze des Wissens“ aufsteigt unter Vermeidung des Umwegs über die „Physik“: „Von den M.A.N.W. muss man nun einen Rückschritt tun zur transzendentalen Philosophie als einem System der Ideen der reinen Vernunft3 , soweit diese Ideen synthetisch sind und a priori aus der3 Vernunft sich herleiten.“ Auf diesem gleichen Blatt definiert Kant die transzendentale Philosophie: „Das System der Ideen in einem absoluten Ganzen“ (Zeile 26). Anderswo ist die Transzendentale Philosophie definiert ausschließlicher durch ihre Methode und nicht durch das ideale Produkt dieser Methode, zum Beispiel Konv.I, Ak. Bd. XXI, S.8520 -864 „Sie reduzieren sich auf die Idee von Gott, auf die der Welt und auf die des Menschen, der sich frei bestimmt in der Welt. Wir verstehen hier die Welt nicht als Objekt der empirischen Anschauung und der Erfahrung4 “. 4 O. P. Konv. I, Bd. XXI, S.8020−25 , Vergl. S.8514−19 Andererseits ist der Übergang zur Physik nicht nur daneben gestellt sondern dem Übergang zur Transzendentalphilosophie entgegengestellt: sie sind „ganz verschieden“: der erste, auf die M.A.N.W. gestützt, 214 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ „erweitert sich bis dahin, das System der Ideen zu konstituieren, durch die das Subjekt sich den Grund a priori von sich selbst gibt und dadurch bis dahin gelangt den formartigen Aspekt, der für die Gesamtheit der Objekte konstitutiv ist5 , zu erreichen“; 5 Ebenda S.10218−20 . [der zweite Übergang hat als Ziel] „die transzendentale Philosophie, betrachtet als Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung, [das heißt] als autonome Bereitschaft (Disposition) des Systems der sinnlichen Objekte, im Blick darauf, die Erfahrung möglich zu machen6 “ 271 6 Ebenda S.10223−25 Wir können uns, mehr als der Autor des O. P. selbst, davon dispensieren, den Parallelismus und den Gegensatz dieser zwei Gesichtspunkte aufzuklären, von denen der erste vor allem die konstruktive Aufgabe des Subjekts betrifft und die zweite die logischen Bedingungen des Objekts. Von Rechts wegen fallen sie in ihrem absoluten Höhepunkt zusammen, der Tatsache nach scheinen sie unter der Feder Kants mehrfach als vertauschbar, praktisch äquivalent. Halten wir uns damit an die zwei folgenden Texte – zwei „Programme“ – woraus mehr oder weniger die Absicht hervortritt, die besonderen Themen der zwei Übergänge in einem einzigen Werk zu gruppieren: 1. Übergang v. d. M. A. N. W. zur Physik. 2. Übergang von der Physik zur transzendentalen Philosophie. 3. Übergang von der transzendentalen Philosophie zum System [der Beziehungen] zwischen Natur und Freiheit. 4. Schluss auf die universelle Verknüpfung der lebendigen Kräfte aller Dinge in der gegenseitigen Relation von Gott und der Welt1 1 O. P., Konv I. Ak., Bd. XXI, S. 1720−24 Das zweite Programm präsentiert sich als ein Projekt der „Einleitung“: 1. Übergang von den M. A. N. W. zur transzendentalen Philosophie 2. Übergang von dieser auf eine allgemeine Lehre über die Erfahrung, das heißt auf eine allgemeine Physik, betrachtet in ihren formalen Bedingungen. 3. Von der natürlichen Philosophie auf eine Lehre von der Freiheit... 4. Weiterleitung zu einer Physik als System: Gott, die Welt und der Mensch, dem moralischen Imperativ unterworfen2 . 2 O. P., Konv I. Ak., Bd. XXI, S. 6115−22 §2.– Die Dreiheit „Gott, Ich, Welt“ 272 Das Konvolut I des O.P. vervielfacht die geplanten Titel für das große Werk, wo Kant davon träumte, die Synthese seiner Philosophie zu vollenden. Die ersten Versuche führten noch nicht das charakteristischste Element dieser Synthese im Titel selbst ein. Man liest zm Beispiel auf der ersten Seite des ersten Blatts: 215 Buch II: Das „Opus postumum“ „Übergang zur Grenze allen Wissens: Gott und die Welt. Eine Gesamtheit des Seins, Gott und die Welt, gruppiert nach ihrer gegenseitigen Beziehung, im synthetischen System der Ideen der transzendentalen Philosophie, durch 3 ..“ 3 O. P., Konv I. Ak., Bd. XXI,S.99−11 Die Welt, nach der hier die Frage ist, besteht nicht in einer Summe – immer unvollendet – von partikulären Wahrnehmungen, sondern in der Erfahrung als ganzer, repräsentiert in unseren Begriffen durch das Prinzip a priori ihrer Möglichkeit1 1 vergl. O. P., Konv I. Ak., Bd. XXI,S.1013−18 Bezüglich Gottes, absoluter Höhepunkt in der Ordnung der Spekulation und des Wollens, stellen sich zwei Fragen. Die erste „Wer, Was ist Gott?“ – wird gelöst durch die strenge Analyse des Begriffs des vollkommenen Seins. Die zweite – „Gibt es einen Gott?“ – löst sich gar nicht auf durch einfache Analyse von Begriffen, sondern nur, wie es die Kritiken festgestellt haben, durch Vermittlung eines vernünftigen Seins, existierend in der Welt, aber in sich selbst „das göttliche Gebot verspürend“ unter der Form des „kategorischen Imperativ2 “. 2 vergl. ebenda S. 9-11 da und dort Gott und die Welt würden erscheinen an zwei objektiven Polen der Erkenntnis, als entgegengesetzte „Maxima3 “; 3 273 ebenda S.1012 vergl. S. 2013−14 Das System, das sie in unserem Denken verbindet, kann nur eine „Kosmotheologie4 “ sein, die, um möglich zu werden, einen Vermittler voraussetzt, angrenzend an die zwei Extreme: einen „Kosmo-theoros“, alles zusammen „Bewohner der Welt“ und „fähig, aus seiner eigenen Tiefe die Elemente einer Erkenntnis a priori der Welt zu ziehen, das heißt fähig, mittels dieser Elemente eine Idee zu konstruieren, der Anschauung des Universums selbst, das er bewohnt5 “. Das „freie Subjekt in der Welt“, der Mensch, moralisches Subjekt, vereinigt diese Bedingungen: er muss nicht aus sich selbst herausgehen, um „den höchst möglichen Grad des Fortschritts im System der reinen Vernunft“ zu erreichen: „Gott und die Welt6 “. 4 ebenda S.1711−17 , 2017−19 , und anderswo. ebenda S.3123−25 Cosmotheoros = „Weltbeobachter“ (ebenda S.4331 oder „Weltbeschauer“ (ebenda S.5536−7 ) 6 Op. cit., p. 205−6 . 5 So zeichnet sich immer klarer die Trilogie ab, die das ganze transzendentale System auf den Punkt bringt. Sehen wir uns einige Bemühungen Kants an, um sie sich im allgemeinen Titel des Werks vervollständigen zu sehen. Er begnügt sich zuerst damit, die zwei „Maxima“ zu erwähnen „Gott und die Welt7 “ 216 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ 7 Op. cit., S. 162−5 . Alsbald fügt sich der dritte Term hinzu: „Gott, die Welt und Ich8 “; 8 Op. cit., S. 234 . dann diese oder jene Bestimmung des hinzugefügten Terms; zum Beispiel: „Gott, die Welt und das Bewusstsein meiner Existenz in der Welt, im Raum und in der Zeit9 “ 9 Op. cit., S. 2422−23 . Oder auch: „Gott, die Welt und der Mensch als Person1 “. 1 Op. cit., S.2914 . vgl. S. 3118−19 Oder auch „Gott, die Welt und (der Mensch) das denkende Wesen in der Welt2 “ 2 274 Op. cit., S.3212 Die vorausgehenden Titel bleiben stumm über die Relation des dritten Terms zu den zwei anderen. Sie könnte formuliert werden wenigstens in einer allgemeinen Weise, z.B.: „Gott, die Welt und der Geist des Menschen, der beide denkt3 “; „Gott, die Welt und das beide Objekte verknüpfende Subjekt, das denkende Wesen in der Welt4 “ 3 Op. cit., S.2925 4 Op. cit., S.3413−14 Andere Formulierungen, wo der Ausdruck der bilateralen Beziehung des Ich fehlt, sind dafür in anderen Punkten weitschweifig, zum Beispiel: „Gott, die Welt und dieser ihr Inhaber, der Mensch in der Welt5 “; 5 Op. cit., S.3822−23 oder diese andere, willkommenere: „Gott, die Welt und der dem Pflichtgesetz unterworfene Mensch in der Welt6 “ 6 Op. cit., S.918−9 Eine andere Idee, interessant in sich selbst, kommt zum Durchbruch in einigen Überschriften: zum Beispiel: „Gott, die Welt und der sein Dasein a priori synthetisch bestimmende Mensch in der Welt7 “, oder noch besser, indem er die Ideen der moralischen Pflicht und der Selbst-Bestimmung heran holt: „Gott, die Welt und der durchs Pflichtgebot sich selbst gesetzgebende Mensch in der Welt8 “. 7 Op. cit., S.3916−17 8 Op. cit., S.569−10 Kant versucht andererseits in der gleichen Epoche auch weniger ausdrucksvolle oder anders orientierte Formulierungen: „Gott, die Welt und Ich (der Mensch) in einem System der transzendentalen Philosophie, vereinigt vorgestellt von...9 “ 9 Op. cit., S.4217−20 vgl. S. 461 217 Buch II: Das „Opus postumum“ „Gott und die Welt, das All der Wesen, in einem System im höchsten Standpunkt der Tranzendental-Philosophie, vorgestellt ... 1 “ 1 Op.cit. S.5220−22 Zugleich mit der ganzen Reihe der vorausgehenden Überschriften führen andere auf der ersten Ebene die Idee eines „Systems der TranszendentalPhilosophie“ an. Hier einige Beispiele davon: „System der Transzendental-Philosophie in drei Abschnitten: Gott, die Welt2 “. „Gott und die Welt. Ein System der Ideen im höchsten Standpunkt der Transzendental-Philosophie, vorgestellt von ...3 “. „Der höchste Standpunkt der TranszendentalPhilosophie, im System der Ideen ... 4 “ 275 2 Op. cit., S. 273−5 . Op. cit., S. 5218−19 . Op. cit., S. 542−3 ; „Der Transzendental-Philosophie höchster Standpunkt: Gott, die Welt...“ op.cit. S.3210−12 (man erkennt wieder, dem Buchstaben nach genommen, den Titel des Bandes III der Erläuterungen von Beck). Vgl. S.593−6 3 4 Bemerken wir noch diese Formulierung, sehr zögernd, die unterstreicht die Tragweite des Werkes, eine Art und Weise des exegi monumentum, vorausgenommen in einem ehrgeizigen Traum; „Die reine Philosophie in der Vollständigkeit ihres Systems dargestellt von I[mmanuel] K[ant]5 “ 5 Op. cit., S. 9525−26 . Hier nun endlich der Titel, – ein wenig lang –, wo die präzisesten Anzeichen angehäuft sind: „Der Transzendentalphilosophie höchster Standpunkt im System der Ideen: Gott, die Welt und der durch Pflichtgesetze sich beschränkende Mensch in der Welt, vorgestellt von ...6 “ 6 Op. cit., S. 593−10 . Ein einfacher Kommentar dieses Titels würde schon eine gute Darlegung der großen Linien des kantschen transzendentalen Systems in seinem Endzustand liefern. Bevor wir diese hier darstellen, müssen wir noch einige Begriffe und einige Thesen überfliegen, die dem erweiterten Horizont eigen sind, den wir erkunden wollen. §3.– „Setzung und Selbstsetzung“ 276 Fichte und Beck – wir haben es schon weiter oben festgestellt – warfen Reinhold vor, eine Tatsache oder einen Satz an die Wurzel des kritischen Systems zu platzieren, während man doch offensichtlich bis zu dem Akt oder zu der 218 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ Handlung aufsteigen muss, die diese ersten formalen, in der Blüte des Bewusstseins entfalteten Produkte, stützen. Und wir haben die verständnisvolle aber noch reservierte Haltung von Kant diesem Versuch der Vertiefung des Kritizismus gegenüber bemerkt. Er selbst ging, seit langem, vorsichtig in dieselbe Richtung weiter: sein Beharren auf dem Primat der Synthese bei der Bildung der Erkenntnis, seine Theorie des Zusammensetzens in den Fortschritten, sind sehr klare Anzeichen dafür. Das O. P., das die letzten Furchtsamkeiten fallen ließ, verallgemeinert die Anwendung der Idee der Setzung (oder der Handlung). Die Priorität der Setzung über die „Form“ in der „empirischen Affektion“ und in den reinen Anschauungen von Raum und Zeit, hat uns schon beschäftigt, und kann keinen Zweifel lassen1 . Wir wollen, unter Inkaufnahme einiger Wiederholungen, Kant hören, wie er noch weitere Sichten darlegt: 1 Siehe weiter oben S.257-263 (§3), 253 (§2) „Der erste Akt der Erkenntnis ist das Wort (Verbum): ich bin Bewusstsein meiner selbst (Selbstbewusstsein), weil ich, Subjekt, für mich selbst Objekt bin. Schon darin liegt eine Relation im Voraus zu jeder Bestimmung des Subjekts... Das Bewusstsein von sich (Apperzeption) ist ein Akt, durch den das Subjekt sich in einer allgemeinen Weise zum Objekt macht. Das ist noch nicht eine Wahrnehmung (perception), [die eine subjektive Affektion in einer empirischen Intuition voraussetzen würde] ... aber es ist zuerst eine reine Intuition, die, unter den Etiketten von Raum und von Zeit nur das formartige Element der Synthese (coordinatio et subordinatio) des intuitiven Mannigfaltigen enthält 2 “ 2 277 O.P. Konv. X Ak, Bd. XXII S. 4132−4 ,11−13 , 15−18 Die Anschauungen von Raum und Zeit sind nicht in sich selbst wahrgenommene „Dinge“, „sondern sie konstituieren ein [virtuelles] Ganzes der Anschauung, die objektiv nur ein reines Phänomen sein könnte, dem das gedachte Objekt als Ding an sich3 nur als Idee entspricht“. 3 Op. cit. S. 42331 -4144 Weit davon entfernt, sich auf partikuläre Wahrnehmungen zu stützen, geht man in der „Synthese der Anschauung“ „aus von einem Prinzip a priori, das das Formale der Anschauung steuert, und man geht von da aus weiter bis zum Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung: ohne noch irgendetwas von der konkreten Erfahrung herzunehmen, setzt man sich selbst. [Tatsächlich], die Existenz des Bewusstseins im Raum und in der Zeit reduziert sich ganz auf ein Phänomen des inneren Sinns oder des äußeren Sinns, und ruft als solches so wie eine Affektion des Subjekts, nach einem synthetischen Prinzip a priori der Anschauung, sich selbst als existierende 219 Buch II: Das „Opus postumum“ Sache in der Raum-Zeit machend. Das Subjekt übernimmt hier die Funktion vom Ding an sich, weil es begabt ist mit Spontaneität. Das Phänomen (die Erscheinung) dagegen, ist Rezeptivität; dabei sehen wir kein anderes Objekt [als das Subjekt], sondern nur eine andere Art [für das Subjekt], sich zum Objekt zu machen. Das intelligible Objekt, weit davon entfernt, ein noumenales Objekt zu sein (objectum noumenon [=gedacht]) ist [in Wirklichkeit] der Akt des Verstandes, der den Inhalt der sinnlichen Anschauung1 zum Phänomen macht“. 1 Op.cit. S.41424 − 4155 Die höchste Apperzeption der empirischen Affektion, die objektiven „Setzungen“, bewirkt durch das Subjekt, staffeln sich wie ebensoviele „partielle Selbstsetzungen“ unter der Führung einer ursprünglichen (=primitiven) „Selbstsetzung“, des reinen „Bewusstseins von sich“. Tatsächlich: „Meine Erkenntnis ist ganz und gar eine mehr oder weniger enge Teilhabe am Bewusstsein von mir selbst ... Dieser Akt der [reinen] Apperzeption (sum cogitans) ist noch nicht ein über ein Objekt gefälltes Urteil (judicium), anders gesagt, ist nicht diese Relation von Prädikat zu Subjekt, die [im engen Sinn] eine Erkenntnis begründet ...; es ist noch weniger eine [analytische] Schlussfolgerung vom Typ: ich denke also bin ich2 “. Es ist die „Handlung des Subjekts3 “, das sich zum Objekt macht, bevor es sich irgend eine partikuläre Bestimmung gibt. 2 0. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 8923 -905 . 3 Op. cit., S. 8915−16 . „Vermittelt durch dieses [primitive = ursprüngliche] Bewusstsein von mir selbst, muss ich mich objektiv nur noch befassen mit meinen Fähigkeiten der Repräsentation [das heißt: ich habe, um objektiv zu erkennen, nicht mehr nötig, als meine subjektiven Fakultäten der Repräsentation spielen zu lassen]. Ich bin für mich selbst ein Objekt. Sogar die Setzung von irgendetwas außer mir geht von mir aus, unter den räumlichen und zeitlichen Formen, wo es immer noch ich bin, der die Objekte des äußeren Sinnes und des inneren Sinnes einordnet. Und es ist das, warum [Raum und Zeit] sich bis ins Unendliche erstreckende Setzungen (Positionen) sind (welche darum unendliche Setzungen sind). So besteht die Existenz der Dinge im Raum und in der Zeit in nichts anderem als in der omnimoda determinatio, rein subjektiv, [der Raum-Zeit]4 “ 278 4 Op. cit., S. 9710−15 . Kurz, so schließt Kant am Ende des Konvoluts X: 220 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ „[In der Transzendental-Philosophie] haben wir nur mit der synthetischen Erkenntnis a priori zu tun, mit der Synthese des Vielfältigen der Anschauung in der Raum-Zeit und mit einem Objekt, das wir selbst machen, alles zusammen wie Zuschauer und wie Urheber1 “ 1 279 Op. cit., S. 4217−10 . Diese Hierarchie der, allgemeinen und partikulären „Setzungen“ des Subjekts, war im Keim, so scheint es uns, seit der zweiten Auflage der Kritik (1787), explizit erkannt in der absoluten Priorität für den Akt der Synthese gegenüber der synthetischen Form. Es ist wahr, dass die Struktur der Erkenntnis da ausgedrückt war, bevorzugt, durch seine „formalen“ Abstufungen: Begriffe und Kategorien, Zeit und Raum als „Daten a priori“ bekannt im empirischen Objekt. Aber dieser formale Aspekt ist wirklich nicht ganz geopfert im O. P.; Denn der Moment „Setzung“ bleibt dort unvermeidlich gefolgt von einem Moment „Reflexion“, der die Form der immanenten Setzung anhält (stoppt) und begreift2 . 2 Vgl. zum Beispiel diese Anmerkung: „Zwei Determinationen: 1. Ich denke; 2. Ich weiß, dass ich denke. Zwei Funktionen: der Determination [synthetische Funktion] und Reflexion [analytische Funktion]. Logische Reflexion [ist] noch eine höhere oder absolute Reflexion“ (op.cit. S. 3054−6 ). Das Wort „Reflexion“ ist kaum verwendet im O.P.; aber die elementare Funktion, die ihr entspricht, findet sich da auf jedem Schritt und Tritt: jedes Mal wenn ein formaler Aspekt der Aktivität des Subjekts sich objektiv im Bewusstsein abhebt. Indem man so mit dem höchsten synthetischen Prinzip unserer Erkenntnisse umgeht, dem „Subjekt als Selbstschöpfer3 “ aller formalen, objektiv in unserem Denken gegenwärtigen Bestimmungen, nähert man dann nicht in merkwürdiger Weise die Eigenschaften der spekulativen Vernunft denen der praktischen Vernunft an? Ihr Abstand erscheint erheblich verringert, wenn man sich berechtigt fühlt in Bezug auf die ersteren die Worte „Imperativ“ und „Autonomie“ zu verwenden, die wir weiter oben4 gefunden haben, siehe sogar das Wort „Autokratie5 “, vorher für den moralischen Willen reserviert, aber hier übertragen in die theoretische Domäne: 3 O.P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 2132 4 vgl. S. 258, und Seite 267-268 5 Op. cit., 9112 : „Die Selbstscöpfung der Ideen (Autokratie)“ „Die transzendentale Philosophie ist die autonome Schöpfung (Autokratie) der Ideen, mit der Wirkung, durch sie ein vollständiges System der Objekte der reinen Vernunft zu konstituieren6 “ 6 Op. cit., S. 8410−11 . Indem man die „reflektierende“ Methode des Übergangs verallgemeinert, wäre es also möglich in einem homogenen System, grundsätzlich identisch um die „Setzung“ herum, alle Grade der strukturellen menschlichen Erkenntnis zu 221 Buch II: Das „Opus postumum“ organisieren, angefangen von der höchsten und universellen Einheit des Bewusstseins bis zur untersten, partikulären, existentiellen (im kantschen Sinne) Grenze, charakterisiert durch die subjektive omnimoda determinatio1 . 1 Siehe weiter oben S. 130 Im Wesentlichen dynamisch, objektiviert die „Setzung“, die „Akt, Handlung, Tun, Machen“ usw. ist, das Subjekt nur, indem es dieses, den gestuften Begrenzungen entsprechend, einzeln aufführt erörtert. Können wir nun das absolut erste [=Einheit gebende] Prinzip dieser objektiven Zersplitterung des Ich in diesem selbst erahnen? §4.– Die Person (das moralische Subjekt) 280 Nachdem wir daran erinnert haben, dass die Reflexion uns über den kategorischen Imperativ unsere Verpflichtungen wie ebensoviele „göttliche Gebote“ ins Auge fassen lässt, lässt Kant nebenbei folgende Bemerkung fallen: „Begriff der Freiheit. – die praktische moralische Vernunft ist eine der bewegenden Kräfte der Natur und [vollzieht sich] an allen Objekten der Sinne2 “ 2 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 10510−12 . Buchstäblich genommen würde diese Formulierung beträchtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Überschreiten wir nicht den aktuellen Horizont von Kant: der Philosoph will nur behaupten, dass die sinnlichen Objekte der bewegenden Kausalität der praktischen Vernunft „ein spezielles Übungsfeld“ bieten, um sich von da „zu den Ideen3 “ zu erheben, mit anderen Worten, um ein totales System des Seins und der Seienden zu errichten. Ideale Schöpfung, die das Werk der „Freiheit“ ist. 3 Ebenda Die Kritik der praktischen Vernunft hat uns die „Freiheit“ untrennbar von der „Moralität“ gezeigt. Das freie Subjekt, sich „seiner selbst bewusst“, „autonom“ und „autokrat“, offenbart sich zugleich „legislatorisch“ und (wenn sie nicht selbst „die vollkommene Heiligkeit ist“), „unterworfen der Verpflichtung des Gesetzes“. Absoluter Anfang und Ziel in sich, ist es in diesem Maße Träger von „Rechten“, von denen es Bewusstsein hat. Wir begegnen auf diese Weise dem kantschen Begriff der Person wieder, der eine wichtige Rolle spielt im zweiten Teil des O. P.: „Die Person ist ein Sein, das Rechte besitzt, von denen sie Bewusstsein hat4 “ 4 Op.cit. S. 5116−17 „Wenn sie nur Rechte hat und nicht Pflichten, ist es Gott5 “l 222 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ 5 Op.cit., S. 4924 „Jedes lebende Wesen, das Bewusstsein von sich hat, enthält ein immaterielles Prinzip und ist eine Person 6 “ 6 281 O. P., Konv. I, Ak., Bd. XXI, S. 666−7 . Vgl. S. 1215−19 . Im System der Seienden begegnet man den charakteristischen Eigenschaften der Person nur in Gott und beim Menschen. Befassen wir uns zuerst mit diesem letzteren. Der Mensch, obwohl Person, erleidet die despotische Macht der Natur1 : 1 Op. cit. S. 1329 „Das Ich (das Subjekt, das ich bin) ist nicht nur eine Person, seiner selbst bewusst, sondern ein Objekt der raum-zeitlichen Anschauung, also zur Welt gehörend. Dennoch – Zeuge ist der kategorische Imperativ – bin ich ein Sein begabt mit Freiheit und als solches gehöre ich nicht mehr zur Welt, wo jede Kausalität verknüpft ist mit dem Raum und der Zeit, während der kategorische Imperativ das Werk eines göttlichen Seins ist, das handelt als Person [und nicht, sagt Kant anderswo, als „Demiurg“]: also, in der aktiven Bestimmung meiner selbst, kommt (das ist ein Proprium der menschlichen Natur) eine technisch-praktische und zugleich praktisch-moralische, rationale Macht ins Spiel2 “. 2 Op. cit., pp. 4222 -432 . Präziser: „Der Mensch gehört zur Welt durch seine äußere Sinnlichkeit. Jeder Mensch ist bestimmt durch Heteronomie [als Sein der Natur], aber er ist es zur gleichen Zeit als Person, indem er sich einem Gesetz der Autonomie unterwirft. Die Person ist ein Sein, das sich selbst bestimmt durch die Prinzipien der Freiheit3 “ 3 Op. cit., S. 6215−18 . Die Autonomie des kategorischen Imperativs erhebt diesen über die Zwänge der Natur, aber sie schließt nicht diesen moralischen Zwang aus, der die dem Menschen auferlegte Verpflichtung ist, sich „einzuschränken“ insofern er handelnd ist „in der Welt“. Wir sind (S.275) der sehr ausdrücklichen Formulierung begegnet: „... der durch Pflichtgesetze sich beschränkende Mensch in der Welt4 “ 4 282 Op. cit., S. 593−10 , Alles das, was letztendlich nur die Kritiken wiederholt, setzt eine enge Entsprechung und, sozusagen, eine Konnaturalität zwischen dem als „Person“ handelnden Menschen und der, dessen Handlung erleidenden, Welt voraus. Wie kann man diese Konnaturalität verstehen, da der Mensch auf keiner Stufe der Autor der Natur ist, weder von seiner eigenen noch von der, die ihn umgibt? 223 Buch II: Das „Opus postumum“ Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt in der Vollkommenheit dieser schöpferischen Freiheit, in der unsere Vernunft den Autor der Natur und das Fundament der moralischen Werte wiedererkennt (anerkennt). „Ein Sein das, am Ursprung, der universelle Gesetzgeber sowohl der Natur als der Freiheit ist, siehe da, das ist Gott. Er ist nicht nur das höchste Sein, sondern die höchste Intelligenz und das höchste Gut (in der Ordnung der Heiligkeit): ens summum, summa intelligentie, summum bonum 1 “ 1 Op.cit. S. 143−6 Dergleichen Sein wird in hervorragender Weise eine „Person“ sein: „Im Begriff Gottes repräsentiert man sich eine Person, das heißt ein intelligentes Wesen, das zuallererst Rechte besitzt, aber das, zweitens [kraft seiner Vollkommenheit], ohne selbst beschränkt zu sein durch irgend ein Sollen, im Gegenteil allen anderen mit Vernunft begabten Seienden die [moralische] Beschränkung durch seine Gebote auferlegt2 “ 2 Op. cit., S. 1019−22 . Und da nach Kant die Existenz Gottes nur beweisbar ist durch die Notwendigkeit, sich auf ein vollkommenes und personales Sein zu berufen, um die Möglichkeit von unbedingt verpflichtenden und ebenso „in der Welt“ der Phänomene rechtskräftigen Gesetzen zu erklären, folgt daraus, dass unsere Idee des Schöpfers wesentlich die einer vollkommen heiligen Absicht einschließt, nicht nur die geschaffenen Willen dem moralischen Imperativ zu unterwerfen, sondern mögliche Ziele für unsere verpflichtende Handlung anzubieten. Die Freiheit Gottes als Prinzip einer moralischen Ordnung, nimmt so den absoluten Höhepunkt aller Dinge ein, in uns und außer uns: „In ihr, das heißt in der Idee von Gott als dem moralischen Sein, leben wir, weben (handeln) und sind wir, angeregt durch die Erkenntnis unserer Pflichten als göttliche Anordnungen. Der Begriff von Gott ist die Idee eines moralischen Seins, das insofern es so beschaffen ist, insofern es moralische Regel ist, universell befehlend (welches, als ein solches richtend, allgemein gebietend ist). Dieses Sein ist nicht etwa ein hypothetisches Ding: es ist die Personifizierung der reinen praktischen Vernunft selbst, mit ihren eigenen bewegenden Kräften die Seienden des Universums und ihre Kräfte beherrschend3 “ 283 3 224 O.P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 11811−18 . Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ Zerstört dieser Satz, den wir gerade niedergeschrieben haben, nicht, indem er es zurückführt auf eine „Fiktion“ (Dichtung, Schein), gerade das Gebäude, von dem es schien, dessen Krönung zu setzen? Die göttliche Freiheit, höchste Lösung aller Rätsel der Philosophie, hätte sie nur als Realität die subjektive Realität der „reinen praktischen Vernunft“ in jedem einzelnen? Mehr denn je müssen wir vorsichtig weitergehen, um zu begreifen, wenn möglich, bis in die Nuancen hinein, das authentische Denken von Kant. Wir werden sukzessive prüfen, nach dem O. P. die zwei zusammenhängenden Probleme des Dings an sich und der Existenz Gottes. §5.– Die Realität des Dings an sich. Bis zur Epoche seiner Korrespondenz mit Beck und selbst später fehlt es nicht an Indizien für die fortdauernde Überzeugung Kants – nicht nur als Mensch sondern als Philosoph – von der Existenz der „Dinge an sich“ außerhalb des erkennenden Subjekts. Dagegen lässt eine schnelle Lektüre der Faszikel des O. P. nach dem Jahre 1799 (Konvolute XII, XI, X, VII und I) leicht vermuten, dass ihr Autor, welches auch immer seine privaten Überzeugungen gewesen wären, keinen Platz mehr hat, in seiner Philosophie, für die Existenz an sich von Dingen oder von Objekten (Dinge, Gegenstände). Wie steht es damit? Sicher, allgemeinen Behauptungen einer äußeren Realität begegnet man noch, isoliert und schlecht gestützt durch den Kontext, zum Beispiel: „Zur einfachen Wahrnehmung, äußerlich oder innerlich, gehören schon bewegende Kräfte sowohl der Materie außerhalb von mir als auch von ihrer Synthese in mir1 “ 1 Op.cit. S. 1813−15 284 Andere Formulierungen können zweideutig erscheinen. Wir fanden weiter oben (S. 250) die folgende, deren Text leider nicht sehr sicher ist: „Erkenntnis der bewegenden Kraft im räumlichen Phänomen im Gegensatz zur bewegenden Kraft in ihr selbst. [Einerseits] Erscheinung von der Erscheinung ... usw. [Andererseits] bewegende Kraft des äußeren Sinns, indirekt vollzogen in der Untersuchung der Natur: es ist das Subjekt, das in sich die Bewegung selbst bewirkt und verursacht, von der sie [die bewegende Kraft?] affiziert [erschüttert?] wird; [er? sie?] führt also a priori in das Subjekt [das Objekt vermutet Adickes] ein, gerade das, was dieses [das Subjekt] von außen empfängt2 ...“ 2 O. P. Konv. X, Bd. XXII, S. 32119−23 225 Buch II: Das „Opus postumum“ Verstehen wir das so, dass das Subjekt, handelnd an sich selbst nach Art einer natürlichen Kraft, dieser immanenten Handlung eine Form aufprägt parallel zu der, die außerhalb des Subjekts, das elementare Spiel der Kräfte der Materie präsentiert? Oder sogar, dass das Subjekt, durch eine spontane Handlung in sich selbst die rohen Bestimmungen rekonstruiert – „transzendente Affektionen“ – die es, andererseits von den „Dingen an sich“ empfangen hätte? Oder auch, nachdem von den Dingen an sich abstrahiert wurde, muss man verstehen, dass jeder Schein von Rezeptivität im Subjekt sich reduziert auf eine Passivität von diesem, sich selbst gegenüber, so dass die „bewegenden Kräfte“, wie auch immer sie beschaffen seien, immer und exklusiv eine subjektive Aktivität zum Ausdruck bringen? Anderes Beispiel einer ungewissen Formulierung: „Das reine Bewusstsein von sich ... ist noch nicht eine Wahrnehmung (apprehensio simplex ), das heißt, eine sinnliche Repräsentation, für die es erforderlich ist, dass das Subjekt affiziert wird durch irgendein Objekt und dass die Anschauung empirisch ist1 “ 1 285 Op.cit. S. 41311−15 Man könnte glauben, dass es sich um eine „transzendentale Affektion“ der Sensibilität handelt; aber lesen wir den Kontext, einige Zeilen weiter unten: „Ob das Vielfältige der Anschauung das Objekt repräsentierbar macht als Phänomen oder als Sein an sich, das macht keinen anderen Unterschied, als zu wissen, ob das formale Element [dieser Vielfältigkeit] gedacht werden muss als subjektiv geltend, das heißt für das Subjekt oder objektiv, für irgendeinen wer auch immer. Das kommt darauf zurück zu wissen, ob die Setzung [von etwas] uns ein Substantiv [eine bewirkte Setzung] oder ein Verb (Tätigkeitswort) [den Akt des Setzens] repräsentiert2 “. 2 Op. cit. S. 41321−26 Aber diese scheinbaren oder zweifelhaften – und, jedenfalls sehr seltenen – Behauptungen der Existenz der Dinge an sich, zählen kaum angesichts der vielen Stellen, die jede transzendente Interpretation der Begriffe des Dings oder des Objekts ausschließen. Wir wollen einige Beispiele von solchen negativen Sätzen überfliegen und wir werden danach versuchen, daraus eine genaue Interpretation des Denkens von Kant über den Punkt, der uns beschäftigt, herauszulösen. Wir haben weiter oben (Seite 251-253) den Begriff des Dings an sich – „Ding an sich = X“ – untrennbar verbunden gefunden mit dem der Erscheinung als eine Art von „conceptus infinitus“ zu diesem komplementär (Ding an sich = 226 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ nicht-Phänomen) gefunden. Was für eine logische Geltung hat diese negative Kehrseite des Phänomens? „Das Ding an sich, das dem als Phänomen repräsentierten Ding entspricht, ist ein reines Gedankending, aber dennoch nicht eine logische Absurdität, (kein Unding)3 “ 3 Op. cit. S.41522−23 In der objektiven Produktion des Phänomens (“objectum phaenomenon“) ist „das unbestimmte Ding an sich (“objekctum noumenon“) nur ein reiner Gedanke, dessen Funktion darin besteht, die [sinnliche] Repräsentation des Objekts im Rahmen des Phänomens beizubehalten, das heißt von dem, was nur indirekt erkennbar ist4 “ 1 Op. cit., S. 4165−9 . Man erkennt hier die Bedeutung des „Grenzbegriffs“, dem Ding an sich durch die Kritik unterstellt5 5 286 Siehe Heft III, S.160 (BIVK1) 3. Auflage S. 213-215 Nur ist das „negative Noumenon“ nunmehr beschränkt in der idealen Ebene der Repräsentation; es kommt gleich einem Verbot, das „phänomenale Objekt“ wie ein Objekt an sich zu behandeln, nicht mehr. Das ist es, was die dem Datum der vorhergehenden späteren Texte wiederholen: „Alles, was man sich als Phänomen vorstellt, ist als verschieden von dem gedacht, was das Objekt an sich selbst ist (so das Sinnliche gegenüber dem Intelligiblen). Aber das Objekt an sich (=X) bezeichnet kein partikuläres Objekt außerhalb meiner Vorstellung: es ist nur die als notwendig anerkannte Idee selbst einer Abstraktion des Sinnlichen. Nicht ein cognoscibile [begriffen] als intelligibile, sondern ein X; denn abstrahiert von der Form des Phänomens, bleibt [das Objekt an sich] trotzdem ein cogitabile (und, um die Wahrheit zu sagen, ein cogitabile, das sich dem Denken aufzwingt: notwendig denkbar ): etwas was nicht [empirisch] gegeben sein kann, aber trotzdem gedacht werden muss als realisierbar, vielleicht in einem verschiedenen Gesamt von Umständen, außerhalb der sinnlichen Ebene1 “ 1 O.P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 2321−30 . „Das Ding an sich ... ist nicht ein anderes Objekt [als das objectum phaenomenon] aber eine andere Beziehung (respectus) unserer Vorstellung zum selben Objekt... Es ist das ens rationis (=X), das der Selbst-Setzung [im Phänomen] entspricht2 “. „Der materieartige [Grund] [des Phänomens], das Ding an sich, ist ein X: einfach die Vorstellung, die das Subjekt von seiner eigenen Aktivität hat3 . 1 Op. cit., S. 3710−12 . 227 Buch II: Das „Opus postumum“ Wir sehen plötzlich von neuem in den beiden letzten Texten die reale Identifikation zwischen dem Ding an sich und der Handlung der Selbstsetzung des transzendentalen Ich auftauchen. Diese Ader, vor allem im Konvolut X ausgebeutet, ist nicht ganz abwesend im Konvolut VII. Zwei Beispiele sollen genügen, das zu zeigen. Das Konvolut X schließt ab mit einer kurzen Aufzählung der zu behandelnden Themen. Wir lesen da die bezeichnenden Notationen: „Das Ding an sich (=X) ist nur ein Sein im Denken, ein ens rationis ratiocinantis... Das subjektive Element der Intuition [eines Objekts] als Phänomen ist die Form a priori. Das Ding an sich ist das X. Transzendental -Philosophie: 1. Sich selbst Setzen. – 2. Sich ein Objekt der Anschauung Entgegensetzen: nicht ein Objekt der empirischen Anschauung sondern [der Anschauung] a priori, in der [reinen] formalen Linie, dem Raum und der Zeit, – 3. [Das], subjektiv als Phänomen4 287 4 Siehe weiter oben die Idee eines reinen Phänomens (Raum-Zeit) verknüpft mit der Idee einer reinen Objektivität. 4.[...] Anmerkung. Der Unterschied zwischen der Repräsentation eines Dings an sich (=X) und der Repräsentation eines solchen und solchen Dings erscheint dem Subjekt [in der Erscheinung]: dabile et cogitabile. Die zwei zusammen bilden ein repraesentabile. (Logische) Einheit entsprechend dem Prinzip der Identität und innere metaphysische Einheit im Subjekt (nicht kontradiktorischer Gegensatz vom Typ a und nicht a, sondern Gegensatz von a und -a, das heißt Gegensatz oder reale Korrelation)1 “ 1 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 42111−30 . Das kurze Programm, das wir gerade wiedergegeben haben, wird eingeleitet durch eine Überschrift, die nichts weniger ankündigt als die Vollendung der „kopernikanischen Revolution“ ausgerufen in der ersten Kritik (Auflage B, Vorwort): „Dass unsere Vorstellungen überhaupt nicht verursacht sind durch die Objekte, sondern dass diese im Gegenteil sich regulieren durch unsere Repräsentationen und nach deren Synthese2 “ 2 Op. cit., S. 42111−13 . Das Konvolut VII überbietet wenn möglich noch diesen Idealismus: „Ich bin Objekt vor mir selbst und vor meinen Repräsentationen. [Die Idee], dass etwas außerhalb von mir existiert, ist ein Produkt meiner Handlung. Ich mache mich selbst. Der Raum ist gar nicht Objekt der Wahrnehmung. (Aber auch die bewegende Kraft im Raum kann nicht vorgestellt werden als reale in der Abwesenheit 228 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ eines Körpers, von dem sie augeht). Wir konstruieren selbst alle Dinge (wir machen alles selbst)3 “ 3 288 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 8211−21 . Wenn wir diese Texte mit anderen Erklärungen zusammenbringen, können wir hoffen, den exakten Sinn des Begriffs des „Dings an sich“ im O. P. herauszuarbeiten. Das Ding an sich ist „ein reines Sein der Vernunft (ein bloßes Gedankending), dennoch nicht eine Chimäre (ein Unding)4 “. Als „Gedankending“ gehört es also allerwenigst zu der Klasse der problematischen Objekte, wo sich die „transzendentalen Ideen“ aufstellen. 4 4O. P., Conv. X. Ak., Bd. XXII, p. 415[22-23]. Weiterhin entspricht es, „aber nur in der Idee5 “ zum Ganzen der Anschauung, objektiviert im reinen raum-zeitlichen Phänomen. Tatsächlich: 5 Op. cit., S. 4142−4 . „In jeder Erkenntnis eines Objekts lassen sich zwei Arten von Repräsentationen erkennen: 10 die Repräsentation eines Objekts an sich; 20 die des Objekts als Phänomen. Durch die erstere setzt sich das Subjekt selbst uranfänglich in der Intuition (cognitio primaria); durch die zweite macht sich das Subjekt indirekt zum Objekt, entsprechend der Forma von der es affiziert wird (cognitio secundaria), und gibt sich so die Intuition von sich im Phänomen [das heißt von sich als Phänomen]. Die Intuition, durch die das sinnliche Objekt dem Subjekt gegeben ist [die empirische Intuition] besteht in der Vorstellung und der Synthese (Zusammensetzung) der Vielfältigen entsprechend den raum-zeitlichen Bedingungen. Was das Objekt an sich betrifft (=X), ist das nicht ein getrenntes Objekt, sondern gerade das Prinzip der synthetischen Erkenntnis a priori, ein Prinzip, das in sich einschließt die Form der Einheit (das Formale der Einheit) der intuitiven Verschiedenheit1 “ 1 0. P., Konv. VII, Ak., Bd. XXII, S. 201−12 . Man findet also, dass das Objekt an sich, reiner Inhalt des Gedankens, einfache Idee, wirklich dem formalen Element der synthetischen apperzeptiven Einheit entspricht, das heißt dem höchsten synthetischen Akt des Verstandes: „Das intelligible Objekt, das ist nicht das objectum noumenon, sondern der Akt des Verstandes, der aus dem Objekt der sinnlichen Anschauung ein reines Phänomen macht. Und [dieser Akt] ist etwas a priori Gegebenes (dabile), das heißt, die intuitive Aktivität selbst, und nicht ein simples Objekt der Anschauung, noch nur ein 229 Buch II: Das „Opus postumum“ mögliches Objekt des Gedankens. Es ist weder ein ens = Seiendes (etwas Existierendes) noch ein Nicht-Seiendes sondern ein Prinzip der Möglichkeit2 “ 2 289 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 4153−9 . Vgl. S. 41212−18 . Es wird offensichtlich, dass der Begriff des Dings an sich hier ausschließlich ins Auge gefasst ist im Rahmen der transzendentalen Philosophie und selbst der transzendentalen Philosophie im strengsten Sinne verstanden, als Untersuchung der Bedingungen a priori der Möglichkeit objektiver Inhalte des Bewusstseins. Der folgende Text grenzt exakt den Horizont ab, in den man sich einschließt: „Der Begriff eines Dings an sich (ens per se) keimt nur auf ausgehend von einem im Voraus gegebenen Begriff, das heißt ausgehend von einem als Phänomen repräsentierten Objekt; folglich ausgehend von einer Relation, die uns das Objekt entsprechend einer Beziehung betrachten lässt: in Wahrheit entsprechend einer negativen Beziehung [als Nicht-Phänomen]3 “ 3 Op. cit., S. 41219−22 . Der Begriff des Dings an sich im O. P. entfernt sich also von dem ursprünglichen Begriff der „Wirklichkeit an sich“, die in der Kritik der reinen Vernunft und in den Prolegomena gegenüber dem Idealismus so energisch gefordert wurde. Aber er kehrt zurück zu dem kritischen Begriff des „transzendentalen Objekts“, genommen in der strengen Bedeutung, wo er sich unterscheidet vom metakritischen Begriff des Objekts an sich4 . 4 Das transzendentale Objekt bezeichnet unter der Feder von Kant manchmal das „Ding an sich“ in seiner transzendenten Wirklichkeit (zum Beispiel KRV, Auflage A S. 46, 227, 372...), manchmal das ideale „Etwas“, reine transzendentale, immanente Bedingung, die gedacht werden muss im Phänomen, entweder als negative, „begrenzende“ Kehrseite von diesem, oder „als die rein intelligible Ursache der Phänomene im Allgemeinen“ (z.B. KRV, Auflage A, S. 478 Fußnote, 494-495. Vgl. KRV B, S.306-307) 290 In seinem Meinungsaustausch mit Beck, anerkannte Kant, wie man sich erinnern wird, die Legitimität der zwei Aspekte, des aufsteigenden und des absteigenden transzendentalen Beweises, ebenso wie die Möglichkeit, ausgehend vom apperzeptiven Höhepunkt die ganze Hierarchie der logischen Momente der Erkenntnis zu deduzieren, bis zur omnimoda determinatio, das heißt bis zum formalen Element der empirischen Anschauung. Die Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft und der Übergang zur Physik haben uns die kantsche Realisierung dieser Deduktion a priori vor Augen gestellt, wenigstens in dem was ihre unteren Stufen betrifft. Es gibt in den letzten Faszikeln des O. P. (oder des erweiterten Übergangs zur Physik ) Stellen, wo die Gesamtheit der Deduktion skizziert ist und sogar vorangetrieben ist über die empirischen Daten hinaus bis zu einer transzendentalen Interpretation des 230 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ ursprünglichen (=primitiven) Dings an sich. Zum Beispiel dasjenige, dessen knappe und technische Redaktion hauptsächlich von Interesse ist: „Ich denke (cogito). Ich bin meiner selbst bewusst (sum). Ich, Subjekt, ich mache mich zum Objekt (apprehensio simplex ); Dieser Akt ist noch nicht ein Urteil, das heißt eine Repräsentation der Beziehung zwischen einem Objekt und einem anderen ...; noch weniger ist es eine Beweisführung...; sondern es ist nur, durch Identität, das formale Element des Urteils [des cogito ergo sum]: nicht eine wirkliche Relation der Dinge sondern nur eine logische Beziehung von Begriffen. Für die Erkenntnis von Dingen braucht es: die Anschauung, den Begriff und ein Prinzip der Bestimmung der Begriffe, die dem Hauptbegriff untergeordnet sind: Wenn diese begriffliche Bestimmung vollständig ist (omnimoda determinatio), enthält sie die Repräsentatio eines existierenden Dings, als existierendes. Die Modalität der Erkenntnis eines Objekts, als vollständig bestimmtes Ding, wird Erfahrung genannt ... Der Verstand muss an erster Stelle synthetisch und a priori, unter der Form eines Systems, alle verschiedenen Akte der Erkenntnis erklären, die bis zum einzigen Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung als subjektive Einheit führen (denn es gibt eine Erfahrung, nicht Erfahrungen) ... Das [betrifft] die transzendentale Philosophie, die synthetische Sätze a priori liefert, wovon die Prinzipien sich vollständig aufzählen lassen1 ,“ 1 Das heißt, die nicht bis ins Unbestimmte weitergehen, wie der Raum und die Zeit, sondern zahlenmäßig begrenzt sind, und sich auf ein Prinzip reduzieren oder auf Prinzipien, die in gleicher Weise zahlenmäßig begrenzt sind. „Der Übergang vom reinen Inhalt des Gedankens (intelligibile) zum Sinnlichen (sensibile) und nicht umgekehrt, vollzieht sich in der Weise, dass das, was nur gedacht war (cogitabile) auch repräsentiert wird als Gegebenes (dabile), obwohl [diese Repräsentation des Gedankens als Gegebenes] nur ein Phänomen sein kann (phaenomenon). Zum Phänomen bildet das Gegenstück sein Gegenteil (noumenon), nicht als ein unterschiedenes Ding, sondern als der Akt selbst des Verstandes; [das Noumenon] ist also nichts außerhalb des Verstandes: reine Repräsentation des Objekts im allgemeinen, existiert es nur im Subjekt selbst. Also das was repraesentabile [als Objekt] ist, ist [muss sein] in erster Linie cogitabile und in zweiter dabile 1 “ 1 O.P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 931−5 , 8−17 22−25 , und 944−12 . 291 Das heißt, dass im Inneren eines Systems der Transzendental-Philosophie die einzige mögliche Interpretation des Dings an sich die ist, es zu identifizieren 231 Buch II: Das „Opus postumum“ mit dem Akt, durch welchen das transzendentale Subjekt sich setzt als Objekt in der empirischen Affektion: Die Schlussfolgerung, formuliert im O. P. mit einer sehr zufrieden stellenden Präzision: „Die reine Anschauung a priori [raum-zeitlich] umfasst die Akte der Spontaneität und der Rezeptivität und durch ihre Reduktion auf die Einheit, den Akt der Reziprozität (Gegenseitigkeit). Diese Akte gehören zum Subjekt als Ding an sich und gehören auch, durch die subjektive Bestimmung, die sie empfangen, zu diesem selben Subjekt, objektiviert in den Phänomenen2 “ 2 Adickes schlägt vor, in diesem letzten Glied des Satzes (deutscher Originaltext Zeile 24), desselben an Stelle von derselben; der Sinn wäre also: „... und durch subjektive Bestimmung von diesem (dem Subjekt) zu seinem objektiven Ausdruck im Phänomen“ „Das Ding an sich (=X) ist hier nichts anderes als der Begriff der absoluten Setzung, weit davon entfernt selbst ein Objekt für sich zu konstituieren: Sie ist nur die Idee der Beziehungen eingeschlossen in der eventuellen Setzung eines Objekts unter der Form der Anschauung, und in der vollständigen Bestimmung (in der durchgängigen Bestimmung), die aus diesem Objekt ein Objekt der möglichen Erfahrung macht3 ...“. 3 292 Op. cit., S. 2821−29 . Die Prüfung dieser wenigen Texte bezüglich des Dings an sich rechtfertigt die folgenden Schlüsse: 1. Nirgendwo ist die Möglichkeit von Dingen an sich geleugnet: dieser Begriff ist in den Augen Kants weder ein logischer Unsinn (ein Unding) noch selbst eine reine Dichtung. 2. Nicht nur als Mensch sondern als Philosoph lässt Kant im O. P. mit einem gewissen Glauben die Existenz transzendenter Objekte zu, die durch die praktische Vernunft postuliert werden: Gott und die Welt. 3. Die Selbst-Setzung des Ich offenbart im transzendentalen Ich ein „Ich an sich“, von dem wir andererseits wissen, dass es Freiheit ist und folglich Person. 4. Das O. P. schließt keine unbestreitbare Behauptung einer „transzendenten Affektion“ ein, verursacht durch ein „Ding an sich“, verschieden vom Subjekt. 5. Das Ding an sich ist im O. P. nur betrachtet unter dem wesentlich subjektiven reflektierten Winkel der transzendentalen Philosophie. Diese schränkt selbst Definitions gemäß ihre Kompetenz ein auf immanente Bedingungen des immanenten Objekts: Modalitäten, Funktionen, Positionen, Begriffe Urteile. Sie betrachtet also das Ding an sich mehr oder weniger als ein ens rationis (Gedankending), logisch notwendig; und wenn sie überdies versucht, die „metaphysische“ Bedeutung dieses den Phänomenen entgegengesetzten Gedankendings zu definieren, kann sie dafür keinen anderen realen Inhalt finden als die transzendentalen Funktionen selbst, das heißt die konstitutiven Bedingungen a 232 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ priori des transzendentalen Subjekts. Das ist es also, wie das Ding an sich uns präsentiert werden kann, entweder als subjektive Idee eines hypothetischen transzendenten Objekts oder als die Beziehung der Negativität, mit der das Phänomen affiziert bleibt, das als Objekt gesetzt ist (anders gesagt: als das rationale Verbot die Phänomene einer Totalität gleichzusetzen), oder schließlich als die metaphysische, rein funktionale Realität des transzendentalen Subjekts: das „reine Ich“ sich offenbarend als „Ich an sich“. Siehe das, was das O. P. uns verstehen lässt. Es konnte damit nicht anders sein in einer allgemeinen Epistemologie, die die durch den Übergang zur Physik in Gang gesetzte Konstruktion a priori nach oben hin verlängert – auf eine Transzendentalphilosophie zu –. Um sich davon zu überzeugen, genügt es, diese oder jene im Konvolut I verstreute Definition der Transzendentalphilosophie zu lesen; z. B.: „Die Transzendentalphilosophie ist der Ausdruck der reinen Vernunft, wenn diese, abstrahierend von allen [partikulären] Objekten, operiert ohne anderes Guthaben als ihre autonome Bestimmung sich im allgemeinen zum Objekt zu machen, das heißt in dem Maße nur, wo sie sich halten kann an das formale Element unserer synthetischen Erkenntnis a priori durch Begriffe und an Prinzipien dieser Synthese1 “ 1 0. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 89[ 3 − 7]. 293 Wie wenn Kant uns sagen würde, mit vertrauteren Ausdrücken: in der Ordnung der theoretischen Vernunft wäre die Existenz an sich von Dingen, die vom Subjekt verschieden sind, nur erkennbar durch eine intellektuelle Intuition (schöpferische Intuition seines Objekts): die transzendentale2 Beweisführung, die eine diskursive Beweisführung ist ausgehend von Phänomenen, kann diese außersubjektive Tragweite nicht haben. 2 Siehe Heft III, 1.Aufl. S.168 (BIVK2§2) 3.Auflage S.216-218. Die Kritik der reinen Vernunft setzte schon unserer Erkenntnis der Natur der Dinge an sich ähnliche Zurückhaltung entgegen; die Existenz selbst dieser Dinge, die sich da ausdrücklich zugelassen fand, war nicht behauptet kraft einer transzendentalen Notwendigkeit. Es scheint uns also nicht, dass das Denken von Kant, das in diesem Punkt expliziter geworden ist, eine vollständige Kehrtwendung erlitten hat3 . 233 Buch II: Das „Opus postumum“ 3 Die vorausgehenden Schlüsse lösen zwei Fragen der Exegese nicht, deren Prüfung wir lieber aufschieben, bis zum Moment, wo sie sich klären könnte aus dem Vergleich mit den idealistischen Systemen der großen „Epigonen“ von Kant: 10 Ist das Ich an sich des O. P. streng identisch mit dem „transzendentalen Subjekt“? 20 Irgendetwas vom irreduziblen Charakter (um nicht zu sagen: irrationalen) des primitiven „Dings an sich“ im äußeren Ursprung des Gegebenen, bleibt es hier nicht weiterbestehen in der immanenten Konversion des Subjekts, das sich zum Objekt macht entsprechend der formalen Begrenzung der „empirischen Affektion“, die es sich gibt? Mit anderen Worten, der Übergang vom „logischen“ Moment zum „transzendentalen“ Moment des Bewusstseins seiner selbst, verlangt diese nicht eine bestimmende Bedingung, die gewisse Attribute des alten „Dings an sich“ (dem Subjekt äußerlich) präsentiert? §6.– Existenz Gottes. 294 Nach einem Schnellen Lauf durch das O. P., muss die Existenz Gottes sehr vielen Lesern als das verwirrendste der Themen erscheinen, die in dieser Sammlung von Fragmenten skizziert sind. Die Affirmation läuft da der Negation nebenher. Das Ja und Nein versuchen abwechselnd, das Terrain zu besetzen; aber andere Stellen, vermischt mit den ersteren, sind voll von Andeutungen, die den Geist einladen, sich vor extremen Standpunkten zu hüten. Evidenter Weise hat die Existenz Gottes im O. P. kein Sonderrecht, das sie freistellt von den Einschränkungen, die schon unserer Erkenntnis des „Dings an sich“ im allgemeinen auferlegt sind. Diese Bemerkung würde ohne Zweifel erlauben, a priori das Feld der wahrscheinlichen Interpretationen zu begrenzen. Wir halten es dennoch für besser, unsere Untersuchung von jedem hermeneutischen Vorurteil freizuhalten und uns ohne Vorauswahl auf die Gesamtheit der Texte zu stützen, die sich auf die Existenz Gottes beziehen. Es versteht sich von selbst, dass wir hier nicht unwichtige Details festhalten, sondern nur die wichtigen Etappen dieser Untersuchung1 . 1 Einige male ist die Priorität eines Fragments vor einem anderen von einem gewissen Interesse für eine richtige Interpretation. Wir haben diesen Umstand in dem sehr bescheidenen Maße, wie es möglich und zweckdienlich war, berücksichtigt „Ob ein Gott existiert oder nicht, als Substanz, darüber hat man gar nicht zu diskutieren, weil diese Debatte ohne Gegenstand wäre (ohne objectum litis). Außerhalb des Subjekts, das urteilt, gibt es kein existierendes Sein, dessen Natur [hier] in Frage kommen könnte: es gibt nur eine Idee der reinen Vernunft, die ihre eigenen Prinzipien untersucht2 “ 2 O.P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 5225 -532 . Dieser Abweisungsbescheid gilt andererseits nur für die theoretische Vernunft: die praktische Vernunft affirmiert Gott auf ihre Weise als moralischen Wert.: „Der Begriff Gottes ist nicht ein technisch-praktischer Begriff sondern ein moralisch-praktischer: das heißt, dass er einen kategorischen Imperativ enthält und durch Identität die Gesamtheit 234 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ (complexus) aller Verpflichtungen des Menschen repräsentiert, die als göttliche Gebote betrachtet werden.3 “ 3 Op. cit., S. 533−6 . vgl. S. 511 -522 . Fast unmittelbar darauf führt Kant weiter aus: „Die transzendentale Idealität des Subjekts, das sich selber denkt, beansprucht für sich den Charakter einer Person (macht sich selbst zu einer Person). Göttlichkeit dieser Person. Ich bin im höchsten Sein. Ich sehe mich (nach Spinoza) als mich selbst in Gott, der in mir ist durch sein Gebot4 “ 295 4 Op. zit., S. 545−8 „Nun aber drückt die Idee eines Seins, das absolute Gebote, entsprechend den moralischen Gesetzen, aufweist, die ideale Vollkommenheit einer Person aus, die so alle Vollmacht hat in Bezug auf die sinnliche Natur1 . ...“ 1 Op. cit., S. 5414−16 . „Außerdem drückt die Idee der im kategorischen Imperativ enthaltenen moralisch-praktischen Vernunft, ein Ideal aus, das nichts anderes ist als Gott. Auf diesem Weg beweist man (vom praktischen Gesichtspunkt aus) wirksam, sicherlich nicht die Existenz Gottes als partikuläre Substanz, aber wenigstens die Zugehörigkeit zur transzendentalen Philosophie [die transzendentale Notwendigkeit] einer Bezugnahme auf einen solchen Begriff [auf den Begriff eines existierenden Gottes]2 “ 2 Op. cit., S. 5423 - 551 . Kurz bezüglich Gottes, „könnte man nicht leugnen, dass ein solches Sein existiert; dem gegenüber kann man nicht behaupten, dass er existiert außerhalb des rationalen Denkens des Menschen3 “ 3 Op. cit., S. 559−11 . In der zitierten Stelle findet sich schon virtuell die ganze Lehre Kants über die Existenz Gottes enthalten. Es bleibt uns nur noch, einige Züge davon mittels anderer Texte zu präzisieren. Zuerst die Texte, die kategorisch die Existenz Gottes behaupten. Zum Beispiel: „Der Begriff Gottes – und der Personalität des Seins, das durch diesen Begriff repräsentiert wird – hat Wirklichkeit. Es gibt einen Gott [gegenwärtig] in der moralisch-praktischen Vernunft, das heißt in der Idee der Relation des Menschen zum Recht und zum Sollen. Aber diese Existenz [Gottes] ist durchaus nicht diejenige eines Seins außerhalb des Menschen4 “ 4 Op. cit., S. 6012−16 . 235 Buch II: Das „Opus postumum“ Um zu verstehen in welchem Sinn Kant die Immanenz eines persönlichen Gottes im moralischen Imperativ und folglich in unserer praktischen Vernunft behauptet, muss man das Prinzip berücksichtigen, das er anderswo aussagt: „das Ding ist da, wenn und wo es wirkt5 “ 5 296 Op. cit., S. 1214 . Die moralische Gesetzgebung mit ihrem absoluten Charakter begreift er als eine göttliche Handlung im Zentrum unseres Geistes: ein Gott ist da in irgendeiner Weise, wie man die Probleme löst, die durch diese Präsenz entstehen.6 6 Op. cit., S. 5517−23 . Er kann auch sagen, dass der kategorische Imperativ uns das „Gefühl der Gegenwart der Gottheit im Menschen7 “ gibt 7 Op. cit., S. 10825−26 . Kant insinuiert im Übrigen, dass man eine Distinktion machen muss, in diesem in unserem Geist immanenten „Göttlichen“, zwischen dem, was uns durch strenge Schlussfolgerung die transzendentale Philosophie liefert, und dem, was dabei die Idee Gottes, ins Auge gefasst als ein „Postulat“, als Objekt des „Glaubens“ 8 , hinzufügt. 8 „Es ist nur ein praktisch-hinreichendes Argument des Glaubens an Einen Gott, der in theoretischer unzureichend ist: das Erkenntnis aller Menschenpflichten als (tamquam) göttlicher Gebote“ (Opcit. S, 127[ 12 − 14]) „Die einfache Idee Gottes ist zugleich Postulat seiner Existenz. Gott denken und an Gott glauben, das ist dasselbe. Das Prinzip des Rechtmäßigen, impliziert im kategorischen Imperativ, macht das Ganze notwendig wie eine absolute Einheit, nicht in Ausdrücken der [immanenten] transzendentalen Philosophie, sondern in Ausdrücken der Transzendenz1 “ 1 Op. cit. S. 10913−15 Ist das nicht wirklich, wie wenn man sagt, dass das „Göttliche“, insofern es unserem Geist als „kategorischer Imperativ“ immanent ist, zur rationalen Domäne der transzendentalen Philosophie gehört, während der transzendente Gott nur das Objekt des „Glaubens“ sein kann? Die Reihe der affirmativen Texte setzt sich fort im Konvolut I, dem letzten dem Datum nach: „Es existiert ein Gott, nicht als Weltseele in der Natur, sondern als persönliches Prinzip der menschlichen Vernunft (ens summum, summa intelligentia, summum bonum), welches, insofern es Idee einer absoluten Heiligkeit ist, im kategorischen Imperativ die vollkommene Freiheit mit dem Gesetz des Sollens2 vereinigt“. 2 O.P. Konv. I, Ak, Bd. XXI S.194−8 Aber dieses höchste Sein, Autor des moralischen Gebots (dieses gebietende Wesen) „ist nicht dem Menschen äußerlich, wie es eine 236 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ 297 vom Menschen distinkte und ein Gegenstück zur Welt bildende Substanz wäre... Die Realität des einen und des anderen Ideals [Gott und Welt] ist von der Ordnung der Idee3 “ 3 O.P. Konv. I, Ak, Bd. XXI S.2115−21 Was ist es also genau, was Kant in uns ausschließt, indem er die Erkenntnis Gottes als existierende Substanz außerhalb von uns ablehnt? Er erklärt es selbst: „Es gibt einen Gott, denn es gibt einen kategorischen Imperativ... dennoch ohne dass man dafür eine Substanz zulassen muss, die dieses höchste Sein für die Sinne repräsentieren würde4 “ 4 O.P. Konv. I, Ak, Bd. XXI S.648−11 „Gott ist nicht ein durch die menschliche Sinneserkenntnis erkennbares Sein... Er ist eine reine Idee der Vernunft, jedoch ausgestattet mit der größten praktischen, inneren und äußeren Realität5 “ 5 O.P. Konv. I, Ak, Bd. XXI S.1429−12 „Gott ist gar nicht Objekt der Sinne sondern nur der Vernunft6 “ 6 O.P. Konv. I, Ak, Bd. XXI S.14219 vgl. S.143 un 144 hier und da Offensichtlich ist das, was der Autor des O.P. aus unserer Affirmation von Gott zurückweisen will, ist die anthropomorphe Idee eines Gottes, der der Kategorie der Substanz unterworfen ist und unseren Sinnen durch sein Phänomen erscheinend. Nicht weniger evident ist seine Verlegenheit, diese – ganz gerechtfertigte – Verneinung mit der Affirmation zu vereinbaren, an der er genauso festhält: von der Existenz eines persönlichen Gottes, den seine dynamische Immanenz für unsere Vernunft nicht daran hindert, eine absolut vollkommene Person zu sein, distinkt also wenn nicht gar getrennt von unseren kleinen einfachen menschlichen Personen1 . 1 Die Unvollkommenheit der menschlichen Person offenbart sich, nach Kant, in der Tatsache, dass sie nicht nur „autonom [autolegislatrix]“ ist, sondern der Verpflichtung des Gesetzes unterworfen, – nicht nur Stütze des „Rechts“ sondern „Pflichten“ unterworfen ist. Bisweilen scheint der Wunsch zu bejahen ganz nahe, den Skrupel, zu viel zu behaupten, zu überwinden: 298 „Das Prinzip, das uns in allen dem Menschen auferlegten Pflichten universell gültige Vorschriften anerkennen lässt, das heißt, die genau die Eigenschaft zeigen, [die die Gebote ausweisen würden als] von einem höchsten, heiligen und mächtigen Gesetzgeber, dieses Prinzip erhebt das gedachte Subjekt [das heißt das moralische Subjekt, dessen wir uns im Imperativ bewusst werden], zum Rang eines einzigartigen und allmächtigen Seins; mit anderen Worten, die Idee, die wir uns von Gott machen, erlaubt zu schließen, 237 Buch II: Das „Opus postumum“ wenn nicht auf die Existenz eines solchen Seins, so wenigstens [auf die Existenz] von etwas, das ihm äquivalent ist; oder, wenn man so will, erlaubt sie, mit einer gleichen Überzeugung, die gleichen Schlüsse zu folgern, die uns ein solches Absolutes aufzwingen würde (dictamen rationis), wenn es als Substanz mit unserem eigenen Wesen2 verbunden wäre“. 1 Op.cit. S. 2022−29 Diese vorsichtigen Zeilen geben noch nicht die Meinung Kants über die Existenz Gottes in ihrer ganzen, zugleich affektiven und rationalen Totalität wieder. Hier eine noch kategorischere Erklärung, eingefügt jedoch in einen Kontext von sehr markantem technischem Klang: „Dass diese Idee von Gott objektive Realität hat, – ich möchte sagen, dass sie [in] der Vernunft jedes nicht komplett zum Rang von Tieren abgefallenen Menschen eine Kraft der Wirkung besitzt, die im Verhältnis steht zum moralischen Gesetz – dass der Mensch sich selbst gegenüber unausweichlich gestehen muss, dass ein Gott existiert und nur ein Gott:. Das verlangt in keiner Weise, dass man die Existenz Gottes bewiesen habe, wie [man die Existenz] einer Sache der Natur [beweist]; das findet sich im Gegenteil schon impliziert in der begrifflichen Entwicklung der [moralischen] Idee, entsprechend der analytischen Regel (nach dem Prinzip der Identität): die einfache Form genügt hier, das Sein der Sache zu konstituieren3 “ 3 Vergl. 0. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 1406−13 „Der aufgeklärte Mensch entkommt nicht der Notwendigkeit, sich moralisch zu verurteilen, oder sich von der Anklage frei zu sprechen1 “ 1 Um das zu interpretieren, vgl. eine Parallelstelle: Ak, Bd.XXII S. 5522−23 „Um die Wahrheit zu sagen, die moralisch-praktische Vernunft, die in sich das Urteil ausspricht, kann verführt und auf die schiefe Bahn gebracht sein durch die Tendenzen der Sinne ... [unvollendeter Satz]2 “ 2 299 Op.cit. S.923−13 Weiter unten zeigt Kant, dass für die als „Weisheit“ betrachtete Philosophie der Satz „es gibt einen Gott“, ohne den das „letzte Ziel“ (Endzweck) Fiktion wäre, ein „Existentialsatz“ ist 3 Op. cit. S.14918−24 Angesichts dieser affirmativen [= bejahenden] Texte, ordnen (führen) wir diejenigen ein (sie gehören hauptsächlich zum Konvolut VII). wo der Akzent auf die Unmöglichkeit eines rationalen Beweises der Existenz Gottes gelegt ist: 238 Kapitel V: „Zur äußersten Grenze des Wissens1 “ „Existiert wirklich ein Sein, das wir uns vorstellen müssen als einen Gott? oder aber ist dieses Sein nur ein hypothetisches Objekt, das wir einzig annehmen, um gewisse Phänomene zu erklären (etwa so, wie wir einen überall gegenwärtigen und alles durchdringenden Äther annehmen)4 ?“ 4 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. I253−7 . Man muss den streng verpflichtenden Charakter des moralischen Gesetzes betrachten, antwortet Kant. Daraus ergibt sich, selbst wenn man „abstrahiert von einem Erlass durch Gott, dass unsere Erkenntnis aller Pflichten des Menschen wie ebensovieler göttlicher Gebote (tamquam non ceu) nicht weniger Wirksamkeit hat, als die Affirmation eines wahrhaft höchsten Richters des Universums5 hätte.“ 5 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. I2512−13 . Der Ton dieser Stelle scheint den „Fiktionalismus“ (die Theorie des „als ob“) von Vaihinger zu rechtfertigen. Und weiter, womit sich dieser Eindruck noch verstärkt: „Dass keine Vorschrift, kein Verbot den Menschen tatsächlich von einem heiligen und allmächtigen Sein auferlegt worden ist, dass selbst unter der Hypothese einer Botschaft von oben, die Menschen, für die sie bestimmt gewesen wäre, unfähig geblieben wären, entweder sie wahrzunehmen, oder sich von ihrer Realität zu überzeugen: das unterliegt keinem Zweifel. Bleibt also nur die Erkenntnis unserer Pflichten, als ob sie göttliche Gebote wären, denen gegenüber unsere unüberwindliche Ignoranz über ihre öffentliche Bekanntmachnung [Promulgation] durch Gott nichts von ihrer Autorität aufheben würde.6 “21−28 6 20−26 7−12 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 64 .. Vergl. S. 116 , S. 117 , S. 1253−15 . – Kant will sagen, dass die verpflichtende Kraft des kategorischen Imperativs, ursprünglich ist, unabhängig von der rationalen Erklärung, die wir nachträglich suchen in der Idee eines göttlichen Gesetzgebers. Vgl. Op.cit. S.122: „Die Idee von einem solchen Wesen, vor dem sich alle Knie beugen, usw. – geht aus diesem Imperativ hervor und nicht umgekehrt“. 300 Ist die Leugnung jedes gültigen Beweises der Existenz Gottes hier nicht kategorisch? Sicherlich, aber in welchem Sinn? „Es existiert ein Sein, das nur Rechte hat, keine Pflichten: Gott.Folglich stellt sich das moralische Subjekt alle seine Pflichten, selbst in dem, was sie an Formalem haben, vor wie göttliche Gebote: nicht dass es dadurch beweisen will [Hervorhebung von uns] die Existenz [an sich als Substanz] von einem solchen Sein; tatsächlich 239 Buch II: Das „Opus postumum“ (Hervorhebung von uns) ist das Übersinnliche gar nicht Objekt einer möglichen Erfahrung (non dabile, sed mere cogitabile) sondern nur Objekt eines Urteils der Analogie1 ...“ 1 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 1206−13 . Nach Kant und dem Großteil der modernen Philosophen, beweist man die Realität eines Objekts nur, indem man es zeigt als Objekt einer aktuellen oder möglichen Anschauung – das heißt beim Menschen als Objekt einer möglichen Erfahrung. Zusammenfassend: Die Betrachtung des moralischen Sollens als „göttliches Gebot“ reicht nicht, den Beweis der Existenz Gottes fertig zu stellen. Dennoch, übertreiben wir nicht den Umfang dieser Unfähigkeit: „Es ist das formale Element des Gesetzes, das hier das Wesentliche der Sache ausmacht.: der kategorische Imperativ ist ein göttliches Gebot und diese Aussage hat mehr als die Gültigkeit eines einfachen Satzes. – Die Idee der absoluten Autorität, die im moralischen Subjekt die reine Verinnerlichung des Sollens annimmt, unterscheidet sich nicht [formal] vom göttlichen Charakter der Person, die gebietet (divinitas formalis). Eine Substanz, die diese absolute Autorität [als ihre] besitzen würde, wäre Gott. Wir können die Existenz einer solchen Substanz nicht beweisen2 ...“ 2 301 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 12818−27 Sie ist tatsächlich nicht experimentell in einem Phänomen gegeben, und ist auch nicht das Objekt eines synthetischen Urteils a priori geeignet für eine objektive Deduktion3 3 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 12818−27 Denn die Ideen Gottes und der Welt, „subjektiv“ ins Auge gefasst, sind „Schöpfungen“ unseres Geistes4 ; 4 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 2131−32 Alle beide drücken ein Bedürfnis der Einheit aus; trotzdem drückt die Idee Gottes direkt in uns das „dynamische und moralische5 “ Prinzip dieser Einheit aus; man könnte, ohne das Denken Kants zu verraten, von einer „dynamischen“ Gegenwart des Göttlichen im Imperativ sprechen6 . 5 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 14320−21 6 siehe weiter oben S. 296 (Anmerkung 8) Dieses „Göttliche“ auf eine Substanz zu beziehen, die ihr proportioniert ist, das heißt, eine gelebte Erfahrung in einen objektiven Begriff projizieren; das heißt, übergehen vom Immanenten zum Transzendenten und uns ein „problematisches1 “ Noumenon zu schaffen; 1 240 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S.1577−8 Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II das heißt vom strengen Gesichtpunkt der Wissenschaft her, eine „Hypothese“ aufstellen, aber eine Hypothese, die für uns nicht freisteht, sie zu setzen oder nicht zu setzen, „eine notwendige Hypothese2 “ 2 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 151: „Der Satz: es ist ein Gott, ist eine notwendige Hypothese der reinen praktischen Vernunft. Er ist auch der höchste Grundsatz der Transzendentalphilosophie“ 302 Letzten Endes gilt nach dem Opus postumum: 10 Das „Göttliche“, unserer reinen praktischen Vernunft immanent, ist eine notwendige Schlussfolgerung der transzendentalen Philosophie. 20 „Gott“, transzendenter Autor des moralischen Gesetzes in uns, ist eine unvermeidbare „Hypothese“, Objekt eines sicheren „Glaubens“. Diese Schlüsse bezüglich der Existenz Gottes, nehmen im Wesentlichen diejenigen der zweiten und der dritten Kritik wieder auf. Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II 303 §1. – Das System des „Opus postumum“: Seine Kohärenz und Tragweite. 1˚ Seine logische Struktur 304 Wenn man verstehen will, was das O. P. im Gesamtwerk von Kant darstellt, muss man sich bemühen, nie den speziellen Gesichtswinkel zu vergessen, unter dem das eingeschränktere Problem des Übergangs ... zur Physik angepackt worden war: Es ist unter diesem selben Winkel, unter diesem selben epistemologischen Horizont, dass der Philosoph die weite Skizze der Lehre zeichnet, die seine letzten Hefte von Notizen füllt. Wir haben weiter oben (Seite 235-248, Kap.II-III) insistiert auf der Natur und der Methode der Lösung des Problems, das im ursprünglichen Übergang gestellt war. Man erlaube uns eine Formulierung zu wiederholen, die sie exakt zusammenfassten: „Der Übergang ist also nur die analytische Theorie der Bedingungen, die a priori die Möglichkeit der Erfahrung steuert, betrachtet entsprechend der ganzen Weite ihrer konstitutiven Formen oder Gesetze. Welche objektive Geltung kann eine solche Theorie beanspruchen? Eine „apodiktische“ Geltung (die einer Analyse) auf der idealen Ebene der Phänomene; die einer „problematischen“ Geltung (die einer widerspruchsfreien Hypothese) auf der Ebene des an sich, als Ausdruck der strukturellen Elemente eines „Universums an sich1 “. 1 Siehe oben S. 248 Die Wissenschaft des Übergangs geht also durchaus nicht auf induktivem Wege vor: sie vermehrt nicht die Beobachtungen der physikalischen Phänomene, um sie auf abstrakten Typen zu staffeln, indem sie eine wachsende Anzahl von besonderen Fakten umfasst, deren Reihen „asymptotisch“ auf eine 241 Buch II: Das „Opus postumum“ höchste Grenze hinzielt, das heißt auf die konkrete Summe, den Inbegriff aller möglichen Fakten. Dieses Gebäude, abgestützt auf die approximativen und vorläufigen Verallgemeinerungen wäre in keiner Weise durch wahre, universelle und notwendige Gesetze gestützt. Im Falle der Konstruktion, wenn sie der Vollendung fähig wäre, würde sich ein hypothetischer, vielleicht utopischer Begriff aufstellen: die Idee einer totalisierenden „intellektuellen Intuition“ – die welche die Kritik der Urteilskraft2 erahnte“ 2 Siehe Heft III, 1.Aufl. S.234 3.Auflage Seite 302 Eine auf Vermutung beruhende Konstruktion, siehe da, alles was wir uns erhoffen können von einer Verallgemeinerung der konkreten Erfahrung (aus der Erfahrung): Auf diesem Wege werden wir nie mit Erfolg zu einer „Wissenschaft“ gelangen. Nun aber muss der Übergang eine Wissenschaft sein, und folglich sich a priori deduzieren: „Die empirische Erkenntnis des Objekts unserer Anschauungen, vorgetrieben bis zur vollständigen Bestimmung dieses Objekts, nennt sich Erfahrung [im vollkommenen Sinn dieses Wortes]. Da die vollkommene objektive Bestimmung, um bewusst zu werden, eine unendliche Vielfalt der intuitiven Ordnung verlangen würde, bleibt dafür nur, dass der totalisierende Begriff (der Inbegriff) der Erfahrung nicht aus der gemachten Erfahrung grundgelegt wird, sondern auf der zu machenden Erfahrung (für sie)1 “ 1 305 O. P. Konv. VII, Ak. Bd. XXII, S.9825 -992 Im unveränderlichen, notwendigen Ideal einer perfekten Erfahrung finden wir das, was die Induktion nicht liefern konnte: den festen Stützpunkt der Deduktion, die die Bedingungen a priori offenbart, ohne welche die physikalischen Gesetze wesentliche logische Eigenschaften für wahrhaftige Gesetze entbehren würden, mit anderen Worten: ohne welche unsere Vorstellungen von der Natur aufhören würden, eine wahrhaftige „Wissenschaft“ zu sein. Eingesetzt im Inneren des bewussten Phänomens, unvermeidlich gegeben in jeder Lehre der Erkenntnis, fragen wir uns das, was ein Phänomen sein muss, in seiner Materie und in seiner Form, um zum fortschreitenden Aufbau der perfekten Erfahrung beizutragen. Zuerst seine Materie. Der Übergang ... zur Physik, in seiner Tiefe den materiellen Inhalt des Phänomens analysierend, deckt uns auf, woraus diese Materie bestehen muss, um seiner Funktion zu entsprechen: so ziehen vorbei vor unseren Betrachtungen, in ihrer logischen Verknüpfung, die Struktur der primitiven Perzeption (der Wahrnehmung), der Mechanismus der „Affektion“, das Spiel der „bewegenden Kräfte der Materie“, und das ganze mit Gold durchwirkend, 242 Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II 306 die radikale Spontaneität eines Subjekts, das sich als Phänomen objektivieren muss, um die ersten Etappen hin auf das volle Bewusstsein von sich zu durchschreiten. Auch von der Seite seiner Form zeigt sich das Phänomen, a priori, abhängig von subjektiven und objektiven Bedingungen: diejenigen der theoretischen Apperzeption, die des moralischen Wollens und der Postulate. Sie haben sich nicht verändert seit der Epoche der Kritik. Nur hat sich hier ihre Einheit, ehemals ein wenig locker, gefestigt, in zwei hauptsächlichen Gesichtspunkten: erstens durch die, jetzt etablierte Kontinuität (den Fortbestand), zwischen den formalen Bedingungen a priori der Sinneswahrnehmung und der qualitativen Struktur der Materie; dann durch die Verminderung der Kluft, die die Formen a priori der Sinneswahrnehmung (Raum und Zeit) noch trennen von den apriorischen Einheiten des Verstandes. Von daher, nach dem konstitutiven spontanen Akt der elementaren Wahrnehmung bis zu vollendeten Einheit des Geistes, resultiert alles, was in und durch das Bewusstsein als Form unterscheidbar ist, aus einer einzigen und selben synthetischen Handlung. Der moralische Wille selbst nimmt Teil, insofern er subjektive „bewegende Kraft“ ist, am Aufbau der integralen Erfahrung. Das Ziel von Kant im O. P. (das heißt, vergessen wir das nicht, in der rationalen Rekonstruktion unserer Erkenntnis bezüglich ihrer Form) erstreckt sich bis zum höchsten Ausgleich von „Natur“ und „Recht“ : „Beziehungen der Natur und Beziehungen des Rechts: die natürliche Einheit des Universums und die Einheit der Prinzipien des Rechts einem moralischen Prinzip unterordnen, das heißt, einer Substanz [Gott?], das bestimmend, was von jedem Sein gesollt wird1 “ 1 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII S. 11031 -1112 So könnte man sagen, dass „die moralisch-praktische Vernunft eine der bewegenden Kräfte der Natur und aller Objekte der Sinne ist2 “. 2 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII S. 10510−11 Das versteht man leicht, wenn man mit Kant zulässt, dass die Objekte der Sinne nicht nur nachträglich „geweckt“ sind in Sicht, im Blickfeld des letzten Ziels unseres Geistes, dem moralischen Ziel, sondern dass sie zu erst zu diesem Zweck „konstruiert“ sind: von Rechts wegen, in ihrer ursprünglichen Reinheit, ist die Natur – unsere und die der Dinge – durchdrungen von Rechtschaffenheit. Die Schlüsse des O. P., die man durch die Methode erhält, die wir gerade beschreiben, nehmen eine in den Augen Kants wohl definierte epistemologische Geltung an. 10 Diese Geltung hängt wesentlich ab von der Glaubwürdigkeit, die die „Idee“ der Erfahrung verdient, von der die ganze in Angriff genommene Deduktion 243 Buch II: Das „Opus postumum“ abhängig bleibt. Nun aber ist die vollkommene Erfahrung für unsere diskursive Erkenntnis nur eine unerreichbare Grenze; sie zwingt sich dennoch auf wie ein unvermeidliches Ideal, die das Maß ist, nach Art eines Ziels, der untergeordneten Notwendigkeit aller partiellen Momente der Erfahrung; anders gesagt: die das einzige logische Fundament setzt, das konzipierbar ist für die Notwendigkeit und Universalität der physikalischen Gesetze. Wenn man sich zuerst diese letzteren vorgibt, wie Kant es machte in der Kritik der reinen Vernunft, postuliert man zugleich die integrale Erfahrung als ihren notwendigen3 idealen Grund. 3 Aus der Notwendigkeit „eines idealen Grundes“ folgt nicht unmittelbar die notwendige Realität des Objekts, das sie repräsentiert: absolut gesprochen könnte dieses Objekt sein entweder eine aktuelle oder mögliche Existenz oder ein zu verwirklichendes Ziel oder nur die Grenze einer Progression. 307 Aber wenn man sich nicht im Voraus diese logische Geltung der Gesetze der Natur geben würde, wäre die Idee der integralen Erfahrung nicht mehr als eine einfache „problematische“ Idee, die die offensichtlich fortschreitende und vereinheitlichende Bewegung der konkreten Wahrnehmungen versinnbildlicht: ihre Geltung würde nicht die einer mehr oder weniger nützlichen Extrapolation übersteigen, unfähig logisch unsere Erkenntnis der Natur zu begründen (grundzulegen) 20 Die epistemologische Geltung der Schlüsse des O. P. hängt an zweiter Stelle ab von der Methode der Untersuchung, die man verwendet, um sie zu entdecken. Diese Methode ist vor allem die rationale Analyse, fundiert auf der logischen Identität. Man sucht tatsächlich die Bedingungen a priori, die die verschiedenen Stufen der Erkenntnis leiten, betrachtet als ebensoviele „Näherungen“ eines idealen Höhepunkts, der perfekten Einheit der Erfahrung. Dieses analytische Vorgehen bietet häufig den Anschein einer Anwendung, weniger des Prinzips der Identität als des Prinzips des hinreichenden Grundes: In Wirklichkeit besteht es hier, wie einst in der transzendentalen Analytik darin, einen „logischen Grund“ zu definieren, innerhalb des Wesens, das man untersucht; nun aber ist für Kant ein intelligibler Grund, immanent im analysierten Wesen gleichwertig zu einer „partiellen Identität“. Fundiert auf der Identität ist also die allgemeine Deduktion des O. P. apodiktisch, da sie an der Wurzel und auf den gestuften Ebenen der Erkenntnis eine einzige und selbe objektivierende Spontaneität unterscheidet: „das Subjekt, das sich vor sich selbst zum Objekt macht“: „1. Ich bin (sum) 2. ich bin meiner selbst bewusst, das heißt ich bin Subjekt zur gleichen Zeit wie Objekt (appercipio). Die Wahrnehmung (apprehensio simplex ) enthält den intuitus (die Schau) meiner selbst und den conceptus (den Begriff), durch den ich mich selbst erkenne, und danach den Übergang vom Subjekt auf das Objekt dieser Schau, das heißt ein Urteil, judicium. Aber dieses Urteil bildet noch gar nicht eine Schlussfolgerung vom Typ: 244 Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II cogito, ergo sum; es ist nur ein identischer Satz: sum cogitans: analytischer [Vorgang]1 “ 1 308 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII S. 10220−25 Führt dieses analytische Urteil zur Existenz ? Verstehen wir dadurch nicht nur unsere Existenz als Subjekt sondern die irgendwelcher in uns repräsentierter Objekte. An sich erreicht das analytische Urteil nur hypothetisch die Existenz: es lässt sie nichtsdestoweniger Durchscheinen, wenn sie schon gegeben ist im analysierten Objekt. Das ist hier der Fall. Die rationale Analyse entdeckt unter unseren Inhalten des Bewusstseins, ein Gerüst von Synthesen a priori, die nur die fundamentale Synthese a priori detailliert, durch die das Ich2 sich in die Existenz setzt2 . Wenn man einen „Leitfaden“ will, um Kant zu folgen in seiner wechselnden Anwendung der Begriffe der Analyse und der Synthese, wird man sich erinnern, zum Beispiel, dass die Analyse Universelles liefert und eine Metaphysik freilegt, während die Synthese eine Totalität aufbaut (Allheit im Gegensatz zu Allgemeinheit). 0 3 Auch stellt das analytische Gemälde, das das O. P. vor unseren Augen entfaltet eine Verknüpfung von Synthesen a priori dar, deren solidarische Gesamtheit durch die Notwendigkeit der Vernunft3 von der Existenz abhängt, aber von der Existenz des Subjekts als Subjekt. 3 Durch transzendentale Notwendigkeit und nicht nur durch sinnliche, kontingente und relative Anschauung. Kant hat es uns an anderer Stelle gesagt: „Dieser logische Akt [die ursprüngliche Intuition von sich, die das Bewusstsein konstituiert,] ist durchaus noch nicht ein Satz, wegen des Fehlens eines definierten Prädikats. Aber er [dieser Akt] vollendet sich durch eine reale Bestimmung; ich existiere (sum) insofern ich denke (cogitans); wodurch etwas (ich selbst) nicht nur gedacht ist sondern gegeben (cogitabile ut dabile)1 “ 1 Es ist gegeben als gedacht. Nur: dieser Akt ist in keiner Weise ein direkter Schluss [vom Formalen auf das Existierende] (cogito ergo sum). Nur das Subjekt, repräsentiert in der vollständigen Bestimmung von sich selbst (in seiner durchgängigen Bestimmung) – und nicht in analytischer Zerstückelung (durch Identität) oder in der reinen klaren Auseinanderfaltung [seines Begriffs] – nur, so sage ich, das repräsentierte Subjekt in der synthetischen Auseinanderfaltung von sich, kann [könnte] uns das Prinzip einer objektiven Existenz liefern (omnimoda determinatio est existentia [= vollständige Bestimmung schließt Existenz ein])2 2 O. P., Konv. VII. Ak , Bd. XXII, S. 9816−24 . Nun aber, so fügt der Philosoph unmittelbar hinzu, wird diese „vollständige Bestimmung“ des Subjekts, das Objekt des Bewusstseins geworden ist, nur verwirklicht in der perfekten Erfahrung 3 . 245 Buch II: Das „Opus postumum“ 309 3 Vergl. O. P., Konv. VII. Ak , Bd. XXII, S. 9825f f. Die objektive existentielle Geltung des „Ich bin (sum)“ gründet und misst sich also auf und an der rationalen Notwendigkeit eines immanenten Ideals, an sich unzugänglich, aber erahnt in seinen „Asymptoten“, den partiellen Repräsentationen des Objekts. Die Analyse dieser Repräsentationen (das heißt eine „metaphysische“ Erklärung) entlarvt eine synthetisch apriorische Konstruktion (eine „transzendentale Philosophie“)4 , die ihren Ursprung findet in der reinen Setzung des Ich. Die Existenz des „Objekt-Ich“ ist also ins Unendliche verschoben; aber das „transzendentale Ich“ setzt sich als solches (das heißt als „apriorische Möglichkeit des Objekts“) in jeder objektiven Repräsentation. 4 O. P., Konv. VII. Ak , Bd. XXII, S. 8714−25 . Vgl. O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 208−12 . Das scheint alles kompliziert und ziemlich künstlich. Kant konnte jedoch diesen Subtilitäten nicht entkommen, wenn er die empirische Existenz mit der rationalen Wissenschaft in Verbindung bringen wollte, ohne entweder eine „intellektuelle Intuition“ (die wir keinesfalls haben), oder einen ausschließlich analytischen Beweis der Existenz (der ein Paralogismus wäre,) vorauszusetzen. Er beachtet treu, bis zum Ende seines Werks zwei methodologische, von ihm lange vor seiner kritizistischen Periode schon anerkannte Verbote. Kurz, um die Formulierung, an die wir weiter oben (S.303 Kap.VI) erinnerten, wieder aufzugreifen: Das System des O. P., Werk des reflektierenden Urteils, führt den ganzen formalen Inhalt der direkten Erkenntnis zurück auf das notwendige Spiel von Bedingungen a priori, apodiktisch gültig im objektivosubjektiven Rahmen der Immanenz, aber rein problematisch, sobald man sie auf die objektive Ebene des an sich projiziert. Wir vergessen nicht, dass die praktische Vernunft dieses eingeschränkte Gerüst der theoretischen Vernunft erweitert. 2˚ Metaphysische Tragweite des „Opus postumum“ 310 Gewiss ist das metaphysische Fresko großartig gewesen, von dem uns Kant im O. P. eine sehr knappe Bleistiftskizze hinterlassen hat. Zu knapp, trotz der frustrierenden Häufung von Wiederholungen und Verbesserungen. Denn, nachdem er die großen Linien gezogen hat, erschöpft er sich darin, sie unbeschränkt nachzuzeichnen, ohne die Kraft zu finden, die Zeichnung zu vollenden. Trotzdem, so wie es ist, enthält es im Keim ein vollständiges System der Philosophie, das einzige, so scheint es uns, das die logische Fortsetzung des anfänglichen Kritizismus war. Ohne uns damit aufzuhalten, nacheinander die Artikulationen dieses Systems1 noch einmal anzusehen, können wir wenigstens mit sicherem Blick, seine Weite richtig abschätzen. Kant selbst wird uns dabei helfen durch einige ganz überraschende Ausdrücke, deren Sinn zu erhöhen wir uns hüten wollen. 1 246 Mehrmals zählt Kant die wichtigsten von ihnen auf, z. B. O. P. Konv. I, Ak., Vd. XXI, S.62-63 Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II „Alle Wesen sind einander verwandt “, schreibt er im letzten Konvolut seiner Notzen2 . 2 Kon. IS.1071 Diese „Affinität“ (das Wort ist von ihm), diese universelle „Verwandtschaft“ der Seienden beschäftigt mehr als je die Tiefe seines Denkens. Seltsame Sache, sie ist häufig assoziiert mit einer – nicht immer richtigen3 – Erinnerung an den Spinozismus: 3 Kant kannte Spinoza nur durch Lichtenberg, der sich auf ihn beruft: indem er Lichtenberg für einen Spinozisten hält, schreibt er den Gesichtspunkt dieses letzteren Spinoza selbst zu. In Wirklichkeit bekannte sich G.Chr. Lichtenberg, Physiker in Göttingen, mit einer betonteren subjektivistischen Nuance zu einer Art transzendentalem Idealismus in der Art Kants. Seine Ideen sind erklärt im Band II seiner Vermischten Schriften (herausgegeben von L. Chr. Lichtenberg und Ft. Kries, Göttingen, 1801). Man bewahrt von diesem zweiten Band ein Exemplar auf, das einige Anmerkungen aus der Hand von Kant enthält. Dieser scheint sehr überrascht gewesen zu sein von der Übereinstimmung zwischen der Lehre des Gelehrten von Göttingen und seiner eigenen; er gefällt sich darin, im Konvolut I, häufig Lichtenberg zu erwähnen; wenn er ihm nicht irgendein Lehrelement entnommen hat, schuldet er ihm wahrscheinlich im O. P. einige Ausdrucksweisen, oder allerwenigstens die Festigung einiger Grundzüge. Siehe über diese späte Folge der philosophischen Entwicklung von Kant die Seiten von Er. Adickes, Kants Opus postumum SS. 833-846 „Wir können Objekte in uns oder außerhalb von uns nicht erkennen, es sei denn, dass sie in uns selbst, nach festen Gesetzen die Akte (actus) dieser Erkenntnis hervorrufen. Der Geist des Menschen ist das [Gegenstück des] Gottes von Spinoza (für das, was das formale Element jedes Objekts der Sinne betrifft): absolut gesprochen ist der transzendentale Idealismus ein Realismus [ein immanenter Realismus]4 “ 311 4 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 9918−22 . Vgl. Konv. VII (Ak., XXII), SS. 551−3 . 5613−15 , 5921−24 , 646 − 11, etc. Das was Kant angeregt hat in dem, übrigens wenig getreuen, Bild, das er sich vom spinozistischen System machte, ist die strenge Immanenz, kraft derer die universelle Ursache, „der Gott von Spinoza, nicht [nämlich außerhalb seiner eigenen Realität] irgendein äußeres Objekt, nicht einmal ein Objekt der Wahrnehmung5 enthält“ 5 Op. cit., S. 1012−4 . Und da der spinozistische Gott ihm identisch schien (quoad nos) mit der höchsten synthetischen Einheit a priori unseres Bewusstseins (von Gott eine distinkte Substanz machen, wäre mystische Extravaganz, „Schwärmerei“)1 , 1 Op. cit., S. 6412 . Vgl. S. 2211−13 , S. 1914−15 . bleibt nur, dass diese höchste synthetische, von Gott ununterscheidbare Einheit, auch „nach Spinoza, (das Prinzip a priori, von dem sich die Formen ableiten) des ganzen Systems der Seienden ist, soweit diese sich systematisch in mein Denken einordnen, und gerade dadurch konzipiert werden als von mir verschieden2 “ 2 Op. cit., S. 1018−12 . „Aus dem Subjekt ein Objekt machen, wie Spinoza3 “: 247 Buch II: Das „Opus postumum“ 3 Op. cit., S. 8924−25 . Vergl. S. 343 . Kant sieht nun unter diesem Gesichtswinkel die Aufgabe der transzendentalen Philosophie. In dem holländischen Metaphysiker glaubt er einen Vorläufer der Theorie der Apriorität wiederzufinden, die das O. P. dominiert. „Die reine Intuition a priori4 muss, 4 „Spinozens Gott, in welchem wir Gott in der reinen Anschauung vorstellen“ (Op.cit. S. 8726−27 ). Unmittelbar nachher erwähnt Kant „das System des transzendentalen Idealismus von Schelling, Spinoza, Lichtenberg usw.“ Vergl. auch SS.1220−21 , 1311−15 , 4322−24 , 5115−17 , 9814−15 nach Lichtenberg und Spinoza, der empirischen Intuition (der der sinnlichen Wahrnehmung) vorausgehen und sie enthält alles Formale des Systems der Ideen und der Vernunft, sowohl spekulativ als moralisch-praktisch, – die Ideen von Gott und der Welt – wenn es wahr ist, dass die Vernunft sich selbst konstituiert in einem Universum5 “ 5 Op. cit., S. 69!7−21 . 312 Diese Lehre, angeblich die von Spinoza, abzulehnen, liegt Kant fern. Seit langem hat sich bei ihm die reine Anschauung der Sinne dem eigentlichen Begriff angenähert und, zum Ausgleich dafür, die ursprüngliche synthetische Einheit, Quelle der Begriffe des Verstandes, den Bedingungen einer Intuition a priori angenähert: Aus diesen zwei inversen Bewegungen resultierte eine Art von Intuition des Verstandes, die nicht mehr die rein sinnliche Anschauung ist und noch gar nicht die volle „intellektuelle Intuition“. Es gereicht Spinozu die Ehre, diese Verschmelzung des begrifflichen Modus und des intuitiven Modus in unserem Bewusstsein des transzendentalen Apriori erahnt zu haben: die „Kosmotheologie“, die das O. P. anpreist, wird durchdrungen sein von der „Idee einer Einheit, die die Intuition mit dem Begriff verknüpft, nach der Weise von Spinoza6 “ 6 Op. cit., S. 1717−18 . Gott erkannt in und durch das Ich; die objektive Intuition zurückgeführt auf die Intuition von sich; die Welt konstruiert durch das Ich im Ich: dieses systematische Gerüst, reife Frucht aus der transzendentalen Kritik, projiziert Kant durch einen seltsamen Anachronismus im Nachhinein auf die ontologistische Metaphysik von Spinoza. „Der transzendentale Idealismus sagt er noch, [ist der] dessen Objekt unseren Verstand als Urheber hat. Spinoza7 “:: 7 Op. cit., S. 156−7 . Wenn es eine wesentliche Identität gibt zwischen der „immanenten Schöpfung“ des Spinoza und der „immanenten Produktion der Formen“ des transzendentalen Idealismus, würde der Gott der Ethik sicherlich das transzendentale Ich ahnen lassen. Es ist also wohl das Ich, als reine Funktion, transindividuell selbst in seiner Inhärenz in den Individuen, göttlich und menschlich alles zusammen, welches 248 Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II 313 das Gravitationszentrum der letzten „Metaphysik“ des Kantismus in Anspruch nimmt. Das Ich unter dem Winkel, der ihm eigentümlich ist, erstreckt sich bis zu den äußersten Enden des Seins, weil es zugleich „Rezeptivität der Natur“ und „Spontaneität der Freiheit1 “ ist; „Heteronomie“ als „Sein in der Welt“ und „Autonomie“ als „Person2 “. 1 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 1311−3 . 2 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 6215−19 . Noch mehr: in diesem zweigesichtigen Ich (wenn man so sich zu sagen traut) löst sich die Rezeptivität und die Heteronomie auf in eine noch radikalere autonome Spontaneität, weil sie selbst zuerst die Welt in sich produzieren muss als Repräsentation, der sie sich unterwirft, indem sie sich in sie einfügt. Kant wiederholt das ohne zu ermüden: die sinnliche Welt ist nichts anderes für uns (soweit sie das Bewusstsein affiziert) als das Subjekt, das sich besondere Bestimmungen (Affektionen) zum Objekt macht, fortschreitend durch Akkumulation, in sich, die es produziert nach dem Maße seiner sinnlichen Passivität: Alle „Setzungen“ von Objekten sind immanente Setzungen des Subjekts durch es selbst, „Selbstsetzungen“. Die Erfahrung wird so eine Art von Erforschung – nie vollendet – die das Ich von seiner eigenen formalen Einheit macht, indem sie sie detailliert im unendlichen Raum durch Reihen ohne Ende von sukzessiven Bestimmungen. Als konkrete Fakten reichern sie nur das empirische Bewusstsein an; aber sie werden für uns „intelligibel“ in ihrer Reihung selbst betrachtet als die „Asymptote“ der einen und perfekten Erfahrung, allein an sich erkennbar: „approximatio experientiae est asymptotica3 “ 3 314 O.P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 1038 . Vgl. S. 10215−17 . Diese Annäherung zwischen der konkreten Weiterentwicklung der Erfahrung und der Asymptote einer regulären Kurve konnte Kant durch das Beispiel von Leibniz nahegelegt worden sein: beide setzen das Prinzip der Intelligibilität der Asymptote in die Intelligibilität seiner Grenze; sie begreifen nur die höchste Grenze der Reihen der endlichen Terme auf verschiedene Weise. Bei Leibniz strebt unsere Repräsentation der Welt asymptotisch gegen eine ideale Realität, auf Gott „der besten Welt“ und folglich auf die Idee eines unendlich weisen und unendlich guten Schöpfers zu, eines persönlichen Gottes, dessen moralische Heiligkeit die schöpferische Geste befiehlt. Bei Kant tendiert die Repräsentation der Welt asymptotisch, nicht hin auf einen Schöpfer Gott sondern auf eine ideale „Erfahrung“ hin, die unserer Subjektivität immanent bleibend, dort wenn es möglich wäre die unendliche Leere der Raum-Zeit vollständig einrichten (möblieren) würde. Um zur Idee Gottes zurückzukommen, muss der kritizistische Philosoph zuerst eine Umkehr bewirken, sich von der Welt auf das Ich zurückbeugen, und sich da des „kategorischen Imperativs“ bewusst werden, wo sich in Identität „das göttliche Gebot“ und, durch notwendiges Postulat, die „Gegenwart Gottes als Person“ affirmiert. Von diesem 249 Buch II: Das „Opus postumum“ göttlichen Höhepunkt, der sich der Welt der Erfahrung gegenüberstellt wie die vollkommene Freiheit sich dem Determinismus gegenüberstellt, öffnet sich sogar gegenüber der Welt eine neue Perspektive, die überhaupt nicht mehr die des Übergangs zur Physik ist. Denn das moralische Gebot, das unser Handeln in und an der Welt verpflichtend regelt, würde aufhören intelligibel zu sein, wenn die höchste Freiheit, aus der das Gebot hervorgeht, nicht gleichzeitig universelle schöpferische Potenz wäre: „Die universelle Ursache (Weltursache), betrachtet als Person, ist Autor der Welt (Welturheber); aber nicht nach der Weise eines Demiurgen1 “ 1 Op.cit. S. 554−5 . Kant versteht unter „Demiurg“ das, dessen Kausalität rein kosmisch wäre, ohne Freiheit und folglich ohne moralischen Charakter. Werk eines unendlichen heiligen Willens, der uns das moralische Gebot als Anweisung gibt, so erscheint also die Schöpfung durchdrungen von moralischer Absicht. Sie hat als letzten Grund des Seins, unserer moralischen Aktivität ein angepasstes Feld des Vollzugs zu geben; und unter diesem Gesichtspunkt ist kein Zweifel, dass die Welt, betrachtet in ihrer ursprünglichen Struktur, für Kant nicht, wie für Leibniz „die best mögliche“ sein muss; nur die endliche Freiheit führt hier ein Prinzip der Störung ein. Der Gott des Kantismus ist also schließlich „eine Ursache, handelnd in der Welt entsprechend den Prinzipien der reinen Moralität, Ursache [von uns] gedacht als Substanz (als ens extramundanum [außerweltliches Seiendes]), und, weil es die Totalität der sinnlichen Objekte beherrscht, einzige Ursache2 “ 2 Op. cit., S. 1314−6 . 315 Kant hat sich bemüht, in einem geplanten Titel, alle die Haupt Elemente seines Systems zu gruppieren, in dem er die theoretische Geltung von jedem genau markiert: „Gott, die Welt und das Bewusstsein meiner Existenz in der Welt von Raum und Zeit. Das erste [Element] ist ein Noumenon, das zweite ist ein Phännomenon, das dritte ist die Kausalität des Subjekts, das sich selbst bestimmt zum Bewusstsein seiner Personalität, das heißt seiner Freiheit in Beziehung zur Gesamtheit der 3 Seienden in absoluter Weise “ 3 22−29 O.P. Konv.I Ak. Bd. XXI S.24 : „Gott, die Welt, und das Bewusstsein meiner Existenz in der Welt im Raum und der Zeit. Das erste ist Noumenon, das zweite Phänomenon, das dritte Kausalität der Selbstbestimmung des Subjekts zum Bewusstsein seiner Persönlichkeit, d. i. der Freiheit, in Verhältnisse des All der Wesen überhaupt“. 250 Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II §2.– Der kantsche Begriff von „transzendentaler Philosophie“ Die kritische Philosophie ist wesentlich eine „transzendentale Philosophie“. Jetzt, nachdem wir das Denken Kants untersucht haben in seinem letzten und umfassendsten Ausdruck, können wir hoffen, das zu begreifen, was schließlich eine authentische transzendentale Philosophie darstellt: das, was man mit Recht von ihr erwartet und das was man dagegen vergeblich von ihr erhofft. Der Begriff des „Transzendentalen“ hat uns häufig beschäftigt bei der Untersuchung der Kritiken 1 . 1 Siehe weiter oben und besonders Heft III, 1.Aufl. S.81 ff. 3.Aufl. SS. 111-117 Die Grundbedeutung dieses Begriffs hat sich gar nicht verändert: sie taucht wieder auf selbst in den Ausdrücken des O. P. Gehen wir aus von diesem Punkt der Begegnung und bemühen wir uns zuerst, das Objekt der transzendentalen Philosophie genau zu umreißen. „Die transtendentale Philosophie ist diejenige, die Antwort gibt auf die Frage: wie sind synthetische Sätze a priori möglich? Dass man in der menschlichen Vernunft derartige Sätze findet und dass sie das Hauptobjekt der Philosophie bilden, das ist evident2 “. 2 O. P., Konv. X, Ak., Bd. XXII, S. 31220−23 . 316 Das Objekt der transzendentalen Philosophie liegt also im Bereich der Synthese a priori durch Begriffe. Aber „mit dem Mittel einer Synthese a priori durch Begriffe können wir die Objekte a priori nur phänomenologisch erkennen, nicht als Dinge an sich3 “ 3 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 2226−28 . Das heißt, dass das direkte Objekt der transzendentalen Philosophie dem Subjekt immanent bleibt: „Das intelligible Objekt ist gar nicht ein noumenales Objekt sondern der Akt selbst des Verstandes, der das Objekt der sinnlichen Anschauung als reines Phänomen4 aufbaut.“. „Es ist durchaus nicht ein Seiendes (etwas was existiert), auch kein Nicht-Seiendes (etwas Unmögliches): es ist ein Prinzip der Möglichkeit5 “ 4 O. P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 415. 5 Ebenda S. 8-9 Ein „Prinzip der Möglichkeit“, dem Denken immanent: wir finden hier den ursprünglichen Sinn wieder, den das Wort „transzendental“ in der Kritik der reinen Vernunft annahm. 251 Buch II: Das „Opus postumum“ „Die Sätze [der transzendentalen Philosophie] müssen immanent sein, ohne jemals transzendent zu werden; denn in diesem letzteren Fall wären sie nicht mehr als falsche hypothetische Konstruktionen (falsche Dichtungen)1 “ 1 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 652−3 . Vergl. ebenda., S. 12014 : „Transzendental ist die philosophische Erkenntnis der subjektiven Philosophie [des subjektiven Aspekts der Philosophie]“. Und schließlich eine Definition, deren Präzision nichts zu wünschen übrig lässt: „Die Transzendentale Philosophie ist das System des reinen Idealismus, das heißt [die systematische Erklärung] der Autodetermination des Subjekts durch begriffliche Prinzipien der Synthese a priori, mittels derer das Subjekt sich ein [oder zum?] Objekt macht: die Form konstituiert hier für sie allein die Totalität des Objekts [das heißt des Objekts, das der transzendentalen Philosophie speziell ist]2 “ 2 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 9217−20 . 317 Das Transzendentale ist „Form“, aber durchaus nicht im abstrakten Sinn von „statischer Form“: es ist „Prinzip der formartigen Bestimmung“, „Funktion“ ebenso wie „Form“. Wir sehen es im O. P. auch versehen mit zwei Eigenschaften, alles zusammen jeweils formal und dynamisch, der „Autonomie3 “ und der „Autokratie4 “. 3 O P., Konv. X. Ak., Bd. XXII, S. 4165 . O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 8410 : Die Transzendental-Philosophie ist die Selbstschöpfung (Autocreatio) der Ideen ... usw. Vergl auch Linien 3-5 4 Aber muss dann nicht die Mathematik, deren Objekt eine immanente Konstruktion des Subjekts ist, zurückgeführt werden auf die transzendentale Philosophie wie ein Teil vom Ganzen? Die Frage rechtfertigt sich um so mehr, als die Intuition a priori der Sinneswahrnehmung sich nun, wie wir gesehen haben, der allgemeinen synthetischen Aktivität des Ich integriert findet. Trotzdem ist die Antwort von Kant negativ: obwohl die transzendentale Philosophie und die Mathematik sich alle beide ausdrücken durch Begriffe und durch synthetische Urteile a priori, beruht die erstere [die Philosophie] ursprünglich auf einer begrifflichen Synthese a priori und die zweite [die Mathematik] auf einer intuitiven Konstruktion a priori: „Die Transzendental-Philosophie hat als unterscheidenden Charakter durchaus nicht, dass sie absolut sprechend Prinzipien für synthetische Urteile a priori enthält, (was nicht weniger der Fall ist für die Mathematik), sondern dass sie Prinzipien der Synthese a priori enthält begründet auf den Begriffen und nicht auf [den Elementen der Konstruktion] dieser Begriffe5 “ 252 Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II 5 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 236−10 . Ein anderer Grund wäre, dass die Mathematik bei der Objektivität, die der Wissenschaft eigentümlich ist, nicht bis zum Endpunkt geht, sie bleibt ein „Werkzeug“ der Philosophie und der Physik: „Die Mathematik strebt nicht nach absoluten Zwecken sondern nur nach bedingten Zielen1 “ 1 318 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 1051−2 . Das ist der Grund, dass sie nur einen sekundären Rang einnimmt: „Als Philosophie hat die transzendentale Philosophie den Vortritt vor der Mathematik und sie ordnet sich die quantitativen Relationen, aus denen diese letztere zusammengesetzt ist, mit der Qualität von Instrumenten,2 unter“. 2 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 733−5 vergl. S. 8711−13 Halten wir die negative Antwort Kants fest, ohne im Moment zu versuchen die Gründe dafür abzuschätzen. Das Objekt der Transzendental-Philosophie schließt nicht nur die reinen Begriffe ein, die die Bedingungen a priori der empirischen Objekte sind, sondern die „problematischen“ Ideen der Vernunft, mittels derer unser Geist die objektive Repräsentation der Einheit dieses Objekts vollendet: das sind vor allem die zwei „Maxima“, die Idee Gottes und die Idee der Welt: „Der Höhepunkt der Transzendental-Philosophie, das heißt die synthetische Erkenntnis durch reine Begriffe (a priori) liegt in der Lösung der zwei folgenden Probleme: 1. Wer ist Gott? 2. existiert Gott? Das Objekt dieser Fragen ist reine Idee3 ...“. Diese Idee von Gott ist andererseits überhaupt nicht „Fiktion (Dichtung)“ ein willkürlich gebildeter Begriff (conceptus factitius), es ist ein der Vernunft notwendig gegebener Begriff (datus)4 3 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 632−5 . – Mit der Idee von Gott ist uns gegeben die von der Welt: ebenda S. 639−18 4 O.P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 63l0−11 . Insofern sie System der Ideen ist, verschmilzt die Transzendental-Philosophie also entweder mit einer subjektiven und funktionalen (apodiktischen) Metaphysik oder mit einer objektiven (problematischen) Metaphysik. Aber es gehört nicht zu ihr, sich kategorisch zu äußern über die Existenz ihrer Objekte: „Weil Ideen [Gott und die Welt] in nichts beitragen können zur Materie der Erkenntnis, das heißt zum Beweis der objektiven Existenz, beschränkt sich ihr Beitrag auf das Formale...Ob ein Gott 253 Buch II: Das „Opus postumum“ existiert, ob es ein absolutes Universum gibt oder eine Pluralität von Welten, darüber ist hier nichts ausgesagt5 “ 5 O.P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 8627 –873 . „Das Dasein, das Gewesen-Sein und das Sein-Werden [die gegenwärtige, vergangene und zukünftige Existenz] gehören zur Natur und folglich zur Welt [nicht zur Repräsentation als solcher]. [Aber] das, was nur in Begriffen gedacht ist, gehört zur [repräsentativen, idealen Ebene des] Phänomens. Daher die Idealität der Objekte und der transzendentale Idealismus6 “ 319 6 Op. cit. S. 8716−19 Das ist es, warum man der transzendentalen Philosophie gar nicht die Frage stellen darf nach der Lösung von Problemen, die nicht zu ihrer Kompetenz gehören. Zum Beispiel bleiben ihr, obwohl sie selbst der Methode nach ein Idealismus ist, Fragen nach der Debatte des Idealismus und des Realismus, Fragen nach der rein vorgestellten Existenz oder der Existenz an sich, fremd: sie bewegt sich im Inneren der Repräsentation, deren immanente Relationen sie untersucht: „Ob ich mir die sinnlichen Repräsentationen als ein ideales Prinzip oder als ein reales Prinzip gebe, das ist in der transzendentalen Philosophie eine indifferente Sache. Denn sie befasst sich nicht mit der Relation der Objekte zum Subjekt, sondern mit der Relation der Objekte unter einander, [unabhängig davon, ob sie eine Realität in sich haben oder nicht haben]1 “ 1 320 O. P., Konv. XI. Ak., Bd. XXII, S. 4426−9 . Die transzendentale Philosophie grenzt sich also ab in ein System von idealen Beziehungen, das sich erstreckt im Höchstfall bis zur Repräsentation der Existenz. Aber wenn die transzendentale Philosophie die Existenz an sich ignoriert, verbietet sie dennoch nicht, sie zu postulieren unter einem anderen Titel; das ist es, warum Kant unter dem Einfluss von Beck sich entschließend, seine kritische Philosophie von all dem zu säubern, was nicht dem Subjekt immanent war, trotzdem seine vorkritische oder metakritische Überzeugung von der Existenz des „Dings an sich“ beibehalten konnte. Wir glauben selbst, dass diese Überzeugung bei dem Autor des O. P. bis zum Ende überlebte. Das wovon er sich befreit hat, sind einzig die Zwänge, mit denen das anfängliche realistische Postulat das kritische System belastete. In dem Maße wie die transzendentale Philosophie auf dem Wege der Immanenz die omnimoda determinatio ihres Objekts erreichen konnte, das heißt die Realität des Objekts im Subjekt, wurde sie frei gemacht vom extrinsezistischen Realismus des „Dings an sich“. Aber sie musste dann erklären, ohne aus dem Subjekt herauszugehen, warum die Affirmation von „Dingen“ untrennbar die Affirmation von 254 Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II „Phänomenen“ begleitet: Das O. P. erfüllt diese Aufgabe in seiner Theorie der Erscheinung (siehe weiter oben Seite 249 ff.) Trotz dieser Präzisierungen ist die Natur der transzendentalen Philosophie im O. P. doch noch nicht mit der ganzen wünschenswerten Klarheit beschrieben. Kant ahnt, so scheint es, zwei entgegengesetzte Ausrichtungen, die die Entwicklung dieser Philosophie nehmen könnte, je nachdem dabei der Gesichtspunkt des Subjekts oder der Gesichtspunkt der Methode dominiert. Er entscheidet sich nicht für eine davon und zeigt auch nicht einen Vermittlungsversuch. Heben wir einige Anzeichen davon hervor, sehr klein in sich selbst aber heute in unseren Augen vergröbert durch die Geschichte des Idealismus in der Zeit nach Kant. Zuerst und auf jeden Fall ist die transzendentale Philosophie ein „System der Ideen“. „Eine Weise der Repräsentation, die darin besteht, die Begriffe – Elemente der Erkenntnis – in ein Ganzes zu gruppieren, das heißt die Möglichkeit der synthetischen Erkenntnis a priori nach Begriffen auf ein System zurückzuführen1 “; 1 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 151−3 . „[sie ist] ein System der Ideen...; allgemeines Prinzip der spekulativ-theoretischen Vernunft und der praktisch-moralischen Vernunft, sie stellt in einem einzigen System die Ideen und diese zwei Vernünfte dar2 “. 2 Op. cit., S. 7326−29 . Vergl. S. 843−5 : „Das All der Wesen der Vernunft“. Aber siehe hier eine Nuance exklusiver subjektiv: „Die traanszendentale Philosophie ist die Lehre, die die Notwendigkeit eines Systems von begrifflichen synthetischen Prinzipien a priori lehrt, konstituiert unter dem Gesichtspunkt der Metaphysik. Sie ist durchaus nicht eine Wissenschaft, die [gerade vom Gesichtspunkt der Objekte her] Prinzipien bezogen auf diese Objekte klar darlegt; sie betrachtet das erkennende Subjekt, die Weite und die Grenzen ihres Wissens3 “ 3 Op. cit., SS. 6330 -642 . 321 Außerdem ist der Gesichtspunkt, den sie uns vom „Weltganzen“ gibt, nicht von außen genommen durch beschreibende Fragmente (“atomistisch“), sondern genetisch und dynamisch, gesteuert, nicht durch vorausgehende Erfahrung sondern durch „die Autonomie von Gesetzen a priori4 “ 4 Op. cit., S. 8925−30 . Dieses Abgleiten zu einem „Subjekt“, das man weniger in seinen immanenten, schon konstituierten Objekten ins Auge fasst, als in der Produktion gerade 255 Buch II: Das „Opus postumum“ dieser Objekte, berücksichtigt die direkte Linie der Entwicklung des „kantschen Transzendentalismus“; aber die verwendeten Formulierungen verraten laterale Einflüsse, besonders die von Fichte: „Die transzendentale Philosophie ist nicht [nur] eine Wissenschaft, die sinnliche Objekte behandelt, wäre das selbst dass sie sie behandelt nach Prinzipien a priori (auch die Metaphysik macht das), sondern es ist die Wissenschaft, die sich selbst als Objekt ihrer Reflexion macht5 “ 5 Op. cit., S. 8520−23 . Vgl. S. 7311−14 . Auf den letzten Seiten des O. P. ist eines der letzten Titel Projekte so abgefasst: „Die Philosophie als Theorie der Wissenschaft (Philosophie als Wissenschaftslehre), reduziert auf ein vollendetes System6 ... “ Man kann es pikant finden, diese Formulierung zu vergleichen mit der „Erklärung gegen Fichte“ von 1799 (siehe weiter oben S. 219) 6 Op. cit., S. 15517−19 ; Hervorhebung von uns. – Im Konvolut II, gegen 1798-1799, verwarf Kant noch, ebenso wie in seiner berühmten Erklärung gegen Fichte, die Idee einer Wissenschaftslehre, verschieden von der reinen Logik; sich höher erheben wollen, bis zu „einer Wissenschaftslehre, die noch universeller ist, käme zurück auf den vergeblichen Vollzug „in seinen Begriffen im Kreis sich zu drehen“; denn diese angebliche Wissenschaft könnte nichts sein als „das wissenschaftliche Element der Erkenntnis im Allgemeinen, das heißt seine Form gerade der Erkenntnis“ O. P. Konv. II, Ak, Bd. XXI S. 20723−30 , Anmerkung von Kant Aber es gibt dabei noch etwas anderes und diesmal dämmert am Horizont der methodische Neukantianismus von Marburg auf: „Die transzendentale Philosophie ist nicht die Erkenntnis von irgendeinem Objekt der Philosophie sondern nur eine gewisse Methode, ein gewisses (formales) Prinzip, um zu philosophieren. [Sie ist] eine Art der Erkenntnis a priori, diskursiv und allgemein, die darin besteht, sich für sich selbst das Objekt der Vernunft zu erschaffen mit dem Mittel der Begriffe von Gott, der Freiheit und der1 Gesamtheit1 “ 31 1 13 19−20 322 O.P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, SS. 85 -86 . Vgl. op. cit., S. 122 , , wo Kant exklusiver als anderswo, den methodologischen oder heuristischen Gesichtspunkt adoptiert: „Von heuristischen Methoden oder Grundsätzen [sic]“; das scheint ein Untertitel unter dem allgemeinen Titel, der lautet: „Philosophie, nicht bloss Philosopheme, nicht dogmatisch sondern kritisch und heuristisch, in ihrem ganzen Inbegriffe der theoretisch-spekulativen und moralisch-praktischen Vernunft“. Ein „System“, eine „Methode“: zwei Pole, zwischen denen das Denken Kants nicht aufhört zu oszillieren. Von den zwei so markierten Orientierungen führt die erste logisch durch Fichte zu Hegel, die zweite bahnt von Weitem den Weg zu H.Cohen, Cassierer, Simmel oder Vaihinger: auf einer Seite der absolute Idealismus, auf der anderen ein Transzendentalismus, der abbiegt zum Pragmatismus. 256 Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II Vielleicht hatte Kant recht, gar nicht zu exklusiv für einen von diesen zwei Wegen zu entscheiden. Wir fragen uns weiter unten, ob seine eigene Philosophie diese Enthaltung gestattete. §3.– Wissen und Weisheit. 323 Man verspürt ein wenig Erstaunen, wenn man im O. P. das Fehlen der Theorie der moralischen Postulate feststellt. Wäre die Erklärung dafür die, dass die in diesem letzten Werk von Kant entwickelte Philosophie eine transzendentale Philosophie ist und dass „die transzendentale Philosophie Definitions gemäß nur eine Philosophie der reinen spekulativen Vernunft ist“, unter Ausschluss von „all dem, was praktisch ist2 ?“ Nicht ganz; denn die transzendentale Philosophie des O. P. beschäftigt sich im Gegenteil sehr viel mit der praktischen Vernunft und behauptet sogar, die Einheit der beiden Vernunften zu realisieren3 : darin setzt sie die Aufgabe der dritten Kritik fort, wo man die Behauptung findet, noch nicht den Beweis von dieser Einheit. Das heißt im Übrigen nicht, dass die nunmehr gewonnene Einheit die Dualität ausschließt oder vergessen macht: mehrere Texte in den letzten Seiten des O. P. insistieren auf dem tiefliegenden Gegensatz der „Theorie“ und der „Praxis“, der „Wissenschaft“ und der „Weisheit“: 2 KRV Ausg. A S.15; Ausg. B S.29, Siehe im selben Sinn KRV, Methodologie Ausg. A, SS 801 ff. 3 Siehe weiter oben S.305-306 „Wissen und Weisheit sind völlig verschiedene Prinzipien des Denkens. Man strebt nach dem einen oder nach dem anderen durch zwei verschiedene Reihen von Vollzügen: in der ersten Reihe schließt sich das Subjekt zurück auf sich selbst, in der zweiten geht es aus sich heraus; trotzdem in der einen oder anderen Weise nach Prinzipien a priori1 “ 1 O.P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 10413−16 . Und dennoch Texte früher als dieser deuteten schon eine Annäherung der gegensätzlichen Perspektiven an: es handelt sich darum „in einem einzigen System“ zu vereinigen, – nicht nur die in Gegensatz zueinander stehenden Elemente der technisch-praktischen Vernunft (der äußeren Handlung, infiziert durch die sinnlichen Vorlieben) und der moralisch-praktischen Vernunft (des reinen, metempirischen Gebots) – nicht nur die „Rezeptivität“ und die „Spontaneität“ des konkreten Wollens – sondern „die Anschauung, das Gefühl und die appetitiven Fähigkeiten“, und noch mehr „Gott, die Welt (zwei Terme außerhalb von mir) und das rationale Subjekt, die sie in der Freiheit vereinigt2 “: 2 Op. cit., S. 225−11 257 Buch II: Das „Opus postumum“ alles das ohne, wie Spinoza, das Prinzip der Einheit zu transformieren in eine „Substanz3 “ 3 324 ebenda Kurz, es handelt sich darum, die zwei Aspekte – technisch und moralisch – der praktischen Vernunft zur Einheit zurückzuführen und den Primat dieser über der theoretischen Vernunft zu beweisen. Das O. P. musste diese seit langem begonnene Arbeit der Vereinigung zu Ende führen. In dem Maße wie Kant den dynamischen Charakter der spekulativen Erkenntnis betonte, näherte er sie an an die imperativen „Positionen“ der praktischen Vernunft. Und in dem Maße wie er das reine rationale, autonome Subjekt mit den Vorrechten des göttlichen Gesetzgebers versah, in dem Maße ließ er auch noch die Heiligkeit der universellen Ursache durchscheinen durch unsere endliche Spontaneität, der Erbauerin der Welt der Phänomene4 . Er anerkannte ausdrücklich Imperative der Erkenntnis, eine moralische Bestimmung des Phänomens: 4 Vergl. O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 1048−12 , 16−18 . „Die gleichzeitige Bewusstwerdung der Anschauung und des Gedankens in einer einzigen Repräsentation (Vorstellung), siehe da, das was die Erkenntnis ist; und der Imperativ, dem der Verstand sich selbst unterwirft (das nocse teipsum [= erkenne dich selbst]) ist das Prinzip, welches das Subjekt antreibt, sich in der Anschauung zu objektivieren und sich in einen Begriff zu übersetzen5 ....“ 5 Op. cit., S. 227−10 . Insofern sie „dictamina rationis [= Diktate der Vernunft]“ sind, ähneln alle fundamentalen Prinzipien dem moralischen Imperativ: „Im transzendentalen Idealismus haben alle begrifflichen synthetischen Sätze a priori (der Imperativ ist von dieser Ordnung) als Funktion, der Vernunft [das Gesetz] aufzuzwingen [diktieren]. Das dictamen rationis bezeichnet, nicht das was wir denken, sondern das was wir machen müssen6 “. 6 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 1510−12 . Diese Annäherung der beiden Arten von Vernunft – der theoretischen und der praktischen – bringt den Autor des O. P. dazu, den Begriff der transzendentalen Philosophie auszuweiten so weit wie den der „Weisheit“: „Die Weisheit ist das höchste Prinzip der Vernunft1 “ 1 258 O. P., Konv. VII. Ak., Bd. XXII, S. 3812 . Kapitel VI: Allgemeine Schlüsse aus dem Buch II „Dass die Philosophie (Weisheitslehre) auf Deutsch Weltweisheit (universelle Weisheit) genannt wird, kommt daher, dass die Weisheit, ich meine das, was es in ihr an Wissenschaft gibt, als Ziel das letzte Ziel (das höchste Gut)2 hat.“ 2 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 14918−20 . Wir wissen es schon durch die Methodologie der Kritik der reinen Vernunft. Aber hier vielleicht noch besser: „Das letzte Ziel von allem Wissen ist, sich selbst zu erkennen im höchsten Ausdruck der praktischen Vernunft ... Die Philosophie richtet sich auf die Ziele des Wissens und ebenso [durch diese Tatsache selbst] auf das letzte Ziel der Dinge im allgemeinen3 “ 325 3 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 1561−2 , 5−6 . Dieser Satz ist sehr tiefgründig. Er allein rechtfertigt die um dieselbe Epoche geäußerte kategorische Erklärung: „Der höhere Gesichtspunkt der praktischen Vernunft des Menschen besteht im Bemühen um Wissen, um in nichts der Weisheit (Philosophie) nachzustehen. Das nocsce teipsum [= erkenne dich selbst]. Das System des Wissens soweit es den Weg der Weisheit zeigt, das ist die transzendentale Philosophie4 “ 4 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 1214−7 . . Wenn das O. P. uns wahrhaft die Tätigkeit, die die Spekulation abstützt und das höchste Ziel der Erkenntnis zusammenfallend mit dem höchsten Ideal der Handlung, schließlich mit dem gemeinsamen Ideal der Spekulation und der Handlung, durchdrungen von unendlicher moralischer Heiligkeit, zeigt, erstaunt es uns dann nicht, mit derselben Datierung unter der Feder von Kant einer kleinen Anzahl von Stellen zu begegnen, deren Ton unwiderstehlich im Geist des Lesers die Wissenschaftslehre von Fichte in Erinnerung ruft? Zum Beispiel die folgende: „Wir müssen uns hier erinnern, dass wir es zu tun haben [in der transzendentalen Philosophie] mit dem endlichen Geist, nicht mit dem unendlichen Geist. Der endliche Geist ist der, der nur tätig werden kann vermittels einer Passivität, eines Leidens, der das absolute nur erreicht, indem er Schranken übersteigt: also nur in dem Maße, wie er empfängt, umgeht mit und mit Form versieht 259 Buch II: Das „Opus postumum“ eine Materie. Ein solcher Geist muss folglich seinem fundamentalen Streben (seinem Trieb) nach der Form ein fundamentales Streben nach der Materie zulegieren, das heißt nach Begrenzungen, die die Bedingungen sind, ohne die er weder sein ursprüngliches Streben besitzen könnte noch erfüllen könnte. Bis zu welchem Punkt dulden es zwei so klar entgegengesetzte Strebungen in einem einzigen und selben Sein zu koexistieren? Diese Frage enthält etwas, was den Metaphysiker in Verlegenheit bringt, jedoch nicht den Transzendental-Philosophen. Dieser nimmt sich tatsächlich in keiner Weise vor, die Möglichkeit [an sich] der Dinge zu erklären, sondern gibt sich damit zufrieden, die Erkenntnisse zu bestimmen, die erlauben, die möglichen Bedingungen der möglichen Erfahrung zu begreifen (die Möglichkeit der Möglichkeit der Erfahrung). Und da die Erfahrung, um möglich zu sein, nicht weniger den [inneren] Gegensatz braucht, von dem wir sprechen, als die absolute Einheit, folgt daraus, dass die Philosophie mit vollem Recht diese zwei Begriffe bildet [den Gegensatz in der Einheit] als in gleicher Weise notwendige Bedingungen der Erfahrung, ohne sich weiter Sorgen zu machen über ihre Kompatibilität an sich1 “. 326 1 327 O. P., Konv. I. Ak., Bd. XXI, S. 761−10 . Indem er sich im Gegensatz dazu darum bemüht, diese „Kompatibilität“ zu erklären, hätte Kant, der sich schon sehr Fichte angenähert hatte, sich ihm im wesentlichen angeschlossen, und sich mit ihm auf einen absoluten Idealismus ausgerichtet. Wir werden darüber weiter unten besser urteilen können2 . 2 [Diese letzten Wörter des Manuskripts von P. Maréchal kündigen die Untersuchung des transzendentalen Idealismus nach Kant an. und tatsächlich folgt ihnen eine Seite, auf der genau dieser Titel folgt: Zweiter Teil. Der transzendentale Idealismus nach Kant. Da dieser zweite Teil nicht redigiert wurde, werden wir in den folgenden Kapiteln sein Fehlen ersetzen durch alte Manuskripte des Autors, bezüglich dessen wir auf das Vorwort der Herausgeber verweisen – Anmerkung der Herausgeber.] 260 Teil II. Transzendentaler Idealismus in der Zeit nach Kant 261 328 263 Kapitel 1: Die hauptsächlichen Typen der Interpretation des Kantismus 329 [Die Redaktion des Inhalts dieses ersten Kapitels – scholastisch in seiner Form – geht zurück auf die Jahre 1930, 1931]. Anmerkung der Herausgeber Die kantsche Kritik suchte eine allgemeine Relation zwischen den drei folgenden Termen: dem Subjekt – dem Objekt – dem Ding an sich. Diese allgemeine Relation muss zwei Probleme lösen: 1. Unter welchen Bedingungen produziert das Subjekt das (gedachte) Objekt? 2. Welches ist die Beziehung des (gedachten) Objekts zur Realität an sich? Nun aber konnten Zweifel entstehen über den exakten Sinn der kantschen Lösung für dieses doppelte Problem, Daraus ergaben sich verschiedene Systeme der Interpretation, die ebensoviele verschiedene Perspektiven eröffneten für die Möglichkeiten der weiteren Entwicklung der kritischen Philosophie. Notieren wir kurz die möglichen Typen der Interpretation. 10 Phänomenalistische Interpretation (formaler, dualistischer Idealismus) 330 Diese Interpretation, die auf dem Boden des wolffschen Realismus bleibt, an dem Kant hartnäckig festhielt, entspricht dem „historischen“ Denken des Philosophen. Alles was gesetzt oder vorausgesetzt ist, muss es sein, entsprechend der zugrundeliegenden Forderung der Vernunft (eine Forderung, deren absolute Geltung von Kant nicht bezweifelt wird), das heißt aber doch: entsprechend der notwendigen Identität mit sich selbst. Nun aber muss in der menschlichen Erkenntnis das Subjekt (= die transzendentale Einheit des Bewusstseins), da sie eine reine objektivierende Funktion ist ohne Inhalt, der ihr eigentümlich ist, um ein Objekt zu konstituieren, einen Inhalt von fremdem (das heißt nicht auf das a Priori des Subjekts reduzierbarem) Ursprung, eine „phänomenale Gegebenheit, empfangen“. Aber eine phänomenale Gegebenheit ist, als solche, 265 Kap. 1; Wichtigste Interpretationstypen des Kantismus 331 gerade die Kontingenz, die Relativität selbst. Das Kontingente oder das Relative setzen oder voraussetzen, ist nur möglich durch Setzen oder Voraussetzen der absoluten Bedingung, ohne die das Kontingente und das Relative dem Prinzip der Identität entwischt und gar nicht mehr „denkbar“ sind, das heißt ein „Absolutes“, ein „An-sich“ sind. Das Phänomen setzen ist also identisch „das Ding an sich “ setzen, wovon die sinnliche Gegebenheit nur die Manifestation unter der Form des Subjekts sein wird. Andererseits bleibt das Ding an sich, obwohl es als Realität affirmiert (gesetzt) ist, ein großes X, von dem alle Bestimmungen in unserem Denken ausschließlich phänomenal sind. Es kann einbeziehen ebensogut das ontologische Subjekt wie die ihm gegenübergestellten ontologischen Objekte. Es wird affirmiert (behauptet) mit logischer Notwendigkeit in der Affirmation (Behauptung) des phänomenalen Objekts selbst, nicht mehr und nicht weniger. Erklären wir konform zu dieser Exegese die allgemeine Relation, die weiter oben beschrieben ist: Wir werden haben: Das (kritische, transzendentale) Subjekt greift ein in das (gedachte) Objekt als Bestimmung a priori. Das Ding an sich (= ontologische Ordnung) ist das An-Sich, das der reinen phänomenalen „Gegebenheit“, der ersten Materie des Objekts, entspricht. Die Bestimmungen a priori, angewandt auf die phänomenalen „Gegebenheiten“ konstituieren das Objekt im Denken. Unter den wichtigsten Repräsentanten dieser phänomenalistischen Exegese, die absolut die Realität des Dings an sich beibehalten, muss man zitieren, trotz tiefgreifender Divergenzen: Schopenhauer (1788-1860), der andererseits als eigenwilliger Theoretiker aus dem „Ding an sich“ das transzendente „Wollen“ macht, das sich manifestiert in der „Repräsentation“. A. Riehl (1844-1924), der die Realität des Dings an sich als wesentlichen Teil der kantschen Philosophie betrachtet. Er selbst bekennt eine Art von physischen Realismus, der, ohne jedes a priori auszuschließen, jede definierte Metaphysik verwirft. Weiter eine gewisse Anzahl von orthodoxen Kantianern, Moralisten und Theologen in Deutschland und außerhalb. 20 Psychologische Interpretation Das transzendentale Subjekt von Kant ist hier betrachtet als psychologisches Subjekt. Die Kritik hätte als Ziel, die natürliche Organisation des erkennenden Subjekts zu entdecken oder, wenn man will, die objektive Erkenntnis zu erklären als Produkt der „Fähigkeiten“ des Subjekts. Das wahrhafte Fundament der Kritik würde sich von daher auf die innere, psychologische Erfahrung reduzieren, woraus die Tragweite mehr oder weniger sein kann, unsere natürliche oder 266 30 Logischer Transzendentalismus. 332 primitive Zustimmung festzustellen (zu messen) und zu begrenzen. Dieser Gesichtspunkt, trotz einiger zweideutigen Ausdrücke, war sicherlich nicht der von Kant, der in keiner Weise behauptete, eine „Psychologie“ zu machen, oder, wie er im Zusammenhang mit Locke sagt, eine „Physiologie“ des Geistes. Das Subjekt ist für Kant ein „kritisches“ Subjekt, das heißt einfach die „Bestimmung a priori“ des Objekts selbst. Hauptsächlichste Repräsentanten des Psychologismus sind: F.E. Beneke (1798-1854): klarer Psychologist. Dann zu verschiedenen Titeln und mit Vorbehalten: J.F. Fries (1773-1843), der das Ding an sich zulässt als Objekt des rationalen Glaubens. F.A.Lange (1828-1875), der aus dem Ding an sich einen reinen Grenzbegriff macht und dadurch, trotz seines Psychologismus, die neukantianische Schule von Marburg (siehe unten) ankündigt. Die Formel des Psychologismus ist: Das Subjekt ist das psychologische Subjekt, von dem wir die innere Erfahrung haben, und als solches erklärt es das Objekt, sein immanentes Produkt. Dem gedachten Objekt kann ein Objekt an sich entsprechen, aber, wenn dieses Ding an sich existiert, ist es für uns Objekt eines Glaubens oder Objekt einer primitiven, unmittelbaren Wahrnehmung, die nicht weiter gerechtfertigt werden kann. 30 Logischer Transzendentalismus. Nach dieser Interpretation: 1. Bleibt das Subjekt ein transzendentales Subjekt im streng kritischen Sinn und ist in keiner Weise gesetzt als ein Absolutes. Als transzendentale Funktion verlangt es, um das Objekt zu konstituieren, eine phänomenale „Gegebenheit.“ 2. Das Objekt bleibt wesentlich unfertig als Objekt oder als Intelligibles: Es erreicht in unserem Denken nie die absolute logische Identität mit sich selbst; aber es erstrebt dennoch diese absolute Bestimmung von sich selbst wie eine „Grenze“. 3. Das Ding an sich, affirmiert als Realität an sich, ist ein Unsinn. Trotzdem drückt das Ding an sich, begriffen als negatives Noumen (als das logische Korrelativ des Phänomens in unserem Denken) die „ideale Grenze“ aus, wo das Objekt voll und ganz Objekt sein wird (= voll und ganz es selbst, voll und ganz rational oder intelligibel) durch Eliminierung seines relativen Elements: An dieser Grenze, die per Definition selbst unzugänglich ist, hätte die „objektivierende Funktion“ des Subjekts sich voll und ganz ins Objekt entwickelt. 4. Das ganze System der objektiven Erkenntnis reduziert sich also auf einen unbeschränkt fortschreitenden Relativismus, in dem das absolute Element, das von der Vernunft verlangt wird, in den Endpunkt der Progression verschoben wird, wie ein Ideal oder wie ein Grenzwert. Die bestimmende Funktion des Subjekts wird „objektiv“ nur genannt auf Grund dieser Idealen Progression; 267 Kap. 1; Wichtigste Interpretationstypen des Kantismus 333 in sich ist sie nur zu jedem Zeitpunkt die nie vollendete Verkettung logischer Bestimmungen des Inhalts des Bewusstseins. Kurzformel des logischen Transzendentalismus: Das transzendentale Subjekt (objektivierende Funktion, Anspruch der Intelligibilität) und die phänomenale Gegebenheit (relativ, kontingent, logisch gefordert um ein Objekt zu konstituieren) geben, durch ihre Vereinigung die gedachten Objekte. Diese, immer wesentlich unvollendet unter dem Gesichtspunkt der absoluten Intelligibilität, zielen ab auf das Ding an sich, begriffen nicht als Realität an sich sondern als der Ideale Zielpunkt (Term), voll und ganz intelligibel, der objektiven Reihe, oder wenn man so will, die „noumenal“ gewordene Ausfüllung (expletion) der „objektivierenden Funktion“ des Subjekts. Hauptrepräsentanten des logischen Transzendentalismus: O. Liebmann (1840-1912), ein Wegbereiter, der noch unter der Form bedingender Relationen des gedachten Objekts ein Äquivalent des realen Dings an sich zulässt; H.Cohen (1842-1917). P.Natorp (1854-1925), E. Cassirer (Geb. 1874) und im allgemeinen die ganze neukantianische Schule von Marburg. Anhang: Man sieht leicht, dass eine rein logische Interpretation des Kantismus, wie die der Schule von Marburg zwangsläufig dazu führt, aus der kritischen Philosophie eine reine Methode des Denkens zu machen. Von da zu einer klar pragmatischen Verwendung dieser Methode ist nur noch ein Schritt. Unter denen unserer Zeitgenossen, die diesen Schritt machen unter dem entfernten Einfluss von Kant, zitieren wir nur außerhalb der Schule von Marburg: Vaihinger (1852-1933), wohl bekannter Kommentator der Kritik der reinen Vernunft, der sich zu einer Philosophie des „als ob“ bekennt, und in einer ein wenig verschiedenen Richtung, G. Simmel (1858-1918), der den radikalsten neu-kantianischen Relativismus vertritt. 40 Absoluter Idealismus. 334 Charakteristiken: 1. Das Begriffsmerkmal des „Dings an sich“ ist undenkbar, innerlich widersprüchlich. Es repräsentiert bei Kant nur einen Trick der Erklärung oder eine Inkohärenz des Ausdrucks (vergleiche schon zu Lebzeiten Kants eine lebhafte Kritik des „Dings an sich“ von Seiten der Gegner Kants, wie Jacobi und auch von Seiten maßloser Befürworter, der „Überkritiker“, wie Reinhold, Schulze [Aenesidem], Beck usw.). 2. Das Absolute, verlangt für die Rationalität des Objekts (Gedanke), kann also nicht gesucht werden in einem dem transzendentalen Subjekt gegenübergestellten Objekt, sondern muss zurückversetzt werden in dieses Subjekt selbst, das sich von daher als absolute Aktivität setzt. 268 40 Absoluter Idealismus. 335 3. Als Konsequenz muss sich das Objekt in seinem phänomenalen (materieartigen) Inhalt ebenso wie in seiner Form des Objekts rational durch das Subjekt erklären. Daher der absolute Monismus des Subjekts und die totale Immanenz des Objekts im Subjekt; im Gegensatz dazu blieb die phänomenalistische Interpretation beim Dualismus des Dings an sich und des Subjekts stehen und sie behielt das An-Sich des Objekts (als absolute Bedingung von dessen Intelligibilität) außerhalb des transzendentalen Subjekts bei. Das Bemühen des absoluten Idealismus wird sich hauptsächlich auf die rationale, systematische Ableitung des Objekts als ganzem, ausgehend vom absoluten Subjekt, erstrecken. Formulierung des absoluten Idealismus: Das transzendentale Subjekt, als absolutes gesetzt, produziert, durch innere Gegenübersetzung, zugleich die a priori objektive Subjekt-Bestimmung und den phänomenalen Inhalt, indem die Einheit dieser zwei Elemente das Objekt (den Gedanken) konstituiert. Kein Ding an sich, weder als Realität noch als Begriff. Hauptrepräsentanten des absoluten Idealismus: Fichte, der als erster mittels der Leugnung des Dings an sich an den kantschen Transzendentalismus das Prinip des absoluten Idealismus anknüpft. (1762-1814). Schelling (17751854) und Hegel (1770-1831) mit ihren entsprechenden Schulen sowie die NeuFichtenschen und Neu-Hegelianischen Gruppierungen. N.B. Trotz bemerkenswerter Unterschiede, die wir weiter unten anzeigen werden, entwickeln sich die drei großen pantheistischen, transzendentalistischen Systeme auf dem gemeinsamen Boden des absoluten Idealismus. Das ist es, warum wir sie hier unter einer gemeinsamen Benennung vereinen können, die ihre Abstammung von Kant unterstreicht. 269 Kapitel 2: Der transzendentale Idealismus von Fichte Für das Datum dieses 2.Kapitels siehe das Vorwort der Editoren. – Anmerkung der Editoren. 336 Zu den konstitutiven Elementen des „Objekts“ der Erkenntnis, so wie es Kant definiert, fügen wir eine Relation zum inneren Werden der Intelligenz hinzu. Welches ist das Schicksal der so korrigierten kantschen Philosophie? Welche Wege bleiben für sie offen zu einer weiteren Systematisierung? Es ist evident, dass wir hier nicht die Rückkehr in Betracht ziehen müssen, die sie machen könnte zu schon überholten Gesichtspunkten. Sie würde jeden Schritt zurück bezahlen mit dem Opfer eines wesentlichen Prinzips. Sie zum Beispiel sich entwickeln lassen zu einem idealistischen Dogmatismus, Panlogismus oder Ontologismus oder zu einem empiristischen Dogmatismus, wie den pluralistischen Materialismus würde so viel sein, wie die fundamentale Absicht der Kritik zu leugnen. Dagegen daraus einen absoluten Phänomenalismus zu schließen oder einen Empirio-Kritizismus oder einen Positivismus würde eine Regression bis zu Hume und noch weiter zurück signalisieren und würde darauf zurückkommen, die Methode der transzendentalen Analyse vor der der reinen objektiven Zerlegung zu streichen. Diese Transformationen wären eher die Negation als die Fort-Entwicklung der kantschen Kritik. Aber eine andere Transformation würde eher einer organischen Evolution ähneln, nämlich die, welche erfolgreich zum subjektiven Idealismus von Fichte, vor allem in seiner Anfangsphase, führt. I.–Der Skandal des „Dings an sich“ Zwischen Kant und Fichte wurde der Übergang durch mehrere interessante Vermittler schonend bewirkt. Erklärte Gegner des Kantismus wie Jacobi oder unabhängige Befürworter wie Reinhold oder Maimon schienen sich das Wort gegeben zu haben, die Realität des „Dings an sich“ zu ruinieren. Selbst bevor man den Streitfall studiert, hat man den Eindruck, sich da vor einer tiefgründigen Schwierigkeit 271 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 337 zu finden, die dem kantschen System inhärent ist, denn sie behauptet sich genau mit einer besonderen Klarheit bei den „Hyperkritikern“, Bewunderern und unmittelbaren Fortsetzern von Kant, ... deren Kühnheiten jedoch der alte Meister nicht übermäßig schätzte. Reinhold zuerst, meinte dass der kantsche Dualismus von Materie und Form, das Dings an sich und die Repräsentation eine unglückliche Unvollkommenheit sei, die möglichst bald zu korrigieren ist. Er schmeichelte sich, die Einheit des Systems wieder herzustellen, indem er die verschiedenen Teile mit einem einzigen Prinzip zusammenfügte: das „Bewusstsein“, das heißt den Akt, eine Repräsentation korrelativ zu einem Subjekt und zu einem Objekt zu beziehen. Seine Ratlosigkeit war groß vor dem Begriff des Dings an sich. Einerseits ist tatsächlich das Ding an sich nicht denkbar, denn selbst Definitions gemäß ist ein Objekt nur denkbar in Relation mit einem Subjekt. Man müsste daraus schließen, dass das Ding an sich, weil widersprüchlich, unmöglich ist. Aber andererseits fordert die Gegenwart einer „Materie“ in der Erkenntnis, mit ganzer Notwendigkeit die Existenz eines Dings an sich: denn wer sagt „Materie“ der Erkenntnis, der sagt „Element nicht hervorgebracht durch das Subjekt“ und postuliert also ein subsistierendes Objekt an sich und fähig, auf das Subjekt zu wirken. Reinhold hat, um die Wahrheit zu sagen, diese Schwierigkeit nicht bewältigt. Wenig später hat Salomon Maimon, zugleich Bewunderer und Gegner von Kant, von dem Kant selbst sagte, dass keiner seiner Widersacher ihn so gut verstanden hat, das Hindernis, das Reinhold stoppte, direkt angepackt. Er macht darauf aufmerksam, dass die Unterscheidung zwischen Materie und Form (der Erkenntnis) ganz relativ ist: In Wirklichkeit gibt es weder reine Materie noch reine Form. Mit Kant zu sagen, dass etwas in der Erkenntnis „gegeben“ ist, und also dabei die Funktion einer Materie annimmt, bedeutet nicht, dass das „Gegebene“ „reine Materie“ der Erkenntnis ist, sondern nur, dass es sich nicht a priori ableiten lässt aus den allgemeinen Gesetzen des Bewusstseins. Dafür dass ein „Ding an sich“ logisch notwendig wird als Ursache des Gegebenen, ist es nötig, dass das Gegebene Materie sei in Bezug auf das Subjekt als ganzes (buchstäblich) genommen und nicht nur in Beziehung auf die allgemeinen Gesetze des Bewusstseins, die nicht notwendig das ganze Subjekt sind. Absolut sprechend könnte die Anwesenheit des Gegebenen sich ebensogut erklären durch die (unbewusste) Aktivität des Subjekts oder der Fakultät der Erkenntnis wie durch den Einfluss eines vom Subjekt unterschiedenen ... und im Übrigen undenkbaren „Dings an sich“. Auf anderen Wegen kommen andere kritische Philosophen, wie etwa G. E. Schulze (Enesideme) und S. Beck zum selben Schluss. Der erste findet, dass Kant, um bis zum Ende logisch zu sein, den absoluten Idealismus hätte bekennen müssen und die Verneinung des Dings an sich. Der zweite, treuerer Befürworter, behauptet (vielleicht, das stimmt, unter dem Einfluss der ersten 272 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 338 Werke von Fichte), dass der Begriff des Dings an sich mehr oder weniger für den Denker aus Königsberg ein Erklärungstrick, ein pädagogisches Verfahren war: nur ein einziger Standpunkt oder Gesichtspunkt würde erlauben, die Kritik genau zu verstehen und insbesondere die Deduktion der Kategorien: der eines rigorosen Idealismus1 . 1 Der kantsche Begriff des „Dings an sich“, erklärt in der zweiten Auflage der Kritik ist gar nicht so evident widersprüchlich: denn er bezeichnet nur die Abstraktion jeder phänomenalen Begrenzung im Objekt: Das Residuum dieser Abstraktion liefert keinen eigentlichen und positiven Begriff, sondern einen negativen und problematischen Begriff. Um die Wahrheit zu sagen, um mit Kant zu sprechen von der Realität des Dings an sich als Grenzwert des Phänomens, müssen wir ein Mittel besitzen, in unserem Bewusstsein eine Begrenzung, insofern sie eine Begrenzung ist, zu erkennen: und das ist nur auf zwei Weisen möglich: durch eine intuitive Schau des Darüber-Hinaus dieser Grenze oder aber durch die reflexe Erkenntnis eines Strebens, das uns antreibt, diese Grenze zu überspringen. Dieser zweite Fall ist, wie wir gesehen haben, der unserer menschlichen Erkenntnis des Absoluten. All diesen Philosophen, Zeitgenossen und Fortsetzer von Kant, schien also das „Ding an sich“ ein Element der Unstimmigkeit und Disharmonie im kritischen System; und da die tiefe Wurzel dieser Disharmonie im psychologischen Dualismus der Sinneswahrnehmung und des Verstandes lag mit seiner scharfen Gegenüberstellung einer Materie der Erkenntnis und eines erkennenden Subjekts, deutete sich die notwendige Richtigstellung von sich aus an: vom Subjekt selbst die Materie der Erkenntnis ableiten. Das ist es, was Fichte realisierte mit einer Ausführlichkeit und einer unbestreitbaren Meisterschaft. Wir müssen in einem anderen Werk auf den subjektiven Idealismus von Fichte zurückkommen insofern er eine Metaphysik auslöst. Wir beschränken uns hier darauf, einige bedeutendere Zeilen ins Licht zu setzen, die direkt zu unserem Thema gehören. II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. Die Untersuchung, die nun folgt stützt sich hauptsächlich auf die folgenden Werke von Fichte: Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (Wir verwenden im Folgenden, um dieses Werk zu erwähnen, die Abkürzung: Grundlage W-L.) 1.Aufl. 1793 und 2.unveränderte Auflage 1802 (vergl. J.G. Fichte’s Sämtliche Werke, herausgegeben von J.H. Fichte, Berlin, 1845, Band I)– Grundriss des Eigentümlichen der Wissenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Vermögen, 1795 (Edit. cit, Band I) – Erste und zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, 1797 (zitierte Ausgabe Band I) – Darstellung der Wissenschaftslehre aus dem Jahr 1801 (zitierte Ausgabe Band II) – Die Thatsachen des Bewusstseins, Vorlesungen gehalten in Berlin 1810-1811 (zitierte Edition Band II) – Die Bestimmung des Menschen, 1800 (zitierte Edition Band II). – Die Anweisung zu einem seligen Leben oder die Religionslehre, 1806 (zitierte Edition Band V), im Internet zugänglich bei gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k266819/f128 273 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte §1.–Die systematische Forderung und die idealistische Voraussetzung bei Fichte 339 Das Ziel von Fichte war, das ganze System der Vernunft zur strengsten Einheit zurückzuführen. Um diese Einheit zu erreichen, war es nötig, ein „absolutes Prinzip“ zu entdecken, aus dem zugleich die formartigen Bestimmungen und der materieartige Inhalt unseres Bewusstseins sich herleiten lassen könnten. Dieses Anfangsprinzip der Vernunft war evident nicht das Axiom „vom Bewusstsein“ oder von der „Repräsentation“, das von Reinhold empfohlen worden war. Tatsächlich überwindet das Axiom von Reinhold nicht den Dualismus von Objekt und Subjekt. Es setzt noch das Subjekt voraus, das auf das Objekt bezogen ist, es ist also relativ und nicht absolut erstes. „Wir setzen uns das Ziel, schreibt Fichte bereits auf der ersten Seite der Wissenschaftslehre, das absolut erste, absolut bedingungslose Prinzip jedes menschlichen Wissens zu suchen. Wenn dieses Prinzip absolut erstes sein soll, wird es sich weder beweisen noch definieren (beweisen oder bestimmen) lassen. es muss eine Aktion (Thathandlung) ausdrücken, von der tatsächlich und mit Recht weggenommen ist jede empirische Bestimmung unseres Bewusstseins, da diese Thathandlung ebensogut das Fundament und selbst die Bedingung der Möglichkeit jedes Bewusstseins ist1 “ 1 Grundlage W-L zit. Edit. S.91 Originaltext: Wir haben den absolut ersten, schlechthin unbedingten Grundsatz alles menschlichen Wissens aufzusuchen. Beweisen oder bestimmen lässt er sich nicht, wenn er absolut erster Grundsatz sein soll. Er soll diejenige Thathandlung ausdrücken, welche unter den empirischen Bestimmungen unseres Bewusstseins nicht vorkommt noch vorkommen kann sondern vielmehr allem Bewusstsein zum Grunde liegt und allein es möglich macht. Das absolut absolute Prinzip drückt also nichts aus, was objektiv in unserem Bewusstsein repräsentierbar ist. Aber es gibt noch mehr. Wir wissen schon, vor jeder Untersuchung, dass das absolute Prinzip ein Subjekt oder ein Ich bezeichnen wird unter Ausschluss eines „Objekts an sich“, eines unabhängigen Nicht-Ich, kurz, eines „Dings an sich“ im angeblich kantschen Sinn dieses Ausdrucks. Denn in den Augen Fichtes wie in den Augen der Kantianer und Antikantianer, seinen unmittelbaren Vorgängern, ist das „Ding an sich“ nur ein Unsinn, „das genaue Gegenteil der Vernunft“, ein „völlig irrationaler Begriff“ (“die völligste Verdrehung der Vernunft“, „ein rein unvernünftiger Begriff2 “). Der absolute systematische Anspruch trifft sich hier mit der idealistischen Voraussetzung. 2 Zweite Einleitung zit. Ed. S.272 Und dieses Zusammentreffen definiert genau das Ideal einer kritischen Philosophie im Gegensatz zu einer dogmatischen Philosophie: „Das Wesen einer kritischen Philosophie besteht darin, ein absolutes Ich zu setzen als völlig unbedingtes und unfähig, durch ein höheres Prinzip bestimmt zu werden, irgendeine äußere Bestimmung zu empfangen: Eine Philosophie, die sich logisch ab- 274 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 340 wickelt, ausgehend von diesem fundamentalen Prinzip, nennt sich eine Theorie der Wissenschaft [Wissenschaftslehre]. Im Gegensatz dazu ist eine Philosophie dogmatisch, wenn sie auf der selben Ebene das Ich an sich und irgendetwas dem Ich Fremdes gegenüberstellt, wie es der Fall ist in dem behaupteten übergeordneten Begriff des Dings (ens), den man gern als absolut höchsten Begriff aufstellt. In einem kritischen System ist das Ding das, in dem das Ich selbst gesetzt wird. So ist der Kritizismus immanent, weil er alles im Ich setzt, der Dogmatismus transzendent, weil er behauptet, das Ich zu überschreiten3 “ 3 Grundlage W-L. zit. Ed. S.119-120 Originaltext: Darin besteht nun das Wesen der kritischen Philosophie, dass ein Absolutes Ich als schlechthin unbedingt und durch nichts Höheres bestimmbar aufgestellt werde. Und wenn diese Philosophie aus diesem Grundsatz consequent folgert, so wird sie Wissenschaftslehre. Im Gegenteil ist diejenige Philosophie dogmatisch, die dem Ich an sich etwas gleich und entgegensetzt; und dieses geschieht in dem höher seyn-sollenden Begriff des Dinges (Ens), der zugleich völlig willkürlich als der schlechthin höchste aufgestellt wird. Im kritischen System ist das Ding das im Ich gesetzte; im dogmatischen dasjenige worin das Ich selbst gesetzt ist; der Kriticism ist darum immanent, weil er alles in das Ich setzt; der Dogmatism transzendent, weil er noch über das Ich hinausgeht. Kurz eine kritische Philosophie verlangt die engste systematische Einheit; die systematische Einheit schließt den inkohärenten Gesichtspunkt des Dings an sich aus und fordert den des totalen Idealismus. Und der Gesichtspunkt des totalen Idealismus ist der der totalen Immanenz im Ich. Das Ich erscheint also wie das exklusive und dominierende Prinzip der kritischen Philosophie. Jede Bestimmung, die das Bewusstsein trifft, muss vom Ich abhängen, in seinem Ursprung und seiner Fortdauer. Wir finden also in unserer Hand bereits an der Schwelle des kritischen Labyrinths, den Faden der Ariadne, der uns dauernd führen muss, das was Fichte nennt „ein allgemeines regulierendes Prinzip1 “: „nichts kommt dem Ich zu, als das, was es in sich setzt2 “, oder noch kürzer: „Im Ich soll alles gesetzt sein3 “: Alles ohne Ausnahme muss sich setzen im Ich. 341 1 Grundriss des Eigenthümlichen.. Zit. Ed. S.333 2 ebenda 3 Grundlage W-L. S. 260 Man möge uns erlauben, beiläufig zu bemerken, dass die idealistische Voraussetzung, unbestreitbar in gewissen seiner Geltungen, durchaus nicht absolut erleuchtend erscheinen kann unter der allgemeinen Formulierung, die wir ihr hier geben. Weder Kant noch selbst irgendein dogmatischer Philosoph leugnet, dass ein „Ding an sich“ definiert durch Ausschluss jeder Beziehung auf irgendein Ich als Objekt undenkbar sei. Denn irgend ein Ding als Objekt denken, das heißt, es denken als Term einer Beziehung der logischen Wahrheit, das heißt als Term einer Relation auf ein erkennendes Subjekt, auf ein Ich. Daraus folgt, dass jede objektiv erkannte Bestimmung, auf die eine oder andere Weise einem erkennenden Ich immanent sein muss: etwas was niemand jemals zu leugnen sich unterstanden hat. Kann man weiter gehen und mit Fichte sagen, dass jede objektiv erkannte Bestimmung vom Ich als Ursprung 275 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte her kommen muss, das heißt nicht nur aktiv reproduziert sondern rein und einfach produziert [hervorgebracht] wird durch die Handlung des Ich selbst? Das ist weniger klar. Dennoch platzieren die wirklich vom dualistischen manichäischen Prinzip unversehrt gebliebenen Metaphysiken auf den Gipfelpunkt und an den Ursprung der Dinge den Geist, das Denken, das heißt, im Sinn wie es Fichte versteht, das absolute Ich. Ein „Ding an sich“ völlig dem Geist fremd, wäre wirklich eine Absurdität. Aber was für Probleme stellen sich dann? Und was ist die Verwandtschaft dieses höchsten Ich, dieses absoluten Geistes mit dem psychologischen Ich, auf das sich unmittelbar die Bestimmungen unseres Bewusstseins beziehen? Ebenso offenbart die idealistische Voraussetzung, die uns vorübergehend als ausrichtendes Prinzip dient, ihre wahre Tragweite erst nach Vollendung des ganzen „Systems“ des Idealismus. Bevor wir Fichte bei der Errichtung dieses Systems folgen, wollen wir uns einen Augenblick aufhalten mit einigen methodologischen Vorbemerkungen, deren Natur es ist, Missverständnissen vorzubeugen. §2.–Auf der Suche nach dem absoluten Prinzip §2.a) Die großen Linien der Methode Die Methode von Fichte, nichts zu betrachten als nur die großen Linien, bietet nichts wirklich beunruhigendes für jemand, der das Vorgehen der kantschen Ableitung der Kategorien verstanden hat. 342 Die analytische und deduktive Methode bei Kant. – Kant nahm den Ausgangspunkt im „objektiven Gedanken“, im „Objekt, das im Bewusstsein gegenwärtig “ ist. Im Inneren des konkreten Objekts offenbarte sich unmittelbar der Gegensatz einer Einheit und einer Vielfachheit. Nun ist aber die Verbindung dieser entgegengesetzten Terme nur begreifbar in einer Relation von Materie zu Form. Die konstitutive Einheit des bewussten Objekts nahm also den Charakter einer Form an, während in demselben Objekt die auf Formen irreduzible Vielfachheit des Bewusstseins, die primitive oder „ursprüngliche“ Vielfachheit, wie sie Kant nennt, notwendigerweise eine Materie oder ein rohes „Datum [=Gegebenes]“ wurde. Aber seinerseits ist die formartige Einheit eines rohen „Gegebenen“ zuerst nur begreifbar als „rezeptive Form“, das heißt als Form einer Sinneswahrnehmung. Andererseits bleibt eine rezeptive Form unfähig, das Gegebene bis zur Einheit eines „Objekts“ zu erheben. Die Analyse des Begriffs des Objekts als solchem zeigt, dass die objektive [=auf ein Objekt bezogene] Form a priori sein muss nicht nur wie es schon die rezeptive Form ist, sondern zugleich a 276 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 343 priori und spontan. Und das Zusammenwirken dieser divergenten Charakteristiken – Rezeptivität und Spontaneität, rezeptive Apriorität und spontane Apriorität – in einer selben Repräsentation des Objekts scheint nur möglich, wenn die Spontaneität die einer „synthetischen“ Einheit ist, die das Gegebene durch die Vermittlung von rezeptiven Formen steuert. Die so definierte synthetische formartige Einheit kann noch verschieden sein, wie es tatsächlich unsere Kategorien sind. Und dennoch werden die bewussten Objekte nicht bewusst, und folglich werden sie nicht Objekte für uns, es sei denn kraft einer gewissen Gleichförmigkeit (Homogenität), die sie bezieht auf die Einheit eines selben Bewusstseins, eines selben „Ich“. Die Verschiedenheit der kategorialen Begriffe ist also objektiv nur möglich unter einer höchsten Bedingung der Einheit, die Kant „die objektive Einheit der Apperzeption“ nennt. Beachten wir genau die Natur dieses Beweises. Man erkennt darin mühelos eine „transzendentale Analyse“, das heißt eine reflexe Dialektik, die die Bedingungen a priori der Möglichkeit eines im Bewusstsein gegenwärtigen Objekts evident macht. Muss man daran erinnern, dass diese transzendentale „Analyse“ sich sehr von der einfachen psychologischen Analyse eines Inhalts des Bewusstseins unterscheidet? Die transzendentale Analyse reduziert, in dem was sie wirklich charakteristisches hat, sich leicht auf das logische Schema der rationalen Synthese vermittelnd zwischen entgegengesetzten Termen. Man kann sie schon feststellen in der kurzen Skizze, die wir gerade vom kantschen Beweis darstellen. Und im Übrigen wird man sich überzeugen, dass es nicht anders sein kann, wenn man es wohl in Acht nehmen will, dass die Bedingungen der Möglichkeit von etwas suchen, zu erst das ist, vorauszusetzen, dass dieses etwas nicht durch sich selbst allein, die volle rationale Harmonie verwirklicht, und es ist an zweiter Stelle, ein sich auf die Suche begeben nach einem höheren Gesichtspunkt, von dem aus die Disharmonie reduziert erscheint. Jede Etappe der kantschen transzendentalen Analyse könnte also reduziert werden auf die dreistufige Form einer Synthese, die eine These mit einer Antithese in Einklang bringt. Wir haben in der Kritik der reinen Vernunft die allgemeinen Resultate der transzendentalen Reflexion, angewandt auf Objekte unseres Bewusstseins untersucht. Von Anfang an mussten wir hinter uns lassen, wie eine irrationale Materie die irreduzible Vielfachheit des empirisch „Gegebenen.“ Dann ist ans Licht gekommen, dass die ersten Bedingungen a priori, die Formen der Sinnlichkeit noch nicht die rationalen Bedingungen waren, denn sie waren durch sie selbst noch nicht reduzierbar auf die Einheit des Verstandes. Mit der Form der Begriffe, partielle Ausdrücke der „ursprünglichen Einheit der Apperzeption“, ging es anders Also schließlich zeigt sich die kantsche transzendentale Analytik, deren Ziel es war, die letzten Prinzipien der objektiven Erkenntnis aufzudecken, unfähig, 277 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 344 sie zurückzuführen auf eine vollkommene Einheit, von der aus es möglich gewesen wäre, sie abzuleiten. Im Gegenteil, sie drängte uns zu der primitiven Dualität einer Materie und einer Form. Noch schlimmer, im Inneren selbst der Form nahm sie eine zweite Dualität an, die der rezeptiven Form und der synthetischen Form, wobei die letztere allein in ihrer Ordnung zu einer wahren Einheit aufsteigt. Das höchste Prinzip, das von Kant erhalten wurde, war also nicht ein völlig absolutes und universelles Prinzip der Deduktion. Es steuerte noch nur die synthetische Form der Objekte. Im Besitz dieses Prinzips wird Kant den durchlaufenen Weg im umgekehrten Sinn wiederaufnehmen. Einfache Phantasie? In keiner Weise. Einfache Kontrolle der durchgeführten Analyse? Mehr als das. Tatsächlich bemühte er sich aus dem formalen Prinzip der Apperzeption, die Bedingungen der aktuellen Ausführung dieses Prinzips im Inneren eines bewussten Objekts zu deduzieren. Man hat vom bewussten (hypothetisch gegebenen) Objekt seine a priorischen Bedingungen der Möglichkeit induziert (abgeleitet); jetzt nimmt man sich vor, aus seinen Bedingungen a priori der Möglichkeit die notwendigen Attribute des bewussten Objekts zu deduzieren. Diese zweite Phase konstituiert (bildet) das was man im eigentlichen Sinn die „transzendentale Deduktion“ des Objekts nennt: in dem Maße in dem sie praktikabel ist, liefert sie uns die reine und apodiktische Wissenschaft eines Objekts, die zuerst nur die kontingente Geltung einer „Tatsache des Bewusstseins“ hat. Aber in welchem Maße ist diese Deduktion möglich? Erinnern wir uns an das, was Kant a priori ableiten konnte aus dem höchsten formalen Prinzip – „reine Einheit des Bewusstseins“ oder „ursprüngliche Einheit der Apperzeption“. – Ein formales Prinzip verlangt einen Inhalt, eine „Materie“. In Strenge könnte dieser Inhalt, auch er selbst, a priori sein, das heißt, dass die reine apperzeptive Einheit also die Form einer intellektuellen Intuition wäre. Kant zeigt diese Möglichkeit an: „Ein Verstand in dem alle die verschiedenen Elemente (= die „Materie“ der Erkenntnis) gegeben wären im Bewusstsein von sich (= in der reinen Apperzeption) wäre intuitiv1 “ 1 345 Kritik der reinen Vernunft, Übersetzung Barni-Archambault 1, Seite 140 Aber das ist evident nicht der Fall unseres Verstandes. Und wir sind zurückgeworfen auf das zweite Glied der Alternative: die reine apperzeptive Einheit verlangt einen Inhalt außerhalb von ihr, das heißt eine „Gegebenheit.“. Wir merken jedoch an, dass in der Alternative einer inneren Gegebenheit und einer äußeren Gegebenheit die Wahl des zweiten Gliedes bestimmt wird in den Augen Kants durch eine Tatsache des Bewusstseins und nicht apodiktisch. Von seiner ersten Etappe an schließt sich unsere transzendentale Deduktion also ein in die Grenzen einer kontingenten Hypothese, sie bemüht sich schon nicht mehr um ein „absolutes System“ der Erkenntnis. Fahren wir weiter. Die reine Einheit des Bewusstseins verlangt, um eine äußere Gegebenheit zu informieren [=mit einer Form zu versehen] die Ver- 278 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 346 mittlung von unmittelbar diese Gegebenheiten rezeptiven Formen, das heißt von Formen a priori einer Sinneswahrnehmung. Wiederum ist dieser Satz apodiktisch: die Notwendigkeit einer Sinneswahrnehmung deduziert sich aus der reinen Einheit des Bewusstseins, angewandt auf eine externe Gegebenheit. Folgt daraus, dass die sinnlichen Formen genau der Raum und die Zeit sein müssen? Das ist möglich, aber Kant versucht selbst nicht eine Deduktion des Raums und der Zeit. Wenn die Sensibilität einmal im allgemeinen abgeleitet ist, kennen wir apodiktisch die Notwendigkeit des „kategorialen“ Modus der Synthese, das heißt des synthetischen Modus, der den Verstand definiert. Tatsächlich, dafür dass die reine Apperzeption das Gegebene erreicht durch die Vermittlung des rezeptiven a priori (Form der Sensibilität), ist es nötig, dass eine funktionale Relation existiert zwischen diesem und jenem: Diese funktionale Relation ist genau das, was wir eine Kategorie nennen. Die Deduktion bringt uns also bis zum kategorialen Modus der Synthese, in der Hypothese einer äußeren Gegebenheit. Aber braucht es eine oder mehrere Kategorien? Um das zu wissen, müssen wir zuerst wissen, wie viele Formen a priori der Sinneswahrnehmung es gibt und wieviele Kombinationen sie untereinander realisieren können. Wenn man „sich vorgibt“ als Formen der Sinneswahrnehmung den Raum und die Zeit, könnte man unter dem Nutzen dieser zweiten Hypothese die Notwendigkeit von zwölf Kategorien der Erfahrung deduzieren. Schließlich unter denselben Vorbehalten und vermittels derselben Hypothesen führt uns das oberste Prinzip der Apperzeption bis zur Notwendigkeit entweder des Schematismus im allgemeinen oder der effektiven Mannigfaltigkeit der reinen Schemata. In dem Moment finden sich alle die Bedingungen abgeleitet, die a priori steuern die Konstitution eines bewussten Objekts vom Typ der bewussten Objekte unserer Erfahrung. Diese Deduktion muss geführt werden durch restriktive Hypothesen, die das Feld der Anwendung der apperzeptiven Einheit beschränken. Aber in diesen Grenzen ist die Deduktion wahrhaftig a priori entwickelt. Und es ist mit Recht, dass Kant, wie folgt, die ganze „Deduktion der reinen Begriffe des Verstandes“ zusammenfasst: „Sie besteht darin, die reinen Begriffe des Verstandes zu erklären (und mit ihnen die ganze theoretische Erkenntnis a priori) als Prinzipien der Möglichkeit der Erfahrung – indem man diese betrachtet als die Bestimmung der Phänomene im Raum und in der Zeit im allgemeinen – und indem man schließlich herleitet aus dem Prinzip der synthetischen aus der Apperzeption entspringenden Einheit, wie aus der Form des Verstandes in seiner Beziehung zum Raum und der Zeit, diese ursprünglichen Formen der Sinneswahrnehmung.1 “ 1 Kritik der reinen Vernunft Übersetzung Barni-Arch. I, S.163 Mit anderen Worten: Kant hat die Deduktion des Objekts unserer Erkenntnis 279 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte durchgeführt sicher nicht bezüglich der „Materie“, noch bezüglich der „Formen von Raum und Zeit“ aber wenigstens bezogen auf die „synthetische Form“, was aus der Repräsentation (Vorstellung) ein Objekt (Gegenstand) macht. 347 Die analytische und deduktive Methode bei Fichte.– Das Beweisverfahren von Fichte unterscheidet sich, trotz einer größeren Ausführlichkeit, in seiner allgemeinen Form in zweifacher Hinsicht nicht von dem von Kant versuchten kritischen Beweis. Die ganze Theorie der Wissenschaft [Wissenschaftslehre] besteht darin, aufzusteigen (in einer freien Entwicklung des reflexen Denkens) von einem subjektiv notwendigen Startpunkt bis zu einem rational absolut ersten Prinzip, und danach von diesem Prinzip deduktiv abzusteigen zum Ausgangspunkt. Und zuerst, welches ist der Ausgangspunkt von Fichte? Genau der von Kant: der objektive Inhalt des Bewusstseins. Das ist der unvermeidliche Ausgangspunkt jeder kritischen Untersuchung: Um eine Kritik einzuführen, muss ich mir wenigstens einen Stoff, eine Materie zu kritisieren vorgeben, einen „Gedanken“ oder ein „Objekt des Bewusstseins“. Meine kritische Aufgabe ist es dann, in diesem bewussten Objekt (das ich mir vorgebe) die absolut notwendigen Prinzipien der Erkenntnis wiederzufinden. Da ein bewusstes Objekt mir nur gegeben sein kann in einer konkreten Erfahrung, entwickelt sich die gesamte Kritik oder die gesamte Wissenschaftslehre von Erfahrung zu Erfahrung, das heißt zwischen der gegebenen Anfangserfahrung und der Erfahrung noch insofern sie sich deduzieren lässt aus Prinzipien a priori. Fichte erklärt es ausdrücklich in seinem Werk Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre: „Mein System des Idealismus geht aus von einem einzigen rationalen Prinzip, das sich unmittelbar im Bewusstsein enthüllt2 “. „Der Weg, auf dem sich dieser Idealismus bewegt, geht von einem, kraft einer freien Aktivität des Denkens im Bewusstsein gegenwärtigen Inhalt aus und führtzum Gesamten der Erfahrung. Der Zwischenraum zwischen diesen extremen Punkten ist das dem Idealismus eigene Gebiet.3 “ 2 Erste Einleitung in die W-L. zit.Ed. S.445 Originlatext: Dieser Idealismus geht aus von einem einzigen Grundgesetze der Vernunft, welches er im Bewusstsein unmittelbar nachweist 3 S.448 Originaltext: Der Weg dieses Idealismus geht, wie man sieht, von einem im Bewusstsein, aber nur zu folge eines freien Denkakts, vorkommend zu der gesamten Erfahrung. Was zwischen beiden liegt, ist sein eigenthümlicher Boden. Von diesem unvermeidlichen Ausgangspunkt (dem akuellen Bewusstsein) ist es also notwendig, aufzusteigen bis zum am weitesten zurückliegenden und absolutesten Prinzip, das wir erreichen können. Wir werden gleich die Hauptstufen der Beweisführung Fichtes aufgreifen. Für den Augenblick beschränken wir uns auf einige Bemerkungen zur Methodologie. In dieser Hinsicht verfährt Fichte, wie es Kant selbst hätte machen können. Nachdem er in den „Inhalten des Bewusstseins“ das Prinzip isoliert hat, welches das objektive Bewusstsein als solches definiert, bemüht er sich, des- 280 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. sen Bedingungen der Möglichkeit zu entdecken und damit zu verbinden. „Der idealistische Philosoph, sagt Fichte, beweist, dass das, was er zuerst gesetzt hat und im Bewusstsein unmittelbar erkannt hat als ein fundamentales Prinzip, selbst nur möglich ist unter der Bedingung von etwas anderem; und dass dieses andere wiederum nur möglich ist durch etwas drittes und so fort bis zum vollständigen Erschöpfen der Reihe der Bedingungen des gesetzten Prinzips, das heißt, bis dahin, dass die Möglichkeit dieses Prinzips völlig intelligibel gemacht ist. Der Lauf des Beweises ist also ein ununterbrochenes Fortschreiten vom Bedingten zur Bedingung1 “ 1 Erste Einleitung, zit. Ed. S.446 Originaltext: Hierbei verfährt er auf folgende Weise: Er zeigt, dass das zuerst als Grundsatz aufgestellte und unmittelbar im Bewusstsein nachgewiesene nicht möglich ist, ohne dass zugleich noch etwas anderes geschehe solange bis die Bedingungen, und dieses andere nicht, ohne dass zugleich etwas drittes geschehe solange bis die Bedingungen des zuerst aufgewiesenen vollständig erschöpft, und dasselbe, seiner Möglichkeit nach völlig begreiflich ist. Sein Gang ist ein ununterbrochenes Fortschreiten vom Bedingten zur Bedingung. Die Bedingung wird wieder ein Bedingtes, und so ist ihre Bedingung aufzusuchen. 348 Wir haben schon gesehen, dass die Suche der Bedingungen der Möglichkeit ein synthetischer Gang der Vernunft ist. Bei Fichte – man zögert nicht, das festzustellen – entwickelt sich das synthetische Verfahren, klarer unterstrichen als bei Kant, durch ein Spiel von Thesen, Antithesen und Synthesen, was den Auftakt bildet zur Dialektik von Schelling und von Hegel. Die intellektuelle Intuition des Aktes oder die dynamische Intuition,– Aber unter dem Parallelismus der Methoden hält sich von Kant zu Fichte eine schwerwiegende Meinungsverschiedenheit. Kant, der die Realität des „Dings an sich“ zulässt, hat überhaupt keine solche Sorge, wie das radikale idealistische Vorurteil; Fichte, der das „Ding an sich“ für widersprüchlich hält, muss diese idealistische Voraussetzung in seine Beweisführung einführen. Während Kant das sinnlich Gegebene akzeptiert, ohne dafür den Ursprung zu suchen, sich dann die Zeit und den Raum als primitive Formen der Sinnlichkeit gibt und schließlich in der Reihe der Bedingungen des Verstandes beim formartigen Prinzip der reinen Apperzeption aufhört (das heißt der reinen Reflexion des Ich über sich selbst), sieht sich Fichte gezwungen, durch seinen strengen Idealismus, ein absolutes Prinzip einzuführen, das einschließt zugleich das sinnlich Gegebene, die Formen von Raum und Zeit und die Form der reinen Reflexion. Noch schlimmer, dieses Prinzip muss, um absolutartig absolut zu sein, auch noch das spekulative Ich und das praktische Ich in eine noch radikalere Einheit verschmelzen. Aber ist das nicht eigentlich ein utopischer Versuch? Was könnte man wohl verlangen jenseits der reinen Einheit der Apperzeption, konzipiert als Prinzip der formartigen Bestimmung? Es scheint, dass die transzendentale Analyse des Bewusstseins nicht weiter führt. Und andererseits, um dieses Darüber Hinaus durch einen rationalen direkten Schluss zu erreichen, müssten wir wenigstens einen Begriff 2 davon bilden können. 281 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 2 Vergl. Zweite Einleitung zit. Ed. S.459 Originaltext: Was ist nun zuvörderst auf das beobachtete Ich zu sagen, dieses sein Zurückgehen in sich selbst; unter welche Klasse der Modifikationen des Bewusstseins soll es gesetzt werden? Es ist kein Begreifen: dies wird es erst durch den Gegensatz eines Nicht-ich und durch die Bestimmung des Ich in diesem Gegensatze. Mithin ist es eine bloße Anschauung. – Es ist sonach auch kein Bewusstsein, nicht einmal ein Selbstbewusstsein; und lediglich darum, weil durch diesen bloßen Akt kein Bewusstsein zustandekommt, wird ja fortgeschlossen auf einen anderen Akt, wodurch ein Nicht-ich für uns entsteht: lediglich dadurch wird ein Fortschritt des philosophischen Raisonnements und die verlangte Ableitung des Systems der Erfahrung möglich. Das Ich wird durch den beschriebenen Akt bloß in die Möglichkeit des Selbstbewusstseins und mit ihm allen übrigen Bewusstseins versetzt. Aber es entsteht noch kein wirkliches Bewusstsein, der angegebene Akt ist bloß ein Teil und ein nur durch den Philosophen abzusondernder, nicht aber ursprünglich abgesonderter Teil der ganzen Handlung der Intelligenz, wodurch sie ihr Bewusstsein zustande bringt. 349 Nun aber setzt der Begriff schon eine Reflexion des Ich voraus, wir können nicht einen Begriff haben von dem, was es an Primitivem und Ursprünglichem im Ich gibt. Wenn wir ein absolut absolutes Prinzip erreichen, dann wäre das also außerhalb jeder begrifflichen Erkenntnis, das heißt in einer Intuition 1 . 1 loc.cit. Tatsächlich, so versichert Fichte, im Inneren selbst der konkreten Repräsentation in enger Beziehung zur sinnlichen Intuition, haben wir eine noch tiefere Intuition, eine wahrhaft „intellektuelle Intuition“, die bis zur Wurzel des Ich eindringt: das ist die Intuition der reinen Aktivität, des „Handelns überhaupt“, durch welche das Ich sich setzt in jeder seiner bewussten Manifestationen. Diese Intuition der Handlung vollzieht sich nie isoliert in unserer Erkenntnis: Sie ist nur eine reine Intuition und in sich unbewusst; aber sie scheint durch in unseren konkreten Repräsentationen, wo unsere Reflexion sie entdeckt. Für das reflektierende Ich, das heißt für den Philosophen, der die Kritik seines Denkens macht, erscheint die Intuition der Handlung objektiv wie ein erstes Faktum des Bewusstseins (“Faktum des Bewusstseins, Tatsache“); Für das tiefe und ursprüngliche Ich, dem Prinzip des refletierenden Ich, kann sie nichts sein als eine Aktion, eine Tathandlung2 das heißt schließlich die unmittelbare Koinzidenz einer primitiven Handlung mit sich selbst. 2 Zit. op. und Ed. Seite 465 Originaltext: Der Schluss, durch welchen der Philosoph auf diese Behauptung der intellektuellen Anschauung kommt, ist folgender: Ich setze mir vor, das oder das Bestimmte zu denken und der begehrte Gedanke erfolgt; ich setze mir vor, das oder das Bestimmte zu tun, und die Vorstellung, dass es geschehe, erfolgt. Dies ist Tatsache des Bewusstseins. Betrachte ich dies nach den Gesetzen des bloß sinnlichen Bewusstseins, so liegt in demselben nichts mehr als das eben angegebene, eine Folge gewisser Vorstellungen; nur dieser Folge in der Zeitreihe wäre ich mir bewusst und nur sie könnte ich behaupten. ... In der ersten Vorstellung liegt der reale Grund der zweiten... Sonach findet der Philosoph diese intellektuelle Anschauung als Faktum des Bewusstseins (Für ihn ist es Tatsache, für das ursprüngliche Ich Tathandlung)... Nun aber, so sagt Fichte, ist diese „Intuition“ der aktiven Setzung des Ich „das einzige solide Fundament jeder Philosophie3 “ 13 ebenda S.466 Originaltext: Diese intellektuelle Anschauung ist der einzige feste Standpunkt für alle Philosophie. Von ihm aus läßt sich alles, was im Bewusstsein vorkommt, erklären. aber auch nur von ihm aus. Ohne Selbstbewusstsein ist überhaupt kein Bewusstsein; das Selbstbewusstsein ist aber nur möglich auf die angezeigte Weise. Dank ihrer hört das systematische Postulat des Idealismus auf, eine Schimäre 282 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. zu sein. Denn die intellektuelle Intuition der reinen Tathandlung des Ich lässt uns „das Prinzip der Erklärung von all dem, was im Bewusstsein4 vor sich geht“ berühren. 4 Ebenda und der letzte Grund, „in dem sich die Sinneswelt und die intelligible Welt aneinanderfügen, wenigstens so, wie sie für uns existieren5 “ 5 350 ebenda S.447 Könnte Kant sein eigenes Denken in diesen Spekulationen wiederfinden oder darin eine normale Entwicklung vom kritischen Standpunkt her würdigen? Man weiß, dass er lebhaft protestierte gegen die Behauptung, die Fichte verbreitete, die kantsche Philosophie treu zu interpretieren und sie zu überschreiten. Der alte Meister, nicht ohne Verstimmung und aus teilweise kontingenten Motiven, behielt seine Konzeption des „Dings an sich“ bei und verwarf das ganze „metaphysische System“ des Idealismus6 . 6 Siehe Kant’s Werke, Ed. Rosenkranz, Band XI SS. 153-155 [Extrakt einer Schrift von Kant in der Nr.109 der Intelligenzblätter der Allg. Lit. Zeit., 1799] War diese Verurteilung nicht ein wenig oberflächlich? Man könnte es denken, ohne dazu die Behauptungen Fichtes ganz anzunehmen.. Einer der Streitpunkte, auf die der letztere hinweist, besteht genau in der an die Basis des idealistischen Systems platzierten „intellektuellen Intuition“. Nun aber, so versichert Fichte, gibt es hier ein Missverständnis. Kant will nicht sprechen hören von „intellektueller Intuition“, weil „diese in seiner Terminologie, sofort zu einem Sein führt, das heißt zu etwas schon Gesetztem, Feststehendem1 “ 1 Zweite Einleitung zit Ed. S.471 Im Gegensatz dazu hat die „intellektuelle Intuition, von der die Wissenschaftslehre handelt, als Objekt nicht ein Sein sondern einen Akt, ein Handeln2 “. Ebensosehr wie die erste unbegreiflich ist, ist die zweite unvermeidlich postuliert. 2 zit. op und Ed. S.472 In Wahrheit nennt sie Kant nirgends, indem er sie aber ganz voraussetzt. Der Ausdruck, der sie am treuesten bezeichnen würde, in der spekulativen Kritik, wäre der der reinen Apperzeption 3 . Darüber hinaus, in der Kritik der praktischen Vernunft, verwendet Kant die Ware ohne die Etikette: denn was ist das Bewusstsein des kategorischen Imperativs anderes als die intellektuelle Intuition, sicherlich von einer unveränderlichen Realität aber von einem autonomen Akt? Es hätte für Kant nur gefehlt, um mit Fichte übereinzustimmen, die spekulative Domäne und die moralische Domäne zu verschweißen in der fundamentalen Intuition der reinen Handlung des Ich4 3 Vergl. ebenda 4 Vergl. ebenda Gerne möchten wir hier unsere Leser verweisen auf die Diskussion der kant- 283 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 351 schen Kritik, die wir weiter oben ausführten.5 5 Eine Diskussion, die der Autor angeführt hatte im ersten unveröffentlichten Text des Ausgangspunkts der Metaphysik, die er aber im zweiten Text nicht aufgenommen hat. Siehe Vorwort der Herausgeber. – Anmerkung der Editoren 352 Das Ungenügen, das wir hier glauben anerkennen zu müssen, fällt teilweise zusammen mit dem, worauf uns Fichte hinweist. Kant, so sagen wir, trennt zu radikal den formartigen, statischen Gesichtspunkt vom dynamischen Gesichtspunkt, oder wenigstens bleiben sein Denken wie seine Ausdrücke in dieser Hinsicht schwankend. Die „apperzeptive Synthese“ definiert sich bei ihm durch ihre formartigen Effekte der Apriorität und der Objektivität; Er leugnet nicht, weit davon entfernt, dass diese Effekte nicht notwendig die einer „aktiven Funktion“ sind; Aber, seltsamer Weise, auch wenn er die kritische Geltung dieser formartigen Effekte registriert, vernachlässigt er völlig, die kritische Geltung der Handlung ins Auge zu fassen, die sie möglich macht. Man muss warten auf die Kritik der praktischen Vernunft, um die Handlung, die Aktivität – aber jetzt nur die autonome moralische Handlung – in ihre absoluten Rechte zurückkehren zu sehen als Fundament einer formartigen Bestimmung. Nun scheint es aber evident, dass die „transzendentale Reflexion“, wenn sie eine „reine apperzeptive Form“ unterscheidet, uns dabei notwendig die „Form einer Handlung“ zeigt. Es ist das, was Fichte behauptet; und es ist auch die Lehre, manchmal vergessen, der aristotelischen und scholastischen Tradition, nach deren Meinung die Form nicht ohne Handlung gehen kann. Man weiß tatsächlich, dass in der klassischen Theorie der „vier Ursachen“ die Form sich zuerst definiert als die Konfiguration einer Bewegung im metaphysischen Sinne eines sukzessiven Übergangs von der Potenz zum Akt. Die Form, die so durch eine „Materie“ begrenzt ist, müsste, um ihre natürliche Dynamik zu verlieren und rein statisch zu werden, mit der reinen Materie sich vermischen: das wäre die Elimination der Form. Unterhalb dieser theoretischen Grenze ist die Form immer die eines metaphysischen „fieri“, eines aktiven Werdens. Und wenn man selbst, wie es die Scholastiker machen, den Begriff der Form über das Werden hinaus ausdehnt bis dahin, sie von jeder Korrelation (direkter Zusammenhang) mit einer Materie freizumachen, wird das so erhaltene Produkt sozusagen die „reine und subsistierende Form“, weit davon entfernt ein „erstarrtes Ding“ zu sein, den kritischen Punkt repräsentieren, wo die Dualität der „Materie“ und der „Form“ sich verwischt (eigentlich: auslöscht) in die Einfachheit einer wesentlichen Aktivität, die die Rückkehr zu sich selbst vollständig macht ohne Verminderung noch Aufteilung: In diesem Zusammenhang eines konzentrierten Dynamismus wird die Form, so sagen die Scholastiker, die subsistierende Idee oder Intelligenz – sie wird Geist oder Ich wird Fichte sagen. Jede Form ist also dynamisch; und wenn wir in uns die „reine Form der Apperzeption“ fassen würden, heißt das, dass wir in gleicher Weise „die reine Aktivität der Apperzeption“ fassen würden. Nichts hindert uns, diese Erkenntnis eine „Intuition der Aktivität (Tathandlung) des Ich“ zu nennen, obwohl die 284 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. Scholastiker vorziehen, von einer „Reflexion des Subjekts über seinen Akt“ zu sprechen. Die Vorbehalte, mit denen wir vielleicht Fichte begegnen müssen, konzentrieren sich weniger auf die Intuition einer Aktivität (Handlung) des Ich, als auf die Natur dieser Handlung und dieses Ich. Aus dem fundamentalen Prinzip der reinen Handlung des Ich musste Fichte, dem idealistischen Postulat entsprechend, nicht nur die Besonderheiten des theoretischen Ich „ableiten (deduzieren)“, sondern die Vorgehensweisen des praktischen Ich; und im theoretischen Ich, nicht nur die synthetische Form der Begriffe, sondern die Formen der Sinneswahrnehmung und bis zu den „Gegebenheiten“ der Sinne, erste Materie der Erkenntnis. So wird sich abschließen, wie ein in sich selbst wieder-schließender Kreis, das kritische Beweisverfahren, die das Innerste der Wissenschaftslehre [Theorie der Wissenschaft] bildet. 353 Die Beweisführung von Fichte und das dialektische Verfahren der modernen Wissenschaft.– Zwischen der allgemeinen Art des Beweisens, die an den „regressiven Beweis“ der Scholastiker erinnert, und der dialektischen Methode der modernen Wissenschaft gibt es eine einzigartige Analogie, obwohl die entsprechenden Anwendungsbereiche verschieden sind. Der Wissenschaftler geht aus von konkreten Erfahrungen, induziert daraus eine verallgemeinernde Hypothese, dann deduziert er aus dieser als Prämisse gesetzten Hypothese die Konsequenzen, die er mit der konkreten Erfahrung vergleicht. Man erkennt den abwechselnd aufsteigenden und absteigenden Gang, oder, wenn man es vorzieht, die kreisförmige Bewegung der Vernunft: nur schließt sich in der empirischen Ordnung der Kreis nicht vollständig und nicht sicher. Das hypothetische Prinzip ist nicht induziert [abgeleitet durch Induktion] als die notwendige Bedingung der anfänglichen Erfahrungen, sondern nur als eine mögliche Bedingung: auch fordert es eine Konfrontation seiner Konsequenzen mit den konkreten Fakten, oder mit anderen Worten, eine „Verifikation“; und die Verifikation wiederum bleibt notgedrungen unvollständig. Im Beweis von Kant oder Fichte ist das induzierte Prinzip nicht mehr eine einfache wahrscheinliche Hypothese sondern eine notwendige Bedingung der Möglichkeit; es hat also nicht eine experimentelle Verifikation nötig und die Deduktion, die sich darauf stützt, nimmt von den ersten Etappen an eine absolute Geltung an. Trotz dieses Unterschieds liefert die idealistische Theorie der Wissenschaft eine sichere und absolute Erklärung der bewussten Phänomene durch die selbe Methode, die die empirische Theorie der Wissenschaften ins Werk setzt, um eine wahrscheinliche und relative Erklärung der experimentellen Fakten zu liefern. Wir beschränken uns hier darauf, an diesen Parallelismus zu erinnern: Es ist hier nicht der Moment, dafür den tieferen Grund zu suchen.1 285 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 1 Wir können die vollständige Theorie der Erfahrung erst zur Sprache bringen in einem weiteren Werk, das durch dieses vorbereitet ist. Man erinnere sich daran, dass unser aktuelles Ziel sich beschränkt auf den „Ausgangspunkt der Metaphysik“, obwohl unter dem Zwang der Dinge, eine Anzahl von partikulären Lösungen virtuell schon vom Gegenwärtigen her gesetzt sind. §2.b) Anknüpfungspunkte im Kantismus Um das Verständnis des Systems von Fichte noch zu erleichtern, werden wir kurz die Anknüpfungspunkte untersuchen, die der Kantismus ihm liefert: Die Orientierung für das Denken, die diese Prüfung uns nahelegen wird, hat eine gewisse Chance, uns im Voraus schon in den Geist der idealistischen Beweisführung eindringen zu lassen. 354 Der kategorische Imperativ und die reine Apperzeption.– Wir haben schon oben daran erinnert: Fichte selbst macht in dieser Hinsicht ganz besonders aufmerksam auf den kategorischen Imperativ und die transzendentale Apperzeption. Vom kategorischen Imperativ haben wir hier kaum etwas anderes zu sagen, als dass er eine „absolute Setzung“, ein autonomes „Sollen“ ausdrückt, als solcher jeder empirischen Bestimmung entzogen. Aber das moralische Absolute bleibt bei Kant isoliert in seinem strengen Glanz: es verbindet sich nicht mit der spekulativen Aktivität und steht im ganzen sehr schlecht in Zusammenhang mit der konkreten moralischen Handlung. man erinnert sich tatsächlich, dass zwischen der reinen Form der durch den kategorischen Imperativ gesetzten Moralität und der Ordnung der Ziele, die von der konkreten Handlung gefordert ist, Kant eine Antinomie eingesteht, die er nur indirekt dadurch behebt, dass er ein ganz äußerliches Zusammenfallen zwischen den entgegengesetzten Termen postuliert. Wie viel zufriedenstellender wäre es, das moralische Absolute, die spekulative Handlung und das Streben nach einem letzten Ziel sich verschmelzen zu sehen in einer gemeinsamen Wurzel! Man ahnt, dass der Knoten des Problems sich in der Handlung der theoretischen Vernunft finden muss. Wenn die Analyse da in gleicher Weise eine „absolute Setzung“ entdecken würde, würde die unmittelbare und innere Versöhnung der moralischen Ordnung und der Ordnung der Ziele möglich. Wollen wir also sehen, ob die Ausführungen über die reine Apperzeption, der Höhepunkt der theoretischen Vernunft, uns nicht einige nützliche Hinweise liefert. Eine dialektische Erforschung auf der Basis der reinen Apperzeption.– Die reine apperzeptive Synthese, so wie Kant selbst sie definiert, kann unter zwei Aspekten betrachtet werden: 10 Als aktive Synthese: das heißt (ohne dabei irgendeinen metaphysischen Hintergedanlen zu implizieren) als reines und unbestimmtes Subjekt. 286 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 355 20 Als passive Synthese, als synthetischer Inhalt, das heißt (äußerhalb jeder ontologischen Voreingenommenheit) als reines und unbestimmtes Objekt. Welche Verwendung werden wir hier von diesen zwei Begriffen machen – „subjektive Synthese“ und „objektive Synthese“ – deren Kombination die reine Einheit der Apperzeption definiert? Wir werden sie getrennt betrachten, indem wir ihnen ihren vollen Spielraum, ihre komplette Ausdehnung geben, um auf diese Weise a priori die Bedingung der Möglichkeit ihrer Kombination und ihrer Verwirklichung zu entdecken. Die ganze hier folgende Beweisführung wird zuerst keine andere Geltung haben, als die einer notwendigen Dialektik der Begriffe: wir werden eine zugleich logische und reelle Notwendigkeit nur erreichen in dem Moment, wo wir eine letzte und absolute Bedingung erreichen, die die von uns untersuchten Begriffe in einem definitiven Gleichgewicht festlegt. Man möge also nicht erstaunt sein, dass man im Abstrakten dahintreibt bis zum Endpunkt dieser sehr schnellen dialektik poreÐa 1. Der dynamische Gegensatz von Subjekt und Objekt.– Vom subjektiven Gesichtspunkt aus betrachtet, erscheint die reine apperzeptive Synthese, als Ausdruck der universellen Einheit des Bewusstseins, wie eine unbeschränkte aktive Setzung des Ich. Das heißt, dass das Ich, definiert als reine synthetische Handlung, von Null der Realität zur Unendlichkeit der Realität läuft, dabei jedes von uns konzipierbare Hindernis durchbricht. Dieser subjektiven Unendlichkeit des Ich setzt sich in der reinen Apperzeption die Unendlichkeit des Objekts als solches entgegen, das heißt der apperzeptiven Synthese passiv betrachtet, in ihrem absolut allgemeinen Inhalt. Denn das Objekt, definiert als passive Synthese, ist dem Subjekt exakt korrelativ und hat davon den ganzen Umfang. Wenn also das reine Subjekt sich aktiv setzt in einer virtuellen Bewegung, die von Null bis Unendlich geht, muss das Feld der Expansion des Objekts ebenfalls unendlich sein1 . 1 Der Gegensatz, den man hier markiert, zwischen Subjekt und (immanentem) Objekt, entspricht exakt dem der zwei komplementären Funktionen der Intelligenz in der aristotelischen Metaphysik: dem Intellektus agens „quo est omnia facere“, und dem Intellktus possibilis „quo est omnia fieri“. Aber werden zwei unendliche Ausdehnungen nicht identisch? Ja, zweifellos, wenn man sie statisch, d.h. als vollendete Dinge, betrachtet. Aber auch in der bilateralen Abwesenheit von Grenzen kann das Subjekt und das Objekt sich nur auf eine Weise unterscheiden, durch die umgekehrte Richtung ihres konstitutiven Dynamismus. Unbeweglich verschmelzen sie. Im selben Sinne durchfahren, verschmelzen sie immer noch. Wir haben gar kein Mittel, sie als verschieden zu betrachten (verstehn, konzipieren), es sei denn dadurch dass wir sie darstellen durch 287 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 356 357 den Antagonismus von zwei gleichen Bewegungen mit entgegengesetztem Vorzeichen. Das heißt also, dass, in unseren Begriffen, das Subjekt oder das Ich den Charakter eines Strebens annimmt und das Objekt oder das Nicht-Ich die Charakteristiken eines Widerstands, das heißt eines entgegengesetzten Strebens. Vom Ich muss man sagen, dass es danach strebt, über die Totalität des Nicht-Ich herzufallen; und vom Nicht-Ich, dass es strebt über die Totalität des Ich herzufallen. Aber ist nicht eigentlich selbst unter dem dynamischen Gesichtspunkt die Synthese des reinen Subjekts und des reinen Objekts in der reinen Apperzeption widersprüchlich? Unter welchem Gesichtswinkel kann die gleichzeitige Realisierung von zwei entgegengesetzten Endpunkten also möglich erscheinen? Denn sie muss möglich sein. Trotz dessen, dass sie sich ausschließen unter ihrer reinen Form betrachtet, müssen unsere Begriffe des Ich und des Nicht-Ich, von Subjekt und von Objekt, eine aktuelle Form der Vereinbarkeit haben, da sie notwendige Aspekte der reinen apperzeptiven Einheit repräsentieren, die selbst die höchste Bedingung der Möglichkeit jedes Bewusstseins ist. 2. Die Abfolge von Realem und Idealem. – Ein Mittel bietet sich an – ein einziges, um den Widerspruch zu überwinden: nämlich in der totalen Bewegung des reinen Ich einen realen und einen virtuellen oder „idealen“ Teil (Portion) zu unterscheiden; und ebenso in der umgekehrten Bewegung des reinen Nicht-Ich, einen reellen Teil und einen idealen Teil; und das entsprechend einem so beschaffenen Gesetz der Abfolge, dass sowohl vom reellen Gesichtspunkt wie vom idealen Gesichtspunkt, die unmittelbare logische Widersinnigkeit verschwindet. Dieses Resultat – man ahnt es – ist nur möglich, wenn das Ich und das Nicht-Ich in einem gewissen Maße einander komplementär werden: nicht wie unbewegliche Dinge, die sich nur von außen durch gegenseitige äußere Begrenzung ergänzen (komplementieren) (denn so wäre das reine Ich, wesentlich begrenzt werdend, nur ein Bruchteil des Ich und das reine Nicht-Ich auch nur ein Fragment des Nicht-Ich), sondern wie Aktivitäten, die sich gegenseitig begrenzen, ohne sich ganz und gar ineinander einschließen zu lassen. Wir erklären das genauer: Im Ich, das sich als synthetische Handlung setzt, kann man begreifen, dass ein Teil der Handlung sich frei setzt und dass ein anderer durch das Nicht-Ich in Schach gehalten wird. Der in Schach gehaltene Teil wird nicht unterdrückt: er ist nur zurückgedrängt und behält seinen eigentümlichen dynamischen Wert. Das, was sich neutralisiert findet, ist allein sein weiterer Effekt der Expansion. Nennen wir real die Geltung des effektiv gesetzten Aktes und ideal die Geltung der zurückgedrängten Handlung. Das aktive Ich der reinen Apperzeption umfasst zugleich den realen Teil und den idealen Teil der apperzeptiven 288 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 358 Handlung. Kehrt man die Terme um, repräsentiert man auf die gleiche Weise die Aktivität des Nicht-Ich. Die Realität des Nicht-Ich würde dem Teil des Ich entsprechen, das aktuell zurückgedrängt ist; der ideale Rest des Nicht-Ich würde dem Teil der Aktivität des Nicht-Ich entsprechen, das durch die „reale“ Aktivität des Ich in Schach gehalten wird. Aber die totale Aktivität – real und ideal – des Nicht-Ich bleibt indefinit ebenso wie die totale Aktivität des Ich. Prüfen wir nun die Konsequenzen dieser dynamischen Konzeption. Zuerst: Sie erlaubt die Synthese des Ich und des Nicht-Ich ohne Verstümmelung dieser zwei Begriffe. Sie behalten jeder seinen totalen Umfang, dadurch dass man dabei eine reale Zone und eine ideale Zone unterscheidet. Tatsächlich hindert nichts daran, die reale Aktivität des Ich und die ideale Aktivität des Nicht-Ich in einer synthetischen Einheit zusammenzufügen, die ideale Aktivität des Ich und die reale Aktivität des Nicht-Ich. Der offensichtliche Widerspruch ist verschwunden. Und andererseits erhält der Wechsel zwischen dem „realen“ und dem „idealen“, der in die Definition der synthetischen Einheit selbst eingeführt wurde, dort die Unterscheidung des Nicht-Ich und des Ich, von Objekt und Subjekt. An zweiter Stelle versetzt uns die dynamische Konzeption zugleich in die Lage, leichter die Aktivität sowohl des Ich als des Nicht-Ich zu definieren. Insofern es sich frei setzt, affirmiert das aktive Ich sich als Realität, als Sein. Insofern durch ein Hindernis zurückgedrängt, affirmiert es sich nur als eine Virtualität, als ein „Streben“, als ein „Sein-Sollen“. Siehe da, das „Sollen“, auftauchend vor einem Hemmnis unter der Form eines Anspruchs der Freiheit und zugleich unter der Form eines aktiven Strebens. Denn das, was sein soll, das ist die komplette, das Hindernis des Nicht-Ich abbauende Entfaltung der freien Handlung. Die über das Nicht-Ich siegende Freiheit wäre also zugleich das moralische Ideal und das letzte Ziel des aktiven Ich. Dieselben Überlegungen müssen logischerweise wiederholt werden zum Thema des Nicht-Ich. Soweit es sich unabhängig vom Ich setzt, nimmt das Nicht-Ich die Attribute des Seins an, soweit es unterdrückt ist durch den Druck des Ich und gegen sie verbunden, wird das Nicht-Ich „Streben“, „Sein-Sollen“, eine Art von „Werden“ gegen den Strich. 3. Manischäischer Dualismus? – Siehe da, ein neuer Rückfall in den Widerspruch; aber dies Mal in den dynamischen Widerspruch, in der Gegensätzlichkeit der Ziele und den Konflikt des Sollens (Pflichtenkollision). Um das für stichhaltig zu halten, müssten wir uns die Welt vorstellen nach der Weise der Manichäer, als ewigen und unversöhnlichen Kampf der zwei feindlichen Prinzipien, gleich grundlegend, dessen labiles Gleich- 289 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte gewicht unser Bewusstsein in jedem Augenblick registriert. Aber es ist noch schlimmer, und der logische Widerspruch wird den dynamischen Widerspruch überholen. Die ewig sich entgegenstehenden „Gegensätze“ scheinen, kraft einer nicht weniger unversöhnlichen Notwendigkeit als ihr Konflikt selbst, sich die eine in der anderen auslöschen zu müssen, sich untereinander zu identifizieren. In der Tat, wenn man sich das Ich und das Nicht Ich im Busen der Reinen Apperzeption definiert, das heißt in einer Zone der Abstraktion höher als jede empirische Bestimmung, existiert kein Grund dafür, die Grenze zwischen „real“ und dem „ideal“ eher hier als da verlaufen zu lassen. Der unbestimmte Begriff des Ich muss sich genauso gut abfinden mit einer unbestimmten Verminderung des realen Elements wie mit einer unbestimmten Verminderung des idealen Elements. Und das gilt genauso für den unbestimmten Begriff des Nicht-Ich. Nun aber, wenn wir im Ich sukzessive das reale Element zu Gunsten des idealen Elements reduzieren, strebt diese regressive Reihe gegen eine Grenze, die singuläre [=erstaunliche] logische Eigenschaften zeigt: Im Grenzfall wäre das Ich tatsächlich zu einem reinen „Sein Sollen“ vermindert, ein reines „Sollen“, unter Ausschluss jedes aktuellen „Seins“. Und diese Grenze würde auch den ersten logischen Augenblick definieren, den absolut absoluten Anfang der Aktivität des Ich. Andererseits, wenn man den Beweis genauso über das Nicht-Ich führt, findet man gleichfalls eine Grenze, die ein erster logischer Augenblick ist, ein absolut absoluter Anfang, und der keine andere Eigenschaft hat, als die eines reinen „Sein Sollens“, eines reinen „Sollens“. Statt das reale Element zu rduzieren, nehmen wir an, dass man schrittweise das ideale Element reduziert, sowohl im Ich als auch im Nicht-Ich. Die so gebildeten Reihen streben nach einer Grenze, die nicht mehr ein absolutes „Sollen“ wäre, sondern ein absolut letzter Term und nur definierbar als absolute Totalität der aktuellen Realität, sagen wir es mit einem Wort, als absolutes Sein. Am Ursprung und am Ziel löscht sich der Unterschied des Ich und des Nicht-Ich aus ins Absolute: Absolutes des Sollens, Absolutes des Seins. Aber das hat große Konsequenzen. Wenn das Ich und das Nicht-Ich gleichen absoluten Ursprung und gleiches absolutes Ziel haben müssen, wird die manichäische Konzeption, die ihren Ursprung und ihr Ziel als Funktion des relativen Gegensatzes definiert, durch welchen sie im Bewusstsein repräsentiert sind, wird diese Konzeption widersprüchlich: Sie erklärt das Relative als Absolutes, sie überträgt auf das Prinzip (Anfang) und auf das Ende die Bedingungen des Werdens als solchem. Die Analyse selbst der Begriffe des Ich und des Nicht-Ich bringt uns dazu, einen umfassenderen Gesichtspunkt zu verlangen als den absoluten Dua- 359 290 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 360 lismus, einen Gesichtspunkt, der die Dualität mit der Einheit versöhnt. Welches wäre dieser Gesichtspunkt? Ein absoluter Monismus, der auf der ganzen Linie das Ich und das Nicht-Ich identifiziert? Nicht genau das, denn ein absoluter Monismus – man erinnere sich an Parmenides – verkennt den wesentlichen Dualismus des Werdens; aber wir brauchen einen Gesichtspunkt, der die absolute Gemeinschaft des Ursprungs und des Ziels bewahrt und zugleich den Gegensatz, der sich skizziert in dem Intervall zwischen diesen Extremen. Das Problem, in realistischen Ausdrücken, drückt sich exakt wie folgt aus: Die Theorie aufstellen von dem, was zwischen einer universellen schöpferischen Virtualität (dem absoluten Ursprung) und der perfekten Erfüllung der Bestimmungen ablaufen muss, die sie hervorruft. (absolutes Ziel) 4. Das Prinzip der Reflexion.– Man kann versuchen, sich genauer Rechenschaft zu geben über die Tragweite des Problems und gerade von daher eine Lösung vorzubereiten. Wir sagten, dass das Ich und das Nicht-Ich hervorgehen mussten aus einem primitiven „Sein Sollen“, die sie beide in ihrer absoluten Virtualität einschloss. Man muss also erklären, wie eine selbe reine Virtualität sich ausdrücken kann durch zwei entgegengesetzte Tendenzen. Dieser Konflikt im Inneren der Einheit scheint nur konzipierbar unter einer Bedingung: nämlich dass die eine der beiden Tendenzen in Wirklichkeit eine einfache Reflexion der anderen auf sich selbst ist. In diesem Fall gibt es wohl immer nur eine einzige primitive Aktivität, die des fundamentalen „Sein Sollens“ aber eine Aktivität, die sich mehr oder weniger breit zum Gegensatz zu ihr selbst macht, die sich zu überwindende Hindernisse schafft durch teilweise Inversion ihres expansiven Stroms, das heißt Objekte. Was ist es, was unmittelbar diesen Rückfluss, diesen Gegenstrom, oder um den technischen Ausdruck zu verwenden, diese Reflexion bestimmt? Alles, was man sagen kann, ist, dass sie hier erscheint wie eine logische Konsequenz, von weit her aber notwendig, der synthetischen Einheit, wo sich die zwei korrelativen Aspekte – objektiv und subjektiv – der kantschen Apperzeption verbinden. Die Reflexion ist für uns, die primitive Bedingung der Einheit des Bewusstseins. 5. Die systematische Einheit des Ich – siehe also da! Durch die erste und unvermeidliche Tatsache einer „Reflexion“ die Gesamtheit unseres bewussten Lebens zurückgeführt auf die Einheit eines absoluten Prinzips: das reine „Sein Sollen“. Prinzip der moralischen1 Handlung des Ich: 291 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 1 genau in dem, aber vielleicht unvollständigen, Sinn, wie Kant die „Moraliät“ versteht. Diese umfasst zweifellos die Autonomie der freien Entscheidung angesichts der empirischen Bestimmungen; aber setzt das, was man die moralische Verpflichtung nennt, nicht unter anderem im geschaffenen Willen eine transzendentale Beziehung voraus? Das ist hier nicht der Ort, diese Frage zu erörtern, die wir persönlich affirmativ entscheiden. Tatsächlich bejaht das primitive „Sollen“ seine Freiheit und seine moralische Autonomie insofern es sich selbst setzt trotz des Objekts und sich als Aufgabe gibt die Eroberung seiner selbst durch das Objekt, das heißt das immer vollständigere objektive Bewusstsein seiner selbst. Prinzip der spekulativen Aktivität: des Ich: denn das primitive „Sollen“ kann sich selbst nur erobern, indem es sich ein Objekt gegenüberstellt, und kann sich ein Objekt nur gegenüberstellen, indem es auf sich reflektiert und sich also als ein Ich setzt. (Denn die Reflexion auf sich definiert das Ich im Gegensatz zur blinden und geradlinigen Aktivität). Prinzip der Finalität des Ich; denn das primitive „Sollen“ ist eine aktive Virtualität und strebt nach der kompletten Absorption des NichtIch in das Bewusstsein, wie nach einem letzten Ziel. Prinzip der Aktivität und der Finalität des Nicht-Ich oder des Objekts, weil das Objekt nichts anderes ist als das primitive „Sein Sollen“ das sich gegen sich selbst zurückwendet in der „Reflexion“ und sich so also eine Grenze auferlegt, eine Bestimmung. Die Bedingungen, unter denen die ursprüngliche Reflexion möglich ist und sich entwickeln kann auf ihr ideales Ziel hin, bestimmen a priori die großen Linien einer „Philosophie der Natur“- 361 Wir beenden hier unsere Spekulationen; nicht dass die Fragen, die sie auslöst, erschöpft sind (es bliebe vor allem das kapitale Problem der Natur Gottes in Bezug auf das reine Ich zu lösen), sondern weil ab sofort die theoretische und die praktische Vernunft, das Reich der Natur und das Reich des Geistes, kurz das ganze Universum – subjektiv und objektiv – wenigstens insofern es etwas für uns ist, seinen deutlichen Platz in einem geschlossenen System findet, so wie es sich Fichte erträumte. Kant hat uns also auf den Idealismus von Fichte ausgerichtet. Indem wir die Zügel der natürlichen Dialektik unserer Vernunft überlassen, ausgehend vom kantschen Begriff der reinen Apperzeption – aber, mehr als es Kant macht, den Dynamismus jeder Synthese berücksichtigend – kommen wir dazu, unsere Begriffe sich aneinanderreihen zu sehen in einem System, das erinnert an die fortschreitende Struktur der Wissenschaftslehre und noch mehr der von zwei ergänzenden Entwürfen aus der Feder von Fichte, nämlich des Grundriss des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre (1797) und der Darstellung der Wissenschaftslehre (1801) 362 Es ist Zeit, glauben wir, die Vorbemerkungen zu verlassen, um uns mit Fichte selbst zu beschäftigen anhand der Hauptetappen der Wissenschaftslehre. 292 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. §3.–Die Wissenschaftslehre §3.a) Die drei fundamentalen Prinzipien Vor der Aufgabe, vom aktuellen Bewusstsein auszugehen, um das absolute Prinzip jedes Inhalts des Bewusstseins zu suchen, können wir nichts besseres machen, als uns auf Anhieb mit den allgemeinsten bewussten Operationen zu beschäftigen, die in die Bildung aller anderen eingehen und sich selbst auf keine andere reduzieren lassen.1 1 Für diesen ganzen Paragraphen a, siehe Grundlage der W.L. 1.Teil, zit.Edit. Band I SS.91-125 im Internet siehe http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k266819/f128.item.zoom Erstes Prinzip. – Jedermann billigt diese Charakteristiken der absoluten Allgemeinheit und äußerst wichtigen Notwendigkeit dem Axiom der Identität zu. In Wahrheit ist es uns unmöglich, ihm diese Zubilligung zu verweigern, ohne uns zu widersprechen. Denn in jeder bewussten Handlung sprechen wir implizit oder explizit das absolute Urteil aus: A ist A oder, wenn man es vorzieht, A=A, in dem A irgendeine Materie bezeichnet2 . 2 zit. Op. S.92-93 Originaltext: siehe obigen Link durch Weiterblättern oder http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k266819/f129.item.zoom Sobald wir „denken“, maßen wir uns wohl oder übel das Recht an, „irgendetwas absolut zu setzen“ (etwas schlechthin zu setzen)3 . 3 Op.zit. S.93 Originaltext: siehe Note 2 Aber was setzen wir so? Dass A ist? Nein; wir setzen nur, dass „wenn A ist, ist A“. Wir behaupten (affirmieren) nicht den materiellen Inhalt A (Inhalt), sondern nur eine formartige Relation (Form): die notwendige Identität von A, was auch immer sie sei, reales Sein oder Sein in der Vernunft, mit sich selbst 1 1 363 Zit. op. S.93 Originaltext: Siehe Note 2 Nun aber muss diese notwendige Relation der Identität, da sie nicht von der partikulären Realität von A abhängt, direkt vom Subjekt abhängen, wo sich A setzt, das heißt vom Ich, und zuerst für das Ich gelten. Tatsächlich erstreckt sie sich auf jeden Inhalt A unterschiedslos, unter der Bedingung dass dieser im Ich repräsentiert ist, das heißt, gesetzt ist in und durch das Ich. Wenn der Satz A = A sich uns in seiner ganzen Allgemeinheit aufzwingt, ist es also, weil er vor allem bedeutet, dass „A gesetzt im Ich identisch ist A gesetzt im Ich“. Aber diese Identität im Ich setzt voraus, dass das Ich selbst identisch ist mit sich: „Ich bin Ich2 “, und folglich, dass es ist: „Ich bin3 “- Die notwendige Setzung der Identität bedeutet ursprünglich die Setzung der Identität des Ich. 2 Zit. op. S. 93-95 3 ebenda So enthält also jedes Urteil vom Typ A = A implizit die Setzung des Ich durch das Ich in der absoluten Identität mit sich selbst. Sagen wir in anderen Worten, dass „das Ich sich selbst setzt und dass es durch diese Setzung ist, 293 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte was es aus sich macht“ (“Das Ich setzt sich selbst, und es ist vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst4 “) 4 Zit. Op. S.96 Wenn wir „absolutes Subjekt“ das nennen, „dessen Sein ganz in der Setzung besteht, die es von sich macht“, müssen wir anerkennen, dass das Ich sich setzt als „absolutes Subjekt“ in jeder bewussten Aktivität, was auch immer für einer. In diesem Sinn drückt das „Ich bin“, das „Je suis“ von Descartes, die primitive, notwendige und universelle Affirmation des absoluten Subjekts aus5 . 5 Zit. op. S.96-97 Siehe da: Wir sind also damit im Besitz des ersten fundamentalen Prinzips: „Das Ich setzt sich selbst“- Absolutes Prinzip sowohl der Form nach, wie dem Inhalt nach. Denn die „absolute Setzung“ des Ich (= Inhalt) ist identisch (= Form) mit dem „Sein“ des Ich. Oder auch, wie Fichte es anderswo6 sagt, das Ich, sich als „absolutes Subjekt“ setzend, realisiert die Identität des Subjekts (aktive Setzung) und des Objekts (gesetztes Sein). man kann nicht höher aufsteigen. 364 6 Zit. op. S.98, Fußnote http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k266819/f135.item.zoom Zweites Prinzip. – Neben dem Satz der Identität: A = A liefert unser Bewusstsein uns einen in gleicher Weise evidenten und in gewisser Beziehung primitiven Satz. Wir wollen vom negativen Axiom sprechen: Nicht-A ist nicht A. 7 . 7 Zit. op. S.101 ff. Dieses negative Axiom unterscheidet sich der Form nach vom Axiom der Identität so wie die Negation sich von der Affirmation unterscheidet. Und diese Bemerkung ist nicht unnütz, denn man könnte versucht sein den negativen Satz: „Nicht-A ist nicht A“ durch den „unbestimmten“ Satz zu übersetzen: „Nicht-A ist Nicht-A“, der eigentlich zum formalen Typ gehört: „A ist A“, wo der Term A irgendeine beliebige Materie bezeichnet. Das negative Axiom, von dem wir hier sprechen, charakterisiert sich durch die „Form der Negation“, was auch immer die Materie sein könnte: Es repräsentiert eine Kehrtwendung in der Haltung selbst des Subjekts das urteilt.1 1 Zit. op. S.102-103. Schauen wir nun, was das Axiom der Negation an wahrhaft Ursprünglichem enthält. Wenn es sich zurückführen ließe auf irgend ein anderes Prinzip, könnte das nur sein auf die Identität A==A, das heißt auf das Prinzip der „absoluten Setzung2 “ 2 Zit. op. S.102 Nun aber ist die reine negative Form: „nicht sein“ in keiner Weise im Voraus enthalten in der reinen positiven Form: „Sein“. Der Form nach ist das negative 294 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. Prinzip also ursprünglich und unabhängig3 3 365 ebenda Aber die Form kann nicht ohne Materie sein. Die Materie – absolut allgemein – des negativen Prinzips schließt die zwei Elemente ein: A und Nicht-A, die beide auf eine oder andere Weise im Ich gesetzt sein müssen; nun ist aber Nicht-A als Nicht-A nur erkennbar vermittels A; die Setzung von Nicht-A als Nicht-A ist also nur möglich durch die Setzung im Voraus von A, was uns zurückbringt auf das erste fundamentale Prinzip, wie auf eine vorausgesetzte Bedingung. Man muss also sagen, dass das negative Axiom primitiv ist bezüglich seiner Form und bedingt bezüglich seiner Materie oder seines Inhalts4 . 4 zit. op. S.103 Machen wir einen weiteren Schritt und entnehmen die tiefe Haltung des Ich, die im negativen Axiom eingehüllt ist. Die absolute und notwendige Geltung des negativen Prinzips hängt in keiner Weise ab von der Realität von A und von Nicht-A; sie gründet sich also auf die Natur des Ich selbst, das a priori das negative Prinzip setzt. Das heißt, dass vor aller Angabe von A oder von Nicht-A, das negative Axiom eine der Aktivität des Ich eigentümliche Relation ausdrückt. Mit anderen Worten, dafür dass das Ich a priori in einer absolut allgemeinen Form affirmieren kann, dass „Nicht-A nicht A ist“, muss zuerst wahr sein, dass „Nicht-Ich, obwohl im Ich, nicht Ich ist“, was impliziert, absolut gesprochen, dass das Ich, indem es sich setzt (erstes Prinzip), sich auch sich selbst als Nicht-Ich entgegensetzt5 5 zit. op. S.104 Die Form der Negation drückt also aus nicht die totale Substitution des Nicht-Ich im Ich, nicht die reine und einfache Unterdrückung der ursprünglichen Aktivität des Ich, sondern die „Reflexion“, die Umkehrung dieser Aktivität auf sie selbst; der so geschaffene Konflikt im Inneren des Ich ist primitiv (ursprünglich) als „Form der Handlung“ (als „Entgegensetzen“); aber als Inhalt (als Gehalt: Nicht-Ich eher als Ich) fließt sie aus der „absoluten Setzung“ heraus, ausgedrückt im ersten Prinzip: es ist dasselbe Ich, das „sich setzt“, und das ganze zusammen „setzt sich sich selbst entgegen1 “ 1 zit. op. S.102-103 Wir registrieren also ein zweites fundamentales Prinzip – absolut durch seine Form der Negation, abgeleitet bezüglich seiner Materie: nämlich dass im Inneren selbst des Ich „dem Ich schlechthin ein Nicht-Ich entgegengesetzt wird“: „ein Nicht-Ich findet sich unausweichlich dem Ich gegenübergestellt2 “ 2 zit. op. S.104 Drittes Prinzip. – Wenn man das erste fundamentale Prinzip in Verbindung bringt mit dem zweiten fundamentalen Prinzip, kann es einem nicht 295 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 366 entgehen zu bemerken, dass sie sich gegenüberstehen wie „These“ und „Antithese“. Tatsächlich 10 das Ich setzt sich und setzt sich sicherlich in sich selbst; 20 das Nicht-Ich ist gesetzt und notwendig gesetzt im Ich. Ich und Nicht-Ich gehören also alle beide zur primitiven Einheit des Ich. Aber das Ich setzen entsprechend seines ganzen Begriffsumfangs, wäre gleich einem das Nicht-Ich Eliminieren. Umgekehrt, das Nicht-Ich setzen, entsprechend seinem gesamten Umfang wäre das Ich eliminieren. Um die Begriffe des ich und des Nicht-Ich in ihrer Fülle zu nehmen, muss man sich einigen, dass das zweite Prinzip den Widerspruch in das Ich einführt und das erste Prinzip selbst trügerisch macht3 . 3 zit. op. S.106-107 Und doch zwingen sich diese zwei Prinzipien auf mit voller Notwendigkeit und müssen gleichzeitig wahr sein. Es obliegt uns also die Aufgabe, die „synthetische Bedingung“ zu suchen, unter der ein Kompromiss möglich ist. Diese Bedingung, schon weiter oben angemerkt, springt in die Augen: denn der Widerspruch resultierte daraus, dass das Ich als solches das Nicht-Ich total unterdrücken würde und umgekehrt. Jeder unmittelbare Widerspruch verschwindet, wenn die Unterdrückung auf beiden Seiten nur partiell ist, das heißt, wenn das Ich konzipiert wird als begrenzt durch das Nicht-Ich und das Nicht-Ich als begrenzt durch das Ich4 . Die gesuchte synthetische Bedingung ist also die „gegenseitige Begrenzung“ (Schranken), was auf beiden Seiten die „Teilbarkeit“ impliziert. 4 zit. op. S.108-109 „Ich und Nicht-Ich müssen also gesetzt werden als Teilbare 5 “ 5 367 zit. op. S.109 So, bemerkt Fichte, findet sich also das Prinzip der „Quantisierbarkeit“ deduziert, oder der „Eignung zur Quantität im allgemeinen“; aber verlassen wir diesen partikulären Gesichtspunkt, auf den wir weiter unten zurückkommen müssen. Und da man nicht vergessen kann, dass das teilbare Ich und das teilbare Nicht-Ich vom Ich und im Ich gesetzt sind, drücken wir das dritte Prinzip, die Synthese der beiden anderen, wie folgt aus: „Ich setze im Ich dem teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich entgegen“. „Das Ich setzt im Inneren des Ich ein teilbares Nicht-Ich einem teilbaren Ich gegenüber 1 “ 1 zit. op. S.110 Die Form dieses dritten Prinzips, das heißt „die gegenseitige Begrenzung im Inneren des Ich“ ist gar nicht primitiv und unbedingt: sie ist deduziert von den zwei anderen fundamentalen Prinzipien, nicht durch einfache Analyse, sondern als eine notwendige synthetische Bedingung. 296 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 368 Bemerkung zur „fundamentalen Synthese“. – Mit diesem dritten Prinzip beenden wir die Aufstellung der Grundlagen des „Bewusstseins“ im eigentlichen Sinn. Und wir haben von jetzt an das typische Vorgehen des Beweisens angewandt, die die Grundlage der ganzen Wissenschaftslehre bildet. Ausgegangen von der Tatsache des Bewusstseins, betrachtet in dem, was es an absolut Allgemeinem und Notwendigen darstellt, haben wir davon die Bedingungen a priori der Möglichkeit gesucht und wir haben festgestellt, dass es das Zusammenwirken einer subjektiven Bedingung (Setzung des Ich) und einer objektiven Bedingung (Reflexion des Ich) verlangt. Das war die aufsteigende Phase unseres Beweisverfahrens; sie entspricht der „transzendentalen Analyse“, von der wir früher gesprochen haben. Dann stieg unser Beweisverfahren von den transzendentalen Elementen des Bewusstseins wieder herab zur Einheit von diesem (transzendentale Deduktion). Das heißt, dass wir uns fragten, unter welcher Bedingung das subjektive Element und das objektive Element (These und Antithese) vereinigt werden könnten in der aktuellen Einheit von einem Bewusstsein. Und wir haben festgestellt, dass diese vermittelnde Bedingung (Synthese) nichts anderes sein kann als die „gegenseitige Begrenzung“ der zwei entgegengesetzten Elemente. Synthese des Subjekts und des Objekts in der Einheit des Ich, das ist gerade die Definition des Bewusstseins. Vor dieser ersten Synthese war es ungerechtfertigt, von Bewusstsein zu sprechen, da dessen fundamentale Bedingungen nicht gesetzt waren. Mit dieser ersten Synthese ist solide begründet, verknüpft mit seinen absolut letzten Bedingungen, das nächste Prinzip, von dem aus die ganze deduktive Untersuchung des Bewusstseins ausgehen muss, mit anderen Worten die gesamte „Wissenschaftslehre“. Man wird bemerken, dass die fundamentale Synthese, von der wir sprechen, ausgeführt in den so allgemein wie möglichen Ausdrücken, noch nicht das Bewusstsein von irgendeinem partikulären Objekt ausdrückt. Das was sie uns gibt, ist die einfache Haltung des Ich in Bezug auf sich selbst in der bewussten Handlung als solcher; anders gesagt, es ist dieses „Selbstbewusstsein“ das ruht auf dem Grund von jedem der partikulären bewussten Akte. Außerdem werden wir bald sehen, dass die primitive Synthese gar nicht isoliert realisierbar ist, nach der ganzen Weite der Begriffe, die es ausdrücken, sondern dass sie sich entwickeln muss in weiteren Synthesen, wahrhaften einschränkenden Bedingungen ihrer Möglichkeit. Man möge uns eine letzte Bemerkung gestatten, bevor wir den Faden des Beweises von Fichte wieder aufnehmen. Man stellt manchmal den Idealismus von Fichte dar als die Deduktion – oder die behauptete Deduktion – von allem „Realen“, Objekt unseres Bewusstseins, ausgehend allein vom ersten fundamentalen Prinzip (absolutes Subjekt oder reines Ich). Es ist leicht einzusehen, von dem bisherigen aus, wiesehr diese Auslegung unrichtig ist: Fichte verknüpft alles Reelle mit dem reinen Ich, wie einem absolut ersten Prinzip, nichts ist mehr wahr. Aber er deduziert 297 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 369 sein rationales System nicht allein aus dem ersten Prinzip, sondern aus der fundamentalen Synthese des ersten Prinzips (Setzung des Ich) mit dem zweiten Prinzip (Reflexion des Ich). Nun aber, wenn die Setzung des Ich durch sich selbst ein absoluter Akt der Freiheit ist (das heißt von metempirischer Aktivität, nicht der Freiheit der Wahl), die den notwendigen Stoff jedes Denkens schafft, ist die Reflexion des Ich über sich selbst, obwohl einfache Inversion (Umkehrung) der primitiven Bewegung, trotzdem von ihrer Seite her ein absoluter Akt der Freiheit bezüglich der Richtung oder der Form: Die Form der „Reflexion“ ist nur möglich vermittels einer „absoluten Setzung“, aber deduziert sich nicht von ihr. So also ist der Idealismus von Fichte nicht ein absoluter Idealismus in dem Sinn, dass die Gesamtheit der Realität hier abgeleitet würde vom reinen Ich auf dem Wege der Notwendigkeit: Das reine Ich schafft die Welt in einem Akt der Freiheit, der sich überhaupt nicht verschmilzt mit dem fundamentalen Akt, durch den das Ich sich setzt. Und das genügt, um zu verhindern, dass man gleich zu Beginn schon die Philosophie von Fichte des Pantheismus verdächtigt. Das Problem ist sehr viel komplexer: wir werden es weiter unten untersuchen. So wie er ist, ist der Idealismus von Fichte dennoch außerordentlich viel weniger entfernt von einem absoluten Idealismus, als es der rein formale Idealismus von Kant war, wie er auf den ersten Blick scheint. Andererseits, wenn man das System von Fichte einen subjektiven Idealismus nennt, darf man nicht vergessen, dass das Subjekt, an dessen Aktivität sich die Gesamtheit des Seins festmacht, dabei als „absolutes Subjekt“ definiert ist, schon vor der Entgegensetzung von Subjekt und Objekt, und nicht als ein Subjekt korrelativ zu einem Objekt. Nun aber beginnt das „Bewusstsein“ nur mit der Synthese des Gegensatzes von Subjekt und Objekt. Man sieht also, wie sehr man sich täuschen würde, wenn man Fichte einen engen „Subjektivismus“ zuschreibt, der behaupten würde, aus dem „bewussten Subjekt“ die Gesamtheit des Objekts abzuleiten. Nachdem wir die konstitutive Formel des Bewusstseins als solchem besitzen, können wir jetzt suchen, unter welchen Bedingungen a priori dieses fundamentale Bewusstsein sich verwirklichen kann in einer aktuellen bewussten Aktivität. Mit anderen Worten, wir können nun mit Fichte fortfahren zur „Deduktion der Kategorien“ oder der Funktionen des Bewusstseins. §3.b) Die Bedingungen der Aktualität des theoretischen Ich: Deduktion der Funktionen des Bewusstseins oder der Kategorien 10 Die primitiven Kategorien und die fundamentale Synthese Wir stehen im Begriff die rationale Genese des „reinen Selbstbewusstseins“ als Synthese der zwei fundamentalen Prinzipien des reinen Subjekts und der reinen Form, mitzuerleben. 298 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 370 Diese Grundsynthese, durch die sich das Bewusstsein wesentlich konstituiert, liefert uns schon drei grundlegende Kategorien, unmittelbar ausdrückbar in ebenso vielen allgemeinen Axiomen. Tatsächlich, das erste absolut absolute Prinzip (“Das Ich setzt sich“) entspricht der reinen Kategorie der Affirmation oder der Realität (im absoluten Sinn) und drückt sich unmittelbar aus im Axiom der Identität: A = A. (1 Siehe oben T2K2II§3aP1) Das zweite Prinzip, das der Reflexion (“Das Ich setzt sich ein NichtIch gegenüber“), entspricht der reinen Kategorie der Negation und drückt sich unmittelbar aus im Axiom des Unterschieds: Nicht-A ist nicht A.(2 Siehe oben T2K2II§3aP2) Das dritte Prinzip, Synthese der zwei anderen (“Das Ich setzt in seiner absoluten Einheit ein teilbares Ich und ein teilbares Nicht-Ich einander gegenüber, die sich begrenzen oder sich gegenseitig bestimmen“) entspricht der Kategorie der Begrenzung (oder der Bestimmung), und es drückt sich aus durch das Axiom des nächsten Grundes (“Satz des Grundes3 “) 3 zit. Op. S.111 ff. [Dieser Zusammenhang zwischen dem dritten Prinzip und dem „Axiom des nächsten Grundes“ kann auf den ersten Blick eigentlich nicht evident erscheinen. Ohne ins Detail des von Fichte4 4 371 loc. zit. vorgelegten Beweises zu gehen, werden wir undeutlich den zentralen Punkt sehen, wenn wir daran denken, dass die „Setzung des Ich“ und die „primitive Reflexion“ oder die „Setzung des Nicht-Ich“ nur „absolute Anfänge“ sein können, „erste Fakten der Freiheit“, für die die Frage des „Warum“ oder der rationalen Bedingung sich gar nicht stellt. Aber weiter unten, sobald wir ein begrenztes Ich setzen und ein begrenztes Nicht-Ich, konzipieren wir diese entgegengesetzten Elemente nur als eng korreliert, jedes auf das begrenzende Element, das ihre diesbezüglichen Konfigurationen bestimmt. So geschieht es, dass das Prinzip der Begrenzung in unser Bewusstsein einschleicht unter der Form eines Prinzips der Relation oder der rationalen Abhängigkeit: Das was das Ich begrenzt, wird für uns der nächste Grund oder die nächste Bedingung des begrenzten Ich; das was das Nicht-Ich begrenzt, wird der Grund oder die nächste Bedingung des begrenzten Nicht-Ich. Tatsächlich muss es zwischen einer Bedingung als solcher und einem Bedingten als solchem eine Gleichheit in der Gegensätzlichkeit geben. Nun aber ist die Begrenzung gerade die Realisierung dieser Charakteristiken, denn was ist denn eine Grenze, wenn nicht die Koinzidenz oder der „Ort“ entgegengesetzter Elemente? Die reine Form der Begrenzung, die im dritten Prinzip gesetzt wird, drückt also gut die Form des Prinzips des nächsten Grundes aus, so wie 299 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte Fichte es ausdrückt: „Die reziproke Äquivalenz von A (begrenzt) und des Komplements von A (das heißt von -A)“ 1 ] 1 0 372 Ebenda 2 Die mittleren Synthesen und die Kategorien der Ursache und der Substanz Greifen wir den Ausdruck des dritten Prinzips oder der fundamentalen Synthese wieder auf: „Das Ich setzt in ihm selbst ein teilbares Ich einem teilbaren Nicht-Ich entgegen“. Die Möglichkeit für das Ich, sich zu „begrenzen“, hat uns einen Ausweg eröffnet aus dem Widerspruch der zwei ersten Prinzipien. Aber wir können nicht dabei stehen bleiben, denn die allgemeine Formulierung dieser ersten Synthese verbirgt neue Widersprüche, die auf ihre Weise behoben werden müssen. Prinzip des praktischen Ich und des theoretischen Ich,– Das dritte Prinzip, so sagt Fichte, schließt implizit die zwei folgenden Sätze ein (zit. op. S.125 ff): 10 „Das Ich setzt das Nicht-Ich als beschränkt durch das Ich“. Dieser Satz würde die Handlung des Ich an einem Nicht-Ich definieren, das heißt die konstitutive Handlung des „praktischen Ich“. Aber wir müssen die Prüfung des praktischen Ich zurückstellen bis nach der Untersuchung des theoretischen Ich: Tatsächlich kann dieses allein uns lehren, in welchem Sinn das Nicht-Ich fähig ist, das Attribut der Realität zu empfangen und die Handlung des Ich zu erleiden. Der erste Untersatz des ersten Prinzips behält also vorläufig in unseren Augen einen rein problematischen Wert. 20 „Das Ich setzt sich selbst als beschränkt durch das Nicht-Ich“. Das ist das fundamentale Prinzip des theoretischen Ich, das heißt des Ich bestimmt durch ein Objekt. Das Ich, so bemerkt Fichte [zit.Op. S.126], hat sich zuerst als absolut gesetzt, dann als begrenzbar oder teilbar, jetzt setzt es sich als begrenzt durch ein Nicht-Ich. Synthese der Reziprozität. – Aber dieser Gang [Entwicklung] geht nicht ohne Schwierigkeiten, denn der Untersatz, der das übersetzt, zerlegt sich in zwei kontradiktorische Behauptungen: a) Das Ich setzt sich (aktiv ) als begrenzt oder bestimmt (“Das Ich setzt sich als bestimmt, heißt offenbar so viel wie das Ich bestimmt sich [zit.Op. S.127]“) b) Das Ich wird (passiv) bestimmt durch das Nicht-Ich (“Also das Ich soll nicht bestimmen, sondern es soll bestimmt werden [ebenda]“) Bezogen auf dieselbe Bestimmung, soll das Ich also zugleich aktiv und passiv sein. Welche synthetische Bestimmung löst diese 300 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 373 neue Antinomie auf? Eine einzige: die reziproke [=wechselseitige] Abfolge der Passivität und der Aktivität oder kürzer, die „Wechselseitigkeit der Handlung“ (Wechselbestimmung, Wechselwirkung) Tatsächlich sind wir gezwungen, zuzulassen, dass das Ich, um sich als Bestimmtes zu setzen, sich auf aktive Weise passiv macht, passiv einem Nicht-Ich gegenüber, das heißt aktiv dem Nicht-Ich eine Handlung am Ich verleiht. Das totale Ich ist also zugleich aktiv (im Nicht-Ich,) indem es die Bestimmung (im Ich) auf sich nimmt, und passiv (im Ich), indem es sich (durch das Nicht-Ich) die Bestimmung gibt Bemerken wir nebenbei, dass wir gerade eine neue Funktion des Bewusstseins entwickeln, das heißt eine neue „Kategorie“: die Reziprozität, die wie Fichte sagt, der kantschen Kategorie der „Relation“ entspricht, was voraussetzt, dass für Fichte [zit. op. S.131], jede Relation bilateral1 ist. 1 Die Scholastiker lassen die Bilateralität jeder Relation nicht zu, obwohl sie anerkennen, dass jede Relation als bilateral konzipiert ist. Sicherlich ist ihnen der Begriff der „Reziprozität“ oder der „wechselseitigen Kausalität“ vertraut: man kennt die weitreichende Verwendung, die sie von den korrelativen Begriffen von Potenz und Akt, von Materie und Form machen. Dennoch sehen sie in der Anwendung dieser Begriffspaare nirgends eine vollständige Reziprozität – Diese wäre eine utopische Grenze, wo die Qualität sich zurückgeführt fände auf die unveränderliche Quantität- Der Unterschied in der Reziprüzität ist genau das Prinzip des universellen Werdens, der inneren Finalität. Die Kategorie der Ursache. – Man ahnt, dass die Kategorie der „Ursache“ (Nicht Kausalität des Ich sondern objektive Kausalität) nicht weiter hinausgeschoben werden kann. Der Beweis, den wir machen, um die „Reziprozität“ des Ich und des Nicht-Ich zu zeigen, führt uns unmittelbar zu einer neuen Synthese. Tatsächlich besitzt das Ich mit vollem Recht die totale Realität, die volle Aktivität, wie es aus dem ersten fundamentalen Prinzip hervorgeht; andererseits macht sich das Ich in der „reziproken Bestimmung“ notwendigerweise passiv, das heißt, es opfert einen Teil seiner aktiven Realität. Wie behält es also die Gesamtsumme dieser Realität intakt? Eine einzige Konzeption kann die Schwierigkeit lösen: die dynamische Konzeption der Reziprozität, nach welcher die „Passivität“ des Ich der Übertragung eines Teils proportional der fundamentalen Aktivität – oder der Realität – vom Ich auf das Nicht-Ich entspricht. Von solcher Art ist die „Synthesis der Wirksamkeit“ (Kausalität)4 4 374 zit.Op. S.136 Das Ich kann sich also nicht als bestimmt denken, ohne zugunsten des Nicht-Ich einen Teil seiner eigenen Aktivität preiszugeben, und folglich, ohne das Nicht-Ich zu denken als Ursache der erlittenen Bestimmung.5 5 zit.Op. S.131, 136 301 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte Die Kategorie der Substanz.– Allerdings muss man zugeben, dass die Antinomie, die die „Synthese der Kausalität“ notwendig macht, durch sie noch nicht vollkommen gelöst ist. Es bleibt schockierend, dass die totale Aktivität des Ich sich so aufteilen kann, sich „begrenzen“, ohne ihre totale Geltung zu verlieren: denn ein „Grad“, ein „Quantum“ der aktiven Realität, das ist, so scheint es, gerade die „Negation der Totalität“ von dieser1 . Siehe da, von neuem sind wir gezwungen, einen Gesichtspunkt zu suchen, der sich uns dem drohenden Konflikt entziehen hilft. 1 Zit. Op. S.138 Hier findet Fichte eine Zuflucht nur in der Unterscheidung der Substanz und des Akzidens, was darauf hinausläuft, die relative Aktivität des Ich auf zwei Ebenen der Realität stufenförmig anzulegen. Diese Aktivität kann unter zwei Aspekten ins Auge gefasst werden: als eine bestimmte Selbstbegrenzung: als ein definiertes Maß der aktiven Reziprozität: als solche ist sie variabel, veränderlich, augenblicklich; oder als unbestimmte Gesamtheit der bestimmenden Aktivität, als Gesamtheit der möglichen Momente der inneren Reziprozität des Ich: unter diesem zweiten Aspekt nimmt die relative Aktivität etwas Absolutes an, denn sie hat die ganze Weite der dynamischen Möglichkeiten des reinen Ich. Nun aber findet sich die unbestimmte Totalität der reziproken Aktivität des Ich, in Bezug auf jede definierte Reziprozität in einer Relation ähnlich der des reinen Ich im Blick auf die primitive Reflexion: Unser Bewusstsein, konstituiert seiend durch die Reflexion, kennt das reine Ich nur in dieser [Reflexion], als absolute Bedingung von dieser, aber kann sich nicht direkt aufbauen im Herzen des reinen Ich, und daraus apodiktisch die Reflexion deduzieren. Diese letztere erscheint also als kontingent bezogen auf das reine Ich gesetzt als Prinzip. Ebenso erscheint uns hier jede Begrenzung des Ich, verglichen mit der integralen begrenzenden Aktivität des Ich, unter dem spekulativen Gesichtspunkt, wie etwas, was der direkten Deduktion entgeht, das heißt, wie etwas Nicht-Notwendiges, etwas „Kontingentes“, „Akzidentelles“. Und korrelativ dazu, muss wohl die totale und unbestimmte Aktivität des Ich erscheinen unter der Varabilität der partikulären Bestimmungen als ein Fortbestehen, als eine Substanz 2 375 2 Zit. Op. S.142-143 „Insofern das Ich betrachtet wird als den ganzen, schlechthin bestimmten Umkreis aller Realitäten umfassend, ist es Substanz... Die Grenze, welche diese [= der einzelnen Determinationen] beson- 302 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. dere Sphäre von dem ganzen Umfange abschneidet, ist es, welche das Akzidens zum Akzidens macht“. „Die Substanz ist aller Wechsel, im allgemeinen gedacht: das Accidens ist ein bestimmtes, das mit einem anderen wechselnden wechselt3 “ 3 Zit. Op. S.142 Zwischen einer totalen Aktivität und einer verminderten oder partikulären Aktivität gäbe es sicher einen Widerspruch, wenn die eine und die andere unter demselben Titel der Ausdruck des Ich sein müsste. Der Widerspruch verschwindet, wenn die totale Summe der Aktivität fortbesteht als Substanz unter den inneren rein accidentellen Bestimmungen. Trotzdem muss man wohl aufmerksam machen, um jede Verwirrung mit anderen Philosophien zu vermeiden, dass in der Terminologie Fichtes die „Substanz-Totalität“ sich definiert unter Einbezug des Accidens: und die Relation ist reziprok: „Keine Substanz ist denkbar ohne Beziehung auf ein Accidens,... kein Accidens ist denkbar ohne Substanz1 “ 1 Zit. Op. S.142 Diese begrenzte Bedeutung entspricht gewiss dem etymologischen Sinn der „Substanz“, betrachtet als „id quod substat accidentibus“ [= das was den Akzidenzen zugrunde liegt], aber nicht dem abgeleiteten und transzendentalen Sinn des „id quod stat per se“ [das was in sich steht], wie die Scholastiker sagten. Die Quantität.– Fichte macht hier2 2 376 Zit. Op. S.144 nebenbei eine Bemerkung, der eine Tragweite nicht abgeht. Die vorausgehenden Beweise enthalten eine Deduktion der „Quantität“ des Ich. Tatsächlich,wenn man ein teilbares Ich einem teilbaren Nicht-Ich gegenüberstellt, behaupten (affirmieren) wir schon das theoretische Fundament der Quantität. Die Deduktion hat sich vollendet in dem Moment, wo wir begründen, dass diese Gegenüberstellung eine reziproke Begrenzung voraussetzt, nur erklärbar durch eine (kontingente) Verminderung der Aktivität des Ich. Nun ist aber eine „Verminderung der Aktivität“ nur möglich, wenn diese „Grade“ präsentieren kann, oder, wenn man will, ein Quantum besitzt. Ebenso wie die Dunkelheit in Wirklichkeit nur ein niedrigerer Grad, ein kleineres „Quantum“ von Licht ist, so erscheint das das Ich begrenzende Nicht-Ich, schlussendlich wie ein Herabsetzen des Grades oder eine quantitative Verminderung des Ich. Die „Quantität des Ich“ ist also gefordert als Bedingung gerade der Möglichkeit der „Passivität des Ich angesichts des Nicht-Ich3 “ 3 Zit. Op. S.144-145 303 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 30 Die letzte konstitutive Synthese des Bewusstseins oder die Deduktion der produktiven Vorstellungskraft Von Synthese zu Synthese hat uns das dritte Fundamentalprinzip in der theoretischen Domäne in die unmittelbare Nähe einer AbschlussSynthese geführt, dem wahrhaften Abschlussstein des ganzen bisher aufgebauten synthetischen Gebäudes und letzte Bedingung der tatsächlichen Realisierung des „reinen Selbstbewusstseins“, des „Bewusstseins als solchem“, unserem Ausgangspunkt. Deduktion der „unabhängigem Aktivität“. – Aber zuerst, warum ist eine neue Synthese notwendig? Haben wir noch nicht alle Möglichkeiten des Widerspruchs eliminiert, die das fundamentale Prinzip des theoretischen Ich verbirgt? Wenn man genau hinschaut, muss man zugestehen: Nein. Unsere Synthese der „Reziprozität“ (mit den Synthesen der Kausalität und der Substantialität, die sich damit unmittelbar in Verbindung bringen), ist noch nicht in seiner allgemeinen und ungenauen Aussage verständlich. Man sagte dort, dass das Ich sich aktiv bestimmt, indem es sich dem NichtIch passiv macht in der Weise, dass die Aktivität des Ich der Passivität des Nicht-Ich korrespondiert und umgekehrt (reziprok) die Aktivität des Nicht-Ich der Passivität des Ich. Aber letzten Endes, so bemerkt Fichte, erscheint das Dilemma, das man vermeiden wollte, wieder: Von den zwei Dingen geht nur eines: „entweder ist es das Ich, das sich aktiv setzt als bestimmt und so ist es nicht bestimmt durch das Nicht-Ich; oder das Ich ist wirklich bestimmt durch das Nicht-Ich, aber wie kann man dann noch behaupten, dass das Ich sich selbst bestimmt1 ?“ 377 1 Zit. Op. S.148 Man sieht mühelos, wo der Knoten der Schwierigkeit liegt. Wenn das Ich und das Nicht-Ich perfekt korrelative Terme wären, definiert allein durch ihre gegenseitige Begrenzung – von solcher Art wäre der Fall in einem dualistischen manichäischen System – würde sich die Kategorie der „Reziprozität“ hier ohne Einschränkung anwenden lassen. Aber, unsere idealistische Voraussetzung gegeben, muss, wie wir gesehen haben, das Nicht-Ich selbst schließlich aus dem Ich hervorgehen. Weil die ganze Aktivität des Nicht-Ich – mittelbar oder unmittelbar – von der Aktivität des Ich entnommen ist, hängt die Passivität des Ich in Bezug auf das Nicht-Ich, was die Form betrifft, ganz korrelativ bleibend zur Aktivität des Nicht-Ich, selbst darin, von einer höheren Aktivität ab, die zugleich auf beiden Seiten der Grenze des Ich und des korrelativen Nicht-Ich sich erstreckt [vorhanden ist]. Das ist es, was Fichte ausdrückt, indem er sich auf die vorausgehen- 304 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. den Synthesen stützt, mit diesen Worten: „Im [totalen] Ich wird eine Aktivität gesetzt, die keine Passivität des Nicht-Ich ausgleicht; und im Nicht-Ich [soweit es abhängt vom Ich] eine Aktivität, die keine Passivität des Ich ausgleicht2 “. 2 378 Zit. Op. S.149 Diese sibyllische Aussage bedeutet – einfacher ausgedrückt – dass es im totalen spekulativen Ich eine synthetische Aktivität gibt, die die partiellen und korrelativen Aktivitäten des Ich und des Nicht-Ich einschließt (verbindet). Fichte nennt die so postulierte synthetische Aktivität: „Unabhängige Tätigkeit“. Was ist das Formal-Objekt dieser unabhängigen Tätigkeit? Denn, was auch immer sie ist, da sie zum theoretischen Ich gehört und so nicht in die reine Setzung des Ich übergeht, muss sie sich also dem „Grundgesetz der Opposition“ unterziehen (zweites fundamentales Prinzip) und sich definieren durch Beziehung auf ein Formal-Objekt, das sie bestimmt. Dieses Formal-Objekt ist kein anderes als die Reziprozität selbst der Aktivität und der Passivität im Inneren des theoretischen Ich (Wechsel Tun und Leiden). Die unabhängige Tätigkeit erscheint also wie die Fakultät, die die reziproken Bestimmungen ursprünglich im Bewusstsein setzt, nach denen sich konkret das Ich und das partielle Nicht-Ich, sagen wir: das Subjekt und das Objekt1 definieren. 1 Zit. Op. S.149-151, 159-160 Die unabhängige Tätigkeit als produktive Vorstellungskraft.– Wir können nicht eintreten in die verwickelten Beweise, durch die Fichte den Begriff der „unabhängigen Tätigkeit“ entwickelt. Denn diese letzte Synthese, gegeben die Zahl der Elemente, die sie ins Werk setzt, ist bei weitem die verwickeltste und schwierigste der ganzen Wissenschaftslehre. Wie fahren also mehr summarisch fort und eilen sofort zum Resultat dieser mühsamen Demonstration, indem wir uns vor allem diesem Instinkt des Erratens (Wahrsagens) anvertrauen, der oft der Vernunft erlaubt, ohne zu großes Risiko die langsame und geregelte Bewegung einer Dialektik im Detail zu überflügeln. Um alles in einem Wort zu sagen, wenn man die allgemeinsten Charakteristiken gruppiert, die die „unabhängige Tätigkeit“ realisieren muss, sieht man unmittelbar, dass sie eine spekulative Fähigkeit definieren, die man mit Fichte „die produzierende Vorstellungskraft“ nennen kann. Diese würde also die letzte Bedingung der Aktualität des theoretischen Ich konstituieren. Überfliegen wir tatsächlich die hauptsächlichen dieser Charakteristi- 305 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte ken: „Die unabhängige Tätigkeit“ muss konzipiert werden als die Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt im theoretischen Ich steuernd, das heißt, als ihre reziproke Bestimmung produzierend weit davon entfernt, nur konsekutiv zu dieser Bestimmung zu sein. Mit anderen Worten, sie muss die nächste synthetische Bedingung der ergänzenden (komplementären) Handlung des Ich und des Nicht-Ich sein. Aber da die jeweiligen Handlungsfelder des Ich und des Nicht-Ich zur Überschneidung kommen können in einem beliebigen Punkt ihrer unbegrenzten Ausdehnung, muss auch „unabhängige Handlung“ unbegrenzt sein in ihrer ProduktionsKraft. Außerdem muss die „unabhängige Handlung“ spontan oder absolut sein, da sie als Handlung in Zusammenhang steht mit dem Ich, im Voraus zum relativen Gegensatz von Subjekt und Objekt; aber sie muss zugleich relativ sein, weil ihr unmittelbares und exklusives Produkt notwendig die partikuläre Begrenzung (oder die Bestimmung) ist, die in das Ich die Relativität des Subjekts und des Objekts einführt. Absolute Virtualität, unbestimmte Produktivität, Handlung begrenzt und relativ in ihrer konkreten Ausführung (Vollzug): Diese Attribute kommen nur einer produktiven Vorstellungskraft zu, die im unbestimmten Lauf der Zeit partikuläre „Repräsentationen“ enthüllt2 379 2 Zit. Op. S.215 und vorausgehende und folgende Seiten Welchem Umstand verdankt die Vorstellungskraft dieses Privileg, Entgegengesetzte koexistieren zu lassen, einen Zustand zu schaffen, wie Fichte sagt, des Mit-Wissens (con-science), „in welchem völlig entgegengesetzte Richtungen vereinigt werden3 “? 3 Zit. Op. S.228 Sie verdankt sie ihrer Fähigkeit der „Repräsentation“. Elemente, die sich auf der Ebene der absoluten Realität einander zerstören würden, können nebeneinanderstehen auf der Ebene der Repräsentation. Nun aber setzt die Vorstellungskraft das Nicht-Ich (oder das Objekt) – nicht etwa als absolute, dem Ich entgegengesetzte Realität, was ein „Ding an sich“ hervorbringen (affirmieren) wäre – sondern als Repräsentation einer unabhängigen Realität, die dem Ich entgegengesetzt ist. Und die Vorstellungskraft setzt das Ich – sicherlich nicht rein und einfach als absolute Realität, die das Nicht-Ich steuert (beherrscht), was das Hervorbringen des reinen Ich selbst oder der Freiheit wäre – sondern als Repräsentation einer unabhängigen Realität, die das Nicht-Ich dominiert, das heißt als Repräsentation der Freiheit1 . (1 Ebenda) Fassen wir das alles in vielleicht leichteren Ausdrücken zusammen: Die streng kontradiktorische Gegensätzlichkeit des Ich und des Nicht-Ich, Bedingung des aktuellen Bewusstseins, ist nicht realisierbar im Absoluten sondern nur als Repräsentation, das heißt durch das Spiel der produktiven Vorstellungskraft. 380 306 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 381 Die unbewusste Fähigkeit der Ideenbildung (Ideation) und das Bewusstsein des Objekts. – Schmeicheln wir uns, nun die letzte synthetische Bedingung begriffen (ergriffen) zu haben, die, welche das aktuelle Bewusstsein möglich macht? Ohne jeden Zweifel. Wir besitzen in der produktiven Vorstellungskraft eine spontane Fakultät, fähig im Inneren des Ich diese reziproke Begrenzung von Subjekt und Objekt zu schaffen, die wir mit einem Wort eine „Bestimmung“ nennen. Aber wie wir gezeigt haben, als wir das zweite fundamentale Prinzip (siehe oben S.364 ff.) erklärten, kann, zu sagen, „dass das Ich in Sich eine Bestimmung setzt“, keinen anderen Sinn haben als den folgenden: „das Ich bewirkt in sich eine Inversion (oder eine Reflexion) seiner Aktivität auf sie selbst“. Der Umfang oder die Form dieser Reflexion definiert exakt den Inhalt der Bestimmung. Das Ich, handelnd in der produktiven Vorstellungskraft ist also identisch das Ich, insofern es in sich eine bestimmte Reflexion seiner grundlegenden Tätigkeit verursacht. Nun aber bringt im Inneren des Ich Reflexion Bewusstsein mit sich, in dem präzisen Maße dieser Reflexion, oder wenn man vorzieht, nach der Form dieser Reflexion selbst. Daraus folgt, dass in jeder Operation der produktiven Vorstellungskraft: 10 die hervorgebrachte Bestimmung (Form der Reflexion) bewusst ist; 20 die Produktion selbst dieser Bestimmung (das heißt die reflektierende Handlung, die unmittelbar diese oder jene Reflexion verursacht,) unbewusst bleibt, da sie selbst ja nicht „reflektiert“ ist; 30 die bewusste Bestimmung, da sie mit keiner produktiven Handlung des Ich verknüpft ist, zeigt sich zuerst isoliert von Jeder Beziehung zum Subjekt, wie ein fremdes Element, das heißt nach Art eines Nicht-Ich oder eines Objekts3 . 3 Wir verstehen darunter das Bewusstsein von etwas, was schon objektiv in uns ist, ohne noch von uns als Objekt anerkannt zu sein. Von solcher Art wäre das rein sinnliche Bewusstsein, getrennt von der Apperzeption. Dieser Zustand entgeht evidenterweise unserer direkten Erfahrung, denn wir erkennen das Sinnliche nur in der Apperzeption selbst. Das ist der Grund, warum nach Fichte die imaginative (=in der Vorstellungskraft) Repräsentation zu allererst in unseren Augen den Charakter eines Objekts annimmt. Aber die zuerst unbewusste Aktivität der Vorstellungskraft kann bewusst werden, indem sie sich reflektiert in einem „zweiten Akt der Reflexion“. Dann also findet sich ihr Produkt, die Repräsentation, effektiv schon gesetzt im bewussten Ich, darin bewusst integriert, das heißt, offenbart seine Abhängigkeit von der produktiven Tätigkeit des Ich. Die erste Reflexion hatte uns das rohe Bewusstsein eines Objekts konstituiert, die zweite Reflexion liefert uns im Bewusstsein des Objekts das Bewusstsein von uns selbst als aktives Subjekt. In dem Moment erhalten wir das ganze wesentliche Spiel des Bewusstseins: eine „bewusstlose Produktion“ der Bestimmungen; das Bewusst- 307 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte sein der objektiven Bestimmungen oder der Repräsentationen im eigentlichen Sinn (“Vorstellungen“; „vorgestellte Welt“); das Selbstbewusstsein als Subjekt dieser Repräsentationen. Der „zweite Akt der Reflexion“. der uns das Anfangs-Bewusstsein von uns selbst im Objekt gibt, ist auf seine Weise, bewusst seiner reflektierten Form nach, aber unbewusst als Handlung. Durch eine neue Reflexion kann diese Handlung, die schon zweifach reflektierend ist, sich selbst begreifen und so weiter. Aber wir insistieren hier nicht auf diesen Reflexionen in Kaskade, denn sie gehören schon zur „Evolution des theoretischen Ich“, die wir in einem folgenden Paragraphen betrachten müssen. Die produktive Vorstellungkraft ist also das notwendige und universelle Instrument des bewussten Lebens. Ohne sie gibt es für uns sozusagen überhaupt keine Realität eines erkannten Objekts. „Jede Realität, so schließt Fichte – und das ist so zu verstehen: jede Realität für uns, denn das Wort Realität kann in einem System der transzendentalen Philosophie keinen anderen Sinn haben – jede Realität also ist nur das Produkt der Vorstellungskraft1 “ 382 1 zit. Op. S.227 §3.c) Die Evolution des theoretischen Ich oder die Deduktion des bewussten Objekts Bevor wir unseren Gang wieder aufnehmen, ist es wichtig, exakt den Punkt zu erkunden, wo unser Beweis oder besser der Beweis von Fichte angekommen ist. Blick zurück: die primitive (grundlegende) Tatsache des „Anstoßes“. – Nachdem einmal in der fundamentalen Synthese die allgemeinsten Bedingungen einer Aktivität des Ich festgestellt sind, haben wir vorübergehend unser Ziel begrenzt auf die Untersuchung des konstitutiven Prinzips des theoretischen Ich oder des Bewusstseins: „Das Ich setzt sich, als bestimmt durch das Nicht-Ich 2 “ 2 siehe oben S.372 und Fichte Zit.Op S.217-218 Dieses Prinzip bot sich unserer Reflexion an als die unmittelbare Versöhnung des Gegensatzes des Ich und des Nicht-Ich im spekulativen Bereich. Dennoch, so wie es ist, notwendig und zugleich unbestimmt, auferlegte es sich uns noch nicht unter einer definitiven Form; es rief nach einer strengeren Prüfung; es musste getestet und präzisiert werden. Bis zu dem Augenblick, wo es unseren rationalen Forderungen volle Genugtuung geben würde, behielte es etwas Hypothetisches, etwas von einem problematischen Prinzip. 308 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 383 Aber hören wir lieber Fichte selbst, die befolgte Methode beschreiben: „Unsere Aufgabe, sagt er, war es, zu suchen, ob der formulierte problematische Satz: Das Ich setzt sich als bestimmt durch das Nicht-Ich – denkbar ist und unter welchen Bedingungen er denkbar ist. Wir haben versucht auf diesen Satz alle neuen Präzisionen anzuwenden, die eine systematische und erschöpfende Deduktion liefern könnte. Wenn wir alles das eliminieren, was inkonsistent und undenkbar erscheint, haben wir das, was wahrhaft denkbar ist in einen immer engeren Kreis eingeschlossen; und so von Etappe zu Etappe, haben wir uns der Wahrheit angenähert bis zu dem Moment, wo wir die einzig mögliche Materie ergriffen haben, das was gedacht werden musste, zu denken. Wenn nun der Satz, von dem wir ausgegangen sind, schon wahr war unter seiner allgemeinen und abstrakten Form – und wir mussten ihn für wahr halten kraft der fundamentalen Prinzipien – wenn weiter es hervorgeht aus der gegenwärtig vollendeten Deduktion, dass dieser Satz nur wahr sein könne auf diese bestimmte Art und Weise [das heißt unter der konkreten Bedingung einer schöpferischen Handlung der Vorstellungskraft,] gibt es keinen Zweifel, dass die deduzierte Schlussfolgerung nicht eine primitive Tatsache ausdrückt, die sich unerwartet in unserem Geist ergibt.1 “ 1 zit. Op. S.219 Originaltext: Unsere Aufgabe war, zu untersuchen, ob und mit welchen Bestimmungen der problematisch aufgestellte Satz: das Ich setzt sich, als bestimmt durch das Nicht-Ich, denkbar wäre. Wir haben es mit allen möglichen durch eine systematische Deduktion erschöpften Bestimmungen desselben versucht; haben durch die Absonderung des Unstatthaften und Undenkbaren das Denkbare in einen immer engeren Circel gebracht, und so Schritt vor Schritt uns der Wahrheit immer mehr genähert, bis wir endlich die einzig-mögliche Art zu denken, was gedacht werden soll, aufgefunden. Ist nun jener Satz überhaupt, d.h. ohne die besonderen Bestimmungen, die er jetzt erhalten hat, wahr – dass er es sey, ist eine auf den höchsten Grundsätzen beruhendes Postulat – ist er kraft der gegenwärtigen Deduction, nur auf diese eine Art wahr: so ist das aufgestellte zugleich ein ursprüngliches in unserem Geist vorkommendes Faktum. Und Fichte erklärt danach, dass er „ursprüngliches Faktum des Bewusstseins“ nennt etwas was nicht nur in diesem ist, ein künstliches und willkürliches Produkt der philosophischen Reflexion, sondern etwas, was sich der Reflexion aufzwingt wie eine Notwendigkeit der bewussten Handlung, das heißt wie die einzige Form, die diese letztere annehmen kann. Nun aber, welches ist dieses „ursprüngliche Faktum“, auf das uns die gestaffelten Synthesen bis hierher geführt haben? Das ist die unbewusste Handlung der Vorstellungskraft, die die ursprüngliche und andauernde, aber partielle Reflexion des Ich auf sich selbst hervorruft, aus der die Repräsentation geboren wird. Und insofern „ursprüngliches Faktum“, das Bewusstsein einleitend, wird diese „unbewusste Handlung“ von Fichte der Anstoß2 , genannt, das heißt der Schock, den sich das Ich gibt, um sich zu reflektieren, das Hindernis, das es sich aktiv schafft, um einen Teil seiner Aktivität zum Rückfluss zu bringen. Adoptieren wir zur Bequemlichkeit unserer weiteren Darstellung, diese metaphorische Bezeichnung, ohne andererseits den im Vorhergehenden definierten technischen Sinn zu vergessen. 2 zit, Op.S.218 und öfter 309 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 384 So also, um mit einem Wort zusammenzufassen, der Beweis von Fichte hat bis hierher eine erste Phase durchlaufen, die sich erstreckt von der Anfangsformel des theoretischen Ich bis zur Endbedingung der Wahrheit dieser Formel, das heißt bis zum ursprünglichen Faktum des Anstoßes. Diese erste Phase könnte man nennen eine „transzendentale Analyse“ des Bewusstseins als solchem. Denn die konstitutive Handlung des Bewusstseins findet sich zurückgeführt auf Bedingungen – oder auf Funktionen – die ihre Möglichkeit a priori bestimmen. Die „pragmatische Geschichte des Geistes“. Fragen der Methode. – Was bleibt uns noch zu machen? Der umgekehrte Weg1 1 zit.Op. S.222-223 Oder, wenn man will, eine Art gelebter Gegenbeweis der gemachten Deduktion. Im absoluten Ich wurde uns das theoretische Ich gegeben, als solches, und wir haben daraus den Anstoß deduziert. Wir werden jetzt den Anstoß in das absolute Ich platzieren und davon , wenn das geht, das theoretische Ich deduzieren. Vorhin analysierten wir das Bewusstsein, indem wir versuchten in seinem wesentlichen Vollzug den Ausgleich seiner Möglichkeits-Bedingungen zu unterscheiden; jetzt behaupten wir, die Genese selbst des Bewusstseins mitzuerleben ausgehend von den genannten Bedingungen. Unser Beweis wird also konstruktiv sein und wird der natürlichen Bewegung des Geistes beim Werden des Bewusstseins folgen. Das ist es, was Fichte ausdrückt in der wohlbekannten Formulierung: „Die Wissenschaftslehre muss die pragmatische Geschichte des menschlichen Geistes sein.“ (Die W-L. soll seyn eine pragmatische Geschichte des menschlichen Geistes)2 2 385 zut. Op. S.222 Man erlaube uns – nebenbei – aufmerksam zu machen auf die Parallele zwischen dieser neuen Phase des Beweises von Fichte und der kantschen transzendentalen Deduktion. Kant nahm dabei als Ausgangspunkt eine rein synthetische Fakultät, eine nicht intuitive Intelligenz, das heißt eine höchste Form der Einheit (reine Apperzeption), gezwungen eine ihr äußere Materie zu bestimmen, oder im eigentlichen Sinn eine „Gegebenheit“. Aus der Annäherung dieser zwei Prinzipien – einer reinen Form und einem Gegebenen – deduziert er die Charakteristiken des objektiven Bewusstseins – oder des bewussten Objekts – ihrer Form nach (Kategorien). Fichte geht in diesem zweiten theoretischen Teil der Wissenschaftslehre auch vom höchsten Prinzip des Bewusstseins aus (dem reinen Ich) und er platziert es im Blick auf ein „ursprüngliches Faktum“, dem „Anstoß“, wahrhaftiges objektives und diversifizierendes Prinzip der Erkenntnis. Man findet hier das Äquivalent der kantschen „Materie“ der Begriffe. Nur kraft der idealistischen 310 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 386 Voraussetzung, geht der Anstoß mit all seinen weiteren Folgen vom Ich aus, statt dem Ich, wie eine ganz äußerliche Begrenzung, entgegengesetzt zu sein. Da wo Kant sich abfindet mit einem irreduziblen Dualismus, setzt Fichte einen Dualismus, von dem er im Voraus die Reduktion postuliert: der einzige Unterschied – aber er ist beträchtlich – zwischen der transzendentalen Deduktion von Kant und der Deduktion des bewussten Objekts ( „Deduktion der Vorstellung“) durch Fichte, besteht im ständigen Eingreifen des idealistischen Postulats bei diesem letzteren, das die integrale (=vollständige) Reduktion der Inhalte des Bewusstseins auf die Einheit des Ich fordert. Als Folge konzentriert sich die Deduktion von Fichte nicht nur auf die Form (Kategorien), sondern auch auf die Materie (Formen der Sinnlichkeit, Sinneswahrnehmung) des bewussten Objekts. Fichte erklärt klar, im Grundriss des Eigenthümlichen, usw. die Methode dieser idealistischen Deduktion des Objekts: „Die Methode der Theorie der Wissenschaft“ in ihrem spekulativen Teil wurde schon beschrieben in der Grundlage: sie ist einfach und leicht zu begreifen. Als Leitfaden haben wir dabei das Ordnungsprinzip, das unsere ganze Untersuchung beherrscht: Nichts passiert dem Ich als das, was es selbst in sich setzt. [= das was es auf sich selbst bezieht insofern es Ich ist.] Als Fundament setzen wir das ursprüngliche Faktum, das wir im Vorausgehenden bewiesen haben [= den Anstoß, die spontane Handlung der produktiven Vorstellungskraft]; und wir werden versuchen, zu sehen, wie das Ich dieses erste Faktum auf sich bezieht. Aber die Handlung des Ich, die in sich selbst, insofern es Ich ist, das erste Faktum setzt, ist in gleicher Weise ein Faktum und muss also in gleicher Weise bezogen werden auf das Ich durch das Ich. Und es geht damit so, ohne Unterbrechung bis zu dem Moment, wo man das höchste Faktum des theoretischen Ich erreicht, das heißt das Faktum, in dem das Ich sich bewusst setzt als bestimmt durch ein Nicht-Ich. So vollendet sich der spekulative Teil der Wissenschaftslehre durch sein Anfangsprinzip, sie kehrt zurück zu ihrem Ausgangspunkt und schließt sich also vollständig auf ihr selbst1 . 1 Grundriss usw. S.333 Das Vorgehen Fichtes ist offensichtlich. Definitionsgemäß ist das Ich Aktivität, die in sich selbst ihr Produkt wiedereingliedert, oder in anderen Worten, die Aktivität, die sich auf sich selbst spiegelt und, im selben Maße, bewusst wird. Damit etwas wahrhaft zum Ich gehört (wie es das idealistische Prinzip verlangt,) muss dieses etwas also nicht nur ein Produkt des Ich sein, sondern das Objekt einer Reflexion des Ich. Ebenso, setzten wir ein „erstes Faktum“ im Ich, wird dieses Faktum notwendiger Weise reflektiert, dann muss diese partikuläre reflektierende Handlung, die sich im Ich setzt, wiederum reflektiert werden, und so weiter. Die notwendigen Stufen des Bewusstseins werden uns geoffenbart durch die überlagerten „Reflexionen“ die sich notwendig einander einfordern. 311 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte Setzen wir uns also jetzt ins Innere des reinen Ich vor das ursprüngliche Faktum des Anstoßes und beschränken uns darauf, die unvermeidliche Entwicklung dieser Anfangssituation zu notieren. (Die Darstellung, die folgen wird, stützt sich hauptsächlich auf die Sektion der Grundlage der Wissenschaftslehre mit der Überschrift: Deduktion der Vorstellung, und ebenso für das, was die Deduktion der reinen Sinneswahrnehmung betrifft, der Intuition und des Bildes auf das in diesen Seiten schon mehrfach zitierte Werkchen; Grundriss des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre). 387 Erste Reflexion und reine Sinneswahrnehmung.– Der „Schock“ oder der Anstoß, der die erste Reflexion des Ich über sich selbst auslöst, schafft im Ich eine Reziprozität des Handelns und des Erleidens, die wir uns vorstellen können als ein Gleichgewicht entgegengesetzter Kräfte. Das Ich konstituiert sich so in einem Zustand der aktiven Passivität, der unbeweglichen Aktivität („ruhende Tätigkeit“; man wäre versucht zu übersetzen in der Sprache der Mechanik: mit „virtuelle Verschiebung“), die der Definition der Materie (Stoff ) entspricht (wenigstens der dynamischen Definition). Aber das ist nicht alles. Da der Anstoß eine erste Reflexion des Ich über sich selbst bestimmt, gibt es also im so geschaffenen Gesamtzustand etwas, was sich auf das Ich bezieht, insofern es Ich ist; mit anderen Worten, das Ich, das sich sozusagen selbst entfremdet hat, indem es eine Materie produziert, eignet sich diese sofort wiederum an durch Reflexion und, im gleichen Maße, erwacht es zum Bewusstsein. Die „Materie“, insofern sie partielle Reflexion des Ich über sich selbst ist, konstituiert die „reine Sinneswahrnehmung“ (Empfindung). Die wesentliche Relativität der Sinneswahrnehmung als solcher ruht also, genau, in der reziproken Gegensätzlichkeit geschaffen durch die erste Reflexion des Ich über sich selbst, oder wenn man so will, geschaffen durch die ursprüngliche Handlung der produktiven Vorstellungskraft. Zweite Reflexion und ursprüngliche Intuition.– Die „reine Sinneswahrnehmung“ ist also im Ich gesetzt als eine Begrenzung des Ich durch sich selbst. Der so geschaffene Zustand muss auf seine Weise, um wirklich im Ich zu sein, das Objekt eines reflektierten Aktes werden, der ihn ins Ich aufnimmt. Mit anderen Worten, es ist nötig, dass die ursprüngliche Begrenzung des Ich nicht nur in irgendeiner Weise im Ich existiert, sondern darin – reflex – ergriffen sei, für das, was sie ist, das heißt als begrenzt. Nun aber heißt eine Grenze erfassen als Grenze, sie überschreiten und eine begrenzende Handlung (oder eine Realität) setzen. Die zweite Reflexion des Ich wird also zum Inhalt haben die Realität (oder die Aktivität), die das Ich begrenzt, das heißt das Nicht-Ich, das Objekt. Man beachte wohl, dass diese zweite reflektierte Handlung, ganz „verloren 312 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 388 im Objekt“, noch überhaupt kein „Bewusstsein von sich“ aufweist. Tatsächlich setzte die erste Reflexion des Ich nur eine Grenze im Inneren des Ich; die zweite Reflexion begriff diese Grenze als Grenze und setzte also ein der Grenze entsprechendes Nicht-Ich. Aber keine Reflexion erreichte bis hierher die Handlung des Subjekts insofern sie so ist. Das würde aber das „Bewusstsein von sich“ voraussetzen. Man muss also mit Fichte sagen, dass der zweite reflexe Moment eine „unbewusste Anschauung des Objekts“ ist (“bewusstlose Contemplation“), eine Kontemplation in der das Ich noch nicht sich selbst wiederfindet. Fichte nennt sie ursprüngliche Intuition (Anschauung). Wie ist der durch diese zweite Reflexion im Ich geschaffene Zustand zu charakterisieren? Die erste Reflexion schuf den Zustand der rohen Sinneswahrnehmung, das heißt der reinen Relativität des Ich und des Nicht-Ich zu ihrer gemeinsamen Grenze. Die zweite Reflexion schuf im Ich, entsprechend dieser Grenze, einen Zustand der Passivität oder des Zwangs, die sich übersetzt für das Bewusstsein durch eine entsprechendes Gefühl. In der objektiven Intuition, das heißt im Inneren der nach außen gerichteten Handlung selbst, fühlt sich das Ich passiv dem Objekt gegenüber, oder genauer – denn es gibt noch nicht eigentlich gesprochen „Bewusstsein seiner selbst“ – das Ich erkennt sich in dem Maße und unter der Form seiner Passivität, nicht mehr und nicht weniger. Dritte Reflexion und reproduzierende Vorstellungskraft.– Die zweite Reflexion hat in das Ich eine neue Tatsache eingeführt (drittes Faktum,) die ruft nach einer dritten Reflexion. Analysieren wir sorgfältig das Objekt dieser [dritten Reflexion]. Sie ist nicht mehr eine Reflexion über den ursprünglichen Anstoß (erstes Faktum), noch selbst eine Reflexion über die „rohe Sinneswahrnehmung“ (zweites Faktum), sondern eine Reflexion über die objektive Intuition, über die Anschauung (drittes Faktum.) Welches ist also der Inhalt, den diese dritte Reflexion im Bewusstsein setzt? Das wird der Inhalt selbst der Intuition sein, das Objekt, aber in den neuen Bedingungen. In der Intuition zwingt sich das Objekt dem Ich auf mit dem Gefühl der „Notwendigkeit“: und der Grund dieser Auferlegung des Zwangs war, dass das intuitionierende (schauende) Ich noch nicht seine eigene intuitive Handlung begriffen hat. Hier findet sich das reflektierte Objekt nicht nur an sich sondern in der Abhängigkeit, in der es ist, nämlich von der Aktivität (Handlung) des Subjekts. Der neue, im Ich durch die dritte Reflexion geschaffene Zustand bringt also ein „freies“ Element der Handlung mit sich. Und tatsächlich ist die Reflexion über die objektive Intuition begleitet vom Gefühl, je nach Wollen sich vollziehen oder nicht vollziehen zu können. [In psychologischen Ausdrücken, würde man sagen, dass die dritte Reflexion schon unter den Standpunkt der willentlichen Aufmerksamkeit fällt.] 313 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 389 Trotzdem ist nicht alles frei im Inhalt dieser letzten Reflexion: Ob sie sich hervorbringen kann oder sich nicht hervorbringen kann, einmal hervorgebracht, gibt sie neu heraus ganz oder zum Teil die Bestimmungen – oder die Form – des Objekts, so wie sie die Intuition anbietet. Freiheit was die Ausübung betrifft, notwendige Abhängigkeit was die objektive Form betrifft: das sind die Züge gerade der reproduzierenden Vorstellungskraft, die uns gibt nicht mehr das Objekt sondern das Bild des Objekts. Setzt man sich auf den Gesichtspunkt der dritten Reflexion, kann man also nennen Ding oder objektives Modell (Vorbild) den Inhalt der ursprünglichen Intuition und Bild oder Repräsentation (Nachbild) dasselbe Objekt, reflektiert als Produkt der spontanen Handlung des Ich. Das Reale und das Ideale für das Bewusstsein.– Wir begegnen hier dem Fundament der Unterscheidung von Real und von Ideal, von Objektiv und Subjektiv (im gewöhnlichen Sinn dieser Wörter). Das Reale oder das Objektive ist das direkte Produkt der Handlung oder der Intuition., das ist das Ding. Das Ideale oder Subjektive ist das Produkt der Reflexion über das Ding, es ist das Bild. Das Ding ist unbewusst gesetzt durch das Ich und das Bild ist nur das Ding dem Ich bewusst wiedergegeben; Real und Ideal hören auf irreduzibel zu scheinen: sie bezeichnen nur unterschiedene Momente in der reflexen Handlung des Ich. 390 Konstruktion der objektiven Kategorien (Substanz, Ursache).– Das ist noch nicht alles. Die dritte Reflexion, die wir jetzt reproduzierende Vorstellungskraft nennen können, setzt im Ich die zwei großen objektiven Kategorien: Die Substanz und die Ursache. Die Substanz weil die Bestimmungen des NichtIch, wiederaufgenommen im Bild durch einen Akt der freien Reflexion, scheint also abtrennbar vom Nicht-Ich, kontingent in Bezug auf dieses, das heißt den Charakter des Akzidens annehmend, das dem Nicht-Ich wie einem „Substrat“ oder einer Substanz inhäriert. Was die Kategorie der Kausalität betrifft, so findet sie sich konstituiert im Bewusstsein allein durch die Tatsache, dass das Nicht-Ich, als Substanz konzipiert, den Charakter der notwendigen Aktivität nicht verloren hat, durch die sie sich in der Intuition der spontanen (freien) Handlung des Ich entgegensetzt. Die Kategorien des Objekts haben also ihren nächsten Ursprung in der Vorstellungskraft. Kant, in dessen Augen die Kategorien ursprünglich „Formen des Denken“ waren (Denkformen)1 1 Siehe Grundriss S.387 muss wohl, auch er, auf die Vorstellungskraft rekurrieren, um die äußeren Gegebenheiten mit ihnen in Verbindung zu bringen: seine Theorie des Schematismus füllt eine Lücke auf, die klaffend blieb zwischen den reinen Kategorien 314 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. und den Objekten. Fichte braucht nicht einen „Schematismus“, denn er leitet die Kategorien selbst ab von der Vorstellungskraft, ebenso wie die Objekte. Der Gesichtspunkt, den er annimmt, zeigt ihm eine organische Einheit dort, wo Kant sich mühsam abmüht, eine Vereinigung der aufeinander bezogenen Stücke zu konzipieren. „Der Irrtum Kants, sagt er, wenigstens der, der sich ausdrückt durch die Buchstaben seiner Werke, ungeachtet des Geistes, der sie inspiriert, besteht einzig darin zu behaupten, dass das Objekt etwas anderes sein muss als ein Produkt der Vorstellungskraft.2 “ 2 Grundriss S.388 [Man sieht ohne Schwierigkeit, dass die von der Vorstellungskraft eingenommene Rolle im System von Fichte nur ein Korrolar der allgemeinen idealistischen Voraussetzung ist. Im Übrigen ist der Ausdruck „Vorstellungskraft“ nicht notwendig synonym bei Kant und bei Fichte; und der Unterschied der Bedeutung, wenn er existiert, muss herkommen von dem, dass der Ausdruck „Ich“ auch nicht notwendig die selbe Geltung hat bei diesen zwei Philosophen. Wir werden weiter unten die Kritik des idealistischen Prinzips machen; in der Erwartung bis dahin muss unsere ganze Sorge darauf gerichtet sein, in das Denken von Fichte einzudringen, indem wir ihn die möglichst wenigen Umstellungen erleiden lassen. 391 Konstruktion der konkreten Quantität (Raum und Zeit)– Die objektiven Kategorien bringen uns in die unmittelbare Nachbarschaft der „Anschauung a priori der Sinneswahrnehmung.“ Im Vorausgehenden haben wir schon die „Quantität“ „deduziert“ als eine notwendige Bedingung der Passivität des Ich im Blick auf das Nicht-Ich1 . Hier in der dritten Reflexion des Ich auf das Nicht-Ich, können wir feststellen die aktive Einführung der Quantität in das Bewusstsein. 1 Vergl. oben Seite 376 Versuchen wir den wesentlichen Zug dieses evolutiven Moments des theoretischen Ich aufzudecken. Wie man weiß, ist das Objekt der dritten Reflexion die Anschauung, die ursprüngliche Intuition, in der das Ich, beeinflusst durch eine gegebene Begrenzung, ein Nicht-Ich setzt, unabhängig vom Ich, als notwendige Ursache dieser Begrenzung. Durch die Anschauung hat sich also das Ich „ein Nicht-Ich an sich“ (= ein „Ding an sich“) gegeben, dessen Aktivität ihm unabhängig von seiner eigenen erscheint. Aber in der Reflexion über die Anschauung begegnet das Ich zum ersten Mal – objektiv – seiner eigenen Aktivität: das Bild, Produkt des Ich, setzt im Bewusstsein, angesichts des „Dings an sich“, das „Subjekt an sich“ oder das „Ich an sich“. Nun aber taucht das „Ich an sich“ im Bewusstsein auf als „unabhängige Handlung“, mit besserem Titel selbst als das „Ding an sich“, 315 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 392 weil die Aktivität des Ich unter jeder Rücksicht den Charakter der Freiheit trägt (“das Bild ist kontingent, wenigstens als Existenz“). Wir finden also gegenwärtig zwei Aktivitäten, voneinander unabhängig. Aber diese Aktivitäten müssen sich begegnen in einer gemeinsamen Begrenzung: es ist also nötig, dass beim Fehlen einer Abhängigkeit zwischen den aktiven Prinzipien, wenigstens ihre „Handlungs-Sphären“ sich überschneiden. nun aber ist die Überschneidung von zwei unabhängigen „Handlungssphären“ nur konzipierbar kraft der „Kontinuität“ eines „Milieus“, wo sich beide entwickeln (entfalten.) So entsteht im Bewusstsein ein neuer Begriff, der des „kontinuierlichen Milieus“, deren Attribute: Ausdehnung, Dauer, unbeschränkte Teilbarkeit sich leicht deduzieren lassen. Tatsächlich, dafür dass die „Produktion des Bildes“ in der dritten Reflexion wirklich kontingent (frei) sei, ist es nötig, dass die Handlung des Ich in einem beliebigen Punkt die Sphäre der Aktivität des Nicht-Ich erreichen kann [Die Scholastiker würden sagen: es gibt keine wahre Freiheit der Ausübung ohne Freiheit der Spezifikation]. Nun aber, wenn man gut hinschaut, ist das nicht möglich außer in einer „Kontinuität der Ausdehnung“. Und da der Begriff dieses ausgedehnten Milieus nicht gebunden ist an irgendeine partikuläre Bestimmung seines Inhalts, folgt daraus auch noch, dass die „ausgedehnte Kontinuität“ in sich genommen, „homogen“ erscheinen muss, „stabil“, „unveränderlich (unbeweglich)“, „indifferent und unbegrenzt teilbar“. Wir stehen im Begriff, die Quantität und den Raum zu definieren. Aber aktiv im Ich die Quantität und den Raum setzen, ist da die Zeit setzen. Im Beweis, der uns zum Begriff des Raumes führte, haben wir diesen definiert, genau als das Milieu – oder den „Ort“ – der Koinzidenzen von Ich und Nicht-Ich. Um die Zeit zu erhalten, genügt es, diese „Bedingung des Milieus“ in Anbetracht der subjektiven Aktivität, die sich da vollzieht, zurückzulegen. Eine Aktivität gezwungen, eine ausgedehnte Gesamtheit unterteilt zu durchlaufen, staffelt sich notwendigerweise in „Augenblicke“ und schafft eine „Sukzession“ oder eine „irreversible Reihe“: Diese Sukzession ist durchaus nicht eine objektive Bedingung des räumlichen Milieus, sondern eine Bedingung der subjektiven Aktivität, die sich in diesem Milieu vollzieht. Der Beitrag der „dritten Reflexion“ zum Bewusstsein ist also wirklich reichhaltig: das Bild, die Kategorien des Objekts, der Raum und die Zeit. Hier endet die Entwicklung des Werkchens von Fichte mit dem Titel: Grundriss des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre. Dieses „Eigenthümliche“, dieses „etwas partikuläres“, das die Theorie der Wissenschaft in Bezug auf die kantsche Kritik differenziert, das ist die systematische Deduktion der Zeit, des Raumes und der ursprünglichen Mannigfaltigkeit (= die kantschen „Gegebenheiten“). Die anderen Unterschiede zwischen den Systemen von Fichte und von Kant leiten sich alle ab von dieser fundamentalen Differenz, in der wir gerade die angesichts der idealistischen Voraussetzung adoptierten Haltungen 316 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 393 wiedererkennen. Neben dem Ich der reinen Apperzeption gab sich Kant als irreduziblen Ausgangspunkt das „Verschiedene [divers]“, den Raum und die Zeit. Fichte behauptet, alles auf das reine Ich zu reduzieren. Außerdem sagt er sehr logisch, dass der Ausgangspunkt von Kant, weit davon entfernt, das ursprünglichste Prinzip zu sein, das uns zu erreichen möglich wäre, schon einen sekundären Stand der Reflexion des Ich über sich selbst darstellt. „Kant, so schreibt er in der Schlussfolgerung des Grundriss, Kant geht in der Kritik der reinen Vernunft von einer Phase der Reflexion aus, in der die Zeit, der Raum und die intuitive Mannigfaltigkeit schon gegenwärtig sind im Ich und für das Ich. Wir haben dagegen damit begonnen, diese Elemente a priori zu deduzieren; und sie sind nun im Ich gesetzt. Dadurch findet sich alles das bewiesen, was die Theorie der Wissenschaft als Eigenes präsentiert in ihrem spekulativen Teil; und wir verabschieden uns vom Leser genau an dem Punkt, wo Kant anbietet, ihn zu führen 1 “ 1 394 Grundriss S.411 Die Evolution der höheren Fakultäten: Verstand, Urteil, Selbstbewusstsein. – Die weitere Entwicklung des theoretischen Ich (höhere Fakultäten), so wie sie von Fichte beschrieben ist, deckt die Etappen ab, die selbst Kant beschreibt (und die vor ihm die Philosophen mit idealistischer Tendenz beschrieben haben). Aber evidenterweise unterlässt es die epistemologische Geltung der beschriebenen Etappen vom einen zum anderen nicht, sehr verschieden zu sein. Wir insistieren nicht auf den Details dieser höheren Deduktion: hier ist ihr allgemeiner Verlauf. Die dritte Reflexion des Ich – oder die Handlung der reproduzierenden Vorstellungskraft – muss, da sie ein „Faktum“ des Ich ist, auf ihre Weise auf das Ich durch Reflexion bezogen sein (vierte Reflexion). Nun aber ist die Handlung der Vorstellungskraft, in sich betrachtet, unbeschränkt beweglich (veränderlich), unbegrenzt, dahinfließend am Faden der Zeit, nicht zu fassen; und ihr Produkt, das Bild, ist also auch variabel, augenblicklich, flüchtig...Die plötzlich dazu kommende Reflexion ergreift diese Handlung, die sich verflüchtigt, hält sie in einem präzisen Moment an und „stabilisiert“ ihr Produkt. Die vierte Reflexion extrahiert also aus dem „Werden“ eine „Dauer“, aus dem veränderlichen Bild macht sie ein festes Bild, das heißt einen „Begriff“. Diese neue Reflexion erfüllt also die Funktion, die dem Verstand eigentümlich ist: sie entzieht die Repräsentation der Veränderlichkeit der Zeit. Aber die nicht-zeitliche Handlung des Verstands ist selbst, insofern sie ein Akt ist, im Ich gegenwärtig als ein „Faktum“, das „reflektiert“ werden muss. Eine fünfte Reflexion erreicht also den Akt des Verstandes, das heißt, ergreift 317 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte das stabilisierte Bild – oder den Begriff – als aktiv durch das Ich gesetzt. Diese neue Reflexion ist nicht nur frei, sondern hat als Inhalt das begriffliche Objekt, insofern es durch eine freie Handlung gesetzt ist. Welches wird von da an die Situation sein, die geschieht mit dem Begriff im Bewusstsein? Es interveniert da als unbestimmt empfänglich dafür zu sein, „reflektiert“ zu werden entsprechend seiner Realität eines Produkts des aktiven Ich, das heißt als Objekt vom Ich angenommen zu werden oder überhaupt nicht reflektiert zu werden, das heißt, selbst nicht einmal „gedacht“ zu werden als Objekt. Im ersten Fall äußert das Ich ein Urteil über das Objekt; im zweiten Fall macht es Abstraktion vom Objekt als Objekt. „Die Fähigkeit zu urteilen, sagt Fichte, ist die freie Fähigkeit, über die im Verstand gesetzten Objekte zu reflektieren oder Abstraktion von diesen zu machen. Und so, sei es, dass sie reflektiert, sei es, dass sie abstrahiert, platziert die Fakultät zu urteilen die Objekte des Verstandes unter eine weitere Bestimmung1 “ Das heißt, dass sie durch das Urteil darüber diese affirmiert (oder sie verneint) und, indem sie frei unterlässt zu urteilen, sie diese im Zustand einfacher Begriffe (entia rationis [Gedanken Dinge]) lässt. 1 395 Grundlage W-L- S.242 Die Handlung des Urteilens vollzieht sozusagen eine freie Reflexion über den Begriff, dem kontingenten Produkt des Verstandes. Da sie nicht verknüpft ist mit irgendeinem partikulären Objekt, muss sie an sich und als solche unabhängig sein von allem und folglich in ihrem eigentümlichen Akt, wie ein reines „Faktum“ des Ich, das Maximum der objektiven Abstraktion darstellen. Wie ist diese absolute Abstraktion von jedem Objekt im theoretischen Ich möglich? Denn jedes bestimmte Objekt vollständig unterdrücken heißt, nur die Selbstbestimmung des reinen Subjekts fortbestehen lassen. Eine letzte Reflexion des Ich gibt den Schlüssel des Problems. Seine judikative Aktivität als solche reflektierend, kann das Ich dabei kein bestimmtes Objekt sehen, weil jedes bestimmte Objekt kontingent ist in Bezug auf den judikativen Akt: Das Ich begegnet nur der „reinen Aktivität der objektiven Bestimmung“, indem es sich selbst als Subjekt setzt; mit anderen Worten: das Ich findet sich endlich wieder als Ich, es kommt zum ersten Mal das Selbstbewusstsein. Dieser höchste Akt der Reflexion ist der der Vernunft eigentümliche Akt. Siehe da, wir haben das fundamentale Prinzip des theoretischen Ich erreicht, das heißt das Bewusstsein, welches das Ich von sich selbst als Prinzip eines Objekts im allgemeinen hat: „Das Ich setzt sich selbst als bestimmt durch ein Nicht-Ich“. Durch alle reflexen Entwicklungen des konkreten Objekts, ist das Ich schließlich dahin gelangt, in einer letzten Anstrengung der Abstraktion, seine eigene kreative Freiheit zu begreifen; das reine Ich, auf den AnfangsAnstoß reagierend, wird Bewusstsein. 318 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 396 Schlussfolgerung.– Und nun, da wir die Phasen der Entwicklung des theoretischen Ich Schritt für Schritt durchlaufen haben, ist es wichtig, um jedes Missverständnis zu vermeiden, eine Betrachtung zu betonen, die wir schon auf dem Wege gemacht haben. Diese Phasen bilden nicht eine Reihe von äußerlich sukzessiven und mit einander verknüpften Handlungen, sondern eine Überlagerung von rationalen Elementen im Inneren einer einzigen Handlung. Sie steuern einander; die, die vorausgehen, liefern die notwendige Stütze denen, die folgen. Die, die folgen, sind die Bedingungen der Möglichkeit von denen, die vorausgehen. Tatsächlich Nutzen ziehend aus dem allgemeinen idealistischen Prinzip, dass „alles, was gesetzt ist im Ich, bezogen werden muss auf das Ich“, spult sich, nachdem einmal der ursprüngliche Anstoß gegeben ist, die innere Entwicklung des Ich bis zum „Selbstbewusstsein“ mit der unflexibelsten logischen Notwendigkeit ab. Es gibt nicht nur kein „Selbstbewusstsein“ ohne Urteil, noch Urteil ohne Begriff, noch Begriff ohne Bild, noch Bild ohne Intuition, noch Intuition ohne reine Sinneswahrnehmung, noch reine Sinneswahrnehmung ohne Anstoß ; sondern umgekehrt (reziprok) es kann im Ich kein Anstoß ohne reine Sinneswahrnehmung sein, noch reine Sinneswahrnehmung ohne Intuition, noch Intuition ohne Bild, noch Bild ohne Begriff, noch Begriff ohne Urteil, noch endlich Urteil ohne Selbstbewusstsein. Es ist dieselbe reflexe Aktivität, die im Anstoß freigesetzt, die im „Selbstbewusstsein“ die rationalen Konsequenzen dieser ersten Entwicklung ausschöpft. Ausgegangen vom Bewusstsein als solchem haben wir abgeleitet die Notwendigkeit des ursprünglichen Faktums des Anstoßes, im Ich gesetzt (das heißt der ursprünglichen Begrenzung des Ich). Dann, nachdem der Anstoß im Ich gesetzt war, haben wir das Bewusstsein als solches abgeleitet. Der Kreis des theoretischen Ich ist vollständig geschlossen. Aber der Anstoß, wenn er sich als Vor-Bedingung des Bewusstseins aufzwingt und so eine relative Notwendigkeit annimmt (=relativ zum theoretischen Ich), hat immer noch nicht die absolute Rechtfertigung gefunden, die seine Notwendigkeit mit dem reinen Ich verknüpfen würde. Warum auferlegt sich das reine Ich eine Begrenzung? Ist daa ein rein willkürliches und kontingentes Faktum? Auf diese neue Frage antwortet die Untersuchung des praktischen Ich. §3.d) Die rationale Funktion des praktischen Ich Wir haben im Vorausgehenden [siehe S.372 K2.II§3b2] angemerkt, dass das in allen unseren bewussten Vollzügen implizierte dritte fundamentale Prinzip (oder die „ursprüngliche [primitive] Synthese“), sich unterteilt in zwei sekundäre Prinzipien, von denen das eine das theoretische Ich definierte und das andere das praktische Ich. 319 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte Die Deduktion des theoretischen Prinzips ist nun komplett vollendet. Dagegen bleibt das Prinzip des praktischen Ich noch im Zustand eines „problematischen Satzes.“, postuliert freilich durch das offensichtliche Spiel unseres Bewusstseins, aber noch nicht a priori deduziert. Wir müssen für dieses zweite Prinzip genau das tun, was wir gemacht haben für seine theoretische Entsprechung2 2 397 vergl. Grundlage W-L.; Grundl der Wissenschaft des Praktischen, S.246 Es sei also das erste Prinzip des praktischen Ich: „Das Ich setzt sich als das Nicht-Ich bestimmend 3 “ 3 zit. Op.S.246 Dieser Satz wie der parallele theoretische Satz versteckt eine ganze Skala von Antithesen, die reduziert werden müssen durch sukzessive Synthesen. Aber dieser Weg ist ganz schön lang; und ganz glücklicherweise schlägt Fichte selbst uns eine Abkürzung vor.4 4 zit. Op.S.247 Alle im praktischen Prinzip versteckten Antithesen sind beherrscht durch eine Haupt-Antithese, deren Auflösung uns die wesentlichen Züge des praktischen Ich liefern kann.5 5 ebenda Die Haupt-Antithese des praktischen Ich.– Bemühen wir uns zuerst, die zwei Terme dieser Antithese klar zu entwickeln. Um sie gut zu erkennen, muss man mit Fichte über dem praktischen Prinzip einen „höheren Standpunkt“ einnehmen, von woher dieses Prinzip selbst schon erscheinen wird, nicht mehr als ein ursprüngliches Prinzip sondern als die „notwendige Synthese“ eines fundamentalen Gegensatzes6 . 6 zit. Op.S.248 Das reine Ich ist wirklich Ich und es ist absolut kraft der Setzung, die es von sich selbst macht, das heißt unabhängig von einem Nicht-Ich. Das bewusste Ich ist Ich in gleicher Weise, aber es ist nur in Abhängigkeit von einem Nicht-Ich. Auf einer Seite Unabhängigkeit, von einer anderen Seite Abhängigkeit. In der „Identität des Ich“, das reine Ich (absolut) und das bewusste Ich, mit anderen Worten, die absolute Freiheit und die Intelligenz stehen sich kontradiktorisch gegenüber.1 1 zit. Op.S.248-249 Wie kann der Widerspruch behoben werden? Wir können nicht weder das absolute Ich unterdrücken – denn das wäre das Setzen dieser logischen Ungeheuerlichkeit, die sich das Nichts nennt, – noch das bewusste Ich – denn das wäre die Leugnung unserer kritischen Untersuchung selbst, im Moment wo wir sie ausführen. Ein einziges Element bietet eine Handhabe zu einer vermit- 320 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 398 telnden Distinktion: Die Abhängigkeit, die das Ich, bewusst geworden, betont angesichts des Nicht-Ich2 2 zit. Op.S.249 Diese „Abhängigkeit“ des Ich bezogen auf das Nicht-Ich hört auf, ein Skandal für den Geist zu sein, sobald man sie umformt in Abhängigkeit des Ich mit Bezug auf sich selbst, das heißt sobald man das Nicht-Ich als ein Produkt des Ich betrachtet. Das ist es, was wir weiter oben gemacht haben bei der Deduktion des theoretischen Ich. Das bewusste Ich – oder die Intelligenz – hängt also unmittelbar vom Nicht-Ich ab und mittelbar von der Ursache des Nicht-Ich, das heißt vom Ich. Auf diese Weise hängt das Ich definitiv nur von sich ab und der Widerspruch hört auf zu bestehen.3 3 zit. Op.S.249-251 Wir wollen uns auf eine „Kausalität des Ich für das Nicht-Ich“ berufen als synthetische Bedingung des Gegensatzes zwischen Freiheit und Intelligenz. Von diesem Stand unseres Beweises ab findet sich die Notwendigkeit eines „praktischen Ich“ virtuell bewiesen, denn was ist ein „praktisches Ich“ wenn nicht „das Ich, das sich setzt als Ursache des Nicht-Ich“ (Das Ich bestimmt das Nicht-Ich)4 4 zit. Op.S.250 Aber das Nicht-Ich, Produkt des Ich, kann nur im Ich gesetzt werden: außerhalb des Ich, wäre es „Ding an sich“, das heißt Nichts. „Das Nicht-Ich verursachen“ bedeutet also für das Ich, sich teilweise verneinen, das heißt sich „zerteilen“ oder sich „begrenzen“. Hier erscheint die große Antithese, die das Prinzip des praktischen Ich einschließt (“Da Ich setzt sich als das Nicht-Ich bestimmend“): Wenn dieses Prinzip wahr ist – und wir wissen schon, dass es das sein muss – bringt die radikale Identität des Ich, die sich setzt und sich verneint beides zugleich, die gleichzeitige Wahrheit dieser zwei widersprechenden Sätze mit sich: „Das Ich setzt sich als Unendliches und Unbegrenztes“ (reine Aktivität [=Handlung] des Ich) „Das Ich setzt sich als endlich und begrenzt“ (objektive Aktivität [=Handlung] des Ich)5 5 399 zit. Op.S.255 Synthese des „unbestimmten Strebens“. – Wenn wir nicht einen Ausweg entdecken aus dieser logischen Sackgasse, müssten wir, so beobachtet Fichte, uns abfinden mit dem Widerspruch und uns mit dem Spinozismus1 abfinden. 1 zit. Op.S.255 Nun aber (Es ist interessant, das zu beachten), sieht Fichte nur einen Ausweg, der erlaubt, dem spinozistischen Monismus zu entkommen. Wir haben ihn schon mehr als einmal in diesen Seiten signalisiert: die „aktive Finalität“ oder das „Streben2 “. 321 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 2 zit. Op.S.261 Um in der Identität von einem und demselben aktiven Ich die unbeschränkte „reine Handlung“ und die beschränkte3 „objektive Handlung“ vereinen zu können, so beweist er, ist es nötig, dass die erstere (die „reine Handlung“) das Unendliche im Ich setzt, zwar nicht als einen aktuellen Zustand, aber als ein zu realisierendes Ziel. Und es ist nötig, infolgedessen, dass das zweite (die „objektive Handlung“) das Endliche setzt oder die „Begrenzung“ im Ich, nicht als ein Ziel an sich, sondern als eine aktuelle Etappe auf das Ziel zu. Das kommt darauf hinaus zu sagen, dass die Handlung des Ich sein muss – ständig – unendlich als Streben und endlich als aktuelle Realisierung, mit anderen Worten, dass sie ein „unbegrenztes [indefinites] Streben“ sein muss (ein „unendliches Streben4 “) 400 3 zit. Op.S.256-257 4 zit. Op.S.261 Außerhalb ihrer Synthese im indefiniten Streben stoßen sich unbegrenzte Handlung und eingeschränkte Handlung widersprüchlich. Man möge nicht aus den Augen verlieren die exakte Tragweite der Deduktion, die gerade gemacht wurde. Sie besteht nicht darin, zu behaupten, dass die reine Handlung, in sich betrachtet, präzisive (= was sie weiter präzisiert) nicht möglich sei als unter der Form des Strebens. Sie sagt nur, dass die reine Aktivität, um Intelligenz zu werden, das heißt, um sich „auf ein mögliches Objekt zu beziehen“, die Form eines unendlichen Strebens annehmen muss. Dieses (das „Streben“) erscheint also, nicht wie die Bedingung der Möglichkeit an sich des absoluten Ich sondern als die „Bedingung der Möglichkeit jedes objektiven Gedankens5 “, anders gesagt, als die eminente Bedingung der Möglichkeit des theoretischen Ich. Das „theoretische Ich“ ist also (kausal) untergeordnet einem „praktischen Ich“, das sich ausdrückt durch ein „unendliches Streben“. 5 zit. Op.S.261-262 Deduktion des Anstoßes.– Aber ein „Streben“, ein Bemühen setzt einen zu überwindenden Widerstand voraus, ein zu bezwingendes Hindernis: „Dem nicht widerstrebt wird, ist kein Streben6 “. 6 zit. Op.S.270 Wie diesen „Widerstand“ im Ich verstehen? Da er vom Ich hervorgebracht sein muss, kann er nur eine Form der Handlung (Aktivität) des Ich sein; und die einzige Form der Aktivität des Ich, die hier einen Widerstand schaffen kann,wäre eine Umkehrung der Richtung, eine Kehrtwendung dieser Aktivität: nennen wir das technische Wort: eine „Reflexion“. Wir finden hier den reflektierenden, spiegelnden „inneren Schock“ wieder, das Anfangs-Hindernis, den Anstoß, von dem weiter oben die Rede war1 . „Es ist nötig, sagt Fichte, dass die unendliche zentrifugale Aktivität des Ich ange- 322 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. stoßen wird in irgendeinem Punkt und auf sich selbst zurückgedrängt wird2 “ 1 Seite 382 ff 2 zit.Op. S. 275 Originaltext siehe Anmerkung 4 Prüfen wir den Zustand der Dinge genau in dem Punkt wo, im Ich, das „dynamische Hindernis“ (der Anstoß) gesetzt ist, der die notwendige Bedingung eines Strebens ist. Wenn die Aktivität des Ich in diesem Punkt vollständig neutralisiert wäre, das heißt gleich und entgegengesetzt zum Widerstand, würde das „Streben“ nicht existieren, und wir fänden uns entweder vor dem Fall eines göttlichen Seins, das sich adäquat selbst reflektieren würde entsprechend der – für uns undenkbaren – Weise einer absoluten Identität von Bewusstsein und Objekt3 oder vor dem Fall des leblosen Gleichgewichts zweier gleicher und entgegengesetzter materieller Kräfte, die sich blockieren und sich gegenseitig annihilieren. Aber dieser Fall ist der Grenzfall, in sich nicht realisierbar, der die reine Materie definiert: die reine Materie, die reine konkrete Quantität kann nicht als solche existieren. 401 3 zit.Op. S.275 Originaltext siehe Anmerkung 4 [weiter unten] Wenn es im Ich „Streben“ gibt, ist es also notwendig, dass das aktuelle Hindernis, das es auftauchen lässt, durch es auf eine gewisse Weise übertroffen wird. Es muss die „zentrifugale“ Aktivität des Ich, die teilweise durch die „zentripetale“ Aktivität der ursprünglichen Reflexion (= durch das Nicht-Ich) im Gleichgewicht gehalten wird, sich trotzdem weiter ausbreiten, sicherlich nicht als ein bestimmter Akt, sondern wie eine „Virtualität (Wirkfähigkeit)“, wie ein „aktiver Anspruch“ [=Forderung]4 . Und da das „Streben“ hier indefinit ist, muss die „Virtualität“, die das Hindernis überwindet, in gleicher Weise indefinit sein, das heißt, jedem bestimmten Hindernis überlegen. 4 Forderung zit.Op. S.274-275 Originaltext: 274 Grundlage ... ist der Körper für uns leblos und seelenlos, und kein Ich. Das Ich soll sich nicht nur selbst setzen für irgend eine Intelligenz außer ihm, sondern es soll sich für sich selbst setzen; es soll sich setzen als durch sich selbst gesetzt. Es soll demnach, so gewiss es ein Ich ist, das Prinzip des Lebens und des Bewusstseyns lediglich in sich selbst haben. Demnach muss das Ich, so gewiss es ein Ich ist, unbedingt und ohne allen Grund das Prinzip in sich haben, über sich selbst zu reflectieren; und so haben wir ursprünglich das Ich in zweierlei Rücksicht, theils, inwiefern es reflektierend ist, und insofern ist die Richtung seiner Thätigkeit centripetal; theils inwiefern es dasjenige ist, worauf reflektiert wird, und insofern ist die Richtung seiner Thäzigkeit centrifugal, und zwar centrifugal in die Unendlichkeit hinaus. Das Ich ist gesetzt als Realität, und indem reflectiert wird, ob es Realität habe, wird es nothwendig als Etwas, als ein Quantum gesetzt; es ist aber gesetzt als alle Realität, mithin wird es nothwendig gesetzt als ein unendliches Quantum, als ein die Unendlichkeit ausfüllendes Quantum. Demnach sind centripetale und centrifugale Richtung der Thätigkeit beide auf die gleiche Art im Wesen des Ich gegründet; sie sind beide Eins und ebendasselbe, und sind bloss insofern unterschieden, inwiefern über sie, als unterschiedene, reflectiert wird – (Alle centripetale Kraft in der Körperwelt ist blosses Produkt der Einbildungskraft des Ich, nach einem Gesetz der Vernunft, Einheit in die Mannigfaltigkeit zu bringen, wie sich zu seiner Zeit zeigen wird.) Aber die Reflexion, wodurch beide Richtungen unterschieden werden könnten, ist nicht möglich, wenn nicht ein drittes hinzukommt, worauf sie bezogen werden können, 323 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte oder welches auf sie bezogen werden könne. – Der Forderung (wir müssen immer etwas voraussetzen, das noch nicht nachgewiesen ist, um uns auch nur ausdrücken zu können; denn der Strenge nach ist bis jetzt noch gar keine Forderung, als Gegentheil des wirklich geschehenden, möglich) der Forderung, dass im Ich alle Realität seyn solle, geschieht unter unserer Voraussetzung Genüge, beide Richtungen der Thätigkeit des 275 Ich, die centipetale und centrifugale, fallen zusammen, und sind nur Eine und ebendieselbe Richtung (Setzet zur Erläuterung, das Selbstbewusstsyn Gottes solle erklärt werden, so ist dies nicht anders möglich, als durch die Voraussetzung, dass Gott über sein eigenes Seyn reflectire. Da aber in Gott das reflectirte Alles in Einem und Eins in Allem, und das reflectirende gleichfalls Alles in Einem und Eins in Allem seyn würde, so würde in und durch Gott reflectirtes und reflectirendes, das Bewusstseyn selbst und der Gegenstand desselben sich nicht unterscheiden lassen, und das Selbstbewusstseyn Gottes wäre demnach nicht erklärt, wie es denn auch für alle endliche Vernunft, d.i. für alle Vernunft, die an das Gesetz der Bestimmung desjenigen, worüber reflectirt wird, gebunden ist, ewig unerklärbar und unbegreiflich bleiben wird.) So ist demnach aus dem oben vorausgesetzten kein Bewusstseyn abzuleiten: denn beide angenommene Richtungen lassen sich nicht unterscheiden. Nun aber soll die ins unendliche hinausgehende Thätigkeit des Ich in irgend einem Punkte angestossen und in sich selbst zurückgetrieben werden; und das Ich soll demnach die Unendlichkeit nicht ausfüllen. Dass dies geschehe, als Factum, lässt aus dem Ich sich schlechterdings nicht ableiten, wie mehrmals erinnert worden; aber es lässt allerdings sich darthun, dass es geschehen müsse, wenn ein wirkliches Bewusstseyn möglich seyn soll. Jene Forderung des in der gegenwärtigen Funktion reflectirenden Ich, dass das durch dasselbe reflectierte Ich die Unendlichkeit ausfüllen solle, bleibt, und wird durch jenen Anstoss gar nicht eingeschränkt. Die Frage, ob es dieselbe ausfülle, und das Resultat, dass es dieselbe wirklich nicht ausfülle, sondern in C begrenzt sey, bleibt – und erst jetzt ist die geforderte Unterscheidung zweier Richtungen möglich. Nemlich nach der Forderung des absoluten Ich sollte seine (insofern centrifugale) Thätigkeit hinausgehen in die Unendlichkeit; aber sie wird in C reflectirt, wird mithin centripetal, und nun ist durch Beziehung auf jene ursprüngliche Forderung einer ins unendliche hinausgehenden centrifugalen Richtung Das Reale und das Ideale im Gesichtspunkt des praktischen Ich. – So ist der Stand der Dinge im Ich bezüglich des ursprünglichen Hindernisses von beiden Seiten her. Wie stellt sich dieser Stand der Dinge dar – nicht mehr für einen fremden Beobachter – sondern für das Ich selbst? Denn alles, was das Ich hervorbringt „in sich“ muss auch „für sich“ produziert sein und das Objekt einer Reflexion werden. Für die Reflexion erscheint die unbegrenzte „Virtualität“ oder die Forderung, die dem unbegrenzten Überschuss an fundamentaler Aktivität des Ich entspricht, notwendigerweise wie „etwas, was noch nicht realisiert ist, aber sich realisieren muss“, das heißt wie ein ideales Ziel. Dagegen erscheint der Teil der Aktivität, der das Hindernis überspringt, das heißt die „objektive Aktivität“, wie etwas im Ich und für das Ich aktuell Gesetztes, oder mit anderen Worten, wie ein reales Objekt. So findet sich im bewussten Ich die doppelte Reihe des Realen und des Idealen, das Reale, das den ganzen Bereich der Aktivität des über sich selbst reflektierten Ich und so etwas „für das Ich“ Gewordenen bezeichnet, das Ideale, das den Bereich der direkten, noch nicht reflektierten Aktivität des Ich bezeichnet, einer indefiniten aber rein virtuellen Aktivität, die „im Ich“ ist, ohne „für das Ich“ zu sein: Diese geht über in den Akt nur, indem sie sich 324 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. 402 reflektiert und im selben Maße wird das Ideal, das sie setzte, Realität1 1 zit.Op. S.277 Das „indefinite Streben“, einzige konzipierbare Form der Aktivität eines Ich, besteht also in dem indefiniten Bemühen, das Reale für das Ideale zu ersetzen, um das Absolute „an sich“ durch ein Absolutes „für sich“, das reine Ich in ein totales Bewusstsein, die Freiheit in Intelligenz zu transformieren. Alle diese Ausdrücke sind äquivalent: sie stützen sich auf das „Aktiv-Werden“, der einzigen konzipierbaren Form des bewussten Ich, und definieren, von diesem zentralen Standpunkt aus, die zwei Perspektiven, die das Werden eröffnet: Nach Rückwärts die Perspektive auf ein Prinzip (Grund); nach Vorwärts die Perspektive auf ein Ziel. Das Prinzip nennen wir das reine Ich. Es muss absolut erstes und unabhängig sein, es ist also Freiheit; sie ist nicht ein Akt sondern eine Forderung eines Aktes: nun aber ist eine Forderung, die sich der Freiheit auferlegt, definitionsgemäß ein Sollen. Andererseits ist das Ziel, so wie es im Inneren des unendlichen Werdens erscheint, korrelativ zum Prinzip. Es ist „das was sein soll“; es hat im sich entwickelnden Ich nicht und kann nicht haben eine andere Aktualität als die einer Idee; verwirklicht wäre es die absolute Aktualität des Bewusstseins2 2 vergl. zit.Op. S.277 Wenn das so ist, präzisiert sich der Sinn des ersten fundamentalen Prinzips, das wir am Anfang formuliert haben. Zu sagen, dass „das Ich sich selbst absolut setzt“ kommt darauf zurück, die absolute logische Priorität eines „Sein Sollens“ zu behaupten (affirmieren), das die Treibkraft selbst des unendlichen Werdens des Bewusstseins ist. Dieses „Sein Sollen“ hat andererseits keine aktuelle Realisierung als die Sukzession selbst der Etappen des „bewusst Werdens“. Das Ich setzt sich wirklich (für uns) nur in diesem „Werden“. 403 Und wir können, nach diesem, sehen, welche Beziehung den Anfangs-Anstoß mit dem reinen Ich verbindet. Wenn das „reine Ich“ nur das im indefiniten Streben implizierte absolute Sollen ist, hängt der Anstoß von diesem absoluten Sollen nicht durch physische Notwendigkeit ab, da dieses Sollen gar kein aktuelles Sein ist, sondern durch moralische Notwendigkeit. Die absolute Aufgabe des Ich verlangt das freie Faktum des Anstoßes als erste Bedingung seiner Ausführung. Denn nur durch den Anstoß reflektiert sich das Ich, setzt sich ein Objekt entgegen und wird sich seiner bewusst im Objekt. Wir haben so nebenbei durch das praktische Ich die Deduktion dieses Anstoßes fertiggestellt oder dieser ursprünglichen Reflexion, die das theoretische Ich voraussetzte aber nicht erklärte. Es wird uns jetzt leichter sein, eine Gesamtschau des Systems von Fichte anzustellen. 325 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte §3.e) Gesamtschau der Wissenschaftslehre 404 Nichts ist wirklich, nur das Ich; und das Ich hat keine andere mögliche Realität als seine Aktivität selbst. Nun aber ist die Aktivität des Ich – soweit sie einen Sinn hat für unsere Augen: „für uns“ – ganz und gar eingeschlossen im unendlichen Werden des Bewusstseins. Dieses Werden, betrachtet in seinem absoluten Prinzip, offenbart sich als ein reines Sollen, das heißt die reine Setzung einer Freiheit ohne definiertes Objekt (erstes fundamentales Prinzip – reines Ich). Das absolute Prinzip verschmilzt also mit dem absoluten Anfang der Moralität, im kantschen Sinne dieses Ausdrucks. Jede Evolution – praktisch und theoretisch – des Ich hat also zutiefst einen moralischen Charakter. Wie tritt dieses absolute Sollen (das nur realisierbar ist im bewussten Werden) in aktuellen Vollzug? mit anderen Worten, wie gibt sich die reine Freiheit ein Objekt? Denn ein Sollen muss eintreten in Vollzug und eine Freiheit muss sich ein Objekt geben. Ein reines Sollen kann sich nur erfüllen, indem es sich „definiert“, indem es sich eine „Form“ auferlegt. Ebenso kann die reine Freiheit ein „Objekt“ nur haben, indem sie sich ein Handlungsfeld schafft, das heißt, indem sie sich einen „Widerstand“ in den Weg legt, den sie überwinden könnte (zweites fundamentales Prinzip – Nicht-Ich). Nun aber gibt es nur eine Art für eine „reine Aktivität“ – wie es das reine Sollen oder die Freiheit ist – Sich selbst eine Grenze (Form oder Objekt) zu setzen: nämlich: das sich auf sich selbst Reflektieren (ursprüngliche Reflexion: Anstoß ). Aber ist diese Anfangs-Reflexion total oder partiell? Die totale Reflexion des Ich auf sich selbst würde uns reduzieren (entsprechend unserer notwendigen und vielleicht unvollkommenen Art und Weise zu denken) auf die absolute Identität des reinen Sollens und seiner Form, der reinen Freiheit und ihres Objekts, das heißt auf die Anfangs Position des reinen „Sollens“. Wir würden auf der Stelle treten in der leeren Affirmation des absoluten Prinzips. So muss also die Anfangs-Reflexion, die vom Sollen postuliert wird, partiell sein (Drittes fundamentales Prinzip). Aber jede partielle Reflexion des reinen Ich setzt dieses als „begrenzt“ oder „bestimmt“ durch ein Nicht-Ich. Wir stoßen hier auf die erste Phase des Bewusstseins, das Prinzip des theoretischen Ich. Tatsächlich haben wir weiter oben durch eine strenge Deduktion gezeigt, dass die partielle Reflexion des Ich die ganze Hierarchie der Funktionen des Bewusstseins einschließt bis zum „Selbstbewusstsein“ inklusive. So wird also die „reine freie Aktivität“, indem sie sich reflektiert und indem sie sich ein Objekt schafft, Bewusstsein und selbst Intelligenz. Der Anfangsmoment dieses theoretischen Prozesses entspricht dem„ was wir genannt haben: „Produktive Vorstellungskraft“. 326 II.–Der transzendentale Idealismus von Fichte. Aber durch diese ursprüngliche Reflexion selbst, direkter Ausdruck einer moralischen Notwendigkeit, hat das unbestimmte Sollen – Sein Sollen oder Handeln Sollen – eine definierte Form angenommen und ist Streben geworden; oder, wenn man will, die reine Freiheit ist einem Hindernis begegnet und hat sich verbunden in einem Bemühen. Von da an ist es wahr, zu sagen, dass „das reine Ich sich setzt als das Nicht-Ich bestimmend“. Wir erkennen hier das Prinzip des praktischen Ich wieder, dieses praktischen Ich, dessen fundamentale Form das Streben ist. 405 Welches Objekt verfolgt das Streben? Notwendigerweise ein unendliches Objekt, da das aktive Prinzip des Strebens (das reine Ich, das absolute Sollen) unbegrenzt ist. Aber dieses unendliche Objekt (= das reine Ich, sich setzend als ideales Ziel ) kann nur verfolgt werden durch endliche Bestimmungen, gestaffelt in einem kontinuierlichen Milieu, was ein in der Verwirklichung des Strebens sukzessives Werden verlangt. Es ist also nötig, dass das Streben die im Ich auftauchenden Hindernisse eines nach dem anderen überwindet; mit anderen Worten, das Streben muss sich die dem Ich durch die „produktive Vorstellungskraft“ aufgezwungenen „Bestimmungen“ sukzessive assimilieren. Worin besteht also dieser Sieg über das Hindernis, diese Assimilation? In der „Reflexion“, die dem Ich die „Bestimmungen“ wiedergibt, die sich ihm zu widersetzen schienen; sagen wir es kürzer: im „Bewusstsein“ dieser „Bestimmungen“. Das praktische Ich (Tendenz, Streben) „verwirklicht“ sich also in und durch das theoretische Ich, indem es dieses dazu bringt, die Etappen ohne Ende zu überschreiten, die es weiterleiten zum absoluten Bewusstsein. In diesem absoluten Bewusstsein hätte das Ich die Totalität seiner möglichen Bestimmungen integriert und hätte also das Nicht-Ich erschöpft. Reines „Sollen“ am Anfang wäre es am Ende „absolute Realität“ geworden; aber muss man wiederholen, dass das absolute „Prinzip“ und „Ziel“ für uns keine andere „Realität“ haben als die des Werdens selbst, dessen rationale Bedingungen sie sind? Das ganze System von Fichte in der Wissenschaftslehre reduziert sich auf folgendes: gib mir das Bewusstsein (das aktuelle Denken) und ich führe es zurück, durch Analyse auf eine Setzung und auf eine Reflexion, auf eine reine Aktivität (Handlung) und einen Anstoß ; gib mir eine reine Aktivität (Handlung) und einen Anstoß, eine Setzung und eine Reflexion und ich baue das Bewusstsein wieder daraus auf. Wenn es wahr ist, dass nichts existiert für uns außerhalb des Bewusstseins, liefert uns Fichte die Erklärung der totalen Realität. Und jede weitere Forderung von unserer Seite unterschlägt, versteckt die völlig utopische Hypothese eines darüber Hinaus der Realität. Wir sagen: „wenn für uns nichts existiert außerhalb des Bewusstseins“, das heißt, wenn in uns keine Fähigkeit existiert, die fähig ist, auch den Rahmen des Wissens zu durchbrechen .. 327 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte §1.–Der Begriff des absoluten Ich 406 Mehr als ein Missverständnis macht das intellektuelle Verstehen des Systems von Fichte fasst unmöglich für Philosophen, die ungenügend vertraut sind mit dem kritischen Gesichtspunkt. Wir können hoffen, dass unsere Darlegung, die sich auf die vorausgehende Studie der kantschem Kritik stützt, jedem ein wenig seriösen Irrtum vorbeugt. Man möge uns dennoch erlauben, auf dem Sinn des fundamentalen Begriffs des absoluten Ich zu insistieren. Und erinnern wir uns zuerst an das, was das absolute Ich (oder das reine Ich) nicht ist und nicht sein kann. Was das absolute Ich nicht ist.– Es kann evidenterweise, in sich genommen, nicht ein definiertes Objekt konstituieren, das heißt dieses „etwas“ an Statischem und Erstarrtem, das in unserem Bewusstsein das Attribut des Seins erhält (ens) Tatsächlich leitet sich alles das, was für uns den Charakter des Objekts oder des Seins präsentiert, schon ab vom Prinzip der Reflexion (zweites fundamentales Prinzip). Nun aber setzt sich das reine Ich im Voraus zu jeder Reflexion. Man würde sich also täuschen, wenn man das reine Ich von Fichte entweder mit dem allgemeinsten objektiven Begriff (dem abstrakten und univoken Begriff des Seins, des ens univocum), oder mit der einfachen Idee des Unendlichen oder des Absoluten im cartesischen Sinn identifiziert. Denn das abstrakte Sein ebenso wie die absolute Idee leiten sich ab von der Reflexion des reinen Ich: das abstrakte Sein ist ein erster bewusster, noch unbestimmter Moment dieser Reflexion und die absolute cartesische Idee wäre die Vollendung dieser im vollkommenen Bewusstsein. Auch die absolute Substanz von Spinoza – absolute objektive Idee – entspricht übrhaupt nicht dem reinen Ich von Fichte: Sie kann nur ein „Absolutes der Reflexion“ sein, während das reine Ich behauptet, vor der Reflexion und auf absolute Weise absolut zu sein. Kurz, das Merkmal des reinen Ich kann für uns kein Objekt bezeichnen, da das Objekt nur auftaucht in Gegenüberstellung zu einem Subjekt, das heißt durch Reflexion des Ich. Wäre dann also das reine Ich ein Subjekt? Die Frage muss distinguiert werden. Ganz zu erst bezeichnet das reine Ich überhaupt nicht das schon begrenzte Subjekt, das unser Ich für jeden ist. Tatsächlich repräsentiert unser personales Ich, ob wir es als kritisches Subjekt oder als ontologisches Subjekt betrachten, 328 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte 407 in jedem Fall, in der allgemeinen Entwicklung des reinen Ich eine spätere Stufe für die absolute Reflexion. Denn jedes partikuläre Ich hat sich durch Entgegensetzung nicht nur dem absoluten Ich gegenüber sondern einer Unendlichkeit von partikulären Ausdrücken des absoluten Ich gegenüber konstituieren müssen. Die „Wissenschaftslehre“ könnte also nicht als Solipsismus und noch weniger als Subjektivismus bezeichnet werden, im gewöhnlichen Sinn dieses Wortes. Zu behaupten, dass das persönliche Ich das einzige und letzte Prinzip der Gesamtheit der bewussten Objekte sei, wäre unter sehr vielen Hinsichten ein Unsinn in der Philosophie von Fichte. Schlimmer noch, wenn man sich auf der Ebene unterhalb der Realität aufhält, wo die individuellen „Iche“ schon konstituiert sind – und es ist unter diesem Gesichtspunkt allein, dass man von Solipsismus sprechen könnte – hat das System von Fichte ganz den Anschein eines sehr betonten Realismus: Das Objekt auferlegt sich dort tatsächlich ursprünglich dem individuellen Ich als realer Effekt eines Nicht-Ich; oder wenn man will, die allgemeine Aktivität des reinen Ich, weit davon entfernt, sich dem Nicht-Ich durch die Vermittlung des persönlichen Ich mitzuteilen, teilt sich wirklich auf zwischen diesem Ich und dem Nicht-Ich. Vielleicht würde es genügen, um die Zahl der Vorurteile zum Verschwinden zu bringen, die gewöhnliche Terminologie von Fichte leicht zu verändern. Das Beispiel von ihm und später von Hegel autorisieren das von anderer Seite her. Man könnte zum Beispiel, indem man den Ausdruck „Ich“ für das individuelle und persönliche Ich eines jeden reserviert, das reine Ich: „absolutes Sein“ oder besser „absoluter Geist“ nennen. Dass der Geist am Anfang aller Dinge sei und selbst der Materie, das ist die fundamentale These der orthodoxesten Metaphysiken: Wird nicht der „erste Motor“ von Aristoteles das reine Denken genannt, der Geist par excellence: ? Aber ein Punkt wurde vielleicht durch die Philosophie Fichtes in helleres Licht gesetzt als durch die antiken Metaphysiker: wir möchten sagen, dass der absolute Geist, weit davon entfernt, sich uns von außen aufzuerlegen, auf dem Weg der Sinne, sich im Gegenteil (unserem Bewusstsein) manifestiert nur in dem Maße, wie er uns seine aktive Immanenz verspüren lässt: wir berühren ihn nur in uns selbst, als die tiefste Bedingung unserer persönlichen Aktivität, als die dauernd sprudelnde Quelle unseres Ich und selbst eminenterweise ein Ich. Es ist also ganz evident, dass das reine Ich in der Sprache von Fichte nicht unsere partikuläre Subjektivität, unser persönliches Ich, im begrenzenden Sinn des Ausdrucks bezeichnet. Bezeichnet er also das „absolute Subjekt“? Notwendigerweise Ja, in einem gewissen Sinn; Aber man muss sich verständlich machen. No sewc nìhsic 408 329 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte Das absolute Ich ist ein „transzendentales Ich“, wenn die „Wissenschaftslehre“ in Wahrheit ein absolutes Subjekt postuliert1 . – sie geht nicht soweit, davon das metaphysische „an sich“ zu definieren. Es ist noch nicht, im eigentlichen Sinn, ein „absoluter Idealismus“, sondern nur ein „transzendentaler Idealismus“. 1 Man darf nicht vergessen, dass das absolute Subjekt in der Terminologie von Fichte nichts mehr an Unvollkommenheit eines „Suppositums“ hat. Es ist genau das einzige Subjekt, bei dem die „Form“ und das „Suppositum“ sich in der reinen Aktivität identifizieren. Das absolute Subjekt ist das, was „existiert durch die Setzung selbst, die es von sich macht“. 409 Was ist dazu zu sagen? Wir kennen schon durch die Untersuchung des Kantismus den technischen Sinn des Wortes „transzendental“ in der kritischen Philosophie. Der Idealismus von Fichte behauptet nur, das absolute Subjekt zu bejahen (affirmieren) als „transzendentale Bedingung“, das heißt unter dem Titel der Bedingung a priori des Bewusstseins. Kant erhob die transzendentale Apperzeption oder die reine Apperzeption zur höchsten Bedingung jedes Bewusstseins. Diese reine Apperzeption musste zugleich Aktivität (Handeln) und Form, aktive Spontaneität und Form der Einheit sein. Fichte hat, wie wir oben festgestellt haben, die höchste Bedingung der Apperzeption voll anerkannt; dennoch, wenn er darin wie Kant das erste konstitutive Element a priori des Bewusstseins sieht, begegnet er darin noch nicht dem absolut ersten Prinzip, das ein idealistischer Monismus verlangt. Die Dualität der Aktivität und der Form im Inneren der reinen Apperzeption verlangt nach einer weiteren Reduktion: Die „Form“ selbst muss sich mit der „Aktivität“ als ihrem Prinzip in Zusammenhang bringen, was nur möglich ist, indem man die „Form“ zurückführt darauf, dass sie nichts anderes ist als eine reine „Reflexion“ der Aktivität auf sich selbst. Muss man hier erinnern an die reziproke (wechselseitige) Gegenüberstellung und die einseitige Abhängigkeit des ersten und des zweiten fundamentalen Prinzips der „Wissenschaftslehre“? Die reine kantsche Apperzeption gehört also schon zur Ebene der Reflexion; das reine Ich von Fichte präsentiert sich als die Bedingung a priori der reinen Apperzeption selbst, wie die absolute Setzung, die von jeder Reflexion vorausgesetzt wird. Das reine Ich ist eher als das reine apperzeptive Ich (reflektiertes Ich.) wie das Hervorquellen früher ist als der gebildete Strahl, wie die Bewegung vor der durchlaufenen Bahn, wie das aktive Werden vor dem vollendeten Sein, wie das Sollen vor der Handlung. Aber man kann nicht vergessen, dass das reine Ich uns nur erscheint durch die reine Apperzeption hindurch, das heißt durch die ursprüngliche Reflexion, was wiederum heißt, eingehüllt in die für jede bewusste Manifestation wesentliche Relativität. Das was sie an sich und für sich ist, wie können wir das wissen, weil jedes „Wissen“, jede „logische Wahrheit“ die Relation von Objekt zu Subjekt impliziert? Ebenso ist für uns die Reflexion als solche (das Wissen) die „ratio cognoscendi [=Grund des Erkennens]“ des reinen Ich, welches uns erscheint als die „ratio essendi [=Grund des Seins]“ der Reflexion; aber 330 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte 410 auf keine Weise ist für uns das reine Ich die „ratio cognoscendi [Grund des Erkennens]“ der Reflexion, wie es ein deduktiver absoluter Idealismus fordern würde. Wenn man das Äquivalent des reinen Ich von Fichte mit, den scholastischen Philosophen vertrauteren, metaphysischen Termen, ausdrücken müsste, würden wir sagen, indem wir einen schon verwendeten Ausdruck wiederholen, dass das reine Ich, so wie es uns in der Wissenschaftslehre erscheint, nichts anderes ist als die schöpferische Potenz wiedererkannt in der schöpferischen Handlung, das geoffenbarte schöpferische Fiat durch das Verbum in der objektiven Schöpfung. Nicht schon durch das Verbum, göttliche Person, so wie es seit Ewigkeit im Inneren Gottes ist, nach der Lehre der christlichen Theologie, sondern durch das Verbum konzipiert als aktuelles Prinzip der indefiniten (unendlichen) Entäußerung Gottes in den Dingen , oder wenn man es vorzieht, durch das Verbum konzipiert als aktive und absolute Finalität des Universums, als „natura (actu) naturans“ (vergl. Scotus Eriugena, hl. Thomas und Spinoza). Es ist wohl diese „schöpferische Virtualität“ oder diese „aktive absolute Finalität“, deren Anfangs-Bewegung sich fortsetzend und multiplizierend durch die sukzessiven Reflexionen die zwei entgegengesetzten und parallelen Reihen des Ich und des Nicht-Ich staffelt. Einerseits die Reihe der subjektiven Aktivitäten des Bewusstseins und andererseits die Reihe der „Dinge“, Objekte dieser Aktivitäten. Auch zu sagen, dass wir Objekte kennen, reduziert sich exakt darauf zu sagen, dass das reine Ich oder die schöpferische Potenz sich partiell sich selbst entgegenstellt und sich so Objekte auf dem eingeschränkten Theater unseres persönlichen Ichs gibt. Aber diese idealistische Konzeption der Einheit der Welt der Intelligenz und der Welt der Objekte ruft große Probleme hervor. Wir können sie zusammenfassen in der folgenden Frage: Ist die Philosophie von Fichte ein Monismus oder ein Dualismus? Ist sie ein Monismus oder ein Dualismus in der relativen Ordnung der Reflexion (psychologischer Monismus oder Dualismus)? Ist sie ein integraler Monismus oder Dualismus (absoluter Monismus oder Dualismus)? §2.–Monismus oder Dualismus? §2.a) Psychologischer Monismus oder Dualismus? Zweifellos gibt sich der Idealismus aus als einen psychologischen Monismus: nachdem einmal das Anfangsprinzip des Bewusstseins aufgestellt ist, die Reflexion, muss sich jedes Objekt daraus ableiten seiner Materie nach ebenso wie seiner Form nach. Trotzdem muss man ab sofort zwei Möglichkeiten des Sinns dieser Formel unterscheiden. Wenn die Deduktionen von Fichte streng (peinlich genau) sind, wissen wir 331 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 411 412 gewiss, dass sich alles ohne Ausnahme aus der Reflexion des reinen Ich (oder der Äußerung der schöpferischen Potenz) herleiten muss. Das reflektierte reine Ich (oder die schöpferische Potenz im Akt) muss also ebenso gut die „Materie“, die unsere Erkenntnis ausfüllt hervorbringen, als auch die Hierarchie der – der sinnlichen und der kategorialen – „Formen a priori“ dieser Erkenntnis. Dieser ersten Behauptung (Affirmation) widerspricht die traditionelle Metaphysik gar nicht, da sie ihrerseits die universelle Abhängigkeit des Verstandenen und der Dinge in Bezug auf den höchsten Geist, Gott verkündet. Aber das Problem hat einen zweiten, mehr bezweifelbaren Aspekt. Fichte macht die Behauptung des psychologischen Monismus abhängig von der dialektischen Bewegung, durch welche mein denkendes Ich (das heißt, meine menschliche, begrenzte Intelligenz) vollzöge, vollständig a priori (das heißt nach einer Methode von strenger Immanenz), die totale Deduktion des Objekts, Materie und Form, ausgehend vom Ausgangsprinzip des Bewusstseins (der reinen Reflexion des Ich, des ursprünglichen Anstoßes). Es wäre durchaus gerechtfertigt, sich zu fragen, bis zu welchem Punkt diese „Deduktion des Objekts“ dem menschlichen Geist möglich ist. Zuerst darf man nicht vergessen, dass diese Deduktion des Objekts bei Fichte sich vollzieht ausgehend vom Anstoß, das heißt ausgehend vom sich reflektierenden Ich: der Anstoß selbst ist nur deduziert unter dem Titel der „moralischen Notwendigkeit“ oder des „notwendigen Mittels, um das reine Ich zum Bewusstsein seiner selbst zu erheben“, das heißt ausgehend von einer schon komplexen „ratio cognoscendi [=Erkenntnisgrund]“. Aber entwickelt sich die Deduktion, ausgehend von diesem ursprünglichen Dualismus wenigstens ohne Lücke und ohne fremde Anleihe? Es scheint, dass es nicht so ist. Die ganze materielle Vielfalt der Objekte leitet sich gewiss, man beweist es, her von einer in der Reflexion des reinen Ich gesetzten Anfangs Vielfalt. Aber wie sind daraus die kontingenten Formen der Anfangsvielfalt abzuleiten? Wenn man weiß, dass sich eine Reflexion des Ich produzieren muss, um das Bewusstsein zu realisieren, können wir a priori nicht einmal ahnen, warum diese Reflexion eher so beschaffen sein muss als irgendwie anders. Wir deduzieren also die „Materie im Allgemeinen“; aber die konkrete Vielfalt der Materie entgeht unserer Deduktion. Weiter, die Deduktion a priori vom Raum und der Zeit, die von Fichte ausdrücklich vorgeschlagen wurden, lässt uns keine Schwierigkeit machen. Vielleicht war Kant zu zaghaft, wenn er den Raum und die Zeit als „formartige Gegebenheiten“ behandelt, deren Deduktion uns völlig unzugänglich wäre. Aber ist es wahr, wie Fichte will, dass die Quantität und die Zeit notwendige rationale Konsequenzen der ursprünglichen (=primitiven) Reflexion sind? Lassen wir gelten, dass diese Reflexion eine „Begrenzung“ im Ich setzt, dann haben wir, gerade durch diese Tatsache im Prinzip „Vielfältigkeit“ grundgelegt. Aber nicht jede Multiplizität ist notwendig eine „quantitative Vielfältigkeit“ 332 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte 413 [im Deutschen = Vervielfältigbarkeit]; wenn man die reine Vielfalt „Quantifizierbarkeit“ nennen will, kann das also nur sein im Sinne einer „übergeorneten Gattung“, von der die „Quantität“ eine „untergeordnete Gattung“ wäre. Der Begriff der „Begrenzung“ impliziert direkt nur die Zerrüttung, den Untergang der absoluten Einheit, das heißt die „metaphysische Kontingenz“, was von sich her „Vielheit“ ist. Um daraus ein Prinzip der „Quantität“ zu machen, müssen andere Bedingungen zu diesem dazukommen. Was für welche? Fichte selbst bringt uns hier auf den Weg. Man erinnert sich, dass seine Deduktion der Quantität und des Raumes sich stützt, nicht unmittelbar auf den Begriff der „Begrenzung“ als solcher, sondern auf das Merkmal einer Grenze, der zufolge das Subjekt und das Objekt in ihrer ganzen indefiniten Erstreckung ständig und ununterbrochen sich ergänzend sind, für eine beliebige Position der Grenze. Nun aber setzt dieser komplexe Begriff – der, wir geben es zu, den rationalen Charakter der Quantität impliziert – die reziproke streng komplementäre Kausalität von Subjekt und Objekt voraus, eine ebenfalls komplementäre Kombination von Passivität und Aktivität. (Ein Scholastiker würde übersetzen: eine Zusammensetzung aus Materie und Form. Und aus der Gegenwart einer „Materie“, im Subjekt und im Objekt, würde er, wenn er Thomist ist, ihre „Quantifizierbarkeit“ und ihre „Quantität“ deduzieren.) Man sieht es, für Fichte selbst wird die Quantität eine notwendige Konsequenz der Begrenzung des Ich nur soweit wie diese Begrenzung notwendig zur Folge hat eine reziproke Handlung des Subjekts und des Objekts, das heißt, wenn wir uns auf den Gesichtspunkt des Subjekts setzen, eine Passivität des Ich dem Objekt gegenüber. Das kommt zurück auf folgende Behauptung: Ein Ich, das in eine bewusste Aktivität nur eintreten kann durch Aufnahme eines Gegebenen (anders gesagt, durch Vermittlung einer Sensibilität) hat notwendigerweise einen quantitativen Modus der Handlung. Die Deduktion der Quantität, die von Fichte vorgeschlagen wird, gilt also nur für die Aktivität einer nicht-intuitiven Intelligenz, so wie es die menschliche Intelligenz ist. Da Kant, in der transzendentalen Deduktion über ein „nicht-intuitives Denken“ diskutiert, hätte er von daher deduzieren können, nicht nur die kategoriale Synthese, sondern die räumliche Form. Und wenn einmal die räumliche Quantität deduziert ist, würde es genügen, darin die Aktivität des Subjekts einzugliedern, um die Zeit zu erhalten. Das was Kant nicht gemacht hat, haben die Scholastiker – außerhalb jeder kritischen Voreingenommenheit – schon seit langem versucht. Aber hat die objektive Begrenzung des reinen Ich (= die „metaphysische Kontingenz“ der Scholastiker) notwendig zur Folge, wie es Fichte voraussetzt, eine reziproke und komplementäre Handlung von Subjekt und Objekt, oder genauer, eine „Passivität“ des Subjekts einem Objekt gegenüber? Das behaupten, heißt, als absolute Bedingungen jedes „Objekts“ die unserer „Repräsentation“ eigentümlichen Bedingungen zu setzen, und das heißt, selbst die 333 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 414 Möglichkeit endlicher Intelligenzen verneinen, die subsistieren außerhalb der Materie. Zugegeben, wir sind unfähig, uns diese reinen Geister, Zwischenglieder zwischen dem absoluten Geist und unserem, zu „repräsentieren“ und wir können uns also davon nicht einen eigentümlichen wirklich objektiven Begriff bilden. Aber andererseits, mit welchem Recht können wir davon die absolute Unmöglichkeit behaupten? Mit welchem Recht also vorgeben, dass Gott nur in der Materie und in der Quantität schaffen kann? Wir schließen daraus, dass Fichte, um die räumliche Quantität und daraus selbst die Zeit zu deduzieren, sich unter die Hypothese eines äußeren Gegebenen stellen musste – was wohl eine Anfangsbedingung des menschlichen Denkens ist, aber nicht, aber dennoch nicht herrührt mit einer absoluten logischen Notwendigkeit vom alleinigen Prinzip der primitiven (ursprünglichen) Reflexion. Ohne primitive Reflexion gibt es gewiss keine mögliche Quantität im Ich; aber wie kann man beweisen, dass, außerhalb der reziproken Kausalität und der Quantität überhaupt keine Form der Reflexion, wir sagen nicht „positiv konzipierbar“ oder „vorstellbar“ bleibt, aber wenigstens negativ konzipierbar ist? So also, ausgehend vom fundamentalen Prinzip des Bewusstseins, müsste sich das System von Fichte, um die Totalität dessen, was ist, zu erklären, sich schon für zwei kontingente Hypothesen – oder für zwei „erste Fakten“ – öffnen: die materielle und konkrete Mannigfaltigkeit des Gegebenen und die Empfänglichkeit des menschlichen Subjekts den Gegebenheiten gegenüber. Auf der menschlichen Ebene, auf der sich die Kritik von Kant bewegt – wenn schon nicht auf der absoluten Ebene des reinen Ich, auf die mit der spekulativen Vernunft sich zu erheben, Kant nicht in den Sinn kam – wäre das nicht schon äquivalent gewesen, die problematische Kausalität „des Dings an sich“ und die Existenz einer Sinneswahrnehmung (Rezeptivität) zuzugestehen, die dem Verstand untergeordnet ist? Wir wagen zu sagen, dass das bedeutet hätte, all das Wesentliche des Dualismus der theoretischen Vernunft von Kant wiederaufzunehmen. Aber die Originalität und vielleicht das Verdienst von Fichte besteht hauptsächlich darin, diesen Dualismus reduziert zu haben auf die absolute Einheit des höheren Ich auf der menschlichen Ebene. Wir untersuchen unmittelbar diesen transzendenten Aspekt des Idealismus. §2.b) Dualismus oder absoluter Monismus? Man weiß, dass Fichte die Darstellung seines kritischen Systems dauernden Überarbeitungen unterzog, bis zu dem Punkt, dass man sich gefragt hat, ob die Entwicklung seines Denkens ihn nicht sogar mitgerissen hat, den ursprünglichen Schlüssen aus seiner Theorie der Wissenschaft zu widersprechen: Man stellt tatsächlich eine erste und eine zweite Philosophie von Fichte einander 334 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte 415 gegenüber, jene eingesperrt in die unüberwindliche Immanenz des Wissens, diese ausbrechend aus dem relativen und immanenten Wissen auf eine absolute Transzendenz hin. Wir glauben nach unserer Meinung, dass trotz einiger ein wenig verwirrender Ausdrücke, man in den Werken von Fichte die stetige Entwicklung eines logisch kohärenten Systems anerkennen muss. Man dispensiere uns davon, diese These der Geschichte und Exegese hier zu begründen, die mit Begabung von Kuno Fischer1 verteidigt wurde und unlängst durch M. Xavier Léon2 . Es soll uns genügen einige allgemeine Gesichtspunkte zu unserem Thema klarzumachen. 1 Geschichte der neueren Philosophie, Band V: Fichte und seine Vorgänger, 2.Auflage, Heidelberg 1890 2 La philosophie de Fichte, Paris, 1902 2b.1˚ Das „Phänomen des Absoluten“ Die Relativität des Wissens und der Glaube. – In den zwei ersten Teilen seines Werkchens Über die Bestimmung des Menschen 3 1 Bestimmung des Menschen, Berlin, 1800 zitierte Edition Band II unterstreicht Fichte, indem er die großen Züge der Wissenschaftslehre wieder aufnimmt, sehr stark die unerbittliche Relativität des sich selbst überlassenen Wissens. Tatsächlich erscheint das Absolute dort nur als Funktion des bewussten Werdens: entweder als unbestimmtes Prinzip oder subjektive Identität oder als letztes ideales Ziel dieses Werdens; nun aber entgehen unbestimmtes Subjekt und ideales Ziel in gleicher Weise der Aktualität des Bewusstseins: Das eine ist von uns „postuliert“, das andere ist von uns „verfolgt“; das eine ist „unterhalb“ des Bewusstseins, das andere ist „ jenseits“ davon; weder das eine noch das andere existiert für uns außerhalb des Werdens selbst. Das Absolute ist uns also nur gegeben als logische Abhängigkeit des Relativen, das heißt des Bewusstseins oder der Reflexion. Auch muss man gestehen, dass jedes Objekt ohne Ausnahme, in uns das Zeichen der Relativität zeigt: Alles ist Bewusstsein einer Tatsache des Bewusstseins, Reflexion einer Reflexion, „Traum eines Traums“. Im zweiten Buch der Bestimmung des Menschen kommt ein Dialog in Gang zwischen dem bewussten Ich und dem Geist. Das Ich, zuerst bewogen durch ein unerschütterliches Vertrauen auf die „Realität an sich“ der Objekte kommt von da dazu, die universelle Relativität zu bekennen. Ich – Ich kann sagen: das ist gedacht. Aber tatsächlich kann ich mich kaum noch so ausdrücken; sagen wir vorsichtiger: es erscheint der Gedanke, dass ich empfinde, schaue an, denke; denn wie absolut behaupten, dass ich fühle, dass ich schaue, dass ich denke? – Der Geist: – Wohl ausgedrückt. 335 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte Ich: – Nirgends etwas von Dauer außerhalb meiner noch in mir; nichts als eine unaufhörliche Fluktuation. Nirgends erkenne ich ein Sein, nicht einmal mein eigenes. Das Sein ist nicht. Ich selbst, ich weiß nichts von nichts und ich bin nicht. Es gibt nur Bilder; sie sind alles das, was existiert und sie kennen sich selbst nur als Bilder... Ich, ich bin nur eines dieser Bilder: weniger als das, ich bin nur konfuses Bild dieser Bilder...Die Schau ist nur ein Traumbild; Der Gedanke .. ist der Traum dieses Traums. Der Geist: – Du hast alles vollkommen begriffen1 . 1 Bestimmung des Menschen Band II, S.244-245 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k26682n/f252.item.zoomOriginaltext: Ich: – Ich kann sonach wohl sagen: Es wird gedacht – doch kaum kann ich auch dies sagen – also, vorsichtiger, es erscheint der Gedanke: dass ich empfinde, schaue an, denke; keineswegs aber: ich empfinde, schaue an, denke. Nur das erstere ist Faktum, das zweite ist hinzu erdichtet. Der Geist: – Wohl ausgedrückt. Ich: – Es gibt überall kein Dauerndes, weder außer mir, noch in mir, sondern nur einen unaufhörlichen Wechsel. Ich weiß überall von keinem Sein, und auch nicht von meinem eigenen, Es ist kein Seyn. – Ich selbst weiß überhaupt nicht, und bin nicht, Bilder sind: sie sind das einzige, was da ist und sie wissen von sich, nach Weise de Bilder: – Bilder, die vorüberschweben, ohne dass etwas sei, dem sie vorüberschweben; die durch Bilder von den Bildern zusammenhängen, Bilder ohne etwas in ihnen Abgebildetes, ohne Bedeutung und Zweck. Ich selbst bin eines dieser Bilder; ja ich bin selbst das nicht sondern nur ein verworrenes Bild von den Bildern. – Alle Realität verwandelt sich in einen wunderbaren Traum, ohne ein Leben, von welchem geträumt wird – ohne einen Geist, dem das träumt; in einen Traum, der in einem Traum von sich selbst zusammenhängt. Das Anschauen ist der Traum, das Denken, die Quelle allen Seins und aller Realität, die ich mir einbilde, meines Seins, meiner Kraft, meiner Zwecke – ist der Traum von jenem Traum. 416 Der Geist: – Du hast alles sehr gut gefasst. Bediene dich immer der schneidensten Ausdrücke und Wendungen ... Wir erreichen hier den Höhepunkt des Wissens: Die Relativität ihrer Relativität bewusst geworden. Ist das nicht ein merkwürdig enttäuschendes Resultat unserer mühsamen Untersuchungen? „Beschränkter Mensch, fährt der Geist weiter... Du wolltest dein Wissen verstehen. Und du bist erstaunt auf diesem Wege gar nichts anderes zu verstehen, als das was du wissen wolltest, nämlich gerade dein Wissen? was würdest du anderes wollen? Das was aus dem Wissen hervorgeht und mit dem Mittel des Wissens kann nur Wissen sein. Nun ist aber alles Wissen nur Repräsentation ... Erwartetest du etwas anderes? Behauptest du das Wesen deines Geistes zu verändern und dein Wissen zu erheben, so dass es mehr ist als ein Wissen?... Du hast nun die Illusion [des Wissens] durchschaut... Und darin liegt die wahre Nützlichkeit des Systems [der 336 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte Wissenschaft:] Es kehrt um und anihiliert den Irrtum. Die Wahrheit kann sie dir nicht geben, denn sie ist an sich absolut leer. Trotzdem, ich weiß es, du suchst noch über die reine Repräsentation hinaus irgendetwas Reales – ein Reales von einer anderen Realität als die, die du auf das Nichts gerade reduziert hast. Dein Bemühen wird vergeblich sein, wenn du behauptest dieses etwas aus deinem Wissen hervorzuholen und mit dem Mittel deines Wissens. Wenn du überhaupt kein anderes Organ besitzest, um die Realität zu begreifen, wirst du sie nie erhalten.“ Aber du besitzt dieses Organ, bemühe dich nur es aufzufrischen... Ich lasse dich allein mit dir selbst1 “ 1 417 zit. op, Seite 246-247 Welches ist dieses „Organ für die Realität“, das den magischen Kreis des relativen Wissens durchbricht? Man errät es; es ist der Glaube, der moralische Glaube. Der dritte Teil der Trilogie „Zweifel, Wissen, Glaube“, der das Fundament der Bestimmung des Menschen bildet, zeigt, dass das absolute Ziel – korrelativ zum absoluten Prinzip (Anfang) sich unserer Anhänglichkeit aufzwingt als festes Objekt des Glaubens, als Postulat (Forderung) einer Aktivität, die den Charakter seines Sollens trägt. Und in der Realität – postuliert – vom absoluten Ziel, ist die Realität von jeder Ordnung der Mittel zu diesem Ziel eingeschlossen. Absolutes und Phänomen des Absoluten. – Man sieht es, die Relativität der Wissenschaftslehre schließt in der Absicht von Fichte nicht das Absolute des Objekts des Glaubens aus. Ja noch mehr: Die Vernunft selbst, indem sie sich Grenzen zieht, übersteigt sich und erreicht in gewisser Weise das Absolute – nicht mehr das Absolute als reine logische Bedingung des Sollens, sondern das Absolute, wenigstens negativ in die transzendente Wirklichkeit seines „an sich“ zurückversetzt. Wir haben soeben festgestellt, dass der Höhepunkt des Wissens gerade das Bewusstsein der Relativität des Wissens war. Aber die reine Relativität trägt sich nicht durch sich selbst: sie verlangt logisch kraft ihres eigenen Begriffs, ein „Absolutes“, zu dem es das „Relative“ ist. Wie Fichte in der Darstellung der Wissenschaftslehre von 1801 sagt, kann unser Wissen in seinem Grund nicht rein relativ sein, rein „formal“: wenn es sich erkennt als „Form“ der Reflexion, erkennt es sich gerade durch die Tatsache als Form von etwas, was nicht rein formartig ist, mit anderen Worten, als Form eines Prinzips oder eines Seins; und da das Wissen als solches „reine Form“ ist, kann das Sein dieser Form nur reines Prinzip sein, absolutes Sein2 . 2 Das darf man nicht verwechseln mit dem aktuellen und empirischen Sein unserer direkten Repräsentationen. 337 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 418 Von Daher – es ist die Lehre von Fichte in dem Werk mit dem Titel: Die Tatsachen des Bewusstseins Vorlesungen in Berlin, 1810-1811– die Relation des Wissens, reine reflektierte Form, zum Prinzip dieser Reflexion oder zum Sein dieser Form, ist nichts anderes als die Relation des Phänomens zur Realität an sich: das Wissen, das heißt das ganze Objekt der Wissenschaftslehre, erscheint als das Phänomen des Absoluten, als das Bild des Seins. Der Dualismus des Realen und der Monismus des Idealen.– Wie muss man, nach diesem, auf die Frage antworten, die wir uns in diesem Paragraphen stellen: Ist das System von Fichte ein Monismus oder ein integraler (=totaler) Dualismus? Alles hängt ab vom Gesichtspunkt, von dem aus man es ins Auge zu fassen behauptet. „Betrachtet vom Gesichtspunkt des Ideals aus [das heißt vom Gesichtspunkt des Ziels und korrelativ dazu, des Prinzips] ist die Wissenschaftslehre ein Monismus: denn sie anerkennt das absolute Fundament jeden Wissens in der ewigen Einheit, die unterhalb jedem Wissen ruht. Betrachtet vom Gesichtspunkt des Realen her, das heißt insofern sie das Wissen selbst in seiner eigenen Aktualität betrifft, ist die Wissenschaftslehre ein Dualismus. Denn unter dieser Beziehung hat sie zwei Prinzipien: die absolute Freiheit [der Reflexion] und das absolute Sein; und sie weiß, dass die absolute Einheit in keinem aktuellen Wissen realisierbar ist sondern nur durch das Denken [welches den Dualismus des Bewusstseins durchbricht und die Einheit in der idealen Ordnung wiederherstellt]1 “ 1 Darstellung ... 1801 S.89 Sollte daher die Wissenschaftslehre nach ihrem Charakter in Bezug auf Unitismus (ἕν καὶ πα̃ν) und Dualismus gefragt werden, so ist ihre Antwort die: Unitismus ist sie in idealer Hinsicht: sie weiß, dass schlechthin allem Wissen das (bestimmend) ewige Eine – jenseits allen Wissens nemlich – zu Grunde liegt; Dualismus ist sie in realer Hinsicht in Bezug auf das Wissen als wirklich gesetzt. Da hat sie zwei Prinzipien: die absolute Freiheit und das absolute Sein – und sie weiß, dass das Absolute Eine in keinem wirklichen (faktischen) Wissen je zu erreichen ist, nur rein denkend. Seltsamer Schluss auf den ersten Blick: das Wissen, insofern es immanent zu sich selbst bleibt, ist ein Dualismus; aber es wird Monismus in dem Maße wie es sich selbst transzendiert, um eine Absolutes zu setzen. Um die Wahrheit zu sagen, bis hierher setzt er das Absolute nur ideal, als notwendiges Bild eines Prinzips und eines Ziels und nicht als an sich erkannte Realität. Diese Setzung des Absoluten im Wissen ist also noch nichts anderes als die – andererseits unvermeidliche – Repräsentation einer Relation zum Absoluten, weit davon entfernt, das direkte Begreifen dieser zu sein. Wir sind noch überhaupt nicht aus dem „Phänomen des Absoluten“ herausgekommen. Gibt es ein Mittel in unserem Bewusstsein, nicht nur die indirekte und phänomenale Repräsentation des Absoluten, sondern direkt das transzendente Absolute zu realisieren? 338 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte 2b.2˚ Das religiöse Objekt und das moralische Objekt. 419 An diesem kritischen Punkt hat sich das philosophische Problem des Wissens transformiert in ein spezifisch religiöses Problem das der letzten Bestimmung. Fichte stellt es auf und löst es in einer Reihe von Vorlesungen zusammengefasst unter dem Titel: Die Anweisung zum seligen Leben, oder die Religionslehre (Berlin 1806). Sie markiert, nach dem Ausdruck des Philosophen selbst, „den Höhepunkt und den hellen Mittelpunkt (Heimstatt)“ jedes idealistischen Systems. Der beherrschende Gesichtspunkt erscheint uns dort andererseits nur eine Ausarbeitung der Ideen zu sein, die schon die Bestimmung des Menschen und andere Schriften der zweiten philosophischen Periode von Fichte inspirierten. Um uns gut verständlich zu machen, möge man uns erlauben, bevor wir eintreten ins Herz der „religiösen Philosophie“, einige einleitenden Erwägungen über die Religion und die Moralität nach Fichte darzulegen.1 1 Wir benützen hier, im übrigen sehr frei, ein interessantes Kapitel des schon zitierten ausgezeichneten Werks von M. Xavier-Léon, La Philosophie de Fichte, Buch III, Kap.4: „La philosophie religieuse“, 420 Beziehung des religiösen Objekts und des moralischen Objekts. – Trotz ihrer engen Einheit gehen die Religion und die Moralität nicht ineinander über. Der Bereich der Moral ist direkt konstituiert durch die Anforderungen des Sollens. Der religiöse Bereich ist ein Produkt der intellektuellen Reflexion, die sich bemüht, die theoretischen Bedingungen des Sollens oder der Moralität zu erfassen. Es lässt sich leicht zeigen – wir haben es weiter oben gemacht – dass das Sollen als solches ein „unendliches Ziel“ verfolgt. Aber dieses „unendliche Ziel“ bleibt ein Ideal. Tatsächlich ist das, was das moralische Sollen unmittelbar fordert noch nicht die Existenz eines unendlichen Objekts, die diesem Ziel entspricht, sondern wohl das Streben selbst nach dem Ziel. Die Realität des Ziels ist noch nicht gesetzt durch die alleinige Tatsache der Bemühung, die danach strebt. Dennoch, die Intelligenz, reflektierend über diesen, auf ein unendliches Ziel gerichteten, moralischen Akt, sieht sich gezwungen, um ihn zu verstehen oder ihn zu erklären, eine „absolute Ordnung der Dinge“ zu konzipieren, zu der das unendliche Ziel gehört, anders gesagt, sieht sich gezwungen, sich das Sollen in einer absoluten Ordnung der Finalität zu repräsentieren, wo das Ziel verwirklichbar ist. Diese „absolute Ordnung“, die nicht „gegeben“ ist durch das Sollen als solchem, sondern postuliert als rationales Fundament des Sollens durch die reflektierende Intelligenz, diese „absolute Ordnung“, die der moralischen Handlung zugrundeliegt, konstituiert im eigentlichen Sinn den religiösen Bereich. 339 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte Für die Augen der Vernunft, reflektierend über die moralische Handlung, erscheint das religiöse Objekt, das heißt Gott also wie die absolute Bedingung, die die moralische Geltung jeder endlichen Aktivität gewährleistet, wie die Geltung des dieser Aktivität immanenten Ideals; nicht – man beachte es wohl – wie eine Ordnung der der Handlung objektiv präsentierten Dinge, sondern wie eine lebendige Ordnung der Handlung selbst, das heißt definitiv, mehr als ein wirklich „gelebtes“, „vollzogenes“, als ein in sich erkanntes Ideal. Heißt das nicht eigentlich, das Absolute unterdrücken, wenn man daraus nur das immanente Gesetz oder das Ideal des moralischen Werdens macht? Heißt das nicht eher seine Realität zu reduzieren auf die unsichere Realität dieses Werdens selbst? Hatten die Gegner Fichtes so sehr Unrecht, ihn des Atheismus zu bezichtigen? Man muss sich hier nach Fichte vor einer Illusion hüten. Ein Gott, der in unserem Bewusstsein die Attribute annähme von einem „feststehenden Ding“, von einem „definierten Sein“, wäre da gesetzt wie der Rückstand der Reflexion, also als begrenztes Objekt, also als räumliches Objekt2 . Ein solcher Gott ist kein Gott, das ist ein „Idol“, welches die Vernunft auf den Kopf stellen muss, um den wahren Gott zu entdecken. 2 421 Vergl. die Wissenschaftslehre Offenbart sich uns das? Sicherlich. In der moralischen Handlung im Vollzug, die für Fichte das ganze Feld der Aktivität des Ich überdeckt, unterscheidet unsere Reflexion und stellt gegenüber die „objektive Bestimmung“ – Begrenzung, Passivität, totes Objekt – und die Freiheit, lebendige und autonome Aktivität. Von sich aus, wenn man es genauer bestimmt, ist diese universell: keiner partikulären Bestimmung unterworfen, erscheint sie wirklich als der Akt des gesamten Universums, souverän [=äußerst] freier Akt, Akt der für sich selbst sein absolutes Gesetz ist. In diesem Akt, zugleich Triebfeder und letzte Norm jeder endlichen Aktivität – und nicht in irgendeiner notgedrungen beschränkten Entität – erreichen wir das rationale Fundament des Sollens, das Absolute, Gott. Die Existenz Gottes als dynamisches Prinzip jeder moralischen Handlung ist also postuliert (affirmiert) durch unsere reflektierende Vernunft. Das Absolute, moralisches Postulat, bei Kant und bei Fichte. – Man muss hier einen erheblichen Unterschied zwischen dem absoluten, moralisches Postulat bei Kant und dem absoluten, moralisches Postulat bei Fichte beachten. Bei Kant – wir haben es weiter oben beobachtet – ist Gott objektiv gesetzt durch die rationale Reflexion, als eine äußere Bedingung der Harmonie zwischen der Natur und der Freiheit; zwischen dem höchsten Glück des Individuums und der Heiligkeit, das heißt der perfekten Universalität des Wollens; 340 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte 422 zwischen der persönlichen Finaltiät und dem reinen Imperativ. So weit man auch durch die persönlichen Ziele die unendlich unbestimmte Reihe der moralischen Realisierungen verlängert, bleibt Gott außerhalb von uns, postuliert ohne Zweifel durch die Vernunft, aber nie besessen in einer Koinzidenz, so inadäquat sie auch sei, von seiner Realität mit der unseren. Der Gott Kants offenbart sich in uns nur durch die Wirkungen seines Handelns: und es ist die harmonische Fülle seiner Wirkungen, die wir unser letztes Ziel nennen, das höchste Gut. Bei Fichte dagegen, findet es nicht mehr statt, ein Prinzip der Harmonie zwischen der Natur und der Freiheit zu suchen zwischen den Zielen der natürlichen Aktivität und dem Ideal der moralischen Handlung. Denn die Natur, das Reich der Ziele ist Ausdruck selbst der Freiheit und der moralischen Handlung. Tatsächlich ist es nicht eigentlich das anfängliche Sollen, das der Reflexion des reinen Ich präsidiert, welches das Streben hervorruft? Die Natur wird der konkrete Akt der Freiheit, ihre „Realisierung“. Dann hat aber doch der durch die Vernunft, wenn sie über das moralische Sollen reflektiert, geforderte Gott wie bei Kant, nicht mehr die Bedeutung eines zugleich unerkennbaren und unzugänglichen Absoluten, das von sehr hoch her das letzte Glück der Tugend gewährleistet; der Gott von Fichte bleibt, ohne Zweifel, ein Postulat des moralischen Sollens, aber er ist postuliert als das immanente Prinzip unserer ganzen natürlichen Aktivität. Nun aber kann diese ihr letztes Ziel nur finden, indem sie ihr immanentes Prinzip ausschöpft und jede auf das letzte Ziel zu bestanden Etappe, ist eine vollständigere Aktuierung des Prinzips.: Also unsere Vernunft zeigt uns nicht nur Gott an der ersten Quelle unserer Aktivität, sondern zeigt ihn uns im fortschreitenden Verlauf dieser Aktivität, indem sie sich in uns mehr und mehr ausdrückt, sich darin „realisierend“ als aktuelle „Form“ unseres Bewusstseins. Der Gott von Fichte ist zugleich ein Gott undeutlich immanent in uns, als Prinzip unseres Lebens, und ein Gott mehr und mehr von uns „besessen“, mit uns „vereinigt“ nach seiner eigenen „Form“ in der Klarheit des Bewusstseins. Für diese direkte und fortschreitende Assimilation Gottes durch das Bewusstsein selbst, zwischen dem göttlichen Prinzip und seiner objektiven Form der Realisierung: das letzte Ziel des Menschen definieren, nach Fichte, durch eine Vereinigung, die die Grenzen unserer menschlichen Individualitäten überschreitet, das heißt durch die volle bewusste Realisierung des universalen Prinzips. An diesem Punkt wird das Absolute „in sich“, Postulat der Moralität, vollendet, durch unsere endlichen Werdenen [=Plural von Werden] seine eigene Form zu erwerben: es wird geworden sein ein „Absolutes für sich“. Wir finden also wieder, unter dem Winkel der persönlichen Bestimmung die Gesichtspunkte selbst, die entwickelt worden sind in der Wissenschaftslehre. 341 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 2b.3˚ Auf die absolute Einheit zu. Die vollkommene Seligkeit. – Diese Einschübe über die Beziehungen zwischen dem Objekt der Religion und dem Objekt der Moralität führt uns direkt ein in die Betrachtungen von epistemologischem Interesse, die wir uns vorgenommen haben in der „Philosophie der Religion1 “ zu bestimmen. 1 Die Anweisung zum seligen Leben, oder die Religionslehre, Vorträge gehalten in Berlin 1806 vergl. Zit Edit. Band V 423 424 Wir erleben alle – das ist die menschliche Erfahrung par excellence – ein Bedürfnis nach voller Erfüllung, einen Trieb nach Befriedigung, nach perfektem Glück. Nennen wir Liebe entweder die aktive Vereinigung mit dem beseligenden Objekt oder das Streben nach dieser Vereinigung, Es wäre leicht, zu zeigen, dass diese so definierte Liebe unser „Lebenstrieb“ ist, und dass sie in uns verschmilzt mit dem „Streben“, das weiter oben in der Wissenschaftslehre in Frage war. Die Liebe ist also in uns das Streben nach dem Besitz des voll beseligenden Objekts. Nun aber kann dieses Objekt nur ewig und ohne Grenzen sein: Unser natürliches Sehnen verlangt nichts Geringeres. Wie können wir das Ewige und das Unendliche besitzen? Durch das Denken, der einzigen wahren Form des Lebens; durch das Denken, das es uns zeigen würde als identisch mit uns im vollen Bewusstsein von uns selbst. Denn es genügt nicht, dass das Unendliche in uns ist und in uns wirkt: wenn wir nicht das Bewusstsein von der Identität des Unendlichen mit uns haben, besitzen wir es nicht, es ist „für uns“ nicht. Aber dieser von unserem Lebenstrieb geforderte „Besitz“ ist nicht leicht zu verstehen. Zeigen wir kurz die absoluten Bedingungen der Möglichkeit an. Etwas als identisch mit uns im vollen Bewusstsein von uns selbst anerkennen, heißt voraussetzen, dass dieses etwas das Objekt einer Reflexion des Ich wird und unter dieser reflektierten Schau sich für uns verschmilzt mit unserem reflex erkannten Ich. Nun aber erkennen wir unser Ich nur vermittels der Welt und als Funktion von ihr, das heißt als Subjekt bezogen auf ein Objekt, als Aktivität in einer Reflexion ihr selbst Entgegengestelltes. Um uns vollständig zu kennen, müssen wir die Totalität der möglichen Bestimmungen unserer in der Tiefe liegenden Aktivität verwirklicht haben. Gerade diese Bedingungen des vollen Bewusstseins von uns selbst sind nicht eine simple spekulative Hypothese, sie haben für uns die Geltung eines Ziels: Unser aller intimster Lebenstrieb – „Streben“ oder Liebe – strebt danach, die Totalität der „objektiven“ Bestimmungen auszuschöpfen, um darin bewusst die Fülle des virtuellen und verborgenen Prinzips wiederzufinden, das uns bewegte. Mit anderen Worten, unser Bewusstsein entwickelt sich, vermittels des gegenwärtigen Werdens, auf ein ideales Ziel hin, wo die subjektive Aktivität 342 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte vollkommen reflektiert wäre, das heißt versehen mit der absoluten Totalität der objektiven Bestimmungen, deren sie fähig ist. An dieser Tatsache der bewussten Entwicklung hätte das Ich es vollendet, sich selbst zu besiegen: es hätte sich nicht nur als Aktivität gesetzt, sondern es besäße sich als „Form perfekter Reflexion“. Nun aber, wir sagten das schon kurz vorher, muss das ewige und unbegrenzte Objekt unserer Seligkeit, das, welches unsere Liebe fordert, zusammenfallen, entsprechend der allerperfektesten Identität, mit diesem Selbstbesitz des Ich durch sich selbst. Wir können also das adäquate Objekt der Seligkeit definieren: die perfekte Reflexion der reinen Aktivität. Von solcher Art erscheint uns, durch das Werden hindurch, unser letztes Ziel. 425 Vom Verbum zum Verbum.– Aber, wir haben es schon weiter oben gesagt, dieses letzte Ziel ist nicht nur eine indifferente Idee, auch nicht nur ein tatsächlich verfolgtes Ideal: es ist für uns ein Sollen. Da es verwirklicht werden soll, halten wir also seine Verwirklichung für möglich. Und wir postulieren folglich, in einem Akt des rationalen Glaubens, die absolute Existenz der Bedingungen der Möglichkeit dieses letzten Ziels, oder, um den Ausdruck von Fichte zu verwenden, die Existenz einer „absoluten Ordnung“, einer „göttlichen Ordnung“, die unserer Handlung immanent ist. Die abstrakte Bedingung der Möglichkeit, die wir definierten als tiefliegende Virtualität des bewussten Werdens, das heißt als reine Reflexion, verlässt nun die Sphäre der logischen Abstraktionen; und da sie gewahr wird der Bedingung der Möglichkeit eines Ziels, das verwirklicht werden muss, erhält sie für unsere Augen eine dynamische Wirklichkeit, die diesem Ziel proportioniert ist. Kraft des rationalen, auf dem Sollen gegründeten Glaubens, setzen wir also diese zwei korrelativen Behauptungen (Affirmationen): 10 dass die reine reflektierende Aktivität (= das Ich in der ursprünglichen Reflexion) das reale Prinzip des fortschreitenden Werdens des Bewusstseins ist, und 20 dass die vollständig reflektierte Aktivität (= das Universum oder das perfekte Objekt) das letzte real und wirksam verfolgte Ziel dieses Werdens ist. Nun aber, was ist dieses religiöse Objekt anderes als diese „absolute Ordnung“, diese Verbindung des fundamentalen Prinzips und des letzten Ziels, welches gerade die Finalität des Werdens gewährleistet1 ? 1 Vergessen wir nicht, dass bei Fichte das Werden ganz und gar moralisches Werden ist Von daher klärt sich und vereinheitlicht sich das Problem unserer Bestimmung, die für jeden von uns auch das Problem der Welt ist. Denn diese Bestimmung rollt ganz und gar ab zwischen der anfänglichen, noch virtuellen Reflexion einer reinen Aktivität und der vollständig abgeschlossenen Reflexion dieser Aktivität. Ersetzen wir die abstrakte Bezeichnung dieses Terminus a 343 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 426 quo und dieses Terminus ad quem durch die Äquivalente, hergenommen aus der christlichen Terminologie: dann werden wir sagen, dass die Bestimmung der Welt und unsere persönliche Bestimmung sich gänzlich abspielen zwischen zwei Zuständen des Logos oder des Verbum: zwischen dem Verbum als schöpferische Virtualität und dem Verbum als objektive perfekte Form des Vaters. Das Absolute zeugt durch Reflexion über sich selbst das Verbum, Das Verbum ist zuerst reiner schöpferischer Dynamismus, virtuelles Bild Gottes, bereit sich zu veräußern, anfängliches „Fiat [=es werde]“, aus dem die Welt wie aus einem Keim hervorgeht. Wir erkennen hier wieder, im Absoluten, das zeugt, das erste fundamentale Prinzip der Wissenschaftslehre (reines Ich) und im Verb, gezeugt als schöpferische Virtualität das zweite fundamentale Prinzip (reine Reflexion). Dann beginnt, kraft einer rationalen unabweislichen Notwendigkeit die Entwicklung dieser schöpferischen Virtualität: wahrhaftige immanente Dialektik des Verbum, die wir weiter oben nach der Wissenschaftslehre skizziert haben. Das Verb (das Prinzip der Reflexion) erscheint dort identisch mit der unpersönlichen Vernunft: in ihm entsteht das Bewusstsein als solches, in ihm entwickelt sich zugleich die Vielfalt der bewussten Aktivitäten und der Inhalte des Bewusstseins. Das ist zu sagen, dass die Entwicklung des Bewusstseins und der Welt im Bewusstsein, die Entwicklung selbst des schöpferischen Verbum ist: das ganze Werden – subjektiv und objektiv – ist nur das „fieri [= Werden]“ des göttlichen Bildes. Am Endpunkt dieses Werdens wäre das Bild perfekt, es wäre die adäquate Form des ursprünglichen Prinzips geworden, wobei sich die absolute Vernunft vollendet im absoluten Bewusstsein. Oder, wenn man will, wäre Gott also in seinem Verbum ausgeschöpft, die unendliche Summe seiner Grade der Nachahmbarkeit: Das Verbum, schöpferische Virtualität, hätte vollständig seine schöpferische Potenz „aktualisiert“ und fände sich identisch zur objektiven, jetzt vollkommenen Schöpfung. Unsere individuellen Bewusstseine stellen in diesem dreifachen Zustand des Verbum einen mittleren Moment dar; denn wir sind ein jeder lokale Phasen des kosmischen Werdens und in der Bewegung, die uns mitreißt, fühlen wir zugleich den dauernden Anstoß einer universellen Vernunft, des Verbum ausgehend vom Vater, immanent in jedem, und die Anziehung eines letzten Ziels, wo die Unendlichkeit des Objekts, die die unsere geworden ist, unsere Individualität erweitern würde über jeden Unterschied hinaus bis zum Wiedervereinigen mit der Form Gottes selbst, das heißt immer noch das Verbum, aber des Verbum, adäquates und prachtvolles Bild des Vaters geworden. Aus dem Zentrum unseres Bewusstseins entnehmen wir so, dank des rationalen Glaubens, selbst gestützt auf das moralische Sollen den sicheren Blick auf ein Absolutes, das uns übersteigt und uns einhüllt, als universelles Prinzip und als letztes Ziel, ohne aufzuhören in uns in jedem Augenblick die allerin- 344 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte nerste Realität zu sein. Und dieses Absolute ist das Absolute der Reflexion, oder in der Sprache der Religion ist es das Verbum. Wir erreichen die äußersten Grenzen unseres menschlichen Horizonts: alles was für uns Realität haben kann, staffelt sich vom Verbum zum Verbum. 427 Die absolute Einheit durch die Liebe. – Dennoch, das Verb selbst, ganz absolut und unendlich es auch sei, erscheint uns noch nur als das Absolute der Form und das Unendliche der Reflexion. Wir sagten weiter oben, dass unsere Vernunft sich Rechenschaft gibt von ihrer wesentlichen Relativität, das heißt von der Relativität jeder Vernunft; das Verbum, das die absolute Vernunft ist, ist nur absolut in der Ordnung der Vernunft selbst, das heißt der Reflexion: es bleibt relativ soweit die Reflexion als solche notwendig ein „Prinzip“ voraussetzt, das sich reflektiert, dass man dieses Prinzip reines Ich nennt, reine Aktivität, Existenz, absolutes Sein, absoluter Geist oder einfach Gott. Sagen wir – kurz – dass das Absolute der Form sich noch stützt auf das Absolute der Existenz und dass das Verb, Ursprung und Ziel unserer Vernunft, noch außerhalb Gottes bleibt. Die Evolution der Vernunft, bis zu ihrem höchsten Term [Endpunk] gebracht, unserer aktuellen Vereinigung mit dem Verb, zeigt sich also als unfähig, die absolute Einheit zu realisieren. Und wir verstehen negativ, über die ganze Ordnung des Wissens hinaus, über das Verbum außerhalb Gottes hinaus eine übereminente Ordnung, wo die phänomenale Existenz, die bewusste Realisierung, die Unterscheidung von Subjekt und Objekt keinen Platz mehr haben – wo selbst die Dualität zwischen Gott und dem Verb sich verwischt in der reinen und einfachen Identität. Aber dann, da wir problematisch etwas konzipieren über das absolute Wissen hinaus, kann dieses, obwohl letztes Ziel unseres Bewusstseins, nicht das absolut letzte Ziel sein, nach welchem diese geheimnisvolle, unersättliche Fähigkeit strebt, die wir die Liebe genannt haben. Diese, auf dem Grund des Bewusstseins ruft nach und fordert das unendlich Unendliche und absolut Absolute. Es begnügt sich nicht mit dem Dualismus des Seins und der Form, und sein Bedürfen schweigt noch nicht, wenn die Form selbst sich nicht verliert im Sein, von dem es ursprünglich hervorging. Der Anstoß selbst, der das Verb im Bewusstsein realisiert hat, stößt es weiter, die Grenzen des Bewusstseins zu überspringen, um sich wiederzufinden als identisch mit Gott. Von solcher Art ist das Wesentliche der berühmten Theorie der Liebe in der Religions-Philosophie von Fichte. Der Zyklus der Aktivität des reinen Ich findet sich jetzt vollständig in sich geschlossen: Vom absolut Absoluten zum absolut Absoluten. Aber man bemerke wohl zu welchen Bedingungen: Es war nötig 10 dass das Wissen sich selbst verneint und seine wesentliche Relativität anerkennt; und 20 dass es so 345 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte das Feld frei ließ für die Liebe. 428 Über das Wissen hinaus, in dieser Domäne, wo von allen unseren Fähigkeiten allein die Liebe hindringt, dreht sich die Perspektive des Realen und des Irrealen, des Seins und des Nicht-Seins um. Wenn wir uns ins Innere des Wissens platzieren, ist das Sein oder das Reale einzig das, was „für uns“ ist, das was reflektiert und affirmiert ist, kurz das was aktuell Objekt ist. Das Absolute dagegen ist für die Augen des Wissens nur ein irreales Ideal, nur ein Nicht-Sein von all dem was für uns ist, als eine Verneinung des Objekts der Wissenschaft. Aber wenn wir uns über das Wissen hinaus platzieren, in den Standpunkt Gottes, dann ist jetzt das Absolute das, was sich setzt als Sein, das Sein des Wissens oder der Reflexion, das Objekt der Wissenschaft, erscheint nur noch wie die Verneinung oder das Nicht-Sein des Absoluten. Monismus vom göttlichen Standpunkt aus, Dualismus vom menschlichen Standpunkt aus.– Wir können jetzt ein letztes Mal die Frage aufgreifen, die wir uns weiter oben gestellt haben: Ist das idealistische System von Fichte ein Dualismus oder ein integraler [=totaler] Monismus? Man erinnert sich, dass Fichte in der Darstellung der Wissenschaftslehre von 1801 darauf antwortete (siehe oben III§2b)1˚): Die Wissenschaftslehre ist ein Dualismus vom realen Gesichtspunkt aus, das heißt vom Gesichtspunkt des aktuellen Wissens her; aber sie ist ein Monismus (Unitarismus) vom Gesichtspunkt des Ideals aus, das heißt vom Gesichtspunkt das absoluten Prinzips und dem letzten Ziel her. Die Moral-Philosophie und Religions-Philosophie von Fichte erlaubt, einen Zug zu dieser Erklärung hinzuzufügen. Die „ideale“ Ordnung affirmiert (bejaht) sich in uns kraft des rationalen Glaubens, nicht mehr nur als Idee sondern als absolute Realität, oder, wenn man will, als Verbum divinum, sich entäußernd in Gott durch die Liebe selbst, die ihn dazu gebracht hat aus Ihm hervorzugehen. Das was Fichte in der Wissenschaftslehre den idealen Gesichtspunkt nannte, findet sich also, dass es der göttliche Gesichtspunkt ist. Um wie Gott zu sehen, müssen wir Absage machen an das reflektierte Wissen und uns platzieren in die Perspektive der Liebe, das heißt der reinen Aktivität, die immer auf dem Grund von uns selbst von uns selbst sprudelt. 429 Wir können also sagen, dass das idealistische System, ins Auge gefasst unter dem relativen Gesichtspunkt des Wissens, das heißt im Grunde, vom menschlichen Gesichtspunkt her, nur ein Dualismus sein kann: aber dass das idealistische System, ins Auge gefasst vom göttlichen Gesichtspunkt her, wohin nur die Liebe Zugang verschafft, die absolute Einheit eines Monismus erreicht. 346 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte 2b.4˚ Theismus oder Pantheismus? Analogie mit dem Neuplatonismus. – Man wird es nicht verfehlt haben, – Fichte selbst lädt zu dieser Parallele ein – die sehr tiefen Analogien zwischen dem idealistischen System einerseits und der neuplatonischen Theodizee oder der christlichen Theologie andererseits zu ahnen. Obwohl die Prüfung dieses speziellen Aspekts des Idealismus viel direkter eintreten muss in das Objekt eines weiteren Werks – das wir vielleicht veröffentlichen werden1 – über die „metaphysische Deduktion“, können wir es nicht unterlassen, dem hier einige Augenblicke zu widmen. 1 Siehe Studien zur Psychologie der Mystiker Band 2, Anhang I Man weiß dass, nach dem alexandrinischen Neuplatonismus das absolute Prinzip nicht der unmittelbare Autor der Vielheit der Geschöpfe sein kann, die sich staffeln auf allen Stufen des Seins bis zur Grenze des Nichts. Das Absolute „schafft“ durch die Vermittlung des Demiurgen, Logos oder Verb außerhalb, der wirklich die unendlich virtuelle Emanantion der absoluten produktiven Potenz ist. Der Demiurg ähnelt in einzigartiger Weise der reinen Reflexion (oder dem Verb) von Fichte: er ist die Hypostase der reinen Reflexion. Andererseits markiert im Neuplatonismus das Absolute den Ziel Terminus einer universellen Bewegung nach rückwärts, einer der geschaffenen Dinge; betrachtet unter diesem Aspekt wird das absolute Prinzip das absolute Gute. Nun aber ist das absolute Gute über der absoluten Intelligenz eingeordnet, über dem Sein sogar oder dem absoluten Objekt: unzugänglich für die Vernunft, liefert es sich nur der Liebe aus, deren ungestüme Fülle, Flut die Relativität überspringt, in die sich die Vernunft noch einschloss. Muss man die enge Verwandtschaft dieser Konzeption mit der eines Absoluten unterstreichen, das nur realisiert ist durch die Selbstverleugnung des Wissens in der Liebe? Im Übrigen lässt der Parallelismus, den wir hier feststellen, uns nicht vergessen, dass der Neuplatonismus eine ontologistische Metaphysik ist, noch ungenügend kritisch, während das System von Fichte, selbst eingeschlossen seine religiöse Philosophie, sich entwickelt auf der Basis eines transzendentalen Idealismus, abstammend aus streng kritischen Voreingenommenheitenâpistrof 430 Die Transzendenz des Absoluten. – Aber wenn das Absolute seine eigene Realität nur hat als etwas über das relative Wissen hinaus, muss man also die Transzendenz des Absoluten mit Bezug auf jedes Objekt dieses Wissens anerkennen, das heißt in Bezug zur Welt. Kehrt die Philosophie von Fichte nicht, im wesentlichen, zurück zur christlichen Theologie, und kann man sie noch als Pantheismus bezeichnen? 347 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 431 Die Frage ist delikat. Sicher hat die Philosophie von Fichte, weniger noch als der Neuplatonismus, nichts gemeinsam mit dem ein wenig summarischen Pantheismus, den man sich bisweilen gern vorstellt. Nichts ist so schwierig zu definieren, wie der Pantheismus in seinem notwendigen Gegensatz zum Theismus. Wir glauben, dass das Problem des Pantheismus sich in ausgeprägten Sinn für das Denken Fichtes nicht gestellt hat. Indem er Gott als transzendentes Sein bejaht, über das Verbum und die Welt hinaus, über die relative Sphäre des Wissens hinaus, glaubte sich Fichte hinreichend rein gewaschen vom Vorwurf des „Atheismus“, mit dem ihn einige überhäuften. Nun aber war der Atheismus, den man im Auge hatte, in Wirklichkeit der Pantheismus nach der Art von Spinoza. Man versteht auch den Nachdruck, den der deutsche Philosoph darauf legt, seinen Fall von dem des cartesischen Denkers zu trennen. Dieser schloss kraft des Postulats der absoluten Objektivität nur der klaren Ideen, das Universum und Gott selbst in den Grenzen des Wissens, oder, wie Fichte sagte, in den Grenzen der Reflexion ein: So vermindert wurde das Absolute rein immanent in der Vernunft und der Welt kommensuriert (von gleichem Maß). Fichte entgeht zweifellos dieser Klippe: das, was bei ihm der Vernunft rein immanent ist und der Welt kommensuriert ist, das ist nicht Gott, das ist das äußere Verb, das Bild von Gott. Und wenn es dabei eine Immanenz Gottes zur Welt gibt – das ist wohl in einem gewissen Sinn nötig – dann ist sie von dynamischer Ordnung, nicht von statischer Ordnung1 . 1 Vergleiche 2. Einleitung, zit.Edit. Band I S.495, Anmerkung.Originaltext: Wenn ich, worauf es ankommt, kurz zusammenfasse: alles Seyn bedeutet eine Beschränktheit der freien Thätigkeit. Nun wird diese Thätigkeit entweder betrachtet, als die der bloßen Intelligenz (als des Subjekts des Bewusstsyns)- Was gesetzt wird, als nur diese Thätigkeit beschränkend, dem kommt zu lediglich ein ideales Seyn, bloße Objektivität in Bezug auf das Bewusstseyn. Diese Objektivität ist in jeder Vorstellung, selbst der des Ich, der Tugend, des Sittengesetzes u.s.w., oder bei völligen Erdichtungen, einem viereckigen Circel, einer Sphinx u. dergl., Objekt der bloßen Vorstellung. Oder die freie Tätigkeit wird betrachtet, als wirkend, Kausalität habend : dann kommt dem sie Beschränkenden zu reelle Existenz: die wirkliche Welt. Beziehung des Verbum und der Welt. – Diese Vorbehalte Fichtes genügen noch nicht, ihn gegen jede Form des Pantheismus abzusichern. Zeigen wir kurz, wo der delikate Punkt liegt, von dem die theistische oder pantheistische Qualifikation des idealistischen Systems insgesamt abhängen kann. Zuerst, es ist kein Zweifel, dass der Gott der „Religions-Philosophie“ identisch ist, im Denken von Fichte, mit dem absoluten Prinzip oder dem absoluten Ziel, betrachtet in ihrem an sich und nicht relativ zur Kreatur. Aber Gott wäre nicht – wie er sein muss – absolutes Ich oder absoluter Geist, wenn er nicht sich auf sich selbst reflektieren würde. Indem er sich reflektiert, zeugt er seit aller Ewigkeit das Verbum; das heißt dass das absolute Prinzip, 348 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte 432 in seiner Unendlichkeit, sich selbst setzt als „schöpferische Virtualität“, als virtuelles Bild von sich oder als mögliche Welt. In diesem ersten Moment ist das Verbum „reine Reflexion“, gleichewig mit dem Vater und unendlich wie der Vater. Das ist die „Natura naturans“ präzisive (genauer zu präzisieren) in sich betrachtet. Aber die „schöpferische Virtualität“ hat für uns noch keine Realität, wenn sie nicht übergeht zum Akt. Das ewige Verbum verwirklicht sich also im Universum; es ist dabei effektive Schöpfung und nicht mehr nur virtuelle Schöpfung. Und diese effektive Schöpfung findet der Quantität nach nur sukzessive statt: denn wir haben gezeigt in der Wissenschaftslehre, dass die reine Reflexion sich „für uns“ nur realisieren könnte vermittels einer unbegrenzten Sukzession von „Begrenzungen“ des reinen Ich oder der absoluten schöpferischen Potenz. Das ewige Verbum, reine zur Reflexion fähige Virtualität des Vaters, entäußert sich also und aktualisiert sich durch ein räumliches und zeitliches Werden. Unter diesem zweiten Aspekt ist es „Natura naturata“, objektives Werden oder wenn man will, evolutives Verbum, außerhalb Gottes. Nun aber, wir müssen folgendes gut anmerken: die Setzung des Verbum als reine Reflexion, reine schöpferische Virtualität, reine göttliche Nachahmbarkeit, gleichewig mit Gott ist so notwendig wie die absolute Setzung des ursprünglichen Prinzips selbst. Ohne Reflexion in der Tat, wäre Gott nur ein blinder Drang, unbestimmt, amoralisch. Gott wäre nicht Geist; er wäre nicht nur etwas Metarationales sondern etwas Antirationales, Monstreuses, folglich Unmöglliches. Diese ursprüngliche Reflexion zeigt sich also untrennbar vom absoluten Prinzip oder von Gott. Aber die zweite Form des Verbum, das Verbum außer Gott, die schöpferische Evolution, die sich aktiv auswickelt (éployer) vermittels der unendlichen Palette der möglichen Bestimmungen des absoluten Geistes, mit einem Wort, das evolutive Verbum: ist das notwendig gesetzt durch die Tatsache, dass in Gott das ewige Verb gesetzt ist? Man muss wohl gestehen, dass das ganze System von Fichte hier nach einer bejahenden Antwort ruft. Die reine Reflexion des Ich (= des absoluten Geistes oder Gottes) hat unausweichlich zur Folge, so scheint es, die „Begrenzung“ im Ich, das heißt die aktuelle Schöpfung. Sagen wir anders: die Hervorbringung des ewigen Verbum als virtuelles Bild Gottes, leitet notwendig die aktuelle und objektive Evolution des Verbum in der Welt ein. Aber präzisieren wir weiter, denn am Grunde des Fichtenschen Beweises verbirgt sich vielleicht irgendein rationales Bedürfnis, das wirklich annehmbar ist selbst von denen, die die Notwendigkeit der Schöpfung ablehnen- Durch die Tatsache, dass Gott sich seit aller Ewigkeit setzt als vor dem in seinem Verb objektiv reflektiert Werden, setzt er die volle Aktualität des Verbum als eine absolute Forderung, deren Charakter zugleich moralisch (Sollen) und naturartig ist. Um wirklich er selbst zu sein insofern er Geist oder Ich ist, muss das Absolute sich, von sich selbst her nicht in irgendeiner Weise besitzen 349 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 433 sondern adäquat in seiner eigenen Form. Wir können also schließen von der reinen Notwendigkeit einer Reflexion in Gott, auf die notwendige Fertigstellung dieser Reflexion, wir können schließen vom Verb, virtuelles Bild Gottes auf das Verb vollkommenes Bild Gottes. Aber ist es wahr, dass der Übergang von der reinen Reflexion zur vollkommenen Reflexion nur möglich ist vermittels einer sukzessiven Reihe von partiellen Begrenzungen des Ich? Ist es wahr, dass das Anfangs-Verbum, reine Virtualität, das aktuell unendliche nur wird, indem es sich entwickelt wie durch ein kosmisches Werden, das heißt, indem es erschafft? Eine psychologische Notwendigkeit. – Tatsächlich können wir uns den Übergang von der reinen Reflexion zur voll aktualisierten Reflexion nicht anders vorstellen. Und man begreift leicht den Grund dieser Unfähigkeit. Eine „reine Form“ wird für uns nur vorstellbar in einem objektiven Begriff, der die Bedingung hat, einen „Inhalt“ zu empfangen, Nun aber kommt uns der einzig mögliche Inhalt unserer Begriffe aus der Sinneswahrnehmung: er ist nichts anderes als die unendliche materielle Vielfalt, unterworfen den Gesetzen von Raum und Zeit. Und diese materielle Vielheit kann nur eine einzige Weise der objektiven Realisierung haben: das Werden; und noch mehr, nicht das reine metaphysische Werden, sondern das zeitliche und räumliche Werden, das heißt die Bewegung. Der Übergang vom Anfangs-Zustand des Verbum (oder der Reflexion) zu ihrem perfekten und endgültigen Zustand, übersetzt sich also notwendigerweise in unserem Bewusstsein durch das Bild des kosmischen Werdens; die reine Form des Verbum, um aus der Abstraktion herauszukommen und sich zu aktualisieren in unserem Bewusstsein, muss sich also beladen (unternehmen etwas zu tun) mit einer indefiniten Reihe von sukzessiven Bestimmungen. Kurz, das Verbum ist nur „vorstellbar“ für uns, ausgedrückt in der Schöpfung. Aber man sieht unmittelbar, dass diese Notwendigkeit beschränkt bleibt auf die psychologische Ordnung; sie hängt an der menschlichen Weise der Vorstellung, die vielleicht selbst kontingent ist; das ist die Notwendigkeit eines subjektiven Symbolismus unseres Denkens, nicht die Notwendigkeit einer absoluten Evolution des Verbs. Diese letztere Notwendigkeit würde existieren, wenn das Band, das in unserem Bewusstsein das ewige Verbum und die aktuelle Schöpfung vereinigt, logisch wäre und nicht nur psychologisch. Nun aber ist es in der streng logischen Ordnung wohl wahr, dass die objektive Begrenzung der schöpferischen Handlung, das heißt die aktuelle Schöpfung nur möglich ist durch das Verbum, das heißt mittels einer Reflexion der absoluten Aktivität auf sich selbst. Das Verbum ist wahrhaft die Bedingung der Möglichkeit der Schöpfung. Aber bietet der umgekehrte Satz dieselbe logische Evidenz? Ist die Reflexion der absoluten Aktivität nur möglich in einer objek- 350 III.–Kritische Bemerkungen zum Idealismus von Fichte 434 tiven Begrenzung dieser Aktivität? Oder ist das Verbum konzipiert ohne die aktuelle Schöpfung ein widersprüchlicher Begriff, eine logische Absurdität? Die pantheistische Lösung.– Wenn man darauf nur antwortet Ja – und es scheint wohl, dass das das Denken Fichtes ist1 – opfert man wirklich dem Pantheismus: 1 [P. Maréchal hat hier eine Bemerkung eingefügt, die von einer Datierung viel später als die Redaktion seines Textes stammen muss, und die wir wie folgt lesen: vergl. tatsächlich das dritte fundamentale Prinzip. Aber hat Fichte es nicht fallen lassen? Vergl Fichtes Sohn, in seines Einleitung zu Sämmtliche Werke (Vorrede des Herausgebers), t.I Seite VIII –Bemerkung der Herausgeber] denn die Welt, die objektive Schöpfung, wird so ein notwendiges Moment des internen evolutiven Zyklus Gottes. Gott kommt zum Bewusstsein seiner selbst und verwirklicht sich dadurch voll, nur indem er sich zum Objekt in der Schöpfung macht. Im Grunde ist nicht nur die Welt relativ zu Gott, sondern Gott ist relativ zur Welt: Die Relation wird reziprok. Durch eine verbale Fiktion setzt man noch Gott und die Welt einender entgegen, das Absolute und das Relative, aber im ganzen genommen, gibt es nur den einen Gott, nur ein Absolutes: die Gesamtheit. Die Totalität verwechseln mit dem Absoluten, das ist genau das eigene Kennzeichen des Pantheismus. Und dahin führt unvermeidlich jede philosophische Konzeption, die die Kontingenz der Schöpfung auslöscht. 435 Die theistische Lösung.– aber auf die weiter oben gestellte Frage: ist der Begriff des Verbum, getrennt vom Begriff einer aktuellen Schöpfung widersprüchlich? – kann man antworten: Nein. Das heißt dass man mehr oder weniger sich nicht für berechtigt hält, eine absolute Reflexion, die keine objektive Begrenzung mit sich bringt, für unmöglich zu erklären. In diesem Fall gäbe es am Ursprung der Schöpfung einen Akt der vollkommenen Freiheit: die notwendige Relation der Welt zum Absoluten wird so einseitig und schließt so jeden Pantheismus aus. Wenn man sich an den begrifflichen Symbolismus von Fichte hält, kann man sicherlich fortfahren zu sagen (indem man so die trinitarische Lehre übersetzt, geoffenbart als Objekt des Glaubens, aber schon stark nahegelegt durch die Analogie unserer Vernunft) kann man fortfahren zu sagen, dass das absolute Prinzip (der Vater) sich objektiviert, das heißt sich reflektiert in Verbum und dass die Liebe, die das Verbum (den Sohn) durch den Vater zeugen machte, das Verbum selbst zur Identität mit dem ursprünglichen Prinzip zurückbringt. Die Liebe oder der Hl. Geist wäre die reziproke Synthese von Vater und Sohn. So würde sich selbst im Inneren Gottes, ein vollkommener Kreis schließen mit drei gleichen Momenten, die teilhaben am selben absoluten Wesen, aber unterschieden durch ihren relativen Gegensatz: Prinzip, Form, gegenseitig Liebe: Setzung, Reflexion, Synthese. 351 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte In dieser Konzeption wäre die reine Reflexion des absoluten Geistes auf Anhieb, durch das Privileg der Unendlichkeit, aktuelle und vollkommene Reflexion, ohne irgendwie sich vervollkommnen zu müssen, indem man das geschaffene Werden durchläuft. Durch Beziehung zum göttlichen Zyklus würde also die ganze Schöpfung die Geltung eines kontingenten Epizyklus annehmen. Mit einer souveränen Freiheit würde sich das transzendente Verbum, gleichewig mit dem Vater als geschaffenes, der Welt immanentes Verbum entäußern (Logos spermatikos). Dieses äußere Verbum, diese schöpferische Handlung, wäre das Sein selbst der Kreatur als Kreatur. Durch das Verbum leitet sich diese vom Vater her. Die Form, die sie annimmt, spiegelt die Form des Verbum selbst, entsprechend einer indefiniten Sukzession von intensiven und extensiven Graden; und die Kommunikation, die das Verbum macht mit der Kreatur, sowohl von sich selbst als Form des Seins, als vom Vater als Quelle des Seins, ist notwendigerweise begleitet von einer proportionalen Beteiligung der Liebe, die den Vater und den Sohn bewegt: Teilhabe ausgedrückt in der inneren und radikalen Finalität aller Dinge. Das Geschöpf würde so erscheinen, dank der freien Vermittlung des Verbum, als kontingentes, veränderliches und progressives Bild der unveränderlichen Trinität. 436 Das Problem des Übernatürlichen.– Die Konzeption, die wir gerade skizzierten, entgeht jedem Verdacht des Pantheismus. Dennoch erreicht sie noch nicht, vom theologischen Gesichtspunkt her, die wünschenswerte Präzision, da sie in der Schöpfung überhaupt nicht die natürliche Finalität unterscheidet von der übernatürlichen Finalität. Tatsächlich stellt sich hier ein unangenehmes Problem, was auch immer man macht. Scheint es nicht, dass der geschaffene Epizyklus, obwohl hervorgebracht und bewegt durch das göttliche Absolute, sich ganz und gar entwickeln muss außerhalb dieses Absoluten und dass folglich die Reflexion unserer Intelligenz über sie selbst dabei nur einem begrenzten Prinzip und einem begrenzten Ziel begegnen kann? Andererseits haben wir das Bewusstsein, dass die radikale Tendenz unseres Wollens – unser „natürliches Verlangen“ würde der hl. Thomas sagen, „der Lebens-Instinkt der Liebe“ wiederholt Fichte – uns über jedes geschaffene Ziel hinaus trägt; die Liebe in uns bricht den kontingenten Kreis der schöpferischen Handlung auf und veredelt ihn, pfropft ihn auf auf den absoluten Zyklus des göttlichen Lebens. durch das immanente Verbum sucht sie das ewige Verbum, und in diesem, das absolut absolute Prinzip, den Vater. Geheimnisvolle Identität der absoluten Liebe und der relativen Liebe; unbegreifliche Kontinuität unserer Finalität der geschaffenen Intelligenzen, mit dem ewigen Rückfluss vom Verbum im Vater. Ist da eine logische Absurdität? Hat unsere Vernunft das 352 Zusammenfassung und Schlussfolgerung. 437 Recht diese Perspektive kategorisch zu versperren? Man wird nicht wagen, das zu behaupten. Aber andererseits man ahnt noch weniger die metaphysische Möglichkeit, das „Wie“ einer so rätselhaften „Ubernaturalisierung“ der Natur. In Wahrheit, wenn die Philosophie, vorgestoßen bis zu ihren letzten Konsequenzen, zwingt, das Problem des Übernatürlichen zu stellen, kann die geoffenbarte Religion allein das Rätselwort geben. Und diese erklärt uns, dass außerhalb der Einfluss Sphäre des Christentums in den Philosophien der Antike zum Beispiel, diese Frage der Notwendigkeit oder der Kontingenz der Schöpfung nie völlig entwirrt worden ist. Wir sind dabei zu zeigen, dass die letzte Lösung davon mit dem religiösen Problem verbunden ist, und dass, die absolute Transzendenz Gottes setzen gleichkommt mit dem setzen des Problems – für die Vernunft beunruhigend – einer nicht nur natürlichen sondern übernatürlichen Bestimmung. Auch wird man nicht erstaunt sein, bei allen antiken Philosophen festzustellen, eine Unsicherheit und Lücken genau bezüglich zweier Punkte, die den Höhepunkt der Metaphysik und der Moral markieren, nämlich bezüglich des „Ziels des Menschen“ und bezüglich der „Natur Gottes“. [Man gestatte uns, diese Überlegungen in unserem Heft VI wieder aufzugreifen: nach der vertieften Untersuchung, die wir dort machen müssen von der thomistischen Epistemologie, wird es uns leichter sein, die Stelle klar zu erkennen, wo sich im Problem der Erkenntnis das spezifisch religiöse Problem des Übernatürlichen einfügt.] Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Fichte gab sich sehr wohl Rechenschaft darüber, dass die perfekte systematische Einheit die Zurückführung der Materie des Objekts (= das Gegebene, die räumliche und zeitliche Vielfalt) auf die Form des Subjekts verlangte. Unter vielfacher Rücksicht musste diese Reduktion utopisch erscheinen: dennoch die Erleuchtung, die sie für die Augen Fichtes als möglich offenbarte, war schon in der kantschen Kritik aufgeleuchtet, wo sie andererseits einsam und verkannt blieb: es war der Begriff des Dynamismus der Form oder der Begriff des Aktes. Es fehlt sicher viel, dass es Fichte nicht gelang, a priori aus der „reinen Handlung“ die materielle Vielfalt, den Raum und die Zeit abzuleiten. Wenigstens gelang es ihm, nicht nur in der Form sondern in der Materie des Objekts einen Zusammenhang der dynamischen Kontinuität mit der „reinen Handlung“ (reines Ich, reiner Geist, absolutes Sein)zu zeigen. Auf diese Art und Weise konnte das idealistische System, ganz unter Beibehaltung des Gegensatzes von Materie und Form der Erkenntnis auf der menschlichen Ebene vermittels des konstitutiven Dynamismus oder der „inneren Finalität“ der Objekte die absolute Einheit ihres Prinzips und ihres Ziels zufällig aufdecken. Kant hat in Wahrheit, vor allem in der Kritik der Urteilskraft die a priori- 353 Kap.2: Transzendentaler Idealismus von Fichte 438 sche Notwendigkeit dieser Einheit des Prinzips und des Ziels geahnt; aber er bemerkte dabei noch nur ein regelndes und ästhetisches, der wahren objektiven Notwendigkeit fremdes Bedürfnis des Subjekts. Fichte ließ die Finalität selbst, mit ihrem doppelten, dem retrospektiven (Prinzip) und dem prospektiven (Ziel) Anspruch in das Objekt als solches eintreten. Wir nehmen leicht wahr, vom beherreschenden Gesichtspunkt aus, den wir erreicht haben, den Unterschied, der die drei großen idealistischen Systeme voneinander trennt, vollendete Typen in ihrer Art: nämlich die Systeme von Spinoza, Kant und Fichte. Diese Philosophen begegnen alle drei der antiken Antinomie der Einheit und der Vielheit unter dem geläuterten Ausdruck, den ihnen lange Jahrhunderts gaben. Kant glaubte, nachdem er die rationalen Antinomien reduziert hatte und die empiristische Zerstreuung der Gegebenheiten der Erkenntnis in eine synthetische Einheit verbunden hatte, vor dem statischen Dualismus der Form und der Materie im Objekt stehen bleiben zu müssen: Die absolute Einheit wurde von ihm aus dem Objekt hinaus verbannt, unter diese subjektiv notwendigen methodologischen Gesichtspunkte, die man in der Realität nur erklären kann, indem man sich die Augen verbindet mit der Binde des Glaubens. Vorher schon hatte Spinoza die objektive Einheit der Substanz proklamiert, und setzte so mit einer kühnen Geste den absoluten Monismus. Auch er hielt fest am statischen Gesichtspunkt der Form; das göttliche Sein, einziges Subjekt und universelle Form, schien ihm immanent unter der kosmischen zur Schau Stellung seiner zwei irreduziblen Attribute: dem Denken und der Ausdehnung. Die objektive Gegenüberstellung der Materie und der Form fand sich so verneint und bejaht zugleich in der substantiellen Einheit und der attributartigen Pluralität des immanenten Gottes, höchste Antinomie, zu der das Postulat der absoluten Einheit verbunden mit der rein statischen (objektiven) Betrachtung der Form drängen musste: denn auf eine unveränderliche Form, reine rationale Bedingung, kann es sehr wohl hier die Relation einer Materie geben, aber nicht die Reduktion einer Materie. Die letzte Reduktion der Materie auf die Form, der Vielfalt auf die Einheit ist nur möglich in einem dynamischen Sinn, vermittels einer Form, die zugleich ein Akt ist. Denn eine reine „Form“ kann sich nur mitteilen, dadurch dass sie ihre ursprüngliche Einheit verliert entweder durch Aufteilung oder durch numerische Vervielfältigung, das heißt indem sie aufhört reine Form zu sein, indem sie sich „materialisiert“ in einem gewissen Grad; ein „Akt“ dagegen kann, ohne die ursprüngliche Einheit seines Hervorbrechens, noch seine dynamische Kontinuität zu verlieren, sich ausdehnen und sich multiplizieren in unzähligen „Reflexionen“ auf sich selbst. So, unter der Voraussetzung einer absoluten Einheit, ist die Vervielfältigung der Form nur möglich in der Kontinuität des Aktes; und die Kommunikation des Aktes, die dynamische Emanation bringt 354 Zusammenfassung und Schlussfolgerung. 439 440 die Vervielfältigung der Form mit sich. Siehe da, was Fichte sieht und sich bemüht, sehen zu machen. Von daher konnte die absolute Einheit der Dinge nicht mehr in der Form als solcher gesucht werden: wenn man Abstraktion vom Akt, vom Handeln macht, dann hat Kant recht gegen Spinoza, der Dualismus triumphiert. Aber die absolute Einheit reduzierte sich nicht noch weiter, wie es Kant wollte, auf eine den Objekten äußere methodologische Forderung. Nein, dank dem Dynamismus der Form, fand sich die absolute Einheit nunmehr eingeschrieben, als eine konstitutive Forderung der Objekte in die „aktive Kontinuität“, die der Vielfalt der „Formen“ zu Grunde liegt: die Einheit der Dinge war gar nicht utopisch, sondern sie wird die ihres Ziels – und korrelativ dazu, ihres Prinzips. Dennoch blieb dieser Monismus des Aktes – glücklicherweise für den Monismus der Form (des immanenten und univoken Seins) des Spinoza substituiert, – zugänglich für zwei Interpretationen: die eine pantheistisch, die andere theistisch. Man könnte tatsächlich die vervielfältigende Erweiterung des Aktes zwischen dem absoluten Prinzip und dem absoluten Ziel als eine Notwendigkeit a priori betrachten: Die Welt repräsentierte also eine Gesamtheit von dazwischenliegenden Momenten, die zum inneren und konstitutiven Kreis der Gottheit gehören. Das wäre, wenn man uns diesen Ausdruck erlaubt, die „Natur“ total „übernatürlich“ geworden; aber es wäre auch die Rückkehr zu den unüberwindlichen Antinomien des Spinozismus, dieses Mal übertragen in dynamische Ausdrücke. Außerhalb dieser pantheistischen Interpretation der dynamischen Einheit der Welt bleibt nur eine mögliche Konzeption, die welche die Emanation oder die intensive Erniedrigung des Aktes – mit seinem korrelativen Term, der Vervielfältigung der Form – als ein kontingentes Ereignis, das wir nicht a priori ableiten können. Auf den inneren und für uns undurchdringlichen Zyklus der Gottheit, notwendiger Zyklus von absoluter Notwendigkeit, pfropft sich ein nicht absolut notwendiger Epizyklus der Schöpfung auf. Sicher, die Einheit der Schöpfung bleibt in jedem Fall die dynamische Einheit des Prinzips und des Ziels, aber die Existenz der Schöpfung ist uns befohlen, in der Ausübung gerade unseres Denkens, nach Art einer gelebten „Tatsache“, deren ursprüngliche Bestimmung zu einem transzendenten Bereich der Freiheit gehört, unendlich über den logischen Notwendigkeiten unserer Beweisführung. Wir haben gezeigt, dass die theistische Konzeption, die einzige die nicht auf einen Widerspruch stößt, wenn sie gezwungen ist, das für die Vernunft unlösbare Problem der übernatürlichen Bestimmung zu stellen. 355 Kapitel 3. Die großen idealistischen Systeme 441 Die thomistische Kritik stützt sich auf den Finalismus, der bei der Konstitution des Objektes im Bewusstsein den Vorsitz führt. Nun aber ist das auch der Gesichtspunkt der großen transzendentalen System, die sich ausgaben als die authentischen Fortsetzer der kantschen Philosophie. Sie skizzieren nochmal a priori die Genese des Objekts im Subjekt und ihre Methode ist wesentlich „teleologisch“. Um sie zu charakterisieren gegenüber dem Thomismus, sind zwei gemeinsame Merkmale zwingend geboten und hinreichend: ihr Idealismus und ihr Finalismus. Wir wollen sie schnell unter diesem doppelten Aspekt prüfen, der ihre epistemologische Tragweite definiert. Wir werden uns darauf beschränken; denn die stärker strukturierte Untersuchung der Gesamtheit dieser Systeme würde mehr zu dem Werk über die „metaphysische Deduktion“ gehören, das wir später zu publizieren hoffen. Im übrigen haben wir schon gesprochen bei einigen Entwicklungen des Idealismus von Fichte im Vergleich mit der Kritik von Kant1 . 1 [Über das Datum dieses Kapitel 3 siehe das Vorwort des Herausgeber. – Anmerkung der Herausgeber] §1.–Der Idealismus von Fichte, Schelling und Hegel. 442 Zwischen diesen drei Philosophen und Kant ist, trotz ihrer gemeinsamen Absicht, die Bedingungen der objektiven Wahrheit zu deduzieren, der Unterschied der Haltung bemerkenswert. Eigentlich postulieren alle drei das „Bewusstsein“: das sind sozusagen ihre Anfangsdaten. Und zwar, wohlgemerkt, nicht eine zu verifizierende Hypothese, sondern, wie Fichte es verstand, eine ursprüngliche Bedingung, die sich von ihr selbst her stellt, nach Art einer Handlung, Aktion oder eines ersten Faktums. Wir haben gesehen, wie Kant sich zuerst auf den Standpunkt des menschlichen Geistes stellt, um auszugehen von einer zugleich psychologisch notwendigen und logisch unbestreitbaren Gegebenheit: dem bewussten Objekt. Fichte geht 357 Kapitel 3. Die großen idealistischen Systeme nicht anders vor: alle seine Deduktionen setzen die immanenten Bedingungen der Reflexion des Ich über sich selbst ins Werk, das heißt des Wissens oder des Bewusstseins. Schelling auf seine Weise setzt schon von der ersten Seite des Systems des transzendentalen Idealismus die Tatsache der „Erkenntnis“ voraus, definiert als „Einheit des Subjektiven und des Objektiven1 “. 1 Schelling, System des transzendentalen Idealismus, Übersetzung Grimblot, Paris 1842Seite 1 ff. Bei Hegel, dessen System einen vollständig in sich geschlossenen Kreis bildet, könnte man sich sicher fragen, welches der Angriffswinkel wirklich war, das wirkliche Anfangs Postulat: Das reine Subjekt der Phänomenologie des Geistes oder der reine unbestimmte Begriff der Logik ? Aber in jedem Fall impliziert das „reine Subjekt“, das nach dem „absoluten Wissen“ strebt oder das “reine und unbestimmte Wissen“, das nach der „absoluten Idee“ strebt, in gleicher Weise das Bewusstsein ein, mit seiner inneren Gegenüberstellung des Objektiven und des Subjektiven2 . 2 Vergl. Hegels Werke, Vollständige Ausgabe, Berlin 1832, Bd. II. Phänomenologie des Geistes; Bd.III Logik; Bd.Vi Enzyklopädie, Logik 443 Der wirkliche Ausgangspunkt dieser Philosophen ist also grundsätzlich identisch: sie platzieren sich auf Anhieb ins Herz des Bewusstseins, der Synthese von Objekt und Subjekt. Aber siehe da, wie sich die Divergenz ihrer Orientierungen verrät. Kant analysiert seinen Ausgangspunkt das bewusste Objekt und, indem er ihn verknüpft mit der formellen apperzeptiven Einheit als mit einer höchsten Bedingung a priori, behauptet er nicht, in der Ordnung des absoluten Denkens ein ganz erstes und völlig unbedingtes Prinzip zu erreichen, aus dem sich der integrale Inhalt der Erkenntnis ableiten würde. Ja die systematische Forderung eines absolut ersten Prinzips könnte in seinen Augen am Beginn einer Kritik gar keinen Sinn haben. Wenn er die objektiven allgemeinen Bedingungen unserer Erfahrung streng deduziert, hält er sich an diese Deduktion der „Form“ des Verstandes und erträumte nicht einmal in der Kritik ein unitäres System der Vernunft als solcher zu konstruieren. Diese erwartende und unvoreingenommene Haltung – zu zaghaft, haben wir gesagt – erlaubte ihm in der menschlichen Erkenntnis ein inneres Ungenügen zu erkennen, eine innere Unzulänglichkeit, ein Mangel an vollständiger Innerlichkeit, die er übersetzt durch seine Theorie des „Dings an sich“. Die Epistemologie Kants bleibt dualistisch. Dagegen – man kann es sehen von den ersten Zeilen der Wissenschaftslehre Fichtes an – dieser und seine Nachfolger nehmen auf Anhieb den Gesichtspunkt unseres Bewusstseins auf unter dem Gesichtspunkt der absoluten Vernunft, die sich selbst für sich genügt. Als rationales Fundament fordern sie ein 358 §1.–Der Idealismus von Fichte, Schelling und Hegel. 444 absolut erstes und unbedingtes Prinzip (unbedingt nicht nur quoad se, sondern quoad nos), von dem aus sich abrollen muss mit einer unbeugsamen Strenge die ganze Entwicklung des Denkens. Man unterscheidet ohne Schwierigkeit das unter diesem Versuch versteckte Postulat. Es kann nur Erfolg haben, wenn die Bewegung selbst unserer objektiven Vernunft, die das „System der Vernunft“ aufbaut, sich völlig verschmilzt mit der notwendigen Bewegung eines absoluten Denkens, eines schöpferischen Denkens. Tatsächlich, wenn es nicht so wäre, wenn unsere objektive Vernunft sich zufällig außerhalb der Achse fände, nach der sich ein absoluter und schöpferischer Gedanke entwickelt, könnten wir nicht eine Theorie der Vernunft nur auf dem Umweg aufstellen, die einer unserer unvollkommenen Natur eigenen Neigung folgt; wir müssten diesen schrägen Einfall berücksichtigen und in unsere Epistemologie einen „relativen Koeffizienten“ einführen, der sie zu einem Dualismus führt nahe beim kantschen Dualismus. Nun aber reflektiert nach dem Thomismus unser Denken das absolute Denken, ohne vollständig mit ihm zusammenzufallen: da wo das absolute Denken schöpferische Energie ist, ist das unsere nur Streben nach Verähnlichung. In dem Sinn, aber nur in diesem, werden wir in dem, was wir sagen werden, uns die Kritiken zu eigen machen, mit denen die Schule von Fries „das systematische Vorurteil der großen Transzendentalisten“ belastet. Denn dieses Vorurteil bestand darin, nicht nur eine strenge Deduktion des Objekts zu machen, wie Kant es sich selbst vornahm, sondern eine objektive Deduktion machen zu wollen, die repräsentierte in ihrem Prinzip und selbst ihrem Gang, die absolute Entwicklung des Gedankens als solchem. Kein Zweifel, dass dieser letztere Anspruch, der als Korollar den idealistischen Monismus zur Folge hat, nicht ein sehr überheblicher Dogmatismus ist und nicht sehr stark die unserer objektivierenden Intelligenz inhärente Forderung (Bedürfnis) sehr stark überschreitet. Trotz allem hätte vielleicht die systematische Tendenz nicht bis zum absoluten Idealismus geführt, ohne die Unterstützung, die sie in einer wirklichen Schwierigkeit der kantschen Kritik fand: wir machen hier eine Anspielung auf den Begriff des „Dings an sich“. Wir haben weiter oben gesagt, wie diese Schwierigkeit die Ursprünge der Philosophie von Fichte beeinflusste. Tatsächlich rechtfertigt sich der kantsche Begriff, selbst als rein problematischer Begriff, des „Dings an sich“ nicht, ohne eine bewusste oder unbewusste Berufung auf die aktive Finalität des Subjekts: außerhalb einer schöpferischen Intuition erlaubt nur die Beziehung der Finalität dem Subjekt, sich aktiv über sich selbst hinaus auszubreiten. Da Kant diesen delikaten Punkt nicht klar gemacht hat, versteht man, dass die Unmöglichkeit eines „Dings an sich“, so wie er es zu verstehen schien, als ein vorläufiges Axiom angenommen wurde von der Dreiergruppe der Transzendentalisten. Nach Unterdrückung des „Ding an sich“ wurde der absolute Idealismus ein einfaches Korollar der psychologischen 359 Kapitel 3. Die großen idealistischen Systeme 445 446 Immanenz des erkannten Objekts: denn aller Inhalt des Bewusstseins muss also nicht nur dem Subjekt innerlich sein sondern ausschließlich hervorgehen aus dem Subjet. Und das systematische Streben hatte freies Feld. Sehen wir nun, wie die großen deutschen Transzendentalisten, eingesperrt in den Gesichtspunkt der totalen (nicht nur psychologischen sondern objektiven) Immanenz, glaubten ihre deduktiven Systeme konstruieren zu können. Wir wissen, dass Fichte versuchte selbst bis zu den Quellen des Bewusstseins aufzusteigen und sich als erstes Prinzip das unbestimmte „Sollen“ gab, das „reine Ich“, das unter dem Imperium der ganz einfachen moralischen Notwendigkeit sich objektiv zu besitzen, in sich selbst zu überwindende Begrenzungen schafft und sich fortschreitend erkennt in seinem inneren Gegensatz zu den Grenzen, die er sich auferlegt. Aber in den Ausdrücken selbst der Wissenschaftslehre, der ersten Etappe des Idealismus von Fichte, erweitert sich diese Besiegung seiner selbst durch sukzessive Bestimmungen in das Indefinite: sie übersetzt sich durch eine Werden ohne Ziel (Ende?) orientiert auf eine absolutes Wissen, das ein unerreichbares Ideal bleibt. Die erste Philosophie von Fichte akzeptiert also die (rationale) Unfertigkeit der aktiven Tendenz: das ist eine Theorie des Bemühens um das Bemühen, nicht des Bemühens nach einem bestimmten Ziel. Hegel warf ihm lebhaft vor, sich so zu berauben, sich so der Umklammerung der Vernunft zu entziehen durch eine ausweichende Perspektive und sich freiwillig zu verlieren in das „Mysterium“Das „Mysterium“ wurde noch undurchdringlicher in der zweiten Philosophie von Fichte. Wir haben gesehen, wie sie einen Ausweg öffnete auf die Transzendenz des Absoluten hin. Die Vernunft, getragen von der Sehnsucht oder von der Liebe, übersteigt sich selbst, indem sie sich selbst verneint: sie setzt so das absolute Ziel über das Wissen hinaus. Man muss gestehen, dass Fichte, nachdem er die Passivität der Sinneswahrnehmung reduziert hat auf die immanente Aktivität des Bewusstseins als solchem und dadurch einen Aspekt des kantschen „Dings an sich“ gemeistert hat, dem Griff des bewussten Ich den letzten Term des Strebens entkommen sieht: auf dem Baumstumpf des idealistischen Monismus, entsteht aus der inneren Finalität neu ein realistischer Dualismus, noch zaghaft und sich vorantastend. Übertragen vom bewussten Ich auf ein absolutes Ich – oder auf ein absolutes Sein – über das Bewusstsein hinaus, die Immanenz der Objekte ist nicht mehr die strenge Immanenz des Idealismus. Das System von Fichte, in der zweiten Periode dieser Philosophie, bleibt pantheistisch, zweifellos, aber hört auf, es unheilbar und hoffnungslos zu sein. Es ist nicht leicht, mit wenigen Worten den Unterschied zwischen dem subjektiven Idealismus von Fichte und dem objektiven Idealismus von Schelling zu kennzeichnen. Versuchen wir dennoch, zu zeigen, warum der zweite einem immanenten Pantheismus nach der Art von Spinoza näher ist. In der ersten und der zweiten Periode seiner Karriere setzt Schelling nach- 360 §1.–Der Idealismus von Fichte, Schelling und Hegel. dem Beispiel Fichtes an die Basis jedes Systems der Vernunft ein unbestimmtes Absolutes, das fortschreitend das volle Bewusstsein seiner selbst erlangen muss, das heißt absoluter Geist werden muss. Nur setzte Fichte an den Ursprung dieses rationalen Werdens die subjektive Identität des reinen Ich mit sich selbst (Ich = Ich), oder wie Hegel sagt das subjektive Subjekt-Objekt; die objektive Identität des Ich mit sich selbst, das heißt die volle Objektivierung des Ich vor ihm selbst war von Fichte nur behauptet als ein „Sein Sollen“, ein Ideal (Ich soll gleich Ich sein)1 1 Vergl. Hegels Werke, Bd.I Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, 1801, Berlin 1892 Seite 163-164 447 Schelling dagegen gibt sich unmittelbar ein Absolutes, das weder Subjekt noch Objekt ist, weil es in jedem Augenblick die Identität des einen und des anderen konstituiert. Tatsächlich, nach diesem Philosophen sind die Natur (Objekt) und der Geist (Subjekt) konstant und streng komplementär im Verlauf des Werdens: ihre Summe bleibt unveränderlich und gleich dem Absoluten. Das Werden befällt also nicht direkt das Absolute sondern nur die zwei korrelativen Terme, in die sich ursprünglich das Absolute differenziert: das Objekt und das Subjekt, die Natur und der Geist. Das Subjekt wickelt sich indefinit aus in objektive Bestimmungen, absolut genauso wie bei Fichte; dennoch ist hier für Schelling nur ein partieller Aspekt der Philosophie: der komplementäre Aspekt, der welcher den Aufstieg des Objekts zum Subjekt hin zeigt, ist nicht weniger legitim. Und Schelling nimmt von da bevorzugt sein Perspektivitätszentrum: seine Philosophie, die, für die er die Originalität beansprucht, ist vor allem die Philosophie der objektiven Bestimmungen oder von der „Natur“. Die Natur, sagt er, ist ein „subjektiviertes“ Werden im Absoluten und dort zum Geist hin tendierend – „die Natur ist unbewusster werdender Geist“ oder auch „die Natur ist das werdende Ich“; die Natur ist das Ich, undeutlich aufsteigend zum Bewusstsein von sich, das ist das Ich „in Potenz“: die Virtualitäten der Natur (Potenzen) werden die Ideen des Geistes (Ideen). Das Ziel der Natur – ideales Ziel, reine Grenze – besteht also in der vollständigen Vergeistigung der Materie wie das Ziel – ebenso unerreichbar – des handelnden Geistes sein wird die vollständige materielle Entäußerung seiner eigenen Form. Diese zwei Strömungen, dem Absoluten immanent, das davon die tiefere Einheit erhält, bilden jeweils das Objekt der Naturphilosophie und der transzendentalen Philosophie. „Ebenso, schreibt Schelling, wie die Wissenschaft der Natur den Idealismus aus dem Realismus heraussteigen lässt, indem sie die Gesetze der Natur in Gesetze der Intelligenz vergeistigt, oder indem sie das Materielle dem Formalen unterwirft, ebenso zieht die transzendentale Philosophie den Realismus aus dem Idealismus, weil sie die Gesetze der Intelligenz materialisiert in Gesetze der Natur, oder führt das Formale ins Materiale 1 “. 361 Kapitel 3. Die großen idealistischen Systeme Die Originalität von Schelling ist es, ein gleiches Recht der Erwähnung bewilligt zu haben den zwei umgekehrten Reihen in der fundamentalen Identität, die ihnen zugrunde liegen. 1 448 System des transzendentalen Idealismus. Übersetzung Grimblot, Paris 1842 S.17 Nun ist es genau diese fundamentale Identität, die sozusagen dem doppelten Werden des Objekts und des Subjekts zugrunde liegt, die Schelling Spinoza so annähert, dass sie eine nicht pantheistische Interpretation des objektiven Idealismus unmöglich macht. Eine Theorie, die das Absolute als dynamisches Prinzip und als letztes Ziel des universellen Werdens aufstellt, kann sich orientieren entweder zum Pantheismus hin oder zum traditionellen Theismus hin; aber eine Theorie, die das Absolute als universelles Subjekt aufstellt (Subjekt oder Suppositum; substantielles immanentes Prinzip) findet sich zum Pantheismus gezwungen. Denn indem man aus dem Absoluten die permanente Totalität des Werdens macht, lässt es keinen Platz mehr für eine wahrhafte Transzendenz. Von einem ganz anderen Gesichtspunkt her, das ist wahr, wirft Hegel auch Schelling vor, er habe sozusagen das Absolute „substantifiziert“ und auf diese Weise den idealistischen Monismus auf einen Dualismus reduziert. Tatsächlich, merkt er an, widersetzt sich die ursprüngliche Entität (das Urwesen), die indifferente Identität des Subjektiven und des Objektiven in irreduzibler Weise seiner notwendigen Differntiation in Natur und Geist: denn die Identität oder die Totalität kann nicht das Prinzip sein für die Differenz. Der Dualismus ist mehr verdeckt als reduziert1 Auch Hegel stellt sich die Aufgabe, die Differenziation in das Absolute zu reintegrieren. Aber so, sagt er, kann das Absolute nicht mehr definiert werden wie bei Schelling, „als die totale Indifferenz des Subjektiven und des Objektiven2 “ 1 Vergl. Hegels Werke, Bd. I, Berlin 1832. Differenz des Fichtenschen und Schellingschen Systems passim – Hegel, Phänomenologie des Geistes, in Hegels werke, Bd.II oder Lasson, Leipzig, 1907 Vorrede II, 1 Seite 12-13 2 Phänomenologie des Geistes l.c. Der Schlüssel des Systems von Hegel muss gesucht werden in der Idee (absolute Idee). Fichte legte den Akzent auf das reine Ich (das reine Subjekt), das indefinite sucht sich zu erkennen, indem es sich objektive Begrenzungen auferlegt: die Natur nahm so die verblasste Rolle eines einfachen Mittels im sich selbst erfüllenden Bemühen des Ich an. Schelling restituierte der Natur ihren normalen Platz an der Seite des Geistes in der unveränderlichen und indifferenten Identität eines zugrundeliegenden Absoluten. Mit einem Wort, bei Fichte ist das Absolute nicht, das Werden allein ist; bei Schelling ist das Absolute, aber es 362 §1.–Der Idealismus von Fichte, Schelling und Hegel. 449 wird nicht: nur die Differentiationen „werden“. Bei Hegel dagegen ist das Absolute und wird zugleich: seine Evolution durchläuft einen inneren Zyklus, der sich in sich selbst schließt und von denen alle Momente sich logisch einender aufrufen. Der subjektive Gesichtspunkt und der objektive Gesichtspunkt repräsentieren die fundamentalen Momente dieser zirkulären Entwicklung. Tatsächlich, wenn man das Absolute als Subjekt betrachtet, durchläuft man entsprechend einem Fortschreiten, das erinnert an die „pragmatische Geschichte des Bewusstseins“ (Fichte), alle Stufen des notwendigen Aufstiegs des reinen Subjekts auf das vollendete Bewusstsein zu, das heißt nach dem Ausdruck Hegels auf das „absolute Wissen“ zu. Von solcher Art ist das Hauptthema der Phänomenologie des Geistes. Wenn man das Absolute in seinen objektiven Manifestationen betrachtet, erhält man eine Wissenschaft der Dinge, konzipiert als Entäußerung der subjektiven Aktivität, und das angefangen von den Phänomenen der Natur bis zu den höheren Produkten des Geistes (“objektiver Geist“) und bis zum absoluten Geist selbst (“absoluter Geist“). Aber die zwei Reihen – objektiv und subjektiv – sind, so sagten wir, nur die Entwicklung der partiellen und korrelativen Momente in der inneren Evolution des Absoluten. In ihrem idealen Term haben sie die Tendenz, in einander überzugehen. Und in ihren verschiedenen Etappen verraten sie eine synthetische Einheit, die sich mit ihnen und durch sie aufbaut. Kennen wir an sich diese synthetische Einheit des Objektiven und des Subjektiven? Zweifellos. Und sie konstituiert die ursprüngliche und unmittelbare Gegebenheit, aus der alle Kritik der Erkenntnis hervorgeht: Der Begriff (Konzept). Der Begriff ist weder sich auf das Bewusstsein hin entwickelndes Subjekt, noch im Bewusstsein entäußertes Objekt: es ist die gemeinsame Grenze, wo sich das eine im anderen absorbiert, zugleich Akt als Subjekt und Form als Objekt. Indem wir uns entschlossen in den Begriff als solchem platzieren, besitzen wir also die zentrale Achse des universellen Werdens. Und es würde uns genügen, um ein ganz und gar rationales System zu errichten, die logisch notwendigen Etappen dieses Werdens zu definieren. Das ist es, was Hegel machte in seiner Logik. Ausgehend vom unbestimmten Begriff des Seins, und die „dialektische Methode“ anwendend, die darin besteht fortschreitend den Begriff von seinen latenten Widersprüchen zu entleeren, deduziert Hegel die komplette Verkettung der logischen Momente, die wir die „Kategorien“ nennen, und platziert als Krönung, als Schlussstein des Gebäudes, oder genauer als letzte Bedingung der Möglichkeit des durchlaufenen Werdens die absolute Idee. Auf diesem Gipfelpunkt des logischen Werdens erinnert sich Hegel an die des Aristoteles. Man begreift den Fortschritt, den dadurch gegenüber dem Gesichtspunkt von Fichte und Schelling zu verwirklichen, sich Hegel rühmt. Ein rein subjektives Werden kann sich verlieren im Indefiniten: es impliziert die Forderung Nìhsic no sewc nìhsic 363 Kapitel 3. Die großen idealistischen Systeme 450 eines Absoluten, ohne dafür das Absolute zu ergreifen . Ein Werden, sei es subjektiv, sei es objektiv, gestützt auf ein zugrunde liegendes Absolutes, bleibt von diesem unterschieden, wie die Differenzierung verschieden bleibt von der reinen Identität, was auch immer man macht. Aber ein logisches Werden, so wie es Hegel setzt, ist in jeder seiner Phasen streng immanent der letzten Synthese, die es möglich macht und die es auf ihre Weise dabei durchdringt. Denn es ist die Eigentümlichkeit einer höchsten rationalen Bedingung der Möglichkeit, zugleich den Terminus jeder logischen Evolution des Bedingten zu konstituieren und die implizite Voraussetzung der ersten Setzung dieses Bedingten selbst. Das logische Werden faltet sich also zurück auf seinen Ursprung; in seinem Prinzip (=Anfang) schon setzt es das absolute Ziel (=Ende): es realisiert die perfekte Immanenz und den strengen Monismus nach dem Ideal des ausschließlichsten Rationalismus. Das „Mysterium des Übernatürlichen“ verliert da mit Recht den problematischen Platz, den ihm noch lassen würde über oder neben der Vernunft Kant und Fichte und selbst Schelling. Um die Originalität des Systems von Hegel wahrzunehmen, muss man in ein und derselben Betrachtung die Phänomenologie des Geistes und die Logik miteinander verbinden. Ohne die Phänomenologie des Geistes würden wir Gefahr laufen, die Logik für ein Gerüst von Abstraktionen zu halten, ohne die Logik könnten wir uns unfähig fühlen, den Gesichtspunkt eines indefiniten subjektiven Werdens zu überschreiten: wir würden wohl ein reines Prinzip und ein aktuelles Werden erhalten, aber nicht den Endpunkt (Terminus) des Werdens. Und das Absolute würde so dem Zugriff unserer Vernunft entkommen. Allerdings muss man nach Hegel vom Absoluten sagen, dass es wesentlich ein Resultat ist, dass es seine eigene Realität nur am Endpunkt [seines Werdens] ist. Und darin genau besteht seine Natur der aktiven Realität, des Subjekts, oder des Sichselbstwerdens. Dagegen ist das Beginnen, das Prinzip oder das Absolute in seinem unmittelbaren Anfangs- Ausdruck nur das [unbestimmte] Universelle 1 1 451 Hegel, Phänomenologie des Geistes, edit. Lasson, Leipzig 1907, Vorrede I, 1 Seite 14 Wenn man also sich an diesen subjektiven Gesichtspunkt halten würde, würde das System der Vernunft sich nicht notwendig vollenden, da das Werden als solches nicht seine eigene Vollendung enthält. Wir würden damit beim subjektiven Sollen von Fichte bleiben. Vielleicht würde, wenn das fundamentale Streben unserer Vernunft die Grenzen alles reflektierten Wissens überspringt, sie eine Bresche eröffnen in der idealistischen Immanenz. Aber im Hegelianismus wird das logische Werden das subjektive Werden vereinigen und sozusagen totalisieren: das einen Spalt geöffnete Ausgangstor in der absoluten Immanenz schließt sich wieder. Nach Ansicht Hegels muss das System der Vernunft sich in sich selbst schließen, wie ein vollkommener Kreis: 364 §1.–Der Idealismus von Fichte, Schelling und Hegel. „Das wahre, schreibt er, ist das Werden seiner selbst, der geschlossene Kreis, in dem der Abschluss, vorausgenommen als ein Ziel, sich zum Anfang macht, aber in dem auch die Realität nur zur letzten Vollendung gehört.1 “ Diesen Bedingungen der Wahrheit gibt nur vollkommen Recht der Gesichtspunkt des logischen Werdens, das innere Werden der Idee. 1 452 Hegel, Phänomenologie des Geistes, Vorrede, edit zit, S.13 Man sieht wie sich bei den drei großen Transzendentalisten das Problem der Koinzidenz der Natur und des Geistes in der Erkenntnis gelöst findet: Es stellt sich nicht mehr. Während Descartes und Spinoza es wagten, es dogmatisch aufzulösen durch die behauptete Korrespondenz der klaren Ideen und der äußeren Dinge, lösen die idealistischen Philosophen es im Voraus, dynamisch wenn man so sagen darf: bei ihnen ist das Subjekt (oder der Begriff im hegelschen Sinn,) weit davon entfernt, sich entitativ den Objekten gegenüber zu stellen, das Werden selbst, das „Werden“ sowohl des Geistes, wie der Dinge, oder einfacher: das Subjekt ist das aktive Werden des Objekts. Trotzdem, das grandiose Gebäudes, das bei den Nachkantianern die immanente Evolution des Absoluten ausdrückt, unterlässt es nicht, einen schlecht verdeckten Riss zu zeigen, der seltsam erinnert an die gähnende Kluft, die das „Ding an sich“ im kantschen Idealismus hervorrief. Man kann noch sooft die absolute Innerlichkeit des Objekts im Subjekt dekretieren, trotzdem bleiben die ganze Entstehung einer materiellen Vielheit im Inneren der reinen Unbestimmtheit und die Entstehung dieser Vielheit eher als dieser anderen, für den Geist erstaunlich, der keinen direkten Grund wahrnimmt für dieses Werden. Wenn Fichte behauptet, dass das reine Ich sich Grenzen auferlegen muss, um zum Bewusstsein zu gelangen, anerkennt er selbst den irrationalen Charakter dieser inneren Grenze: das ist eine „grundlose Thathandlung“, deren Notwendigkeit sich in das System der Vernunft einschleicht, nicht durch eine direkte Deduktion, sondern als eine indirekte Konsequenz. als eine Art Postulat des Wissens. Schelling, auch er, setzt unmittelbar das objektive Werden in seiner Korrelation mit dem subjektiven Werden und interpretiert es als eine partielle Manifestation des Absoluten, aber er deduziert nicht das Objekt ausgehend von einem mehr ursprünglichen Prinzip. Was Hegel betrifft, trotz des hohen Grades der Systematisierung seiner Philosophie, erklärt er nicht weiter die Genese des materiellen (objektiven) Elements der Erkenntnis: die Entäußerung der reinen Logik in eine Materie ist eine Tatsache, sagt er. Es ist wahr, dass es eine durch die teleologische Notwendigkeit kommandierte Tatsache ist, um das Bewusstsein zu erlangen, wie bei Fichte. „Alle Aktivitäten des Geistes sind nichts anderes als verschiedene Weise das Äußere in die Innerlichkeit zurückzubringen, die der Geist selbst ist. und es ist nur durch diese Reduktion, durch diese Idealisation oder durch diese Assimilation des Äußeren, was der 365 Kapitel 3. Die großen idealistischen Systeme Geist wird und ist1 “. Nun aber setzt die Interiorisierung ein vorausgehendes Außen-Sein voraus; aber der direkte Grund der geforderten Exteriorisierung entgeht der deduktiven Theorie. 1 Hegels Werke, Berlin 1845 Bd.VII, Enzyklopädie, 3.Teil, Philosophie des Geistes, S.18 Scheint es nicht, dass der idealistische Immanentismus scheitert, das kantsche „Ding an sich“ vollständig zu eliminieren? Im rationalistischsten der Systeme, dem von Hegel, bleibt ein irrationaler Teil, ein dem deduktiven Licht undurchlässiges Element. Man wäre versucht, sich zu fragen, ob Kant, gerade vom Gesichtspunkt des transzendentalen Idealismus aus, wohin er sich platziert, nicht ein wenig recht hat, Dualist zu sein. Denn wenn es unbestreitbar ist, dass das subsistierende Denken, die das universelle Prinzip der Geister und der Dinge sein muss, scheint es nicht, dass das aktive Fundament unseres individuellen Bewusstseins vollkommen mit diesem absoluten und schöpferischen Denken zusammenfällt. Die Apriorität unseres Denkens überdeckt nicht adäquat den Inhalt unseres klaren Bewusstseins. Und dieses Anzeichen des Dualismus würde schon genügen, unser Misstrauen gegen das Vorurteil des absoluten Idealismus zu wecken. Andererseits, auf was beruht das idealistische Vorurteil ? Auf der Notwendigkeit eines von uns aus einem einzigen und absolut ersten Prinzip deduzierten rationalen Systems? Wir haben gesehen, dass diese Forderung reiner Dogmatismus ist. Auf dem inneren Widerspruch des „Dings an sich“. Das wäre schwerwiegender, wenn die innere Finalität des Denkens nicht erlauben würde das „Objekt an sich“ zu definieren als Funktion des Subjekts selbst und so die Innerlichkeit und Außerlichkeit, Immanenz und Transzendenz miteinander in Einklang zu bringen. Nìhsic 453 §2.–Der Finalismus im nach-kantschen Idealismus Dieser Charakter ist so offensichtlich, dass es kaum nötig ist, darauf zu insistieren. Die innere Entwicklung des absoluten Subjekts und die „dialektische Methode“, die nur der logische Ausdruck dieser Entwicklung ist, implizieren beide ein Werden im strengsten Sinn des Wortes. Zweifellos unterscheiden sich von Fichte zu Schelling und zu Hegel die Gesichtspunkte bezüglich dieses Werdens ein wenig. Daraus ergibt sich eine gewisse Vielfalt der Formulierungen, die es zum Ausdruck bringen. Fichte nimmt den moralischen Gesichtspunkt an: am Beginn setzt sich eine „Aufgabe“, ein „Handeln Sollen“, das danach seine immanenten Wirkungen entwickelt, Schelling stürzt sich auf Anhieb auf das „physische Werden“, diese fortschreitende 366 §2.–Der Finalismus im nach-kantschen Idealismus 454 Spiritualisierung der reinen Materie. Hegel reiht logische Etappen auf, ausgehend vom „rein Unbestimmten“. Aber alle drei entdecken unter der unstetigen Hierarchie der spekulativen Repräsentationen den vitalen und stetigen Drang einer immanenten Finalität, eines wahren metaphysischen Dynamismus. Im Übrigen verlangt ihre synthetische Methode, um wirksam zu sein, eine aktive Finalität des Subjekts. Wie könnte sonst das anfängliche Sollen (Fichte) aus seinen Grenzen herauskommen? Wie würde eine rein statische Unproportioniertheit des „Realen“ und des „Idealen“ in der Natur weiterleiten zur Identität des einen und des anderen Terms (Schelling)? Wie könnte der Widerspruch der logischen Bestimmungen, der spekulative Gegensatz der Thesen und Antithesen (Hegel) gestaffelte Synthesen bis zur reinen Idee hervorbringen? Von sich aus sind das abstrakte Sollen, der qualitative oder quantitative Unterschied, der logische Gegensatz unbeweglich und steril. Um eine Entwicklung in Schwung zu bringen und zu unterhalten, auferlegt sich unvermeidlich die belebende Ergänzung eines dynamischen Prinzips. Nun aber heißt, aus der inneren Finalität des Subjekts eine Bedingung a priori der objektiven Wahrheit zu machen, heißt entschieden eintreten in das Gebiet, wo sich einst die thomistische Epistemolgie gebildet hat. Auch für den hl. Thomas beginnt die erste rationale Etappe auf das Objekt zu bei der reinen Unbestimmtheit, aber bei einer Unbestimmtheit, die im Ganzen nur die Unbegrenztheit einer aktiven Potenz ist: man erinnere sich an den intellectus possibilis „quo est omnia fieri [=wodurch es ist alles zu werden]“ und den intellectus agens „quo est omnia facere [wodurch es ist alles zu machen]“. Der hl. Thomas könnte also sagen, wie Hegel: „Am Anfang des Denkens haben wir nur das Denken in seiner reinen Unbestimmtheit... Die Unbestimmtheit, die wir da haben, ist die unmittelbare Unbestimmtheit, ... es ist die Unbestimmtheit, die jeder Bestimmung vorausgeht, die Unbestimmtheit als absoluter Ausgangspunkt. Es ist das, was wir Sein nennen1 “ 1 Hegel, Enzyklopädie, §86 Trad. Vera, Logik t. s 393 ff. Denn das abstrakte Sein der Thomisten drückt auch nicht mehr aus als die Form der Anfangs-Unbestimmtheit in der intellektuellen Aktivität. Diese Unbestimmtheit andererseits nach Hegel wie nach dem hl.Thomas ist für uns nur erkennbar im Inneren des „Werdens“, wo es seine erste konkrete Realität erwirbt: was wohl ein Zeichen ist, dass man es auf beiden Seiten setzt ganz beladen mit einer unendlich verdichteten Finalität. Nur, siehe wo sich ein wesentlicher Unterschied ankündigt: die postkantschen Idealisten beleben (=aufregend machen) ihr Prinzip der Finalität, indem sie es gewaltsam kombinieren mit dem Vorurteil der totalen Immanenz. Die ganze rationale Entwicklung, angefangen mit dem reinen Unbestimmten bis zur höheren evolutiven Grenze: Geist oder Idee, ist von ihnen bezogen auf 367 Kapitel 3. Die großen idealistischen Systeme 455 ein einziges und gleiches absolutes Subjekt, das den ewigen Zyklus seiner inneren Momente durchläuft: Setzung, Äußerung, Bewusstsein oder Synthese. In einem gleichen Zyklus, wo nichts erworben wird und auch nichts sich verliert, nimmt die Finalität einen sehr speziellen Sinn an: es ist eine Finalität, die zugleich beraubt ist eines wahrhaften Bedürfnisses und einer realen Wirkung: um sie ohne logischen Widerspruch zu konzipieren, muss man sie sublimieren [verfeinern] bis zu dem Punkt, wo sie aufhörend eine Werden zu sein, sie sich reduziert auf die unbewegliche Gegenüberstellung von gleichzeitigen Relationen. Denn jede Bewegung oder jedes wahre Werden unterstreicht eine dem Subjekt inhärente Potentialität und ruft nach einem fremden Akt – was in einem absoluten Subjekt eine Absurdität ist, aber das was logischerweise das Absolute außerhalb der entwickelnden Subjektivität werfen würde und die Transzendenz setzen würde1 . 1 456 vergl. Fichte 2. Periode und Schelling 3.Periode. Befreit von der Voraussetzung des absoluten Idealismus (oder von der totalen Immanenz) würden die großen transzendentalistischen System, dank ihrer tiefgehenden Wahrnehmung des Werdens und der aktiven Finalität, zum traditionellen Aristotelismus zurückkehren. Sie müssten dazu darauf verzichten, das Absolute mit dem (kritischen) Subjekt zu identifizieren und folglich müssten sie dieses letztere mit einer „Natur“ versehen, partizipiert vom Absoluten. Andererseits würde das (kritische) Subjekt, so vom Absoluten unterschieden, aufhören ausschließliche Quelle zu sein jedes Inhalts des Bewusstseins: in Stand gesetzt, fremde Bestimmungen aufzunehmen, würde es nur noch die Einheit a priori, die den empfangenen Bestimmungen aufgezwungen wird, aus seinem eigenen Fundament beziehen. Unter den weiter oben genannten Einschränkungen, muss man anerkennen, dass die Deduktionen von Fichte, Schelling und Hegel uns die detaillierteste Beschreibung liefert, die von den notwendigen Schritten der angewandten Vernunft auf ein Gegebenes gemacht wurde. Und unter den selben Vorbehalten würde die thomistische Metaphysik ohne Zweifel in diesen jüngeren Systemen, welche die durch den Kantismus unterbrochene metaphysische Tradition erneuerte, erfreuliche Inspirationen für ihre eigene Weiterentwicklung finden. 368 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries 457 §1.–Fundamentaler Gesichtspunkt Die Arbeiten von Fries und die der Schule, die in unseren Tagen sich auf ihn berufen, bieten ein sehr spezielles Interesse, sowohl durch die positiven Schlüsse, die sie unterstützen, wie durch die dialektische Kritik, die sie enthalten von verschiedenen Systemen der Epistemologie1 . 1 Über das Datum dieser Studie siehe das Vorwort der Herausgeber. – Anmerkung der Editoren. 458 Die fundamentale These der Lehre von Fries besteht darin, dass er in die traditionelle Alternative der Intuition oder der Deduktion, ein mittleres Glied einführte, das er nennt: „eine unmittelbare, nicht intuitive Erkenntnis der Vernunft“. Zur Tatsache der Intuition, sagt er, besitzen wir nur die sinnliche Intuition. Andererseits macht unsere intellektuelle Erkenntnis nicht Halt davor, die begrifflichen Formen der sinnlichen Erfahrung einzukreisen und sie danach zu behandeln nach den Regeln der logischen Deduktion: das ist der Gesichtspunkt der Vorgehensweise der „Philosophien der Reflexion“, das heißt, der Philosophien, die das folgende Dilemma akzeptieren: Jede wahre Erkenntnis reduziert sich auf eine Intuition oder auf reflexive Operationen über einen Inhalt der Intuition; Kant sogar ließ sich davon zwingen durch die trügerische Alternative. Man muss im Gegenteil verkünden, dass unsere Intelligenz, die keine eigentliche Intuition hat, von Natur her eine ursprüngliche, dunkle, unmittelbare, nicht-intuitive Erkenntnis der allgemeinen und notwendigen Relationen besitzt, ausgedrückt in den Kategorien. In Wahrheit kommt diese Erkenntnis in unser klares Bewusstsein nur in der „Reflexion“ und bei Gelegenheit eines sinnlich Gegebenen, das heißt unter der Form von Begriffen und von Urteilen: Aber diese reflexiven Operationen der Vernunft machen nichts anderes als eine unmittelbare rationale Apprhension zu offenbaren, die ihnen vorausgingen. Außerdem erklärt Fries, „ist es in dieser gegenseitigen Beziehung [der spontanen Vernunft und der Reflexion] auf der das ganze Geheimnis der Philosophie beruht2 “ 369 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries 2 J. F. Fries Neue Kritik der Vernunft, 1. Band, Heidelberg, 1807, S.200 „Unsere Hauptaufgabe muss also sein, zu zeigen, dass unsere Fakultät der Reflexion die notwendige Bedingung konstituiert für unsere Erkenntnisfähigkeit, besonders insofern sie unserem klaren Bewusstsein unsere persönlichen unmittelbaren Erkenntnisse klar macht.1 “ 1 Ebenda, S. 207. Für die allgemeine Erklärung des Gesichtspunkts von Fries siehe vor allem, in dem zitierten Werk, die Einleitung und den §54 459 Halten wir die Fomulierung fest: „eine nicht-anschauliche, unmittelbare, Erkenntnis der Vernunft“: eine rationale Erkenntnis, unmittelbar aber nicht intuitiv. Diejenigen unserer Leser, die die letzten Jahre die Entwicklung der Denkpsychologie in der sogenannten Schule „von Würzburg“ verfolgt haben, werden nicht verfehlen sich zu erinnern. wie sehr der philosophische Gesichtspunkt, versteckt unter diesen neuen Forschungen, sich dem von Fries annähert. In Wahrheit, die unmittelbare Inspiration der wichtigsten Arbeiten scheinen hauptsächlich ausgeschöpft worden zu sein bei dem phänomenalistischen Logiker Husserl; aber dieser, obwohl er nicht offizielle zur Schule von Fries gehört, ist dieser wenigstens nahe benachbart durch seinen Begriff der „kategorialen Intuition“ (“Die kategoriale Anschauung2 “). die man ohne zu übertreiben zu einem Synonym der „unmittelbaren rationalen Erkenntnis“ machen könnte. Die Ideen von Fries sind also nicht so sehr veraltet. Wir glauben sogar, dass sie typisch eine der häufigsten Irrtümer über den Sinn des kritischen Beweises repräsentieren. 2 Vergl. E. Husserl, Logische Untersuchungen 2. Teil, Halle, 1901 6. Kapeitel Fügen wir hinzu für unsere thomistischen Leser, dass das epistemologische Prinzip sowohl von Husserl als auch der Schüler von Fries in seinem wesentlichsten Zug so sehr „der unmittelbaren rationalen Evidenz der ersten Prinzipien“ ähnelt, das zu allen Zeiten von den Scholastikern bekannt wurde, dass man versucht sein könnte, zwischen ihnen diese zwei kritischen Positionen zu verwechseln. Es wird also nicht unnütz sein, klar zu markieren, worin sich der Kritizismus von Fries von der authentischen thomistischen Epistemologie unterscheidet. Bevor wir diese Parallele ausarbeiten, wollen wir sehen. wie Fries selbst und die aktuellen Repräsentsnten seiner Schule ihren Gesichtspunkt dem der großen modernen Systeme der Epistemologie gegenüberstellen. 370 §2.–Kritik der modernen epistemologischen Systeme durch Fries und seine Schule §2.–Kritik der modernen epistemologischen Systeme durch Fries und seine Schule 460 Vor Kant. – Die ganze moderne Philosophie hat sich, ohne es wahrzunehmen, beherrschen lassen durch dieses hauptsächliche Vorurteil: dass die Wahrheit uns nur erscheinen kann in der Intuition oder in der logischen Deduktion: zwischen Erfahrung und Beweis gibt es nichts Mittleres. Eingeschlossen zwischen diese zwei Terme, trafen die Philosophen die Wahl von einem dieser beiden, oder versuchten sie zu kombinieren. Die Rationalisten zuerst optierten für die Deduktion, was sie zum Dogmatismus drängte. Ihr unterscheidendes Vorurteil, nämlich „dass jede Wahrheit abgeleitet werden muss vom einem einzigen höchsten Prinzip1 “, wurde systematisch ins Werk gesetzt durch Spinoza, Leibniz und Wolff2 . 1 Fries, op.cit. 1.Band, Einleitung S.XXIII 2 Ebenda Aber schon vor Abschluss dieser Entfaltung der rationalistischen Tendenz hatte sich eine Reaktion gebildet, die zum äußersten Gegenteil führte: die empiristischen Systeme. so etwa der empiristische Realismus von Locke, stützten die objektive Wahrheit ausschließlich auf die Intuition, das heißt, wegen des Fehlens der intellektuellen Intuition, auf die sinnliche Wahrnehmung.3 . Die Rolle der Deduktion beschränkte sich auf die reine Analyse der sinnlichen, in der „Reflexion“ zu einer Einheit zusammengefassten Daten. 3 Op. zit., S.XXIII Dann kam Hume, der nicht das so wenig gerechtfertigte Monopol akzeptieren konnte, sei es der sinnlichen Intuition, die das Sein nicht erreicht, sei es der logischen Deduktion, einfacher Form der Verknüpfung. Auch er, beherrscht vom unbewussten Vorurteil des Fehlens jeder anderen Quelle des Wissens, glaubte, dass die Wahrheit, wenn sie zugänglich wäre, sich auffinden lassen müsse in einer Kombination der sinnlichen Intuition und der logischen Beweisführung. Seine partikuläre (besondere) Voraussetzung, sagt Fries, war also die folgende: „Die spekulative Sicherheit ist nur möglich durch die Beweise bezogen auf den Inhalt der Intuition4 “ 4 Fries, op.zit. S.XVIII Aber der logische Beweis ist rein analytisch; die Rationalisten extrahieren daraus eine Metaphysik nur, indem sie sich dogmatische Prämissen geben; angewandt auf die reinen sinnlichen „Eindrücke“, kann die logische Analyse 371 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries sich nicht erheben über die phänomenale Ebene der „Eindrücke“. Auch Hume schließt auf die Vergeblichkeit des metempirischen Bemühens, auf den „Skeptizismus“. Kant stellt sich die Aufgabe, den Skeptizismus von Hume zu korrigieren, Leider „fällt er, ohne es zu merken, selbst, durch die Art und Weise, wie er die Kritik der Vernunft behandelt, unter die Herrschaft des Vorurteils, die seinen Vorläufer in die Irre führte.“ 5 Fries, op.zit. Einleitung S.XXVI Versuchen wir die exakte Tragweite dieser Anschuldigung von Fries zu begreifen. 461 Prozess und Verurteilung des Kantismus. – Sehr früh sieht sich Kant dem Vorwurf ausgesetzt, Hume nicht widerlegt zu haben. Man erinnert sich, dass der Angelpunkt des kantschen Beweises gegen den empiristischen Phänomenalismus der Begriff der Erfahrung war. Kant geht – wie Hume selbst auf der anderen Seite – aus von der Erfahrung als einer erlebten Notwendigkeit, der sich der Skeptiker nicht mehr als der Dogmatiker entziehen kann6 ; 6 Freis op. zit. Einleitung S.XX Und er stellt das Prinzip auf, dass in jedem epistemologischen System die Erfahrung möglich sein muss.. Bis dahin gibt es gar keine Kontroverse. Aber hier beginnt die Schwierigkeit. Wir erklären sie, indem wir Salomon Maimon folgen, der sie als erster klar und deutlich gemacht hat1 . 1 S.Maimon, Kritische Untersuchungen über den menschlichen Geist. Leipzig, 1797 Siehe vor allem S. 148 ff Was ist die Erfahrung? Maimon gibt davon eine Worterklärung, die sich an der von Kant ausrichtet: Das ist der innere Zusammenhang der Wahrnehmungen (“die Beziehung der Wahrnehmungen“. Kant sagte „die Synthese der Phänomene“) als objektiv notwendig und universell gedacht 2 . Wir kennen die synthetischen Relationen, die die Kohärenz der „Erfahrung“ sicherstellen: die Kausalität, die Substantialität, die Reziprozität usw.. 2 S.Maimon, zit. Op. S.134 Wenn man diese Definition zulässt, findet sich die Notwendigkeit der synthetischen Prinzipien a priori, welche die Möglichkeit der Erfahrung selbst steuert, analytisch bewiesen. Denn die Universalität oder die Notwendigkeit der objektiven Gruppierung der Phänomene kann nicht herkommen, weder von der rein empirischen Verknüpfung dieser Phänomene noch von einer analytischen, 372 §2.–Kritik der modernen epistemologischen Systeme durch Fries und seine Schule 462 an ihnen ausgeübten Deduktion. Man muss von daher also die Prinzipien der Ursache, der Substanz usw. als den Ausdruck der Bedingungen zugleich synthetisch und a priori jeder möglichen Erfahrung betrachten. Von solcher Art wäre im wesentlichen die kantsche Deduktion der „Prinzipien des reinen Verstandes“, die die Erfahrung steuern. Ihre strenge Apriorität scheint „bewiesen“ zu sein im Gegensatz zu Hume. Aber – und das ist der Einwand von Maimon – wenn diese Deduktion zweifellos gegen Hume schlüssig sein soll, kommt das nicht gerade daher, dass man unversehens die Schlussfolgerung in die Prämissen gleiten ließ? Sicherlich; man hat sich „objektive Erfahrung“ vorgegeben, eine Definition, die sie sehr klar unterscheidet von dem, was eine „rein subjektive Erfahrung“ wäre. Aber hat man da etwas anderes gemacht als eine Abgrenzung von „Begriffen“? „Dass der so bestimmte Begriff eine objektive Realität habe, oder, wenn man so will, eine konkrete Verwendung, das ist eine andere Frage, die man eigentlich noch gar nicht berührt hat3 .“ 3 S.Maimon, zit. Op. S.153 Es ist überhaupt nicht sicher, ob die konkrete „Erfahrung“ – die der Skeptiker genau so erfährt wie der Dogmatiker – wirklich universelle und notwendige Synthesen aufweist und dem theoretisch definierten Begriff der „objektiven Erfahrung“ entspricht. Kant müsste also noch die Anwendung seiner Definition der Erfahrung auf die Synthesen von Phänomenen beweisen, die wirklich ausgeführt werden in unserem „empirischen Denken“. Nun aber würde ein Skeptiker nach Art von Hume dieser Anwendung widersprechen: Hume ist nicht widerlegt. Der kantsche Begriff der objektiven Erfahrung, so fügt Maimon4 hinzu„ ist ein regulierender Begriff, der Begriff einer Grenze, wie es die Ideen sind; 4 zit. Op. S.154 tatsächlich die konstante Wiederholung von Durchhalten und Sukzessionen von Phänomenen verlangt ein Prinzip der Stabilität, deren feststellbare Geltung sich unendlich annähern kann an eine Universalität und einer wahrhaftigen Notwendigkeit: die konkrete Erfahrung strebt nach der theoretisch definierten Erfahrung. Kommen wir nun zurück auf die Kritik, die Fries in der Nachfolge S. Maimons, glaubt, der kantschen Lehre von der Erfahrung entgegnen zu müssen. Kant, sagt er, opfert dem „transzendentalen Vorurteil“, welches im Grunde nichts anderes ist als eine umgeleitete Wiederaufnahme des elementaren Vorurteils, dem seine Vorläufer geopfert haben. Vor der Aufgabe, gegen die auflösenden Analysen von Hume die wahre Apriorität der Prinzipien der Erfahrung zu zeigen und da er diesen Beweis auf keine Intuition stützen kann, 373 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries 463 bemüht er sich, ihn durch logische Ableitung in Ordnung zu bringen. Er denkt nicht daran, die enge Alternative aufzubrechen. Das Ergebnis seines Versuchs drückt sich aus in dem so unerbittlich von Salomon Maimon demaskierten Scheinargument1 . 1 Vergl. Fries,zit. op. Einleitung S.XXXII, XXXIV und folgende Dennoch, in dem was die tatsächliche Existenz synthetischer Prinzipien betrifft, den apriorischen Bedingungen der Erfahrung, gibt Fries Kant gegen Hume Recht. Und er lässt außerdem zu, dass Kant auf dem Weg zu einem gültigen Beweis war: wenn er diesen nicht vermischt oder sogar verwechselt hätte mit dem „tranzendentalen Beweis“, das heißt die oben kritisierte logische Deduktion mit der „transzendentalen Analyse“ (“Deduktion“ im Gegensatz zu „Beweis“, „subjektiver Deduktion“), die ihn zum Ziel hätte bringen können, er hätte das Schwanken und die Verdunkelung vermieden, die seine Deduktion der Begriffe und der Prinzipien des reinen Verstandes verunstalten. Er hätte deutlich verzichtet auf jeden logischen Beweis der Apriorität der Erfahrung, da dieser Beweis ebenso auf einer petitio principii (einem Zirkelschluss) beruht; sondern er hätte, durch die regressive Analyse der Bestimmungen der Erfahrung ihr rationales Fundament entdeckt: die unmittelbare und nicht intuitive Erkenntnis der Bedingungen a priori, die sie steuern.. Er hätte nur die Alternative verneinen müssen: Intuition oder logische Deduktion.2 2 464 Fries, zit. Op. S. XXVII und folgende Wir rühren hier an einen sehr delikaten Punkt der Kritik von Fries. Von welcher Natur wäre die transzendentale Analyse oder die subjektive Deduktion, die nach ihm die Rechtfertigung der ersten Prinzipien der Erfahrung liefern muss? Diese Prinzipien, da sie erste sind, können sich nicht auf logische Prämissen stützen, das ist zugegeben. Aber andererseits, da sie synthetisch sind, tragen sie nicht, wie die analytischen Urteile ihre Rechtfertigung in ihren Termen selbst: sie brauchen ein ihnen äußeres Fundament, und eines, das nicht ein Urteil ist, das selbst eine neue Rechtfertigung verlangen würde. «Die Prinzipien der Philosophie, schreibt Fries, beruhen auf unseren Überzeugungen, unabhängig von jeder logischen Prämisse (“ohne alle Begründung“); aber kein Satz verdient eine Zustimmung ohne Rechtfertigung oder „ohne Grund“. Wir müssen also die Geltung dieser Prinzipien durch eine Deduktion garantieren in dem Sinn, wo „Deduktion“ sich dem „Beweis“ gegenüberstellt, in welchem wir zeigen, dass sie aus der Natur der Vernunft selbst herrührt. Aber das ist eine reine Affäre der Anthropologie und folglich der inneren Erfahrung 1 .» 1 374 Fries zit.op. S.284 §2.–Kritik der modernen epistemologischen Systeme durch Fries und seine Schule Bei dieser Schlussfolgerung wäre Kant zusammengezuckt, er, der keine Spur von „Psychologismus“ in der Kritik duldete. Denn die Behauptung von Fries besagt nichts weniger als, so scheint es, als auf eine empirische Feststellung die Apriorität der Prinzipien zu fundieren. Ein aktueller Repräsentant der Schule von Fries verteidigt diesen gegen den Vorwurf des Psychologismus in einer jüngsten Publikation2 . 2 L. Nelson, über das sogenannte Erkenntnisproblem, Göttingen 1908 Auszug aus den Abhandlungen der Friesschen Schule, Neue Folge Bd.II, 4 Das Fundament seiner Verteidigungsrede kommt zurück auf eine von Fries selbst verwendete Distinktion: Nicht weniger als Kant denkt Fries daran, dem zu widersprechen, dass eine Erkenntnis a priori abgeleitet werden könne von einer empirischen Erkenntnis. Denn von einem rein assertorischen Satz kann man nicht einen apodiktischen Satz ableiten. Nun aber ist jede Erkenntnis a priori notwendigerweise apodiktisch. Es wäre also utopisch, zu behaupten, die metaphysischen Prinzipien der Erfahrung auf irgendeine Induktion zu gründen, sei sie psychologisch oder anders.3 3 465 L.Nelson zi.t Op. S. 727 Nachdem dies klar festgestellt ist, muss man mit Fries unterscheiden zwischen dem Objekt (Gegenstand) und dem materieartigen Inhalt (Inhalt) dieser philosophischen Untersuchung, die wir „Kritik der Erkenntnis“ nennen. Ihr Objekt besteht in Erkenntnissen a priori, aber ihr materieartiger Inhalt besteht sehr häufig aus empirischen Erkenntnissen. Die Urteile, die den Inhalt der Kritik bilden, sind nur assertorisch. Dagegen hat sie als Objekt apodiktische Urteile. Zum Beispiel weiß ich a priori und mit einer apodiktischen Sicherheit, dass jede Veränderung eine Ursache hat. Aber die Präsenz dieses Prinzips der Kausalität unter meinen Erkenntnissen und die Art und Weise, in der sie begründet ist in meiner denkenden Subjektivität (das heißt seine Apriorität) ... können mir als in einem assertorischen Urteil, das aus der inneren Erfahrung gezogen ist4 nicht ganz genau so bewusst sein. Die transzendentale Analyse, die von Fries mit der inneren Erfahrung gleichgesetzt wird, begründet nicht die Apriorität der Prinzipien sondern offenbart sie. 4 Nelson zit.Op. S.729-730 Einer der Aspekte des Irrtums Kants würde also genau darin bestehen, dass er nicht diese Unterscheidung berücksichtigt hat zwischen dem Inhalt und dem Gegenstand.: Kant bemüht sich nicht nur, das subjektive Fundament der Prinzipien a priori zu entdecken, sondern er behauptet, ihre Apriorität apodiktisch zu beweisen. Als ob die Kritik sich mit ihrem Objekt verwechseln müsste und 375 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries unter ihren konstitutiven Sätzen das höchste Prinzip jeder Wahrheit a priori enthalten müsste. Diese Behauptung, die Kritik (Erkenntniskritik) in eine systematische Theorie der Erkenntnis (Erkenntnistheorie) zu transformieren, musste man noch mehr bei Reinbold behaupten, und würde zu den großen idealistischen Metaphysiken von Fichte, Schelling und Hegel führen. Prüfung der Vorwürfe von Fries gegen Kant. – Bevor wir uns fragen, ob Kant im Prozess, den ihm die Schule von Fries macht, unterliegen muss, müssen wir etwas Zeit aufwenden, um diesen seltsamen Satz zu untersuchen: „Die Apriorität der Prinzipien der Erfahrung wird durch die innere Erfahrung festgestellt..“ Tatsächlich ein seltsamer Satz, anerkennt auch L.Nelson; denn die „Universalität und die Notwendigkeit eines Urteils sind nicht empirisch einsehbar nach Art einer Tatssche. Das was die innere Erfahrung feststellen kann, ist nur, dass ein Urteil Anspruch erhebt auf die Universalität und die Notwendigkeit1 “ 1 466 zit. Op. S.747 Nelson hat darin tatsächlich nicht Unrecht: um die Universalität und die Notwendigkeit eines Urteils festzustellen, das heißt die wirkliche Apriorität, müsste man sich im Inneren der aktiven Fakultät befinden, die dieses Urteil abgibt, oder vielmehr, wäre es nötig, dass die a priorische Aktivität ein Bewusstsein ihrer Apriorität hätte in ihrem Vollzug. Dieses intuitive Bewusstsein würde unmittelbar eine Metaphysik grundlegen und würde eine Kritik überflüssig machen. Nun aber weist die „innere Erfahrung“ von Fries ein derartiges Bewusstsein seiner selbst nicht auf; denn diese psychologische Erfahrung begreift die inneren Ereignisse wie vollendete „Tatsachen“ und nicht in ihrem inneren „Entstehen“. Das Höchste, was sie liefern könnte, ist also ein gewisses Gefühl der Universalität der metaphysischen Urteile, oder, wenn man will, und um wie Nelson zu sprechen, die Feststellung der Behauptung, die sie auf die Universalität erheben. Drücken sie wirklich die Bedingungen a priori jeder möglichen Erfahrung aus? Darüber sagt uns in Wahrheit die innere Erfahrung nichts und diese Kritik hat uns, ausgenommen dass sie die Apriorität apodiktisch beweisen will, nichts weiter zu sagen.2 2 Nelson zit.Op. S.756 Kant hätte sicherlich nie zugestimmt, sein Vorhaben so sehr zu reduzieren. Denn wenn die von Fries erreichte epistemologische Folgerung nicht ganz Null ist, so scheint sie dennoch zu dünn und zu wenig im Verhältnis zu dem imposanten Apparat der Neuen Kritik. Wäre man dabei stehen geblieben, hätte man sich bis zu einem gewissen Punkt damit rühmen können, Hume 376 §2.–Kritik der modernen epistemologischen Systeme durch Fries und seine Schule widerlegt zu haben: denn nach der Bemerkung von Nelson ist die Feststellung von Urteilen mit universellem Anspruch unverträglich mit dem assooziativen Empirismus und würde sogar dazu zwingen, die Existenz einer unmittelbaren, nicht intuitiven rationalen Erkenntnis anzuerkennen.3 3 zit.Op. S.756 Vielleicht, strenggenommen, hätte man bescheidener schließen müssen, dass die universelle Form gewisser Urteile die Intervention einer metempirischen Fähigkeit verrät. Aber ganz gleich: in beiden Fällen findet sich Hume überholt und überholt selbst auf dem Gebiet der psychologischen Analyse. Das ist schon etwas. Es ist auch etwas, dabei „die Möglichkeit der Metaphysik im allgemeinen1 “ festgestellt zu haben – sagen wir es genauer: die NichtUnmöglichkeit der Metaphysik. 1 467 zit.Op. S.759 Aber letzten Endes, welche „objektive Geltung“ gibt die Kritik von Fries uns in die Hände? Welche Bedeutung nehmen darin die allgemeinen Prinzipien der Erfahrung an? Nichts als das: diese Prinzipien sind ein natürliches und ursprüngliches Produkt unserer Vernunft. Ihr Anspruch auf die objektive Universalität – erste Tatsache – kann sich nicht weiter rechtfertigen; wir adoptieren diese Behauptung kraft des „Vertrauens, das unsere Vernunft zu sich selbst hat.“. „Das letzte subjektive Prinzip aller menschlichen Urteile, schreibt Fries, ist das Prinzip des Vertrauens der Vernunft auf sich selbst; jeder Mensch hält seinen Geist für der Wahrheit fähig und für mit der Wahrheit ausgestattet.2 ...“ 2 Fries, Neue Kritik, 2.Auflage, Band II §89, zitiert nach Nelson: wir haben nur die erste Auflage zur Hand. Insgesamt, sagt Fries noch – und diese Stelle bringt seinen Gesichtspunkt auf den Punkt – „geben wir durch diese Deduktion [das heißt die „subjektive Deduktion“ zurückgeführt auf die innere Erfahrung] dem systematischen Bedürfnis recht, keinen Satz zuzulassen ohne Fundament (Grund ), aber zur gleichen Zeit entledigen wir uns des lästigen und falschen Vorurteils, das uns zum logischen Beweis von all dem, was wir im Urteil behaupten, zwingen würde. Wir gewinnen dabei, in der Philosophie einen idealistischen Gesichtspunkt zu bewahren, der uns ein festes Urteil über jede Wahrheit erlaubt, ohne dafür einen gefährlichen Sprung über die Barrieren unseres Ich auf das Objekt zu zu wagen. Wir sagen nicht, die Sonne scheint am Himmel, sondern nur: jede endliche Vernunft weiß, dass die Sonne am Himmel scheint; wir sagen nicht: der Wille ist frei, sondern nur: jede endliche Vernunft glaubt an die Freiheit ihrer Willensakte; wir sagen nicht: es gibt einen Gott, sondern nur: jede endliche Vernunft erahnt, vermittels des Lebens und der Schönheit der natürlichen Formen, die allmächtige und ewige Schönheit3 “. 377 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries 3 468 Fries, Neue Kritik, 1.Auflage, Band I S.284-285 Man kann hieran den Abstand ermessen, der Fries von Kant trennt. Kant bezeichnet als Ziel für die Kritik des Objekts der Erkenntnis nicht die einfache subjektive Feststellung: Dieses Prinzip ist unwiderlegbar durch die Vernunft gesetzt, sondern die objektive Schlussfolgerung: dieses Prinzip ist wahr, das heißt, drückt eine Bedingung a priori der Möglichkeit selbst für jedes Objekt der Erfahrung aus4 4 Siehe z.B. Kritik der reinen Vernunft, Übersetzung Barni-Archambault, T.I S.162 Fries unterwirft dem „rationalen Glauben“ selbst die Erfahrung; Kant behauptet, die spekulative Geltung der Erfahrung zu beweisen und reserviert den „rationalen Glauben“ für die metempirischen Objekte. Ist es wahr, dass darin Kant dem „Vorurteil des logischen Beweises“ nachgibt und einem Trugbild folgt? Man erlaube uns, die dialektische Hinrichtung der „kantschen transzendentalen Deduktion“, die Fries versucht, ein wenig oberflächlich zu finden. Wir gestehen gern, dass die Ausdrucksweise Kants dabei nicht immer die wünschenswerte Klarheit hat. Er scheint, sich dabei nicht klar und offen entscheiden zu können zur Wahl zwischen zwei Gesichtspunkten, die sich der Reihe nach in seinem Geist abzeichnen. Auf der einen Seite hält er die Notwendigkeit und Universalität der allgemeinen synthetischen Prinzipien der Erfahrung für unmittelbar evident. Hat er diese Feststellung nicht seit den ersten Seiten der Kritik gemacht, in der Weise von vorläufigen Erwägungen? Sein unerschütterlicher Glaube an die experimentelle Wissenschaft veranlasste ihn vielleicht, die Übereinstimmung aller Geister darin, die wahrhafte Universalität der wissenschaftlichen Gesetze anzuerkennen, zu übertreiben. Aber wenn man ihm diesen Anfangspunkt vergibt, ist seine Deduktion der Bedingungen a priori der Erfahrung absolut korrekt und analytisch. Wir sehen da keineswegs eine naive petitio principii [Zirkelbeweis] sondern die Adoption einer Voraussetzung – die anderswo ganz allgemein angenommen wird – die die Tragweite der Kritik auf die Frage einschränkt, die von Kant selbst in seiner Einleitung gestellt wurde: Vorausgesetzt, dass wir synthetische Urteie a priori über eine empirische Materie bilden, wie sind diese Urteile möglich? Unglücklicherweise könnte man noch in Frage stellen, dass wir wirklich „synthetische Urteile a priori“ in physischer Materie bilden. Denn so, wie wir weiter oben gesagt haben, stellt sich die wirkliche Apriorität nicht als eine empirische Tatsache fest. Um die Kritik auf ein solides Fundament zu setzen, muss man also zeigen. dass es notwendig ist, dass wir solche synthetischen Urteile a priori bilden. 378 §2.–Kritik der modernen epistemologischen Systeme durch Fries und seine Schule 469 470 Der Beweis dieser Notwendigkeit scheint uns ein unerlässliches Stück für ein gutes Gleichgewicht der Kritik der reinen Vernunft. Selbst bevor man die Einwände von Fries kennt, glauben wir, die Kontinuität des kantschen Denkens nicht wieder finden zu können, ohne diesen schwierigen und komplizierten Beweis zu durchlaufen. Wie gelingt es also Kant, apodiktisch die Notwendigkeit von synthetischen Urteilen a priori zu beweisen? Wir haben es früher schon gesehen: Sicherlich braucht er für seinen Beweis einen Ausgangspunkt: nur fällt dieser Ausgangspunkt hier zusammen mit den Ausgangsdaten jeder Kritik der menschlichen Fähigkeit zu erkennen: ein Objekt gegenwärtig im Bewusstsein ohne intellektuelle Intuition. Der bewusste Charakter des Objekts definiert die formartige ursprüngliche Bedingung der „reinen Apperteption“. Der nicht intuitive Charakter des Objekts definiert die materieatige fundamentale Bedingung der „reinen Gegebenheit“. Die „transzendentale Dedultion“ bei Kant macht nichts anderes als die vermittelnden logischen Bedingungen explizit zu nennen, die das Zusammentreffen der reinen Einheit der Apperzeption und die elementare Gegebenheit in einem Objekt fordern. Diese Deduktion führt vielleicht nicht bis zur – sehr gekünstelten – Tafel der kantschen Kategorien; aber sie erzwingt die Notwendigkeit von Kategorien und folglich von „synthetischen Urteilen a priori“, um diese Daten bis zur objektiven Erkenntnis zu erheben. Der Beweis von Kant ist analytisch und setzt nichts anderes voraus als das, was wohl oder übel jedes kritische Unternehmen voraussetzt: Wissen um ein dem Bewusstsein gegebenes Objekt und die analytische Norm der Identität. Man kann also das Unternehmen Kants nicht verurteilen unter dem Vorwand, dass alles beweisen zu wollen zwingen würde, wie Aristoteles sagt, „bis ins Unendliche weiter zu gehen.“ Die „transzendentale Ableitung“ gibt sich einen Ausgangspunkt und sie bleibt dafür nicht im Dogmatismus stehen. Denn dieser Ausgangspunkt ist geanu der einzige, der nicht angezweifelt werden kann ohne unmittelbaren Widerspruch. Wenn wir weiter oben Kant kritisiert haben, mussten wir Kant vorwerfen, dass er nicht alles wahrgenommen hat, was implizit sein Ausgangspunkt, das bewusste Objekt, enthielt; aber wir haben überhaupt nicht das Prinzip der „transzendentalen Deduktion“ selbst , angewandt auf das bewusste Objekt, angegriffen Es scheint uns also nicht so, dass das Vorurteil, ausgedrückt im Dilemma „Intuition oder logischer Beweis“ peinlich die kantsche Kritik beeinflusst hat im präzisen Punkt, den Fries angibt. Aber wir geben gerne zu, dass diese enge Alternative, die im Grunde das Postulat jedes analytischen Denkens ist, seit Ockham die moderne Philosophie in eine statische Konzeption der Wahrheit eingesperrt hat; künstliche Konzeption, der zu entgehen Kant nicht gelungen 379 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries 471 ist: daher kommen nach unserer Meinung die Mängel seiner Kritik der spekulativen Vernunft. Fries nennt „transzendentales Vorurteil“ das Unglück, das bei Kant das „analytische Vorurteil“ überquert, von dem wir noch sprechen wollen: dieses transzendentale Vorurteil wäre verantwortlich für die kantsche Lehre vom transzendentalen oder formalen Idealismus, das heißt von der Lehre, die alles das definiert, was es an a priori gibt in den Objekten als reine Form des erkennenden Subjekts. Hier unterscheiden wir gern wie folgt: dass jedes Apriori der erkannten Objekte der Ausdruck wäre von formartigen, dem Subjekt inhärierenden Bedingungen, das scheint uns, was auch immer Fries darüber denkt, von Kant ganz legitim deduziert: in dem Sinne gibt es eine „Idealität“ der metaphysischen Objekte, wie es eine „Idealität“ von Raum und der Zeit gibt. Dagegen, dass die Geltung der Bestimmungen a priori des Objekts ganz und gar nur in dieser Übertragung der Form vom Subjekt her besteht und dass sie nicht, ohne aufzuhören relativ zum Objekt zu sein, eine absolute Bedeutung annehmen könne, das scheint uns eine effektiv willkürliche Einschränkung zu sein, die Kant vorgeschrieben wurde von seinem „analytischen Vorurteil“, das ihm die innere Finalität des objektivierenden Gedankens verbarg. Aber diese Verurteilung trifft Fries genauso wie Kant selbst. Wir könnten also, wenn man darauf besteht, die Aussage der Schule von Fries, dass das transzendentale Vorurteil, der kantsche Modus des allgemeinen analytischen Vorurteils, der hinterhältige Inspirator des formalen Idealismus sei, auf unser Konto nehmen. Dennoch würde die materielle Identität der Formel sehr verschiedene Konzeptionen überdecken; wir glaubten, das hier klar machen zu müssen. Über den nach-kantschen Idealismus. – Wir haben gesehen, wie der formale Idealismus von Kant sich fortsetzte im subjektiven Idealismus von Fichte. Es ist interessant, das Urteil von Fries bezügliche dieser Abhängigkeit zu hören.1 1 siehe zit.Op. Einleitung S.XXII und XXXVII Reinhold behauptete als erster, indem er das Vorurteil der logischen Deduktion und der systematischen Einheit ins Extrem steigerte, die kantsche Kritik zu verbessern, indem er sie ganz und gar von einem einzigen und höchsten Prinzip ableitete: dem „Bewusstsein“ als solchem. In dem so entworfenen System blieb kein Platz mehr für das „Ding an sich“, was pfeilgerade zum subjektiven Idealismus führte. Dieser ist also nur eine Form eines erneuten Einbruchs des rationalistischen und systematisierenden Geistes. „Fichte mit seinem reinen Ich, Bardili mit seinem Vorherigen, Reinhold mit seinem Denken als Denken, 380 §2.–Kritik der modernen epistemologischen Systeme durch Fries und seine Schule Schelling mit seiner absoluten Vernunft und die ganze Schule von Schelling mit ihrer absoluten Wissenschaft oder ihrer Wissenschaft von Allem, begegnen sich darin, dass ihre Philosophie die Behauptung aufstellt, das Wesen der Dinge aus einer ewigen Einheit zu deduzieren.2 “ 2 Fries zit.Op. Einleitung S.XXII Das rationalistische Vorurteil begünstigte offensichtlich das idealistische Vorurteil. Andererseits fand dieser letztere noch eine Stütze in der direkten Kritik, die Jacobi am kantschen „Ding an sich“ machte. Fichte, so sagt Nelson, war das Opfer zugleich des methodologischen Vorurteils von Reinhold, das heißt des alten rationalistischen Vorurteils, und des „rationalistischen Postulats“ von Jacobi3 . 3 472 L.Nelson zit.Op. S.670-671 Da er nur im Inneren des erkennenden Subjekts das Prinzip der systematischen Einheit der Erkenntnis finden konnte, war er gezwungen zu seiner Theorie des reinen Ich. Diese Einschätzung rief eine Diskussion hervor, die zu weit führt für den Raum, der uns hier zur Verfügung steht. Wir beschränken uns auf zwei Bemerkungen. Zuerst: Es ist wahr in einem Sinn, dass das rationalistische Vorurteil der Einheit zum subjektiven Idealismus treiben muss; aber diese unglückselige Konsequenz rührt weniger her von der Suche der Einheit als solcher, als von der Suche einer exklusiv auf spekulativen Prämissen fundierten Einheit: tatsächlich könnten diese höchsten Prämissen, abgesehen davon dass sie dogmatisch gesetzt sind, nur die dem Subjekt immanente Form ausdrücken, das so universelles Prinzip der Dinge geworden ist. Muss man also aus Furcht vor dem absoluten Idealismus die Forderung [Bedürfnis] nach Einheit, das so tief in unserer Intelligenz verankert ist, als illusorisch verdammen? Weit davon entfernt. Wir haben nach dem hl.Thomas gezeigt, dass die Erkenntnis, ins Auge gefasst als eine aktive Bewegung, statt ihre Einheit zu suchen durch eine Art von regressiver Abstraktion im inneren des erkennenden Subjekts, sie erahnt als ihr vorausliegend in einem objektiven Ziel. Die Einheit, die sich zu allererst unserer Vernunft aufzwingt, ist die Einheit des letzten Ziels, die logisch mit sich bringt die Einheit des ersten Prinzips, aber nicht notwendig die Einheit des Subjekts oder des Ich. Die innere Finalität der Erkenntnis würde also erlauben die systematische Forderung der Einheit zu respektieren, ohne sich dazu in den subjektiven Idealismus einzusperren. Unsere zweite Bemerkung reduziert sich im Grunde auf die erste. Das unterscheidende Prinzip jedes nach-kantschen Idealismus ist das Prinzip der Immanenz. Hier führt die Schule von Fries – der einen sehr besonderen Idealismus 381 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries lehrt – noch einen treffenden Vorbehalt ein: Der psychologische Inhalt des Aktes der Erkenntnis (alles das, was man qualifizieren kann als „Inhalt der Erkenntnis“), ist notwendigerweise immanent. Aber daraus folgt nicht die Immanenz des Objekts dieses Aktes (des „Gegenstands der Erkenntnis1 “). Mit anderen Worten, das Prinzip der Immanenz hat eine psychologische, keine logische Bedeutung oder Tragweite. 1 473 Vergl. Nelson zit.Op. S.511 ff. Kritik des Prinzips der Immanenz bei Rickert. Diese Unterscheidung, die von den Scholastikern zu allen Zeiten gemacht wurde, bringt das fundamentale Dogma des modernen Idealismus ins grelle Licht, der willkürlich „Inhalt des Bewusstseins“ und „Objekt des Bewusstseins“ verwechselt. Aber bringt das als Konsequenz, wenn man dem idealistischen Dogmatismus entkommen will, die zentrale These des Friesschen Kritizismus mit sich, das heißt die Existenz einer rationalen nicht intuitiven Aktivität, in der uns unmittelbar die metaphysischen Bedingungen gegeben wären, die das Objekt als solches dem einfachen Inhalt des Bewusstseins entgegenstellt? Zweifellos, um einen Inhalt des Bewusstseins zu „objektivieren“, braucht es etwas anderes als eine empirische Wahrnehmung oder einen analytischen Beweis: in ihrem negativen Teil, insofern sie eine Quelle des Wissens postuliert, die anders ist als die empirische Intuition oder die Deduktion, ist die These von Fries exakt. Aber besteht diese Quelle des Wissens notwendig in einer obskuren und unmittelbaren Erkenntnis der Vernunft, in einer Erkenntnis, die wir in der Reflexion wahrnehmen wie etwas erstes „Gegebenes“ von metempirischer Ordnung, ohne es weiter analysieren zu können? Hier trennen wir uns von Fries, denn eine rationale Erkenntnis, die bewusst geworden ist durch die auf sie ausgeführte Reflexion, würde uns nur objektiv erscheinen, wenn ihre reflex wahrgenommenen Charakteristiken direkt eine Extraposition des rationalen Inhalts mit Bezug auf das Subjekt offenbaren würden oder logisch implizieren würden. Nun aber haben wir gesehen, dass diese Extraposition des rationalen Inhalts nur möglich ist auf dem Wege der aktiven Finalität. So gesteht der Kritizismus von Fries, indem er den subjektiven Idealismus beiseiteschiebt, sich unfähig, ein Objekt außerhalb des Subjekts zu begreifen: die weitestgehende seiner Schlüsse bleibt dabei stehen, im Subjekt die notwendige und ursprüngliche Repräsentation der metempirischen Bedingungen des Objekts festzustellen, oder höchstens die natürliche Tendenz, das metaphysische Objekt zu setzen. Eine Philosophie gestützt auf den Kritizismus von Fries, brächte sicherlich nicht mit sich eine metaphysische Immanenz des Objekts im Subjekt, aber sie würde auch nicht gehen bis zum objektiven Realismus; sie gäbe sich damit zufrieden, das System der instinktiven Postulate der spekulativen Vernunft zu sein. Das würde genügen – wie auch in der Kritik von Kant die problematische Geltung der Ideen genügt – um zu 382 §3.–Hauptsächliche Diskrepanz zwischen der thomistischen Epistemologie und dem Kritizi 474 verbieten, das metaphysische Objekt zu leugnen; es würde nicht genügen um logisch zu erzwingen, es zu affirmieren. §3.–Hauptsächliche Diskrepanz zwischen der thomistischen Epistemologie und dem Kritizismus von Fries. 475 Die Überlegungen, die wir gerade gemacht haben, lassen ahnen, wo genau die Abweichung zwischen der thomistischen Epistemologie und dem Kritizismus von Fries liegt. Die thomistische Epistemologie konnte für die modernen Autoren, die sich bemühten, sie zu systematisieren, einen dogmatischen Anschein erwecken. Aber im Grunde genommen, in sich selbst betrachtet, in ihrer authentischsten Tradition, entspricht sie den kritischen Forderungen. Man muss hinzufügen, dass sie auf dem kritischen Terrain sich nicht zufrieden gibt mit einer „subjektiven Evidenz“ des Objekts, nach der Art von Fries; sie behauptet die „objektive Evidenz“ zu erreichen im strengsten Sinne, das heißt die theoretische Notwendigkeit der absoluten Affirmation. Mit Fries kann man noch das metaphysische Objekt bezweifeln, ohne sich zu widersprechen, obwohl man sich damit selbst Gewalt antut. Nach dem Thomismus kann man nicht zweifeln über das metaphysische Objekt, ohne sich wenigstens implizit zu widersprechen. Wo die Kritik von Fries sich darauf beschränkt, unsere metempirischen Affirmationen als eine Tatsache der inneren Erfahrung festzustellen, deduziert die thomistische Kritik streng die Notwendigkeit gerade dieser Affirmationen. Offenbart dieser Anspruch des Thomismus nicht gerade darin das Empire des „systematischen Vorurteils“ (das “erkenntnistheoretische Vorurteil“) Nicht mehr und nicht weniger und vielleicht selbst ein bisschen weniger als bei Kant die Behauptung, die „transzendentale Deduktion des Kategorien“ zu machen. Es ist unmöglich, alles zu beweisen, wendet die Schule von Fries ein, die ersten Prinzipien der Demonstration sind notwendigerweise unbeweisbar. Ohne jeden Zweifel; aber das unbewiesene Prinzip einer Demonstration kann so sein, dass seine Bezweiflung gleichkommt, die unvermeidlichen Gegebenheiten des Problems zu leugnen. In diesem singulären Fall wäre die Lösung logisch notwendig, ohne dass dafür die Kette der Prämissen sich bis ins Unendliche erstrecken muss. Nun aber ist im allgemeinen Problem der Erkenntnis der Fall so beschaffen: da ist das Gegebene – das „Objekt des Bewusstseins“ – so universell, dass außerhalb seiner Annahme der menschliche Geist keine möglichen Halt mehr findet: Diese Gegebenheit ablehnen, heißt sich formal zu widersprechen, denn es heißt nochmal affirmieren, es leugnen zu wollen oder es in Zweifel zu ziehen. Nun aber enthält diese Gegebenheit implizit die logische 383 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries 476 Notwendigkeit eines „metaphysischen oder transzendenten Objekts“. Die allgemeine Form der thomistischen Deduktion erscheint also von perfekter Richtigkeit. Wenn das Resultat dieser Deduktion unzulässig erschiene, müsste die Ursache des Irrtums in einer unrichtigen Analyse des „bewussten Objekts“ zu finden sein, den Anfangsdaten jeder Kritik. Wir stellen ausführlich das fest, was die Analyse der ursprünglichen kritischen Gegebenheit an wahrhaft Charakteristischem im Thomismus bietet: die objektive Gegebenheit ist dort begriffen, in ihrer natürlichen Bewegung, als die Form einer Handlung, die sich entwickelt auf ein Ziel hin. Dank dieser konkreten Finalität bietet das Objekt des Bewusstseins Zugriff für die Deduktion, die es offenbaren wird als konstituiert, insofern es Objekt ist, durch eine innere Beziehung zum absoluten Ziel, das heißt wirklich als „objektiviert“, im AbsolutenDagegen, wenn man die konkrete Finalität des Objekts vernachlässigt, findet die kritische Reflexion nichts mehr vor sich, im Subjekt, als eine leblose Form, darstellend oder nicht Behauptungen der Objektivität und der Transzendenz, das heißt letztendlich einen psychologischen Komplex, den nichts notwendig von der reinen Subjektivität ablösen würde. Man hätte immer das Mittel, diesen subjektiven Inhalt des Bewusstseins zu „objektivieren“ kraft eines dogmatischen Prinzips, wie es die „Übereinstimmung der Vernunft und der Dinge“ wäre. Aber stachelt man sich an, jeden Dogmatismus zu vermeiden, lässt die Verkennung der thomistischen „Finalität“ keinen anderen Zugang zum metaphysischen Objekt als eine subjektive Gläubigkeit der Vernunft, etwa so wie Fries sie definierte. Man muss ganz einfach hier an die epistemologische Position der nicht thomistischen scholastischen Schulen denken. Wenn sie die unmittelbare Evidenz der metaphysischen Prinzipien behaupten, der „principia primo per se nota“, unterscheiden sie sich dann von der Schule von Fries anders als durch ein dogmatisches Postulat, mittels deren Ausdruck sie die subjektive Unstillbarkeit der Zustimmung als objektive Evidenz qualifizieren? Tatsächlich, wie würden sie kritisch die objektive Geltung der metaphysischen Synthesen rechtfertigen? Durch die konstitutive Finalität des (immanenten) Objekts? Aber denkt man daran? Die Affirmation des absolut Objektiven auf dem inneren Finalismus des Akts des Verstehens zu gründen, zieht nach sich, als Korrolarium, alle charakteristischen Thesen des Thomismus: Die strenge Geltung der komplementären Begriffe von Akt und Potenz, das heißt die reale Distinktion des Seins als Akt und des Wesens als Potenz; die Kontingenz des endlichen Seins verstanden entsprechend dieser fundamentalen These; die grundlegende Analogie der Idee des Seins; die intellektuelle Spontaneität und die äußere Mitwirkung der Sinnlichkeit zum Begriff, was die Vermittlerrolle des intellectus agens impliziert; den Vorrang des abstrakten Begriffs in der intellektuellen Apprehension der materiellen Individuen; korre- 384 §3.–Hauptsächliche Diskrepanz zwischen der thomistischen Epistemologie und dem Kritizi 477 lativ dazu die metaphysische These der Individuation der abstrakten Formen durch Beziehung zur konkreten Quantität oder zur quantifizierten Materie, und so weiter. Alle diese großen thomistischen Thesen sind eng verbunden miteinander: die eine leugnen heißt die anderen erschüttern; und alle zusammen hängen unlösbar an der finalistischen Konzeption der objektiven Erkenntnis. Mehrfach im Verlauf dieser Vorlesungen unterstreichen wir diesen logischen Zusammenhang. Sie würde noch besser aufscheinen, wenn wir hier direkt die „metaphysische Deduktion“ hätten behandeln können. Aber erst die nicht-thomistischen scholastischen Philosophien, außer wenn sie die Züge opfern, die sie vom Thomismus unterscheiden, wollten sie die kritische Form annehmen, so könnten sie das nur im Sinn des Kritizismus von Fries:. sie würden im gleichen Boot sitzen wie der kartesische oder wolffsche Rationalismus, wenn er seinen Dogmatismus abschwören würde. Die unbewussten Verwandtschaften, auf die wir gerade aufmerksam machen, zwischen verschiedenen, auf den ersten Blick sehr verschiedenen, Formen des philosophischen Denkens, rechtfertigen uns, auf dem Kritizismus von Fries insistiert zu haben: wir haben ihn hier betrachtet als den Typ einer sehr verbreiteten epistemologischen Haltung. Und wir haben angemerkt, dass der grundlegendste Punkt, an dem wir uns davon trennen, auf einer verschiedenen Einschätzung des Finalismus des objektivierenden Aktes beruht. Wenn die Schule von Fries sich über das thomistische System der Erkenntnis hätte äußern müssen, hääte sie es zweifellos unter die „teleologischen Theorien“ eingeordnet, über die Nelson eine allgemeine Kritik abgibt bei Gelegenheit von Lipps und von Rickert. Eine schnelle Prüfung der hauptsächlichen Einwände von Nelson wird uns einmal mehr erlauben, unseren Gesichtspunkt zu präzisieren. Das spezifische Merkmal einer „teleologischen Theorie“ der Erkenntnis wäre es, die objektive Wahrheit unmittelbar auf die Finalität oder auf den Wert [die Geltung] 1 abzustützen. 1 Nelson zit.Op. S.493 Das kann man auf zwei Weisen verstehen: entweder hat die „Geltung“ die Rolle eines einfachen Kriteriums, das die Existenz eines Objekts offenbart (Lipps); oder die objektive Existenz ist „postuliert“ (“gefordert“) durch die aktive Finalität des Bewusstseins 2 . 3 zit.Op. S.494 Über seine zwei Formen macht Nelson die Anmerkung, dass diese finalistische Konzeption ausgeht von einer einzigen Voraussetzung: „Dass eine Erkenntnis uns nur möglich sei im Urteil3 “ 3 zit.Op. S.500 385 Kapitel 4. der Kritizismus der Schule von Fries 478 Nun aber, gesteht er, das zugegeben, wäre es schwierig, den Finalismus in der Kritik abzulehnen: denn das Urteil hängt ab von unserem Wollen unter zwei Titeln: durch die Wahl der zusammengestellten Terme und durch die Zustimmung, die es außerhalb des reinen Denkens setzt. Ein Thomist macht sofort darauf aufmerksam, dass die Finalität des für das Objekt konstitutiven Urteils, überhaupt nicht ein eigentliches Wollen ist, sondern nur eine implizite, natürliche Finalität. Nelson setzt voraus, wie andererseits auch Fries, dass jedes Urteil sich durch einen reflexiven Akt bildet, auswählend aus objektiv (obwohl nur dunkel) im Bewusstsein gegenwärtigen Materialien, sie gruppierend und danach ihre Synthese bejahend oder verneinend: wenn jedes Urteil also reflexiv ist, wäre die Finalität des Urteils eine elizierte [bewusst gewollte] Finalität, ein Wollen im strengen Sinn des Wortes. Nun aber wird kein Thomist zugeben, dass jedes Urteil „reflexiv“ ist; denn genau das Urteil ist erfordert für die erste Konstitution des Objekts im Bewusstsein. Obwohl vor dem Urteil undurchsichtige Veränderungen in unseren Fakultäten stattfinden könnten, wird keine dieser Veränderungen uns objektiv bewusst, als nur in einem Urteil. Und der „objektivierende“ Faktor ist dabei durchaus nicht unserer „Willkür“ überlassen, da die Möglichkeit selbst dieser „Willkür“ schon konstituierte Objekte erfordert. „Urteil“ und „Objekt“ gehen Hand in Hand. Aber verfolgen wir den Haupteinwand, den Nelson geltend macht gegen die Voraussetzung des kritischen Finalismus. Zuerst, sagt er, woher bezieht man die „Abhängigkeit des Urteils vom Wollen“ wenn nicht aus der inneren Erfahrung? Aber man muss logisch bleiben: die innere Erfahrung zeigt auch im Bewusstsein Erkenntnisse, die nicht die wesentlichen Attribute des Urteils besitzen, zum Beispiel die „sinnlichen Wahrnehmungen1 “ 1 zit. OP. S.501 Nelson bemüht sich also, zu beweisen, dass die „sinnlichen Wahrnehmungen“ nicht Urteile sind, aber dass sie kraft ihres assertorischen Charakters dennoch „Erkenntnisse“ sind. Sein Beweis erstaunt jeden Leser, der vertraut ist mit der Theorie des Urteils in den antiken Philosophien. Es möge uns genügen, darauf hinzuweisen, ohne in die tiefere Diskussion einzutreten, dass für einen Thomisten – wie fürdie meisten nicht empiristischen Philosophen – die Sinneswahrnehmung unser klares Bewusstsein nicht erreicht und den „assertorischen Charakter“ nicht annimmt, es sei denn im Inneren einer objektiven Apperzeption, welche der Definition nach ein Urteil ist. Direkt dem sinnlichen Inhalt des Bewusstseins, isoliert vom Urteil, die assertorische Form der Objektivität zuteilen, käme dem Bekenntnis des radikalen Empirismus gleich. 386 §3.–Hauptsächliche Diskrepanz zwischen der thomistischen Epistemologie und dem Kritizi 479 Muss man wenigstens, wie es Nelson insinuiert, sagen, dass die finalistische Kritik – wie auch immer sie beschaffen wäre – sich wohl oder übel auf eine Feststellung der inneren Erfahrung stützt und so im Gesamten nicht in einer besseren Position ist als der Kritizismus von Fries? Auf diesen Einwand kann man keine durchschlagendere Antwort geben als die Darlegung der thomistischen Kritik, die wir weiter oben gemacht haben. Man kann sicherlich finalistische Epistemlogien konzipieren, die überhaupt nicht konkludent sind, oder die eine dogmatische Prämisse verstecken. Ihr gemeinsamer Fehler bestünde darin, die Rechtfertigung der objektiven Wahrheit zu suchen in einer elizierten (=ausdrücklich gewollten) Finalität, die ein schon im Bewusstsein gegenwärtiges Objekt voraussetzt. Die thomistische Epistemologie dringt ein in die Genese des Objekts selbst als solchem in den Bereich der natürlichen Finalität der Intelligenz. Der Zugang zu diesem dunklen Bereich steht ihm offen durch die einfache Analyse des ursprünglichem Datums jeder Kritik: das bewusste Objekt, nicht das künstlich vom Subjekt abstrahierte Objekt sondern das Objekt in der vit