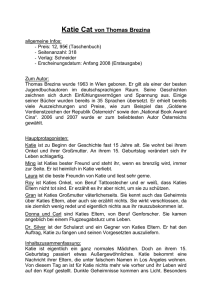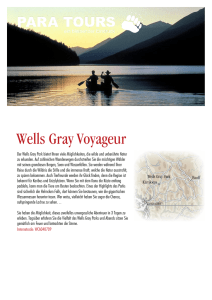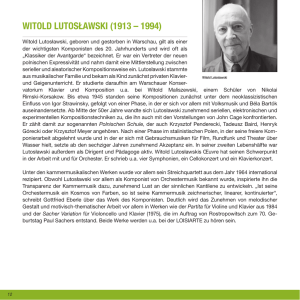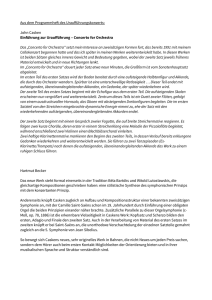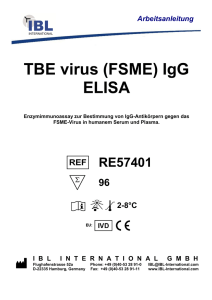Im Zeichen des Krieges - Schlachthaus Theater Bern
Werbung

Der kleine 33 — Donnerstag, 31. Januar 2013 Berner Woche Veranstaltungen Mehr Angaben unter: www.agenda.derbund.ch Von 31. Januar bis 6. Februar 2013 Sounds Emily Wells Die ungezähmte Schwester Sie singt mit der Sanftheit eines Popsternchens und hat die Attitüde eines PunkChicks. Das funktioniert gut. Die Lautenart Ngoni – hier in der verstärkten Variante – im Kreise Bassekou Kouyatés Band Ngoni Ba. Foto: zvg Sounds Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba Im Zeichen des Krieges Während der Aufnahmen zu seinem neusten Album wurde der malische Musiker Bassekou Kouyaté vom Militärputsch überrascht. Hannes Liechti Eigentlich bezeichnet er sich als unpolitisch. Doch seit in seinem Heimatland Mali Krieg herrscht, kommt Bassekou Kouyaté nicht umhin, Stellung zu beziehen: «Ich möchte Frankreich und François Hollande danken», kommentierte er gegenüber der englischen «Times» vor ein paar Tagen die jüngsten Entwicklungen im westafrikanischen Wüstenstaat und hob den Zeigefinger: «Unsere Musik ist in Gefahr.» Mit Blick auf die seit Monaten unter islamistischer Kontrolle stehenden Gebiete im Norden des Landes wird rasch klar, dass Kouyaté keineswegs übertreibt. Von Musikverboten, wie sie einst von den Taliban in Afghanistan durchgesetzt worden sind, ist die Rede. Auch in der Hauptstadt Bamako ist es musikalisch ruhig geworden: Es werden kaum noch Konzerte veranstaltet, zu heikel sei die Sicherheitslage. Unvermittelt ist der Musiker Bassekou Kouyaté zum politischen Botschafter seines Volkes geworden. Kouyaté ist ein Griot. Seit Jahrhunderten sorgen diese musikalischen Ge- schichtenerzähler in Westafrika für die mündliche Verbreitung von traditionellem Wissen. Stets eng mit ihren Auftraggebern – den Mächtigen der Gesellschaft – verbunden, amten die Griots gewissermassen als Hofsänger. Kouyaté stammt von der ältesten und einflussreichsten Griot-Familie Malis ab und war mit dem gestürzten Präsidenten Amadou Toumani Touré befreundet. Die Maschine in der Ngoni Das traditionelle Instrument der Griots ist die Lautenart Ngoni. Angeregt von der Musikwissenschaftlerin Lucy Durán, die in der zeitgenössischen Kultur Malis im Verschwinden begriffene Kunstform wiederzubeleben, gründete Kouyaté mit der Gruppe Ngoni ba das erste NgoniQuartett überhaupt. Seither gilt er als Erneuerer jener Musik, von der ein weit verbreiteter Mythos besagt, sie sei der Ursprung des afroamerikanischen Blues. Kouyaté war es, der das Instrument an elektronische Verstärker anschloss und es konzerttauglich machte. In Mali erspielte sich der Griot bald ein begeistertes Publikum, und in der internationalen Weltmusikszene wurde er zum Star. Sein Debütalbum erhielt den BBC World Music Award, und das Folgealbum brachte es zu einer Grammy-Nominierung. Eines ist sicher: Die Musik Kouyatés ist virtuos. So sehr, dass er schon von einem Zuschauer gefragt worden sei, ob er in seiner Ngoni eine Maschine verstecke, die all diese Klänge produziere. Hamsterkäufe und Ausgehsperren Nun ist Bassekou Kouyaté mit seinem dritten Album «Jama ko» auf Tour. Die Arbeiten im Studio begannen im Frühling des vergangenen Jahres. Noch am selben Nachmittag brach in Bamako der Militärputsch los, mit einschneidenden Folgen: Hamsterkäufe, Stromausfälle und Ausgehsperren erschwerten die Aufnahmen. Entstanden ist schliesslich eine von den Unruhen zutiefst geprägte Platte. So singt Kouyaté darauf von einem malischen Herrscher, der im 19. Jahrhundert erfolgreich die Islamisierung seines Gebietes aufhalten konnte. Der Titel «Jama ko» bedeutet übersetzt «eine grosse Zusammenkunft vieler Menschen». Der Griot verbindet damit einen Ruf nach Einheit, Frieden und Toleranz in Zeiten der Krise. Ein friedliches «Jama ko» hat Mali bitter nötig, das ist Kouyatés eindringliche Botschaft. Es geht ihm dabei auch darum, die reichen musikalischen Traditionen des Landes zu retten: «Wir haben kein Erdöl, wir haben nichts. Wir haben nur unsere Musik.» Turnhalle im Progr So, 3. Februar, 19.30 Uhr. Als kniete man in einer Blumenwiese und blickte dann gen Himmel. Zuerst ist er wolkenverhangen, dann wird er blau. Schnitt. Eine Autofahrt: über eine Brücke, durch einen Tunnel, wahrscheinlich filmt die Person auf dem Beifahrersitz. Eine kehlige Stimme singt: «I’m a passenger / Give me the keys / I wanna drive». Das Video zum Lied «Passenger», bestehend aus zusammengeschnipselten Bildsequenzen, in Kombination mit dieser erotisierenden Stimme, ja, das könnte auch ein frühes Werk von Lana Del Rey sein. Doch dann erscheint die Verantwortliche im Bild und ist alles andere als blond, süss und volllippig: Emily Wells. Ungeschminkt, strähniges Haar, verbraucht, offensichtlich nicht daran interessiert, was andere über ihr Aussehen denken. Sie ginge höchstens als ungezähmte Schwester der Del Rey durch. Und doch hat die Multiinstrumentalistin Emily Wells mit dem Pop- und WerbeSchätzchen mehr gemein, als man denken würde: Beide singen in ätherischer Manier über orchestrale Liedwerke und thematisieren gern ihre Vorliebe für Waffen und die Flucht ins nächste Abenteuer. Spielt bei ihren Produktionen immer die Erste Geige: Emily Wells. Foto: zvg Die Texanerin lebt und werkelt in New York. Ihre Geigenspiel-Künste paart sie mit Hip-Hop-Beats, unterlegt sie mit Glockenklängen und Spielzeuginstrumenten, gerne auch analogen Synthesizern. Vorgekocht ist nichts, besonders bei Live-Auftritten, denn sie programmiert ihre Beats in Echtzeit. In ihrer Diskografie tauchen die Alben «Sleepyhead», «Symphonies», «Dirty» und das 2012 unter Partisan Records publizierte «Mama» auf. Eben hat sie gemeinsam mit dem Hip-Hop-Produzenten Dan the Automator die CD «Pillowfight» veröffentlicht. Die Lieder sind nahe am Pop-Bereich angesiedelt, aber auf die Charts schielen sie nicht. Das würde wahrscheinlich gar nichts bringen, denn: Wells will machen, was sie will. (mik) Café Bar Mokka Sonntag, 3. Feb., 20.30 Uhr/ Fri-Son Mittwoch, 6. Februar, 20 Uhr. Kunst Supergrupa Azorro Hofnarren im Königreich der Kunst Spuckende Männer und ein Roadmovie in Latein: Die Videos der Supergrupa Azorro sind Meta-Kunst mit Mega-Witz. Ein Bild malen, mit einem Pferd drauf ? Schon gemacht. Eine Skulptur, vielleicht aus Butter? Längst schon gemacht. Ein Stück von sich abschneiden? Schon gemacht, zum Glück. Ein Foto von nichts, ohne Kamera? Auch schon gemacht. Gute zehn Minuten geht dieses Frageund-Antwort-Spiel. Die Protagonisten des Kurzfilms sind vier Künstler, die in einem Garten um ein sehr kleines Tischchen herum sitzen, rauchen – und überlegen, was sie als nächstes tun könnten. Doch auf jeden Vorschlag folgt, wie ein Mantra, der Satz: «Schon gemacht.» So belustigt sich das polnische Künstlerquartett, das sich Supergrupa Azorro nennt, über den Innovationsterror in der Kunst. Von 2001 bis 2010 drehten Oskar Dawicki, Igor Krenz, Wojciech Niedzielko und Lukasz Skapski vordergründig alberne, aber durchaus hintergründige Filmchen, in denen gefragt wird, was der Künstler soll, kann und darf. Das Schlachthaus- Theater zeigt eine Auswahl von neun Filmen, darunter «Darf ein Künstler alles?». Darin spucken die vier von einer Autobahnbrücke, gehen bei Rot über den Zebrastreifen oder malen auf einem Ausstellungsplakat Andy Warhol einen Schnauz – bewusst harmlose Grenzüberschreitungen in einem Land, in dem Zensur lange nichts Aussergewöhnliches war. Die vier geben sich in ihren Videos gerne naiv, so auch in «Es gefällt uns sehr»: Sie betreten Galerien und Museen, und wenn sie herauskommen, kommt aus ihnen nichts anderes heraus als: «Es gefällt mir sehr. Grossartig. Super.» Doch die Sprache ist nicht immer nur eine klägliche Krücke im Werk der Supergrupa, denn es gibt auch noch das Roadmovie «Pyxis Systematis Domestici Quod Dicitur». Die Gruppe fährt darin nach Wien – und unterhält sich auf der Reise mit Kioskfrauen, Kellnerinnen und Dörflern auf Lateinisch, egal in welchem Land. Es hat seinen ganz eigenen Reiz, wie einer in einer angeblich toten Sprache ein Snickers kauft. Über die Kunst in kurzen Filmen nachdenken? Längst schon gemacht. Aber längst nicht immer so gut. (reg) Schlachthaus-Theater 2., 3., 9. und 10. Februar, jeweils 17 bis 19 Uhr. Klassik Hommage an Witold Lutoslawski Bühne «Bunny» Bis in die Noten unzerstörbar «Ich bin eine tickende Zeitbombe» Lutoslawskis expressive Musik spiegelt den Geist eines Komponisten, dem das Leben nichts ersparte. Das Stadttheater Bern zeigt den herben Teenagermonolog «Bunny» des preisgekrönten Dramatikers Jack Thorne. Wenn man ihn doch fragen könnte, wie er das alles ausgehalten hat. Und weshalb er nicht zerbrochen ist. Vor 100 Jahren kam Witold Lutoslawski in Warschau auf die Welt. Seine Mutter war Medizinerin, sein Vater Pianist und politisch aktiv: Er organisierte den Widerstand gegen die russische Besetzung in Polen. Witold erlebte, wie man seinen Vater 1915 verhaftete und später hinrichtete. Da war er fünährig, spielte bereits Klavier und Violine und zeigte Talent beim Improvisieren. Mit 9 kam das Komponieren dazu. Später studierte er am Warschauer Konservatorium, belegte «nebenbei» Mathematik-Vorlesungen. Lutoslawskis Opus 1 entstand 1938, die «Symphonischen Variationen». Das Berner Symphonieorchester (Leitung Andrey Boreyko) wird sie im Kultur-Ca- sino aufführen. Dazu das vierteilige Cellokonzert, das Lutoslawski Ende der 1960er-Jahre komponierte. Es beschwört eine Konfliktsituation zwischen Orchestertutti und Solist herauf: Da wird zwischen den Registern intrigiert, getrotzt, gedonnert. Im Finale lassen Bläser und Schlagzeug Fortissimo-Kaskaden über das klagende Cello einbrechen. Starke, expressive Klänge, modern und verständlich. Oder meint Lutoslawski mehr als die Musik der Notenwerte? Meint er mit den ungleichen Klangparteien die durch einen Staatsapparat gefährdete Humanität? Wenn man ihn doch fragen könnte. Der russische Cellist Mstislav Rostropowitsch spielte den Solopart bei der Uraufführung des Cellokonzerts in London. In Bern wird es Rostropowitschs letzter Student tun, der Meistercellist Ivan Monighetti. Es dürfte der Hommage eine besondere Authentizität verleihen. (mks) Kultur-Casino Do, 31. 1./ Fr 2. 2., 19.30 Uhr. Programm: www.konzerttheaterbern.ch Der polnische Komponist Witold Lutoslawski (1913–1994). Foto: zvg Ein schwüler Nachmittag, ein Zusammenstoss, eine Glace, die auf den Boden fällt, eine gefährliche Autofahrt: HighNoon in einer britischen Kleinstadt. Was Katie, die mit ihrem Freund und dessen Kollegen unterwegs ist, alles durch den Kopf geht, hat der britische Dramatiker Jack Thorne zu einem dichten Monolog verarbeitet. Im Gedankenstrom der 16-Jährigen schwimmt alles mit, der erste Sex, der tägliche Frust, der Stress und der Rassismus, der in ihrer Heimatstadt so selbstverständlich ist wie Gewalt und Arbeitslosigkeit. Katie redet drauflos in einer beiläufigen Sprache der unfertigen Sätze, in denen sich ihr Gemütszustand spiegelt. Noch ist sie in der Erwachsenenwelt nicht angekommen, noch ist sie ein halbes Kind, dessen Empfindungen längst nicht kongruent mit seinem Handeln sind. Alsdann landet das Mädchen in einer Konstellation, in der die Katastrophe nur ein Fingerschnippen entfernt ist. Mit «Bunny» ist Thorne eine überzeugende Momentaufnahme aktueller Teenagernöte gelungen. Seltsam unbeteiligt schaut die junge Frau zu, wie sie macht, was sie eigentlich nicht will, und sich dabei nicht einmal besonders unwohl fühlt. Es ist diese Ambivalenz, die Thornes kurzen Text so aufregend macht und gleichzeitig so authentisch. Denn der preisgekrönte Dramatiker liefert weder ein Teenagerdrama noch Erklärungen. Seine Katie scheint ihm immer noch einen Schritt voraus zu sein. Gleichzeitig ist sie keine Heldin, sondern vielmehr ein unauffälliger Teenie. «Ich bin eine tickende Zeitbombe», sagt Katie einmal. Mit «Bunny», das am Stadttheater Bern als Schweizer Erstaufführung inszeniert wird, kartografiert Thorne das alltägliche Minenfeld, dem Jugendliche heute ausgesetzt sind. (bnb) Vidmarhallen 12. Februar, 19.30 Uhr.