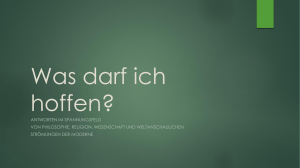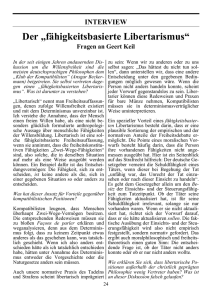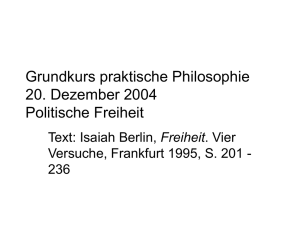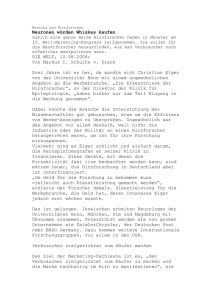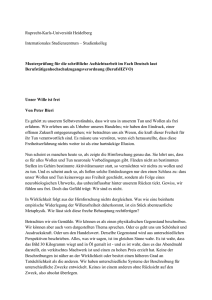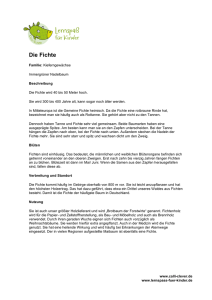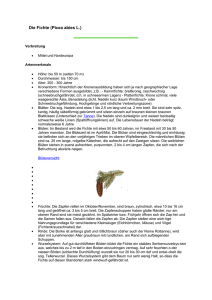Freier Wille – frommer Wunsch? - Evangelische Akademie Tutzing
Werbung

Erschienen in: Helmut Fink, Rainer Rosenzweig (Hg.): Freier Wille – frommer Wunsch? Gehirn und Willensfreiheit. Paderborn: mentis Verlag 2006 (S.205-218). Matthias Kettner Selbstbestimmung – das latente Thema der Willensfreiheitsdebatte I. Determinismusgläubigkeit Die großen Wellen der öffentlichen Biopolitik- und Bioethik-Kontroversen ebben seit etwa zwei Jahren ab und werden von einem neuen Thema überlagert, der Debatte über Willensfreiheit und Determinismus. Von einigen der in Deutschland bekannteren Philosophen und Hirnforscher bis hin zu den journalistischen Zweit- und Drittverwertern wird in den Feuilletons der großen Tageszeitungen, an evangelischen und katholischen Bildungsakademien, in Volkshochschulen und Seminaren an einer neuen Variante des Genres der naturalistischen Aufklärung mitgewirkt, der großen Desillusionierung über das Wesen der menschlichen Freiheit. Man weiß nicht so recht, welche Affekte im Publikum überwiegen: Der Schrecken angesichts des Denkmöglichen, dass Willensunfreiheit wird, was Willensfreiheit schien, eine alte und dunkle Ahnung, die nun zum ersten Mal sogar mit wissenschaftlichem Prestige daherkommt? Oder die Erleichterung darüber, die Zumutungen der Freiheit nun endlich auch mit gutem intellektuellem Gewissen loszuwerden? Es ist schon erstaunlich: Was in den 80er Jahren die ernsteste Spielerei der Postmoderne schien – die durch den Neostrukturalismus vermittelte Austreibung des Subjekts, Neuauflage der von den Empiristen von Ernst Mach bis Otto Neurath verbreiteten Losung „das Ich ist nicht zu retten“ – vollendet sich heute ungleich wirkungsmächtiger durch Vermittlung der Neurowissenschaften: mit spielerischem Ernst wird das Subjekt des freien Willens demontiert. Woher diese breite Faszination durch Fragen, die philosophisch ein für alle mal abgetan schienen? Womöglich steht hinter aller Determinismusgläubigkeit die Tatsache, dass das Wissen um die eigene Freiheit Angst macht vor der Eigenverantwortung, ihrem unabweisbaren Begleiter. Dieses allgemeine Motiv einer Angst vor der Freiheit, das von JeanPaul Sartre und Herbert Marcuse sozialphilosophisch, von Alexander Mitscherlich und Eberhard Richter psychodynamisch analysiert worden ist, ist aufschlussreich und verstörend, weil es die emanzipatorische Annahme relativiert, von der die Aufklärung in der Tradition Kants zehrt: dass die Menschen aus ihrer Unmündigkeit hinauskommen wollen. Kulturwissenschaftlich muss Determinismusgläubigkeit im Kontext der großen Lenkungserzählungen erklärt werden. Unter Lenkungserzählungen möchte ich Selbst- und Weltdeutungen verstehen, die darauf hinauslaufen, dass das, wovon wir denken, wir tun es, weil wir es so wollen, produziert wird von etwas, zu dem einer nicht „ich“ sagen würde. Die im Selbstverständnis der Person verankerten (und daher auf „bürgerliche“ Freiheiten nicht reduzierbaren) Freiheiten der Willkür, des Überlegens und der Handlungsentschließung werden in Lenkungserzählungen relativiert. Aber indem sie zu nicht-ichlichen Instanzen in Relation gesetzt und dadurch von diesen abhängig gemacht werden, müssen sie nicht immer auf so einfache Alternativen gezogen werden, wie dies derzeit in den populären Debatten über „Freiheit versus Determinismus“ geschieht. Jenes christlichen Gemütern noch vertraute „der Mensch denkt – Gott lenkt“ klingt im Vergleich recht gemütlich und stempelt den so Gelenkten nicht zum Zombie. Auch die logozentrische Philosophie hat ihre Lenkungserzählung: den denkenden Menschen leitet die Stimme einer Vernunft, die nicht geradewegs mit dem Intellekt zusammenfällt, mit dem die Person sich selbst identifiziert. Ungemütlicher wurde es mit Freuds tiefenpsychologischer Anthropologie, derzufolge das Ich im eigenen Haus nicht der Herr ist, sondern Programme abarbeitet, die ihm von unbewussten Kräften vorgeschrieben werden (die Freud als die „psychischen Instanzen“ des Es und des Überich beschreibt). Mit der Alleinheitslehre der „materiellen“ Welt, wie sie die modernen Naturwissenschaften beschreiben, allen voran die Physik, entsteht die Plausibilität jener großen Lenkungserzählung von den Naturgesetzen, die allen modernen „rationalen“ Determinismusvorstellungen zugrunde liegt und diesen von ihren vielfältigen mythischen „irrationalen“ Varianten eines Schicksalsglaubens unterscheidet. Die Natur lenkt alles, was geschieht, in der festen Bahn der Naturgesetze. Sie sind für einen lückenlosen „Kausalzusammenhang“ verantwortlich, dem sich alles, was ist, fügt, weil nichts anders geschehen kann, als es tatsächlich geschieht. Hatte die mythenlösende Kraft der monistischnaturwissenschaftlichen Weltanschauung mit den Schicksalsmächten, Geistern und Wundern, Kehraus gemacht, ohne dass die im Selbstverständnis der Person verankerten Freiheiten Schaden nehmen mussten, gerät die naturalistische Aufklärung mit diesen in Widerstreit, sobald der Sitz dieser Freiheiten mit dem Gehirn identifiziert und das Gehirn als ein natürlicher Teil der objektiven Welt wie jeder andere thematisiert wird. Nun besetzen die naturgesetzlich unterlegten Gehirnprozesse die Rolle jener Instanz, die die Fäden zieht und lenkt, wo die einander als sich selbst bestimmende und deshalb eigenverantwortliche Personen begegnenden Menschen zunächst einmal sagen würden, dass sie selbst es sind, die die Fäden ziehen und lenken. Das allgemeine Motiv einer Angst vor der Freiheit lässt sich vor diesem Hintergrund um ein Schlüsselmotiv ergänzen, ohne die jene determinismusgläubige Disposition, die der Willensfreiheitsdebatte den Treibstoff gibt, nicht verstanden werden kann. Das ergänzende Schlüsselmotiv liegt in einer verbreiteten Erfahrung und Mentalität, die in den modernen Lebensverhältnissen selbst wächst und ist mit den Stichworten Entfremdung und Fremdbestimmtheit bezeichnet. Entfremdung und Fremdbestimmtheit notieren Zweifel an der Reichweite und Tiefe von Selbstbestimmung. Selbstbestimmung verlangt ihrem Begriff nach nicht bloß, dass Handlungen irgendwelche Ursachen sondern dass sie Autoren haben. Der Handelnde (Aktor), soweit er in seinem Tun als freie Person in Erscheinung tritt, will es so, wie er beabsichtigt; damit sieht er sich zugleich als der seiner selbst bewusste Urheber (Autor) seines Tuns und Lassens. Umstände und Unvorhersehbares, die Wechselfälle des Lebens und der Situation können aus den Handlungsabsichten alles Mögliche machen. Aber die Handlungsabsichten und das Geflecht der Überlegungen und Entschließungen, aus denen sie aufsteigen, wird zusammengehalten und vereinigt durch eine Person, die „ich“ zu sich sagt und eine praktische Autorität hat zu beurteilen, ob die Bedeutung ihres Tuns der von ihr intendierten Bedeutung entspricht (oder von ihr abweicht), die die praktische Autorität der Perspektive einer zweiten und dritten Person (die natürlich ebenfalls Gewicht haben) ceteris paribus übersteigt. Die autoriale Erfahrung in der aktorialen ist aber, als Erfahrung, nicht einfach immun gegen widerstreitende Evidenz. Wenn aus Umständen und Unvorhersehbarem, aus den Wechselfällen des Lebens und der Situation allzu oft aus den Handlungsabsichten einer Person etwas anderes wird als das, was sie intendiert, kommt der Person das autoriale und zuletzt sogar das aktoriale Selbstbewusstsein abhanden, wird unauthentisch, von zuwenig Erfahrung untermauert und nähert sich zuletzt bloßer Fiktion. Das ganze Spektrum von Entfahrungen des Entgleitens und Verfalls von autorial-aktorialer Selbstbestimmung ist mit den Begriffen von Entfremdung und Fremdbestimmtheit markiert. Meine Behauptung, dass Entfremdung und Fremdbestimmtheit (im soeben definierten Sinne) in den modernen Lebensverhältnissen selbst wachsen, lässt sich in der hier gebotenen Kürze nicht so nachdrücklich entwickeln, wie es ihrer Bedeutung angemessen wäre. Viele soziologische Belege kommen aus Theorien der kulturellen Globalisierung, z.B. aus den neueren Arbeiten von Richard Sennett über die Kultur des Kapitalismus, aber auch aus sozialphilosophischen Überlegungen zur globalen Netzwerkgesellschaft (Manuel Castells) und zum Übergang von der Überwachungs- (Michel Foucault) zur Kontrollgesellschaft (Gilles Deleuze). Wenn die berufliche Karriere ebenso unsicher wird wie die Partnerwahl, wenn die vermeintlich planbare Altersversorgung im Zuge der „Ökonomisierung des Sozialen“ der Volatilität der Finanzmärkte preisgegeben werden muss, wenn sich in den trügerisch robusten Ballungszentren alltäglicher Transaktionen (z.B. Massentransport und Tourismus) die Angst vor terroristischen Attacken einnistet, wenn bürgerliche Freiheitsrechte durch staatliche Maßnahmen eingeschränkt werden; wenn derselbe Staat, der machtvoll genug ist um Grundfreiheiten seiner Bürger einzuschränken, soviel demokratische Souveränität an transnationale Gebilde abgibt, dass er nicht mehr die Macht hat, Wohlstand, Sicherheit, Gesundheit und Bildung seiner Bürger auf einem wünschenswerten Niveau zu halten – dann dünnt der Erfahrungsgehalt der autorial-aktorialen Selbstbestimmung in existenziell wichtigen Bereichen zusehends aus und bereiten den Boden für eine Krise der Autonomie. Diese Krise, so scheint mir, wird in symbolischer Verschiebung dort mitverhandelt, wo über Willensfreiheit versus Determinismus schwadroniert wird im naiven Glauben, es mit einer wissenschaftlich entscheidbaren Alternative zu tun zu haben. II. Historischer Vorläufer des Determinismus-Schauders Unser Zweifel daran, es bei der Alternative „Willensfreiheit oder Determinismus“ vorrangig mit einer wissenschaftliche entscheidbaren Tatsachenfrage zu tun haben, werden weiter genährt, sobald wir ideengeschichtliche Vorläufer jener merkwürdigen Angstlust am Determinismus in den Blick nehmen, die wir im vorigen Abschnitt beschrieben haben. Eines der beredtesten Dokumente des Determinismus-Schauders ist Johann Gottlieb Fichtes im Jahre 1800 in Berlin veröffentlichtes Bruch über „Die Bestimmung des Menschen“. In seinen drei Teilen führt es vom „Zweifel“ an der Haltbarkeit der autorial-aktorialen Erfahrung des Ich weg zu einer Analyse des theoretischen „Wissens“ und von dort zum „Glaube“, wo der Zweifel verfliegt und die praktische Gewissheit, dass ich als handelndes Ich Realität habe, zurückgewonnen wird. Fichte Aporie ist das unbegreifliche Verhältnis zwischen einem naturwissenschaftlich-naturalistisch-deterministischem Weltverständnis einerseits und andererseits dem Selbstverständnis eines Wesens, das zu überlegtem Wählen und absichtsvollem Handeln fähig ist: „Im unmittelbaren Selbstbewusstsein erscheine ich mir als frei; durch Nachdenken über die ganze Natur finde ich, dass Freiheit schlechterdings unmöglich ist: das erstere muss dem letztern untergeordnet werden, denn es ist selbst durch das letztere sogar zu erklären.“1 1 Johann Gottlieb Fichte, Die Bestimmung des Menschen (Stuttgart: Reclam 1976, S. 26). Instruktiv für die heutige Debatte über Willensfreiheit ist besonders der erste, skeptische Teil. Wie knapp zweihundert Jahre früher René Descartes im Gedankenxperiment ausprobierte, was aus unserem gewöhnlichen Selbst- und Weltverständnis dann wird, wenn ich mich nur noch auf das verlasse, was mir selbst unmittelbar und irrtumsimmun gewiss ist – radikaler Solipsismus- , so versucht Fichte das Gedankenexperiment eines radikalen Naturalismus avant la lettre. Fichte probiert, was aus unserem gewöhnlichen Selbst- und Weltverständnis dann wird, wenn ich mich durchgängig als Teil des Naturganzen auffasse. Kam Descartes beim „Cogito ergo sum“ heraus – ich bin gewiss ein dies hier jetzt denkendes Wesen - , so gelangt Fichte zu einer Auffassung, die er in den Worten ausdrückt: „Ich bin eine durch das Universum bestimmte Äußerung einer durch sich selbst bestimmten Naturkraft“.2 In der Konsequenz dieser Auffassung liegt für Fichte das Folgende: Ich „handele ja überhaupt nicht, sondern in mir handelt die Natur; mich zu etwas anderem zu machen, als wozu ich durch die Natur bestimmt bin, dies kann ich mir nicht vornehmen wollen, denn ich mache mich gar nicht, sondern die Natur macht mich selbst und alles was ich werde. Ich kann bereuen, und mich freuen, und gute Vorsätze fassen; - ohnerachtet ich der Strenge nach auch dies nicht einmal kann, sondern alles mir von selbst kommt, wenn es mir zu kommen bestimmt ist; - aber ich kann ganz sicher durch alle Reue, und durch alle Vorsätze nicht das kleinste an dem ändern, was ich nun einmal werden muss. Ich stehe unter der unerbittlichen Gewalt der strengen Notwendigkeit; bestimmt sie mich zu einem Toren und Lasterhaften, so werde ich ohne Zweifel ein Tor und ein Lasterhafter werden; bestimmt sie mich zu einem Weisen und Guten, so werde ich ohne Zweifel ein Weiser und Guter werden. Es ist nicht ihre Schuld noch Verdienst, noch das meinige. Sie steht unter ihren eigenen Gesetzen, ich unter den ihrigen: Es wird, nachdem ich dies einsehe, das Beruhigendste sein, auch meine Wünsche ihr zu unterwerfen, da ja mein Sein ihr völlig unterworfen ist.“3 Aus dieser Einsicht resultiert allerdings keine schöne Meeresstille der Seele, auch keine naturfromme Ergebenheit, sondern ein verzweifeltes Aufbegehren gegen die vom konsequenten Naturalismus dekretierte Selbstentfremdung: „[W]arum sollte ich mir länger die Wehmut, den Abscheu, das Entsetzen verhehlen, welche (…) mein Inneres“ ergreifen? (…) Wie kann ich (…) an eine Erklärung meines Daseins glauben, die der innigsten Wurzel meines Daseins, dem Zwecke, um dessen willen ich allein sein mag, (…) so entscheidend widerstreitet? Warum muss mein Herz trauern und zerrissen werden, von dem, was meinen Verstand so vollkommen beruhigt?“ Freilich sieht Fichte auch, dass sich die naturalistische Aufklärung nicht einfach verdrängen lässt. Dass nicht sein kann, was man nicht aushält, wäre so wenig stichhaltig wie dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Fichte meint - und hierin liegt die unabgegoltene Aktualität dieses ansonsten so merkwürdigen Dokuments des Deutschen Idealismus -, dass wir durch die naturalistische Aufklärung hindurch gehen müssen, und noch dieser Durchgang selbst erscheint determiniert: „Hätte ich vielleicht hingehen sollen in dem freundlichen Wahne, der mich umgab, mich in dem Umfange des unmittelbaren Bewusstseins, meines Seins erhalten, und die Frage nach den Gründen desselben, deren Beantwortung mich jetzt elend macht, nie erheben sollen? Aber wenn diese Beantwortung recht hat, so musste ich jene Frage erheben; ich erhob sie nicht, sondern die denkende Natur in mir erhob sie. – Ich war zum Elende bestimmt, und ich beweine vergebens die verlorne Unschuld meines Geistes, welche nie zurückkehren kann“.4 2 Ebd. S. 31. Ebd. S. 32. 4 Ebd. S. 33. 3 Johann Gottlieb Fichte erreicht mit Bezug auf die Krise der Autonomie eine Position, die derjenigen ähnelt, die der Hirnforscher Wolf Singer, der Psychologe Wolfgang Prinz und andere heute einnehmen, wenn sie im Strafrecht die Umstellung von Schuld auf reine Prävention befürworten. Fichte schreibt: „Aber darum hört die Tugend nicht auf Tugend, und das Laster Laster zu sein. Der Tugendhafte ist eine edle, der Lasterhafte eine unedle und verwerfliche, jedoch aus dem Zusammenhange des Universums notwendig erfolgende Natur. (…) Nur die Begriffe Verschuldung und Zurechnung haben keinen Sinn, außer den für das äußere Recht. Verschuldet hat sich derjenige, und ihm wird sein Vergehen zugerechnet, der die Gesellschaft nötigt, künstliche äußere Kräfte anzuwenden, um die Wirksamkeit seiner der allgemeinen Sicherheit nachteiligen Triebe zu verhindern.“5 Wolf Singer zieht aus dem Stand der Hirnforschung folgende Konsequenz: In dem neuen, von den empirischen Neurowissenschaften mitgeprägten Menschenbild müssten wir unsere Willensfreiheit als ein notwendig falsches Bewusstsein behandeln, - als eine kulturell konstruierte Ideologie,6 die lediglich dazu dient, dass wir uns für den Lauf der Dinge gegenseitig verantwortlich machen.7 Zwar werden wir auch im Zeichen des neuen Menschenbilds weiterhin Schwerverbrecher einsperren oder therapieren, aber nur noch weil wir sie für gemeingefährlich, nicht mehr weil wir sie zudem für schuldig halten.8 Wäre das neurobiologische Selbstbild wirklich, wie Singer meint, nachsichtiger und optimistischer als unser jetziges? Wer Stanley Kubricks Film „Clockwork Orange“ erinnert, wird hier erhebliche Zweifel haben. Drei seien genannt. (1) Wer soziopathische Gewalttäter nicht mehr als verantwortungs- und somit schuldfähige Personen anerkennt, sondern nur noch als Träger reprogrammierbarer Verhaltensrepertoires, schafft womöglich mehr neues Leid und Unglück (und, nach unseren derzeitigen Begriffen: mehr moralisches Unrecht), als er auf diese Weise verhindern kann. (2) Systeme der Verhaltenskontrolle, die technisch auf eine externe Instanz verlagert werden (in behavioristische Techniken der Verhaltensmodifikation oder der neuronal-hormonalen Reprogrammierung), verlieren mit dem Wegfall der normenregulierten internalisierten Instanz auch die Umsichtigkeit und intelligente Plastizität, die für normengeleitetes Handeln als solches typisch ist. (3) Mit Blick auf die Reprogrammierer selbst entsteht erneut die Frage, wem gegenüber sie mit welchen Gründen für ihr Tun Rechenschaft ablegen, also sich verantwortlich zeigen müssen. Jeder dieser Einwände kann mit Hilfe von Argumenten der Ethik, der analytischen Philosophie des Geistes und der pragmatischen Handlungstheorie ausgebaut werden.9 Hier 5 Ebd. S. 31. 6 Wolf Singer, Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung (Frankfurt: Suhrkamp 2003, S. 59 f.). 7 8 Ebd. S. 51. Ebd. S. 65 f. Zur Kritik an Singer vgl. Eva Neumann-Held, Louise Röska-Hardy, Matthias Kettner, Lutz Wingert, „Die Vereinigungseuphorie der Hirnforscher. Acht Nachfragen“, in: Jörn Rüsen (Hg.), Jahrbuch 2002/2003 (Kulturwissenschaftliches Institut: Essen 2003, S. 15-38). 9 möchte ich aber eine andere, kulturwissenschaftlich Betrachtungsweise verfolgen und auf merkwürdige Brüche hinweisen, die die neurowissenschaftliche Problematisierung der Willensfreiheit schon kennzeichnen, noch bevor irgendeine Sachfrage erreicht wird, über die sich Philosophie und Neurologie in die Haare geraten können. III. Merkwürdigkeiten der aktuellen Debatte über Willensfreiheit Die erste Merkwürdigkeit der derzeitigen Debatte ist der enge Fokus auf Verbrechen.10 Warum werden Entgleisungssituationen, wie Taten im Affekt oder aus pathologischem Zwang es sind, als beispielhaft für Normalität genommen? Hirnforscher, die die Normalität des autorial-aktorialen Selbstbewusstseins mit Erklärungsmustern überziehen, die auf abnorme Verbrecher zugeschnitten sind, verhalten sich absurd. Ökonomen schließen ja auch nicht aus der Betrachtung von Bankrotteuren auf die Natur des unternehmerischen Handelns. Merkwürdig ist zweitens, dass die Debatte verkürzt wird auf unterkomplexe Alternativen wie die von Geist und Gehirn, Freiheit und Determinismus, Philosophie und Hirnforschung. Hätten Soziologie und Psychologie, hätten Pädagogik und Geschichtswissenschaft und andere Kulturwissenschaften nicht auch Nennenswertes über menschentypische Freiheitsspielräume und deren Einschränkungen zu sagen? Drittens muss die bis jetzt durch nichts gedeckte Hoffnung erstaunen, mit der der praktischen Verwertung der Erkenntnisse der Hirnforschung weitenteils entgegen gesehen wird. Neurophysiologische Erkenntnisse haben die in Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften besten bisher entwickelten Versuche, wichtige Phänomene zu begreifen (wie Rechtsordnungen, religiöse Weltdeutungen, Wirtschaftssysteme, politische Systemen, Kunstproduktion, Kriegsbereitschaft und Friedfertigkeit, ja der Wissenschaft selbst) nicht verbessern können. Warum sollten wir z.B. für Kindererziehung und schulisches Lernen eine geistige Neuorientierung durch die Ergebnisse der Hirnforschung erwarten? Hier liegt gewiss vieles im Argen und vieles verlangt wagemutige Neuerungen. Aber was da im Argen liegt, liegt nicht aus Mangel an Hirnforschung im Argen, und was an Wagemut gebraucht wird, können nicht die Hirnforscher liefern. Viertens erstaunt die Hartnäckigkeit, mit der Neurowissenschaftler an einer naturalistischen Weltsicht festhalten, deren Reduktionismus so offensichtlich ist. Naturalismus ist das Beharren darauf, dass verlässliche Erkenntnisse überhaupt nur mit Methoden der empirischen Naturwissenschaft gewonnen werden können, egal worüber Erkenntnis gesucht wird, sei es über Supraleitung oder über Selbstmordattentäter. Schon gegen diese Nivellierung wäre Misstrauen geboten. Noch mehr verblüfft die Abstraktion von kulturellen Qualitäten. Zwei verliebte Neandertaler sind für den hirnphysiologischen Blick ununterscheidbar von Romeo und Julia. Denn den Riesenunterschied zwischen beiden Fällen macht Kulturelles, und dafür ist jener Blick blind. Man mag sich viel damit beschäftigen, was Partnerbeziehungen im Tierreich mit der Liebe zwischen uns Menschen gemeinsam haben – etwa in Bezug auf Sexualhormone, Hirnzentren, Verhaltensdispositionen. Aber die kulturell jeweils herrschende Idee von Liebe, die unsere 10 Pars pro toto vgl. die Debatte zwischen dem Pädagogen Micha Brumlik und dem Hirnforscher Gerhard Roth, „Hat der Mensch keinen freien Willen? Sind Schuld und Sühne nur Fiktion?“ (Chrismon 9, 2004, S. 24-26). Beziehungen ganz wesentlich und höchst real bestimmt, z.B. die Exklusivität der Zweierbeziehung, die Hochschätzung des anderen als Individuum – das alles ist nicht allein im Gehirn abgebildet. Es ist in kulturellen Deutungsmustern verkörpert, nicht in einzelnen Organismen, einzelnen Zentralnervensystemen. Der methodologische Individualismus – dass die Forschung nur auf einzelne Gehirne blickt, weil sie über andere Methoden auch gar nicht verfügt – ist der zweite große Reduktionismus in den bisherigen Neurowissenschaften. Warum regt sich gegen diese schädeldeckenfixierte Sichtweise nicht mehr Skepsis, obwohl wir uns in vielen anderen Bereichen längst von einer atomaren Sicht des Individuums gelöst haben? IV. Coda: Die übersehene Welt der Gründe Vor einigen Monaten ist eine Gruppe von Neurowissenschaftlern, im Folgenden „Hirnforscher“ genannt, der Aufforderung einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift gefolgt und hat ein Manifest veröffentlicht.11 Das „Manifest der Hirnforscher“ ist kulturwissenschaftlich betrachtet ein wichtiges Dokument. Im Ton vordergründig bescheiden, wiederholt es doch alle im vorigen Abschnitt beschriebenen Merkwürdigkeiten. Alle im Manifest enthaltenen Aussagen sind von methodologischem Individualismus geprägt – die Sichtweise ist eingeengt auf die Erforschung des einzelnen Hirns, also auf das, was unter der Schädeldecke einzelner Menschen passiert. Damit wird ein entscheidender Teil unseres autorial-aktorialen Selbstbewusstseins und des Weltbildes, mit dem dieses Selbstbewusstsein ein kohärentes Ganzes bildet, ausgeblendet. Ausgeblendet wird, dass wir soziale Wesen sind, die in Gemeinschaft leben und die Gründe für ihr Handeln aus eben dieser Gemeinschaft beziehen. Die Hirnforscher meinen, dass auch Gründe, also die Beweg- und Rechtfertigungsgründe für unser Tun und Lassen, doch nur im Kopf existieren können. Aber: Man versteht die Natur von Gründen völlig falsch, wenn man meint, ein guter Grund existiere nur im Kopf dieser oder jener Person. Mein guter Grund, etwas Bestimmtes zu tun, kann eben auch derselbe gute Grund andere Personen werden, sobald diese sich in einer ähnlichen Situation begreifen. Mit demselben Recht, wie Hirnforscher davon sprechen, unser Erleben und Verhalten „gründe“ in Hirnprozessen, muss man behaupten, es „gründe“ in den Gemeinschaften zwischenmenschlicher Kommunikation. An soziale Interaktion und Intersubjektivität reichen die Begriffe der Hirnforscher vorerst nicht heran. Zwar weisen manche Forscher bereits darauf hin, dass die Forschungsperspektive erweitert werden müsste. Aber im Manifest der Hirnforscher findet sich kein methodischer Ansatz, wie dies zu bewerkstelligen wäre. Solange diese methodologische Beschränkung besteht, ist es mit Bekundungen der Hirnforscher, man werde auch die höheren kognitiven Leistungen des Menschen lückenlos naturalistisch beschreiben, nicht weit her. Denn zum Kern menschlicher Rationalität gehört die Fähigkeit, Gründe zu geben, zu verstehen und vergleichend zu bewerten. Die Fähigkeit des Überlegens und Abwägens, Argumentations-, Diskurs- und Urteilsfähigkeit sind allesamt Ausprägungen dieser einen, für unser lebensweltliches Welt- und Menschenbild konstitutiven Fähigkeit zur Orientierung in einem „Raum“ der Gründe. Der Begriff eines Raums der Gründe dient in gegenwärtigen Debatten der philosophischen Rationalitätstheorie und der philosophischen Anthropologie zur Markierung einer Grenze für naturalisierende 11 www.gehirn-und-geist.de/manifest Thematisierungsweisen und Forschungsmethoden. Denn gute Gründe gehen durch ihren intersubjektiv nachvollziehbaren Bedeutungsgehalt offenbar über jede naturalistische – soll heißen: methodisch-individualistische, einzelorganismuszentrierte und objektivierende Beschreibungssprache – hinaus. Die Aufschlusskraft naturalistischer Beschreibungssprachen bricht sich an einer anthropologisch tiefsitzenden begrifflichen Grenze: Als rationale Bewerter von Gründen denken wir uns als vernunftgeleitete Personen mit autorial-aktorialem Selbstbewusstsein, nicht als zentralnervös gesteuerte Organismen. Personen leben in einer Welt der Gründe. Gründe gelten gleichsam als die gemeinsame Währung innerhalb einer prinzipiell offenen Gemeinschaft vernünftiger Personen. Ich habe eingangs die These vertreten, dass die aktuelle Debatte über Willensfreiheit ein symbolischer Schauplatz ist, an dem sich Erfahrungen der Entfremdungs- und Fremdbestimmung inszenieren, die ihren Sitz nicht unter der Schädeldecke sondern in den Lebensformen modernen Gesellschaften haben. (Nicht behauptet habe ich, diese Debatte sei nichts weiter als dieser symbolische Schauplatz.) Selbstbestimmung bzw. deren Krise ist das latente Thema der Debatte über Willensfreiheit. Über deren manifesten Gehalt bzw. Vordergrund habe ich im vorliegenden Zusammenhang wenig gesagt, außer meinen Schlussbemerkungen über die problematische Ausblendung der Welt von Gründen, die unsere Lebenswelt ist. Aber führt die Welt von Gründen, wenn sie (wie ich behauptet habe) mit unserem Verständnis von Rationalität verschwistert ist, nicht auch nur wieder in eine große Lenkungserzählung hinein? Ich meine, die Antwort hängt davon ab, als was wir unsere rationalen Fähigkeiten begreifen wollen. Wo „die Vernunft“ als ein Nachfolgebegriff der göttlichen Weltregierung fungiert, verstricken sich Theologie und Aufklärung in die Fallstricker derselben Lenkungserzählung. Wo andererseits mit Vernunft nur mehr die kognitiven Prozesse gemeint sind, die die Hirnforschung modelliert, verstrickt sich diese in die Determinismusgläubigkeit der naturalistischen Lenkungserzählung. Es käme darauf an, vernünftige Selbstbestimmung so zu denken, dass wir beide Lenkungserzählungen hinter uns lassen können.