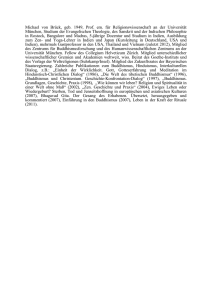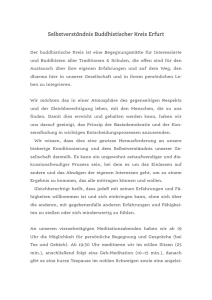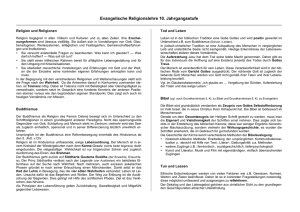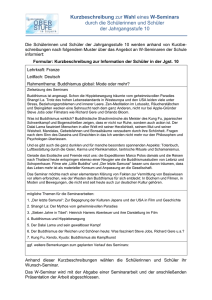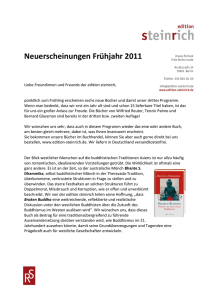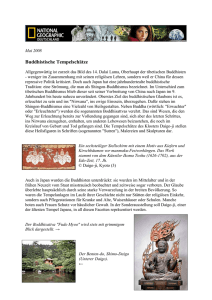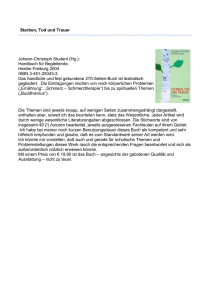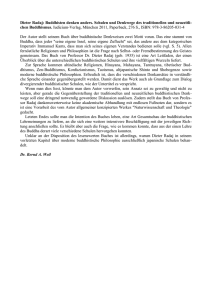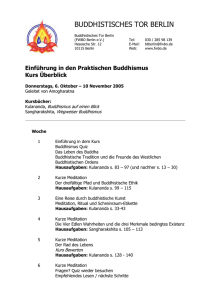Gerhard Burda
Werbung

1 Gerhard Burda Nicht-Zweiheit: heile Einheit, heilige Differenz Analytische Psychologie und buddhistische Spiritualität Abstract Dieser Aufsatz bemüht sich im Ausgang von Texten C.G. JUNGS zu östlicher und westlicher Religiosität um eine Annäherung an buddhistische Spiritualität. Es wird zu zeigen versucht, dass die Nicht-Zweiheit (Non-Dualität)1 als Herzstück buddhistischer Spiritualität nicht einseitig als primitiv-regressives Einheitsstreben missverstanden werden müsste. Aus einer anderen Perspektive heraus könnte man nämlich auch von einer Bezogenheit auf das Selbst sprechen, dessen ethische Potenzialität mit der Wortbildung Archethyp (Archetyp + ethos) unterstrichen wird. Um sich dieser Perspektive anzunähern, ist es nötig, sich im Vorfeld mit einer heiligen Differenz auseinanderzusetzen, die jedes einseitige Streben nach Einheit einer kritischen Revision unterzieht. Das Adjektiv heilig (sacer) ermöglicht dabei, die Gegensatzstruktur von Verdammung und Erlösung im Schnittfeld von Religion, Ethik und Psychotherapie zu thematisieren. Keywords: Buddhismus, Spiritualität, Religion, Ethik, Selbst, Archethyp Einleitung Der Buddhismus erfreut sich in seinen diversen Spielarten weltweit wachsender Beliebtheit. Besonders der tibetische Buddhismus, um den es hier hauptsächlich gehen wird, genießt – nicht zuletzt dank der charismatischen Präsenz des Dalai Lama – einen ständig wachsenden Zustrom. Kritischen Gegenwartsstimmen gilt das westliche Interesse an buddhistischer Spiritualität freilich als Verhaftetsein an ein postsäkulares Imaginäres (ZIZEK 2001, 110) und wird insofern als illusionär diskreditiert. Die Frage nach dem finalen Aspekt des Interesses an buddhistischer Spiritualität bleibt dabei jedoch ausgeblendet. Auch C.G. Jung hat sich, angeregt durch seine Kontakte zu Heinrich ZIMMER und W.Y. EVANS-WENTZ, in einigen Texten kritisch zum östlichen Heilsweg geäußert. Den Unterschied zwischen Westen und Osten gibt er folgendermaßen an: Der Westen sei in seiner habituellen Grundhaltung „extravertiert“ (der Geist ist Mentalität, Bewusstsein ein Epiphänomen physiologischer Prozesse, das Introvertierte gilt als autoerotisch, im Zentrum steht ein Ich). Der Osten sei demgegenüber „introvertiert“ (der Geist gilt als „Essenz des Seins“, die Getrenntheit werde als illusorisch und extravertiertes Begehren als trügerisch bewertet, der Osten kenne ein „Bewusstsein ohne Ich“). Es ist in der Folge zu fragen, ob diese Grundannahme und ihr latenter Dualismus letztlich imstande sein können, dem paradox non-dualen Wesen buddhistischer Spiritualität gerecht zu werden. Um uns an diese Frage anzunähern, müssen wir uns zunächst ins umstrittene Schnittfeld von Psychologie und Religion begeben. Es wird sich zeigen, dass dabei sofort eine weitere Größe ihren Anspruch anmelden wird: die Ethik. 1. Psychologie, Religion, Ethik Der Buddhismus ist westlichem Verständnis zufolge eine Religion und verfügt über eine komplexe Psychologie, Metaphysik, Erkenntnispraxis und Ethik. Im Mysterium Coniunctionis (1990) wird von JUNG in Bezug auf Metaphysik generell eine „erkenntnistheoretische 2 Beschränkung“ formuliert, die auch für das Verhältnis von Psychologie und Religion bestimmend ist. Er empfiehlt, „in Ansehung der Beschränktheit des menschlichen Vermögens anzunehmen, dass unsere metaphysischen Begriffe zunächst einmal nichts anderes seien als anthropomorphe Bilder und Meinungen, welche transzendente Tatsachen entweder gar nicht oder dann nur in sehr bedingter Weise ausdrücken“ (ebd. 326). Diese Begriffe und Bilder gehen auf „dem Menschen zustoßende, numinose Erlebnisse“ (ebd. 327) zurück. Ein „bewusstseinstranszendenter Wille“ hat den Menschen erfasst, eine Übermacht, die als „göttlich“ aufgefasst wird. Dies heiße jedoch nicht, dass dies ein Beweis für die Existenz Gottes sein kann (ebd. 328). JUNG spricht hier davon, nicht den „höchsten metaphysischen Faktor in Rechnung zu ziehen, sondern bescheidenerweise eine unbewusste psychische bzw. psychoide Größe“ (ebd. 339). Formulierungen wie „bewusstseinstranszendenter Wille“ oder „numinoses Erlebnis“ drücken aus: Der Mensch ist ein „homo religiosus“. Religion gilt als „universeller Ausdruck der menschlichen Seele“ und als „besondere Einstellung des Bewusstseins, welches durch die Erfahrung des Numinosen verändert worden ist“. Dies ergebe die „religio“ und verlange die „sorgfältige Beachtung gewisser dynamischer Faktoren“ (1992, 23), die JUNG unmittelbar mit der Ethik verbindet: Bei der „religio“ handle es sich um ein „ethisches Problem erster Ordnung“ (1987, 235). Hier taucht neben der Liasion von Psychologie und Religion, die ihm den Vorwurf des Psychologismus eingebracht hat (so z.B. BUBER 1953) noch die Ethik auf – nicht ohne Grund, wie wir später sehen werden. Wir können nun fragen, von welcher Art der Veränderung des Bewusstseins durch die Begegnung mit dem Numinosen der Buddhismus Zeugnis ablegt. Als „atheistischer Religion“ (PANNIKAR) bzw. auch als „religiösem Atheismus“ (van der LEEUW) kommt ihm zunächst insofern eine Sonderstellung zu, als er sich bei Weitem nicht im „spirituellen Imaginären“ erschöpft, wie ihm kritisch vorgeworfen wird. In seinem Zentrum ist nämlich eine Leere lokalisiert, die in mancher Hinsicht europäisch-postmetaphysischen Konzepten vergleichbar ist. In Hinblick auf das verpönte Imaginäre ist auch daran zu erinnern, dass die Ikonographie des Buddha überhaupt erst unter hellenistischem Einfluss entstanden ist (vorher wurde er durch einen leeren Thron symbolisiert). Die Vermutung schleicht sich ein, dass bei diesem Feldzug gegen das Imaginäre vielleicht gerade die buddhistische Leere dem Euro- und Ethnozentrismus als willkommener Bildschirm dient, das verdrängte eigene Imaginäre zu imaginieren, zu lokalisieren und auch zu bannen. Gegen diesen Feldzug wider das Imaginäre ist zu betonen, dass gerade jenes verpönte Medium erlaubt, auf eine Differenz aufmerksam zu werden, die ich in der Folge heilig nennen möchte. Das Adjektiv heilig eröffnet nämlich die Möglichkeit, die Gegensatzstruktur von Vernichtung und Erlösung, von Erhabenheit und Verdammung (sacer) zu thematisieren, die nicht nur im Religiösen, sondern auch im Therapeutischen zentral ist. Der Übergang dieser Extreme in einander im Medium des Imaginären erlaubt, die Gegensätze des Heiligen in ihrem Bildgehalt zu untersuchen. Dagegen hat sich freilich die Tradition der abrahamitischen Religionen seit jeher vehement gewehrt. Das Sakrale wird etwa in der jüdischen Religionsphilosophie als das „Halbdunkel, in dem die Zauberei, vor der es dem Judentum graut, gedeiht“ (LÉVINAS 1998, 89) disqualifiziert. Der Bildgehalt ermöglicht jedoch im Gegenteil, zu erkennen, dass Lebensgründung und Tötungsmacht, Höchstes und Niedrigstes aufs Engste zusammengehören – ein Umstand, der in den Religionen meistens gerne ausgeblendet wird. Die internationale Krise, die durch die dänischen Karikaturen des Propheten im Herbst 2005 bzw. Winter 2006 ausgelöst wurde, belegt dies eindrucksvoll. Auf dem Feld des Religiösen ist die Bedingung der Möglichkeit (wie Unmöglichkeit) des Heils das Unheil. Dieser Gegensatz, der z.B. in der Polysemie des Wortes sacer oder auch in der Tatsache, dass die meisten indoeuropäischen Sprachen zwei Ausdrücke für das Adjektiv heilig kennen, klar zur Sprache kommt, ist JUNG zufolge die große Herausforderung von Religion wie Psychologie. Die Begegnung mit dem Numinosen 3 ist heilsam, aber: Die Gefahr (Überschwemmung oder Auslöschung des Ich, Inflation mit archetypischen Inhalten) sei nicht zu unterschätzen. Der Mensch, der homo religiosus, entpuppt sich so gesehen als homo sacer: Er ist einer numinosen (belebenden wie vernichtenden) Macht und damit einer „internen Alterität“ ausgesetzt, mit der er sich auseinander setzen muss, eine Macht, mit deren Dynamiken er sich oftmals – gerade in psychischen Ausnahmezuständen (aber auch in schöpferischen Momenten) – identifiziert. JUNG betont immer wieder, dass der Mensch mit dieser Macht nicht identisch sei, sondern zu ihr in einem konstitutiven Differenzverhältnis stehe. An dieser Stelle lässt sich die an das Religiöse zu stellende Frage anschließen, ob das Ziel von Religion deshalb tatsächlich darin gesehen werden kann, diese heilige Differenz in einer heilen Einheit (etwa in einseitiger Identifizierung etwa mit dem erlösenden, positiven Aspekt des Heiligen) zu suspendieren, oder ob man dabei nicht auf dem Feld des Religiösen einem gleichermaßen verführerischen wie gefährlichen Selbstabschluss desselben verfällt. Auf die Religion bezogen heißt es deshalb folgerichtig bei JUNG, dass sie die „die Frucht und der Höhepunkt der Vollständigkeit des Lebens“ ist, „welche beide (Hervorhebung GB) Seiten enthält“. Eine Religion, die diese Antinomie ausblendet, unterliegt einem illusionären Selbstabschluss. Wenn man nun in Betracht zieht, dass auch der Buddhismus sich oft so darstellt, dass diese konstitutive Differenz aufgehoben werden soll, so ist dem entgegenzuhalten, dass dies in letzter Konsequenz nicht möglich sein kann. Interessanterweise ist es eine ethische Idee, die diesen Schluss nahelegt: die Idee oder das Ideal des Bodhisattva, des „Erleuchtungswesens“ (s. auch: SANTIDEVA 1997). Der Bodhisattva setzt nämlich durch seine Verpflichtung, alle Wesen zu erlösen, die im Religiösen verworfene Differenz wieder in ihr Recht. Das ethische Ideal des Bodhisattva könnte also Bestätigung für die Vermutung sein, dass es eine reine Religion nicht gibt, sondern dass das Religiöse auf metareligiöse, d.h. über das Religiöse hinausweisende, Dispositive (v.a. auf die Ethik) angewiesen bleiben muss, um seinen genuinen Anspruch nicht in einem totalisierenden Selbstabschluss ins Gegenteil dessen zu verkehren, was zu sein es sein beansprucht: ein Heilsweg (vgl. dazu: BURDA 2005). Außer dem vorhin angesprochenen (speziell für die abrahamitischen Religionen – Judentum, Christentum, Islam – charakteristischen) Feldzug gegen das Imaginäre lässt sich noch eine weitere Tendenz feststellen: Die Interpretation des östlichen Denkens dient oft auch als Projektionsfläche einer verlorenen Einheit. SAMKARA etwa, jener hinduistischDenker des Advaita (siehe Anm.1), hatte im religiösen Pluralismus Indiens bei weitem nicht jenen Stellenwert, der ihm von europäischen Religionshistorikern des 18. bzw. 19. Jahrhunderts (und im 20. Jahrhundert auch von Vertretern des Neo-Hinduismus) zugemessen wurde. Wenn nun JUNG vom „Inder“ meint, dass ihm „der erkenntniskritische Standpunkt ebenso sehr wie unserer religiösen Sprache“ (1944/1992, 580) fehle und ihn „vor-kantisch“ nennt, so ist zu fragen, ob dieses Urteil nicht einen Dualismus a lá DESCARTES voraussetzt, der für das östliche Denken gerade nicht gilt und deshalb einen Riss einführt, der einer Fehleinschätzung buddhistischer Spiritualität Tür und Tor öffnet. JUNG schreibt: „Wir zögern natürlich, die östliche Mentalität primitiv zu nennen, sind wir doch tief beeindruckt von ihrer bemerkenswerten Zivilisiertheit und Differenziertheit. Und doch beruht sie auf dem primitiven Geist … Der Westen hat einfach den anderen Aspekt der Primitivität kultiviert, nämlich die äußerst genaue Beobachtung der Natur auf Kosten der Abstraktion … Der Osten andererseits kultiviert den psychischen Aspekt der Primitivität zusammen mit einem übermäßigen Betrag von Abstraktion“ (1939/1992, 501). Fragwürdig erscheinen hier erstens die Gleichungen Osten = introvertiert, Westen = extravertiert, die noch näher zu vertiefen sein werden. Den dabei vorausgesetzten cartesischen Dualismus kennt der Osten nämlich nicht. Im hindu-religiösen Denken gibt es keinen Raum an sich, sondern je spezifische Sphären der Existenz (loka) für Götter, Menschen, Tiere, 4 Pflanzen, Sterne oder Geister. Im Buddhismus etwa fallen auch das konzeptuelle Denken und das Mentale in den Bereich der Sinneswelt: „Für den Buddhismus steht die Sinneswahrnehmung in Verbindung mit dem offenen Raum … Im Westen haben wir … die Gewohnheit, in dualistischer Weise zwischen der sinnlichen und gedanklichen Welt zu unterscheiden. Eine derartige Unterscheidung macht im tibetischen Buddhismus keinen Sinn, denn der offene Raum manifestiert sich in seiner reinsten Form im Nirmanakaya … Die Ursache aller Probleme ist im Buddhismus nicht ´die Materie´ , sondern das Ich, das den offenen Raum verschleiert“ (MIDAL 2002, 30). Fragwürdig erscheint zweitens die aus dem Dualismus resultierende essentialistische Auffassung vom Ich. Die Lehre vom anâtman besagt dagegen überhaupt nicht, dass es kein erkennendes Ich gibt. Im Gegenteil: „Es ist nicht so, dass es … kein erkennendes Subjekt gibt. Die Subjekte sind im Gegenteil so zahlreich wie die in jedem Augenblick im ständigen Fluss aller Dinge enthaltenen. Das heißt, das Subjekt eines jeden gegebenen Aktes der Erkenntnis ist nicht irgendein Substrat, das Wandlungen durchmacht … Die ´Selbste` sind dynamische Punkte“ (EPSTEIN 1998, 107). Entscheidend ist also, dass es weder ein empirisches noch ein absolutes Subjekt i.S. einer Substanz gibt. PANNIKAR (1992) spricht diesbezüglich von „reiner Kontingenz“. Jedes Seiende ist als Seiendes ein „provisorisches Phänomen“ (NISHITANI 1996, 214), sein „Seinsmodus ineins mit der Leere“, sein „Selbstsein“, seine „Mitte“ (ebd. 215) realisiert sich als „paradoxe Selbst-Identität mit der Leere … eine absolut un-substantielle Substantialität“ (ebd. 208). Erschöpft sich also die Spiritualität des Buddhismus in einem primitiven Einheitsdenken, das aus einer Mentalität stammt, die – im Gegensatz zum Westen – „nie den Zusammenhang mit der instinktiven Grundlage verloren hat“? Oder finden sich – gerade bei JUNG – Auffassungen, die eine Brücke zwischen westlicher und östlicher Spiritualität zu schlagen erlauben? Aussagen wie „Das Ziel östlicher Praktik ist das gleiche wie das der westlichen Mystik: der Schwerpunkt wird vom Ich zum Selbst … verschoben“ (1944/92, 582) oder „Der Geist in dem die Unvereinbaren – sangsara und nirvana – vereint werden, ist letztlich unser (Hervorhebung GB) Geist“ (1939/92, 501) scheinen dieses Unterfangen zu legitimieren. „Religiös-ethisches Ziel“ ist also vielleicht nicht so sehr „die Auflösung des Ich“ (1944/92, 583), als vielmehr jener psychopoethische „Prozess“ einer „Entelechie des Selbst“, der „in einem Weg endloser Kompromisse“ verdeutlicht, dass es einerseits um einen „a priori vorhandenen Zielcharakter“ geht, der „in der Regel sogar außerhalb des Bewusstseins abläuft und seine Gegenwart durch eine Art Fernwirkung auf dieses verrät“, dass aber andererseits ebenso wenig „das Ichbewusstsein entraten“ werden kann (alle: 1944/92, 583 f). Kurz gesagt: Es wird darum gehen, zu zeigen, dass auch im Buddhismus das Selbst ohne den „physischen und psychischen Menschen … völlig gegenstandslos“ (ebd.) ist. Um dies nachzuweisen werde ich später auf JUNGS Aussagen zur Trinität und zum Geist zurückgreifen. Es wird sich zeigen, dass auch im Buddhismus der Geist „als das ´Mittel zur Erreichung des Anderen Ufers` auf eine Verbindung zwischen der transzendenten Funktion und der Idee von Geist oder Selbst“ (1939/92, 505) deutet. Das Selbst als Symbol wird sich dabei als entscheidendes „Mittel zur Wandlung“ (ebd.) darstellen. Als Archethyp, als ethisches Potenzial, das eine Individuationsleistung herausfordert, erweist es so seine über die Psychologie und Religion hinausreichende ethische Bedeutung. 2. JUNG und der Buddhismus: Feuer nicht mit Wasser mischen Die große Gefahr, vor der JUNG im Hinblick auf den Buddhismus warnt, ist – abgesehen von dem unreflektierten Transfer eines exotischen Kulturgutes in das sinnentleerte eigene Vakuum – diejenige der Desintegration der Psyche durch eine verstärkte Introversion. Nun 5 sind es oft gerade tatsächlich die Unsicherheit bezüglich der eigenen Identität, eine tiefe existenzielle Angst und eine Enttäuschung, die westlich sozialisierte Menschen zum Buddhismus führen und den Wunsch nach Heil wecken. Im Buddhismus ist gerade dieses „zentrale Gefühl der Unsicherheit über die eigene Identität“ (EPSTEIN 1998, 18) der Ausgangspunkt analytisch-mediativer Erforschung der Rastlosigkeit und Leerheit des Geistes. Diese Methode, „auf Selbstdarstellungen zu achten, ohne neue zu schaffen“ (ebd. 82), kann natürlich Öl ins Feuer gießen und bei früh gestörten Menschen einen verheerenden Brand verursachen. Die „Integration aller Aspekte des Selbst“ (ebd. 30) erfordere nämlich eine paradoxe Strategie: einerseits die „Intensivierung gewisser Ichfunktionen“ (ebd. 138) – der Prozess muss gehalten werden können, andererseits die Dekonstruktion des Selbstgefühls, wobei das Selbst „als Metapher“ des Erkennens (ebd. 163) sehr wohl relevant bleiben soll. Zuvor müssen jedoch die „primitiven Aspekte des Selbst“, der Primärprozess, die Affektstürme, zur Ruhe kommen. Man muss sich z.B. in seinen Schmerz versenken können und alle Reaktionen darauf spüren, ohne darauf zu reagieren (ebd. 121). Die Aufmerksamkeit allein sei dabei mitunter schon heilsam, wobei ein gutes Maß „Unpersönlichkeit“ (ebd. 131) als wesentliches Element erscheine, um die beiden Pole des „falschen Selbst“ – Grandiosität und Leere – neutralisieren zu können (ebd. 74). Hier scheint es also einige Schnittstellen mit dem psychotherapeutischen Prozess zu geben. Der Weg zum Ziel ist jedoch, JUNG zufolge, in Buddhismus und Psychotherapie ein entgegen gesetzter: Während der östliche Initiationsweg z.B. im Bardo Thödol beim Dharmakaya beginne, um dann wieder in die Niederungen des Nirmanakaya abzusteigen – also von der archetypischen Psyche ins individuell Psychische führe, beginne der westliche Praktizierende beim Nirmanakaya und begegne etwa im Sambhogakaya den friedvollen wie zornigen Aspekten der Gottheiten, das heißt jenen archetypischen Bildpotenzialen, die eine enorme affektive Potenz transportieren und ein schwaches Ich überfluten, das diese Erfahrungen nicht halten kann. JUNG schreibt: „Es ist ein Eingriff in das Schicksal, welcher ins Tiefste der menschlichen Existenz trifft und eine Quelle von Leiden eröffnen kann, von denen man sich in gesunden Sinnen nichts hätte träumen lassen. Ihnen entsprechen die Höllenvisionen des Tschönyid-Zustandes … Der Todesgott schlingt ein Seil um deinen Hals und zerrt dich entlang; (er) schneidet deinen Kopf ab, nimmt dein Herz heraus, reißt deine Eingeweide heraus, leckt den Hirn aus, trinkt dein Blut, isst dein Fleisch und nagt an deinen Knochen; du aber bist unfähig zu sterben. Selbst wenn dein Körper zerhackt wird, erholt er sich wieder. Das wiederholte Zerhacken bereitet furchtbaren Schmerz und Qual“ (1935/92, 521 f). Unter den drei (oder auch mehr) Kayas versteht man die Erscheinungsweisen der Wirklichkeit, denen ein ursprüngliches Wissen korreliert (vgl. DOWMAN 1994). JUNG (1939/92, 484) setzt nun den Dharmakaya (die non-duale Leerheit, deren Natur einerseits strahlendes Licht und andererseits Grundlage der Erscheinungen ist) mit der Matrix der kreativen Psyche gleich, von der alles ausströmt und in die hinein alles sich wieder auflöse. Der Dharmakaya (Gesetzeskörper) entspricht also dem kollektiven Unbewussten, der Sambhogakaya (Körper der Freude oder Belebung) den archetypischen Bildern und der Nirmanakaya (Emanationskörper, nirmana bedeutet „auf ein Maß bringen“) der Welt der Erscheinungen und des Bewusstseins. Bewusstsein im westlichen Sinn wird als Zustand der Unwissenheit (avidya) angesehen, wohingegen dem, das wir den „dunklen Hintergrund der Bewusstheit“ (das Unbewusste) nennen, im Osten eine „höhere Bewusstheit“ (ebd. 487). zukomme. JUNG zieht folgendes Resumee: „Die Verschiedenheit ist so groß, dass man keine vernünftige Möglichkeit der Nachahmung sieht, noch viel weniger deren Ratsamkeit. Man kann Feuer und Wasser nicht mischen. Die 6 östliche Haltung verdummt den westlichen Menschen und vice versa. Man kann nicht ein guter Christ sein und sich selbst erlösen, auch kann man nicht ein Buddha sein und Gott verehren. Es ist viel besser, den Konflikt anzunehmen; denn wenn es überhaupt eine Lösung gibt, dann nur eine irrationale. Und weiter: Statt die geistigen Techniken des Ostens auswendig zu lernen … wäre es viel wichtiger, herauszufinden, ob im Unbewussten eine introvertierte Technik existiert, die dem führenden geistigen Prinzip des Ostens ähnlich ist … Wenn wir diese Dinge uns direkt vom Osten aneignen, haben wir nur unserer westlichen Erwerbstüchtigkeit nachgegeben. Damit bestärken wir wieder, dass „alles Gute draußen ist“, von wo es geholt und in unsere unfruchtbaren Seelen gepumpt werden muss“ (ebd. 485). Es ist lohnend, die Kayas in einer buddhistischen Darstellung näher zu betrachten, um das Ergebnis mit der jungschen Darstellung zu vergleichen. Der nun folgende Text, ein Lehrstück in Psychopoethik, stammt von SHABKAR aus dem 19. Jahrhundert, aus einer Tradition, die als die höchst entwickelte buddhistische Anschauung gilt und Dzog Chen (die „Große Vollkomenheit“, der „ursprüngliche Zustand“, auch „Ati-Yoga“) genannt wird. In unserem Beispiel handelt es sich um dreiundzwanzig Lieder zur Unterweisung in der TrekchoMeditation. In Das zwölfte Lied: das Schaubild des Kristalls und die Dynamik des Seins finden wir: „Es gibt zwei Arten, die drei Kayas zu definieren: In Bezug auf das Wissen als universellen Seinsgrund und in Bezug auf den Prozess der Erscheinungen, die von diesem Wissen ausstrahlen. Wenn ihr diese beiden Definitionen klar versteht, werdet ihr Samsara und Nirvana intuitiv als Reine Länder der drei Kayas erkennen. Dies ist die Definition der drei Kayas, die dem ursprünglichen Wissen Struktur gibt …: Ursprüngliches inneres Wissen ist wie eine Kristallkugel: Ihre Leerheit ist die Natur des Dharmakaya; ihr klarer, natürlicher Glanz ist der Sambhogakaya, und als offene Grundlage aller Erscheinungen ist sie der Nirmanakaya. So werden die drei Kayas als ursprüngliches Wissen definiert, und obwohl sie nicht mit ihm identisch sind, sind sie doch auch nicht von ihm getrennt (Hervorhebung GB) . So wie die fünf Spektralfarben aus einem Kristall hervorbrechen, so entstehen die Manifestationen des Seinsgrundes aus dem ursprünglichen Wissen. Im Prozess der Manifestation sind die erhabenen Ausstrahlungen der reinen Buddha-Länder und die verwirrenden Ausstrahlungen der Phänomene und Wesen, eben alle Dinge, in ihrer Essenz leer. Diese Leerheit ist der Dharmakaya; ihre Natur ist strahlendes Licht, der Sambhogakaya, und die ungehinderte Vielfalt ihrer Manifestationen ist der Nirmanakaya. So werden die drei Kayas als Prozess der Manifestation der Erscheinungen im universellen Seinsgrund definiert. […] Wenn ihr das versteht, erkennt ihr die gesamte Welt der Phänomene und die Energie, die sie belebt, als spontan entstandenes Mandala der drei Kayas. Woanders findet ihr die Reinen Länder der drei Seinsweisen nicht. Wenn die Wesen nur fähig wären, die sechs Lebensformen spontan als die drei Kayas zu erkennen, würden sie alle zur Buddhaschaft erwachen – ohne irgendeine Meditationspraxis. Da die drei Erscheinungsweisen des Seinsgrundes letztlich der Dharmakaya sind, solltet ihr sie nicht verschieden voneinander sehen [...]; in der Dimension des Dharmakaya ist Leerheit der Eine Geschmack. Wenn das Ende des Pfades erreicht wird, nachdem sich die in der Grundlage manifestierenden Erscheinungen spontan wieder in den Grund aufgelöst haben und sich die Dynamik des universellen Dharmakaya offenbart, wird das letzte Ziel erreicht. Danach ...entsteht ein ununterbrochener Strom von Aktivität zum Wohle aller Wesen“ (DOWMAN 1994, 114 ff). Zurück zu JUNG: Was bei ihm im Vergleich zu dieser Darstellung auf den ersten Blick merkwürdig anmutet, ist die einfache Gleichsetzung des Dharmakaya mit dem (kollektiven) Unbewussten, mit dem sich der Gläubige durch seine nahe am „Primitiven“ bleibende 7 Introversion identifizieren soll. Was hier unter dem Teppich verschwunden ist, ist eine Dynamik, die durchaus etwa der Beschreibungen des „Dreischritts“ (JUNG 1940/41/92, 190) der christlichen Trinität vergleichbar ist. Es scheint, als würde JUNG selbst das tun, wovor er ausdrücklich warnt: „Wasser mit Feuer“ zu mischen. Ich möchte deshalb auf JUNGS Aufsatz Psychologische Deutung des Trinitätsdogmas zurückgreifen, um vielleicht einen anderen Zugang zu ermöglichen. Es gibt übrigens durchaus auch aus dem buddhistischen Kontext Ansätze, die drei Kayas trinitarisch zu verstehen. In der „buddhistische(n) Trinität der Wirklichkeit“ (SOGYAL 1996, 411 f) entspricht der Vater dem Dharmakaya, der Sohn dem Nirmanakaya und der Geist dem Sambhogakaya. Buddha ist auf den Ebenen der drei Kayas unterschiedlich zu sehen, er ist nicht nur wie Christus ein Symbol des Selbst, mit dem sich der Gläubige identifiziert, sondern auf von einander zu unterscheidenden Ebenen jeweils sowohl eine historische als auch eine transzendente Gestalt (vgl. MIDAL 2002, 26f). In JUNGS Aufsatz wird nun die Trinität als „psychologisches Symbol“ nicht nur als „Wandlungsprozess einer und derselben Substanz, nämlich der Psyche als Ganzem“ (JUNG 1940/41/92, 209) beschrieben, sondern v.a. auch als ein „im Individuum stattfindender unbewusster Reifungsprozess“ (ebd. 208). Im Hintergrund webt dabei die Vorstellung von einer schwierig zu erreichenden Kostbarkeit (Ring, Juwel, Gefäß etc.), die das Selbst repräsentiert (ebd. 172). Die Beziehung des Menschen zum (innergöttlichen) trinitarischen Prozess ist nun einerseits durch die „menschliche Natur Christi“, andererseits durch die „Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Menschen“ angedeutet (ebd. 174): „Wenn der Vater im Sohne erschienen ist und mit dem Sohne gemeinsam atmet, und der Sohn diesen Heiligen Geist dem Menschen hinterlässt, so atmet der Heilige Geist auch aus dem Menschen und atmet damit zwischen dem Menschen, dem Sohn und dem Vater“ (ebd. 174). Das heißt, nicht bloß die nahe am „Primitiven“ wirkende Seele etwa der „Inder“, sondern „auch wir empfinden gewisse besonders erleuchtende Einfälle noch als ´Einhauchungen` (Inspirationen)“ (ebd. 177). JUNG spricht an dieser Stelle übrigens von der Anima, wenn diese „Einhauchungen“ dem Bewusstsein „unbewusst übermittelt“ werden. Hierzu lässt sich nahtlos die buddhistische Tara, die weibliche Seite Buddhas, assoziieren, die einer Legende nach aus einer Träne von Avalokiteshvara, dem Budhisattva des Mitgefühls, geboren wurde. Avalokiteshvara wurde angesichts des Leidens der fühlenden Wesen derart von Trauer überwältigt, dass aus seinen Augen Tränen strömten. Die Träne seines rechten Auges verwandelte sich in die Grüne Tara, die Träne des linken in die Weiße Tara. Tara gilt – ebenso wie Buddha – einerseits als Mensch, andererseits als Leerheit und „Mutter aller Buddhas“, die den „eigentlichen Gedanken der Erleuchtung geboren hat“ (MIDAL 2002, 51). Als solche signifiziert sie prajna, die non-duale Einsicht, das Herzstück buddhistischer Spiritualität. Von dieser kleinen Geschichte aus, in der das Leid der Wesen angesprochen ist, lässt sich der Bogen zu folgender Passage JUNGS spannen: „Der christliche Mensch ist der moralisch leidende Mensch, der trotz seiner potentiellen Erlöstheit in seinem Leid des Trösters, des Parakleten, bedarf. Der Mensch kann den Konflikt aus eigener Kraft nicht überwinden … Er ist auf die göttliche Tröstung und Versöhnung angewiesen, das heißt auf die spontane Offenbarung jenes Geistes, der menschlichem Willen nicht gehorcht, sondern kommt und geht, wie Er will. Jener Geist ist ein autonomes seelisches Geschehen, eine Stillung nach dem Sturm, ein versöhnendes Licht in den Finsternissen des menschlichen Verstandes und die geheime Ordnung unseres seelischen Chaos. Der Heilige Geist ist ein Tröster wie der Vater, ein stilles, ewiges und abgründiges Eines, in welchem die Liebe und der Schrecken Gottes zur wortlosen Einheit zusammengeschmolzen sind. Und eben darin wird der Ursinn der noch sinnlosen Vaterwelt im Raume menschlicher Erfahrung und Reflexion wieder hergestellt. Der Heilige Geist ist in einer quaternischen Anschauung eine Versöhnung der Gegensätze“ (JUNG 1940/41, 191). 8 Christlicher Spiritualität ist von ihrer Grundlage her also durchaus ähnlich beschreibbar wie die buddhistische: „Das Ziel östlicher Praktik“, schreibt JUNG an anderer Stelle, „ist das gleiche wie das der westlichen Mystik: der Schwerpunkt wird vom Ich zum Selbst … verschoben“ (1944/92, 582). Dies ist nun zu vertiefen. 3. Der Mittelweg der absoluten Relativität Natürlich ist auch der Begriff Spiritualität ein dem westlichen Denken entlehnter. Er stammt vom lat. Adjektiv spiritualis, eine Übersetzung des griech. pneumatikós (Substantiv spiritus bzw. pneuma, die beide mit „Geist“ übersetzt werden). Die Grundbedeutung ist „bewegte Luft, Atem, Wind“, ein Bezug, den auch das hebr. ruach aufweist. Im christlichen Verständnis verweist das Wort Spiritualität auf den Heiligen Geist und sein Wirken: Spiritualität meint das vom bedeutungsgeladenen Geist erweckte und geschenkte Leben, das den Menschen über sich hinausträgt, seine Selbstbefangenheit löst, inspiriert und mit der Schöpfung, mit Gott und den Mitmenschen verbindet. Hier ist also eine duale, paradox persönlich wie unpersönliche Relation betont. Der Buddhismus wiederum unterscheidet, wenn er vom „Geist“ spricht den relativen, samsarischen Bewusstseinsstrom, d.h. die assoziativ und meist unbewusst ablaufenden Denkmuster, die unser Leben bestimmen (der „Affe“, der rastlos von Ast zu Ast hüpft), von der wahren „Natur des Geistes“ (rigpa, sems, sanskrit: bodhicitta), jener absoluten Ebene, auf der die Unterschiede der relativen in die „reine Vision“ aufgehoben sind. Buddhistische Meditation versteht sich deshalb als „Unterweisung in Nicht-Dualität“. Eine dieser Methoden, die ich nun beispielhaft anführen möchte, stammt aus dem Dzogchen (vgl. NORBU 1993) und wird „Trekcho“ (die „Ebene des Durchschneidens“) genannt. Sie hat zum Ziel, alle Erscheinungen, Gefühle und Gedanken in ihre eigentliche Natur der ursprünglichen Reinheit aufzulösen. Umschrieben wird dies mit: „jenseits von Anstrengung, nichts erzeugen, nichts verändern, nichts wechseln, sich im wahren Zustand befinden“. Das heißt: Alles – also auch jede karmische, „unreine“ Vision (unser Leben und seine Umstände) – ist Ausdruck der Einheit von „Leere, Klarheit und Mitgefühl“ der Natur des Geistes. Praktizieren bedeutet, „Teil der Vision zu sein“, und Vision umfasst alle sinnlichen oder mentalen Wahrnehmungen, meint „meditieren ohne zu meditieren“. Eine der vielen Umschreibungen der wahren Natur des Geistes lautet: „Essenz des uranfänglichen Bodhicitta“. Auch in Bezug auf Bodhicitta, den „Erleuchtungsgedanken“, werden nun zwei Aspekte unterschieden: Man spricht erstens vom „relativen Bodhicitta“ (fühlende Wesen zu befreien, es gibt ein Ich, das Mitgefühl erzeugt) und zweitens vom „absoluten Bodhicitta“, dem gemäß alles – also auch das Leid der Wesen – „wie Illusion und wie ein Traum“ ist, wie es in einer Rede Buddhas heißt. Auf dieser Ebene gibt es in letzter Hinsicht also keine fühlenden Wesen, die leiden. Dieser Eindruck des Leidens und damit das Streben nach Bodhicitta auf der relativen Ebene kommt erst durch „gegenseitiges abhängiges Entstehen“ und durch die die Natur des Geistes verdunkelnde „unreine Vision“ im relativen, samsarischen Bewusstsein zustande. Die Lehre vom absoluten Bodhicitta, derzufolge es keine leidenden Wesen gibt, die befreit werden müssen, ließe sich – isoliert vom relativen Aspekt der „unreinen Vision“ – als Tendenz in Richtung einer reinen Religion lesen, die einem regressiven Selbstabschluss gleichkäme, da sie die entscheidenden Bedingungen des Heils und der Erlösung ausblendet: das Unheil, das Leid, das Böse. Eine Religion würde sich ausschließlich so gesehen ins Gegenteil dessen verkehren, was zu sein sie beansprucht: Der lebensvernichtende Aspekt des Heiligen, der jedoch die Bedingung der Möglichkeit seiner Kehrseite, des lebensspendenden Aspekts ist, wäre ausgeblendet. Auf der absoluten Ebene allein würden also die Gegensätze des Heiligen tatsächlich in einer Zone der Ununterscheidbarkeit verschwimmen. Fazit: Auch 9 im Buddhismus findet man, wenn man es darauf anlegt, eine inhärente Immunisierungsstrategie, die freilich auch in anderen Religionen nachzuweisen ist (z.B. Christentum, Islam). Hier kommt nun bezeichnenderweise die Ethik des Bodhisattva-Ideals ins Spiel: Was den Buddhismus seit der radikal ethischen Revolution des Mahayana zu Beginn unserer Zeitrechnung auszeichnet, ist nämlich die Betonung der Verantwortlichkeit für das Wohl aller fühlender Wesen. Man nimmt intuitiv die Unmöglichkeit dieses Strebens wahr: die Unmöglichkeit der Erfüllung, den messianischen Abstand, das ewige Morgen. Gerade diese Unmöglichkeit des Abschlusses ermöglicht jedoch, das Religiöse als Religiöses, d.h. den Heilsanspruch, offen zu halten. Man könnte Ethik in diesem Sinn als jenes metareligiöses – d.h. über die Religion hinausweisendes – Moment bezeichnen, das die Möglichkeit wie Unmöglichkeit des rein Religiösen erweist: Die Möglichkeit von Religion in Bezug auf Ethik bestünde also darin, die Unmöglichkeit eines totalisierenden Selbstabschlusses anzuerkennen und auf Strategien von Selbstimmunisierung zu verzichten. Dazu müsste sie sich dem Ethischen öffnen, das den Selbstabschluss des Religiösen verhindert. Die Rede vom Mittelweg der absoluten Relativität (DOWMAN 1994, 25) oder das Ideal des Bodhisattva lassen sich nun durchaus in diesem Sinne verstehen. Betont wird bei diesem Mittelweg immer wieder, dass es fruchtlos sei, den relativen Geist in eine absolute Wirklichkeit verwandeln zu wollen. Sobald man etwas erwartet (ein Ergebnis, die Erleuchtung etc.), hat man es schon verfehlt. Diese falsche Sicht gilt es „durchzuschneiden“ (Trekcho, Trekchöd), um „im Zustand der Kontemplation, in der natürlichen Essenz des reinen Geisteszustandes“ (TENZIN 1997, 187) zu verweilen. Doch bis dies tatsächlich erreicht werden kann, „dauert es zweifellos ziemlich lange … möglicherweise bis zum Ende unseres Lebens“ (ebd. 188). Verweilt muss also wohl bei dem bleiben, was sich gerade im Bewusstseinsstrom selbst enthüllt, d.h. alles Auftauchende wird akzeptiert. Der Mittelweg der absoluten Relativität lässt so gesehen ein dekonstruktives Moment erkennen, das die einseitige Hierarchisierung von absolut und relativ eindeutig aufhebt und die Unverzichtbarkeit des individuellen, samsarischen Bewusstseins unterstreicht. Mit den Worten JUNGS: „Der Geist in dem die Unvereinbaren – sangsara und nirvana – vereint werden, ist letztlich unser (Hervorhebung GB) Geist“ (1939/92, 501). Anders gesagt: Das, was Bedingung der Un-/Möglichkeit der relativen Existenz ist, das Unbedingte und Absolute, ist paradoxerweise selbst irgendwie durch das partikulare, samsarische Bewusstsein mitbedingt. Auf eine plakative Formel gebracht könnte man sagen: Das Absolute ist relativ, das Relative absolut. Die Verdoppelung der Ebenen, die Rede von relativem und absolutem Bodhicitta, ist also ein Indiz für die eingangs angesprochene konstitutive Differenz, für den in sich gespaltenen „Einen Geschmack“ der psychischen Existenz, der nicht durch eine illusionäre Schließung aufzuheben ist. Gerade das Bodhisattva-Ideal lässt sich in diesem Sinne interpretieren. Der Bodhisattva ist nämlich der, der nicht bloß die Einheit seiner aus dem transzendenten Wissen erfolgenden Handlung mit dem absoluten Urgrund symbolisiert, sondern auch die Differenz zu diesem, da er auf seine Erlösung verzichtet und wieder in den Daseinskreislauf zurückkehrt, um andere Wesen zu befreien. Im Bodhisattva-Gelübde heißt es: „Von jetzt, bis ans Ende von Samsara, werde ich zum Wohle aller Wesen wirken, die meine Väter und Mütter gewesen sind“. „Bis ans Ende von Samsara … „: Wenn man in Betracht zieht, dass Samsara Nirvana und Nirvana Samsara ist, dann kann es dieses Ende nie geben. Buddha kann nie „alles in allem“ sein, obwohl er doch eigentlich bereits alles in allem sein müsste. Das Rad der Wiedergeburten wird sich weiter und weiter drehen, die Geschichte wird nie an ihr Ende kommen, es werden immer zukünftig kommende Buddhas zu erwarten sein, der Panenbuddhismus wird – wenn man dieses Wortspiel gestattet – nie buddh-en-pantistisch sein können. 10 4. Non-Dualität und ethischer Raum Um den ethischen Horizont des Buddhismus nun nicht einseitig in einer Art „Negativ der Ethik des Guten“ (jedes positive Gute ist ein Köder, die Leere ist das einzig wahre Gute) zu versiegeln, ist es nötig, die Non-Dualität im Sinne eines die Gegensätze vereinigenden Paradoxons aufzufassen. Wir können dieses Paradoxon von zwei Seiten aus zu formulieren versuchen: 1) als duale Non-Dualität: als Durchbruch von Mitgefühl, als Durchbruch des vereinigenden Erleuchtungsgedankens, als Inspiration einer „reinen Vision“ in den samsarischen Bewusstseinsstrom und 2) als non-duale Dualität: als Aufbrechen der trennenden „unreinen Vision“ von Leid innerhalb des samsarischen Bewusstseins im Verhältnis zum Erleuchtungsgedanken. Das heißt: Dem Durchbruch des absoluten Bodhicitta (1), der heilen Einheit, die zur Identifikation mit dem Symptom (mit dem ausgeschlossenen Leid und den davon betroffenen Wesen als jenem verdrängten Partikularen, auf das sich der Universalitätsanspruch dennoch stützt) führt, korreliert der Aufbruch des relativen Bodhicitta (2) und damit die Erkenntnis der Differenz, die zur Identifikation mit dem Universalen drängt. Beide Aspekte zusammen ergeben ein dem abendländischen Verständnis von Spiritualität angenähertes Bild und transportieren eine Auffassung von Religion, die einerseits eine konstitutive Differenz von individueller Psyche und Numinosum und andererseits ein dialogisches Moment als wesentlich erachtet. Die oftmals gestellte Frage, ob der Buddhismus nun dualistisch sei oder den Dualismus überwinde, stellt folglich vor eine falsche Alternative, da es, wie es heißt, um Non-Dualität geht: um eine Nicht-Zweiheit, die jedoch auch keine simple Einheit darstellt. Damit wird erahnbar, dass es in der buddhistischen Spiritualität um mehr als um ein „Bewusstsein ohne Ich“ gehen könnte, nämlich um die existentielle Bezogenheit des individuellen Bewusstseins auf das Selbst als Archethyp i.S. jenes ethischen Potenzials, in dem, wie das Ideal des Bodhisattva verdeutlicht, auch alle anderen fühlenden Wesen mitgemeint sind. Wenn diese fühlenden Wesen nämlich allesamt einmal „unsere Mütter“ gewesen sind, wie es in einer buddhistischen Kernaussage heißt, so mag dieser Satz insofern nachdenklich stimmen, als er ein konträres Bild zum üblicherweise strapazierten Regress zum Mütterlichen evoziert. Es könnte dann, was den finalen Aspekt betrifft, nicht bloß darum gehen, selbst wiedergeboren (oder erlöst) zu werden, sondern um eine Art räumlichen, mütterlich konnotierten Aspekt des Selbst, nämlich um das Eröffnen eines ethischen Raumes all den anderen Wesen, all den „Müttern“ (und im therapeutischen Kontext auch der Mutter) gegenüber, die uns je immer schon einen Raum eröffnet haben (hat). Anmerkung: 1 Die ursprünglich hinduistische Lehre von der Nicht-Zweiheit (Advaita) geht auf die Philosophie SAMKARAS zurück. Im Unterschied zu dualistischen Vorstellungen des Samkhya-Yoga vertritt jener eine Art Monismus, wobei diese Bezeichnung freilich irrig ist. Für SHANKARA ist das Selbst des Menschen, der Atman, identisch mit dem Brahman, der Realität, der alles zugrunde liegt. Brahman ist absolut, ohne ein Zweites (advaya), eigenschaftslos und unveränderbar. Es ist bloßes Sein (sat), reines Bewusstsein (chit) und höchste Glückseligkeit (ananda), wird aber schwach theistisch z.B. auch als Höchster Herr bezeichnet. Wichtig dabei ist, dass der Mensch weder Brahman werden (in diesem Fall wäre das Brahman nicht schon in ihm und er könnte die Einheit nicht erfahren), noch Brahman sein kann (in diesem Fall müsste er es nicht mehr werden). Die Lehre von der Nicht-Zweiheit fordert so gesehen das, was sie im Grunde leugnet: eine Einheit von Brahman und Atman. Der soteriologische Ausweg führt über die Unterscheidung zweier Wissensformen: Nur für das Unwissen (avidya) gibt es Zweiheit. Das höhere Wissen kann die Nicht-Zweiheit in sich erkennen, aber weder durch Gedanken noch durch Taten (sondern nur durch Schriftoffenbarung) anstreben, da beides der Welt der Vergänglichkeit angehört (vgl. dazu MICHAELS 1998, 296f). 11 Literatur: BUBER, M. (1953): Gottesfinsternis. Mit einer Entgegnung von C.G. Jung, Lambert & Schneider, Gerlingen 1994 BURDA, G. (2005): The Matrix Religion oder Das unmögliche Ende, in: texte. psychoanalyse. ästhetik. kulturkritik, Passagen-Verlag, Wien 2005/1, 21-50 DOWMAN, K. (1994): Der Flug des Garuda. Vier Dzogchen-Texte aus dem tibetischen Buddhismus, Theseus Verlag, Zürich 1994 EPSTEIN, M. (1998): Gedanken ohne den Denker. Das Wechselspiel von Buddhismus und Psychotherapie, Fischer, Frankfurt 1998 JAFFÉ, A. (Hg.): Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G. Jung, Walter, Olten 1982 JUNG, C.G. (1963): Gesammelte Werke 11: Zur Psychologie westlicher und östlicher Religionen, Walter, Olten 1992 1) Psychologischer Kommentar zu: Das tibetische Buch der großen Befreiung, 1939 2) Psychologischer Kommentar zum Bardo Thödol, 1935 3) Zur Psychologie östlicher Meditation, 1943 4) Psychologie und Religion, 1939 5) Versuch einer psychologische Deutung des Trinitätsdogmas, 1940/41 6) Über den indischen Heiligen. Einführung zu Heinrich Zimmer: Der Weg zum Selbst, 1944 JUNG, C.G. (1968): Gesammelte Werke 14/II: Mysterium Coniunctionis. Untersuchungen über die Trennung und Zusammensetzung der seelischen Gegensätze in der Alchemie, Walter, Olten 1990 JUNG, C.G. (1952): Grundwerk, Band 8: Heros und Mutterarchetyp. Symbole der Wandlung 2, Walter, Olten 1987 LÉVINAS, E. (1977): Vom Sakralen zum Heiligen. Fünf neue Talmud-Lesungen, Verlag Neue Kritik, Frankfurt 1998 MICHAELS, A.(1998): Der Hinduismus. Geschichte und Gegenwart, Beck, München 1998 MIDAL, F. (2000): Tibetische Mythen und Gottheiten. Einblick in eine spirituelle Welt, Theseus, Berlin 2002 NISHITANI, K. (1980): Was ist Religion?, Insel Verlag, Frankfurt 1986 NORBU, N. (1986): Dzog Chen. Der ursprüngliche Zustand, Odiyana Edition, Frankfurt 1993 SANTIDEVA (1981): Eintritt in das Leben zur Erleuchtung (Bodhicaryavatara), Eugen Diederichs Verlag, München 1997 SHARDZA TASHI GYALTSEN / Commentary by LOPON TENZIN NAMDAK (1993): Heart drops of Dharmakaya. Dzogchen Practice of the Bön Tradition, Snow Lion Publications, Ithaca 1993 SOGYAL RINPOCHE. (1996): Das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis von Leben und Tod, Bern TENZIN WANGYAL (1993): Der kurze Weg zur Erleuchtung. Dzogchen-Meditation nach den Bön-Lehren Tibets, Fischer, Frankfurt 1997 ZIZEK, S. (2001): Die gnadenlose Liebe, Suhrkamp, Frankfurt 2001