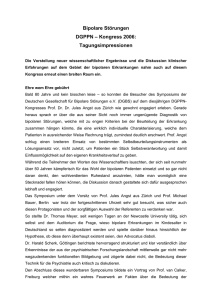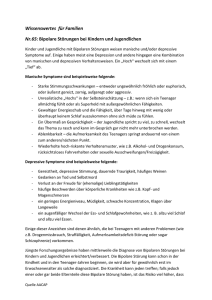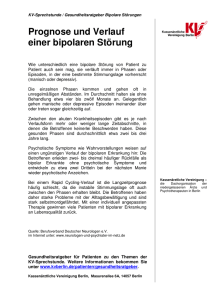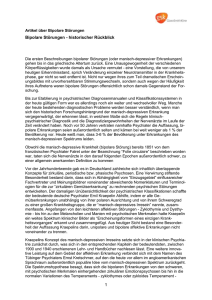036-40 BA-Gesundheitsıko
Werbung

036-40 BA-Gesu dheits ko 04.03.2004 7:46 Uhr Seite 36 Beruf aktuell Die gesundheitsökonomische Bedeutung bipolarer Störungen © Archiv Konsequente Behandlung könnte Kosten senken Langsam wird die Bedeutung bipolarer Störungen von Wissenschaftlern und Gesundheitsökonomen besser wahrgenommen. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach wie vor nur ein Bruchteil der Betroffenen eine adäquate Behandlung erhält – mit fatalen Folgen für die Patienten und die ohnehin danieder liegende Volkswirtschaft wie Anne Berghöfer und Stefan N. Willich vorrechnen. I n den westlichen Industrienationen stehen psychische Störungen inzwischen an vorderster Stelle als Ursache für Lebensjahre, die mit Behinderung gelebt werden (disability adjusted life years – DALYs). In der Studie der Weltgesundheitsorganisation „Global Burden of Disease“ werden bipolare Störungen an sechster Stelle genannt (Murray, Lopez, 1996). Nicht nur im Hinblick auf die Einschränkung der Lebensqualität, auch im Hinblick auf die Kosten, die durch eine Erkrankung entstehen, liegen bipolare Störungen weit vorne. In einer aktuellen Übersicht aus den USA über die teuersten psychiatrischen Störungen befindet sich die chronische bipolare Störung mit 30 US Dollar pro versichertem Mitglied auf Platz 1. Hinzu kommen weitere 25 US Dollar für Kosten durch Arbeitsausfall sowie für eine 36 Wiedereingliederung ins Berufsleben. Erst weit dahinter kommen die Depressionen mit Gesamtkosten von 22 US Dollar, gefolgt von Alkoholismus und Angsterkrankungen. Zum Vergleich seien die Zahlen für den Diabetes mellitus als eine der teuersten chronischen körperlichen Erkrankungen genannt. Hier entstehen Kosten von 75 US Dollar pro Versicherten, weitere 30 US Dollar für Arbeitsausfall und berufliche Wiedereingliederung (Goetzel et al., 2003). Welche Kostenarten sind für Kostenstudien relevant? Unter die direkten Kosten (Verbrauch von Ressourcen) fallen medizinische Kosten (Arztkosten, stationäre Kosten, Rehabilitation, Medikamente, Heil- und Hilfsmittel, Selbstbeteilung des Patienten sowie Krankengeld) und nicht-medizini- sche Kosten (Sozialarbeiter, Rechtsanwaltskosten, Betreuungskosten), die je nach Organisationsstruktur des Gesundheitssystems unterschiedlich gewichtet sein können. Zu den indirekten Kosten (Verlust von Ressourcen) zählen Produktivitätsausfall durch Arbeitsunfähigkeit, krankheitsbedingte Arbeitslosigkeit, frühe Sterblichkeit infolge der Erkrankung sowie Rentenzahlungen bei Frühberentung. Für ihren Anteil an den Gesamtkosten ist vor allem relevant, ob die Kosten in einem Niedrig- oder Hochlohnland berechnet werden. Die intangiblen Kosten beschreiben den Verlust an Lebensqualität für den Patienten. Kosten in europäischen Gesundheitssystemen sind nur bedingt mit amerikanischen Zahlen zu vergleichen, da die Gesundheitssysteme von Land zu Land verschieden organisiert sind. Die Berechnung der indirekten Kosten erfolgt nach dem „Humankapitalansatz“. Hierzu wird das durchschnittliche Bruttoeinkommen aus täglicher unselbstständiger Arbeit als Kosten über die Zeit der Arbeitsunfähigkeit, Berentung oder krankheitsbedingter Arbeitslosigkeit veranschlagt. Dieser Ansatz ist durchaus umstritten. Denkbar wäre alternativ, dass jeder Arbeitsplatz nach Ausfall des Erkrankten sofort anderweitig ersetzt wird (so genannter Friktionsansatz) und tatsächlich nur ein geringer Schaden für die Volkswirtschaft entsteht. Hiervon muss insbesondere in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ausgegangen werden. Wodurch entstehen die hohen Kosten bei der bipolaren Störung? Die bipolare Störung hat eine hohe Rezidivneigung und führt häufig zu Krankenhausaufenthalten. In der Folge Fortsetzung S. 39 — NeuroTransmitter 2·2004 036-40 BA-Gesu dheits ko 04.03.2004 7:46 Uhr Beruf aktuell kommt es zu Arbeitsunfähigkeit und vorzeitiger Berentung, wenn eine adäquate Stabilisierung des Verlaufs nicht zu erzielen ist. Darüber hinaus haben bipolare Patienten ein hohes Suizidrisiko; etwa jeder fünfte Patient nimmt sich im Laufe der Erkrankung das Leben. Die Exzessmortalität (Übersterblichkeit) gegenüber der Normalbevölkerung infolge Suizid beträgt das 50- bis 100fache, die allgemeine Übersterblichkeit das zwei- bis dreifache (Goodwin, Jamison, 1990). Darüber hinaus haben Patienten mit bipolaren Störungen ein erhöhtes Risiko, eine psychische Begleiterkrankung zu entwickeln; meist sind es Sucht- und Angsterkrankungen (Freeman, 2002). Auch die Gefahr körperlich zu erkranken ist höher; insbesondere Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen seien hier genannt (Kubzansky, Kawachi, 2000). Kostenberechnungen aus den USA Daten über Kosten der bipolaren Störungen kommen vorrangig aus den USA. Abhängig davon, welche Parameter in die Kostenberechnung einfließen, können die Ergebnisse ganz erheblich schwanken. In einer Erhebung von Begley et al. (2001) werden für den chronischen bipolaren Verlauf 625.000 US Dollar pro Patient über die Lebenszeit beziffert. In einer weiteren Arbeit von Simon und Unützer (1999) werden für Störungen aus dem bipolaren Spektrum 3.400 US Dollar pro Patient in sechs Monaten veranschlagt. Die Kosten liegen in dieser Berechnung über denen für Depressionen (2.570 US Dollar) und somatische Erkrankungen (1.500 US Dollar). Eine weitere Arbeit aus der amerikanischen Versorgungsforschung vergleicht die direkten medizinischen Kosten bipolarer Patienten mit denen nicht-bipolar erkrankter Vergleichspatienten (alle psychischen und somatischen Diagnosen – Stender et al., 2002). Die jährlichen Medikamentenkosten liegen mit 2,8 Mio. US Dollar mehr als fünfmal höher als bei den Vergleichspatienten (0,5 Mio. US Dollar), die Kosten für Arzt-, Ambulanzund Psychotherapie betragen das Vierfache (16,2 versus 4,1 Mio. US Dollar). Die stationären Kosten liegen mit 4,8 Mio. US Dollar fast 50-mal so hoch wie bei den Vergleichspatienten. NeuroTransmitter 2·2004 Seite 39 Bipolare Störungen Auch die Selbstbeteiligung, das heißt die von den Patienten privat aufzubringenden nicht erstatteten Kosten, liegen pro Jahr pro Patient mit 568 US Dollar bei bipolaren Störungen höher als bei anderen psychiatrischen Erkrankungen mit einem Durchschnitt von 232 US Dollar (Peele et al., 2003). Zahlen aus Großbritannien Ausgehend von einer Prävalenz von zirka 300.000 bipolar Erkrankten in Großbritannien werden direkte medizinische Kosten von 293 Mio. EUR, direkte nicht-medizinische Kosten von 126 Mio. EUR sowie indirekte Kosten von 2,6 Mrd. EUR errechnet (Das Gupta, Guest, 2002). Bemerkenswert an diesen Daten ist, dass die direkten Kosten nur 14 %, die indirekten Kosten 86% der Gesamtkosten ausmachen. Die direkten medizinischen Kosten entfallen wiederum zu einem großen Teil auf die stationären Aufenthalte und die gemeindenahe Versorgung (Das Gupta et al., 2001). Erhebungen in Deutschland bisher Fehlanzeige Vergleichbare Erhebungen für Deutschland liegen bislang nicht vor, daher kann nur auf Umwegen eine einigermaßen präzise Schätzung der gesundheitsökonomischen Belastung durch bipolare Störungen vorgenommen werden. Dies wird unter anderem durch die bis 1999 verwendete dreistellige ICD-9-Kodierung, in der bipolare Störungen und unipolare Depressionen nicht unterschieden wurden, erschwert. Ausgehend von der sehr konservativen Schätzung einer Querschnittsprävalenz von 1 % in Deutschland, das heißt zirka 820.000 Betroffenen, können die englischen Daten hochgerechnet werden. Dabei entstehen für das deutsche Gesundheitssystem direkte Kosten von insgesamt 1,2 Mrd. EUR pro Jahr und indirekte Kosten für die Volkswirtschaft in Höhe von 7,7 Mrd. EUR. Die Annahme einer Prävalenz von 1% schließt nur die klassischen stationär behandlungspflichtigen Verläufe ein. Im Bundesgesundheitssurvey, Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ (Wittchen et al., 2000) wurde eine Zwölf-Monats-Querschnittsprävalenz allein an bipolaren Depressionen von 0,8% gefunden. Auf eine ähnliche Prävalenz weisen die Daten des ADT-Panels (Stichprobe aus den mittels Abrechnungsdatenträger abrechnenden Praxen einer Region) der KVen hin: Bei nur 0,9% der Patienten wurde die Diagnose einer bipolaren Störung nach ICD10 gestellt (Pfäfflin, May, 2003). Würden die Diagnosen aus dem gesamten bipolaren Spektrum einbezogen, so dürfte von einer weit höheren Prävalenz von 5–8% auszugehen sein (Arolt, Behnken, 2003) und damit tatsächlich auch weit höhere Kosten entstehen. Löwenanteil der direkten Kosten entsteht stationär Stationäre Kosten machen den wesentlichen Anteil der direkten medizinischen Kosten aus. Bipolare Patienten werden mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 41 Tagen weitaus länger stationär behandelt als psychiatrische Patienten im Durchschnitt (27 Tage). Die durchschnittliche Verweildauer für alle Erkrankungen (psychiatrische und somatische Diagnosen) liegt inzwischen bei zehn Tagen (Statistisches Bundesamt, 2003). Da in Deutschland die Ausgaben für stationäre Behandlungen zirka ein Heraus aus dem Schattendasein Die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen (DGBS e.V.) hat es sich mit ihrem gesundheitspolitischen Engagement und ihrer weitreichenden Öffentlichkeitsarbeit zur vorrangigen Aufgabe gemacht, die Versorgung bipolar Erkrankter zu verbessern. Dazu fördert die DGBS Forschung und Lehre über die Ursachen, Diagnose und Therapie der bipolaren Störung, unterstützt Selbsthilfeinitiativen bipolarer Patienten und arbeitet eng mit anderen psychiatrischen Fachgesellschaften zusammen. Wenn Sie Fragen haben oder mithelfen wollen, bipolare Erkrankungen aus ihrem „Schattendasein“ herauszuführen, können Sie die DGBS unter folgender Adresse erreichen: Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. (DGBS), Postfach 92 02 49, 21132 Hamburg, Tel. (0 40) 85 40 88 83, E-Mail: [email protected] www.dgbs.de 39 036-40 BA-Gesu dheits ko 04.03.2004 7:46 Uhr Beruf aktuell Drittel der Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen betragen, ist insbesondere in diesem Sektor eine Kostensenkung wünschenswert. Die Last der indirekten Kosten Indirekte Kosten entstehen vornehmlich durch Arbeitsunfähigkeit, frühe Berentung und krankheitsbedingte Arbeitslosigkeit. Die Analyse von Krankenkassendaten ergab eine wesentlich höhere mittlere Anzahl von Arbeitsunfähigkeitstagen pro Jahr bei bipolaren Patienten gegenüber dem Durchschnitt aller Versicherten (62,5 versus 12,8 Tage) (Pfäfflin, 2003). Der Anteil vorzeitiger Rentenzugänge infolge bipolarer Störungen ist mit 0,33 % vergleichsweise gering, jedoch ist das Renteneintrittsalter mit zirka 46 Jahren deutlich niedriger als bei anderen Erkrankungen (Pfäfflin, May, 2003). Einsparungen durch Phasenprophylaxe Bereits in den 80er Jahren wurden Überlegungen angestellt, wie bei bipolaren Störungen durch eine adäquate Phasenprophylaxe Krankheitskosten reduziert werden und volkswirtschaftlicher Schaden abgewendet werden könnte. Frühe Berechnungen von Felber (1981, 1993) beziehen sich zunächst auf den Effekt einer Langzeittherapie mit Lithium. Felber konnte anhand einer umfangreichen Kohorte von Langzeitpatienten zeigen, dass eine konsequente Prophylaxe mit Lithium direkte und indirekte Kosten um 60 % senkt. Lehmann et al. (1997) errechneten einen Nettogewinn von 220 Mio. DM im Jahr in der BRD (alte Bundesländer) durch eine konsequente Lithiumprophylaxe. Derartige Berechnungen haben in heutigen Zeiten knapper Kassen ganz andere Bedeutung erlangt. Li et al. (2002) zeigten für die USA eine Reduktion der direkten Kosten von zirka 10.000 auf unter 6.000 US Dollar pro Patient und Jahr durch eine konsequente Phasenprophylaxe. Welches Medikament hierfür verwendet wird, ist zunächst nicht von Bedeutung. Entscheidend ist, dass überhaupt eine Phasenprophylaxe durchgeführt wird. Davon sind deutsche Therapiestandards noch weit entfernt. Daten des Arzneiverordnungsreports (Schwabe, Paffrath, 2003) sowie von IMS Health (Pfäfflin, May, 40 Seite 40 Bipolare Störungen 2003) zeigen, dass in Deutschland nur zirka 200.000 Patienten korrekt als bipolar diagnostiziert werden. Von diesen erhalten zirka 25 % eine Lithium-Prophylaxe, weniger als 10 % eine Prophylaxe mit Antikonvulsiva. Ausgehend von einer Zahl von zirka 4 Millionen Patienten, die an einer Erkrankung des bipolaren Spektrums leiden, darunter zirka 820.000 mit einer stationär behandlungsbedürftigen klassischen bipolaren Störung, ist von einer massiven Unterversorgung auszugehen. Durch die Trennung des ambulanten und stationären Versorgungssektors in Deutschland gibt es allerdings für die ambulanten Versorgungsstrukturen wenig Anreiz zur Optimierung der Therapie, solange die zu erwartenden Einsparungen aus dem stationären Sektor nicht angerechnet werden, sondern im Gegenzug niedergelassene Ärzte durch Budgetierung ihrer Arzneimittelausgaben zu Sparsamkeit gezwungen werden. Fazit Neben dem enormen persönlichen Leid verursachen bipolare Störungen hohe direkte und indirekte Kosten. Diese Situation ist nur durch eine erheblich frühere Diagnose und einen früheren Beginn der prophylaktischen Therapie zu verbessern. Hierzu bedarf es umfangreicher und konsequenter Aufklärung und Fortbildung von Ärzten, Betroffenen und Angehörigen. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass gesundheitsökonomische Fragestellungen einen höheren Stellenwert erlangen. Die Sektorisierung der Patientenversorgung in strikt abgetrennte ambulante und stationäre Bereiche ist der optimalen Versorgung bipolarer Patienten letztlich nicht zuträglich. Es bedarf dringend der Entwicklung integrierter Versorgungsmodelle nicht nur für bipolare sondern auch für andere psychiatrische und chronisch körperlich Kranke. Literatur bei der Verfasserin Dr. med. Anne Berghöfer Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Charité Campus Mitte, 10098 Berlin E-Mail: [email protected] NeuroTransmitter 2·2004