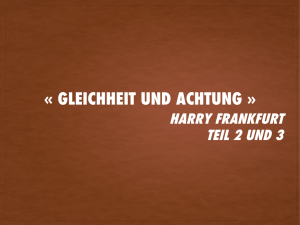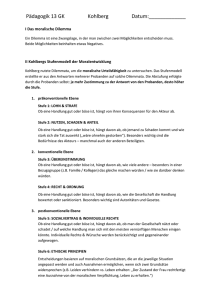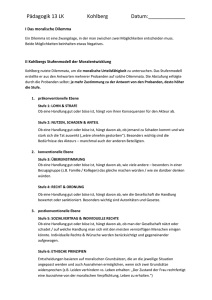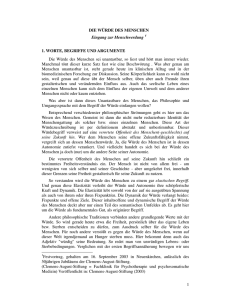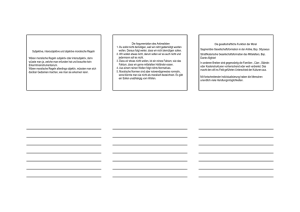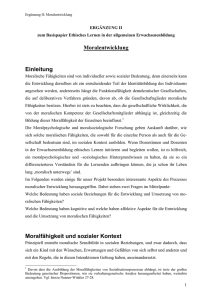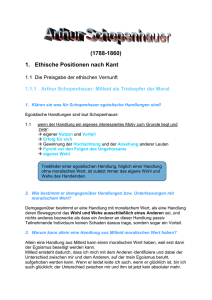Rationalität oder Praktische Vernunft? Über Argumente und andere
Werbung

Universität Zürich Institut für Sozialethik Prof. Dr. Johannes Fischer Rationalität oder Praktische Vernunft? Über Argumente und andere Gründe Jürgen Habermas hat die Redewendung vom „zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ 1 geprägt. Sie findet sich bei ihm im Zusammenhang von Überlegungen zu den rationalen Grundlagen gesellschaftlicher Ordnung und Kooperation. Für diese ist mehr erfordert als nur dies, dass die Gesellschaftsmitglieder ihr Handeln an Gründe binden, die allgemein zustimmungsfähig sind. Denn die Zustimmung könnte eine bloss faktische sein aufgrund zufälliger Übereinstimmungen von Meinungen und Überzeugungen. Das gesellschaftliche Zusammenleben würde damit von kontingenten Bedingungen abhängen, die sich jederzeit ändern können. Erfordert ist vielmehr die Bindung an Gründe, denen jedermann unabhängig von den zufälligen Bedingungen des eigenen Herkommens und der eigenen Prägung mit Notwendigkeit zustimmen muss. Von dieser Art sind Argumente. Sie sind Gründe, die mit dem Anspruch auftreten, den Nachweis für die Wahrheit oder Richtigkeit einer Behauptung führen und solchermassen Zustimmung erzwingen zu können. Im Idealfall hat ein Argument die Form eines deduktiven Schlusses, dessen Gültigkeit schlechterdings nicht bestritten werden kann. Wenn alle Gesellschaftsmitglieder ihr Urteilen und Handeln an solche Gründe binden, dann macht der zwanglose Zwang des besseren Arguments jede andere Form des Zwanges zur Gewährleistung gesellschaftlicher Ordnung und Kooperation überflüssig. ‚Gesellschaft’ wird solchermassen nach dem Modell einer Argumentations- oder Diskursgemeinschaft begriffen. Rational verhält sich, wer sich in seinem Urteilen und Handeln allein durch die besseren Argumente leiten lässt. Diese Auffassung von Rationalität findet sich nicht nur in der Diskursethik, sondern sie beherrscht weite Teile des heutigen ethischen Denkens. Ethische Deliberation vollzieht sich hiernach in Gestalt von Argumenten. Ethikexperten sind solche, die sich eine besondere Kompetenz in der Kunst moralischen Argumentierens angeeignet haben. Studierende der Ethik werden daher im Gebrauch von Argumenten geschult. 1 Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Band 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Frankfurt: Suhrkamp, 1981, 52f u.ö. Universität Zürich Institut für Sozialethik Prof. Dr. Johannes Fischer Im Folgenden möchte ich diese Auffassung zur Diskussion stellen. Dabei soll nicht bestritten werden, dass Argumente bei der Beurteilung ethischer Probleme eine wichtige Rolle spielen können. Bestritten werden soll aber, dass sich die ethische Deliberation ausschliesslich in der Form von Argumenten vollzieht. Eine solche Auffassung übersieht, dass in moralischen Fragen einer anderen Art von Gründen eine weitaus grössere Bedeutung zukommt. Argumente sind, wie gesagt, mit dem Anspruch verbunden, dem Opponenten zeigen und den Nachweis führen zu können, dass ein Urteil oder eine Behauptung wahr ist. Bei jener anderen Art von Gründen handelt es sich hingegen um solche, bei denen sich dies dem anderen selbst zeigen muss. Von dieser Art sind narrative Gründe, die eine Situation schildern und vor Augen führen, um die Richtigkeit oder Gebotenheit einer Handlung zu begründen. Ob solche Gründe ihr Ziel erreichen, hängt davon ab, ob der andere für sie empfänglich ist und ob er die Situation genauso wahrzunehmen imstande ist wie der Sprecher. Daher lässt sich mit solchen Gründen Zustimmung nicht erzwingen. Von Zwang oder Nötigung kann hier nur in dem Sinne die Rede sein, dass die vor Augen geführte Situation den anderen zur Einsicht in die Richtigkeit der Handlung nötigt. Es ist nicht der Sprecher, der dies tut. Im Unterschied zu einem am Gedanken argumentativen Zwangs orientierten Rationalitätsideal geht es hier um eine praktische Vernunft, die darin besteht, den Anspruch der Wirklichkeit vernehmen und anderen kommunizieren zu können, wie er in der Konfrontation mit konkreten Situationen begegnet. Die herrschende Auffassung von Rationalität, wonach sich nur derjenige rational verhält, der sein Urteilen und Handeln von dessen argumentativer Begründbarkeit abhängig macht, hat dazu geführt, dass viele Ethiker dieser anderen Art von Gründen nicht nur keine Aufmerksamkeit schenken, sondern sie für ethisch irrelevant erachten und aus der ethischen Deliberation ausschliessen. Eine Folge davon ist, dass die Bedeutung, die wir Situationen und Handlungen zumessen, für grosse Teile der heutigen Ethik kein Thema ist. 2 Denn diese Bedeutung lässt sich nur narrativ, d.h. durch die Schilderung von Situationen und Handlungen vergegenwärtigen. So ist die Bedeutung, die die Tötung eines Menschen für uns hat, nach dieser Sicht kein hinreichender Grund für das moralische Urteil, dass die Tötung eines 2 Universität Zürich Institut für Sozialethik Prof. Dr. Johannes Fischer Menschen etwas Schlechtes ist. 3 Vielmehr muss dies argumentativ begründet werden, zum Beispiel mit dem konsequenzialistischen Argument, dass damit die Zukunftspläne des Getöteten durchkreuzt und Glück verhindert wird, das er noch hätte erleben können. Ebenso liefert die Erwägung, was es für Menschen bedeutet, in extremer Armut zu leben, keinen hinreichenden Grund für das moralische Urteil, dass es eine Pflicht gibt, etwas gegen die Armut zu unternehmen. Vielmehr muss auch diese Pflicht argumentativ hergeleitet werden, 4 und falls sich dies als unmöglich erweisen sollte, dann ist es auch nicht rational, im Sinne dieser Pflicht zu handeln. Die Folge ist eine eigentümliche Spaltung zwischen lebensweltlicher Orientierung und ethischer Vernunft bzw. dem, was dafür gehalten wird. Für viele Ethiker ist diese Spaltung freilich kein Grund zur Irritation, ganz im Gegenteil. Sie betrachten sie als unvermeidliche Konsequenz des Projekts der Aufklärung, das sich die kritische Hinterfragung unserer Alltagsintuitionen zur Aufgabe gemacht hat, um unser Leben und Handeln auf eine rationale Grundlage zu stellen. Nun mag zugunsten dieser Rationalitätsauffassung vorgebracht werden, dass der Gedanke argumentativer Rechtfertigung bereits in dem Anspruch enthalten ist, der mit einem moralischen Urteil erhoben wird. Erheben wir nicht mit dem Urteil ‚Es gibt eine moralische Pflicht, Menschen in extremer Armut zu helfen’ einen Geltungsanspruch gegenüber anderen, d.h. den Anspruch, dass die Wahrheit dieses Urteils auch ihnen aufgezeigt und einsichtig gemacht werden kann? Diesen Anspruch aber können wir nicht mit narrativen Gründen einlösen, da deren Erfolg 2 Zu dem mit dem Ausdruck ‚Bedeutung’ Gemeinten vgl. Christopher Cordner, Ethical Encounter. The Depth of Moral Meaning, Swansea Studies in Philosophy, 2002. 3 „Entscheidender ist die unterschiedliche Einstellung, die Fachethiker gegenüber ethischen Fragen haben. Von ihrer beruflichen Ausbildung her müssen sie bereit sein, alles in Frage zu stellen. Bei Handlungstypen, deren Verwerflichkeit allen Laien offensichtlich ist, stellen sie die Frage: ‚Was ist wirklich falsch daran?’ Was ist falsch an Folter, Mord, Sklaverei, Diskriminierung der Frau? Dass sie hier aber allein die Frage stellen und eine argumentative Prüfung für nötig erachten, bringt sie freilich schon in den Ruf der Amoralität. Denn gibt es ein besseres Zeichen für das Manko der Experten, dass sie etwas hinterfragen, was jeder als moralisches Subjekt erzogener (sic!) Person offensichtlich sein muss? Schon dies macht sie als Personen suspekt. Philosophische Ethik muss tatsächlich mit diesem Manko leben. Nimmt sie nicht die Intuitionen der eigenen Zeit, die doxa, für gegeben, muss sie diese rational hinterfragen…“ Klaus Peter Rippe, Ethikkommissionen als Expertengremien? In: ders. (Hg.), Angewandte Ethik in der pluralistischen Gesellschaft, 1999, 363f. 4 Vgl. dazu etwa Peter Singer, Hunger, Wohlstand und Moral, in: Barbara Bleisch, Peter Schaber (Hg.), Weltarmut und Ethik, aaO., 37-52. Die Beiträge dieses Bandes geben einen guten Einblick in jene Art des ethischen Denkens, die hier kritisiert wird. Das gilt insbesondere für den Beitrag Peter Singers. Obgleich in diesem Beitrag spürbar ist, dass es eigentlich das Leiden der Menschen im damaligen Bengalen ist, das Singer motiviert, taucht dieses Leiden nirgendwo als Grund dafür auf, warum diesen Menschen geholfen werden sollte. Vielmehr versucht Singer, eine entsprechende Hilfspflicht auf dem Wege einer kasuistischen Argumentation zu begründen. 3 Universität Zürich Institut für Sozialethik Prof. Dr. Johannes Fischer kontingent davon abhängt, ob sich dies ihnen selbst zeigt. Also kommen hierfür nur Argumente in Betracht. Folglich müssen moralische Urteile argumentativ begründet werden. Ersichtlich beruht diese Auffassung auf einem Missverständnis, nämlich auf der Verwechslung von Urteilen und Behauptungen. Es gilt diesbezüglich zu unterscheiden zwischen einer Äusserung, einer Aussage, einem Urteil und einer Behauptung. Um eine Äusserung handelt es sich, wenn jemand beim zufälligen Blick aus dem Fenster ausruft: „Es regnet!“. In dieser Äusserung ist als deren propositionaler Gehalt die Aussage enthalten: ‚Es regnet’. Diese kann wahr oder falsch sein. Davon ist das Urteil „Es regnet“ zu unterscheiden, mit dem für diese Aussage ein Anspruch auf Wahrheit erhoben wird, d.h. der Anspruch, dass der ausgesagte Sachverhalt eine Tatsache ist. Mit dem überraschten Ausruf „Es regnet“ wird ersichtlich kein solcher Anspruch erhoben. Mit einer Behauptung oder These wird demgegenüber der diskursive Anspruch erhoben, auf Verlangen den Nachweis für das Behauptete erbringen zu können. Wenn jemand sagt „Ich behaupte, dass Peter die Unwahrheit gesagt hat“ und auf Verlangen keine Gründe nennt für den Erweis des Behaupteten, aber gleichwohl an seiner Behauptung festhält, dann hat er nicht verstanden, was es heisst, etwas zu behaupten. Urteile sind also etwas anderes als Behauptungen. Es ist Eines zu beanspruchen, dass eine Aussage zutreffend ist, und ein Anderes, einen Geltungsanspruch gegenüber jemandem, noch dazu gegenüber jedermann zu erheben, der dazu verpflichtet, diese Geltung so zu begründen, dass sie auch dem Gegenüber einleuchtet. Der erste Anspruch bezieht sich auf das Verhältnis der Aussage zu dem Sachverhalt, um den es geht, der zweite Anspruch ist ein diskursiver Anspruch, der die Rechtfertigung der Aussage betrifft. Nur der zweite Anspruch verpflichtet auf Argumente, der erste hingegen nicht. In vielen Fällen halten wir uns mit Behauptungen oder Thesen zurück, weil wir uns nicht in der Lage sehen, den damit verbundenen diskursiven Anspruch einzulösen. Aber dies hindert uns nicht daran, Urteile zu treffen. Der Unterscheidung zwischen Urteilen und Behauptungen kommt gerade in der Situation des moralischen und weltanschaulichen Pluralismus Bedeutung zu, die es schwierig machen kann, tatsächlich jedermann im globalen Horizont von der Rich- 4 Universität Zürich Institut für Sozialethik Prof. Dr. Johannes Fischer tigkeit eines moralischen Urteils zu überzeugen. Dies zeigt sich heute etwa im Bereich der Bioethik, in dem kulturelle und religiöse Traditionen in Bezug auf das Verständnis des Menschen eine wichtige Rolle spielen. Wäre die Wahrheit eines moralischen Urteils an die Bedingung gebunden, dass sie gegenüber jedermann, und dies im globalen Horizont, gerechtfertigt werden kann, dann dürften wir viele unserer moralischen Urteile in bioethischen Fragen, von deren Wahrheit wir aus guten Gründen überzeugt sind, nicht für wahr halten. Die entscheidende Frage ist damit, ob sich Aussagen moralischen Inhalts überhaupt zum Gegenstand von Behauptungen machen lassen, was nach dem Gesagten bedeutet, dass sie argumentativ begründet werden müssen. Nur dann lassen sie sich dazu machen, wenn der diskursive Anspruch, der mit ihnen erhoben wird, im Prinzip auch eingelöst werden kann. Doch lässt sich der Anspruch einlösen, der mit der Äusserung „Ich behaupte, dass es eine moralische Pflicht gibt, Menschen in extremer Armut zu helfen“ erhoben wird? Oder muss man sich hier auf das Urteil beschränken „Es gibt eine moralische Pflicht, Menschen in extremer Armut zu helfen“, für das man, um ihm Plausibilität zu verleihen, auf die Erwägung rekurrieren kann, was es für Menschen bedeutet, in extremer Armut zu leben, eine Erwägung freilich, die nicht den Charakter eines zwingenden Arguments hat? In seinem Aufsatz „Beruht die Moralphilosophie auf einem Irrtum?“ 5 hat H. A. Prichard überzeugende Gründe dafür vorgetragen, dass sich moralische Pflichten nicht mit Argumenten begründen lassen. Er vergleicht darin die Moralphilosophie mit der Erkenntnistheorie, die ihren Urprung in dem Zweifel hat, ob das, was wir für Wissen halten, tatsächlich Wissen ist. Hieraus resultiert die Suche nach Kriterien, anhand deren wir uns dessen vergewissern können, dass wir tatsächlich wissen. Um sicher zu sein, dass wir wissen, dass etwas der Fall ist, müssen wir hiernach wissen, dass wir wissen, und von der Erkenntnistheorie wird erwartet, dass sie uns hierfür Kriterien an die Hand gibt. Der Irrtum dieser Auffassung liegt Prichard zufolge darin, dass der Gegenstand unseres Zweifels gar nicht unser Wissen ist. „Denn wenn wir sagen, wir zweifeln daran, dass wir uns tatsächlich in einem Zustand des Wissens befanden, so meinen wir damit, wenn wir überhaupt etwas damit 5 Universität Zürich Institut für Sozialethik Prof. Dr. Johannes Fischer meinen, dass wir daran zweifeln, dass unsere vorherige Annahme richtig war, eine Annahme, die sich so beschreiben liesse: Wir glaubten, dass A B ist. Um daran zu zweifeln, dass unser vorheriger Zustand ein Zustand des Wissens war, dürfen wir ihn nicht für ein Wissen, sondern nur für eine Annahme halten, und unsere Frage kann dann lediglich lauten: ‚War diese Annahme richtig?’“ 6 Um aber dies herauszufinden, müssen wir noch einmal dasjenige überprüfen, was uns zu dieser Annahme brachte, also zum Beispiel eine mathematische Lösung noch einmal neu ausrechnen. Wir bedürfen dazu keiner allgemeinen erkenntnistheoretischen Kriterien für Wissen. Denselben Fehler diagnostiziert Prichard in der Moralphilosophie. Auch sie hat ihren Ursprung in einem Zweifel, nämlich dem Zweifel daran, dass das, was wir für unsere Pflicht halten, tatsächlich unsere Pflicht ist. „Wir wollen dann bewiesen haben, dass wir so handeln sollten, d.h. wir wollen davon überzeugt werden, und zwar durch einen Prozess, der als Argumentationsprozess von anderer Art ist als unsere ursprüngliche und unreflektierte Erkenntnis.“ 7 Auch hieraus resultiert die Suche nach Kriterien, anhand deren wir uns unserer Pflicht vergewissern können, und die modernen ethischen Theorien erheben den Anspruch, solche Kriterien bereitzustellen. Wie Prichard argumentiert, können sie diesen Anspruch nicht einlösen. Er unterscheidet zwei Arten der argumentativen Begründung von Pflichten, die in der Moralphilosophie angetroffen werden, nämlich einerseits die konsequenzialistische, der zufolge eine Handlung richtig ist, wenn sie Wohlergehen oder Glück befördert, und andererseits die Begründung der Richtigkeit einer Handlung daraus, dass sie an sich, d.h. unabhängig von ihren Folgen, gut ist. 8 Die erste Art der Begründung scheitert daran, dass sich aus der Tatsache, dass etwas wünschenswert ist, nicht ableiten lässt, dass es gesollt ist. Die zweite Art der Begründung scheitert daran, dass die Bewertungen ‚gut’ und ‚richtig’ Unterschiedliches bewerten, im einen Fall das Motiv der Handlung, im anderen Fall die Handlung selbst unabhängig von dem Motiv. Daher kann die Richtigkeit der Handlung nicht aus deren Gutsein – im Sinne des Gutseins ihres Motivs – abgeleitet sein. 5 H. A. Prichard, Beruht die Moralphilosophie auf einem Irrtum?, in: Günther Grewendorf, Georg Meggle (Hg.), Seminar: Sprache und Ethik. Zur Entwicklung der Metaethik, 1974, 61-82. 6 AaO. 77. 7 AaO. 79. 8 AaO. 62ff. 6 Universität Zürich 7 Institut für Sozialethik Prof. Dr. Johannes Fischer Prichard kommt zu dem Ergebnis, „dass wir nicht durch eine Argumentation …zur Erkenntnis einer Verpflichtung gelangen“ 9 . Vielmehr ist „das Gefühl der Verpflichtung zu einer bestimmten Handlung oder die Richtigkeit dieser Handlung … absolut primär (d.h. von nichts anderem abgeleitet) bzw. unmittelbar. Die Richtigkeit einer Handlung besteht darin, dass sie in einer Situation einer bestimmten Art ein Ergebnis einer bestimmten Art A herbeiführt, wobei die genannte Situation in einer bestimmten Beziehung B des Handelnden zu anderen oder zu seiner eigenen Natur besteht.“ 10 Statt allgemeine Kriterien für ‚richtig’ oder ‚geboten’ aufzustellen, gilt es daher, die betreffenden Situationen bzw. Beziehungen in den Blick zu nehmen, gemessen an denen Handlungen richtig bzw. geboten sind. Wenn wir Zweifel haben, dass eine Handlung richtig ist, dann lassen sich diese Zweifel nur ausräumen, indem wir dasjenige noch einmal überprüfen, was uns zu der Annahme brachte, dass sie richtig ist, und das ist die betreffende Situation. Prichard unterscheidet dementsprechend zwischen einem moralischen Denken und einem nichtmoralischen Denken, wobei mit Letzterem das Denken der von ihm kritisierten Moralphilosophie gemeint ist, die Pflichten auf argumentativem Wege meint herleiten zu können. Folgt man dieser Argumentation, dann lässt sich die moralische Richtigkeit oder Gebotenheit einer Handlung nicht behaupten, d.h. mit dem diskursiven Anspruch vorbringen, sie argumentativ aufzeigen und den Nachweis für sie führen zu können. Vielmehr kann sie sich dem anderen nur selbst zeigen, indem er sich die betreffende Situation vergegenwärtigt. Die praktische Vernunft fügt sich nicht jenem Rationalitätsmodell, dem zufolge sich nur derjenige rational verhält, der sein Urteilen und Handeln von dessen argumentativer Begründbarkeit abhängig macht. Vielmehr besteht sie in praktischer Klugheit im Sinne des Blicks für das einer Situation oder auch einem Wesen Angemessene. Daher führt auch die diskursethische Konzeption des menschlichen Zusammenlebens nach dem Modell einer Argumentationsgemeinschaft in die Irre. Entgegen ihrem eigenen Anspruch steht sie im Widerspruch zur praktischen Vernunft, insofern sie mit der Verpflichtung auf den Zwang von Argumenten diejenigen Gründe, die für die moralische Orientierung wirklich zählen, aus der ethischen Deliberation verbannt. 9 AaO. 71. Universität Zürich Institut für Sozialethik Prof. Dr. Johannes Fischer William David Ross hat den hier in Rede stehenden Sachverhalt in folgendem Zitat auf den Punkt gebracht und mit kritischer Spitze gegen den Anspruch der modernen ethischen Theorien das unverzichtbare Recht der vortheoretischen praktischen Vernunft, also dessen, was Prichard ‚moralisches Denken’ nennt, herausgestellt und verteidigt. Zu verlangen, »wir sollten unsere faktische Einsicht in das, was richtig oder falsch ist, einer bloßen Theorie zuliebe aufgeben, wäre so, als wollte man von den Menschen verlangen, sie sollten ihre tatsächliche Erfahrung der Schönheit als ungültig betrachten, einer Theorie zuliebe, die bestimmt, dass ›nur das schön sein kann, was diese und jene Bedingung erfüllt‹. Wenn das, was ich unsere faktische Einsicht genannt habe, wahrhaft Einsicht ist (was ich behaupten würde), das heißt ein Stück Erkenntnis, dann ist dieses Verlangen geradezu absurd. Die Gesamtheit der moralischen Überzeugungen der Besten ist das kumulative Ergebnis der moralischen Reflexion vieler Generationen, die ein außerordentlich feines Gespür für moralische Unterscheidungen entwickelt hat; und der Theoretiker kann sich nicht erlauben, diese anders als mit dem größten Respekt zu behandeln [...].« 11 Wenn die vorstehenden Überlegungen zutreffend sind, dann bedarf es zur Ausarbeitung eines tragfähigen Konzepts von praktischer Vernunft nicht oder doch erst in zweiter Linie einer Argumentationstheorie, sondern vielmehr einer Theorie jener anderen Art von Gründen, die für das ‚moralische Denken’ im Sinne Prichards konstitutiv sind. Sie hat insbesondere zu zeigen, inwiefern und in welcher Weise solche Gründe kritisierbar und vernünftiger Verständigung zugänglich sind. 15. Juli 2009 JF/ak 10 AaO. 69. William David Ross, »Ein Katalog von Prima-facie-Pflichten«, in: Dieter Birnbacher/Norbert Hoerster (Hg.), Texte zur Ethik, München: dtv, 1976, 253-268, hier: 266f. 11 8