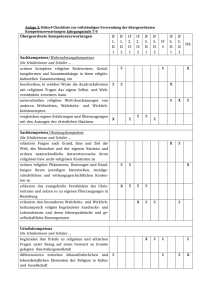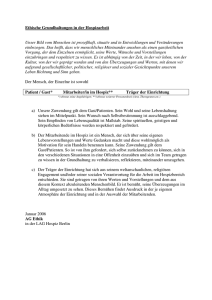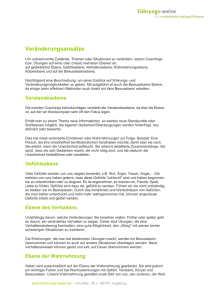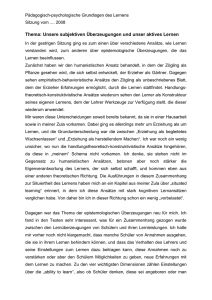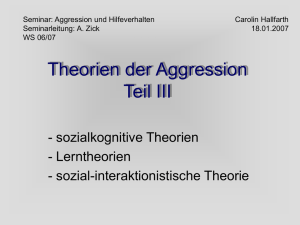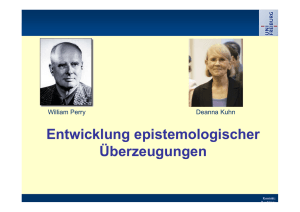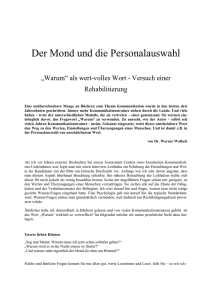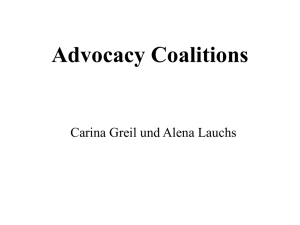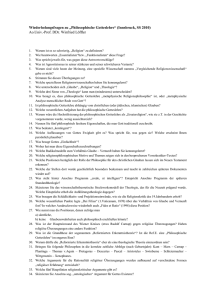Studien Glaubensüberzeugungen und säkulare Gründe
Werbung

Studien Glaubensüberzeugungen und säkulare Gründe Zur Legitimität religiöser Argumente in einer pluralistischen Gesellschaft Thomas M. Schmidt Die pluralistische Verfassung moderner Gesellschaften legt jene Unterscheidung zwischen zwei grundlegenden Bedeutungen von Ethik nahe, die sich in der Moralphilosophie der Gegenwart eingebürgert hat. »Ethik« kann einmal im Plural verstanden werden. Dann sind ethische Überzeugungen gemeint, die Entwürfe eines guten und gelungenen Lebens artikulieren. Ethische Überzeugungen dieser Art treten in modernen Gesellschaften unweigerlich im Plural auf. Wenn »Ethik« hingegen im Singular verstanden wird, dann bezeichnet der Ausdruck Moral- und Rechtsnormen, die von allen Mitgliedern einer pluralistischen Gesellschaft, unabhängig von ihren divergierenden ethischen Überzeugungen, als verbindlich anerkannt werden können. Auf der Grundlage des pluralen Verständnisses von Ethik stellt die Rolle religiöser Überzeugungen in den öffentlichen Ethik-Debatten weder in deskriptiver noch in normativer Hinsicht ein besonderes philosophisches Problem dar. Religiös fundierte ethische Überzeugungen werden im öffentlichen Raum faktisch vertreten und artikuliert. In normativer Hinsicht besteht kein Grund dies zu kritisieren, wenn sich die religiösen Überzeugungen wie alle anderen partikularen Wertorientierungen innerhalb eines gemeinsamen, die diversen Ethiken übergreifenden normativen Rahmens bewegen. In der Begründung und Akzeptanz eines solchen allgemeinen normativen Rahmens, einer für alle verbindlichen Ethik im Singular, liegt die eigentliche philosophische Herausforderung, die hinter der Frage nach der Rolle religiöser Überzeugungen in den ethischen Debatten pluralistischer Gesellschaften steckt. Eine Ethik im Singular, eine für alle Bürgerinnen und Bürger vernünftigerweise akzeptable normative Grundlage zu formulieren, erscheint vor allem dann erforderlich, wenn eine pluralistische Gesellschaft demokratisch verfasst sein soll. Eine demokratische Verfasstheit stabiler pluralistischer Gesellschaften ist nämlich keineswegs selbstverständlich. Wie etwa das Beispiel des osmanischen Millet-Systems zeigt, ist ein rechtlich garantierter Pluralismus auch auf der Grundlage eines Systems von Gruppenrechten denkbar, die von einem autokratischen Regime auf paternalistische Weise, etwa aus Gründen der politischen Stabilität eines Vielvölkerstaates gewährt werden.1 Dann sind aber die Rechte der Einzelnen an die Mitgliedschaft in Gruppen gebunden. Für die Mitglieder gibt es keine echte Option, ihre Gruppe zu verlassen. Sie besitzen politische Rechte nur als Anhänger einer bestimmten Überzeugungsgemeinschaft, nicht als individuelle Bürger. Das Prinzip der Demokratie bindet dagegen die Legitimität des Pluralismus an den Gedanken der Selbstbestimmung. Politische Autonomie, die Selbstgesetzgebungskompetenz der Bürgerinnen und Bürger kann von ihrer moralischen Selbstbestimmung als Personen, der au248 Zeitschrift für Evangelische Ethik, 45. Jg., S. 248 – 261, ISSN 044-2674 © Gütersloher Verlagshaus 2001 tonomen Entscheidung über ihre ethische Orientierung, nicht getrennt werden. Volkssouveränität verlangt mündige Bürger, die sich in der Wahl ihrer Lebensorientierung ebenfalls als autonom und souverän erweisen. Das Prinzip der Autonomie, das Recht auf die Wahl der eigenen Überzeugung, unterscheidet die demokratische Form pluralistischer Gesellschaften von anderen politischen Ordnungen. Da die Bürger in ihrer Entscheidung für eine bestimmte ethische Überzeugung autonom sind, ist ihre Entscheidung für divergierende Überzeugungen zu respektieren. Daher müssen die Bürger die Grundlagen der Legitimität ihres gemeinsamen politischen Handelns unabhängig von ihren jeweiligen, partikularen Überzeugungen akzeptieren können. Ein solches Prinzip der Normativität muss vor allem in jenen Debatten zur Geltung gebracht werden, in denen es um die Rechtfertigung von Gesetzen und staatlicher Sanktionsgewalt geht. Solche Entscheidungen betreffen nämlich nolens volens alle Bürger. Sie müssen daher auf der Basis von Gründen gerechtfertigt werden können, die prinzipiell von allen Betroffenen geteilt werden können. Diese Vorstellung einer neutralen normativen Basis, einer von substantiellen Überzeugungen unterschiedenen Ethik im Singular, wird aus der Perspektive religiöser Überzeugungen häufig kritisiert. Der Tenor dieser Kritik besagt, dass religiöse Überzeugungen durch die liberale Trennung von öffentlich gerechtfertigten Normen und privater Gesinnung aus der Sphäre der politischen Öffentlichkeit ausgeschlossen und marginalisiert würden. Um dieser Kritik wirksam zu entgegnen, muss eine Form der Begründung der normativen Grundlagen einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft gefunden werden, die solchen Vorwürfen standhält. Nur dann kann ein Vorschlag für eine normative Basis der ethisch-rechtlichen Debatten pluralistischer Gesellschaften vernünftigerweise darauf hoffen, auch die Zustimmung und Unterstützung von Menschen mit religiösen Überzeugungen zu erhalten. Damit ist eine zweite epistemologische bzw. rationalitätstheoretische Aufgabe verbunden. Jenes Konzept von Vernunft, das als Kriterium der Rechtfertigung im Singular fungiert, muss komprehensiv genug sein, dass es religiösen Überzeugungen keine im Vergleich mit anderen Überzeugungen überproportionale Lasten zumutet. Es muss gezeigt werden können, wie religiöse Überzeugungen eine vernünftige Rolle in den ethischen Debatten pluralistischer Gesellschaften spielen können, ohne dass dadurch die Stabilität und Legitimität der demokratischen Ordnung untergraben, noch religiöser Glaube trivialisiert oder verdrängt wird. Als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines solchen Begriffs dient im folgenden John Rawls Konzeption eines »vernünftigen Pluralismus«. Das »Faktum des Pluralismus« bildet nämlich für Rawls Theorie eines politischen Liberalismus nicht nur ein inhaltliches Problem ersten Ranges. Der politische Liberalismus stellt vielmehr in seiner gesamten Theoriestruktur eine methodologische Reaktion auf jene Herausforderung dar, die von der pluralistischen Verfasstheit moderner Gesellschaften ausgeht. John Rawls trägt dabei wie kaum ein zweiter politischer Theoretiker der Gegenwart gerade der Bedeutung religiöser Überzeugungen in pluralistischen Gesellschaften Rechnung. Er tut dies nicht nur durch die unermüdliche Betonung der historischen Perspektive, der zufolge es gerade das Faktum des religiösen Pluralismus, genauer der konfessionellen Spaltung des alten Europas und der daraus resultierenden Religionskriege war, die wesentlich zur Entstehung einer liberalen und säkularen Theorie des Rechtsstaats beigetragen hat. Gerade die beständige Weiterentwicklung seines Ansatzes wird vorangetrieben durch der Frage nach der angemessenen und legitimen Rolle, die religiöse und ethi249 sche Überzeugungen im öffentlichen und politischen Raum moderner pluralistischer Gesellschaften einnehmen können. 1. Vernünftiger Pluralismus – Rawls’ politischer Liberalismus John Rawls hat sich in den letzten Jahren verstärkt mit den methodischen Konsequenzen auseinander gesetzt, die sich für eine politische Konzeption von Gerechtigkeit als Fairness aus dem Umstand ergeben, dass sie gegenüber Bürgern gerechtfertigt werden soll, die in grundlegenden ethischen, politischen und religiösen Fragen divergierende Überzeugungen besitzen.2 Der Pluralismus ethischer Überzeugungen ist Ausdruck der immanenten Grenzen vernünftigen Argumentierens, ein Zeichen der Endlichkeit menschlicher Vernunft. Genau aus diesem Grund geht der politische Liberalismus davon aus, dass es keine erkenntnistheoretische Möglichkeit gibt, eine Gerechtigkeitskonzeption auszuzeichnen, die mit bestimmten Überzeugungen über das Wesen der Person, den Sinn und das Ziel menschlichen Lebens, kurzum mit einer inhaltlichen Vorstellungen des Guten, verbunden ist. Die Gerechtigkeitsbegriffe der traditionellen politischen Philosophien, auch des klassischen Liberalismus, basieren Rawls zufolge auf solchen mit Wahrheitsanspruch verbundenen Vorstellungen. Rawls nennt solche Konzeptionen »metaphysisch«. Rawls’ politischer Liberalismus gründet dagegen auf einem »politischen« Begriff der Gerechtigkeit. Ein politischer, nicht metaphysischer Begriff von Gerechtigkeit legt auf der Ebene der Gesellschaft die Idee eines Systems der fairen Kooperation zugrunde, nicht die substantielle Vorstellung eines allgemeinen guten Lebens; auf der Ebene des Individuums setzt er den politischen Begriff des Bürgers voraus, keine umfassende Theorie menschlicher Subjektivität und Identität. Diese Theorie ist also nicht nur in dem Sinne politisch, dass sie auf die politische Sphäre der Gesellschaft als ihrem ausschließlichen Geltungsbereich eingeschränkt wäre; vielmehr soll der Begriff einer Gerechtigkeit als Fairness allein aus politischen Erwägungen, unabhängig von weiteren philosophischen oder religiösen Gründen, überzeugen können. Eine solche politisch-nichtmetaphysische Theorie der Gerechtigkeit kann Rawls zufolge unter den Bedingungen eines vernünftigen Pluralismus am ehesten mit einer weit gehenden Akzeptanz unter allen vernünftigen Bürgerinnen und Bürgern rechnen. 2. Freistehende Gerechtigkeitskonzeption und übergreifender Konsens Anhänger divergierender Konzeptionen des Guten sollen die politische Konzeption der Gerechtigkeit als normative Grundlage einer pluralistischen Gesellschaft anerkennen können. Es kann Rawls zufolge nämlich von allen Bürgern im Prinzip eingesehen werden, dass Grundgüter der fairen Kooperation wie Freiheit und Gleichheit zentrale und konstitutive Elemente einer gerechten politischen Ordnung darstellen. Diese Elemente sollen aus der Perspektive der Anhänger verschiedener »umfassender Lehren«, wie Rawls religiöse und substantiellethische Anschauungen nennt, interpretiert und als verbindlich akzeptiert werden können, ohne dass diese Doktrinen selbst in die Rechtfertigungsgrundlage der freistehenden Gerechtigkeitskonzeption einfließen. Die Möglichkeit der Akzeptanz der freistehenden Gerechtig250 keitskonzeption aus den unterschiedlichen Perspektiven der umfassenden Lehren ist ein Kriterium dafür, dass die politische Gerechtigkeitskonzeption auf unkontroversen Voraussetzungen beruht. Dabei können die Gründe für die Zustimmung bei den verschiedenen ethischen und religiösen Doktrinen ganz unterschiedlich beschaffen sein. Entscheidend ist, dass sich ihre Perspektiven in dem Fluchtpunkt einer politischen Gerechtigkeitskonzeption treffen. Ein solcher überlappender Konsens kann sowohl aus Gründen der sozialen Stabilität als auch der vernünftigen Legitimität der demokratischen Verfassung einer pluralistischer Gesellschaft notwendig erscheinen. Rawls selbst behauptet gelegentlich, dass das »Stabilitätsproblem ... für die politische Philosophie grundlegend« (PL 13) sei. Nach dieser Auffassung erscheint es als Hauptaufgabe politischer Philosophie, die Bedingungen einer effektiven Realisierung vernünftiger Gerechtigkeitsprinzipien im politischen Alltag pluralistischer Gesellschaften zu formulieren. Aus Gründen der sozialen und politischen Stabilität bedarf es offensichtlich der Inkorporation vernünftiger Rechts- und Gerechtigkeitsprinzipien in die Lebenswelt der vernünftigen Bürger. Rawls’ Aussage, dass die Idee eines übergreifenden Konsenses einen Teil der »Erklärung der Stabilität« (PL 28) ausmache, legt ebenso wie seine Rede von der politischen Gerechtigkeitskonzeption als einem »Modul«3, das in die verschiedenen, von den Bürgern bejahten umfassenden Lehren eingebettet werden müsse, eine solche am Gesichtspunkt der Stabilität orientierte Auffassung nahe. Diese modulare Einbettung kann jedoch nicht als ausschließliche Funktion des übergreifenden Konsenses im Rahmen der Konzeption eines vernünftigen Pluralismus verstanden werden. Gegen diese Lesart spricht allein schon der Umstand, dass Rawls zwischen der Hintergrundkultur einer demokratischen Gesellschaft und dem übergreifenden Konsens der umfassenden Lehren unterscheidet. Der übergreifende Konsens unterscheidet sich von einer lebensweltlich eingespielten stillschweigenden Übereinkunft dadurch, dass er ausdrücklich mit Vernunft und Wille, d. h. aus Gründen vollzogen wird. Die Idee des übergreifenden Konsenses ist eine moralische Idee, die zur Stabilität aus den richtigen Gründen führt. Die Konzeption der Gerechtigkeit als Fairness verlangt nicht Stabilität schlechthin, sondern eine bestimmte, »notwendige Form der Stabilität« (PL 230). Wenn der übergreifende Konsens allein aus Gründen der Stabilität für notwendig erachtet werden würde, dann könnte auch die Rolle von Religion in rein funktionalistischen Begriffen bestimmt werden. Für die Akzeptanz der freistehenden Gerechtigkeitskonzeption reichte es dann aus, dass die Vertreter religiöser Überzeugungen ihr faktisch zustimmen könnten, also auch aus rein strategischen Gründen. Wenn der Konsens der umfassenden Lehren jedoch auch in begründungstheoretischer Hinsicht notwendig erscheint, dann müssen religiöse Überzeugungen die liberalen Gerechtigkeitsprinzipien auch aus moralisch-vernünftigen Gründen akzeptieren können. Religiösen Überzeugungen muss es nicht nur erlaubt sein, sich in die ethischen Debatten einer pluralistischen Gesellschaft einzubringen; sie müssen vielmehr aus ihrer Perspektive die allgemeinen normativen Regeln dieser Debatte als verbindlich akzeptieren können. Es stellt sich also die Frage, unter welchen Bedingungen religiöse Überzeugungen sich in den normativen Debatten einer pluralistischen Gesellschaft authentisch artikulieren können und zugleich die liberale Idee einer allgemeinen und neutral formulierten normativen Basis akzeptieren könnten. Gibt es aus der Perspektive religiöser Überzeugungen gute Gründe, einer freistehenden Konzeption von Gerechtigkeit zuzustimmen? Zur Beantwortung dieser Frage soll im Folgenden ein Blick auf die Kontroverse zwischen Robert Audi und Nicholas Wolterstorff4 251 geworfen und ihre konkurrierenden politisch-religionsphilosophischen Ansätze skizziert werden. Beide formulieren nämlich Gründe für die Akzeptanz einer liberaldemokratischen Verfassung pluralistischer Gesellschaften aus der Perspektive religiöser Überzeugungen. Sie unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Beurteilung des Rawlsschen Theorieprogramms. Während Audi die Auffassung vertritt, dass sich auf der Basis des politischen Liberalismus Gründe und Bedingungen identifizieren lassen, die Bürger mit religiösen Überzeugungen zur Unterstützung der liberalen Demokratie veranlassen könnten, ist Wolterstorff der Meinung, dass die Loyalität religiöser Menschen gegenüber dem liberalen Rechtsstaat nur unter Voraussetzungen erwartet werden kann, die der politische Liberalismus aufgrund seines Prinzips der neutralen Begründung nicht adäquat erfassen kann. Diese Kontroverse wird den Boden bereiten für die Diskussion der epistemischen Bedingungen einer liberalen Begründung der pluralistischen Demokratie. Die Frage, welche Normen unter pluralistischen Bedingungen als gerechtfertigt und welche Überzeugungen als legitim betrachtet werden können, führt unausweichlich auf die Frage nach der epistemischen Rechtfertigung von Überzeugungen überhaupt. 3. Religiöse Rezeption und Kritik des Politischen Liberalismus 1. Religiöse Überzeugungen und säkulare Gründe Robert Audi betrachtet es als vorrangige Aufgabe, Kriterien für den angemessenen Gebrauch religiöser Argumente in einer pluralistischen Öffentlichkeit zu benennen.5 Die Formulierung solcher Kriterien erscheint vor allem dann erforderlich, wenn auf der Basis religiöser Überzeugungen Gesetze oder vergleichbare politische Maßnahmen gefordert oder unterstützt werden, die individuelle Freiheiten beschränken. Handlungen, zu denen Personen qua Gesetz gezwungen werden, erscheinen ihnen nur dann durch Gründe normativ gerechtfertigt, wenn sie als rationale Personen auf der Basis derselben Gründe autonom handeln würden. Daher können religiöse Überzeugungen nur dann öffentlich legitime Argumente darstellen, wenn für sie adäquate säkulare Gründe angegeben werden können. Audi ist überzeugt, dass diese Bedingung keine unvernünftige oder unzumutbare Einschränkung für die Einstellung religiöser Personen darstellt. Ein solches Kriterium muss weder den religiösen Charakter der fraglichen Auffassungen verschleiern oder unterdrücken, noch die wünschenswerte und gerechtfertigte Trennung zwischen dem Religiösen und Politischen untergraben. Audi nennt zunächst Kriterien, mit deren Hilfe religiöse Überzeugungen von säkularen Argumenten unterschieden werden können, vor allem ein inhaltliches und ein epistemisches Merkmal. Dem inhaltlichen Kriterium zufolge ist ein Argument religiös zu nennen, wenn es auf einer Überzeugung aufruht, deren propositionaler Gehalt religiösen Charakter besitzt. Dieses Kriterium erscheint zunächst trivial; es bietet aber die Voraussetzung für wichtige Unterscheidungen. Bestimmte ethische Überzeugungen können nämlich in epistemischer Hinsicht, im Blick auf ihre Rechtfertigungsgründe religiös sein, auch wenn sie keinen explizit religiösen Inhalt besitzen. Diese Unterscheidung ist für die Frage nach dem Status religiöser Überzeugungen im Horizont pluralistischen Gesellschaften von höchster Relevanz. Denn gerade in den Ethik-Debatten pluralistischer Gesellschaften werden häufig Argumente vorgetragen, die zwar keinen explizit religiösen Inhalt besitzen, aber in epistemischer Hinsicht, im Blick auf 252 ihre Rechtfertigungsgründe, religiöser Natur sind. Audi diskutiert kontroverse Fälle wie Abtreibung und Empfängnisverhütung, in denen häufig behauptet wird, die Grundlagen der Argumentation seien nicht religiöser, sondern allgemein metaphysischer oder naturrechtlicher Art. Audi ist der Auffassung, dass die genannten Fälle zeigen, dass die Argumentationsgrundlagen letztlich religiöser Natur sind. So gebe es weder eine allgemein akzeptierte nicht-religiöse metaphysische Begründung für die These, dass bereits die menschliche Zygote beseelt oder eine Person sei, noch kann eine streng naturrechtliche Argumentation allein den Nachweis der moralischen Verwerflichkeit von Empfängnisverhütung erbringen; hierzu bedarf es weiterer religiöser Interpretationen. Solche heftig und kontrovers diskutierten Streitfälle zeigen, wie wichtig es im Kontext normativ-politischer Debatten erscheint, religiöse Argumentationen auch in epistemischer Hinsicht spezifizieren und identifizieren zu können. Die Unterscheidung zwischen dem inhaltlichen und dem epistemischen Aspekt, also zwischen Gehalt und Rechtfertigungsgrund einer Überzeugung, eröffnet nun den logischen Raum für ein Reflexionsgleichgewicht, das eine rationale Person zwischen dem propositionalen Gehalt einer Überzeugung und verschiedene Arten rechtfertigender Gründe herstellen kann. Eine rationale Person wird nach einer reflektierten kognitiven Balance suchen, in der sich ihre unterschiedlich motivierten und begründeten Überzeugungen und Einstellungen als kohärent erweisen und gegenseitig stützen. Von religiösen Bürgern liberaler Demokratien kann Audi zufolge verlangt werden, dass sie sich um ein solches ethisch-theologisches Reflexionsgleichgewicht zwischen religiösen Überzeugungen und säkularen Begründungen bemühen. Eine reflektierte religiöse Person wird nur auf der Basis solcher religiöser Überzeugungen politische Optionen zu rechtfertigen suchen, für die adäquate säkulare Gründe angegeben werden können. Audi fordert jedoch nicht nur, dass religiöse Gründe in säkulare übersetzt werden können müssen. Auch auf der Ebene der Handlungsmotivationen muss ein Entsprechungsverhältnis zwischen religiöser und säkularer Motivation gefunden werden. Audi beharrt darauf, dass die Verpflichtung besteht, keine öffentlichen politischen Maßnahmen zu unterstützen, solange keine entsprechenden säkularen Motivationen für dieses Engagement benannt werden können. 2. Religiöse Kritik der liberalen Pluralismuskonzeption Nicholas Wolterstorff hat sich wiederholt und nachdrücklich gegen die von Rawls und Audi formulierten Kriterien einer Trennung von religiösen Überzeugungen und säkularen Gründen und die Privilegierung der letzteren gewandt.6 Ziel seiner Kritik ist allerdings nicht die Ablehnung der liberalen Demokratie, sondern der politischen Philosophie des Liberalismus. Wolterstorff zufolge bietet der politische Liberalismus eine unangemessene Explikation der Prinzipien der politischen Praxis liberaler Demokratie. Auf der Grundlage dieser unangemessenen Theorie formuliere er ungerechtfertigte Ausschlussbedingungen des Religiösen aus dem Raum der politischen Öffentlichkeit. Ein liberales politisches Gemeinwesen müsse aber in der Praxis nicht notwendig Religion aus öffentlichen Debatten ausschließen. Genauso wenig setze die Unterstützung für eine liberale Politik die Akzeptanz der liberalen politischen Theorie voraus. Eine solche, praktische Unterstützung könne genauso gut und wohlbegründet auf der Basis religiöser Überzeugungen aufruhen. Ein liberales politisches Gemeinwesen ist nach Wolterstorff durch einen verfassungsmäßigen Rahmen charakterisiert, der sich dem Schutz individueller Freiheiten und Rechte ver253 pflichtet weiß. Die Tatsache, dass ein liberales politisches Gemeinwesen dem Schutz der bürgerlichen Freiheiten und Grundrechte eine hohe Priorität einräumt, ist Wolterstorff zufolge Ausdruck dafür, dass es sich dem obersten Ziel verpflichtet weiß, die Verletzung von Personen zu verhindern und zu vermeiden. Die leitende Idee hinter den bürgerlichen Freiheiten und Grundrechten ist nicht, das hohe Gut der Autonomie um seiner selbst willen zu fördern, sondern das große Übel der Verletzung von Personen zu vermeiden. Diese Interpretation, welche die Vermeidung dieses Übels als das leitende Ideal eines liberalen Gemeinwesens ansieht, bietet Wolterstorff zufolge einen angemesseneren Begriff der wirklichen Struktur demokratischer Gemeinwesen als der konzeptuelle Vorschlag der liberalen politischen Theorie. Nur unter der Bedingung des zentralen Wertes der unbedingten Vermeidung der Verletzung der Person werde das jedem liberalen Gemeinwesen zugrunde liegende Ideal zutreffend beschrieben; und nur unter einer solchen Beschreibung zeige sich zugleich, dass religiöse Personen gute interne Gründe besitzen, eine liberaldemokratische Ordnung als Ausdruck ihrer eigenen Werte und Aspirationen zu begreifen. Eine solche religiöse Fundierung des liberalen Prinzips des gleichen Respekts erscheint Wolterstorff nicht zuletzt deshalb erforderlich, weil nach seiner Auffassung die Rawlssche Rekonstruktion einer unabhängigen Vernunftbasis scheitert. Eine Begründung der Prinzipien liberaler Demokratie solle sich daher von Anfang an auf jene Tugenden konzentrieren, die erforderlich sind, um den öffentlichen Diskurs auf eine Weise zu führen, die dem Prinzip der liberalen Demokratie, also der Vermeidung der Verletzung von Personen, angemessen ist. Eine faire Kooperation aller Bürger ausschließlich auf der Basis neutraler Vernunft erscheint Wolterstorff dagegen utopisch. An die Stelle religiöser und anderer ethisch gehaltvoller Überzeugungen trete nicht die Bindung an den vernünftig begründeten Respekt gegenüber allen Mitbürgern, sondern die Berufung auf eigene partikulare Interessen. Wolterstorff kritisiert zudem, dass der Liberalismus gegenüber jenen Menschen unfair sei, die das Leben einer »religiös integrierten Existenz« führen möchten. Die liberale Trennung von Religion und Politik zwinge die religiöse Person zu einer unzumutbaren Identitätsspaltung. Hierauf ist zu erwidern, dass die liberale Idee des öffentlichen Vernunftgebrauchs Menschen, die ein Leben im Sinne des religiösen Integralismus führen wollen, in der Tat bestimmte Lasten auferlegt. Aber nicht alle religiösen Personen wollen oder müssen ihre Religiosität im Sinne des Integralismus verstehen, um konsequente Gläubige zu sein. Religiöser Integralismus ist nicht identisch mit authentischer religiöser Existenz überhaupt. Zudem ist der Hinweis, dass es bestimmten religiösen Milieus unter Bedingungen pluralistischen Gesellschaften und liberaler Rechtsstaatlichkeit schwer fällt, sich zu reproduzieren, noch kein Argument, das eine prinzipielle Ungerechtigkeit der demokratischen Verfassungsordnung aufdecken würde. Der Einwand müsste, wie Rawls zutreffend feststellt, weitergehen und nachweisen, dass der Untergang einer bestimmten Lebensweise genau darauf zurückzuführen ist, »dass es der wohlgeordneten Gesellschaft des politischen Liberalismus nicht gelinge ... eine gerechte Grundstruktur einzurichten, in der die zulässigen Lebensweisen eine faire Chance haben, zu bestehen« (PL 295). Der Untergang eines bestimmten Milieus oder Lebensstils als solcher ist noch kein Anzeichen für Ungerechtigkeit oder Intoleranz. Religiöse Überzeugungen können ein Recht auf »Artenschutz« in einer pluralistischen und säkularen Gesellschaft jedenfalls nicht prinzipiell als eine Forderung der Gerechtigkeit begründen. Dazu bedarf es des Nach254 weises, dass diese bestimmten religiösen Überzeugungen genau deshalb vom »Aussterben« bedroht sind, weil sie durch die liberalen Institutionen und Prinzipien auf eine systematische Weise benachteiligt werden. Einem Rechtfertigungs- und Reflexionsdruck sind aber in einer pluralistischen Demokratie alle Überzeugungssysteme in einer gleichen Weise ausgesetzt; dieser Reflexionsdruck ist nicht per se ungerecht. Schwerer wiegt aber ein anders akzentuierter Vorwurf, der auf ungleiche Einlassbedingungen für religiöse und säkulare Überzeugungen in öffentliche Debatten verweist. Nach dieser Einschätzung müssen religiöse Personen ungleich mehr ihrer identitätsstiftenden Grundüberzeugungen einklammern als solche mit säkular-liberalen Vorurteilen, wenn sie sich an politischen Diskursen als gleichberechtigte Partner beteiligen wollen. Im Unterschied zur säkularliberalen Person muss das religiöse Subjekt nach dieser Auffassung vitale Komponenten seiner Persönlichkeit abspalten, wenn es als anerkannter Bürger in politischen Diskursen auftreten will. Das liberale Gerechtigkeitsmodell verletze somit im Fall religiöser Überzeugungen seine eigenen Prinzipien der Fairness. Der religiös motivierte Vorwurf einer unfairen Trennung und unzumutbaren Spaltung, der gegen die liberale Konzeption eines vernünftigen Pluralismus erhoben wird, lässt sich als Hinweis verstehen, dass die von Rawls vorgeschlagene Trennung von allgemeiner, freistehender Vernunftkonzeption und persönlicher, religiöser Wahrheitsauffassung nicht alle restlos zu überzeugen vermag. Die Kritik von religiöser Seite macht auf konzeptuelle Probleme der liberalen Idee eines vernünftigen Pluralismus aufmerksam, vor allem auf die Probleme einer Trennung zwischen einem allgemeinem vernünftigen Konsens und der moralischen Wahrheit der jeweiligen umfassenden Lehren. Rawls zufolge ist eine Konzeption ja dann vernünftig, wenn ihr öffentlich zugestimmt werden kann. Der Wahrheitsanspruch, der von den partikularen ethischen oder religiösen Überzeugungen erhoben wird, bleibt hingegen vollkommen in jene religiösen und metaphysischen Weltbilder eingebettet, die selbst nicht mehr durch öffentlichen Vernunftgebrauch gerechtfertigt werden. Eine Verbindung zwischen ethischer und politischer Rechtfertigung zeigt sich bei Rawls daher nur in der Binnenperspektive der jeweiligen umfassenden Lehren, die aus ihrer Perspektive zentrale Gehalte der politischen Gerechtigkeitskonzeption als »wahr« akzeptieren können. Diese Wahrheit ist dem öffentlichen Vernunftgebrauch jedoch nicht zugänglich. Jene Art von Zustimmung, welche die allgemeine Gerechtigkeitskonzeption in Gestalt eines so genannten übergreifenden Konsenses findet, ist daher nicht in Form eines anspruchsvollen moralischen Standpunktes zu verstehen, sondern als die bloß öffentlich gemachte Konvergenz einer nichtöffentlich begründeten Akzeptanz. Der »überlappende« Konsens ist ein veröffentlichter, kein öffentlich vollzogener Konsens. Der übergreifende Konsens bleibt somit abhängig von Wahrheitsansprüchen, über deren Berechtigung sich der Theoretiker eines Urteils enthält. Aber nicht nur politische Theorie und Moralphilosophie müssen Rawls zufolge hier auf ein begründetes Urteil verzichten; auch den Bürgern selbst steht keine Beurteilung des Wahrheitsanspruches jener Gründe zu, aus denen heraus ihre Mitbürger, die anderen umfassenden Lehren anhängen, der gemeinsamen Gerechtigkeitsvorstellung zustimmen. Wenn kein begründetes Urteil über die Gültigkeit der Inhalte der umfassenden Lehren gefällt werden soll, dann kann lediglich die Vernunft der Personen, die solche Lehren vertreten, zum Maßstab der Rechtfertigung solcher Überzeugungen erhoben werden. Die Einstellung, die Personen zu ihren Überzeugungen einnehmen und die Art 255 des öffentlichen Gebrauchs, den sie als Bürger von diesen Überzeugungen machen, bilden die Kriterien vernünftiger Rechtfertigung. Offensichtlich benötigt Rawls aber doch einen Maßstab für die Beurteilung des Inhalts der umfassenden Lehren; auch auf der Inhaltsseite der umfassenden Lehren sind Distinktionskriterien nötig, die das Vernünftige vom Unvernünftigen scheiden können. Eine umfassende Lehre wird nämlich nicht nur dann »vernünftig« genannt, wenn sie von vernünftigen Personen vertreten wird, sondern wenn sie inhaltlich so beschaffen ist, dass sie die »wesentlichen Merkmale einer demokratischen Ordnung nicht ablehnt« (PL 13). Gerade das Beispiel fanatischer, antidemokratischer Religionen zeigt, dass Rawls die Trennung zwischen wahr und vernünftig im ursprünglichen Sinn nicht aufrecht erhalten kann. »Irrationale und sogar irrsinnige Lehren« müssen nämlich »eingedämmt« werden, damit sie »nicht die Einheit und die Gerechtigkeit der Gesellschaft untergraben« (ebd.). Daher muss Rawls davon ausgehen, dass vernünftige Bürger stets nur solche umfassenden Lehren bejahen, die ihrem Inhalt nach schon vernünftig sind. Aus der vermeintlichen Trennung zwischen der Vernunft der Bürger und der Wahrheit der umfassenden Lehren wird so unter der Hand die Unterstellung eines Entsprechungsverhältnisses zwischen den vernünftigen Einstellungen von Personen, die bestimmte umfassende Lehren vertreten, und dem vernünftigen Inhalt jener Überzeugungen, die sie vertreten. Die Frage nach der vernünftigen Begründung des Inhalts der umfassenden Lehren, also auch der religiösen Überzeugungen, erscheint unvermeidbar. Die Rechtfertigung der Gerechtigkeit kann nicht ausschließlich auf eine im Rawlsschen Sinne politische Weise erfolgen, sondern bedarf der Fundierung durch eine allgemeine Theorie gerechtfertigter Überzeugungen. 4. Zur Rechtfertigung religiöser Überzeugungen unter pluralistischen Bedingungen Das Konzept des vernünftigen Pluralismus ist auf die Fundierung durch eine epistemologische Theorie rationaler Rechtfertigung angewiesen. Diese Auffassung repräsentiert auf eindringliche Weise die von Gerald F. Gaus entwickelte Konzeption eines »rechtfertigenden Liberalismus«.7 Gaus erkennt das Ziel der Begründungsstrategie des Politischen Liberalismus an, nämlich allgemein verbindliche Standards der Rechtfertigung unabhängig von divergierenden Überzeugungen zu begründen. Er konzediert, dass das begründungstheoretische Grundproblem unter Bedingungen eines entfalteten Pluralismus darin besteht, dass metaphysische Theorien, also philosophische Theorien über den Charakter der Realität und Definitionen der Wahrheit, ebenfalls in einem konkurrierenden Plural auftreten. Es erscheint deshalb nicht aussichtsreich, normative Theorien, die das Zusammenleben aller regeln wollen, auf der Basis einer solchen Theorie zu etablieren. Gaus ist daher der Überzeugung, dass die Frage nach der Rechtfertigung und vernünftigen Begründung in der Tat von Fragen nach der Wahrheit und Falschheit unserer Überzeugungen unterschieden werden kann. Die Frage nach der epistemischen Rechtfertigung und vernünftigen Begründung von Überzeugungen ist jedoch für jede normative Theorie, also auch für die politische Philosophie unvermeidbar. Der Kern des Liberalismus ist Gaus zufolge gerade ein epistemologischer, nämlich die Lehre von gerechtfertigten Überzeugungen. Sein Konzept eines rechtfertigenden Liberalismus differenziert zwischen persönlicher, öffentlicher und politischer Rechtfertigung. Dieses Stufenmodell bietet eine 256 nützliche Grundlage, um den legitimen Status religiöser Überzeugungen in den ethischer Debatten pluralistischer Gesellschaften angemessen zu bestimmen. Denn auf dieser Basis kann gezeigt werden, dass die rechtfertigenden Gründe für religiöse Überzeugungen nicht prinzipiell von den Gründen für andere Arten von Überzeugungen verschieden sind. Damit kann der Vorwurf einer unfairen Exklusion der Religion auf der epistemischen Ebene aufgeräumt werden. Zugleich können so die berechtigten liberalen Forderungen und einschränkenden Bedingungen gegenüber religiös motivierten politischen Ansprüchen zur Geltung gebracht werden. Der rechtfertigende Liberalismus zeigt, dass mit Forderungen nach einem ethisch-theologischen Reflexionsgleichgewicht keine unzumutbaren oder und unfairen Forderungen gegenüber Personen mit religiösen Überzeugungen verbunden sind. 1. Persönliche Rechtfertigung – subjektive Rationalität ethisch-religiöser Überzeugungen Das Programm eines rechtfertigenden Liberalismus beginnt mit der Frage nach dem Status individueller Basisüberzeugungen. Diese Art der Rechtfertigung wird von Gaus »persönliche Rechtfertigung« genannt. Angesichts des Faktums eines vernünftigen Pluralismus muss laut Gaus eine Begründung des Liberalismus mit einer Theorie epistemischer Rechtfertigung beginnen, die zeigen kann, welche Gründe für Personen individuell gültig sind, um von dort zu solchen Gründen voranzuschreiten, die von allen geteilt werden können. Das Konzept der persönlichen Rechtfertigung kann auf diese Weise erklären, warum überhaupt eine Vielfalt vernünftiger Überzeugungen erwartbar ist. Die Idee eines vernünftigen Pluralismus unterstellt ja geradezu, dass Menschen Ansichten besitzen, die zwar vernünftig zu nennen sind, aber nicht öffentlich vor allen und für alle gerechtfertigt werden können. Das Konzept der persönlichen Rechtfertigung rekonstruiert die Grundlagen dieses unvermeidlichen epistemischen Pluralismus im Rekurs auf die Vielfalt gerechtfertigter individueller Überzeugungssysteme. Zugleich entwickelt es Kriterien der Legitimität dieser Überzeugungen und bestimmt damit die Grenzen ihrer Vielfalt. Das Konzept der persönlichen Rechtfertigung erläutert, wie diese Vielfalt individueller Überzeugungen auf die Regeln gemeinsamer Prozeduren der Rechtfertigung und der Argumentation bezogen werden können. Dabei zeigt sich, dass diskursive Verpflichtung und unterstellte intersubjektive Anerkennung nicht erst nachträglich mit persönlichen Überzeugungen verknüpft werden. Gegen den Verdacht, die Konzeption persönlicher Rechtfertigung repräsentiere ein individualistisches und monologisches Modell, ist zu betonen, dass jede Form von Rechtfertigung, auch diejenige, die auf das Überzeugungssystem eines Individuums bezogen bleibt, als ein Geben und Einfordern von Vernunftgründen notwendig intersubjektiven Charakter besitzt. Persönliche Rechtfertigung bedeutet nicht private Begründung. Auf diese Weise kann die Befürchtung, moralische und politische Diskurse würden zusammenbrechen, wenn die starke Verwobenheit moralischer Urteile mit persönlichen Glaubensüberzeugungen betont wird, durch eine Konzeption ausgeräumt werden, die bereits auf der Ebene persönlicher, nicht öffentlicher Überzeugungen von einer nicht-monologischen Form epistemischer Rechtfertigung ausgeht. Das Konzept offener Rechtfertigung geht vom aktuellen Überzeugungssystem einer Person aus und fragt, ob diese Person in Anbetracht dieses Überzeugungssystems verpflichtet ist, neue Informationen zu akzeptieren und ihre Überzeugungen im Lichte dieser Informationen 257 gegebenenfalls zu revidieren. »Offene Rechtfertigung« bedeutet also, dass diejenigen Propositionen für eine bestimmte Person gerechtfertigt sind, welche sie auch nach der Revision grundlegender Überzeugungen akzeptieren würde. Offen gerechtfertigt ist eine Überzeugung, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, auch angesichts anhaltender Kritik und neuer Information als stabil erweist. Gaus nennt sein Verfahren daher eine »negative Analyse spontaner Überzeugungen«8. Es geht vom Begründetsein basaler Überzeugungen aus und fragt nach jenen Gründen, die eine Änderung oder Preisgabe solcher Auffassungen verlangen würden. Eine Person ist gerechtfertigt Überzeugungen aufrecht zu erhalten, solange diese nicht überführt worden sind, mit anderen epistemischen Verpflichtungen dieser Person inkonsistent zu sein. Dies lässt sich nahtlos an ein religionsphilosophisches Konzept der Rationalität religiöser Überzeugungen anschließen, wie es im Kontext der so genannten »reformierten Epistemologie« gerade von Wolterstorff vertreten wird.9 Rationalität wird hier verstanden als ein personenbezogenes Konzept von Begründung. Rationalität gilt immer relativ zu den Werten, Präferenzen und Einstellungen einer Person. Ausgangspunkt dieses Rationalitätskonzepts sind Personen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt bereits eine bestimmte Anzahl von Überzeugungen besitzen. Zum Nachweis der Rationalität einer Überzeugung genügt nach Wolterstorff ein epistemischer innocent-until-proven-guilty-Grundsatz. Eine Person ist rational gerechtfertigt, bestimmte Überzeugungen zu vertreten, solange sie keinen angemessenen Grund besitzt, sie auf zugeben. Unsere Überzeugungen sind rational, solange kein Grund gegen sie spricht. Sie sind nicht allein schon dadurch nichtrational, dass kein angemessener Grund für sie besteht. Solange keine externen Einsprüche geltend gemacht werden können, sind die Überzeugungen subjektiv gerechtfertigt. Religiöse Überzeugungen können daher auf der individuellen Ebene als unmittelbar gerechtfertigte Basisüberzeugungen betrachtet werden. Diese Unmittelbarkeit entzieht diese Überzeugungen jedoch nicht den Anforderungen diskursiver Rechtfertigung. Durch die epistemische Rechenschaftspflicht wird die Eigenart dieser Überzeugungen, persönlich gerechtfertigt zu sein, nicht erschüttert. Wenn religiöse Überzeugungen allerdings zur Grundlage moralischer und politischer Ansprüche erhoben werden, dann kann und muss gefordert werden, dass sie sich den allgemeinen Kriterien öffentlicher Rechtfertigung beugen. Religiöse Menschen schulden anderen Personen, die von den Folgen ihrer Überzeugungen betroffen sind, Gründe, welche diese vernünftigerweise einsehen können. Anders als auf der Ebene der Rationalität, besteht hier bei einem Scheitern der Begründung die Pflicht zur Enthaltsamkeit. Eine Überzeugung, die nicht intersubjektiv gerechtfertigt werden kann, darf nicht zur Grundlage von Handlungen erhoben werden, die alle betreffen. Die öffentliche Rechtfertigung zielt auf eine intersubjektive Begründung allgemein verbindlicher Normen. Sie ist daher von der persönlichen Rechtfertigung, die dem Nachweis der subjektiven Rationalität von Überzeugungen dient, zu unterscheiden. 2. Öffentliche Rechtfertigung – intersubjektive Begründung moralischer Normen Das Prinzip einer öffentlichen Rechtfertigung geht davon aus, dass moralische Pflichten und rechtliche Sanktionen nicht vollständig aus der Perspektive der ersten Person und ihrer individuellen Bindungen und Wertungen erklärt werden können. Hierzu bedarf es eines transsubjektiven moralischen Gesichtspunktes. Erst eine öffentliche, von persönlicher Rechtfertigung 258 unterschiedene vernünftige Argumentation kann Prinzipien der Gerechtigkeit und die Sanktionsgewalt des Rechts legitimieren. Aber genau deshalb ist es wichtig, eine Differenz von persönlicher und öffentlicher Rechtfertigung zu etablieren. Denn erst die Möglichkeit einer von öffentlicher Rechtfertigung logisch unabhängigen persönlichen Rechtfertigung kann zeigen, dass eine Person nicht irrational ist, wenn sie an persönlichen Überzeugungen festhält, die nicht zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung erhoben werden können. Auch jene Gründe, die als säkulare Übersetzungen für die ursprünglich auf der Basis religiöser Überzeugungen erhobenen normativen Geltungsansprüche angeboten werden, können nicht immer auf ungeteilte öffentliche Zustimmung rechnen. In diesen Fällen dürfen die so begründeten Normen dann auch nicht den nichtreligiösen Mitbürgern als Pflichten auferlegt werden. Zur Verpflichtung, für die religiösen Überzeugungen im Rahmen einer öffentlichen Rechtfertigung angemessene säkulare Gründe zu nennen, tritt somit die Verpflichtung, im Falle des Scheiterns einer solchen allgemeinen öffentlichen Rechtfertigung darauf zu verzichten, ihnen die Form zwingenden Rechts verleihen zu wollen. Dies stellt im Fall religiöser Überzeugungen ja das besondere Legitimitäts- und Stabilitätsproblem pluralistischer und liberaler Demokratien dar. Bestimmte minoritäre religiöse Gruppen wollen ihre moralischen Vorstellungen ja auch dann zur Grundlage allgemein verbindlicher Normen und Gesetze erheben, wenn diese Überzeugungen nicht öffentlich gerechtfertigt werden können. Notwendig erscheint also die Begründung eines Rechtsgehorsams auch in Fällen solcher Gesetze, die auf der Ebene der gerechtfertigten persönlichen Überzeugungen als unmoralisch eingestuft werden. 3. Politische Rechtfertigung – reflexive Differenzierung von religiöser Überzeugung und legitimen Recht Unter Bedingungen eines vernünftigen Pluralismus ist nicht damit zu rechnen, dass eine öffentlich vollzogene intersubjektive Rechtfertigung subjektiv rationaler Überzeugungen in jedem Fall gelingt. Nicht alle individuellen, persönlich gerechtfertigten Überzeugungen lassen sich in pluralistischen Gesellschaften in öffentlich akzeptierte Vorstellungen transformieren. Daher muss eine weitere Differenzierung vorgenommen und eine dritte Ebene der Rechtfertigung eingeführt werden, die im Konfliktfall zwischen persönlicher und öffentlicher Rechtfertigung vermitteln kann. Es bedarf einer von der persönlichen und öffentlichen Rechtfertigung unterschiedenen Form der politischen Rechtfertigung. Sie begründet die Ebene einer konstitutionellen Ordnung. Aus der Verpflichtung, die eigenen Überzeugungen öffentlich zu rechtfertigen, wenn sie als allgemeine moralische Normen akzeptiert werden sollen, folgt die Verpflichtung, den Mitbürgern keine Normen aufzuzwingen, die nicht im Sinne einer solchen öffentlichen Moral gerechtfertigt werden können. Eine solche Enthaltsamkeit kann gefordert werden, weil im Rahmen einer gestuften Theorie der Rechtfertigung von Überzeugungen gezeigt werden kann, dass eine fallibilistische Einstellung gegenüber den eigenen Basisüberzeugungen im öffentlichen Raum durchaus vereinbar ist mit jenem Unbedingtheitscharakter, den diese Überzeugungen auf der Ebene der persönlichen, subjektiven Rationalität besitzen. Das Gebot, auf die Durchsetzung nicht verallgemeinerungsfähiger Überzeugungen zu verzichten, ist nicht gleichbedeutend mit einem Eingeständnis der Irrationalität und Irrelevanz dieser Überzeugungen. Aus der fallibilistischen Einstellung und kognitiven Toleranz gegenüber den eigenen Basisüberzeugungen, die mit 259 unterschiedlichen und unabhängigen Gründen vertreten werden können, folgt a fortiori die politische Toleranz gegenüber Gründen, die andere Personen für ihre persönlich gerechtfertigten Überzeugungen geltend machen. Daraus folgt die Akzeptanz jenes spezifisch liberalen Prinzips politischer Rechtfertigung, welches rechtlichen Zwang, der nicht mit allgemeinen Gründen einsichtig gemacht werden kann, für illegitim erklärt. Aufgrund der Kohärenz religiöser und säkularer Überzeugungen, die rationale religiöse Personen auf der Ebene der persönlichen Rechtfertigung durch ein weites Reflexionsgleichgewicht herzustellen suchen, sind sich diese Personen darüber im klaren, dass bereits für ihre elementaren religiösen Bindungen eine Pluralität unterschiedlicher und unabhängiger Gründe zur Verfügung steht. Daraus folgt eine fallibilistische Einstellung gegenüber den Begründungen für die eigenen religiösen Überzeugungen, auch für diejenigen, die den Charakter unmittelbarer, sinnstiftender Gewissheit besitzen. Denn die unmittelbare Rechtfertigung einer Überzeugung schließt nicht aus, dass im Laufe eines Reflexionsprozesses andere stützende Gründe für diese Überzeugungen gefunden werden können. Dies erlaubt eine kognitive Distanz zu den eigenen Basisüberzeugungen und eine epistemische Toleranz gegenüber anderen, möglicherweise besseren Gründen für diese Überzeugungen. Diese Einstellung mindert aber nicht den basalen Charakter dieser betreffenden Überzeugungen. Ein Modell der Rechtfertigung, dass unter den Voraussetzungen eines gemäßigten epistemologischen Fundamentalismus operiert10, trägt dem Selbstverständnis religiöser Überzeugungen Rechnung, unmittelbar gerechtfertigt und gewissheitsverbürgend zu sein. Gleichzeitig wird daran festgehalten, dass auch solche Überzeugungen offen gerechtfertigt werden sollen. Unmittelbare gerechtfertigte Überzeugungen, zu denen religiöse Überzeugungen zweifellos gehören können, besitzen die Tendenz zu einer partikulare Kontexte überschreitenden inferentiellen und allgemeinen Form der Rechtfertigung. Dies ändert nichts daran, dass sie unter bestimmten Bedingungen als individuelle Überzeugungen direkt und unmittelbar epistemisch gerechtfertigt sind. Religiöse Überzeugungen können sich daher in ethische Debatten einer pluralistischen Gesellschaft einbringen, ohne die normative Grundlage einer für alle verbindlichen demokratischen Ordnung zu gefährden. Sie können diese normativen Grundlagen einer liberaldemokratischen Verfassungsordnung nämlich als Kriterien ihrer Rationalität akzeptieren, ohne ihren religiösen Ursprung und Charakter zu zerstören. Auf der Grundlage eines moderaten epistemologischen Fundamentalismus, wie ihn etwa Gaus’ Theorie des rechtfertigenden Liberalismus vertritt, kann gezeigt werden, dass religiöse Überzeugungen weder pathologisiert noch ridikülisiert werden müssen, um die Legitimität und Stabilität einer liberaldemokratischen Ordnung zu garantieren. Auf der anderen Seite muss eine liberale Begründung des Rechts und der Gerechtigkeit weder dämonisiert noch trivialisiert werden, um religiösen Überzeugungen Relevanz und Aufmerksamkeit in einer pluralistischen Öffentlichkeit zu verschaffen. PD Dr. Thomas M. Schmidt Institut für Philosophie Johann-Wofgang-Goethe-Universität Frankfurt Dantestrasse 4-6 D-60054 Frankfurt 260 Abstract John Rawls’ conception of a reasonable pluralism proceeds on the epistemological assumption that it is not possible to set up one specific notion of justice attached to certain beliefs about the nature of the person, the purpose and the goal of human life. The liberal position insists on the principle of moral justification, according to which no norm is legitimate unless it can be accepted in principle by all affected persons. According to this view, it is recommended, in public debates where the legitimacy of laws and state actions is being disputed, citizens should confine themselves to the use of religious arguments for which independent, secular reasons can be given. This conception has elicited an array of critical responses from authors of a religious persuasion. Critics point above all to the unequal terms of entry to public debates. But it can be shown in terms of a modest foundationalist epistemology that the required translation of religious beliefs in secular reasons is not an unfair and unjustified charge. Personally justified basic beliefs can be tested in intersubjective and public procedures of reasoning without requiring believers to sacrifice their religious or confessional identity. Anmerkungen 1. Auf dieses Beispiel und seine systematische Bedeutung hat Will Kymlicka hingewiesen. Will Kymlicka, »Two Models of Pluralism and Tolerance«, in: Analyse und Kritik, 14 (1992), 33-55. 2. John Rawls, Politischer Liberalismus (übers. von Wilfried Hinsch) Frankfurt am Main 1998 (=PL). 3. John. Rawls, »Erwiderung auf Habermas«, in: Philosophische Gesellschaft Bad Homburg/W. Hinsch (Hrsg.), Zur Idee des politischen Liberalismus. John Rawls in der Diskussion, Frankfurt am Main 1997, 207. 4. Robert Audi/Nicholas Wolterstorff, Religion in the Public Square. The Place of Religious Convictions in Political Debate, Lanham, Maryland 1997. 5. Die Diskussion der Position Audis bezieht sich auf seine Beiträge: »The Separation of Church and State and the Obligations of Citizenship«, Philosophy and Public Affairs 18 (1989), 259-296; »The Place of Religious Argument in a Free and Democratic Society«, San Diego Law Review 30 (1993), 647-675; »The State, the Church, and the Citizen«, in: Paul J. Weithman (ed.), Religion and Contemporary Liberalism, Notre Dame 1997, 38-75; »Liberal Democracy and the Place of Religion in Politics«, in: Audi/Wolterstorff 1997, 1-66. Ein Großteil der Argumente aus diesen Aufsätzen findet sich zusammengefasst in: Robert Audi, Religious Commitment and Secular Reason, Cambridge 2000. 6. Die Diskussion der Position von Wolterstorff bezieht sich im Folgenden auf seine Beiträge: »Why We Should Reject What Liberalism Tells Us about Speaking and Acting in Public for Religious Reasons« (Weithman 1997), 162-181; »The Role of Religion in Decision and Discussion of Political Issues« (Audi/Wolterstorff 1997), 67-120. 7. Gerald F. Gaus, Justificatory Liberalism. An Essay on Epistemology and Political Theory, New York 1996. Vgl. ders., Value and Justification: The Foundations of Liberal Theory, Cambridge 1990. 8. G. F. Gaus, Justificatory Liberalism, a.a.O., 93. 9. N. Wolterstorff, »Can Belief in God Be Rational If It Has No Foundations?«, in: A. Plantinga/ N. Wolterstorff, (eds.), Faith and Rationality. Reason and Belief in God, Notre Dame 1983, 135-186. 10. Zur Diskussion des epistemologischen Fundamentalismus vgl. Th. M. Schmidt, »Das epistemische Subjekt. Basale Überzeugungen und intersubjektive Rechtfertigung«, erscheint in: Gerhard Krieger/Hans-Ludwig Ollig (Hrsg.), Fluchtpunkt Subjekt, Paderborn 2001. 261