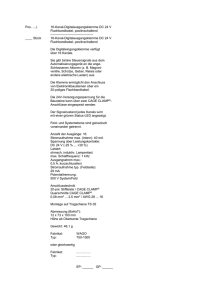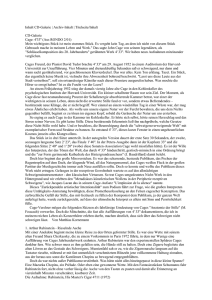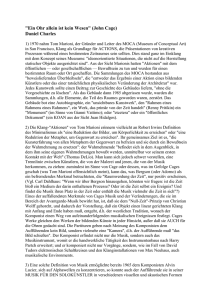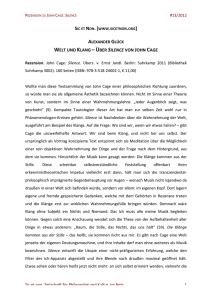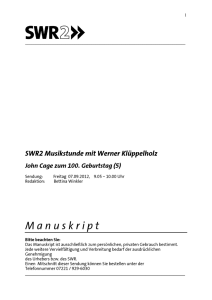Wenn du auslöschst Sinn und Ton — Was hörst du dann ?
Werbung

Wenn du auslöschst Sinn und Ton — Was hörst du dann ? 1 1 Ja pa nisc h es Koa n des Zen (11.Jh . n. C h r.) In: Joa c h im -Ernst Berendt, N a da Bra hm a, Reinbek/F rankfurt 198389, S. 56. Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien im Fach: Musik (Doppelfach) Thema: MOMENT UND FORM Die Auflösung traditioneller Formerwartungen in John Cage’s Mu s ic o f Ch an g e s und Variatio n s I 2 Inhalt 1. Einleitung - Rechtfertigung des Themas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Ein Überblick über die Grundästhetik - was wir unter „Musik“ im Kontext des Europäischen Kunstverständnisses bis in das 20. Jahrhundert hinein verstehen . . . . . . . . . 8 2.1 Ästhetische Identifikation: Musik - ein Spiel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2 Bild und Emotion - die „Bedeutung“ in der Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.3 Musik als Reizgebilde - Klangfarben, Abbildlichkeit und außermusikalische Inhalte . . . . . 20 2.4 Werkidentität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.5 Erkennendes Verstehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. Kurze Zusammenfassung der Situation in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts . . . . . . . 29 4. Cages Entwicklung hin zu einer neuen Idee von Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.1 Cages Persönlichkeit - Neugier auf Unbekanntes und der Entschluss, einen eigenen Weg zu beschreiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.2 Geräusche. Die Isolation der Töne. Allklang. Stille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4.3 Der Moment - Zeit und Zeitbegriff. Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.4 Emotion. Rückzug der Persönlichkeit. Indische Philosophie und Zen . . . . . . . . . . . . . . . 59 4.5 Anarchismus und „Offenheit für alles“ - Musik und Leben. Beurteilung von Musik . . . . 70 4.6 Raum und Darstellung. Das multimediale Happening. Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4.7 Aleatorik und Indetermination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5. Betrachtung der kompositorischen Prämissen Cages anhand der Music of Changes und der Variations I. Analyse und Hintergründe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5.1 Music of Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5.2 Variations I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6. Musik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3 1. E INLEITUNG - R ECHTFERTIGUNG DES T HEMAS Die Kunst von John Cage hat innerhalb der mächtigen Umwälzungsbewegungen in der Kunstmusik im Laufe des 20 Jahrhunderts einen Sonderplatz eingenommen. Im Zuge des zunehmenden Bedürfnisses nach Verstärkung der Kontrolle des Komponisten (insbesondere innerhalb der Richtung des Serialismus) über die musikalischen Parameter in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich John Cage im Laufe seines Schaffensprozesses zu einem Gegenpol zu dieser Entwicklung. Sein sich zunehmend radikalisierender Rückzug aus der Kontrolle des Komponisten über Form, musikalische Sprache, Material, Besetzung, Struktur und sein völlig neues Verständnis von dem Verhältnis von Komponist zu Interpret und Hörer, seine Erforschung neuer Klangwelten (auch innerhalb des traditionellen Instrumentariums) und das Suchen eines neuen - dem 20. Jahrhundert angemessenen - Sinns von Musik (um nur einige Aspekte zu nennen) hat das gesamte Musikdenken nachhaltig beeinflusst. Sein sehr eigener Weg hat ihn aber auch von allem entfernt, was wir traditionell unter Musik verstehen, und ihn herber Kritik von allen Richtungen ausgesetzt; Und die ästhetische Diskussion ist noch längst nicht abgeschlossen. Cage hat eine langanhaltende Debatte in Gang gebracht darüber, was wir unter Musik verstehen und von ihr erwarten. Seine ästhetische Kehrtwende ist enorm und hat vielen der musikalischen Avantgarde an sich zugewandten Musikern und Experten „Kopfschmerzen” bereitet. Viele Skandalaufführungen säumen seinen „Weg“. Viele musikalische Größen der Zeit, die sich ihm zunächst neugierig annäherten, haben sich später abgewandt, darunter Stockhausen und Boulez. Cage steht außerdem nicht nur für ein einziges bestimmtes spezifisches Merkmal. Man kann ihn nicht nur auf ein Schlagwort wie „Aleatorik“ reduzieren. Diese Aleatorik hat viele sich wandelnde Gesichter. Er steht daneben genauso symbolisch für das „präparierte Klavier“, was wiederum nur ein Symbol für die Auslotung der Klangeigenschaften aller Musikinstrumente außerhalb der Wege traditioneller Klangerzeugung sein kann. Auch das Verständnis des multimedialen „Happenings“ hat er sicherlich mitgeprägt; Nicht zu vergessen das ganz besonders zu verstehende Element der „Stille“. Sein unermüdlich wiederholter Leitspruch „die Musik mit dem Leben gleichsetzen“ deutet bereits an, welche Umstellung der traditionelle „Beethoven4 Hörer“ zu durchlaufen hat, um sich dieser Kunst anzunähern. Cages Kunst zielt darauf, den Menschen zu verändern. Natürlich kommt auch eine solche Entwicklung nicht aus dem Nichts. Auch Cage hat von Kunstrichtungen wie Dadaismus und Futurismus profitiert. Charles Ives, Edgar Varèse, Marcel Duchamp, Henry Cowell und Eric Satie und viele Andere haben ihn beeinflußt. Er bezog viele seiner Vorbilder interessanterweise nicht nur aus der Musikszene, sondern aus Literatur, Tanz, Theater und Malerei. Die Synthese und Beziehung der Künste hat ihn nachweislich sehr beschäftigt. Er umgab sich mit einem engen Zirkel von Künstlerfreunden, darunter David Tudor, Earl Brown, Morton Feldmann und Merce Cunningham, die sich gegenseitig halfen und inspirierten. Zusätzlich wird uns die Frage beschäftigen, inwiefern und inwieweit indische und japanische Philosophie wirklich mit seiner Kunst zu tun hat. Cage ist von einem unstetigen, immer vorwärts strebenden Geist besessen gewesen, der, immer, wenn er etwas Neues geschaffen hatte, sofort nach dem Nächsten griff. Nie hat sein Werk eine längerwährende Beständigkeit in Form, Prinzip und Material gehabt (von ganz fundamentalen Grundprinzipien, wie dem des Zufalls / der Unbestimmtheit abgesehen, doch auch jene haben sich mit der Zeit graduell geändert). Er sagte: „Mich interessiert immer nur die Musik, die ich als letztes geschrieben habe“. Die Entwicklung ist - zwischen den Zeilen gelesen - immer auch das Ergebnis seiner persönlichen Erfahrungen gewesen. Die Beschäftigung mit seiner Biographie lässt genug Anhaltspunkte dafür, daß entscheidende Einschnitte in seinem Leben und seine spezielle Persönlichkeit zu Veränderung in seinem musikalischen Weg geführt haben, als Beispiel sei hier nur die Publikumsaufnahme seines vielleicht persönlichsten Stückes The perilous Night, 1944, kurz vor der Scheidung von seiner Frau Xenia genannt. Bei der Beschäftigung mit Cage muss unbedingt auch darüber gesprochen werden. Obwohl der Titel dieser Arbeit suggeriert, die Beschäftigung mit Cage reduziere sich hauptsächlich auf Variations I und Music of Changes, muss der Bogen weiter gespannt werden und sich eher auf fundamentale Aspekte seiner Kunst beziehen, als auf einzelne Werke - schon deshalb, weil der Werkbegriff bei Cage nicht zentral ist. Das Werk (und sein Leben) muss spätestens ab den 50er Jahren als eine Art sich entwickelndes „musikalisches Kontinuum“ angesehen werden, von dem einzelne Werke oder Konzerte nur kleine, nach außen hin sichtbare Ausschnitte bilden. Nichtsdestotrotz bieten diese beiden Werke wichtige Schlüsselaspekte, 5 die in ihrer Begrenztheit exemplarisch auf das Gesamtwerk übertragen werden können. Außerdem will ich hier versuchen, mich von der anderen Seite her - nämlich von der Seite des Zuhörers - dem Werk zu nähern. Diese Arbeit ist keine primär Musikhistorische oder musiksystematische Abhandlung, sondern beschäftigt sich mit dem interessantesten Teil bei Cage: dem ästhetischen. Cage selbst hat dazu eine Fülle von Erklärungen und ein umfangreiches Schriftwerk hinterlassen. Er war angesichts seiner radikal neuen Ideen ständig in Erklärungsnot und hat im Laufe seines Lebens viele Vorträge und Vorlesungen gehalten, in denen seine Kunstansichten dokumentiert sind. Diese hat er sogar z.T. systematisch praktisch in die methodische Umsetzung seiner Veranstaltungen mit einfließen lassen. Das hat dazu geführt, dass man Cage oft lieber als Musikphilosoph denn als Musiker angesehen hat, der seine Ideen besser hätte theoretisch als praktisch propagieren sollen. Zudem spielt bei Cage neben seinem Interesse für fernöstliche Philosophie, und seiner Neigung zur Askese auch seine „Begeisterung für chaotischen Überfluss“2 und seine zunehmende Entwicklung zum politischen Anarchisten, resultierend aus seiner Beschäftigung mit Duchamp, eine Rolle. Diese Prinzipien spiegeln sich auch in seiner Musik selbstredend wieder. Durch seine Negation von Vielem, was bisher unter Musik verstanden wurde, bietet sich die Gelegenheit, sich die traditionellen grundlegenden Prinzipien einmal wieder genau vor Augen zu halten und sie anschließend den neuartigen gegenüberzustellen. Daher wird die Arbeit sich auch erst einmal mit der traditionellen Musikästhetik auseinandersetzen. Dabei kann natürlich keine ausführliche Diskussion von allen unzähligen divergierenden Meinungen und Darstellungen der Geschichte erfolgen, das würde den Rahmen dieser Arbeit um ein Vielfaches sprengen. Ich kann nur ausschnitthaft auf meines Erachtens zentrale Aspekte eingehen und nehme hierzu hauptsächlich auf die relativ junge Musikästhetik „Musik Verstehen“ von Hans Heinrich Eggebrecht3 Bezug. Diese Arbeit ist aber auch eine kritische Auseinandersetzung mit Cage. Nicht alles kann einfach unbesehen aufgenommen werden. Und schließlich muss und werde ich die vielleicht schwerwiegendste Frage stellen: nämlich, inwieweit Cages Werk noch mit dem 2 Hans Heinrich Eggebrecht, Musik verstehen, Wilhelmshaven 1999, S. 309/310 . 3 Eggebrecht, Musik Verstehen, 1999. 6 traditionellen Begriff von „Musik“ zu vereinbaren und damit in diese Kategorie einzuordnen ist. Cage hat sich selbst schon bemerkenswert früh dazu geäußert. Trotz der kritischen Auseinandersetzung mit Cage muss hier ausdrücklich auf die bemerkenswerte Leistung bezüglich seines Lebenswerkes hingewiesen werden. Die Beschäftigung mit Cages Biographie öffnet den Leser für den bewundernswerten, geradlinigen Lebensweg eines konsequenten, unabhängig denkenden Menschen, der ungeachtet von Hass und Verachtung, bösem Spott, vielen Rückschlägen und langer, bitterer Armut einen konsequenten Weg gegangen ist und der sich die späte Anerkennung seines Lebenswerkes hart verdienen musste. 2. E IN Ü BERBLICK ÜBER DIE G RUNDÄSTHETIK - WAS WIR UNTER „M USIK“ IM K ONTEXT DES E UROPÄISCHEN K UNSTVERSTÄNDNISSES BIS IN DAS 20. JAHRHUNDERT HINEIN VERSTEHEN 2.1 Ä STHETISCHE IDENTIFIKATION: M USIK - EIN SPIEL? Musik hat im Laufe der Geschichte viele Gesichter gezeigt. Von der Erzeugung von Stimmung und Extase in alter ritueller Musik, über das Symbol von Lobpreisung im sakralen Gesang des Mittelalters, von der Spielmusik zur Unterhaltung und Ergötzung auf Jahrmärkten und am Hofe, der Gebrauch ihrer emotionalen Eigenschaften im (auch rituell-symbolischen) Liebesgesang - angefangen vom Minnesang bis heute - oder der Gebrauch ihrer mitreissenden rhythmischen Eigenschaften in der Tanzmusik, die Tradierung von Identifikation und Bräuchen in der authentischen Volksmusik überall auf der Welt bis hin zur Entwicklung einer weltlichen Kunstmusik in aller ihrer Variation vom Barock bis in unsere Zeit hinein und darüber hinaus in Jazz und Pop (die 7 modernen Formen von Volks- und Spielmusik) - alles hat dazu beigetragen, dass Musik zwar universal, aber in ihrer Bedeutung auch sehr vielfältig und schwer zu fassen ist. Wer traut sich schon zu sagen, was das Wesen von Musik ist? Fest steht, dass sie etwas mit der Bildung von Kultur (im Sinne von völkischer Tradition) zu tun hat. In jeder Kultur, und sei es im hintersten Ureinwohnerdorf im letzten Winkel der Welt, hat sie in irgendeiner Form Platz gefunden. Wie sie verstanden wird, darüber besteht unter den Denkern und Experten keineswegs Einigkeit. Doch fest steht auch, dass sie verstanden wird, und zwar - jenseits von kulturellen Vorurteilen, die sich in Wirklichkeit nur auf ethnische Aspekte bezieht, und nicht auf die Musik als solche, und auch jenseits von persönlichem Geschmack und Vorlieben - jede Musik und von jedem. Ob es nun eine emotionale Botschaft ist, ein Nachempfinden von rein musikalischen Gestalten, oder das Sprechen einer universellen völkerübergreifenden „Sprache“; Es gibt offenbar eine Art von „Kommunikation“, die einfach verstanden wird (auch wenn Cage dieses bestreitet). Es ist zweifelsohne kein primär rationales Verstehen (Eggebrecht nennt es „Erkennendes Verstehen“), sondern ein sinnliches Wahrnehmungsverstehen, ein „Ästhetisches Verstehen“ (griech: aísthsis = „Wahrnehmung“). Grundsätzlich heißt also „Verstehen“ nach Eggebrecht: „daß die Musik den Hörer affiziert, daß sie von ihm angenommen wird, Einlaß findet in sein Empfinden und Fühlen, den Hörer ergötzt und bewegt“4. Das passiert ganz natürlich, unbewusst und begriffslos. Es ist uns offenbar angeboren, Musik „als Sinngefüge zu erfassen, auch wenn der Sinn unbenannt und der Prozess des Erfassens uns unbewußt bleibt“5. Dieses „Sinngefüge“, von dem Eggebrecht spricht, ist in seinem Verständnis ein Mitvollzug des Geistes von dem Tongebilde innewohnenden Tonbeziehungen, und die vom Geist fassbaren und unterscheidbaren Gebilde (z.b. Motive), die erkannt, wiedererkannt und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Bis zu einem gewissen Grade, argumentiert er, kann man diese Verstehensprozesse mit einer Form von Sprache vergleichen, die jedoch auf einer nicht-begrifflichen Ebene verstanden wird. Das Interessante dabei ist, 4 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 19 5 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 26 8 dass sie nicht „missverstanden“ werden kann. Sie ist wie die Muttersprache (physikalische Erreichbarkeit vorausgesetzt), deren Verständlichkeit man sich einfach nicht entziehen kann. Der Mitvollzug der Sinneinheiten erfolgt automatisch und unabhängig von positiver oder negativer Einstellung zu den Inhalten. Das ästhetische Verstehen ist nach Eggebrecht also geschmacksunabhängig. Deshalb unterscheidet Eggebrecht hier sehr genau das ästhetische Verstehen von der (emotionalen) Reaktion des Hörers auf das Gehörte. Dieser Prozess ist rein subjektiv und individuell, und kann wissenschaftlich auf keinen einheitlichen Nenner gebracht werden (deshalb ist es auch so schwer, Musik zu bewerten, ihr verbindliche qualitative Merkmale zu verleihen; verstanden wird sie immer, aber die Bewertung basiert zwangsläufig auf einer persönlichen Werteinstufung, die vom reinen Verstehen aus immer den Bereich des Geschmacks passiert. Zur Verifizierung kommen dann erst die objektiven Kriterien hinzu, die sich bekanntlich immer für oder gegen etwas ausspielen lassen. Von diesem Manko der Bewertung ist auch der Kritiker oder der Musikwissenschaftler nicht gefeit). Angeboren ist dabei jedoch nur die Fähigkeit, diese Prozesse aufzunehmen. Mit der zunehmenden Hörerfahrung bildet sich ein zusammenhängendes System von „Sinnstiftungen“, in die „das sinnliche Verstehen sich eingewöhnt, einfühlt, einwohnt, einlebt [...], seine Regulative und Definitionen, ins Spiel der musikalischen Sinnstiftungen“6. Eggebrecht nennt das „ästhetische Erfahrung“. Sie ermöglicht uns unter anderem auch die Bestimmung von besonderen Stilmerkmalen einzelner Komponisten oder Epochen (Polyversabilität). Wichtig in diesem Zusammenhang ist noch, dass Eggebrecht davon ausgeht, dass deswegen das „sinnstiftende“ Element in der Musik selbst ist, und nicht im Hörer erst entsteht. Sonst müsste die Allgemeinverbindlichkeit des Verstehensprozesses wieder angezweifelt werden. Verstanden wird also der „Sinn“ der Musik. Der hier etwas sonderlich gebrauchte Begriff von „Sinn“ muss noch kurz erklärt werden, damit keine Missverständnisse entstehen. Er bezieht sich nicht auf einen kausalen Zusammenhang, eine Art von Daseinsbegründung von Musik und sagt auch nichts über die spezifische Aussage von Musik aus. Eggebrecht spricht davon an anderer Stelle unter dem Namen „Bedeutung“. Darauf komme ich später noch zurück. Sinn ist vielmehr nur das System von 6 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 25 . 9 Verbindungen innerhalb der „Sprache“ von Musik, quasi vergleichbar mit einer Syntax, die zum Teil aus den begreifbaren Einheiten, zum Teil aus tradierten Sinnträgern besteht. Solche tradierten Sinnträger gibt es interessanterweise je mehr, je restriktiver eine überlieferte Musik sich von individuellen Einflüssen abschottet. Man denke beispielsweise an die Reichhaltigkeit der Symbole und Seufzerfiguren im Barock zu einer Zeit, in der man aber auch um jede Neuerung schwer ringen musste, da man immerwährend an den damaligen Größen (zum Beispiel Händel und Telemann) gemessen wurde. Hingegen ist es im 20. Jahrhundert fast unmöglich geworden, ein von jedem verstandenes System von symbolischen Figurationen aufzubauen, da die persönliche Freiheit eines jeden komponierenden Individuums und die damit verbundene Vielfalt das nicht zulässt. Die Sinnstiftung geht also von der Musik aus, doch an welcher Stelle steht der Hörer? Eggebrecht gebraucht für diese Aktivität des Nachvollziehens eine schöne Metapher. Er spricht vom „Spiel“. Damit deutet er an, warum wir überhaupt bereit sind, diesen Prozess mitzuvollziehen. Wir „spielen“ ein ästhetisches, sinnliches Wahrnehmungsspiel, „das als Formung sich darbietet und sich zu verstehen gibt durch das Mitspielen des Spiels“7. Die Gehalte, die innerhalb der Musik transportiert werden, können sich nur mitteilen, in dem die musikalische „Sprache“ aufgeschlüsselt wird. An dieser Stelle muss bereits vorweggenommen werden, dass Cage hier ganz anderer Meinung ist. Für ihn hat der Gedanke von Kommunikation keine Bedeutung. Auch für den spielerischen Gedanken im Sinne eines „Mitvollziehens“ ist kein Platz bei ihm. Was er dagegen hält, und wie es bei ihm zu dem andersartigen Verständnis kommt, wird dann im zweiten Teil der Arbeit diskutiert. 7 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 79 . 10 2.2 B ILD UND E MOTION - DIE „B EDEUTUNG“ IN DER M USIK Im vergangenen Kapitel ist von der sich mitteilenden Syntax in der Musik gesprochen worden, die durch ihren sinnlichen Spiel- und Sprachcharakter schon selbst einen Teil der Bedeutung von Musik ausmacht und offenbar darin enthaltene Inhalte transportiert. Wir sind am Punkt angelangt, an dem wir den „Sinn“ von Musik verstehen. Wir spielen ein Spiel. Doch kann das alles sein? Sitzen wir im Konzert, nur um „zu Spielen“ ? Steckt da nicht mehr dahinter? Was ist das für ein trauriges Spiel, das uns die Tränen der Rührung in die Augen treibt, wenn wir der Filmmusik von „Casablanca“ lauschen, während die Schatten auf der Leinwand dazu die existentielle Verzweiflung mimen? Wozu gäbe es die Verbindung von Musik und Film, die sich schon lange als unverzichtbar für die Filmindustrie gezeigt hat, wenn der Film allein die Botschaft tragen würde? Auch im Kontext zur Ästhetik von Cage, die keine transportierten Inhalte kennt und alle sich mitteilende (auch emotionale) Persönlichkeit von Komponist und Interpret auszuschalten versucht, müssen wir die Frage nach dem Transport von Emotionen durch Musik stellen. Der geneigte Leser wird mir deshalb gestatten, mich mit dieser wichtigen Frage etwas gründlicher auseinanderzusetzen. Natürlich weiß jeder Mensch, dass Musik in irgend einer Verbindung mit der Emotion steht. Wie diese Verbindung aussieht, darüber wage ich keine definitive Prognose. Dies ist ein Thema, über das sich die Menschen schon lange (gegenseitig) die Köpfe zerbrechen. Die historische Situation ist folgende: Die vom frühen 19. Jahrhundert ausgehende starke Betonung des Gefühls in der Musik hat einige mächtige Gegner dieser Ansicht auf den Plan gerufen. Der Streitpunkt liegt vor allem darin, ob die Emotion in der Musik begründet liegt oder im Hörer individuell hervorgerufen werden kann, und somit für das Wesen von Musik irrelevant ist. Gegner der Theorie, dass Musik Emotion selbst transportiert, haben die Betonung auf das Gefühl gelegentlich etwas polemisch als „pathologisches Hören“ denunziert, die die Musik auf die „einseitige Reaktion auf das Emotionale [reduziert], die es lediglich als 11 Auslöser subjektiver Gefühlsprojektionen benutzt“8. Der Prominenteste in dieser Beziehung ist vielleicht Eduard Hanslick, Freund von Brahms und mächtiger Musikkritiker seiner Zeit, der, nicht zuletzt in seinem Buch „Vom Musikalisch Schönen“ von 1854, immer wieder gegen diese „außermusikalische“ Verbindung gewettert hat. Er war der Ansicht, dass die Bedeutung von Musik immer nur in sich selbst liege, und es keinerlei beweisbare Verbindung zwischen der Musik und der hervorgerufenen Emotion bestünde. Die Debatte ist dabei aber schon viel älter und dauert auch bis heute an. Ich kann aus Zeitgründen den Fortgang der Debatte nicht beleuchten, das sprengt bei weitem den Rahmen dieser Arbeit. Ich möchte hier nur auf einen Diskurs des britischen Philosophen Malcolm Budd über die Thesen Hanslicks eingehen, der in dem Kapitel „The repudiation of emotion“ („Die Zurückweisung von Emotion“) in seinem Buch „Music and the emotions“9 auf elaborierte Weise versucht, Hanslicks Thesen auf Basis philosophischer Argumentation teilweise zu entkräften. Nach einer langen Abhandlung über das Wesen von Emotion kommt er auf Hanslicks Argumentation zu sprechen. Diese beruht auf drei aufeinander aufbauenden Annahmen: 1. Musik kann keine „Bedeutung“ in Form von Gedanken repräsentieren 2. Benennbare Emotionen (die einzigen, die er zweifelsfrei als Emotionen identifizieren kann), wie Hoffnung, Traurigkeit und Liebe beinhalten jedoch immer Gedanken 3. Also kann Musik keine definitiven Emotionen repräsentieren Hanslick geht dabei davon aus, dass eine Emotion aus nichts Anderem als einem Gedanken verbunden mit einem allgemeinen körperlichen Gefühl von Befriedigung oder Unbehagen besteht, die die „dynamischen Eigenschaften“ von ihm ausmachen, also den inhaltlichen Gedanken in unterschiedlicher Stärke fühlbar machen. Die Emotionen können also nur durch die beinhalteten Gedanken von einander unterschieden werden (weil die Kategorie der Befindlichkeit von Befriedigung und Unbehagen zu allgemein zur Unterscheidung ist, und weil mehrere Gefühle den 8 Sinngemäßes Hanslick-Zitat in Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 79 . 9 Malcolm Budd, Music and the Emotions - The Philosophical Theories, London 1985, S.20-47 . 12 gleichen Grad von Befriedigung oder Unbehagen beinhalten können). Hanslick „erlaubt“ der Musik eine Imitation der dynamischen Eigenschaften von Emotionen, aber keineswegs von anderen Eigenschaften. Die These wird davon gestützt, dass Emotion selbst keine „hörbare“ Qualität besitzt, höchstens die äußerlichen Anzeichen (die in Verbindung mit den dynamischen Parametern stehen) sind hörbar, genauso, wie Emotion keine sichtbare Qualität besitzt, sondern nur über ihre äußerlichen Anzeichen, d.h. den Ausdruck der Emotion (beispielsweise im Gesicht) wahrnehmbar ist. Die Probleme tauchen jedoch weniger am Ende, denn am Anfang der Argumentation auf. Ob es wirklich so ist, dass es Gefühle nur in Verbindung mit zugehörigen Gedanken gibt, den Beweis bleibt er letztendlich schuldig. Beispielsweise gibt es Gefühle, die die schleichende Grenze zu Stimmungen beschreiten, beispielsweise die (von ihm als Emotion anerkannte) Fröhlichkeit. Man kann nicht wirklich beweisen, dass es im Falle von Fröhlichkeit einen Auslösergedanken geben muss. Ähnliche Fälle lassen sich sicherlich bei eingehender Betrachtung noch weitere finden. Somit ist ihm das Argument aus der Hand geschlagen, dass Musik nicht diese speziellen Gefühle ausdrücken könne. Außerdem, wenn Musik die dynamischen Eigenschaften von einer Emotion repräsentieren oder imitieren kann, was Hanslick nicht bestreitet, repräsentiert sie unweigerlich dasjenige Element der Emotion, ohne welches die Erfahrung des Gedankens der spezifischen Emotion nicht „emotional“ wäre!10 So könnte bereits die Erfahrung der dynamischen Parameter der Emotion den Hörer stimulieren, und „belohnen“, nur eben, dass die nicht im Sinne einer spezifischen Emotion definiert werden könnte. Des Weiteren gibt es unbestreitbare Parallelen zwischen harmonischer Spannung und dem Drang nach Auflösung (Konsonanz/Dissonanz) auf der einen Seite, und dem Gefühl von psychischer oder emotionaler Spannung und dem Drang nach seiner Auflösung auf der anderen Seite. Hanslick führt weiter an, dass, selbst wenn Musik Emotionen darstellen könne, die Qualität der Musik nicht auf die emotionale Repräsentation angewiesen wäre. Neben 10 Siehe: Budd, Music and the Emotions - The Philosophical Theories, S. 25 13 anderen Argumenten vokale Musik betreffend gibt er als Beispiel, die Möglichkeit an, dass durch schlechte Interpretation die Schönheit (und infolge dessen der Wert) einer Musik zerstört werden könne, ohne dass die Richtigkeit der Repräsentation einer angeblichen Emotion berührt sei. Doch das widerlegt nicht die Existenz einer solchen Repräsentation von Gefühlen durch Musik. Und andersherum, durch schlechte Repräsentation von Gefühlen muss nicht die Schönheit (oder der Wert) von Musik beeinträchtigt sein. Beide Parameter, Schönheit/Wert und Emotion sind unabhängig von einander. Auf der anderen Seite bestreitet er nicht, dass Musik Emotionen im Hörer hervorrufen kann, er bestreitet lediglich, dass sie für die Betrachtung von Musik relevant oder überhaupt angemessen sei, da sie nicht innerhalb der Musik beweisbar ist. Er führt an, dass Musik vom Typen des emotionalen Hörers oft für emotionale Höhenflüge „missbraucht“ wird, während der „musikalische“ Hörer die wahren Qualitäten im strukturellen Entwicklungsgeschehen suche. Nun, dies ist eine Argumentation, die stark auf das musikalische Wesen des 18. Jahrhunderts schielt (vielleicht noch mit begrenzter Ausweitung auf Bach). Eine große Palette musikalischer Erscheinungsformen vor 1600 und nach ca 1850 n. Chr. legen dagegen kein besonderes Augenmerk auf ihre immanente Struktur und verstehen sich primär als Träger von Inhalten. Dies ist so breit anerkannt, dass ich nicht glaube, es anhand einzelner Beispiele beweisen zu müssen. Dieses Musikverständnis wird bei Hanslick nicht in angemessener Weise berücksichtigt. Diese Argumentation erbringt somit nicht den Beweis der Allgemeingültigkeit und sollte mit Vorsicht genossen werden, besonders, weil das (bei Adorno wiederkehrende) Element des strukturellen Hörens bei vielen Menschen gar nicht wirklich entwickelt ist. Die meisten Menschen wären damit vom „korrekten“ Musikverstehen ausgeschlossen. Budd seinerseits behauptet gar nicht, dass Emotionen in Musik enthalten seien. Er führt selbst folgende Beweisführung dagegen an: Emotionen rufen unweigerlich körperliche Reaktionen hervor. Als Beispiel nennt er die „Unruhe“, da die äußerliche Reaktion daran besonders plastisch darzulegen ist. Unruhe ruft „unruhige“ Bewegungen hervor; allerhand Bewegungen sind zu beobachten, die sich ohne echten Grund wiederholen, nervös zucken, mitunter hastig sind, nicht fähig, still zu stehen. Diese Bewegung kann zweifelsfrei erkennbar in Musik imitiert werden. Stakkato-Passagen, Triller, starke Betonungen, Beschleunigungen, Schüttelbewegungen, 14 immerwährende feingliedrige Bewegung, unmotivierte Sprünge, und vieles mehr. Diese Entsprechungen kann man akzeptieren. Damit stehen die musikalischen Mittel für die äußerlichen (körperlichen) Anzeichen eines mentalen Zustandes und könnten ihn bedeuten, da er mit seinen äußerlichen Anzeichen gleichgesetzt wird. Doch hier entsteht nach seiner Ansicht ein unbemerkter Paradigmenwechsel: Die Musik klingt so, wie der Körper sich anfühlt. So stellt die Musik in diesem Fall lediglich mittelbar körperliche Anzeichen, nicht aber den mentalen Zustand akkurat dar. Mentale Zustände können nicht direkt von Musik dargestellt werden, nur die körperlichen Anzeichen werden nachgeahmt. So fehlt bereits an zwei Stellen die beweisbare direkte Entsprechung. Budd übersieht allerdings in aller Spitzfindigkeit philosophischer Argumentation hier, dass der Wille, also die Intention eines Komponisten zur Entsprechung sehr wohl da sein kann, wenn sie auch nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar erfolgen kann. Ihre Existenz ist nicht widerlegt. Wenn die Entsprechungen nicht missverstanden oder anderweitig fehlgeleitet wird, kann die Entsprechung über die Mittelbarkeit hinweg erfolgen. Die Emotion würde in diesem Fall symbolisch in der Musik vorhanden sein wenn gewollt. Die hier ausführlich behandelten „äußerlichen Anzeichen“ können ohne weiteres mit der Bezeichnung „Ausdruck/Expression“ gleichgesetzt werden. Es stellt sich also die Frage: Kann Musik Emotion „ausdrücken?“ Der symbolische Akt einer Entsprechung tritt dort an die Stelle eines direkten Transportes. Es stellt sich die Frage, ob Beides gleichgesetzt werden kann. Eggebrechts Position in „Musik verstehen“ dazu ist nicht zweifelsfrei zu erkennen, wobei jedoch auffällt, dass er ebenfalls eine sehr negative Einstellung gegenüber dem Typus des emotionalen Hörers zu erkennen gibt. Und er holt sich zu diesem Zwecke mächtige Verbündete heran. „Das Subjekt, das die Musik ästhetisch versteht, bringt seine Subjektivität in der Weise ins Spiel, daß es auf das ästhetischVerstandene reagiert. Dieses Reagieren wird durch die Musik ausgelöst, hat jedoch im Rahmen dieser Auslösung und Bezogenheit [...] einen unendlichen Spielraum an Möglichkeiten.“11 Eggebrecht bezieht sich damit eindeutig auf Hanslicks Trennung von Musik und Emotion. Des weiteren unterscheidet er die 11 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 42 . 15 Begriffe „Empfinden“ und „Fühlen“. Das Zweite ist dabei der Auslöser von Ersterem. Es ist ein Sinneseindruck, der von der „Empfindung auch den emotionalen Gehalt des Reizes [registriert] und leitet ihn weiter an das Gefühl, das auf die vom Objekt ausgehende emotionale Seite der Reizempfindung subjektiv reagiert“12. Hier spricht er allerdings plötzlich vom “emotionalen Gehalt des Reizes“ (ich habe den betreffenden Ausdruck unterstrichen), und ein paar Zeilen weiter unten vom „ihm innewohnenden emotionalen Element [...], das [...] in unserem subjektiven Gefühlsbereich ein Gefühl erzeugt“. Darauf basiert seine Argumentation, dass das „Empfinden“ vom Sinneseindruck her kommt, und demnach direkt objektgebunden (von der Musik kommend) ist, während das „Gefühl“ subjektive Reaktion darauf ist. Was nun aber der genaue Unterschied zwischen einem „emotionalen Element“ und einem „Gefühl“ ist, die Erklärung bleibt er schuldig, insbesondere weil er den Terminus „Emotion“ ein paar Zeilen später mit „Gefühlswert“13 übersetzt und verwirrenderweise von der „Gefühlsempfindung“ als subjektive Reaktion des Hörers spricht (was seiner eigenen Definition von „Empfindung“ widerspricht). Er führt aus, dass „sich die Empfindung mit dem Gefühl [berührt] und gelangt mit ihm zur Deckung, weshalb im Sprachgebrauch beide Begriffe austauschbar sind“. Gefühl und das aus der Musik kommende „emotionale Element“ sind demnach Eggebrecht zufolge deckungsgleich. Man muss sich fragen, weshalb solches Aufhebens gemacht wird um den feinen Unterschied zweier Begriffe, die letztendlich doch einen identischen Inhalt haben. Diese Deckungsgleichheit würde überdies Hanslick das Argument aus der Hand schlagen, dass die subjektive Reaktion ohne jede Relevanz für die Bedeutung der Musik (oder ihre „Schönheit“) ist. Auf Seite 75 ff. wendet sich Eggebrecht gegen den Typus des ausgeprägt emotionalen Hörers, der „die Definitionsprozesse des musikalischen Sinns“ übertönend, primär die „Gefühlsbotschaft“ als „Stimulanz der eigenen Gefühlswelt benutzt“. Im Folgenden gibt er der „Form“, also dem System von Sinnstiftungen eindeutig das Primat gegenüber den „Gehalten“ von denen er die Emotion als die Wichtigste nennt. Zur Verstärkung zitiert er Immanuel Kant aus seiner „Kritik der Urteilskraft“ (§51 und 53). Ich möchte 12 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 73 . 13 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 74 . 16 im Folgenden die Textstelle (S. 76) als Ganzes abdrucken: Abb. 1: Eggebrecht, Musik verstehen, S. 76 Eggebrecht deutet Kants Ausdruck von „Form“ in Z. 9 im Sinne seines Begriffes von „Formsinn“ (siehe Z. 5 und 18). Das ist, so wie er Kant zitiert, jedoch nicht im Sinne des Verfassers interpretiert, der von „Form der Zusammensetzung dieser Empfindungen“ spricht, die gegenüber der Einzelemotion den Vorrang habe. Demnach beinhaltet die ganze Stelle eine Fehlinterpretation Kants und bleibt in der Beweisführung nicht schlüssig. Schon eher in seinem Sinne ist folgendes Hegel-Zitat: (b.w.) 17 Abb. 2: Eggebrecht, Musik verstehen, S. 77 Hegel sagt hier sinngemäß, dass die emotionale Lautäußerung erst durch Stilisierung (kadenzale Interjektion) zur Kunst wird. Hegel gibt der „Form“ im Sinne Eggebrechts in diesem Fall ebenfalls den Vorzug, jedoch ausdrücklich als Darstellung von Emotion. Beide Philosophen sprechen von Musik als einer Sprache des „Gefühls“ oder „Gemüts“ oder der „Affekte“ (was hier gleichzusetzen ist), dessen bevorzugter Untersuchung Hegel im folgenden Zitat (S. 77/78) aber auch wegen ihrer „inhaltslosen Subjektivität“ eindeutig eine Absage erteilt. Damit erhebt er die Form der Darstellung von Emotionen zum eigentlich künstlerischen Element in der Kunst. Der schärfste Gegner des emotionalen Hörers erweist sich jedoch Th. W. Adorno im Zitat seiner Abhandlung über „Typen Musikalischen Verhaltens“ dessen Argumentation sich jedoch an Hanslick anlehnt, und deshalb hier nicht noch gesondert diskutiert wird. Über dieses Thema ließe sich sicher noch eine getrennte Staatsarbeit schreiben, ich muss jedoch, um den Rahmen nicht zu sprengen, vor den Augen des ermüdeten Lesers jetzt die Diskussion abbrechen. Es gibt im Bereich der „Bedeutung von Musik“ natürlich noch andere Inhalte, beispielsweise die sogenannten außermusikalischen Inhalte wie bildliche Symbole und Naturlautnachahmungen, die im folgenden Kapitel behandelt werden. 18 2.3 M USIK ALS R EIZGEBILDE - K LANGFARBEN , A BBILDLICHKEIT UND AUßERMUSIKALISCHE INHALTE Entgegen Johannes Brahms und Eduard Hanslick bildete sich Mitte des 19. Jahrhunderts um Franz Liszt die sogenannte Gruppe der „Neudeutschen Fortschrittler“14, die gegenüber dem traditionellen Modell des vorrangigen „Sinngebildes“ der musikalischen Abbildlichkeit den Vorzug geben. Damit gemeint waren Bilder und Symbole der gegenständlichen Welt oder aber der persönlichen inneren Welt des Komponisten, seinen Ängsten und Leidenschaften, die mittels bestmöglicher Nachahmung in die Musik importiert wurden. Eggebrecht nennt hier als Möglichkeiten malerische, idiomatische, emotionale, assoziative und gestische Abbildetypen. Als Beispiele gibt er Naturnachahmungen, sozial und geschichtlich geprägte und traditionsgestiftete Abbilder wie Märsche, Tanz-, oder Signalidiome (u.a.) und außerdem anthropologisch begründete Abbildtypen, beispielsweise das Seufzermotiv oder Aufschrei und Verstummen an. Der Unterschied zum traditionellen Verständnis, wo der „Sinn“ innerhalb eines ausschließlich musikimmanenten Beziehungsgebildes als Definition sich bildet, liegt der Sinn beim Abbild durch das Symbolhafte schon vor und wird lediglich „wiedererkannt“. Es braucht nicht „musikalisch definiert“ zu werden (muss aber laut Hegel erst „künstlerisch zubereitet“ werden, um als Musik wahrgenommen zu werden; siehe voriges Kapitel). Ein anfänglicher Meilenstein in diese Richtung bildete sicherlich die allseits bekannte Sinfonie Fantastique von Hector Berlioz aus dem Jahre 1830. Das Modell der Sinfonie wurde von den Komponisten um Liszt jedoch von der Sinfonischen Dichtung weitestgehend abgelöst, die durch ihre Anlagen dem Ideal des „Sinfonischen Klanggemäldes“15 mehr entgegenkam. In der Neuen Musik des 20. Jahrhunderts, wo dem Hörer das Verstehen des traditionellen Sinnverstehens (angesichts der sehr individuellen und komplexen 14 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 71 . 15 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 71 . 19 Klangsprache) oft sichtlich schwerfällt, rät Eggebrecht dem ratlosen Hörer als ein erstes Hilfsmittel die Beachtung der abbildlichen Vorgänge an. Genommen ist dem Hörer durch das Durchstoßen der Tonalitätsgrenze durch Schönberg nicht nur ein allgemeinverbindliches System von Stinnstiftungen, sondern auch ein ebenso allgemeinverständliches Bedeutungs- und Ausdruckssystem16. Das „tonale Haus ist abgerissen“ metaphoriert Eggebrecht treffend. Abbilder sind weiterhin möglich, werden aber nicht mehr im gewachsenen traditionellen System kodiert. Ab nun ist jedes komponierende Subjekt (nach Schönberg durch weitere Radikalisierung noch zunehmend) mit seinem eigenen, selbstgewählten System alleingelassen. Die musikalische Sprache wird zunehmend subjektiver. Doch wo bleibt der arme Hörer? Er steht vor den Trümmern des gleichen „Hauses“ und hat außerdem das Problem, dass es nicht das seine ist. Er muss sich im individualisierten, neuen System des einzelnen Werkes zurechtfinden. Der Hörer benötigt, schreibt Eggebrecht, „die Kultivierung der ästhetischen Erfahrung gegenüber dem Neuartigen“17. Das ist zugegebenermaßen nicht leicht und benötigt häufig eine Erklärung des Komponisten für eine Chance des vollen Verständnisses der Komposition. Diese Form der „Beiheft-Erklärung“ ist uns jedoch schon seit Berlioz geläufig. Jegliche subjektive Gedankenwelt, jede „Erzählung“ in Musik, braucht eine Erklärung, will man sie im Sinne des Komponisten verstehen. Schönberg setzt das im Kern im 19. Jahrhundert angelegte Expressionsdenken weiter fort und steigert es bis zum Extrem. Das musikalische Geschehen in der Kunstmusik der 20er Jahre heißt demnach konsequenterweise „Expressionismus“. Die Expression benötigt neben der Abbildlichkeit und der Klangfarbe nicht die Tonalität, um wirksam und verständlich zu sein18. Sie konstituiert sich aus „Idiome[n] assoziativer, emotionaler, gebärdischer Art“ - und kann deshalb als Abbild vom Hörer erkannt werden. Auf die Situation im 20. Jahrhundert werde ich jedoch in einem späteren Kapitel noch ausführliches eingehen. Ich will hier noch den Gedanken der „Reizästhetik“ kurz beleuchten. 16 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 91 ff. 17 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 110. 18 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 95 . 20 Jegliche Musik besteht aus akustischen Reizen, die durch ihre Wahrnehmung „Erregungen auslösen und Empfindungen [...] verursachen“19. So wie das Abbild benötigt der Reiz als Erlebnis keine musikalische Sinndefinition, der Sinn liegt in der unmittelbaren sinnlichen Wirkung, schreibt Eggebrecht. Jeder Reiz hat einen in sich selbst vordefinierten Charakter, der auf seine eigene Art „verstanden“ wird. Ein wichtiges Beispiel der Idee vom Reiz ist die Klangfarbe, wie sie besonders augenfällig im sogenannten musikalischen „Impressionismus“ kultiviert wurde. Zu erwähnen ist im Zusammenhang mit dem Impressionismus allerdings die verwirrende Tatsache, dass dort die Klangfarbe der Musik nicht ausschließlich von der Klangfarbe des einzelnen Tones abhängt, sondern auch von der Verwendung eines ausgeklügelten, speziellen harmonischen Systems, was die schöne klare Trennung zwischen der Tonalität als sinnstiftendes Ordnungssystem auf der einen Seite, und dem Reiz als unmittelbare sinnliche Wirkung auf der anderen Seite zumindest teilweise wieder in Frage stellt. Besonders deutlich wird das in der impressionistischen Klaviermusik, beispielsweise Debussys, denn die eigentliche Klangfarbe des Klaviers ist bei Debussy objektiv nicht wesentlich von derjenigen der Klassik unterscheidbar. Das ändert sich erst mit dem Erscheinen Cages in den 30er Jahren und gehört nicht in den Zusammenhang mit dem Impressionismus. Der Klangfarbe kommt unter anderem die Bedeutung als Charakterträger und Ausdruckswert zu. Eggebrecht zählt die Klangfarbe zu den „peripheren“ Toneigenschaften, da sie kein reguliertes, skalenartiges Ordnungssystem als Grundlage haben, was einen gegebenen Wert als relativen Bezugswert dazu definieren würde, und das Ganze somit ein schlüssiges Sinngefüge, ähnlich wie das der Tonalität, bilden würde. Nun, bei genauer Betrachtung gibt es sicherlich Tendenzen zwischen Extremen wie espressivo und dolce, dunkel, und hell, zart und stark. Ob sie aber systematisch genug sind, um sinnstiftend zu sein, muss dahingestellt bleiben. Schönberg allerdings ist da ganz anderer Meinung, wie wir noch im Kapitel 3 sehen werden. In diesem Zusammenhang zeichnen sich allerdings genaugenommen wieder Unklarheiten zwischen Klangfarbe als Reiz und Tonalität ab. Die tonalitätsbezogenen Parameter Dur (hart) und Moll (weich) sind nämlich ebenfalls eigentlich 19 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 64 . 21 Klangfarbendefinitionen. Man kann jedoch nicht auf alle Ungenauigkeiten eingehen. Es gibt immer Schlupflöcher Ausnahmen und Generalisierungen im Auffindungsprozess von Prinzipien. Lassen wir Eggebrechts Aussagen deshalb im Großen und Ganzen ihre Gültigkeit. Auch auf Klangfarbenreize reagiert das Subjekt auf eine „genießerische“, imaginative Art20, ohne einen „objektivierten“ Verstehensanspruch im traditionellen Sinne zu erheben, schreibt Eggebrecht. Infolge meiner Argumentation bei der Frage um die Emotion im vorigen Kapitel, die uns vor die gleiche Situation stellt, muss ich allerdings hier wiederum aus den gleichen Gründen Bedenken erheben. Wenn die sinnliche Reaktion des Subjekts wiederum deckungsgleich mit dem Farbwert des ausgehenden sinnlichen Reizes ist - wozu sich Eggebrecht diesmal jedoch nicht distinktiv äußert - so muss sie auch als objektiv gelten (s. Gefühl vs. emotionales Element in Kapitel 2.2). Die Bedeutung, die dem Reizgeschehen zukommt ist kann trotz der feinen Unterscheidung, ob sie subjektiv oder objektiv ist, unangefochten als wichtig eingestuft werden. Reiz und Abbild bleiben in einigen Stilrichtungen am Anfang des 20. Jahrhunderts wichtige Parameter auf der Suche nach Ersatz der allgemeinen Sinnstiftung der Tonalität. In musikalischen Formen außerhalb der „Kunstmusik“, beispielsweise in der Filmmusik, spielt sie auch bis heute noch eine zentrale Rolle. 2.4 W ERKIDENTITÄT Die Frage nach der Identität eines Werkes ist eine sehr wichtige im Zusammenhang mit Cage. Sie beleuchtet einerseits, wie abgeschlossen ein Werk für sich allein steht, und andererseits - noch interessanter im Zusammenhang mit Cage - wie es mit der Wiedererkennbarkeit, der Identifikation eines Werkes bestellt ist. Die Identität macht die Wiedererkennbarkeit des Werkes trotz der individuellen Interpretationsunterschiede aus, Eggebrecht nennt sie die „Zeichnung“ eines Stückes. Grob gesagt ist die Zeichnung das, was der Komponist niederschreibt. Eggebrecht unterscheidet zu recht hier sehr 20 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 67 . 22 genau von dem „Dasein“ des Werkes. Denn allein das Niedergeschriebene „lebt“ noch nicht als tönende Musik. Erst das individuelle, persönliche Spiel des (oder der) Interpreten erweckt das Leben des Werkes und erhebt das trockene theoretische Konstrukt zum genießbaren Erlebnis. Die Persönlichkeit des Interpreten kann ein Werk jedoch auch sehr unterschiedlicherscheinen lassen, im Extremfall bis zur Entstellung. Diese Verwirklichung des Werks als Klang nennt Eggebrecht das „Dasein“ des Werkes. Es subsumiert allerdings im Gegensatz zur Zeichnung eher die „Verschiedenheit“ eines Werkes mit sich selbst, das heißt, die Einmaligkeit seines Daseins in jeder einzelnen Aufführung. Ein Spezialfall ist allerdings die Wiedergabe einer Aufführung vom Tonträger. Die Einmaligkeit des Augenblicks ist hier außer Kraft gesetzt, wird reproduzierbar. Das hat den Vorteil, dass die schönsten, gelungensten Momente erhalten bleiben, man kann sie das nächste Mal wieder in voller „Einmaligkeit“ genießen und sich völlig darin einleben. Andererseits wird die „konservierte Einmaligkeit“ allmählich zur Wiederholung, die nach einiger Zeit abgeschmackt und fahl werden kann. Der „Kick“ ist weg. Viele Hörer greifen als Konsequenz zum Lautstärkeregler; doch auch das hilft nur begrenzt. Hier zeigt sich, das der Mensch zum neuen, frischen Erlebnis eine gewisse Variation braucht. Sie gibt dem gleichen Stück neue Lebendigkeit. Ein Werk bestimmt sich aber darüber hinaus seine Identität noch durch sein Verhältnis zum Geist der Zeit: Es arbeitet mit den Stilmitteln der Zeit, in der es entstand. Gleichzeitig bringt fast jedes Stück durch seine Individualität der Komposition kleine Neuerungen, die wiederum den Stil bereichern. Jede Komposition „altert“ irgendwann, denn der Geist der Zeit ändert sich kontinuierlich. Die Komposition gehört dann an ihren geschichtlichen Ort. Die Komposition ist in ihren - nun historischen - Stil einordbar. Die Stilfrage ist deshalb so wichtig, weil im traditionellen Notentext nicht alles fixierbar ist. Viele tradierte Spielkonventionen ergänzen den skizzenhaften Notentext und ersetzen auch viele komplizierte Sonderzeichen, die jedesmal vom Komponisten neu definiert werden müssten. Das macht es aber auch so schwierig, ein Werk in seiner historischen Gestalt neu zu rekonstruieren, wenn die Traditionslinien einmal abgerissen sind, wie am Beispiel des Barock - und vorher - zu erkennen ist. Eggebrecht erwähnt im Hinblick auf die sogenannte „Historische Aufführungspraxis“, 23 das es nicht ohne Schwierigkeit ist, dem heutigen Hörer ein (selbst wenn auch perfektes) Klangkonstrukt einer vergangenen Zeit zu präsentieren21. In der hitzigen Debatte um das Für und Wieder wird nämlich oft der Hörer ganz vergessen. Das mit allen Kontexten vergangenen Kunstverständnisses und tradierten Stilbedeutungen (z.b. musikalisch-rhetorischen Figuren) vergangener Jahrhunderte behaftete Werk trifft nämlich auf meist unbedarfte Ohren, die die Botschaften oft gar nicht entschlüsseln können, da Kunstverständnis und auch Weltsicht eine andere geworden sind. Ob aber andererseits eine moderne Interpretation einem alten Werk in den Ohren des Hörers mehr gerecht wird, bleibt ebenso fraglich. Bei der Neuartigkeit einer Musiksprache, wie die von John Cage (besonders in seiner mittleren und späten Schaffensphase) kann der Komponist nur sehr eingeschränkt auf solche Konventionen zurückgreifen. Deswegen ist eine große Vielfalt von Sonderzeichen entstanden, die sich mit zunehmender Mehrdeutigkeit der Kompositionen bis hin zu einer graphischen Notation entwickelte, die dem Betrachter eher an ein Bild erinnert, als an die Fixierung von Musik. Berühmt geworden ist in diesem Zusammenhang das Improvisationsstück December 1952 von Earle Brown, einem Freund von John Cage: Abb. 3: Earle Brown: December 1952 aus: Dahlhaus, „Die Musik des 20. Jahrhunderts“, Handbuch der Musikwissenschaft 7 S. 336. 21 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 56/57 . 24 Die Identität des „Werkes“ hat mit allen genannten Faktoren zu tun, und spaltet sich dort in eine verwirrende Vielfalt auf. Noch viel größer ist die Vielfalt eines einzigen Werkes jedoch dort, wo es eigentlich hingehört: In jedem einzelnen Hörer, der ihr durch seine eigene Persönlichkeit und Disposition ihren eigenen, ganz individuellen Sinn verleiht. Dort hören jedoch die Kategorien der Wissenschaft auf und fängt die Musik an als das zu wirken, was sie ist: Als KUNST . 2.5 E RKENNENDES V ERSTEHEN Zurückgehend auf die im vorigen Kapitel erwähnten Probleme des unbedarfteren Hörers im Verstehen der musikalisch-rhetorischen Figuren, insbesondere des Barock22, ist als Erklärung wichtig, dass die natürlich in größerem Masse auf die intellektuelle Seite des Verstehens zielt, die Eggebrecht „erkennendes Verstehen“ nennt. Dazu gehören Zahlensymbole (häufig bei J.S. Bach zu finden), wichtige Motivtypen wie etwa das „Suspirato“ (Seufzerfigur), oder der „Lamento Bass“, auch „Passus Duriuskulus“ genannt (absteigende Basslinie, ein Leidensmotiv im religiösen Sinne) und unzählige mehr, aber auch verschiedenste Abbilder-typen, die im Stil-geschehen ihrer Zeit häufig gebraucht wurden und den Hörern gut vertraut waren. Viele Figuren vermitteln ihre Bedeutung nur reflektiv, auf der Basis des begrifflichen Wissens23. Wir wollen uns deshalb die Verstehensprozesse des erkennenden Verstehens und die wichtigsten Gründe anschauen, warum das „erkennende Verstehen“ neben dem „ästhetischen Verstehen“ eine so wichtige Rolle spielt. Während das ästhetische Verstehen das „begriffslose Verstehen“ darstellt, ist das erkennende Verstehen das „begriffshafte Verstehen“. Das ästhetische Verstehen arbeitet 22 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 67/68 . 23 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 68 . 25 auf begriffsloser Ebene bereits ebenfalls „erkennend“, zum Beispiel in der Verarbeitung und dem Wiedererkennen von Motiven und Themen. Das begriffshafte Verstehen filtert ebenfalls zusammengehörige Tonfolgen aus dem Gehörten und kann sie durch Wiedererkennen und Einordnen intellektuell verarbeiten. Man kann sie nun benennen, mit Worten beschreiben und vergleichen. In der Folge wird das Analysieren und ÜberMusik-Sprechen, und auch das Bewerten von Musik möglich. So hängt fast der gesamte Bereich musikalischer Bildung, die gesamte Forschung innerhalb der Musikwissenschaft und nicht zuletzt die Musiktheorie (das Verstehen seiner Machart und Stilmittel einschließlich der Effekte) vom erkennenden Verstehen ab. Davon ausgenommen ist dabei aber das bloße Wiedererkennen von Musik (-stücken), das fast nur begriffslos abläuft. So wichtig das erkennende Verstehen ist, es bleibt „gegenüber dem Dasein der Musik immer sekundär, begrenzt und uneigentlich“24. Doch es erlaubt das Fragen nach der objektiven Aussage eines Werkes. Besonders im Zusammenhang mit vokaler Musik kann es die häufig besonders konkrete Aussage durch Analyse von Abbildlkichkeit, Struktur, Zahlensymbolik und besondere Hervorhebung von Wörtern oder Textstellen in Hinblick auf den Worttext unterstützen. Besonders Zahlensymbolik erschließt sich selten allein durch das Ohr. Die raffinierten verborgenen Geheimnisse bringt oft erst die Analyse der Partitur zutage. So hilft sie zur stilistischen Standortbestimmung und Einordnung in einen spezifischen Kontext. Auch kann mittels Analyse (die ja auf dem erkennenden Verstehen aufbaut) die Schlüssigkeit beispielsweise einer Werkstruktur untersucht werden und möglicherweise vermitteln, warum ein Werk so wirkt, wie es wirkt. Eggebrecht wirbt auf der anderen Seite um Verständnis darum, dass viele, insbesondre junge Hörer sich dem erkennenden Verstehen verweigern, aus Angst, den emotionalen Zugang durch das Wissen zu unterhöhlen und abgeschmackt werden zu lassen. Durch das kritisch Fragende nach Struktur, Aussage und Beziehung zum stilistischen Umfeld wird die subjektive Öffnung des ästhetischen Verstehens zur Musik hin eingeschränkt, objektiviert und nicht selten gestört. Die Problematik solle man ernst nehmen, und die ästhetische Identifikation nur so stark wie unbedingt nötig helfend unterstützen. So 24 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 120. 26 kann eine Bewusstseinserweiterung für kaum oder gar nicht beachtete Erscheinungen stattfinden, ohne zur aufdringlichen Bevormundung zu werden. Aus leider häufig gegebenem Anlass muss davor gewarnt werden, jemals die helfende Rolle der Analyse zum selbstdarstellerischen Selbstzweck emporkommen zu lassen, der in keinem Falle hilfreich ist, und oft eher einen negativen, abschreckenden Effekt hat. Fa zit Ich habe bis jetzt versucht, einen kurzen Überblick über einige zentrale Aspekte im traditionellen europäischen Musikverständnis zu liefern, und habe es mir doch nicht nehmen lassen, dabei auch hier und da einen kritischen Blick auf alle mir vorliegenden Informationen zu werfen und hier und dort zu vergleichen, und so wird mir der geneigte Leser verzeihen, wenn sogar meine persönliche Ansicht sich an einigen Stellen - gut gekennzeichnet - darin widerspiegelt. Einige Aspekte sind dabei allgemein wichtig in Hinblick auf die Thematik, andere sind besonders interessant im Hinblick auf den kommenden Hauptteil der Arbeit und haben so ihren Weg in den Überblick gefunden. 27 3. K URZE Z USAMMENFASSUNG DER SITUATION IN DER ERSTEN H ÄLFTE DES 20.JAHRHUNDERTS Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zeichneten sich bereits große Veränderungen in der Musikwelt ab. Die Musik war bereits hoch komplex geworden und die Tonalität ausgereizt. Der Impressionismus hatte die Tonalität bereits erweitert und sie in seinen dunstigen Schleier gehüllt. Die Richtungen gingen spätestens am Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich auseinander. Einige Komponisten hielten weiterhin am alten, spätromantischen Stil fest, beispielsweise Rachmaninow, oder Strauss, der jedoch in Salome und Elektra zwischenzeitlich ebenfalls bis an die Grenzen der Tonalität ging, aber danach mit dem Rosenkavalier zur traditionellen, leichter verständlichen Musik des vorigen Jahrhunderts zurückkehrte. Er war als „Star“ der deutschen Oper zu sehr dem Publikum verpflichtet. Andere griffen die modernen rhythmischen Tendenzen auf und suchten die „Ur-kräfte“ einer vorzeitlichen, rituellen Musik, wie Strawinsky in seinem Le sacre du printemps, das bei der Uraufführung 1913 einen Skandal provozierte. Die Komponisten des „Futurismus“ um Prattella und Russolo integrierten die immer mehr den Alltag bestimmende Industrialisierung mit ihrem Maschinenlärm in ihre Musik25, manche mit großem Enthusiasmus. In diesem Zusammenhang symbolisch geworden ist Honneggers Pacific 231, einer schweren amerikanischen Dampflokomotive. Vor allem im Balkan integrierten Komponisten wie Bartok und Kodaly folkloristische Einflüsse in ihre Musik. Nach einigen Vorstudien durchbrach Schönberg, dicht gefolgt von Skrjabin, erstmals 1909 im Klavierstück op. 11,1 die Tonalität endgültig. Schönberg steht symbolisch für die größten Neuerungen der Zeit. Er ersetzt die Tonalität durch eine „Klangfarbenmelodie“, die mit jedem Ton wechselt und Melodie, Harmonik und Rhythmik durch ein eigenes Ordnungssystem von Helligkeit, Dichte und Abfolge entgegenstellt (und steht damit ganz im Gegensatz zu dem, was die traditionelle Auffassung der Klangfarbe zutraut, siehe Kapitel 2.3). Er steigert das expressive Element der Musik bis zum 25 DTV Atlas zur Musik 2, hrsg. von Ulrich Michels, Kassel 1997, S. 519 28 Extrem (beispielsweise in „Das Buch der hängenden Gärten“ 1808/09 und „Pierrot lunaire“ von 1912) und begründet damit die kurze Periode des Expressionismus mit. Die „Neue Musik“ bis 1920 litt aber nach der Aufkündigung aller traditioneller Strukturen an Strukturmangel und extremer Kürze. Es muss aber betont werden, dass trotz der Aufkündigung der Tonalität viele andere Parameter der Musik immer noch ihre Gültigkeit hatten. Die Musik als Sprache und Ausdruckssystem blieb bei Schönberg immer erhalten. Hinzu zur Atonalität trat die „Emanzipation der Dissonanz“. Schönberg wollte erreichen, dass der Hörer den komplexeren Schwingungsverhältnissen dissonanter Intervalle einen gleichwertigen Platz neben den konsonanten Intervallen einräumte (statt sie als auflösungsbedürftige Spannung zu empfinden). Damit wollte er die traditionelle Geschmacksbildung, die zu sehr an alten Mustern der Zentrumsbildung hing, ersetzen. In den 20er Jahren entwickelte Schönberg dann an Stelle der alten, natürlich gewachsenen Ordnung der Tonalität eine künstliche, die berühmte „Zwölftontechnik“. Der bereits in der Einleitung erwähnte Drang nach zusätzlicher Kontrolle des Komponisten über das Klangmaterial führte zur Zunahme der Determinierung, und zwar nicht auf Grund von konventionierten Stilbedeutungen, sondern dem Komponisten direkt unterworfen, und mit einer neuen mathematischen Systematik. Das Gesetz der Zwölftonreihe war, dass jeder einzelne Ton der Reihe erst wiedererscheinen konnte, nachdem alle anderen Töne einmal erschienen waren. Alle 12 Halbtöne unseres europäischen Tonsystems waren enthalten. Die nötigen Variationsmöglichkeiten wurden durch Umkehrformen (Umkehrung, Krebs, Spiegel, usw.) erreicht. Die Reihe war dabei in der Behandlung eine Art Thema, oder Melodie, die begleitenden Stimmen waren in ihrer Ausführung zunächst nicht so strengen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass gleichzeitig mit der Entwicklung ganz neuer Formen um Schönberg herum, mit Igor Stravinsky ab den 20er Jahren eine Rückbesinnung auf klassische Formen im sogenannten „Neoklassizismus“ stattfand. Damit einher ging eine „Anti-Ausdrucks-Ästhetik“26 gepaart mit klassischem Formideal. Sie wurde jedoch bewusst tonal verfremdet. Auch hier vorherrschend war der Drang 26 DTV Atlas zur Musik 2, S. 531 29 nach Determination. Stravinsky: „je mehr die Kunst kontrolliert, begrenzt und gearbeitet ist, um so freier ist sie“27. Die Forderung hinter dieser Musik war, mehr zu einer bodenständigen, objektiveren „Alltagsmusik“ zurückzukehren, weg von Gefühl, Subjektivität und Ornament. Ihr fehlt aber, entgegen, der „echten“ Klassik die lyrische „Unschuld“ und Weltenharmonie und so wirkt sie oft kühl und distanziert28. Verzerrung und Ironie ersetzten gepaart mit Bi-Tonalität häufig traditionellen Ausdruck und das Bemühen um tiefen, sich mitteilenden Ausdruck. Sinnbild dafür ist u.a. Charles Ives in den USA geworden. Auch der Jazz machte sich in vielen Kompositionen, insbesondere in den USA bemerkbar. George Gershwin, Charles Ives und Aaron Copland sind (unterschiedlich stark) davon beeinflusst. Der frische, rhythmisch betonte, aber auch in der Harmonik reizvolle Musikstil mit seinem hohen Improvisationsanteil reizte viele Komponisten, bis hin nach Russland zu Schostakowitsch. Im Zuge der sogenannten „Seriellen Bewegung“ in den 50er Jahren wurden zunehmend auch andere Parameter der Musik seriell, das heißt in geplanten Reihensystemen, durchorganisiert. Die Stufe der Determinierung nahm zu. Durch simultane Verwendung mehrerer Reihenstrukturen wurde das wahrnehmbare, hörbare Klangbild zunehmend punktuell. Zusammenhänge wurden immer schwieriger hörend zu erkennen, obgleich perfekt durchrationalisiert. Hörbare und komponierte Struktur drifteten zunehmend auseinander. Die fortschreitende elektrotechnische Entwicklung eröffnete ganz neuen Klangwelten. Die elektronische Musik ab etwa 1948 kennt zwei grundsätzliche Klangerzeugungsmethoden. Einerseits die Verfremdung und Verzerrung natürlich erzeugter Klänge und Geräusche (Sinnbild für die „Musique concrète“ um P. Schaeffer und P. Henry), andererseits die elektronische Generierung völlig neuer Klänge (die eigentliche „Elektronische Musik“ um Stockhausen und Edgar Varèse). Neben der (gemäßigten) „Neuen Musik“ hat vor allem die avantgardistische Musik des 20. Jahrhunderts, von den Anfängen bis heute, auch eine Geschichte der Exklusivität und Elitenbildung wie nie zuvor. Hervorgerufen durch die starke Ablehnung im breiten Publikum angesichts des Ausmaßes und der Geschwindigkeit der ästhetischen 27 DTV Atlas zur Musik 2, S. 531 28 DTV Atlas zur Musik 2, S. 533 30 Veränderungen, und nur verehrt und unterstützt von einer kleinen Gemeinde von Erneuerern, Intellektuellen und Kunstgönnern, zog sie sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück in kleine private Veranstaltungen und exklusive Festivals29. Neben einigen fortschrittlichen Universitäten griff allenfalls der Rundfunk in seinem Selbstverständnis als Kulturträger die avantgardistische Musik auf und protegierte sie immer wieder mit spektakulären Konzertmittschnitten, erklärenden Sendereihen und technischer Ausstattung. Ich bin meinerseits der Ansicht, dass nicht nur die Schnelligkeit der Entwicklung und die große Vielfalt der Stile dafür verantwortlich war, dass große Teile, vor allem der avantgardistischen Musik bis heute in der breiten Öffentlichkeit so wenig Fuß gefasst hat, sondern auch gerade die Entsubjektivierung, Intellektualisierung und Komplexität der Struktur und Musiksprache. Musik teilt sich vielfach nur noch mit Hilfe verbaler Erklärungen wirklich mit und verliert damit ihren (fast) rein ästhetischen Charakter. Manchmal ist an die Stelle der ästhetischen Botschaft die reine Vorstellung eines Kompositionsprinzips getreten, oftmals mit dem Ziel, den Hörer zu einem neuartigen Hörverständnis oder sogar zur Änderung seines Selbstverständnisses im Bezug auf seine gesamte Selbst- und Umgebungswahrnehmung zu erziehen. Wir werden im Bezug auf Cage unbedingt auf diesen Punkt zurückkommen müssen. So tritt die Bedeutung gänzlich hinter der Form zurück. Aber natürlich muss betont werden, dass dieses nicht für alle in diesen Kontext einbezogene komponierte Musik gilt. Der DTV-Atlas sieht ebenfalls ein erneuertes Selbstverständnis von Musik: „Die alten ästhet. Gestaltungsprinzipien der Musik als einer der schönen Künste werden z.T. radikal geleugnet. Musik muß nicht mehr unbedingt schön oder harmonisch sein, sondern vor allem wahr, also auch häßlich. Ziel ist nicht die Erbauung, sondern die Erschütterung des Menschen[...]“30 Diese Feststellung halte ich persönlich für eine der wichtigsten und in ihren Konsequenzen am weitreichsten greifenden. Die Musik hat im 20. Jahrhundert ihre traditionelle Rolle verlassen und neues Gebiet betreten. Offenbar können und wollen ihr viele Menschen zur Zeit nicht dorthin folgen. Dies gilt auch für Teile der Hörer der 29 DTV Atlas zur Musik 2, S. 547 30 DTV Atlas zur Musik 2, S. 521 31 sogenannten „E-Musik“, die sich hauptsächlich auf die Musik vergangener Jahrhunderte beschränken. Davon ist ebenfalls die Musikerziehung betroffen. Die Heranführung junger Menschen an speziell avantgardistische Musik mit ihren neuen Konzepten ist kaum rudimentär angelegt. Damit greift die Konfrontation dieser Musik mit einem voll ausgebildetem traditionellen Musikverständnis natürlich meist ins Leere. Auf diese Probleme stößt Cage mit seinen neuen Konzepten und seiner neuen Musiksprache selbstverständlich auch. Doch seine Reaktion darauf ist eine ganz Spezielle. 32 4. C AGES E NTWICKLUNG HIN ZU EINER NEUEN IDEE VON M USIK Ich habe hier in dieser Arbeit darauf verzichtet, die Biographie von Cage darzustellen. Sie ist gut dokumentiert und überall nachzulesen. Für empfehlenswert halte ich die Cage-Biographie von David Revill mit dem Titel „Tosende Stille“31, auf die ich mich im Laufe meiner nächsten Kapitel oft beziehen werde. Sie bietet eine ihm wohlgesonnene, aber nicht unkritische Betrachtung von Cages Leben mit einigen Sonderkapiteln, die näher auf einige wenige zentrale Aspekte in Cages Schaffen eingehen. Selbstverständlich wird aber auch auf eine Vielzahl anderer Quellen, nicht zuletzt von Cage selbst, eingegangen. Ich möchte an Stelle der Biographie einige Charaktereigenschaften, Umstände und Zeitpunkte herausheben, von denen ich (auf Basis des Biographen) glaube, dass sich daran Richtungsentscheidungen in Cages Leben ablesen lassen und somit das Klangphänomen sowie die dahinterstehende Kunstphilosophie zumindest teilweise erklären. Meine These ist, dass nicht in erster Linie äußere Begleitumstände, wie etwa bestimmte Richtungsentwicklungen der Zeit für Cages Entwicklung eines neuen Musikverständnisses die Hauptgrundlage bilden (obwohl er sicherlich auch von verschiedensten Einflüssen profitiert hat), sondern vielmehr zum großen Teil auf eine bestimmte Entwicklung seiner Biographie und seine Persönlichkeit zurückzuführen sind. Dabei ist selbst-verständlich Vorsicht in der Interpretation geboten, jedoch Cage hat sich selbst meist dazu geäußert, so dass die Schlüsse auf keinen Fall aus der Luft gegriffen sind. Ich werde in der Betrachtung über einige Schlüsselaspekte von Cages Musik - in Themengebiete gegliedert - Jeden mehr oder minder einzeln besprechen. Nicht immer einfach ist dabei die saubere Trennung der Aspekte voneinander, da sie oft eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig erklären. Aus Gründen der Systematik werde ich dennoch versuchen, sie getrennt voneinander zu behandeln. 31 David Revill, Tosende Stille - Eine John-Cage-Biographie, Deutsche Ausgabe, München 1995 33 Doch zunächst möchte ich vom Hörerlebnis ausgehen, die auffälligsten Merkmale der Musik ansprechen, und anschließend auf die einzelnen Kapitel weiterverweisen. Wenn man sich Cages Music of Changes von 1951 anhört, fällt als erstes die (scheinbare?) Zusammenhangslosigkeit der Töne auf. Der Hörer steht vor einem Fluss an Tönen, die scheinbar ziellos, mal dichtgedrängt, mal tröpfelnd, auf den Hörer zuströmen. Sie werden weder von einer zusammenhaltenden Tonalität gebunden, die die Töne nach ihrer akkordischen Zugehörigkeit bündeln und von einander abgrenzen würde, noch ist eine Strukturierung des Klangbildes nach zusammenhängenden Linien oder Akkordstrukturen zu erkennen. Die Strukturierung des Klangbildes nach „oben“ und „unten“ gelingt gar nicht, da kein Ton dem anderen in irgendeiner logischen Reihenfolge zu folgen scheint und so weder Bass-Linien noch Diskant-Melodien, ja nicht einmal geschlossene Klangflächen in Erscheinung treten. Es gibt keinerlei Bewegung „zu irgendwas hin“, oder „von irgendwas weg“. Die Dynamik ist in ihrer Gesamtheit nicht auszumachen, da sich ständig laute und leise Klänge abwechseln und sogar überschichten. Die Musik macht einen sehr punktuellen Eindruck, die kurzen Töne scheinen zu überwiegen (das dieser Eindruck zum Teil trügerisch ist, werde ich noch im Zusammenhang mit der zugrundeliegenden Aleatorik ansprechen). Auch Großstrukturen im traditionellen, bedeutungstragenden Sinne sind nicht auszumachen, obwohl sich Teile durch Pausen voneinander absetzen. Nicht einmal die Rhythmik schafft irgendeine Art von Struktur, obwohl doch sie normalerweise eine der augenfälligsten strukturbildenden Elemente ist. Es ist sogar nicht ganz unproblematisch, von „Rhythmik“ überhaupt zu sprechen, denn es gibt keinerlei erkennbare regelmäßige Zeiteinheiten, die eine Art von Struktur oder gar ein durchgehendes Tempo erkennen lassen. Kurz, es gibt keinerlei Kontur, keine konventionellen Elemente, an denen sich der aufs Sortieren, Katalogisieren, Orientieren, Einfühlen und Wiedererkennen geschulte Geist festhalten kann. Der ratlose Hörer, gewohnt, eine mitvollziehbare, mit Inhalten gespickte Botschaft zu empfangen, begegnet einem „Kauderwelsch“ an Klangereignissen, das er wohl aufnehmen, aber nicht verarbeiten kann. So bleibt die erhoffte „Botschaft“ aus. Aus welchem Grund auch immer teilen sich keine Inhalte mit. Man fragt sich, aus welchem Grund die Klangereignisse überhaupt stattfinden, möchte man 34 als Zuhörer doch Teil haben an Gedanken und Gefühlen des Komponisten oder des Interpreten, reich geschmückte Figurationen oder ausdrucksstarke Klänge mitempfinden. Keine Spannung und Entspannung nimmt den Hörer in Anspruch, obwohl es an Dissonanzen objektiv gesehen nicht mangelt. Nein, auch kein mitreißender Schwung „fährt in die Beine“. Nun, jeder Typ hört anders, manche mögen auf synästhetische Farben warten, andere, wie bei einer Geschichte, durch ein labyrinthisches Konstrukt schlüssig und zwingend zu einem bestimmten Finale geführt werden. Alles das bleibt aus. Mancher traditionell geschulte Hörer gibt hier auf und „schaltet ab“. Vielleicht gibt es noch einen einzigen Trost. Was man da hört, ist zweifelsohne ein Klavier, und der Interpret spielt (offenbar wahrheitsgetreu) aus Noten, also hat man doch noch eine Sicherheit: Man hört gerade „Musik“. Doch diese Sicherheit ist einem beim Anhören der Aufnahme der Variations I von 1958 auch noch genommen. Es beginnt mit klassischer Musik aus einem Radio, welches von einem barbarischen Knall, mit Splittern und Bersten von Material durchbrochen wird. Mehr Knallgeräusche folgen, die Radiosender wechseln. Ab und zu hört man Klaviergeräusche, wenige konventionell erzeugte Töne, auf den Saiten wird gezupft und gekratzt. Klopfen und Schlagen auf alle Teile des Instrumentes. Man hört lächerliche Pfeiftöne, offenbar produziert von Kinderspielzeug. Nicht zu überhören: Das Publikum. Von Anfang an Lachen, anfangs gemischt mit ärgerlichem Zischen, was bald verebbt, aber auch immer Rascheln, Knacken und alle bekannten Geräusche, die ein Publikum normalerweise macht. Die Geräusche überwiegen quantitativ die „Töne“ und folgen offenbar keinerlei Ordnung. Zwar ist das einzelne Klangereignis in seiner Herkunft nachvollziehbar: Mit wenig Erfahrung lassen sich allein vom Klangereignis her beinahe alle Geräusche einigermaßen mühelos in ihrer Erzeugung erklären. Die Vielzahl der Geräusche erinnert manchen möglicherweise an ein Hörspiel. Man hört eine „Situation“. Nur der übergeordnete „Sinn“ davon wird nicht klar. Die Wahl des verwendeten „Instrumentariums“ scheint keiner logischen Ordnung zu folgen. Zudem sind alle in der Music of Changes erwähnten Beobachtungen auch hier gültig. Man fragt sich: Was soll das alles? Wenn man sich dieser Kunst nähern will, so muss man vieles Altbekannte über Bord werfen, und den Begriff Musik ganz neu definieren. Da Cages Lebensweg eine 35 Entwicklung darstellt, die ihn immer mehr von dem „normalen“ Zuhörer trennt, macht es Sinn, wenigstens teilweise chronologisch im Sinne seines Lebenslaufes vorzugehen. Cage war anlagebedingt neugierig auf Neues und Unbekanntes. Der erste Abschnitt (4.1) beschäftigt sich demnach erst einmal mit Cages Charakter und seiner Grundeinstellung zur Musik in ihrer tonalen Gestalt und der Rolle seines Schaffens dazu. Schon früh experimentierte er mit Geräuschen. Er wollte auch den nicht-etablierten Klängen ein „Tor“ zur Musik öffnen. Demnach wollen wir uns im Kapitel 4.2 mit den Geräuschen beschäftigen und bereits zu dem vordringen, was er später dann mit dem Begriff „Allklang“ verband. Hier her gehört thematisch (wenn auch nicht chronologisch) die wichtige Idee der Stille. Die Isolation und Zusammenhangslosigkeit der Töne, bzw. die Zerstörung aller Tonbeziehungen wird näher beleuchtet, und was damit erreicht werden soll. Hier treten sicherlich die radikalsten Neuerungen im Klangbild auf. Cage hatte mit allem, was traditionell strukturbildend wirkte, so seine Probleme. Schon im Kapitel 4.2 werden wir über Tonhöhenorganisation und Tonalität gesprochen haben und im Kapitel 4.3 möchte ich mich dann der Struktur im Allgemeinen und der Rolle der Zeit darin widmen. Wir werden auf die Begriffe „Moment“ bzw. „Momentform“ zu sprechen kommen. Cage hatte mit seiner experimentellen Musik in den 30er und 40er Jahren schon früh wenig Erfolg beim Publikum. Er merkte, dass die Hörer scheinbar seine musikalische „Sprache“ nicht verstanden und mit Unverständnis auf seinen persönlichen Ausdruck reagierten. Seine sehr eigene Antwort darauf ist der Rückzug seiner Persönlichkeit aus seiner Musik. Damit zusammen hängt seine Beschäftigung mit fernöstlicher Philosophie in den späten 40er und Anfang der 50er Jahren, erst der Indiens, dann des Japanischen Zen. Im Themenkomplex 4.4 werde ich also auf diese Aspekte eingehen und seine Auffassung von Zen und die musikalischen Konsequenzen mit anderen Ansichten über Zen vergleichen. Mit der Zerstörung von allen Leidenschaften in der Musik und die Rolle des Klangs im Produzierenden und im Rezipienten werden essentielle Fragen musikalischer Ästhetik aufgegriffen. Aus dieser Beschäftigung mit Zen ergeben sich weitere Konsequenzen. Cage hat sein musikalisches Bild in den 50er Jahren ganz umdefiniert und völlig neue Anforderungen 36 an den Hörer gestellt. Seine linksradikale „anti-politische“, anarchistische Einstellung in bezug auf die Gesellschaft, die er auf seine Musik übertragen hat, wird uns in Kapitel 4.5 beschäftigen u. a. unter dem Stichwort „Offenheit für alles“, die Idee von „Musik und Leben“ wird angesprochen. Aus seiner veränderten Einstellung zum Hören von Musik und seiner Beschäftigung mit anderen Künsten resultieren veränderte Darstellungsformen. Das sehr von traditionellen Vorstellungen differierende Bild des „Konzertes“ mit seiner Einbeziehung der Zuhörer und dem Prinzip der Simultanität wird uns hier im Kapitel 4.6 beschäftigen, wie auch seine persönliche Auffassung von Notation. Dem wichtigen Aspekt Aleatorik bzw. Indetermination werden wir uns am Ende in Kapitel 4.7 zuwenden. Wir werden dann in Kapitel 5 noch einmal auf die Variations I und Music of Changes (Buch I) zurückkommen und beispielhaft daran untersuchen, ob und in welcher Form der Zufall hier wirklich eine Rolle spielt, welche weiteren wichtigen Eigenschaften am deutlichsten zu erkennen sind, und was das im Zusammenhang zu bedeuten hat. Am Schluss dessen stehen wir sicherlich vor einem rauchenden „Trümmerhaufen“ musikalischer Konventionen. Ich werde in Kapitel 6 eine kurze Reflexion darüber wagen, ob dieser Trümmerhaufen den Namen „Musik“ noch verdient, und wie sich Cage dazu selbst äußert und werde die Arbeit damit abschließen. 4.1 C AGES P ERSÖNLICHKEIT - N EUGIER AUF U NBEKANNTES UND DER E NTSCHLUSS, EINEN EIGENEN W EG ZU BESCHREITEN Am Anfang meiner Betrachtungen möchte ich mich mit Cages Einstellung zu Musik und seinen persönlichkeitsbezogenen Anlagen beschäftigen. Meine Ansicht ist, dass neben den Schlüsselerlebnissen, die ich in den folgenden Teilkapiteln versuchen werde darzustellen, und selbstverständlich auch Vorbildern und gesellschaftlichen Einflüssen, die vermutlich in dieser Arbeit etwas zu kurz kommen werden, immer ein Stückweit 37 seine Persönlichkeit die Voraussetzungen für die Richtungsentscheidungen seiner Ästhetik verantwortlich sind. Geboren ist Cage am 5. September 1912 in Los Angeles. Dabei ist nicht ganz unwichtig, dass er der Sohn des innovativen Erfinders John Milton Cage war, der selbst „nicht nur Praktiker, sondern auch ein Visionär“32 war und u.a. das erste Wechselstromradio baute, sich mit elektromagnetischen Feldern und der U-boottechnik befasste. Sein Sohn John jnr. hat wohl den selben Hang zum Pragmatismus und zum Visionären geerbt. Sein Lehrer Schönberg hat einmal über Cage gesagt: “Natürlich ist er kein Komponist, sondern ein Erfinder - ein genialer Erfinder“33. Meine Interpretation dessen führt dahin, dass Cage mehr nach außen als nach innen, mehr auf „Vision und Aktion“ als auf „Reflexion und Emotion“34 gerichtet war. Er hat sich mit der Emotion notgedrungen vielfach befasst und sich in Gesprächen oft darüber äußern müssen, warum er sie zunehmend aus seiner Musik verbannt hat. Seine Begründung war immer, Töne hätten keine Emotionen, lediglich Menschen hätten Welche. Davon wird aber später noch ausführlicher die Rede sein. Wie bereits zu Anfang in der Einleitung erwähnt, war er von einem stetigen, ruhelosen Drang nach Neuerung und Fortschritt besessen. Sobald er etwas geschaffen hatte, warf er sich sofort auf das Nächste, Andere, Neuartige. Sein berühmtes Statement: „Meine Lieblingsmusik ist die Musik, die ich noch nicht gehört habe [...] Ich höre nicht die Musik, die ich schreibe. Ich schreibe, um Musik zu hören, die ich noch nicht gehört habe. So bin ich ich bin am meisten an dem interessiert, was ich noch nicht getan habe. Aber [...] wenn ich an dem interessiert sein muß, was ich getan habe, so bin ich immer an dem zuletzt Geschriebenen interessiert.“35 Ist überall nachzulesen. Sicher hat man als Leser solcher Flaggschiff-Statements (die es bei Cage in größerer Anzahl gibt) immer auch das Gefühl der propagandistischen Übertreibung, jedoch passt sie in diesem Fall ganz gut zu Cages Biographie. 32 Revill, Tosende Stille, S. 32 . 33 Zitat aus Revill, Tosende Stille, S. 68 . 34 Revill, Tosende Stille, S. 24 . 35 Revill, Tosende Stille, S. 25 . 38 Zudem war er mit einer (für seinen Lebensweg essentiellen) Portion Optimismus gesegnet. Revill schreibt: „Mit der Unbekümmertheit seines Handelns geht eine ungewöhnlich einfache und positive Art der Lebensbewältigung einher. [... Cage: ] »Ich habe das Gefühl, daß Optimismus ein natürlicher Zustand des menschlichen Verhaltens ist«“36. Cage war ein guter Schüler. Es wird berichtet, dass er die Abschlussprüfung an seinem College mit der höchsten Punktzahl der Geschichte der Schule abschloss. Es war lange nicht klar, dass Cage die Laufbahn des Komponisten einschlagen würde. Nach dem Collegeabschluss dachte er zuerst an eine kirchliche Karriere, wurde aber von einem Geistlichen, bei dem er vorsprach, abgewiesen und verlor bald das Interesse daran. Er war von Anfang an vielseitig interessiert und begann gleichzeitig mit den ersten Kompositionsversuchen 1930 auch an zu malen und sich für Architektur zu interessieren37. Cage war offenbar nicht mit traditionellen musikalischen Fähigkeiten gesegnet, wie vielerorts zu lesen ist. Insbesondere hatte er keinen Sinn für Harmonik und machte trotzig um die Mitte der 30er Jahre aus dem Mangel eine Tugend „und konzentrierte sich fortan auf die experimentelle „Organisation von Klang“ “38. Rainer Riem zitiert in seinem Artikel mit dem Titel „Noten zu Cage“39 Stockhausen, der einige Zeit mit Cage befreundet war, zu diesem Thema: „Cage ist der verrückteste Kombinationsgeist, der mir begegnet ist; er ist weniger ein Erfinder - als den man ihn gewöhnlich bezeichnet - als ein Finder; er hat zudem jene Gleichgültigkeit allem Bekannten und Erfahrenen gegenüber, die für einen Forscher notwendig ist; ihm fehlt hingegen die unausweichliche klangliche Vorstellungskraft, das Visionäre, das heimsucht“. Revill hebt hervor, dass Cage zwar ein „feinfühliger Spieler“ war, der einen „schönen 36 Revill, Tosende Stille, S. 26 . 37 Musikkonzepte, Sonderband John Cage I, hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Rihm, München 1990, S. 155- 162 . 38 „Die Musik des 20. Jahrhunderts“, Handbuch der Musikwissenschaft 7, hrsg. von Carl Dahlhaus, Laaber 1984, S. 330. 39 „Noten zu Cage“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage I, S. 100. (Siehe Anmerkung 55 ) 39 Anschlag“ und „ein Gefühl für natürlichen Fluss“ hatte, aber „seine Unfähigkeit in bezug auf [andere] traditionelle musikalische Fähigkeiten [feiert]. [Cage:] »Ich kann nicht rein singen« [...] »In Wirklichkeit habe ich keinerlei musikalische Begabung«. William Duckworth gegenüber betonte er, er könne keine Melodien erinnern und behalten; immer komme ein Augenblick, sogar bei den Melodien, die er sehr häufig gehört hat, da er sich nicht mehr daran erinnern könne, was als nächstes kommt. [Cage:] »Alles was in der Musik mit Tonhöhe zusammenhängt, entgeht mir [...] ob ein Ton zu hoch oder zu tief ist, ist für mich wenig ausschlaggebend«“40. Cages Schwierigkeiten mit Schönberg gegen Ende ihrer gemeinsamen Arbeit in den 30er Jahren war zum Teil auch darin begründet, dass er insbesondere kein Gespür und kein Interesse an Harmonik hatte, die für Schönberg eine zentrale strukturbildende Grundlage hatte.41 Ob diese Behauptungen über seine musikalischen Fähigkeiten wiederum in ihrer Radikalität eine Übertreibung sind, ist nicht so wichtig; prinzipiell glaubhaft werden sie schon bei der Betrachtung darüber, wie wenig sich Cage in seinem Schaffen um (die Aussagekräftigkeit einer) Tonhöhenorganisation gekümmert hat. Neben seinem zu Schau getragenen Stolz gegen die ihm angeblich fehlenden Fähigkeiten reagierte er zuweilen bissig gegen die musikalischen Konventionen. Seine Ansicht über den Leitton deutet das an: „Man schreite auf eine Art und Weise fort, die die Präsenz eines Tones voraussetzt, der nicht wirklich präsent ist; dann halte man alle Leute zum Narren, indem man nicht bei diesem Ton landet, sondern ganz woanders. Wer wird zum Narren gehalten? Nicht das Ohr, sondern der Geist“42. Diese Aussage drückt seine (wohlbekannte) Opposition gegen alle Tonbeziehungen aus. Eine sehr außergewöhnliche Ansicht, da die Herstellung von Tonbeziehungen im Hörer meines Wissens eigentlich vorher noch von niemandem in Frage gestellt wurden. Diese Einstellung hängt unter anderem mit seiner veränderten Weltsicht infolge der Beschäftigung mit Zen, ab der Mitte der 40er Jahre zusammen. Mehr dazu in Kapitel 4.4 und 4.5 . 40 Revill, Tosende Stille, S. 41-43 . 41 Revill, Tosende Stille, S. 74 . 42 Revill, Tosende Stille, S. 42 . 40 Eine weitere besondere Charaktereigenschaft ist seine Zähigkeit und das Durchhaltevermögen, mit dem er seine Ziele verfolgte, gegen den Widerstand und die oft niederschmetternde Kritik der Öffentlichkeit, auch beißendem Spott und wüsten Beschimpfungen, und nicht zuletzt auch gegen eine jahrzehntelange Armut und Hunger. Revill schreibt, dass der seit der frühen Jugend angelegte schöpferische Ausdrucksdrang in Cage im Musikschreiben sein Ventil fand. Cage: „Wenn man die Neigung verspürt, etwas zu machen [...] ist Schreiben eine Weise, ohne andere Übung schöpferisch tätig zu sein“43. Nach seinen ersten Kontakten mit moderner Kunst (vor allem in Paris 1931) war er der Meinung, dass man ohne besondere Vorkenntnisse Kunst machen könne. Er hat sich nach seiner Ausbildung bei Schönberg in den frühen 30er Jahren bewusst wenig um die traditionellen Kunstregeln geschert. Ich bin überzeugt davon, dass auch seine Grundeinstellung zu sich und seinen Fähigkeiten durch einen Entschluss in eine bestimmte Richtung gegangen ist, die für seine weitere Entwicklung Vorbedingung war. Cage liebte die Musik schon als Kind. Er spielte gern Grieg und Chopin auf dem Klavier. Aber er ließ sich schnell durch bessere Leistungen anderer und seine angeblich mäßige Singe-Fähigkeit verunsichern, berichtet Revill. Später, mit wachsender Selbstsicherheit entschloss er sich, „jede Unzulänglichkeit eher als Schlüssel zum Erfolg denn als Ursache des Misserfolges zu werten. [Cage:] »Ich hatte nicht das Bedürfnis, meine Mängel zu überwinden [...] Ich versuchte eher, sie zu nutzen, indem ich sie in den Dienst der Erfindung stellte«“44. Wir werden sehen, dass dieser Entschluss für andere Entschlüsse prägend war. Cage hat sich an diesem Leitsatz orientiert, ganz gleich, was andere über ihn sagten. Er hat sich bei Kritik an verschiedenen Stellen zunehmend radikalisiert, anstatt sich anzupassen. Auf besondere Beispiele werde ich u. A. im Zusammenhang mit der „Offenheit für alles“ und dem „Allklang“ zurückkommen. Er ist seinen eigenen Weg konsequent zu Ende gegangen. Er „ist ganz einfach John Cage. Er hat bestimmte anlagebedingte Neigungen, und seine Musik sollte eine bestimmte spirituelle Ausrichtung haben. Er fand seinen existenziellen Ort, eine Weltsicht, die ihn in die Lage versetzte, von seinen angeborenen 43 Revill, Tosende Stille, S. 48 . 44 Revill, Tosende Stille, S. 43 . 41 Gaben und Mängeln Gebrauch zu machen“45. Ulrich Dibelius hat sich in seinem Artikel „Kompositorische Experimente“46 im Abschnitt über John Cage mit der sich selbst extremisierenden Rolle des Avantgardisten befasst. Er kritisiert, dass das „die Bahnen des Gewohnten verlassende“ kompositorische Subjekt nach einiger Zeit in Originalitätszwänge gerät, insbesondere in den unmittelbaren Neuerungen nachfolgenden Werken, um trotz eines sich „aufbrauchenden“ Unternehmungsgeistes sich seinem Ruf der bisherigen Originalität würdig zu erweisen. Der Individualist „muß produzieren, was seinem Ruf entspricht, also partout Ausgefallenes, Überraschendes, Abwegiges ersinnen. Damit „verfällt das Besondere, Herausgehobene der initialen Idee, die den ersten künstlerischen Schub verschaffte [...] dem abstumpfenden Zwang der Serie“. So kritisiert er eine fortschreitende Radikalisierung, oder zumindest eine immerwährende Suche nach Neuem, und damit den möglichen Verlust der Schlüssigkeit einer Ideologie. Das ist natürlich nicht zwangsläufig so, jedoch möglicherweise ein berechtigter Ansatz von Dibelius’ Kritik an Cage. Leider bleibt bei Dibelius auf der anderen Seite eine weitere Präzisierung und Erläuterung seiner Anschuldigungen aus, inwieweit dieses Prinzip seiner Meinung nach wirklich bei Cage greift. Er bleibt sehr allgemein, so dass der Leser des Artikels mit den Behauptungen im Wesentlichen allein gelassen wird. Es gibt noch einige andere Charaktereigenschaften von Cage, die unbedingt Erwähnung finden müssen. Sie gehören jedoch in einen anderen Zusammenhang, und werden deshalb im Laufe der nächsten Kapitel erläutert werden. 45 Revill, Tosende Stille, S. 233. 46 Ulrich Dibelius, Moderne Musik II 1965-85, München 1989, S. 113. 42 4.2 G ERÄUSCHE. D IE ISOLATION DER T ÖNE. A LLKLANG. STILLE Seit seinem Pariser Aufenthalt 1931 bis in die Mitte der 30er Jahre hat Cage innerhalb der Bahnen des traditionellen 12-tönigen Tonsystems mit verschiedenen, u.a. seriellen Verfahren experimentiert. Er erinnert sich nicht daran, vorher je ein besonderes Interesse an Geräuschen gehabt zu haben47. Dann begann er sich für Schlagzeugkompositionen zu interessieren. Cage war nicht der Erste, der Geräusche in seine Kompositionen einbezog. Bereits die Futuristen hatten in ihrer Begeisterung für die technischen Fortschritte der Zeit bereits Maschinengeräusche in ihre Musik einbezogen oder instrumental nachgeahmt. Möglicherweise hat Cage solche Kompositionen gekannt. Er traf George Antheil, der in sein Ballet méchanique Industriegeräusche einbezogen hatte. Cages Bekanntschaft mit Edgar Varése und Henry Cowell und der Besuch von dessen Vorlesungen müssen ebenfalls Anreize in diese Richtung gegeben haben. Cage schrieb 1935 sein erstes Werk („Quartet“) für Schlagzeug als Auftakt einer Serie von Kompositionen für Schlagzeug, dass er in einer eigens gegründeten Schlagzeuggruppe noch bis Mitte der 40er Jahre aufführte. Sie weckten sein weiteres Interesse an Geräuschen. In der „Musik-Szene“ stieß Cage mit seiner sich bereits radikalisierenden Tonsprache zunehmend auf Kritik. Seine interessantesten Befürworter kamen aus meist anderen Kunstsparten, aus bildender Kunst, Theater und vor allem aus dem Ballett, bzw. dem modernen Ausdruckstanz. Sein Freund und späterer Lebensgefährte Merce Cunningham war ein bedeutender Tänzer. In dem Zusammen-hang mit dieser Kunstsparte liegt auch das Erlebnis, welches ihn zum „präparierten Klavier“ führte, eines der bekanntesten Errungenschaften seines Schaffens. Er war wiederum nicht wirklich der Erste, der die traditionelle Klangerzeugung auf dem Klavier um verfremdete Klänge erweiterte. Cage hat Cowells Banshee, das erste Werk mit der direkten Behandlung der Klaviersaiten zur Tonerzeugung, gekannt und sehr geschätzt. Cowell hatte jedoch lediglich mit den Fingern oder einem Stopfei die Saiten zum 47 Revill, Tosende Stille, S. 35 . 43 Schwingen gebracht. Außerdem hat Revill darauf hingewiesen, dass bereits in der Unterhaltungsmusik zu der Zeit die Hämmer oder Saiten des Klaviers mit Materialien bestückt wurden, um andere Instrumente oder Charakteristika, beispielsweise des Cembalos zu imitieren, jedoch nie mit dem Hintergedanken der Schaffung ganz neuer Klänge. Offenbar hat Cage schon seit 1938 mit Saitenmanipulationen am Klavier experimentiert48, jedoch für die Erfindung des präparierten Klaviers ist folgende Anekdote bekannt geworden: Im März 1940 wurde Cage gebeten, bei einer Tanzperformance mit afrikanischer Thematik als Komponist für jemand anders einzuspringen. Er hatte nur eine Woche Zeit und die Bühne war zu klein, um ein Schlagzeugensemble neben der Tanzfläche unterzubringen. Es stand nur ein alter Flügel da, für den Cage nun gezwungen war, etwas zu schreiben. Nach längerer fruchtloser Herumprobiererei kam er auf den Gedanken, die Saiten mit allerlei kleinen Gebrauchsgegenständen zu präparieren, um durch die Raschel- und Scheppergeräusche und die Tonverfremdung möglichst nahe an eine Schlagzeugcharakteristik heranzukommen. Die Klangproduktion wurde außerdem unberechenbarer, was Cage auch gefiel (hier kann vorausgenommen werden, dass das bereits ein stückweit „Indetermination“ ist, die uns später noch beschäftigen wird). So entstand das erste Stück „Baccanale“ auf einem präparierten Klavier. Die Idee wurde eine Zeitlang Cages Markenzeichen. Die Verwendung von Geräuschen ist eine Sache, doch Cage ist in seinem Werk noch einen ideologischen Schritt weitergegangen. Angestoßen worden ist das (Revill zufolge) von Oscar Fischinger, mit dem er in dieser Zeit zusammen einige experimentelle Filmprojekte (und der dazugehörigen experimentellen Musik) durchführte. Revill beschreibt das folgendermaßen: „Eines Tages, mitten in der Arbeit, vertraute Fischinger Cage an: »Alles in der Welt hat seinen eigenen Geist, und dieser Geist wird hörbar, wenn man ihn in Schwingung versetzt.« »Das brachte mich auf Trab«, erinnert sich Cage. »Er setzte mich auf die Fährte der Erkundung der Welt um mich herum, die seither kein Ende gefunden hat mit Schlagen und Strecken, Kratzen und Reiben an allem nur möglichen.« Cages 48 Revill, Tosende Stille, S. 95 . 44 Begeisterung für etwas, was ein anderer als recht wunderliches und folgenloses Ansinnen aufgegeben haben würde, ist wohl nicht nur eine Bestätigung seiner Vorliebe fürs Experiment, sondern auch ein erster Hinweis auf seine Auffassung der spirituellen Dimensionen der Musik - die allerdings ihrem Wesen nach mit der Sinnlichkeit der Alltagswelt verbunden ist. »Ich war kein Spiritist« sagt Cage »aber ich begann alles, was ich sah, zu beklopfen«“49. Cage entwickelte sich in eine Richtung mit dem Ziel dessen, was heute rückblickend „Allklang“ genannt wird. Der „Allklang“ geht davon aus, dass alles in der Welt einen Klang hat, und man sich diesem „Klang“ öffnen und ihn neugierig erkunden soll. Hier wird noch eine ihm sehr eigene Ansicht über Musik deutlich, die ihn sein ganzes Leben auf konsequenteste Weise begleitet hat. Cage geht es offensichtlich nie um geistige Konzepte, oder Beziehungen, die hinter dem Klangereignis stehen, sondern immer nur um die blanke Präsenz (oder Nicht-Präsenz) eines Tones, ohne irgendwelche bedeutungsschwangeren Attribute. Diese verleugnet er auf verbohrteste Art, wo immer er sich über Musik äußert. Diese Ansicht spiegelt sich natürlich unübersehbar in seinem Werk. Dies unterscheidet ihn grundsätzlich von aller traditionellen Musikästhetik (Ich habe das Modell des musikalischen Sinns und der Sprachhaftigkeit von Musik im Kapitel 2.1 beschrieben). So neigen seine Klänge (spätestens ab Mitte der 40er Jahre) zur völligen Zusammenhangslosigkeit. Der MGG beschreibt das (sich auf Konrad Boehmer berufend) folgendermaßen: „Dem Gesamtwerk ist seiner gesamten Struktur nach, das Prinzip der Vermittlung fremd, welches es durch bloße Setzung, Addition von Material, ersetzt hat. Darin schon tendiert es zur Isolation der musikalischen Elemente“50. Seine Vorliebe fürs Experimentelle und sein Nach-außen-Gerichtetsein ließen ihn die geheimnisvolle Anregung Fischingers aufgreifen und bereiteten den Boden für die neue Orientierung, die sich allmählich auch direkt in seiner Musik niederschlagen sollte. Diese neue Wahrnehmung von der Außenwelt interessierte ihn immer mehr und wurde im Laufe der nächsten 10 Jahre zum zentralen Bestandteil seiner Musik. 49 Revill, Tosende Stille, S. 71 . 50 Martin Erdmann, Art. „Cage, John“, in: MGG 2 Personenteil, hrsg. von Ludwig Finscher, Kassel 2000, Sp. 1568. 45 „Musik ist für Cage nicht das Resultat einer künstlichen Zusammensetzung von Tönen, Klängen und Geräuschen, um ihnen künstlerische Bedeutung zu verleihen, sondern die Organisation klanglicher Ereignisse, derart, daß sie als das erscheinen, was sie sind“51, schreibt Eggebrecht dazu. Cage trat vehement für die „Gleichberechtigung“ der Geräusche gegenüber der traditionellen Tonorganisation ein. Er redete deshalb auch nicht gern von „Tönen“, sondern von „Klängen“, wobei die ganze Welt der Geräusche damit einbezogen wurde. Cage: „Ich vertrete nicht den Standpunkt, den westlichen Hörer eine bestimmte Einstellung aufzubürden, sondern sie zu überzeugen, daß es Klänge gibt und daß diese Klänge, was immer sie sind, wert sind, gehört zu werden“52. Gemeint sind neben dem Experimentieren mit der möglichen Anzahl von Klangeigenschaften von Gegenständen auch die Produktion von „natürlichen“ Geräuschen des alltäglichen Lebens. Er wollte den Hörer öffnen für das, was auf ihn zukommt und ihn so verändern. Cage benutzte dazu nahezu alle Gegenstände. Er traf keine Auswahl nach ästhetischen Kriterien. Begünstigt wurde diese Entwicklung jedoch auch von profaneren Dingen wie seiner Armut; er konnte sich in den 40er und 50er Jahren konventionelle Instrumente zum größten Teil gar nicht leisten. So musste er sich mit dem begnügen, was er hatte, und begann, damit zu improvisieren. Das zielt schon hin auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen, die über die reine Musik hinaus auf das Menschenbild zielen. Die noch zu behandelnde „Offenheit für alles“ und die ihm sehr eigene Interpretation von dem Bezug der Musik zum Leben und ist thematisch kaum noch davon zu trennen. Wir werden da nahtlos ansetzen, wo wir hier aufgehört haben. Jedoch muss der Chronologie halber gesagt werden, dass Cages Interesse für Geräusche sehr viel früher noch angelegt ist (nämlich in der zweiten Hälfte der 30er Jahre) als die totale Offenheit/Indetermination, oder die sich daraus entwickelnde philosophische Dimension. Vorerst verband er die Offenheit der Klänge noch mit einer Art rhythmischer Struktur. So vermied Cage Harmonie und Tonhöhenorganisation zugunsten von anderen Parametern, wie beispielsweise der Zeit, auf die ich ebenfalls in einem gesonderten Kapitel zurückkommen werde. 51 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 192. 52 Cage in: Für die Vögel (Deutsche Ausgabe), Berlin 1984, S. 259. 46 Für den Hörer bedeutet das also, dass er sich öffnen muss für eine Welt der gleichberechtigten Klänge. Er muss eine Entdeckungsreise mitgehen, weg vom „künstlichen“ Kunstgebilde und weg von den Tonbeziehungen, hin in eine Welt der ästhetisierten „natürlichen“ Geräusche (hier würde allerdings der Begriff „naturidentisch“ vielleicht besser passen, da die „natürlichen“ Geräusche dennoch künstlich im Konzert erzeugt werden). Der Hörer muss seinen ganzen Werkbegriff umdenken, und ein Stück nicht länger als eine in sich stimmige Einheit sehen, die gedanklich ineinander verwoben ist, sondern als ein Kontinuum aus existierenden Klängen. Es kommt nicht mehr darauf an, einen Ton innerhalb einer bestimmten Ordnung zu anderen Tönen in Beziehung zu setzen, oder Zieltöne vorauszuahnen (ob sie nun kommen oder nicht), sondern die reine Präsenz eines Tones an sich ist „schön“. Obwohl Cage sich im Laufe seines Lebens immer wieder elaboriert philosophisch darüber äußert, ist diese Ästhetik im Grunde viel ursprünglicher, vielleicht könnte man fast sagen „primitiver“ als diejenige früherer Jahrhunderte, da sie keinerlei geistige Verarbeitung der sensuellen Reize beinhaltet. Sie fragt nicht einmal notwendigerweise nach der Herkunft der Geräusche. Vom Geist wird nur verlangt, dass er ohne Urteil oder Einordnung das „Signal“ offen aufnimmt, ohne sich im Vorhinein vor bestimmten Reizen zu verschließen. Diese Einstellung erinnert etwas an die frühgeistige Entwicklung eines Kindes, dass offen staunend die Welt um sich herum aufnimmt, ohne dafür gleich geistige Kategorien mitbekommen zu haben. Dieser naiven Offenheit trauern wir Erwachsenen gelegentlich melancholisch nach. Hier setzt allerdings auch meine eigene Kritik an dieser geistigen Haltung an. Ich glaube, dass es unser natürlich angeborenes Bestreben und unsere unaufhaltsame Entwicklung ist, die auf uns einströmenden Signale nach einiger Zeit einzuordnen, beurteilbar zu machen, und ihnen durch Beziehung zueinander einen Sinn zu verleihen. Allmählich erfolgt die Auswahl und gegebenenfalls auch die Ablehnung von Reizen. Das ist ein grundlegender Bestandteil des Reifeprozesses eines normal begabten Menschen, der sich damit seine Umwelt begreifbar macht. Gelegentlich kann das in der Übertreibung zur geistig einengenden Verkrustung und damit zum verknöcherten Konservatismus führen, den man ja besonders den Gegnern der avantgardistischen Kunst vorwirft; aber wenn man nach den Gründen sucht, weshalb die Kunst von John Cage bei so wenigen Menschen wirklich Akzeptanz findet, so kann 47 man hier möglicherweise einen „Regelverstoß“ Cages gegen die natürliche geistige Ordnungsbildung im Hörer feststellen, die vergeblich nach einer sinngebenden Regel sucht. Cage begründet das mit einer veränderten Weltsicht infolge seiner Beschäftigung mit fernöstlicher Philosophie, auf die wir in Kapitel 4.4 noch zu sprechen kommen werden. Eine Konsequenz daraus ist auch, dass der Hörer zur Passivität verdammt ist. Da jeglicher musikalischer „Sinn“ (im Sinne von Eggebrecht) aus der Musik gebannt ist, bleibt dem „zur konzentrierten Passivität angehaltenen Hörer“53 keine Möglichkeit des Mitvollzugs. Was bleibt, ist das bloße „Anschauen“. Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass der normale Mensch sehr wohl offen für Geräusche aller Art ist, deren Sinn er erkennt. Zur Verdeutlichung muss ich noch einmal auf einen Vergleich zur Filmwelt zurückkommen. Beispielsweise ist es auffällig, wie aufwendig die Nachvertonungen bei den großen Kinoproduktionen gestaltet werden und mit welcher technischen Ausstattung sie wiedergegeben werden, obwohl die Geräusche den Sinn einer Geschichte kaum unterstützen. Klangliche Reize werden sehr wohl genossen, doch der Unterschied zu Cage ist (und das gilt über ihn hinaus für viele avantgardistische Musik die mit Geräuschen arbeitet, beispielsweise die musique concréte), dass die Geräusche zu ihrer Entstehung zuordbar sind und so in ihrem Sinn verstanden werden. Besonders deutlich ist mir das mit der Geschichte des musikalischen (Hör-) Wunderkindes Elias in der Vilsmaier-Produktion Schlafes Bruder54 geworden. Der Film arbeitet (in Übereinstimmung mit dem Thema) sehr viel mit Klangreizen, auch (Umwelt-) Geräuschen, und fordert deren Genuss geradezu heraus; doch der unmittelbare Klang steht immer in Beziehung zu seinem Auslöser und bleibt damit nachvollziehbar. Auch bleiben die Klänge immer in einer Art akustischer „Umgebung“, sie „passen“ quasi zueinander, niemals wird - wie das bei Cage im Zusammenhang mit dem „Zufall“ der Fall ist - der Hörer überrascht und verwirrt durch neuartige, das Umfeld in Frage stellende Klänge. Zur Trennung dieser Klänge von ihrem musikalischen Umfeld hat sich Cage erfreulicherweise auch selbst in „Für die Vögel“ (seinen Gesprächen mit Daniel Charles) geäußert: „Ich weiß in der Tat, daß Watts an mich dachte, als er das schrieb[...] Sein Standpunkt 53 Dahlhaus, „Die Musik des 20. Jahrhunderts“, S. 330. 54 Schlafes Bruder, Regie Joseph Vilsmaier, nach einem Roman von Robert Schneider, Perathon Film 48 zur Musik war, daß Stadtgeräusche nicht herausgelöst und in einen Konzertsaal verpflanzt werden sollten. Die Trennung der Klänge von ihrer Umgebung war, nach seiner Meinung, tödlich. Gut, ich hab nie etwas anderes gefordert! Und es ist mein tiefster Wunsch, daß die Leute letztendlich in ihrer eigenen Umgebung auf Klänge hören. In ihrem natürlichen Raum“55. Cage plädiert hier ebenfalls für eine Rückverpflanzung der Geräusche in ihre umgebungsmäßige Heimat und betrachtet offenbar deren Darstellung in seinen Performances als eine Art Zwischenstufe auf dem Weg zu einer permanent ästhetisierten Wahrnehmung der Umwelt. Das Leben wird zur Kunst. Die atemberaubend zwingende Schlussfolgerung daraus ist allerdings die, dass damit alle Arten von Konzerten und Aufführungen, überflüssig würde. Sie würden nicht gebraucht, weil das „Leben“ bereits die Gesamtheit der erfahrbaren Reize bereitstellt. Außerdem wären sie auch gar nicht möglich, denn außer den natürlichen Publikumsgeräuschen (die ja bei Cage eine wichtige Rolle spielen, wie ich in Kapitel 4.6 noch darstellen werde) wäre jede Art (absichtlicher) Klangerzeugung unnatürlich, weil aus ihrem Umfeld gerissen. Diese Schlussfolgerung führt weiterhin bewundernswert konsequent zu Cages Indetermination. Die Klänge dürfen nicht mehr intentioniert sein, um nicht eine unnatürliche Realität zu kreieren. Meines Erachtens ist Cage jedoch bis zur Schaffung seines „Stillen Stücks“ - heute allgemein bekannt unter dem Titel „4'33“ - in gewisser Weise inkonsequent, denn trotz dem Anspruch der Nicht-Intentionalität der Klänge ist jede Klangproduktion im Moment ihrer Schaffung notwendigerweise intentioniert. Nicht intentioniert ist lediglich die Art der Klänge, und damit ihr geistiger Hintergrund. Und das führt zu Unverständnis beim Hörer, da er in jeder Konzertsituation (richtigerweise!) davon ausgeht, dass die Klänge vom Ausführenden absichtlich hervorgebracht werden, aber den Zusammenhang nicht erkennt. Die letzte Konsequenz ist also bei Cage richtigerweise die Schaffung eines Stückes ohne intentionierte Klänge, d.h. der „intentionierten Stille“, die also nicht als Provokation gedacht ist, als die sie bei ihrer Uraufführung 1952 von Vielen verstanden wurde, sondern die letzte Konsequenz ist, aus einer Kette von Gedanken, die möglicherweise bei Cage ähnlich wie hier dargestellt abgelaufen ist. Cage nennt das Stück die 55 Cage Für die Vögel, S. 124. 49 „Gesamtheit der unintentionierten Klänge“, ich würde sie vielmehr als die „Realität der unintentionierten Klänge“ bezeichnen. Doch was heißt das für den Fortbestand der „reformierten“ Kunst? Schauen wir einmal auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen: Kunst löscht sich hier selbst aus. Es gibt keine absichtlich hervorgebrachte Kunst mehr. Darin wird sie eine Kunst der Isolation. Durch das Fehlen einer absichtlichen (wie auch immer gearteten) kommunikativen Botschaft sind keine Begegnungen zum gemeinsamen Kunsterlebnis mehr nötig (Dieter Schnebel gibt mir in seinem Artikel „Wie ich das schaffe? - Die Verwirklichung von Cages Werk“ recht)56. Jeder genießt einsam „seine eigene Kunst“ seiner eigenen unmittelbaren Umwelt. Fakt ist die totale Individualisierung; ohne Möglichkeit des Teilens eines gemeinsamen künstlerischen Erlebnisses, schon aufgrund der fehlenden gemeinsamen Kriterien, da die Klänge in ihrem „unmittelbaren Sein“ keine vordefinierte oder verabredete Sinngebung haben. Sie ist Ergebnis einer vollständigen Orientierung nach außen, ohne Mitteilung der inneren Welt eines Individuums: Die Kunst als Brückenschlag zwischen den Menschen ist nicht mehr möglich, da dort wieder Beziehungen und Bedeutungen vorausgesetzt werden, die über die reine Präsenz des (Klang-) Ereignisses hinausgehen. Ob das die Kunst ist, die wir im 20. Jahrhundert zur Bewältigung unserer sozialen Problemstellungen brauchten, bleibt meiner Ansicht nach fraglich. 4.3 D ER M OMENT - Z EIT UND Z EITBEGRIFF. STRUKTUR Der Begriff Struktur (und auch Form) ist in Cages Schaffen zunehmend zurückgedrängt worden zugunsten der Methode, die sein Denken ganz und gar eingenommen hat. Konventionelle Strukturen (und Formen) boten sich bei Cage (dem Zeitgeist gemäß) von vornherein nicht an; Tonalität oder Harmonie aufgrund seiner Abneigung dagegen 56 Musikkonzepte, Sonderband John Cage I, München 1990, S.53 . 50 ebenfalls nicht. Was sich aber bei Schlagzeugkompositionen offensichtlich anbot, war die Dimension der Zeit, also eine Struktur durch den Rhythmus. So experimentierte Cage in den 30er Jahren unter anderem eine Zeitlang mit einem Prinzip, das kleine rhythmische Einheiten (Mikrostruktur) proportional auf die Großstruktur übertrug (und andersherum) und nannte es entsprechend „mikro-makrokosmische rhythmische Struktur“57. Diese wird uns aber als Übergangsphänomen nicht weiter beschäftigen. Im weiteren Schaffen ist nach Heinz-Klaus Metzgers Ansicht eine zunehmende „Desorganisation“ der Musik Ausdruck von Cages Abneigung gegen die traditionelle Objektbildung in der Musik, die zu oft in ein erstarrtes Gebilde gegossen sind, was mit dem natürlichen Fluss der Dinge nichts mehr zu tun hat58: „Wohl bezeichnet Cage mit der Zertrümmerung des »obligaten Stils«, dessen Ausbildung die abendländische Musik überhaupt ihre Verbindlichkeit verdankte, mit der aller Objektbildung entgegengesetzten Tendenz seines Komponierens das absolute antitraditionalistische Extrem. Sein Begriff des musikalischen Objekts trifft, was er an der Tradition nicht mehr erträgt: daß die Themen und Gestalten in ihr wie geprägte Gegenstände sind, die man stets wiedererkennt, auch wenn sie an einen anderen Platz gerückt werden, daß das ganze Werk schließlich ein solches Objekt ist, buchstäblich ein Ding, durch jede Aufführung bloß in seiner beharrenden Beschaffenheit wieder repräsentiert [...] Bis vor kurzem hatte der Verlauf der Musikgeschichte ja in der Tat die umgekehrte Tendenz gezeigt: ließ etwa noch Johann Sebastian Bach in seiner Notation fast durchweg Kategorien wie Tempo, Phrasierung, Artikulation, Lautstärke, Akzentuation offen, so daß diese in die Kompetenz der sinngemäßen Interpretation fielen, so hat das Komponieren in der Folgezeit das alles stets zunehmend seiner eigenen Disziplin unterworfen, in strikte Elemente des Kompositorischen es verwandelt, und ist darüber zum Integralen geraten“. 57 Revill, Tosende Stille, S. 83 . 58 Bei meiner Lektüre von Heinz Klaus Metzgers Artikeln bin ich zu der Absicht gelangt, dass man seine Aussagen manchmal mit Vorsicht betrachten muss, da er (wie auch sein Co-Herausgeber des Sonderbandes über Cage, Rainer Riem) im „Eifer des Gefechts“ seiner verteidigenden Argumentation manchmal übers Ziel hinausschießt und sich in unpräzisierte Pauschalaussagen und zuweilen üble Polemik versteigt. Sprachlich gepaart mit einer unnötigen Überbetonung von Fach- und Fremdworten ist die Lektüre zuweilen unerquicklich. Trotzdem sind auch bei ihm interessante Ideen und Sichtweisen zu finden, die eine Beachtung verdienen. Sein Artikel: „John Cage oder die freigelassene Musik“, Musikkonzepte, Sonderband John Cage I, S.53 . 51 Metzger kritisiert hier in der gesamten traditionellen Musik die Bildung von verbindlichen musikalischen Gestalten, die zunehmend in die berechnende Kontrolle des Komponisten geraten. Cage demontiert demnach dieses Konstrukt durch seine absichtliche Desorganisation und Nicht-Objektbildung (die ja mit der bereits beschriebenen Dissoziation der Töne einhergeht) und stellt sie in die Freiheit des Augenblicks. Ob Töne als zusammengehörig erkannt werden ist Sache des Hörers. Cage möchte den Hörer befreien von vordefinierten Sinngebungen, die den Zuhörer auf jeweils eine Interpretation festlegen. Cage selbst hat das in „Empty words“59 folgendermaßen ausgedrückt: „A structure is like a piece of furniture, whereas the process is like the weather. In the case of a table, the beginning and end of the whole and each of its parts are known. In the case of weather, though we notice change in it, we have no clear knowledge of its beginning or ending. At a given moment, we are when we are. The nowmoment. [...] For some time now, I have preferred processes to objects for just this reason: processes do not exclude objects. It doesn’t work the other way round.“ Übersetzung: Eine Struktur ist wie ein Möbelstück, während ein Prozess wie das Wetter beschaffen ist. An einem Tisch sind Anfang und Ende des Ganzen und aller Einzelteile bekannt. Beim Wetter haben wir keine genaue Vorstellung von Anfang und Ende, obgleich wir gewisse Veränderungen wahrnehmen. An einem beliebigen gegebenen Moment sind wir, wenn wir [dort] sind. Im Augenblick. [...] Seit einiger Zeit nun bevorzuge ich Prozesse den Objekten, aus diesem einen Grund: Prozesse können Objekte beinhalten, das ist andersherum aber ausgeschlossen. Nach Cage ist in der Starrheit der Objekte das Wesentliche nicht möglich: der Blick auf den Moment, der den Hörer da „abholt“, wo er ihm begegnet. Objekte sind im Prozess auch möglich, (nach seiner Ansicht) nicht aber Prozesse bei Objekten. Cages Argumentation ist hier jedoch nicht wirklich schlüssig, man denke beispielsweise an die Veränderungsprozesse eines Themas durch konfrontierende Reibung mit einem gegensätzlichen Thema in der Musik des 18. Jahrhunderts. Besonders bei Beethoven werden so Objekte variiert, gedreht und gewendet; im Extremfall bis an die Grenze des Erkennbaren. Dennoch gibt es immer ein Objekt, das von der Aufmerksamkeit 59 Cage: „The future of music“, Empty words, Middletown 1979, S. 178. 52 fokussiert wird. Diese Fokussierung lehnt Cage ab, da sie notwendigerweise eine Selektion mit sich bringt und damit die „Offenheit für Alles“ nicht ermöglicht. Cage wendet sich insbesondere gegen das in traditioneller Musik vorherrschende Prinzip der Prioritätsbildung; besonders derjenigen, der sich die Zeit unterwerfen muss. Sie wird organisiert, strukturiert, betont, in „wichtige“ und „unwichtige“ Zählzeiten eingeteilt, in eine lineares Gerüst gesteckt. „Alle musikalische Form ist nichts anderes als Abhandlung von Prioritätsverhältnissen in der Zeit“(Metzger)60. Cage dagegen setzt (Metzger zufolge) alle Prioritäten außer Kraft und ersetzt sie durch die alle Objekte gleichwertig betrachtende „Reihenfolge“. Als Methode bedient er sich unter anderem der indeterminierten Notation, die wir aber noch in folgenden Kapiteln besprechen werden. Die Hierarchielosigkeit wird in den 40er und 50er Jahren zu einem der Grundprinzipien von Cage, resultierend aus seinen anarchistischen Tendenzen (s. Kapitel 4.5). Eggebrecht zitiert Cage: „Ich interessiere mich für jede Kunst, insofern sie kein in sich Geschlossenes ist, sondern etwas, was aus sich heraus geht, um sich mit allen anderen Dingen gegenseitig zu durchdringen, selbst wenn diese auch zu den Künsten zählen. Dabei wird allen diesen Dingen - jedem einzelnen - gleiches Gewicht zuteil; keines wird als wichtiger angesehen als ein anderes“61. Es ist auffällig, dass „Quantität“ eine größere Rolle spielte als „Qualität“62. Damit ist gemeint, Selektion und Priorität durch Vielfalt zu ersetzen. Etwa kann man in einer Bemerkung von ihm sehen, die er 1930 (in der Zeit vor seinem Unterricht bei Schönberg) über eine (vorübergehende) Liebe für die Zwölftonmusik von Schönberg äußerte, wie Revill es beschrieben hat: “Was Cage an der Zwölftonmusik so reizvoll fand, war, [Cage:] »daß diese zwölf Töne alle gleich wichtig waren, daß keiner davon wichtiger war als ein anderer. Es ergab sich ein Prinzip, das man mit dem eigenen Leben in Beziehung setzen und akzeptieren konnte, während die Prinzipien des Neoklassizismus sich dazu nicht eigneten, sie hatten mit dem eigenen Leben nichts zu tun«“63. Diese, bei Cage oft zu 60 Metzger, „John Cage oder die freigelassene Musik“; Musikkonzepte, Sonderband John Cage I, S. 8/9 . 61 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 185/186 . 62 Siehe: Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 197. 63 Revill, Tosende Stille, S. 56/57 53 findende Beziehung „zum eigenen Leben“ ist ab der Mitte der 50er Jahre überall in seinen Äußerungen zu finden. Zeit hat Cage stark beschäftigt. Er sah sie als eines der fundamentalsten Dinge in der Kunst und im Leben an. Revill beschreibt eine Anekdote, mittels derer er feststellt, wie Cage dazu gekommen ist64: Sein Interesse für Schönberg führte ihn vorerst zu Richard Buhlig, einem Pianisten aus Los Angeles, der sich mit den Kompositionen Schönbergs auseinandergesetzt hatte, und sich schließlich dazu bereiterklärte, Cages Kompositionen zu prüfen und ihm Unterricht zu erteilen. Bei einem der Termine bei Buhlig stand er am verabredeten Tag vor Buhligs Tür - eine halbe Stunde zu früh - „weil ich, wenn ich unterwegs war, mehr aufs Trampen als auf die gewöhnlichen Transportmittel angewiesen war! Also, ich komme an, ich klopfe an seiner Tür, er öffnet und sagt: »Sie sind eine halbe Stunde zu früh. Kommen Sie zur richtigen Zeit wieder.« Nun, ich hatte einige Bücher dabei, die ich der Bücherei zurückgeben mußte. Ich nutzte diese Zeit aus, um das zu erledigen. Ich ging zur Bücherei, gab meine Bücher ab und ging wieder zu seinem Haus. Eine halbe Stunde zu spät! Als er mir das zweite Mal die Tür öffnete, war er außer sich. An diesem Nachmittag hatten wir eine zweistündige Sitzung, er lehnte es ab, meine Arbeit anzusehen und hielt mir nur einen Vortrag über Zeit; über die Wichtigkeit von Zeit nicht nur in der Musik, sondern auch im Leben desjenigen, der sein Leben der Musik widmen will. [...] Seitdem habe ich immer die Zeit als die wesentliche Dimension aller Musik angesehen.“ In wieweit diese Begebenheit wirklich für seine Wahrnehmung für Zeit zentral war, kann ich nicht mit Sicherheit beurteilen, man muss eine solche Bemerkung zumindest ernst nehmen, wenn sie in zwei der wichtigsten Bücher Cages („Silence“ und „Für die Vögel“) vorkommt, und auch bei Revill hervorgehoben wird. Cage sah ihren Gebrauch in der traditionellen, „aus begrenzt zeitlichen Objekten geschaffene Musik mit einem Davor und Danach“65 als falsch an. Er kritisierte, dass sich die Menschen einbildeten, sie könnten die Zeit durch Strukturierung beherrschen. Er 64 Cage, Für die Vögel, S. 75/76 65 Cage, Für die Vögel, S. 97 . 54 wollte die Musik durch Destrukturierung von ihrer Beherrschung und Zerstückelung befreien66. Als ein Mittel dazu benutzte er die Zufallsoperationen. Interessanterweise ist ihm von Leonard Meyer 67 der Vorwurf gemacht worden, dass bei seiner Musik musikalische Zeit überhaupt gemieden wird, und so eine „Stasis“ (eine statische Musik) entstehe. Cage hat diesen Vorwurf nicht entkräftet. Er spricht vielmehr davon, die „Linearität der Zeit zu brechen“68. Die Nicht-Linearität bewirke, dass sich die Musik türmt, überschichtet und damit selbst „annuliert“. Cage empfand eine große Begeisterung für die Idee, (auch konventionelle) Stücke gleichzeitig aufzuführen. Sein „HPSCHD“ und der Musicircus stehen unter diesem Motto. Er sagte einmal, er habe nichts dagegen, Beethovens Sinfonien aufzuführen - vorausgesetzt, sie würden alle auf einmal aufgeführt. Cage führt an, Tyrannei und Gewalt fielen unter die Linearität, während die Unbestimmtheit ein Sprung in die Nicht-Linearität, und damit in die Freiheit und den „Überfluß“ darstelle. Hier ist interessanterweise wieder zu bemerken, wie er über die Musik hinausweist auf den Menschen und die Gesellschaft. Seine Argumentation ist im Ganzen geprägt von diesen Übertragungen und es wird deutlich, in welcher Rolle er die Musik sieht. Sie steht gerade zu in einer gesellschaftlichen Verantwortung. Ich werde darauf im Kapitel über den Anarchismus noch zurückkommen. Cages Bemerkungen69 entnimmt man, dass seine Musik keine vordefinierte Zeiteinteilung beinhaltet, sondern die Zeit erst im Moment der Aufführung real wird. Sie ist also im Konzept des Stückes gar nicht enthalten. Cage gibt höchstens einen Zeitraum an, der das Ganze umschließt. Es gibt kein „Zeitmaß“. Nichts wird eingeteilt, es gibt keine „Interpretation“ irgend einer Vorgabe. Dafür eignen sich die indeterminierten Notationen, beispielsweise von Variations I, ganz besonders, weil sie keinerlei Ablauf festlegen, zumindest nicht einen in Zeit gemessenen. Der Hörer erlebt seine eigene, persönliche Zeit. Wie er sie erlebt, ist seine Sache. Cage lässt hier wieder seinen 66 Cage, Für die Vögel, S. 38 ff. 67 Cage, Für die Vögel, S. 97 . 68 Cage, Für die Vögel, S. 251. 69 Cage, Für die Vögel, S. 156/157 . 55 Unwillen gegenüber jeglicher Bevormundung des Hörers durch Vorgaben erkennen. Cage befindet sich dort jedoch nicht in Überseinstimmung mit dem Empfinden der Mehrzahl der Hörer. Selbst wenn der Hörer mit einer gegebenen Interpretation eines Stückes nicht einverstanden ist, sie vielleicht schneller oder langsamer bevorzugen würde, so stellt er in der Regel damit nicht das Prinzip der eingeteilten Zeit generell in Frage (außerdem wären genaugenommen auch Cages Stücke vor solcher Kritik nicht gefeit, nur eben nicht in Verbindung mit einem durchgehenden Zeitmaß, sondern mit einer generellen Klanghäufigkeit). Im Gegenteil, das Mitempfinden eines Zeitmaßes gehört zu den schönen Eigenschaften der Musik. Damit ist das Gefühl von Schwung verbunden, was durchaus erlebbar ist und auch genossen wird. Auf deren Verbindlichkeit gründet sich beispielsweise die ganze Tanzmusik. Die Probleme Cages mit den Eigenschaften traditioneller Musik sind an dieser Stelle nicht ganz nachvollziehbar. Möglicherweise hängt das mit dem zusammen, was wir Europäer gelegentlich mit dem etwas überzogenen Freiheitsbedürfnis der Amerikaner verbinden. Ulrich Dibelius formuliert Cages Umgang mit Zeit folgendermaßen: „Musik oder, auf der Cage’schen Reduktionsstufe, Hören - soll dazu verhelfen, Gegenwart zu erfahren, ohne sich um das Vergangene zu kümmern oder Zukünftiges zu erwarten. Und solches Akzeptieren von Sein und Zeit, vermittelt durch akustische sowie, begleitend, auch visuelle Wahrnehmung, entspricht der grundlegenden Definition von Musik als Zeitkunst“70. Dibelius legt in seiner Interpretation die Betonung auf die Ablehnung der Erwartungshaltung (worüber wir ja schon gesprochen hatten). Cage setzt demnach hier einen Trend fort, der aber schon länger in der Musik des 20. Jahrhunderts angelegt ist, die Ent-Teleologisierung. Man versucht, Erwartungshaltungen des Hörers zu enttäuschen und abzubauen, um sich aus alten Strukturen zu lösen und den Weg für Neues freizumachen. Für den Hörer bedeutet dies, dass er seinen festen Werkbegriff mit seinen abgeschlossenen Abschnitten und seinen überschaubaren, wiedererkennbaren Gestalten ganz aufgeben muss. In Cages Musik gibt es nichts wiederzuerkennen und nichts von „oben herab“ zu überschauen, sondern vielmehr ein sich vom unmittelbaren 70 Dibelius, Kompositorische Experimente, S. 103. 56 Geschehen „einhüllen lassen“ und zeitloses Schauen auf das, was auditiv (und auch visuell) vorüberzieht. Somit ist keinerlei wirkliche Kontrolle über das Geschehen möglich, weder vom Komponisten, noch vom Interpreten, und schon gar nicht vom Hörer. Man treibt im Augenblick, von Moment zu Moment, und ist dazu angehalten, alles für sich, also vergleichs- und kritiklos aufzunehmen. Ein Vorausahnen und (vergleichendes) Zurück-schauen ist nicht möglich, weil sich keine Kontur zum Greifen anbietet. Besonders das „Erkennende Verstehen“ (s. Kapitel 2.5) ist betroffen, es ist fast völlig ausgeschaltet, weil es völlig auf Kontur und Gedächtnis, auf Messung und Vergleich angewiesen ist. Cages Musik versteht sich nicht als abgeschlossene Sinneinheit, sondern als ein sichtbarer Teil, ein Art zufälliger Ausschnitt, aus einem Klangkontinuum, was den Menschen eigentlich schon von jeher ständig umgeben hat, er es aber anders, nämlich ästhetisch wahrnehmen soll. Die dort verlebte Zeit ist keine vorher geplante, strukturierte „Kunst-Zeit“, sondern nur ein Ausschnitt der sowieso vorüberziehenden Lebenszeit. Damit ist ein Konzert keine besondere Situation und Kunst kein besonderes Erlebnis mehr. Die Konzerte mit Cages Musik sind nur ein Übergang, eine Art „Lehrgang“, um die alten „neuen“ Inhalte in einer vertrauten Situation neu kennenzulernen. Das alte Spiel mit Erwartung und Erfüllung/Nicht-Erfüllung ist eine künstliche Hülle, die abgestreift ist. Mit dem Entfernen der „Zeit“ aus der Konstruktion (als Gerüst um die Inhalte) hat sie ihre Bedeutung verloren und ist gewichen, „nur“ die Inhalte bleiben übrig. Doch auch die Inhalte sprechen keine Sprache, sind nur so beschaffen, wie sie auftreten und sind vom Geist deshalb nicht verarbeitbar. Damit wird das Interesse die einzige mögliche Geistesregung, mit der man der Musik Cages begegnen kann. Bleibt die Frage, ob das dem hörenden Menschen auf Dauer genug ist. 57 4.4 E MOTION. R ÜCKZUG DER P ERSÖNLICHKEIT. INDISCHE P HILOSOPHIE UND Z EN Wir hatten in Kapitel 2.2 behandelt, welch wichtige Rolle im Musikleben bis heute die Frage nach der Emotion, als Wichtigste der Inhalte in der Musik, spielt. Der Leser, welcher sich bis hier durch meine Erläuterungen durchgearbeitet hat, wird ahnen, dass ohne Struktur, ohne „Sprache“ von Mensch zu Mensch auch keine Emotionen transportiert werden können. Cage negiert ab seiner mittleren Schaffensphase nicht nur, dass Töne Emotionen bergen, er geht noch einen Schritt weiter. Bei ihm verliert sich jeder Bezug zwischen Musik und Emotion im Hörer; das heißt, die Musik ist nicht mehr direkt für die empfundene Emotion verantwortlich. Für Cage ist die Freiheit der eigenen Emotion das entscheidende71. Die Musik soll dem Hörer keine bestimmte Emotion aufdrängen. Diese wird also nicht durch die Musik selbst gezeugt, sondern höchstens von ihrer Präsenz als Anlass im Hörer selbst. Cage ist Emotionen in der Musik gegenüber generell sehr negativ eingestellt. Er gibt dazu letztendlich (wie so oft) gesellschaftliche Gründe an: „Emotionen, wie aller Geschmack und das Gedächtnis, sind zu stark mit dem Selbst, dem Ego verbunden. Die Emotionen zeigen, daß wir innerlich betroffen sind, und der Geschmack beweist unsere Art, äußerlich betroffen zu sein. Wir haben aus dem Ego eine Wand fabriziert, und die Wand hat nicht einmal eine Tür, durch die das Innere mit dem Äußeren kommunizieren könnte! Suzuki hat mich gelehrt, diese Wand zu zerstören. Es ist wichtig, das Individuum in den Fluß dessen was geschieht zu tauchen. Und um das zu tun, muß die Wand zerstört werden; Geschmack, Gedächtnis und Emotionen müssen geschwächt werden; alle Schutzwälle müssen niedergerissen werden. Man kann eine Emotion fühlen; nur denke man nicht, sie sei so wichtig...Nimm sie so, daß du sie fallen lassen kannst. Bestehe nicht darauf. Es ist wie mit dem Hähnchen, das ich im Restaurant bestelle: es betrifft mich, aber es ist nicht wichtig. Und wenn wir Emotionen beibehalten und sie verstärken, können sie eine kritische Situation auf der 71 Siehe: Cage, Für die Vögel, S. 180/181 . 58 Welt herbeiführen. Genau die Situation, in der die Gesellschaft heute gefangen ist“. Nun, welche Situation das ist, wird im Folgenden leider nicht klar. Ihm kommt es jedenfalls darauf an, dass der Austausch zwischen Außen und Innen nicht blockiert oder gefiltert wird. Emotionen sind „erlaubt“, haben aber nichts mit der Musik zu tun, und sind deshalb für deren Betrachtung irrelevant. Diese Position erinnert an diejenige von Hanslick, die ich in Kapitel 2.2 diskutiert habe, bezweifelt aber noch radikaler die Möglichkeit eines direkten Zusammenhanges von Musik und Emotion. Cage ist deshalb in Diskussionen immer wieder in die Defensive gedrängt worden. Wie es zu einer solch radikalen Ablehnung kam, will ich im Folgenden versuchen zu beleuchten. Ich habe bereits erwähnt, dass Cage eine Tendenz hat, sich gegenüber von Widerständen weiter zu radikalisieren. Zuerst muss ich dazu zum Ende der 30er/ Anfang der 40er Jahre zurückschauen, wo Cage zum Ende der frühen Phase seines Schaffens mit Geräuschen und verschiedenen Strukturverhältnissen experimentierte und sich langsam immer mehr von traditionellen Strukturelementen entfernte. Die Musik bis zum Ende der 40er Jahre verwendet hauptsächlich Geräusche oder, wie bei seinem präparierten Klavier, verfremdete Töne. Das Klangbild ist von feingliedrigen rhythmischen Elementen durchzogen, viele Offbeats und kompliziertere Muster schaffen zusammen mit dem neuartigen Geräusch-Klang ein interessantes, abwechslungsreiches Klangbild. Man kann dort sehen, dass Cage ein feinsinniges Gespür für das Spiel mit klingenden Gegenständen hatte. In diesen Jahren reiste Cage mit seinem Schlagzeugensemble herum auf der Suche nach Aufträgen und dem nötigen Geld für eine Existenzgründung. Er war mit seiner Frau Xenia seit 1935 verheiratet. Noch war Cage bemüht, seine Persönlichkeit in den Werken zu verwirklichen. Als eine Art Höhepunkt kann dabei das Stück Amores von 1943 angesehen werden. Cage meinte: „Amores ist dazu ausersehen, ich würde sagen: Liebesgefühle zu wecken“72. Das Klangbild ist ein Typisches für die Musik dieser Jahre. Jedoch ist ein eher hohes Maß an Klangfarbigkeit und ein gestisches, vielleicht in dieser Musiksprache durchaus persönlich emotionales Moment im Stück zu erkennen. Er interessierte sich zu dieser Zeit schon für indische Philosophie. Es ist das erste Werk von Cage, „in dem sich sein Interesse an östlichem Denken zeigt. [...] Das Stück ist ein Versuch, die Kombination 72 Revill, Tosende Stille; S. 110. 59 des Erotischen und der Ruhe zum Ausdruck zu bringen“73. Sowohl die Erotik, wie auch die Ruhe gehören zu den zentralen 9 Gefühlen nach der hinduistischen Philosophie. Ich werde im Laufe des Kapitels noch darauf zu sprechen kommen; der Rückzug von Cages Persönlichkeit hängt meiner Ansicht nach aber nicht primär damit zusammen. Cage hatte vielmehr Probleme in der Kommunikation der inneren Botschaft seiner Werke. Er fühlte sich nicht verstanden. Revill schreibt, die Stücke aus dieser Zeit des Krieges und der persönlichen Krise: Imaginary Landscape Nr 3, Credo in US, In the Name of Holocaust „waren dazu bestimmt, seine Gefühle und Ideen zum Ausdruck zu bringen und mitzuteilen. Expression aber, Ausdruck, erzeugt Mißverständnisse. »Ich wurde gewahr, daß, wenn ich sorgfältig und gewissenhaft etwas Trauriges schrieb, die Hörer und Kritiker zum Lachen neigten«, erinnert [Cage] sich. »Ich konnte die akademische Idee nicht akzeptieren, daß der Zweck von Musik Kommunikation sein sollte«“74. Noch dazu kam eine schwere Lebenskrise in der Mitte der 40er Jahre, in Verbindung mit der Trennung von Xenia 1945. Den ganzen folgenden Abschnitt entnehme ich Auszügen direkt aus Revills Biographie (Kapitel 8, Abschnitt III; S. 113-116), da die Krise und ihre kompositorischen Folgen dort detailliert beschrieben sind und einen guten Einblick ermöglichen: „Die bevorstehende Trennung von Xenia war nicht nur der Verlust einer Beziehung, einer wichtigen Beziehung, sondern auch Zeichen des Verlustes sexueller Identität und Orientierung. [...] Cages Verwirrung und Traurigkeit kommt in einer sechssätzigen Suite für präpariertes Klavier zum Ausdruck, The Perilous Night, geschrieben im Winter 194344. [...] Die Musik erzählt von den Gefahren des Liebeslebens, vom Elend dessen, »was zusammengehörte und zersprang« [...] The Perilous Night ist sehr eindringliche Musik. [...] Offenbar suchte er nach einer Balance der Emotionen, die er offenbar später in der Stille der Leere finden sollte. [...] Die Störung blieb nicht auf sein Gefühlsleben beschränkt. »Ich war« erinnert [Cage] sich, »sowohl in meinem Privatleben als auch in meiner öffentlichen Arbeit als Komponist Opfer dieser Verwirrung«. [...] Am Ende dieser Entwicklung stand The Perilous Night, mit Cages abgründigstem Gram und 73 Revill, Tosende Stille; S. 110. 74 Revill, Tosende Stille; S. 115/116 . 60 Kummer gesättigt, während ein Kritiker schreiben konnte, das Stück klinge »wie ein Specht im Glockenturm«. »Ich hatte ein gut Teil Emotion in diesem Stück verarbeitet, und das teilte sich offensichtlich überhaupt nicht mit«, berichtet Cage. »Oder ich teilte etwas mit, aber alle anderen Künstler sprachen eine andere Sprache, und das nur für sich selbst. Die ganze Situation machte auf mich mehr und mehr den Eindruck einer babylonischen Verwirrung.« Und er fährt fort: »Ich entschloß mich, das Komponieren aufzugeben, bis ich einen besseren Grund dafür gefunden hatte als Kommunikation.«“ Mit diesem Zitat möchte ich zeigen, dass Cage meiner Ansicht nach seine Ablehnung von Emotion und auch Kommunikation in der Musik eher aus der Frustration über die Ablehnung seiner Versuche Emotion mitzuteilen gezogen hat, oder wenigstens darin eine Bestätigung seiner Ahnungen fand, und zum Anderen mit der Verbannung der „Verstrickung der Leidenschaften“ versuchte, sein aus den Fugen geratenes Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass das weniger mit seinen Erklärungen aus der Zen-Philosophie wirklich zu tun hat, sondern er lediglich nachträglich darin eine ideologische Bestätigung fand. Des weiteren möchte ich das Zitat auch als eines der deutlichsten Beispiele markieren für meine Ansicht, dass Cage in seiner musikalischen Entwicklung weniger von seiner künstlerischen Umwelt beeinflusst ist, als viel mehr durch seine Biographie und seine sich ins weitere Extrem verbohrende Charaktereigenheit, die aus einer Niederlage ihre ganz eigenen Schlüsse zieht. Ich kann im Rahmen dieser Arbeit keine Analyse der genauen Umstände der Publikumsreaktionen durchführen, und damit bleiben meine Überlegungen ein stückweit Hypothese. Ich glaube dennoch, dass Cage einen falschen Schluss aus dem Unverständnis gezogen hat, denn ich halte es in konventioneller Musiksprache keineswegs für unmöglich, solche persönlichen Gefühle mitzuteilen (oder wenigstens im Hörer zum „Wiederhall“ zu bringen)75. Wir müssen Cages verzweifelte Versuche sich mitzuteilen nämlich in den Kontext seiner erneuerten Musiksprache stellen, dazu 75 Eines der unzähligen prominenten Beispiele dafür ist die 6. Sinfonie Tschaikowskis, der sie nachweisbar in größter Verzweiflung wenige Wochen vor seinem Tode schrieb, und dessen Kommentare über das Stück und seine Situation eindeutig in diese Richtung verweisen. Es gibt wohl Wenige, die ihm die Eindeutigkeit der persönlichen emotionalen Reaktion in dieser Musik ernsthaft absprechen. 61 noch in einer Zeit, die der Tradition innerhalb des Musikbetriebs noch weit mehr verpflichtet war, als das bei uns heute der Fall ist (vgl. dazu in Kapitel 3). Möglicherweise ist seine Musiksprache nicht verstanden worden, was aber den Transport von Inhalten nicht notwendigerweise ausschließt. Cage hat sich bald nach der Scheidung 1945 intensiver mit der fernöstlichen Philosophie beschäftigt, angefangen mit indischer, dann gefolgt von der noch prägenderen Zen-Philosophie Japans. Ersteres wurde durch den Kontakt zu Gita Sarabhai, einer jungen Frau aus einer reichen indischen Familie, möglich. Er hatte sich schon vorher dafür interessiert, und so praktizierten die beiden einen Kulturaustausch zu beiderseitigem Vorteil. Er fand sofort Parallelen von der tala (die den Rhythmus in der indischen Musik organisiert) und seiner Musik76. Dort lernte er eine Lebenseinstellung kennen, die ohne einen „Anfang“ und ein „Ende“ auskommt. Er, der auf der Suche war nach einem neuen Sinn für Musik, lernte von Gita „das Ziel von Musik liege darin, den Geist zu reinigen und zu beruhigen und ihn dadurch für göttliche Einflüsse empfänglich zu machen“. Ähnliche Beispiele ließen sich schnell auch in der eigenen christlichen Religion finden. Er veröffentlichte einen Aufsatz mit dem Namen „Forerunners of Modern Music“ in der er seiner neuen Begeisterung für den spirituellen Ansatz in der Musik Ausdruck verlieh77. Gegen Ende der 40er Jahre macht sich eine Strenge im Satz seiner Stücke bemerkbar in denen „das Bemühen um Ausdruckslosigkeit“78 spürbar wird. Cage setzte sich mit den neun ständigen Gefühlen des Hinduismus auseinander, die da sind: Das Heroische, das Erotische, das Heitere und das Wunderbare, und ihre dunklen Widerparts: die Angst, der Zorn, der Kummer und der Widerwille. Das zentrale Gefühl zwischen der „hellen“ und der „dunklen“ Seite liegt die Ruhe. Die Ruhe faszinierte Cage sofort und seine Stücke sind ein Umkreisen dessen. Anfang der 50er Jahre hat Cage die Vorlesungen von Deisetz Teitaro Suzuki an der Columbia University besucht. Suzukis Lehre wurde einer der wichtigsten Einflüsse in Cages Denken und er hat dessen Folgen in seinem Denken an zahllosen Stellen 76 Revill, Tosende Stille, S. 117. 77 Revill, Tosende Stille, S. 117. 78 Revill, Tosende Stille, S. 136. 62 betont79. Suzuki kam aus Japan, war aber kein praktizierender Mönch oder Zen-Meister. Er widmete sein Leben dem Vermitteln der Zen-Philosophie im Westen, um der „Rastlosigkeit“ und dem „spirituellen Mangel“ der westlichen Zivilisation abzuhelfen. Dort lernte Cage, dass das Leben als Einheit zu betrachten ist, und er schloss daraus: „Ob das richtig ist oder falsch, darauf kommt es nicht an, ein ›Fehler‹ gehört nicht zur Sache, denn sobald etwas passiert ist es authentisch, es ist, was es ist“80. Für ihn war entscheidend: „Ich glaube nicht, daß wir an dem Wert der Dinge interessiert sind. Wir sind an der Erfahrung der Dinge interessiert“. Infolge der Lehren von Suzuki bekam Cage eine Weltsicht von „Ungehindertheit“ und „wechselseitiger Durchdringung“. Das bedeutet, dass jeder Mensch sein eigenes Zentrum bildet, aus dem er sich in alle Richtungen auf alle anderen Individuen zu verströmt und sie durchdringt. So entsteht ein dichtes Netz wechselseitiger Beziehungen, was ungehindert durch Zeit und Raum geht. Der kontinuierliche Fluss darf demnach nie ins Stocken geraten. Festlegungen, wie „Ja“ oder „Nein“ sind schon statische Gebilde. Das Prinzip Yun liegt zwischen Ja und Nein, und vermeidet so die Stasis einer endgültigen Festlegung. Die Sorglosigkeit, mit der der Erleuchtete dem Tag begegnet, kam Cages „heiterer Wesensart“ sehr entgegen. Er begegnete dem Tag gerne mit der japanischen Weisheit: „Jeder Tag ist ein schöner Tag“. Nach Cages Meinung ist die westliche Kunst eher dazu bestimmt, die Realität zu transformieren oder zu verbessern, als das Bewußtsein oder Verständnis für das natürliche Wesen der Dinge zu erlangen. Im Zen gilt es, die Realität so zu erkennen und anzunehmen, wie sie ist. Unser Kausalitätsprinzip, das nach dem „Warum“ der Dinge fragt, ist ein Beispiel für eine verminderte, gefärbte Weltsicht, denn die beinhaltet ein Gedankenkonstrukt und Filterung. Nichts soll beurteilt und begründet werden, sondern durch die Öffnung für alles verändert man sein Inneres. Jede Art der Wiederholung ist schädlich (auch die, sich ein Stück mehrmals anzuhören), da es damit konserviert bleibt, anstatt sich im Fluss des Lebens aufzulösen, und dabei „lebendig“ zu bleiben. „Im Laufe des Studiums des Zen“, sagte Suzuki, „benutzen [Sie] ihre Vorlieben und Abneigungen nicht mehr, um sich in der Welt der Relativität zu schützen, sondern Sie 79 Siehe: Revill, Tosende Stille, S. 139-165 . 80 Revill, Tosende Stille, S. 143. 63 wachsen damit“81. Vorlieben und Abneigungen führen zu extremen Erfahrungen: Lust, wenn etwas stattfindet, was wir lieben, und Schmerz, wenn etwas passiert, wogegen wir Abneigung empfinden. Cage schließt mit einer vielleicht etwas „eigenen“ Logik daraus, dass, wenn wir uns davon losmachen, die Lust „universaler“ und „konstanter“ wird. Cage begann, seine früheren Stücke hinsichtlich dieser Einstellung abzuklopfen und ganz neu zu bewerten. Er begann, alle Art der Konstruktion als unwichtig anzusehen. Am meisten polemisierte er gegen die traditionelle Tonalität und Harmonik, die zugegebenermaßen dem sehr entgegensteht. Die Tonalität steht für Präferenz und Selektion des Tonmaterials und die Zuordnung der Töne zu Funktionen und Konstrukten. „Sogenannte Harmonie“ sagt er, „ist eine erzwungene abstrakte vertikale Beziehung, die das spontan sich vermittelnde Wesen der darunter gefaßten Klänge verdeckt. Sie ist künstlich und unrealistisch“82. „Die Kunst wird vom Leben getrennt, und um sie zu erreichen, müssen wir erst das Zentrum von jemand anderem überqueren“. Cage neigt in seinen Erklärungen und Rechtfertigungen zur Dogmatik und Übertreibung. Ein Beispiel: „Wenn man Tönen mit einem periodischen Rhythmus zuhört, hört man notwendigerweise etwas anderes als allein die Töne. Man hört nicht die Töne - man hört den Tatbestand, daß die Töne organisiert wurden.83“ Ohne lange Erklärungen merkt hier der Leser, dass diese Aussagen nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Wenn wir Töne innerhalb eines streng tonalen mehrstimmigen Gebildes hören, ordnen wir sicher dem Ton eine Funktion zu, und stellen Zusammenhänge her. Das ist auch wichtig, da wir nicht immer jeden einzelnen Ton verarbeiten können. Auf diese Weise reduzieren wir gegebenenfalls die Eindrücke auf ein verarbeitbares Maß. Trotzdem können wir Töne auch einzeln wahrnehmen und verstehen deren Beschaffenheit. Darüber hinaus machen die Attribute eines Klangs aber oft erst dessen Reiz aus. Die Bedeutung wächst weit über den reinen Ton hinaus. Man „versteht“ eine 81 Revill, Tosende Stille, S. 148. 82 Revill, Tosende Stille, S. 157. 83 Cage, Für die Vögel, S. 255. 64 Stimmung; man ergreift den Gestus einer Melodie; man misst, inwieweit ein Ton in seine Umgebung passt, und was das heißt. Soweit geht Cages Musik nicht im Hörer. Sie wird nicht „begriffen“, sondern nur angeschaut. Revill meint rückblickend: „Cage war zu einer Ästhetik gelangt, die im Grunde optimistisch und leicht zugänglich war: Steigerung von Freude und Genuß Angesichts von Allem, was geschieht. Un doch war er im Begriff, eines der verwirrensten künstlerischen Werke der Geschichte zu vollbringen, das von den meisten Leuten als unverständlich und anmaßend abgelehnt wurde“84. Jede Art von Dialog wird in der Musik Cages abgelehnt. Deshalb entwickelte er mit der Zeit eine besondere Abneigung gegen Jazz, selbst gegen Freejazz, der zwar seinem Idealbild am nächsten kam, aber das Prinzip des Dialogs nach wie vor beibehalten hatte. „Musik als Diskurs funktioniert nicht. Wenn Sie eine Diskussion führen wollen, führen Sie sie und benutzen Sie dazu Wörter“85. Cage hat seine Abneigung gegen Emotionen und Persönlichkeit in der Musik im Nachhinein oft mit den Lehren aus dem Zen begründet. „Wir haben aus dem Ego eine Wand fabriziert, und die Wand hat nicht einmal eine Tür, durch die das Innere mit dem Äußeren kommunizieren könnte! Suzuki hat mich gelehrt, diese Wand zu zerstören. Es ist wichtig, das Individuum in die Strömung, den Fluß dessen was geschieht zu tauchen“86. Man muss vielleicht betonen, dass Cage sich vom Zen nicht in irgend einer Weise hat religiös beeinflussen lassen. Zen war eingereiht in das System der „Nützlichkeiten“, mit dem Cage sein Leben gestaltete und das ihm bei der Lösung seiner Aufgaben und Probleme half. Soweit ein Überblick über Cages Verständnis von Zen. Ich habe mich bemüht, Cages Verständnis von Zen mit anderen Quellen zu vergleichen und bin dabei auf „Nada Brahma“ von Joachim Ernst Berendt gestoßen, der eine detaillierte Beschreibung der indischen und japanischen Philosophien gibt. Trotz der Nähe zur Popularwissenschaft, 84 Revill, Tosende Stille, S. 162/163 . 85 Aus: Revill, Tosende Stille, S. 159. 86 Cage, Für die Vögel, S. 57 . 65 die man ihm manchmal vorwirft, habe ich dort wertvolle Informationen gefunden. Von dort aus werde ich versuchen, einen kurzen Überblick der grundlegenden Idee zu geben und die mit Cages Verständnis zu vergleichen. Ich habe leider keine genaue Vorstellung von der Gesamtheit von Cages Verständnisses von Zen, und muss mich auf das verlassen, was er in den mir bekannten Gesprächen darüber gesagt hat, und was er davon in die Musik transportiert hat. Zen bietet einen spirituellen Weg zwischen praktischem Denken und Irrationalität. Beide Bereiche haben viel miteinander zu tun. Zen ist eine spätere nach Japan überlieferte Form (oder Methode) des indischen Buddhismus, ab dem 13. Jh n. Chr., und ihm wird eine besondere Praxisnähe nachgesagt. Um zum näheren Verständnis der buddhistischen Geisteseinstellung zu gelangen, muss man sich mit deren Meditationstechniken auseinandersetzen: In der Mantra- (Indien) bzw. Koan- (Zen) Technik des Buddhismus geht es um das Erlernen eines anderen Verständnisses vom menschlichen Geist. Die Koans unterscheiden sich genaugenommen etwas von den Mantras, was wir in diesem Kontext aber nicht weiter verfolgen. Es wird dem Schüler vom Weisen eine Aufgabe gestellt, die auf den ersten Blick mit der menschlichen Logik nicht lösbar ist. Beispiele sind: „Gebrauche den Spaten, den du in deinen leeren Händen hältst“ oder dasjenige, welches ich dieser Arbeit als Leitspruch vorangestellt habe: „Wenn du auslöschst Sinn und Ton - was hörst du dann?“. Der Schüler wird verpflichtet, dieses Koan zu lösen, und wenn er Jahre darüber meditieren muss. Dabei geht es oftmals gar nicht um die Lösung des inhaltlichen Problems, sondern man stößt auf die Grenzen der menschlichen Rationalität und lernt mit der Frage selbst umzugehen. Wenn nötig, wird sie mit dem Hinweis auf die alles erfüllende Gottheit oder dem allumschließenden Nichts (MU) beantwortet. „Das ist der Trick des Koans: Indem der Verstand die ihm aufgegebene Frage tage-, wochen-, jahrelang abtastet, entdeckt der Schüler von ganz allein: Mit dem Verstand komme ich nicht weiter. Es gibt keine rationalere Methode, die Grenzen der Rationalität zu erkennen und - was wichtiger ist - selbst zu erfahren als die Arbeit an einem Koan“87, schreibt Berendt. Das Ziel ist, den Menschen freizumachen von den Fesseln des beschränkten Geistes und seiner Willensanstrengung zum 87 Joachim-Ernst Berendt, Nada Brahma, Reinbek/Frankfurt 1985, S. 56 . 66 Erreichen seiner nichtigen persönlichen Ziele. Der „Klang“ ist ein wichtiges Element des Buddhismus. Die Welt wird als UrSchwingung aufgefasst: „Nada Brahma“ (Die Welt ist Klang). Der Klang als „Musik“ hat mit dem Klang als „Ur-Schwingung“ nichts zu tun. Es ist eine Vibration der Welt, nicht direkt hörbar, nur nachvollziehbar im buddhistischen Ur-Mantra „OM“. „Die Weisen Indiens und des Tibet wie die Mönche von Sri Lanka meinen: Wenn es einen für uns normale Sterbliche - hörbaren Klang gibt, der diesem Urklang, der die Welt ist, nahekommt, dann ist es der Klang des heiligen Wortes OM“88. Das Kernproblem bei Cage liegt nun in dem Versuch, ein religiöses und philosophisches Prinzip einer alten Kultur, das den Menschen formen, erweitern und für göttliche Einflüsse bereitmachen soll, auf eine abendländische Kunstform zu übertragen und sie damit völlig zweckzuentfremden. Cages Umweltgeräusche haben meinem Verständnis nach keine Ähnlichkeit mit dem buddhistischen Welt-Klang; der eben nicht zu verwechseln ist mit den „Klängen der Welt“, d.h. den Umweltgeräuschen. Der Weltklang hat auch nichts mit dem Zufall zu tun. Die Zufallsproduktion von Geräuschen gibt nicht die (durchaus periodische) Schwingung der Welt wieder. Bezeichnend ist deswegen auch die Reaktion Suzukis, Cages ZenLehrmeister, als Cage ihn auf die Verbindung des Zen zu seiner Musikproduktion aufmerksam macht. Er sagte nur: „Ich verstehe von Musik rein gar nichts“. „Ich wollte Zustimmung von ihm“ berichtet Cage. „Als ich sie nicht bekam, ging ich einfach meinen Weg weiter“89. Ebenfalls hat die indische oder japanische Musik, außer vielleicht in ihrer Tendenz zur Überschreitung von Anfang und Ende, keinerlei Ähnlichkeit mit Cages Kunst. Das „OM“ ist mächtigste Mantra-Prinzip. Es ist wie eine Ur-Keimzelle, aus der alles entsteht. Dieses Prinzip ist in Cages Werk deutlich enthalten. Der Aufstieg zur Universalität, das Verlassen der eigenen beschränkten Menschlichkeit, die „Durchdringung der Zentren“ ist Cages Bestrebung. Im Buddhismus gibt es aber auch den 88 Berendt, Nada Brahma, S. 39 . 89 Revill, Tosende Stille, S. 163. 67 umgekehrten Weg, das Prinzip „HUM“, das „Mantraische Maß des Menschlichen“90, welches er ignoriert. Hier wird der umgekehrte Weg in den Menschen hinein, zu seiner Persönlichkeit beschrieben. Weiterhin gibt es das Prinzip „HRIH“, der Wärme, Intensität, und Inspiration. Auch hier findet sich die Persönlichkeit des Menschen, die Cage im Menschen natürlich nicht leugnet, aber in seiner Musik ignoriert. „Im OM macht sich der Meditierende so weit wie das All [...] im HRIH aber entzündet er die aufwärts lodernde Flamme der Inspiration und der Hingabe“91. Interessant ist der Drang nach dem „Nichts“ im japanischen Zen. Berendt schreibt: „Die japanischen Worte ku - Leere - und mu - Nichts - sind Hauptworte des Zen. »Mu! Mu! Mu!« sagen die Meditierenden vor sich hin - in Gedanken oder auch psalmodierend, gegen Ende langer Meditationen gar schreitend - stundenlang, tagelang, wochenlang, um leer zu werden: leer von all dem Nichtigen, womit wir Menschen uns anfüllen, damit Raum wird für die einzige Fülle, die zählt - die Fülle des Seins, welche die Fülle des Nichts ist“92. Gleichzeitig gilt das Bestreben, sich immer nur einer Sache ganz zu widmen. Damit wird die volle Konzentration auf das MU, die „Leere“ erreicht. Für den Hörer heißt das, dass er vorher wissen muss, welchen Sinn Cages Musik erfüllen soll. Es geht nicht um eine Form des Genusses von „Kunst“, sondern das Ausleben von Prinzipien. Leere, Konzentration, Verlassen der gewohnten Denkbahnen, das Erleben eines Zeitkontinuums, das Empfinden des „Welt-Klangs“, die „Nicht-Aussage“ ist das Ziel. Man geht weg vom „Ich“ mit seinen Vorlieben und Abneigungen, weg vom „Warum“, einer hinterfragbaren Aussage. Realität wird nicht künstlich transformiert, überhöht, sondern alles ist jetzt. Kurz: Cages Musik ist Meditation. Sosehr Cage auch betont, den Klang „für sich“ wahrzunehmen, sosehr ist der einzelne Klang in Wirklichkeit unwichtig. Im Hinblick auf Zen ist die „Musik“ ein Vehikel eines spirituellen Lebensprinzips. Eggebrecht hat betont, dass „Cages Affinität zu fern- 90 Berendt, Nada Brahma, S. 40 . 91 Berendt, Nada Brahma, S. 40 . 92 Berendt, Nada Brahma, S. 239/240 . 68 östlichem Denken wohl nicht zu hoch veranschlagt werden [sollte] [...] für derartige Ideen fand Cage in der fernöstlichen Philosophie wohl weniger einen Ausgangspunkt als vielmehr eine Bestätigung, Rechtfertigung, Bekräftigung, einen philosophischen Halt, den er benutzte, wie er ihn gebrauchen konnte“93. 4.5 A NARCHISMUS UND „O FFENHEIT FÜR A LLES“ M USIK UND LEBEN . B EURTEILUNG VON M USIK Im Kapitel 4.2 waren bereits wichtige Aspekte der „Offenheit für alles“ angesprochen worden. Ich möchte an dieser Stelle nicht alles wiederholen, sondern das Bild verdeutlichen und ergänzen und zudem versuchen zu erklären, wie Cage auf diesen Gedanken gekommen ist. Wie bereits dargestellt hat Cage immer schon eine Tendenz zur Offenheit gegenüber Neuem und der Lust zum Experimentellen gehabt. Schon zum Ende der 30er Jahre hatte Cage eine Erfahrung, die für seine weitere Ästhetik von entscheidender Bedeutung werden sollte. Revill schreibt94: „Ein anderer Maler, dessen Bekanntschaft Cage damals machte, war Mark Tobey[...] Das Wichtigste, worauf Tobey ihn hinwies, war die Bedeutung der alltäglichen Dinge. [...] Einige Jahre später, nachdem er in New York heimisch geworden war, besuchte Cage eine Ausstellung in der Williard Gallery - wo schon sehr früh Werke von Tobey und Graves hingen. Als er an einer Kreuzung der Madison Avenue auf den Bus wartete, wurde er gewahr, daß das Betrachten des Straßenpflasters zu seinen Füßen eine ebenso bereichernde Erfahrung war, wie die weißen Bilder Tobeys, die er sich gerade angeschaut hatte. Es war eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit, die in späteren Jahren für Cages Ästhetik sehr bedeutsam werden sollte.“ Beim Warten auf den Bus entstand folgendes Gedicht: 93 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 203. 94 Revill, Tosende Stille, S. 80/81 . 69 »Ich schaute zufällig auf das Muster des Straßenpflasters, Auf dem ich stand; ich sah keinen UnteRschied zwischen dem Betrachten von Kunst und dem Schauen anderswohin« Der Quersinn „M ARK“ ist der Vorname des Malers Mark Tobey. Diese Art von Gedicht heißt M esostichon. Sie faszinierte Cage sehr und er verarbeitete sie erst in Grüßen und Glückwünschen, später auch als Textgrundlage mehrerer Kompositionen Er begann seine Umwelt als eine Künstlerische zu entdecken. Plötzlich war die Welt überall Kunst. „Es ist die Vorstellung, daß Musik, die in diesem Falle auf Geräuschen beruht, von allen Leuten benutzt werden kann, um ihre - oft als unangenehm erlebten Erfahrungen des Alltagslebens zu integrieren, und nicht dazu, einen ästhetisch höheren Bereich abseits der Welt zu hegen“95. Cage sah sogar einen therapeutischen Wert in seiner Musik: „Dann werden sie ganz plötzlich die Schönheiten in ihrem Alltagsleben hören“96. Hier wird noch ein tiefgreifender Aspekt seiner Kunstanschauung deutlich, der aber eine durchaus verbreitete Ansicht der Avantgarde des 20. Jahrhunderts ist. Seit den 20er Jahren, wo die Dadaisten bereits gewöhnliche Gegenstände zu Kunst erklärt hatten, um damit gegen das tradierte Kunstideal zu protestieren, hat man aus Mangel an verbindlicher Form den Begriff der „Kunst“ immer wieder erweitern müssen. Heute ist vielleicht das einzige Kriterium, worunter man Kunst allgemein in ihrer unerschöpflichen Vielfalt der Erscheinungsformen noch zuverlässig zusammenfassen kann, die Absicht. Kunst ist dann Kunst, wenn sie als solche angesehen wird. Auch die banalsten Gegenstände des täglichen Lebens werden dann zur Kunst, wenn man sich ihnen nicht von ihrer funktionalen Seite her nähert, sondern von der ästhetischen bzw. ihrer Daseinsform, also zum Beispiel ihrem Aussehen, oder, in Cages Fall, ihrem Klang. Seines Erachtens „konnte jeder Klang durch die einfache Tatsache musikalisch werden, daß er in ein musikalisches Stück aufgenommen werden konnte“97. Nicht unwichtig ist eine Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, und wo sich eine 95 Revill, Tosende Stille, S. 87 . 96 Revill, Tosende Stille, S. 87 . 97 Cage, Für die Vögel, S. 81 . 70 Lücke in Cages Argumentation auftut: Wenn Alles Kunst ist, ist auch ein Jeder Künstler. Gegenstandslos ist dann zwar die oft gehörte Kritik über Alltagskunst oder Geräuschkunst geworden, „das sei gar keine Kunst, das könne man ja auch; dafür brauche man nicht in ein Konzert gehen“, denn genau dieses ist ja deren Sinn. Es ergibt sich eine fantastische Vision davon, dass jeder - weil in den künstlerischen Prozess eingebunden - sich mit Kunst zu identifizieren die Möglichkeit hat. Eine andere Sache ist jedoch, ob sich das Publikum in dieser Rolle auch selbst sieht. Bei einer Aufführung von Atlas Eclipticalis in Venedig 1961, eine der vielen Skandalaufführungen von Cages Musik, gab es zum wiederholten Male einen Tumult. Mittendrin klopfte ein alter Mann mit seinem Krückstock auf seinen Sitz und schrie: „Jetzt bin ich auch Musiker!“98. Cage haben diese Tumulte nicht gefallen, aber sie gehören doch zum „Klangbild“ der Aufführung dazu, also, wenn man so will, in seiner Ästhetik auch zur Musik. Der Zuhörer ist kein Zuhörer, sondern wird selbst ungewollt aktiv im Lautgeschehen. Problematisch daran ist nur, dass die Geräusche der Zuhörer nicht notwendigerweise ästhetisch intendiert sind, und als solche deswegen eigentlich auch nicht angesehen werden dürfen. Wenn etwas beispielsweise als Störgeräusch intendiert ist, bleibt es auch ein Störgeräusch. Andernfalls säße der alte Mann gefangen wie ein Vogel im Käfig, dessen Schrei nach Freiheit als „Gesang“ interpretiert wird. Wenn man also Intention durch Ästhetik ersetzt, hat die Intention keine Chance mehr. Cage hält deshalb nicht alle Menschen für reif für die gegebene Freiheit. Er spricht in diesem Zusammenhang von der „Disziplin des Egos“. In „Für die Vögel“ sagt er: „Ein Ego ohne Disziplin ist verschlossen, es neigt dazu, sich in seine Gefühle einzuschließen. Disziplin ist das Einzige, was diese Verschlossenheit verhindert. Mit ihr kann man sich dem Äußeren, wie dem Inneren öffnen.“99 An anderer Stelle meint er: „Mein Verständnis von Disziplin geht dahin, daß sie uns von der Tyrannei der in uns aufkommenden Neigungen und Abneigungen frei macht“100. Damit ist wohl gemeint, dass der Hörer sich einer eigenen Erziehung zur „Offenheit“ unterziehen soll. Ulrich 98 Revill, Tosende Stille, S. 271. 99 Cage, Für die Vögel, S. 60 . 100 Dieter Schnebel, „Wie ich das schaffe?“, Musikkonzepte, Sonderband John Cage I, S. 52 . 71 Dibelius hält dies allerdings für eine Utopie. „Gelassenheit gegenüber dem Ungewöhnlichen, ob vom Komponisten mit Lust inszeniert und heiter zur Schau gestellt oder vom Hörer als Akt der Einübung in Lebenswirklichkeit erwartet, ist letztlich eine Wunschhaltung. Sie schützt Abgeklärtheit vor und unterminiert dabei die natürlichen Reaktionen [...] Zweifelsohne ist ruhiges Abwarten, die Bereitschaft, zuzuhören, sich auf eine Sache einzulassen [...] immer noch der bessere Weg zu Einsichten und Erfahrungen zu gelangen, als vorschnell und borniert dagegen das ganze Arsenal an klischierten Vorurteilen, abwiegelnden Vergleichsmaßstäben und empörter Grundwertverteidigung aufzubieten. Aber das Bemühen, dies um Himmels willen zu vermeiden, kippt doch ins genaue Gegenteil um, wenn alles, was ist, mit dem selben Gleichmut [...] hingenommen wird“101. Die Schlussfolgerung, dass alles ins Gegenteil umkippt, vermag ich nicht ganz nachzuvollziehen, bin aber grundsätzlich Dibelius’ Meinung, dass die Offenheit für alles Erdenkliche zu einer passiven Teilnahmslosigkeit führt und für unsern Geist eher „ungesund“ ist. Ich muss an dieser Stelle noch einmal auf den Dadaismus zurückkommen. Cage hat von ihm profitiert, man kann sagen, dass seine Kunst von der Methode her eine „akustische Variante“ von Dadaismus ist, beispielsweise im Gebrauch von Alltagsphänomenen für Kunst und die Ablehnung von alten Kunstanschauungen. Cage hat jedoch im Laufe der 40er und 50er Jahre eine andere Entwicklung durchgemacht, hat persönlich noch andere Motive für seine Arbeit entwickelt, hat sich philosophisch anders orientiert und hat nicht nur die Protesthaltung gegen das „Bürgerliche“ als Ziel. Die Betonung auf die „Existenz“ einer Sache, ohne Blick auf die Beziehungen oder Attribute hat bei ihm Vorrang vor dem Protest. Somit ist das „Phänomen Cage“ nur teilweise mit dem Dadaismus zu erklären. In Kapitel 4.2 hatte ich bereits über die Hierarchielosigkeit der Töne gesprochen, die mit der Isolation der Töne einhergeht. Cage hat sich nicht direkt darüber geäußert, aber es ist dennoch möglich, dies in Cages gedanklichen Hintergrund stellen. Resultierend aus seiner Bekanntschaft mit Duchamp und der Beschäftigung mit seinen Schriften und mit dem Dadaismus (dem Duchamp zugerechnet wird) hat er sich zum politischen Anarchisten entwickelt. Duchamp war „Cages unbestrittenes Leitbild im Blick darauf, 101 Dibelius, Moderne Musik II 1965-85, S. 106. 72 wie ohne Leitbild zu leben sei“102, der dem „disziplinierten“ Menschen zutraut, ohne Hierarchien zu leben. Er beäugte die Regierungen immer mit großem Misstrauen und sah auch gesellschaftlich alle Arten von Hierarchie als schädlich an. Wichtig ist zu betonen, dass Cage die gesellschaftliche Einstellung in seine Musik transportiert hat, nicht umgekehrt. An dieser Stelle zeigt sich wiederholt, dass seine Musik ein Konglomerat von Einflüssen ist, die er teilweise aus anderen Bereichen des Lebens in die Musik hinein transportiert hat. Die Beziehung zum „Leben“, und die Andersartigkeit seines Kunstverständnisses werden damit wiederum deutlich. An dieser Stelle möchte ich mich kurz der Frage widmen, wie Cages Musik bewertet werden kann, im Sinne von „guter“ oder „schlechter“ Musik. Das Besondere - und Problematische - bei der Beurteilung von Cages Musik ist, dass sie sich jedem Kriterium entzieht. Eggebrecht schreibt: „Die Beurteilung einer Musik steht im traditionellen Konzept der Kunstmusik unter der ästhetischen Maxime der Komposition als Resultat von Determination im Sinne von Beziehungsreichtum, Sinnfülle, Intentionalität. Wo aber, wie bei Cage, das Gegenteil von all dem gelten soll, [...] wird der Begriff von »guter« Musik im traditionellen Sinn in Frage gestellt. Was dem Alltag zugehört, dem Leben, und als solches zum Beispiel im Rahmen des »stillen Stücks« erscheint, was nicht qua Kunstgesetz determiniert, sondern es selbst sein soll, ist nicht gut oder schlecht - es steht unter der Maxime, daß es ist.“103. Damit wird klar: was sich den Regeln widersetzt, kann nicht danach beurteilt werden. Das einzige, was beurteilt werden kann, ist das Konzept als Ganzes. Cage widersetzt sich bezeichnenderweise in „Für die Vögel“104 auch jeglicher Beurteilung einer Aufführung seiner Werke. Er sagt wiederholt nur, ob ihn die „Klänge“ des einen oder anderen Stückes mehr „interessiert“ habe. Auch auf wiederholte Anfragen ist von ihm demonstrativ keine Beurteilung über die Erfüllung des Konzeptes seines Stückes zu erfahren (er hat dies aber an anderer Stelle dennoch getan, beispielsweise bei seinem „Perilous Night“, die aber noch der frühen Kompositionsphase zugeordnet werden). 102 Clytus Gottwald: „John Cage und Marcel Duchamp“, Musikkonzepte, Sonderband John Cage I, S. 134. 103 Eggebrecht, Musik Verstehen, S. 192. 104 Für die Vögel, 1984, S. 60/61 . 73 Für den Hörer hat der Inhalt dieses Kapitels nicht sehr viel direkte Auswirkungen auf das Klangbild. Es ist gedacht als Hintergrund-Erklärung verschiedener schon anderweitig beschriebener Phänomene, wie Beziehungslosigkeit und Isolation der Töne oder die Einbeziehung aller Arten von Geräusch. Hier versuche ich eine Erklärung, warum die Musik in Beziehung zum „Leben“ stehen soll, warum das Augenmerk auf der ästhetischen Betrachtung der Alltagsumwelt basiert und was vom Hörer erwartet wird. Außerdem erfährt er hier, nach welchen Kriterien er die Musik bewerten (oder nicht bewerten) kann. 4.6 R AUM UND D ARSTELLUNG. D AS MULTIMEDIALE H APPENING. N OTATION Dieses Kapitel ist nur der Vollständigkeit des Bildes von Cage enthalten, es ist nicht zentral für die Betrachtung seiner Musik und wird deshalb relativ kurz und allgemein bleiben. Ich habe bereits vorher erwähnt, dass Cage sich immer auch an anderen Kunstsparten orientiert hat, viele Tänzer, Maler und Schriftsteller kannte und sich dort Anregungen holte, oder dort selbst tätig war, besonders, weil er allgemein der Ansicht war, dass der Erwerb traditioneller Kenntnisse und Fertigkeiten ein unnötiger Ballast sei, und man ohne Vorkenntnisse gleich kreativ werden solle. Es ist klar, dass diese Vielseitigkeit sich auch auf seine Kunst allgemein übertrug. Cage ist ein großer Pionier der interdisziplinären Betrachtung von Kunst gewesen. Die Anfänge des „multimedialen Happenings“ in den 60er Jahren hat er stark mitgeprägt. Sinnbild dafür ist das Stück „HPSCHD“ (steht für „Harpsichord“, die englische Bezeichnung des Cembalos), das mit einer Besetzung mit 7 Cembali, 208 computergenerierten Tonbändern und vielen Film- und Diaprojektoren zum multimedialen Spektakel gerät. Quantität ist hier Maxime, sie ist das Entscheidende. Das Publikum soll in diesem absichtlichen Durcheinander herumgehen, und seine Aufmerksamkeit dorthin lenken, wo es will. Die Sinneseindrücke sollten (wie auch im „richtigen Leben“) so vielseitig und zufällig sich 74 kombinierend sein wie möglich. Die Realisation verlangt nach einer freieren Gestaltung der Räumlichkeiten. Bei „HPSCHD“ wurden alle eingeladen, sich frei zu bewegen. Schon früher in eher akustisch dominierten Performances setzte Cage das Publikum „sich gegenüber“, d.h. im Kreis, so dass die Zuhörer sich gegenseitig sehen konnten; die aktiven Künstler agierten in der Mitte dazwischen. Der Zweck dessen ist es, das Augenmerk des Publikums auf sich selbst zu richten. Riem: „der Inhalt ist bei Cage die »Form« und die »Form« ist die soziale Situation“105. Man muss vielleicht hier das Wort „soziale“ präzisieren; es handelt sich hier nicht um die Beziehung der Beteiligten zueinander, sondern das Faktum, dass Menschen an einem Ort vorhanden sind, die freiwillig oder unfreiwillig interagieren, ohne sich einer Beziehung bewußt zu sein. Es wird nicht Kunst „präsentiert“, sondern die Situation wird durch sich selbst, und die Aktion der Beteiligten zur „Kunst“. Eine Kunst der Grenzüberschreitung und Multimedialität, wie sie bei Cage realisiert ist, verlangt natürlich auch nach erweiterten Notationsformen. Wie bereits erwähnt, ist die Notation generell ab den 30er Jahren immer freier geworden, Stücke wie die von Earle Brown waren immer schwerer als musikalische Notation zu assoziieren. Cage hat eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, hat aber nie den akustischen Zweck aus den Augen verloren. Notwendig wurde eine grundsätzliche Veränderung erst mit der Einführung der „Unbestimmtheit“ (s. Kapitel 4.7). Lange Erklärungen der erweiterten Notation sind seither die Regel bei Cages Stücken. Die Liquidierung der Dimension „Zeit“ aus der Notation (s. Kapitel 4.3) machte die sukzessive Notation auf den Notenlinien unnötig. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Notation der „Variations I“. Dort werde ich noch genauer darauf eingehen. Auf der Suche nach neuen aleatorischen Kompositionsverfahren, hat Cage auch die Unebenheiten auf dem Notenblatt zur Ortsbestimmung der Noten benutzt. Dort mischen sich Komposition und Notation. Mit zunehmender Indetermination nimmt natürlicherweise die Ungenauigkeit der Notation zu. In seinem Klavierkonzert von 1957/58 hat er nur noch „63 lose Blätter“, 105 Rainer Riem, „Noten zu Cage“, Musikkonzepte, Sonderband John Cage I, S. 100. 75 von denen eine beliebige Anzahl in einer beliebigen Reihenfolge gespielt werden sollen. Dort finden sich auch mehrere Notationsformen nebeneinander, die ebenfalls teilweise wählbar sind. Einige Notationsarten bieten einen Tonvorrat an, aus dem der Interpret Töne wählen kann (s. Abb.; Zeile G23; die gezogene Linie bildet nur einen Vorschlag für eine mögliche Tonauswahl): Abb. 4: John Cage, Concerto for Piano and Or c h e s t r a 1957/58, Henmar © Press Inc., New York; S.9 (Ausz.) Für den Hörer bedeutet das einerseits, dass er mittels dieser Informationen teilweise Einblick in die Vorgaben des Interpreten bekommt (dies gilt für Cages Stücke ab der Mitte der 50er Jahre), und so annähernd beurteilen kann, in welchem Verhältnis dieser zu den Vorgaben steht; andererseits entdeckt er, das alles was er - als Teil des Publikums - tut, Teil des Kunstwerkes ist. Er ist somit nicht mehr der (mehr oder minder) passive Konsument von dargebotenen Inhalten, sondern selbst „Künstler“. Das verlangt aber auch ein anderes Verhalten von ihm. Er positiver und offener er sich zu der Situation verhält, desto größer ist die Chance, dass sich aus dieser Situation etwas Interessantes, Gewinnbringendes ergibt. 76 4.7 A LEATORIK UND INDETERMINATION Wir haben gesehen, dass Cage die persönliche Aussage und den Transport von Inhalten anders als dem „Sein“ der Klänge ablehnte. Die Frage entsteht, wie er nun Musik organisiert. Cage brauchte einen Ersatz für die Ablehnung der ästhetisch organisierten Musik. Irgendetwas musste die Auswahl des Materials übernehmen. Cage nannte das Prinzip „unaesthetic choice“106. Um konsequent jeglichen persönlichen Einfluss des Komponisten (und damit seinen Vorlieben und Abneigungen) auszuschalten, hat er zunächst den Zufall an Stelle des Komponisten gesetzt, der alle Parameter der Musik bestimmt. Alle Töne und ihre möglichen Parameter werden durch Zufallsoperationen bestimmt. Cage fing dieses Verfahren mit den „Sixteen Dances“ 1951 an. Zunächst waren die zugrundeliegenden Reihen noch von ihm ausgewählt und wurden per Zufallsoperationen verarbeitet. Im Concerto für Klavier und Kammerorchester von 1951 werden altes und neues Komponieren in Einklang gebracht. Während das Klavier zunächst „romantisch und expressiv bleibt“107 gibt es im Laufe des 2. Satzes seinen persönlichen Geschmack auf und gerät im 3. Satz mit dem die ganze Zeit schon nach dem unpersönlichen Zufallsprinzip agierenden Orchester in Synthese. Zur Bestimmung der Zufallsprozesse benutzte Cage zunächst den Münzwurf. Eine bald zunehmend intensiv genutzte Methode zur Zufallsbefragung kommt direkt aus dem Zen. Es ist das Orakelbuch I Ging. Er bekam 1950 ein Exemplar von seinem Schüler Christian Wolff geschenkt. Er setzte das Hexagrammsystem des I Ging zu Zahlen in Beziehung und erhielt so eine zufällige Antwort auf komplexere Fragekombinationen. So ersparte er sich Zeit, jeden musikalischen Parameter einzeln durch Würfeln oder Münzwurf abzufragen. Die Zufallsbestimmung der Noten war nämlich mit beträchtlichem Aufwand verbunden. Später hat Cage dann noch effizientere Mittel zur Zufallsgenerierung verwandt, beispielsweise mit dem Computer, wo er große Massen an Zufallsantworten quasi im Voraus generierte und dann später im eigentlichen 106 Pierre Boulez und John Cage, Correspondance et documents, hrsg. von Jean-Jacques Nattiez u.a., Winterthur 1990, S. 124. 107 Revill, Tosende Stille, S. 169. 77 Kompositionsprozess benutzte. Einige Jahre später erkannte er, dass das einzelne Stück, gleichwohl aus Zufallsoperationen entstanden, dennoch total determiniert ist. Der Zufall ist im Moment der Aufführung nicht mehr wirklich präsent und so entsteht wiederum doch die determinierte, konzeptionierte Gegenständlichkeit, die er aus der Zen-Philosophie heraus ablehnte er im Laufe der 50er Jahre mehr und mehr verabscheute. Die Identifikation des Aufführenden sei so nicht möglich und das Ganze „inhuman“.108 Obwohl Cage später immer noch Zufallsprozesse dazu benutzte, Entscheidungen aller Art zu treffen, hat er sich bald danach von der vollkommenen Determinierung des Materials durch die Aleatorik abgewandt. Alle Determinierung sollte dem klaren Blick auf das reine Wesen des Tons weichen. Das habe ich in den Kapiteln 4.4 und 4.5 bereits erläutert. Die „Indetermination“ gibt dem Klang völlige Freiheit. Alles das, was passiert, wird akzeptiert. Alles Festgelegte wird zugunsten einer jedesmal völlig neuen Situation aufgegeben. Der Werkbegriff (das, was Eggebrecht mit „Werkidentität“ bezeichnet; vgl. Kapitel 2.4) sinkt dabei in die Bedeutungslosigkeit. Das, was bei Eggebrecht das „Dasein“ eines Werkes ist, wird zur unbedingten Priorität erhoben. Bei Cage ist es das Einzige, was „interessant“ ist. Der Hörer bleibt passiv. 108 W ortlaut Cage in: Silence, M iddeltown 1973, S. 36: „Though chance operations brought about the determinations of the composition these operations are not available in its performance. [...] But that its notation is in all respects determinate does not permit the performer any such identification: his work is specifically laid out before him. He is therefore not able to perform his own center but must identify himself insofar as posssible with the center of the work as written. The Music of Changes is an object more inhuman than human, since chance operations brought it into being. The fact that these things that constitue it, though only sounds, have come together to control a hum an being, the performer, gives the work an alarming aspect of a Frankenstein monster.“ 78 5. B ETRACHTUNG DER KOMPOSITORISCHEN P RÄMISSEN C AGES ANHAND DER „M USIC OF C HANGES“ UND DER „V ARIATIONS I“. A NALYSE UND H INTERGRÜNDE Ich habe in den vergangenen Kapiteln versucht darzustellen, dass Cages Musik auf dem Zufall (bzw. der Indetermination) beruht. Das bleibt strenggenommen bisher nur eine Behauptung. Ich werde im Folgenden versuchen, diese Aussagen anhand von 2 Beispielen zu demonstrieren. 5.1 M USIC OF C HANGES Die „Music of Changes“ entstanden 1951, mitten in der Phase der sogenannten „Aleatorik“. Das Stück ist David Tudor gewidmet, der es uraufführte. Das Werk besteht auf 4 „Büchern“ und ist für Klavier. Dem Werk steht eine Erklärung vor, welche die genaue Ausführung erläutert. Die Gesamtdauer ist genau auf 43 Minuten festgelegt. Das ist in der Präzision möglich, da alle Tempoangaben absolute Metronomangaben (Schläge pro Minute) sind. Die Längenangabe des ersten Buches ist: Abb. 5: Music of Changes (1951), © 1961 Henmar Press Inc., New York; Einleitung Die Takte sind von genau gleich festgelegter Größe, denn der Platz definiert die Länge der Note, und zwar nicht relativ, wie es in der herkömmlichen Notation auch üblich ist, sondern absolut (siehe Skala in Abb. oben). Entscheidend ist nicht der Notenkopf, sondern der Notenhals. 79 Dabei ist die Angabe: für jede Note im ganzen Stück verbindlich. Die Angabe: heißt also, dass eine Viertel auf ihrem Platz von 2 ½ cm mit dem Tempo 69 auf dem Metronom gespielt wird. Ritardando bzw. Accelerando sind in Verbindung mit Metronomzahlen angegeben: Die Notenlängen scheinen taktübergreifend organisiert zu sein, da auch am Ende des Taktes lange Noten gezeichnet sind. Es scheint dem Takt keine festgelegte Notenwertlänge zugeordnet zu sein. Die rhythmische Struktur ist mit den Zahlenverhältnissen 3 - 5 - 6¾ - 6¾ - 5 - 3c angegeben. Ihre hauptsächliche Funktion ist es, die Abstände zu ermitteln, in denen das Tempo geändert wird. Also nach 3 Takten das erste mal, nach weiteren 5 Takten das zweite mal, usw. Die haben auch Bedeutung für die Großstruktur. Ich werde im Rahmen dieser Betrachtung nicht weiter darauf eingehen, eine genaue Beschreibung dessen ist bei Stefan Schädler109 nachzulesen. Offensichtlich wird hier die zeitliche Strukturierung eines Werkes (s. Kapitel 4.3) in absoluten Zeitmaßstäben. Alle Dynamikbezeichnungen von unregelmäßigen Abständen vertreten. pppp bis ffff sind vorhanden und in Oft wird plötzlich zwischen Extremen gewechselt. Artikulationszeichen sind vorhanden, auch Bindebögen sieht man zuweilen. 109 Stefan Schädler, „Transformationen des Zeitbegriffs in John Cages Music of Changes“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage II, S. 185-247 . 80 Pedalangaben sind: Haltepedal: Haltepedal nach Tonanschlag: sostenuto: una chorda: Vorzeichen trägt jede Note einzeln und sie beziehen sich auch nur auf diese. Das Stück ist also atonal organisiert. Ebenso ist - auf den ersten Blick - keine rhythmische Struktur erkennbar. Im Folgenden möchte ich, die bekannten Aussagen Cages zur Kompositionsweise des Stückes zunächst ignorierend, einmal die Struktur und Tonsprache des Stückes anhand einiger kurzer Auszüge analysieren, um zu sehen, ob es Indizien für eine aleatorische Tonauswahl gibt, oder ob möglicherweise doch der persönliche Geschmack des Komponisten eine Rolle spielt. So möchte ich einen analytischen Blick auf die Möglichkeit der Tonbeziehungen, organisiert in Stimmführung, Lagenverteilung, Akkordstruktur und -häufigkeit, werfen. Beispielhaft möchte ich die erste Partiturseite heranziehen. Die Notation ist sehr komplex und dahingehend verwirrend, dass Noten im Hintergrund übergebunden sind, wobei die Bindebögen meist nicht durchgehend und Aufteilung der Notenwerte zT. nicht einfach nachvollziehbar sind. Der Tonumfang bis zur ersten längeren Pause in Takt 4 geht von D-2 bis g4. Danach (bis zum Seitenende) H-2 bis ebenfalls g4. Das ist in der Musik des 20. Jahrhunderts nicht unbedingt ungewöhnlich, beispielsweise findet sich Ähnliches in der seriellen Musik. In einer „traditionellen“ Musikästhetik würde innerhalb des harmonischen Systems eher auf Kompaktheit der Klänge geachtet. Laut Partitur treten bis zur Pause im 4. Takt 33 Einzeltöne den 14 Tonkomplexen („Akkorden“) gegenüber (wobei die Komplexe zeilenübergreifend gezählt wurden). 81 Problematisch sind zeitgleich auftretende Klänge, die jedoch unterschiedlich lang gehalten werden. Als „Komplex“ wurden hier nur Klänge zusammengefasst, die auch gleichlang gehalten sind (wobei diese Definition genauso inkonsequent ist, wie deren Gegenteil, denn die Klänge werden beim Anschlag als Komplex, im weiteren Verlauf aber als Einzelton gehört). Nach der Pause bis zum Seitenende treten 14 Einzeltöne 17 Tonkomplexen gegenüber. Die Struktur der Tonkomplexe lässt keine Rückschlüsse auf harmonische Strukturen zu. Die Töne des ersten Tonkomplexes cis1 - eis1 - f1 - g1 - as1 mit dem darüber liegenden c2 ergeben kein sinnvolles Gebilde im Sinne einer Harmonielehre, genau so wenig, wie die nächsten: F-1 - A-1 - F - B, oder die Folgenden: b1 - des2 - es2 mit Vorhalt auf Einzelton E3. Auch die folgenden gleichzeitig angeschlagenen fis1 - g1 - h1 - fis2 - gis2 - a2 suggerieren keinerlei erkennbare Struktur. Die Intervallstruktur innerhalb der Akkorde scheint kaum Regelmäßigkeit zu zeigen. Im Notenbild des ersten Taktes (Abb. 6) ergibt sich folgende Tabelle: Abb. 6: Music of Changes (1951), © 1961 Henmar Press Inc., New York; Takt 1 82 Erster Akkord: gr. Terz/ verm. Sekunde/ gr. Sekunde/ kl. Sekunde/ gr. Terz Zweiter Akkord: gr. Terz/ kl. Sext/ Quarte Dritter Akkord: verm. Terz/ gr. Sekunde Vierter Akkord: kl. Sekunde/ gr. Terz/ Quinte/ gr. Sekunde/ kl. Sekunde Fünfter Akkord: gr. Septime/ kl. None Sexter Akkord: kl. Septime Siebter Akkord: gr. Sekunde/ kl. Sekunde/ gr. Terz/ kl. Sekunde Achter Akkord: kl. Sekunde/ gr. Sekunde Neunter Akkord: kl. Sekunde/ verm. Quinte/ Quarte Zehnter Akkord: gr. Terz/ verm. Quinte über Oktave/ überm. Sekunde/ verm. Sekunde Elfter Akkord: kl. Sekunde/ überm. Prim/Quinte/ kl. Sekunde Zusätzlich klingen noch Töne weiter, die zusätzliche Intervallspannung bilden Ergebnis: 1x überm. Prim; 2x verm. Sekunde; 9x kl. Sekunde; 5x gr. Sekunde; 1x überm. Sekunde; 1x verm. Terz; 0x kl. Terz; 6x gr. Terz; 2x Quarte; 1x verm. Quinte; 1x verm. Quinte über Oktave; 2x Quinte; 1x kl. Septime; 1x gr. Septime; 1x kl. None Statistisch gesehen ergibt sich eine Bevorzugung der kl. Sekunde, gefolgt von gr. Terz und gr. Sekunde. Auffällig ist das Fehlen der kl. Terz, was eine herkömmliche Akkordstruktur beinahe mit Sicherheit ausschließt. Wenn man sich die horizontale Intervallstruktur anschaut, ist das Ergebnis weniger klar. Ich habe stellvertretend für das Ganze die obersten Töne der ersten 3 Takte herausgegriffen, um zu sehen, ob hier eine Tauglichkeit zum Herstellen eines Zusammenhanges erkennbar ist: a 1 - h 2 - c1 - es 2 - es 2 - e3 - a 2 - b 2 - e1- a2 - a2 - f 1 *) - f 2- c4 - g 4 - es 2 - h 1 - b 2 - a 1 - cis 2 - e2 - d 4 *) rechte H and rutscht hier für die Dauer einer Note in den Bass; links: Das Nebeneinander von enharmonischen Wechslern wie h - b, c - cis und es - e suggeriert keine systematische Verwendung von Tönen. Zudem gibt es herbe Sprünge (bis fast zwei Oktaven), die dem Ohr keinen Eindruck von Zusammengehörigkeit anbieten. Hier sind nur zwei Terzintervalle und zwei Sekunden zu verzeichnen, der Rest sind größere Intervalle. Kein Intervall wird direkt nachfolgend wiederholt. Die Rhythmik ist sehr komplex und von multiplen Ebenen durchzogen. Das Letztere weist darauf hin, dass hier auch strukturelle Elemente vorhanden sind. Revill schreibt: 83 „Um jedes Segment für sich schreiben zu können, legte Cage zunächst das Tempo fest und die Anzahl der Lagen in jeder Einheit. Während das Concerto noch monophon110 gewesen war, sollte jede Einheit des neuen Stückes aus zwischen einer und acht unabhängig voneinander komponierten Lagen bestehen“111. Dabei sind aber Schichten nicht im klaren überlieferten Sinne von „Melodie“, „Begleitung“, oder „Basslinie“ erkennbar. Sie haben offenbar keinen Bezug zueinander und wechseln oft die Oktavräume. Die folgende Graphik zeigt das. Allein aus dem Notenbild ist es nicht möglich, die Lagen sauber zu trennen. Außerdem ergibt es vom Höreindruck ein anderes Bild als im Schriftbild: Abb 7.: Music of Changes (1951), © 1961 Henmar Press Inc., New York; Takt 1-3: rote Linie - Höchste Tonhöhe nach notierter Lage; blaue Linie - Höchste Tonhöhe nach Klangbild Es ist zu sehen, dass Höreindruck und Klangbild nicht immer deckungsgleich sind. Der wichtigste Punkt dabei ist, dass vom Höreindruck her eigentlich überhaupt keine Lagen wahrgenommen werden. Allenfalls liegenbleibende Töne werden als Überlappung interpretiert. Nur die gelegentlichen kurzen Läufe, wie Nebenstehender in Takt 3, geben einen Anhaltspunkt, dass hier nicht nur Töne per Zufallsprinzip nacheinander notiert sind, sondern 110 Gemeint ist offenbar das Concerto für Klavier und Kammerorchester aus dem gleichen Jahr. Hier wurde offenbar nur eine „Lage“ nach Zufallsoperationen komponiert. 111 Revill, Tosende Stille, S. 177. 84 irgendwie zusammenhängend ausgewählt worden sein müssen. Dieser Anhaltspunkt ergibt sich jedoch primär rhythmisch, denn die Tonhöhen suggerieren nicht zwingend einen Zusammenhalt. Was hier deutlich wird, ist, dass Dasein und Form auseinanderstreben (vgl. Kapitel 2.4). Strukturen, die dem Notenbild zu entnehmen sind, spiegeln sich im Höreindruck nicht wieder. Das Phänomen ist nicht unbedingt neu, auch schon viel vorher gab es Inhalte in der Partitur, die vom Hörer nicht herausgehört werden konnten. Diese Tendenz verstärkt sich jedoch im 20. Jahrhundert, in dem Sinne, dass nicht nur Details nicht wahrnehmbar sind, sondern wichtige Teile der Struktur der Tonsprache aus dem Hörbild nicht erkennbar wird. Wenn wir nun annehmen, das Stück wäre vom Zufall organisiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jede Note etwa gleich oft vorkommt, am höchsten. Voraussetzung ist jedoch, dass bei allen Lagen der gesamte Tonraum des Klaviers zugrunde liegt. Je größer der untersuchte Ausschnitt zudem ist, desto genauer und aussagekräftiger ist das Ergebnis. Da das Töne Zählen jedoch einen hohen Zeitaufwand bedeutet, wird der Leser mir verzeihen, dass ich wiederum nur die ersten 4 Takte als Versuchsfeld verwende, und somit in Kauf nehme, dass die Ergebnisse nur bedingt aussagekräftig sind. Ton Häufigkeit Ton Häufigkeit Ton Häufigkeit g4 1 h1 5 cis1 2 d4 1 b1 2 c1 3 c4 2 a1 3 h e 3 2 fis 5 h 2 1 1 as 3 ais 1 1 1 g 4 gis 1 1 2 ges 1 g 1 2 2 1 fis 2 H 2 e2 2 f1 4 B 1 1 3 Fis 1 1 f 2 es 4 2 des c 2 eis 2 dis 3 F 1 2 1 2 D 1 F-1 1 d Die Töne, die hier nicht aufgelistet sind, kommen in dem Ausschnitt nicht vor. Bei einer Gesamtanzahl von 71 Tönen liegt die Häufigkeit von 1 (bzw. 0) bis 5 durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings ist ein Anstieg der Häufigkeit im Bereich der zwei85 und eingestrichenen Oktave auffällig. Dies kann dreierlei bedeuten: 1. es trat bei einigen Lagen eine Tonraumbegrenzung auf 2. die Annahme, dass die Tonauswahl vom Zufall gesteuert wurde, ist falsch 3. die Ungenauigkeit ist zu hoch Ich bin leider nicht in der Lage, mit Sicherheit eine Aussage zu treffen, welche Möglichkeit die Wahrscheinlichste ist112. Man kann nur soviel sagen, dass die häufigsten Töne es2, h1, a1, g1 und f1 nicht unbedingt gut zueinander passen, und schon gar nicht zu eis, dis und as, die in der Häufigkeit danach folgen. Für die Annahme einer aleatorischen Auswahl der Töne spricht die Bandbreite verschiedener Töne, die auch in ihrer Reihenfolge zumindest keinen Zusammenhang suggerieren. Mit der Zunahme der Bandbreite verschiedenster Töne und dem Grad ihrer Verteilung, nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Tonbeziehung proportional dazu ab. Das alles ist jedoch kein sicherer Beweis für oder gegen die Aleatorik. Was hiermit untersucht werden kann, ist das Fehlen von Zusammenhängen, Strukturen und statistischen Präferenzen. Was durch eine Analyse in keinem Fall bewiesen werden kann, ist das Vorhandensein des Zufalls in der Tonauswahl. Gerade weil der Zufall keine Spuren seiner Selbst hinterlässt, ist er nicht nachweisbar. Das liegt daran, dass er einerseits gerade kein System beinhaltet, welches man aufdecken könnte, andererseits aber die Zufallsanalyse auch keine gesicherten Prognosen über eine unsystematische Tonauswahl treffen kann. Auch hier sind die Spuren verwischt. Ob die Willkür der Tonauswahl ästhetisch bedingt ist, oder von nicht-ästhetischen Faktoren (wie Würfel, Münzwurf, Sternenkarten, oder anderen) gespeist wird, ist gar nicht analysierbar. Hier muss man den Aussagen des Komponisten vertrauen. Beim Nachschlagen in der Literatur findet man denn auch Informationen über den tatsächlichen Kompositionsprozess. Offenbar wurden I-Ging Diagramme zur Tonauswahl benutzt. Revill schreibt: „Cage gestaltete die Diagramme achteckig, so daß jedes 112 Es ist natürlich klar, dass in diesem Abschnitt die verschiedenen Erklärungen Cages über die Machart seines Stückes ignoriert werden, um zu einem unabhängigen, überprüfenden Ergebnis zu kommen. 86 davon auch zu den vierundsechzig Hexagrammen in Beziehung gesetzt werden konnte [...] In den Diagrammen für die Klänge stellte er die Klänge in die ungeradzahligen und die Pausen in die geradzahligen Räume. «Alle zwölf Töne waren in allen vier Elementen eines gegebenen Diagramms präsent«, erklärte [Cage], «gleichgültig, ob eine Linie des Diagramms in horizontalem oder vertikalem Sinn gelesen wurde. Nachdem diese Zwölfton-Forderung einmal erfüllt war, wurden Geräusche und Tonwiederholungen mit aller Freiheit verwendet« [...] «Die Music of Changes habe ich komponiert [...] indem ich Klavier spielte, auf Unterschiede achtete und eine Auswahl traf«“113. Offenbar ist dies also eine Mischform. Erst wurden die Klänge in Hexagrammen nach dem Zufallsprinzip sortiert, und dann aber beim Ausprobieren der Ergebnisse eine geschmackliche Auswahl getroffen. 5.2 VARIATIONS I Das die Variations I indeterminiert komponiert wurden, ist bei Einsicht in das Material sofort für jedermann ersichtlich. Die Notation umfasst sechs Klarsichtfolien in einer Kartonhülle mit einer abgedruckten schriftlichen Erklärung. Auf einer Folie befinden sich verschieden große schwarze Punkte, auf den restlichen fünf Folien je fünf schwarze Linien, die Notenlinien ähneln, nur dass sie in alle Richtungen verstreut übereinander liegen. Keine Folie gleicht der anderen. Die Anweisung ist, nach den in der Erklärung definierten Regeln die Linien in ihrem Abstand zu den Punkten in Beziehung zu setzen, und damit Spielanweisungen zu erhalten, die jedoch trotzdem in der Art der Ausführung dem Interpreten überlassen sind. Nach der Größe der Punkte definiert wird dazu eine Anzahl Folien übereinander gelegt und der Punkt zu den Linien räumlich in Beziehung gesetzt. Dabei definiert die Größenklasse des Punktes die Anzahl der zu erzeugenden Geräusche. 113 Revill, Tosende Stille, S. 176-178 . 87 Abb. 8: Folie mit 4 verschiedenen Größen von Punkten aus den Variations I. Da offenbar aufgrund von Materialunsauberkeiten die Anzahl der tatsächlich existenten Punkte die Anzahl der in der Erklärung Definierten bei weitem übersteigt, habe ich versuchsweise die offenbar „Intendierten“ herausgesucht und farbig markiert. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Rot: die 4 größten Punkte Grün: die 3 zweitgrößten Punkte Blau: die 7 zweitkleinsten Punkte Orange: die 13 kleinsten Punkte Ein Beispiel für eine mögliche Zusammenstellung unter Verwendung nur einer Linienfolie: Abb. 9: Möglichkeit einer Zusammenstellung von Folien der Variations I 88 Die Spielanweisungen ergeben sich nun aus der Bewertung des direkten Abstandes des jeweiligen gewählten Punktes von den 5 Linien, wobei jeder Linie symbolisch einem Parameter zugeordnet ist (tiefste Frequenz, einfachste Obertonstruktur, größte Amplitude, kürzeste Dauer und frühestes Vorkommen). Diese Definitionen sind jedoch - wie leicht ersichtlich - relativ ausgesprochen und liegen in ihrem Maß im Ermessen des Ausführenden. In seinem Ermessen liegt es auch, wie genau er die Abstände interpretiert, ob er alle Parameter genau abmisst, oder mit einem flüchtigen Blick alles überschaut und abschätzt. Wenn man sich nun vor Augen führt, dass die fünf herkömmlichen Linien im System einen Verlauf darstellen, also eine zeitliche Richtung angeben, kommt man schnell zu dem Schluss, dass diese zeitliche Richtung hier nicht vorhanden sein kann. Der zeitliche Ablauf ist also nicht im Stück festgelegt. Die Folien geben keine Reihenfolge, keinen Anfang und kein Ende an. Kein Ereignis steht in Beziehung zum Anderen (sondern lediglich zu seinen Parametern). Dieses Werk ist somit kein „Klang-Gebilde“, sondern ein „Klang-Fundus“. Dem aufmerksamen Leser fällt sofort auf, dass dies reine Handlungsanweisungen sind, die über das tatsächliche Klangergebnis in der Realisation nichts aussagen. Noch offensichtlicher wird das, wenn man in der Anfangserklärung liest, dass Anzahl und Art der Instrumente dem Interpreten völlig freigestellt sind. In der legendären Uraufführung bei den Darmstädter Musiktagen 1958 mit Cage und Tudor werden Radios, ein Klavier, aber auch Rasseln und kleine Spielzeuggegenstände zur Aufführung herangezogen, was beim Publikum (nach den festgehaltenen Publikumsreaktionen zu urteilen) offenbar auch einen entsprechend lächerlichen Eindruck gemacht haben wird. Keine Frage also, dass über alle Arten von „Inhalten“ keine Angaben gemacht werden. Die obliegen dem im Moment agierenden Interpreten. Das Klangergebnis ist so ungenau definiert, dass es der jeweiligen Willkür und der momentanen Stimmung des Interpreten überlassen wird, was dabei inhaltlich herauskommt. Lediglich eine Rahmenbegrenzung der Handlungen ist gegeben, die dem Werk eine eingeschränkte Identität als Werk (im theoretischen Sinne) erlauben. Das Stück versteht sich (in seinem Konzept) ausdrücklich als eine zufällig ausgewählte Möglichkeit, einen Ausschnitt der unendlichen Fülle möglicher Klänge innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu 89 produzieren. Als Komposition oder gar festgelegte Sinneinheit im Eggebrecht’schen Sinne von „Identität“ (s. Kapitel 2.4) eines Werkes tritt das Stück in die Bedeutungslosigkeit zurück. Mehr noch, in seiner gedruckten Vorlage ist es als „Stück“ (im Sinne eines zu erwartenden Ergebnisses) so gar nicht existent (und somit auch nicht analysierbar), bis es zur klingenden Ausführung kommt. Dies ist eine neue Dimension von „Werk“, das sich dem Drang nach inhaltlicher Erfassung und struktureller Durchdringung durch den menschlichen Geist erfolgreich widersetzt. Wenn man aber weiter nach dem Grund einer solchen Werkanlage fragt, bietet es durchaus Anlass für wilde Spekulationen. 6. M USIK? Die völlige Freiheit der Indetermination mag dem einen Ausführenden zu geniöser Kreativität herausfordern, in einem Andern lediglich Unbehagen angesichts der Haltlosigkeit erzeugen. Nach der Definition des Stückes ist das Ergebnis jedoch immer gelungen solange die Anweisungen nicht missachtet werden. Es erfolgt keine ästhetische Beurteilung des Ergebnisses. Für den Hörer ist jedoch das (im Aufführungszeitpunkt immer konkrete) Klangergebnis entscheidend. Er unterscheidet dabei nicht, auf welche Art ein Klang erzeugt wurde und was für Vorgaben dafür verwendet wurden. Deshalb ist beispielsweise eine Beethoven Sinfonie - ästhetisch gesehen - vom Klangergebnis her erst einmal mit den „Variations“ absolut gleichzusetzen. Es ist der Prozess des Aufnehmens auditiven Materials und der Versuch, daraus etwas Sinnvolles zu gestalten und sich zum Ergebnis in Beziehung zu setzen. Natürlich stellt der gebildete Hörer jedes Stück dennoch in einen stilistischen Kontext und behandelt also jedes Stück gemäß der verschiedenen Prämissen und Zielen. Dies setzt jedoch eine genaue Kenntnis dieser Prämissen voraus. Was ist aber, wenn er diese nicht kennt, oder aber absichtlich ignoriert, weil er mit einer persönlichen Erwartungshaltung an jedes Stück „Musik“ herangeht? Wird er dann dem Stück nicht gerecht, oder wird das Stück ihm nicht gerecht? 90 In der Indetermination schafft sich jedes Stück sein eigenes Ziel, seine eigenen Prämissen, seine eigenen Definitionen, seine eigene Aussage und seine eigene Form. Wie ich bereits im Kapitel 4.4 dargestellt habe, ist diese Form beim Beispiel Cage eher an speziellen philosophischen Prämissen orientiert, als an traditionell musikalischen. Die Erwartungshaltung des Hörers orientiert sich jedoch meist an tradierten ästhetischen Vorstellungen, die mit dem Begriff „Musik“ verknüpft sind. Sie werden (als spezifischer Teil) mit dem Begriff „Kulturgut“ assoziiert. Dieser bestimmt - überspitzt gesagt - ob ein Ereignis in den Definitionsrahmen passt, oder nicht und somit als „Kunst“ erkannt wird oder nicht. Nicht zu vergessen ist, dass der Hörer sich unter diesen Voraussetzungen einem Phänomen überhaupt aussetzt und diesen ästhetisch betrachtet. Einfach ausgedrückt kann es sein, dass ein in einem Konzert sitzender Hörer Klangereignisse nicht als „Musik“ bzw. „Kunst“ erkennt oder anerkennt, weil sie in seinen Definitionsrahmen nicht hineinpassen. Damit hält er das Ereignis nicht dem Anlass adäquat und reagiert darauf mit Unverständnis oder Gereiztheit114. Hier stellt sich die Frage: Muss er seinen Definitionsrahmen erweitern (unter der Gefahr, dies „blind“ zu tun, da sich die Definitionen nicht von selbst erschließen), oder müsste sich das als „Kunst“ bzw. „Musik“ selbst definierte Ereignis den jeweiligen Prämissen anpassen? Cage selbst hat eigentlich schon in den 50er Jahren in Bezug auf sein Werk nicht mehr auf dem Wort „Musik“ bestanden. Er bezeichnete sein Werk gern als „Geräuschkunst“ oder „Klangorganisation“. „Sie brauchen es nicht für Musik zu halten, wenn dieser Ausdruck Sie choquiert“115 sagte er. Damit trägt er der Verschieden-haftigkeit in der Werkanlage mit dem traditionellen Musikbegriff durchaus Rechnung. Dennoch wird er heute immer noch (meist vereinfachend) vor allem aus historischen Gründen fraglos unter die selbe Kategorie gefasst, wie die Musik vorheriger Jahrhunderte. Das hat auch systematische Gründe, denn kann man eine Trennlinie mitten durch das Schaffen eines Künstlers ziehen? Das führt jedoch auf der anderen Seite immer wieder zu den 114 Aus diesem Anlass ist es im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder zu Tumulten bei Aufführungen gekommen. Das Argument, diese Tumulte habe es schon viel früher gegeben, lasse ich dabei nur eingeschränkt gelten, da die ästhetischen Umstände nie so radikal waren und nie den Begriff „Musik“ bzw. „Kunst“ als Ganzes in Frage gestellt haben. 115 Aus: Metzger, „John Cage oder die freigelassene Musik“; Musikkonzepte, S. 12. 91 Ablehnungsreaktionen der Zuhörer, die unter dem Überbegriff Musik intuitiv etwas Anderes verstehen. Durch eine andere Klassifizierung würde meines Erachtens vieles an Aufregung und Missverständnissen vermeidbar und würde für Cages Kunst unter einem anderem „Label“ viele „Türen“ öffnen. Nicht jedoch ist der Ausdruck „Kunst“ vom Tisch. Cage versteht sich eindeutig als Künstler. Diese Kunst hat - ähnlich wie der Dadaismus - ein kommunikatives Problem im Bezug auf Kunst. Ich möchte in diesem Zusammenhang den bereits erwähnten Satz, Kunst definiere sich nur noch aus der Absicht Kunst zu machen, aufgreifen und aus der Sicht des Konsumenten zur Debatte stellen. Ist dabei nur die äußere Form beliebig, oder kann sich ein Kunstwerk auch seine Prämissen und Zielstellungen frei wählen? Kann es sich beispielsweise dem Prinzip der Kommunikation - also dem geformten Transport von Inhalten - verweigern? Kann es Form und Struktur nicht nur aufweichen, sondern ganz weglassen und sich in einen Pool an Möglichkeiten verwandeln? Kann es funktional intendierte Gegenstände oder Ereignisse „ästhetisieren“, wie bei Cage und vor allem bei den Dadaisten davor geschehen, und dabei unabhängig von der reinen Protesthaltung zu einem „künstlerischen“ Ergebnis kommen? Mir scheint, dass Kunst immer eine „positive“ Aussage hat. Sie präsentiert ein - wie auch immer geartetes - Ergebnis eines Prozesses. Was ist, wenn ein Kunstwerk - wie vor allem im Fall Dadaismus - jedoch nur negiert, protestiert, also kein kreatives, neu schaffendes Ergebnis sondern nur ein verweigerndes, negierend protestierendes Ergebnis hat? Gerät es damit nicht in Konflikt mit seinem fundamentalsten Wesen? Ist es dann noch Kunst oder bloß Satire? Die Ablehnung des kommunikativen Elements in der Kunst führt dazu, dass sich ein Kunstwerk nicht zum Konsumenten in Beziehung setzen muss. Es ist ihm sozusagen gleichgültig, ob und von wem es konsumiert wird und was es für denjenigen bedeutet. Es rückt sich selbst ins Zentrum ohne Berücksichtigung des Empfängers. Das macht es dem Kunstschaffenden leicht, alles Mögliche mit jeglicher Zielstellung zur Kunst zu erheben. Ein Kunstwerk macht jedoch nur Sinn im Empfang des Rezipienten. Es führt kein Eigenleben. Ich glaube deshalb, dass Kunst ohne kreative, intendierte Botschaft als Kunst fragwürdig ist. Ich begebe mich hiermit in die Gefahr der reaktionären Argumentation, die auf Altem beharrt und sich einer natürlichen Erneuerung und Veränderung des Kunstverständnisses verweigert. Für mich steht aber im Mittelpunkt 92 der Versuch der Erklärung, warum die Kunst Cages bei den meisten Menschen keinen Zugang findet, und meiner Einschätzung nach sich auch in Zukunft nicht durchsetzen wird, obwohl sie das Nachdenken über Kunst im 20. Jahrhundert durchaus mitgeprägt hat und in Teilen in ihrer kritischen Haltung und Offenheit für Neues zur konstruktiven Überprüfung des Kunstverständnisses bereits wirksam beigetragen hat. Das Prinzip der Kommunikation von Mensch zu Mensch (wenn auch nicht auf begrifflicher Ebene) und das Spiel von intendiert ästhetischem Reiz, sich aus dem Inneren mitteilend, absichtlich ausgesendet und adäquat auch am anderen „Ende“ verstanden, ist ein ur-altes Prinzip. Dieses wird man nicht auf Dauer umkehren können, zu tief ist es verwurzelt in unserer Kultur und in unserem Wesen. Das ist auch im fernen Osten nicht anders. Beweis dafür ist das Koan des Zen, was ich an den Anfang der Arbeit gestellt habe. An diesem Punkt ist es möglich, Cage mit seinen eigenen Waffen zu schlagen: Was bleibt also, wenn Du auslöschst Sinn und Ton? 93 Anhang LISTE DER HIER VERWENDETEN LITERATUR UND M ATERIALIEN - Joachim-Ernst Berendt, Nada Brahma, Reinbek/Frankfurt 1983-89. - Hans Heinrich Eggebrecht, Musik verstehen, Wilhelmshaven 1999. - Malcolm Budd, Music and the Emotions - The Philosophical Theories, London 1985. - DTV Atlas zur Musik 2, hrsg. von Ulrich Michels, Kassel 1997. - David Revill, Tosende Stille - Eine John-Cage-Biographie, Deutsche Ausgabe, München 1995. - Musikkonzepte, Sonderband John Cage I, hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Rihm, München 1990. - Carl Dahlhaus, „Die Musik des 20. Jahrhunderts“, Handbuch der Musikwissenschaft 7, hrsg. von Carl Dahlhaus, Laaber 1984. - „Noten zu Cage“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage I. - Ulrich Dibelius, Moderne Musik II 1965-85, München 1989. - Martin Erdmann, Art. „Cage, John“, in: MGG 2 Personenteil, hrsg. von Ludwig Finscher, Kassel 2000. - John Cage, Für die Vögel, Berlin 1984. - Schlafes Bruder, Regie Joseph Vilsmaier, nach einem Roman von Robert Schneider, Perathon Film. - Dieter Schnebel, Art.„Wie ich das schaffe? - Die Verwirklichung von Cages Werk“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage I. - Metzger, Art.„John Cage oder die freigelassene Musik“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage I. - Cage, Art. „The future of music“, in: Empty words, Middletown 1979. - Cage, Art. „Rede an ein Orchester“ (Annotation von Michael Nyman), in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage I. - Cage, Anarchic Harmony, hrsg. von Stefan Schädler/Walter Zimmermann, Frankfurt/Mainz 1992. - Cage, Silence, Middeltown 1973. - Cage, Art. „Gedanken eines progressiven Musikers über die beschädigte Gesellschaft“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage I. - Clytus Gottwald, Art. „John Cage und Marcel Duchamp“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage I. - Rainer Riem, Art. „Noten zu Cage“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage I. - Pierre Boulez und John Cage, Correspondance et documents, hrsg. von Jean-Jacques Nattiez u.a., Winterthur 1990. - Stefan Schädler, Art. „Transformationen des Zeitbegriffs in John Cages Music of Changes“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage II, München 1990. 94 - Umberto Eco, Das offene Kunstwerk, Frankfurt 1998. - Peter Böttinger, Art. „Vom Außen und Innen der Klänge“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage I. - Charles Hamm, Art.„Cage, John“, in: The new Grove Dictionary of American Music, hrsg. Wiley Hitchcock, New York 1986. - James Pritchett/Laura Kuhn, Art. „Cage, John“ in: The New Grove (2. Ed.), hrsg. Stanley Sadie, London 2001. - Paul Griffith, Art. „Aleatory“, in: The New Grove. - Klaus Ebbeke, Art. „Aleatorik“, in: MGG 2 Sachteil, hrsg. von Ludwig Finscher, Kassel 2000. - Christian Wolff, Art. „Brief an Heinz-Klaus Metzger“, in: Musikkonzepte, Sonderband John Cage I. - Richard Kostelanetz, John Cage, Köln 1973. - Pascal Decroupet, Art. „Dem Zufall einen bestimmten Raum überlassen“ Teil I und II, in: Vom Innen und Außen der Klänge, <http://www.swr2.de/hoergeschichte/sendungen/000501_08_zufall/index.html> - Cage, Variations I, © 1960 Henmar Press Inc., New York. - Cage, Music of Changes Buch I, © 1961 Henmar Press Inc., New York. - Cage, Variations I, Interpreten: Cage und Tudor, h 1996, col legno, WWE 1CD 31895. - Cage, Amores, Quatuor Helios, h 1989, Wergo, WER 6203-2. - Cage, Music of Changes, Herbert Henck, h 1982/1988, Wergo, WER 60099-50. - Cage, Concert f. piano and orchestra, S.E.M Ensemble/P. Kotik; Joseph Kubera (pno), h 1993, Wergo, WER 6216-2. - Cage, The Perilous Night, Joshua Pierce, h 1988, Wergo, WER 60157-50. 95