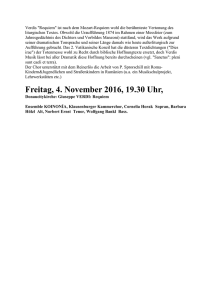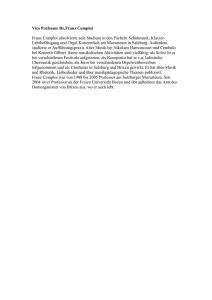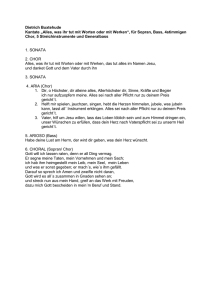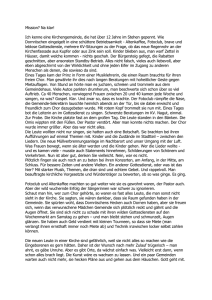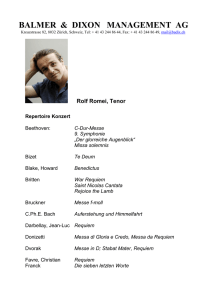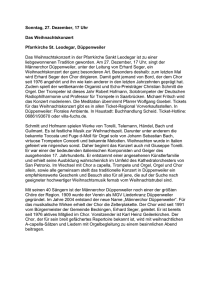Programm Cherubini Brahms dt_c.indd
Werbung

musi ultur Taufers Cherubini | Requiem d-Moll Brahms | Alt-Rhapsodie Männergesangverein Brixen 1862 Männerchöre Neustift und Taufers Auswahlorchester Marlene Lichtenberg Mezzosopran Leitung Christian Unterhofer Samstag 3. November 2012 | Dom zu Brixen | 20.00 Uhr Sonntag 4. November 2012 | Pfarrkirche Sand in Taufers | 18.00 Uhr Programm Luigi Cherubini - Requiem Nr. 2 in d-Moll Luigi Cherubini (1760 – 1842) Requiem Nr. 2 in d-Moll für Männerchor und Orchester Introitus – Kyrie Graduale Dies irae Offertorium Sanctus Pie Jesu Agnus Dei Johannes Brahms (1833 – 1897) Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester op. 53 Ausführende Männergesangverein Brixen 1862 Leitung: Christian Unterhofer Männerchor Neustift Leitung: Rudi Chizzali Männerchor Taufers Leitung: Christian Unterhofer Auswahlorchester Leitung: Günther Ploner Marlene Lichtenberg Mezzosopran Christian Unterhofer Gesamtleitung S. 1: Der Männergesangverein Brixen 1862, der heuer sein 150. Vereinsjubiläum feiert Maria Luigi Carlo Zenobio Salvatore Cherubini wurde 1760 in Florenz geboren. Nach erstem Musik- und Klavierunterricht bei seinem Vater und kontrapunktischen Studien bei dem Komponisten Bartolomeo Felici und dessen Sohn Alessandro studierte er ab 1778 Komposition bei Giuseppe Sarti in Venedig und Mailand. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in London, wo er die Werke Händels kennen lernte, übersiedelte er im Jahr 1787 auf Anregung des Geigers Viotti nach Paris und wurde Inspektor der Königlichen Musikschule. Während der drei Jahre in Paris komponierte er für das Théâtre Feydeau französische Bühnenwerke. Angeregt durch Glucks Opern gelangte Cherubini zu einem neuen Kompositionsstil, der gekennzeichnet ist durch reiche Ausgestaltung des Orchesterapparats, farbige Instrumentation und motivische Arbeit. Aus Wien bekam er 1805 einen Kompositionsauftrag und machte die Bekanntschaft mit Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven. Im gleichen Jahr belagerte Napoleon Wien, und Cherubini wurde mit der Leitung der Hofkonzerte beauftragt. Wieder in Paris entstand eine Messe in F-Dur, die mit großem Erfolg in Paris aufgeführt wurde. Da er zu dieser Zeit mit Opernkompositionen weit weniger Glück hatte, begann er sich mit Instrumentalmusik zu beschäftigen. Er ging auf Einladung der Philharmonischen Gesellschaft im Jahr 1815 nach London und schrieb dort eine Sinfonie in D-Dur, eine Ouvertüre und eine vierstimmige Hymne. Ein Jahr später erhielt Cherubini eine Anstellung als Kompositionsprofessor und übernahm bis kurz vor seinem Tod die Leitung des Pariser Konservatoriums. Von seinen weiteren Kompositionen seien zwei Requien, ein achtstimmiges Credo und die Streichquartette erwähnt. Cherubini gilt als Reformer der französischen Oper und Begründer des neuen Stils, der die französische Oper in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts führend machte. Einige seiner Werke zählen zu den ersten „Rettungsopern“, (etwa Der Wasserträger, 1800) zu denen auch Beethovens Fidelio (1805) zu rechnen ist. Überhaupt ist der Einfluss Cherubinis auf Beethoven nicht zu unterschätzen. Charakteristisch für ihn ist die motivische Durcharbeitung der Begleitstimmen und die perfekte Verschmelzung von Wort und Musik. Das Requiem Nr. 2 in d-Moll für Männerchor und Orchester wurde 1834–36 auf Anregen des Pariser Erzbischofs komponiert. Der damalige Erzbischof von Paris kritisierte 1834 Cherubinis erstes Requiem (Requiem in c-Moll), weil es auch Frauenstimmen verlangt, und untersagte eine Aufführung an einer Trauermesse in Paris. In der Folge komponierte der schon im hohen Alter sich befindende Cherubini das Requiem in d-Moll nur für Männerstimmen, brauchte aber zwei Jahre bis zur Fertigstellung im September 1836. Die Uraufführung fand am 25. März 1838 in Paris statt. Wenngleich das erste Requiem ein größerer Erfolg war und heutzutage weitaus öfter aufgeführt wird, zeugt das zweite von nicht minderer musikalischer Qualität und wurde als große kirchenmusikalische Schöpfung gefeiert. Auf Wunsch des Komponisten wurde es an dessen eigener Beerdigungszeremonie im Frühling 1842 aufgeführt. Nach seinem Tod gerieten er und seine Werke größtenteils in Vergessenheit, so auch dieses Requiem, welches heutzutage im Gegensatz zum Requiem in c-Moll selten aufgeführt wird. Für die Besetzung wählte Cherubini ein klassisches Orchester: 1 Flöte, 1 Piccoloflöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 2 Pauken sowie Streicher. Die Chorstimmen wurden entsprechend der französischen Gepflogenheit als dreistimmiger Männerchor komponiert, wobei häufige Stimmteilungen in allen drei Lagen oft zu vier- oder gar fünfstimmigen Abschnitten führen. Der Introitus steht in der Grundtonart d-Moll und beginnt nach kurzer orchestraler Einleitung mit polyphoner Sequenzierung von mehreren kurzen Chorthemen. Als Hauptinstrument wird das Violoncello verwendet. Die Violine kommt erst beim Dies Irae zu ihrem ersten Einsatz. Nach einer Reprise des ersten Themas folgt das in B-Dur stehende Kyrie, welches gegen Ende nach d-Moll zurückmoduliert und mittels Plagalschluss von g-Moll nach D-Dur den Chorsatz beendet. Der orchestrale Ausklang am Schluss hingegen moduliert wieder in die Grundtonart d-Moll zurück. Das Graduale beginnt mit einer kurzen a-Moll-Kadenz, welche vom Chor imitiert und dann einmal in der Paralleltonart F-Dur sequenziert wird. In den folgenden sequenzierenden Themen wird die für Cherubini bekannte chromatische Stimmführung deutlich. Das Stück endet auf A-Dur. Die durchkomponierte Totensequenz (Dies irae) wechselt im ersten Teil zwischen homophonen Fortissimo-Abschnitten und kanonisierten und imitierten polyphonen Tonfolgen in mezzopiano. Nach der Stelle „Judex ergo“ kehrt eine vermeintliche Ruhe ein, welche durch das Fortissimo des „Rex tremendae“ gebrochen wird, aber bis zu „fons pietatis“ wieder zurückkehrt. Den folgenden Abschnitt kürzte Cherubini durch das „Polytexturverfahren“ (jede Stimme singt gleichzeitig je zwei Verse allein) bis zum kurzen lautstarken „Confutatis“, das wiederum in einen ruhigen Abschnitt führt. Nach dem klagenden „Lacrimosa“ wird für das abschließende „Pie Jesu“ nach D-Dur gewechselt. Wie im Kyrie kehrt die Tonart aber während des orchestralen Ausklangs nach d-Moll zurück. Das in F-Dur stehende Offertorium beginnt majestätisch mit der Anrufung des Königs der Ehren, des Herrn Jesus, und geht über in einen ruhigen, mit viel Chromatik verzierten Teil. Das lieblich klingende „Sed signifer“ wird von den Tenören mit den hohen Orchesterstimmen alleine gesungen, bevor die Bässe zur kurzen rasanten Fuge „Quam olim Abrahae“ ansetzen. Wieder in Larghetto und d-Moll steht das anschließende „Hostias et preces“, welches wiederum viel Chromatik aufweist. Den Schluss bildet die Reprise der Fuge „Quam olim Abrahae“, welche in den folgenden Engführungen verlängert und mit den chromatischen Elemente der homofonen Teile zuvor vereint wird. Das feierliche Sanctus steht in B-Dur und ist am Anfang und gegen Schluss durchgehend forte bis fortissimo; einzig der kurze Mittelteil „Benedictus“ ist piano. Das Pie Jesu beginnt mit einem kurzen Klarinettenmotiv in Begleitung der Holzbläser in g-Moll, welches vom Chor a cappella dreimal verarbeitet wird; in den Chorpausen dazwischen erklingt immer wieder das Klarinettenmotiv mit der Holzbläserbegleitung. An den dritten Chorteil schließt sich beim Wort „sempiternam“ eine kurze Überleitung zu einer vierten Verarbeitung an. Der orchestrale Schluss der Holzbläser nimmt nochmals das Motiv auf, bevor unisono auf G geendet wird. Das abschließende Agnus Dei steht wieder in der Grundtonart d-Moll. Das Thema wird dreimal imitierend wiederholt, und jedes Mal schließt sich der A-cappella-Satz „dona eis requiem“ an, wobei jedes Mal harmonisch variiert wird. Eine kurze Steigerung zum „Lux aeterna“ markiert den ersten Höhepunkt, welcher im „Quia pius es“ wieder verlassen wird. Hierbei singen die einzelnen Chorstimmen nacheinander eine absteigende Melodiefolge in B-Dur. Der lange Schlusston der Bässe führt zum Schlussteil, in welchem die Bässe auf dem D einen Orgelpunkt imitieren und von den Tenören auf dem A um zwei Takte versetzt als Kanon gefolgt werden. Zur finalen Steigerung des Chores ins Forte des „luceat eis“ wird nochmals nach D-Dur gewechselt, bevor nach dem unisono auf D endenden Chorschlussakkord das Orchester das Requiem ruhig und wieder in d-Moll zurückgekehrt ausklingen lassen. Johannes Brahms: Alt-Rhapsodie Entsprechend den drei vertonten Strophen ist die Komposition dreiteilig. Die erste Strophe (c-Moll) wird von einem kurzen Orchestervorspiel (Adagio) eingeleitet, das von dissonanten Akzenten und einer absteigenden Linie mit Seufzerfiguren in den Fagotten, Celli und Bässen, begleitet von Tremoli der Geigen und Bratschen, bestimmt wird. Die hinzutretende Altstimme ist expressiv-rezitativisch geführt. Die zweite Strophe – ebenfalls in c-Moll – ist als dreiteilige Arie komponiert. Für die Führung der Solostimme sind, wie bereits in der 1. Strophe, extreme Intervallsprünge bis hin zur Duodezime charakteristisch. In der dritten Strophe tritt in Untermalung der Altstimme ein hymnischer Männerchor hinzu, gemäß dem hoffnungsvolleren Text in Art einer Fürbitte („Ist auf Deinem Psalter, Vater der Liebe, ein Ton seinem Ohr vernehmlich, so erquicke sein Herz“) erfolgt eine Wendung nach C-Dur, in dem das Werk versöhnlich schließt. Aber abseits wer ist’s? Im Gebüsch verliert sich der Pfad. Hinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Öde verschlingt ihn. Ach, wer heilet die Schmerzen Des, dem Balsam zu Gift ward? Der sich Menschenhass Aus der Fülle der Liebe trank? Erst verachtet, nun ein Verächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eigenen Wert In ungenugender Selbstsucht. Ist auf deinem Psalter, Vater der Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquicke sein Herz! Öffne den umwölkten Blick Über die tausend Quellen Neben dem Durstenden In der Wüste! Johannes Brahms schrieb die „Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester“ op. 53 nach einem Text von Johann Wolfgang von Goethe (Fragment aus „Harzreise im Winter“) im Jahre 1869. Die Uraufführung erfolgte am 3. März 1870 in Jena mit dem dortigen Akademischen Gesangverein. Die Ausführenden Männergesangverein Brixen 1862 Mit dem „Ziel der Pflege des deutsche Liedes in der Heimat, weiters der Pflege des anspruchsvollen Gesanges im Allgemeinen, sowie der Förderung eines gehobenen Gesellschaftslebens in der Vaterstadt Brixen“ ging im Jahre 1862 die Gründung unseres Vereines aus dem sog. „Dr.-Krapfschen-Quartett“ hervor. Seit dieser Zeit – unterbrochen wurde die Sangestätigkeit lediglich durch die faschistische Zwangsauflösung im Jahre 1926, um dann nach dem Zweiten Weltkrieg seine Tätigkeit wieder aufzunehmen – trägt der Chor maßgeblich zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Bischofsstadt Brixen sowie im südlichen Tirol bei. Die Pflege der traditionellen Männerchorliteratur aber ebenso das echte Volkslied sowie die Einbeziehung geistlicher Chorwerke bildeten die Schwerpunkte der musikalischen Vereinsarbeit. Seit dem Frühjahr 2007 steht Christian Unterhofer aus Lappach am Dirigentenpult des Männergesangvereins Brixen. Von Kindesbeinen an singt und musiziert er, bildet sich fort und ist immer musikalisch unterwegs. Im Jahr 1996 übernahm er den Ahrntaler Männerchor und leitete diesen bis 2006. Von 2003 bis 2009 stand er dem Kirchenchor Sand in Taufers als musikalischer Leiter vor. Seit mehreren Jahren leitet er die Bürgerkapelle Sand in Taufers. Besondere Akzente setzte er mit der Gründung des bekannten Männerviergesanges „Tauernquartett“, dem „Ahrntaler Doppelquartett“ und dem „Lappacher Viergesang“. Als künstlerischer Leiter steht er zudem seit einem Jahr der Kulturinitiative „Musikultur Taufers“ vor. Christian Unterhofer hat in den ersten Jahren seines Wirkens im Männergesangverein Brixen bereits einige Akzente gesetzt. Besonders wichtig ist ihm das Einüben und Beherrschen verschiedenster Volkslieder. Jedoch auch die Männerchorklassiker von F. Schubert, R. Schumann und anderen großen Meistern dürfen da nicht fehlen. Beim Symposion Musik & Kirche im Jahr 2008 wagte man sich auch mit Erfolg auf das Terrain zeitgenössischer Musik. Der Chorleiter des Männergesangvereins Brixen 1862 hat durch seine schwungvolle Art und sein attraktives Wirken den Chor erneut jung gemacht. Derzeit zählt der Chor 60 sangesfreudige Brixner Männer. Im Jahr 2000 hat Alfred Ellecosta aus Brixen den Vereinsvorsitz als Obmann übernommen und leitet seitdem rührig und geschickt den Männergesangverein Brixen. Im heurigen Jahr 2012 feiert der Verein sein 150jähriges Bestandsjubiläum. Hervorzuhe- ben ist die zu diesem Anlass erschienene CD „stimmgewaltig“ mit einem bunten musikalischen Querschnitt. Ein besonderer Höhepunkt im Vereinsleben war die Teilnahme am internationalen Chorwettbewerb in Prag im Herbst 2001, wobei der Chor die Goldmedaille erzielte. Auch beim Gesamttiroler Wertungssingen im November 2010 hat der Chor mit „ausgezeichnetem Erfolg“ teilgenommen. Der Chor ist durch seine sängerische Tätigkeit fest im Brixner Stadtleben verankert, er setzt aber neben dem Singen auch gesellschaftliche und kulturelle Akzente, wobei auf das „Stadtlerlåchn“ sowie die Herausgabe der „Hoblschoatn“ im Fasching hingewiesen wird. Nicht zuletzt darf der gesellschaftspolitische Wert des Vereines hervorgehoben werden, ein unbezahlbarer Wert, dem gerade in der heutigen Zeit immer größere Bedeutung beigemessen werden muss. Männerchor Neustift Der Männerchor Neustift wurde im Jahre 1959 von sechs jungen Sängern welche als Sängerknaben in der Klosterschule von Prof. Josef Gasser, dem langjährigen Stiftschorleiter und Stiftsorganisten eine gediegene Gesangsausbildung erhalten hatten, gegründet. Heute zählt der Chor 33 aktive Mitglieder und steht unter der Leitung von Prof. Rudi Chizzali. Seit seiner Gründung war und ist der Männerchor Neustift stets aufgeschlossen für Neues ohne jedoch die Tradition zu vergessen und bewährte Pfade zu verlassen. Er hat sich die Pflege des Chorgesangs unter Berücksichtigung geselliger und anspruchsvoller Literatur zum Ziel gesetzt. Stilistisch spannt sich der Bogen vom Volkslied über die Klassik bis hin zu zeitgenössischen Werken. Mit weltlichen und geistlichen Konzerten tritt der Chor immer wieder an die Öffentlichkeit. Besondere Höhepunkte in der nunmehr 53-jährigen Geschichte des Chores waren der erste Platz mit höchster Punktezahl beim „1. Gesamttiroler Wertungssingen“ 2001 in Sterzing, der zweite Platz beim „Europäischen Volksliedwettbewerb für Männerchöre“ 2002 in Bozen und wiederum der erste Platz mit höchster Punktezahl (97 von 100 möglichen Punkten) beim „2. Gesamttiroler Wertungssingen“ 2004 in Innsbruck. Gleich zwei Preise (1. Preis in der Kategorie „Männerchor“ und „Sonderpreis für die beste Interpretation eines Chorwerkes von Franz Schubert“) erhielt der Chor im November 2005 beim „22. Internationalen Schubert-Chorwettbewerb“ in Wien. Männerchor Taufers Im Jahre 1981 hatte der damalige Kulturassessor der Gemeinde, Lehrer Eduard Auer, singfreudige Männer aus Taufers eingeladen, den Chor zu gründen. Somit konnte man im Februar 2011 auf eine 30-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Ein Jahr nach der Gründung zählte der Verein 33 Mitglieder und in letzter Zeit hat der Chor Zuwachs auch aus der jüngeren Generation. Derzeit gehören dem Verein 39 aktive Sänger an. Von den Gründungsmitgliedern sind noch acht aktiv im Chor tätig. Die musikalische Leitung hatten anfangs Hans Corradini und Anton Haidacher gemeinsam inne. 14 Jahre leitete Josef Mair am Tinkhof aus Uttenheim den Männerchor Taufers, gefolgt von Josef Stifter aus Weißenbach, der die Leitung im Frühjahr 2007 an Siegfried Mair am Tinkhof aus Mühlwald abgab. Seit 2009 dirigiert Christian Unterhofer aus Lappach die Gruppe. Obmann des Chores ist seit 2008 Reinhold Voppichler. Der Verein organisiert Konzerte wie das alljährliche Frühjahrskonzert und pflegt auch den Kirchengesang. Mit sehr gutem Erfolg beteiligte sich der Chor am 4. Gesamttiroler Wertungssingen im Jahr 2011 in Innsbruck. Marlene Lichtenberg wurde in ihrem Heimatdorf Latzfons von dem deutschen Dirigenten Fritz Weisse entdeckt. Daraufhin studierte sie am Mozarteum Salzburg und an der Janáček Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Brünn (CZ) Chorleitung und Gesang. Ihre Gesangsausbildung erhielt sie von dem erfolgreichen tschechischen Bass-Bariton Richard Novak. In Liedklassen und Meisterkursen arbeitete die Mezzosopranistin u. a. mit Janina Baechle, Vito Maria Brunetti, Hilde Zadek und Mara Zampieri. Ihr Operndebüt gab Marlene Lichtenberg im Sommer 2007 beim Opernfestival von Avenches (Schweiz). Als Opernsängerin trat sie außerdem in Turin als „Maddalena“, im Stadttheater Bozen als „Julie“ (Boesmans), im Staatstheater von Košice (SK) und in Nordhausen als „Ulrica“, in Sirmione als „Zia principessa“ auf. Weitere Engagements führten sie nach Catania, ins „Teatro Massimo Bellini“ als 1. Magd (Elektra). Im Mai 2010 debütierte sie im Theater von Liberec in der Rolle der „Carmen“ von Bizet. Im September 2010 gastierte Marlene Lichtenberg in „Romeo et Juliette“ an den Opernhäusern Pisa, Ravenna und Trient. Neben ihren zahlreichen Opernauftritten ist die Mezzosoparnistin auch eine gefragte Konzertsolistin und Liedinterpretin. Im Oratorienfach begeisterte sie im „Weihnachtsoratorium“ und in der „h-Moll Messe“ in der Beethovenhalle Bonn. In Bremen konnte man sie im Requiem von W. A. Mozart hören und in Berlin trat sie mit dem Ensemble Nobiles auf. Seit November 2010 ist Marlene Lichtenberg Ensemblemitglied des Staatstheaters Cottbus. Hier singt sie u.a. Amneris, Jezibaba und die Erda. Im Oktober 2011 hat sie in Cottbus den Max Grünebaum Preis erhalten. Die renommierte Wiener Opernzeitschrift Der Neue Merker bezeichnete sie als eine große Hoffnung für das Alt-Fach. Kartenvorverkauf Tourismusverein Brixen, Regensburger Allee 9, Tel. 0472 836401 Karten Euro 20, Senioren und Familienpass Euro 15, Jugendliche, Studenten und Kulturpass Euro 10 Gefördert von Mit freundlicher Unterstützung durch Herrn Arnold Gasser