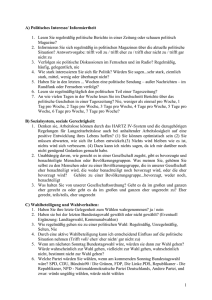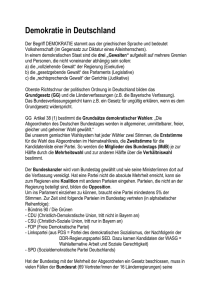Frank Decker (Hamburg) Über das Scheitern des neuen
Werbung
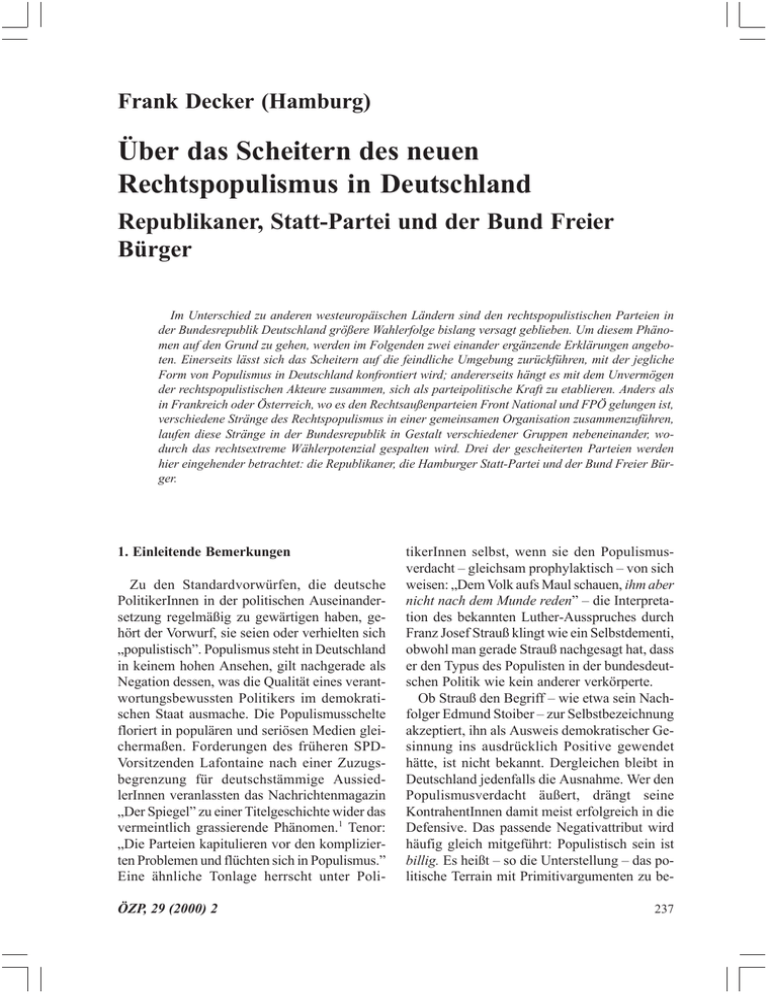
Frank Decker (Hamburg) Über das Scheitern des neuen Rechtspopulismus in Deutschland Republikaner, Statt-Partei und der Bund Freier Bürger Im Unterschied zu anderen westeuropäischen Ländern sind den rechtspopulistischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland größere Wahlerfolge bislang versagt geblieben. Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, werden im Folgenden zwei einander ergänzende Erklärungen angeboten. Einerseits lässt sich das Scheitern auf die feindliche Umgebung zurückführen, mit der jegliche Form von Populismus in Deutschland konfrontiert wird; andererseits hängt es mit dem Unvermögen der rechtspopulistischen Akteure zusammen, sich als parteipolitische Kraft zu etablieren. Anders als in Frankreich oder Österreich, wo es den Rechtsaußenparteien Front National und FPÖ gelungen ist, verschiedene Stränge des Rechtspopulismus in einer gemeinsamen Organisation zusammenzuführen, laufen diese Stränge in der Bundesrepublik in Gestalt verschiedener Gruppen nebeneinander, wodurch das rechtsextreme Wählerpotenzial gespalten wird. Drei der gescheiterten Parteien werden hier eingehender betrachtet: die Republikaner, die Hamburger Statt-Partei und der Bund Freier Bürger. 1. Einleitende Bemerkungen Zu den Standardvorwürfen, die deutsche PolitikerInnen in der politischen Auseinandersetzung regelmäßig zu gewärtigen haben, gehört der Vorwurf, sie seien oder verhielten sich „populistisch”. Populismus steht in Deutschland in keinem hohen Ansehen, gilt nachgerade als Negation dessen, was die Qualität eines verantwortungsbewussten Politikers im demokratischen Staat ausmache. Die Populismusschelte floriert in populären und seriösen Medien gleichermaßen. Forderungen des früheren SPDVorsitzenden Lafontaine nach einer Zuzugsbegrenzung für deutschstämmige AussiedlerInnen veranlassten das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel” zu einer Titelgeschichte wider das vermeintlich grassierende Phänomen.1 Tenor: „Die Parteien kapitulieren vor den komplizierten Problemen und flüchten sich in Populismus.” Eine ähnliche Tonlage herrscht unter PoliÖZP, 29 (2000) 2 tikerInnen selbst, wenn sie den Populismusverdacht – gleichsam prophylaktisch – von sich weisen: „Dem Volk aufs Maul schauen, ihm aber nicht nach dem Munde reden” – die Interpretation des bekannten Luther-Ausspruches durch Franz Josef Strauß klingt wie ein Selbstdementi, obwohl man gerade Strauß nachgesagt hat, dass er den Typus des Populisten in der bundesdeutschen Politik wie kein anderer verkörperte. Ob Strauß den Begriff – wie etwa sein Nachfolger Edmund Stoiber – zur Selbstbezeichnung akzeptiert, ihn als Ausweis demokratischer Gesinnung ins ausdrücklich Positive gewendet hätte, ist nicht bekannt. Dergleichen bleibt in Deutschland jedenfalls die Ausnahme. Wer den Populismusverdacht äußert, drängt seine KontrahentInnen damit meist erfolgreich in die Defensive. Das passende Negativattribut wird häufig gleich mitgeführt: Populistisch sein ist billig. Es heißt – so die Unterstellung – das politische Terrain mit Primitivargumenten zu be237 setzen, nicht um der Sache, sondern um der vordergründigen Gunst öffentlicher Zustimmung willen zu streiten, sich dem vermeintlichen Volkswillen anzubiedern (während man für sich selbst den Mut des Unpopulären reklamiert). Ein solches Verdikt ist nicht unbedingt ehrenrührig, selbst dann nicht, wenn darin der Vorwurf der Unredlichkeit mitschwingt. In seiner Unverbindlichkeit hat der Populismusvorwurf etwas wohltuend Unverfängliches; er trifft die/den andere/ n, ohne sie/ihn wirklich auszugrenzen oder zu stigmatisieren und ist in der Auseinandersetzung wohl gerade deshalb so schnell bei der Hand. Jemanden einen Populisten zu schelten, kostet den/der AngreiferIn also nicht viel, im Gegenteil: Der Vorwurf ist so wohlfeil, dass eine zu häufige Verwendung selbst „billig” wäre und auf den/die UrheberIn zurückfallen könnte. Populistische Parteien und Bewegungen haben nicht nur in Deutschland einen schlechten Ruf, wenngleich die negative Konnotation des Begriffs hier besonders ausgeprägt zu sein scheint (zum sozialwissenschaftlichen Populismuskonzept allgemein vgl. Ionescu/Gellner 1969; Canovan 1981) . Dieser auf ausländische BeobachterInnen bisweilen befremdlich wirkende anti-populistische Reflex ist vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte leicht verständlich. Er entspringt der traumatischen Erfahrung eines Landes, dessen ohnehin verspätete erste Demokratie an einer Massenbewegung zugrunde gegangen ist, die deutlich populistische Züge trug. Obwohl Hitler auch bei der letzten noch halbwegs freien Reichstagswahl im März 1933 keine eigene Mehrheit erringen konnte, ist er doch nicht gegen, sondern durch das Volk an die Macht getragen worden. Die Konsequenzen für die Begründung der zweiten deutschen Demokratie sind bekannt: Von tiefem Misstrauen in die Demokratiefähigkeit der Deutschen geprägt, haben die Verfassungsgeber ein System geschaffen, das der Verführbarkeit des Volkswillens künftig jeden erdenklichen Riegel vorschieben sollte. Die in der Nachkriegszeit noch überwiegend normativ ausgerichtete Politikwissenschaft reflektierte dies in einem merkwürdig dichotomisierten Demokratieverständnis, bei dem sich plebiszitäre und repräsentative Komponenten nach Art eines Null238 summenspiels scheinbar unvereinbar gegenüberstehen (Puhle 1986, 23). Der von den Populisten hochgehaltene Plebiszitgedanke hat zwar – u.a. durch die Parteien – an Boden gewonnen, doch wird diese Entwicklung mit größerem Argwohn betrachtet als anderswo: Die Abweichung vom „anti-populistischen Konsens” ist in der Bundesrepublik bis heute gering geblieben. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn der parteiförmig organisierte Populismus in Deutschland eine zwiespältige und – im Vergleich zu anderen Ländern – ziemlich bescheidene Erfolgsbilanz aufweist. Nicht nur, dass die neuen populistischen Parteien in der Bundesrepublik sehr spät in Erscheinung getreten sind – größere Wahlerfolge erzielten sie erst gegen Ende der achtziger Jahre; ihre Höhenflüge blieben von vornherein auf die kommunale und Länderebene beschränkt und waren auch dort zumeist nur von kurzer Dauer. Lediglich in Baden-Württemberg ist es den rechtspopulistischen Republikanern (REP) 1996 gelungen, ihr Wahlergebnis von 1992 annähernd zu halten (9,1 gegenüber 10,9%); in den übrigen Ländern konnte sich die Partei ebensowenig etablieren wie die rechtsextreme Konkurrenz von NPD und DVU2 oder andere Neugründungen, die eine gemäßigtere Version des Populismus bevorzugen (Statt-Partei, Bund Freier Bürger). Die diskontinuierlichen Wahlerfolge spiegeln sich in der wissenschaftlichen Rezeption wider: Standen zunächst die Ursachen des Aufschwungs der neuen populistischen Parteien (vor allem: der Republikaner) im Zentrum des Interesses, so setzte sich bald die Einsicht durch, dass es um die Überlebensfähigkeit solcher Parteien in der Bundesrepublik nicht zum Besten bestellt ist. Zwei Erklärungsmöglichkeiten bieten sich für die vergleichsweise Schwäche an: Zum einen könnte es sein, dass die Durchsetzungschancen des rechten Populismus aufgrund der beschriebenen Vorbelastungen in Deutschland an anspruchsvollere Voraussetzungen gebunden sind als anderswo. Wie die Wahlerfolge der Republikaner gezeigt haben, gibt es einen Nährboden für populistischen Protest auch in der Bundesrepublik, doch wird die Organisierbarkeit dieses Protests (in Gestalt neuer Partei- en) durch die Stigmatisierung der Vergangenheit wesentlich erschwert. Die Integrationskraft der „Altparteien” muss darum möglicherweise höher veranschlagt werden, als nach den Anfangserfolgen des neuen Populismus zu erwarten war. Die zweite Erklärung geht davon aus, dass die Voraussetzung einer Etablierung in Deutschland genauso günstig oder ungünstig liegen wie in anderen Ländern – allein hätten es die neu entstandenen Akteure versäumt, die sich ihnen bietenden Gelegenheiten zu nutzen. Verwiesen wird hier auf die mangelhafte Organisationsstruktur und Darstellungskompetenz der populistischen Parteien, die zur inneren Konsolidierung nicht in der Lage waren und deren negatives Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit eine längerfristige WählerInnenbindung vereitelte. Symptomatisch für die Durchsetzungsschwäche des neuen Populismus ist seine organisatorische Zersplitterung. Während es der französische Front National (bis zur Spaltung der Partei 1999) und die österreichische FPÖ geschafft haben, verschiedene Stränge des populistischen Protests in einer gemeinsamen Partei zusammenzuführen, verlaufen diese Stränge in der Bundesrepublik in Gestalt mehrerer Gruppierungen nebeneinander. Die hier betrachteten Parteien – Republikaner, Statt-Partei und Bund Freier Bürger – haben sich, was ideologische Ausrichtung und elektorale Strategie betrifft, wechselseitig kaum beeinflusst. Ihre Agenden werden von ganz unterschiedlichen Themen beherrscht, die in der jeweiligen Programmatik oben anstehen: bei den Republikanern war und ist das die Ausländerpolitik, bei der Statt-Partei die institutionelle Reform des Parteienstaates, beim Bund Freier Bürger die Ablehnung des europäischen Maastricht-Prozesses. Andere Themen bleiben dem untergeordnet oder werden nur am Rande behandelt. Dies gilt insbesondere für das Wohlfahrtsstaatsissue, das in Deutschland sicher nicht weniger Anknüpfungspunkte für eine Profilierung bieten würde als in vergleichbaren Ländern. Nachdem mit Hermann Fredersdorfs Bürgerpartei die Erstauflage einer Steuersenkungspartei in den 70er Jahren gescheitert war, wurde das Thema in den 90ern von den neuen Kräften erst gar nicht (oder nur halbherzig) bedient – den Nutzen hatten die FDP sowie Teile der Union. Ein weiteres Erschwernis für die neuen Parteien stellten die Folgen des deutschen Vereinigungsprozesses dar. Nicht nur, dass es in der ehemaligen DDR an einer breiten Mittelschicht fehlte, aus der sich der Anhang des Populismus hätte speisen können; auch die reichlich vorhandene Unzufriedenheit wirkte sich dort nicht zugunsten der Newcomer aus, da mit der PDS eine andere, genuin ostdeutsche Protestalternative bereitstand: Die Kombination von linkem und regionalistischem Populismus sicherte der SED-Nachfolgepartei in den neuen Ländern Stimmenanteile, von denen ihre rechtspopulistischen Konkurrenten im Westen nur träumen konnten. 2. Rechtspopulistische Parteien in Deutschland 2.1 Die Republikaner Nachdem die extreme Rechte in Deutschland fast zwei Jahrzehnte ein Schattendasein gefristet hatte, begann mit dem Überraschungsergebnis der Republikaner bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus Anfang 1989 eine ungeahnte Erfolgsserie, an der neben den Republikanern auch andere Parteien der extremen Rechten wie DVU und NPD partizipierten. Größere Wahlerfolge solcher Parteien hatte es in der Bundesrepublik schon zweimal vorher gegeben. Die erste Welle des Rechtsextremismus setzte in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein, als mehrere rechte Splitterparteien dank der noch nicht eingeführten Sperrklausel in den ersten Bundestag einziehen konnten und bei den nachfolgenden Landtagswahlen zum Teil zweistellige Stimmergebnisse erreichten. Die damaligen Erfolge waren ein direktes Produkt der alten Ordnung des Nationalsozialismus, aus dessen Anhängerschar sich die WählerInnen der Rechtsaußenparteien ausnahmslos rekrutierten (vgl. Stöss 1991, 106–115). Dass der organisierte Rechtsextremismus in den fünfziger Jahren rasch abebbte und in politische Bedeutungslosigkeit fiel, lag zum einen an der repressiven Vorgehensweise des Staates (Verbot der Sozia239 listischen Reichspartei durch das Bundesverfassungsgericht 1952 und Auflösung weiterer rechtsextremer Gruppierungen), zum anderen – noch wichtiger – am erfolgreichen Bemühen der Unionsparteien, die rechtsextremen WählerInnen in das Lager der Bürgerlichen zu überführen. In den 60er Jahren geriet dieses Erfolgsmodell vorübergehend unter Druck. Die Rezession von 1966/67 bescherte der Republik eine Wirtschaftskrise, während auf außenpolitischem Gebiet erste Schritte in Richtung Entspannung unternommen wurden, um die Konfrontation zwischen Ost und West abzubauen. Politische Konsequenz der veränderten Lage war die Bildung der Großen Koalition (1966), die aus Sicht der Union eine Linksverschiebung ihrer bisherigen Politik darstellte. Dies und das gleichzeitige Aufkommen der Außerparlamentarischen Opposition (APO) verbesserten die Ausgangslage für die extreme Rechte erheblich und führten zu einer Reihe spektakulärer Wahlergebnisse der erst 1964 gegründeten NPD, die zwischen 1966 und 1968 in sieben Landesparlamente einziehen konnte und bei der Bundestagswahl 1969 die Fünf-Prozent-Marke nur um wenige Zehntelprozente verfehlte (ebd., 144–150). Die erstmalige Bildung einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung mit ermöglichend, trug das knappe Scheitern der NPD dazu bei, dass die Partei von der Bildfläche ebenso schnell wieder verschwand wie sie aufgetaucht war. Das Jahr 1969 markiert insoweit in der Entwicklung des organisierten Rechtsextremismus eine wichtige Zäsur: In ihrer Oppositionsrolle konnten sich CDU und CSU von nun an verstärkt nach rechts orientieren; dadurch gelang es ihnen, das rechtsextreme Wählerpotenzial auszutrocknen und die oppositionellen Kräfte im eigenen Lager zu bündeln (Jaschke 1990, 17). Die NPD hatte dem wenig entgegenzusetzen. Von innerparteilichen Streitigkeiten aufgerieben, zerfiel sie seit 1971 in zahlreiche Splittergruppen, deren politische Wirkung gegen Null ging. Erst Mitte der achtziger Jahre, als die NS-belasteten Altfunktionäre einer jüngeren Führungsgeneration Platz machten, zeichnete sich eine allmähliche Wiederbelebung ab, die unter dem theoretischen Einfluss der Neuen 240 Rechten auch zu programmatischen Innovationen führte. Befördert wurde der Aufschwung durch die 1987 gegründete DVU-Liste D des Verlegers Gerhard Frey, dessen Zusammenarbeit mit der NPD das jahrelange Schisma der alten Rechte beendete. Indem Frey seinen publizistischen Apparat nun auch parteipolitisch in den Dienst der rechtsextremen Sache stellte, trug er zu den anschließenden Wahlerfolgen von DVU und NPD maßgeblich bei (ebd., 18–21). Dass diese Erfolge erst im Windschatten der Republikaner möglich wurden, steht auf einem anderen Blatt. Vergleicht man die Stimmergebnisse der drei Parteien, so zeigen sich, was WählerInnenstruktur und -motive angeht, kaum Unterschiede (s.u.). Aus Sicht der WählerInnen schien es demnach keine große Rolle zu spielen, für welche der drei Rechtsparteien sie im Einzelfall votierten. Anders liegen die Dinge auf der Angebotsseite. Während sich DVU und NPD bis heute als rechtsextreme Sammelbecken verstehen, verkörperten die Republikaner – zumindest in der Anfangsphase – weniger eine extremistische denn eine rechtskonservative Partei mit starker Affinität zum rechten Unionsflügel. Die unterschiedlichen Ausgangslagen lassen sich an der Entstehungsgeschichte ablesen. Während DVU und NPD von der veränderten politischen Konstellation profitierten, die durch die Regierungsübernahme der Union 1982/83 eingetreten war, sind die Republikaner – als Abspaltung von der bayerischen CSU – aus dieser Konstellation hervorgegangen. Gegründet wurde die Partei im November 1983 von den beiden Bundestagsabgeordneten Franz Handlos und Ekkehard Voigt, die ihrer Partei aus Verärgerung über den von Franz Josef Strauß vorgenommenen Kurswechsel in der Ost- und Deutschlandpolitik den Rücken gekehrt hatten. Als drittes Gründungsmitglied gesellte sich mit dem früheren Fernsehjournalisten Franz Schönhuber ein weiterer CSU-Renegat hinzu. Den Anlass der Verärgerung bildete ein von Strauß vermittelter Milliardenkredit an die DDR, dessen politische Folgewirkungen im eigenen Lager der bayerische Ministerpräsident offenbar unterschätzt hatte. Bis dahin galt Strauß als Garant dafür, dass CDU und CSU ihre Gefolgschaft bis weit nach rechts integrieren konnten. Unter den Bedingungen der Opposition noch leicht zu befriedigen, nahm der Integrationsbedarf ab 1982 stark zu, da sich die unionsgeführte Regierung unter Bundeskanzler Kohl auf eine radikale Abkehr von der alten Politik nicht verstehen mochte. Nachdem die von Kohl versprochene „geistigmoralische Wende” in der Praxis folgenlos blieb, begann sich die konservative Publizistik lautstark auf CDU und CSU einzuschießen (ebd., 35–48). Elektoral war das für die beiden Schwesterparteien solange verschmerzbar, wie die Kritik von der Integrationsfigur Strauß aufgenommen und absorbiert wurde. Erst dessen eigene „Wende” öffnete den politischen Raum nach rechts und verhalf den Republikanern zu einem ersten Achtungserfolg bei der bayerischen Landtagswahl im Oktober 1986 (3,0%). Als der CSU-Vorsitzende zwei Jahre später starb, war das Abbröckeln des rechten Unionsrandes bereits in vollem Gange (zur Entstehungsgeschichte der Republikaner vgl. Jaschke 1990 und Neubacher 1996). Die innerparteiliche Entwicklung der Republikaner verlief bis zu diesem Zeitpunkt und auch später wenig verheißungsvoll. Von ihrem Vorsitzenden Handlos als eine Art „bessere CSU” betrachtet, gelang es der Partei, zahlreiche Mitglieder und FunktionsträgerInnen von der Union zu sich herüberzuziehen, was ihr im bürgerlichen Lager zunächst eine gewisse Reputierlichkeit verschaffte. Der gleichzeitige Zustrom von rechtsextremen Kräften sorgte jedoch dafür, dass sich die innerparteiliche Balance schon bald zugunsten derjenigen verschob, die wie Schönhuber einem stärker nationalpopulistischen Kurs der Partei das Wort redeten. Nach Handlos’ Entmachtung ging der Vorsitz 1985 auf Schönhuber über, unter dessen Ägide die Brücken zum organisierten Rechtsextremismus immer mehr verstärkt wurden. Symptomatisch für die Neuausrichtung war, dass mit Harald Neubauer ein ehemaliger Funktionär der NPD zum Generalsekretär und – später – Bundessprecher der Partei avancierte. Der Erfolg in Bayern änderte nichts daran, dass der Aufbau der parteilichen Strukturen insbesondere in den norddeutschen Bundesländern nur schleppend voranging. Die Republikaner konnten darum weder bei der Hamburger Bürgerschaftswahl im November 1986 noch bei der Bundestagswahl im Januar 1987 antreten. Wo sie sich zur Wahl stellten – in Bremen (September 1987), Baden-Württemberg und SchleswigHolstein (Mai 1988) – blieben die Stimmergebnisse deutlich unter den Erwartungen. Der Erfolg in Berlin kam insoweit auch für die Partei selbst überraschend – die Republikaner gewannen mehr Parlamentssitze als sie mit eigenen KandidatInnen besetzen konnten. Unterstützt durch die erhöhte Medienaufmerksamkeit setzte sich der Erfolg bei den Europawahlen fort (Juni 1989); die 7,1%, die man damals erzielte, bedeuten bis heute das beste Ergebnis der Republikaner bei einer bundesweiten Wahl. Die Hoffnung, der elektorale Durchbruch würde zur inneren Stabilisierung beitragen, erfüllte sich allerdings nicht. Der rasche Anstieg der Mitgliederzahlen und die gleichzeitig erfolgte finanzielle Besserstellung der Partei – dank großzügig fließender Wahlkampfkostenerstattung – ermöglichten zwar den weiteren Ausbau der Organisation; sie waren jedoch nicht imstande, den innerparteilichen Machtkämpfen entgegenzuwirken, die in der Folge an Heftigkeit sogar zulegten. Die autoritären Strukturen der Partei erwiesen sich als untauglich, eine Lösung der inneren Konflikte herbeizuführen, weshalb sich der Unmut der Basis fast zwangsläufig über Schönhuber und dessen Führungsstil entlud. Von den Befürwortern eines gemäßigten Kurses unter Druck gesetzt, behielt dieser in der Konfrontation mit den rechtsextremen Kräften zunächst die Oberhand und drängte in Harald Neubauer seinen wichtigsten Kontrahenten aus der Partei. Das hinderte den Vorsitzenden nicht, sich später seinerseits für ein Zusammengehen mit den Rechtsextremen auszusprechen, um die strategische Lage der Republikaner zu verbessern. Damit hatte Schönhuber den Bogen freilich überspannt. Von der Partei zum Rückzug gezwungen, musste er das Feld für den badenwürttembergischen Landesvorsitzenden Rolf Schlierer räumen, der zuvor bereits Schönhubers Stellvertreter gewesen war (Dezember 1994). Unter Schlierer gerieten die Republikaner in ein ruhigeres Fahrwasser, was sich elektoral jedoch kaum auszahlte und auch bei der Mitglieder241 entwicklung zu keinen nennenswerten Fortschritten führte.3 Die Parteiorganisation bleibt somit weiterhin eine wesentliche Schwachstelle, die der Verstetigung der Wahlergebnisse im Wege steht. Dies wirft natürlich die Frage auf, warum die Republikaner bei einigen Wahlen trotzdem so gut abgeschnitten haben. Darüber Aufschluss geben kann ein Blick auf die „Nachfrageseite”. Was zunächst die Motive der WählerInnen betrifft, sind in der Literatur unterschiedliche Thesen vertreten worden. Die einen sehen in der Wahl der Republikaner den Ausdruck eines politischen Protests, der aus Deprivationsgefühlen herrühre und von der Unzufriedenheit mit den vorhandenen Parteien bestimmt werde (Veen/ Lepszy/Mnich 1991/92). Dass sich die Unzufriedenheit in der Wahl einer Rechtsaußenpartei kundtut, ist nach dieser Lesart eher zufällig, weil von der Struktur des politischen Angebots abhängig. Sind Alternativen nicht verfügbar (wie etwa die PDS in Ostdeutschland), könnte sich der Protest genauso gut in einem höheren Nichtwähleranteil niederschlagen. Andere Autoren ziehen diese Interpretation in Zweifel, indem sie auf den Gesinnungscharakter der Wahlentscheidung verweisen (Butterwegge 1997). Das Votum für die Republikaner erkläre sich danach wie das Votum für verwandte Parteien in früheren Zeiten aus dem Vorhandensein rechtsextremer Anschauungen und Wertorientierungen. Vorliegende Untersuchungen bestätigen diese Ansicht, wenngleich man berücksichtigen muss, dass die ermittelten Rechtswählerpotenziale von den zugrunde gelegten Einstellungsindikatoren abhängen und darum beträchtlich schwanken können (Falter/ Klein 1994, 147–153). Dennoch stehen beide Erklärungsansätze nicht in Widerspruch zueinander. Wie Jürgen Falter und Markus Klein in ihren wahlanalytischen Studien nachgewiesen haben, tragen rechtsextreme Einstellungen zur Wahl einer rechtsextremen Partei nicht automatisch bei, sondern erst im Zusammentreffen mit politischer Unzufriedenheit – das Fortbestehen eines rechtsextremen Bodensatzes der Wählerschaft auch in Deutschland unterstellt, wäre die relative Erfolglosigkeit solcher Parteien in der Bundesrepublik ansonsten kaum zu erklären. 242 Ebenso wichtig ist aber auch der umgekehrte Zusammenhang, wonach Proteststimmung einer Verbindung mit rechtsextremen Überzeugungen bedarf, um die Wahrscheinlichkeit der Rechtswahl zu erhöhen; sind diese Überzeugungen nicht vorhanden, äußerst sich die Unzufriedenheit eher als Nichtwahl oder wird sie von den bestehenden Parteien absorbiert. Der Protest kann also verborgene rechtsextreme Einstellungen politisch aktualisieren. Damit wird die zugrunde liegende Unzufriedenheit zur entscheidenden Bestimmungsgröße, um den wechselhaften Erfolg der Republikaner zu erklären. Empirische Untersuchungen zeigen, dass RechtswählerInnen dem politischen System gegenüber stärkere Entfremdungsgefühle hegen als die WählerInnen anderer Parteien (Veen/ Lepszy/Mnich 1991/92, 46–52). Die Gründe dafür werden ersichtlich, wenn man die Rangfolge der als wichtig erachteten Themen betrachtet. Unter den abgefragten Problemfeldern gab es 1993 lediglich zwei, nämlich „Asyl/Ausländer” und „Parteienverdruss”, die von den WählerInnen von Rechtsparteien häufiger genannt wurden als von denen der übrigen Parteien, wobei das Erstgenannte mit 57% der Nennungen klar an der Spitze lag (Falter/Klein 1994, 107–115). Die zeitliche Entwicklung der Themenkonjunktur macht deutlich, dass die Wahlerfolge der Rechtsparteien in hohem Maße an das „Asyl-/Ausländerproblem” gekoppelt waren (und sind). Im bayerischen Landtagswahlkampf 1986 noch ohne nennenswerte Bedeutung, wurde das Thema 1989 erstmals nach vorne gebracht, wobei die Großstädte Berlin und Frankfurt a.M. in ihrer Problemkombination von hohem Ausländeranteil, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot für einen Wahlerfolg ebenso gute Voraussetzungen boten wie die vergleichsweise unwichtige (und daher als willkommene Protestgelegenheit geschätzte) Europawahl. Eine direkte Verbindungslinie zwischen Wahlergebnissen und Dominanz des Ausländerthemas lässt sich im Jahr 1992 ziehen, als die innenpolitische Agenda der Bundesrepublik von der Auseinandersetzung um das Asylrecht beherrscht wurde. Man mag darüber streiten, ob dieser Auseinandersetzung ein objektiv gestiegener Problemdruck zugrunde lag (starker Zu- strom von AsylbewerberInnen infolge der Grenzöffnung im Osten), oder ob sie aus parteipolitischem Interesse lediglich geschürt wurde. Fest steht, dass das Thema von den großen Parteien aufgegriffen und in einer Weise entschieden wurde, die der extremen Rechte entgegenkam (Young 1995); gerade dadurch konnte sich diese in ihren Bemühungen legitimiert fühlen und die Einschränkung des Asylrechts als eigenen Erfolg reklamieren. Nachdem mit der Änderung des GrundgesetzArtikels 16 die Voraussetzung für eine drastische Reduktion der AsylwerberInnenzahlen geschaffen worden war, wurde das Thema im öffentlichen Bewusstsein von anderen Problemen wie der steigenden Arbeitslosigkeit wieder verdrängt, bei denen die etablierten Parteien einen klaren Kompetenzvorsprung vor den Republikanern aufwiesen. Die programmatische Fixierung auf das „Ausländerproblem” brachte den Rechtsextremen insofern nur kurzfristigen Erfolg. Dass sie sich damit zum Gefangenen ihrer politischen Gegner machten (denen es oblag, die für nötig gehaltenen Änderungen herbeizuführen), war die eine Sache. Eine andere, wichtigere Sache war, dass die Kehrtwende beim Asyl das „Ausländerproblem” auf eine Normallage zurückwarf, die der Partei ohnehin kaum Angriffsflächen bot. Der Grund dafür liegt in der merkwürdigen Gleichzeitigkeit von „Öffnung” und „Schließung”, welche der bundesdeutschen Ausländerpolitik von Anfang an eigen war. Einerseits herrschte (und herrscht) in Deutschland eine relativ großzügige Einwanderungspraxis, ablesbar am hohen Anteil der ausländischen „Gastarbeiter”, den zahlreich aufgenommenen Bürgerkriegsflüchtlingen und einer – bis 1992 – äußerst liberalen Asylgesetzgebung. Die Großzügigkeit ist nicht allein, aber doch zum großen Teil ein Reflex des nationalsozialistischen Erbes, das der Bundesrepublik die Verpflichtung auferlegt hat, dem Fremdenhass zu wehren und sich der Welt als „ausländerfreundliches” Land zu präsentieren. Diese Verpflichtung bedeutet, dass sich die extremen Rechtsparteien hüten müssen, in allzu große Nähe zum Nationalsozialismus zu geraten (Kitschelt/McGann 1995, 203–207). Auf der anderen Seite hielt die offizielle (Regie- rungs)politik lange Zeit an der Doktrin – KritikerInnen sagen: Fiktion – fest, wonach die Bundesrepublik kein Einwanderungsland sei. In diesem Fall steht die extreme Rechte vor dem Problem, dass sich der konservative Mainstream von ihrer eigenen Position nicht allzu sehr unterscheidet. An der Vorstellung der ethnisch reinen Nation orientiert, teilen beide ein Identitätsverständnis, das jegliche Form des Multikulturalismus ablehnt und eine echte Integration darum weder für wünschenswert noch für machbar hält (Koopmans/Kriesi 1997). Ob das auch in Zukunft so bleiben wird, ist allerdings fraglich. Parlamentarische Mehrheiten für eine integrationsfreundlichere Ausländerpolitik gab es schon in der Regierungszeit Helmut Kohls, doch wurde eine Verständigung darüber vom Mehrheitsflügel der CDU und der bayerischen CSU blockiert. Die von der rot-grünen Bundesregierung betriebene Reform des Staatsangehörigkeitsrechts stellt die Unionsparteien heute vor die unangenehme Situation, ihre ablehnende Haltung in verbaler Konkurrenz zu den Rechtsaußenparteien vertreten zu müssen. Damit könnten sich die Mobilisierungschancen der extremen Kräfte wieder verbessern: In dem Maße, wie die Union unter Druck gerät, sich einer Reform nicht gänzlich zu verschließen, würde ihre Integrationsfähigkeit nach rechts wahrscheinlich nachlassen und der elektorale Spielraum für die Rechtsaußenparteien größer (vgl. Minkenberg 1998 und Karapin 1998a). Um die rückliegenden Erfolge der Republikaner zu verstehen, ist ein Blick auf die Struktur ihrer Wählerschaft nötig. Die Priorität des Ausländerthemas in deren Augen ist ja kein Zufall; sie spiegelt sich in den erwähnten rechtsextremen Einstellungen wider, die wiederum in Zusammenhang stehen mit sozialen und Statusmerkmalen. Wie die NSDAP in den 30er und die NPD in den 60er Jahren, erzielten die Republikaner unter ArbeiterInnen überdurchschnittlichen Zuspruch; Pfahl-Traughber (1994, 78) bezeichnet sie insoweit treffend als „Volkspartei mit Unterschichtenbauch”. Die parteipolitische Herkunft der WählerInnen täuscht über diesen Sachverhalt in gewisser Weise hinweg. Wanderungsanalysen haben ergeben, dass der größere Teil der Republikaner-WählerInnen 243 (rund 40%) aus dem Unionslager stammt; lediglich 20% geben an, bei der vorausgegangenen Wahl für die SPD gestimmt zu haben (Falter/Klein 1994, 23–26). Eine genauere Betrachtung zeigt freilich, dass es sich bei der erstgenannten Gruppe nicht um traditionelle UnionswählerInnen handelt, sondern um solche, die früher der SPD zugeneigt waren. Die soziale Zusammensetzung deutet darauf hin, dass die WählerInnen der Republikaner zu den sog. „ModernisierungsverliererInnen” gehören. Diese gibt es im Prinzip in allen sozialen Schichten, sie konzentrieren sich jedoch auf diejenigen Teile der Gesellschaft, denen es schlechter geht als dem Durchschnitt, die weniger qualifiziert sind und sich in einer Position mit ungewissen Zukunftsaussichten befinden (Falter/ Klein 1994, 61–79). Unabhängig davon, ob der soziale Abstieg real oder nur empfunden ist, tendieren solche Personen zu Abwehrreaktionen, die sich in Vorurteilen und einseitigen Schuldzuweisungen niederschlagen. Hier liegt der Konnex zum „Ausländerproblem”. Wahlanalysen haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit der Rechtswahl allein von dessen Perzeption abhängt und nicht von der „objektiven Problemlage” (z.B. dem jeweiligen AusländerInnen-Anteil). Eine Ausnahme besteht lediglich in bezug auf die Kriminalität: Sind AusländerInnen daran übermäßig beteiligt, nimmt die Unterstützungsbereitschaft für die Rechtsparteien zu. Deren Wahlchancen steigen also erst, wenn zwischen AusländerInnen und sozialen Problemen eine Verbindung existiert oder unterstellt wird. Ist dies nicht der Fall, geht die Unterstützungsbereitschaft sogar zurück: Je mehr AusländerInnen in einem bestimmten Gebiet leben und zur „einheimischen” Bevölkerung Kontakt haben, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Vorurteile abgebaut und die WählerInnen gegen eine Stimmabgabe nach rechts immunisiert werden (Chapin 1997). Offen bleibt, warum die Republikaner das Potenzial der Modernisierungsopfer, das in der Bundesrepublik nicht geringer sein dürfte als in anderen Ländern, in der Vergangenheit nur sporadisch ausschöpfen konnten. Kitschelt/McGann (1995, 206) argumentieren, dass es die Partei nicht geschafft habe, eine dauerhafte elektorale 244 Gewinnerkoalition aufzubauen, so wie es z.B. Le Pen in Frankreich gelungen sei. Der Grund dafür liege im fehlenden neoliberalen „Appeal”: Während der Front National und andere Parteien des neuen Populismus aus einer breit angelegten Wohlfahrtsstaatskritik Nutzen zögen, bleibe das deutsche Pendant infolge seiner ethnozentrischen Verengung auf die Wählerbasis der alten Rechten beschränkt. Neuere Untersuchungen haben die Abhängigkeit der rechtsextremen Wahlerfolge von der Gunst des Ausländerthemas bestätigt: Auch innerhalb der Bundesrepublik fallen die Wahlergebnisse unterschiedlich aus, je nachdem, ob das Thema hoch im Kurs steht oder nicht (Karapin 1998a). Das Fehlen eines weitergehenden programmatischen Anspruchs hat in erster Linie interne Ursachen; es verweist darauf, dass sich die Befürworter einer rechtskonservativen Linie innerhalb der Partei nicht durchsetzen konnten. Daneben lassen sich aber auch objektive Erschwernisse erkennen. So stehen in der Bundesrepublik alle rechten Parteien vor der Problem, dass im Osten des Landes mit marktradikalen Inhalten elektoral nichts zu gewinnen ist. Für die Republikaner birgt die Vereinigung besondere Brisanz, weil ihre west- und ostdeutschen Klientelen gleichermaßen zu den sozialen Verlierern gehören und daher leicht gegeneinander ausgespielt werden können. Gemessen an der Abwägung zwischen Wohlfahrtschauvinismus (West) und Sozialpopulismus (Ost) ist die Partei bis heute eine rein westdeutsche Unternehmung geblieben, wodurch sie das Unzufriedenheitspotenzial im Osten weitgehend der linkspopulistischen PDS überlassen hat (vgl. Neugebauer/Stöss 1999, 135). Ob es die Republikaner schaffen werden, ihre Wählerbasis in Zukunft zu verbreitern, scheint nach dem Gesagten selbst im Westen eher unwahrscheinlich. Voraussetzung dafür wäre eine Öffnung in Richtung desjenigen Teils der Bevölkerung, dem es objektiv betrachtet noch gut geht, der aber gleichfalls von Modernisierungsängsten geplagt wird und um den erreichten Wohlstand fürchtet. Bezüglich der wirtschaftspolitischen Aussagen der Republikaner finden sich in der Literatur unterschiedliche Einschätzungen. Während einige Autoren (z.B. Saalfeld 1993) einen dezidiert neoliberalen Tenor ausmachen, heben andere die egalitären, mithin linken Programmelemente hervor (Pappi 1990). Die Unsicherheit darüber rührt einerseits aus ungenauen Formulierungen, zum anderen aus dem insgesamt geringen Stellenwert des Themas. Nur bei einer stärkeren Priorität hätten sich die Republikaner als Vertreter einer veritablen Neuen Rechten empfehlen können. So aber ist es ihnen weder gelungen, die altrechten Tendenzen im eigenen Bereich zu neutralisieren, noch waren sie imstande, dem bürgerlichen Lager ernsthaft zuzusetzen oder auch nur das Aufkommen populistischer Konkurrenzparteien zu verhindern. Der Wiederholungserfolg bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat daran nichts Wesentliches geändert. Immerhin zeigt er, dass bei konsolidierter Organisation und halbwegs seriöser Parlamentsarbeit eine Etablierung zumindest auf regionaler Ebene möglich bleibt. Diese relativ günstigen Bedingungen lassen sich freilich ebenso wenig auf andere Länder oder den Bund übertragen wie die speziellen Themen des baden-württembergischen Landtagswahlkampfes, der das „Ausländerproblem” – dank einer von der SPD angestoßenen Kampagne in Sachen Aussiedlerpolitik – einmal mehr in den Vordergrund gerückt hatte (Fascher 1997). Selbst wenn es den Republikanern gelingt, sich ideologisch und organisatorisch fester zusammenzuschließen,4 bleibt das Problem, dass die Partei nach Schönhubers Abgang an populistischem Elan stark eingebüßt hat. Kompetenz in der Darstellung nach außen ist jedoch unter Wirkungsgesichtspunkten unabdingbar und lässt sich durch Stabilität im Innern nicht ohne weiteres aufwiegen! Dies gilt umso mehr, als die Rechtsparteien in der bundesdeutschen Medienöffentlichkeit einen schweren Stand haben, der ihre Chancen im politischen Wettbewerb bisweilen unfair beeinträchtigt. 2.2 Die Hamburger Statt-Partei Der Hamburger CDU-Fraktionsvorsitzende Ole von Beust bezeichnete die Statt-Partei einmal als „uneheliches Kind der Hamburger CDU”. Richtig daran ist, dass die von Markus Wegner Mitte 1993 ins Leben gerufene Wählervereinigung das unmittelbare Produkt innerparteilicher Zustände der Hamburger Christdemokraten ist. Die Gründung der Statt-Partei wurde möglich, nachdem das Hamburgische Verfassungsgericht im Mai 1993 die Bürgerschaftswahlen von 1991 aufgrund schwerwiegender Demokratieverstöße beim Kandidatenaufstellungsverfahren der CDU für ungültig erklärt und eine Wiederholung der Wahl angeordnet hatte – ein bis dato in der Bundesrepublik nicht gekannter Vorgang. Für die Entstehung der Statt-Partei von Bedeutung war dabei weniger das Urteil an sich als seine politische Folgewirkung. Obwohl man davon ausgehen konnte, dass die Bürgerschaft nur für den zweijährigen Rest der Legislaturperiode (und das heißt zugleich: auf eigene Kosten der Parteien) neu gewählt werden würde, verständigten sich die Fraktionen darauf, im Wege der Selbstauflösung eine komplette Neuwahl herbeizuführen, was angesichts der vom Gericht bestrittenen Legitimationsgrundlage des Parlaments eine zweifelhafte Konsequenz darstellte. Dies und der Umstand, dass ein solches Verfahren geeignet war, mögliche Alternativen zu den etablierten Parteien auf weitere vier Jahre aus dem Landesparlament herauszuhalten, hat Markus Wegner (1994, 53/54) später als Auslöser für die Gründung der Statt-Partei bezeichnet. Hinzu kommt, dass Wegner, der sich als Exponent der innerparteilichen Oppositionsbewegung schon seit längerem in den Vordergrund gespielt hatte, die CDU noch vor der Verfassungsgerichtsentscheidung verließ, weil er nach eigenem Bekunden an die Erneuerungsfähigkeit der Partei nicht mehr glaubte. Auch eine Organisation wie die 1991 gegründete Hamburger Vereinigung DemO (Demokratische Offenheit) erschien ihm wenig geeignet, eine Reform der Parteiendemokratie anzustoßen, weil sie sich gerade nicht als Konkurrentin der vorhandenen Parteien begriff, sondern das Ziel verfolgte, diese Parteien durch Demokratisierung für die BürgerInnen wieder attraktiver zu machen (Stubbe-da Luz 1994, 273–290). Ihre „Kopflastigkeit” ergab zudem, dass die Breitenwirkung einer solchen Bürgerinitiative nicht 245 ausreichte, die angemahnten Reformen zu erzwingen. Aus dieser Einsicht wollte Wegner die Konsequenzen ziehen: Nach seiner Ansicht war den vorhandenen Parteien nur mehr mit der „Macht des Stimmzettels” beizukommen, bedurfte es also einer wählbaren Alternative, um die nötigen Veränderungen in Gang zu setzen. Die Resonanz des Gründungsaufrufs und das Engagement seiner neu gewonnenen MitstreiterInnen schienen Wegner Recht zu geben. Angefangen von der gelungenen Wortschöpfung „Statt-Partei” über die organisatorischen Leistungen beim Aufbau der Wählervereinigung bis hin zur programmatischen und personellen Darstellung gelang es der neuen Gruppierung in kürzester Zeit, den Hamburger WählerInnen für den anstehenden Urnengang ein passables Angebot zu machen. Insbesondere die programmatische Selbstbeschränkung erwies sich im Ergebnis als richtig kalkuliert: Sie bedeutete nicht nur, aus der Not der kurzen Wahlvorlaufzeit (drei Monate) eine Tugend zu machen und die Dinge aufs Wesentliche zu konzentrieren, sondern lag auch im Sinne der Statt-Partei-Idee selbst, die eine Stärkung der Eigenverantwortung von BürgerInnen und PolitikerInnen reklamierte und darum mit der Forderung nach möglichst weitgehenden inhaltlichen Vorgaben unvereinbar war. Die als Wahlkampfplattform beschlossenen Programmgrundsätze der Statt-Partei liefen auf eine schonungslose Kritik des vorhandenen „Parteienstaates” hinaus, dessen überzogenen Herrschaftsanspruch es durch institutionelle Korrekturen zurückzudrängen gelte. Im einzelnen wurden dazu eine Erweiterung der demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten der BürgerInnen (durch Änderung des Wahlrechts, Einführung von Elementen direkter Demokratie, u.ä.), eine Stärkung der Unabhängigkeit und Gemeinwohlorientierung von MandatsträgerInnen (durch Unvereinbarkeitsregelungen und die Absage an jeden Fraktionszwang) sowie der Rückzug von ParteienvertreterInnen aus Behörden, Rundfunkanstalten und öffentlichen Unternehmen gefordert. Obwohl fast alle von der Statt-Partei thematisierten Erscheinungen auf bundesweite Ursachenhintergründe verweisen, wäre der 246 Wahlerfolg – sie erreichte bei der Bürgerschaftswahl auf Anhieb 5,6% der Stimmen – kaum so deutlich ausgefallen, wenn nicht die Hamburger Politik für die vermeintliche Krise des Parteienstaates besonders gutes Anschauungsmaterial geboten hätte. Kritik und Unmut richteten sich dabei zum einen auf den erwähnten Zustand der CDU (und die damit verbundene Schwäche ihrer Oppositionsrolle), zum anderen auf die Abnutzungserscheinungen einer praktisch ununterbrochenen Regierungsmacht SPD mitsamt dem in der Hansestadt so notorischen „roten Filz”. Hinzu kamen die Umstände des Hamburger Diätendebakels von 1991, als Regierung und CDU-Opposition den (vergeblichen) Versuch unternommen hatten, eine Neuordnung der Abgeordnetenbesoldung mit zum Teil massiven Diätenerhöhungen an der Öffentlichkeit vorbei zu beschließen. Zwar konnte Parteigründer Wegner in seinem Plädoyer für die bundesweite Ausdehnung der Wählervereinigung (als vollgültiger Partei) zu Recht argumentieren, dass all diese Punkte auf gesamtsystemische Probleme zurückführten und folglich auch auf dieser Ebene angegangen werden mussten – gerade darin unterschied sich die Statt-Partei von den kommunalen Wählergemeinschaften süddeutscher Provenienz. Der Ausdehnungsbeschluss vom Januar 1994 und die gleichzeitige Verabschiedung einer Bundessatzung folgten jedoch vielmehr ganz pragmatischen Überlegungen. Da sich Statt-Parteien in anderen Bundesländern notfalls auch ohne Zutun oder Zustimmung des Hamburger Originals bilden würden, stand nicht die Ausweitung der Idee zur Debatte, sondern allein die Frage, ob und in welcher Form eine solche Ausweitung von Hamburg aus kontrolliert betrieben werden konnte und sollte. Obwohl von den BefürworterInnen ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass der Ausdehnungsbeschluss keine Vorentscheidung über eine etwaige Teilnahme der Partei an der bevorstehenden Europawahl bedeuten sollte, trat genau dieser Effekt ein. Den Hamburger Delegierten gelang es zwar, der ersten ordentlichen Bundesversammlung (im März 1994) das Zugeständnis abzuringen, wonach die Teilnahme an der Wahl erst in Frage komme, wenn eine annähernd flächendecken- de Organisation der Partei erreicht sei; die eigentliche Schwierigkeit einer organisatorischen Ausweitung wurde damit jedoch nur notdürftig verdeckt. Anders als unter den überschaubaren Bedingungen des Hamburger Stadtstaates war in den größeren Flächenländern (z.B. Bayern und Nordrhein-Westfalen) ein kontrollierter Aufbau der Partei in weniger als drei Monaten nicht zu bewerkstelligen. Schon bei der niedersächsischen Landtagswahl hatte sich gezeigt, dass sich zwielichtige Personengruppen den noch unbeschädigten Ruf der Statt-Partei als Trittbrettfahrer zunutze machen konnten, ohne mit deren eigentlichen Zielen und Grundsätzen allzu viel im Sinn zu haben.5 Auch die Gruppierung, die sich in Nordrhein-Westfalen unter dem Namen „Die Unabhängigen” zusammengefunden hatte und die Anerkennung als Landesverband begehrte, stand im Verdacht, von Personen des rechten politischen Spektrums unterwandert zu sein. Nachdem der Bundesvorstand der Partei gegen den Willen des Vorsitzenden Bernd Schünemann (Bayern) entschieden hatte, die Gründung des Landesverbandes NRW erst nach einer genauen Prüfung der eingegangenen Mitgliedsanträge zu betreiben, kam es auf der bereits einberufenen Konstituierungsversammlung in Wuppertal zu tumultartigen Szenen. Was folgte, war das „politische Chaos”: eine Serie juristisch ausgefochtener Streitigkeiten und Scharmützel (Absetzung des Vorsitzenden, einstweilige Verfügungen, Anberaumung von Bundesversammlungen und -vorstandssitzungen, Abwahl des Bundesvorstandes, Wahl eines Gegenvorsitzenden usw.), mit denen sich die Statt-Partei aller Chancen begab, auf Bundesebene bald eine nennenswerte Rolle zu spielen. Ihre Wahlergebnisse bei der Europa- und späteren Bundestagswahl sowie bei den Landtagswahlen (wo sie kandidiert hatte) bewegten sich in einer Größenordnung, die sogar die sicher geglaubte Beteiligung an der staatlichen Wahlkampfkostenerstattung (ab 0,5% der Zweitstimmen) vereitelte und die Partei damit auch finanziell an den Abgrund brachte. Wo liegen die Gründe dafür, dass sich die Senkrechtstarter binnen weniger Wochen selbst ins politische Abseits manövrierten? Immerhin hatten im Vorfeld der niedersächsischen Land- tagswahl in einer bundesweiten Umfrage rund 50% der Befragten betont, dass sie die StattPartei (oder eine ähnliche Bürgerbewegung) für eine notwendige Ergänzung des bestehenden Parteiensystems hielten. In derselben Umfrage bekundeten 6% der WählerInnen ihre feste Absicht, einer solchen Partei die Stimme zu geben, während weitere 23% sich dies zumindest vorstellen konnten (Feist 1994). Parteigründer Wegner sprach öffentlich die Vermutung aus, dass sich hinter den internen Querelen womöglich eine gezielte Aktion politischer Kräfte verberge, die ihre eigene Position in der bürgerlichen Mitte durch das Aufkommen der Statt-Partei gefährdet sähen (Wegner 1994, 122–129). Für eine geplante Unterwanderung durch UnionsanhängerInnen oder Mitglieder der Republikaner gab es freilich weder konkrete Belege noch – was die CDU/CSU anbelangt – nachvollziehbare politische Gründe. Die Union befand sich ja schon vor der Europawahl in einem deutlichen Aufwind der WählerInnengunst, was ein aggressives Vorgehen gegen die Statt-Partei keineswegs nahelegte. Stattdessen sollte der Vorwurf der Unterwanderung wohl über die unangenehme Einsicht hinweg täuschen, dass die Statt-Partei eine natürliche Anziehungskraft für rechte Sektierer(gruppen) besaß – nicht nur aus Gründen der Selbstprofilierung, wie Wegner mit Blick auf die „Machthungrigkeit” mancher Funktionäre meinte, sondern auch und gerade aufgrund der bewussten Offenheit ihrer inhaltlichen Vorstellungen. Bereits in Hamburg war deutlich geworden, dass der programmatische Konsens der Partei im Bereich ihrer institutionellen Forderungen (mehr Bürgernähe und -beteiligung, Bekämpfung von Parteienfilz und Ämterpatronage, Stärkung inner- und zwischenparteilicher Demokratie) und die große Bandbreite und Heterogenität der materiell-politischen Auffassungen unter den Mitgliedern6 nur zwei Seiten derselben Medaille darstellten: Die reklamierte Offenheit der inhaltlichen Aussagen – als Prinzip – stand der erforderlichen programmatischen Integration der Willensbildung offenkundig entgegen. Dieses Problem musste sich aber in anderen Ländern und auf Bundesebene noch verschärfen, wo auch die Überzeugungskraft eines in247 stitutionellen Programms nicht ohne weiteres gegeben war und vorausgesetzt werden konnte. Was in der Hansestadt stark integrierend gewirkt hatte – die Forderung nach plebiszitären Elementen und einer Änderung des Wahlsystems etwa –, machte in Ländern wie Bayern und Baden-Württemberg wenig Sinn. Und auf Bundesebene stand die Neuauflage einer Verfassungskommission, die für eine solche Reform konkrete Anknüpfungspunkte hätte bieten können, schon 1994 nicht mehr zur Debatte. Das Fehlen einer politikinhaltlichen Klammer bedeutete, dass persönliche Ambitionen und Eitelkeiten einzelner FunktionsträgerInnen und die geringe politische Erfahrung der meisten Mitglieder auf das Erscheinungsbild der Partei voll durchschlagen konnten. Dieses Negativimage blieb nicht ohne Rückwirkungen auf den Hamburger Landesverband. Es führte dazu, dass sich dessen Delegierte aus den Geschäften des Bundesverbandes nach und nach zurückzogen, um die Position der Partei in der Hansestadt nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Im Vorfeld der Bürgerschaftswahl hatte sich die Wählervereinigung nach kontroverser Debatte mehrheitlich darauf verständigt, im Bedarfsfall für eine Regierungsbeteiligung in Hamburg zur Verfügung zu stehen. Dass eine Zusammenarbeit wenn überhaupt nur mit den Sozialdemokraten in Frage kommen würde, blieb unumstritten. Ein Zusammengehen mit der Union verbot sich vor dem Entstehungshintergrund der Partei von selbst. Außerdem war davon auszugehen, dass in der Hansestadt ein Senat ohne oder gegen die SPD nicht würde gebildet werden können. Nach Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der zunächst favorisierten Grün-Alternativen-Liste gelang es den Sozialdemokraten in recht kurzer Zeit, sich mit der Statt-Partei auf eine koalitionsähnliche Regierungs„kooperation” zu einigen. Die nominelle Herabstufung des Bündnisses sollte zum einen die Unabhängigkeit ihrer Abgeordneten unterstreichen; zum anderen dokumentierte sie, dass die Statt-Partei nicht mit eigenen VertreterInnen in die Regierung eingezogen war, sondern für die ihr zugebilligten Senatsposten zwei parteilose „Fachmänner” nominiert hatte. Die Bewährungspro248 be der „Kooperationsvereinbarung” lag für die Wählervereinigung in einer möglichst weitgehenden Durchsetzung ihrer institutionellen Forderungen. Dabei konnte sie sich programmatisch eng an die Enquete-Kommission „Parlamentsreform” der Hamburger Bürgerschaft anlehnen, die, nach dem Diätendebakel von 1991 eingesetzt, ihren Abschlussbericht rechtzeitig zur Bürgerschaftswahl vorgelegt hatte. SPD und StattPartei einigten sich darauf, eine umfassende Verfassungs- und Parlamentsreform auf der Grundlage der dort enthaltenen Empfehlungen herbeizuführen; diese sahen u.a. eine Stärkung der Position des Ersten Bürgermeisters, die Demokratisierung der Gesetzgebung und des Wahlsystems sowie die Einführung eines vollprofessionalisierten Parlamentsbetriebs vor. Gemessen an den weitreichenden Zielen blieben die 1996 verabschiedeten Verfassungsänderungen ein Torso. Bei der Wahlrechtsreform war man sich nicht einig geworden, bei der Abschaffung des Feierabendparlaments auf halbem Wege steckengeblieben. Die Statt-Partei musste einsehen, dass sie mit der ehrgeizigen Verpflichtung auf das Projekt nichts erreicht hatte. Dies wog um so schwerer, als sie es auch in anderen Bereichen der Regierungspolitik versäumte, spürbare Akzente zu setzen. Die Hoffnung, der Kooperationspartner könne eine in langjähriger Regierungsverantwortung verbrauchte SPD dazu bewegen, neue und bessere Lösungen für die Probleme der Stadt zu befördern, bewahrheitete sich nicht, im Gegenteil: Mit der Ablösung Wegners als Fraktionsvorsitzendem (November 1994) nahm das Durchsetzungspotenzial der Wählervereinigung weiter ab, so dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung bald zum bloßen Anhängsel der SPD absackte. Die Schwierigkeiten der Statt-Partei in der Regierungsrolle zeugten in erster Linie von hausgemachten Problemen. Als Hauptbelastung der parlamentarischen Arbeit erwies sich von Anfang an die dominierende Rolle des Parteigründers Wegner, dessen unduldsame und schroffe Art nicht geeignet war, eine eher zufällig besetzte und politisch noch unerprobte Fraktionstruppe zusammenzuführen. Jenseits der persönlichen Vorwürfe zielte die Kritik an Wegner vor allem auf dessen Bestreben, wich- tige Entscheidungen an Partei und Fraktion vorbei an sich zu ziehen und inhaltlich zu präjudizieren. Diejenigen, die sich dagegen wandten, fühlten sich durch Wegner und dessen autoritären Führungsstil zunehmend an die Wand gedrückt, zumal sich dieser in der Öffentlichkeit keineswegs beeilte, das Bild der „Ein-MannPartei” zu korrigieren. Die Entmachtung Wegners und sein schließlicher Rückzug aus Partei und Fraktion kamen insoweit nicht überraschend. Die internen Probleme der Partei können freilich nicht allein den Abgeordneten oder der (bis zum November 1994) dominanten Führungsfigur Wegner angelastet werden, sondern verweisen in hohem Maße auch auf eine wachsende Lethargie in der Partei selbst, die ihre neu gewonnenen Möglichkeiten in der Hamburger Politik nicht auszuschöpfen wusste. Dabei hatte alles ganz vielversprechend angefangen. Nach zähem Ringen und teilweise erbittert geführten Auseinandersetzungen war es der Partei im Januar 1994 gelungen, eine Satzung zu verabschieden, die in vielerlei Hinsicht Vorbildcharakter hatte. Zahlreiche ihrer Bestimmungen rührten aus dem negativen Vorbild der „Altparteien” und bezeugten die vergeblichen Reformbemühungen von Wegner und anderen in der Hamburger CDU.7 Die Statt-Partei bekundete damit ihren Anspruch, es in punkto innerparteilicher Demokratie besser zu machen als die anderen Parteien; das Machtgefälle zwischen Funktionären und einfachen Mitgliedern sollte abgebaut, der parteiliche Entscheidungsprozess durchsichtiger und ergebnisoffener gestaltet werden. Dass die Realität hinter diesen ambitionierten Vorstellungen zurückbleiben musste, liegt auf der Hand. Selbst wenn es der Statt-Partei gelungen wäre, ihre politischen Ziele – jenseits der Systemforderungen – in einem Grundsatzprogramm zu fixieren, hätte sie schwer daran getan, sich mit einem solchen Programm als Alternative zu den anderen Parteien glaubhaft zu empfehlen. Ein Jahrhundertthema wie die Ökologie stand für die Wählervereinigung von vornherein nicht bereit. Um so wichtiger wäre es dann aber gewesen, das Projekt der zivilen oder Bürgergesellschaft in politikinhaltlicher Richtung konsequent weiterzuverfolgen. Das Scheitern der Statt-Partei war vorgezeichnet,8 nachdem sie dazu keine überzeugenden Beiträge liefern konnte – weder in bezug auf die institutionelle Seite noch bei der alltäglichen Gestaltung der „Bürgerpolitik”, die sie mitunter mit bloßer Interessen- und Kirchtumspolitik verwechselte. 2.3 Der Bund Freier Bürger Die Hamburger Bürgerschaftswahl von 1997 sah neben der Statt-Partei noch einen weiteren Verlierer: Der Bund Freier Bürger (BFB) erreichte lediglich 1,3% der WählerInnenstimmen, was angesichts des immensen Werbeaufwands der von Manfred Brunner angeführten Partei eine herbe Enttäuschung darstellte. Die Entstehung des BFB geht zurück auf das Jahr 1992. Damals sah sich der Chef des Stabes Binnenmarkt bei der EG und frühere bayerische FDP-Vorsitzende Brunner veranlasst, seinen Dienst in Brüssel zu quittieren, nachdem er den von der Bundesregierung unterstützten Maastricht-Prozess zur Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung nicht länger mittragen mochte. Im darauffolgenden Jahr zog Brunner zusammen mit anderen in derselben Sache vor das Bundesverfassungsgericht und verbuchte dort zumindest einen Teilsieg: Das Gericht erklärte den Maastricht-Vertrag zwar als mit dem Grundgesetz vereinbar, knüpfte daran jedoch die Bedingung, dass es sich bei der anzustrebenden Politischen Union um einen prinzipiell kündbaren „Staatenverbund” handeln müsste und die wesentlichen Entscheidungszuständigkeiten dabei den Nationalstaaten vorbehalten bleiben müssten. Durch das Urteil ermutigt, entschloss sich Brunner zur Gründung einer bundesweiten Bürgerbewegung, um den Widerstand gegen die Währungsunion auf politischem Gebiet fortzusetzen. Bei der Gründungsversammlung des BFB im Januar 1994 waren 87 Personen zugegen, von denen die eine Hälfte keiner Partei angehörten, die andere Hälfte dem bürgerlichen Lager von CDU/CSU und FDP entstammten. Die Mitgliederentwicklung ging zunächst und auch später nur langsam voran, was zum Teil auf den hohen Aufnahmebeitrag für Beitritts249 willige zurückzuführen war. Aufgrund der schmalen Mitgliederbasis ist der BFB über die Gründung von Landesverbänden bislang nicht hinausgekommen. Vertretungen auf Kreisebene unterhielt er 1997 lediglich in einigen seiner süddeutschen Schwerpunktregionen (Bayern, Baden-Württemberg und Hessen), wo die Mehrzahl der rund 1.000 Parteimitglieder herstammt. Die organisatorischen Probleme sind aber nicht der alleinige Grund für das schwache Abschneiden des BFB auf elektoraler Ebene. Da die Partei zu Beginn in nur wenigen Wahlkreisen Süddeutschlands mit eigenen KandidatInnen antreten konnte, blieben ihre landesweiten Ergebnisse bei den dortigen Kommunal- und Landtagswahlen naturgemäß dürftig. Der BFB hatte indessen auch unter besseren Bedingungen keinen Erfolg. Dass er im ersten Anlauf 1994 ausgerechnet bei der Europawahl scheiterte – der Stimmenanteil betrug wenig mehr als ein Prozent –, war ein Schlag ins Gesicht seines antieuropäischen Programms und bedeutete für die nachfolgenden Wahlen ein schlechtes Omen. Den zweiten großen Anlauf unternahm die Partei 1997 in Hamburg, wo die Voraussetzungen ebenfalls günstig schienen: Einerseits ermöglichte der Stadtstaat einen intensiveren Wahlkampf als in den Flächenländern, zum anderen handelte es sich bei der Bürgerschaftswahl um die letzte Landtagswahl vor dem für Frühjahr 1998 erwarteten Beschluss über den definitiven Start der Währungsunion. Dennoch erbrachte der Urnengang dem BFB nicht den erhofften Sprung nach vorn, im Gegenteil: Das Wahlergebnis lag sogar noch unter dem, das die Partei bei der Europawahl in Hamburg erzielt hatte (1,3 gegenüber 1,5%). Das Scheitern ist insoweit erklärungsbedürftig, als von der inhaltlichen Ausrichtung her der BFB den oben formulierten Ansprüchen einer elektoralen Gewinnerkoalition eher entspricht als Republikaner oder Statt-Partei. Maastricht bleibt weiterhin das dominierende Thema der „D-Mark-Partei” (so die Selbstbezeichnung), doch wird die Kritik an der Währungsunion eingebettet in ein weiter gefasstes populistisches Konzept, das nationale (konservative) und „freiheitliche” (neoliberale) Elemente miteinander vereint. Gerade diese Verbindung hat sich in 250 anderen Fällen als Schlüssel erwiesen, den bürgerlichen Parteien das Feld streitig zu machen, wie u.a. das Beispiel der österreichischen FPÖ beweist. Nicht von ungefähr pflegt Brunner mit der Haider-Partei rege und freundschaftliche Beziehungen. Wenn der BFB das Erfolgsmodell des Vorbilds nicht nachahmen konnte, dann deshalb, weil es seinem populistischen Konzept an der nötigen Durchschlagskraft mangelte. Der wählerwirksamen Ausstrahlung stand z.B. im Wege, dass die Partei – außer Brunner selbst – keine wirklich prominenten ÜberläuferInnen in ihren Reihen verzeichnete, wofür sich vor allem der nationalliberale Flügel der FDP angeboten hätte; dessen VertreterInnen um den früheren Generalbundesanwalt Alexander von Stahl ließen es jedoch bei einer punktuellen Zusammenarbeit bewenden. Ein weiteres Problem stellte der hohe Professorenanteil unter den Vorstandsmitgliedern dar, der zwar die Reputierlichkeit förderte, mit den Erfordernissen einer populistischen (= volksnahen) Strategie aber ebenso schlecht in Einklang zu bringen war wie der nüchterne, bisweilen spröde wirkende Stil des Vorsitzenden selbst. Schließlich wurde Brunner und seiner Bürgerbewegung vorgeworfen, bei der Abgrenzung nach rechtsaußen zu lasch zu verfahren; insbesondere die Kontakte zur FPÖ sorgten dabei für innerparteilichen Zündstoff und verschlechterten das Bild der Partei in der Öffentlichkeit. Durch die ausbleibenden Wahlerfolge ernüchtert, schloss sich der BFB im Januar 1998 mit der „Offensive für Deutschland” des hessischen Landtagsabgeordneten Heiner Kappel zusammen; dieser entstammte wie Brunner dem rechten Flügel der FDP und hatte seine Partei kurz zuvor im Streit verlassen. Das Zusammengehen führte freilich nicht zum Erfolg, im Gegenteil: Nachdem der BFB bei der Bundestagswahl 1998 mit kläglichen 0,2% gescheitert war, kam es zwischen Brunner und Kappel zu harten Auseinandersetzungen über die künftige Linie, die im Zerwürfnis endeten. Gegenstand war auch hier das Verhältnis zur rechtsextremen Konkurrenz. Während Brunner weiterhin auf Abgrenzung setzte und den bürgerlichen Charakter des BFB betonte, plädierte der neue Generalsekre- tär für eine stärkere Öffnung der Partei nach rechts. Ein Kooperationsangebot des von Kappel geführten hessischen Landesverbandes an die Republikaner erfolgte gegen den erklärten Willen Brunners und veranlasste diesen im Dezember 1998, den Vorsitz niederzulegen und die von ihm selbst gegründete Partei zu verlassen. So wenig er sich im organisatorischen Sinne als Teil des bürgerlichen Lagers darstellen konnte, so wenig taugte der BFB als Protestalternative. Das Desaster in Hamburg hielt aus dieser Sicht zwei wichtige Lektionen bereit. Einmal musste Brunner einsehen, dass er die Mobilisierungskraft des Euro-Themas gewaltig überschätzt hatte: Eine Mehrheit der Deutschen lehnte die Abschaffung der D-Mark zwar weiterhin ab, doch spielte die Frage bei der Wahlentscheidung praktisch keine Rolle. Selbst in diesem Fall hätte der BFB das Thema nicht monopolisieren können, da die Ablehnung von sämtlichen Rechtsaußenparteien geteilt wurde und Kritik an der EU-Politik auch aus dem Unionslager (Edmund Stoiber) und der SPD (Gerhard Schröder) zu vernehmen war. Mit der politischen Konkurrenz ist auf das zweite entscheidende Hindernis verwiesen: Die Zersplitterung des organisierten Populismus in der Bundesrepublik hat zur Folge, dass sich dessen Stimmenpotenzial nach unterschiedlichen, nicht immer leicht nachzuvollziehenden Gesichtspunkten auf mehrere Gruppierungen verteilt. Einerseits bestehen regionale Differenzen – Republikaner und BFB sind im Süden, DVU und Statt-Partei im Norden der alten Bundesrepublik stärker, während in den östlichen Ländern die linkspopulistische PDS dominiert; andererseits kommt es zu Hin-und-Her-Bewegungen auch innerhalb der jeweiligen Regionen, wofür die Hamburger Wahl ein gutes Beispiel liefert. Die rechtsextreme DVU schnitt hier 1997 mit 4,9% besser ab als die gemäßigteren Republikaner (1,9%) und der noch gemäßigtere BFB. Vier Jahre zuvor hatten sich die Stimmen nahezu umgekehrt verteilt, was auf einen weitgehenden Austausch der Wählerschaft schließen lässt (Republikaner 4,8%; DVU 2,8%). Rechnet man den BFB hinzu, war das Gesamtaufkommen der rechten Stimmen 1997 in etwa gleich groß wie 1993 (8,2 gegenüber 7,6%). Der Wahlausgang zeigt, dass dort, wo mehrere Protestparteien um die Wählergunst buhlen, nicht unbedingt diejenigen mit dem qualitativ besten personellen und programmatischen Angebot die Nase vorn haben. In Hamburg wurde von den WählerInnen entweder bewusst der extremste Anbieter bevorzugt (um den Denkzettel-Charakter des Votums zu unterstreichen) oder schlicht auf die Partei mit den vermeintlich besten Erfolgsaussichten gesetzt. In beiden Fällen erwies sich der BFB als konkurrenzschwache Alternative: Weder konnte die Bürgerbewegung die Originalität ihrer Botschaft deutlich machen, noch hatte sie den für einen elektoralen Durchbruch notwendigen Anfangserfolg vorzuweisen, der auf einem weniger überfüllten politischen Markt vielleicht möglich gewesen wäre. 3. Abschließende Bemerkungen Nach der Herausbildung der ökologischen Parteien in den 70er Jahren sahen sich die meisten westeuropäischen Länder in den achtziger Jahren mit einer ähnlichen Entwicklung am rechten Wählerrand konfrontiert, wo neu entstandene Parteien zum Teil beachtliche Wahlerfolge landen konnten. Deutschland bildet hier im Prinzip keine Ausnahme. Anders als den Grünen auf der Linken ist dem neuen Rechtspopulismus der parteipolitische Durchbruch in der Bundesrepublik bislang jedoch versagt geblieben. Selbst wenn man die Prozentanteile ihrer einzelnen Vertreter zusammenzählt, lag das Gesamtergebnis der neuen Rechten bei den letzten Bundestagswahlen unter demjenigen der NPD von 1969. Auf der Landesebene waren die populistischen Neugründungen zumeist erfolgreicher, doch verdankt sich ihr besseres Abschneiden hier vor allem institutionellen Faktoren.9 Trotzdem fallen auch diese Resultate hinter den Ergebnissen vergleichbarer Parteien aus anderen Ländern zurück. Im vorliegenden Aufsatz ging es darum, den Gründen der elektoralen Schwäche nachzuspüren. Dabei hat sich gezeigt, dass es eine grundsätzliche Wahl zwischen den anfangs vorgestellten Hypothesen nicht geben kann: Die Erfolg251 losigkeit der neuen Rechtsparteien verweist einerseits auf das unfreundliche Umfeld, mit dem jede Form von Populismus in der Bundesrepublik rechnen muss; zum anderen hängt sie mit dem speziellen Unvermögen dieser Parteien zusammen, sich als politische Kraft zu formieren. Letzteres hat sowohl zufällige als auch strukturelle Ursachen. Zu den zufälligen Faktoren, die sich der Erklärbarkeit letztlich entziehen, zählt das Fehlen einer überzeugenden Führerfigur. Populistische Parteien repräsentieren einen Organisationstypus, den man mit Panebianco (1988, 143–147) als „charismatische Partei” bezeichnen könnte. Charakteristisch für diesen Typus ist das prekäre Verhältnis von Führerautorität und Institutionalisierung. Charismatische Parteien zeichnen sich dadurch aus, dass die Identität der Partei mit derjenigen des Führers vollständig verschmilzt. Der Führer gründet die Partei, gibt ihr die ideologischen Ziele vor und schart die AnhängerInnen der Partei um sich. Ein Blick auf Italien, Frankreich oder Österreich zeigt, dass sich die Entstehung und der elektorale Durchbruch des neuen Rechtspopulismus ausnahmslos mit der Leistung einzelner Führungspersönlichkeiten – Bossi, Berlusconi, Le Pen, Haider – verbinden, deren Charisma ihren deutschen Pendants offenbar abgeht. Anders als die Genannten konnten Schlierer, Wegner und Brunner Integrationsfähigkeit nach innen nicht mit der nötigen WählerInnenwirksamkeit nach außen verknüpfen. Allein Schönhuber kommt mit seinen Qualitäten der Vorstellung eines charismatischen Führers nahe. Dies machte sich in der Erfolgsbilanz der Republikaner bis 1994 positiv bemerkbar, konnte Schönhuber selbst allerdings nicht vor dem Scheitern bewahren. Damit ist auf eine zweite, strukturelle Erfolgsbedingung verwiesen: das Problem der institutionellen Stabilität. Weil die charismatischen Erfolgsbedingungen sich im Laufe der Zeit verbrauchen, droht die Attraktivität der Partei ab einem bestimmten Punkt nachzulassen: „When charisma disappears, success no longer shines on the movement, and faith in the leader’s ,state of grace’ ceases. When this occurs in an organization in which the leader was successful in preventing the routinization of charisma (in order not to lose his total control), the 252 movement ends and the organization dissolves. Or, alternatively, charisma is objectified and the organization overcomes the crisis through the transformation of personal charisma into official charisma. In this latter case, the organization institutionalizes” (ebd., 144). Die Bedingungen der Institutionalisierung sind besonders heikel bei denjenigen Vertretern, die in ihrer autoritären Struktur dem Selbstverständnis einer rechtsextremen (neofaschistischen) Partei nahekommen. Wie das Beispiel des Front National jüngst gezeigt hat, können selbst elektoral erfolgreiche Parteien an internen Rivalitäten und Richtungskämpfen zerbrechen, wenn die Voraussetzungen einer geregelten internen Konfliktaustragung nicht gegeben sind. Bei den bundesdeutschen Rechtsparteien kommt erschwerend hinzu, dass sie eine unwiderstehliche Sogwirkung auf Gruppierungen und subkulturelle Milieus im rechtsextremen Lager ausüben, die auf diese Weise aus der politischen Isolierung (und Bedeutungslosigkeit) heraustreten wollen. Auch hier tut der „Schatten Hitlers” seine Wirkung. „Whenever a far-right party has gained votes in postwar Germany, neo-Nazi militants have been attracted to it, not least because of the strong chances of gaining local offices in the decentralized governmental system. The new activists pull the party toward neo-fascist positions and spoil its reputation among prospective voters” (Karapin 1998b: 225). Das Schicksal von Statt-Partei und Bund Freier Bürger macht deutlich, dass selbst gemäßigte Parteien nicht davor gefeit sind, durch rechtsextreme Personen und Gruppen unterwandert zu werden. Parteiinterne Konflikte über den angemessen Umgang mit dieser Entwicklung konnten daher nicht ausbleiben und haben das Bild der Parteien in der Öffentlichkeit beschädigt. Die Relevanz der strukturellen Faktoren wird offenkundig, wenn man berücksichtigt, dass Deutschland von seiner sozialen und politischen Befindlichkeit her die Voraussetzungen für eine Bewegung von rechts in ähnlicher Weise erfüllen müsste wie z.B. Frankreich oder Österreich (Roberts 1995; zum FN vgl. Marcus 1995, zur FPÖ Decker 1997). Wenig spricht dafür, dass sich an dieser Diskrepanz in absehbarer Zeit etwas ändert. Um die künftigen Chancen des Rechtspopulismus in Deutschland zu ermessen, gilt es jedoch zu bedenken, dass die genannten Restriktionen von unterschiedlicher Qualität sind: Während der „Schatten Hitlers” eine gegebene Größe darstellt, deren Bedeutung erst auf lange Sicht schwinden wird, lassen sich die akteursseitigen Faktoren durch politisches Handeln schon heute beeinflussen. Unter günstigeren personellen Vorzeichen – wenn ihm eine überzeugende Führungspersönlichkeit zuwächst – könnte es also durchaus sein, dass der Populismus seine Organisationsschwäche überwindet und er eine Zukunft in Deutschland noch vor sich hat. ANMERKUNGEN 1 Der Spiegel Nr. 10 v. 4.3.1996, S. 22. 2 Eine modernisierte Neuauflage des alten Rechtsextremismus, der seine Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut nicht verbergen kann, fällt die DVU aus der rechtspopulistischen Parteienfamilie heraus und wird daher im folgenden nur am Rande betrachtet. Die Notwendigkeit, sie nicht ganz außer acht zu lassen, ergibt sich aus ihrem Konkurrenzverhältnis zu den Republikanern. Auch wenn zwischen beiden Parteien ideologisch und organisatorisch deutliche Unterschiede bestehen, stellen sie aus Sicht der WählerInnen weitgehend austauschbare Protestäquivalente dar. 3 Nach 25.000 im Rekordjahr 1989 lag die Zahl der Mitglieder 1997 laut Verfassungsschutz bei rund 15.000. 4 Wie die zahlreichen Übertritte von RepublikanerMitgliedern und -Funktionären zur DVU nach deren Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gezeigt haben, befindet sich die Partei diesbezüglich weiterhin in einer prekären Schwebelage. Zwar konnte sich der gemäßigte Vorsitzende Schlierer auf dem Parteitag im November 1998 als Parteichef klar behaupten, doch bedeutete dies keine wirkliche Distanzierung von der rechtsextremen Szene: Noch im selben Monat verständigten sich Republikaner und DVU auf eine begrenzte Zusammenarbeit dergestalt, dass sie bei den 1999 anstehenden Landtagswahlen nicht gegeneinander antreten würden. Vgl. Jaschke 1999, 152/153. 5 Neben dem von Hamburg zunächst nicht anerkannten Landesverband Statt-Partei Niedersachsen war dort eine rechtsgerichtete Vereinigung von ehemaligen Mitgliedern der Republikaner unter dem Namen „Neue Statt-Partei” (!) zur Wahl angetreten. 6 Dies spiegelt sich auch in der Zusammensetzung der WählerInnenschaft wider. Die Statt-Partei bezog ihre Unterstützung bei den Hamburger Wahlen überwiegend aus der typischen Klientel der FDP (deren Einzug in die Bürgerschaft sie damit verhinderte), konnte aber auch ArbeiterInnen und vergleichsweise mehr Beamte ansprechen. Rund ein Drittel der WählerInnen hatten bei der vorangegangenen Bürgerschaftswahl SPD oder Grüne gewählt, während knapp die Hälfte dem bürgerlichen Lager entstammte. Vgl. Decker 1994, 259/260. 7 Hierzu zählten beispielsweise die Bindung der Mitgliedschaft an den Wohnsitz, das Einsichtsrecht in die Mitglieder- und Delegiertenlisten, die Einzelabstimmung bei Kandidatenaufstellungen und Vorstandswahlen sowie das Urabstimmungsvotum bei der Nominierung von SpitzenkandidatInnen. 8 Mit 3,8% der Stimmen bei der Bürgerschaftswahl 1997 verpasste die Statt-Partei den Wiedereinzug in das Landesparlament klar. Dass das Ergebnis dennoch besser ausfiel als erwartet, dürfte zum einen an der Schützenhilfe von Bürgermeister Voscherau gelegen haben, der sich vor der Wahl für eine Fortsetzung des rot-grauen Regierungsbündnisses ausgesprochen hatte; zum anderen konnte die Partei mit dem früheren Sportfunktionär Jürgen Hunke einen von den Querelen der Vorjahre unbelasteten Spitzenkandidaten aufbieten, der das Image der Wählervereinigung aufbesserte. Hunke übernahm nach der Wahlniederlage den Landesvorsitz, konnte aber den weiteren Abstieg der Statt-Partei nicht mehr verhindern, die in der Öffentlichkeit anschließend kaum noch Präsenz entwickelte. Auch die übrigen Landesverbände (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt) sind bislang bedeutungslos geblieben. 9 Landtags- und Kommunalwahlen erlauben es einerseits, wahlpolitische Anstrengungen auf ein bestimmtes Gebiet zu konzentrieren; andererseits stellen sie – wie Europawahlen – Korrektive dar, um unerwünschten Entwicklungen in der Bundespolitik qua Stimmzettel zu begegnen. Die stabilisierende Funktion des Föderalismus täuscht insoweit über die wahre Stärke der neuen Rechtsparteien hinweg, die irgendwo in der Mitte zwischen ihren Landtags- und Bundestagswahlergebnissen liegen müsste; vgl. Phillips 1995, 228. LITERATURVERZEICHNIS Butterwegge, Christoph (1997). Entwicklung, gegenwärtiger Stand und Perspektiven der Rechtsextremismusforschung, in: Christoph Butterwegge u.a. (Hg.): Rechtsextremisten in Parlamenten, Opladen, 9–53. Canovan, Margaret (1981). Populism, London. Chapin, Wesley D. (1997). Explaining the Success of the New Right: The German Case, in: West European Politics 20(2), 53–72. Decker, Frank (1994). Die Hamburger Statt Partei. Ursprünge und Entwicklung einer bürgerlichen Wählerbewegung, in: Jahrbuch für Politik 4, 249–294. 253 Decker, Frank (1997). Die FPÖ unter Jörg Haider. Erfolgsbedingungen einer rechtspopulistischen Partei, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 28, 649– 664. Falter, Jürgen W. in Zusammenarbeit mit Markus Klein (1994). Wer wählt rechts? Die Wähler und Anhänger rechtsextremistischer Parteien im vereinigten Deutschland, München. Fascher, Eckhard (1997). Die politischen Erfolgsaussichten der „Republikaner” in Deutschland, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 28, 21–29. Feist, Ursula (1994). Statt einer Partei die Statt Partei, in: Das Parlament, 28.1./4.2.1994. Ionescu, Ghita/Ernest Gellner, Hg. (1969). Populism. Its Meanings and National Characteristics, London. Jaschke, Hans-Gerd (1990). Die Republikaner. Profile einer Rechtsaußen-Partei, Bonn. Jaschke, Hans-Gerd (1999). Die rechtsextremen Parteien nach der Bundestagswahl 1998: Stehen sie sich selbst im Wege?, in: Oskar Niedermayer (Hg.): Die Parteien nach der Bundestagswahl 1998, Opladen, 141–157. Karapin, Roger (1998a). Explaining Far-Right Electoral Successes in Germany. The Politicization of Immigration-Related Issues, in: German Politics and Society 16, 24–61. Karapin, Roger (1998b). Radical-Right and Neo-Fascist Political Parties in Western Europe, in: Comparative Politics 30, 213–234. Kitschelt, Herbert/Anthony McGann, (1995). The Radical Right in Western Europe. A Comparative Analysis, Ann Arbor. Klein, Markus/Jürgen W. Falter (1996). Die dritte Welle rechtsextremer Wahlerfolge in der Bundesrepublik Deutschland, in: Jürgen W. Falter/Hans-Gerd Jaschke/Jürgen R. Winkler (Hg.): Rechtsextremismus, Opladen, 288–312. Koopmans, Ruud/Hanspeter Kriesi (1997). Citizenship, National Identity and the Mobilization of the Extreme Right. A Comparison of France, Germany, the Netherlands and Switzerland, Wissenschaftszentrum Berlin, FS III 97–101. Marcus, Jonathan (1995). The National Front and French Politics. The Resistible Rise of Jean-Marie Le Pen, Houndmills/London. Minkenberg, Michael (1998). Context and Consequence. The Impact of the New Radical Right on the Political Process in France and Germany, in: German Politics and Society 16, 1–23. Neubacher, Bernd (1996). NPD, DVU-Liste D, Die Republikaner. Ein Vergleich ihrer Ziele, Organisationen und Wirkungsfelder, Köln. Neugebauer, Gero/Richard Stöss (1999). Nach der Bundestagswahl 1998: Die PDS in stabiler Seitenlage?, in: Oskar Niedermayer (Hg.): Die Parteien nach der Bundestagswahl 1998, Opladen, 119–140. Panebianco, Angelo (1988). Political Parties. Organization and Power, Cambridge. Pappi, Franz Urban (1990). Die Republikaner im Parteiensystem der Bundesrepublik. Protesterscheinung oder politische Alternative, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 21, 37–44. Pfahl-Traughber, Armin (1994). Volkes Stimme? Rechtspopulismus in Europa, Bonn. Phillips, Ann L. (1995). An Island of Stability? The German Political Party System and the Elections of 1994, in: West European Politics 18(3), 219–229. Puhle, Hans-Jürgen (1986), Was ist Populismus, in: Helmut Dubiel (Hg.): Populismus und Aufklärung, Frankfurt a.M., 12–32. Roberts, Geoffrey (1995). The German Party System in Crisis, in: Parliamentary Affairs 48, 125–140. Saalfeld, Thomas (1993). The Politics of NationalPopulism: Ideology and Politics of the German Republikaner Party, in: German Politics 2, 177–199. Stöss, Richard (1991). Politics against Democracy. RightWing Extremism in West Germany, New York/Oxford. Stubbe-da Luz, Helmut (1994). Parteiendiktatur. Die Lüge von der „innerparteilichen Demokratie”, Frankfurt a.M./Berlin. Veen, Hans-Joachim/Norbert Lepszy/Peter Mnich (1991/ 92). Die Republikaner-Partei zu Beginn der 90er Jahre. Programm, Propaganda, Organisation, Wählerund Sympathisantenstrukturen, Forschungsbericht der Konrad Adenauer Stiftung, Interne Studien Nr.14. Wegner, Markus E. (1994). Für eine offene Demokratie. Ein Mann kämpft gegen die „Polit-Mafia” und für die Erneuerung des Gemeinwesens, München/Leipzig. Young, Brigitte (1995). The German Political Party System and the Contagion from the Right, in: German Politics and Society 13, 62–78. ANHANG Ausgewählte Wahlergebnisse von Republikanern, Statt-Partei und Bund Freier Bürger REP Statt BFB 1986 3,0%1 1989 7,1%2 1990 4,9%1 1992 1993 10,9%3 5,6%4 1994 3,9%2 1,1% 2 1996 9,1%3 1997 3,8%4 1,3%4 1998 1,8%5 0,2%5 (1) Landtagswahl Bayern; (2) Wahlen zum Europäischen Parlament; (3) Landtagswahl Baden-Württemberg; (4) Bürgerschaftswahl Hamburg; (5) Bundestagswahl 254 AUTOR Frank DECKER, geb. 1964, Dr. rer pol., Dipl.-Pol., Privatdozent für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr Hamburg. Arbeitsschwerpunkte: Parteienforschung, Rechtspopulismus, Umweltpolitik. Anschrift: Universität der Bundeswehr Hamburg, Fachbereich WOW, Institut für Politikwissenschaft, Holstenhofweg 85, D-22043 Hamburg. E-Mail: [email protected]. 255