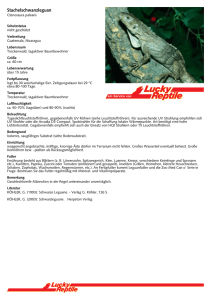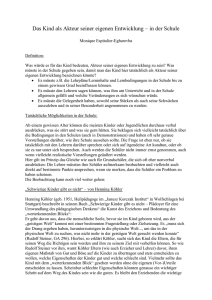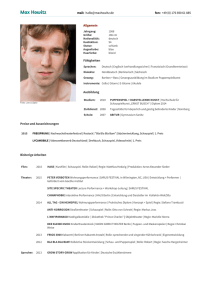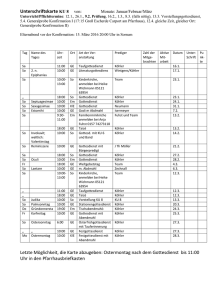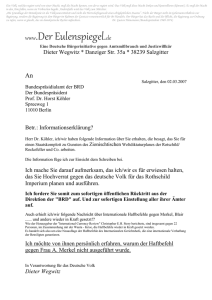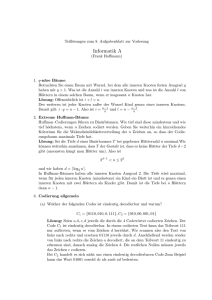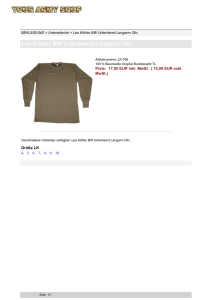Herr Köhler, wir würden jetzt gerne Ihre Meinung zu der
Werbung
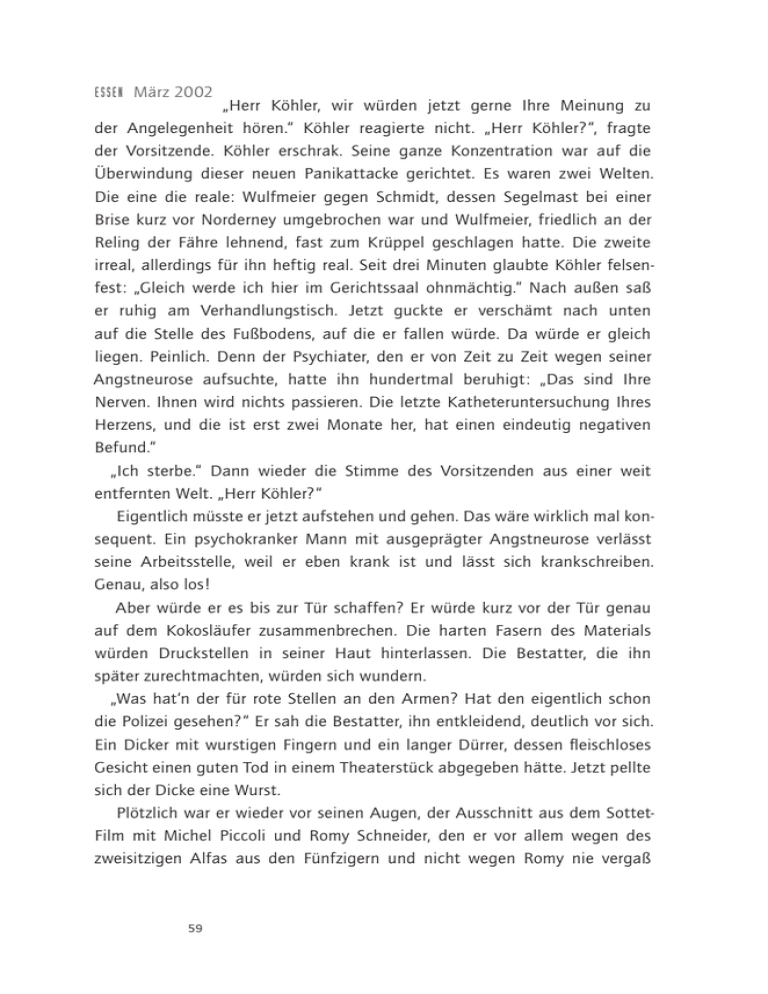
E S S E N März 2002 „Herr Köhler, wir würden jetzt gerne Ihre Meinung zu der Angelegenheit hören.“ Köhler reagierte nicht. „Herr Köhler?“, fragte der Vorsitzende. Köhler erschrak. Seine ganze Konzentration war auf die Überwindung dieser neuen Panikattacke gerichtet. Es waren zwei Welten. Die eine die reale: Wulfmeier gegen Schmidt, dessen Segelmast bei einer Brise kurz vor Norderney umgebrochen war und Wulfmeier, friedlich an der Reling der Fähre lehnend, fast zum Krüppel geschlagen hatte. Die zweite irreal, allerdings für ihn heftig real. Seit drei Minuten glaubte Köhler felsenfest: „Gleich werde ich hier im Gerichtssaal ohnmächtig.“ Nach außen saß er ruhig am Verhandlungstisch. Jetzt guckte er verschämt nach unten auf die Stelle des Fußbodens, auf die er fallen würde. Da würde er gleich liegen. Peinlich. Denn der Psychiater, den er von Zeit zu Zeit wegen seiner Angstneurose aufsuchte, hatte ihn hundertmal beruhigt: „Das sind Ihre Nerven. Ihnen wird nichts passieren. Die letzte Katheteruntersuchung Ihres Herzens, und die ist erst zwei Monate her, hat einen eindeutig negativen Befund.“ „Ich sterbe.“ Dann wieder die Stimme des Vorsitzenden aus einer weit entfernten Welt. „Herr Köhler?“ Eigentlich müsste er jetzt aufstehen und gehen. Das wäre wirklich mal konsequent. Ein psychokranker Mann mit ausgeprägter Angstneurose verlässt seine Arbeitsstelle, weil er eben krank ist und lässt sich krankschreiben. Genau, also los! Aber würde er es bis zur Tür schaffen? Er würde kurz vor der Tür genau auf dem Kokosläufer zusammenbrechen. Die harten Fasern des Materials würden Druckstellen in seiner Haut hinterlassen. Die Bestatter, die ihn später zurechtmachten, würden sich wundern. „Was hat‘n der für rote Stellen an den Armen? Hat den eigentlich schon die Polizei gesehen?“ Er sah die Bestatter, ihn entkleidend, deutlich vor sich. Ein Dicker mit wurstigen Fingern und ein langer Dürrer, dessen fleischloses Gesicht einen guten Tod in einem Theaterstück abgegeben hätte. Jetzt pellte sich der Dicke eine Wurst. Plötzlich war er wieder vor seinen Augen, der Ausschnitt aus dem SottetFilm mit Michel Piccoli und Romy Schneider, den er vor allem wegen des zweisitzigen Alfas aus den Fünfzigern und nicht wegen Romy nie vergaß 59 und vergessen würde und schon zigmal gesehen hatte. Diese nicht enden wollende Sterbeszene; der Alfa lag schon zertrümmert im Feld und der Dicke war einer der das Festmahl genießenden Gäste. Südfrankreich mitten auf dem Land. Wäre schön, wenn er jetzt da wäre! Aber nicht kurz vor seinem Abgang, sondern voll im Leben! Mit Mon auf einer Decke, mitten auf der großen Wiese. Sein Schwanz würde hart werden. Aber für einen kleinen Fick waren viel zu viele Leute auf der Wiese. „Ja?“ „Herr Köhler, Sie haben jetzt das Wort.“ Er schrak auf. Die Attacke war vorbei. Nur sein Puls war noch auf mindestens 130. „Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ich musste kurz einen Blick auf diese Papiere werfen. Also … ich hab dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Der Beklagte wendet hier ein …“ Bla, bla, bla … juristisches Bla, bla, bla. Er konnte sich selber nicht mehr zuhören. Es war für ihn ein nicht endender Verdruss, sich mit dieser ganzen juristischen Sprache und Kultur zu beschäftigen. Außerdem, er musste ja nicht nur sich selber hören, sondern seine vielen Kollegen, Richter, Staatsanwälte und andere, die in den gleichen Sprechblasen redeten. Es war nicht nur eine Beschäftigung. Er war ein Teil der Jura-Kultur. Manchmal dachte er, dass die Panikattacken mit seinem immer stärker werdenden Widerwillen gegen die Juristerei zusammenhingen und das, obwohl er ein hervorragender Jurist und Spezialist für Schadensersatz und das Verteidigen von Wirtschaftsdelikten war. Diesen Prozess hatten sie schon fast gewonnen. Wulfmeier, der noch immer eine schwarze Augenklappe trug, stünde eine lebenslange Rente von circa achthundert Euro monatlich und ein Schmerzensgeld von wenigstens fünfzigtausend Euro zu. Wenn sein Kontrahent jetzt nicht bald einlenkte – der Vorsitzende wurde schon sauer über den nicht enden wollenden Redefluss seines jungen Kollegen – würden sie es sogar bis sechzigtausend schaffen. Wie lange machte er das eigentlich schon ? Mit siebenundzwanzig hatte er als angestellter Rechtsanwalt bei Köhler, Vogelsang & Partner angefangen. Jetzt war er zweiundsechzig. Fünfunddreißig lange Jahre hatte er in der Kanzlei gearbeitet. Sein Vater hatte die Kanzlei Anfang der Dreißiger in Essen gegründet. Jetzt waren sie zehn Anwälte, wenn man die jungen Hüpfer mit den Angestelltenverträgen nicht mitrechnete. Der Vorsitzende hatte nichts gemerkt. Er könnte in diesem Saal Purzelbäume schlagen und das damit begründen, das sei wegen seines Kreislaufs 60 notwendig und habe ihm sein Arzt verordnet. Auch das hätte man ihm durchgehen lassen. Darauf würde er wetten. Sein Ruf als Anwalt, als Verhandlungspartner, der schnell zur Sache kam, ohne das anstrengende Salbadern gewisser Kollegen. Er war beliebt. Ursprünglich war er sich gar nicht bewusst, wie sehr. Bis dann vor fünf Jahren Emma an Krebs gestorben war und ihm eine überwältigende Sympathie entgegenschlug. Eine Menge Beileidsbriefe und -bekundungen. Viele litten mit ihm. Das gefiel ihm oder hatte ihm gefallen, obwohl er es gar nicht wahrhaben wollte. 1997, das Jahr, in dem Emma gestorben war, hatte er gerade mit der Therapie angefangen. Für sich nannte er die Zeit davor seine Vor-Therapie-Zeit. Zu deren Kälte, das heißt auch seiner damaligen Kälte, gehörte das geschickte Ausblenden und Verdrängen von allem, was entfernt danach aussah, als sei er ein liebenswerter und beliebter Mensch. Natürlich hatte er immer heimlich geargwöhnt und damit kokettiert, dass er liebenswert war. Er konnte gegenüber Personen, die das offen infrage stellten, sehr ruppig und vernichtend sein. Sein großes Problem bestand auch nicht darin, dass ihn jemand nicht liebenswert fand. Sein Problem bestand darin, dass er gegenüber Menschen, die ihn gernhatten und ihn das wissen ließen, den sofortigen Totstellreflex auslöste; quasi so tat, als hätte er die Zuneigung und Sympathie nicht wahrgenommen. Das Fatale war, dass der Reflex überproportional zunahm, je intensiver die Nähe zu dem Menschen war, der ihm seine Liebe oder Zuneigung oder eine kleine Andeutung mit Chance auf mehr bekundete und je mehr er sich nach dessen Liebe oder Gemochtwerden sehnte. Die Folge davon war natürlich ein großer Hunger danach, Zuneigung zu bekommen und eine große Leere, weil er genau das durch sein Verhalten verhinderte. Die Ader, durch die zu allen normalen Menschen Zuneigung und Nähe strömt oder besser strömen muss, war bei ihm gewissermaßen verstopft. Die Illusion, Nähe und Zuneigung seien schlicht automatische Begleitumstände des Zusammenlebens eines verheirateten Ehepaares, hatte er parallel zu der Weiterentwicklung seiner Therapie längst aufgegeben. Das war sein Skript, quasi sein Drehbuch, hatte ihm sein Therapeut versucht zu erklären. Aus irgendwelchen Gründen hatte er sich als Kind zu diesem Drehbuch seines Lebens entschieden. Mithilfe seines Therapeuten 61