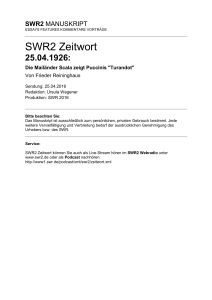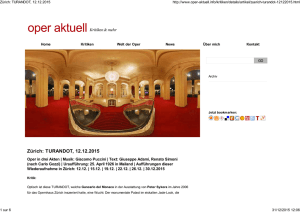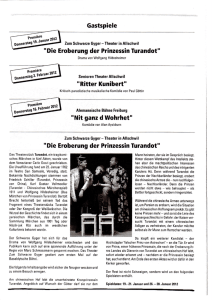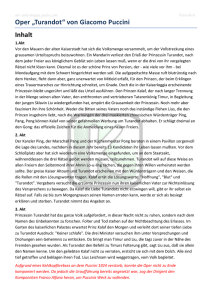In den Fängen eines Trugbilds
Werbung

Kultur 12 NUMMER 145 Als Waise in der DDR Kultur kompakt AMERIKANISCHE FILM-ACADEMY Christop Waltz darf künftig über Oscars abstimmen Oscar-Preisträger Christoph Waltz wird als neues Mitglied in die amerikanische Filmakademie aufgenommen. Dies gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt. Der 53-Jährige, Star der Nazi-Satire „Inglourious Basterds“, zählt zu 135 Filmschaffenden, die in diesem Jahr auf Einladung der Organisation beitreten dürfen. Auch Christian Berger (65), der für seine Kamera-Arbeit in Michael Hanekes Schwarz-Weiß-Drama „Das weiße Band“ eine Oscar-Nominierung erhalten hatte, steht auf der Liste. Die neuen Mitglieder dürfen bei der Verleihung der Oscars mit abstimmen. (dpa) Peter Wawerzinek gewinnt in Klagenfurt ADAM ZIELINSKI Der Schriftsteller starb im Alter von 81 Jahren Der polnisch-österreichische Schriftsteller Adam Zielinski ist tot. Er starb nach kurzer schwerer Krankheit in der Nacht zum Sonntag in Wien. Der Autor, der auf Polnisch und Deutsch schrieb, hatte vor ein paar Tagen noch seinen 81. Geburtstag gefeiert. Sein letztes Buch, „Im Schtetl“, erscheint Ende August. Zielinski wurde am 22. Juni 1929 in Drohobycz bei Lemberg geboren. Seine Eltern wurden während des Zweiten Weltkrieges von den Nazis getötet. 1957 ging er mit seiner Familie nach Wien und gründete zunächst ein Handelsunternehmen. Seit 1989 war er auch als Schriftsteller bekannt. (ddp) BERLINER SCHLOSS-WIEDERAUFBAU In Kürze Richtfest für das Infozentrum Trotz des verschobenen Baubeginns für das Berliner Schloss laufen die Vorarbeiten für das Mammutprojekt auf Hochtouren. Die sogenannte „Humboldt-Box“, die über die künftige Nutzung des Schlosses informieren soll, feiert am 8. Juli Richtfest. Die Baukosten für die „Humboldt-Box“ sind auf fünf Millionen Euro veranschlagt, die Eröffnung ist für Ende des Jahres geplant. In dem fünfstöckigen Bau auf dem Schlossplatz soll über den Wiederaufbau der einstigen Residenz informiert werden. (dpa) AUSZEICHNUNG Carlo-Schmid-Preis für Kunsthistoriker Spies Der Kunsthistoriker Werner Spies (73) ist am Sonntag in Mannheim mit dem Carlo-Schmid-Preis ausgezeichnet worden. Die Schmid-Stiftung hatte sich für Spies entschieden, um damit „seine besonderen Verdienste um das deutsch-französische Kulturverhältnis“ zu würdigen. Laudator war Filmemacher Volker Schlöndorff. Nach dessen Meinung hat Spies auch schon vor seiner Zeit als Direktor des Pariser Centre Georges Pompidou zur Verständigung der Deutschen und Franzosen beigetragen. (dpa) Calaf (Ricardo Tamura, Mitte) wird bedrängt, Abstand zu nehmen von seinem Vorhaben, Turandot zu erobern. Foto: A. T. Schaefer/Theater Augsburg In den Fängen eines Trugbilds Turandot Auf der Augsburger Freilichtbühne inszeniert Thaddeus Strassberger Puccinis Opernstoff als schwärmerisches, sich letztlich auflösendes Gespinst eines jungen Mannes VON STEFAN DOSCH Augsburg „Keiner schlafe!“, lautet die Empfehlung von der Bühne, und nur zu gerne mochte man den berühmten Arienworten an diesem Abend Folge leisten. Denn was für eine tadellose Sommernacht war der Saisoneröffnung der Augsburger Freilichtbühne beschieden! Wachen Sinns mochte man auf der malerischen Anlage am Roten Tor auch deshalb sein, weil hier nach über 20 Jahren erstmals wieder „Turandot“ gegeben wurde, Giacomo Puccinis in jeder Hinsicht opulente, exotische Oper, wie geschaffen für großes Ausstattungstheater und mithin für die Freilichtbühne. Thaddeus Strassberger (Regie/ Bühne) hat der Märchenhandlung aus einem mythischen alten China einen jüngeren Erzählrahmen verpasst. Zu Beginn sieht man eine kolonial-archäologische Situation, in der unter Aufsicht europäisch gekleideter Auftraggeber im fernen Osten Terrakotta-Kriegerfiguren ausgegraben werden (Kostüme: Madeleine Boyd). Dem jungen Calaf wird die Legende von der gefühlskalten Prinzessin Turandot zur fixen Idee, schon gar, nachdem die Ausgrabung eine Art Sarkophag ans Licht befördert – aus dem später die Kaiserstochter hervortritt. Das ist ein Topos abendländischer Geisteswelt: der Mann in jungen Jahren, der sich in eine Gestalt aus vergangener Zeit verguckt. Sigmund Freud, als er einen ähnlich schwärmerischen Fall unter die Lupe nahm (nämlich die Hauptfigur in Wilhelm Jensens Novelle „Gradiva“), gab das Anlass zu psychoanalytischen Betrachtungen. Die „Turandot“-Geschichte als Phantasmagorie, als männlich-überhitztes Truggebilde – ein vielversprechender Ansatz. Der jedoch rasch verebbt, weil es Strassberger nur selten gelingt, daraus szenisch Kapital zu schlagen. Die Idee, Turandot und Calaf auch dann, als alle Hindernisse (scheinbar) überwunden sind, nicht beieinander, sondern weit voneinander entfernt singen zu lassen und somit die tatsächliche Distanz zwischen den beiden zu versinnbildlichen, gehört dabei zu den lobenswerten Ausnahmen. Puccini und die Regie gehen teils getrennte Wege Schwer wiegt auch, dass das Konzept nicht selten mit Libretto und Musik kollidiert. Was auf der notierten Ebene verhandelt wird, findet auf der Szene oft keinen Niederschlag. Das geht zulasten der Dramatik, schon gleich zu Beginn. Wie viel kollektive Blutlüsternheit, aber auch Angst liegt hier doch in den Äußerungen der Volksmenge – welche Nervosität verbreitet auch die Musik. Strassbergers ArchäologenSzenerie wirkt dagegen betulich, trotz einiger Aufsehergewehre. Überhaupt die Massen. Sie wollen in dieser Choroper schlüssig bewegt sein, damit die Schraube des Dramas sich immer fester ziehe. Doch die Regie lässt viel Potenzial verpuffen. Würde der Pöbel am Ende nicht buchstäblich Liù zerreißen, man hätte wohl kaum Kenntnis davon, dass er zuvor schon eine ganze Szene hindurch die opferwillige Sklavin mit dem Tode bedrohte. Musikalisch freilich wird man in dieser „Turandot“ des Theaters Augsburg schadlos gehalten. Die Partie der Liù – für manch einen das emotionale Zentrum der Oper – erhält durch Sophia Brommers Sopran nicht nur lyrischen Schmelz, sondern auch jenen Schuss Tapferkeit, der die Figur zur anrührenden Opfergängerin macht. Sally du Randt, eigentlich keine Hochdramatische, verfügt zwar nicht über letzte Durchschlagskraft, präsentiert all die vokalen Sprünge und Spitzen der Turandot jedoch souverän. Sie erfasst auch eindrucksvoll in Stimmgestaltung und Spiel die Ambivalenz der Turandot: die emotionale Starre, hinter der sich gleichwohl ein fühlendes Herz verbirgt. Ricardo Tamura bleibt als Akteur auf der Bühne blass, was wohl dem Einspringerstatus geschuldet ist. Unvollendet – vollendet Puccinis „Turandot“ gehört zu den unvollendeten Werken der Operngeschichte – der Meister starb 1924 vor Fertigstellung des 3. Akts. Sein Schüler Franco Alfano vollendete die Partitur nach Puccinis Notizen, die Uraufführung der „Turandot“ fand mit diesen Ergänzungen 1926 statt. Die viel kritisierte, dennoch gebräuchlich gewordene Fassung Alfanos ist auch Grundlage der Augsburger Aufführung. (sd) Seine Tenorstimme aber besitzt Kraft, Gleichmaß, Italianità, und so geht seinem Calaf „Nessun dorma“ mit Leichtigkeit, vielleicht eine Spur zu routiniert von den Lippen – jenem Calaf, der am Ende von seinem Liebesgespinst Abschied nimmt, als Turandot wieder im Sarkophag verschwindet. Sehr homogen das Ministertrio (das die Partie des Kaisers gleich miterledigt) mit Mark Bowman-Hester, Seung-Hyun Kim und Seung-Gi Jung. Ist bei „Turandot“ vom Gesang die Rede, geht es nicht ohne die Chöre. Karl Andreas Mehling hat das komplette Aufgebot des Theaters (Kinder inklusive) bestens präpariert. Der Komponist als Klassiker der Moderne In Dirk Kaftans Dirigat ist das Bestreben zu verspüren, Puccini nicht als bloßen Lieferanten süffiger Melodien zu verstehen, sondern als Klassiker der Moderne, der sehr wohl wusste, dass neben ihm Schönberg und Strawinsky wirkten. Einschlägig kantable Stellen der Partitur ließ Kaftan die Augsburger Philharmoniker jedenfalls nicht über die Maßen auskosten, war auch bemüht, klanglichen Monumentalismus gar nicht erst aufkommen zu lassen. Trotzdem hätte ein Quäntchen mehr Belcanto-Leidenschaft der Aufführung zu noch packenderem Ausdruck verholfen. Vielleicht auch deshalb zwar herzlicher, jedoch kein enthusiastischer Applaus. O Wieder am 29. Juni, dann bis 31. Juli neun weitere Aufführungen. Ganz auf Sicherheit Mark Knopfler Der Gitarrist in München: perfektes Handwerk, nicht mehr, nicht weniger VON FRANZ NEUHÄUSER Bekanntes, allzu Bekanntes von einem älteren Herrn: Mark Knopfler in München. Foto: Stefan M. Prager MONTAG, 28. JUNI 2010 München Eigentlich geht es um Mark Knopfler und sein Konzert auf dem Münchner Königsplatz. Aber es bietet sich ein kurzer Schwenk nach Dornbirn an. Dornbirn? Ja, Dornbirn, Österreich, south of the border, nahe Bregenz. Dort gastierte vorvergangenen Samstag Bob Dylan. Man wundere sich besser nicht, in welchen Orten musikalischer Diaspora seine niemals endende Tour inzwischen Station macht. Bob Dylan also in Dornbirn. Außergewöhnlich wie immer. Ein 16-Song-Programm, Raritäten aus seinem umfangreichen Katalog, die selbst vermeintliche Kenner ins Grübeln bringen. „The lonesome Death of Hattie Carrol“ – wo hat er das ausgegraben? Aber auch wohlbekannte Klassiker, die der Meister zuweilen sehr freihändig umdeutet. So wie „Desolation Row“, das vertraut beginnt und nach der dritten Strophe in eine Art Stakkato-Rap mutiert. Typisch Dylan eben. Der Wandel ist das beständigste Element in seinem Schaffen. Und jetzt dazu im harten Kontrast Mark Knopfler. Auch ein 16-Song-Programm. Aber ganz auf Sicherheit gespielt. Wer an dem wunderbaren Sommerabend die Augen schließt, der könnte meinen, dass da vorne auf dem Königsplatz eine riesige Stereoanlage steht. Der Sound perfekt ausbalanciert (zumindest in den bühnennahen Regionen), die Interpretation originalgetreu. Perfektes Musiker-Handwerk, aber kein bisschen Risiko. Beim Dire-Straits-Klassiker „Sultans of Swing“ zum Beispiel wird die eigentlich acht Mann starke Band freiwillig auf ein Quartett reduziert – weil das der Originalversion entspricht. Manchmal wünscht man sich ein bisschen mehr Dylan im Knopfler. Warum nicht mal die „Sultans“ im veränderten Arrangement? Fürchtet er, die Erwartungen des Publikums zu verprellen, wenn er sein Solo nicht lehrbuchexakt nachspielt? Neben den „Sultans“ greift Knopfler noch weitere vier Mal auf Dire-Straits-Material zurück („Romeo & Juliet“, „Telegraph Road“, „Brothers in Arms“, „So far away“), allesamt stürmisch gefeiert. Das restliche Programm, ein Querschnitt aus seinen Soloalben, wird freundlich begrüßt. In den hinteren Reihen des weitläufigen Areals mag man sich etwas gegrämt haben, dass sich Knopfler keine Videotechnik leisten mag, die ihn optisch etwas näher bringt. Andererseits: Viel zu sehen gibt es ja nicht. Ein älterer Herr im grauen Hemd und in Jeans, halb stehend, halb auf einem Hocker sitzend – des Rückens wegen. Der Arzt hat ihm „no more disco dancing“ verordnet, erklärt Knopfler in einer kurzen Ansprache. Ansonsten lässt er seine Musik sprechen. Und am Ende ist auch die spannendste Frage dieses Abends beantwortet. Das Gewitter, das sich im Münchner Osten aufgebaut hatte, verschonte den auf Sicherheit bedachten Herrn Knopfler und seine zufriedenen Fans. Ganz getreu dem Song-Titel und Tour-Motto „Get lucky“ – werde glücklich. Klagenfurt Peter Wawerzinek hat mit seinem Text „Rabenliebe“ den 34. Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Der Schriftsteller überzeugte mit den Erinnerungen an seine Kindheit in einem Waisenhaus in der ehemaligen DDR nicht nur die von Burkhard Spinnen geleitete siebenköpfige Fachjury, sondern auch die Zuhörer, die ihm zusätzlich per Internetabstimmung den Publikumspreis verliehen. „Peter Wawerzineks Prosa ist große Literatur“, lobte die Literaturkritikerin Meike Feßmann, die den Autor für den Wettbewerb vorgeschlagen hatte. Die Preisträger von vier der insgesamt fünf vergebenen Auszeichnungen sind Deutsche. Der von der Stadt Klagenfurt gestiftete Hauptpreis, der mit 25 000 Euro dotiert ist, gilt als eine der wichtigsten Literaturehrungen im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr waren bei dem dreitägigen Vorlesemarathon 14 Teilnehmer am Start, darunter neun Deutsche, drei Österreicher und zwei Schweizer. Das Leben als immerwährender Winter In Wawerzineks autobiografischem Buch, das im Herbst 2010 bei Galiani Berlin erscheinen wird, geht es um die Nöte eines Kindes, das von seinen Eltern in der DDR zurückgelassen wurde. Im Waisenhaus wird er als zurückgeblieben eingestuft und von anderen wegen seiner Magerkeit gehänselt. „Mein Leben kennt keine andere Jahreszeit als den Winter“, heißt es in dem erschütternden Text. Den Preis nahm Wawerzinek, der 1991 schon einmal bei Bachmann-Wettbewerb las, am Sonntag sichtlich bewegt entgegen. Den Kelag-Preis (10 000 Euro) erhielt die Schweizerin Dorothee Elmiger für ihren Text „Einladung an die Waghalsigen“. Sie war Wawerzinek zuvor bei der Stichwahl im zweiten Wahlgang mit drei zu vier Jurystimmen unterlegen. Der mit 7500 Euro dotierte 3sat-Preis ging an die in Berlin lebende Judith Zander für ihren Romanauszug „Dinge, die wir heute sagten“. Der in Gera geborene, in Dublin lebende Aleks Scholz bekam für „Google Earth“ den mit 7000 Euro dotierten ErnstWillner-Preis. (dpa) Zur Person Die Last der Erinnerung Peter Wawerzinek ist mit 55 Jahren der bisher älteste Preisträger des renommierten Ingeborg-BachmannWettbewerbs. 1954 als Peter Runkel in Rostock in der ehemaligen DDR geboren, flüchteten seine Eltern in den Westen und ließen den Vierjährigen zurück. Nach zehn Jahren in staatlichen Kinderheimen wurde er adoptiert und wuchs an der Ostsee auf. Nach dem Schulabschluss machte er eine Lehre als Textilzeichner, brach später jedoch sein Studium an der Kunsthochschule ab. Der heute in Berlin lebende Schriftsteller übte anschließend viele Berufe aus, war als Totengräber und Tischler tätig und machte sich in der Ostberliner Szene in den 1980er Jahren als Performance-Künstler und Stegreifpoet einen Namen. Die verlorenen Eltern belasteten jedoch weiterhin sein Leben. Nach dem Mauerfall suchte und fand er seine Mutter. Es blieb aber bei einer einzigen Begegnung. Über seine Gefühle und Erinnerungen geschrieben zu haben, habe eine „riesige Last“ von ihm genommen, sagt Wawerzinek über seinen beim Klagenfurter Wettbewerb erfolgreichen Text „Rabenliebe“. (dpa)