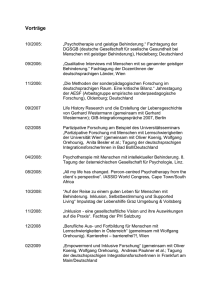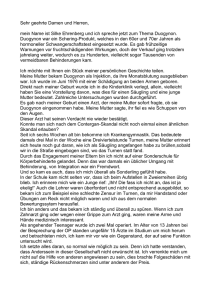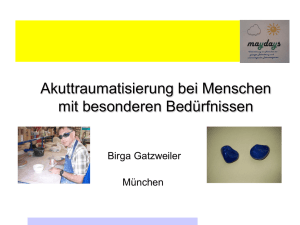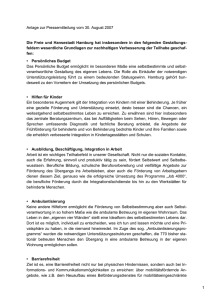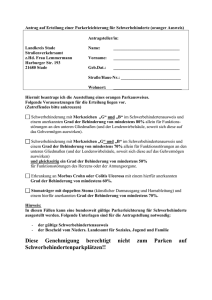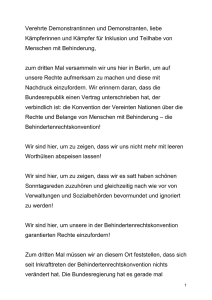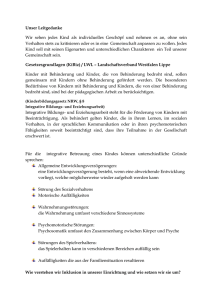Leseprobe - Krammerbuch
Werbung

1 Stand der Forschung 1.1 Definition und Klassifikation Unter dem Begriff der geistigen oder intellektuellen Behinderung werden Erscheinungsbilder zusammengefasst, die vor allem durch abweichende Entwicklungen in kognitiven sowie in sozial-adaptiven Fertigkeiten ab der frühen Kindheit charakterisiert werden. Der Begriff hebt somit jene Merkmale hervor, die für das klinische Erscheinungsbild prominent sind, nämlich eine deutliche Beeinträchtigung in den intellektuell-kognitiven Funktionen, im Generalisierungsvermögen, im Vorstellungsvermögen, bei der Stategieentwicklung und bei der Strategieumsetzung. Begriff Damit gehen deutlich niedrigere Leistungen in Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktionen einher. Durch diese Probleme wird die Ausbildung mentaler Konzepte erschwert, anhand derer wiederholt dargebotene Informationen mit früheren Eindrücken oder Ereignissen verglichen und identifiziert werden. Durch die Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses sowie der Entwicklung prä-verbaler Schemata fehlen wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung von abstrakt-logischen bzw. komplexen kognitiven Denkfunktionen. Als weitere Merkmale lassen sich Unterschiede in den sprachlichen und motorischen Fertigkeiten sowie damit einhergehende Kommunikations- bzw. Koordinationsstörungen feststellen (Weber & Rojahn, 2005). In den internationalen Klassifikationsschemata ICD-10 und DSM-IV werden unterschiedliche Grade von geistiger Behinderung (Intelligenzminderung) unterschieden (vgl. Tab. 1). Die Einteilung erfolgt nach Intelligenz- oder Entwicklungstestergebnissen. Kinder mit leichter geistiger Behinderung haben in der Regel recht gute sprachliche Fähigkeiten und Aussichten, basale Kenntnisse im Lesen und Schreiben zu erwerben. Bei mittelgradiger Behinderung sind die kognitiven, sprachlichen und schulischen Fertigkeiten stärker eingeschränkt, viele Fähigkeiten der Selbstversorgung können aber sehr wohl erlernt werden. Tabelle 1: Klassifikation der Intelligenzminderung nach ICD-10 Leicht F 70 IQ 50–70 Mittelgradig F 71 IQ 35–49 Schwer F 72 IQ 20–34 Schwerst F 73 IQ < 20 Klassifikation nach Schweregraden 2 Kapitel 1 1.2 Epidemiologie 80.000 Schüler Über die Gesamtzahl der Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland gibt es keine zuverlässigen Angaben. Nach den Grundund Strukturdaten, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung veröffentlicht wurden, befinden sich 68.467 Schüler und Schülerinnen in Klassen für geistig Behinderte. Eine beträchtliche Zahl von Schülern mit geistiger Behinderung und zusätzlichen (Sinnes- oder Körper-)Behinderungen wird in anderen Sonderschulformen unterrichtet, etwa 2 000 Schüler nehmen bundesweit am gemeinsamen Unterricht in integrativen oder inklusiven Klassen teil. Daher wird von einer Gesamtzahl von über 80 000 Schülern und Schülerinnen mit geistiger Behinderung ausgegangen (Mühl, 2006), was etwa 0.8 bis 0.9 % pro Geburtsjahrgang entspräche. Skandinavische und nordamerikanische Studien, die z. T. auf der vollständigen Erfassung einer regionalen Population beruhen, kommen für die schwere Intelligenzminderung zu relativ übereinstimmenden Prävalenzangaben von 0.3 bis 0.4 % je Geburtsjahrgang. Es finden sich keine geschlechtsspezifischen oder sozialen Unterschiede, d. h. die schwere geistige Behinderung tritt bei Jungen und Mädchen und in allen sozialen Schichten gleichermaßen häufig auf. Die Prävalenzangaben zur leichten Intelligenzminderung variieren stärker. Biologische Ursachen Epidemiologische Studien haben auch wertvolle Erkenntnisse über die Verteilung der Ursachen von geistiger Behinderung geliefert. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass bei der Ätiologie der schweren geistigen Behinderung (IQ < 50) biologische Faktoren überwiegen. Hagberg und Kyllerman (1983) fanden z. B. bei 55 % der Patienten, Strømme und Hagberg (2000) bei 70 % pränatale Ursachen. Darunter sind genetische Störungen und nicht-chromosomale Dysmorphiesyndrome am häufigsten. Unter den Patienten mit leichter geistiger Behinderung ist der Anteil perinataler Ursachen (Infektionen, Asphyxien und Hirnblutungen nach sehr unreifer Geburt u. Ä.), vor allem aber – trotz verbesserter medizinischer Diagnostik – der Anteil an ungeklärter Ätiologie weitaus höher. In dieser Gruppe ist auch der Einfluss ungünstiger Umweltfaktoren (z. B. mütterlicher Alkohol- oder Drogenkonsum) weitaus höher als bei schwerer Behinderung und wird für fast 10 % der Fälle verantwortlich gemacht. Kovariation mit dem Sozialstatus Auch spielen bei der leichten Behinderung multifaktorielle polygene Erbgänge eine größere Rolle, bei denen die modulierenden Faktoren der Umwelt stärker wirken. So fanden Strømme und Magnus (2000) bei der Untersuchung von Schulkindern in Norwegen ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer leichten geistigen Behinderung in Familien mit niedrigem Haushaltseinkommen und Bildungsstatus, während das Auftreten Stand der Forschung 3 einer schweren Behinderung nicht mit dem Sozialstatus kovariierte. In dieser Gruppe ist die Zahl der Jungen auch etwa im Verhältnis 1,6 : 1 höher als die der Mädchen. 1.3 Klinische Symptomatik und Psychopathologie Unter Fachleuten besteht ein breiter Konsens, geistige Behinderung als menschliche Existenzweise mit besonderem Förder- und Hilfebedarf und nicht als klinische Störung oder Krankheit anzusehen, auch wenn sie nach wie vor in den psychiatrischen Diagnosesystemen ICD-10 und DSM-IV in dieser Form aufgeführt wird. Psychische Störungen sind nicht zwangsläufig die Folge oder unvermeidliche Begleiterscheinungen kognitiver Defizite. Es ist aber von einer erhöhten Störanfälligkeit infolge ungünstiger biologischer Dispositionen, beeinträchtigter Verarbeitungsprozesse, emotional belasteter Beziehungen, eingeschränkter Entwicklungsmöglichkeiten und ungünstiger Lernerfahrungen auszugehen, die problematische Erlebens- und Verhaltensweisen entstehen lassen und aufrecht erhalten (Irblich, 2005). Psychische Störungen und problematische Erlebens- und Verhaltensweisen können prinzipiell bei allen Schweregraden der geistigen Behinderung vorkommen. Dabei ähnelt das Störungsspektrum bei leichter geistiger Behinderung dem bei nicht behinderten Kindern und Jugendlichen, während bei schwerer Behinderung Selbstverletzungen und Stereotypien häufig sind, die bei Kindern ohne geistige Behinderung nur sehr selten auftreten (Dekker et al., 2002; vgl. Tab. 2) Tabelle 2: Relativer Anteil (%) von Kindern mit auffälligen CBCL-Skalenwerten bei leichter bzw. schwerer intellektueller Behinderung (Dekker et al., 2002) IQ 60 bis 80 IQ 30 bis 60 Zurückgezogen 17.5 22.3 Körperliche Beschwerden 12.0 8.3 Ängstlich-depressiv 16.8 10.3 Soziale Probleme 35.5 51.7 8.8 12.3 Aufmerksamkeitsstörung 30.7 38.0 Dissoziales Verhalten 18.0 11.0 Aggressives Verhalten 21.0 19.7 Denkstörung Anmerkung: CBCL – Child Behavior Checklist (Elternfragebogen) Unterschiedliches Störungsspektrum 4 Kapitel 1 Spezielle Psychopathologie Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung können eine Reihe spezieller Symptome und Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Aggressives Verhalten äußert sich oftmals in Form unprovozierter, und daher unvorhersehbarer körperlicher Angriffe auf andere Kinder, Jugendliche, Erzieher oder Eltern. Schlagen, Boxen, Beißen und Kratzen sind typische Beispiele. Es kann sich als destruktives Verhalten auch auf Gegenstände beziehen. Häufige Formen selbstverletzenden Verhaltens sind Beißen der Lippen und Wangen, Finger und Hände sowie Ins-Gesicht-Schlagen, Kopfschlagen, Haarereißen, Augenbohren. Stereotypien sind repetitive, monotone Bewegungen und Bewegungsabläufe, deren Funktion nicht unmittelbar erkennbar ist und die automatisch bestärkt, bzw. zwanghaft wirkt. Dazu gehört das Wedeln mit den Händen, Drehen der Finger vor dem Gesicht, Körperschaukeln, bizarre Körperhaltungen, Drehen, Zwirbeln oder Aufreihen von Objekten, Augenbohren, Drehen an den Haaren, Zum-Mund-Führen von Gegenständen oder Lutschen an den Fingern. Hyperaktives und impulsives Verhalten umfasst einen starken Bewegungsdrang, fehlende Fähigkeit zu gezielter selbstständiger Beschäftigung, überschießendes Reagieren auf bestimmte Ereignisse und fehlende Gefahreneinschätzung. Es geht oft einher mit ausgeprägtem Verweigerungsverhalten bei sozialen Anforderungen. Zusätzlich bestehen zu einer Reihe von psychischen Störungen spezielle Beziehungen (vgl. Steinhausen 2003, 2006). Unter den tiefgreifenden Entwicklungssstörungen ist vor allem die Koexistenz mit dem frühkindlichen Autismus zu nennen, zumal bis zu drei Viertel aller Kinder mit einem frühkindlichen Autismus geistig behindert sind. Wenngleich bei der Definition Hyperkinetischer Störungen (bzw. ADHS) von einer normalen Intelligenz ausgegangen wird, sind die Symptome von Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizit und Impulsivität bei geistiger Behinderung häufig und wurden in der alten Literatur in dieser spezifischen Beziehung vor allem zur schweren geistigen Behinderung abgrenzend und treffsicher mit dem Begriff der Erethie bezeichnet. Die ICD-10 berücksichtigt eine Hyperkinetische Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien (F84.4), für die eingeräumt wird, dass sie schlecht definiert und hinsichtlich der nosologischen Validität unsicher sei. Gleichwohl werden damit charakteristische Symptome bei mittelgradiger und schwerer geistiger Behinderung zu einem psychopathologischen Syndrom zusammengefasst. Die Ausscheidungsstörungen Enuresis und Enkopresis kommen bei Kindern mit geistiger Behinderung häufiger als bei normal intelligenten Kindern vor. Seltene Formen der Essstörungen wie Pica und Rumination sind kaum bei normal intelligenten Kindern zu beobachten und Polydipsie und Polyphagie werden in der Regel durch die auch für die schwere geistige Behinderung verursachende Hirnschädigung vermittelt. Die Diagnose von schizophrenen Psychosen kann speziell bei schwerer geistiger Behinderung Probleme in der Abgrenzung aufwerfen. Ebenso ist die Stand der Forschung 5 Diagnostik schwerer depressiver Episoden bei mittelgradiger und schwerer geistiger Behinderung durch den beeinträchtigten Rapport zusätzlich kompliziert. Atypische psychotiforme Bilder können im Zusammenhang mit neurodegenerativen Störungen beobachtet werden, die in der ICD-10 psychopathologisch am ehesten durch die Kategorie der desintegrativen Störungen des Kindesalters (F84.3) erfasst werden. Die ICD-10 bietet innerhalb der Kategorie „Intelligenzminderung“ eine grobe Klassifikation für Verhaltensstörungen an, indem keine oder geringfügige Verhaltensstörungen z. B. mit F70.0, deutliche Verhaltensstörungen mit F70.1, nicht näher bezeichnete Verhaltensstörungen mit F70.9 kodiert werden. Zusätzliche Diagnosen aus anderen Abschnitten, z. B. die Kodierung von Verhaltens- und emotionalen Störungen des Kindes- und Jugendalters unter F90 bis F98 werden nicht ausgeschlossen. Verhaltensstörungen Wie in anderen Bereichen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und klinischen Kinderpsychologie wurden auch im Bereich der geistigen Behinderung zahlreiche Studien zur Prävalenz von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Eine aktuelle Übersicht geben Whitaker und Read (2006). Gillberg et al. (1986) stellten z. B. in einer repräsentativen Stichprobe von 149 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren bei 64 % der Jugendlichen mit schwerer intellektueller Behinderung (IQ < 50) und 57 % der Jugendlichen mit leichter intellektueller Behinderung (IQ 50 bis 70) die Diagnose einer psychischen Störung. Strømme und Diseth (2000) untersuchten 178 Kinder in Norwegen und fanden eine oder mehrere psychische Störungen bei 42 % der Kinder mit schwerer und 33 % der Kinder mit leichter intellektueller Behinderung. Die häufigsten Diagnosen waren Hyperaktivität (16 %), Störungen aus dem autistischen Spektrum (8 %) und Stereotypien (5.5 %). 3- bis 4-mal höhere Rate Emerson (2003a) kam in einer repräsentativen Untersuchung an 264 Kindern zwischen 5 und 15 Jahren in England zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Eine psychiatrische Diagnose wurde bei 39 % gestellt. Die häufigsten Störungsbilder waren oppositionelle und soziale Verhaltensstörungen (13.3 %), emotionale Störungen (9.5 %), hyperkinetische Störungen (8.7 %), tiefgreifende Entwicklungsstörungen (Autismusspektrum, 8.7 %) und verschiedene Angststörungen (8.7 %). Depressive Störungen, Essstörungen oder psychotische Störungen wurden statistisch nicht häufiger diagnostiziert als in der Normalpopulation. Dekker und Koot 2003a) fanden in den Niederlanden unter 474 Kindern (7 bis 20 Jahre, standardisiertes kinderpsychiatrisches Interview) bei 14.8 % eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und bei 16.9 % eine Störung des Sozialverhaltens. In dieser Stichprobe ergaben sich zusätzlich erhöhte Raten für Angststörungen (21.9 %) und affektive Störungen (4.4 %). Die aktuellen Studien lassen sich zusammenfassen zu der Schlussfolgerung, dass die Rate psychischer Störungen durchweg um das 3- bis 4-fache höher ist als in der Normalpopulation. Studien, bei 6 Kapitel 1 denen die Prävalenz mittels psychopathologischer Fragebögen beurteilt wird, kommen zu ähnlichen Ergebnissen (vgl. Tab. 3). Tabelle 3: Studien zur Prävalenz von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung mit Verhaltensfragebögen Verfasser Relativer Anteil behandlungsbedürftiger Kinder Methode N Dekker et al. (2002) CBCL 1041 50 % Koskentausta et al. (2004) CBCL 90 43 % Baker et al. (2002a) CBCL 225 26.1 % Einfeld und Tonge (1996) DBC 428 40.7 % Cormack et al. (2000) DBC 123 50.4 % Anmerkung: CBCL = Child Behavior Checklist, DBC = Developmental Behavior Checklist Psychopathologische Vulnerabilität Für die erhöhte psychopathologische Vulnerabilität sind verschiedene Erklärungsansätze vorgeschlagen worden (Dykens 2000). Persönlichkeitsbezogene Ansätze stellen das weniger differenzierte Selbstkonzept, Versagenserlebnisse in der Lerngeschichte, Außenorientierung bei der Problembewältigung und abweichende soziale Stile mit sowohl mehr Enthemmung als auch mehr Isolation in den Vordergrund. Zu den familiären Faktoren werden Belastung, Minderbegabung und psychische Störungen in der Familie gerechnet. Auch soziale Faktoren leisten über das erhöhte Misshandlungs- und Missbrauchsrisiko sowie Ablehnung und Stigma bedeutsame Beiträge. Schließlich können biologische Faktoren wie begleitende Epilepsien, teratogene Schäden (z. B. bei den Fetalen Alkohol-Spektrumsstörungen) oder Verhaltensphänotypen wirksam sein, bei denen eine spezifische Form einer genetisch vermittelten psychopathologischen Vulnerabilität angenommen wird. Assoziation mit Elternbelastung Emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten treten bereits bei 2- bis 4-jährigen Kindern mit geistiger Behinderung wesentlich häufiger auf als bei nicht behinderten Kindern. Sie bestimmen in höherem Maße die elterliche Belastung und die Beziehungsqualität in der Familie als die Diagnose der Behinderung selbst. Es kommt zu Wechselwirkungen; die Probleme verfestigen und verschärfen sich insbesondere bei den Kindern, deren Eltern sich hoch belastet fühlen (Baker et al., 2002a, 2003; Herring et al., 2006). Risikofaktoren Einzelne Autoren haben sich mit der Identifikation von Risikofaktoren für die Ausbildung psychischer Störungen beschäftigt. Die einzelnen Faktoren haben offenbar je nach Schweregrad der Behinderung unterschiedliche Relevanz. Bei schwerer Behinderung scheinen die sozioöko- Stand der Forschung 7 nomischen Bedingungen, das Geschlecht und Alter der Kinder keinen Einfluss zu haben (Chadwick et al., 2000). In der Gesamtgruppe von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung treten psychische Auffälligkeiten mit höherer Wahrscheinlichkeit auf bei Jungen, Jugendlichen und ungünstigen Familienumständen (niedriger sozialer Status, Armut, alleinerziehende Eltern, psychiatrische Belastung eines Elternteils). Kein systematischer Unterschied fand sich zwischen Kindern, die integrative Schulen besuchen, und solchen aus Förderzentren (Emerson, 2003b; Dekker & Koot, 2003b). McClintock et al. (2003) analysierten die Risikofaktoren für verschiedene Störungsbilder. Aggressive und destruktive Verhaltensweisen waren besonders häufig bei Kindern mit zusätzlichen autistischen Merkmalen, selbstverletzende Verhaltensweisen bei Kindern mit geringen rezeptiven und expressiven Kommunikationsfähigkeiten. 1.4 Verhaltensphänotypen Neben dem Schweregrad der intellektuellen und kommunikativen Behinderung stellen genetische Dispositionen und teratogene Störungen bei spezifischen Syndromen ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung psychischer Störungen dar (u. a. Dykens & Hodapp, 2001; Sarimski, 2003; Steinhausen et al., 2002, 2003, 2004). Bei ihnen gehört eine Disposition zur Ausbildung bestimmter emotionaler oder sozialer Auffälligkeiten zu ihrem syndromspezifischen Verhaltensphänotyp. Der Begriff des Verhaltensphänotyps meint eine Kombination von Entwicklungs- und Verhaltensmerkmalen, die bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einem bestimmten genetischen Syndrom häufiger oder stärker ausgeprägt sind als bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen mit einer Behinderung anderer Ursache (Dykens, 1995). Damit ist allerdings nicht postuliert, dass syndromspezifische Entwicklungs- und Verhaltensmerkmale für jedes Kind mit diesem Syndrom in gleichem Maße und in jeder Entwicklungsstufe zutreffen müssen. In der Regel handelt es sich um eine partielle Spezifität, d. h. bestimmte Symptome treten bei einem definierten Syndrom häufiger auf als bei Kindern mit intellektueller Behinderung im Allgemeinen, jedoch nicht ausschließlich bei Kindern mit dieser Anlage. Konzept der Verhaltensphänotypen Zum Verhaltensphänotyp von Kindern mit Fragilem-X-Syndrom gehört eine schwere Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung, soziale Scheu und stereotype sowie selbstverletzende Verhaltensweisen (Wedeln mit den Armen, Handbeißen; u. a. Backes et al., 2000; Hatton et al., 2002; Steinhausen et al., 2002). Bei Kindern mit Prader-Willi-Syndrom stehen zwanghafte Verhaltensweisen, Wutanfälle und selbstverletzendes Verhalten („skin-picking“; u. a. Dykens et al., 1996; Einfeld et al., 1999; Sarimski, 2002; Steinhausen et al., 2002, 2004), bei Kindern mit Willi- Syndromspezifische Merkmale 8 Kapitel 1 ams-Beuren-Syndrom spezifische Ängste und eine allgemeine Überbesorgtheit (Dykens et al., 2003) im Vordergrund. Kinder mit Cri-du-ChatSyndrom weisen eine besondere Irritabilität und Neigung zu stereotypen und selbstverletzenden Verhaltensweisen auf (Ross Collins & Cornish, 2002). Beim Smith-Magenis-Syndrom (SMS) gehören Wutanfälle, Selbstverletzungen und schwere Schlafstörungen zum Verhaltensbild (Clarke & Boer, 1998; Sarimski, 2004). Unterschiedliche selbstverletzende Verhaltensweisen gehören zu den Merkmalen des Verhaltensphänotyps bei bestimmten Syndromen, z. B. die Neigung zum Aufbeißen der Lippen und Finger (zusammen mit Kopfschlagen, Einklemmen der Arme, Augenbohren) bei Patienten mit Lesch-Nyhan-Syndrom, Beißen beim Cornelia-de-Lange-Syndrom (Berney et al., 1999) und Nägelreißen beim SMS (Dykens & Smith, 1999). Bei Fetalen Alkohol Spektrumsstörungen sind Leitsymptome der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) charakteristisch (Steinhausen et al., 1993, 2002, 2003). Das Verhalten bei Mädchen mit Rett-Syndrom ist durch extreme Stereotypien (Handbewegungen, Atemregulationsstörungen, Bruxismus) geprägt (Mount et al., 2002; Sarimski, 2003). Kinder mit AngelmanSyndrom weisen eine sehr hohe Rate von Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsproblemen sowie Schlafstörungen auf (Clarke & Marston, 2000). Zwanghafte Verhaltensweisen sind häufig bei Kindern mit Cornelia-de-Lange-Syndrom (Hyman et al., 2002). Erhöhtes Risiko psychotischer Erkrankungen Bei einzelnen Syndromen muss auch mit einem höheren Risiko für die Ausbildung von psychotischen Störungen im Jugendalter gerechnet werden. Dies gilt für Jugendliche und Erwachsene mit Prader-Willi-Syndrom (Clarke, 1998) und einer Deletion 22q11 (Briegel & Cohen, 2004). Depressionen treten gehäuft bei Jugendlichen mit Down-Syndrom auf (Collacott et al., 1992). Die Zusammenhänge zwischen genetischer Disposition und Ausbildung dieser Erkrankungen sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die Rate schwerer affektiver und psychotischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung nicht generell erhöht ist. 1.5 Neuropsychologische Aspekte Differenzierung neuropsychologischer Funktionen Forschungsarbeiten zu neuropsychologischen Aspekten versuchen, Kerndefizite durch geeignete Testverfahren zu identifizieren und ihre Zusammenhänge mit den Befunden in neurophysiologischen und bildgebenden Verfahren zu analysieren. Während sich dieser Ansatz bei Kindern mit Lernbehinderungen und autistischen Störungen als sehr fruchtbar erwiesen hat, steckt er bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung noch in den Anfängen. Zu den wichtigen Funktionen, die durch eine neuropsychologische Diagnostik differenziert werden sollen, gehören: