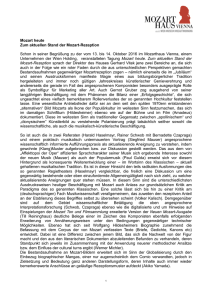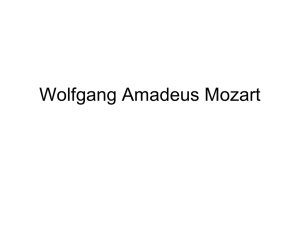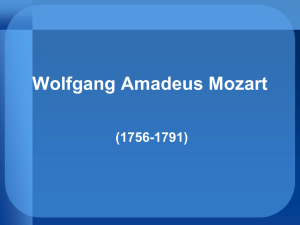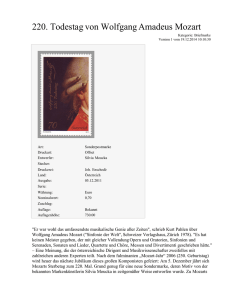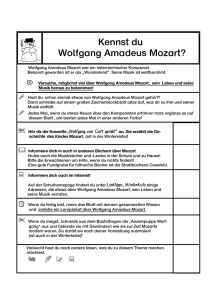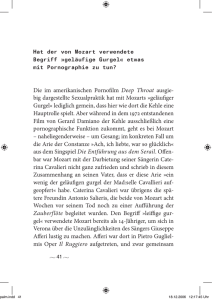- Deutsche Mozart
Werbung

Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft MOZART! SCHWERPUNKT WETTSTREIT HÖHER, SCHNELLER, SCHÖNER? Konkurrieren um den Schönklang – heute und früher 03+06 08 10 12 14 05+16 Eine Oper über die Oper: FLORIAN GASSMANNS »L’OPERA SERIA« dirigiert von René Jacobs in Brüssel COMPOSER SLAM Wettbewerb ad absurdum geführt AUGSBURG – SALZBURG – ZHUHAI © Daniel Delang Die drei großen Mozartwettbewerbe Die Musik ist wichtiger als Wettbewerbe: Interviews mit JULIA JONES und INGOLF WUNDER UNSERE EMPFEHLUNGEN – Bücher und CDs EDITORIAL Liebe Mitglieder der DMG, liebe Crescendo-Leser, DOKUMENT »Mon très cher Pére« – mit diesen Worten beginnt Wolfgang Amadé Mozarts Brief vom 16. Januar 1782, in dem er seinem Vater vom Wettstreit mit seinem Kollegen Muzio Clementi berichtet, den er am Weihnachtsabend vor Kaiser Joseph II. und Ehrengästen in der Wiener Hofburg absolvieren musste. © Internationale Stiftung Mozarteum, Bibliotheca Mozartiana Wettbewerbe sind ein essentieller Bestandteil des Musikbetriebs geworden und kaum eine internationale Karriere eines Spitzenkünstlers ist ohne die Beteiligung an namhaften Formaten wie einem ARD-Wettbewerb oder ähnlichen internationalen Marken denkbar. Mozart hätte sich in seiner Zeit wohl kaum vorstellen können, wie ausgefeilt Jury-Regularien sein können und wie hart umkämpft der Musikmarkt. Wettbewerbe waren im 18. Jahrhundert eher noch ein Wettspiel und ein aristokratisches Vergnügen, das der Unterhaltung diente. In diesem Zusammenhang denken wir z. B. an die von ­Kaiser Josef II. am Weihnachtsabend 1781 arrangierte Begegnung zwischen Mozart und Clementi, bei der beide Künstler am Fortepiano versuchten, die auf sie ausgesetzten Wetten für sich zu entscheiden. Anders verhält es sich schon mit dem 1786 ebenfalls von Josef II. ausgelobten Opernwettstreit. Bei einem Fest im Palmenhaus von Schönbrunn trafen mit Mozart und Salieri zwei Komponisten aufeinander, die grundsätzlich um Aufträge konkurrierten. In der Folge stilisierte man beide zu erbitterten Gegenspielern. Vermutlich pflegten sie aber eher einen professionellen Umgang miteinander, darauf lässt jedenfalls die als Gemeinschaftswerk komponierte Arie Per la ricuperata salute di Ophelia schließen, die erst jüngst im Prager Musik­museum gefunden wurde. Wettbewerb um Aufträge und die Gunst des Publikums gibt es aber nicht nur in der Wiener Klassik. In den europäischen Metropolen verlangt ein inzwischen bürgerliches Publikum nach immer neuen aufregenden Entdeckungen und Virtuosen, die wir heute Stars nennen. Ein Musiker- oder Primadonnenwettstreit wie noch in Mozarts Schauspieldirektor entspricht kaum mehr der Wirklichkeit. Statt von den Künstlern selbst, wird dieser heute von den Marketingabteilungen großer Labels oder Agenturen ausgetragen. Sie konkurrieren um Marktanteile in einem globalen Klassikgeschäft, das um Quoten und bei gleichbleibendem Standardrepertoire, um neue, unverbrauchte Interpreten ringt. Diese wiederum – und hier schließt sich der Kreis – generiert der Klassikmarkt in Wettbewerben. Mit der vorliegenden Ausgabe bieten wir Ihnen einen Streifzug durch die Welt der Wettbewerbe von »Jugend musiziert« bis zum »Composer Slam«. Bei allem Wettbewerbsdenken, wollen wir aber auch die persönlichkeitsbildende Kraft der Musik nicht aus dem Auge verlieren. Viel Vergnügen und eine anregende Lektüre wünscht Ihnen Fundstück So ein Wettspiel zweier Musiker auf Befehl adliger Gönner dürfte einigermaßen demütigend gewesen sein. Doch ließ sich Mozart bereitwillig darauf ein: Er war auf das Wohl­ wollen des Kaisers angewiesen, konnte jede Einkommensquelle gebrauchen – die 50 Dukaten, mit denen ihn der Kaiser belohnte, waren ebenso großzügig wie hoch willkommen – und wollte sich und seine Kunst in den musikaffinen Wiener Kreisen bekannt machen. Die Rechnung ging auf: Anfang März 1782 konnte Mozart das erste eigene Konzert geben. Während Clementi sich später v. a. an das elegante Äußere Mozarts erinnerte, bietet Mozart in seinem Bericht an den Vater Einblick in seine ästhetischen Überzeugungen: Geschmack und Empfindung waren ihm wichtiger als bloße Technik. Noch heute gilt es bei jedem Wettbewerb, zwischen diesen beiden Aspekten abzuwägen. ❙ Ihr THOMAS WEITZEL, Präsident der Deutschen Mozart-Gesellschaft Cover ❙ Flötist, Preisträger, Mozartfan: SÉBASTIAN JACOT im Herkules-Saal in München beim ARD-Wettbewerb 2015, fotografiert von Daniel Delang 2Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft Aufruhr in der »theuren Halle«: In der Romantik hielt man den Sängerkrieg auf der Wartburg für ein historisches Ereignis. WETTSTREIT Höher, schneller, schöner? Mozart war nicht der Erste, der musikalisch gegen seine Kollegen antrat von Dr. Melanie Wald-Fuhrmann Das antike Vorbild Fresko von Moritz von Schwind: Der Sängerkrieg, 1855, Wartburg »Zum Kampf der Wagen und Gesänge, Der auf Corinthus Landesenge Der Griechen Stämme froh vereint, Zog Ibycus, der Götterfreund.« Angesichts der dramatischen Ereignisse, von denen Schiller in seiner Ballade Die Kraniche des Ibycus (1798) erzählt, überliest man bisweilen den Hintergrund des Szene: Ibykos, ein historisch belegter lyrischer Dichter des 6. Jhs. v. Chr. ist auf dem Weg zu den isthmischen Spielen in Korinth. Diese fanden seit 580 v. Chr. alle zwei Jahre zu Ehren des Gottes Poseidon statt. Wie die drei anderen sogenannten panhellenischen Wettspiele – die olympischen, die pythischen und die nemeischen – umfassten auch die Isthmien nicht nur athletische Disziplinen wie verschiedene Läufe, Wagenrennen mit Pferden, Fünfkampf, Diskuswerfen oder Ringen, sondern auch eine ganze Reihe musischer Wettkämpfe: Singen zur Kithara, Singen zum Aulos, reines Aulos-Spiel, reines Kithara-Spiel, Tragödien-­Auf­ führungen, rhetorische Vorträge und Malen. So ist die Geschichte der Musik-Wettbewerbe also mittlerweile über 2500 Jahre alt. Und wenn die Kombination von Sport und Musik heutzutage auch eher abwegig erscheint, gelten andere Aspekte noch immer: So gab es bereits Wertungs-Jurys, die sich auf Beurteilungskriterien einigen mussten – schließlich ermittelten sich musische Sieger im Gegensatz zu sportlichen nicht von selbst. Die Sieges­ preise waren eher symbolischer Art – Lorbeerkränze in Delphi, Fichten­zweige in Korinth –, doch konnte der so gewonnene Ruhm etliche positive Folgen haben. Wer, wie der Chorlyriker Pindar, mit dem Dichten und Komponieren seinen Lebensunterhalt verdienen wollte – was damals noch alles andere als die Regel war –, konnte nach ­einem Sieg auf Aufträge reicher Mäzene oder gar eine Anstellung hoffen. Mozart, der als Wunderkind zwar keine regulären Wett­ bewerbe absolvierte, aber von seinem Vater ein Show-Programm beigebracht bekommen hatte, bei dem die zirzensisch-sportlichen Anteile überwogen, ging es ebenso. Ritter, Barden, Meistersinger Musikwettbewerbe – also im Vergleich ermittelte beste Sänger, Barden oder Dichter-Komponisten – standen auch bei der ritter­ lichen Elite an den mittelalterlichen Höfen hoch im Kurs. Weiterhin wurde das musikalische Wetteifern nach einem sportlichen Muster, dem der Turniere, gemodelt und diente nicht der Vor­ führung professioneller Standards, sondern dem Nachweis allgemeiner höfischer Qualitäten. Die Sage (und Liedersammlung) vom Sängerkrieg auf der Wartburg ist ein plastischer Reflex davon. Die ­Eisteddfoddau – Bardenwettbewerbe – der irischen und wali­ sischen Barden hingegen dürften als nationale Volksfest eher an die Zusammenkünfte der alten Griechen erinnert haben. Zünftisch ernst nahmen hingegen die städtischen deutschen Meistersinger Regeln und Wettbewerb. Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft3 Amphora des Andokides-Malers, aus Athen (um 525 / 520 v. Chr.). Dargestellt werden zwei Musiker auf einer Bühne. Der eine ist ein Aulos-Spieler, bei dem anderen könnte es sich um einen ­Sänger handeln. Ist die Person vor den beiden Musikern ein Jury-Mitglied? Dargestellt ist vermutlich ein musikalischer Wettbewerb. Aber für all diese Formen gilt: Musikalische Praxis und Kreativität forderte offenbar zum Vergleich auf. Musiker wie Publikum wollten schlecht von gut, gut von besser unterscheiden und zwar nicht auf dem Papier, sondern in einer lebendigen Vorführung. Dass dabei die Unterhaltung oft wichtiger war als das Künstlerische, dokumentieren nicht zuletzt die von Fürsten angeordneten Wettspiele von Musikern. Das Duell zwischen Mozart und Clementi von 1781 ist dabei durchaus typisch: Der Fürst, hier Joseph II., nimmt die Durchreise eines fremden Virtuosen zum Anlass, dessen virtuose Fertigkeiten zu testen, indem er einen seiner besten vor höfischem Publikum gegen ihn antreten lässt und auch noch auf ihn wettet. Auch der Stücke-Wettbewerb zwischen Mozart und Salieri im ­Februar 1786 war letztlich nur ein Moment im höfischen Fest­ kalender anlässlich des Besuches des niederländischen Statthalterpaars: Die Orangerie von Schloss Schönbrunn, in der auf je einer Bühne rechts und links die heiteren Einakter Der Schauspieldirektor (Johann Gottlieb Stephanie / Mozart) und Prima la musica e poi le parole (Giambattista Casti / Salieri) gegeneinander antraten, war für das höfische Festpublikum prächtig illuminiert worden. Wer da siegte und aufgrund welcher Kriterien, war eigentlich bedeutungslos, jedenfalls ist es uns nicht überliefert. wichtigen Instrument der musikalischen Ausbildung und beruf­ lichen Selektion. Erstmals trennt man klar zwischen Kompositionsund Interpretations-Wettbewerben. Intern hatten Musiker freilich schon zuvor darauf gesetzt: Für die Besetzung von evangelischen Kantoren-Positionen gab es formalisierte Prozeduren aus Vorspiel und der Aufführung einer eigenen Komposition, und auch spontane Wettspiele ereigneten sich immer wieder – Mozart beispielsweise wurde mehrmals von Kollegen zu einem musikalischen »Duell« gefordert und trat sowohl gegen den Organisten Häußler wie den Pianisten Ignaz Beecke an. Das Wettbewerbsmodell entspricht einerseits den bürgerlichen Werten: Der Erfolg einer Person wird nicht von ihrer Herkunft, sondern von ihrem Fleiß und ihrer objektiven Leistung bestimmt. Zugleich rückte mit dem Virtuosenzeitalter in den 1820er und 1830er ­Jahren die technische Fertigkeit und Brillianz in den Vordergrund, wodurch so manche Vorführung wieder mehr an eine sportliche als eine künstlerische Übung erinnerte. Wenn sich auch ab den 1840er Jahren die Maßstäbe wieder änderten, besteht der Streit zwischen Technik und interpretativer Kunst weiter fort. Die Diskussion um Wertungs­maßstäbe, ihr Objektivierbarkeit und subjektiver Anteil gehört folglich zu jedem Wettbewerb. Sie wird entsprechend ernsthaft geführt, nicht zuletzt, weil sich alle Beteiligten bewusst sind, wie sehr die Karrieren junger Musikerinnen und Musikern von Wett­ bewerbs-Erfolgen abhängen. In den entsprechenden Viten jedenfalls sind Wettbewerbs-Erfolge neben Auftritten an renommierten Häusern und mit bekannten Musikern die zentrale »Währung«, aufgrund derer andere den künstlerischen Rang eines Musikers einschätzen. © Andres Putting Die Wissenschaft der Bewertung Mit 365 Punkten moderner Held werden: Måns Zelmerlöw beim ­Eurovision Song Contest 2015 in Wien, mit dem Song »Heroes« (Platz 1) Professionalisierung Traten in den musikalischen Wettbewerben der Antike und des Mittelalters nach heutigem Verständnis Liebhaber oder höchsten Halb-Profis gegeneinander an, verschiebt sich das Bild ab dem 19. Jahrhundert. Mit der Herausbildung eines eigenständigen, von professionellen Orchestern und formalisierten Ausbildungswegen getragenen Musikwesens werden Wettbewerbe plötzlich zu einem Dr. Melanie Wald-Fuhrmann ist Musikwissenschaftlerin und leitet die Abteilung ­Musik am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt / Main. Dass nicht immer und notwendig der oder die beste in einem Wett­bewerb auch siegt und welche nicht-musikalischen Kriterien unbewusst bei den Entscheidungen der Jury eine Rolle spielen, interessiert mehr und mehr auch die Wissenschaft. Mit statistischen Analysen und Experimenten weisen Forscher nach, dass Aspekte wie die Startnummer ihren Anteil an den Plazierungen haben. ­Furore machte vor einiger Zeit ein Experiment, bei dem man erfahrenen Jurymitgliedern die Wettbewerbsbeiträge verschiedener Personen entweder nur als Film (ohne Ton) oder nur als Ton vorspielte und zu bewerten bat. Dass sich daraus zwei unterschiedliche Rangfolgen ergaben, leuchtet noch ein. Ernüchternd aber war, dass die Reihung, die aufgrund der Filmaufnahme zustande kam, dem tatsächlichen Ergebnis des Wettbewerbs wesentlich näher kam als die eigentlichen musikalischen Bewertungen. Selbst professionelle Jurys hören also auch mit den Augen. In einem populären Musik-Wettbewerb wie dem Euro­vision Song Contest – insgesamt gesehen wohl der erfolgreichste Musik-Wettbewerb überhaupt –, in dem laut Statuten eigentlich das beste Lied ermittelt werden soll, haben die Produktionsteams, Choreographen, Kostümbildern, Sänger und Tänzer diese Erkenntnis schon lange in die Praxis umgesetzt. ❙ 4Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft Dr. Melanie-Wald-Fuhrmann © Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, Fotografin: Antje Pohsegger © Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig / Andreas F. Voegelin WETTSTREIT Empfehlungen REZENSIONEN CDs auch einmal wieder einen guten Booklet-Text leistet – Dieter Borchmeyer führt in ihm Ideen aus seinem Mozart-Buch weiter – ist ein weiterer positiver ­Aspekt dieses Mozart-Projekts. Dr. Melanie Wald-Fuhrmann Dorothea Röschmann: Mozart Arias. Daniel Harding, Swedish Symphony Orchestra. Sony Classical 88875061262, VÖ: Novem­ber 2015 Das Lachen, in das die Schlusskoloratur von Elettras Wahnsinns-Arie aus Idomeneo umschlägt, klingt angemessen irre und gerät doch nicht außer Kontrolle. Die schwarze Tiefe der Arie der Vitellia ruft Schauder hervor und beeindruckt zugleich durch Klangfülle. Das sind nur zwei der Höhepunkte des Mozart-Albums von Dorothea Röschmann. Die Sängerin legt hier gleichsam eine erste Summe ihrer Auseinandersetzung mit Mozarts Arien­ kosmos vor, die sie von den lyrischen längst zu den hochdramatischen Partien geführt hat. Ihre farbenreiche Stimme erlaubt ihr, für beinahe jedes Stück ein eigenes Timbre zu finden, und vereint Expressivität mit perfekter Technik. Das Swedish Symphony Orchestra, das ihr unter der Leitung von Daniel Harding auf dieser Live-Einspielung zur Seite steht, ist ein ebenbürtiger Partner: klanglich differenziert, dynamisch und prägnant arbeitet es die Feinheiten des Mozartschen Orchestersatzes heraus. Und dass sich eine Plattenfirma Anton Wranitzky: Violin Concerto op. 11, Paul Wranitzky: Cello Concerto op. 27, Sym­phony op. 16/3. Howard Griffiths, Münchener Kammerorchester. Sony Classical 88875127122, VÖ: Januar 2016 Der im selben Jahr wie Mozart geborene Paul und sein fünf Jahre jüngerer Bruder Anton Wranitzky gehörten zu den angesehensten Musikern im Wien der Mozart- und Haydn-Zeit. Mit Ämtern bei musikliebenden Fürsten sowie leitenden Positionen an den Opernorchestern standen sie im Zentrum der musikalischen Ereignisse in den 1780er und 90er Jahren. Ihr umfangreiches kompositorisches Oeuvre ist heute indes nur noch wenig bekannt. Dass sich eine Entdeckung aber lohnt, zeigen das Münchener Kammer­ orchester und Howard Griffiths mit drei Ersteinspielungen, in denen sie die Werke mit ebenso großem künstlerischen Anspruch wie Einsatz zum Leben erwecken. Als Solistinnen a­gieren mit Veriko ­ Tchumburidze und Chiara Enderle zwei junge ­ Musiker­innen, die von der Orpheum Stiftung zur Förderung junger Solisten unterstützt werden. Zu recht – überzeugen sie doch durch technische Sou­ veränität, reine Tongebung, differenzierten Ausdruck und schöne Klangfarben. Können die Konzerte durch abwechslungsreiche Satzcharak­ tere und farbige Details interessieren, so ist die Sinfonie geradezu fesselnd: Auf einen mitreißenden Kopfsatz folgen ein abgründig zwischen Mollund Dur­passagen abwechselndes Adagio und ein quirliges Finale. Im differenzierten und effektvollen Einsatz der Instrumente, besonders der Bläser, steht Wranitzky Mozart in nichts nach. Dr. Melanie Wald-Fuhrmann Mozart: Le Nozze Di Figaro, ­George London, Lisa Della Casa, Roberta Peters, Giorgio Tozzi, Fernando Corena, Rosalind Elias, Sandra Warfield, Gabor Carelli, Annie Felbermeyer, Ljubomir Pantscheff, Wiener Philharmoniker / Wiener Staatsopernchor, Ltg. Erich Leinsdorf (1958), URANIA RECORD WS 121.304 (3 CD) Wer bisher die alte Erich-­KleiberAufnahme als ideale Verwirk- lichung des Figaro betrachtete (die »historisch Informierten« einmal außen vorgelassen), wird bei Erich Leinsdorfs Einspielung von Le Nozze di Figaro eines Besseren belehrt. Die Wiener Philharmoniker spielen unter dem ehemaligen Bruno Walterund Toscanini-Assistenten nicht nur präzise und klangprächtig, sondern mit so viel Schwung, buffonesker Spiellaune und funkelnder Virtuosität wie selten. Eine unvergleichliche Aufnahme auch des Sängerensembles wegen. Lisa della Casa sieht als Gräfin nicht nur wie ein Engel aus, auch ihre sängerische ­ Beauté ist betörend. Die lupenreine Susanna von Roberta Peters ­ hat Despinaverschlagenheit. Der Che­ru­bino der Rosalind Elias agiert singend derart rasant, dass man bei seinem Fenstersprung im 2. Akt das Glas zerspringen hört. Giorgio Tozzis Figaro ist konkurrenzlos. Fernando Corena als Bartolo singt wie in einer »Lerchenauischen Komödie«. Der virile wie noble Graf George Londons ist ein vergleichsloses Stimmereignis. Der seit 1938 im angelsächsischen Exil lebende Wiener Dirigent, der 45 Jahre Meister der MET war und erst nach dem Zweiten Weltkrieg in seine Heimat zurückkehrte, hat mit dieser Aufnahme eine der scharfgeschliffensten, aber auch vollsaftigsten Interpretationen des dramma giocoso vorgelegt. Mehrfach ist es bei verschiedenen Labels erschienen, jetzt endlich klangrestauriert bei Urania Records: was für ein Gewinn für jeden Mozartisten! Dr. Dieter David Scholz Unsere Buchempfehlungen finden Sie auf Seite 16. Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft5 KARRIERE Klassik-Karrieren: Ohne Wettbewerb geht’s nicht von Sven Scherz-Schade © Erich Malter Anders, schöner, ­besser? Stars werden in den Köpfen ihrer Fans geboren. Hand aufs Herz: Haben wir nicht alle unsere Vorstellungen und Ideale – vielleicht auch Vorurteile, wie Vita und Karriere derer aussehen sollen, die wir als Solistinnen und Solisten bestaunen? Das Publikum ist neugierig und liest gern im Programmheft nach, um befriedigt festzustellen, dass man sich Lebensweg und Referenzen bei ihr oder ihm genauso vorgestellt hat: Studiert an nam­ haften Hochschulen, Meisterkurse und natürlich: Musikpreise, Best­platzierungen oder noch besser ›Nummer eins‹ … Wobei, wenn allzu viele Lorbeeren aufgetischt werden, kann die Erwartungshaltung im Publikum einen unangenehmen Beigeschmack bekommen. Denn Zuhörer, die allzu achtsam auf Höchstleitungen gespannt sind, vergessen mitunter, die Musik schlichtweg zu genießen. Juroren, die in Musikwettbewerben die Punkte zu vergeben haben, k ­ ennen dieses leidige Phänomen nur zu gut, wenn sie zum x-ten Male das von allen Teilnehmern gewissenhaft eingeübte Pflichtstück vorgetragen bekommen. So allgegenwärtig wie das Wettbewerbsprinzip im Musik- und Klassik­betrieb ist auch der widersprüchliche Irrsinn, der damit verbunden ist. Denn zu unseren Vorstellungen und Idealen gehört eben auch das Wissen, dass in den Künsten und in der Musik – anders als wie so oft im Sport – die Höchstleistung keineswegs das Maß aller Dinge ist. Die oder der Beste zu sein, lässt sich bei Arien und Kadenzen nie exakt messen. Und ab einem bestimmten musi­kalischen ­Niveau wird es geradezu absurd, die Leistungen zu vergleichen. Oder will sich jemand ernsthaft darüber den Kopf zerbrechen, ob nun Julia Fischer oder Hilary Hahn die Mozart-Violinkonzerte musikalisch-technisch »besser« gespielt hat? Dennoch weiß es jeder Liebhaber und Kenner zu schätzen, dass die künstlerischen Lebenswege der beiden genannten Geigerinnen von einem ECHO hier und einem Grammy dort gesäumt werden. Hut ab! Das Wettbewerbsprinzip gilt auch für die beiden Genannten, für ehemalige Wunderkinder sogar in besonderer Weise. »Jugend musiziert«: schon früh Bestleistungen zeigen »Der Wettstreit und der Wunsch, sich miteinander zu messen, gehört zum Menschen dazu wie essen und trinken«, sagt Reinhart von Gutzeit. Der Musikpädagoge war Rektor der Salzburger Universität Mozarteum, er ist Ehrenvorsitzender des Verbandes deutscher Musik­ schulen und Vorsitzender des Wettbewerbes »Jugend ­musiziert«, der 1963 vom Deutschen Musikrat initiiert wurde. Mit ihm bekommt der Nachwuchs das allgegenwärtige Wettbewerbsprinzip in die Wiege gelegt. Gern wird »Jugend musiziert« mit dem Pendant aus dem Sport »Jugend trainiert für Olympia« verglichen, das mit dem olympischen Gedanken »Dabei sein ist alles« wirbt. Durch Breiten­ wirkung die Besten zu suchen, gelte auch bei »Jugend musiziert«, meint Reinhart von Gutzeit. Der Wettbewerb findet auf drei Ebenen mit jeweils recht unterschiedlichen Anforderungen statt: »Auf der unteren Regionalebene wünschen wir uns schon, dass möglichst viele mitmachen, auch diejenigen, die nicht für einen Preis auf Bundesebene in Frage kommen.« Wichtiger als erste Plätze zu machen, sei es für die jungen Menschen zunächst einmal, dass sie sich ihre innere Zielvorstellung klar machen: Sie nehmen teil, um ihre persönliche Bestleistung zu erringen. Sie zeigen, was sie erarbeitet haben und bekommen die Chance, im Moment der Präsentation ein kleines Stück über ihr Können hinauszuwachsen. Die Frage, ob sie damit besser als andere sind, sollte erst an zweiter Stelle stehen. »Aber dass gerade junge Leute auch den Wunsch haben, gut abzuschneiden und gute Plätze zu machen, halte ich für völlig normal«, sagt Reinhart von Gutzeit. Zu wenige Wettbewerbe auf den »unteren Ebenen« Jede Klavierlehrerin, jeder Cellolehrer – selbst Musikfachkräfte der anthroposophischen Waldorfschulen, die in der Tradition Rudolf Steiners dem Leistungsprinzip eher skeptisch gegenüberstehen – sie alle wissen die Bedeutung des Vorspiels zu schätzen. Hier finden beim Kind oder Jugendlichen Entwicklungsschübe statt. Trotz Aufregung und Lampenfieber birgt es die Chance auf stolze Freude am musikalischen Vortrag. Und die behält der junge Mensch auch nicht für sich, sondern teilt sie im Moment des Erlebnisses mit anderen. So gesehen müsste es noch viel mehr Musikwettbewerbe auf jenen »unteren Ebenen« geben, wo breitenwirksam Vorspiel- und Wettstreitsituationen inszeniert werden. Während Fußballkinder, die im Verein kicken, jeden Samstag die Möglichkeit haben, sich mit ­Gleichaltrigen zu messen, gibt es für junge Musiker nur einmal im Jahr dazu Gelegenheit, eben wenn Vorspiel ist. Ein Blick in die 6Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft © Petja Gohr Wer es bis hierher geschafft hat, dem ist die Aufmerksamkeit der Jury gewiß: Vorspiel bei Jugend musiziert. Landschaft der Sponsoren und deren gestifteter Preise zeigt, dass das Musikland Deutschland – obwohl es insgesamt viele Preise zu gewinnen gibt – gerade an jenen »niederschwelligen« Wettbewerben durchaus noch mehr vertragen könnte. Sven Scherz-Schade © privat Die neue Dimension: Wettbewerb im Internet So wird der Musik- und Konzertbetrieb letzten Endes zur Metapher unseres gesellschaftlichen Lebens, das zu einem Großteil von Konkurrenz und dem Ringen um Aufmerksamkeit geprägt ist. Wird in der Klassik eher handwerkliches Können gemessen, im Jazz mehr Originalität, so zählen im Pop vor allem Reichweite und kommer­zielles Potential. Und während bis vor wenigen Jahren die Platten­firmen oder Rundfunk-Hitparaden noch ihre absolutistische Wächterposition innehatten, um den Besten der Besten den Ritterschlag zu erteilen, so haben Digitalisierung und Internet prinzipiell allen Musikern – auch jenen ohne Plattenvertrag – den Zugang zum Markt geebnet. Diesen neuen Verhältnissen ist der in Berlin geborene ­Pianist, Musikproduzent und Komponist Martin ­Herzberg in seiner Dissertation nachgegangen: Musiker im Wettstreit um Publikum bei YouTube, Facebook & Co. lautet der Untertitel seiner Schrift Musik und Aufmerksamkeit im Internet, die deutlich macht, dass für die künstlerische Bestätigung und für den musikalischen Erfolg die Zuhörerschaft jenseits des Konzertsaales von größter Bedeutung ist. Was er theoretisch erarbeitet hat, lebt ­Martin Herzberg heute auch praktisch als Musiker im Cross-Over-­Genre. Denn sein Umgang mit den neuen Online-Regularien schwankt zwischen Ausprobieren und Ausnutzen. »Ich habe einem meiner Videos auf YouTube den Titel ›Sehr bewegende Klaviermusik‹ ­gegeben«, schildert Herzberg und schwärmt: »Das hatte über eine Million Plays!« Weil dieser Titel als Wortlaut vieler Suchanfragen genutzt wird, kam ein extrem hohes Ranking zustande. Nach dem gleichen Muster wäre auch ein Stück wie »traurige ­Klaviermusik« denkbar, es wird dann auf iTunes, Spotify und anderen entsprechenden Musik-Por­ talen gefunden. Und das World Wide Web lauscht mit – Pianist Martin Herzberg spielt auf der Klaviatur des Internets ebenfalls virtuos. Der Musikwettstreit von heute beinhaltet insofern auch einen Wettkampf um die besten Suchbegriffe und Herzberg weiß, dass sich die Klassik-Szene damit schwer tut, wenn im Internet mehrere Dutzend Einspielungen von Vivaldis Vier Jahreszeiten um Aufmerksamkeit ringen. »Aber auch Klassik-Ensembles müssen etwas finden, was aus der Masse herausschaut, damit sie gefunden werden«, ist Herzberg überzeugt: »Die Klassik steht hier unter Druck, sich anzupassen.« Die dafür notwendige Selbstdarstellung sieht Herzberg als Teil der künstlerischen Persönlichkeit. Wer nahbar ist, authentisch rüberkommt und kleine Überraschungen liefern kann, sei am besten für diesen neuen Wettstreit gewappnet. Doch die Klassik fordert weitaus mehr ein. Hier zumindest sind heute die allermeisten Karrieren durch die Poliermühlen der Wettbewerbe geschliffen worden. Wer als Solist international unterwegs sein will, muss – so verlangen es Veranstalter – auch erfolgreich bei irgendeinem Big Player teilgenommen haben wie beim ARD-Musikwettbewerb oder dem alle vier Jahre stattfindenden Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau. »Musikpreise garantieren nicht nur Aufmerksamkeit. Sie sind auch ein Qualitätsausweis«, sagt Reinhart von Gutzeit. Der ABBA-Titel The winner takes it all ist übrigens falsch. Im Musikgeschäft kursieren in der Regel immer auch die Namen der Zweitund Drittplatzierten, bei »Jugend musiziert« werden bei gleich guter Leistung mitunter mehrere erste Plätze vergeben. Und dem kroatischen Pianisten Ivo Pogorelich hatte 1980 beim Internationalen Chopin-Wettbewerb Warschau ein Eklat zum großen Erfolgs­ durchbruch verholfen. Die Jury hatte ihn von der Endrunde ausgeschlossen und ihm den ersten Platz verweigert. Das empörte die Fans! Wie gesagt: Stars werden in deren Köpfen geboren. ❙ Sven Scherz-Schade (Karlsruhe) ist freier Journalist für Hörfunk und Print. Neben Berichten über ­ Konzertwesen und Musikwirtschaft bildet die Kultur­­politik einen Schwerpunkt seiner kultur­publizistischen Arbeit. Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft7 Oper kurz vor Mozart René Jacobs begeistert mit FLORIAN LEOPOLD GASSMANNs »L’Opera seria« in Brüssel · Premiere 9. Februar 2016 von Dr. Dieter David Scholz Er war einer der wichtigsten Vorläufer der Wiener Klassik. In seinen komischen Opern hat er Mozart geradezu vorgearbeitet. Der böhmische Komponist Florian Leopold Gassmann, der in Italien ausgebildet wurde und dort seine ersten Triumphe feierte, war ab 1763 Nachfolger Christoph Willibald Glucks als Ballettkomponist am Wiener Hof und ab 1772 sogar Hofkapellmeister. Als Nachrichten vom Dahinsiechen des auf einer Italienreise verunglückten Gassmann (der 1774 verstarb) Leopold Mozart zu Ohren gekommen waren, reiste er am 14. Juli 1773, verführt durch die Wolfgang vom kaiserlichen Hofe in Wien erwiesenen Huld­ bezeigungen, mit seinem Sohn nach Wien in der Hoffnung, diesen dort unterbringen zu können. Vergeblich. Doch gnadenlos, wie die Musikgeschichte ist: Mozarts Genie ließ Gassmann schnell verblassen. So geriet auch seine ehedem so populäre Commedia per musica L’Opera seria zu einer der besten Parodien auf die sterbende Gattung, der Mozart dessen ungeachtet noch einige glänzende Reverenzen erwies. Uraufgeführt wurde das Werk 1769 im Burgtheater in Wien. Es geriet für über 200 Jahre in Vergessenheit. Vor mehr als 20 Jahren hat René Jacobs dieses Opernjuwel ausgegraben und erstmals einem begeisterten Publikum vorgestellt. Es war eine Koproduktion der Berliner Staatsoper mit den Schwetzinger Festspielen, die auch im Théâtre des Champs-Elysees in Paris gezeigt wurde. Jetzt widmet er sich diesem Werk erneut und zwar im Cirque Royal, der Ausweichspielstätte des wegen Renovierung geschlossenen Théâtre de la Monnaie in Brüssel. es gnadenlos. Dann treffen ein dummer Tenor und drei kapriziöse Sängerinnen ein, streiten sich um alles und verlangen zusätzliche Arien. Im ersten Akt überschlagen sich Intrigen, Eitelkeiten, Amouren, Capricen und Rivalitäten. Im zweiten Akt folgt die Opernprobe. Im dritten Akt findet dann die Premiere der eigentlichen Opera seria satt: L’Oranzebe ist die krachende Parodie einer barocken Oper seria: In ihr geht es um einen siegreichen Feldherrn, der in Liebesentscheidungsnot zwischen seiner Gefangenen, der indischen Königin, und der Schwester seines Herrschers, der Prinzessin von Hindustan, steht. Der Feldherr ist der Tenor, der in einem von einem großen Krokodil gezogenen Kampfwagen seinen großen Auftritt hat und seinem Herrscher Oranzebe, Kaiser der Mogulen, die gefangene indische Königin präsentiert; dazu gibt es den »Auftritt« eines Elefanten. Die Opera seria endet schließlich in einem gewaltigen Fiasko samt Prügelei. Dann brennt auch noch der Theaterdirekor mit der Kasse durch. Die Katastrophe wird nur dank des beherzten Eingreifens der Mütter en travestie verhindert. Das Werk: eine Satire – das Ende: ein Fiasko Als René Jacobs zum ersten Mal dieses bis dato vergessene Opernjuwel reanimierte, hat der inzwischen verstorbene Jean-Louis Martinoty Regie geführt. Jetzt inszenierte Patrick Kinmonth, langjähriger Ausstatter Robert Carsens. Jean-Louis Martinoty hat seinerzeit eine Guckkastenbühne liebevoll ironisch vollgerümpelt mit verstaubten Requisiten, Prospekten und Dekorationen aus dem Opernfundus. Die Produktion hatte den unwiderstehlichen Charme von striesehaftem Schmierentheater und war eine lustvolle Klamotte. Patrick Kinmonths Inszenierung in der Zirkusarena dagegen ist elegantes, stilvolles Ausstattungstheater, ästhetisch ausgefeilt bis ins kleinste Detail. Er macht der turbulenten Komödie Kein Opernführer verrät etwas über dieses bedeutende Werk, das eine Satire auf die hohlen Themen und Texte der Seria, auf Starallüren und Sängertypen ist. Man will die Oper L’Oranzebe aufführen. Der Komponist hört auf den sinnigen Namen Sospiro und schreibt auch so: Seufzer. Der Dichter nennt sich Delirio (Gefasel) und liefert sich mit jenem ein Wortgefecht um die Frage, ob Musik oder Wort in einer Oper wichtiger seien. Der Impresario heißt bezeichnenderweise Fallito (Pleitemacher). Komponist und Librettist sind von ihrem Werk überzeugt, dem Impresario ist es aber zu lang. Er kürzt Kulinarisches Theater, ästhetisch ausgefeilt 8Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft Fotos Inszenierung © Baus / La Monnaie INSZENIERUNG Die Aufführung der Opera seria »L’Oranzebe« im dritten Akt Tenor im Kreise der Primadonnen (1. Akt) bei den Streitereien, Capricen, Intrigen und Besser­ wissereien unter den Künstlern. Im Vordergrund Dirigent René Jacobs. Vorderbühne mit den drei »Müttern« (1. Akt), dahinter die barocke Kulissenbühne mit der Bewegungstanzgruppe und dem Ensemble quasi im Stillstand, ­räsonierend während des Tanzsatzes. des Librettisten (und Gluckmitarbeiters) Calzabigi Beine, mit einer durchgestylten, immer wieder auch ritualisierten »Performance« auf zwei hintereinander liegenden Spielflächen, einer großen Bretterbühne und einer barocken Kulissenbühne, die unentwegt offene Verwandlungen zeigt, dazwischen das groß besetzte Orchester. Man wohnt kulinarischem Theater bei, es ist beeindruckend, verglichen mit Martinotys Inszenierung aber von steriler Perfektion. Hinreißend sind die historischen Kostüme von Patrick Kinmonth. Seine Personenführung ist quicklebendig, lässt den Sängern viel Raum für individuelle Entfaltung und überzeugt durch souveränes Handwerk. Die Tanztheater-Choreographien Fernando Melos’ wären, einmal abgesehen von den barocken Tänzen, nicht nötig gewesen. An szenischen Gags, barocken Gesten und temporeicher Situationskomik mangelt es nicht. Die inszenierten Publikums­ reaktionen im Zuschauerraum sind allerdings etwas heftig. Da hat die Regie dem Affen wohl zuviel Zucker gegeben. Aber unterm Strich, obwohl Krokodil und Elefant nicht auftreten dürfen, eine beeindruckende Inszenierung, die das selten gespielte, lange Werk unterhaltsam und prächtig beglaubigt, fern von allem obsessiven Regisseurstheater. Dieter David Scholz © privat Quicklebendig und phantasievoll musiziert Auch sängerisch beeindruckt die Produktion. Elf anspruchsvolle Partien sind mit handverlesenen Solisten mehr als nur rollendeckend besetzt worden. Eine Art Don Alfonso ist der fabelhafte Impresario von Marcos Fink. Die Sopranistinnen Robin Johannsen, Sunhae Im und Alex Penda überbieten sich an barockem Ziergesang und feuern zielsicher ihre Koloraturraketen ab. Star des Abends ist jedoch ein Ausnahmetenor, den man gehört haben muss: Mario Zeffiri legt als Ritornello mit seinem fulminant hohen, hellen und beweglichen Silbertenor (auch darstellerisch) eine hinreißende Karikatur von eitel-gespreiztem, dummem Opera seria-Tenor hin. Am wenigsten überzeugten die drei Counters Magnus Staveland, Stephen Wallace und Rupert Enticknap als Mütter en travestie. Auch die Regie weiß mit ihnen erstaunlich wenig anzufangen. Mit Wehmut denkt man an die frühere Besetzung (Curtis Rayam, Dominique Visse und Ralf Popken) zurück. Da standen René Jacobs andere Kaliber von falsettierenden Sängerdarstellern zur Verfügung, sie sind unvergessen. Als Jacobs das Werk ausgrub, spielte Concerto Köln. In Brüssel arbeitet er mit dem belgischen B’Rock Orchestra und Musikern des La Monnaie Symphony Orchestra zusammen. Ohne Frage ist ­Concerto Köln das brillantere, virtuosere Orchester. Aber René Jacobs weiß auch dem Brüsseler Ensemble ordentlich einzuheizen und den überschäumenden musikalischen Witz des Stücks zum Ausdruck zu bringen. Er entfaltet auch diesmal ein mehr als vierstündiges Feuer­ werk, indem er die sich überstürzende, einfallsreiche Musik von Gassmann quicklebendig und phantasievoll musizieren lässt, pointiert und rasant, nicht so scharf gemeißelt wie ehedem, weicher im Klang, aber mit enormer Spiellust, die offenbar auch die Musiker angesteckt hat. Das enthusiasmierte Publikum bedankte sich für diese Ausnahmeproduktion mit Ovationen. ❙ Dr. Dieter David Scholz (Berlin) ist Musikjournalist in ARD-Hörfunk und Printmedien, Buch- und Programmheft-Autor, Moderator und war viele Jahre Jury-Mitglied (Operngesangswettbewerbe und u. a. auch des Preises der Dt. Schallplattenkritik) und Mitglied des künstlerischen Beirates der Kunststiftung Sachen-Anhalt. Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft9 Pianistin Barbara Milou bei ihrem Auftritt im Composer Slam Wettbewerb ad absurdum geführt Der Composer Slam als Einstiegshilfe für die Klassikfans von morgen von Constantin Alexander Junge Menschen interessieren sich nicht mehr für Klassik oder Ernste Musik? Ein neues Konzept der Musikvermittlung beweist das Gegenteil: Bei Composer Slams bekommen Musiker fünf Minuten Zeit, eigene Stücke zu spielen. Das ­Publikum kürt den Sieger des Abends. Nicht jedem in der Szene gefällt dieser nicht ganz ernst gemeinte Wettbewerb. Das hannoversche Faust-Kulturzentrum ist bei Freunden klassischer Musik bislang ein weißer Fleck auf der Landkarte. Das ehemalige Fabrik-Gelände im angesagten Stadtteil Linden könnte mit seinen alten Backsteinmauern, den bunten Graffitis und den zahlreichen Konzertplakaten ruhig als das genaue Gegenteil eines stattlichen Konzerthauses oder einer Oper bezeichnet werden. Gemeinsam mit zahlreichen anderen, ähnlich alternativen Clubs ist die Faust jedoch zu einer Art Keimzelle geworden für das, was die Zukunft der Musikvermittlung sein könnte: Hier treffen sich regelmäßig junge Komponisten, Musiker und Musikbegeisterte, um in zwangloser Atmosphäre Composer Slams zu feiern. Der Composer Slam hat seine Ursprünge im Poetry Slam, einem modernen Dichter-Wettstreit, der in den 1980er-Jahren in den USA erfunden wurde. Poeten bekommen eine bestimmte Zeit, um eigene Prosa oder Lyrik vorzutragen. Das Publikum entscheidet, wer der oder die Beste des Abends ist. Inzwischen sind die Wettstreite ein fester Bestandteil der Literaturszene geworden. Zu den deutsch­ sprachigen Poetry Slam-Meisterschaften kommen jedes Jahr Tausende Zuschauer, Videos der Stars werden bei Youtube millionenfach angeklickt. Und im Wissenschaftsbereich hat sich bereits ein Pendant etabliert: der Science Slam. Publikum und Medien scheinen diese Formate der kompakten Show also zu lieben. Für den studierten Musiker Simon Kluth war der Besuch auf so einem Poetry Slam 2012 eine Art Erweckung. Nach seinem Violin-­Studium in Detmold, Paris und Hannover fragte sich Kluth, welche Alternativen es zu einer Karriere als Orchestermusiker gebe und wie man gleichzeitig die Szene ein wenig verjüngen könnte. Im Slam-Format fand er einen radikalen Ansatz: »Diese Energie hat mich einfach gepackt«, erzählt der Hannoveraner. Ihm gefiel besonders die Idee, dass Künstler mit eigenem Stück auftreten konnten und das Publikum dann entscheidet, wie der Abend verläuft. »Dieses Prinzip auf die ­Instrumentalmusik zu übertragen, schien mir geradezu natürlich.« Für Schüler ist es »Klassik zum Ausprobieren« 2013 gab es den ersten Composer Slam in Eichstätt, kurz darauf startete die Stammreihe in Hannover. Seitdem initiierte er Dutzende Slams in ganz Deutschland. Diesen April ist der Composer Slam bereits zum dritten Mal beim Heidelberger Frühling zu Gast. Im August 2014 gab es bereits eine Zusammenarbeit mit der Jungen Deutschen Philharmonie beim Festival FREISPIEL. Vergangenen Februar erweiterte Kluth die Idee und veranstaltete zum ersten Mal Composer Slams speziell für Schüler in Hannover, Oldenburg und Osnabrück. Dieses Musikförderprojekt wurde mit dem Förderpreis Musikvermittlung 2015 der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der Musikland Niedersachsen gGmbH ausgezeichnet. Zudem war es unter den Nominierten für den JUNGE OHREN PREIS 2015. Bei dem Schülerprojekt erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, mithilfe von Profis an eigenen Stücken und Ideen weiterzuarbeiten. Zum Abschluss treten die Teilnehmenden bei einem eigenen Schüler-­Slam auf. »Besonders Schüler und junge Erwachsene begeistern sich für die Slams«, erklärt Kluth. »Das Format ist offen und gibt keine Vorgaben, wie eine Komposition zu sein hat. Das kommt bei den jüngeren Musikern gut an.« 10Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft © Philip Loeper MUSIKVERMITTLUNG © Franziska Gili © Philip Loeper Constatin Alexander © Kevin Münkel Composer Slam-Initiator Simon Kluth mit dem Komponisten Pablo A. Rosado. Erst nach einem kurzen Interview zu Person und Werk werden die Stücke vorgestellt. Niemand wird ausgegrenzt Kompositionen in der Feuerprobe Diese Offenheit ist eine Stärke, die auch erfahrene Musiker aus den unterschiedlichsten Genres anspricht: Hier findet der studierte ­Instrumentalist zum ersten Mal eine Bühne, auf der er nicht nur reproduziert, was er in jahrelanger Übung perfektioniert hat. Hier finden auch etablierte Künstler einen Raum, in dem sie ihre Persönlichkeit in einer eigenen fünfminütigen Komposition zeigen können. Viele nutzen die Chance und präsentieren ihre Fähigkeiten an Instrumenten, die sonst nur wenig Platz finden, auf den Hochkultur­ bühnen und in den Orchestern. Wo kommt man schon in den Genuss, free-jazz-artige Stücke auf der Bassklarinette zu hören, gefolgt von experimentellen Elektronikstücken und dann wieder einer klassisch-­romantischen Komposition auf dem Klavier? Die Composer Slams werden für die Zuschauer so auch zu einer Einführung in das große Potenzial der Musik. »Es sind Einstiegshilfen für Menschen, die sich für diese Art von Musik interessieren, aber vielleicht nicht irgendwo starr zwei Stunden in einem Konzert sitzen möchten«, erklärt Kluth. Für fünf Minuten offenbarten sich so ganze Welten von Möglichkeiten. Der Wettbewerb rücke dabei aber in den Hintergrund, im Zentrum stehe die Musik. »Beim Composer Slam wird niemand ausgegrenzt. Egal, welche Musik er oder sie macht«, so Kluth. »Ich wollte von Anfang an keine Diskussion um Begrifflichkeiten führen, sondern Musikern einfach die Möglichkeit geben, sich und ihre Kunst zu präsentieren.« Mit seinem Ansatz macht sich Kluth nicht nur Freunde. »Manche Künstler finden das Konzept hinter dem Composer Slam anbiedernd.« Ihnen gefalle es nicht, sich einem Publikum auszusetzen, das ihre Kunst bewertet. »Dabei sind Wettbewerbe doch ein fester Teil der Szene. Nur dass bei uns keine Jury sitzt und entscheidet, wer welches Stück am fehlerfreisten nachspielen kann.« Gleichzeitig nehmen Composer Slams aus Kluths Sicht den ernsten Charakter von klassischen Wettbewerben aufs Korn: »Bei uns gibt es keine großen Preisgelder zu gewinnen.« Niemand sei traurig, wenn er nicht den ersten Platz mache. »Musik ist immer subjektiv, und manchmal bin ich selbst erstaunt, welche Komposition gewinnt. Das Publikum zeigt aber immer einen sehr guten Geschmack.« Dass fünf Minuten zu kurz für eine ernsthafte Komposition seien, glaubt Simon Kluth hingegen nicht: »Länge ist nur ein Parameter und sagt nichts über die Qualität einer Komposition aus.« Wie unvoreingenommen junge Menschen hingegen mit dem Format umgehen, merkt Kluth immer wieder auf den Slams: »Zu uns kommen vorwiegend junge Erwachsene und Jugendliche, die häufig selbst Musik machen und sich auch stark für Musik interessieren.« Die relaxte und oft alternative Atmosphäre der Clubs erinnert dabei häufig an frühe Jazz-Konzerte: Die Zuschauer trinken entspannt Bier oder Wein während der Vorstellung, rufen ihre Begeisterung über die Musik spontan heraus und diskutieren lebhaft über die gehörten Stücke. Auch die Musiker genießen den Rahmen, um sich und ihre Stücke mal in einer anderen Atmosphäre zu präsentieren. »In der Klassik sind die Leute ja immer sehr zivilisiert«, erzählt Sebastian Wendt, der mit seinen Stücken auf der Bassklarinette schon zahlreiche Composer Slams gewonnen hat. »Da das Publikum beim Slam aber so bunt ist, kommt da schon oft eine ganz andere Energie rüber.« Er sieht das auch nicht als richtigen Wettbewerb, sondern als ein interaktives Konzert, das Genre-Grenzen »fröhlich ignoriert und dem Publikum eine spielerische Interaktion mit dem Klanggeschehen ermöglicht«. Die Abende sind für ihn auch immer wieder ein geeigneter Anlass, um neue Stücke zu schreiben. »Besonders die Möglichkeiten der Musikvermittlung sind beim Composer Slam wunderbar«, erklärt Wendt. »Vielen eher verkopften Musikern würde es einmal gut tun, ihre Kompositionen der Feuerprobe zu unterziehen und den vermeintlich ungeübten Hörern zum Fraß vorwerfen.« Auch der Musiker Daniel Schunn hat auf Composer Slams nur gute Erfahrungen gemacht: »Als ich das erste Mal als Zuhörer einen Composer Slam erlebt habe, war ich fasziniert von der musikalischen Vielfalt«, erzählt er. »Von Panflöte, Mundharfe, Kalimba oder Santur bis hin zu gewohnten Soloinstrumenten oder auch einem live gespielten Computer habe ich mittlerweile viele verschiedene Sounds, Spielweisen und Stilistiken gehört«. Für ihn ist das direkte Feedback durch die Zuschauer ein klarer Pluspunkt: »Das ist besonders in jungen Jahren wertvoll.« ❙ Constantin Alexander hat Mandoline und Gitarre spielen gelernt und viel mit Synthesizern experimentiert. Er pendelt als Nachhaltigkeitsberater und Journalist für Kultur- und Wirtschaftsthemen zwischen Berlin und Hannover. Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft11 MOZART-ORT(E) © privat »Mozart steht für ­die ideale E ­ rziehung eines ­jungen Musikers« Wer in Salzburg, Augsburg oder Zhuhai zum ­Wettbewerb antritt, hat gute Chancen, Paul Roczek zu begegnen: Sein Name ist mit ­allen drei ­Wettbewerben untrennbar ­verbunden. von Julia Rumplmayr Bei den Mozartwettbewerben in Salzburg und Augsburg zeigen junge Musiker schon seit Jahrzehnten ihr Talent. 2015 hat die chinesische Stadt Zhuhai das Trio komplettiert. Paul Roczek kennt alle drei von Beginn an – der Geiger im Gespräch über Mozart, den Musikerberuf und den Reiz der Wettbewerbe. Vor wenigen Jahrzehnten war die chinesische Küstenstadt Zhuhai noch ein unbekanntes Fischerdorf. Mittlerweile ist sie ein beliebter Touristenort, ein chinesisches Monte Carlo – mit Palmenallee, Golfplätzen und einer Formel-1-Strecke. 2014 wurde die »Stadt der hundert Inseln« zur lebenswertesten und nachhaltigsten Stadt C ­ hinas ernannt. Zhuhai hat aber noch ein großes Ziel: Es will Kulturstadt werden, über die Grenzen hinaus bekannt – und knüpfte dafür Kontakte nach Europa. Das Pferd wurde vom Schwanz aufgezäumt, zuerst kam die Hülle, dann der Inhalt: Parallel zum Bau eines prächtigen Kulturbezirks wandte man sich an das Salzburger Mozarteum, das mit seiner Erfahrung bei der »Software« unterstützte. Den Start sollte ein internationaler Wettbewerb machen. Der Geiger Paul Roczek, kürzlich emeritierter Professor und langjähriger Vizerektor am Salzburger Mozarteum, war der ideale Partner dafür – schon seine gesamte berufliche Laufbahn über hatte er mit Wettbewerben zu tun: Als Präsident des Fachbeirates von Musik der Jugend kümmert er sich unter anderen um den Jugendwettbewerb Prima la Musica, er ist Jurymitglied zahlreicher Wettbewerbe und langjähriger Juryvorsitzender des Salzburger Mozartwettbewerbs und des Leopold-Mozart-Wettbewerbs in Augsburg. Nicht zuletzt verfolgte er mit seinen beiden hochbegabten Kindern Saskia und Leonhard Wettbewerbe auch aus der Vaterperspektive. »Ich habe den Namen Zhuhai vor zwei Jahren zum ersten Mal gehört. Das wird den meisten so gehen«, erzählt Paul Roczek. »Vor zwei Jahren war noch nichts gebaut. Es gab nur Pläne, aber die waren gewaltig.« Mittlerweile hat Zhuhai ein Opernhaus, ein Konzerthaus, Ausstellungshallen und neue Hotels. Es wurde an nichts gespart, ein Konzertsaal wurde gar dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins nachempfunden. Roczek riet Zhuhai zu einem Jugendwettbewerb, und zum Verwenden des Namens Mozart: »Wenn das Mozarteum für den Wett­ bewerb verantwortlich ist, sollte das eine musikalische Ausrichtung bekommen. Kein Wettbewerb, wer lauter, schneller oder sauberer spielt, sondern einer, der die guten Musiker sucht. Und das war auch ein Grund des großen Erfolgs.« Im September 2015 wurde die erste Zhuhai Mozart Competition für Geige und Klavier ausgetragen, allein für das Fach Violine gab es über 200 internationale Bewerbungen. »Wir hatten ein wirklich gutes Bewerberfeld«, attestiert Roczek dem jungen Wettbewerb. »Es war ein sehr guter Start, der auch international ausgestrahlt hat.« 2017 soll die nächste Ausgabe folgen, ein Zwei-Jahres-Rhythmus ist vorgesehen. Der intensive Kontakt mit dem Mozarteum wird weiter bestehen: »Wir sind bei den Inhalten gefragt«, sagt Paul Roczek. »Hier wird alles gebraucht, Orchester, Kammermusikensemble, Sänger, Bühnenbildner … Zhuhai ist ein großes Zukunftsprojekt.« Ideal: ein Wettbewerb mit Bürgerengagement Vorbild war der Mozartwettbewerb des Salzburger Mozarteums, der in diesem Februar zum zwölften Mal stattfand. Nach vielen Jahren, in denen in gleich vier bis fünf Sparten Preisträger gekürt wurden, wurde der Wettbewerb nun nach Disziplinen getrennt. Er findet alle zwei Jahre statt, 2016 mit Violine und Klavier, 2018 12Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft Salzburg © Christian Schneider | Augsburg © Christina Bleier | Zhuhai © Zhuhai International Mozart ­Competition for Young Musicians | Julia Rumplmayr © privat mit Streich­quartett und Gesang. Der diesjährige Jury­vorsitzende im Fach Violine, Benjamin Schmid, hat seine Karriere allerdings bei einem anderen Mozartwettbewerb begonnen: beim Internationalen Leopold-Mozart-Violinwett­ bewerb in Augsburg, dessen neunte Ausgabe am 3. Mai dieses Jahres beginnt. Als langjähriges Jury-Mitglied ist Paul Roczek sehr gerne dort: »Hier gibt es eine wunderbare Sache, die ich mir für Salzburg wünschen würde: ein Bürgerkomitee, das für Organisation und Finanzierung zuständig ist«. Dass Augsburger Bildungsbürger Kandidaten während des Wettbewerbs bei sich zuhause unterbringen, habe viele Vorteile: »Die Säle sind vom ersten Durchgang an voll, weil die Gastgeber ihre Schützlinge sehen wollen und ihnen die Daumen drücken. Sie sind auch nicht böse, wenn diese die ganze Nacht üben – sondern freuen sich darüber!« Roczek beschreibt Augsburg als einen sehr lebendigen Wett­bewerb mit internationalem Niveau. Außerdem habe er mit seinen ersten Preisträgern Isabelle Faust und Benjamin Schmid gleich fantastische Sieger gehabt. »Dank ihnen war der Wettbewerb sofort bekannt.« Glücklich im Kreise der Camerata Salzburg: Der russische Geiger Sergej Malov im Finale 2011 des Salzburger Mozart-Wettbewerbes. Nur gute Nachrichten gab es für Maia Cabeza (Mitte) beim LeopoldMozart-­Violin-Wettbewerb 2013 in Augsburg: Sie durfte den auch von ihren Kollegen heiß begehrten ­Mozart-Preis entgegen nehmen. Zum ersten Mal in China: ­Wert­volle Handschriften und Dokumente der Stiftung Mozarteum, in Zhuhai erklärt von Dr. Gabriele Ramsauer, der Direktorin der Mozart-Museen der Stiftung Mozarteum. Die Kür: Ein Mozart-Violinkonzert Allen drei Mozartwettbewerben ist jedenfalls eines gemeinsam: ihr Namensgeber. »Mozart steht für die ideale Erziehung eines jungen Musikers«, erklärt Paul Roczek. »Dafür, dass man schon als junger Mensch so fertig sein kann. Er vermittelt, dass es in diesem Wettbewerb um die Musik geht. Wer nur gut Geige oder Klavier spielen kann, hat keine Chance.« Das Repertoire der Wettbewerbe ist zwar breitgefächert, allen drei Wettbewerben gemein ist aber das große Mozartkonzert als letzter Durchgang. Der Name Mozart bringt den Wettbewerben auch eine besondere Anziehungskraft. Es gibt nur wenige, die es wirklich schaffen Begabte Musiker nehmen aus den unterschiedlichsten Beweggründen an Wettbewerben teil: Man misst sich mit jungen Kollegen, wird von anderen bewertet, hat die Hoffnung, als Talent entdeckt zu werden, oder kann einen ersten Platz in seine Vita eintragen. Eine Heraus­forderung, die viele reizt, sei auch das Hinarbeiten auf den Termin des Wettbewerbs, erklärt Paul Roczek. Es gilt, viele große Werke gleichzeitig zu können und dann zu wechselnden Bedingungen abzurufen. Der Wettbewerb ist für viele außerdem die erste »Öffnung hinaus in die Welt« mit ihrem Talent. Wettbewerbe sind aber nicht unbedingt zum Gewinnen da, erklärt Roczek: »Davor hat man schon das Meiste erreicht, der Rest hängt von Tagesform, Jury und Glück ab. Man lernt enorm viel bei einem Wettbewerb, weil plötzlich ein Druck da ist, den man ohne ihn nicht aufbauen könnte.« Seine Schüler auf der Bühne zu erleben, ist auch für den Lehrer Paul Roczek, der schon zahlreiche junge Musiker auf Wettbewerbe vorbereitet hat, interessant. »Man erlebt den eigenen Schüler oft sehr anders«, erzählt er: »Manche können auf der Bühne ihre Gefühle nicht so gut zeigen, speziell bei Japanern ist schon durch die Erziehung die letzte Öffnung am Podium oft nicht möglich. Andere, die sogenannten Rampen­ sauen, blühen erst so richtig auf, wenn tausend ­Leute zuschauen. Das sind dann die Performer, die aufs Podium gehören, die anderen sind fürs Orchester geeignet.« In der Natur der Wettbewerbe liegt ihre Ausrichtung auf das Solistische, wenngleich die Musikwelt natürlich nicht so viele Solisten braucht: »Aber es führt nun mal kein Weg daran vorbei, dass ich als Geiger das Brahms-Konzert perfekt spiele, welche Laufbahn darauf auch immer folgt. Man kann nun einmal keine Schmalspur-Ausbildung machen, die zur zweiten Geige einer Mozart-Oper führt«, sagt Paul Roczek. Er selbst erlebte Wettbewerbe aber auch aus der Vater-Perspektive: Sein Sohn Leonhard Roczek ist mehrfacher Preisträger von Cello-­ Wettbewerben, Tochter Saskia spielt wie ihr Vater Geige und gewann u. a. den ersten Preis beim internationalen Wettbewerb Giovani Talenti – Rovere d’Oro. Dass auch seine Kinder Musiker wurden, war nicht unbedingt der Wunsch des Vaters: »Ich habe immer gesagt, ich würde mich freuen, wenn sie die Musik nicht zu ihrem Beruf machen. Es gibt in der Musik nur wenige, die es wirklich schaffen und dann ein wunderbares Leben haben, die anderen haben wahnsinnig viel investiert und bekommen nur wenig zurück. Aber irgendwann kam der Tag, an dem sie sagten, ich will Musiker werden.« Paul Roczek ist seit Jahrzehnten Teil des Wettbewerbsgeschehens, als Juryvorsitzender, als Juror, als Lehrer, als Vater. In Augsburg ist er in diesem Jahr zum fünften Mal in der Jury, in Salzburg von den Anfängen in den 1980er-Jahren an, der Wettbewerb in Zhuhai trägt seine Handschrift. Wie interessant ist das Wettbewerbsgeschehen für ihn nach so vielen Jahren? »Es wird immer reizvoller. Es ist immer etwas Neues, jeder junge Mensch zeigt wieder einen neuen Zugang.« ❙ Julia Rumplmayr ist freie Kulturjournalistin in Oberösterreich, u. a. für die Wiener Zeitung und die Bühne. Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft13 INTERVIEW Der Pianist Ingolf Wunder Der österreichische Pianist Ingolf Wunder spielte zunächst Geige, als ein Lehrer die außer­ gewöhnliche pianistische Begabung des 14-Jährigen erkannte. Bald darauf gab er sein ­Debut im Schubertsaal des Wiener Konzerthauses. Er gewann den ersten Preis bei mehreren Wettbewerben und ist in ganz Europa, in Asien und Amerika aufgetreten, solistisch und mit ­renommierten Orchestern. Was halten Sie denn von Wettbewerben, Herr ­Wunder? Der Wettbewerb an sich ist etwas Menschliches, es liegt in unserer Natur, dass wir Vergleiche ziehen wollen. Zu Mozarts Zeit war es eine andere Art von Wettbewerb, wenn sie improvisiert haben über Themen, wenn sie sich gegenseitig begleitet haben. Für mich waren die Jugend-Wettbewerbe, von denen ich sehr viele gemacht habe, sehr nützlich. Das waren wunderbare Gelegenheiten, mein Repertoire vor Publikum auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Denn als Student ist es nicht selbstverständlich, dass man Konzerte vor Publikum bekommt. Einigen Wirbel gab es im Jahr 2010 um den Chopin-Wettbewerb in Warschau. Sie bekamen den 2. Preis sowie einige Sonderpreise, danach gab es eine hitzige Debatte, dass Sie doch den ersten Preis verdient hätten. Hat das Ihre Sicht auf Wettbewerbe nicht verändert? Das ist ein von mir nicht favorisiertes Thema, denn Kunst und Musik können für mich nicht in Nummern bewertet werden. Das ist ein System, das nicht funktioniert. Aber der Chopin-Wettbewerb 2010 ist eine sehr positive Erinnerung für mich. Nur: um diese großen Wettbewerbe herum hat sich ein gewisses Geschäft entwickelt, an dem hab ich immer meine Zweifel geäußert habe. Aber dass diese Wettbewerbe positive Seiten haben, ist unumstritten. Ist es für einen jungen Pianisten vermeidbar, an Wettbewerben teilzunehmen, wenn er weiter­ kommen will? Natürlich, es geht immer anders. Aber große Wettbewerbe wie der Chopin-Wettbewerb sind im Zentrum der Medien. Wenn man dort spielt, egal ob man gewinnt oder nicht, kann man davon ausgehen, dass einen Leute hören. Und wenn man dann gut spielt oder fundamental gut spielt, ist es eigentlich egal, ob man gewinnt oder nicht. Das ist die positive Seite. Wie objektiv oder subjektiv kann denn die Jury sein? Wie soll man Musik in Nummern bewerten? Und die ganzen Eindrücke und Emotionen, die man in der Musik hat, wie kann man die in hundert Punkte konvertieren? Da fängt das Problem an. Wenn man ­Mozarts Wettstreite betrachtet, etwa den mit ­Muzio Clementi: Da hat der Kaiser beiden ein ­ Thema zum Improvisieren gegeben, jeweils einer hat den anderen dabei am zweiten Klavier begleitet, oder sie präludierten. Da muss sehr viel Inspiration, sehr viel Kreativität drin gesteckt haben. Und da sollten wir irgendwann wieder hin, dass die Kunst weniger maschinell wird – wieder kreativer, individueller. Damit man zu einem tieferen Verständnis der Musik kommt? Ich arbeite jeden Tag an mir, um diesem Verständnis ein bisschen näher zu kommen. Wahrscheinlich werde ich, wenn ich neunzig bin, wenn ich soweit komme, oder mit achtzig oder siebzig mein Leben beenden und immer noch nicht wissen, was der Sinn wirklich ist. Aber das ist das Schöne am Leben: Man lernt ständig und ist auf der Suche danach, was wirklich der Sinn ist. Beim täglichen Wettbewerb der Künstler ist es wie auf jedem Gebiet: Wenn das Angebot groß ist, ist die Konkurrenz groß. Aber wir sind in der Kunst und Musik in der glücklichen Position, dass es um etwas Höheres geht. Nicht um den Verkauf von Gütern, sondern um Kunst und das, was im Endeffekt uns Menschen ausmacht. Als Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg gefragt wurde, ob man das Kunstbudget ins Militär geben soll, hat er gesagt: »Aber wozu kämpfen wir dann noch?« Das heißt, alles was von uns bleibt, ist Kunst. Wir kennen unsere Vergangenheit aufgrund der Kunstwerke, die Genies erschaffen haben. Das weiterzugeben, ist eine schöne Aufgabe, und ich bin extrem froh, dass ich meine volle Arbeitskraft darein stecken darf. Das ist die Hauptmotivation, wie auch immer der Markt ausschaut. Wie können wir da wieder zu einem Um­denken kommen? Wettbewerbe sind so wichtig geworden für junge Leute, dass oft die falschen Motive im Vordergrund stehen, auch von Kandidatenseite. Man muss sich immer vor Augen halten, dass es nicht um den Wettbewerb an sich geht, sondern um die Musik. Ich weiß, dass das oft schwierig ist. Aber das ist die Grundnachricht, die man weitergeben sollte. Es muss um die Musik gehen, von Jurorseite, von Kandidatenseite. ❙ Das Interview führte Julika Jahnke. 14Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft © A. Svirskas Es muss um die Musik gehen INTERVIEW © Maurice Korbel Warum sollte ich einen ­Wettbewerb besuchen? Die Dirigentin Julia Jones Nach den Anfängen ihrer Karriere in Deutschland war Julia Jones vier Jahre lang Chefdirigentin für Oper am Theater Basel, 2008—2011 Chefdirigentin des Orquéstra Sinfonica Portuguesa und des Teatro Nacional São Carlos Lissabon. Seit 2011 ist sie freischaffend tätig und dirigiert häufig an den Wiener Opernhäusern sowie in den Opernhäusern in Frankfurt, Dresden und London (Royal Opera House). Als gefragte Mozartkennerin dirigierte sie bei den Salzburger Festspielen 2004 u. a. die Entführung aus dem Serail. Warum haben Sie nie an einem Wettbewerb teilgenommen? Ich habe mit dreiundzwanzig Jahren angefangen zu arbeiten. Warum sollte ich einen Wettbewerb besuchen? Es ist viel besser, Arbeitserfahrungen direkt am Platz zu sammeln. Ich war erst Korrepetitorin, habe so schon viel über den Beruf gelernt und mich später für eine Kapellmeisterstelle beworben. Haben Wettbewerbe für Sie einen zu hohen Stellenwert? Jeder hat eine andere Vorstellung davon, wie er seine Karriere gestalten will oder sein Lebensziel. Manche wollen das mit einem Wettbewerb erreichen. Und es gibt andere, so wie mich, die gleich in den Beruf eingestiegen sind. Für mich war es wichtiger, gleich am Kölner Opernhaus zu beginnen, wo ich von den besten Dirigenten und Sängern gelernt habe. Ein Dirigent lernt nur, wenn er vor einem Orchester steht. Gab es in der Zeit Ihrer musikalischen Ausbildung Konkurrenz unter den Studierenden? Als ich zwölf Jahre alt war, habe ich begonnen, Klavier an der Chetham’s School of Music zu studieren, das ist die Internatsschule für begabte junge Musiker schlechthin in Großbritannien. Und man ist dort natürlich der Konkurrenz ausgesetzt. Für mich war nach einem Jahr klar, dass ich mich nicht mit den anderen Studierenden messen kann, die schon mit vierzehn ein Tschaikowsky-Klavier­konzert spielen. Und ich habe erkannt, dass ich gar nicht Konzertpianistin werden, sondern Musik zusammen mit anderen machen möchte. Ich habe mich damals geweigert, einmal im Monat ein Solo-­ Konzert zu geben, weil ich Kammer­musik spielen und die Sänger bei Lieder­abenden begleiten wollte. Und habe das durchgesetzt, weil ich gemerkt habe, dass meine Fähigkeiten in diese Richtung gehen. Wie kam es, dass Sie sich dann so eindeutig auf die Oper festgelegt haben? Weil ich im Internat auf eigenen Wunsch angefangen habe, Sänger zu begleiten. Ich habe schon mit fünfzehn die großen Liederzyklen im Konzert gespielt, z. B. die Winterreise. Ich habe eine enge Beziehung zum Gesang gehabt und auch im Chor gesungen. Ich mag die menschliche Stimme sehr und arbeite auch sehr gern mit Sängern. Da kommt man automatisch zur Oper. Sie sind eine ausgewiesene Mozartkennerin. Haben Sie Mozart auch schon im Studium für sich entdeckt? Das begann schon viel früher, auch als Kind, und dann später, als ich an der Musikhochschule viele Werke von ihm gespielt habe. Aber ich kann nicht in Worten ausdrücken, warum das so ist. Wenn ich einen Komponisten aussuchen müsste, mit dem ich lebe und sterbe, dann ist das Mozart. Aber ob ich eine Spezialistin bin, da bin ich vorsichtig. Ich g­ estalte Mozart auf meine Art und Weise, ob das »richtig« ist, kann ich nicht sagen. Es gibt tausende Möglichkeiten, ein und dieselbe Phrase zu interpretieren. Überzeugend muss es sein und die Menschen, die zuhören, erreichen. Und deswegen ist es wichtig, seine eigenen Fähigkeiten zu erkennen. Wie in jedem Beruf gibt es in der Musikwelt Neid, Konkurrenzkampf, sogar Mobbing. Als Dirigentin stehe ich alleine auf dem Podium – Gott sei dank –; als Dirigent muss man eine gesunde Portion Egoismus haben. Zu zweit würde es gar nicht gehen! Als Musiker im Orchester zu sitzen, ist viel schwieriger. Man muss sich in der Gruppe anpassen, und das oft über Jahrzehnte lang. Positive Konkurrenz ist gut, sogar überlebungswichtig, aber negative Konkurrenz ist etwas ganz Schlimmes; und solche Verstimmungen beeinflussen leider den gesamten Apparat und schließlich das musikalische Ergebnis. Auch Konkurrenz unter Sänger ist hart, aber mit der Einstellung »Eigentlich müsste ich morgen an der MET singen, aber ich sitze hier im kleinen Opernhaus« kommt man nicht weit. Setzen sich die Guten denn immer durch? Am Schluss kommt immer die Wahrheit heraus. Es gibt schon einen großen Konkurrenzkampf der Veranstalter und Agenturen, die junge Nachwuchstalente groß herausbringen. Das hilft manchen jungen Musikern anfänglich sicher. Aber ohne das notwendige technische und musikalische Talent geht es auf Dauer nicht. Die besten Sänger und Solisten, mit denen ich gearbeitet habe, waren immer bescheidene, hart arbeitende und hoch professionelle Menschen, die es nicht nötig hatten, sich zu beweisen. ❙ Das Interview führte Julika Jahnke. Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft15 Empfehlungen REZENSIONEN Bücher W. A. Mozart im Spiegel des Musikjournalismus. Deutschsprachiger Raum, 1782–1800. Edition. Vorgelegt und kommentiert von Rainer J. Schwob. Salzburg und Stuttgart 2015: Carus-Verlag (Beiträge zur Mozart-Dokumentation, Bd. 1), 822 Seiten. Warum ist Mozart so schwer verständlich? Diese Frage stellten sich seine Zeitgenossen. Eines der Klavierkonzerte etwa nahm der Berliner Musik­kritiker Carl Spazier im Oktober 1791 zum Anlass, um Mozart die »bizarreste Seelenschwelgerei« und »seltsamsten Paradoxien« anzukreiden. Derlei scheinbar absurde Aussagen sollten nicht einfach abgetan werden: Damals hörte man Mozarts Musik vor dem Hintergrund seiner (beträchtlich erfolgreicheren) Zeitgenossen wie Cimarosa, Dittersdorf, Haydn oder Paisiello, und verstand ihre komplexe Tiefe noch im Missverständnis vielleicht besser als wir. Alle Urteile, Anekdoten, ja selbst flüchtige Erwähnungen Mozarts, die bis 1800 auf­zu­finden waren, hat Rainer Schwob mit vorbildlicher Sorgfalt ediert und kommentiert. Man kann auf der Website http://dme.­mozarteum.at/mozart­rezeption ergänzend ­sämtliche Texte nach verschiedenen Stich­ wörtern (z. B. Spazier oder Klavierkonzert) durchsuchen (wo­ bei altertümliche Schreibweisen gleich mitberücksichtigt werden). Zum Lesen, Schmökern und Ent­decken empfiehlt sich hingegen der schön aus­gestattete, gewichtige Band. Weitere zur Mozart-­ Rezeption im 19. Jahrhundert sind in Vorbereitung. Wolfgang Fuhrmann Eva Gesine Baur: Mozart-ABC. Illustriert von Chris Campe. München 2016, 148 S. Man kann aus der Not, dass einfach schon viel zu viel über Mozart geschrieben wurde, auch versuchen eine Tugend zu machen. Eva Gesine Baur, die in den letzten Jahren schon mit der Pioniertat einer Schikaneder-­Biographie und einer eigenwilligen Mozart-­ Deutung in Erscheinung getreten ist, versucht genau dies in ihrem handlich-kleinen, au- genzwinkernden Mozart-ABC. In alphabetischer Reihenfolge sind hier einige näher und ferner liegende Stichworte aus dem Mozart-Kosmos erläutert. Der durchgehende Plauderton vermag aber durchaus auch manche interessante Aufklärung zu bieten oder sonst nur mühsam eruierbare Informationen auf den Punkt zu bringen: Gleich der erste Eintrag »Amadeus« zeichnet nach, wie aus Gottlieb (Taufeintrag) und Amadé (Selbstnennung) der ätherische Amadeus wurde. Ansonsten dreht sich viel um Details des Alltags (Essen und Trinken kommen nicht zu kurz) und interessante kleine kultur­ geschichtliche Eindrücke. Brauchen tut man so ein Buch sicher nicht; aber wenn man es mal in der Hand hat, ist das Blättern und Schmökern durchaus vergnüglich. Dr. Melanie Wald-Fuhrmann Christian Gerhaher: »Halb Worte sind’s, halb Melodie«. Gespräche mit Vera Baur. Leipzig/Kassel 2015, 174 S. »Bilde, Künstler! Rede nicht!« Es gibt viele Künstler, denen man dieses Goethe-Wort auch heute noch ins Stammbuch schreiben möchte. Für den Bariton Christian Gerhaher gilt das indes nicht: Die besondere Evidenz, Eindringlichkeit und Nachdenklichkeit seiner von Publikum und Kritik gleicher­ maßen gefeierten Lied- und Opern-­Interpretationen weisen ganz offenkundig auf einen hoch reflektierten Künstler. Dass er diese Reflexion nicht nur in Gesang, sondern auch in Worte übersetzen kann, zeigt dieser als Gemeinschaftsproduktion der Verlage Seemann Henschel und Bärenreiter erschienene Gesprächsband. Zwar kennt man Gerhaher als bekennenden Schumannianer und Liedsänger, doch seit er sich vermehrt der Oper zuwendet, nimmt auch Mozart einen wichtigen Platz in seinem Wirken ein: Das erste der beiden der Oper gewidmeten Kapitel ist denn auch fast ausschließlich eine Reflexion auf Gerhahers Erfahrung als Don Giovanni in der Frankfurter Produktion von 2014. Er ist dabei tief in die Rolle eingedrungen und hat sich ein durchaus eigenständiges Bild von ihr gemacht. Aber auch in jeder anderen Hinsicht ist dies ein Buch, dessen Lektüre anregt und bereichert. Dr. Melanie Wald-Fuhrmann Impressum Deutsche Mozart-Gesellschaft e. V. Mozarthaus · Frauentorstraße 30 · 86152 Augsburg Telefon: +49 (0)821 / 51 85 88 E-Mail: [email protected] Präsident: Thomas Weitzel Schriftleitung: Melanie Wald-Fuhrmann Redaktion und Geschäftstelle: Julika Jahnke Layout: Esther Kühne 16Die Seiten der Deutschen Mozart-Gesellschaft