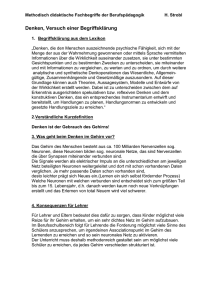Professor Herbert Beck Neurodidaktik oder: Wie lernen wir?
Werbung

1 Professor Herbert Beck Neurodidaktik oder: Wie lernen wir? (Veröffentlicht in „Erziehungswissenschaft und Beruf“, Heft 3/2003) Das deutsche Bildungssystem steckt in der Krise, seit PISA ist es eine Binsenweisheit. Hilfe in der Not kommt von allen Seiten und nicht zuletzt versprechen neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaften Unterstützung. Doch auch vor der Wirtschaft macht die Hirnforschung nicht Halt: Wirtschaftliche Entscheidungen sind nur zu einem Teil rationaler Natur. Neurologen erklären deshalb nicht mehr nur, welche Emotionen bei wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen wie eine Rolle spielen, sondern sie analysieren sogar, welche Teile des Gehirns bei welchen Entscheidungen und Gefühlen beteiligt sind. Der letztjährige Nobelpreis für Ökonomie ging nicht von ungefähr an einen Psychologieprofessor. Jeder Lernvorgang verändert das Gehirn nachweislich und deshalb nehmen Hirnforscher auch das Lernen unter die Lupe und liefern neue und – so ihr Anspruch teilweise revolutionäre Ergebnisse, die über das Lernen von kleinen Kindern Aufschluss geben, das Lernen in der Schule allgemein erhellen und die Voraussetzungen und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens thematisieren. Grundlegende Lernmechanismen werden aufgedeckt, um biologisch fundierte Thesen zum optimalen Lernen generieren zu können. Diese Verbindung von Neurobiologie und Schule ist seit einigen Jahren als „Neurodidaktik“ im Gespräch.1 Hirnforscher helfen inzwischen den Pädagogen bei der Entwicklung neuer Lernstrategien, ja sie fordern sogar ultimativ mehr Einfluss auf die Pädagogik2 und wollen ihre Erkenntnisse nun in Lehr-/Lernkonzepte umsetzen.3 Und gerade weil jeder Lernvorgang mit einer Veränderung des Gehirns einher geht, kann besser lehren, wer versteht, wann es warum zu dieser Änderung kommt. Die erkenntnisleitende Fragestellung für diesen Beitrag lautet daher: Welche Konsequenzen zeichnen sich für die Schule allgemein und insbesondere für berufliche Schulen aufgrund neurobiologischer Forschungsergebnisse ab? Dabei würde es den Rahmen dieses Beitrags sprengen, die Begründungen und das Hintergrundwissen zu liefern. Diese finden sich in der Bezugsliteratur der Fußnoten. Die Basis Das Gehirn des Menschen wiegt etwa 1,4 Kilogramm, macht etwa 2 Prozent des Körpergewichts aus und verbraucht trotzdem mehr als 20 Prozent der Energie des gesamten Körpers. Es besteht im Wesentlichen aus Nervenzellen (Neuronen) sowie aus Faserverbindungen zwischen den Neuronen. Diese Gliazellen bilden ein Stütz- und 1 Der Begriff „Neurodidaktik“ wurde 1988 durch den Freiburger Wissenschaftler Gerhard Preiß geprägt. Vgl. Focus, Heft 43/2002, S. 84 3 Vgl. GEO WISSEN, Nr. 31/2003, S. 34 2 2 Versorgungsgewebe für die Neuronen, nehmen aber auch an der neuronalen Erregungsverarbeitung teil. Die Gestalt der Neurone ist außerordentlich verschieden, es gibt im menschlichen Gehirn etwa hundert verschiedene Typen von Neuronen. 4 Abb. 1: Neuron5 Jedes Neuron besitzt weite, baumartige Verzweigungen (Dendriten), und einen langen Fortsatz, das Axon. Sowohl an den Dendriten als auch am Zellkörper des Neurons enden die Axone anderer Neuronen mit verknüpfenden Endknöpfchen (Synapsen). Die einzelnen Nervenzellen sind durch Synapsen vielfältig miteinander verbunden. Der Hauptfortsatz einer Nervenzelle kann im Extremfall bis zu einem Meter lang werden. Die Übertragung eines Nervenimpulses von einem Neuron zum anderen geschieht an einer Synapse und je nach Stärke der Übertragung kann der gleiche Input das eine Neuron anregen, das andere jedoch nicht. Die etwa 20 Milliarden Neuronen des Großhirns sind mit jeweils bis zu 10 000 anderen Neuronen verbunden und bilden ein unüberschaubares Netzwerk, das alles Denken, Lernen, Fühlen und Handeln hervorbringt. Das Dogma der heutigen Neurobiologie lautet deshalb, dass alle Leistungen des Gehirns aus den Integrationsleistungen einzelner Nervenzellen resultieren.6 Das Gehirn ist damit das anpassungsfähigste Organ des Menschen und zugleich das komplexeste Gebilde des Universums. Wie gelangt aber nun Wissen der Welt in unser Gehirn, wie wird es dort verankert, und wie wird es bei der Wahrnehmung der Welt genutzt, um diese zu ordnen? Diese Fragen haben zahllose Menschen über viele Jahrhunderte hinweg fasziniert und ihren Forscherdrang herausgefordert.7 Hippokrates meinte z.B., dass das Gehirn der 4 Vgl. Roth, Gerhard: Neurobiologische Grundlagen des Bewusstseins. In: Neurowissenschaften und Philosophie, hrsg. von Michael Pauen und Gerhard Roth, München 2001, S. 164 f. 5 Quelle: Spitzer, Manfred (2000): Geist im Netz – Modelle für Lernen, Denken und Handeln, Heidelberg und Berlin 2000, S. 19 6 Vgl. Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit – Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen, Frankfurt am Main 1997, S. 46 f. 7 Vgl. Düweke, Peter: Kleine Geschichte der Hirnforschung – Von Descartes bis Eccles, München 2001 3 Sitz der Seele wäre. Nun endlich verfügen wir über genügend Sachkenntnis, um solche Fragen zu beantworten.8 Wer wissen wollte, wo das Gehirn welche Funktion ausführt, der musste früher den Kopf öffnen. Dies ist heute dank der Entwicklung bahnbrechender Methoden der Neurowissenschaft nicht mehr nötig: Man kann heute mit bildgebenden Verfahren dem Gehirn bei der Arbeit (also beim Denken) zuschauen,9 ohne den Kopf öffnen zu müssen (funktionelles Neuroimaging).10 Die Ergebnisse – wieder wird ein Paradigmenwechsel propagiert11 -sind auch für Pädagogen höchst befriedigend: Denn das Gehirn ist für das Lernen optimiert und „kann nichts besser und tut nichts lieber“12 als ständig zu lernen – vorausgesetzt man geht „richtig“ mit ihm um und liefert ihm die „richtigen“ Sachverhalte.13 Neurobiologische Aspekte des Lernens: Hirngerechtes Lehren und Lernen Auf den Anfang kommt es an Wie und wofür ein Kind sein Gehirn nutzt ist entscheidend dafür, welche Verschaltungen zwischen den Milliarden Nervenzellen besonders gut gebahnt und stabilisiert und welche nur unzureichend entwickelt und ausgeformt werden. Um diese Verschaltungen ausbilden zu können, müssen Kinder möglichst viele und möglichst unterschiedliche eigene Erfahrungen machen. Damit es ihnen gelingt, sich im Wirrwarr von Anforderungen, Angeboten und Erwartungen zurechtzufinden, brauchen sie Orientierungshilfen, also äußere Vorbilder und innere Leitbilder, die ihnen Halt bieten und an denen sie ihre Entscheidungen ausrichten. Bildung kann beispielsweise nicht gelingen, wenn Kinder in einer Welt aufwachsen, in der die Aneignung von Wissen und Bildung keinen Wert besitzt (Spaßgesellschaft), sie keine Gelegenheit bekommen, sich aktiv an der Gestaltung der Welt zu beteiligen (passiver Medienkonsum) oder mit Reizen überflutet, verunsichert und verängstigt werden (Überforderung).14 Tägliche schulische Erfahrungen in dafür „anfälligen“ Schulklassen zeigen, dass sich diese Befunde leider bereits in einem Gebäude von lernunlustigen, lernunwilligen, lernschwachen und desinteressierten Schülern niederschlagen. Die Hirnforscher haben darüber hinaus nachgewiesen, dass sichere emotionale Bindungsbeziehungen eine wesentliche Voraussetzung für eine optimale Hirnentwicklung sind. Störungen dieser emotionalen Beziehungen stellen eine kaum bewältigbare Belastung dar und haben destabilisierende Einflüsse auf bereits 8 Vgl. Greenfield, Susan, A.: Reiseführer Gehirn, Heidelberg und Berlin 2003, S. 16 ff. Vgl. Rüegg, Johann Caspar: Psychosomatik, Psychotherapie und Gehirn – Neuronale Plastizität als Grundlage einer biopsychosozialen Medizin, Stuttgart 2003, S. 11 f. 10 Vgl. Spitzer, Manfred (2002): Lernen – Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Heidelberg und Berlin 2002, S. 37 und Singer, Wolf: Der Beobachter im Gehirn – Essays zur Hirnforschung, Frankfurt am Main 2002, S. 37 f. 11 Vgl. Singer, Wolf: Das Bild im Kopf – ein Paradigmenwechsel. In: Gene, Neurone, Qubits & Co., hrsg. von Detlev Ganten u.a., Stuttgart und Leipzig 1999, S. 267 ff. 12 Spitzer, Manfred (2002): A.a.O., S. 14 13 Vgl. ebenda und Spitzer, Manfred (2003,1): Neue Erkenntnisse der Gehirnforschung für das Lernen, Vortragsveranstaltung des Staatlichen Seminars für Schulpädagogik (BS) Stuttgart gemeinsam mit der IHK Stuttgart am 17. März 2003 in Stuttgart. 14 Vgl. Hüther, Gerald: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. In: Stuttgarter Zeitung vom 11. Jan. 2003, S. 43 9 4 entstandene neuronale Verschaltungen.15 Das Beste, was man für ein Kind tun kann ist, sorgfältig darauf zu achten, welche Fragen es stellt, und sie dann möglichst erschöpfend und eindeutig zu beantworten.16 Jeder Mensch kann lebenslang lernen Das Gehirn hat die Fähigkeit, sich beständig den Erfordernissen seines Gebrauchs anzupassen (Neuroplastizität), wenn auch mit zunehmendem Alter langsamer.17 Entgegen früherer Auffassung: Unsere neuronalen Netze sind plastisch, d.h. sie lassen sich bis ins hohe Alter verändern und entwickeln. Jeder Mensch kann daher lebenslang lernen.18 Die Großhirnrinde (Kortex) erweist sich dabei als einzigartig anpassungsfähige und sich zugleich beständig selbst optimierende Struktur. Bei Kindern ist die Lerngeschwindigkeit zwar hoch, dafür verfügen ältere Menschen jedoch über die Möglichkeiten des Lernens durch Analogiebildung, welche bei Kindern so nicht vorhanden ist. Insofern gibt es in der Entwicklung jedes Menschen sensible „Zeitfenster“, die für eine Weile offen stehen und in denen nach funktionellen Kriterien entschieden wird, welche Gehirnverbindungen übrig bleiben und welche wieder „eingeschmolzen“, d.h. für immer geschlossen werden.19 Im Laufe der Entwicklung öffnen sich neuronale Fenster quasi explosionsartig und in noch viel stärkerem Maß als bisher angenommen wird die Entwicklung des menschlichen Gehirns durch nutzungsbedingte Bahnungs- und Strukturierungsprozesse bestimmt. Wenn bestimmte Funktionen nicht rechtzeitig eingeprägt werden, lassen sie sich kaum mehr nachholen oder nur sehr unvollkommen ausbilden.20 Das Gehirn bildet sich seine Regeln selbst Der Schüler lernt das Allgemeine nicht abstrakt sondern dadurch, dass er Beispiele verarbeitet und aus diesen Beispielen Regeln selbst produziert (Beispiel-RegelSequenz). Aus konkreten Beispielen werden die tragenden Muster durch die Schüler selbst entwickelt und es entstehen so neuronale Landkarten. Jede Einzelerfahrung wird registriert, im Hippocampus, einem Bereich im Zentralhirn, gespeichert, weitergegeben an die Großhirnrinde, dort zusammengefasst mit anderen Einzelerfahrungen, abstrahiert und endgültig abgespeichert. Offenbar ist der Hippocampus notwendig, um Neues dauerhaft im Gedächtnis zu verankern. Dabei scheint es auf die gleichzeitige Aktivität von Hirnzellen anzukommen. Doch nur bestimmte Vorgäng durchlaufen den Hippocampus: Worte, Namen, Zusammenhänge, räumliche Orientierung (deklaratives Lernen), nicht aber Bewegungsabläufe.21 Es kann im Unterricht nicht darum gehen, stumpfsinnig Regeln auswendig lernen zu lassen. Was Kinder und Schüler brauchen, sind Beispiele. Sehr viele Beispiele und – wenn möglich - die richtigen und guten Beispiele. Auf die Regeln kommen die Schüler 15 Vgl. Hüther, Herald: Die Bedeutung emotionaler Sicherheit für die Entwicklung des kindlichen Gehirns. In: Kinder brauchen Wurzeln, hrsg. von Karl Gebauer und Gerald Hüther, Düsseldorf und Zürich 2002, S. 15 ff. 16 Vgl. Singer, Wolf: „In der Bildung gilt: Je früher, desto besser.“ In: Psychologie heute, 26. Jg. Heft 12/1999, S. 62 17 Vgl. Spitzer, Manfred (2000): A.a.O., S. 148 18 Vgl. Spitzer, Manfred (2003,2): Nervensachen – Perspektiven zu Geist, Gehirn und Gesellschaft, Stuttgart 2003, S. 23 ff. 19 Vgl. Singer, Wolf: Ein neues Menschenbild? – Gespräche über Hirnforschung, Frankfurt am Main 2003, S. 110 20 Vgl. Singer, Wolf (1999): A.a.O., S. 60 21 Vgl. GEO WISSEN: A.a.O., S. 39 5 dann schon selbst.22 Lernen erfolgt am Beispiel und nicht durch Instruktion und Predigen. Nur so wird sich im Laufe der Zeit ein Schatz an erworbener allgemeiner Erfahrung ansammeln, der es den Schülern erlaubt, sich in der Welt zurechtzufinden. Wichtig ist jedoch die ständige und regelhafte Wiederholung der Beispiele. Die Schüler brauchen diese strukturellen Inputs: „Nichts ist schädlicher als chaotischer Input, denn sofern der Input keine Regelhaftigkeit aufweist, können keine Regeln extrahiert werden, kann also nichts gelernt werden.“ 23 Parallelen zur induktiven Stoffentwicklung und zum handlungsorientierten Unterricht sind unübersehbar. Chaotischer Input liefert sicherlich der nicht genügend lernpsychologisch und didaktisch aufbereitete Einsatz des Internets in Familie, Freizeit aber auch Schule. Lernen durch Tun Handeln im Sinne von Verfolgen von (möglichst selbstgesetzten) Zielen unterscheidet sich grundlegend vom bloßen Reagieren auf bestimmte Sinnesreize.24 Die Schüler lernen etwas dadurch, dass sie es „tun“, immer wieder, in den unterschiedlichsten Kontexten und mit den verschiedensten Menschen. Durch die neuere Hirnforschung wird eindrucksvoll bestätigt: Lebewesen lernen dann am besten, wenn sie selbst tätig sind. Bloßes Zuschauen oder Zuhören genügt nicht: Wir müssen schon in einen aktiven Dialog mit der Umwelt eintreten, wenn wir lernen wollen.25 Dabei sollten die Lehrer für viele Beispiele sorgen und für große Verschiedenheit der Beispiele. Und wir müssen die jungen Menschen „handeln“ lassen. Durch dieses Handeln wird gelernt. Regeln sind für das Lernen wichtig, um Beispiele zu generieren. Erarbeitete Regeln werden im Unterricht verwenden, um damit immer wieder neue Beispiele zu konstruieren und zu bearbeiten. Auch hier zeigen sich wieder Grundprinzipien des problem- und handlungsorientierten Unterrichts innerhalb induktiver Stoffentwicklung. In Verbindung mit dem ersten Aspekt liefert die Hirnforschung einen hochinteressanten Ansatz - um nicht zu sagen hirnbiologischen Nachweis - für den z.B. in Baden-Württemberg in den beruflichen Schulen propagierten handlungsorientierten Unterricht. Die fundamentale Erkenntnis jeglicher Lernforschung wird von den Hirnbiologen bestätigt: Kinder und Schüler erwerben in rasanter Geschwindigkeit Wissen und generieren Fähigkeiten, wenn sie dabei möglichst viel selbst ausprobieren und tun können. Und die Neurodidaktiker sind sich auch in der kritischen Einschätzung des Computers im Hinblick auf Lernen einig: „Tödlich für alles, was in der Schule gelernt wurde, ist die Dauerdaddelei vor dem Computer. Dieser Informationsflut hält keine Vokabel stand, solange sie sich noch im Kurzzeitgedächtnis befindet.“26 (Anders verhält es sich natürlich bei konstruktivistisch angelegter Lernsoftware.) Lernarrangements, die sich durch einen hohen Grad an Selbstorganisation auszeichnen, erlauben dem Individuum, sich seine eigene Denkstruktur zu „konstruieren“ (Konstruktivismus) und viele konstitutiven Elemente innerhalb des komplexen Unterrichtsgeschehens sind in offeneren und stärker handlungsorientierten 22 Vgl. Spitzer, Manfred (2002): A.a.O., S. 78 und S. 356 f. Spitzer, Manfred (2000): A.a.O., S. 63 24 Vgl. Roth, Gerhard: Fühlen, Denken, Handeln – Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Frankfurt am Main 2001, S. 406 ff. 25 Vgl. Kluge, Jürgen: Schluss mit der Bildungsmisere – Ein Sanierungskonzept, Frankfurt am Main 2003, S. 12 26 Scheich, Hennig. Zitiert nach: „Guten Morgen, liebe Zahl“, Der Spiegel, Heft 27/2002, Seite 73 23 6 Unterrichtsformen Veränderungsprozessen ausgesetzt. Nicht zuletzt erfährt die Rolle des Lehrers, der mit weitem Abstand den wichtigsten Faktor beim schulischen Lernen darstellt, eine entscheidende Veränderung: Er wird zum Berater und Moderator von Lernprozessen und muss Abschied nehmen von der überkommenen Auffassung vom Stoff“vermittler“. Lernen ohne Struktur geht nicht Einzelheiten machen nur im Zusammenhang Sinn, und es ist dieser Zusammenhang und dieser Sinn, der die Einzelheiten interessant macht. Strukturen bzw. Muster werden langsam erworben, d.h. „Inputs“ müssen konstant gehalten werden, bis ein Lernvorgang abgeschlossen ist. Ständige Veränderungen von Situationen und Bedingungen verwirren und behindern damit das Lernen. Besonders negativ auf den Lernprozess wirkt sich das Fehlen von Strukturen aus. Wer noch keine Orientierung über ein bestimmtes Sachgebiet hat, wer die grundlegenden Begriffe nicht kennt, der kann auch mit noch so viel Fakten nichts anfangen. Daher ist jeder verfrühte Einsatz des Internets kontraproduktiv und auch das Erlernen spezieller Anwendungssoftware in Schulen wenig sinnvoll – ja diese Reizüberflutung bewirkt im Gehirn genau das Gegenteil. Das Gehirn muss sich davor schützen, zu viel zu lernen. Sekunde um Sekunde wetteifern unermesslich viele Eindrücke und Wahrnehmungen um seine Aufmerksamkeit. Würden sie alle gespeichert, das Gehirn wäre binnen kürzester Zeit von einer Flut sinnlosen Datenmülls lahm gelegt. Deshalb muss es vor allem zwei schwierige Aufgaben bewältigen: Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden und Kategorien bilden. Wissen im Gehirn zu verankern ist ein Einordnungsprozess. Jede neue Information muss einen sinnvollen Platz im bereits vorhandenen Wissen einnehmen und sich entsprechend damit vernetzen. Übung macht den Meister Nur wenn die gelernte Regel immer wieder angewendet wird, geht sie vom expliziten und sehr flüchtigen Wissen im Arbeitsgedächtnis in Können über, das jederzeit wieder aktualisiert werden kann. Das Gedächtnis ist dabei kein lokalisierbares Feld im Kopf. Inhalte werden in verschiedenen Regionen gespeichert und – je nach Vorerfahrung – mit unterschiedlichen anderen Inhalten verknüpft. Wichtige Inhalte müssen immer wieder „gelernt“ und das Begriffene immer wieder angewendet werden. Nur so wird man sicher. Unser Gehirn arbeitet nach dem Prinzip der neuronalen Vernetzung. Eindrücke, Bilder, Informationen usw. werden aufgenommen und weiterverarbeitet. Entweder werden neue Strukturen herausgebildet oder die eingehenden Impulse werden mit bereits vorhandenen Strukturen vernetzt. Die Häufung ähnlicher Wahrnehmungsmuster führt zu einer Erweiterung des entsprechenden Areals, da das Gehirn die Informationen durch die kontinuierliche Beschäftigung damit für bedeutsam hält. Eine ganz wichtige Aufgabe von Unterricht muss es daher sein, durch Wiederholungen und durch verstärktes Aufgreifen bereits bekannter Zusammenhänge solche neuronalen Prozesse der gehirninternen Verarbeitung zu nutzen. Deshalb: Bekanntes immer wieder ansprechen und damit erneut in den Aufmerksamkeitshorizont bringen. Oberkellnergedächtnis versus Lernen für das Leben 7 Schüler lernen heute für Klassenarbeiten nach dem Oberkellner-Prinzip: Wenn ein Tisch abgeräumt ist, wird alles vergessen, damit Platz ist für die nächsten Gäste. So lernen die Schüler für die nächste Klassenarbeit und einen Tag später sind sie nicht mehr in der Lage, Sinnvolles oder überhaupt Etwas zu dem in der Klassenarbeit abgefragten Stoff - obwohl vielleicht sogar mit einer guten Klassenarbeitsnote bedacht – wiederzugeben. Klassenarbeiten sollten folglich nicht vorwiegend den gerade eingepaukten Stoff abfragen, sondern schwergewichtig den länger zurückliegenden. Es sollte wenig von dem geprüft werden, was gerade im Unterricht behandelt wurde, sondern insbesondere alles andere. Wenn es sich für Schüler lohnt, etwas dauerhaft zu behalten, statt für die Abfrage von vielen Details auf Punktejagd zu gehen, werden sie ihre Strategie ändern und nachhaltig lernen und nicht die Zeit mit sinnlosem Gepauke verschwenden. Hinzu kommt, dass die Informationen zerfallen oder überlagert werden, wenn Inputs zu schnell aufeinanderfolgen und keine Möglichkeiten des Datentransfers geboten sind. Ungestörter und ausreichender Schlaf ist unbedingte Voraussetzung für gelingende Lernprozesse, damit der Transfer der Erfahrungsdaten vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis erfolgen kann. Mit anderen Worten: Der Hippokampus fungiert im Schlaf als Lehrer des Kortex. Immer dann, wenn der Hippokampus etwas (vorläufig) gelernt hat, wird nachfolgend im Tiefschlaf das Gelernte zum Kortex übertragen.27 Das deklarative Gedächtnis also „im Schlaf“ konsolidiert, wenn auch die notwendigen Schlafphasen individuell verschieden sind. Die besten Leistungen erbrachten die Versuchspersonen bei cirka acht Stunden Schlaf.28 Inhalte, die dauerhaft in unserem Gehirn verankert werden sollen, erfordern einen grundlegenden Umbauprozess an den Nervenzellen und brauchen Zeit und ausreichende Ruhepausen zwischen den Lektionen. „Ohne Pausen wissen die Neuronen nicht mehr, was sie speichern sollen.“29 Pädagogische Schlussfolgerungen Wenn wir etwas Neues lernen, erleben wir ein Glücksgefühl. Wenn wir ein „Aha“Erlebnis haben, belohnt sich das Gehirn mit der hauseigenen Glücksdroge, dem körpereigenen Opiat, Dopamin. Lernen macht offensichtlich Lust auf mehr, denn Dopamin steuert, neben anderen Hormonen wie Noradrenalin, die Aufmerksamkeit. Und selbständig eine Lösung zu finden – so die Hirn- oder besser Lernforscher – bereitet offensichtlich ungeheure Lust. „Ein Kind lernt dann am besten, wenn es Aufgaben selbständig löst. Das Lustgefühl, das damit einhergeht, ist nachhaltiger als jede Belohnung von außen – anders als viele Erziehungswissenschaftler meinen.“30 Die Devise muss daher lauten: Den Schülern nicht möglichst viel Stoff eintrichtern zu wollen, sondern sie zum eigenen Problemlösen anzuregen – denn nur dies aktiviert schließlich das Belohnungszentrum - und sie im Selbstversuch die Grenzen von Erfolg und Misserfolg ausloten zu lassen. Doch wenn das Gehirn kaum etwas lieber tut, als Neues zu erfahren, warum bevölkern dann Heerscharen unlustiger Schüler Deutschlands Klassenzimmer? Meist sind schon die Rahmenbedingungen (Klassengröße, Klassenzimmer, aber auch Langeweile und 27 Vgl. Spitzer, Manfred (2002): A.a.O., S. 410 f. und S. 123 ff. Vgl. GEO WISSEN: A.a.O., S. 43 29 Scheich, Henning. In: Focus, Heft 43/2002, S. 85 30 Derselbe. In: Der Spiegel, Heft 27/2002, S. 69 28 8 Unterforderung) nicht dazu angetan, freudige Empfindungen aufkommen zu lassen und dämpfen die dem Hirn innewohnende Neugier. Vor allem sind Angst und Stress schlechte Lehrmeister (Furcht vor Blamage, Klassenarbeit, Prüfung usw.). Denn diese führen im Körper zur Ausschüttung des Hormons Cortisol, das die Funktion des Hippocampus beeinträchtigt. Bei Dauerberieselung damit, kann dieses Hirnareal sogar schrumpfen.31 Hinzu kommen wenig motivierende Rituale an unseren Schulen, z.B. der Zwang zur Notengebung, das wenig differenzierende Bildungssystem bzw. Vorgehen in unseren Klassen, das nicht ausgelotete didaktisch-methodische Spektrum mit oftmals geringen Möglichkeiten der Selbstorganisation von Lernprozessen, das über die Jahre gewachsene personale Beziehungsgeflecht mit durchaus auch ablehnenden Verhaltensmustern oder anderes mehr. Die neuere Gehirnforschung zeigt den bekannten Sachverhalt, dass Lernen ein sehr komplexer Vorgang ist und viele pädagogische Weisheiten kommen durch die Neurodidaktiker zu neuen Ehren: Manche Erkenntnis wird von fortschrittlichen Pädagogen schon seit Jahren so vorgetragen und sie versuchen auch, diese unterrichtlich umzusetzen. In vielen Bereichen können sie nun die Hirnforschung oder Neurobiologie als Beweis anführen. In dieser Stringenz war dies bisher nicht möglich. Die neueren Forschungsergebnisse zeigen, dass der Reformpädagogik zuzurechnende Pädagoginnen und Pädagogen und auch z.B. Montessori oder Comenius mit ihren Vermutungen und mit vielen Aussagen Recht hatten und ihre durch Beobachtung gewonnenen Schlussfolgerungen auch neueren naturwissenschaftlich begründbaren Nachweisen standhalten. So hat z.B. das Bedürfnis des Kindes nach Struktur schon Maria Montessori erkannt. Heute kann es in seiner Bedeutung hirnphysiologisch erklärt werden. Ältere Lerntheorien stehen damit nicht im Widerspruch zu neueren Erkenntnissen. Die neuere Hirnforschung hat viele pädagogische Richtlinien bestätigen können und untermauert naturwissenschaftlich die Auffassung, dass jedes Individuum eine eigene Denkstruktur „konstruiert“. „Wenn aber Lernen ein subjektiver Vorgang ist, mit individuellen Zugängen, individuellem Niveau und unterschiedlichen Verknüpfungen mit je anderen Denkinhalten, dann hat die ‚alte Schule’, in der alle Schüler zur gleichen Zeit möglichst alle das Gleiche lernen sollten, wirklich ausgedient.“32 Lernen, so die Neurodidaktiker, ist ein höchst subjektiver Vorgang, mit individueller Struktur und unterschiedlichen Verknüpfungen mit der bestehenden neuronalen Landkarte. Damit ergeben sich weitreichende Konsequenzen für die Schule: Nicht alle Schüler können – wie in der „herkömmlichen Schule“ - zur gleichen Zeit möglichst das Gleiche lernen, sondern müssen in autonomeren Schulen offenere Lernumgebungen erhalten, damit Lernen als subjektiver Vorgang stattfinden und gelingen kann, mit individuellen Zugängen, individuellem Zeitbedarf, individuellem Niveau und unterschiedlichen Verknüpfungen mit je anderen Denkinhalten.33 Die Didaktik macht seit 20 bis 30 Jahren und in Anknüpfung an reformpädagogische Ansätze einen Paradigmenwechsel durch,34 der sie von der herkömmlichen 31 Vgl. GEO WISSEN: A.a.O., S. 40 Michaelis-Jähnke, Karin: Die neuere Lern- und Gedächtnisforschung und die bekannten Lerntheorien. In: Seminar, Heft 3/2002, S. 114 33 Vgl. ebenda 34 Vgl. Bönsch, Manfred: Der Paradigmenwechsel in der Allgemeinen Didaktik: Von der Vermittlungsdidaktik über die handlungsorientierte Didaktik zur Autodidaktik. In: Selbstgesteuertes Lernen in der Schule, hrsg. von Manfred Bönsch, Neuwied 2002, S. 143 f. 32 9 Vermittlungsdidaktik über den Ansatz einer handlungsorientierten Didaktik zur Konstruktion einer Autodidaktik führt. Dabei erfolgt die Entwicklung nicht linear, eher in Sprüngen, Stagnationen, Schritten nach vorn und wieder mit Rückbindung an die traditionellen Denkmuster der Vermittlung. Der handlungsorientierte Unterricht macht einen entscheidenden Schritt in Richtung Paradigmenwechsel. Neuere hirnbiologische Erkenntnisse lassen vermuten, dass jetzt ein Schritt weitergegangen wird. Lernen muss (wieder) Spaß machen, dies ist eine entscheidende Botschaft der Hirnforscher: Dann wird das Gelernte an der richtigen Stelle gespeichert und nicht im so genannten Mandelkern, der für Flucht und Kampf zuständig ist. „Für Kreativität ist eine andere Stelle im Gehirn zuständig – der Hippokampus -, deshalb schließen Angst und Kreativität sich einander aus.“35 In der Bezugsliteratur finden sich Fundstellen mit weiteren neueren und hochinteressanten hirnbiologischen Erkenntnissen zum Lernen, wie . . . . . . . die Bedeutung von Motivation und Emotionen für das Lernen, die Notwendigkeit von Schlaf und Traum für das Lernen, das Lernen von sozialem Verhalten und ethischen Grundsätzen, die Auswirkungen des massenhaften Konsums von Gewaltdarstellungen im Fernsehen und von Videospielen auf das Lernen, die Wirkung von Stress auf das Lernen, die Bedeutung eines funktionierenden Lehrer-Schüler-Verhältnisses für das Lernen oder die Wichtigkeit guter Deutschkenntnisse in unseren Schulen und anderes mehr. Diese Quellen erlauben einen vertieften Einstieg in eine faszinierende Materie. Denn die lange Zeit aufrechterhaltene und bis heute vorgenommene Trennung zwischen der Hirnentwicklung und der Entwicklung des Verhaltens, Denkens und Fühlens, ja selbst des Gedächtnisses hat sich ebenso als Irrtum erwiesen wie die Vorstellung, dass der Prozess der strukturellen Ausreifung des menschlichen Gehirns gegen Ende des dritten Lebensjahres weitgehend abgeschlossen sei.36 35 Spitzer, Manfred (2003,1): A.a.O. und Maier, Gerhard: Hirnforscher rät: „Lernen muss Spaß machen.“ In: http://www.sembs.s.bw.schule.de/fb2/index.htm vom 12. Mai 2003 36 Vgl. Hüther, Gerald: Wohin, wofür, weshalb? Über die Bedeutung innerer Leitbilder für die Hirnentwicklung. In: Kinder suchen Orientierung, hrsg. von Karl Gebauer und Gerald Hüther, Düsseldorf und Zürich 2002, S. 20