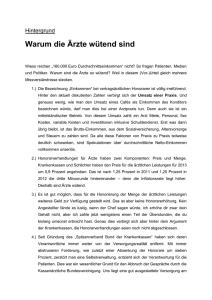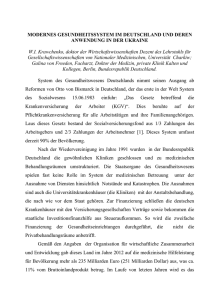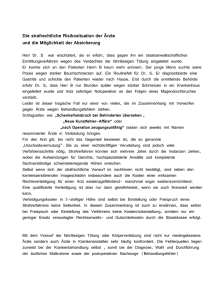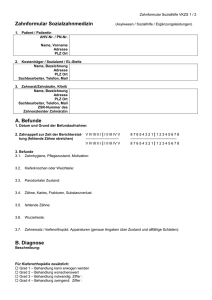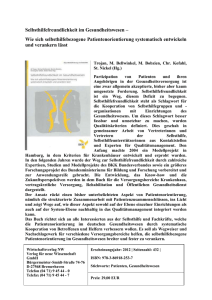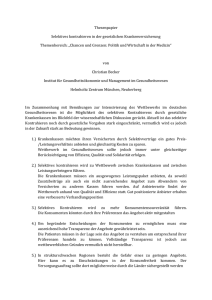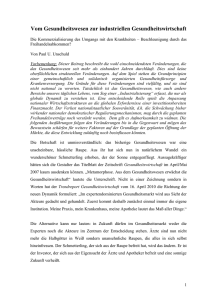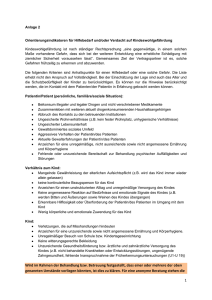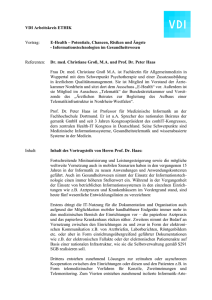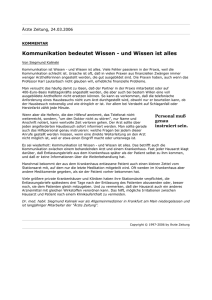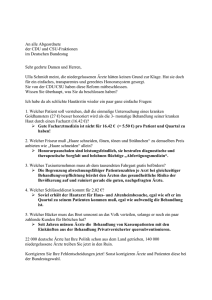Der Patient im Spannungsfeld zwischen Gesundheit und Kosten
Werbung
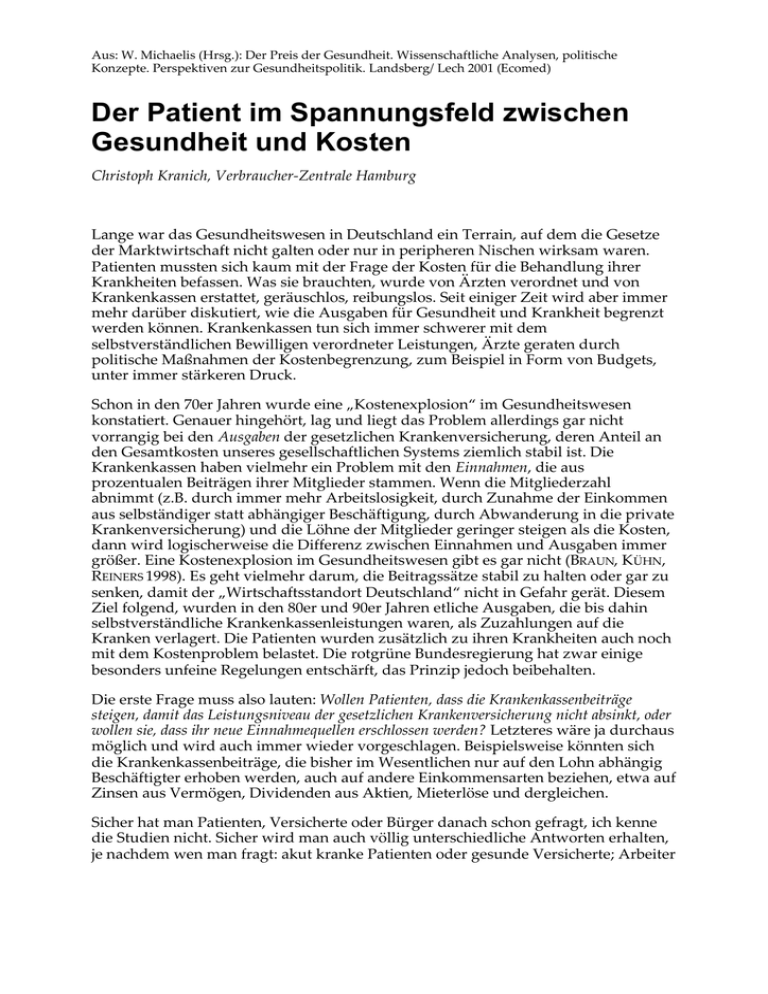
Aus: W. Michaelis (Hrsg.): Der Preis der Gesundheit. Wissenschaftliche Analysen, politische Konzepte. Perspektiven zur Gesundheitspolitik. Landsberg/Lech 2001 (Ecomed) Der Patient im Spannungsfeld zwischen Gesundheit und Kosten Christoph Kranich, Verbraucher-Zentrale Hamburg Lange war das Gesundheitswesen in Deutschland ein Terrain, auf dem die Gesetze der Marktwirtschaft nicht galten oder nur in peripheren Nischen wirksam waren. Patienten mussten sich kaum mit der Frage der Kosten für die Behandlung ihrer Krankheiten befassen. Was sie brauchten, wurde von Ärzten verordnet und von Krankenkassen erstattet, geräuschlos, reibungslos. Seit einiger Zeit wird aber immer mehr darüber diskutiert, wie die Ausgaben für Gesundheit und Krankheit begrenzt werden können. Krankenkassen tun sich immer schwerer mit dem selbstverständlichen Bewilligen verordneter Leistungen, Ärzte geraten durch politische Maßnahmen der Kostenbegrenzung, zum Beispiel in Form von Budgets, unter immer stärkeren Druck. Schon in den 70er Jahren wurde eine „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen konstatiert. Genauer hingehört, lag und liegt das Problem allerdings gar nicht vorrangig bei den Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung, deren Anteil an den Gesamtkosten unseres gesellschaftlichen Systems ziemlich stabil ist. Die Krankenkassen haben vielmehr ein Problem mit den Einnahmen, die aus prozentualen Beiträgen ihrer Mitglieder stammen. Wenn die Mitgliederzahl abnimmt (z.B. durch immer mehr Arbeitslosigkeit, durch Zunahme der Einkommen aus selbständiger statt abhängiger Beschäftigung, durch Abwanderung in die private Krankenversicherung) und die Löhne der Mitglieder geringer steigen als die Kosten, dann wird logischerweise die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben immer größer. Eine Kostenexplosion im Gesundheitswesen gibt es gar nicht (BRAUN, KÜHN, REINERS 1998). Es geht vielmehr darum, die Beitragssätze stabil zu halten oder gar zu senken, damit der „Wirtschaftsstandort Deutschland“ nicht in Gefahr gerät. Diesem Ziel folgend, wurden in den 80er und 90er Jahren etliche Ausgaben, die bis dahin selbstverständliche Krankenkassenleistungen waren, als Zuzahlungen auf die Kranken verlagert. Die Patienten wurden zusätzlich zu ihren Krankheiten auch noch mit dem Kostenproblem belastet. Die rotgrüne Bundesregierung hat zwar einige besonders unfeine Regelungen entschärft, das Prinzip jedoch beibehalten. Die erste Frage muss also lauten: Wollen Patienten, dass die Krankenkassenbeiträge steigen, damit das Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung nicht absinkt, oder wollen sie, dass ihr neue Einnahmequellen erschlossen werden? Letzteres wäre ja durchaus möglich und wird auch immer wieder vorgeschlagen. Beispielsweise könnten sich die Krankenkassenbeiträge, die bisher im Wesentlichen nur auf den Lohn abhängig Beschäftigter erhoben werden, auch auf andere Einkommensarten beziehen, etwa auf Zinsen aus Vermögen, Dividenden aus Aktien, Mieterlöse und dergleichen. Sicher hat man Patienten, Versicherte oder Bürger danach schon gefragt, ich kenne die Studien nicht. Sicher wird man auch völlig unterschiedliche Antworten erhalten, je nachdem wen man fragt: akut kranke Patienten oder gesunde Versicherte; Arbeiter 2 und Angestellte, Arbeitslose oder Menschen, die hauptsächlich von Miteinnahmen, Zinsen und Dividenden leben. Die Patientin1 gibt es gerade bei dieser Frage nicht. Egal wie derartige Befragungen ausgingen: Patienten wären schlecht beraten, würden sie sich gegen den Erhalt von Kernelementen des deutschen Gesundheitssystems aussprechen, dessen Ausgleich zwischen Gesunden und Kranken, Jungen und Alten, Alleinlebenden und Kindererziehenden auch im Ausland als beispielhaft gilt. Nun sind zu einem bestimmten Zeitpunkt die meisten Menschen gerade nicht Patienten. Aber auch Gesunde, die z.B. als Bürger zur Wahl gehen und über die künftige Gesundheitspolitik mitentscheiden, täten gut daran, ihre Stimme nicht für einen Abbau des solidarisch finanzierten Gesundheitssystems abzugeben. Denn wenn sie einmal krank sind, werden sie für die Existenz dieses Systems dankbar sein. So wie ich meine Gesundheit nicht spüre, wenn sie da ist, und erst der Schmerz mich auf ihr Fehlen und die Krankheit aufmerksam macht, so kann ich die Existenz einer solidarischen Absicherung des Krankheitsrisikos so lange ignorieren, bis ich sie plötzlich einmal brauche. Dann aber nutze ich sie aus, als wäre sie das Selbstverständlichste von der Welt. Das ist sie aber nicht – sie musste mühsam errungen und gegen mannigfaltige Anfeindungen abgesichert werden. Und jetzt gilt es, sie zu verteidigen. Individualität und Solidarität als Leitmotive der Gestaltung des Gesundheitswesens Das heutige Gesundheitswesen wird von falschen Prinzipien beherrscht. Gesund wäre eine ausgewogene Mischung aus Individualität und Solidarität, zwei komplementären Gestaltungselementen jedes funktionierenden Gemeinwesens. Sie können einen zwar dynamischen, im Ergebnis aber harmonischen Ausgleich herstellen zwischen der Eigenheit und Unersetzbarkeit des Einzelnen und der Anerkennung und Achtung der Anderen. Statt dieser sozial „gesunden“ Prinzipien regiert aber im Gesundheitswesen ein Gemenge zweier destruktiver Wirkprinzipien, ein Amalgam aus Egoismus und Kollektivismus. Sie sind wie die Schattenbilder der ersteren, sozusagen ihre missratenen Brüder. Was heißt das auf der Ebene des unmittelbaren Erlebens der Patientin? Sie fühlt sich unmündig, enteignet, ihrer Individualität beraubt. Einen großen Teil ihrer Autonomie und Selbstbestimmung gibt sie ab, längst bevor sie die Arztpraxis betritt – nicht nur weil der Arzt noch viel zu oft im Sinne des überkommenen Paternalismus von der Patientin „compliance“ verlangt (worunter er lediglich Gehorsam und Folgsamkeit versteht), sondern vor allem auch aus strukturellen Gründen. Patient hängt etymologisch zusammen mit passiv, Passion, Leiden. Im Kerngeschäft des Gesundheitswesens, den medizinischen Leistungen, bleibt die Patientin die Leidende, Erduldende, sie regrediert, sie delegiert ihre Souveränität an „die Medizin“, die der Arzt vertritt. Sie empfindet sich abhängig von einem kollektiven Imperativ, der sich in der Medizin zum Beispiel in Gestalt des „wissenschaftlich Anerkannten“ artikuliert – und sie entwickelt als Gegenbewegung das vitale Bedürfnis, ihre eigene Lebensgeschichte und Individualität in diese objektivabstrakte Welt wieder einzubringen; nicht nur als interessanter Fall einer vielleicht seltenen Krankheit gesehen zu werden, sondern als Person mit körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Aspekten ihrer individuellen Gesundheit. Das 1 Der Patient ist immer mitgemeint. 3 Empfinden von Degradierung und Kollektivierung erzeugt bei ihr (berechtigten) Egoismus als Versuch der Behauptung des Selbst gegenüber den Kränkungen des Systems. Da das System das Individuum nicht ausreichend unterstützt und stärkt, entsteht statt gesundem Individualismus ungesunder Egoismus. Nötig wäre eine aktive Kompensation durch das Gesundheitswesen: eine Medizin, die den Menschen biographisch betrachtet, und ein System, das die Kosten wirklich solidarisch verteilt. Stattdessen wird die Patientin zur „Kundin“ hochstilisiert. Die Kundenrolle jedoch ist kein geeignetes Mittel gegen die Nebenwirkungen des Patientseins. Krankenkasse/ -versicherung Recht Versicherter Anonyme Institution, z.B. Krankenhaus Verbraucher Kunde Freie Arzt-, Krankenhaus- und Krankenkassenwahl, Selbstmedikation, Prävention Mandant Mensch Klient Gesundheitspolitik Bürger Wissenschaft und Forschung Proband Patient Medizinische Behandlung (Kerngeschäft) Psychotherapie Abb. 1: Die Rollen des Menschen im Gesundheitswesen Was macht die Kundin aus? Das souveräne Bestellen einer Leistung und das anschließende Bezahlen. Das Bestellen überlässt die Patientin aber dem Arzt, es heißt dann Verordnen, und das Bezahlen der Krankenkasse, an die sie regelmäßige, gleichbleibende Beiträge abgeführt und damit den anderen Teil ihrer Kundenautonomie abgetreten hat. Hersteller Händler Hersteller, Anbieter Arzt bestellt Kunde KV usw. Krankenkasse bezahlt Patient bestellt + bezahlt Abb. 2: Der Unterschied zwischen Kunde und Patient 4 Die beiden die Kundin konstituierenden Merkmale delegiert die Patientin an mächtige Akteure. Diese – Leistungserbringer (Ärzte, Psychologen, Heilpraktiker…) wie Kostenträger (Krankenkassen, Krankenversicherungen…) – haben ein enormes Netz an Institutionen neben und hinter sich (Kammern, Verbände, Fakultäten, Institute…), und sie kommunizieren miteinander über weitere mächtige Institutionen (z.B. Kassenärztliche Vereinigungen…). Ganz anders die Patientin; ihr steht allenfalls ihr familiäres Umfeld, in seltenen Fällen eine Selbsthilfegruppe zur Seite. Die Akteure des Gesundheitswesens sind also nicht die Patienten, um die sich doch alles dreht (oder drehen sollte), sondern Ärzte (Leistungserbringer) und Krankenkassen (Kostenträger). Das wäre noch erträglich, wenn diese beiden ihr Handeln nach den Prinzipien Individualität und Solidarität ausrichten und damit für die Patientin produktiv zusammenwirken würden. Doch genau das tun sie nicht. Die Ärzte waren einst einem hohen ethischen Anspruch verpflichtet, der sich z.B. im hippokratischen Eid ausdrückte – noch heute bezeichnen die Heilberufegesetze mancher Bundesländer die Ärzte als „hochstehenden Berufsstand“, den die Ärztekammern zu schützen haben. Und die Krankenkassen waren Selbsthilfeorganisationen der Arbeiter und Angestellten zur solidarischen Absicherung des Krankheitsrisikos, das heißt zum gemeinsamen Überleben. Heute dagegen regieren Egoismus und Kollektivismus. Ärzte handeln mehr nach ökonomischen als nach medizinischen Gesichtspunkten, Krankenkassen sind mehr an „guten Risiken“ interessiert als an Kranken – beides wird zwar nicht gerne so offen zugegeben, ist aber nur allzu offensichtlich, etwa wenn man ärztliche Fortbildungskurse zur „Optimierung“ der Abrechnung oder das Werbeverhalten der Krankenkassen betrachtet. Wen wundert es da, dass auch die Patientin nicht verschont bleibt von den missratenen Gesellen Egoismus und Kollektivismus. Wie soll gerade sie sich als Muster an Solidarität gebärden, wenn ihr von den mächtigen Vertretern des Gesundheitswesens das Gegenteil vorgelebt wird? Kann man im Ernst von ihr einen Beitrag zur „Kostendämpfung“ verlangen, kann man sie zu „kostenbewusster Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen“ veranlassen, wenn Ärzte, Kassen, Politiker vor ihren Augen ausschließlich für ihre jeweils eigenen Zwecke eintreten und fast nur gegeneinander kämpfen, kaum je aber für die Sache der Patientin? Ein gutes Beispiel für die Dominanz der falschen Prinzipien ist die aktuelle Debatte zur Sterbehilfe. Wen wundert es, dass nicht nur die Mehrheit der deutschen Bevölkerung für das Recht auf aktive Sterbehilfe eintritt (64% im Westen, 80% im Osten), sondern auch die Mehrheit der Christen (68% der Katholiken, 60% der Protestanten)? Wenn dann der christliche Oberhirte Kardinal Lehmann dogmatisch von oben herab verkündet: „Gottes Gebot ‚Du sollst nicht töten‘ und unsere christliche Überzeugung von der Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens stehen der aktiven Sterbehilfe entgegen“ (FAZ vom 12.4.2001), fühlt sich der moderne Mensch bevormundet und fasst lieber sein eigenes (wenn auch vielleicht nur vermeintliches) Wohl ins Auge. Ist es nicht nachvollziehbar, dass die meisten Menschen nicht an Schläuchen und Maschinen sterben wollen? Die Gesellschaft (hier in Gestalt der Kirche) hat Solidarität und Achtung vor der Individualität jahrzehntelang vernachlässigt, und nun bekämpft sie mit kollektivistischem Imperativ das Überhandnehmen des Egoismus. Warum wurden Hospize als Orte des menschenwürdigen, am Individuum und dessen Bedürfnissen orientierten Sterbens nicht schon in den langen Jahren der Regentschaft sich christlich nennender Parteien gefördert? Warum erst unter Rot-Grün? 5 Der selbstbestimmte und mitgestaltende Beteiligte Das Prinzip des Individualismus sollte für die Medizin in der unbedingten Achtung der Würde und der Werte der Patientin bestehen. „Entscheidungen zwischen Alternativen unterschiedlicher Risiken und Chancen sind individuelle Wertentscheidungen, die nicht mit medizinischem Sachverstand gefällt werden können, sondern ausschließlich von den Betroffenen selbst aufgrund der Beratung durch einen medizinischen Sachverständigen“, sagt schon 1992 der SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR DIE KONZERTIERTE AKTION IM GESUNDHEITSWESEN. Ein noch moderneres Konzept ist das vor allem in den angelsächsischen Ländern schon weit entwickelte „shared decision making“, die partnerschaftliche Entscheidungsfindung von Arzt und Patient (ELWYN, EDWARDS, KINNERSLEY 1999). Da arbeiten beide zusammen so lange an Klärung, Vermittlung, Verständnis und Verarbeitung einer Diagnose, unter Hinzuziehung zweiter und dritter Meinungen sowie außermedizinischer Ratgeber aus dem familiären Umkreis und aus Patientenberatungsstellen und Selbsthilfegruppen, bis eine wirklich tragfähige und von beiden Partnern verantwortbare Entscheidung möglich wird. In Deutschland hat zu diesem Thema Ende letzten Jahres eine erste Ausschreibung des Bundesgesundheitsministeriums für Modellprojekte stattgefunden. Weiter scheint man hier noch nicht zu sein – was nicht verwundert, ist doch zunächst unser System auf einen solchen gemeinsamen Weg nicht eingestellt. Welcher Kassenarzt kann diesen Prozess abrechnen, welches Krankenhaus hat genügend Personal, um eine partnerschaftliche Entscheidungsfindung als gemeinsamen Weg mitzuvollziehen? Wir müssten eine Art biographische Medizin kultivieren, die nicht nur Organe und Funktionen, sondern auch und vor allem das Individuum sieht, den Menschen hinter den medizinischen Fakten. Ich bin sicher, dass eine solche Heilkunst – trotz des Mehraufwands an Gesprächen und interpersonalen Kommunikations- und Verarbeitungsprozessen – nicht teurer wird als die gegenwärtige, chemisch und technisch orientierte Medizin. Auch die Solidarität hat es nicht leichter. In einer Gesellschaft, die ihre Mitglieder immer mehr auf individuelle Leistung hin sozialisiert, in der das Unternehmertum und der Erfolg an der Börse zu den wichtigsten Triebfedern gehören, hat das Mitdenken und Berücksichtigen der Anderen immer weniger Platz. Vor allem wenn sie krank und nicht mehr leistungsfähig sind. Dabei wollen alle die Solidarität der Anderen in Anspruch nehmen, wenn es ihnen schlecht geht. Ein Beispiel: Es ist eine häufige Erfahrung in Patientenberatungsstellen, dass Menschen aus der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung zurück wollen, wenn sie älter und die Beiträge unbezahlbar werden. Früher wollten sie die billigen Tarife, jetzt wollen sie von der Unterstützung der anderen leben. Solidarität hieße dagegen, einen prinzipiellen Ausgleich zwischen den eigenen Interessen und denen der Anderen zu finden: Nur wenn es allen gut geht, kann auch ich mich wohlfühlen. Wie müsste ein Gesundheitswesen aussehen, das solche Solidarität ermöglicht? Alle wären in ein System der Umverteilung einbezogen, ohne dass sich der kleine Teil Besserverdienender hinausstehlen könnte. Es gäbe weder Pflichtversicherungs- noch Beitragsbemessungsgrenze. Das so zusätzlich ins 6 solidarische System fließende Geld würde flächendeckend Qualitäts- und Beschwerdemanagement sowie unabhängige Patientenunterstützung ermöglichen. Ärzte würden nicht mehr als freier, selbstverwalteter und selbstkontrollierter Beruf bei sich selbst Einzelleistungen bestellen, sondern sie würden die Patientenbedürfnisse ermitteln und Prozesse der partnerschaftlichen Entscheidung ermöglichen – vielleicht als gut bezahlte und abgesicherte Angestellte, vielleicht als selbstverwaltete Unternehmergemeinschaft zusammen mit anderen Gesundheitsarbeitern, vielleicht auch in einer völlig neuen Assoziationsform ähnlich einer Genossenschaft im Bunde mit ihren Patienten. Und nicht zuletzt die Patienten: Sie müssten, ebenso wie alle anderen Beteiligten, eine Schulung in Solidarität erhalten. Das Prinzip der sozialen Versicherungen – dass Junge für Alte und Kranke für Gesunde einstehen – muss wieder ins Bewusstsein der Menschen eindringen können, muss sich endlich wieder gegen die dominierende Orientierung an Macht, Geld und Erfolg behaupten. Und sie brauchen Organe der kollektiven Interessenvertretung, wie sie die anderen Akteure längst haben. Das klingt nach Utopie und Traumtänzerei, werden viele sagen. Diesem Einwand könnte ich (mit einem etwas abgegriffenen Spruch aus vergangenen Tagen) entgegnen: Wer nicht den Mut zum Träumen hat, dem fehlt die Kraft zum Kämpfen. Doch ich kann auch prominente Zeugen für manche dieser Forderungen anführen, etwa die Konferenz der Gesundheitsminister der 40 Staaten des Europarates, die 1996 vom „dreiseitigen Sozialpakt zwischen Patienten, Leistungserbringern und Kostenträgern“ sprach, bei dem alle drei „die gleichen Möglichkeiten zur Mobilisierung der öffentlichen Meinung“ haben sollen (FÜNFTE KONFERENZ DER EUROPÄISCHEN MINISTER FÜR GESUNDHEIT). Auch dies klingt allerdings nach Utopie und Traumtänzerei. Bezeichnenderweise haben die Beschlüsse der europäischen Gesundheitsminister keinerlei Bindungswirkung. Warum also wurden sie formuliert? Entweder sind sie normative Sätze, aus ethisch-moralisch-politischer Überzeugung gesprochen; oder sie verfolgen ein strategisches Ziel, etwa, wie anfangs skizziert, die Verantwortung für unbequeme Entscheidungen an die Patienten als Leidtragende zu delegieren. Egal welche Version mehr Überzeugungskraft entfaltet, man kann die Anregung einmal aufnehmen und ihre Konsequenzen durchdenken. Schritte auf dem Weg zur „dritten Kraft“ Stellen wir uns doch einmal vor, nicht nur Krankenhäuser und Ärzte, Krankenkassen und Krankenversicherungen hätten ihre Verbände und Vertretungen, sondern auch Patienten, etwa wie in den Niederlanden. Ich stelle mir ein ideales System der Patientenunterstützung so vor: 7 Patientenbeauftragte (Ombudsperson) Gremien des Gesundheitswesens Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (Patientenstelle, Verbraucher-Zentrale) Patientenverband Patientenvertrauensperson (PVP) Patient, stationär Patient, ambulant Patient Patient Selbsthilfegruppe, Patienteninitiative Abb. 3: Ein ideales System der Patientenunterstützung Links der professionelle Zweig: Patienten im Krankenhaus steht eine hauptamtliche und unabhängige Patientenvertrauensperson zur Seite. In Holland gibt es das z.B. für die Psychiatrie seit mehr als 20 Jahren, inzwischen sogar auf gesetzlicher Grundlage (MANDERS & WIDDERSHOVEN 1997). Ambulante Patienten können sich direkt an unabhängige Patientenberatungsstellen wenden, die auch für die Vertrauenspersonen Aufgaben der Koordination und Weiterbildung übernehmen. Solche gibt es in Deutschland seit mehr als 20 Jahren an Gesundheitsläden und seit 13 Jahren auch an Verbraucherzentralen, z.B. in Hamburg und Berlin. Sie sind also erprobte Modelle, die jedoch den bundesweiten Bedarf bei weitem nicht decken können (KRANICH 1999). Rechts die Selbstorganisation: Patienten schließen sich auf verschiedenen Ebenen in Gruppen und Initiativen zusammen – vieles davon gibt es auch bereits in Deutschland. Uns fehlt jedoch ein auch nur halbwegs machtvoller Patientenverband, wie er in vielen anderen Ländern existiert, z.B. in den Niederlanden mit der NP/CF, der Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie. Er kann zusammen mit den professionellen Patientenunterstützern eine kompetente, akzeptierte und legitimierte Vertretung der Patientenstimme in allen wichtigen Gremien des Gesundheitswesens darstellen. Und da das alles die strukturelle Unterlegenheit der Patienten noch nicht beseitigt, sollten wir noch die Funktion von Patientenbeauftragten auf der parlamentarischen Ebene erwägen, etwa analog den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder. Sie können auf einer noch höheren Ebene für die Einhaltung der Grundprinzipien Individualität und Solidarität im Sinne des Patientenwohls eintreten (KRANICH 1995). Was hat das alles mit Ausgabenbegrenzung und Kostendämpfung im Gesundheitswesen zu tun? Sehr viel. Es ist fatal, wenn Patienten mit ihrem heutigen Bewusstsein und ihrem heutigen gesellschaftlichen Organisationsgrad für Kostenverlagerungen eingespannt und vielleicht sogar mit dieser Intention in relevante Entscheidungsgremien einbezogen werden. Ich spreche nicht im Konjunktiv, denn das geschieht bereits. In Hamburg gibt es die Position eines Bürgervertreters in der Ethikkommission; in Rheinland-Pfalz wurde mit einer Änderung des Heilberufegesetzes verfügt, dass Patientenvertreter an den 8 Schlichtungsausschüssen der Kammern beteiligt werden sollen; und sogar Ärztefunktionäre sprechen sich für die Teilnahme von Patienten an den Entscheidungen des Bundesausschusses Ärzte und Krankenkassen aus – nicht ohne ehrlicherweise zuzugeben, dass sie sich dort von ihnen eine Unterstützung der Ärzteposition gegenüber den Krankenkassen erhoffen. Und genau das ist die Gefahr: dass Patienten, schwach und abhängig und ohne jeglichen politischen Rückhalt aus ihren eigenen Reihen, von den Großen im System verheizt und zwischen deren Interessen zerrieben werden. Die Hoffnung, die Patientenvertreter würden die Ärzte gegen die Krankenkassen unterstützen, kann man ja nur haben, wenn man annimmt, dass die Patienten eher den Ärzten ihr Vertrauen schenken als den anonymen Großorganisationen der Krankenkassen. Zu ihren Ärzten haben sie die stärkere Abhängigkeitsbeziehung. Solange Patienten im Gesundheitswesen Objekte bleiben, werden sie im Einzelfall immer mehr und immer bessere Leistungen im Krankheitsfall fordern, vor allem wenn sie erleben, dass die Großen auch nur an sich denken – z.B. dass Ärzte über Budgets klagen und „Individuelle Gesundheitsleistungen“ (IGEL) erfinden, nur um ihnen zusätzliches Geld aus der Tasche zu ziehen. Erst wenn Patienten als Subjekte – und damit als Individuen – anerkannt und gewürdigt werden, kann die Bereitschaft entstehen, wirkliche Mitverantwortung zu übernehmen. Dann sind Patienten auch bereit, berechtigte Belange der Ärzteschaft zu unterstützen, etwa wenn es um die unverantwortlichen 30-Stunden-Schichten im Krankenhaus geht oder um die Gängelung durch ungerechte Honorierungssysteme. Das ist auch eine Erfahrung in Patientenberatungsstellen: Wenn ein Arzt, der einen Fehler gemacht hat – egal ob „nur“ die Rechnung zu hoch war oder ob ihm ein richtiger Behandlungsfehler passiert ist – sein Missgeschick einräumt und sich entschuldigt, sind die meisten Patienten sehr verständnisvoll, viele verzichten sogar auf weitere Schritte. Patienten wollen Ärzte (und andere Gesundheitsarbeiter), die primär die Patientengesundheit im Auge haben, nicht das Budget. Wenn sie dies sehen und glauben, sind sie gerne bereit, auch über Kosten zu sprechen, das heißt einen sinnvollen Beitrag zur Ausgabenbegrenzung im Gesundheitswesen zu leisten. Aber nicht nur zur Reduktion des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern zur Begrenzung aller Kosten im Gesundheitswesen, auch z.B. der Gewinne der Pharmaindustrie. Spürbare Solidarität muss dann wirklich von allen kommen! Literatur BRAUN B, KÜHN H, REINERS H: Das Märchen von der Kostenexplosion. 2. Aufl. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main (1995) ELWYN G, EDWARDS A, KINNERSLEY P: Shared decision-making in primary care: The neglected second half of the consultation. British Journal of General Practice 49, 477482 (1999) FÜNFTE KONFERENZ DER EUROPÄISCHEN MINISTER FÜR GESUNDHEIT, Warschau 7.–8. November 1996: Soziale Herausforderungen an die Gesundheit: Gerechtigkeit und Patientenrechte im Kontext von Gesundheitsreformen. Abschlusstext. Unautorisierte Übersetzung in: KRANICH C & BÖCKEN J (Hrsg.): Patientenrechte und Patientenunterstützung in Europa. Nomos, Baden-Baden (1997), 197 ff 9 KRANICH C: Patientenbeauftragte. In: DAMKOWSKI W, GÖRRES S, LUCKEY K (Hrsg.): Patienten im Gesundheitssystem. Maro, Augsburg (1995) KRANICH C: Patientenunterstützung in Deutschland. In: BADURA B, HART D, SCHELLSCHMIDT H (Hrsg.): Bürgerorientierung des Gesundheitswesens. Nomos, Baden-Baden (1999) MANDERS H & WIDDERSHOVEN TP: Patientenvertrauensarbeit in der Psychiatrie. In: KRANICH C & BÖCKEN J (Hrsg.): Patientenrechte und Patientenunterstützung in Europa. Nomos, Baden-Baden (1997) SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR DIE KONZERTIERTE AKTION IM GESUNDHEITSWESEN: Ausbau in Deutschland und Aufbruch nach Europa. Jahresgutachten 1992. Nomos, Baden-Baden (1992), Kapitel 3, Ziffer 361