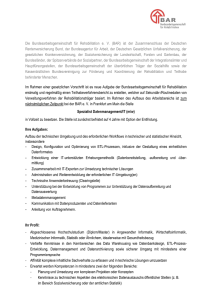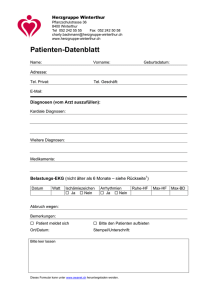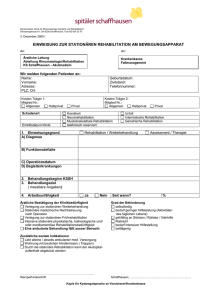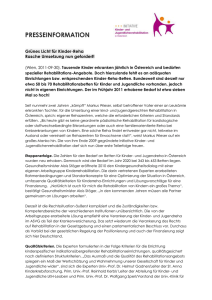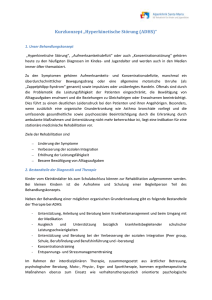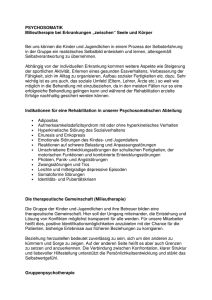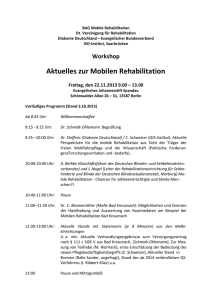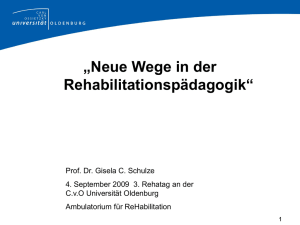Leistungsprofil für eine Rehabilitation für Kinder und Jugendliche im
Werbung

Leistungsprofil für eine Rehabilitation für Kinder und Jugendliche im Mental Health Bereich (Version März 2011) AutorInnen: G. Spiel, L. Thun Hohenstein, M. Finsterwald Stand: 31.03.2011 Seite 1 von 40 Inhaltsverzeichnis 1. ALLGEMEINES ................................................................................. 3 1.1 Ziele der Rehabilitation.............................................................................................. 3 2. ZUWEISUNGSKRITERIEN ................................................................ 9 2.1 Voraussetzungen ....................................................................................................... 9 2.2 Indikationen im Kindes- und Jugendalter .............................................................. 10 3. BEDARFSSCHÄTZUNG UND STRUKTURIERUNG DER REHA ... 20 3.1 Bedarfsschätzungen ................................................................................................ 20 3.2 Strukturierung .......................................................................................................... 26 4. QUALITÄTSSICHERUNG UND EVALUATION ............................... 27 4.1 Hintergrund .............................................................................................................. 27 4.2 Anknüpfungspunkte ................................................................................................ 28 5. STRUKTURQUALITÄT.................................................................... 30 5.1 Human Ressources ................................................................................................. 30 5.2 Organisationsstrukturen ......................................................................................... 32 5.3 Materielle Ressourcen ............................................................................................. 32 6. PROZESSQUALITÄT ...................................................................... 34 7. ERGEBNISQUALITÄT..................................................................... 37 7.1. Nachweis der Ergebnisqualität .............................................................................. 37 7.2 Entlassungsbericht .................................................................................................. 38 8. Literatur........................................................................................... 39 Seite 2 von 40 1. ALLGEMEINES 1.1 Ziele der Rehabilitation Nach der allgemeinen Definition der Weltgesundheitsorganisation schließt Rehabilitation alle jene Maßnahmen ein, die darauf ausgerichtet sind, das Ausmaß von Einschränkung der Aktivitäten und der Partizipation zu verringern, um eine gute soziale Integration zu erreichen. Rehabilitation zielt nicht nur darauf ab, beeinträchtigte oder behinderte Personen an ihre Umgebung anzupassen, sondern auch Umgebungsfaktoren und die Gesellschaft so zu beeinflussen, dass deren soziale Integration erleichtert wird. Nach der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit; s. WHO, 2005) stellt Rehabilitation das personenbezogene multi- und interdisziplinäre Management von Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit dar. Psychiatrische Rehabilitation im engeren Sinn umfasst alle jene Maßnahmen, die einen seelisch kranken Menschen über die Akutbehandlung hinaus durch umfassende Maßnahmen auf medizinisch, schulisch, beruflich und allgemeinen sozialem Gebiet in die Lage versetzen, seine Lebensform und Stellung, die ihm entspricht, zu finden bzw. wiederzuerlangen (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, 2005). Nach einer anderen Definition (Anthony& Liberman, 1986) ist psychiatrische Rehabilitation die systematische Anwendung von Interventionen, die entwickelt wurden um Schädigungen (Impairment), Funktionseinschränkungen (Disabilities) und soziale Beeinträchtigung (Handicap) zu reduzieren. Das Ziel psychiatrischer Rehabilitation ist es daher sicherzustellen, dass Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen die körperlichen, sozialen und emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten entwickeln können, um in ihrer Gemeinschaft zu leben, zu lernen und zu – und arbeiten. In der Definition der Deutschen Gesellschaft für Kinder Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (2007) wird Kinder – und Jugendpsychiatrische Rehabilitation als Psychosoziale Rehabilitation bezeichnet und damit eine inhaltlich etwas weitere Definition vorgenommen, die somit psychosomatische und sozialpädiatrische Problemfelder ebenfalls mit einschließt (Voll, 2004). Unter Psychosozialer Rehabilitation definiert die Leitlinie einerseits Hilfe zur Krankheitsverarbeitung und Bewältigung von Behinderung und andrerseits die Förderung der sozialen Kompetenz, der Reduktion krankheitsbedingter Handicaps, der Teilnahme am altersentsprechenden sozialen Leben inkl. Arbeit und Schule sowie Seite 3 von 40 der Verwirklichung des Rechtes auf ein selbstbestimmtes Leben. Rehabilitation soll nicht mehr die Herstellung bestmöglicher Gesundheit, sondern die Gewährleistung einer weitgehend normalen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zum Ziel haben (Fachgesellschaft für Rehabilitation in der Kinder- und Jugendmedizin, 2006). : Ausgehend aus diesen Definitionen lassen sich für die REHA von Kindern und Jugendlichen im Bereich Mental Health folgende Ziele ableiten: Hauptziel ist eine bestmögliche Wiederherstellung der Gesundheit. Dies kann einerseits durch die direkte Arbeit mit den Kindern bzw. Jugendlichen geschehen. Hierbei werden v.a. zwei Ziele angestrebt: 1) Unterstützung in der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben des Jugendalters 2) Verbesserung der gesundheitsbezogene Lebensqualität durch o eine Reduktion der Symptome o soziale Teilhabe und eine Sinn erfüllende Tagesstruktur o die Entwicklung (beruflicher) Perspektiven o Kompetenzförderung Allgemeine Kompetenzen (z.B. Bewältigung von Alltagsanforderungen, soziale und emotionale Kompetenzen, Arbeits- und Lernverhalten, Copingstrategien) Berufs(bild)bezogen (z.B. Fertigkeiten und Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Bewältigung beruflicher Aufgaben grundlegend sind) Andererseits gilt es aber auch mit den Eltern/Angehörigen zu arbeiten bzw. diese zu integrieren (z.B. durch die Weitergabe von Information, Ermöglichung von Partizipation; Psychoedukation). Die Ziele bei den Eltern/Angehörigen gilt es aber noch zu formulieren. Die genannten REHA-Ziele für Kinder und Jugendliche im Bereich Mental Health stehen somit zum Großteil in Übereinstimmung mit den verschriftlichten Zielen der stationären REHA für Kinder und Jugendliche im organisch pädiatrischen Bereich erstellt vom Referat „Rehabilitation im Kindes- und Jugendalter der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde“ (2011; S. 4-5): Seite 4 von 40 „Zusammenfassung der Ziele: Bestmögliche Wiederherstellung der Gesundheit im Sinne des biopsychosozialen Krankheitsmodells (Restitutio ad Optimum) durch Einsatz eines interdisziplinären Rehabilitationsteams. […] Erstellung weiterführender Therapiekonzepte Kompetenzsteigerung (Empowerment) des Rehabilitanden im Umgang mit der Erkrankung durch Schulung und Entwicklung von CopingStrategien Präventive Maßnahmen Möglichst weitgehende Reintegration in das soziale und berufliche Umfeld (Implementierung von Case- und Caremanagement) Vermeidung bzw. Verminderung der Pflegebedürftigkeit Integration der Eltern/Familie im Sinne von Empowerment Im Folgenden sollen nun die beiden Hauptziele für die Kinder und Jugendlichen expliziert werden. Konzept der Entwicklungsaufgaben: Das Konzept der Entwicklungsaufgaben wurde erstmals von 1948 Robert J. Havighurst definiert (vgl. Mienert, 2008). Er postulierte, dass jede Person im Verlauf des Lebens immer wieder vor Problemstellungen/ Aufgaben steht, die es zu bewältigen gilt. Anders formuliert: Entwicklungsaufgaben sind Aufgaben/Problemstellungen, die sich alle Menschen im Rahmen der persönlichen Entwicklung und Reifung im Laufe ihres Lebens stellen und die es im Rahmen einer erfolgreichen, gesellschaftlichen Integration zu bewältigen gilt. Gelingt eine positive Bewältigung, führt dies zu einer Stabilisierung der Persönlichkeit. Wie diese Aufgabe bewältigt wird, wird durch verschiedene, aufeinander einwirkende Faktoren beeinflusst: Diese umfassen innere Faktoren (z.B. individuellen Anlagen einer Person) und äußere Faktoren (physische oder soziale Umwelt). Die zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben sind für unterschiedliche Altersgruppen/ Lebensabschnitten verschieden. Die Festlegung dieser Aufgaben, die die Gesellschaft an den Einzelnen stellen, ist normativ, jedoch sind die Altersgrenzen für die Entwicklungsaufgaben eher als deskriptives, variables Element dieses Konzeptes zu verstehen. Ebenso variiert der Grad der normativen Verpflichtung: einige Entwicklungsaufgaben sind als Angebote mit Empfehlungscharakter zu verstehen, Seite 5 von 40 andere sind durch Sanktionen gestützte Forderungen. Nicht alle Aufgaben sind jedoch vorgegeben, ein Teil setzt sich aus persönlichen Zielen und Projekten (z.B. Gestaltung einer Partnerschaft) zusammen. Im Folgenden sind die Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit, des mittleren Kindesalters und des Jugendalters angeführt. Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit (bis 6 Jahre) nach Dreher und Dreher (1985): Gehen lernen Lernen, feste Nahrung aufzunehmen Sprechen lernen Lernen, Körperausscheidungen zu kontrollieren Geschlechtsunterschiede und sexuelles Schamgefühl erlernen Begriffsbildung und Spracherwerb zur Beschreibung sozialer und physikalischer Realität Bereit werden für das Lesen lernen Zwischen „richtig“ und „falsch“ unterscheiden lernen und Beginn der Gewissensentwicklung Entwicklungsaufgaben des mittleren Kindesalters (ca. 6 - 12 Jahre) nach Dreher und Dreher (1985): Erlernen körperlicher Geschicklichkeit, die für gewöhnliche Spiele notwendig ist Aufbau einer positiven Einstellung zu sich als einem wachsenden Organismus Lernen mit Altersgenossen zu Recht zu kommen Erlernen eines angemessenen männlichen/ weiblichen sozialen Rollenverhaltens (Geschlechtsrollenidentifikation) Entwicklung grundlegender Fertigkeiten in den Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen etc.) Entwicklung von Konzepten und Denkschemata, die für das Alltagsleben notwendig sind (=Konkrete Operationen) Entwicklung von Gewissen, Moral und einer Werteskala Erreichen persönlicher Unabhängigkeit Entwicklung von Einstellungen gegenüber sozialen Gruppen und Institutionen Seite 6 von 40 Entwicklungsaufgaben des Jugendalters (ca. 12. - 18. Lebensjahr) nach Dreher und Dreher (1985): Aufbau eines Freundeskreises Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung Erwerb einer Geschlechtsrolle Aufnahme engerer Beziehungen, Sexualität Ablösung vom Elternhaus Berufswahl und Ausbildung Entwicklung von Vorstellungen über Partnerschaft und Familie Sich selbst kennen lernen und wissen, wie andere einen sehen Klarheit über sich selbst finden Entwicklung einer eigenen Weltanschauung, eines eigenen Wertesystems Entwicklung einer Zukunftsperspektive, eines Lebensplans Kinder und Jugendliche mit psychopathologischen Symptomen haben erschwerte Voraussetzungen die Entwicklungsaufgaben angemessen zu bewältigen. Psychischeund Entwicklungsprobleme Entwicklungsaufgaben können sein. Fallen aber auch jedoch zu Ausdruck viele nicht bewältigter Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten aus, kann dies zu Entwicklungsstörungen führen sowie zum Auftreten psychopathologischer Symptome. In diesem Sinne können manche psychopathologische Symptome auch als Reaktionsmuster interpretiert werden, die eine Überforderung in der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben zeigen. Für Kinder und Jugendliche, die sich bereits in kinder- bzw. jugendpsychiatrischer Behandlung befinden, stellt die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben eine besondere Herausforderung dar. Zusätzlich stehen diese auch noch vor der Herausforderung ihre psychischen Probleme zu bewältigen. Es ist also vielfach eine Entwicklungsunterstützung notwendig. Gesundheitsbezogene Lebensqualität In neueren Definitionen von Gesundheit und Krankheit findet sich neben der Berücksichtigung der körperlichen Dimension stets auch die Berücksichtigung der psychosozialen Dimension (vgl. Nitzko & Seiffge-Krenke, 2009). Zu letzteren lassen sich die Begriffe Lebensqualität“ Seite 7 von 40 „subjektives zuordnen (vgl. Wohlbefinden“ Ravens-Sieberer, bzw. „gesundheitsbezogene Thomas & Erhart, 2003). Gesundheitsbezogene Lebensqualität wird als multidimensionales Konstrukt aufgefasst, das „… körperliche, emotionale, mentale, soziale, spirituelle und verhaltensbezogene Komponenten des Wohlbefindens und der Funktionsfähigkeit (des Handlungsvermögens) aus der subjektiven Sicht des Betroffenen“ (Schumacher, Klaiberg & Brähler, 2003, S. 2) in relevanten Lebensbereichen beinhaltet. Für Kinder bzw. Jugendliche betrifft dies beispielsweise das subjektive Wohlbefinden hinsichtlich der Situation in der Schule, der Familie oder der Freizeit. Seite 8 von 40 2. ZUWEISUNGSKRITERIEN 2.1 Voraussetzungen MAS-Diagnose Im Sinne eines in deutschsprachigen Ländern bestehenden Standards ist eine Diagnose nach dem 6-Achsigen Multiaxialen Klassifikationsschema nach ICD10 (Remschmidt et al, 2001) zu stellen. Reha-Bedürftigkeit Feststellung anhand standardisierter Testverfahren (Quality of Life, OutcomeMeasures etc.) Beschreibung der subjektiven Lebens-Gesundheitssituation und dem ICF Reha-Ziele Kooperative Festlegung zwischen PatientIn, Eltern/Obsorgeträger und Klinik Grundlage Diagnosen und Reha-Bedürftigkeit (ICF) Reha-Fähigkeit Wird verstanden als Einschätzung der Beeinflussbarkeit und Veränderbarkeit einer subjektiven Situation in Bezug auf ein vorhandenes Reha-Ziel Reha-Motivation Wird als wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Reha angesehen und sollte sowohl auf persönlicher als auch familiärer Basis erhoben werden und vorhanden sein Reha-Prognose Prognostische Zusammenschau von Rehab-Diagnose, -Bedürftigkeit, Motivation und -Fähigkeit, -Zielsetzung und theoretischer Erreichbarkeit Seite 9 von 40 2.2 Indikationen im Kindes- und Jugendalter Bevor auf das Indikationenspektrum eingegangen wird soll auf das verwendete Instrumentarium eingegangen werden. Diagnosen gegenüber erlebt man ganz unterschiedliche Bewertungen. Das Spektrum reicht von einer positiven Einstellung, die davon ausgeht, dass Diagnosen handlungsleitend und daher notwendig sind, über ambivalente Einstellung bis zur offenen Ablehnung. Dabei wird häufig Skepsis betreffend die Relevanz von Diagnosen ausgedrückt und auf die Gefahr des „labelings“ hingewiesen. Dazu ein Zitat von D.P. Cantwell 1996: „… it is now recognized, that the so called harmful effects of classification of psychopathology results from abuse of the system and not from the classification system per se“. Funktionen von Diagnosen Mit der zunehmenden Verfeinerung und empirischen Begründung der diagnostischen Systeme, kommt den Diagnosen eine ordnende Funktion zu. Darüber hinaus ist die kommunikative Funktion festzuhalten, die uns erst ermöglicht, Beobachtungen und Befunde in sehr verkürzter Form auszutauschen. Letztlich fußen der Behandlungsplan wie auch Prognosen – und dies sei hier besonders hervor gestrichen – auf reliablen und validen Diagnosen. Grundprinzipien der Diagnostik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Im Folgenden sollen Grundprinzipien der Kinder- und Jugend(neuro)psychiatrie stichwortartig aufgelistet werden (W. Spiel & G.Spiel, 1987): Ganzheitlicher Erklärungs- und Verstehensansatz von Symptomatik Berücksichtigung des biopsychosozialen Modells Berücksichtigung des Entwicklungsgedankens in der Genese von Problemlagen Berücksichtigung von Struktur- und Systemgegebenheiten des Kontexts Dimensionale Betrachtungsweise von Symptomatiken Individuumsbezogener Krankheitsbegriff Methodenpluralismus Vor diesem konzeptionellen Hintergrund und den damit verbundenen Anforderungen muss eine umfassende, diagnostische Klassifikation häufig Stückwerk bleiben: Die komplexen Verschränkungen von ätiologischen Faktoren einerseits und devianten Seite 10 von 40 Entwicklungsprozessen andererseits, die zu einer bestimmten Symptomatik im Erleben und Verhalten führen, können vielfach nicht vollständig aufgeklärt werden. Eine nosologisch-diagnostische Klassifikation sollte aber zumindest so weit führen, dass auf der Basis einer hochwahrscheinlichen Hypothese Interventionsschritte geplant werden können. Überblick über gebräuchliche, deskriptive diagnostische Systeme: International sind derzeit folgende Systeme gebräuchlich: die Internationale Klassifikation der Erkrankungen, Version 10 (ICD-10; WHO, 1992) das Multiaxiale Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindesund Jugendalters nach ICD-10 (Remschmidt et al., 2001) die Internationale Klassifikation von Funktionen (ICF; WHO, 2001) das Diagnostisches und statistisches Manual der American Psychiatric Association, Version IV (DSM-IV; American Psychiatric Association 1994) Im deutschsprachigen Raum spielt die DSM-IV im Vergleich zur ICD-10 eine untergeordnete Rolle. Im kinder- und jugend(neuro)psychiatrischen Bereich hat sich seit den 1970er Jahren die Verwendung von multiaxialen Schemata durchgesetzt Es sei hervorgehoben, deskriptiven/operationalen dass Zugang alle haben. die genannten Systeme einen Die dadurch ermöglichte, reliable Erfassung von Krankheitszeiten ist sicherlich ein Vorteil, andererseits bilden diese Systeme nur das vordergründig Vorhandene und Beobachtbare ab und weisen Schwächen im Hinblick auf die Ursachenabklärung auf. Die überwiegende Mehrzahl von psychischen Erkrankungen jedoch ist nicht unikausal determiniert, sondern - und das wird ja auch durch das Begriffskonstrukt des biopsychosozialen Modells ausgedrückt - durch eine ursächlich wirkende Verschränkung von biologischen, sozialen und lebensgeschichtlichen Aspekten. Wesentlich ist bei allen Überlegungen, zwischen Diagnosen auf der einen Seite, und Symptomen und Funktionseinschränkungen auf der anderen Seite zu unterscheiden. Symptome sind sozusagen als Bausteine von Diagnosen aufzufassen. Sie sind das, was man vorerst wahrnimmt oder erfährt, isoliert oder in Kombination. Einzelsymptome sind kaum je konstitutiv für eine bestimmte Diagnose, erst wenn Symptome in einer besonderen Ausprägung über einen bestimmten Zeitraum und in Seite 11 von 40 einer bestimmten Kombination gemeinsam auftreten, können sich solche Symptomcluster zu Diagnosen verdichten. Demgegenüber bezieht Funktionsdiagnostik bei der Merkmalsbeschreibung immer auch ein konkretes Ziel, dass es zu erreichen gilt, mit ein – z. B. ein gewisses, soziales Funktionsniveau. Idente Symptome, wie Funktionseinschränkungen, können sich in der Gestalt unterschiedlicher Diagnosen wieder finden. Symptome können sich derart kumulieren, dass sie zwar zu relevanten Funktionsbeeinträchtigungen (vor allem im interaktionellen sozialen Bereich) führen, jedoch keine Diagnose nach sich ziehen, da nicht der jeweilige spezifische Symptomenmix und Ausprägungsgrad für die Vergabe einer Diagnose besteht. Was damit ausgedrückt werden soll ist, dass neben den deskriptiven Diagnosen individuelle Symptomkonstellationen und Funktionsbeeinträchtigungen bei Hilfeplanungen mit zu berücksichtigen sind. In der Kinder- und Jugend(neuro)psychiatrie wurden bereits in den 70-er Jahren multiaxiale diagnostische Klassifikationsschema (MUAX) eingeführt das sich in folgende Achsen differenziert, wobei der Achse VI eine besondere Stellung zukommt (siehe weiter unten): Achse I: klinisch-psychiatrisches Syndrom Achse II: umschriebene Entwicklungsstörungen Achse III: Intelligenzniveau Achse IV: körperliche Symptomatik Achse V: aktuelle, abnorme, psychosoziale Umstände Achse VI: Globalbeurteilung der psychosozialen Anpassung Die ICF-Systematik wiederum widmet sich zwei Aspekten, einerseits den so genannten Lebensfunktionen, andererseits der Partizipation. Diese Grundkonzeption ist aus folgender Abbildung ersichtlich: Seite 12 von 40 Abbildung: biopsychosoziale Grundkonzeption der ICF Im Bereich der psychosozialen Hilfe für Kinder und Jugendliche ist die ICF ein wichtiger weiterer Beitrag zur Indikationsstellung und Hilfeplanung. Es ergänzt sich besonders gut zur Beschreibung sozialer Teilhabe im Kontext von Behinderungen. In diesem Sinne ist sie als Ergänzung des stärker phänomenologisch ausgerichteten, und primär defizitorientierten MUAX zu würdigen. Für eine interdisziplinäre Hilfeplanung bieten sich insbesondere über die Achse VI des MUAX, welche eine Globalbeurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus ermöglicht, Anknüpfungspunkte zur ICF an. Berücksichtigung weiterer Aspekte( siehe dazu auch weiter oben): Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass, obwohl das an dieser Stelle angeregte Diagnosekonzept umfassend und komplex ist, wichtige Aspekte weiterhin nicht integriert sind, nämlich einerseits entwicklungsaufgabenbezogene, funktionelle, beziehungs-(insbesondere familien-) und psychodynamische Aspekte. Auf diese Aspekte sollte abschließend eingegangen werden. Die Entwicklungspsychologie, respektive –psychopathologie und die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD, 2004) bieten hierfür den Bezugsrahmen. Unter Entwicklungsaufgaben versteht man nach Havighurst solche Anforderungen, die sich in allen Entwicklungsphasen des Menschen mehr oder weniger in ähnlicher Form stellen und die durch den Reifungsprozess einerseits und gesellschaftlich sozialen Anforderungen andererseits entstehen. Seite 13 von 40 Es ist daher leicht möglich, für jede Entwicklungsaufgaben zu formulieren. Die Altersphase die spezifischen Entwicklungsaufgaben dienen als Leitfaden für das Verhalten und die Entwicklung sozial verantwortungsvollen Handelns. Gerade unter dieser Systematik fällt es leicht unter Berücksichtigung der oben angeführten deskriptiven Diagnostik fördernde und hemmende Bedingungen für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben zu orten. Gerade aus dem Umstand heraus, dass die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben nicht nur durch aktuelle interpersonelle Konflikte gehindert werden, sondern, dass in diesem Zusammenhang auch intrapersonelle Konstellationen mit bedacht werden müssen, bietet sich als Ergänzung – sozusagen als eine weitere Verständnisebene – die Psychodynamische Diagnostik in der Form der OPD an. Dieses System gründet in einem tiefenpsychologischen Theoriengebäude und versucht dessen Schwächen wie etwa die Unschärfe psychoanalytischer Begriffe, die wechselnden Bewertungen von Theorienaspekten, aber auch die fehlende Validierung psychoanalytischer Theorien - zu überwinden. Das aus der diagnostischen und therapeutischen Situation, aber auch aus der Anamnese stammende Material und die Beobachtungen und Wahrnehmungen sollen so systematisiert werden, dass eine Aussage über folgende Bereiche möglich wird: Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen, Beziehung, Konflikte, Strukturen, wobei die Themen in Zusammenhang mit Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen sowie Beziehungen durchaus auch ohne Bezug auf tiefenpsychologische Theorien behandelt werden können. Für die Systematisierung der innerpsychischen Konflikte und der Beschreibung psychischer Struktur ist eine Referenzierung auf tiefenpsychologische Modelle jedoch notwendig. Unter Konflikt ist ein intrapsychischer, unbewusster, respektive vorbewusster, der zeitlich überdauernd wirkt und entwicklungshemmend ist, sowie Einfluss auf die Beziehungsgestaltung hat, zu verstehen. Folgende Entwicklungsdimensionen lassen sich dabei voneinander abgrenzen: Abhängigkeit versus Autonomie, Unterwerfung versus Kontrolle, Versorgung versus Autarkie, Selbstwertkonflikte (narzisstische Konflikte), Über-Ich- und Schuldkonflikte respektive Loyalitätskonflikte, ödipal-sexuelle Konflikte, Identitätskonflikte. Seite 14 von 40 Nicht nur die Identifizierung solcher habitueller Konflikte ist notwendig, sondern auch die Zuordnung dieser Konflikte zu verschiedenen Lebensbereichen, wie Familie, Peer-Group und Gleichaltriger. Zusammenfassung und Ausblick: Die dargestellten Diagnose- und Klassifikationssysteme sind historisch in unterschiedlichen Handlungsfeldern als Arbeitsbehelfe etabliert worden. Das MUAX bzw. die dahinterliegende ICD-10 traditionell im klinischen Bereich(siehe weiter unten), die OPD im psychodynamischen Therapiefeld und die ICF bereits sehr stark vor dem Hintergrund Entwicklungsaufgabenmodell interdisziplinärer stammt aus Kooperationserfordernisse. der Entwicklungspsychologie. Das Die Entwicklungspsychopathologie aus der Vernetzung entwicklungspsychologischer und kinder- und jugendpsychiatrischer Konzepte. Erste Ansätze zu einer sinnvollen Kombination dieser Systeme im Sinne einer multimodalen Therapieplanung haben sich in den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendarbeit bereits durchgesetzt. Wichtig wird es sein, die Anwendung der Instrumente im Sinne eines ganzheitlichen Zugangs zu den PatientInnen/ KlientInnen weiter zu fördern, wobei insbesondere interdisziplinäre Weiter und Fortbildungen geeignet erscheinen. Seite 15 von 40 Orientierungshilfe zur multiaxialen Klassifikation psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter/1 Erste Achse: Klinisch-psychiatrisches Syndrom 00.0 keine psychiatrische Störung F0 Organische einschließlich symptomatischer psychischer Störungen F07.0 Organische Persönlichkeitsstörung F2 Schizophrenie, schizotype u. wahnhafte Störungen F32 Depressive Episode F32.0 Leichte… F42.0 Vorwie Zwang F20 Schizophrenie F32.1 Mittelgradige… F42.1…Zwan F20.0 Paranoide Schizophrenie F32.2 Schwere…ohne psychotische Symptome F42.2 Gemisc F20.1 Hebephrene… F20.2 Katatone… F20.3 Undifferenzierte F20.4 Postschizophrene Depression F20.5 Schizophrenes Residuum F32.3 F07.1 F07.2 F1 Postenzephalitisches Syndrom Organisches Psychosyndrom nach SHT Psychische u. Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen F1x.0 Akute Intoxikation F1x.1 Schädlicher Gebrauch F1x.2 Abhängigkeitssyndrom F33 …..mit Delir F1x.5 Psychotische Störung F 1x6 Anamnestisches Syndrom F1x.7 Restzustand u. verzögerte psychotische Störung Anhaltende affektive Störungen F34.0 Zyklothymia F 20.6 Schizophrenia simplex F34.1 Dysthymia F21 F4 Neurotische, Belastungs- u. somatoforme Störungen F23 F24 Seite 16 von 40 Rezidivierende depressive Störungen F34 F22 F1x.4 Schwere…mit psychotischen Symptomen Schizotype Störung Anhaltende wahnhafte Störungen Vorübergehende akute psychotische Störungen Induzierte wahnhafte Störung F40 Phobische Störungen F40.0 Agoraphobie F40.1 Soziale Phobien F40.2 Isolierte Phobien F25 Schizoaffektive Störungen F41 Andere Angststörungen F3 Affektive Störungen F41.0 Panikstörungen F41.1 F30 Manische Episode Generalisierte Angst F41.2 F31 Bipolare affektive Störung Angst u. depressive Störung F41.3 Andere gemischte Angst F42 F43 Zwang Reaktio Belastu Anpass F43.0 Akute B reaktion F43.1 Posttra Belastu F43.2 Anpass F44 Dissozi Störung F45 Somato Störung F5 Verhal fälligke körper Störun Faktor F50 Essstör F50.0 Anorex F50.1 Atypisc n. F50.2 Bulimia F50.3 Atypisc n. F50.4 Essatta andere ischen sive e F42 Zwangsstörungen F51 Nichtorganische Schlafstörungen … F42.0 Vorwiegend Zwangsgedanken F51.0 …Insomnie adige… F42.1…Zwangshandlungen F51.1 …Hypersomnie e…ohne tische me F42.2 Gemischt F51.2 ..Störung des Schlaf-WachRhythmus e…mit tischen men ierende sive gen nde affekrungen F43 F43.0 Akute Belastungsreaktion F51.4 Pavor nocturnus F52 Sexuelle Funktionsstörung nicht organisch oder krankheitsbedingt F53 Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett F54 Psychische Faktoren oder Verhaltenseinflüsse bei andernorts klassifizierten Erkrankungen F55 Missbrauch von Substanzen, die keine Abhängigkeit hervorrufen F6 Persönlichkeits- u. Verhaltensstörung F60 Spezifische Persönlichkeitsstörung F43.2 Anpassungsstörung F44 ische, ungs- u. oforme gen F51.3 Schlafwandeln F51.5 Alpträume F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung ymia mia Reaktion a. schwere Belastungen u. Anpassungs Dissoziative Störungen F45 Somatoforme Störungen F5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen u. Faktoren F50 Essstörungen che gen hobie Phobien e Phobien Angsten örungen lisierte F50.0 Anorexia nervosa F50.1 Atypische Anorexia n. F50.2 Bulimia nervosa F50.3 Atypische Bulimia n. F60.0 Paranoide… F50.4 Essattacken bei anderen psychischen Störungen . depretörung F60.1 Schizoide… F60.2 Dissoziale… gemAngst Seite 17 von 40 Orientierungshilfe zur multiaxialen Klassifikation psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter/2 Erste Achse: Klinisch-psychiatrisches Syndrom F60.3 Emotional instabile… F66 Psychische u. Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung u. Orientierung F66.0 Sexuelle Refungskrisen F68 Andere… F68.0 Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen F60.4 Histrionische… F60.5 Anankastische… F60.6 Ängstliche F60.7 Abhängige… F61 F63 Kombinierte u. andere Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Erkrankung des Gehirns Abnorme Gewohnheiten u. Störungen der Impulskontrolle Hype Störu F90.0 Einfa Aufm F90.1 Hype des S F91 Störu Sozia F84 Tiefgreifende… F91.0 Auf d Rahm F84.0 Frühkindlicher Autismus F91.1 …be Bindu F91.2 …be sozia F91.3 …mit Verha F92 Komb Sozia Emot F92.0 …mit Störu F93 Emot des K F93.0 Mit T F93.1 Phob F84.1 Atypischer… F63.2 …Stehlen F84.2 Rett-Syndrom F63.3 Trichotillomanie F84.3 Andere desintegrative Störung des Kindesalters Störungen der Geschlechtsidentität F84.4 F64.2 …des Kindesalters Störungen der Sexualpräferenz F84.5 Seite 18 von 40 F90 Entwicklungsstörung F63.1 …Brandstiftung F65 Verh emot mit B Kind F8 F63.0 Pathologisches Glücksspiel F64 F9 Hyperkinetische Störung mit Intelligenzminderung u. Bewegungsstereotypien Asperger-Syndrom Vergen in it der wicklung g F9 F93.2 …mit sozialer Überempfindlichkeit F93.3 …mit Geschwisterrivalität F94 Störung sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit u. Jugend F94.0 Elektriver Mutismus F94.1 Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters m.Enthemmung F95 Ticstörungen F95.0 Vorübergehende… …bei fehlenden sozialen Bindungen F95.1 Chronische, motorische oder vokale… …bei vorhandenen sozialen Bindungen F95.2 Kombinierte … (Tourette-Syndrom) …mit oppositionellem Verhalten F98 Andere… Kombinierte Störung des Sozialverhaltens u. der Emotionen F98.0 Enuresis F98.1 Enkopresis F92.0 …mit depressiver Störung F98.2 Fütterungsstörung im frühen Kindesalter F93 Emotionale Störungen des Kindesalters F98.3 Pica F98.4 Stereotype Bewegungsstörung F98.5 Stottern F98.6 Poltern F90 Verhaltens- u. emotionale Störung mit Beginn in der Kindheit u. Jugend Hyperkinetische Störungen n örperme aus Gründen sstörung … egrative indes- he telligenzBewegien F90.0 Einfache Aktivitäts- u. Aufmerksamkeitsstörung F90.1 Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens F91 Störung des Sozialverhaltens F91.0 Auf den familiären Rahmen beschränkte… F91.1 F91.2 F91.3 F92 drom F93.0 Mit Trennungsangst F93.1 Phobische Störung Seite 19 von 40 3. BEDARFSSCHÄTZUNG UND STRUKTURIERUNG DER REHA 3.1 Bedarfsschätzungen Aufgrund des nahezu völligen Fehlens von Gesundheitsdaten über Kinder und Jugendliche in Österreich existieren auch keine Bedarfszahlen für die Rehabilitation psychisch kranker Kinder und Jugendlicher. Daher werden an dieser Stelle Schätzversuche anhand (a) stationärer sowie(b) ambulanter Berechnungen und (c) einer österreichweiten Befragung angeführt und diese dann (d) mit Zahlen aus der Deutschland verglichen. a) Berechnung anhand stationärer Zahlen der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg Diese Bedarfsberechnung wurde aus Daten der stationären Betreuung an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg vorgenommen. In den Jahren 2005-2007 wurden 726 Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre) behandelt. In einer retrospektiven Analyse wurde bei 92 (12,2%) Kindern und Jugendlichen (31 m, 61 w) eine Indikation für eine nachstationäre Rehabilitation gestellt. Von diesen waren 17 (18,5%) durch eine Jugendwohlfahrts-Einrichtung wohnversorgt. Die Indikationen ließen sich in drei große Gruppen teilen: Gruppenbildung nach Indikationen Prozentuale Verteilung Psychiatrische Erkrankungen im engeren Sinne 46% Störungen des Sozialverhaltens, 43% Persönlichkeitsentwicklungsstörungen Suchterkrankungen, Essstörungen 11% Es muss einschränkend festgehalten werden, dass insbesondere im Suchtbereich (Alkohol und Drogen) der Bedarf sicher höher anzusetzen ist, da die Salzburger Kinder- und Jugendpsychiatrie keine primäre Behandlungsstation für Suchtkranke ist. Wieder auf das Bundesland Salzburg (ca. 530.000 Einwohner laut Statistik Austria, 2009) bezogen: Ausgehend von den genannten 92 Kindern und Jugendlichen innerhalb von 3 Jahren, bedeutet dies im Schnitt pro Jahr 31 Kinder und Jugendliche. Seite 20 von 40 Bei einer geschätzten durchschnittlichen Verweildauer von 6 Monaten wären das ca. 15 Plätze pro Jahr für Salzburg. Hochgerechnet auf ganz Österreich wären das 237 Betten. Anzumerken ist bei dieser Schätzung – im Gegensatz zu den folgenden Schätzungen –, dass hier von einer Verweildauer von 6 Monaten (im Gegensatz zu den üblichen 35 Tagen) ausgegangen wird. Dies hängt mit dem speziellen PatientInnenstamm der Klinik zusammen. Allgemein lässt sich festhalten, dass die notwendige Verweildauer in der REHA im Bereich Mental Health sehr abhängig von den Diagnosen der Kinder und Jugendlichen ist. Dies muss bei der Bedarfsschätzung und der Strukturierung der verschiedenen REHA-Formen mit bedacht werden. b) Berechnung aus ambulanter Betreuung am Beispiel von pmkijufa (Kärnten) Kärnten ist im ambulanten Bereich relativ gut versorgt (2 Ambulatorien und 1 Ambulanz im Krankenhaus auf 560.000 Einwohner laut Statistik Austria, 2009). Daher haben wir hier die Anzahl der Neuaufnahmen für das Jahr 2009 erfragt, um möglichst aktuelle Zahlen als Datenbasis zu haben. Wir versuchen somit die Unterversorgung durch die Hochrechnung von einem gut versorgten Bundesland auf GesamtÖsterreich zu korrigieren. Hochrechnung - Bedarf nach einem Reha-Platz in Kärnten: 683 Kinder und Jugendliche wurden in Kärnten im Jahr 2009 im ambulanten Bereich neu aufgenommen 4% (Mittelwert) der 683 Kinder und Jugendlichen hatten schätzungsweise einen Bedarf nach Reha; d.h. 27 Kinder und Jugendliche (Range (M±SD): 0% bis 9%; d.h. 0 bis 61 Kinder und Jugendliche); Bettenanzahl (bei einer geschätzten Verweildauer von 35 Tage wie in Deutschland; d.h. Verhältnis Bettenanzahl zu Kindern/ Jugendlichen: 0,96): 3 Betten (Range (M±SD): 0% bis 9%; d.h. 0 bis 6 Betten) Hochrechnung - Bedarf nach einem Reha-Platz in Österreich: Grundlage: Einwohner in Österreich: 8.384.000 (Statistik Austria; 2009; gerundet) Einwohner in Kärnten: 560.000 (Statistik Austria; 2009; gerundet); d.h. 6.68% aller österreichischen Einwohner leben in Kärnten Seite 21 von 40 Berechnung: Kinder und Jugendliche, die schätzungsweise pro Jahr in Österreich im ambulanten Bereich vorstellig werden = (Summe der Kinder- und Jugendlichen, die in Kärnten vorstellig wurden) * (14,971; Verhältnis Einwohner Österreich – Kärnten) Bedarf: 10225 Kinder und Jugendliche wurden schätzungsweise im Jahr 2009 in Österreich im ambulanten Bereich vorstellig 4% (Mittelwert) davon hatten schätzungsweise einen Bedarf nach Reha; d.h. 409 Kinder und Jugendliche (Range (M±SD): 0% bis 9%; d.h. 0 bis 920 Kinder und Jugendliche) Bettenanzahl (35 Tage Verweildauer; d.h. Verhältnis Bettenanzahl zu KiJu: 0,96): 39 Betten (Range (M±SD): 0% bis 9%; d.h. 0 bis 88 Betten) D.h.: Der Bedarf für ganz Österreich (berechnet aus den Ambulanzen in Kärnten) ergäbe 39 Reha-Plätze im Bereich Mental Health bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 35 Tagen. c) Berechnung anhand einer Umfrage an den österreichischen Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Mental Health durch pmkijufa Wir beziehen uns bei dieser Schätzung auf Zahlen aus einer Befragung im April 2010. Wir haben hierzu einen kurzen Fragebogen an stationäre und ambulante Einrichtungen in Österreich geschickt, mit der Bitte uns rückzumelden, wie viele Kinder und Jugendliche im April betreut wurden und wie viele davon einen Bedarf nach einem Reha-Platz hätten. Auf Basis der Rückmeldungen (nur aus dem stationären Bereich) und unter Korrektur der Ausreißer haben wir Schätzungen für den Bedarf in Österreich vorgenommen. Datenlage: 5 Rückmeldungen aus 5 Bundesländern 289 Kinder bzw. Jugendliche wurden dort im Monat April 2010 stationär betreut Bedarf nach einem Reha-Platz: 32% bis 51% der Kinder und Jugendlichen, die im April 2010 betreut wurden (Mittelwert (=M): 40%; Standardabweichung (=SD): 7%; Range (M±SD): 33% bis 47%) Seite 22 von 40 Da zwei außerhalb des Ranges lagen (Bedarf bei 32% bzw. 51%), wurden diese für die weitere Berechnung ausgeschlossen. Der Mittelwert für die weitere Berechnung liegt nun bei 39%, die Standardabweichung bei 2%. Gesamtzahl der Betten in Österreich (ÖSG 2008; Stand 2007): 347 Betten inkl. An manchen Standorten Neurobetten (17 in Wien, 12 in Kärnten) aber: in 7 Bundesländern liegt eine Unterversorgung vor (Range: 10 bis 43 Betten Unterversorgung). Diese wurde in der vorliegenden Berechnung nicht korrigiert. Bedarf an einem Reha-Platz in Österreich laut der Befragung aus dem stationären Bereich: 39% (entspricht Mittelwert des Bedarfs) von 347 Betten = 135 Betten als Bedarf für Reha-Plätze im Bereich Mental Health (Range (M±SD): 37% von 347 Betten = 128 Betten; 41% von 347 Betten = 142 Betten)1 D.h.: Der Bedarf für ganz Österreich (berechnet aus stationären Zahlen aus fünf österreichischen Bundesländern) ergäbe 135 Reha-Plätze im Bereich der Mental Health bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 35 Tagen. d) Berechnung nach Zahlen aus Deutschland Wir beziehen uns bei dieser Schätzung auf Zahlen aus Deutschland aus dem Jahre 2008, die aufzeigen, wie vielen Kinder und Jugendliche durch die Rentenversicherung bzw. Krankenversicherung ein Rehabilitationsplatz gewährt wurde und wie viel Prozent davon in den Bereich „Psyche“ fielen. Dabei betrug die durchschnittliche Verweildauer 35 Tage. Für das Jahr 2009 lagen bei der Verfassung dieses Papers noch keine Zahlen vor. Unter der Annahme, dass in Österreich der Bedarf an RehaPlätzen und die Verweildauer in etwa dieselben sind wie in Deutschland, haben wir 1 Um eine genauere Schätzung des Bedarf für das Jahr 2010 zu erhalten, könnte man aus dem Bericht der ÖSG 2008 den Planungshorizont für 2010 bzgl. der Bettendichte heranziehen. Gemessen an der Anzahl der Einwohner in Österreich wären dies als untere Grenze (0,06 pro 1000 Einwohner) 503 Betten, die für Kinder und Jugendliche im akut stationären kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich zur Verfügung stehen sollten - als obere Grenze (0,10 pro 1000 Einwohner) 838 Betten. Unter der Annahmen, dass auch bei einer Vollversorgung in Österreich der erhobene Mittelwert von 39% bzgl. des Bedarfs nach einem Reha-Bett besteht sowie dass die ambulante Versorgung dem derzeitigen Stand entspricht, würde dies mindestens 196 Betten (=untere Grenze; d.h. 39% von 503 Betten) bzw. maximal 327 Betten bedeuten (=obere Grenze; d.h. 39% von 838 Betten). Seite 23 von 40 bei der Schätzung lediglich die unterschiedliche Einwohnerzahl von Österreich und Deutschland berücksichtigt. Grundlage der Berechnung: Einwohnerzahl Deutschland: 81.757.600 Einwohnerzahl Österreich: 8.383.784; daraus berechnet sich das Verhältnis Einwohnerzahl Deutschland – Österreich = 9,752:1 Anzahl der Kinder und Jugendliche, die laut Renten- und Krankenversicherung einen Rehaplatz im Jahr 2008 bekommen haben: 57568 Kinder und Jugendliche in Deutschland o d.h. umgerechnet auf die Größe von Österreich: 5.904 Kinder und Jugendliche. Davon fielen in Deutschland 22% in den Bereich Psyche. o D.h. umgerechnet auf die Größe von Österreich: 1.299 Kinder und Jugendliche hätten einen Bedarf auf einen Rehaplatz im Bereich „Psyche“ Anzahl der Betten, die in Deutschland für die Reha von Kindern und Jugendlichen belegt waren: 5.520 Betten in Deutschland o D.h. umgerechnet auf die Größe von Österreich: 566 Betten Davon fielen in Deutschland 22% in den Bereich „Psyche“ o D.h. umgerechnet auf Österreich: 125 Betten wären der Bedarf nach Reha-Plätzen im Bereich Mental Health. Seite 24 von 40 Zusammenfassung der Schätzungen: Quelle geschätzter Bedarf für den Bereich Mental Health Berechnung aus einer Erhebung in einer 237 Betten für Österreich Station (Salzburg) (6 Monate Verweildauer) Berechnung aus der Erhebung in 2 174 Betten für Österreich Ambulatorien (Kärnten) und (35 Tage Verweildauer) einer österreichweiten Umfrage im Ambulanter Bereich: 39 Betten für Österreich stationären Bereich Stationärer Bereich: 135 Betten für Österreich Berechnung nach Erfahrungswerten aus 125 Betten für Österreich Deutschland : Hinweis: Es wurden auch Bedarfsschätzungen für den Bereich Mental Health seitens der ÖBIG (2010) vorgenommen, die aber letztendlich auch zu keiner konkreten Empfehlung hinsichtlich der Bettenanzahl kommen: „Aufgrund der auch unter den Experten/Expertinnen bestehenden erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich des exakten Bedarfs im Bereich „psychosoziale Rehabilitation“ (Bettenbedarfsschätzung zwischen 110 und 220 Betten) sind hier noch weiterführende Arbeiten erforderlich. Dies insbesondere in Richtung Monitoring des Bedarfs (auch unter Einbeziehung des ambulanten Bereichs) und Klärung der kompetenzrechtlichen Fragestellungen, sowie in Bezug auf Standards für Rehabilitationsstrukturen.“ (S.19). Unter Berücksichtigung dieser Diskrepanzen wird seitens der AG 4/ Rehabilitation des österreichischen Kindergesundheitsdialogs vorerst von 150 Betten/ Plätzen insgesamt als Planungsgrösse ausgegangen. Seite 25 von 40 3.2 Strukturierung Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass bei der Verwirklichung der REHA im Mental Health Bereich Differenzierungen bei den Angeboten durchzuführen sind. Die AG4/ Rehabilitation hat sich auf eine Strukturierung in 4 REHA-Typen geeinigt Tabelle: KONSENSUSSTATEMENT der AG 4/Rehabilitation betreffend Mental Health (MH) 2 Rehabilitation: SPEZIFIZIERUNG der MENTAL HEALTH (MH) REHA-BETTEN/PLÄTZE : 2 Die Diskussion wann vollstationäre oder ambulante(nach Sprachgebrauch der Sozialversicherungsträger) Angebote erforderlich sind ist noch nicht geführt und muss den lokalen/ regionalen Versorgungskontext berücksichtigen. Seite 26 von 40 4. QUALITÄTSSICHERUNG UND EVALUATION 4.1 Hintergrund Im Gesundheitsbereich wird der Nachweis von Effektivität (Ausmaß der Zielerreichung) und Effizienz (Verhältnis von Kosten und Nutzen) vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit und des ständig steigenden Kostendrucks immer bedeutsamer; die Forderung seitens der Stakeholder nach Transparenz, Qualitätssicherung und –entwicklung wächst stetig. Es herrscht zwar Einigkeit über die Notwendigkeit von Qualitätssicherung, jedoch finden sich keine allgemeinen Regelungen, wie diese konkret beschaffen sein sollte (Grawe & Braun, 1994; Merod & Petermann, 2006; Steinhausen et al., 2000). Orientierung hierfür können zwar Maßnahmen aus dem Profit-Bereich bieten, diese sind aber aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen nur eingeschränkt übertragbar (s. dazu auch Finsterwald & Spiel, 2010). Auch gibt es keine allgemeinen Standards zur Beurteilung des Behandlungserfolgs, Erfolgskriterien sind eingeschränkt und zum Teil nur langfristig erfassbar und es sind viele verschiedene Beurteilerperspektiven (Arzt/Ärztin, PatientIn etc.) zu berücksichtigen. Innerhalb der Europäischen Union gibt es im Rahmen der UEMS (European Union of Medical Specialists) und zwar konkret in der Sektion Child and Adoleszent „Psychiatry d.h. in der europäischen Fachärztegesellschaft Sektion Kinder und Jugendpsychiatrie Bestrebungen dahingehend, Standards und Strategien für die Sicherung von Qualität im Gesundheitswesen zu entwickeln. Diese Standards/ Strategien sollen als Empfehlungen für die europäische und nationale Gesundheitspolitik gelten. Im Rahmen eines CAP-Treffens der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Jahr 2009 wurden von der eingerichteten Working Group “Quality assurance in service delivery” folgende Ergebnisse festgehalten: “A multidimensional matrix to localise elements of Evaluation and Quality Assurance in CAP is needed. Following procedure to systematize the field was agreed upon. First: The complexity of this field should be illustrated and some general guiding principles should be defined. For instance all efforts in this field should focus on the benefit for the individual patient and his/her relative. Seite 27 von 40 Second: The general structural/organizational framework in which Quality Assurance is taking place should be mentioned, depicted and discussed. There must be on a meta-level to establish a quality assurance friendly atmosphere. Third: Distinctions should be systematically and transparently depicted. For instance a major distinction is the field in which Quality Assurance is taking place (inpatient or outpatient) or whether Quality Assurance is focusing the individual level or the institutional level. Fourth: There should be an agreement that standards of evaluation especially regarding the utility of the evaluation, the feasibility, the property (ethical aspects) and the accuracy have to be carefully monitored. Fifth: All evaluation should follow general guidelines. In child and adolescent psychiatry it is a matter of course that the multidimensional approach should be chosen, not only symptoms relive but also racing quality of life should be in the focus and the whole endeavour should be sensitive to the stakeholders. Six (but not least): Diagnostic and therapeutic pathways should be agreed upon; e.g. for developmental disorders with CAP comorbidity, epilepsy, ADHD etc. to mention a few.” (Budapest 22.08.2009; G. Spiel, S. Bailey, J. Hovland, Ch. Schaff, M. Tomori) 4.2 Anknüpfungspunkte Avedis Donabedian, ein renommierter Wissenschaftler der „School of Public Health, University of Michigan“, beschäftigte sich intensiv mit der Frage der Qualitätsmessung im Gesundheitswesen (Donabedian, 1988). Neben der generellen Frage, was Qualität überhaupt ist, gilt es zu klären, wer im Zentrum der Qualitätsbeurteilung stehen sollte (die Behandlerin/ der Behandler? der Eigenbeitrag der Patientin/ des Patienten? Die strukturellen Bedingungen vor Ort? Das Gesundheitssystems an sich?). Für eine Beurteilung der Qualität werden also Informationen (1) über strukturelle Bedingungen benötigt, innerhalb derer die Behandlung stattfindet, (2) über den Verlauf des Behandlungsprozesses und (3) über den Behandlungserfolg an sich. Um letzteres bestimmen zu können, müssen jedoch zuvor Indikatoren und (normative) Standards Seite 28 von 40 formuliert werden, zu denen es im Laufe des Behandlungsprozesses Informationen zu sammeln gilt. Nach Donabedian werden drei Dimensionen von Qualität unterschieden, die miteinander in Zusammenhang stehen und die bei der Bestimmung von Qualität immer gleichzeitig betrachtet werden sollen: 1) Strukturqualität: Diese kennzeichnen Merkmale des Settings, in dem die Maßnahmen stattfinden. Sie umfasst v.a. die Human Ressources (vorhandenes Personal, Qualifikationen/ Fähigkeiten der MitarbeiterInnen etc.), die Organisationsstruktur (Methoden des Peer-Reviews, Vergütung, etc.) sowie die entsprechenden materiellen Ressourcen (Einrichtung, technische Ausrüstungen, zur Verfügung stehende finanzielle Mittel, etc.). 2) Prozessqualität: Diese umfasst alle Aktivitäten, die im Behandlungsverlauf stattfinden. D.h. es wird betrachtet, welche Aktivitäten durchgeführt werden, die zur Zielerreichung geeignet und notwendig sind, und wie diese ausgeführt werden (z.B. Qualität der diagnostischen Einordnung und der durchgeführten Maßnahmen). Hier fließen auch Aktivitäten seitens der Patientin/ des Patienten zur Zielerreichung ein (z.B. Compliance). 3) Ergebnisqualität: Hierunter fallen die Behandlungseffekte (z.B. Verbesserung des Gesundheitszustands, der Arbeitsfähigkeit oder der Lebensqualität, Zufriedenheit der Patientin/ des Patienten, Fortschritte hinsichtlich der Psychoedukation). Die Differenz zwischen dem Eingangszustand und dem Ausgangszustand wird dabei betrachtet. In den folgenden Kapiteln soll nun dargestellt werden, welche Anforderungen aus Sicht der Qualitätssicherung an die REHA im Bereich Mental Health gestellt werden. Wir orientieren uns dabei an den drei Dimensionen von Donabedian. Die formulierten Standards sind derzeit noch für alle REHA-Typen formuliert und bedürfen in Folge noch einer Spezifizierung pro REHA-Typ. Bei der Aufstellung dieser orientierten wir uns an den QINC- bzw. QINMAC-Standards (Royal College of Psychiatrists, o.J.,ab), die im College Centre for Quality Improvement des Royal College of Psychiatrists im United Kingdom entwickelt wurden. Dieses College beschäftigt sich seit 2006 mit Qualitätssicherung im Mental Health Bereich im gesamten U.K. Seite 29 von 40 5. STRUKTURQUALITÄT Die Strukturqualität kennzeichnet Merkmale des Settings, in dem die Maßnahmen stattfinden. Sie umfasst v.a. die vorhandenen Human Ressources (vorhandenes Personal, Qualifikationen/ Fähigkeiten des Personals etc.), die Organisationsstruktur (Methoden des Peer-Reviews, Vergütung, etc.) sowie die entsprechenden materiellen Ressourcen (Einrichtung, technische Ausrüstungen, zur Verfügung stehende finanzielle Mittel, etc.). 5.1 Human Ressources Vorab sei angemerkt, dass es hinsichtlich der Einschätzung des Personalbedarfs wenig Zahlenmaterial, geschweige denn Standards gibt, wie diese zu berechnen sind. Es liegen lediglich Erfahrungswerte vor, auf Basis dessen die folgenden Einschätzungen gemacht wurden. Bei der Umsetzung der REHA-Einrichtung müssen diese Personalzahlen und der Berufsgruppenmix jedoch durch eine begleitende Evaluation kritisch überprüft und ggf. angepasst werden. Es ist durchaus denkbar dass im Bereich Typ 2 und 3 zusätzlich Ergo therapeutische Expertise erforderlich ist. Seite 30 von 40 In den verschiedenen REHA-Einrichtungen sollen Personen aus folgenden Berufsgruppen wie folgte vertreten sein (für den Typ I liegen bis dato noch keine Zahlen vor respektive werden diese im parallel erarbeiteten Leistungsprofil für eine Rehabilitation für Kinder und Jugendliche Sperl W. et al dargestellt*): REHA TYPEN TYP I (Noch zu klären, ev*) TYP II TYP III TYP IV 1:24 1:24 1:10 BERUFSGRUPPEN Arzt/ Ärztin PsychologIn PsychotherapeutIn Pflege/PädagogIn/SozialpädagogIn PhysiotherapeutIn plus ev Sport/ Gymnastiklehrer 1:24 1:24 in 2 oder 1 in 2 oder 1 integriert integriert 1:2 1:2 1:10 1:10 1:3 1:40 ErgotherapeutIn 1:10 LogopädIn 1:50 DiätassistentIn 1:25 DiätassistentIn (Essstörung) 1:50 MTF 1:45 SozialarbeiterIn 1:8 1:8 1:10 Musik-/Kunst-/ TanztherapeutIn 1:12 MasseurIn plus ev Bademeister 1:100 Hinsichtlich des Personals sollen für alle REHA-Typen folgende Standards gelten (vgl. Royal College of Psychiatrists, o.J.,a b): Das Personal ist für seine Arbeit gut ausgebildet. Die Anzahl des entsprechend ausgebildeten Personals ist ausreichend. Es gibt eine Einstellungspolitik, die garantiert, dass freie Positionen schnell und mit gut qualifizierten und geprüften Personen besetzt werden. Das Personal erhält Aus- und Weiterbildungen, die sie in ihren Kernkompetenzen hinsichtlich wichtiger Themen im Bereich Mental Health stärken. Seite 31 von 40 Das Personal wird darin unterstützt, sich auch außerhalb von konkreten Trainings weiterzubilden (z.B. mittels Büchern). Das Personal arbeitet effektiv als interdisziplinäres Team zusammen. Das Personal wird regelmäßig beurteilt und supervidiert und diese wissen, wie sie bei Bedarf zusätzliche Beratung und Unterstützung bekommen können. Etc. Was nun das Bildungsangebot anlangt so sollen im Sinne der anzustrebenden Integration soweit als mögliche Regelangebote genutzt werden. Die reale Gestaltung dieses Lebensbereichs muss lokale Gegebenheiten die Dauer der Rehabilitation und den jeweiligen Typ der MH Rehabilitation berücksichtigen. Kooperation mit dem Kindergarten und Schulwesen ist erforderlich. 5.2 Organisationsstrukturen Die Organisation soll so strukturiert sein, dass gegenüber dem Personal größtmögliche Transparenz vorliegt (z.B. wird das Personal zu Klinikrisiken in Kenntnis gesetzt oder in das Klinik-Audit mit einbezogen.). Auch sollen interne PeerReview Systeme und Qualitätszirkel eingesetzt werden. 5.3 Materielle Ressourcen Hinsichtlich der materiellen Ressourcen (Einrichtung und Umgebung) sollen für alle REHA-Typen folgende Standards gelten (vgl. Royal College of Psychiatrists, o.J.,a b): Die Kinder- und Jugendeinrichtungen sind von den Erwachseneneinrichtungen getrennt. Die Räumlichkeiten sind so konzipiert und beaufsichtigt, dass die Rechte, die Privatsphäre und die Würde der Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern/ Angehörigen gewahrt bleiben. Die REHA-Einrichtungen stellen eine sichere Umgebung für die Kinder und Jugendliche dar. Seite 32 von 40 Das Personal hat ausreichende Büroeinrichtungen und robuste administrative und technische Hilfesysteme, einschließlich IT-Systeme. Die REHA-Einrichtungen sind günstig gelegen und verfügen über die notwendigen räumlichen und technischen Ausstattungen/Ressourcen, um den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern/ Angehörigen gerecht zu werden. Etc. Beispielsweise könnte die räumliche Ausstattung für die REHA-Einrichtung folgender Maßen ausgestattet sein: Kleingruppenstruktur: 5-6 Kinder/Jugendliche pro Gruppe; altersangepasstes Equipment Pro Gruppe: 1-2 Bettzimmer à 20-25 m2, Gruppenraum ca. 40-60 m2 inkl. Ruhezone und Essecke; Kücheneinheit; Lern/Arbeitsräume; BetreuerInnen-/ Administrationsraum, Besprechungszimmer Pro Zentrum: LeiterInnenzimmer, Sekretariat, je 1 Raum pro Vollzeitarbeitskraft; Bewegungsraum, Ergotherapieraum (SI-Therapie, Massage u.ä.), Kunsttherapieraum (Mal-, Musik-, und Gestaltungstherapie), Ambulanzraum; Übernachtungsmöglichkeit für Angehörige (Eltern, Partner) Angebote für gesundheitsförderliche kindgerechte Schwimmbadbenützung, geführte Spielplatzbenutzung, Sekundärpatienten für Freizeitgestaltung, Wanderungen, Sauna tägliche Kneippkindergarten, und Nutzung von Trainingsgeräten sowie sonstige bewegungstherapeutische Angebote – jeweils nach ärztlicher Freigabe. Außerdem Verfügbarkeit von Gemeinschaftsräumen, Vorträge, Information über regionale Angebote (z. B. Ausflüge) und Ermöglichung der Teilnahme daran, u.ä. Seite 33 von 40 6. PROZESSQUALITÄT Die Prozessqualität umfasst alle Aktivitäten, die im Behandlungsverlauf stattfinden. D.h. es wird betrachtet, welche Aktivitäten durchgeführt werden, die zur Zielerreichung geeignet und notwendig sind, und wie diese ausgeführt werden (z.B. Qualität der diagnostischen Einordnung und der durchgeführten Maßnahmen). Hier fließen auch Aktivitäten seitens der Patientin/ des Patienten zur Zielerreichung ein (z.B. Compliance). Um Prozessqualität zu sichern, ist es zunächst relevant die in den REHAEinrichtungen stattfindenden Prozesse zu standardisieren und genau zu definieren. Diese müssen auch gut dokumentiert werden. Insbesondere gilt es sich die Prozesse (1) Zugang und Aufnahme, (2) Information, Einwilligung und Vertraulichkeit (3) Rechte, Sicherheit und Schutz (4) Betreuung und Behandlung sowie (5) Entlassung, Nachbetreuung, Übergangsphasen genauer anzusehen und Standards zu formulieren (vgl. Royal College of Psychiatrists, o.J.,a b): 1) Zugang und Aufnahme: Die REHA-Einrichtungen arbeiten mit den Zuweisern zusammen, um so garantieren zu können, dass die Zuweisungen rechtzeitig und angemessen erfolgen. Somit sollen für die Kinder bzw. Jugendliche keine unnötigen Verzögerungen entstehen. Bei der Aufnahme herrscht Gleichbehandlung hinsichtlich des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, des Sozialstatus, Behinderungen, des körperlichen Gesundheitszustands, des Wohnorts etc.. Die Kinder bzw. Jugendliche werden in den Zuweisungsprozess einbezogen und darüber informiert. Sie sollen wissen, was sie erwartet. Die Eltern/Angehörigen werden mit bedacht und eingebunden, wenn Diagnosen oder Interventionen durchgeführt werden. Etc. Seite 34 von 40 2) Information, Einwilligung und Vertraulichkeit Die Kinder bzw. Jugendlichen und deren Eltern/Angehörige erhalten Informationen, die für sie geeignet und verständlich sind. Alle Untersuchungen und Behandlungen werden nur mit entsprechender Zustimmung durchgeführt. Das Personal folgt strikt den Anweisungen zur Erlangung rechtsgültiger Einverständniserklärungen. Es stellt sicher, dass die Kinder bzw. Jugendlichen und deren Eltern/Angehörige gut informiert sind über ihre Rechte bzgl. ihrer Einverständniserteilung. Persönliche Informationen über das Kind bzw. den Jugendlichen werden vertraulich behandelt, sofern dies nicht von Nachteil für die Betreuung ist. Die Kinder bzw. Jugendlichen und deren Eltern/ Angehörige sind über ihr Recht auf Information und Vertraulichkeit sowie über Einschränkungen dieser Rechte gut informiert. Die Kinder bzw. Jugendlichen und deren Eltern/Angehörigen haben Zugang zu ihren Krankenakten. Etc. 3) Rechte, Sicherheit und Schutz Wenn ein Kind bzw. Jugendlicher aufgenommen wird, sind die rechtliche Befugnis dazu geklärt. Die Rechte und individuellen Bedürfnisse der Kinder bzw. Jugendlichen und deren Eltern/ Angehörige werden geachtet und berücksichtigt - unabhängig vom Geschlecht, der ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Begabung, Kultur oder sexuellen Orientierung etc.. Die Kinder bzw. Jugendlichen und deren Eltern/ Angehörige sind gut informiert über ihre Rechte und wie sie Beschwerde einlegen und eine unabhängige Beratung bekommen können. Die REHA-Einrichtungen halten sich an die Dienstvorschriften der Kinder- und Jugendschutzbehörden vor Ort. Das Personal arbeitet mit den zuständigen örtlichen Behörden zusammen, um das Wohl der Kinder bzw. Jugendlichen, die länger bleiben müssen, zu schützen und zu fördern. Die Kinder bzw. Jugendliche werden durch klare Sicherheitsrichtlinien und Verfahrensanweisungen vor Missbrauch und Misshandlung geschützt. Etc. Seite 35 von 40 4) Betreuung und Behandlung Die Kinder bzw. Jugendliche erhalten möglichst umgehend Betreuung und Behandlungen bzw. Therapien. Dies wird durch ein flexibles und zuverlässiges Terminierungssystem gewährleistet. Es gibt ein strukturiertes Behandlungs- bzw. Interventionsprogramm. Die verschriftlichten Interventionspläne sind individuell und umfassend. Sie werden in Kooperation mit den Kindern bzw. Jugendlichen und deren Eltern/ Angehörige erstellt. Den Kindern bzw. Jugendlichen steht ein umfassendes Angebote an Interventionen durch qualifizierte und erfahrene Fachkräfte zur Verfügung. Die Erfolge der Interventionen werden regelmäßig überprüft. Jedes Kind bzw. jeder Jugendliche hat eine Hauptbetreuungsperson. Die Kinder bzw. Jugendliche und deren Eltern/ Angehörige stehen in ständigem Kontakt mit der Hauptbetreuungsperson. Die Kinder bzw. Jugendlichen und deren Eltern/ Angehörige werden unterstützt, sich auch selbst helfen können. Die Kinder bzw. Jugendlichen können ihre (schulische oder berufliche) Ausbildung während stationärer Aufnahmen fortsetzen. Etc. 5) Entlassung, Nachbetreuung, Übergangsphasen Die Kinder bzw. Jugendlichen und deren Eltern/ Angehörige werden bei Vereinbarungen hinsichtlich Vorkehrungen für die Entlassung einbezogen. Sie wissen, wie und wo sie bei Bedarf künftig Hilfe bekommen können. Es werden Vorkehrungen getroffen um sicherzustellen, dass eine Nachbetreuung nach der Entlassung stattfinden kann. Kinder bzw. Jugendliche, die eine stationäre Betreuung benötigen, werden an jene stationären Abteilungen verwiesen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Die Personal der verschiedenen REHA-Einrichtungen arbeiten eng zusammen, um so effektive Übergaben zu gewährleisten. Das Personal arbeitet eng mit den Erwachsenendiensten zusammen, um auch hier eine effektive Übergabe zu gewährleisten. Etc. Seite 36 von 40 7. ERGEBNISQUALITÄT Unter Ergebnisqualität Verbesserung des werden die Effekte Gesundheitszustands, der der Behandlung gefasst Arbeitsfähigkeit oder (z.B. der Lebensqualität, Zufriedenheit der Patientin/ des Patienten, Fortschritte hinsichtlich der Psychoedukation). Die Differenz zwischen dem Eingangszustand und dem Ausgangszustand wird dabei betrachtet. 7.1. Nachweis der Ergebnisqualität Für die Qualitätssicherung in der REHA soll auch der Standard gelten, dass Daten zum Nachweis der Ergebnissicherung erhoben werden. Dazu können sowohl Daten, die im Betreuungsprozess erhoben wurden herangezogen werden (z.B. Testwerte zu verschiedenen Zeitpunkten), als auch die Kinder bzw. Jugendlichen und deren Eltern/ Angehörige direkt aufgefordert werden, ihr Feedback zur Institution zu geben. Konkret bedeutet dies, dass die in Kapitel 1 formulierten Ziele der REHA überprüft werden. D.h. es ist ein Nachweis zu erbringen, inwiefern der Aufenthalt in der REHA die Kinder und Jugendlichen in der der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben unterstützt hat und zur Verbesserung der gesundheitsbezogene Lebensqualität durch eine Reduktion der Symptome, durch soziale Teilhabe und eine Sinn erfüllende Tagesstruktur, durch die Entwicklung (beruflicher) Perspektiven sowie durch die Förderung von Kompetenzen beigetragen hat. Auch die Ziele hinsichtlich der Elternbzw. Angehörigenarbeit sollen überprüft werden. Um die Ergebnisqualität zu messen, ist ein Prä- und Post-Test Design erforderlich (d.h. Datenerhebung bei der Aufnahme und bei der Entlassung). Sollte das Kind bzw. der Jugendliche länger betreut werden, sind auch Zwischenmessungen ratsam. Es ist anzustreben, dass zur Messung der Nachhaltigkeit auch ein Follow-up nach 6 Monaten stattfinden. Zur Messung der Ergebnisqualität sollen v.a. Fragebögen und Diagnoseinstrumente eingesetzt werden, die - wenn vorhanden - standardisiert sind. Auch ist darauf zu achten, dass sowohl Selbst- als auch Fremdeinschätzungen vorgenommen werden Seite 37 von 40 (d.h. Einschätzungen durch die Kinder bzw. Jugendliche selbst als auch durch das betreuende Team und die Eltern/ Angehörige). Weiters wird der Einsatz von indirekter und direkter Veränderungsmessungen geraten: Eine indirekte Veränderungsmessung liegt vor, wenn dasselbe Messinstrument zu mindestens zwei Zeitpunkten vorgegeben wird und zur Bestimmung von Veränderungen die Mittelwertsdifferenzen betrachtet werden (vgl. Baumann, Sodemann, & Tobien, 1980; Gollwitzer & Jäger, 2007). Bei der direkten Veränderungsmessung wird die Veränderung von dem Patienten/ der Patientin bzw. einer anderen Person selbst eingeschätzt. Die Anwendung von direkten Veränderungsmessung wird zwar oftmals kontrovers diskutiert (z.B. Einschätzung abhängig von der Gedächtnisleistung der Personen; Abstände müssen gut gewählt sein), jedoch sind auch indirekte Veränderungsmessungen nicht unproblematisch, insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Übungseffekte. Dies kann dazu führen, dass tatsächlich stattfindende Veränderungen nicht erfasst werden können. Auch ist die subjektive Wahrnehmung von Veränderungen (insbesondere für die Einschätzung der Lebensqualität) oftmals wichtiger als eine objektiv feststellbare. Eine Kombination direkter und indirekter Verfahren für die Messung der Ergebnisqualität sollte somit zu einer erhöhten Aussagekraft hinsichtlich der tatsächlichen Wirkung der REHA führen. 7.2 Entlassungsbericht Die REHA-Einrichtungen sind verpflichtet, Entlassungsberichte zu verfassen. Der Entlassungsbericht ist dem Rehabilitanden in der Regel bei der Entlassung auszuhändigen, spätestens jedoch binnen 14 Kalendertagen zuzusenden. Gleiches gilt für die Übermittlung an die PVA / den SVT. Anderen Adressaten darf der Entlassungsbericht nur mit Zustimmung des Rehabilitanden ausgefolgt werden. Sollte der endgültige Entlassungsbericht zum Zeitpunkt der Beendigung des Rehabilitationsaufenthaltes nicht fertig gestellt werden können, muss der Rehabilitand einen vorläufigen Entlassungsbericht (Kurzbericht) erhalten. Bei der Verfassung der Berichte sollten ebenfalls Standardisierungen vorgenommen werden. Seite 38 von 40 8. Literatur American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fourth Edition (DSM-IV). Anthony, W. A. & Liberman, R. P. (1986). The practice of psychiatric rehabilitation: historical, conceptual and research base. Schizophr Bull, 12, p. 542-559. Arbeitskreis OPD (Hrsg. 2004). Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik – OPD (4. Auflage). Verlag Hans Huber Baumann, U., Sodemann, U. & Tobien, H. (1980). Direkte versus indirekte Veränderungsmessung. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 1, 201216. Berger, E., Aichhorn, W., Friedrich, M. H., Fiala-Preinsberger, S., Leixnering, W., Mangold, B., Spiel, G., Tatzer, E., & Thun-Hohenstein, L. (2006). Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung in Österreich. Neuropsychiatrie, 2, p. 86-90 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (2005). Rehabilitation und Teilhabe. Köln: Deutscher Ärzteverlag. Cantwell, D.P. (1996). Classification of child and adolescent psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 1, 3-12. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (2007). Psychosoziale Rehabilitation. In: Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings-, Kinder- und Jugendalter. Köln: Deutscher Ärzteverlag. Donabedian, A. (1988). The Quality of Care. How Can It Be Assessed? JAMA, 260(12), 17431748. Dreher, E. & Dreher, M. (1985). Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. Bedeutsamkeit und Bewältigungskonzepte. In D. Liepmann & A. Stiksrud (Hrsg.), Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz (S. 56-70). Göttingen: Hogrefe. Fachgesellschaft für Rehabilitation in der Kinder- und Jugendmedizin (2006). Leitlinie zu Rehabilitation in der Kinder- und Jugendmedizin. Fachgesellschaft Rehabilitation in der Kinder- und Jugendmedizin. Finsterwald, M. & Spiel, G. (2010). Qualitätsmanagement und Evaluation im Non-Profit Bereich. Sozialarbeit in Österreich, Sondernummer 2010, 36-38. Gollwitzer, M., & Jäger, R. (2007). Evaluation. Weinheim: Beltz. Grawe, K. & Braun, U. (1994). Qualitätskontrolle in der Psychotherapiepraxis. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 23(4), 242-267. Merod, R. & Petermann, F. (2006): Messung der Prozess- und Ergebnisqualität in der Therapie von Kindern und Jugendlichen. Kindheit und Entwicklung, 15(3), 164-169. Mienert, M. (2008). Total Diffus. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Nitzko, S. & Seiffge-Krenke, I. (2009). Wohlbefindensforschung im Kindes- und Jugendalter. Entwicklungsdynamik, Alters- und Geschlechtsunterschiede. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 17, 69-81. ÖBIG (2010). Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen in Österreich. Wien. Zugriff am 25.03.2011 unter Seite 39 von 40 http://www.goeg.at/index.php?pid=produkteberichtedetail&bericht=220&smark=Rehabilit&nor eplace=yes Ravens-Sieberer, U., Thomas, C. & Erhart, M. (2003). Körperliche, psychische und soziale Gesundheit von Jugendlichen. In K. Hurrelmann, A. Klocke, W. Melzer & U. Ravens-Sieberer (Hrsg.), Jugendgesundheitssurvey – Internationale Vergleichsstudie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (S. 19–98). Weinheim: Juventa. Remschmidt H., Schmidt M. & Poustka F. (Hrsg 2001). Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO. Mit einem synoptischen Vergleich von ICD-10 und DSM-IV. Bern: Huber Royal College of Psychiatrists (o.J.,a). QNIC: A Quality Network for Inpatient Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS). Zugriff am 14.02.2011 http://www.qnic.org.uk/ Royal College of Psychiatrists (o.J.,b). Quality Improvement Network for Multi-Agency. CAMHS. Zugriff am 14.02.2011 http://www.rcpsych.ac.uk/quality/ quality,accreditationaudit/qinmaccamhs.aspx Schumacher, J., Klaiberg, A. & Brähler, E. (2003). Diagnostik von Lebensqualität und Wohlbefinden – Eine Einführung. In J. Schumacher, A. Klaiberg & E. Brähler (Hrsg.), Diagnostische Verfahren zu Lebensqualität und Wohlbefinden (S. 1–18). Göttingen: Hogrefe. Spiel, W. & Spiel, C. (1987).On the Nosological Classification in Child and Adolescence Neuropsychiatry Basic Remarks in Seva A. et.al.(Hrsg),The European Handbook of Psychiatry and Mental Health Editorial Anthropos: Barcelona Steinhausen, H-C., Lugt, H., Doll, B., Kammerer, M., Kannenberg, R. & Prün, H. (2000). Der Züricher Interventionsplanungs- und Evaluationsbogen (ZIPEB): Ein Verfahren zur Qualitätskontrolle therapeutischer Maßnahmen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 49, 329-339. WHO (1992). International Statistical Classification of Diseases: ICD-10. WHO (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. WHO (2005). Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. DIMDI. Seite 40 von 40