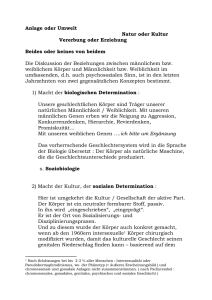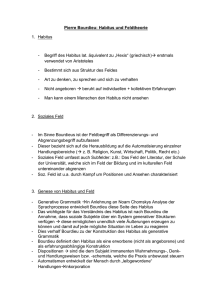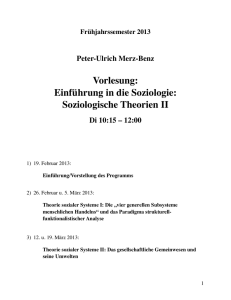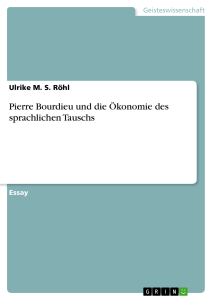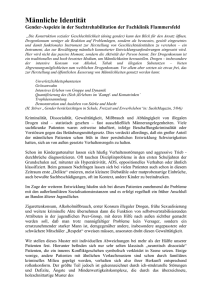ichkeit - HAWK
Werbung

ichael bleuser t Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster L ao,o~"isc~ie„-i Leske + Budrich, Opladen 1998 ichkeit Inhalt Vorwort .................................................................................. 7 Einleitung............................................................................... 9 Theorie: Geschlecht und Männlichkeit im soziologischen iskurs ........................................................................ 17 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 Gedruckt auf säurefreiem und altersbeständigem Papier. ISBN 3-8100-2000-1< 1998 Leske -t Budrich, Gpladen Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Druck: Druck Partner Rübelmann, Hemsbach Printed in Germany 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 Zwischen Wesensmetaphysik und soziologischer Entzauberung. Männlichkeit in den Geschlechtertheorien soziologischer Klassiker ................................................... Ferdinand Tönnies: Weiblicher Wesenwille und männlicher Kürwille ........................................................................ Georg Simmel: Männliche Differenziertheit und weibliche Einheitlichkeit ................................................................ Emile Durkheim: Geschlechtliche Arbeitsteilung und der Mann als Produkt der Gesellschaft ..................................... Geschlecht: Soziale Rolle oder soziale Konstruktion?............. Geschlechtsrollentheorie: Instrumentelle Orientierung und die `Gefahren' der männlichen Geschlechtsrolle ..................... Die soziale Konstruktion von Geschlecht: Männliche Dominanz und das Arrangement der Geschlechter ................. Geschlechtersoziologie: Frauenforschung und Männerstudien ... Patriarchat oder Gender? Mann und Männlichkeit in den Perspektiven der Frauenforschung ...................................... Patriarchale Unterdrückung oder hegemoniale Maskulinität? Die Diskussion der Männerstudien ..................................... Geschlecht und Habitus. Überlegungen zu einer soziologischen Theorie der Männlichkeit .................................................. Habitusbegriff und Geschlechterverhältnis bei Pierre Bourdieu.. Geschlechtlicher Habitus - ein Entwurf ................................ Der männliche Geschlechtshabitus....................................... 17 21 31 41 50 50 62 76 76 89 104 108 112 117 Empirie; Gesehieeht und Männhehkeit in den Diskursen der Männer ................................................................................ 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Multioptionale Männlichkeiten? ................................................ Von Mann zu Mann. Dekonstruktionen und Rekonstruktionen von Männlichkeit in der Männerverständigungsliteratur ........... Defizitkonstruktionen: Der Mann als Mängelwesen .................. Maskulinismus: Die Rückbesinnung auf die gefährdete Männerherrlichkeit ..................................................................... Differenz: Die Suche nach authentischer Männlichkeit ............. Schlußbemerkung: Zur kulturellen Dynamik männlicher Selbstthematisierung ................................................................... Unter Männern. Kollektive Orientierungen und existentielle Hintergründe................................................................................ Zur Methode: Wissenssoziologische Rekonstruktion kollektiver Orientierungen oder: Wie läßt sich das fraglos Gegebene zum Sprechen bringen? .............................................. „Weil das immer so gewesen ist". Verankerung in der Tradition und habituelle Sicherheit ............................................ „Ich brauche mich dafür nicht entschuldigen". Prekäre Sicherheiten ............................................................................... „Immer noch so viel Verunsicherung". Institutionalisierte Dauerreflexion und die Suche nach Authentizität - Die Sinnwelt der Männergruppen ..................................................... „Du tust es einfach, du redest nicht". Pragmatische Arrangements jenseits von Tradition und Verunsicherung ........ Männerwelten und Frauenbilder. Zur `männlichen' Konstruktion der Frau ................................................................. Eheliche Beziehungen und homosoziale Männerwelten. Lebensweltliche Hintergründe männlicher Orientierungen ........ Konjunktive Erfahrungsräume. Zur Bedeutung von milieu-, entwicklungs- und generationsspezifischen Besonderheiten ...... Zusammenfassung: Habitus, männliche Hegemonie und habituelle Sicherheit ................................................................... 123 Vorwort 123 129 135 148 156 167 173 174 183 203 223 246 262 276 289 295 Schluß: Freisetzung aus Traditionen? Krise des Mannes? Ein modernisierungstheoretisches Resümee ............................................ 303 Literatur ............................................................................................... 311 Anhang .................................................................................................. 327 Diese Studie ist die leicht überarbeitete Version meiner vom Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Bremen angenommenen Habilitationsschrift. In ihrem empirischen Teil basiert sie auf Daten, die in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsprojekt zusammengetragen worden sind. Der Titel des Projekts lautete: „Die Symbolik der Geschlechtszugehörigkeit. Kollektive Orientierungen von Männern im Wandel des Geschlechterverhältnisses". Ich möchte an dieser Stelle den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen in dem Projekt, Cornelia Behnke, Rainer Hoffmann und Peter Loos, für ihren hohen Einsatz und ihre niemals ermüdende Diskussionsbereitschaft danken, ohne die das Projekt nicht hätte erfolgreich abgeschlossen werden können. Ebenfalls gebührt mein Dank Alexander Gattig, Andreas Henkenbehrens, Martin Herberg, Eva Munz, Susanne Peter, Jutta Reichelt, Katrin Stinner und Karola Zygnsunt, die als studentische Hilfskräfte und PraktikantInnen wertvolle Unterstützung bei Datenerhebung und -auswertung geleistet haben. In gleicher Weise zu Dank verpflichtet bin ich den StudentInnen, die in einer zweisemestrigen Lehrveranstaltung zum Verfahren der Gruppendiskussion wichtige Arbeit bei der Erprobung des Erhebungsinstruments geleistet haben. Für eine kritische Lektüre des Manuskripts und hilfreiche Hinweise zu dessen Verbesserung danke ich Rüdiger Lautmann, der das Habilitationsverfahren federführend betreut hat, Cornelia Behnke, Rainer Hoffmann sowie Karin Gläßer-Meuser. Einleitung „Wenn man gute Gründe braucht, um soziale Probleme zu untersuchen, dann sollte man neutrale Analysen sozialer Zusammenhänge derjenigen durchführen, die mit den Privilegien institutioneller Macht ausgestattet sind - Priester, Psychiater, Lehrer, Polizisten, Generäle, Regierende, Eltern, Männer, Weiße, Staatsangehörige, Medienexperten und all die anderen etablierten Personen, die durch ihre Position in der Lage sind, ihre Version der Wirklichkeit offiziell durchzusetzen" (Goffman 1994b, S. 103£). Ob 15 Jahre, nachdem Erving Goffman mit diesen Sätzen das Manuskript seiner - aus Krankeitsgründen nicht gehaltenen - Ansprache als Präsident der American Sociological Association beendet hat, den Männern die Aufnahme in den Kreis der privilegierten Wirklichkeitsgestalter noch umstandslos gebührt, sei dahingestellt. Daß sie zumindest ein gewichtiges Wort mitreden, wenn es darum geht, Lebenschancen und Handlungsspielräume von Menschen festzulegen, steht außer Frage. Insofern ist eine „neutrale", d.h. weder anklagende noch larmoyante Analyse der `Männerwelt' eine Aufgabe, die von der Soziologie zu leisten ist. Die vorliegende Arbeit wendet sich einem Gegenstand zu, den die deutschsprachige soziologische Geschlechterforschung - anders als die angelsächsische - bislang weitgehend vernachlässigt hat. Maskulinität, Männerwelten als ein neuer Gegenstand der Soziologie? Nach und neben der Frauenforschung nun eine Männerforschung? Hat sich die Soziologie als „männliche Wissenschaft`, in einer selbstverständlich vor genommenen Gleichsetzung des Männlichen mit dem Allgemein-Menschlichen' nicht seit jeher ausschließlich mit der sozialen Welt des Mannes befaßt? So jedenfalls lautet die Diagnose feministischer Wissenschaftskritik'. Die in dieser Art von `Männerforschung' enthaltenen Annahmen über Männer und Männlichkeiten sind jedoch implizit geblieben, sind nicht als solche kenntlich gemacht worden. Das betonen vor allem die in den achtziger Jahren entstandenen „men's studies" (s. Kap. 3.2), und das zu ändern definieren sie als ihr Ziel. 1 2 Hierzu hat Simmel (1985, S. 201) bereits zu Beginn der Jahrhunderts scharfsinnige Analysen vorgelegt. Ich komme darauf zurück (s. Kap. 1.2). Vgl. allgemein Hausen/Nowotny 1 986, auf die Soziologie bezogen Brück u.a. 1992, S. 17ff. Die Geschlechtsblindheit, mit der die Wissenschaft Soziologie nicht weniger `geschlagen' gewesen ist als andere Humanwissenschaften, läßt sich als Folge ihrer ` Männlichkeit' verstehen. Claudia Honegger (1991) hat in ihrer Rekonstruktion der Diskurse der Wissenschaften vom Menschen eindrucksvoll gezeigt, wie der im späten 18. Jahrhundert erfolgten `Erfindung' polar entgegengesetzter Geschlechtscharaktere (vgl. Hausen 1976) im 19. Jahrhundert ein wissenschaftlicher Begründungsapparat an die Seite gestellt wurde, in welchem mit der Naturalisierung der Frau und der Konzeptualisierung des Mannes als `ganzem' - und das meint vor allem kulturfähigem - Menschen die Grundlagen für die Deutungsmuster gelegt wurden, die auch heute noch weitgehend die Geschlechterwahmehmung des common sense bestimmen. Paradigmatisch geschieht dies in der institutionellen Ausdifferenzierung einer Sonderwissenschaft von der Frau: Mit der Herausbildung der Gynäkologie wird, so Honegger, die Charakterkunde des Weibes physiologisch reduziert'. Philosophie und Geisteswissenschaften befassen sich wieder mit dem ,ganzen Menschen', hinter dem sich niemand anders als der Mann verbirgt. Allerdings bleibt dieser so gut verborgen, daß kaum jemand das 'Versteckspiel' bemerkt. Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit, die kulturelle Konstruktion des Mannes, wie sie in solchen wissenschaftlichen und in sonstigen Diskursen sich vollzogen hat, historisch-genetisch zu rekonstruieren. Nur soweit die Sozio logie daran einen Anteil hat, wird der Blick sich rückwärts richten. Über explizite Thematisierungen des Geschlechterverhältnisses wird nicht allzu viel zu berichten sein, denn auch für die Soziologie gilt, daß ein universalistisches Selbstverständnis den Blick auf die geschlechtliche Segmentierung der sozialen Welt verstellt hat. Nicht nur die Moderne ist `geschlechtlich halbiert' (vgl. Beck 1986, S. 176ff.), auch die Wissenschaft von der Moderne par excellence ist es lange gewesen. Man denke nur an die Geschlechtsblindheit der Theorien sozialer Ungleichheit (vgl. Kreckel 1987, 1989; Hradil 1987a) oder an die Jugendsoziologie, die zu großen Teilen eine (implizite) 'Jungensoziologie' (gewesen) ist (vgl. CJstner 1986). Daß die Soziologie nicht die einzige Wissenschaft ist, die solche blinde Flecken aufweist4, entlastet sie nicht, Versäumtes nachzuholen. Die vorliegende Arbeit will hierzu einen Beitrag leisten, indem sie die Seite im Geschlechterverhältnis in den Fokus rückt, die zumindest als Gegenstand empirischer Forschung bislang wenig Aufmerksamkeit gefunden hat. 3 4 10 Eine entsprechende Sonderwissenschaft vom Mann hat sich nicht ausdifferenziert. Eine ` Androkologie' existiert (noch) nicht. Wie auch immer man die von Carol Gilligan (1984) getroffene Unterscheidung einer weiblichen und einer männlichen Moral einschätzen mag (für eine kritische Perspektive vgl. Nunner-Winkler 1994), eines hat ihre Studie „Die andere Stimme" deutlich gezeigt: daß ein androzentrischer Bias des Samples die Forscher nicht notwendig veranlaßt, die Aussagekraft der Resultate auf die männliche Hälfte der Menschheit zu begrenzen. Zwar fehlt es im rezenten Geschlechterdiskurs auch hierzulande nicht an Thesen über den Mann, über sein Wesen, über seine aktuelle Befindlichkeit, über den Schaden, den er anrichtet, auch über die Leiden, die er zu ertragen hat (s. Kap. 6); empirisch-soziologische Studien sind jedoch an den Fingern einer Hand abzuzählen. Ihre „Geschlechtssensibilisierung" (Kreckel) hat die Soziologie durch die Frauenforschung erfahren. Diese hat aus naheliegenden Gründen zunächst einmal weibliche Lebenszusammenhänge und die gesellschaftliche Lage der Frau zum Gegenstand gemacht, galt es doch, einem Androzentrismus von Forschung und Theoriebildung gegenzusteuern. Allerdings, auch ohne den Mann ausdrücklich zu betrachten, enthalten die Arbeiten der Frauenforschung zahlreiche mehr oder minder explizit gemachte Annahmen über den Mann und über Männlichkeits. In einer Relation von zwei Elementen' implizieren Aussagen über die eine Seite notwendig Annahmen über die andere. Seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre gibt es zwar nicht sehr viele empirische klntersuchungen der Frauenforschung, die den Mann zum Gegenstand haben, wohl aber eine Diskussion darüber, in welcher Weise, mit welchen Konzepten, von welchen Voraussetzungen aasgehend und in welchem wissenschaftssystematischen Rahmen Männer und Männlichkeiten erforscht werden können und sollen. Die Auseinandersetzungen gelten nicht zuletzt einer „Politics of Naming" (Richardson/Robinson 1994; vgl. auch HagemannWhite/Rerrich 1988): Kann die Erforschung des Mannes i m Rahmen von , women's studier' erfolgen oder übersteigt das deren Zuständigkeiten? Ist eine übergreifende Perspektive in Gestalt von ` gender studies' notwendig oder eher eine Spezialwissenschaft vom Mann, die ` men's studies"? Es ist freilich nicht allein eine wissenschaftsimmanente Entwicklung der Frauenforschung, die Ende der achtziger Jahre den Mann, wenn zunächst auch nur zögerlich, vor den Scheinwerfer der sozialwissenschaftlichen Aufmerksamkeit rückt. Frauenforschung und Soziologie befassen sich reit dem Mann in dem Moment, in dem die Fraglosigkeit seiner sozialen Existenz zu schwinden beginnt. Auf empirische Indikatoren hierfür werde ich unten eingehen. An dieser Stelle sei auf die forschungstrategische Bedeutung des Reflexivwerdens von Selbstverständlichkeiten hingewiesen. Diese resultiert aus der Dialektik von Determination und Emergenz und hat grundlagen- wie modernisierungstheoretische Aspekte. I m Zuge einer Entwicklung, die Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim (1990, S. 199) als „erlittene Emanzipation" der Männer beschrieben haben, gewährleistet die unbefragte Reproduktion des Selbstverständlichen zu5 6 Für eine Analyse feministischer Konstruktionen des Mannes vgl. Rave (1991). Rave bezieht sich freilich über die Frauenforschung i.e.S. hinaus allgemein auf den feministischen Diskurs. Das ist nicht allein ein Streit um Namen. Es geht auch um die Sicherung von Ressourcen. nehmend weniger Handlungssicherheit und -erfolg, Die durch die Frauenbewegung bewirkten Veränderungen in den Strukturen des Geschlechterverhältnisses erzeugen für i mmer mehr Männer einen Druck, ihren Ort in den alltäglichen Geschlechterbeziehungen neu bzw. zum ersten Male bewußt zu definieren. Wie generell in Umbruch- und Krisensituationen kommt es zu einer erhöhten lebensweltlichen Reflexivität, als deren Folge Deutungsmuster zumindest zeitweise manifest werden'. Für eine synchronisch ansetzende Geschlechterforschung stellen Umbruch- und Krisensituationen ideale Forschungsgelegenheiten dar. Wie auch sonst geht mit der Herausbildung des Neuen eine von dessen `Protagonisten' geführte Auseinandersetzung mit dem Alten einher, aus dem heraus das Neue transformatorisch entwickelt werden muß (vgl. Oevermann 1991, S. 314f.). Wir haben also die forschungsstrategisch günstige Situation, daß sich traditionelle und virtuelle neue Deutungsmuster von Männlichkeit zugleich rekonstruieren lassen'. Zudem wird die Konstrukthaftigkeit der Geschlechtszugehörigkeit zumindest denkbar. Die Kulturproduktion hat den Mann schon längst entdeckt. In sämtlichen Medien, in allen möglichen Sparten von Trivial- und Hochkultur und als Gegenstand diverser Formen der Betrachtung ist der Mann zunehmend 'ge fragt'. Die öffentliche Aufmerksamkeit reicht von Fernsehsendungen ä la „Mann-O-Mann", in der Männer als Objekt weiblicher Lust präsentiert werden, über von Parteien veranstaltete Hearings, Titelgeschichten in Print-Medien und Verlagsreihen bis hin zu Ausstellungen in Museen (vgl. Völger/ Welck 1990) und von einer Frauenzeitschrift in Auftrag gegebenen Studien'. Etablierte und profilierte Bildungs- und Tagungsstätten nehmen sich der Männer an. Auf dem evangelischen Kirchentag 1993 in München wurde erstmals in dessen Geschichte ein „Männerforum" veranstaltet, mit einer geschlechtsexklusiven Zutrittsregelung. - Der Mann als öffentlich-geschlechtliches Wesen ist interessant geworden, und er macht sich selbst öffentlich, in welcher Form und in welchen Aspekten seiner Existenz auch immer. Was außer einer vor allem massenmedial produzierten Aktualität läßt ` Mann' zu einem soziologisch relevanten Gegenstand werden? Auf einer kategorialen Ebene, vorab aller empirischen Evidenz ist darauf zu verweisen, daß Geschlecht nur relational zu denken ist: Frauen gibt es nur insoweit, als es Männer gibt, und vice versa'°. Eine Forschung, die nur die eine Seite des 7 8 9 10 12 Das Konzept der sozialen Deutungsmuster nimmt als eine grundlegende Eigenschaft von Deutungsmustern deren Latenz an (vgl. Meuser/Sackmann 1992). George Herbert Mead hat darauf hingewiesen, daß ohne einen Bruch Kontinuität nicht erkennbar ist. „Aber schiere Kontinuität wäre nicht erfahrbar. In jedem Moment der Erfahrung steckt ein Hauch von Neuem. ... Ohne diesen Bruch in der Kontinuität wäre die Kontinuität unerfahrbar" (Mead 1987, S. 342). Bereits zweimal hat die Zeitschrift „Brigitte" eine Untersuchung über den Mann in Auftrag gegeben (vgl. Pross 1978; Metz-Göckel/Müller 1986). Das ist hier nicht in einem biologischen Sinne gemeint, sondern als soziales Verweisungs- Verhältnisses fokussiert, greift mithin zu kurz. Dieses kategoriale Argument soll hier allerdings nicht weiter verfolgt werden. Ich möchte ein empirisches Argument in den Vordergrund stellen und die These begründen, daß jenseits aller modischen Erscheinungen Anzeichen eines sozialen und kulturellen Wandels männlicher Existensweisen sichtbar sind. Eine Soziologie, die sich mit Maskulinität als geschlechtlicher Erfahrungskategorie befaßt, ergänzt nicht lediglich in theoriesystematischer Absicht fehlende `Mosaiksteine''', sie ist wichtigen und folgenreichen gesellschaftlichen Veränderungen auf der Spur. Diese haben ihren Grund und dokumentieren sich in einer Diskursivierung von Maskulinität, welche als Indikator für eine Erschütterung von Ordnungsgewißheiten zu verstehen ist. I m empirischen Teil der Arbeit werden zunächst die medienvermittelten Diskurse der Maskulinität behandelt werden. Wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen ist das Abbröckeln vormals eherner Gewißheiten für eine Vielzahl von Sinnlieferanten Anlaß, Deutungsangebote und Handlungsperspektiven zu offerieren. Zunächst, in den siebziger Jahren, noch recht zögerlich, in den Achtzigern dann mit Macht und seit Beginn der Neunziger mit einer Pluralität an Orientierungen aufwartend, hat sich ein Genre auf dem Markt der Bücher zur Lebenshilfe etabliert, das ich ` Männerverständigungsliteratur' nenne. Eine Rekonstruktion der darin enthaltenen Deutungsmuster und Leitbilder wird die interne Varietät des Männlichkeitsdiskurses aufweisen bzw. ausdifferenzierte Teildiskurse voneinander abgrenzen. In einer modernisierungstheoretischen Perspektive wird die Diskursivierung der Männlichkeit als solche, unabhängig von den jeweilig angebotenen Deutungen, als Indikator einer schwindenden Fraglosigkeit analysiert werden. Einen Diskurs über etwas zu eröffnen macht es den daran Beteiligten schwer, weiterhin in einem „Zustand des unreflektierten ` Zuhauseseins' i n der sozialen Welt` (Berger/Berger/Kellner 1987, S. 71) zu leben. Medial vermittelte öffentliche Diskurse stellen kulturelle Leitbilder bereit. In welcher Weise und in welchem Ausmaß die Adressaten die Botschaft aufnehmen, steht auf einem anderen Blatt und ist mit den Mitteln einer Diskursanalyse nicht zu bestimmen. Auch ein Blick auf Auflagenhöhen und Verkaufszahlen hilft nur bedingt weiter. An die Literaturanalyse wird sich deswegen eine Rekonstruktion alltagsweltlicher kollektiver Orientierungen von Männern anschließen. Die Daten sind in Gruppendiskussionen in einer Vielzahl und vor allem in einer Vielfalt von Zusammenschlüssen von Männem gesammelt worden. In der bereits erwähnten, auf den sozialen Wandel der Geschlechterverhältnisse gerichteten Perspektive wird die Frage gestellt, 11 verhältnis. Freilich macht die Rede von der Relationalität der Geschlechterkategorien auch in einem biologischen Bedeutungszusammenhang Sinn, wiewohl die `Verheißungen' der Gentechnologie dies womöglich ändern werden (vgl. Treusch-Dieter 1992). Auch dies wäre für sich bereits ein nicht zu gering zu schätzendes Unterfangen. 13 in weicher Weise sich dieser Wandel in den Selbst- und Fremddeutungen von Männern niederschlägt. Ausgehend von der Prämisse, daß Deutungs- und Orientierungsmuster nicht nach Gutdünken ausgewählt werden (können), sondern einen Bezug zu Problemen der alltäglichen Handlungspraxis haben, wird der Blick auf lebensweltliche Hintergründe gerichtet, in denen bestimmte Orientierungen einen Sinn machen. Der mediale Diskurs der Maskulinität und die alltagsweltlichen Deutungsmuster von Männern schließen nur unter bestimmten Bedingungen bruchlos aneinander an, dort, wo `männerbewegte Männer' sich in Männer gruppen organisieren und das Vokabular zu ihrer Selbstdeutung der einschlägigen Literatur entnehmen. Ansonsten - und dies betrifft die Majorität der Männer - sind die Beziehungen zwischen öffentlichem Diskurs und lebensweltlich verfügbaren Interpretationen komplizierter, vertrackter, verborgener. Die mediale Präsenz des Diskurses ermöglicht ein Sprechen über das eigene Mannsein; dieses Sprechen macht sich allerdings nicht notwendig die Deutungen des Diskurses zu eigen. Bevor die empirischen Rekonstruktionen präsentiert werden, gilt es zu resümieren, was soziologische Theorie und Forschung zu Geschlecht und Männlichkeit an Konzepten anzubieten haben. Diese werden im Sinne einer sensibilisierenden Begrifflichkeit bei der Interpretation des empirischen Materials genutzt. Dies soll jedoch keine `tour d'horizon' durch die kaum noch zu überblickende sozialwissenschaftliche Geschlechterforschung werden. Vielmehr wird dargelegt, wie die Soziologie den Gegenstand `Mann' (nicht) behandelt hat; wie und unter welchen Bedingungen sich das in der jüngsten Vergangenheit zu ändern begonnen hat und welche theoretischen Modelle gegenwärtig gehandelt werden. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Probleme zu richten sein, die sich aus einer allgegenwärtigen Verknüpfung von (Geschlechter-)Forschung und (Geschlechter-)Politik ergeben. In Anschluß an das Bourdieusche Konzept des Habitus als inkorporierte soziale Praxis wird auf der Schnittstelle des theoretischen und des empirisehen Teils der Begriff des männlichen Geschlechtshabitus entworfen, um anschließend zu fragen, inwieweit unter den gegenwärtigen Geschlechterverhältnissen noch die Anwendungsbedingungen dieses Habitus gegeben sind. Damit wird die vorliegende Studie in ihrem empirischen Teil auf eine Ebene orientiert, der, wie Maihofer anmerkt, von der sozialkonstruktivistischen Geschlechterforschung nicht die gebührende Aufmerksamkeit zuteil wird. Maihofer (1994, S. 236) kritisiert, über der Frage, „wie Geschlechter gemacht werden", werde vernachlässigt zu untersuchen, „wie Geschlechter als gewordene/werdende sind. D.h. die Rekonstruktion des Frau- oder Mannseins tritt fast völlig in den Hintergrund". Um das Mannsein, dessen alltagsweltliche Deutung und Bedeutung, geht es in dieser Arbeit. Ein Mann, der die eigenen Geschlechtsgenossen zum Gegenstand soziologischer Forschung macht, wird nicht selten mit der Frage konfrontiert, wie 14 er es mit der `Betroffenheit' halte. Die vorliegende Arbeit will nicht zuletzt zeigen, daß es möglich ist, auf der Basis des modernen Wissenschaftsbegriffs eine nicht-androzentrische Analyse des Geschlechterverhältnisses vorzunehmen. Entgegen Simmels (1955, S. 214) Diktum, wonach das Männliche als „das schlechthin Allgemeine ... sich nicht definieren" lasse, soll genau dies versucht werden; allerdings nicht im Sinne einer Wesensbestimmung, sondern indem gefragt wird, wie das vermeintlich Allgemeine in sozialer Praxis hergestellt wird. 15 ne Bestimmung des Wesens der Geschlechter, ein Denken in essentiellen Kategorien bestimmt aber dennoch seine implizite, von ihm selbst nicht systematisch ausgearbeitete Geschlechtertheorie. Das erzeugt die mehrfach festgestellte Spannung zwischen konsequent soziologischer Analyse und Geschlechterideologie. Die Ansätze zu einer Soziologie des Geschlechts, die in den Werken der Klassiker Tönnies, Simmel und Durkheim enthalten sind, sind von der sich institutionalisierenden Soziologie des 20. Jahrhunderts zunächst nicht aufgenommen und weiterentwickelt worden. Erst um die Mitte des Jahrhunderts, i m Rahmen der soziologischen Rollentheorie und hier insbesondere in den Arbeiten von Talcott Parsons wird der Thematik der Geschlechterbeziehungen wieder größere Aufmerksamkeit zuteil. Ein expliziter Gegenstand von Forschung und Theoriebildung wird die männliche Geschlechtsrolle. Mit dem Konzept der Geschlechtsrolle verbindet sich ein Paradigma, das in der sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung trotz aller Kritik, die es erfährt, nach wie vor seinen Platz hat, das aktuell freilich mehr in der So zialpsychologie als in der Soziologie vertreten ist. Die rezente soziologische Diskussion wird von verschiedenen Varianten des Sozialkonstruktivismus dominiert. Hier hat ein Paradigmawechsel stattgefunden, der in der amerikanischen Soziologie weitreichender vollzogen ist als in der deutschen. Aber auch hierzulande kreisen zumindest die Theoriedebatten um die Frage, was mit dem Konzept der sozialen Konstruktion gemeint ist und wie es empirisch eingeholt werden kann. 2.1 Geschlechtsrollentheorie: Instrumentelle Orientierung und die `Gefahren' der männlichen Geschlechtsrolle An der Schnittstelle von soziologischer Rollentheorie und psychologischer Geschlechterdifferenzforschung hat sich in den dreißiger und vierziger Jahren dieses Jahrhunderts in den USA eine Forschung zur Entwicklung der Geschlechtsrollenorientierung entwickelt. Der Begriff der Geschlechtsrolle ist das Konzept, das den sozialwissenschaftlichen Diskurs über das Geschlechterverhältnis bis in die jüngste Vergangenheit dominiert hat. Vor allem in der psychologischen Diskussion waren Merkmale und Probleme der männlichen Geschlechtsrollenidentifikation von Beginn an ein zentrales Thema. Pleck (1987) bezeichnet das Konzept der männlichen Geschlechtsrollenidentität als 50 das dominante Erklärungsmodell der amerikanischen Psychologie zum Verständnis männlicher Erfahrung. Die rollentheoretische Fassung des Themas Mann und Maskulinität zeichnet sich durch zwei Aspekte aus. Erstens: Die Geschlechtsrolle wird als psychologische Entsprechung des biologischen Geschlechts verstanden; eine angemessene Geschlechtsrollenidentität manifestiert sich in Erwerb und Besitz derjenigen Eigenschaften und Attitüden, die i m psychologischen Sinne das biologische Geschlecht bestätigen. Zweitens: Dieser Fundierung in der Anatomie korrespondiert eine implizite Normativität des Konzepts der Geschlechtsrolle. Eine heterosexuelle Orientierung als statistischen und moralischen - Normalfall voraussetzend, wird nach den Charakterzügen gefragt, die eine „gesunde" männliche Geschlechts-identität ausmachen. Dies führt zur Entwicklung der bis heute in vielfältigen Modifikationen verwendeten Maskulinitäts- und Femininitätsskalen, deren items die kulturellen Stereotype über männliche und weibliche Eigenschaften reproduzieren (vgl. Bierhoff-Alfermann 1989; Sieverding/Alfermann 1992) 4°. Als ein normaler Mann gilt, wer hohe, aber keine extremen Werte auf der Maskulinitätsskala und geringe Werte auf der Femininitätsskala erreicht. Als Abweichungen von der männlichen Geschlechtsrolle werden sowohl Hypermaskulinität (z.B. übersteigerte Aggressivität) als auch Effeminierung (z.B. Konfliktvermeidung) gesehen. Als extremste Form der Abweichung gilt Homo40 Diese Skalen stellen die in der Sozialpsychologie vorherrschende Methode dar, um die Geschlechtsrollenidentifikation von Versuchspersonen zu messen. In die Testkonstruktion, d.h. in die Formulierung und in die Auswahl der items, gehen massive stereotypisierende Annahmen über Geschlechtscharaktere ein. Ein Vergleich der Test-items und der Eigenschaften, die der Geschlechterdiskurs des 19. Jahrhunderts als weibliche und als männliche definiert hat, ergibt verblüffende Übereinstimmungen (vgl. die Übersichten bei BierhoffAlfermann 1989, S. 30ff. und Hausen 1976, S. 368). Folgte die Testkonstruktion zunächst dem Prinzip der Bipolarität - ein item ist entweder Indikator für Femininität oder für Maskulinität, nicht aber für beides; niedrige Werte auf der Maskulinitätsskala indizieren ein hohes Maß an Femininität und vice versa -, so wird das heute zunehmend als ein Problem gesehen. Wer hohe Ladungen auf der Femininitätsskala aufweist, muß deswegen nicht notwendig niedrige Maskulinitätswerte haben. Gleichsam dem kulturellen Diskurs folgend, der z.B. von weiblichen Anteilen beim Mann spricht, werden zweidimensionale Konzepte und Androgynitätsskalen entwickelt. Eine Versuchsperson kann hohe Werte auf beiden Skalen haben, auf der Feminünitäts- und auf der Maskulinitätsskala, und gilt dann als androgyn. Maskulin ist, wer hoch auf der M- und niedrig auf der F-Skala lädt; für feminine Individuen gilt das umgekehrte. Wer auf beiden Skalen niedrige Werte erzielt, gehört zur Restkategorie der Undifferenzierten. Andere Reformulierungen der ursprünglichen Skalen verstehen diese nicht mehr als Operationalisierung von Maskulinität und Femininität, sondern von instrumentellen und expressiven Persönlichkeitsmerkmalen. Was sich geändert hat, sind die Kriterien, nach denen die Testergebnisse interpretiert werden,, weitgehend gleich geblieben sind aber die Inhalte der für Weiblichkeit und für Männlichkeit stehenden items. Herzlich, heiter, gefühlsbetont, sanft, kinderlieb, launisch usw. findet man auf den Femininitätsskalen, aggressiv, besonnen, ehrgeizig, selbstsicher, stark usw. auf den Maskulinitätsskalen. Eine soziologische Konzeptualisierung von Männlichkeit wird man auf der Basis solcher Bestimmungen, die kulturell verankerte Stereotype wiederholen, nicht entwickeln können. 51 sexualität. Die Differenz zwischen homosexuellen und heterosexuellen Männern gleicht derjenigen zwischen Männern und Frauen. Der Beginn des wissenschaftlichen Interesses an Problemen der männlichen Geschlechtsrollenidentifikation datiert in einer Epoche, als die amerikanische Gesellschaft mit einer massiven wirtschaftlichen Krise zu kämpfen hatte, in der Zeit der „Großen Depression". Pleck (1987, S. 27) versteht diese Krise nicht nur als eine ökonomische, sondern zugleich als eine gravierende Unterminierung der institutionellen Basis der traditionellen Männerrolle. Der Mann als Ernährer der Familie stand in Gefahr, diese Funktion nicht mehr erfüllen zu können4 ' . Unter anderen Auspizien und mit einer anderen Ausrichtung wiederholt sich gegenwärtig diese reaktive Anbindung sozialwissenschaftlicher Theoriebildung an eine Situation gesellschaftlichen Umbruchs in Gestalt der „men's studies", die ohne die feministische Infragestellung des traditionellen Geschlechterarrangements wohl kaum entstanden wären (s. Kap. 3.2). Diese explizite `Männerforschung' hat das Konzept der männlichen Geschlechtsrolle als leitendes Paradigma einer soziologischen Konzeptualisierung von Männlichkeit abgelöst. Insgesamt hat die Geschlechtsrollentheorie seit den siebziger Jahren einen Bedeutungsverlust erfahren (vgl. Pleck 1987, S. 36), und zwar genau in dem Maße, in dem im Zuge der Frauenforschung zunächst klassentheoretische und dann konstruktivistische Perspektiven an Boden gewonnen haben. In die Soziologie hat das Konzept der Geschlechtsrolle vor allem durch die Arbeiten von Talcott Parsons Eingang gefunden. Mit der Verknüpfung von psychoanalytischer Entwicklungstheorie und strukturfunktionalistischer Soziologie hat Parsons die elaborierteste und theoretisch anspruchsvollste Version der Geschlechlechtsrollentheorie vorgelegt. Parsons' Bezugsrahmen ist nicht die Geschlechter-, sondern die Familiensoziologie. Die Sozialisation in der Kernfamilie steht im Fokus, und der Aneignung der männlichen Geschlechtsrolle gilt eine besondere Aufmerksamkeit. Die strukturfunktionalistische Perspektive auf Geschlechtsrollen im allgemeinen und auf die familialen Rollen von Frau und Mann im besonderen fragt danach, welche Motivationen die Angehörigen beider Geschlechter entwickeln müssen, damit die Reproduktion der Gattung gewährleistet ist (vgl. Ritzer 1983, S. 226). Institutionalisierung von Heterosexualität sowie die Tabuisierung von Homosexualität und von Inzest treten an die Stelle fehlender Instinktsteuerung. Für Parsons sind dies universell anzutreffende Muster, die im familialen Sozialisationsprozeß anzueignen sind. Normale Erwachsenensexualität zeichnet sich dadurch aus, daß die erotischen Bedürfnisse mit dem Wertsystem der Gesellschaft in Übereinstimmung stehen 4 z. 41 42 52 Wie der empirische Teil zeigen wird, hat die Funktion des Familienernährers in bestimmten Männerwelten nichts an identitätsstiftender Funktion verloren (s. Kap. 7.2). Eine anders strukturierte Sexualität bezeichnet Parsons (1964a, S. 225) als „regressiv". „In its involvement in the sozial system in a larger way the erotic love relationship is universally associated with marriage, reproduction, and parenthood. ... The erotic love relationship itself is thus tied in with the acceptance of the parental roles and their responsibilities" (Parsons 1964a, S. 390). Das ist der Bezugspunkt, von dem aus Parsons weibliche und männliche Geschlechtsrollen sowie deren Aneigung in der Primärsozialisation analysiert. Die Sozialisation des Mädchens muß beispielsweise gewährleisten, daß dieses fähig wird, später eine reife Bindung („mature attachment") zu einem Mann einzugehen (S. 224). Die Geschlechtsrollen erfahren ihre spezifische Ausprägung im Hinblick auf die funktionalen Anforderungen des Gesellschaftssystems. Parsons nimmt an, daß die Familie im allgemeinen in der Lage ist, die Kinder entsprechend zu sozialisieren 43 . Geschlechtsrollenorientierungen müssen in der Sozialisation erworben werden und sind somit Produkt sozialer Praxis, sie haben aber einen Bezugspunkt in anatomischen Unterschieden, sind mithin nicht beliebig. „Obwohl natürlich die anatomischen Unterschiede der Geschlechter fundamentale Bezugspunkte für die Entwicklung von Orientierungen abgeben, ist es für das Kind erforderlich, die Bedeutung dieser Fakten für die Verhaltenserwartungen zu erlernen, von denen die Rollendifferenzierungen der beiden Geschlechter geprägt werden" (Parsons 1968, S. 55). Die soziale Geschlechtsrollendifferenzierung macht sich den anatomischen Unterschied zu Nutzen, um die Rollen eindeutig bestimmten Kategorien von Akteuren zuzuweisen, die Inhalte der Rollen sind jedoch durch jenen Unterschied nicht präformiert. Männliche und weibliche Geschlechtsrollen sind entlang der Achse „instrumentell-adaptiv" versus „expressiv-integrativ" differenziert und folgen damit einem allgemeinen und elementaren Muster der funktionalen Differenzierung sozialer Systeme (vgl. Parsons/Bales 1955, S. 22£) 44 . Instrumentelle Rollen sind vor allem auf die Verwirklichung von Systemzielen gerichtet, expressive auf die Integration der Gruppe. Parsons sieht 43 44 Die funktionalistische Perspektive bedeutet nicht, daß Parsons nicht auch die Möglichkeit von Spannungen und Inkonsistenzen sieht. Diese sieht er vor allem in der Jugendkultur gegeben, für die er eine Art künstlicher Isolierung der romantischen Liebe von Heirat und folgender Elternschaft diagnostiziert (vgl Parsons 1964a, S. 391). Da die Jugendphase aber eine vorübergehende ist und gewöhnlich in eine normale Erwachsenenorientierung einmündet - in eine Berufsorientierung beim Mann, eine Familienorientierung bei der Frau (vgl. Parsons 1964b, S. 71) -, stellen solche Abweichungen kein gravierendes Problem für die Systemintegration dar. Neuere Parsons-Interpretationen betonen, daß Parsons - anders als popularisierte Versionen der Geschlechtsrollentheorie - die Geschlechtsrollen nicht als eine kulturelle Ausarbeitung des biologischen Dimorphismus begreift (vgl. Connell 1995, S. 22), daß er Geschlecht ebenso wie Alter und Verwandtschaft als sozial konstruiert konzipiert, da deren Bedeutung interkulturell variiert (vgl. Johnson 1993, S. 117). Das heißt jedoch nicht, daß die Geschlechtsrollen von den anatomischen Unterschieden entkoppelt wären (s. auch Fn. 45). 53 hierin „die Hauptachse der Differenzierung von Geschlechtsrollen in allen Gesellschaften" (1968, S. 58) 45 . Mit dem Erwerb der eigenen Geschlechtsrolle, der zugleich eine kognitive Aneignung des Systems der Geschlechtsrollendifferenzierung ist, wird dem Kind ein Grundprinzip funktionaler Differenzierung vermittelt. Die geschlechtliche Sozialisation ist also in einem fundamentalen Sinne eine Einübung in die Gesellschaft. Die Geschlechtsrollenkategorisierung ist, „abgesehen vom Alter, die erste universalistische Kategorisierung, auf die das Kind stößt; sie ist von fundamentaler struktureller Bedeutung für die Gesellschaft als Ganzes" (Parsons 1968, S. 56). Parsons betont die Bedeutung der Geschlechtsrolle für die strukturelle Differenzierung von Gesellschaften, die ohne eine deutliche Unterscheidung weiblicher und männlicher Rollen nicht möglich wäre. Wichtig sind hier die Komponenten der Geschlechtsrolle, die auf die außerfamiliäre Sphäre bezogen sind. Die männliche Rolle erweist sich für Parsons in diesem Zusammenhang als wichtiger als die weibliche, denn die außerfamiliären Komponenten treten bei jener „unvermeidlich mehr hervor" (1968, S. 61). Die Unvermeidlichkeit resultiert aus der differentiellen Zuweisung instrumenteller und expressiver Funktionen an die Geschlechter und aus der damit verbundenen Zuweisung öffentlicher und privater Rollen 46. Die zentrale lebensgeschichtliche Aufgabe des Jungen sieht Parsons in Anlehnung an die psychoanalytische Theorie der Überwindung des Ödipuskomplexes in der Ablösung von der Mutter, in der Überwindung einer ur sprünglich weiblichen Identifikation. In diesem Zusammenhang betont er die Notwendigkeit des „Vatersymbols". Die Vaterrolle stellt „zweifellos einen der Grundsteine der sozialen Struktur dar - nicht nur in der Kernfamilie, sondern in allen Verwandschaftssystemen" (1968, S. 47). Die Bedeutung des 45 46 54 Parsons kritisiert an dieser Stelle Margaret Meads These, derzufolge es Gesellschaften gibt, in denen die Zuweisung von instrumentellen und expressiven Funktionen an die Geschlechter genau umgekehrt zu der von Parsons behaupteten allgemeinen Regel geschieht. Parsons erscheint dies „zweifelhaft in Anbetracht der weiblichen Funktionen bei der Fürsorge für das Kind" (1968, S. 58, Fn. 2). Wenn auch die anatomischen Unterschiede keine Inhalte von Geschlechtsrollen vorgeben, so stellt sich Parsons die Zuweisung der elementaren Funktionen an die Geschlechter dennoch nicht als losgelöst von körperlichen Voraussetzungen dar. An anderer Stelle bemerkt er zum Symbolismus des Geschlechtsverkehrs, der Mann in seiner instrumentellen Rolle sei der Initiator, „with his penis as instrument, the main active ` giver of pleasure' to both partners; ... The woran, an the other hand is not only typically more passive and receptive, but by admitting the penis and ` embracing' it in her vagina, she may be said to be symbolizing her acceptance of the relationship and of her partner in it" (Parsons/Bales 1955, S. 151, Fn. 11). Anatomische Unterschiede prädestinieren zumindest für die Zuweisung differenter sozialer Funktionen. Und auch innerhalb der Berufssphäre wiederholt sich dieses Muster. Typische Frauenberufe wie Lehrerin, Sozialarbeiterin, Krankenschwester, Sekretärin haben starke expressive Komponenten und stehen zu männlichen Rollen oft in einer unterstützenden Funktion (vgl. Parsons/Bales 1955, S. 15, Fn. 13). Vatersymbols ist nicht auf die Beziehung zu den Kindern begrenzt. Über den sozialisatorischen und den familiären Aspekt hinaus ist der Vater eine symbolische Figur von allgemeiner kultureller Tragweite. Der jüdisch-christliche Gott-Vater verdeutlicht dies eindringlich (vgl. S. 68)4 '. Was den Vater für die Geschlechtsrollensozialisation bedeutsam macht, ist nicht allein seine Position innerhalb der Familie, sondern, daß seine männliche Rolle - anders als die weibliche Rolle der Mutter - über die Grenzen der Familie hinausweist. Der Vater ist „als Mann mit besonderer Beziehung zu seiner Rolle außerhalb der Familie und zu den kulturellen Werten, die er hinsichtlich extrafamiliarer Angelegenheiten vertritt, der entscheidende Mittelpunkt für das Kind" (Parsons 1968, S. 62). Aus der Verbindung familialer und öffentlicher Rollen erwächst dem Vater eine doppelte Bedeutung für den geschlechtlichen Sozialisationsprozeß. Insofern als seine Berufsrolle Teil der Familienrolle ist (Ernährer der Familie), wird er zum „instrumentellen Führer" des Familiensystems (vgl. Parsons/ Bales 1955, S. 13). Er ist erstens die Autoritätsfigur in der Familie, die dem Kind - so Parsons in Anlehnung an die psychoanalytische Theorie - zur Ablösung von der Mutter verhilft; und ihm kommt zweitens die Funktion zu, gesellschaftliches Rollenmodell zu sein (Identifikationsfigur für den Jungen, Männlichkeitsideal für das Mädchen). Der Vater ist für die Kinder der „Prototyp der `Männlichkeit"` (S. 56), er symbolisiert aber auch Statusdifferenzen. Eine ambivalente Haltung der Kinder gegenüber der Vatergestalt ist die Folge - zwischen Bewunderung und Angst, zwischen Respekt und Aggression. Der universalistisch orientierte Vater hat als Mittler zwischen der auf unmittelbare Gegenseitigkeit gegründeten Welt der Familie und der durch ökonomische Rationalität geprägten Welt des Berufs die Funktion, den Kin dern die Wertorientierungen der Erwachsenenwelt zu vermitteln (vgl. Parsons 1964a, S. 224). In Gestalt des Vaters kommt das Leistungsprinzip innerhalb des familiären Raums zur Geltung. Die Mutter ist dazu wegen ihrer stärker partikularistischen Orientierung nicht in der Lage. Da ihre Rolle auf den Binnenraum der Familie bezogen ist, kann sie universalistische Prinzipien, die für strukturell differenzierte Systeme typisch sind, nicht in dem Maße repräsentieren wie der Vater. Diese Funktionsbestimmug gilt zunächst für die Beziehung des Vaters zur Tochter wie zum Sohn 48 . Für den Jungen erweist sich der Vater von wei47 48 Parsons sieht die Macht dieses Symbols in Zusammenhang damit, „daß die Bindung der Kultur an das Verwandtschaftssystem als solches überwunden wurde" (1968, S. 68). In dem Aufsatz über das „Vatersymbol" (Parsons 1968, S. 46-72), in dem Parsons über dessen Bedeutung für die Geschlechtsrollensozialisation schreibt, findet eine interessante, aber vom Autor nicht kenntlich gemachte Perspektivenverschiebung statt. Der Aufsatz befaßt sich auf den letzten Seiten nur noch mit der Vater-Sohn-Beziehung bzw. mit der Be55 tergehender Bedeutung. Die Übernahme der männlichen Geschlechtsrolle geschieht im Modus der „`Identifizierung' mit dem Vater" als Verinnerlichung einer allgemeinen Vaterrolle („exrafamiliäre Komponente") und als Verschmelzung „mit dem allgemeinen Muster der männlichen Rolle in der jeweiligen Gesellschaft" („extrafamiliäre Komponente") (Parsons 1968, S. 67). Eine positive Geschlechtsrollenidentifizierung sieht Parsons nicht nur als wichtig an, um Selbstverstrauen in der eigenen Geschlechtsrolle zu entwikkeln. Im Hinblick auf soziale Integration sind drei weitere Aspekte bedeutsam. Eine positive Identifikation ist Voraussetzung dafür, erstens, daß die Rolle adäquat ausgefüllt werden kann, vor allem in ihrem relationalen Gehalt, in ihrer Bezogenheit auf die weibliche Komplementärrolle, zweitens, daß eine Bereitschaft zur späteren eigenen Übernahme einer Vaterrolle ausgebildet wird, und drittens, daß weitere Rollenspezifizierungen entwickelt werden (vgl. S. 69) 49 . Wie wichtig für Parsons eine positive, d.h. den Normen von Heterosexualität und Reproduktionswilligkeit verpflichtete Geschlechtsrollenidentifikation des Mannes ist, zeigt die Beschreibung eines Negativbeispiels für mißlungene Geschlechtsrollensozialisation. „Es darf ... vermutet werden, daß die typische Haltung des sogenannten `Wolfs' gegenüber Frauen, um ein vertrautes amerikanisches Beispiel zu nehmen, ein fundamental ambivalentes Verhältnis zur Männlichkeit einschließlich der eigenen Übernahme einer Gatten-Vater-Rolle offenbart. Die positive Seite kommt in dem Bedürfnis zum Ausdruck, Frauen zu beeindrucken und zu beherrschen, die negative in der Unfähigkeit, die normale Verantwortung zu akzeptieren, die zu einer sozial integrierten geschlechtlichen Beziehung gehören sollte, und oft in dem unbewußten Verlangen, Frauen zu verletzen, sie zu verführen und dann zu verlassen. Es dürfte wahrscheinlich sein, daß ein derartiges Muster in der Regel eine unvollständige Identifizierung mit einer stabilen Vatergestalt, vielleicht auch eine Komponente femininer Identifizierung enthält, der gegenüber die übertriebene und verzerrte Männlichkeit eine 49 56 deutung des Vatersymbols für die Aneignung der männlichen Geschlechtsrolle. Man könnte argumentieren, daß dies die unterschiedliche Bedeutung des Vaters für weibliche und männliche Geschlechtsrollensozialisation reflektiert. Dies allerdings tut Parsons nicht, er begründet seine Perspektivenbegrenzung nicht. Man mag das als einen impliziten `male bias' der Parsonsschen Theorie bezeichnen. Allerdings hebt Parsons sich von einer in den Sozialwissenschaften verbreiteten und unter dem Stichwort von der `Männlichkeit der Wissenschaft' kritisierten Praxis in gewisser Weise ab. Auf männliche Erfahrungswelten bezogene Aussagen werden nicht umstandslos zu allgemeinen, geschlechtsneutralen Thesen generalisiert, die Geschlechtsbezogenheit bleibt deutlich sichtbar. Erste weitere Rollendifferenzierungen finden nach Parsons im Anschluß an die familiale Primärsozialisation statt. Voraussetzung ist freilich eine klare Geschlechtsrollenidentität. „Das nach-ödipale Kind tritt eindeutig als Junge oder Mädchen kategorisiert in das System der formalen Erziehung ein, aber weiter ist seine Rolle noch nicht differenziert" (Parsons 1968, S. 166). Bei Schuleintritt ist das Geschlecht die einzige Basis einer formellen Statusdifferenzierung. Eine strukturelle Differenzierung erfolgt dann zunehmend nach dem Kriterium der Leistung. Reaktionsbildung darstellt. Mit anderen Worten, der Wolfdürfte häufig latent homosexuell sein" (1968, S. 69). Eine positive männliche Geschlechtsrollenidentifikation kombiniert maskuline Dominanz mit Verantwortlichkeit für Frau und Familie. Sowohl Homosexualität als auch Machismo (Frauen verführen und dann verlassen) stellen Abweichungen dar. Parsons entwirft ein - implizit normatives - Modell einer Einheitsmaskuiinität, demgegenüber andere Formen als „übertriebene und verzerrte Männlichkeit" erscheinen. Innerhalb des Rahmens dieses einheitlichen Modells sind freilich Variationen möglich. Der Inhalt der Männerrolle „wird entsprechend der Rollenstruktur der Gesellschaft stark variieren" (S. 67). Heterosexualität, Reproduktionswilligkeit und Verantwortlichkeit für Ehe und Familie stellen allerdings universale Grundpfeiler der männlichen Geschlechtsrolle dar1o. Parsons familiensoziologisch und sozialisationstheoretisch fundierte Ausarbeitungen des Konzepts der Geschlechtsrollenorientierung lassen ein Konzept von Männlichkeit erkennen, das diejenigen Eigenschaften, die bei dem amerikanischen middle class-Mann der fünfziger Jahre (Angestellter und Vater in einer Kleinfamilie mit nicht berufstätiger Mutter) zweifelsohne typischerweise zu beobachten gewesen sind, zu transhistorischen und transkulturellen Attributen der männlichen Geschlechtsrolle hypostasiert. Das sind im einzelnen: eine universalistische Orientierung, affektive Neutralität, instrumentelle Zielverfolgung, Betonung von Leistung. Wie bereits die Tönniesschen Dichotomien" und wie Simmels These vom Mann als dem differenzierteren Geschlecht reflektieren auch die Parsonsschen Ausführungen in gewisser Hinsicht eine gesellschaftliche Praxis, versäumen es aber, diese Praxis als eine gesellschaftliche zu benennen, d.h. zu berücksichtigen, daß sie wie alle Praxis kontingent ist. Die Parsonssche Geschlechtsrollentheorie faßt Männlichkeit implizit als Leistung und damit als etwas, was ein Mann, wie das Beispiel des „Wolfs" zeigt, auch verfehlen kann. Es ist nicht zufällig, daß Parsons sich explizit mit Problemen der männlichen Geschlechtsrollenidentifikation befaßt, nicht aber mit solchen der weiblichen. Wie schon bei Tönnies, bei Simmel und bei Durkheim erscheint Weiblichkeit eher als unmittelbar gegeben, von daher auch nicht zu verfehlen 5 z. Auch spricht Parsons von gesellschaftlichen Varia50 51 52 An anderer Stelle bemerkt Parsons, der Inhalt von Maskulinität und Femininität habe sich in der amerikanischen Familie geändert, das Prinzip der Differenzierung sei jedoch keineswegs ungültig geworden (vgl. Parsons/Bales 1955, S. 24). Den Parsonsschen „pattern-variables" liegt eine ähnliche Logik zugrunde wie den Tönniesschen Dichotomien von Gemeinschaft und Gesellschaft (vgl. Jensen 1 980, S. 59). Eine feministische Fortführung dieses Denkens stellt Chodorows (1985) bekannte Schrift „Das Erbe der Mütter" dar. An Freud, aber auch an Parsons anknüpfend, beschreibt sie den Prozeß der Ablösung des Jungen aus der primären Mutterbindung als einen krisenhaft verlaufenden Prozeß, der dem Jungen Anstrengungen abverlangt, die das Mädchen, das das 57 tionen nur bei der männlichen Rolle. Das korrespondiert mit der Annahme, daß Differenzierung ein Prinzip instrumenteller, nicht aber expressiver Rollen ist (vgl. Zahlmann-Willenbacher 1979, S. 66). Der Rahmen der weiblichen Erwachsenenrolle ist spätestens mit der Heirat gesetzt. „Mit der Heirat ist der grundsätzliche Status der Frau festgelegt, und danach geht es in ihrem Rollenmuster nicht mehr so sehr um Statusbestimmung, als vor allem darum, entsprechend den an sie gestellten Erwartungen zu leben und dabei befriedigende Interessen und Tätigkeiten zu finden" (Parsons 1964b, S. 77). Zwar sieht Parsons, daß auch die weibliche Erwachsenenrolle Elemente von Spannung und Unsicherheit enthält, diese manifestieren sich aber anders als beim Mann, nämlich in neurotischem Verhalten. Solches Verhalten stellt aber keine Abweichung von der Rolle dar, wie es Homosexualität oder Machismo beim Mann sind. Wie generell bei Parsons die Betonurig der normativen Integration der Gesellschaft auf Kosten einer Analyse von Macht- und Herrschaftsverhältnissen geht, so auch in seiner Geschlechtsrollentheorie. Seine familiensoziologi schen Arbeiten thematisieren Machtaspekte nur im Verhältnis der Generationen, nicht aber in dem der Geschlechter. Zumindest für die amerikanische Familie diagnostiziert er ein nahezu vollständiges Machtgleichgewicht von Frau und Mann. Den Grund sieht er in der hohen Bedeutung, die universalistischen Werten in dieser Gesellschaft zukommt (vgl. Parsons/Bales 1955, S. 152). Der Vater ist Familienoberhaupt nur in dem Sinne, daß er die Familie repräsentiert und daß er für deren Unterhalt zuständig ist, nicht aber in dem Sinne, daß er sie dominiert. Parsons verkennt, daß die Differenzierung der Funktionen entlang der Achse instrumentell/expressiv dem Mann in seiner instrumentellen Rolle Macht gegenüber der Frau in ihrer expressiven Rolle verleiht, zumindest unter den Bedingungen der Kleinfamilie in einer industrialisierten Gesellschaft. Allerdings wäre eine solche Analyse auf der Basis seiner Begrifflichkeit durchaus möglich (vgl. Johnson 1993, S. 124f.). Abgesehen davon, daß Parsons Machtstrukturen hätte beobachten können, vor allem die ökonomische Abhängigkeit der Ehefrau, fällt er konzeptionell hinter die Simmelsche Einsicht zurück, daß in einem sozialen Verhältnis eine Seite sich zum Absoluten aufschwingt und in der Normierung der Relation die andere Seite dominiert (s. Kap. 1.2). Aber auch in seinem eigenen Modell kommt den expressiven Rollen eine unterstützende Funktion für die instruIdentifikationsobjekt nicht wechseln muß, nicht auf sich nehmen muß. Oberhaupt haben Parsonssche Konzepte einen größeren Widerhall in der feministischen Theoriebildung gefunden, als man anzunehmen geneigt ist. Gilligans (1984) Unterscheidung einer weiblichen Fürsorge- und einer männlichen Gerechtigkeitsmoral weist den Geschlechtern Eigenschaften zu, die sich auf der Achse expressiv/instrumentell abbilden lassen. Freilich nimmt der feministische Diskurs eine Umwertung vor. Die Gleichwertigkeit, wenn nicht Höherwertigkeit expressiver Werte wird betont. 58 mentellen zu, so daß sich schwerlich eine Gleichwertigkeit der beiden annehmen läßt, zumindest nicht unter den Bedingung einer männlich dominierten Gesellschaft (vgl. Tuana 1993, S. 284f.) 53 . Obwohl die Geschlechtsrollentheorie und auch Parsons - entgegen einem verbreiteten Mißverständnis - weder den Wandel von Geschlechtsrollen noch Phänomene wie Rollenkonflikt und Rollenstress ausblenden 54 , ist das funk tionalistische Verständnis gleichwohl von der Annahme einer prinzipiellen Gleichgerichtetheit von sozialen Institutionen, Rollennormen und Persönlichkeitsstrukturen bestimmt (vgl. Connell 1995, S. 23). Erst in Folge der feministischen Kritik sowohl am Geschlechterverhältnis selbst als auch an dem theoretischen Konzept, mit dem die Sozialwissenschaften dieses Verhältnis begrifflich fassen", stehen Wandel, Rollenstress, vor allem aber der Aspekt der Macht im Fokus der Diskussion über Geschlechtsrollen. Und in Reaktion auf' die feministische Kritik expandiert in den siebziger Jahren die Forschung zur männlichen Geschlechtsrolle. Die männliche Geschlechtsrolle wird neu und in kritischer Perspektive vermessen. Große Popularität, nicht nur innerhalb der sozialwissenschaftlichen Diskussion, erlangt Brannons (1976) Bestimmung von vier normativen Dimensionen: „No sissy stuff ` meint die Vermeidung alles Weiblichen. Diese Negativabgrenzung stellt die elementarste Norm dar, wichtiger als die folgenden positiv formulierten Erwartungen. „The big wheel" steht für Erfolgs- und Statusorientierung, für Überlegenheit gegenüber anderen, „the sturdy oak" für Härte, Unabhängigkeit und Selbstvertrauen und „giv ` ein hell" für Aggressions- und Risikobereitschaft, auch für Bereitschaft zu Gewalt, sollte diese `nötig' sein. Die positiv formulierten Erwartungen verweisen auf instrumentelle Orientierung und Aktivität. Diese neue Forschung zur männlichen Geschlechtsrolle fragt des weiteren danach, welche Folgen der soziale Wandel des Geschlechterverhältnisses 53 54 55 Luhmann (1988, S. 49) bemerkt, „daß anschlußfähige Unterscheidungen eine (wie auch i mmer minimale, wie immer reversible) Asymmetrisierung erfordern". Eine Unterscheidung der Geschlechter nach expressiven und instrumentellen Rollen ist nicht neutral hin sichtlich der Dimensionen von Macht, Herrschaft und Ungleichheit, zumindest solange nicht, wie Geschlecht selbst ein potentiell omnirelevantes Strukturmerkmal sozialer Interaktion und Organisation ist. In seinem 1942 erschienenen Aufsatz über „Alter und Geschlecht in der Sozialstruktur der Vereinigten Staaten" befaßt sich Parsons (1964b) eingehend mit der Modernisierung der weiblichen Rolle und geht auch auf Probleme der Männerrolle ein. - Eine andere Frage ist, inweiweit das Konzept der Geschlechtsrolle selbst das begriffliche Instrumentarium bereithält, um Prozesse sozialen Wandels erklären zu können (s.o.). Die feministische Kritik - genausowenig wie man von Klassen- oder Rassenrollen spreche, mache es Sinn, von Geschlechtsrollen zu sprechen; die Rollenbegrifflichkeit vernachlässige notwendig das Element der Unterdrückung im Geschlechterverhältnis - hat paradoxerweise zumindest nicht zu einem quantitativen Bedeutungsverlust der Geschlechtsrollenforschung geführt. Auch wenn das Konzept in der feministischen Theoriebildung eher das Dasein eines `armen Verwandten' fristet, „sex role research boomed as never before with the growth of academic feminism" (Connell 1995, S. 23). 59 für den Mann hat. Dabei gilt als empirischer Kontrolle nicht zu unterziehende Prämisse: „Sex roles are reciprocal in any society. Changes taking place among women inevitably affect men" (Harrison 1978a, S. 324). Auf diesem Hintergrund sind die popularisierten Thesen über eine weit verbreitete Krise des Mannes oder über die männliche Inexpressivität entstanden. Dem liegen oft simple Umkehrschlüsse zugrunde. Wenn die weibliche Rolle sich durch Expressivität auszeichnet, dann die männliche durch das Gegenteil. Wenn Frauen die Vorherrschaft des Mannes attackieren, dann kann dies nicht ohne Auswirkungen auf Seiten der Männer bleiben. Der empirische Teil wird zeigen, daß solche Schlüsse vielfach Kurzschlüsse sind, daß sie zumindest unzulässig generalisieren. Daß weibliche und männliche Rollen nicht in einem Verhältnis `kommunizierender Röhren' zueinander stehen, verdeutlicht auch eine Studie von Thompson und Pleck (1987) über männliche Rollennormen, die mit Hilfe einer Geschlechtrollenskala ermittelt werden. Als Ergebnis halten die Autoren fest, daß „moderne" Einstellungen gegenüber Frauen mit traditionellen gegenüber Männern einhergehen können, daß ein Wandel der Einstellungen zu Frauen nicht notwendig einen ebensolchen hinsichtlich des eigenen Geschlechts nach sich zieht. Die Folgen, die der Wandel des Geschlechterverhältnisses für die Männer hat, werden unter den Stichworten Rollenkonflikt und Rollenstress thematisiert. Zwang und negative Aspekte der Männerrolle werden in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt (vgl. O'Neil 1982, Solomon 1982). In einer zeitdiagnostischen Perspektive wird konstatiert, daß seit den siebziger Jahren Kannsein bedeutet, mit einer Fülle von Unsicherheiten und widersprüchlichen Anforderungen leben zu müssen. Zwar sind Männer nicht Opfer geschlechtlicher Diskriminierung, aber durch die rigide Geschlechtsrollensozialisation erfahren auch sie Unterdrückung. Trotz veränderter Geschlechterverhältnisse sind nur wenige neue Rollen entstanden, so daß ein defensives Verhalten der Männer vorherrscht. Der männlichen Geschlechtsrolle werden krankmachende Eigenschaften attestiert. „Warning: the male sex role may be dangerous to your health" lautet der Titel eines im „Journal of Social Issues" erschienen Aufsatzes (Harrison 1978b). Eine hohe Übereinstimmung zwischen dem „Idealbild des traditionellen Mannes" und der „Risikopersönlichkeit des Infarktpatienten" wird entdeckt (vgl. Raisch 1986, S. 86f.). Die höhere Suizidrate des Mannes wird auf der Folie von Rollenstress interpretiert. Basis für Geschlechtsrollenstress und -konflikt sei die Angst vor Weiblichkeit, Äußerungsformen seien eine restriktive Emotionalität, Homophobie, Kontroll- und Machtstreben sowie ein restriktives Sexualverhalten (insbesondere Phallusfixierung). Diese Beschreibung der männlichen Geschlechtsrolle unterscheidet sich von derjenigen, wie sie etwa Parsons gibt, darin, daß sie die instrumentellen Aspekte der männlichen Rolle nicht im Hinblick auf ihre Funktionalität für ein soziales System analysiert, sondern in ihrer Wirkung auf die individuelle 60 männliche Psyche. Die implizit positive Konnotation von Instrumentalität erfährt dabei eine Umdeutung ins Defizitäre. Mit dieser Tendenz steht diese Forschung zur männlichen Geschlechtsrolle der populären Männerliteratur sehr nahe, die sich ebenfalls in den siebziger Jahren entwickelt hat (vgl. Kap. 6.1). Wissenschaftliche Forschung und popularisierender Diskurs sind eng miteinander verbunden, wie die zitierte Warnung vor den Gefahren der Männerrolle zeigt56. Am deutlichsten wird diese Verwobenheit anhand der These von der Krise des Mannes. Es gilt als ausgemacht, daß es eine solche gibt und daß sie in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden ist (vgl. Brittan 1989, S. 25) 57. Trotz des seit den siebziger Jahren zu verzeichnenden immensen Anstiegs an Arbeiten, die eine kritische Perspektive auf Rollennormen beinhalten, erfährt die Geschlechtsrollentheorie unvermindert Kritik sowohl von seiten der Frauenforschung als auch von seiten der ebenfalls in den Siebzigern entstandenen ` men's studies'. Diese Kritik richtet sich auf Schwachstellen des grundlegenden Konzepts, das im übrigen seit den Arbeiten Parsons keine entscheidende Weiterentwicklung erfahren hat (vgl. Connell 1987, S. 49ff.; 1995, S. 24ff.; Kimmel 1987b, S. l lff., Stacey/Thome 1985; West/ Fenstermaker 1993, S. 153ff.): Die Geschlechtsrollentheorie verfügt über keine Begrifflichkeit, um Macht-, Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse zu analysieren. Dem steht die Idee der Komplementarität der weiblichen und der männlichen Rolle entgegen. Wenn Aspekte von Macht und Oppression thematisiert werden, dann geschieht das mit dem Tenor, daß die Geschlechtsrollen an sich und für beide Geschlechter gleichermaßen unterdrückende Effekte haben, indem sie einer freien Entfaltung des Selbst entgegenstehen58. Eine Analyse von Macht und Herrschaft in gesellschaftstheoretischen Kategorien findet nicht statt. Biologisches Geschlecht (sex) und soziales Geschlecht (gender) werden nicht deutlich voneinander unterschieden. Indem alle Erscheinungsformen von Männlichkeit und Weiblichkeit auf einen einzigen Dualismus von zwei homogenen Kategorien reduziert werden, entsteht eine Parallelisierung der Geschlechtsrollen mit dem biologischen Dimorphismus. In 56 57 58 In einer Literaturbesprechung zum Thema Männerrolle und Männerleben finden wissenschaftliche, populärwissenschaftliche und sonstige Bücher gleichermaßen Berücksichtigung (vgl. Harrison 1978a). Zur Absicherung der eigenen Thesen wird häufig auf Bücher der ` Bewegungsliteratur' verwiesen. Eine rollentheoretische Beschreibung dieser Krise gibt Pleck (1981) in seinem für den sozialwissenschaftlichen Männlichkeitsdiskurs wichtigen Buch „The Myth of Masculinity". Diesem Verständnis von Unterdrückung liegt die Konzeption eines außergeseilschaftlichen Ichs zugrunde, das gegenüber der „ärgerlichen Tatsache der Gesellschaft" (Dahrendorf 1974. S. 20) von vornherein auf verlorenem Posten steht. 61 Entsprechung zu diesem wird ein Modell von zwei fixierten, statischen und sich gegenseitig ausschließenden sets von Rolleninhalten formuliert. Die Statik des Konzepts macht es unfähig, einen Wandel des Geschlechterverhältnisses zu erklären. Dieser geschieht mit den Geschlechtsrollen und verändert sie, z.B. als Folge von Entwicklungen im ökonomischen oder technologischen Bereich. Der Wandel kann nicht als Ergebnis eines Prozesses erfaßt werden, der im Geschlechterverhältnis selbst abläuft. Bedingt durch die dem funktionalistischen Rollenmodell inhärente Idee einer normativen Integration der Gesellschaft beziehen sich die Forschungen allein auf die Ebene von Erwartungen und Normen. Deren Konsequentialität und Effektivität für die soziale Praxis wird angenommen, nicht aber empirisch überprüft. Zahlreiche Arbeiten innerhalb der Geschlechtsrollentheorie (nicht Parsons!) tendieren dazu, Rollenattribute als individuelle Eigenschaften der Person zu begreifen; eine Perspektive, die für die allgemeine Rollentheorie nicht typisch ist. Das hängt zum einen mit der Rückbindung an das biologische Substrat zusammen, zum anderen damit, daß Geschlechtsrollen, sobald sie erworben sind, lebenslang gültig sind. Der Terminus „sex role", dem erst in jüngster Zeit mit demjenigen der „gender role" Konkurrenz erwachsen ist, reflektiert die Zuweisung von Rollenattributen ad personam auf begrifflicher Ebene. In der allgemeinen Rollentheorie ist eine soziale Rolle auf eine bestimmte Position in einer bestimmten interaktiven Konstellation bezogen und betrifft den Rollenträger nur in bestimmten Segmenten seines sozialen Handelns (Lehrerrolle, Vaterrolle). Die potentielle Omnirelevanz der Geschlechtsrolle macht virtuell jede soziale Situation zu einem Anwendungsfall und damit das gesamte Handeln eines Akteurs zum Geschlechtsrollenhandeln. Damit verliert die Kategorie an diskriminierender Schärfe. 2.2 Die soziale Konstruktion von Geschlecht. Männliche Dominanz und das Arrangement der Geschlechter Unter den theoretischen Ansätzen in der Soziologie sind die sozialkonstruktivistischen des Symbolischen Interaktionismus und der Ethnomethodologie diejenigen, die der Geschlechterthematik die größte Aufmerksamkeit gewidmet haben. Das gilt für die Anzahl einschlägiger Arbeiten, vor allem aber hinsichtlich des Stellenwerts, den dieser Gegenstand für die Theoriebildung hat. Während die zuvor diskutierten Theorien die gesellschaftliche Tatsache, daß es zwei und nur zwei Geschlechter gibt, als selbstverständlich voraussetzen, um auf dieser Basis nach Unterschieden zu suchen, impliziert die These von der sozialen Konstruktion des Geschlechts, daß die Konstitution der 62 Zweigeschlechtlichkeit selbst zum Topos der Forschung und der Theoriebildung gemacht wird. Das Selbstverständliche wird heuristisch in etwas Unwahrscheinliches, höchst Voraussetzungsvolles transformiert. Nicht nur das Verhältnis von Über- und Unterordnung, die Geschlechtszugehörigkeit selbst wird als soziale Konstruktion verstanden. Diese Perspektive ist vor allem von der Ethnomethodologie stark gemacht worden, zuerst von Harold Garfinkel (1967, S. 116ff.) in seiner Fallstudie über Agnes, eine Mann-zu-Frau-Transsexuelle. Für die Ethnometho dologie stellt das „passing" der Transsexuellen, das Überschreiten der Geschlechtsgrenzen, gleichsam ein unter Alltagsbedingungen ablaufendes Krisenexperiment dar. Durch die Rekonstruktion der Normalisierungsleistungen, welche die Transsexuellen erbringen müssen, um im angestrebten Geschlecht als kompetente und berechtigte Mitglieder akzeptiert zu werden, zeigt die Ethnomethodologie, daß Geschlechtszugehörigkeit mittels bestimmter Praktiken im Alltagshandeln und in Kooperation aller Beteiligten interaktiv hergestellt wird. Die Ausgangsfrage ethnomethodologischer Geschlechterforschung lautet: „How is a social reality rohere there are two, and only two, Benders constructed?" (Kessler/McKenna 1978, S. 3) Gefragt wird nach den Kriterien, an denen die Unterscheidung zwischen den Geschlechtern im Alltag festgemacht, nach denen Geschlechtszuschreibungen in sozialen Interaktionen vorgenommen werden. Die Bedeutung der primären und der sekundären Geschlechtsmerkmale, also von biologisch fundierten Kriterien, wird insofern als eher gering dargestellt, als es nicht Informationen über diese Merkmale sind, die den Handelnden in Interaktionen normalerweise zur Verfügung stehen. Dennoch ist in einem anderen Sinne Geschlechtszuschreibung wesentlich „Genitalzuschreibung", weil im Alltagswissen eine entsprechende Verknüpfung vorgenommen wird. Da die primären Geschlechtsmerkmale in der Mehrzahl alltäglicher Interaktionen nicht sichtbar sind, sprechen Kessler und McKenna von „kulturellen Genitalien" (S. 153f.). Auf der Basis einer experi mentellen Studie, in der Versuchspersonen Zeichnungen von Figuren vorgelegt bekamen, denen `eindeutige' primäre Geschlechtsmerkmale fehlten oder bei denen primäre und sekundäre nicht zusammenpaßten (z.B. Penis und Busen), und in der die Versuchspersonen aufgefordert wurden, das Geschlecht der jeweiligen Figur zu benennen, kommen Kessler und McKenna zu dem Schluß, daß unter den kulturellen Genitalien dem Penis Priorität zukommt. Den „male response blas", nur den Penis als einen eindeutigen Geschlechtsmarkierer zu sehen, bezeichnen sie als ein integrales Element der sozialen Konstruktion von Geschlecht: diese ist - zumindest in der abendländischen Kultur - zugleich die Konstruktion einer männlich dominierten Ordnung. Als generelle Devise alltäglicher Geschlechtswahrnehmung gilt: „See someone as female only rohen you cannot see them as male" (S. 158). Dem liegt nicht etwa eine größere Sichtbarkeit und Offensichtlichkeit männlicher 63 Geschlechtsmerkmale zugrunde, sondern die Konstruktion von Geschlecht geschieht in einer Weise, daß männliche Körpermerkmale als die offensichtlicheren wahrgenommen werden. „In the social construction of gender `male' is the primary construction" (S. 159) 59. Wie die Ethnomethodologie allgemein den prozessualen Charakter sozialer Wirklichkeit betont (`Vollzugswirklichkeit'), so auch beim Geschlecht, indem sie von „doing gender" spricht"' (West/Zimmerman 1987): Ein Ge schlecht hat man nur, indem man es tut. Geschlecht wird als praktischmethodische Routine-Hervorbringung („accomplishment") begriffen, die auf fortdauernder Interaktionsarbeit der Handelnden beruht. In der Beherrschung der entsprechenden Praktiken erweist sich die (geschlechtsbezogenene) Handlungskompetenz der Gesellschaftsmitglieder. Gegenstand der Analyse sind nicht individuelle Handlungsvollzüge, sondern Interaktionsverhältnisse und institutionelle Arrangements. Geschlecht wird als emergierende Eigenschaft sozialer Situationen, „doing gender" als unvermeidliche Aufgabe in jeder Situation verstanden"' (vgl. West/Zimmerman 1987; West/Fenstermaker 1993; 1995). Die ethnomethodologische Analyse löst auch die vertraute sex-genderUnterscheidung konstruktivistisch auf. Gewöhnlich wird mit „sex" das biologische Substrat und mit „gender" die soziale Zugabe, Ausarbeitung, Ober formung bezeichnet. Die Differenz der Geschlechter als solche und nicht nur die Zuweisung binär codierter Eigenschaften zu vorhandenen Geschlechtern ist der ethnomethodologischen Sichtweise zufolge sozial erzeugt. Wie Hirschauer zeigt, ist der Körper immer ein `kultureller Körper', und auch die Wissenschaft, die ihn als nicht-kulturellen erforscht und vermißt, die Biologie, schließt an kulturell etablierte Wissensbestände über die Tatsache der Zweigeschlechtlichkeit an: „Dem theoretischen Interesse an Unterschieden geht ein praktisches an Unterscheidungen voran" (Hirschauer 1993, S. 24). Mit ihrer konsequent konstruktivistischen Fassung des Geschlechterbegriffs will die Ethnomethodologie das Problem überwinden, daß neue Ansätze zur Analyse der Ungleichheit der Geschlechter auf alten Konzepten von Geschlecht basieren (vgl. West/Fenstermaker 1993, S. 151). Mit dem Vor59 60 61 64 Die von Kessler und McKenna beobachteten Versuchspersonen reproduzieren ein Wahrnehmungsmuster, das eine lange und `ehrwürdige' Tradition hat. So schreibt etwa Simmel (1985, S. 28) über den körperlichen Unterschied von Mann und Frau: „Die Oberfläche des männlichen Körpers ist mehr differenziert als die des weiblichen. Das Knochengerüst tritt energischer hervor, macht sich durch Hebungen und Senkungen bemerkbar, während bei dem Weibe die gleichmäßigeren Fettpolster den Körper als eine mehr ebene, nur in groben Zügen gehobene und gesenkte Fläche erscheinen lassen". Der Begriff „doing gender" läßt sich nicht angemessen ins Deutsche übersetzen. ` Geschlechtshandeln' gäbe nicht wieder, daß das Geschlecht selbst `getan' werden muß. Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der ethnomethodologischen These, daß „doing gender" eine Aufgabe ist, die sich immer und überall, in jeder sozialen Situation, stellt, vgl. Hirschauer 1994. schlag, Geschlecht als soziale Praxis und nicht als eine individuelle Eigenschaft zu begreifen, hofft sie, die Frage beantworten zu können, wie soziale Strukturen mitsamt den Prozessen sozialer Kontrolle, welche die Strukturen befestigen, in Interaktionen produziert und reproduziert werden. „Gender is obviously muck more than a role or an individual characteristic: it is a mechanism whereby situated social action contributes to the reproduction of social structure" (West/Fenstermaker 1995, S. 21). Empirische Studien einer ethnomethodologischen Geschlechtersoziologie geben Aufschluß darüber, wie, mit welchen Handlungsmechanismen und strategien, auf der Ebene elemanter sozialer Interaktion Ungleichheitsrelatio nen (Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse und dazu passende geschlechtliche Identitäten) von den Akteuren „lokal" reproduziert werden. Die meisten dieser Studien arbeiten mit dem Verfahren der Konversationsanalyse. Pamela Fishman (1978, 1984) hat unter der Fragestellung, wie männliche und weibliche Macht durch Gespräche in Szene gesetzt und ausagiert wird, Alltagskommunikationen von geschlechtsheterogenen Paaren konversationsanalytisch ausgewertet. Sie beschreibt Interaktion als Frauenarbeit in dem Sinne, daß die Frauen quantitativ mehr Beiträge beisteuern, ohne damit jedoch die Kontrolle über die Gespräche, insbesondere über deren Inhalt zu gewinnen. Diese verbleibt bei den Männern. Die Frauen leisten unterstützende Arbeit, indem sie den Themen der Männer zum Erfolg verhelfen. Fishman zieht die Schlußfolgerung, daß die Handelnden sich in diesem Sinne konstant männlich oder weiblich verhalten müssen, damit das Geschlecht als selbstverständlich anerkannt wird. Bezogen auf die von Fishman betrachtete Konstruktion von Weiblichkeit bedeutet das: Durch konversationelle Arbeit für Männer kann eine Frau zeigen, daß sie weiblich ist. Darüber, welche Art von Realität so interaktiv produziert wird, hat sie eine nur geringe Kontrolle. Als Resultat einer konversationsanalytischen Untersuchung von Gesprächen zwischen Frauen und Männern, die sich zum erstenmal begegnen (in einer Laboratoriumssituation) halten Candace West und Angela Garcia (1988) fest, daß das Kontrol lieren von Themen Männlichkeit zu demonstrieren vermag. Zu ähnlichen Resultaten gelangen konversationsanalytische Untersuchungen zur Funktion von Humor in gemischtgeschlechtlichen Interaktionen (vgl. Kotthoff 1988). Die Stärke der konversationsanalytischen Untersuchungen liegt zweifelsohne darin, daß sie die interaktive Konstruktion der Geschlechterdifferenz minutiös rekonstruieren. Wie die situierten Praktiken in übergreifende sozialstrukturelle Zusammenhänge eingebunden sind, kann mit diesem Verfahren freilich nicht gezeigt werden. Es bleibt zumeist bei dem Hinweis, daß „doing gender" eine Eigenschaft sozialer Verhältnisse ist und daß „its idiom derives from the institutional arena in which those relationsships come to life" (West/Fenstermaker 1995, S. 21). Das Interesse ethnomethodologischer Theoriebildung gilt den formalen Mechanismen und Strukturen des Alltagshandelns, so auch bei der Analyse des doing gender. Auf der Ebene der Theorie bleibt weitgehend unberück65 sichtigt, in welcher Hinsicht sich das doing gender der Frauen von dem der Männer unterscheidet. Auch die ethnomethodologische Transsexualitätsforschung hat nicht systematisch untersucht, inwiefern das passing eines Frauzu-Mann-Transsexuellen anders als das einer Mann-zu-Frau-Transsexuellen verläuft. Differenzen sind durchaus zu beobachten, und diese sind dergestalt, daß sie auf strukturelle Elemente der Geschlechterordnung verweisen. Hirschauer (1993, S. 63Q stellt fest, daß transsexuelle Frauen es schwerer als transsexuelle Männer haben, in ihrem Geschlecht in der Öffentlichkeit anerkannt zu werden. Einen Grund sieht er darin, „daß Frau-Sein in viel stärkerem Maße bedeutet, attraktives Schauobjekt (`schönes Geschlecht') zu sein und daher auch leichter enttarnt werden kann". Transsexuelle Frauen müssen folglich mehr in ihre Darstellungsarbeit investieren als transsexuelle Männer6i. Konversationsanalytische Arbeiten haben - wie die Frauenforschung, in deren Kontext die meisten entstanden sind - den Blick vornehmlich auf die Konstruktion von Weiblichkeit gerichtet. Dabei wird natürlich zwangsläufig deutlich, welche konversationellen Praktiken Männer einsetzen, um z.B. Gespräche zu kontrollieren. Aus einer solchen Enaktierung männlicher Dominanz zu schließen, daß die Kontrolle der Kommunikation ein Mittel ist, um Männlichkeit in Szene zu setzen, liegt nahe, ist zunächst aber nur eine Hypothese, die auf einem Umkehrschluß beruht. Um sie zu überprüfen, müßte auch die Perspektive der Männer empirisch rekonstruiert werden. Daß die ethnomethodologische Geschlechtertheorie den geschlechtlichen Unterschieden im doing gender nicht systematisch nachspürt, hat auch einen methodologischen Grund. Hagemann-White (1993, S. 74) macht auf die me thodische Komplexität aufmerksam, „welche eine konstruktivistische Perspektive auf die Zweigeschlechtlichkeit nach sich zieht. Sie verlangt von uns, nicht bloß unseren Blickwinkel zu verlagern, sondern zugleich den alten, im Vollzug gelebter Zweigeschlechtlichkeit involvierten Blick beizubehalten, da dieser das Instrument ist, mit dem wir das Material für jenen gewinnen". Ohne den „alten" Blick, d.h. ohne den `gesunden Menschenverstand', welcher der alltagsweltlichen Geschlechterklassifikation zugrunde liegt, wäre es unmöglich, überhaupt ein sample zustandezubringen. Das, was in seiner Konstruiertheit untersucht werden soll, das Geschlecht, wird in seiner weiblichen und männlichen Gestalt nicht nur vorausgesetzt, sondern von Forscherin und Forscher in Interaktion mit der Untersuchungsperson mit-hergestellt. Die 62 66 Freilich sollte man von der Transsexualitätsforschung nicht mehr erwarten, als sie leisten kann. Ihre Theorierelevanz besteht darin, gut zeigen zu können, daß Geschlecht in sozialer Interaktion hergestellt wird. Weniger gut eignet sie sich dazu, ein `Inventar' der Praktiken und Symboliken von `normaler' Weiblichkeit und Männlichkeit zu erstellen. Weil die untersuchten Transsexuellen im angestrebten Geschlecht noch nicht heimisch sind, machen sie oft Fehler, nicht zuletzt solche des übersteigerten Enaktierens stereotypisierter Ausdrucksformen, so daß die Darstellung des Geschlechts als solche erkennbar ist (vgl. Hirschauer 1989). Ethnomethodologie fragt einerseits, woher wir wissen, daß diese Person eine Frau oder ein Mann ist, und muß andererseits die Gültigkeit dieses Wissens voraussetzen, um überhaupt Personen zur Verfügung zu haben, angesichts derer eine solche Frage gestellt werden kann. Alles andere führte zu Peinlichkeiten63. In der empirischen Forschung kann auch die Ethnomethodologie gar nicht anders, als die Konstruktion von Weiblichkeit anhand des Handelns zu untersuchen, das von als Frauen identifizierten Personen und gegenüber diesen vollzogen wird. Auch der Ethnomethodologie gelten Orte, die den Mitgliedern einer Geschlechtskategorie vorbehalten sind, z.B. Umkleideräume oder Schönheitssalons, als günstige Gelegenheiten, um typische Ausprägungen von Männlichkeit oder Weiblichkeit empirisch zu erfassen (vgl. West/Fenstermaker 1995, S. 31). Die Unvermeidbarkeit der Strategie, Weiblichkeit bei Personen zu vermuten, die in der Manier des Alltagsverstandes als Frauen identifiziert werden, und Männlichkeit bei nach der gleichen Logik als solche wahrgenommenen Männern, mag ein Grund dafür sein, daß ein großer Teil der ethnomethodologischen Geschlechterforschung, insbesondere in deren Anfängen, die geschlechtliche Grenzsituation der Transsexualität zum Gegenstand hat. Dort ist im Alltag die Eindeutigkeit der Zuordnung aufgelöst. Gegenüber der Ethnomethodologie hat die interaktionistische Geschlechtersoziologie ein weniger weitreichendes Konzept der Konstruktion von Geschlecht. Symbolisch-interaktionistisch orientierte Konzeptualisierungen ge hen gemäß der von Blumer (1973) formulierten Prämissen zwar davon aus, daß anatomische und biologische Differenzen in sich keine Bedeutung haben. Bedeutung entsteht durch die Beziehung handelnder Subjekte auf die Objekte ihrer Welt. Die biologischen Geschlechterdifferenzen werden jedoch, einem Diktum Meads folgend, als physische Dinge, die unserem Handeln Widerstand leisten, begriffen, so daß jede Kultur mindestens von zwei Geschlechtern ausgehen muß. Die Art der geschlechtlichen Klassifikation ist allerdings durch und durch kulturell bestimmt (vgl. Cahill 1983, S. 3). Die soziale Klassifikation bleibt der Person nicht äußerlich, ist keine bloße Rolle. Ein Geschlecht zu haben meint mehr, als weibliches oder männliches Verhalten zu lernen. Die gesamte Person ist involviert, in psychischer, aber auch in körperlicher Hinsicht. Der jeweilige geschlechtliche Code formt den weiblichen oder männlichen Körper (vgl. Deegan 1987, S. 4; Denzin 1993, S. 200). Die interaktionistische Geschlechtertheorie behandelt im wesentlichen zwei große Themenkomplexe, darin der allgemeinen Ausrichtung interaktio63 Der Geschlechterforscher befindet sich gewissermaßen in einer Situation, die der einer Person vergleichbar ist, die eine öffentliche Toilette aufsuchen will. In dem einen wie dem anderen Fall dürfte die ethnomethodologische Einstellung entweder zu Handlungsunfähigkeit führen (keine Erleichterung der Blase bzw. keine Probanden) oder zumindest zu unangenehmen Peinlichkeiten (Aufsuchen der falschen Toilette bzw. Verletzung der Integrität der Untersuchungspersonen). 67 nistischer Theorie und Forschung folgend: die Entwicklung von Geschlechtsidentität (1) und Geschlechterbeziehungen als ausgehandelte Ordnung (2). (1) Hinsichtlich des ersten Themenkomplexes sind zwei Fragestellungen zu unterscheiden: 1. Wie entsteht Geschlechtsidentität im Prozeß sozialer Interaktion? 2. Wie lernt das Kind, Geschlechtsidentität anderen und sich selbst anzuzeigen (vgl. Cahill 1987, S. 82). Die Fragestellungen sind aufeinander bezogen, denn es gilt zu analysieren, wie Individuen lernen, normale Geschlechtspersonen zu sein, für die eine entsprechende Selbstdarstellung etwas völlig Natürliches, Unhinterfragtes ist (vgl. ebd., S. 95). Entscheidend für die Entwicklung von Geschlechtsidentität sind geschlechtlich differenzierte Muster der Interaktion zwischen Bezugsperson und Kind. Ist ein rudimentärer Sinn für Geschlechtsidentität etabliert (mit ca. zwei Jahren), wird das Kind zum aktiven Agenten der eigenen Geschlechtsentwicklung. Wichtig in diesem Prozeß ist die Reaktion von signifikanten Anderen, gleichgültig welchen Geschlechts, auf die frühen Geschlechtsdarstellungen des Kindes sowie die spielerische Interaktion in der Gleichaltrigengruppe (vgl. Cahill 1983, 1987). Die Entwicklung der Geschlechtsidentität geschieht über die Aneignung der symbolischen Realität der Geschlechterordnung, vor allem der geschlechtsklassenadäquaten Muster der Selbstpräsentation (vgl. Cahill 1989). Solche Muster variieren kulturell, und außerhalb der symbolischen Realität der Geschlechterordnung gibt es keine dem menschlichen Körper inhärente Bedeutung. Cahill grenzt das interaktionistische Modell der Entwicklung von Geschlechtsidentität strikt von psychologischen Konzepten ab, die anatomische Differenzen als unmittelbar bedeutsam für die Kinder erachten. „As Mead observed, physical things may ` resist' human action, but they do not determine human responses to them er, by implication, their meaning. Children's conceptions of sex and gender are not derived, therefore, from unmediated contact with brute, physical facts nor is their acquisition of a stable gender identity a product of automatic cognitive or psychosexual reactions to their own or other's bodies" (Cahill 1986, S. 306). (2) Neben der sozialisationstheoretischen Perspektive richtet sich das Interesse der interaktionistischen Geschlechterforschung auf die Frage, wie die Strukturen der Geschlechterverhältnisse als ausgehandelte Ordnung zustandekommen. Allgemeiner theoretischer Hintergrund ist der „negotiated order approach" (vgl. Strauss 1978; Fine 1984). Zumeist auf der Mesoebene von sozialen Organisationen angesiedelt, befaßt sich die Forschung vor allem mit der Aushandlung der Geschlechterordnung in männerdominierten Berufsfeldern (vgl. Fine 1987; Kanter 1987; Martin 1987; Padavic 1991). Ein weiterer Gegenstand ist die ausgehandelte Ordnung der innerfamiliären Arbeitsteilung (vgl. Hochschild 1993; Pestello/Voydanoff 1991). Stärker als die ethnomethodologische Geschlechtertheorie akzentuiert der negotiated order approach Unterschiede in der Definitionsmacht der Ge68 schlechter. Die asymmetrische Verteilung von `Verhandlungsressourcen' wird besonders augenfällig an Arbeitsplätzen, an denen eine einzelne Frau oder einige wenige Frauen in einem Beruf arbeiten, der sowohl in quantitativer Hinsicht von Männern dominiert ist als auch hinsichtlich des Tätigkeitsprofils als ein klassischer Männerberuf gilt. Die Analyse der Interaktionen zwischen den sog. „token" (Kanter 1987), den wegen ihres Minderheitenstatus als Mitglieder einer Geschlechtskategorie wahrgenommenen Frauen, und den männlichen Kollegen läßt die Mechanismen der Reproduktion einer männerdominierten Geschlechterordnung und einer maskulin geprägten Organisationskultur sichtbar werden. Die einschlägigen Studien sind mithin im Rahmen der vorliegenden Arbeit von besonderem Interesse. Sie gehören zu den wenigen Arbeiten, die Aspekte der interaktiven Konstruktion von Männlichkeit empirisch untersuchen. Entgegen naheliegenden Annahmen - bzw. tatsächlichen Befürchtungen der `betroffenen' Männer - stellen die in rein männlich geprägte Arbeitsplätze , eindringenden' Frauen keine Gefahr für den männlichen Zusammenhalt dar. Die Anwesenheit einer Frau stellt vielmehr eine Gelegenheit dar, um Maskulinität zu bestätigen. Für die Männer ist dies zwar kein willkommener, faktisch jedoch ein genutzter Anlaß, die Geschlechterdifferenz zu betonen. Die eigene Männlichkeit kann zugleich demonstriert und geklärt werden, und das nicht nur gegenüber den Frauen, sondern insbesondere auch gegenüber den männlichen Kollegen (vgl. Padavic 1991). Die Anwesenheit weniger Frauen unterminiert in keiner Weise die Interaktionskultur der Männer; diese Frauen werden vielmehr `instrumentalisiert', um die Majoritätskultur zu unterstreichenb 4. Kanter (1987) hat das in einer Studie über die Situation von Frauen in der Berufswelt von Vertreterinnen gezeigt. Der Außenseiterinnenstatus der Frauen impliziert, daß sie anders als die Männer als Mitglieder einer Geschlechtskategorie wahrgenommen werden. Und das bedingt, daß alle ihre Aktivitäten spezifische symbolische Konsequenzen haben, die sich auf den geschlechtlichen Status beziehen. Sie sind Anlaß für vielfältige Formen der Grenzziehung durch die Männer. Auf diese Weise wird eine Situation der potentiellen Bedrohung umgestaltet in eine Gelegenheit, die Gültigkeit der dominanten Kultur zu bekräftigen. Den Frauen bleiben nur zwei Reaktionsformen. Entweder sie ziehen sich zurück oder sie werden Insider, „one of the Boys", indem sie sich als Ausnahmen ihrer eigenen sozialen Kategorie definieren. In beiden Fällen bestätigen sie die dominante Geschlechterordnung. Ein zentrales Mittel der Männer, Grenzen zu ziehen, sind sexuelle Anspielungen, Scherze, Anzüglichkeiten usw. Frauen, die „one of the boys" werden wollen, müssen bereit sein, sich auf diese Ebene der Kommunikation einzulassen. Fine (1987) hat auf der Basis von teilnehmender Bobachtung in Restaurantküchen verschiedene Strategien analysiert, die die Männer einsetzen, um trotz der Anwesenheit einer Frau eine 64 Dies ist freilich weniger als ein intentional-strategisches Handeln zu verstehen, sondern eher als ein latenter Effekt. 69 homosoziale Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Wesentlicher Teil dieser „`clubby' atmosphere" ist die Selbstverständlichkeit von „sexual talk". In Anwesenheit einer Frau ist diese Kommunikationsform nicht ohne weiteres aufrechtzuerhalten. „Either the sexual joking must go, or the women must go - or must adjust" (S. 135). Die Anpassung ist die gängige Lösung. Eine weitere interaktionstheoretisch-konstruktivistische Konzeptualisierung von Geschlecht hat Erving Goffman vorgelegt. Goffmans geschlechtersoziologische Arbeiten, der Aufsatz „Das Arrangement der Geschlechter" (1994c) und das Buch „Geschlecht und Werbung" (1981), nehmen seine These, die Interaktionsordnung sei ein eigenständiges und für die soziologische Theoriebildung überaus wichtiges Forschungsgebiet (1994b), gegenstandsspezifisch vorweg". Goffman wendet seine Aufmerksamkeit nicht Eigenschaften von Frauen und Männern, auch nicht Rollenerwartungen zu, er analysiert das institutionelle Arrangement der Geschlechter, die Geschlechter(mikro)politik von Identitätszuschreibungen und ritualisierten Darstellungsformen, in und mit denen die Geschlechter die soziale Ordnung ihrer Beziehungen herstellen. In gewissem Sinne in Einklang mit der interaktionistischen Prämisse, derzufolge Objekte, mithin auch der anatomische Dimorphismus, ihre Bedeutung nicht in sich tragen, sondern in sozialer Interaktion erhalten, behandelt Goffman Geschlecht als einen Fall sozialer Klassifikation. Mehr noch: die jede und jeden treffende und lebenslange Geltung beanspruchende Einordnung in eine von zwei „Geschlechtsklassen" stellt sich ihm als „Prototyp einer sozialen Klassifikation" dar (1994c, S. 108). Die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht ist die wichtigste Quelle der Selbstidentifikation, wichtiger noch als die Altersstufe. Geschlecht ist die „Grundlage eines zentralen Codes, demgemäß soziale Interaktionen und soziale Strukturen aufgebaut sind" (S. 105). Dieser Code prägt die Vorstellungen, die wir von unserer menschlichen Natur haben. Jede soziale Situation bietet die Gelegenheit zur Geschlechtsdarstellung. Insofern ist Geschlecht eine Sozialkategorie, die virtuell omnirelevant ist. Die Aufgabe einer soziologischen Geschlechterforschung besteht nicht darin, soziale Konsequenzen angeborener Unterschiede zu erklären, sondern zu zeigen, wie der Dimorphismus als Grundlage und Rechtfertigung ge schlechtsbezogener sozialer Arrangements verwendet wird, wie solche Arrangements dadurch gültig gemacht werden. Hierzu führt Goffman den Begriff der „institutionellen Reflexivität" ein. Erst diese verleiht dem angeborenen Unterschied eine Bedeutung. Ein Beispiel ist die Trennung öffentlicher Toilettenanlagen nach dem Geschlecht. Diese knüpft zwar an den Unter65 70 Die geschlechtersoziologischen Arbeiten sind 1976 und 1977 erschienen, der Aufsatz zur Interaktionsordnung ist die von Goffman nicht gehaltene Präsidentenansprache vor der American Sociological Association von 1982, die gewissermaßen Goffmans theoretisches Vermächtnis enthält. schied weiblicher und männlicher Organe an, doch deren Funktionsweisen verlangen keineswegs zwingend eine Trennung. „Die Trennung der Toiletten wird als natürliche Folge des Unterschieds zwischen den Geschlechtskategorien hingestellt, obwohl sie tatsächlich mehr ein Mittel zur Anerkennung, wenn nicht gar zur Erschaffung dieses Unterschieds ist` (Goffnan 1994c, S. 134). Ein weiteres Beispiel sind die Konventionen der Paarbildung, die sich auf die Körpergröße beziehen und dafür sorgen, daß gewöhnlich die Frau kleiner ist als der Mann. Zwar sind Männer im Durchschnitt etwas größer als Frauen, doch ist der Bereich der Überschneidung groß genug, daß bei der Mehrzahl der Paare Frauen und Männer annähernd gleich groß sein könnten. Die soziale Praxis nutzt einen biologisch gegebenen Unterschied aus, um ein symbolisches Mittel zur Darstellung der Geschlechterordnung zu gewinnen und macht ihn erst dadurch bedeutsam sowie im Alltag sichtbar. Goffman stellt sich dies als „Paradebeispiel einer Norm" dar, „die ohne offizielle oder spezifische Sanktionen eingehalten wird" (1994c, S. 142) 66 . Solche institutionelle Reflexivität sorgt für die Aufrechterhaltung von Deutungsmustern, welche die Geschlechterdifferenz als biologisch fundiert darstellen (starker Mann, schwache Frau). Wie das Beispiel zeigt, sind Geschlechtsdarstellungen nicht beliebig, sie folgen einem gesellschaftlich festgelegten Plan, „der bestimmt, warum welche Ausdrucksform wann angebracht ist" (1981, S. 35). Die Fähigkeit und Bereitschaft, einen Plan einzuhalten, und zwar den für das eigene Geschlecht vorgesehenen Plan, kennzeichnet Personen als Angehörige einer Geschlechtskategorie. Geschlechtszugehörigkeit ist also an eine soziale Praxis gebunden, an eine Praxis der Distinktion. Eine Geschlechtszugehörigkeit außerhalb oder vor dieser sozialen Praxis gibt es nicht. Der Besitz eines mit bestimmten Merkmalen ausgestatteten Körpers garantiert allein noch nicht die Mitgliedschaft in einer Geschlechtsklasse. Allerdings bleibt die planbestimmte Praxis der Geschlechtsdarstellung nicht folgenlos für den Körper. Dies nicht nur in dem Sinne, daß soziales Handeln immer Bewegungen des Körpers impliziert, sondern in dem weitergehenden und für die Stabilität von Geschlechtsdarstellungen eminent wichtigen Sinne, „daß es auch durch etwas motiviert und gestaltet ist, das den einzelnen Körpern innewohnt" (1994c, S. 66 In Heiratsanzeigen ist die Wirksamkeit dieser Norm augenfällig dokumentiert. Neben der Angabe des Alters gehört die der Körpergröße zu den Kerninformationen, die ein Inserent oder eine Inserentin über sich mitteilt. Das ist eine gewisse Garantie, daß nur größenmäßig , passende' Personen auf die Anzeige antworten. Die Anzeigen, in denen zusätzlich Erwartungen über die gewünschte Größe des potentiellen Ehepartners geäußert werden, belegen eindeutig die Bedeutung der Körpergröße für die Konventionen der Paarbildung (vgl. Gern 1992, S. 143ff.). 71 113). Das meint nicht genetische Dispositionen, sondern die Inkorporierung einer lebensgeschichtlich erworbenen Darstellungspraxis 6'. Goffrrtans Konzeption der sozialen Konstruktion von Geschlecht unterscheidet sich sowohl vom dekonstruktivistischen Verständnis von Geschlecht als Performanz als auch vom ethnornethodologischen Konzept des „doing gender" (vgl. Kotthoff 1994; Knoblauch 1994). Mit diesem stimmt Goffman insoweit überein, daß Geschlechtsdarstellungen die Struktur von Dominanz und Unterwerfung zum großen Teil erst konstituieren; „sie sind Schatten und Substanz zugleich" (1981, S. 29). Gegenüber der Schwerpunktsetzung auf eine lokale Produktion von Geschlecht betont Goffman mit dem Begriff der institutionellen Reflexivität aber, daß die Geschlechterdifferenz nicht nur situativ erzeugt wird, sondern auch institutionell geregelt ist. Die Trennung öffentlicher Toiletten nach Geschlechtern oder die Konventionen der Paarbildung sind gewiß Produkt einer sozialen Praxis, sie setzen der situativen Darstellung von Geschlechtszugehörigkeit jedoch einen Rahmen, in dem die Verbindung von Interaktionsordnung und Sozialstruktur „ikonisch" reflektiert wird. „Ähnlich wie andere Rituale, können auch die Darstellungen der Geschlechter fundamentale Merkmale der Sozialstruktur ikonisch reflektieren" (Goffman 1981, S. 38). An der Produktion der Geschlechterordnung sind Frauen wie Männer als `intelligente' Akteure beteiligt. Über einen Plan der Darstellung und über die Fähigkeit, gemäß diesem Plan zu handeln, verfügen beide Geschlechter. Darin unterscheiden sie sich nicht, wohl aber in den Inhalten der jeweiligen Darstellungen und damit in den Konsequenzen, die unterschiedliche Pläne für die soziale Positionierung der Akteure haben". Wo funktionalistische Ansätze sogleich soziale Differenzierung, Arbeitsteilung und damit den Unterschied der Geschlechter akzentuieren, betont Goffman gemäß dem allgemeinen Akteurskonzept des interpretativen Paradigmas, daß die soziale Konstruktion der Geschlechterwirklichkeit Produkt einer Kooperation beider Geschlechter ist, auch wenn Frauen und Männer nicht nur Verschiedenes dazu beitragen, sondern dies auch aus strukturell ungleichen Positionen heraus tun. Goffmans Analyse der Darstellungspraktiken und -rituale geschieht immer mit Blick auf die Dominanz- und Unterordnungsverhältnisse, auf die Macht67 68 72 Kotthoff (1994, S. 166) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß Goffman den Körper im Unterschied zu dekonstruktivistischen Geschlechtertheorien nicht als bloßen diskursiven Effekt begreift. - Zur Bedeutung der Inkorporierung siehe auch Kap. 4. Empirisch instruktiv ist hierfür Hochschilds (1990) Studie über die Gefühlsarbeit, die FlugbegleiterInnen und Angestellte von Inkassofirmen zu leisten haben. Für Männer und Frauen sind jeweils andere Gefühlsdarstellungen obligatorisch, in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht, und diese Unterschiede in der Gefühlsarbeit spiegeln und reproduzieren die geschlechtliche Dominanzordnung. Die größere Kompetenz der Frauen in emotionalen Angelegenheiten erfährt eine kommerzielle Nutzung, die den Frauen allerdings nicht einen Statusgewinn beschert (vgl. insb. S. 132ff.). und Herrschaftsstrukturen, die sich in diesen Praktiken äußern und die mit ihnen hergestellt werden. Auch darin unterscheidet sich seine Perspektive von der funktionalistischen. Das Hauptaugenmerk richtet Goffman auf Darstellungsformen, die auf den ersten Blick an andere Verhältnisse als an die von Über- und Unterordnung denken lassen: Rituale der Zuvorkommenheit, der Ehrerbietung und der Höflichkeit, welche Männer Frauen gegenüber praktizieren. In diesen Formen der rituellen Inszenierung des Unterschieds der Geschlechter ist prosoziales Handeln eng mit Dominanz verknüpft. Diese Formen einer 'freundlichen' Darstellung der Asymmetrie macht die Dominanz der Männer erträglich und ist für Goffman ein Ausdruck dafttir, daß die Frauen verglichen mit anderen benachteiligten Gruppen „auf der Skala der ungerecht Behandelten" „nicht sehr weit unten" zu verorten sind (1994c, S. 116). eine HerrDie Herrschaft des Mannes ist „von ganz besonderer Art schaft, die sich bis in die zärtlichsten, liebevollsten Momente erstreckt, offenbar ohne Spannungen zu erzeugen" (1981, S. 41). Die Spannungen mögen heute, 20 Jahre, nachdem Goffman dies geschrieben hat, zugenommen haben, die subtile Verknüpfung von Liebe, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Beschützerhaltung und Herrschaft bleibt weiterhin ein strukturelles Merkmal des fair Männer vorgesehenen Plans der Geschlechtsdarstellungb 9. Dieser Plan ist nach dem Muster des „Eltern-Kind-Komplexes" aufgebaut. Hinsichtlich der Rituale der Geschlechtsdarstellung sind Frauen untergeordneten Männern gleichgestellt und beide wiederum den Kindern. Die Rituale, welche in Eltern-Kind-Interaktionen zum Tragen kommen, weisen fundamentale Gemeinsamkeiten mit denen auf, die in der Beziehung von Mann und Frau eine Rolle spielen. In seiner Analyse von Werbefotos zeigt Goffman, daß viele Posen, die Männer gegenüber Frauen einnehmen, strukturell denen gleichen, die auf Bildern zu sehen sind, auf denen Erwachsene gemeinsam mit Kindern abgebildet sind. Mit diesem Vergleich nimmt Goffman nicht wie Tönnies eine essentialisierende Gleichsetzung von Frauen mit Kindern vor; vielmehr verdeutlicht er die soziale Asymmetrie, die im Fall der intergenerationellen familiären Beziehungstruktur offensichtlicher ist als bei der geschlechtlichen. Die Ungleichheit der Verhältnisse und der Herrschaftscharakter der Beziehung von Mann und Frau bleiben freilich nur solange in einer `freundlichen Atmosphäre' verborgen, wie die Frau mitspielt. Verweigert sie die Kooperation, stehen dem Mann Handlungsweisen zur Verfügung, welche die Dominanzordnung manifest werden lassen. „Bedenken wir aber, daß der geringergestellte, wie unangenehm und demütigend er solche freundlich gewährten Vorrechte empfinden mag, es sich zweimal überlegen muß, ob er offen sein Mißfallen ausdrücken will, denn derjenige, der wohlwollende 69 Das gilt insbesondere für in der Tradition verankerte Männer, denen ihr Geschlecht etwas fraglos Gegebenes ist (s. Kap. 7.2). 73 Rücksichtnahme schenkt, kann rasch die Tonart wechseln und die andere Seite der Macht zeigen" (1981, S. 27f.). Diese andere Seite der Macht erfährt allerdings keine weitere Betrachtung. Das mag dadurch motiviert sein, daß Goffman mehr an den subtilen Mechanismen der Geschlechterordnung als an offensichtlichen Manifestationen derselben interessiert war'°. Es mag, zumindest was die Analysen in „Geschlecht und Werbung" betrifft, seinen Grund aber auch darin haben, daß das empirische Material, das den Ausgangspunkt der theoretischen Überlegungen bildet, keine Szenen gewaltförmiger Beziehungen enthält. Dem Image eines Produktes wäre damit ein schlechter Dienst erwiesen. Goffmans Analyse von Werbefotos zielt auf die Identifikation hyperritualisierter Darstellungsformen, die eine kulturelle „ldealvorstellung" von der sozialen Präsentation der Geschlechter sowie von deren strukturellen Bezie hungen geben. Das vielfältige Bildmaterial sowie Goffmans Kommentare ergeben gewissermaßen ein Inventar geschlechtlicher Darstellungsformen". Die ritualisierten Darstellungen des Mannes bedienen sich sowohl physikalischer und räumlicher Mittel des Inszenierung als auch gestischer, mimischer, haptischer und taktiler. Viele der dargestellten Szenen lassen sich als Beispiele institutioneller Reflexivität lesen. Als wichtiges physikalisches Mittel wird die Körpergröße verwendet. Die Männer sind größer als die Frauen, oder sie sind so abgebildet, daß sie größer wirken. Eine Ausnahme von dieser egel liegt dann vor, wenn die Frau offensichtlich einen höheren sozialen oder beruflichen Status als der Mann hat. Wo nicht die Körpergröße als Hierarchiemarkierer fungiert, sind die Geschlechter so positioniert, daß der Mann höher aufragt als die Frau oder daß die Frau zum Mann hinaufschaut (z.B. Mann stehend, Frau sitzend.). Die räumliche Anordnung symbolisiert oft einen distanzierten Abstand des Mannes zum Geschehen. In Familienszenen stehen die Väter typischerweise etwas außerhalb der Runde von Mutter und Kindern. Das unterstreicht den Überblick und die Verantwortlichkeit des Mannes für die gesamte familiäre Einheit. Hinsichtlich der dargestellten Aktivitäten erscheinen die Männer als die Belehrenden, Zupackenden, zielgerichtet Handelnden, bei gemeinsamen Aktivitäten als die Leitenden, Frauen hingegen oft als verspielt und verträumt. Männer lassen den Frauen eine Vielzahl von beschützenden und unterstützenden Aktivitäten angedeihen. Wenn Männer bei der Verrichtung von frauentypischen Tätigkeiten oder in abhängigen Positionen gezeigt werden, dann sorgen die Stilmittel von Ironie 70 71 74 Allerdings führt die Vernachlässigung der „anderen Seite" dazu, daß Goffman emotionale Beziehungen zwischen den Geschlechtern nur in ihrer prosozial-protektiven Dimension betrachtet, nicht aber hinsichtlich der Verletzbarkeit, die daraus für den `beschützten Teil' erwächst. Genauer: Das Material ist eine Fundgrube, um ein solches Inventar zu erstellen. Die Kommentare Goffmans geben dabei wichtige Hilfestellungen, sind aber nicht zu einer Systematik verdichtet. und Verfremdung dafür, daß männliche Distanz und Souveränität betont werden. Frauen werden bisweilen in kindlichen Posen gezeigt, Männer niemals. Männer machen mit Frauen Dinge, die ansonsten der Interaktion von Erwachsenen mit Kindern vorbehalten sind, z.B. auf den Arm nehmen, hochheben. All dies sind Rituale männlicher Hegemonie. Allerdings bleibt eine Dimension völlig ausgespart, die der Sexualität. Dies verwundert, denn anders als die Gewalt sind Sexualität und Erotik Stilmittel, die auf vielen der Werbe fotos eingesetzt werden. An anderer Stelle, im Kontext seiner Analyse der institutionellen Reflexivität verweist Goffman auf die Bedeutung dieser Dimension für die männliche Selbstvergewisserung. Die „selektive Arbeitsplatzvergabe", die dafür sorgt, daß an vielen Arbeitsplätzen von Männern junge und attraktive Frauen in untergeordneten Positionen zugegen sind, denen gegenüber sexuelle Anzüglichkeiten und Scherze üblich sind, versteht Goffman als eine soziale Konstruktion, die den Männern täglich eine Form der Bestätigung ihrer Männlichkeit ermöglicht, die sie in der ehelichen Gemeinschaft nicht erfahren. „Das Prinzip lautet hier: Wenige für viele, und infolgedessen entwickelt sich die Welt jenseits des Haushalts zu einem schummrigen Rotlichtviertel, in dem Männer schnell in Interaktionen Erfolge erzielen und in Sicherheit genießen können" (1994c, S. 137). In Variation eines berühmten Diktums von Karl Marx bemerkt Goffman, das Geschlecht, nicht die Religion sei das Opium des Volkes (S. 131). Die Beispiele, die er gibt, machen deutlich, daß es wohl insbesondere Opium für den männlichen Teil des Volkes ist. Im beruflichen wie im privaten Bereich stehen den Männern Frauen zur Seite, die dem Mann das sichere Gefühl geben, mindestens in einem sozialen Verhältnis die dominierende Position innezuhaben, gleichgültig, unter welchen Hierarchien und Zwängen er ansonsten zu leiden hat. Immer sind Frauen anwesend, „die seine zur Schau gestellte Kompetenz bestärken" (S. 131). „Wohin auch immer der Mann geht, kann er, scheint es, eine geschlechtsspezifische Teilung der Arbeit mit sich nehmen" (S. 132). Diese Arbeitsteilung analysiert Goffman - und mit ihm sämtliche Ansätze einer konstruktivistischen Geschlechtersoziologie - in einer Weise, die beide Geschlechter bei ihrer Arbeit zeigt, wenn auch mit unterschiedlichen Tätigkeiten. Die einer konstruktivistischen Perspektive verpflichteten Untersuchungen machen eindrucksvoll deutlich, daß und wie die sog. Passivität der Frau in kunstvollen Interaktionspraktiken hergestellt wird und in welcher Weise die Frau hierzu aktiv `Passivitätsarbeit' leistet. Hochschild (1990, S. 135) zeigt, daß vermeintlich passive weibliche Eigenschaften wie Anpassung an die Bedürfnisse anderer in einer von Frauen geleisteten gesellschaftlichen Arbeit erzeugt werden: durch eine Steuerung ihrer Gefühle in einer Weise, daß Wohlbefinden und Status der Männer verbessert und aufgewertet wer75 den. Konversationsanalytische Untersuchungen von Paarkommunikation machen deutlich, daß der Eindruck weiblicher Zurückhaltung eine wenig sichtbare Unterstützungsarbeit der Frau zur Grundlage hat. Geschlechtersoziologie. Frauenforschung älnnerstudien Die bisherigen Kapiteln standen unter der Frage, wie das Geschlechterverhältnis in der soziologischen Theorietradition thematisiert wird. In diesem Kapitel geht es um theoretische Konzepte, wie sie in einer auf das Geschlechterverhältnis fokussierten Forschung entwickelt worden sind. Nicht die Zugehörigkeit zu einem theoretischen Paradigma, sondern die Gemeinsamkeit des Gegenstandes zeichnet die im folgenden behandelten Arbeiten aus. Wie sich der Unterteilung des Kapitels in Frauenforschung und Männerstudien entnehmen läßt, spiegelt sich die Dichotomie, die der kulturellen Codierung des Gegenstandes zugrunde liegt, in der sozialwissenschaftlichen Aufbereitung desselben wider. Inwieweit mit dem Begriff ` Geschlechtersoziologie' eine Klammer gegeben ist, welche die Schwerpunktsetzungen unter einem Dach zusammenführt, ist eine Frage, die insbesondere in der Frauenforschung kontrovers diskutiert wird (dazu unten mehr). Jeder Gegenstand läßt sich unter verschiedenen theoretischen Perspektiven betrachten. Sowohl in der Frauenforschung als auch in den Männerstudien sind die kontrovers geführten Theoriedebatten auf die Frage zentriert, ob mit dem Begriff des Patriarchats eine angemessene Konzeptualisierung des Geschlechterverhältnisses sowie - was hier vor allem interessiert - männlicher Dominanz geleistet werden kann, und, sollte dieser Begriff ungeeignet sein, was an dessen Stelle treten könnte. In den folgenden Ausführungen fungiert diese Diskussion als Kriterium dafür, was aus der Fülle der sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung als einschlägig selektiert wird. Es geht also nicht um einen Report zum Stand der Forschung, sondern um die Rekonstruktion theoretischer Modelle. kategorie zur Analyse der (modernen) Gesellschaft zu begreifen, wird die Soziologie des Geschlechterverhältnisses als Teil der allgemeinen Soziologie verstanden und als in gleicher Weise fundierend angesehen wie die Soziologie sozialer Ungleichheit in Gestalt von Klassenverhältnissen'z . Die Frauenforschung - auch das ist bekannt - beinhaltet eine Vielfalt theoretischer Perspektiven (vgl. Krüger 1994). Die können hier nicht im einzelnen rekapituliert und im Hinblick auf ihre explizite oder implizite Konzeption von Männlichkeit rekonstruiert werden. Das erforderte eine eigenes Buch'3 . Das Spektrum reicht von rollentheoretischen über interaktionstheoretische bis zu klassentheoretischen Ansätzen, von psychoanalytischen bis zu dekonstruktivistischen". Viele der im vorigen Kapitel rezipierten interaktionistischen und ethnomethodologischen Arbeiten sind im Kontext der Women's studies entstanden. Dieses Kapitel wird in groben Zügen zwei Positionen innerhalb der Frauenforschung kontrastieren und auf ihre Männlichkeitskonzeptionen hin befragen: eine explizit gesellschaftstheoretische, wie sie mit dem Begriff des Patriarchats als zentraler analytischer Kategorie verbunden ist, und eine weiter gefaßte, als „gender"-Perspektive bezeichnete, in der sowohl gesellschaftstheoretische als auch interaktionstheoretische Analysen integriert sind. Mit den Konzepten „Patriarchat" und „gender" sind nicht nur unterschiedliche Perspektiven benannt, sie stehen auch in einer zeitlichen Folge, mit ihnen ist ein gewisser Paradigmawechsel verbunden. Ute Gerhard (1993, S. 12f.) konstatiert, daß „das Konzept Patriarchalismus selbst in der Frauenforschung heute größtenteils als überholt, wenn nicht als wissenschaftlich unbrauchbar bezeichnet wird'1 75. „Gender" sei als der „seriösere Begriff' weitgehend akzeptiert, da mit ihm der gesellschaftliche Zusammenhang in allen Lebensbereichen und auf allen Ebenen kultureller und symbolischer Repräsentation zu erfassen sei: nicht nur der Zusammenhang von Beruf und Familie, auch der von Geschlecht und Sprache oder von Geschlecht und persönlicher Identität. Judith Lorber (1994, S. 3) verzichtet auf den Begriff des Patriarchats als analytische Kategorie (nicht als deskriptive) und favorisiert 72 73 3.1 Patriarchat oder Gender? Mann und Männlichkeit in den Perspektiven der Frauenforschung 74 Es ist bekannt, daß es die Soziologie der Frauenforschung verdankt, daß sie ` geschlechtssensibilisiert' worden ist. Das Bemühen der Frauenforschung richtet sich nicht darauf, den vorhandenen Bindestrich-Soziologien eine weitere hinzuzufügen. Mit der These, Geschlecht sei als eine zentrale Struktur76 75 Darüber hinaus hat die Frauenforschung auf einer die einzelnen Disziplinen übergreifenden Ebene eine Diskussion methodologischer und erkenntnistheoretischer Fragen in Gang gesetzt (vgl. z.B. Harding 1990; List/Studer 1989). Eine Analyse des Männerbilds in einigen populären feministischen Schriften, wissenschaftlichen und anderen, hat Rave (1991) vorgelegt. Sie konstatiert eine Gleichsetzung der „gesellschaftlichen Kategorie patriarchaler Macht" mit der biologisch gegebenen Geschlechtlichkeit (S. 20). Gute Überblicke bieten der von England (1993) herausgegebene Sammelband sowie die Monographien von Tong (1989) und Evans (1995). Zu einer anderen Einschätzung kommen Gildemeister und Wetterer (1992, S. 202ff.). Sie machen darauf aufmerksam, daß die deutsche Frauenforschung die von den amerikanischen Women's studies eingeschlagene Richtung der gender-Forschung nicht mitvollzieht. Einen hohen Stellenwert hat das Patriarchatskonzept nach wie vor in der britischen Frauenforschung (vgl. Cockbum 1991a; Walby 1990). 77 „gender", weil dies ein allgemeinerer Begriff sei, der alle sozialen Verhältnisse umfasse, welche Menschen unterschiedliche geschlechtliche Positionen zuweisen; Patriarchat und männliche Dominanz über Frauen seien nur ein Teil dieser Verhältnisse. Mit dem Paradigmawechsel geht eine Erweiterung des Gegenstandsbereichs der Frauenforschung einher. Männer, Männerwelten, Männlichkeitsmuster werden in zunehmendem Maße expliziter Gegenstand der Frauenfor schung. Implizit enthält jede feministische Theorie Annahmen über das männliche Geschlecht, auch wenn weibliche Lebenszusammenhänge im Fokus stehen. Das bedingt die Relationalität der Kategorie Geschlecht. Seit Ende der achtziger Jahre nimmt aber vor allem die Anzahl empirischer Studien über männliche Lebenszusammenhänge deutlich zu. Zunächst hat sich die Frauenforschung auf die `vernachlässigte Hälfte der Menschheit' konzentriert. In wissenschaftshistorischer Perspektive ist diese `Einseitigkeit' der notwendige Reflex auf die androzentrische Praxis auch der Wissenschaft Soziologie. Frauen in die Geschichte und in die Wissenschaften hineinzuschreiben war das Ziel. Die für den Feminismus charakteristische enge Verzahnung von sozialer Bewegung und Wissenschaft ist eine weitere Erklärung dafür, daß weibliche Lebenswelten und Existenzweisen den Fokus der Forschung ausmachen. Wie Segal (1990, S. 206f.) ausführt, waren die Feministinnen in den siebziger Jahren damit befaßt, Kontrolle über ihr eigenes Leben zu erlangen. Männer seien nur insofern von Interesse gewesen, als sie aus der Frauenbewegung ausgeschlossen werden mußten. Zum Problem und damit zum Gegenstand feministischer Diskurse sei der Mann geworden, als Vergewaltigung und männliche Gewalt gegen Frauen und Kinder zentrale Themen der Diskussion wurden. Im Zuge dieser Diskussion sei die Unterdrückung der Frau den Männern individuell zugerechnet worden. Ein transhistorisch gegebenes, primordiales Machtstreben der Männer sei betont worden, während weniger Gewicht darauf gelegt worden sei zu erkunden, wie männliche flacht in sich wandelnden sozialen Arrangements und ihren Ideologien institutionalisiert wird. Ein wichtiges Instrument sowohl für die Analyse von als auch für die politische Auseinandersetzung mit männlicher Macht war bzw. ist der Begriff des Patriarchats. Auf dieses Konzept können sich verschiedene gesellschaftstheoretisch orientierte Richtungen der Frauenforschung verständigen. Patriarchat bezeichnet je nach theoretischer Präferenz entweder das zentrale oder - neben dem Kapitalismus - ein zentrales Prinzip der Vergesellschaftung der Geschlechter. In diesem Sinne spricht die gesellschaftstheoretisch orientierte Frauenforschung von der Strukturkategorie `Geschlecht' (vgl. Beer 1990, S. 12). Das weitestgehende Patriarchatskonzept vertritt der sog. radikale Feminismus' 6. Dieser versteht Frauen und Männer als distinkte Klassen, 76 78 Die amerikanische Literatur unterscheidet folgende Richtungen des Feminismus: einen li- die durch fundamental entgegengesetzte Interessen bestimmt sind. Männliche Macht und die männlich dominierte Kultur gelten als Quelle der Unterdrükkung der Frau. Deren Unterordnung im Haushalt ist primär gegenüber derjenigen in der Sphäre der Erwerbsarbeit. Das Patriarchat, nicht der Kapitalismus ist der Mechanismus der Unterdrückung der Frau (vgl. Shelton/Agger 1993, S. 27f.). Deren Soziallage, nicht die des Proletariats, stellt die fundamentalste Form der Unterdrückung dar. Als zentrales Mittel gilt die männliche Kontrolle des weiblichen Körpers und der weiblichen Sexualität, so daß die Bedürfnisse und Interessen der Männer bedient werden, nicht aber die der Frauen. Das Patriarchat wird als eine Institution begriffen, mit der der Mann Kontrolle über die reproduktive Kraft der Frau gewinnt, gewissermaßen eine Kompensation für nicht vorhandene eigene reproduktive Fähigkeiten. Männer fürchteten diese als mysteriös wahrgenommene Kraft und seien eifersüchtig auf sie (vgl. Tong 1959, S. 71ff.). Gegenüber solchen psychologisierenden Interpretationen betont Heidi Hartmann, eine prominente Vertreterin der „dual-systems thcory"", die materielle Basis des Patriarchats, womit mehr gemeint ist als ökonomische Res sourcen'8 . Das Patriarchat basiert in dieser Perspektive auf sozialen Beziehungsstrukturen unter Männern, die, obwohl selbst hierarchisch organisiert, eine Interdependenz und Solidarität unter Männern etablieren, die sie in die Lage versetzen, Frauen zu dominieren (vgl. Hartmann 1981b). Homosoziale Beziehungsgeflechte der Männer sind die Voraussetzung für ein patriarchal strukturiertes Geschlechterverhältnis (vgl. Dietzen 1993, S. 116). Cockbum (1991a, S. 158) begreift männerbündische Strukturen am Arbeitsplatz, von `sexual talk' bis zum geselligen Zusammensein nach Feierabend, als eine wesentliche Stütze des patriarchalen Regimes. Den männlichen Zusammenhalt potentiell bedrohende Klassenwidersprüche würden auf diese Weise stillgelegt. 77 78 beralen, einen marxistischen, einen sozialistischen (auch „dual-systems theory"), einen radikalen, einen psychoanalytischen, einen existenzialistischen und einen postmodemen Feminismus (vgl. Tong 1989). Anders als der radikale Feminismus geht dieser Ansatz nicht davon aus, daß das Patriarchat universell das primäre Unterdrückungsverhältnis ist, und anders als der marxistische Feminismus nimmt der Zwei-Systeme-Ansatz an, daß die Strukturen des Geschlechterverhältnisses fundamental andere sind als die des Klassenverhältnisses und daß Patriarchat und Kapitalismus zwei interdependente Systeme sind, die sich tendenziell in einer Konfliktlage befinden (vgl. Hartmann 1979; Walby 1986) Die Logik des Kapitals wird als geschlechtsblind begriffen und kann deswegen nicht die Unterdrückung von Frauen erklären (vgl. Shelton/Agger 1993, S. 29f; Tong 1989, S. 173ff). Kennzeichnend für diese Variante des Patriarchatskonzepts ist eine modifizierende Verwendung marxistischer Begrifflichkeit. Das Verhältnis von Mann und Frau wird analog dem von Kapitalist und Lohnarbeiter konzipiert; der marxistische Begriff der Produktion wird erweitert: „The concept of production ought to encompass both the production of `things', or material needs, and the `production' of people or, more accurately, the production of people who have particular attributes, such as gender" (Hartmann 1981 a, S. 371). 79 Je nach theoretischer Perspektive wird der Zusammenhang von Klassenund Geschlechterverhältnissen unterschiedlich begriffen (vgl. Fn. 77). Damit erfährt auch der Patriarchatsbegriff unterschiedliche Akzentuierungen. Um herauszuarbeiten, wie im feministischen Patriarchatsdiskurs Männlichkeit konzipiert wird, können die Nuancen vernachlässigt werden' 1. Hier ist von Belang, welche Ebene der Konzeptualisierung von Männlichkeit mit dem Begriff des Patriarchats verbunden ist. Cynthia Cockburn (1991x), die trotz der feministischen Kritik ausdrücklich an dem Begriff festhält", versteht ihn nicht als eine Metapher, sondern als eine angemessene Bezeichnung für eine lebendige Realität („living reality") (S. 18). Die einfachste, gewissermaßen auch umfassendste Definition faßt Patriarchat als System sozialer Strukturen und Praktiken, in denen Männer Frauen dominieren, unterdrücken und ausbeuten. Der Begriff der Struktur impliziert für Walby (1990, S. 20), daß jeder individuelle Mann in einer dominanten und jede individuelle Frau in einer untergeordneten Position ist. Walby (1986, S. 52ff.) begreift in Analogie zur marxistischen Klassentheorie die Hausfrauen als die produzierende Klasse, die Ehemänner als die nicht-produzierende ausbeutende. „The exploitation, or expropriation, which is taking place is the expropriation of the surplus labour of the domestic labourer by the husband" (S. 53). Der Mann gewinnt damit Kontrolle über die Arbeitskraft der Frau, über die er nach seinem Gutdünken verfügen kann. So wie der Kapitalist sich zum Lohnarbeiter verhält, so verhält sich der (Ehe-)Mann zur (Ehe-)Frau. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Die Produktionsbeziehung zwischen den Ehegatten existiert als eine personalisierte Beziehung zwischen Individuen. Diese Besonderheit ist freilich kein Anlaß, die konzeptionelle Tragfähigkeit der Analogie zu überdenken. Vielmehr gilt Walby ein Ansatz wie der Symbolische Interaktionismus, der versucht, der besonderen Struktur personaler Beziehungen begrifflich und methodologisch gerecht zu werden, als nicht geeignet, patriarchale Strukturen zu erfassen (vgl. ebd., S. 67). Patriarchale Verhältnisse finden sich auf allen Ebenen sozialer Beziehungen, in der Intimität des Geschlechtsverkehrs wie in Wirtschaft und Politik. Als zentral für die Fundierung patriarchaler Herrschaft gelten Hausarbeit und Lohnarbeit (vgl. Hartmann 1979; Walby 1986). Die konkrete Ausformung des Patriarchats unterliegt sozialem Wandel, manifestiert sich mithin in unterschiedlichen Strukturen. So sei heute die im engen Sinne väterliche Gewalt von einer allgemeineren männlichen Geschlechtsmacht abgelöst („male sex-right") (Cockburn 1991a, S. 7; vgl. auch Metz-Göckel 1987, S. 29). Bedingt durch den systemischen Charakter ist die `Mitgliedschaft' im Patriarchat nicht optional. Das gilt für Frauen wie für Männer. Frauen können dem System nicht entfliehen, zumindest nicht als einzelne, und Männer, mögen sie sich auch bemühen, in ihrem persönlichen Leben Frauen nicht zu unterdrücken, bleiben aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit ` Benefiziare' des patriarchalen Regimes. „But being male they continue to be seen by others as members of the patriarchy, and they are bound to share, even if unwillingly, in the benefits it affords men" (Cockburn 1991a, S. 8). Geschlecht als Schicksal, auch für den Mann. Dem zu entrinnen kann nur gelingen, wenn Männer unter ihresgleichen eine Unterstützung des feministischen Kampfes organisieren. Und obwohl sie Nutznießer des Patriarchats sind, sieht Cockburn einen Grund, weshalb sie dies tun sollten. Das Patriarchat korrumpiert den Mann mit hohem sozialem Status und `verstümmelt' denjenigen, der am unteren Ende der Hierarchie steht. „Men in patriarchy castrate men, literally and symbolically, in the interests of phallocracy" (Cockburn 1991x, S. 8). Ob das eine angemessene Analyse männlicher Lebenswirklichkeit und männlicher Interessen ist, steht an dieser Stelle nicht zur Debatte. Hier interessiert zunächst die Logik der Argumentation. Die mit der Zugehörigkeit zu einer biologisch gegebenen Geschlechtsklasse festgelegte Position im System bestimmt die Bedeutung des Handelns. Wie immer auch die Intentionen sein mögen, sie zählen wenig bis gar nichts im Vergleich mit den vom System vorgezeichneten Struktureng'. Der Mann ist qua Geschlechtsstatus Mitglied des Patriarchats. Woher er dann die Motivation nehmen soll, die Strukturen des Systems aufzubrechen, und wie die Einsicht, daß dies notwendig ist, zustandekommen soll, ist nicht erkennbar. Die Logik, die der Formulierung der dem Mann offenstehenden Optionen zugrundeliegt, bleibt allerdings die gleiche wie zuvor. „And men today have a choice: accept the patriarchal system or work collectively to contradict it. Be part of the problem or be part of the solution" (Cockburn 1991x, S. 9). Dies ist die binäre Logik des 'entwederoder'. So wie individuelle Intentionen (der Männer) nichts bedeuten gegenüber der Macht des Systems, so gibt es zwischen einem `dafür' und einem ` dagegen' keine Option, keine Zwischenlösung. Sowohl auf der analytischen Ebene wie auf derjenigen der politischen Praxis tendiert das Patriarchatskonzept dazu, Handlungsspielräume und Binnendifferenzierungen zu vernachlässigen. Zumindest auf konzeptioneller Ebene verleitet das Konzept dazu, Thesen über männliche Erfahrungsmodi zu formulieren, die einer empirischen Grundlage bedürften und nicht einfach aus dem gesellschaftstheoretischen Entwurf abgeleitet werden können. Aus der Grundannahme, daß Männer unabhängig von ihren Intentionen „in patriarchalen Verhältnissen einen Status81 79 80 80 Für eine Diskussion verschiedener Patriarchatskonzepte vgl. Walby 1986, S. 5ff. „However, `patriarchy' has come to be a popular shorthand term for systemic male dominance and for that reason I use it here" (Cockburn 1991 a, S. 7f.). So auch Metz-Göckel (1987, S. 28): „Analytisch ist Patriarchat ein Systembegriff insofern, als es jenseits des Wollens einzelner Männer existiert. Einzelne können als Individuen persönlich von den Zumutungen und Zuschreibungen patriarchalen Denkens und Handelns abweichen, ohne daß sich am Geschlechterverhältnis insgesamt etwas ändert". 81 vorteil aufgrund ihres Geschlechts" haben, folgert Metz-Göckel (1987, S. 28): „Das Patriarchat verschließt der männlichen Selbstdeutung die kritische Einsicht als überlegenes Geschlecht ... Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind Männer blind gegenüber den Privilegien und sozialen Dimensionen ihres Geschlechts". Der empirische Teil der Arbeit wird zeigen, daß sich diese Schlußfolgerung nicht halten läßt (s. Kap. 7). Es gibt eine Vielzahl von Männern, die durchaus ein Wissen um die eigene Überlegenheit und um die Privilegien des männlichen Geschlechts haben, und dies auch in Milieus, in denen man es dem soziologischen common Sense zufolge am wenigsten vermutete. Diese Einsicht führt freilich nicht zwangsläufig zu einer Kritik an den Verhältnissen, sondern ist mit einer zustimmenden Haltung sehr gut vereinbar. Privilegien können auch bewußt genossen werden. Des weiteren wird sich zeigen, daß die wenigen Ausnahmen., die sich selbst als profeministische Männer begreifen und bei denen sich Wissen mit einer Kritik der bestehenden Geschlechterverhältnisse und der dominanten Position des Mannes verbindet, nicht zu einer verändernden Praxis finden. Nicht nur gegenüber dem Patriarchatskonzept, sondern allgemein gegenüber gesellschaftstheoretischen Entwürfen erweist sich die Notwendigkeit einer empirisch-rekonstruktiven Forschung, welche zum einen Unerwartetes zu entdecken vermag und zum anderen dessen strukturelle Verankerung zu rekonstruieren hat. Dazu bedarf es offenerer theoretischer Konzepte, die kein Präjudiz darüber enthalten, wie die empirische Wirklichkeit aussieht. Das Patriarchatskonzept läuft Gefahr, Unerwartetes nur als Zufall fassen zu können. Beispielsweise gilt Knapp (1987, S. 245) die Familie stärker von Aspekten der Ungleichheit als von egalitären Dimensionen bestimmt. „Letztere verdanken sich eher dem Zufall geglückter Beziehungen, die zwar innerhalb der Familienideologie einen Stammplatz haben, aber außerhalb der gesellschaftlichen Formbestimmtheit des Geschlechterverhältnisses liegen". Auch wenn egalitäre Beziehungen nicht der Normalfall sein mögen, so enthebt das nicht der Aufgabe, der strukturellen Verankerung des sogenannten Zufalls nachzuspüren. Das setzte einen modifizierten Strukturbegriff voraus, der nicht eindimensional konzipiert ist und der vor allem nicht im voraus, d.h. vor der empirischen Rekonstruktion, weiß, weiche Struktur die entscheidende ist. Diese analytische Offenheit hat das „gender"-Konzept, sie findet in der Breite der Begrifflichkeit ihren Ausdruck. Was gegenüber dem Konzept des Patriarchats als ein Mangel an begrifflicher Präzision erscheinen mag, hat methodologische Vorteile. Die gender-Perspektive stellt eine Mehrdimensionalität der Strukturen des Geschlechterverhältnisses in den Bereich des Möglichen und setzt den Schwerpunkt nicht auf gesellschaftstheoretische Ableitungen, sondern auf empirische Rekonstruktion. Sie begreift Frauen wie Männer als kompetente Konstrukteure von Wirklichkeit und impliziert die Forderung, Männer zum Gegenstand der Forschung zu machen. Judith Gerson und Kathy Peiss fassen das Forschungsprogramm zusammen: 82 „This emphasis suggests that we appreciate women as the active creators of their own destinies within certain constraints, rather than as passive victims or objects. At the same time, this suggests that feminist scholars must avoid analyzing men as onedimensional, omnipotent oppressors. Male behavior and consciousness emerge from a complex interaction with women as they at times initiate and control, while at other times, cooperate or resist the action of women. Clearly researchers need to examine men in the context of gender relations more precisely and extensively than they have at the present time" (Gerson/Peiss 1985, S. 327). Mit der gender-Perspektive ist keine einzelne Theorie bezeichnet, sondern ein Forschungsprogramm bzw. ein Paradigma, das den zitierten Linien folgt. Es hat deutlich sozialkonstruktivistische Konturen, ist aber nicht auf ethnomethodologische und interaktionistische Ansätze begrenzt. Kern der genderPerspektive ist die Absage an eine Konzeption des Geschlechterverhältnisses, in der Frauen und Männer einander in binärer Opposition gegenüberstehen. as impliziert, daß keines der beiden Geschlechter als monolithisch begriffen wird (vgl. Lorber 1994, S. 4f.). Ein zentrales Bemühen und ein wichtiges Ergebnis der Frauenforschung besteht darin zu zeigen, in welcher Weise Weiblichkeit als ein vieldimensionales Phänomen zu begreifen ist, auf die Vielfalt weiblicher Lebenslagen und weiblicher Lebensentwürfe hinzuweisen. In dem Maße, in dem dies akzentuiert worden ist, sind Unterschiede in männlichen Lebenslagen konzeptionell eingeebnet worden (vgl, Gonnell 1985, S. 266). Der Fokus auf männliche Macht in einem patriarchalen Unterdrückungsverhältnis hat eine Befassung mit männlicher Ohnmacht als unwichtig erscheinen lassen. Die gender-Perspektive postuliert einen differenzierenden Blick auch auf männliche Lebenszusammenhänge, ohne allerdings die Machtrelation aus dem Auge zu verlieren. In die Beziehung der Geschlechter ist die Asymmetrie notwendig eingebaut, wie Ruth Seifert (1992, S. 861) unter Rekurs auf Luhmann ausführt, wie dies aber auch Simmel bereits deutlich herausgestellt hat (s. Kap. 1.2). Von einer kulturellen, sozialen und politischen Dominanz des Mannes auszugehen impliziert jedoch nicht, in allen gesellschaftlichen Bereichen, am Arbeitsplatz wie in der Familie, eine einheitliche, nach dem gleichen Muster funktionierende Machtstruktur anzunehmen. Patriarchatskonzept und gender-Perspektive unterscheiden sich hinsichtlich der begrifflichen Fassung der Asymmetrie zwischen den Geschlechtern dahingehend, daß letztere Macht als eine formale Kategorie begreift, während das Konzept des Patriarchats eine inhaltliche spezifizierte Ausprägung von Macht begrifflich festschreibt. Lynne Segal (1990, S. 205f.) fordert, nachdem der Feminismus das Bild einer einheitlichen Weiblichkeit aufgegeben hat, nun in gleicher Weise die Vorstellung einer essentiellen Männlichkeit in Frage zu stellen, freilich ohne dabei die Probleme zu nivellieren, die aus der männlichen Dominanz resultieren. Vielfalt und wechselnde Bedeutungen von Männlichkeit würden ansonsten übersehen, und damit auch Ansatzpunkte für Veränderungsstrategien. 83 Die simple Gleichsetzung von Maskulinität und männlicher Dominanz verhindere ein adäquates Verständnis beider (vgl. Segal 1993, S. 638). in ihrer Studie über den Wandel der Männlichkeit zeigt Segal, daß die Familie immer weniger eine stabile Basis männlicher Autorität und Macht ist. Die überlegene Position des Mannes löst sich zwar nur langsam auf, aber: „The dominant idea of a fixed and pure heterosexual masculinity, to which women and children are inescapably subordinated, once so securely grounded in the nuclear family, is, if not in crisis (as is often glibly claimed), at least a little less hegemonic than it has ever been before" (Segal 1990, S. 100). Nicht nur hinsichtlich Männlichkeit, sondern insgesamt steht die genderPerspektive gegenüber dem Konzept des Patriarchats für eine Erweiterung des Blickfeldes. Die Forschungsgegenstände erstrecken sich von der geschlechtlichen Arbeitsteilung über geschlechtliche „sexual scripts" und geschlechtliche Persönlichkeitsmerkmale bis hin zu Geschlechtsidentität und Geschlechtsdarstellung (vgl. Lorber 1994, S. 30f). Diese beispielhaft herausgegriffenen Dimensionen" machen deutlich, daß das Konzept des Patriarchats wenig geeignet ist, die Forschung auf all diesen Gebieten anzuleiten. Für die Dimension der geschlechtlichen Arbeitsteilung mag es eine logisch angemessene Begrifflichkeit sein, nicht unbedingt eine empirisch angemessene, für eine Rekonstruktion weiblicher und männlicher Gefühlsnormen oder der Modi der Selbstdarstellung der Geschlechter im Alltag dürfte dieses Konzept jedoch wenig nützlich sein. Mit der Absage an ein Verständnis des Geschlechterverhältnisses, in dem Männer und Frauen monolithische Einheiten sind, die in binärer Opposition zueinander stehen, geht eine Kritik an Ansätzen einher, welche die Differenz positivieren (vgl. Gildemeister/Wetterer 1992). Untersuchungen, denen die Perspektive des Patriarchats zugrundeliegt, fragen typsicherweise nach der sozialen Konstitution des Geschlechterverhältnisses (vgl. Beer 1990, S. 12). Die Existenz von zwei Geschlechtern wird vorausgesetzt, die soziale Konstruktion der Differenz ist kein Gegenstand von Forschung und Theoriebildung. Der „latente Biologismus" (Gildemeister/Wetterer 1992, S. 207) der sex-gender Unterscheidung, derzufolge gender, das soziale Geschlecht, die gesellschaftliche Ausarbeitung von sex, der biologisch gegebenen Differenz, ist, kommt voll zum Tragen. Anders als beim Klassenverhältnis gebe es beim Geschlechterverhältnis, d.h. bei dem System von sex und gender, „einen biologischen Faktor, der zwar nicht absolut, so doch stark prädisponierend 82 84 Lorber (1994, S. 30f) unterscheidet a) die Ebene sozialer Institutionen, b) die des Individuums und führt folgende Dimensionen auf. a) „Gender statuses", ..Gendered division of Labor", „gender kinship", „gendered sexual scripts", „gendered personalities", „gendered social control", „gender ideology", „gender imagery"; b) „sex category", „gender identitiy", „gendered marital and procreative status", „gendered sexual orientation", „gendered personality", „gendered processes", „gender beliefs", „gender display". ist" (Cockbum 1991b, S. 83). Dieser Faktor ist die Gebärfähigkeit der Frau. Demgegenüber betont die gender-Perspektive die soziale Konstruktion von Geschlecht und thematisiert diese auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Dimensionen: von der Konstruktion der Differenz bzw. der Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit bis zur Reproduktion kultureller Muster von Weiblichkeit und Männlichkeit, von der Analyse elementarer sozialer Interaktion bis zur Rekonstruktion kultureller Deutungsmuster. Im Patriarchatskonzept sind die Geschlechtskategorien den geschlechtlichen Praktiken vorgängig, in der gender-Perspektive werden die Geschlechtskategorien durch die Praktiken hervorgebracht, sind gewissermaßen gleichursprünglich. Grosso modo läßt sich sagen, daß die methodologische Orientierung der gender-Perspektive den Maximen einer interpretativen Soziologie folgt. Damit gewinnt die verstehende Rekonstruktion von Eigen- wie Fremdwahrneh mung, von Deutungsmustern des Geschlechterverhältnisses und der eigenen Position in diesem, wie sie dem Denken und Handeln von Frauen und Männern zugrundeliegen, an Bedeutung. Hinsichtlich der Untersuchung von Männerwelten und Männlichkeitsmustern hat das zur Folge, daß Orte, an denen die Konstruktion von Männlichkeit geschieht, zum Gegenstand der Forschung gemacht werden und daß diese Forschung sich bemüht, die Perspektive der dort agierenden Männer ohne Rekurs auf vorgegebene inhaltliche Kategorien zu erfassen. Während das Patriarchatskonszept vornehmlich die Auswirkungen des Handelns von Männern auf Frauen thematisiert, versucht die gender-Perspektive männliches Handeln auch aus der maskulinen Binnenperspektive heraus zu verstehen, fragt nicht nur danach, in welcher Weise es zur Aufrechterhaltung der geschlechtlichen Dominanzstruktur beiträgt. Segal (1990, S. 207ff.) kritisiert, daß der Feminismus der ausgehenden siebziger Jahre bei der Suche nach einer fundamentalen transhistorischen Basis männlicher Dominanz die männliche Sexualität in einer Weise fokussiert hat, die der sexuellen Wirklichkeit, wie sie von Männern erfahren wird, nicht gerecht wird. Die These von der männlichen ` Phallokratie' bringt diese Position nicht nur metaphorisch auf den Punkt. Zwar kann der Phallus, so Segal, als ein kulturelles Symbol männlicher Macht verstanden werden, irreführend ist es allerdings, dieses Symbol mit der gelebten Erfahrung männlicher sexueller Dominanz gleichzusetzen. Segal macht auf die Diskrepanz aufmerksam, die zwischen den Präpotenz akzentuierenden kulturellen Bildern männlicher Sexualität und den alltäglichen Erfahrungen von Männern besteht. „Heterosexual Performance may be viewed as the mainstay of masculine identity, but its enactment does not in itself give men Power over women" (S. 211). Autobiographische Berichte sowie wissenschaftliche Untersuchungen zur männlichen Sexualität zeigen gleichermaßen, daß für viele Männer die Sexualität der Bereich ist, in dem sie die größte Unsicherheit gegenüber Frauen erleben, und dies in starkem Kontrast zu der Erfahrung von Autorität und Unabhängigkeit in der öffentlichen Welt. Der Alltag heterosexueller ge85 schlechtlicher Beziehungen scheint eher durch eine komplexe Aushandlung von Macht zwischen Mann und Frau als durch ein stabiles und einseitiges Dominanzverhältnis bestimmt zu sein. Segals Beschreibung männlicher sexueller Erfahrungen zeigt beispielhaft, wie die gender-Perspektive eine Analyse ermöglicht, in der die Eindimensionalität vieler Darstellung männlicher Machtstrukturen aufgebrochen wird. Die generelle gesellschaftliche Dominanz des männlichen Geschlechts setzt sich nicht bruchlos in sämtliche Lebensbereiche fort. Macht als exlusiv dem einen Geschlecht vorbehalten und als einen einseitigen., top-down-Prozeß zu begreifen führt zudem dazu, die Partizipation der Frauen bei der Aufrechterhaltung männlicher Dominanz unberücksichtigt zu lassen (S. 261). Ein weiteres Beispiel für eine die Vielschichtigkeit der geschlechtlichen Wirklichkeit betonende Analyse sind die Arbeiten von Francesca Cancian (1985, 1986) über weibliche und männliche Ausdrucksformen von Liebe. Cancian untersucht, welche Folgen die kulturelle Codierung von Liebe dafür hat, wie Frauen und Männer ein unterstützendes und Zuwendung ausdrükkendes handeln wahrnehmen. Ihre These ist, daß unterstützendes Handeln, das Männer selbst als Ausdruck von Liebe begreifen, weder von den Frauen noch im allgemeinen gesellschaftlichen Verständnis als solches wahrgenommen wird, weil als Folge einer ` Femininisierung der Liebe' (1986) nur emotional expressives Verhalten, nicht aber instrumentelle Unterstützung mit Liebe konnotiert werden. Als Ergebnis empirischer Generalisierung hält Cancian (1985, S. 253) fest: „Women prefer emotional closeness and verbal expression; men prefer giving instrumental help and sex". Cancian rekonstruiert die Perspektiven beider Geschlechter und gelangt so zu einer Analyse des Verhältnisses von Liebe, Abhängigkeit und Macht, die ein komplexes Wechselverhältnis von männlicher Macht und männlicher Abhängigkeit aufzeigt. Liebe in Gestalt von instrumenteller Hilfe auszudrücken impliziert eine überlegene Position gegenüber der Person, der man hilft, die man schützt, die man versorgt usw. Die Abhängigkeit von der Zuwendung der unterlegenen Person kann somit unbemerkt bleiben. Beim Wunsch nach emotionaler Nähe ist hingegen die Abhängigkeit nicht zu leugnen. Mit den unterschiedlichen Stilen von Frauen und Männern, Liebe zu zeigen, ist eine Machtrelation unausweichlich verbunden, sie knüpft an der kulturellen Codierung der Differenz von expressiv und instrumentell an. Daß in die Liebesbeziehung die Machtrelation eingelassen ist, ist im Rahmen des feministischen Diskurses keine neue Einsicht. Cancian zeigt darüber hinaus, daß das, was in systemischer Perspektive als Ausdruck von Macht erscheint, zugleich ein zumeist verkannter Ausdruck von Liebe sein kann und daß dieser männlichen Sicht nicht weniger Wirklichkeit zukommt als den Abhängigkeitserfahrungen der Frauen. Des weiteren macht Cancian deutlich, daß im Zuge dessen, was sie Femininisierung der Liebe nennt, der männliche Stil der Liebe eine öffentliche Entwertung erfährt, während die 86 Legitimität des weiblichen Wunsches nach emotionaler Expression zunehmend anerkannt wird. Daß die gender-Perspektive gegenüber Machtstrukturen nicht blind ist, zeigt auch eine Analyse über die Institution des Militärs von Ruth Seifert (1992). Seifert beschreibt das Militär als einen Ort, an dem Männlichkeit und männliche Macht gleichsam in hypertropher Form gelebt werden. Diese Macht richtet sich extern, d.h. im Kriegsfall gegen die Soldaten der gegnerischen Armee, aber immer auch und in zunehmendem Maße gegen die Zivilbevölkerung, die in Kriegssituationen überwiegend aus Frauen und aus Kindern besteht. In der internen Organisation des Militärs betreffen die Machtstrukturen vornehmlich das Verhältnis von Männern untereinander. Auch heute noch, in Zeiten hochtechnisierter Kriegsführung, gelten sog. klassische männliche Tugenden wie „Tapferkeit, Zähigkeit und körperliche Ausdauer, eine gewisse Aggressivität und eine bestimmte Ausprägung von Rationalität" (S. 863) als wichtige Eigenschaften. „In vielen Einheiten gehören exzessives Trinken und eine mit sexuellen Metaphern durchsetzte Sprache ebenfalls zum Alltag" (ebd.). Eine unmittelbare Funktionalität für die Realisierung militärischer Ziele ist bei vielen dieser Merkmale nicht gegeben, sie scheinen vielmehr dazu zu dienen, die Identifikation mit einer männlichen Gemeinschaft zu ermöglichen und ein „Bewußtsein von hegemonialer, heterosexueller Männlichkeit" zu nähren. „Dies mag wiederum militärisch nutzbar sein; aus militärischen Anforderungen allein allerdings ist es nicht ableitbar" (S. 863f.). Mit der Betonung dieser `Tugenden' wird das Militär als männliche Institution bewahrt. Das zeigt sich zum einen an den Reaktionen auf Frauen, die in militärischen Führungspositionen ein `männliches' Verhalten an den Tag legen. Untergebene Männer nehmen dies als weibliche Entwertung ihrer Männlichkeit wahr. Ein auf männliche Autorität aufgebautes Wertesystem wird untergraben. Die Bedeutung der bezeichneten ` Tugenden' manifestiert sich zum anderen in Reaktionen auf männliche Soldaten, die es an der geforderten Tapferkeit mangeln lassen. Solche Soldaten, und seien es auch wenige, stellen eine Gefährdung der „Bastion der symbolischen Konstruktion von Männlichkeit" dar (S. 866). Diese Soldaten die Macht der Institution spüren zu lassen ist nicht nur als ein Ausdruck der für jede Institution typischen Hierarchie zu begreifen, gleichgültig, was der Zweck der Institution ist, sondern dient auch der Reproduktion einer bestimmten Geschlechterordnung. Es ist gewissermaßen eine `Erinnerung' daran, die geschlechtlichen Grenzen nicht zu überschreiten. Die „strikte Trennung von männlich und weiblich", die das Militär vornimmt, läßt sich, so Seifert, unter Berufung auf militärische Forderungen nicht rechtfertigen. Sie erfüllt „vielmehr eine Ordnungsfunktion im Gendersystem" (S. 869). Ob Männer und Männlichkeiten zum Gegenstand der Forschung gemacht werden sollen, und wenn ja, in welcher Weise, wird in der deutschen Frauenforschung kontrovers diskutiert (vgl Hagemann-White/Rerrich 1988). Strittig 87 ist vor allem, ob eine verstehende Perspektive gegenüber Männern angebracht ist bzw. wie weit ein solches Verstehen gehen sollte. Ist eine solche Perspektive auch gegenüber männlicher Gewalt vertretbar? Der engen Verzahnung von Frauenforschung und Frauenbewegung gemäß werden solche Fragen sowohl in ihrer geschlechterpolitischen als auch in ihrer wissenschaftlichen Bedeutung diskutiert. i n jüngster Zeit mehren sich die Stimmen, welche die Vernachlässigung der Eigenheiten männlicher Welten als ein Defizit begreifen". Plakativ postuliert Ursula G.T. Müller (1988): „Neue Männerforschung braucht das Land". Eine feministische Analyse von Männlichkeit kann, so Maria Rerrich und Carol Hagemann-White (1988, S. 3) Phänomene aufdecken, die trotz - oder gerade wegen - des Androzentrismus der Wissenschaft bislang nicht gesehen werden konnten. Lerke Gravenhorst (1988, S. 13) macht darauf aufmerksam, daß sowohl Frauenforschung als Frauenbewegung ohne ein Männerbild nicht auskommen, daß sie geradezu davon leben, sich ein solches zu machen. Sie plädiert dafür, die zumeist impliziten Bilder explizit zu machen. Die bekannteste Arbeit der deutschen Frauenforschung über den Mann ist zweifellos die von der Zeitschrift „Brigitte" in Auftrag gegebene, von Siegrid Metz-Göckel und Ursula Müller (1986) durchgeführte repräsentative Umfrage unter Männern. Zentrales Ergebnis dieser Folgestudie zu der Untersuchung von Helge Pross (1978) aus den siebziger Jahren ist, daß sich in dem Jahrzehnt, das zwischen den beiden Erhebungen vergangen ist, ein Wandel männlicher Einstellungen gegenüber Frauen vollzogen hat, daß dieser Einstellungsänderung aber keine entsprechende Veränderung in der alltäglichen Praxis des Geschlechterarrangements, sprich: in der Organisation der geschlechtlichen Arbeitsteilung, korrespondiert. Diese Diskrepanz wird von den Männern freilich kaum wahrgenommen. Vielmehr bemühen sie sich, „mit Hilfe einer immer obsoleter werdenden Ideologie die brüchige Wirklichkeit zu übersehen und noch einmal in falscher Harmonie die tendenzielle Übereinstimtriung von Lebenswünschen und Wirklichkeit bei sich wie bei den Frauen zu behaupten" (hetz-Göckel/Müller 1987, S. 26f.). Ein Schwerpunkt der von deutschen Frauenforscherinnen durchgeführten empirischen Untersuchungen zur Männlichkeit liegt im Bereich der Jungenforschung und hat die Sozialisation von Jungen zum Gegenstand (für einen Überblick vgl. Metz-Göckel 1993). Dabei kommen Frauen als Mütter in ihrer 83 88 Das gilt nicht nur für die Soziologie, auch in anderen Sozial- und Geisteswissenschaften wird eine Ausdehnung des Gegenstandsbereiches der Frauenforschung gefordert. Für die deutsche Geschichtswissenschaft diagnostiziert Ute Frevert (1991b. S. 268) einen ausgesprochenen „Forschungsnotstand". „In der Frauengeschichte nimmt man `den Mann' und ` das Männliche' hauptsächlich als das generalisierte Andere wahr, ohne ein Gespür für seine enorme Variationsbreite zu entwickeln". Hanna Schissler (1992, S. 220) zufolge kann „das feministische Projekt, die Überbetonung und normative Überhöhung des Männlichen aufzubrechen", nur gelingen, wenn „Männer als Männer" erforscht werden. Funktion als Mitbeteiligte an der sozialen Konstruktion der Geschlechterwirklichkeit in den Blick. Metz-Göckel (1993, S. 103) führt aus, unter welchen Bedingungen eine „feministische Jungenforschung" „kein Widerspruch" ist; „wenn sie den kritischen Blick in zwei Richtungen wendet: Wie wirken Jungen auf Mädchen und welchen Anteil haben Frauen an der Sozialisation von Jungen. Der feministische Blick sensibilisiert für Dominanz, Konkurrenz und Verdrängung im Verhalten von Jungen, führt dann aber auch zu einer Kritik an Frauen, insbesondere Müttern". Die Befassung mit Jungen begreift Metz-Göckel als Konsequenz des Konzeptes des doing gender. Es fällt auf, daß in der deutschen Frauenforschung ein Verständnis der „Geschlechterbeziehungen als interaktive Konstruktion beider Geschlechter" (S. 107) zunächst in der Forschung über heranwachsende Männer wirksam wird, während der allgemeine Diskurs der Frauenforschung - der Diagnose von Gildemeister und Wetterer (1992) zufolge - gegenüber einer solchen Perspektive noch von einer weitgehenden „Rezeptionssperre" bestimmt ist. Ein Grund mag sein, daß die Mütter als die im Generationsverhältnis überlegenen Akteurinnen eine Position innehaben, in der ihnen eine Definitionsmacht zukommt, die sie dort, wo Frauen und Männer als Erwachsene aufeinander treffen, nicht in dem Maße haben. Der Sozialisationsprozeß von Jungen erscheint als eine Schlüsselstelle für Frauen, auf eine Veränderung des Arrangements der Geschlechter hinzuwirken. 3.2 Patriarchale Unterdrückung oder hegemoniale Maskulinität? Die Diskussion der Männerstudien Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre erscheinen in Großbritannien und in den USA erste Arbeiten, die eine kritische Theorie der Männlichkeit anstreben und dies unter dem Etikett „men's studies" betreiben (vgl. Tolson 1977; Pleck 1981). Diese Forschungsrichtung entwickelt sich in den achtziger Jahren in einem an Spannungen nicht armen Verhältnis zum Diskurs der Frauenbewegung und hat zumindest in den USA einige institutionelle Erfolge im akademischen Bereich erzielt. Hierzulande steht die sozialwissenschaftliche Thematisierung des Mannes in seiner Geschlechtlichkeit noch in den Anfängen. Zwar hat es in der Geschichte der Soziologie und der empirischen Sozialforschung hier und da Studien gegeben, welche soziale Aspekte des Mannseins zum Thema hatten, doch geschah dies vereinzelt und vor allem nicht unter dem Dach einer konsistenten Forschungsperspektive. Am bekanntesten sind die Untersuchungen von Mirra Komarovsky über die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf den familialen Status des Mannes (1971) und über die Orientierungen männlicher College-Studenten angesichts sich wandelnder Geschlechtsrollen (1976). Ebenfalls in der Tradition der Geschlechtsrollen89 forschung steht die von Helge Pross (1978) durchgeführte Studie „Die Männer". Mit der in den siebziger Jahren vollzogenen Umorientierung der Forschung zur männlichen Geschlechtsrolle von einer strukturfunktionalistischen zu einer kulturkritischen Perspektive (s. Kap. 2.1) werden die men's studies vorbereitet, mit deren Etablierung vollzieht sich jedoch ein Paradigmawechsel. Die Kritik richtet sich nicht mehr nur auf die Deformationen, die der Mann durch seine Geschlechtsrolle erfährt, sondern sie richtet sich auf die Machtposition des Mannes im Geschlechterverhältnis. Auf theoretischer Ebene gerät die rollentheoretische Position in Mißkredit84; sie wird von konstruktivistischen Ansätzen abgelöst. Das findet seinen Niederschlag in der Begrifflichkeit. Der Plural ersetzt den Singular, an die Stelle einer einheitlichen Männlichkeit treten multiple Maskulinitäten. Mannsein wird als kontingent konzipiert. Eine weitere entscheidende Differenz zur Theorie der männlichen Geschlechtsrolle ist die Politisierung der Männerstudien. Diese werden eingebunden in den Kampf um eine Veränderung der Geschlechterverhältnisse, und die feministische Devise, derzufolge das Private politisch ist, wird übernommen. Für Morgan (1992) ist Männerforschung keine neutrale Wissenschaft, bei der die eigene Involviertheit in den Forschungsgegenstand geleugnet und die politische Relevanz ausgeblendet wird: „not a desinterested search for knowledge or insight" (S. 2). Für Heam (1987, S. 182) gilt es, nicht das `Patriarchat eines desinteressierten Positivismus' zu reproduzieren, als das er die `normale Wissenschaft' begreift. Diese sei in ihrem impliziten Androzentrismus selbst eine Institution des Patriarchats. Brod und Kaufman (1994, S. 2) plädieren für einen „simultaneous focus an both scholarship and activism". „Kritische Männerforschung" zielt, so Böhnisch und Winter (1993, S. 9), darauf, „die anthropologischen, psychischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingungen für ein anderes Mannsein, eine andere Würde des Mannes zu analysieren und zu formulieren". Die Verknüpfung von Forschung und sozialer Praxis ist weitgehend Konsens 85, weniger Einmütigkeit herrscht darüber, wie sich die Männerstudien zu Frauenforschung und Feminismus verhalten sollen und ob die Unterdrückung der Frau durch den Mann der zentrale Gegenstand sein soll oder die maskuline Binnenwelt. Ein großer Teil der Männerforscher, insbesondere der britischen und diejenigen, die das Patriarchatskonzept vertreten, plädiert für eine 'nicht- ursupatorische' Haltung gegenüber der Frauenforschung. Das betrifft zunächst die Bezeichnung der eigenen Forschung. Das Etikett Männerforschung bzw. men's studies gilt als problematisch, weil es insinuiere, ein notwendiges Äquivalent zur Frauenforschung zu sein; so als solle diese um etwas komplementiert werden, was sie selbst nicht leistet. Um den Eindruck einer „unwarranted symmetry between men's and women's studies" zu vermeiden, schlägt Heam (1987, S. 182) den Begriff ` Kritik des Mannes' („critique of men") vor". Heam und Morgan (1990) formulieren sechs Regeln, nach denen sich Männer, die Geschlechterforschung betreiben, richten sollen: 1. Sie sollen feministische Forschung unterstützen. 2. Der Gegenstand sind Männer. 3. Es gibt keine Parität zwischen Frauenforschung und der Kritik des Mannes. Während Frauenforschung eine exklusive Angelegenheit von Frauen ist, steht die Beschäftigung mit dem Mann beiden Geschlechtern offen. 4. Die Kritik des Mannes ist im Licht des Feminismus zu entwickeln. 5. Deren Ziel ist die Veränderung des Mannes. 6. Männer müssen Gleichstellungspolitik unterstützen und sollten nicht versuchen, Forschungsmittel aus Fonds einzuwerben, die für Geschlechter- und Frauenforschung vorgesehen sind. Das Verhältnis von Männer- und Frauenforschung ist prekär, und das von beiden Seiten. Auch ein solcher profeministischer Verhaltens- bzw. ` Ethikkodex', der jeder Kritik an feministischen Positionen von vornherein entsagt, und eine Anbindung der eigenen Forschung an feministische Forschungspolitik8' bewahren nicht davor, daß die Berechtigung von Männerstudien von Frauenforscherinnen in Frage gestellt wird. Im direkten Anschluß an Hearns und Morgans Katalog von Verhaltensregeln artikulieren Canaan und Griffin (1990) fundamentale Vorbehalte gegen eine Männerforschung. Sie fürchten eine Entwertung der Erfahrungen, die Frauen mit Männern und Männlichkeit gemacht haben. Sie halten es für möglich, daß Männerstudien nichts weiter sind als ein neuer Versuch, männliche Dominanz zu legitimieren. Schließlich sehen sie das Problem der Konkurrenz um Forschungsmittel. Weniger fundamental ist die Kritik, die Stein-Hilbers (1994) an der neuen Männerforschung übt. Deren Berechtigung stellt sie nicht prinzipiell in Frage, wohl aber fürchtet sie, daß der Fokus von den Lebenslagen der Frauen auf die der Männer wechselt, sowie „eine weitere Stärkung männlicher Vormachtstellung im Wissenschaftssystem" (S. 76), die dadurch zustandekomme, daß 86 84 85 90 Die Kritikpunkte sind in Kap. 2.1 aufgelistet. Manche Positionsbestimmungen erinnern an die (Anfänge der) Frauenforschung. So postulieren die Herausgeber eines deutschsprachigen Sammelbandes zur Männerforschung: „Kritische Männerforschung ist nach unserer Auffassung allerdings nicht nur ein neuer Wissenschaftsbereich. Sie ist historisch, personell und politisch sehr stark mit der antisexistischen Männerbewegung verknüpft und versteht sich als politisch-emanzipative Theorie" (BauSteineMänner 1996, S. 7). 87 Wobei natürlich auch hier die Frage gestellt werden könnte, ob diese Kritik nicht bereits von der Frauenforschung geleistet wird. Hearn und Morgan (1990) beobachten skeptisch die Tendenz zu einer Institutionalisierung von gender studies, fügen dann aber hinzu: „We say this with some caution, aware that some feminists support the term ` gender studies' as an umbrella term" (S. 204). Der Frauen forschung gebührt die `Meinungsführerschaft'. Sollte diese sich entschließen, sich in gender studies umzubenennen, hätte die Männerforschung dem zu folgen. Keinesfalls aber dürfte diese eine Vorreiterrolle spielen. 91 Männer ein Forschungsgebiet entdecken, das von Frauen mühsam aufgebaut werden mußte. Wie in der Einleitung bereits ausgeführt, läßt sich in gewissem Sinne der überwiegende Teil der bisherigen sozialwissenschaftlichen Forschung als Männerforschung begreifen, insofern als die Forschung von Männern betrie ben worden ist, als sie die Besonderheiten weiblicher Lebenslagen nicht berücksichtigt hat, als sie das Männliche mit dem Allgemein-Menschlichen gleichgesetzt hat. Daß die in dieser Art von `Männerforschung' enthaltenen Annahmen über Männer implizit geblieben sind, hat, wie die Protagonisten der neuen Männerforschung betonen (vgl. Hearn/Morgan 1990b; Brod 1987b, S. 40f), nachgerade verhindert, daß Maskulinität als geschlechtliche Kategorie thematisiert worden ist. „Studies which are routinely about men, in that men constitute the acknowledged or unacknowledged subjects, are not necessarily about men in a more complex, more problematized, sociological sense. They tend to be resource rather than topic" (Hearn/Morgan 1990b, S. 7). Hier setzt die Männerforschung im Sinne von men's studies an; sie macht Mannsein und Männlichkeit zum topos. „The most general definition of men's studies is that it is the study of masculinities and male experiences as specific and varying social-historical-cultural formations. Such studies situate masculinities as objects of study an a par with femininities, instead of elevating them to universal norms" (Brod 1987b, S. 40). is auf wenige Ausnahmen mangelt es den Männerstudien bislang sowohl an theoretischer wie an empirischer Substanz. Zwar gibt es zahlreiche Arbeiten, die den Anspruch auf Theoriebildung erheben („theorizing masculinities"), doch kommen die meisten über ad hoc-Erklärungen, die sich nur wenig vom populärwissenschaftlichen Diskurs abheben, nicht hinaus. Probleme des methodischen Vorgehens werden kaum angesprochen; wichtiger als eine Erörterung der Gütekriterien der Forschung erscheint allemal die Diskussion der geschlechterpolitischen Orientierung im Verhältnis zum Feminismus (s.o.). Coltrane (1994), der selbst moniert, daß über der Kritik an den ` maskulinistischen' Sozialwissenschaften die Frage, wie man denn nun selbst vorgehen solle, vernachlässigt wird (S. 42f.), kritisiert nicht näher benannte Forscher, die mittels interpretativer und ethnographischer Verfahren Leben und Erfahrungen von Männern und Frauen miteinander vergleichen. Anlaß der Kritik sind weder methodische Fehler noch durch die Daten nicht verbürgte Interpretationen. Sondern: „The Eindings of differente that emerge from these studies tend to legitimate taken-for-granted assumptions about dissimilarity and reinforce the importance of gender in everyday life" (S. 44). Die Möglichkeit, daß solche Resultate eine angemessene Beschreibung der untersuchten Wirklichkeit sein könnten, wird nicht erwogen; politische Kriterien ersetzen nie92 thodische, sind zumindest vorrangig: „Nevertheless, it is useful to consider the political implications of adopting research methods or embracing theories that stress gender differentes" (ebd.). Die Versuche, eine soziologische Theorie der Männlichkeit zu entwikkeln, sind auf eine machttheoretische Analyse der Position des Mannes im Geschlechterverhältnis gerichtet. Über diese Fokussierung sind sich alle Ver treter einer kritischen Männerforschung einig (vgl. Brittan 1989; Connell 1987; Hearn 1987, Kaufman 1994). Stärker als in der Frauenforschung werden Machtverhältnisse in zwei Dimensionen untersucht: Nicht nur die systematische Unterdrückung der Frau durch den Mann, sondern auch Dominanzverhältnisse unter Männern gilt es zu erklären. Die soziale Situation des Mannes wird als eine eigenartige Kombination von Macht und Machtlosigkeit beschrieben; eine Gleichzeitigkeit von Privileg und Leid macht für Kaufman (1994, S. 142) die `verborgene Geschichte' des Mannes aus. Die beiden Dimensionen der Macht im Geschlechterverhältnis sind freilich nicht gleichrangig. Die partielle Ohnmachtserfahrung des Mannes ist nicht mit der systematischen Unterdrückung der Frau durch den Mann gleich zu setzen. In der Theoriediskussion der Männerforschung lassen sich zwei Modelle unterscheiden, mit denen das doppelte Machtverhältnis konzeptionell zu fassen versucht wird: zum einen das der feministischen Theorie entnommene Konzept des Patriarchats, erweitert um den Binnenaspekt männlicher Macht, zum anderen das Konzept der hegemonialen Maskulinität, das deutlich der gender-Perspektive verpflichtet ist. Die Männerstudien wiederholen damit den Paradigmastreit der Frauenforschung. Zumindest mit dem zweiten Konzept gehen sie aber über eine Adaptation feministischer Theorie hinaus und leisten einen eigenen Beitrag zu einer Soziologie der Geschlechterverhältnisse, der inzwischen auch in der Frauenforschung rezipiert wird. Der Begriff der hegemonialen Maskulinität ist von dem australischen Soziologen Bob Connell geprägt und in die Diskussion eingebracht worden. Das Programm einer Patriarchatsanalyse wird in den men's studies am entschiedensten von dem britischen Soziologen Jeff Hearn vertreten und in seiner Bedeutung für eine Theorie der Männlichkeit entfaltet. Ähnlich wie die Vertreterinnen des Zwei-Systeme-Ansatzes in der Frauenforschung (s. Kap. 3.1) begreift Hearn Kapitalismus und Patriarchat als ineinander verwobene, jedoch nicht aufeinander reduzierbare Systeme der Unterdrückung. „Capitalism operates by conversion of wage labour to value and profit; patriarchy by the appropriation of the unwaged labour and energy of women to produce male power. Both are concerned with the control and accumulation of the creativity, labour and energy of women by men" (Hearn 1987, S. 121). Gegenüber dem feministischen Patriarchatsdiskurs ist insofern ein neuer Akzent gesetzt, als Hearn nicht nur den Kapitalismus, sondern auch das Patriar93 chat als ein System begreift, dessen oppressive Kraft sich auch gegen Männer richtet, d.h. gegen diejenigen, die die Akteure und Agenten der Unterdrükkung sind. Auf diesen Aspekt des Patriarchats weisen die feministischen Theoretikerinnen zwar gelegentlich hin, gehen dem aber nicht systematisch nach. Hearn thematisiert Maskulinitäten als Machtbeziehungen gegenüber folgenden Kategorien von Akteuren: Frauen, Kinder, junge Menschen und andere Männer (vgl. Heam/Collinson 1994, S. 98). Die alle anderen Unterdrückungen fundierende sowie am weitesten verbreitete Form männlicher Suprematie ist die gegenüber der Frau. Männer gehören, ob sie es wollen oder nicht, dem „gender of oppression" an, so der Titel des breit rezipierten Buches von Heam (1987). Als Unterdrückung versteht er Praktiken der Diskriminierung, Ignorierung, Vernachlässigung und Verletzung, mit denen Menschen auf einen subhumanen Status degradiert werden (S. XIII). Die Quelle männlicher Macht ist die Aneignung der reproduktiven Kapazitäten der Frau. Ähnlich wie Walby (s. Kap. 3.1) konzipiert Heam die Männer als die ausbeutende Klasse, die sich in der patriarchalen Ordnung des Spätkapitalismus die menschlichen Werte von Frauen und Kindern aneignen. Von der kapitalistischen Ausbeutung unterscheidet sich die patriarchale darin, daß sie eine Aneigung von Ressourcen ohne eine Entschädigungsleistung und daß Gewalt ihre ultima ratio ist. Die Strukturen des Geschlechterverhältnisses sind die einer feudalen Ordnung. Die sexuelle Position von Ehefrauen gleicht der ökonomischen von Bauern im Feudalismus (vgl. Hearn 1987, S. 68ff.). Heam befaßt sich ausführlich mit den Institutionen des patriarchalen Regimes. Sowohl in den Institutionen der Privatwelt als auch in öffentlichen wird die reproduktive Kraft der Frauen von Männern kontrolliert". Durch die männlich definierten Institutionen wird die Unterdrückung der Frau zu einer systematischen und damit unabhängig von den Intentionen der Akteure. Hearn begreift Männer nicht als von Natur aus unterdrückend („inherently oppressive"), sondern als Agenten der Unterdrückung (vgl. Heam 1987, S. 89). Er benennt vier Institutionen, in denen solches organisiert wird, `hierarchische Heterosexualität' und Vaterschaft sind Institutionen der privaten Welt, Professionen und der Staat solche der öffentlichen. Alle vier sind männlich konnotiert, dienen der Durchsetzung männlicher Suprematie, auch wenn Männer innerhalb der Institutionen in Konkurrenz zueinander stehen und sich wechselseitig unterdrücken, z.B. in Gestalt von Machtkämpfen um Einfluß und Ressourcen. 1. Hierarchische Heterosexualität: Sexualität ist im Patriarchat hierarchisch organisiert, in Gestalt einer `Zwangsheterosexualität'$. Egalitäre hetero- 88 In einer neueren Arbeit unterscheidet Heam (1992, S. 53) explizit zwischen einem privaten und einem öffentlichen Patriarchat. Hearn rekurriert auf die Thesen von Adrienne Rich (1980). 89 94 sexuelle Beziehungen sind erst in dem Maße möglich, wie die kulturelle Norm der Heterosexualität an Gewicht verliert. Solange dies nicht geschieht, ist die sexuelle Dominanz des Mannes festgeschrieben, kontrolliert der Mann die Sexualität und den Körper der Frau (vgl. S. 90ff.). 2. Vaterschaft: Da nur die Frau, nicht aber der Mann Gewißheit hat, wer das Kind gezeugt hat, ist die Institution der Vaterschaft ein Mittel zur Kontrolle der reproduktiven Kapazitäten der Frau. Heam begreift Vaterschaft als eine Institution, die ihre Existenz rechtlicher und sonstiger Arrangements zwischen Männern verdankt (vgl. S. 92). 3. Die Professionen: Die sog. klassischen Professionen der Medizin, des Rechts und der Kirche versteht Heam als Instanzen zur Kontrolle der Reproduktion: Kontrolle der Sexualität, der Geburt, der Erziehung. Vor mals private Erfahrungen werden nach Maßgabe männlicher Kontrollinteressen vergesellschaftet. Die direkte, in der persönlichen Beziehung der Ehegatten fundierte patriarchale Kontrolle der Frau in der Familie wird zunehmend ergänzt durch die unpersönliche Kontrolle männlicher Professionsvertreter (Ärzte, Therapeuten) (vgl. S. 92f., 135ff.). 4. Der Staat: Der Staat gilt Heam als die größte Konzentration patriarchaler Macht und Gewalt. Was das Monopolkapital für das Klassenverhältnis ist, ist der Staat für das Geschlechterverhältnis: „the concrete consolida tion of men's appropriation of violent labour-power" (S. 93), korporiertes Destruktionspotential. Hinter der Neutralität des Staates verbirgt sich männliche Dominanz. Der Staat ist ein entscheidendes Mittel, durch das die männlich bestimmte öffentliche Sphäre die Privatsphäre dominiert (vgl. S. 93ff., 115ff.). Die Unterdrückung der Frau durch den Mann ist das zentrale Merkmal dieser Institutionen; gleichwohl richtet sich die männliche Unterdrückung auch gegen das eigene Geschlecht, gegen die eigene Person wie gegen andere Männer. Handlungen, welche die Macht des männlichen Geschlechts stärken, können für den Einzelnen schädliche bis tödliche Folgen haben. Heam erwähnt die aus der kulturkritischen Betrachtung der Männerrolle bekannten Phänomene von Stress und erhöhtem Gesundheitsrisiko, das z.B. Spitzenmanager eingehen, aber auch militärische Aktionen. Wettbewerbs- und Konkurrenzsituationen lassen Männer zu Objekten männlichen Dominanzstrebens werden. Die Professionen kontrollieren nicht nur die reproduktiven Kapazitäten der Frau, sie wirken gleichfalls als Kontrolleure von Emotionen. Davon sind auch Männer betroffen; eine wichtige Erfahrungsmodalität bleibt ihnen verwehrt. Heam gelangt zu dem Resümee: „ We men are formed and broken by our own power" (S. 98; Hervorhebung im Original). Hearns Konzept des männlichen Geschlechts als „gender of oppression" ist von einem starken Determinismus geprägt. Männer können nicht NichtUnterdrücker sein (vgl. S. 167). Wie bei der feministischen Patriarchatsana95 lyse gelten die Intentionen der Handelnden wenig gegenüber der strukturellen Macht der Institutionen. Was immer auch einzelne Männer oder Frauen tun mögen, „the `terms of trade' are to a large extent structurally determined. Men may become soft fathers, liberal professionals, or kind policemen but the institution remains intact as a potential or actual means of oppression" (S. 96). Wegen der gesellschaftlichen Formbestimmtheit der Heterosexualität als Zwangsheterosexualität besorgt beispielsweise die bloße Existenz heterosexueller Männer die Aufrechterhaltung der hierarchischen Heterosexualität, auch wenn einzelne Männer ihre Partnerinnen nicht sexuell unterdrücken. Eine oppresive Praxis scheint der Mann ohnehin kaum vermeiden zu können, gilt doch bereits die bloße Anwesenheit im öffentlichen Raum als Form der Unterdrückung: „More obviously oppressioe heterosexual men reinforce this process just by being, by standing in the street, by the use of cultural signs and symbols, even without harassing, speaking or moving" (S. 108). Gegenüber Hearns Patriarchatskonzept lassen sich die gleichen Einwände formulieren wie gegenüber dem feministischen (s. Kap. 3.1). Hearns Determinismus verstellt den unvoreingenommenen Blick auf die Empirie sogar noch stärker. „Gender of oppression" - der Titel gibt die Richtung der Interpretation vor, und - am Rande notiert - er führt eine stark moralische Komponente ein: die Schuldfrage ist geklärt. Die deterministische Perspektive ist nicht nur für die empirische Forschung problematisch, sie ist - konsequent verfolgt - auch für die geschlechterpolitische Praxis fatal. Heams Vorschläge verlassen dann auch den in der Analyse gesetzten engen Rahmen. In einer Diskussion der Möglichkeiten einer antisexistischen Praxis von Männern schlägt er Initiativen und Handlungsweisen vor, die seiner Analyse zufolge an der Macht der Institutionen scheitern müssen. Auch wenn Hearn sein Patriarchatskonzept weniger deterministisch fassen würde, bliebe eine konzeptionelle Schwäche, die angesichts dessen, daß ihm wie der Männerforschung insgesamt auch daran gelegen ist, die männli che Binnenwelt zu erfassen, besonders schwer wiegt. Um die Machtbeziehung des Mannes zur Frau zu charakterisieren, auch die zu Kindern und zu jungen Menschen, kann der Begriff des Patriarchats als logisch angemessen gelten. Wenn es aber um die Vielfalt der Beziehungen geht, die Männer untereinander haben, und seien es nur solche, die machtförmig strukturiert sind, verfehlt der Begriff die Eigenheiten der dort gegebenen Verhältnisse. Das Verhältnis eines Meisters zu seinem Gesellen mag vielleicht hier und da noch nach dem Modell des pater familias strukturiert sein, um aber das Geschehen in Männerbünden oder die Beziehungen, die männliche Manager untereinander pflegen, zu erklären, bedarf es anderer analytischer Mittel". Ein Ansatz, der sowohl den Determinismus des Patriarchatskonzepts vermeidet als auch Dominanzverhältnisse unter Männern systematisch berücksichtigt, ist mit dem von Bob Connell entwickelten Begriff der hegemo nialen Maskulinität gegeben. Diese nicht nur in den means studies breit rezipierte Theorie der Maskulinität ist eingebunden in eine allgemeine soziologische Theorie des Geschlechts. In Abgrenzung sowohl von voluntaristischen als auch von deterministischen Ansätzen betont Connell (1987, S. 61 ff.) die Notwendigkeit einer `Theorie der Praxis' („practice-based theory"). Eine Theorie, die die These von Geschlecht als zentraler sozialer Strukturkategorie ernst nimmt, kann seiner Einschätzung nach ihre logische Form weder aus natürlichen Differenzen noch aus den Prozessen der biologischen Reproduktion gewinnen. Aber auch die funktionalen Erfordernisse der Gesellschaft, von denen die Geschlechtsrollentheorie ausgeht, sind kein geeigneter Anknüpfungspunkt, ebensowenig die Imperative der sozialen Reproduktion, die in Patriarchatstheorien zugrundegelegt werden. Eine Geschlechtertheorie muß ihre eigene Begrifflichkeit entwickeln und darin autonom sein (vgl. 1987, S. 91). Connell verortet seinen Entwurf in der soziologischen Theoriediskussion über das Verhältnis von Handlung und Struktur. Zu berücksichtigen seien sowohl die konstituierenden Leistungen der handelnden Subjekte als auch die Strukturen sozialer Beziehungen, die eine Bedingung einer jeden Praxis seien (vgl. 1987, S. 62). Die Form der angestrebten Theoriebildung sieht Connell in den Ansätzen von Bourdieu und Giddens verwirklicht, am deutlichsten in dem von Giddens entwickelten Konzept der Dualität der Struktur". Connells Position gegenüber Patriarchatstheorien ist nicht ganz eindeutig. In seinem geschlechtersoziologischen Hauptwerk „Gender and Power" (1987) erwähnt er kurz begriffliche Schwierigkeiten des „Zwei-Systeme Ansatzes" (vgl. S. 43ff.). In einem vor wenigen Jahren erschienenen Aufsatz (1992, S. 736) kritisiert er die Ahistorizität des Patriarchatskonzepts. Maskulinität sei kein simpler Reflex patriarchaler Macht, und Männer generell als die Inhaber von Macht zu bezeichnen, impliziere einen Begriff von Geschlecht, der Männer als undifferenzierte Klasse behandelt. In seinem neuesten Buch (1995) ist hingegen recht häufig von patriarchaler Macht die Rede". Allerdings enthält auch dieses Buch keine Patriarchatstheorie. Dieses Konzept hat keinen systematischen Stellenwert, weder für seine allgemeine Geschlechtertheorie noch für die der hegemonialen Maskulinität. Connell unterscheidet drei fundamentale Strukturen, in denen Geschlechterverhältnisse organisiert sind: Arbeit bzw. Produktion", Macht und 91 90 96 Heani (1992, S. 67) erwähnt in diesem Zusammenhang den Begriff „fratiarchy", entfaltet ihn aber nicht, sondern bestimmt die `Bruderschaft' als Element des öffentlichen Patriarchats. 92 93 An Bourdieu kritisiert er eine gewisse `Strukturlastigkeit', die eine angemessene Konzeptualisierung des Akteurs und der historischen Dynamik verhindere. In dieses Buch ist der 1992 erschienene Aufsatz als ein Kapitel aufgenommen, in dem aber genau die Passagen fehlen, in denen er das Patriarchatskonzept kritisiert. In seinem neuesten Buch (1995) ist der Begriff der Arbeit durch den der Produktion ersetzt. 97 libidinöse Besetzung („cathexis") (vgl. 1987, S. 96ff., 1995, S. 73ff.). Diesen Strukturen liegen unterschiedliche Organisationsprinzipien zugrunde: Trennung (Arbeitsteilung), ungleiche Integration (Über- und Unterordnung) und emotionale Bindung. Die Unterscheidung dieser drei Strukturen ist empirisch gewonnen. Connell nimmt nicht an, daß es notwendige Strukturen sind, sie sind historisch und kulturell kontingent. Diese `Trias' ist m.E. als eine Form tentativer Theoriebildung zu begreifen. Statt nach einer `Einheitsformel' zu suchen, aus der heraus sämtliche Erscheinungsformen des Geschlechterverhältnisses zu erklären sind, weist Connell auf Strukturen hin, in denen sich das Geschlechterverhältnis reproduziert und manifestiert. Die additive Behandlung der Strukturen läßt allerdings außer Betracht, daß die Struktur der Macht die beiden anderen überlagert. Insofern ist Macht die primordiale Kategorie in einer Geschlechtertheorie. Connell berücksichtigt das auf konzeptioneller Ebene nicht; seine Theorie der Männlichkeit basiert jedoch auf der Kategorie der Macht. Männliche Suprematie äußert sich sowohl in den Strukturen der Produktion als auch in den kulturellen Mustern der emotionalen Anziehung. Den Kern seiner Maskulinitätstheorie bildet der Begriff der Hegemonie. Die Hauptachse der Machtstruktur ist die Verknüpfung von Autorität mit Maskulinität. In diesem Sinne ist Maskulinität im Verhältnis von Mann zu Frau bestimmt. Männlichkeit erfährt ihre Bestimmung jedoch nicht nur aus der Relation der Geschlechter zueinander, sondern auch aus den Beziehungen, die Männer zu anderen Männern haben. Insofern wird die Hauptachse durch eine zweite überlagert, von einer Hierarchie von Autoritäten innerhalb der dominanten Geschlechterkategorie (vgl. 1987, S. 109). Das manifestiert sich in Gestalt von Ausgrenzungen (z.B. von homosexuellen Männern) oder in Subordinationsverhältnissen, wie sie für bestimmte Männerbünde charakteristisch sind (z.B. i m Verhältnis von `Fuchs' und `Bursche' in studentischen Verbindungen). Die doppelte Relation, in der die Männlichkeit ihre Kontur gewinnt zum anderen und zum eigenen Geschlecht - faßt Connell mit dem Begriff der hegemonialen Maskulinität. Damit ist eine Konfiguration von Geschlechts praktiken gemeint, welche insgesamt die dominante Position des Mannes im Geschlechterverhältnis garantieren. Hegemoniale Maskulinität ist keine feste Charaktereigenschaft, sondern kulturelles Ideal, Orientierungsmuster, das dem doing gerader der meisten Männer zugrunde liegt. „`Hegemonic masculinity' is always constructed in relation to various subordinated masculinities as well as in relation to women" (Connell 1987, S. 183). Im doing gender der Frauen entspricht der hegemonialen Maskulinität keine ebensolche Femininität. Wegen der globalen Dominanz des männlichen Geschlechts kann es eine hegemoniale Weiblichkeit nicht geben. Das heißt nicht, daß es unter Frauen keine Dominanz- und Machtbeziehungen gibt, die sind jedoch nicht der männlichen Hegemonie vergleichbar, erstrecken sich 98 vor allem nicht auf das andere Geschlecht. Die der hegemonialen Maskulinität komplementäre Form der Weiblichkeit bezeichnet Connell als `betonte Femininität' („emphazised femininity"). Das meint das Einverständnis mit der eigenen Unterordnung und die Orientierung an Interessen und Wünschen des Mannes. Die Betonung des Einverständnisses mit der eigenen Position innerhalb der Geschlechterordnung, sei es die der Frau oder die eines untergeordneten Mannes (hierzu unten mehr), ist der Kern des Begriffs der Hegemonie, den Connell von Gramsci übernimmt. Der über Ideologien und kulturelle Deutungsmuster erzeugten Einwilligung in Verhältnisse, welche die eigene Unterlegenheit festschreiben, kommt mindestens soviel, wenn nicht mehr Gewicht zu als einer Erzwingung der Unterordnung durch Androhung oder gar Anwendung von Gewalt. Gewalt ist die ultima ratio, wenn kulturelle Hegemonie versagt, damit aber auch ein Indikator für die Unvollkommenheit des Systems, ein Zeichen für Legitimationsprobleme. Connell (1995, S. 84) zufolge verweist das gegenwärtig hohe Ausmaß an Gewalt auf Krisentendenzen der modernen Geschlechterordnung 94. Eine zentrale symbolische Stütze hegemonialer Maskulinität ist dasjenige kulturelle Deutungsmuster, das das physiologische Fundiertsein der Geschlechterdifferenz betont. Die Naturalisierung der Ungleichheitsordnung entzieht diese dem legitimen Feld politischer Auseinandersetzungen. Das funktioniert heute immer weniger, hat aber ganz entscheidend zur Etablierung und über weite Strecken der bürgerlichen Gesellschaft zur fraglosen Akzeptanz der männlichen Hegemonie beigetragen. Besonders wirksam ist die geschlechtsspezifische Fassung dieses Deutungsmusters, welche die Geschlechter nach der Nähe bzw. Ferne zur Natur bzw. zur Kultur differenziert (vgl. Ortner 1974; Sauer 1994). Als Gestalter der Kultur gebührt dem Mann die Vorherrschaft gegenüber der der Diktatur ihrer Körperlichkeit unterworfenen Frau. Als zentrales Merkmal hegemonialer Maskulinität sieht Connell eine heterosexuelle Orientierung, sichtbar zum Ausdruck gebracht in der Institution der Ehe. Hier besteht eine gewisse Übereinstimmung mit der Bestimmung der männlichen Geschlechtsrolle durch Parsons, der zusätzlich den Aspekt der Reproduktionswilligkeit betont (s. Kap. 2.1). Allerdings ist die Bestimmung der Elemente des dominanten maskulinen Orientierungsmusters bei Parsons nicht in eine Theorie von Macht und Herrschaft eingebunden. Zudem 94 Connell diskutiert allerdings nicht, ob die Zunahme der registrierten Gewalttaten nicht auch auf eine erhöhte Bereitschaft, Gewalt qua Anzeige öffentlich zu machen, zurückgeht. Freilich wäre auch das ein Krisenindikator, jedoch in einem anderen Sinne. Ein höheres Konfliktpotential von Frauen verweist darauf, daß eine männlich dominierte und definierte Geschlechterordnung bröckelt. Vermutlich wirkt beides zusammen, eine aus männlicher Verunsicherung geborene erhöhte Gewaltbereitschaft und eine stärkere Konfliktbereitschaft von Frauen. 99 kann Parsons Abweichungen nur als Pathologie fassen, wie das Beispiel des „Wolfs" gezeigt hat, während Connell von untergeordneten und marginalisierten Männlichkeiten spricht (s.u.). Den bezeichneten Stellenwert kann die Ehe nur haben, wenn sie als eine Institution begriffen wird, die durch ein Ungleichheitsverhältnis bestimmt ist. Das ist sie in der bürgerlichen Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts und bis in die jüngste Vergangenheit ohne Zweifel gewesen, aber auch unter den Bedingungen einer massiv angestiegenen Erwerbsquote von Frauen bleibt ein Dominanzgefälle bestehen, das Ausdruck der globalen Machtrelation im Geschlechterverhältnis ist". Am deutlichsten zeigen dies Untersuchungen, die in Ehe und Familien durchgeführt worden sind, in denen beide Partner erwerbstätig sind (vgl. Hochschild 1993). Die Tatsache, daß die Dominanzordnung ausgehandelt ist und oft beide Seiten starke Kompromisse eingehen, macht die eheliche Beziehung zu einem dynamischen Prozeß, nicht aber unbedingt zu einem Austausch von Gleichen. Vielmehr dürfte der Aushandlungscharakter eine entscheidende Stütze der hegemonialen Ordnung sein, da er ein Einverständnis der untergeordneten `Partei' mit der Ordnung erleichtert. Die Beschreibungen, die Hochschild (1993) von den vielfätigen Aushandlungsprozessen im ehelichen Alltag gibt, zeigen eindrucksvoll, wie Frauen Selbst- und Beziehungsdefinitionen entwickeln, mit denen sie sich in der ausgehandelten Ordnung einrichten und z.B. das Bild einer gerechten Verteilung der im Haushalt anfallenden Arbeiten aufrechterhalten, für sich und für den Partner. In Anschluß an Goffman (s. Kap. 2.2) läßt sich verdeutlichen, weshalb der Institution der Ehe eine hervorgehobene Bedeutung zukommt. Die Ehe ist der Ort, an dem dem Mann die dominante Position zugewiesen ist, so daß er idealiter - zumindest in einem Lebensbereich die Suprematie erfährt, die dem Ideal der hegemonialen Maskulinität zufolge seine kulturelle Bestimmung ist. Nicht jeder Mann in jeder Ehe erfährt diese Dominanz, aber wie der empirische Teil zeigen wird, ist die Struktur der Beziehung zum (Ehe-)Partner ein entscheidender lebensweltlicher Hintergrund dafür, ob das Mannsein eine fraglose Gegenbenheit ist oder ob es zum lebensgeschichtlichen Problem wird (s. Kap. 7.7). Hegemoniale Maskulinität strukturiert nicht nur die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern, sondern auch die von Männern untereinander: als Abwertung und Ausgrenzung anderer Formen von Maskulinität sowie in Ab hängigkeits- und Unterordnungsrelationen in männlichen Subkulturen. Sie impliziert eine Normalitätsorientierung, auf deren Basis in Eigen- und Fremdtypsierungen Grenzziehungen vorgenommen werden. Sie wirkt mithin 95 100 Im empirischer. Teil der Arbeit wird deutlich werden, daß und in welcher Weise das Muster der hegemonialen Maskulinität eine symbolische Ressource ist, um männliche Dominanz auch dort zu behaupten, wo deren ökonomische Basis wegbricht (s. Kap. 7.2). auch im Sinne einer Strategie der Ausschließung, deren Merkmal allgemein ist, daß der oder die Andere als völlig anders definiert wird. Im Fall des männlichen Geschlechts heißt das mitunter: als weiblich, als effeminiert. Connell bezeichnet die abgewerteten, ausgegrenzten, nicht `für voll genommenen' Maskulinitäten als untergeordnete und marginalisierte (vgl. Connell 1987, S. 186; 1995, S. 78ff.). Homosexualität ist die am stärksten ausgegrenzte Form von Männlichkeit. Homophobie gehört zum Kernbestand der hegemonialen Maskulinität in der bürgerlichen Gesellschaft96. In soziologischer Perspektive ist Homopho bie nicht als psychische Abwehrreaktion verdrängter Impulse zu verstehen, sondern als Verteidigung der zentralen Institution der hegemonialen Maskulinität. Wie keine andere Form des Mannseins wird Homosexualität als Angriff auf die Norm der Heterosexualität wahrgenommen, mithin auf die Basis der Geschlechterordnung. Ausschließung, wenngleich in einer anderen Form, die die Männlichkeit des Ausgeschlossenen nicht grundsätzlich in Frage stellt, ist auch das Prinzip, auf dem der Fraternalismus beruht, wie er für zahlreiche Männerbünde cha rakteristisch ist (vgl. Clawson 1989, S. 11). Der Ausschluß trifft nicht nur Frauen, sondern auch `andere' Männer, z.B. solche, die keinen angemessenen sozialen Status haben (z.B. in Herrenclubs wie Rotary oder Lions), und/oder solche, denen es an bestimmten Fähigkeiten, Tugenden oder auch an Mut fehlt (z.B. sich eine Mensur schlagen zu lassen). Über den Auschluß der ` Anderen' erfolgt eine implizite Bestimmung dessen, was Mannsein bedeutet: z.B. verantwortungsbewußter Umgang mit finanziellen Ressourcen und mit Abhängigen oder Ertragen von Initiationsschmerzen, `ohne mit der Wimper zu zucken"'. Von Marginalisierung sind heterosexuelle männliche Lebensweisen betroffen, die sich dem hegemonialen Muster explizit entziehen oder die dagegen opponieren. Eine typische Reaktion gegenüber diesen Formen einer 'al ternativen' Männlichkeit ist die Karikatur. Der `Hausmann', der `bewegte Mann' sind bevorzugte Objekte. Die im Vergleich zur Homophobie `sanfte' Form der Abwertung zeigt, daß die Majoritätskultur hierin kaum eine ernsthafte Bedrohung sieht. Wie die Analyse der Subkultur der Männergruppen zeigen wird, stehen solche Alternativen in einem höchst ambivalenten Verhältnis zur hegemonialen Form der Männlichkeit. Die Probleme, die diese ` Dissidenten' mit dem gewählten Lebensentwurf haben, belegen eindrucksvoll die weithin ungebrochene Macht des vorherrschenden Leitbildes. 96 97 In früheren Epochen (z.B. Athen) und in anderen Kulturen gelten hingegen institutionalisierte und zeitlich limitierte sexuelle Kontakte zwischen (älteren und jüngeren) Männern als notwendiger Schritt der Mannwerdung (vgl. Gilmore 1991, S. 161f£; Winterling 1990; Bohle 1990). Instruktive ethnographische Beschreibungen verschiedener Männerbünde und ihrer Praktiken und Riten finden sich in dem zweibändigen Sammelband von Völger/Welck 1990. Hegemoniale Maskulinität ist ein Orientierungsmuster, ein Modell, das nur von den wenigsten Männern in vollem Umfang realisiert werden kann, das aber von den meisten gestützt wird, da es ein effektives symbolisches Mittel zur Reproduktion gegebener Machtrelationen zwischen den Geschlechtern darstellt (vgl. Donaldson 1993, S. 645f.). Auch wer nicht in der Lage ist, durch sein Einkommen Frau und Kindern ein von finanziellen Sorgen freies Leben zu ermöglichen, verteidigt das Leitbild des Mannes als Familienernährer bzw. begreift sich sogar als ein solcher und trägt damit zur Reproduktion der Geschlechterordnung bei (vgl. Kap. 7.2). Connell (1995, S. 79f.) nennt dies ` komplizenhafte' Maskulinität. Er differenziert damit - anders als das Patnarchatskonzept - zwischen kulturellem Ideal und der alltäglichen Realität des Zusammenlebens von Mann und Frau, setzt das eine nicht mit dem anderen gleich, kann aber gleichwohl erklären, weshalb das von nur wenigen realisierte Ideal kulturmächtig bleibt. Eine entscheidende institutionelle Stütze solcher Wirklichkeitskonstruktionen sind homosoziale, männerbündische Zusammenschlüsse, wie sie in Gestalt von Burschenschaften, Herrenclubs, Stammtischen, Vereinen u.v.m. existieren. Da s sind soziale und nicht selten auch physikalische Räume, in die man sich temporär zurückzieht. Angesichts sich verändernder Geschlechterverhältnisse kommt diesen Refugien vor allem die Funktion zu, sich wechselseitig der Normalität und vor allem auch der im moralischen Sinne Angemessenheit der eigenen Überzeugungen und Alltagspraktiken zu vergewissern. Männerbünde sind nach wie vor eine wichtige institutionelle Stütze männlicher Solidargemeinschaft (s. Kap. 7.7). Das Konzept der hegemonialen Maskulinität begreift Männlichkeit nicht als eine Eigenschaft der individuellen Person, sondern als in sozialer Interaktion - zwischen Männern und Frauen und von Männern untereinander - (re-) produzierte und in Institutionen verfestigte Handlungspraxis (vgl. Connell 1993, S. 602). An der für die frühe bürgerliche Gesellschaft und deren Begriff der Ehre wichtigen Institution des Duells sei dies paradigmatisch erläutert (vgl. Frevert 1991, S. 214ff.). Der Ehrenzweikampf Mann gegen Mann hatte immer auch, wenn nicht sogar primär die Funktion eines Männlichkeitsbeweises. Was auf dem Spiel stand, war die „Manneswürde", der „Mannesstolz" u.ä.. Einer Ehrverletzung durch eine satisfaktionsfähige Person nicht mit einer Duellforderung zu begegnen bzw. einer solchen sich zu entziehen kam einem Männlichkeitsverlust gleich. In den Regeln des Duells war freilich festgelegt, wer in diesem Sinne seine Männlichkeit zu beweisen hatte: der adelige und der bürgerliche Mann. Nicht `Jedermann' war privilegiert, in dieser Weise einen Ehrenhandel auszutragen. Und Frauen schon gar nicht. In diesem doppelten Ausschluß, des anderen Geschlechts - wurde die Ehre einer bürgerlichen Frau verletzt, hatte deren Mann stellvertretend und als MitBeleidigter zu handeln - und von untergeordneten Angehörigen des eigenen Geschlechts, zeigt sich die komplexe Ordnungsstruktur der hegemonialen 102 Maskulinität. Die Distinktion im Klassenverhältnis und der Vollzug der Geschlechterdifferenz sind eng miteinander verknüpft. Worin sich die hegemoniale Maskulinität manifestiert, ist den Prozessen des sozialen Wandels unterworfen. Das Duell hat ausgedient, und auch das Militär scheint seine Bedeutung als eine zentrale Institution hegemonialer Maskulinität zumindest in Deutschland seit 1945 verloren zu haben (vgl. Seifert 1992). Einer These Connells (1993, S. 613ff.) zufolge kommt gegenwärtig dem technokratischen Milieu des Managements und den Professionen eine hervorgehobene Bedeutung zu. In dem einen Fall basiert hegemoniale Maskulinität auf interpersoneller Dominanz, in dem anderen auf Wissen und Expertise. Vermutlich korrespondiert der Differenzierung der Zentren gesellschaftlicher und politischer Macht in der Gegenwartsgesellschaft eine Pluralität hegemonialer Maskulinitäten, welche um Institutionen wie Wirtschaft, Politik, Militär, Profession, Kirche u.a. organisiert sind. Einschlägige Forschungen fehlen nahezu vollständig. Auch ist es eine empirisch offene Frage, ob hegemoniale Maskulinität an höhere soziale Milieus gebunden ist, bzw. a n den Besitz ökonomischen, sozialen oder kulturellen Kapitals im Sinne Bourdieus. Eine ungeklärte Frage ist auch, welche Bedeutung einer körperbetonten Virilität, wie sie z.B. durch die Figur des Rambo symbolisiert wird, zukommt im Vergleich mit einer Männlichkeit, wie sie etwa der `smarte' und 'jung-dynamische' Börsenmakler präsentiert. Wenn man das Konzept so faßt, daß damit nicht eine Charaktereigenschaft bestimmter Männer aus höheren sozialen Schichten gemeint ist, sondern ein kulturelles Modell mit hoher Breitenwirkung, als Ideologie der Männlichkeit, dann wäre zu fragen, wie sich hegemoniale Maskulinität in unterschiedlichen sozialen Milieus manifestiert9'. In diesem Zusammenhang ist eine Studie von Cockburn (1991b) über Ausgrenzungsstrategien instruktiv, die Facharbeiter im englischen Druckgewerbe gegenüber ungelernten männlichen Arbeitern wie gegenüber Frauen einsetzen. Die traditionelle Form des Druckens erforderte neben manuellem Geschick und einer gewissen körperlichen Kraft eine qualifizierte Ausbildung. Mit der Einführung des Computersatzes war im Prizip jeder und jede, die eine konventionelle Schreibmaschinentastatur bedienen können, in der Lage, im Druckgewerbe zu arbeiten, also auch ungelernte Arbeiter und die bis dahin weitgehend ausgeschlossenen Frauen. Deren fortgesetzte Ausgrenzung durch die gewerkschaftlich gut organisierten Drucker läßt sich zutreffend als Prozeß der sozialen Schließung begreifen. Man kann aber auch mit Cockbum annehmen, „daß die bewußte Abgrenzung der gelernten von den ungelernten Arbeitern gleichzeitig ein Schritt zur Konstruktion von Geschlechtsidentität ist` (S. 76). 98 In einer ausführlichen Diskussion des Connellschen Ansatzes stellt Armbruster (1993, S. 83) die Frage, „ob nicht an verschiedenen Orten oder in verschiedenen Diskursen jeweils andere Versionen von Männlichkeit hegemonial sind". 103 Da der Computersatz manuelle Abläufe beinhaltet, die sich nicht mehr von typischer `Frauenarbeit' unterscheiden, kommt der symbolischen Grenzziehung, die durch unterschiedliche Lohnniveaus abgestützt wird, eine erhöhte Bedeutung zu. Dadurch, daß die Facharbeiter bestimmte Tätigkeiten für sich reservieren und mit gewerkschaftlicher Unterstützung als qualifizierte definieren, betonen sie ihre hegemoniale Position sowohl gegenüber Frauen als auch gegenüber den ungelernten Männern, die `Frauentätigkeiten' ausüben. Das Konzept der hegemonialen Maskulinität ist ein Ansatz zu einer soziologischen Theorie der Männlichkeit, eine ausformulierte Theorie ist es noch nicht. Wie die letzten Bemerkungen zeigen, ist der Gehalt oder die Sub stanz dieser Form von Männlichkeit noch unzureichend bestimmt. Connells Ausführungen informieren mehr über Verhältnisse und Beziehungsstrukturen zwischen den Geschlechtern und unter Männern als darüber, was Männlichkeit bzw. was Männer als ein Geschlecht ausmacht. Der tentative Charakter seiner Theoriebildung wird aber m.E. der Komplexität des Gegenstandes eher gerecht als das Patriarchatskonzept, das die sich überlagernden Dominanzstrukturen nicht berücksichtigt. Das impliziert eine größere methodologische Offenheit, die einer empirischen Rekonstruktion und damit einer Sozialforschung als Entdeckungsstrategie Perspektiven eröffnet. Der Begriff der hegemonialen Maskulinität läßt sich im Sinne einer interpretativen Methodologie als „sensitizing concept" begreifen (vgl. Blumer 1954, Denzin 1970). Connells Ansatz ist eine machttheoretische Analyse der Männlichkeit, welche es vermeidet, Macht nur als top-down-Prozeß und nur als Instrument zur Regulierung des Verhältnisses von Männern und Frauen zu konzipieren. Mit dem von Gramsci entlehnten Begriff der Hegemonie gewinnt eine kultursoziologische Analyse der Ungleichheit der Geschlechter an Bedeutung. Das Verständnis von hegemonialer Maskulinität als praktizierte Ideologie verweist auf ein wissenssoziologisches Verständnis, für das die Frage nach den lebensweltlichen Fundierungen kultureller Deutungsmuster naheliegt: „lt does imply that ideology has to be seen as things people do, and that ideological practice has to be seen as occuring in, and responding to, definite contexts" (Connell 1987, S. 244). hängige Variable, die zur Erklärung von Merkmalsverteilungen herangezogen wird, macht Geschlecht zu einer Ressource, deren soziologischer Gehalt zumeist ungeklärt bleibt. Nur selten wird Geschlecht zum Topos. Andere Standardvariablen, vor allem die soziale Schichtzugehörigkeit, sind Gegenstand umfassender Theoriebildung und Streitobjekt zwischen verschiedenen soziologischen `Schulen'. Eine prima facie dem Geschlecht in ihrer biologischen Dimension verwandte Variable, das Alter der Untersuchungspersonen, erfährt in der Umformung zur Kohorte und noch stärker als Indikator für Generationszugehörigkeit eine Verwendung, die an soziologischen Kriterien orientiert ist. Im Falle des Geschlechts appelliert ein großer Teil der soziologischen Forschung nach wie vor implizit an Selbstverständlichkeiten des Alltagsbewußtseins und übernimmt damit ein naiv biologistisches Verständnis. Das erklärt den Mangel an genuin soziologischen Konzeptualisierungen von Geschlecht. Trotz aller institutionellen Erfolge der Frauenforschung ist eine soziologische Geschlechtertheorie allenfalls in Ansätzen vorzufinden". Zumal die deutsche Soziologie befindet sich gegenüber der amerikanischen und auch der britischen Forschung, die unter dem Titel „gender studies" diese Problemstellung zu bearbeiten begonnen hat, in einem Reflexionsrückstand. Vorhandene Ansätze zu einer soziologischen Konzeptualisierung von Geschlecht lassen sich danach unterscheiden, ob sie den Aspekt der sozialen Ungleichheit im Geschlechterverhältnis betonen oder ob sie die situierte Dar stellung der Geschlechterdifferenz im alltäglichen Handeln fokussieren. Die erste Perspektive entspricht einer sozialstrukturellen Betrachtung, die zweite einer interaktionstheoretischen. Connells Konzept der hegemonialen Maskulinität (s. Kap. 3.2) versucht beides miteinander zu verknüpfen. Daß mit Geschlecht eine zentrale Dimension sozialer Ungleichheit benannt ist, darüber besteht in der soziologischen Ungleichheitsforschung inzwischen ein weitgehender Konsens. Neuere Arbeiten versuchen, die ge schlechtsspezifischen Disparitäten in ein allgemeines Modell sozialer Ungleichheit zu integrieren (vgl. Beck 1986, Hradil 1987a, 1987b; Kreckel 1987, 1992). In der Frauenforschung gibt es eine intensive Diskussion darüber, ob Geschlecht analog zu der Dimension sozialer Ungleichheit konzi99 Geschlecht Sand Habitus. Überlegungen zu einer soziologischen Theorie der Männlichkeit Das Geschlecht der Untersuchungspersonen ist eine Variable, die in nahezu jeder empirisch-soziologischen Untersuchung erhoben und in der Regel auch in Auswertung und Interpretation berücksichtigt wird. Die Weise, in der die gängige soziologische Forschungspraxis `Geschlecht' verwendet, als unab104 Hirschauer (1994, S. 669) sieht zwei Gründe für die „soziologische Indifferenz gegenüber dem sozialen Phänomen der Geschlechterunterscheidung": die implizite Naturalisierung des Phänomens und eine Arbeitsteilung mit der Frauenforschung. Dieser Arbeitsteilung sei die Frage „nach dem sozialen Charakter der Geschlechterdifferenz" zum Opfer gefallen. „Denn auch die Frauenforschung griff diese Fragestellung über Jahrzehnte nicht auf, sondern verwendete die Geschlechtskategorisierung einfach zur Organisation ihrer Themen, Theonen und ihres Personals". Ähnlich urteilen Gildemeister und Wetterer (1992), die in der „Positivierung der Differenz" (S. 203), wie sie von einem Teil der deutschen Frauenforschung betrieben werde, einen Grund dafür sehen, daß „die Frauenforschung in einem sehr grundlegenden Bereich an Selbstverständlichkeiten des Alltagshandelns (partizipiert), statt sie zum Gegenstand kritischer Analyse zu machen" (S. 204). (Vgl. auch Nunner-Winkler 1 994). 105 piert werden kann, die Basis der traditionellen Theorien sozialer Stratifikation ist: Geschlecht als Klasse oder „Klasse Geschlecht" (Beer 1987) - die Begrifflichkeit verweist darauf, daß hier explizit ein „Anschluß an die marxistische Theorietradition" (Kreckel 1959, S. 305) gesucht wird bzw. worden ist (vgl. auch Gyba 1994). Die Probleme einer solchen Strategie der Theoriebildung sind recht bald erkannt worden. Geschlecht verliert bzw. gewinnt erst gar nicht den Status einer primären sozialen Kategorie (vgl. Gerson/Peiss 1985). Geschlechtliche Ungleichheit ist etwas qualitativ anderes als klassenspezifische Ungleichheit, weil die Differenz, an die die soziale Ungleichbehandlung anknüpft und die als Legitimationsbasis bemüht wird, sich in mindestens zwei Punkten fundamental unterscheidet. Erstens ist die geschlechtliche Differenz binär codiert. Auf- und Abstieg sind nicht möglich, auch kein mehr oder weniger. Ein Mensch ist entweder Mann oder Frau, und das lebenslänglich. Die vermeintliche Ausnahme der Transsexualität bestätigt nur die selbstverständliche Gültigkeit dieser Ordnung. Sowohl in der Selbstwahrnehmung der Transsexuellen als auch an der Weise, wie Fälle von Transsexualität gesellschaftlich prozediert werden, wird dies deutlich. Die transsexuelle Person fühlt sich immer schon dem Geschlecht zugehörig, als das sie (an-)erkannt werden möchte, und genau diese biographische Kontinuität wird von den begutachtenden (Psychologen) und entscheidenden (Gericht) Instanzen als Voraussetzung fair eine operative und personenstandsrechtliche `Geschlechtsumwandlung' gefordert (vgl. Hirsehauer 1993). Zweitens erfahren Frauen eine soziale Behandlung, die sich von derjenigen untergeordneter Gruppen in anderen Ungleichheitsverhältnissen deutlich unterscheidet. Goffman (1994c, S. 115ff.) hat darauf hingewiesen, daß sich das Geschlechterverhältnis durch eine spezifische blähe in der Distanz auszeichnet, eine Nähe, die die Grenzen immer wieder transzendiert. Diese Nähe hat ökologische, soziale und emotionale Dimensionen. Anders als die Angehörigen verschiedener sozialer Klassen sind Frauen und Männer (zumindest in industrialisierten Gesellschaften) nicht räumlich voneinander getrennt; sie wohnen nicht nur in denselben Stadtvierteln, sondern auch in denselben Wohnungen, teilen Tisch und Bett. Frauen gegenüber gibt es eine Vielzahl von Ritualen der Ehrerbietung und der Höflichkeit, für die es in der Interaktion von Statushöheren mit Statusniedriegeren im Klassenverhältnis kein Aquivalent gibt"'. Und schließlich gründen intime Beziehungen von Frauen und Männern in unserer Kultur gewöhnlich auf Liebe"'. Das Verhältnis von „intimate strangers" (Rubin 1983) verleiht der Ungleichheit der Geschlechter 100 Daß solche Rituale ein Element der geschlechtlichen Dominanzordnungsind,relativiert deren Bedeutung für die Bestimmung der Besonderheiten der geschlechtlichen Ungleichheitsrelation keineswegs. Vielmehr ist dies ein weiterer Hinweis darauf, daß Geschlecht eine primäre soziale Kategorie ist, die einer eigenen Konzeptualisierung bedarf. 1 01 Zum Verhältnis von Liebe und Dominanz vgl. Dröge-Modelmog 1987. 106 eine Dimension, die eine einfache Analogisierung zum Klassenverhältnis als wenig aussichtsreiche Strategie der Theoriebildung erscheinen läßt. Die in Kapitel 2.2 dargestellten interaktionstheoretischen Ansätze, welche den Aspekt der situierten Produktion und die Darstellung der Geschlechtszugehörigkeit, also die Dimension der Performanz in den Vorder grund stellen, markieren den Gegenpol zu der klassentheoretischen Konzeptualisierung'°z. Dem klassentheoretischen Verständnis gilt Geschlecht in seiner dichotomen Gestalt als gegeben; erklärungsbedürftig ist allein die Ungleichbehandlung, die sich daran knüpft. Die sozialkonstruktivistische Perspektive, am konsequentesten die Ethnomethodologie, sieht die Zweigeschlechtlichkeit selbst als soziale Praxis, als „generatives Muster der Herstellung sozialer Ordnung" (Gildemeister/Wetterer 1992, S. 230). Dabei wird nicht nur einfach Differenz hergestellt, sondern zugleich eine Dominanzordnung: der Primat des Männlichen. Ethnomethodologisch orientierte Frauenforscherinnen ziehen daraus die Konsequenz, daß eine „Enthierarchisierung der Differenz" nicht gelingen kann, „ohne das binäre Grundmuster in Frage zu stellen" (Gildemeister/Wetterer 1992, S. 248)'°'. Die Pole, zwischen denen der geschlechtersoziologische Diskurs osziliert, sind aus der allgemeinen soziologischen Theoriediskussion bekannt: Mikro und Makro, Handlung und Struktur. Deutlich wird, welche Dimensio nen eine soziologische Theorie des Geschlechts zu berücksichtigen hätte: die sozialstrukturell verankerte Ungleichheit der Geschlechter in gleicher Weise wie die situierte oder lokale Produktion der Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit. Des weiteren erscheint es mir sinnvoll, die im Konzept von Geschlecht als Klasse enthaltene Intention, die Konzeptualisierung von geschlechtlicher Disparität an die allgemeine soziologische Diskussion über soziale Ungleichheit anzubinden, aufzunehmen. In dieser Diskussion stellt m.E. Bourdieus kultursoziologisch gefaßter Begriff des Habitus den anspruchvollsten Versuch dar, die Dimensionen von Sozialstruktur und sozialem Handeln miteinander zu vermitteln. Eine Übertragung des bei Bourdieu vornehmlich auf die Klassenlage bezogenen Habitusbegriff auf die Geschlechtslage erscheint mir als eine fruchtbare Strategie, um eine soziologische Geschlechtertheorie zu entwickeln, die nicht nur zu rekonstruieren erlaubt, wie Zweigeschlechtlichkeit als soziale Tatsache konstruiert wird, sondern auch, wie - in diesem Fall - Mannsein sich in einer distinkten sozialen Praxis reproduziert 1 14. 102 Diskurstheoretische Ansätze wie z.B. den von Judith Butler (1991) lasse ich hier außer Betracht. Ich beschränke mich auf explizit soziologische Ansätze. 1 03 Die geschlechter- und wissenschaftspolitischen Konsequenzen einer solchen Perspektive sind weitreichend. Sie betreffen die Frage, inwieweit Frauenförderung und Frauenforschung die unintendierte Folge einer Dramatisierung und Reifizierung der Geschlechterdifferenz haben, statt sie abzubauen (vgl. Gildemeister/Wetterer 1992, S. 247f). 104 Maihofer (1994) bemerkt, daß die zweite Fragestellung in den sozialkonstruktivistischen 107 4.1 Habitusbegriff und Geschlechterverhältnis bei hierre Bourdieu Der Begriff des geschlechtlichen Habitus, der im folgenden näher erläutert werden wird, entstammt nicht einfach einer theoretischen Übertragung der Bourdieuschen Kategorien auf das Geschlechterverhältnis. Vielmehr hat sich i m Zuge der Interpretation des Datenmaterials, vor allem desjenigen aus den Gruppendiskussionen (s. Kap. 7), gezeigt, daß sich Lebenslagen von Männern vor allem danach unterscheiden, inwieweit sie durch eine geschlechtsbezogene habituelle Sicherheit gekennzeichnet sind. Im Sinne des ` grounded theory approach' stellt die Bezugnahme auf Bourdieu den Versuch dar, eine gegenstandsbezogene Theoriebildung an eine formale Theorie anzubinden (vgl. Strauss 1987, S. 241ff.)'". Das ermöglicht, wie noch zu zeigen sein wird, in umgekehrter Richtung ein tieferes Verständnis des Datenmaterials. Das Bourdieusche Konzept des Habitus ist bekannt genug, daß es ausreicht, dessen Logik kurz zu skizzieren. Habitus meint ein System dauerhafter Dispositionen, ein „Erzeugungsprinzip von Strategien, die es ermöglichen, unvorhergesehenen und fortwährend neuartigen Situationen entgegenzutreten" (Bourdieu 1979, S. 165). Basis eines Habitus ist eine spezifische Soziallage. Akteure, die sich durch die Gemeinsamkeit einer Soziallage auszeichnen, tendieren dazu, soziale Situationen in ähnlicher Weise wahrzunehmen und ähnlich zu handeln: weil sie einen ihrer Soziallage korrespondierenden Habitus ausgebildet haben, der, als „Handlungs-, Wahrnehmungs- und Denkmatrix" (Bourdieu 1979, S. 169) wirkend, typische Muster der Problembewältigung generiert. Der Habitus fungiert als ein „gesellschaftlicher Orientierungssinn" (Bourdieu 1987, S. 728). Da jeder Soziallage ein und nur ein Habitus eignet, bedeutet die durch ihn ermöglichte soziale Orientierung i mmer auch soziale Differenzierung, „ein praktisches Vermögen des Umgangs mit sozialen Differenzen" (Bordleu 1987, S. 728). Insofern ist der Habitus nicht neutrales Mittel der Orientierung in der sozialen Welt, sondern Mechanismus der Reproduktion sozialer Ungleichheit. Wie i mmer auch die Intentionen des individuellen Akteurs sein mögen; in dem Maße, in dem sein Ansätzen zu kurz kommt. Sie fordert eine Perspektive ein, die berücksichtigt, daß ungeachtet der Tatsache, daß Geschlecht sozial konstruiert ist, Frauen und Männer in den geschlechtsbezogenen Praxen „tatsächlich existieren" (S. 258). 1 05 Die Etikettierung des Habituskonzepts als formale Theorie gibt diesem Konzept einen Status, den es der Intention Bourdieus zufolge nicht hat, den es aber im Zuge der Theoriediskussion in der Soziologie mehr und mehr erhält. Bourdieu versteht seine Arbeiten eher nicht als `große Theorie', vielmehr kritisiert er die Tendenz zu einer „theoretizistischen Deutung" seiner empirischen Studien (1989, S. 396) und grenzt seine Art der Theoriebildung als „wahrnehmungs- und Aktionsprogramm", „das sich nur aus der empirischen Arbeit, in der es realisiert wird, erschließt", von einem Stil der Theoriediskussion ab, die er „theoretische Theorie" nennt: „ein prophetischer oder programmatischer Diskurs, der sich selbst Zweck ist und aus der Konfrontation mit anderen Theorien erwächst und von ihr lebt" (1997a, S. 59). 108 Handeln durch den Habitus bestimmt ist, gibt es ein `unschuldiges' Handeln nicht"'. Ein Soziallage ist bei Bourdieu durch eine bestimmte Kapitalkonfiguration bestimmt, d.h. durch ein bestimmtes Verhältnis von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital. Welche Kapitalsorten in welchem Maße beses sen werden oder auch nicht, das bestimmt letztlich, welcher Habitus ausgebildet wird. Erworben bzw. „inkorporiert", in den Leib eingeschrieben, wird der Habitus in der Primärsozialisation, und manifest wird er in distinkten Lebensstilen (vgl. Bourdieu 1987). Bei Bourdieu wird die Soziallage vornehmlich als Klassenlage gefaßt, und wenn er von Habitus spricht, dann meint er zumeist den Klassenhabitus. Diese Engführung ist aber keinesfalls zwingend. Der Habitusbegriff läßt sich zur Analyse sozialen Handelns im Rahmen anderer Soziallagen als der durch Klassenzugehörigkeit bestimmten verwenden, ohne die Logik des Begriffs aufzubrechen. In den Arbeiten Bourdieus selbst, vor allem in den früheren, finden sich einige Hinweise auf ein breiteres Verständnis des Habitusbegriffs. So erklärt er z.B. den Generationskonflikt dadurch, daß „unterschiedliche Habitusfor men aufeinanderprallen ..., die gemäß unterschiedlichen generativen Modi erzeugt wurden" (Bourdieu 1979, S. 168). An anderer Stelle spricht er vom Habitus einer Kultur, „im Sinne einer in einer homogenen Gruppe erworbenen kulturellen Kompetenz" (ebd., S. 181). Das freilich sind beiläufige Bemerkungen, denen keine weiteren Erläuterungen folgen. Einen größeren Raum beanspruchen Ausführungen zum Geschlechterverhältnis. Die „Arbeitsteilung zwischen den sozialen Klassen, Altersgruppen und Geschlechtern" (Bourdieu 1987, S. 727) wird in den Schemata des Habitus wiedergegeben, diesen sozialen Unterschieden korrespondieren „geschichtlich ausgebildete Wahmehmungs- und Bewertungsschemata" (ebd., S. 730). Eine soziale Klasse ist für Bourdieu (1987, S. 185) nicht zuletzt dadurch bestimmt, welche Stellung und welchen Wert sie „den beiden Geschlechtern und deren gesellschaftlich ausgebildeten Einstellungen einräumt`. In den zumeist recht umfangreichen Arbeiten, in denen Bourdieu das Habituskonzept entwickelt und weitergeführt hat (1970, 1979, 1987, 1993), behandelt er Geschlecht nicht in einer systematischen Weise und auch nicht als ein grundlegendes organisierendes Prinzip. Begriff und Theorie des geschlechtlichen Habitus findet man hier nicht. Erst in jüngster Zeit, in einem umfangreichen Artikel über die „männliche Herrschaft" (1997b) hat sich Bourdieu schwerpunktmäßig mit dem Geschlechterverhältnis befaßt. Hier 1 06 Hier ist natürlich nicht von ad personam zurechenbarer Schuld die Rede. Das Handeln ist insofern nicht unschuldig, als jedes individuelle Handeln eingebunden ist in die Matrix der auf spezifische Soziallagen bezogenen Habitus und die in diese Matrix eingelassenen Ungleichheitsrelationen reproduziert. 109 spricht er an einer Stelle von einem „vergeschlechtlichten und vergeschlechtlichenden Habitus" (S. 167). Dieser Habitus fungiert in gleicher Weise wie der Klassenhabitus als gesellschaftlicher Orientierungssinn: „Der Habitus erzeugt gesellschaftlich vergeschlechtlichte Konstruktionen der Welt und des Körpers, die zwar keine geistigen Repräsentationen, doch darum nicht weniger aktiv sind. Desgleichen bringt er synthetische und passende Antworten hervor" (S. 167). Bourdieu entwickelt eine Vorstellung von der „gesellschaftlichen Konstruktion des Geschlechts", die der Goffmanschen nahekommt (s.o.): „Der männliche und der weibliche Körper, und ganz speziell die Geschlechtsorgane, die, weil sie den Geschlechtsunterschied verdichten, prädestiniert sind, ihn zu symbolisieren, werden gemäß den praktischen Schemata des Habitus wahrgenommen und konstruiert" (S. 174). Der Artikel ist - neben Connells Begriff der hegemonialen Maskulinität sicherlich der theoretisch anspruchvollste und soziologisch ertragreichste Beitrag zu einer Analyse männlicher Herrschaft. Der Begriff des Ge schlechtshabitus wird allerdings mehr angedeutet als systematisch entfaltet. In einem vor wenigen Jahren gegebenen Interview äußert Bourdieu sich zu den Möglichkeiten eines solchen Begriffs ambivalent. Zwar bezeichnet er das Geschlecht als „eine ganz fundamentale Dimension des Habitus" (1997c, S. 222), meldet aber wenig später Zweifel an, ob es Sinn mache, von einem Geschlechtshabitus in gleicher Weise zu sprechen wie vom Klassenhabitus. Die Klassensozialisation erscheint ihm als grundlegend, „selbst wenn sie zutiefst von der Geschlechtssozialisation beeinflußt wird" (S. 224). Bourdieu hält die Entscheidung explizit offen: „Aber vielleicht müssen wir dieses Problem schlicht und einfach fallenlassen, weil wir nicht die Mittel haben, es zu entscheiden: Was wir beobachten, das sind immer gesellschaftlich und geschlechtlich konstruierte Habitus" (S. 225). Der Artikel über die männliche Herrschaft hat als empirische Basis die ethnologische Feldforschung, die Bourdieu Ende der fünfziger Jahre in der kabylischen Gesellschaft in Algerien durchgeführt hat. Diese Forschungen sind ebenfalls der empirische Hintergrund gewesen, auf dem er den Begriff des Habitus als inkorporierte soziale Struktur entwickelt hat (vgl. Bourdieu 1979). Die kabylische Gesellschaft kennt nur ein Prinzip sozialer Differenzierung: das Geschlecht. Die Ordnung sowohl des privaten als auch des öffentlichen Raums sowie die Organisation der Zeit basieren auf der geschlechtlichen Matrix. Soziale Unterschiede sind nach der Unterscheidung männlich/weiblich codiert (vgl. Krais 1993, S. 213f.). „Die Polarität der Geschlechter ... kommt in der Aufteilung des Vorstellungs- und Wertsystems in zwei komplementäre und zugleich antagonistische Prinzipien zum Ausdruck" (Bourdieu 1979, S. 35). Der weiblichen Welt des Innen und des Passiven steht die männliche des Außen und des Aktiven gegenüber. Diesem Prinzip gehorcht auch die Organisation des Binnenraums des Hauses, der in sich „nach einem Gefüge homologer Gegensätze aufgebaut" ist (ebd., S. 53), eben den gleichen, die das Haus und die Außenwelt voneinander trennen. Alle sozialen Beziehungen werden im geschlechtlichen Code erfaßt, nicht zuletzt die verwandtschaftlichen: „Die parallele patrilineare Kusine steht als kultivierte, ` geradegerichtete' Frau der parallelen matrilinearen Kusine, d.h. der natürlichen, `krummen', unheilbringenden und unreinen Frau, gegenüber wie das Weiblich-Männliche dem Weiblich-Weiblichen" (Bourdieu 1979, S. 97). Das ethnologische Material nutzt Bourdieu, um sein Konzept des Habitus als inkorporierte soziale Struktur zu entwickeln 117. Die weibliche Tugend „orientiert den gesamten weiblichen Körper nach unten, zur Erde, zum Haus, nach Innen hin, während die männliche Vorbildlichkeit ihre Bestätigung in der Bewegung nach oben, nach draußen, zu den anderen Männern hin findet" (Bourdieu 1979, S. 196). Die männliche Körperorientierung wird als zentrifugal, die weibliche als zentripetal beschrieben. Die Unterschiede in der Einverleibung sozialer Strukturen, die hier die des Geschlechterverhältnisses sind, manifestieren sich, so Bourdieu, noch in der Wahrnehmung des Geschlechtsaktes. Die sozialen Gelegenheiten, in denen die Strukturen der geschlechtlichen Teilung der sozialen Welt angeeignet werden, sind die Beziehungen zu Vater und Mutter (vgl. Bourdieu 1979, S. 193) und das kindliche Spiel (vgl. ebd., S. 190f) 10 a. Das Geschlechterverhältnis hat bei Bourdieu gewissermaßen den Status eines heuristischen Hilfsmittels, um zentrale Elemente des Habitusbegriffs zu entwickeln. Wie noch zu zeigen sein wird, ist es nicht zufällig, daß der Aspekt der Einverleibung von Strukturen am Beispiel der Verkörperung des Geschlechtsstatus beschrieben wird, gilt doch der Körper in unserer Kultur als ultimativer Geschlechtsbeweis. In Frauen- und Geschlechterforschung gibt es einige Versuche und Anregungen, einen Begriff des geschlechtlichen Habitus zu entwickeln (vgl. Conway-Long 1994, S. 71ff., Frerichs 1997; Krais 1993; Liebau 1992; McCall 1992). Daran knüpft sich die Erwartung, die subtilen Mechanismen der Reproduktion der Geschlechterordnung erfassen und gerade auch die These von `Tätern' und `Opfern' in einer nichtvoluntaristischen Weise reformulieren zu können (vgl. Krais 1993, S. 217)' 01. 1 07 Im „Entwurf einer Theorie der Praxis" beziehen sich die Beispiele in dem Kapitel über die „Einverleibung der Strukturen" (Bourdieu 1979, S. 189-202) vornehmlich auf die Geschlechtszugehörigkeit und das Geschlechterverhältnis. 108 Auf die Bedeutung des kindlichen Spiels für die Aneignung der dem eigenen Geschlecht sozial angemessenen Dispositionen verweisen aus der Perspektive der kognitiven Entwicklungspsychologie Piaget (1973, S. 80ff) und Gilligan (1984). Diese Übereinstimmung ist nicht zufällig. Piagets Modell der Adaptation von Handlungs- und Wahrnehmungsschemata an eine widerständige Umwelt hat starke Affinitäten zu Bourdieus Verständnis des Körpers als „Analogien-Operator" (vgl. IRaphael 1 991, S. 250f) 109 An Bourdieus Theorie ist häufig kritisiert worden, daß sie mit ihrem Klassenbegriff der 4.2 Geschlechtlicher Habitus - ein Entwurf „Denn als solche, das heißt als etwas über die Summe der einzelnen Mitglieder Hinausgehendes, existiert eine Gruppe dauerhaft ja nur, insofern jedes einzelne Mitglied die dazu erforderliche Einstellung mitbringt, daß es durch und für die Gruppe existiert, oder genauer, gemäß den ihrer Existenz zugrunde liegenden Prinzipien existiert" (Bourdieu 1988, S. 110f.). Gleichgültig, wie man die biologische Basis der Geschlechterdifferenz einschätzt, ob man im Sinne der sex-Bender-Unterscheidung ein vorsoziales biologisches Substrat annimmt oder ob man auch dieses ethnomethodologisch dekonstruiert, ein soziologischer Begriff von Geschlecht meint notwendig mehr bzw. anderes als den Besitz bestimmter biologischer Merkmale. In einem handlungstheoretisch-soziologischen Sinne besteht ein Geschlecht aus einer und existiert in einer distinkten Handlungspraxis. Sozial ist ein Geschlecht mehr als die Summe derjenigen Personen, denen aufgrund einer nach der Geburt vorgenommenen Inspektion („Hebammengeschlecht") oder sonstiger Kriterien (Chromosomen, Gonaden, Hormone) ein bestimmtes Geschlecht zugewiesen worden ist. Die auf Berufsgruppen gemünzte Feststell ung Bourdieus übertragend, läßt sich sagen, daß ein Geschlecht nur dadurch (sozial) existiert, daß die Angehörigen einer Geschlechtskategorie gemäß einem Prinzip handeln, das für diese, nicht aber für die andere Geschlechtskategorie Gültigkeit hat. Mit anderen Worten: Die soziale Existenz eines Geschlechts ist an einen spezifischen Habitus gebunden, der bestimmte Praxen generiert und andere verhindert"". In einer vergleichbaren Perspektive bemerkt Goffman (1981, S. 40), Angehörige einer Geschlechtskategorie seien dadurch gekennzeichnet, daß sie fähig und bereit sind, bei ihren Geschlechtsdarstellungen einen bestimmten Plan einzuhalten. An anderer Stelle führt Goffman (1994c, S. 113) den Begriff „Genderismus" ein, um zu bezeichnen, daß das Handeln der Mitglieder einer Geschlechtsklasse nicht „bloß als eine Reaktion der Individuen auf eine formal festgesetzte Regel angesehen werden kann", sondern „durch etwas motiviert und gestaltet ist, das den einzelnen Körpern innewohnt`. Vielfalt ausdifferenzierter Lebenslagen in der modernen postindustriellen Gesellschaft nicht gerecht wird. Zu berücksichtigen sei auch, in welcher Weise sich „die kollektiven Erfahrungen der einzelnen Generationen (...), Nationalitäten, Geschlechter, Altersgruppen in Form spezifischer Habitus" (Hradil 1 989, S. 126) niederschlagen. Wiewohl es nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Bourdieusche Theorie fortzuentwickeln - der Rekurs auf Bourdieu ist, wie erwähnt, durch die Erwartung eines besseren Gegenstandsverständnisses motiviert -, so mag die Entwicklung eines Begriffs des geschlechtlichen Habitus doch vielleicht auch dazu beitragen, daß die Engführung des Habitus als Klassenhabitus ein wenig aufgebrochen wird. Allgemein heißt es bei Bourdieu (1993, S. 111): „Die Soziologie behandelt alle biologischen Individuen als identisch, die als Erzeugnisse derselben objektiven Bedingungen mit denselben Habitusfonnen ausgestattet sind". 112 In diesem Zusammenhang läßt sich das ethnomethodologische Konzept des „doing Bender" aufnehmen. Der geschlechtliche Habitus ist Basis von „doing Bender", garantiert als „modus operandi" dessen Geordnetheit. Für das Individuum bedeutet das: Im Habitus hat es ein Geschlecht („opus operatum"), indem es ein Geschlecht `tut' („modus operandi"). Insofern als dieses Tun nicht voluntaristisch beliebig ist, sondern im Rahmen des Habitus geschieht, ist Geschlecht - obwohl dem Individuum als Merkmal zugeschrieben - keine individuelle Eigenschaft"'. Andererseits reproduziert sich der Habitus nur im Handeln, so daß Geschlecht nicht etwas dem Handeln der Akteure Externes ist. Mit dieser intersubjektivitäts- und handlungstheoretischen Bestimmung läßt sich das ethnomethodologische Konzept des „doing gender" begrifflich differenzieren: „Gender is obviously rauch more than a role or an individual characteristic: it is a mechanism whereby situated social action contributes to the reproduction of social structure" (West/Fenstermaker 1995, S. 21). Bourdieu bestimmt den Habitus als „einverleibte, zur Natur gewordene und damit als solche vergessene Geschichte" (1993, S. 105). Der geschlechtliche Habitus ist verkörperte und naturalisierte Praxis par excellence. Hirsch auer (1993, S. 60) bezeichnet den Körper als „fleischliches Gedächtnis von Darstellungen". Der Körper `weiß', wie man sich darstellen muß, um als Frau bzw. als Mann anerkannt zu werden; im Körper ist die Geschlechtlichkeit habitualisiert. Stärker bzw. buchstäblicher als der Klassenhabitus scheint der geschlechtliche verkörpert zu sein. In den dominanten kulturellen Deutungsmustern über Geschlechtszugehörigkeit und Geschlechterverhältnisse sind Kultur und Natur zu einer unauflösbaren Einheit verbundenllz. Das Deutungsmuster des physiologischen Fundiertseins der Geschlechterdifferenz bestimmt den common Sense, aber nicht nur diesen. Geschlechtscharaktere gelten als natürliche Folge des Dimorphismus" 3. Soziale Differenzierung kann sich auf die physiologische Differenz der Körper als unhintergehbare Basis berufen. Eine Naturalisierung von sozialer Praxis und von historisch 111 Hirschauer (1994, S. 673) sieht - unter Rekurs auf Bourdieu - auch den geschlechtlichen Körper in dieser Weise vergesellschaftet: „Daß Individuen nicht autonom über ihren Körper verfügen, führt hier nicht auf den phänomenologischen Gedanken, daß sie ihr Leib sind, sondern auf den, daß er ihnen nicht allein gehört. Wenn Individuen ihr Leib sind, dann nicht ihr eigener. Der Habitus ist ein gesellschaftlicher Körper: mit Haut und Haaren gehört er der Gesellschaft". 112 Auch Goffman (1981, S. 39) betont, daß das Verhältnis zur Natur ein Moment ist, hinsichtlich dessen sich Geschlechtslage und Klassenlage unterscheiden. „Zusammenfassend können wir sagen, daß das Geschlecht, zusammen mit dem Lebensalter - vielleicht mehr als so ziale Klassen und andere gesellschaftliche Unterteilungen -, ein Verständnis dafür ermöglicht, wie wir unsere Natur letztlich begreifen und wie oder wo wir diese Natur zeigen sollen". 113 Dieses Deutungsmuster findet sich in einer Vielzahl der Gruppendiskussionen wieder, auf die im empirischen Teil der Arbeit eingegangen werden wird. 113 gewordenen Verhältnissen ist nirgendwo leichter zu bewerkstelligen als dort, wo der Rekurs auf ein körperliches Substrat möglich ist"'. „Denn in diesem Fall findet die Transformation eines willkürlichen Produktes der Geschichte in Natur eine scheinbare Grundlage ... in den Erscheinungsformen des Körpers" (Bourdieu 1997b, S. 169). Die als zweite Natur realisierte Geschichte erscheint als erste, der geschlechtliche Habitus als von der Natur diktiertes Schicksal"'. Mehr als beim Klassenhabitus ist beim geschlechtlichen verdeckt, daß eine soziale Praxis in Gestalt von Habitualisierungen in den Körper eingeschrieben worden ist. Das Unsichtbarmachen der Tatsache, daß der ge schlechtliche Körper ein kulturell erzeugter ist, macht nachgerade die Kompetenz des doing gender aus. Ein Blick auf die geschlechtlichen `Grenzgänger', auf die Transsexuellen, hilft, dies zu verdeutlichen. Der neue, ein dem angestrebten Geschlecht angemessener Körper muß mittels kunstvoller Praktiken gezielt erzeugt werden. Aber erst in dem Maße, in dem Transsexuelle die erlernten körperlichen Mittel der Geschlechtsdarstellung (Gesten, Tonlage beim Sprechen, Positionierung i m Raum usw.) als erlernte vergessen, d.h. habitualisieren, entsteht ein geschlechtlicher Körper, der den Eindruck vermittelt, als sei er die Basis der geschlechtlichen Performanz, als seien die arstellungen „nur sein natürlicher `Verhaltensausdruck"` (Hirschauer 1993, S. 48). Erst wenn dies gelingt, wenn sich ein geschlechtlicher Habitus als selbstverständliche verkörperte Praxis entwickelt, ist eine Anerkennung im gewählten Geschlecht gewährleistet. Das „passing" der Transsexuellen (Garfinkel 1967) läßt sich folglich begreifen als Tilgung von in den Körper eingeschriebenen Dispositionen, nämlich derjenigen, in die sie sozialisiert worden sind, und als gleichzeitiges Ein schreiben angemessener neuer Dispositionen. Dieser Prozeß impliziert, daß Habitusformen erworben werden, die sich auf die Semantik der Ungleichheit der Geschlechter beziehen. Die symbolischen Ressourcen, deren sich die Unterscheidung von zwei Geschlechtern bedient, sind gewonnen aus den Unterschieden der Geschlechterordnung. Mit der Aneignung einer typisch weiblichen Art, sich zu kleiden, zu schminken, zu sprechen usw., wird auch eine bestimmte Position in einem sozialen Ordnungsgefüge eingenommen. Daß dieses Substrat selbst kulturell erzeugt ist, hat Laqueur (1992) in seiner Sozialgeschichte des geschlechtlichen Körpers eindrucksvoll gezeigt. Dies kann hier jedoch vernachlässigt werden, weil die soziale Praxis den Körper als vorsozial wahrnimmt, Wie diese Naturalisierung sozialgeschichtlich entstanden ist, in welchen gesellschaftlichen Konstellationen, das zeigen Studien zur „Erfindung" der Geschlechtscharaktere in der bürgerlichen Gesellschaft (vgl. Hausen 1976; Honegger 1991; Frevert 1995). Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts, mit der Etablierung der vergleichenden Anatomie konstituiert sich, so Honegger (1991, S. 8), „der Körper auf moderne Weise als erzeugungsmächtiger ' Analogien-Operator' (Pierre Bourdieu), der es vor allem gestattet, die Geschlechterdifferenz zu regulieren". Was Transsexuelle sich in mühsamen Lernprozessen intentional aneignen und dann als Angeeignetes wieder vergessen müssen, wird ansonsten im Sozialisationsprozeß eher beiläufig erworben. Dort wird „der Körper zu einer Art Analogien-Operator ausgebildet ..., der praktische Äquivalenzen zwischen diversen Teilungen der sozialen Welt stiftet - Teilung der Geschlechter, der Alters- und Gesellschaftsklassen ... Geleistet wird dies durch Integration der Symbolik sozialer Herrschaft und Unterwerfung mit der Symbolik sexueller Herrschaft und Unterwerfung im Rahmen ein-und-derselben Körpersprache" (Bourdieu 1987, S. 740f., Fn. 13). Untersuchungen über nonverbale Kommunikation haben gezeigt, daß die „Körperstrategien", mit denen Dominanz zwischen Statushohen und Statusniedrigen hergestellt und ausgedrückt wird, denen gleichen, die in der Interaktion von Männern und Frauen zum Tragen kommen (vgl. Henley 1988; Bourdieu 1993, S. 132f.). Auf die sozialisatorische Aneignung des geschlechtlichen Habitus durch das Individuum kann hier ebensowenig eingegangen werden wie auf die Sozialgeschichte der gesellschaftlichen und kulturellen Genese des weiblichen und des männlichen Habitus. Hier soll eine andere Frage behandelt werden, deren Beantwortung wichtig ist für die Interpretation der im empirischen Teil präsentierten Daten. Gibt es pro Geschlecht einen Habitus oder mehrere? Gibt es jeweils eine geschlechtliche Soziallage oder mehrere? In der Bourdieuschen Konzeption des Klassenhabitus eignet einer sozialen Klasse ein und nur ein Habitus. Soziologische Modernisierungstheorien betonen das Aufbrechen von tradierten Bindungen und Zugehörigkeiten. „Jenseits von Stand und Klasse", heißt es bei Beck (1983). Auch von Geschlecht? Die Frauenforschung thematisiert im Zuge einer Abkehr von einer auf weiße Frauen der Mittelschicht zentrierten Perspektive (vgl. West/Fenstennaker 1995, S. 10ff.) mehr und mehr die Vielfalt von weiblichen Lebenswelten und weiblichen Lebensentwürfen. In den men's studier ist es üblich geworden, von Maskulinitäten zu sprechen und den Singular zu vermeiden. All dies wird gewöhnlich mit dem vorsorglichen Hinweis versehen, eine postmoderne Beliebigkeit sei damit nicht verbunden. Im Hinblick auf Weiblichkeit und Männlichkeit den Plural zu verwenden steht einem Konzept von jeweils einem geschlechtlichen Habitus nicht entgegen. Hier sind unterschiedliche Dimensionen angesprochen: zum einen Ausdrucksformen (Maskulinitäten), zum anderen ein generierendes Prinzip (Habitus). Dies führt zu folgenden These: Es gibt pro Geschlecht einen Habitus, also einen männlichen und einen weiblichen. Der jeweilige Habitus manifestiert sich nicht in einer Uniformität von Handlungen, Einstellungen, Attributen; es gibt vielmehr unterschiedliche Ausprägungen von Femininität und Maskulinität, wobei soziales Milieu, Generationszugehörigkeit, Entwicklungsphase und familiäre Situation sich als lebensweltliche Erfahrungshintergründe erweisen, deren Relevanzstrukturen Einfluß auf die Muster haben, in denen sich der geschlechtliche Habitus manifestiert. Selbst dort, wo der geschlechtliche Habitus intentional geleugnet bzw. abgelehnt wird, erweist sich - im Sinne der Dialektik von Determination und Emergenz - seine strukturelle Macht. Der Begriff des geschlechtlichen Habitus unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von dem verbreiteten Konzept der Geschlechtsrolle: Habitus meint nicht, daß man eine Geschlechtsrolle hat, sondern daß man alles Handeln, gleichgültig, welche spezifische Rolle jeweils aktualisiert ist, nach einem bestimmten erzeugenden Prinzip gestaltet. Soziale Rollen sind an bestimmte Positionen in bestimmten sozialen Situationen gebunden (Lehrerrolle, Vaterrolle usw.). Daraus ergibt sich ein fundamentales konzeptionelles Problem des Geschiechtsrollenbegriffs, ist doing gender doch virtuell in jeder sozialen Situation gefordert. Dieses Problem vermeidet der Begriff des Geschlechtshabitus. Er stellt damit Geschlecht konzeptionell, hinsichtlich des Stellenwertes als soziologische Kategorie, dem Begriff der Klasse gleich, bestimmt Geschlecht mithin als Gegenstand der allgemeinen Soziologie, während die Kategorie der Geschlechtsrolle eher auf eine spezielle Soziologie verweist. Auch wenn ein Individuum in einer sozialen Rolle aufgehen mag, der Rollenbegriff faßt die Rolle als eine gesellschaftlich organisierte Erwartungshaltung, die dem Akteur äußerlich bleibt, und nicht als inkorporierte soziale Struktur. Von Rollen kann man sich distanzieren, der Habitus als ` fleischliches Gedächtnis' erinnert beständig an die Macht der Struktur. Geschlechtsrolle ist ein komplementär konzipierter Begriff. Habitus faßt das Geschlechterverhältnis als Ungleichheitsrelation. e Überlegungen zum geschlechtlichen Habitus sind Ergebnis zum einen der Adaptation der Bourdieuschen Theorie auf die Geschlechterlage, zum anderen der Interpretation der Daten. Da diese Daten einem Forschungsprojekt über „kollektive Orientierungen von Männern" entstammen, soll die These im folgenden anhand des männlichen Geschlechtshabitus erläutert werden. Damit ist zugleich eine Überleitung zum empirischen Teil der Arbeit verbunden. Diese thematische Spezifizierung macht eine Einschränkung notwendig. Die Ausführungen zum männlichen Geschlechtshabitus beruhen auf datenbasierter Theoriebildung (grounded theory). Inwieweit der weibliche Geschlechtshabitus ähnlich strukturiert ist, bedürfte einer empirischen Prüfung, die entweder in einer vergleichbaren empirischen Studie vorgenommen werden könnte oder die die vorhandenen Untersuchungen über weibliche Lebenswelten, Weiblichkeitsmuster u.ä. entsprechend rekonstruieren müßte. Beides steht außerhalb des Fokus der vorliegenden Arbeit. 116 4.3 Der männliche Geschlechtshabitus Im geschlechtlichen Habitus ist immer zweierlei ausgedrückt: eine Strategie der Differenz und eine Position im Gefüge der Geschlechterordnung. An die Unterscheidung von Männern und Frauen knüpfen sich Unterschiede. Eine Konzeption des männlichen Geschlechtshabitus maß mithin sowohl berücksichtigen, wie Mannsein in Abgrenzung von Frausein sich konstituiert (Dimension der Differenz), als auch, wie in der Herstellung der Differenz männliche Dominanz entsteht (Dimension der Ungleichheit). Die beiden Dimensionen können allenfalls analytisch voneinander geschieden werden, und auch das nur schwierig. Auch dort, wo scheinbar neutral weibliche und männliche Eigenschaften gegenübergestellt (etwa in sozi alpsychologischen Studien der Geschlechterdifferenzforschung) oder wo Mitster der Handlungs- und Weltorientierung (z.B. die Parsonsschen „pattern variables'`) geschlechtlich konnotiert werden, folgt die Ungleichheit gleichsam auf dem Fuße. Die kulturelle Wertigkeit von Orientierungsalternativen wie aktiv versus passiv oder universalistisch versus partikularistisch ist immer mitpräsent und immer mitgedacht. bloch in der feministischen Aufwertung des Duldenden, der Weltverbundenheit usw. - in Bourdieuscher Terminologie: des weiblichen kulturellen Kapitals (z.B. bei Chodorow oder bei Gilligan) - kommt die kulturell dominierende Werteordnung zum Tragen und zum Ausdruck. In den vorliegenden soziologischen Versuchen von Simmel bis Connell, ein Konzept von Männlichkeit zu entwerfen, wird allemal deutlich, daß „doing Bender" „doing difference" ist und daß die Herstellung der Differenz sich der gesellschaftlichen Semantik sozialer Ungleichheit bedient. Es wird aber auch deutlich - und dies wiederum bereits bei Simmel -, daß die Invisibilisierung des Geschlechtlichen im Handeln von Männern ein entscheidendes Merkmal und die zentrale `Strategie' des männlichen doing gender ist, mithin Bestimmungselement des männlichen Habitus. Die Transformation von Macht in Recht ist für Simmel Ausdruck und Mittel dieser Invisibilisierung. Aus dem willkürlichen „Aasnutzer der Macht" wird „der Träger einer objektiven Gesetzlichkeit" (Simmel 1985, S. 202). Schon bei Simmel wird der Zusammenhang von Differenz und Dominanz deutlich, wird sichtbar, wie Differenz sich in und durch Dominanz herstellt. Dominanz, Über- und Unterordnung, Abhängigkeiten und Ungleichheiten gibt es nicht nur im Verhältnis der Geschlechter zueinander, sondern auch in binnengeschlechtlichen Beziehungen. In Connells Begriff der „hegemonia len Maskulinität" ist dies festgehalten. Ausgangspunkt der Connellschen Theorie von Männlichkeit ist die gesellschaftliche Dominanz von Männern über Frauen. Die soziale Konstruktion von Männlichkeit kann nur adäquat begriffen werden, wenn zugleich die Qualität der Konstruktion der Ge- schlechterdifferenz berücksichtigt wird. Die Relationalität der Kategorie Geschlecht ist unaufhebbar. Insofern als das Konzept der hegemonialen Maskulinität Männlichkeit nicht als eine Eigenschaft der individuellen Person begreift, sondern als in sozialer Interaktion - zwischen Männern und Frauen und von Männern untereinander - (re-)produzierte und in Institutionen verfestigte Handlungspraxis, liegt diesem Konzept eine Logik zugrunde, die der des Habitusbegriffs kompatibel ist. Der Begriff der hegemonialen Maskulinität stellt das kulturell erzeugte Einverständnis der Unterprivilegierten heraus. Dieses, nicht so sehr physische Gewalt, garantiert das Funktionieren der Geschlechterordnung. Bourdieu spricht im Zusammenhang mit männlicher Dominanz von symbolischer Gewalt. „ Symbolische Gewalt übt einen Zwang aus, der durch eine abgepreßte Anerkennung vermittelt ist, die der Beherrschte dem Herrschenden zu zollen nicht umhin kann" (Bourdieu 1997b, S. 164). Diese Gewalt funktioniert nur solange, wie sie nicht als solche erkannt wird. Das kulturell erzeugte Einverständnis begründet eine gewisse `Komplizenschaft' zwischen `Opfer' und ` Täter' (vgl. Krais 1993, S. 232f.)' 16. In privaten Beziehungen zwischen Frauen und Männern unterstützen die Erotisierung der Dominanz und die Tatsache, daß solche Beziehungen nicht selten auf Liebe gründen, die ' Komplizenschaft' (vgl. Dröge-Modelmog 1987). Gesellschaftlich wird sie abgesichert durch einen kulturellen Moralkonsens sowie durch einen Rekurs auf allgemeingültige Deutungsmuster"'. Feministische Diskurse versuchen die Allgemeinheit, d.h. Geschlechtsneutralität solcher Deutungsmuster als geschlechtlich konnotiert zu dekonstruieren. Ein prominentes Beispiel ist Gilligans (1984) These, die herrschende Gerechtigkeitsmoral sei keine universelle, sondern eine spezifisch männliche Moral. Hegemoniale Maskulinität ist der Kern des männlichen Habitus, ist das Erzeugungsprinzip eines vom männlichen Habitus generierten doing gender bzw. ` doing masculinity', Erzeugungsprinzip und nicht die Praxis selbst. Der männliche Habitus kann sich folglich in einer Vielzahl von Formen äußern, als Generalverantwortlichkeit für Wohl und Wehe der Familie (Familienoberhaupt) ebenso wie in physischer Gewalt, in Formen prosozialen Handelns (Beschützer) wie in Hypermaskulinität (Rambo, Macho)'ls. Hegemoniale Umgekehrt impliziert ein Aufkündigen der Komplizenschaft, symbolische Gewalt als Gewalt zu thematisieren. Das ist die Strategie des Feminismus. „Im ideologischen Kampf zwischen Gruppen (z.B. Alters- oder Geschlechtsklassen) oder gesellschaftlichen Klassen um die Definition der Wirklichkeit wird der symbolischen Gewalt als verkannter und anerkannter, also legitimer Gewalt das Bewußtmachen der Willkür gegenübergestellt, das den Herrschenden einen Teil ihrer symbolischen Stärke nimmt, indem es Verkennung beseitigt" (Bourdieu 1993, S. 244, Fn. 1). 117 An der besagten `Komplizenschaft' scheitern u.a. immer wieder Versuche, Maßnahmen positiver Diskriminierung zugunsten von Frauen zu implementieren (vgl. Muster 1992). 118 Bourdieu (1997b, S. 215f) spricht von einer gesellschaftlich konstituierten „libido doniinandi" des Mannes, die, „und das oft in derselben Bewegung, ebenso zu extremen Ge- 118 Maskulinität ist zudem der Maßstab, der an das Handeln eines Mannes von anderen Männern herangetragen wird (und oft auch von Frauen). Wer sich dem Habitus zu entziehen versucht, wird von den anderen an dessen Gültigkeit erinnert, und sei es nur derart, daß ein verheirateter Arbeiter, der regelmäßig ohne Pausenbrote zur Arbeit kommt, von seinen Kollegen gefragt wird, ob seine Frau ihm denn keine Brote schmiere. Massivere Formen der ` Erinnerung' sind Etikettierungen wie ` Weichei' oder ` Männerheulverein' für Männer, die als `bewegte' Männer den männlichen Habitus offensiv angreifen"'. Also nicht nur die Erzeugung des eigenen, sondern auch die Bewertung des fremden Handelns geschieht im Rahmen der vom Habitus vorgesehen Parameter. Ein Leben gemäß dem (männlichen) Habitus erzeugt habituelle Sicherheit. Dieser Begriff hat einen spezifischeren Sinn als derjenige der „ontologisehen Sicherheit", wie Anthony Giddens (1991, S. 92ff.) ihn im Rahmen sei ner modernisierungstheoretischen Analyse verwendet. Gleichwohl knüpfen sich, wie wir noch sehen werden, auch an den Begriff der habituellen Sicherheit modernisierungstheoretische Folgerungen. Ontologische Sicherheit meint eine Art Urvertrauen sowohl in die Kontinuität von Selbstidentität als auch in die Konstanz der Strukturen der umgebenden Sozialwelt. Das erinnert an die von Alfred Schütz (1971, S. 257f.) in Anschluß an Husserl als Basis des Alltagshandelns benannten Konstanzidealisierungen des ,;und so weiter" und des „immer wieder". Mit habitueller Sicherheit ist eine Sicherheit gemeint, die ein Handeln betrifft, das unter den Geltungsbereich eines bestimmten Habitus und in den Rahmen einer bestimmten Sozialordnung fällt, hier derjenigen der Zweigeschlechtlichkeit. Habituelle Sicherheit impliziert eine „selbstbewußte Zustimmung zum habituellen Schicksal" (Janning 1991, S. 31), ist positiv angenommener Zwang. Sie erweist sich in einer indexikal vollzogenen Verortung im Beziehungsgeflecht der Geschlechter" 1 ° (im Gewalttätigkeiten des virilen Egoismus wie zu äußersten Opfern der Hingabe und der Uneigennützigkeit führen" könne. 119 Diese Beispiele sind dem empirischen Material entnommen. 120 Joachim Matthes (1985, S. 370) hat den ethnomethodologischen Begriff der Indexikalität gewählt, um den Modus zu charakterisieren, in dem Generationen sich selbst thematisieren. Dies geschehe nicht in Form eines „Gruppenbewußtseins", sondern „solche Selbstthematisierungen (werden) immer im Wechselspiel der generationellen Verhältnisse indexikal getroffen". Setzt man an die Stelle von generationellen Verhältnissen Geschlechterverhältnisse, dann kann für ein männliches ` Geschlechtsbewußtsein', das von Selbstzweifeln und Identitätskrisen nicht affiziert ist, gleiches gesagt werden. Die Ethnomethodologie verwendet den Begriff der Indexikalität, um das rekursive Verhältnis von singulärer Erscheinung (eine Äußerung, eine Handlung) und übergreifendem Muster (eine Regel, ein Orientierungsmuster, ein Deutungsmuster) zu bezeichnen. Die wechselseitige Bezugnahme geschieht in der Routine des Alltagshandelns nicht explizit bzw. nicht qua Reflexion, sondern eben als vorreflexive Routinepraxis in der Manier des „praktischen Bewußtseins" (Giddens). Nur dann, wenn die Routinebasis des Handelns gestört wird, wie es in den bekannten Krisenexperimenten Garfinkels der Fall ist, sehen sich die Handelnden gezwungen, ihr gensatz zu einer diskursiv vorgenommenen Positionsbestimmung), und sie hat zu Folge, daß man seine Männlichkeit nicht als Ergebnis von (intentional gesteuertem) Handeln begreift. Damit, d.h. mit einem intendierten Darstellen, hätte man sie vielmehr bereits verloren. Habituelle Sicherheit kommt dem gleich, was Bourdieu „Doxa" nennt, beruht auf einer „gewohnheitsmäßigen Verwurzelung mit der alltäglichen Ordnung des Ungefragten und Selbstverständlichen" (Bourdieu 1987, S. 668). Diese Verwurzelung ist umso eher möglich, je stabiler die Ordnung ist und je vollständiger die Dispositionen der Akteure, d.h. ihr Habitus, die Strukturen der Ordnung reproduzieren (vgl. Bourdieu 1979, S. 327). Die Ordnung der Geschlechter ist am Ausgang des 20. Jahrhunderts alles andere als stabil. Das müßte Auswirkungen auf Ausmaß und Äußerungsformen habitueller Sicherheit haben. Hierauf wird im empirischen Teil der Ar beit näher eingegangen. Dieser Teil der Arbeit ist unter die Leitfrage gestellt, ob angesichts der zunehmenden Instabilität der Geschlechterordnung die Lebenspraxis noch die Anwendungsbedingungen des männlicher Geschlechtshabitus erfüllt. Inwieweit repräsentieren die Anwendungsbedingungen in einer Epoche deutlichen sozialen Wandels des Geschlechterverhäfnisses noch einen partikularen Zustand" (Bourdieu 1979, S. 171) derjenigen Struktur, die - historisch-genetisch - der Entwicklung des männlichen Geschlechtshabitus zugrundeliegen? Diese Leitfrage läßt sich milieu- und generationsspezifisch differenzieren. Sind die Anwendungsbedingungen beispielsweise in höheren sozialen Milieus mit einem hohen Einkommen des Mannes eher gegeben als in Arbeitermilieus, in denen das Familieneinkommen in einem hohen Maße von der Erwerbstätigkeit der Frau abhängt? Veränderungen in den Strukturen der Sozialordnung ziehen nicht automatisch einen Wandel der Habitusformen nach sich. Bourdieu bezeichnet das Beharrungsvermögen des Habitus bzw. dessen relative Autonomie als „Hysteresiseffekt". Hieran knüpft sich die Frage, mit welchen Strategien die .Akteure eine habituelle Sicherheit aufrechterhalten, wenn die Strukturen, denen die Anwendungsbedingungen des Habitus korrespondieren, in Auflösung begriffen sind. Normalisierung und Nihilierung sind hier probate (kognitive) Mittel. ie Strukturen der Geschlechterordnung werden nicht alle zugleich brüchig, und nicht alle Männer sind in gleichem Maße davon betroffen. Eine Gleichzeitigkeit von Umbruch und Routine kennzeichnet die Lebenslage der meisten Männer. Ein Personalchef in einem großen Unternehmen beispielsweise erfährt in seinem beruflichen Alltag den Wandel der Geschlechterverhältnisse unmittelbar in Gestalt von Forderungen der Frauenbeauftragten des Betriebs, lebt aber in traditionellen familiären Verhältnissen, die auch von Handeln bzw. ihre Äußerungen zu „formulieren" bzw. zu „entindexikalisieren", d.h. sich und den anderen explizit zu machen, was ihr Handeln bedeutet. 120 seiner Ehefrau nicht problematisiert werden. Solche Ungleichzeitigkeiten werfen die Frage auf, welche Bereiche der alltäglichen Lebenswelt besonders sensibel sind für habituelle Verunsicherungen. Im Geschlechterdiskurs, wie er von den Medien vermittelt wird, spielt die These von einer Krise des Mannes oder einer Krise der Männlichkeit eine große Rolle. Ob die so verbreitet ist wie behauptet, mag man zu Recht be zweifeln. Allerdings läßt sich nicht übersehen, daß es Männer gibt, die ihre geschlechtliche Existenz als krisengeschüttelt begreifen. Wenn man sich den Erfahrungen, Selbstdeutungen und Sehnsüchten dieser Männer in einer analytischen Perspektive zuwendet, wie sie den Garfinkelschen Krisenexperimenten zugrundeliegt, dann läßt sich an den Bruchstellen der Geschlechterordnung viel über deren Funktionieren erfahren. Diesen Männern ist der geschlechtliche Habitus von einer Vorgabe zu einer Aufgabe geworden. Vor allem zeigt sich an den Reaktionen dieser habituell tief verunsicherten Männer, welche fundamentale Bedeutung den leibgebundenen Expressionen zukommt. Tendenziell schreibt sich eine habituelle Verunsicherung in den Körper ein. Die Mittel der körpergebundenen geschlechtlichen Selbstpräsentation werden nicht mehr oder nur unzureichend beherrscht. Der Körper versagt als fleischliches Gedächtnis. Dem Beobachter teilt sich dies als Stilbruch mit, als nicht authentische Selbstpräsentation. Umgekehrt tauchen in den Sehnsüchten verunsicherter Männer immer wieder Bilder einer ostentativ körperlichen Virilität auf, diese Männer sehnen sich nach einer am Körper eindeutig ablesbaren Männlichkeit. Einmal mehr macht sich die Dialektik von Determination und Emergenz geltend. 11. Empirie: Geschlecht und Männlichkeit in den iskursen der Männer pti®naüe ännlichkeite „Noch vor nicht allzulanger Zeit war die Frau der dunkle und unerschlossene Kontinent der Menschheit, und niemand wäre auf die Idee gekommen, den Mann in Frage zu stellen. Männlichkeit erschien als etwas Selbstverständliches: strahlend, naturgegeben und der Weiblichkeit entgegengesetzt. In den letzten drei Jahrzehnten sind diese jahrtausendealten Selbstverständlichkeiten in sich zusammengebrochen. Indem die Frauen sich neu definierten, zwangen sie die Männer, das gleiche zu tun." (Elisabeth Badinter: XY. Die Identität des Mannes, 1993, S. 1lf) „In den hochtechnisierten Nationen haben die Partnerschaftsbeziehungen in den vergangenen 30 Jahren erhebliche Verfallserscheinungen gezeigt. Archaische Strukturen, die sich seit Tausenden von Jahren bewährt hatten, wurden durch die Wandlung zur arbeitsteiligen Gesellschaft und den gewaltigen Informationstransfer gravierend verändert." (Joachim H. Bürger: Mann, bist Du gut! 1990, S. 7) „Was eine richtige Frau ist, kann ich sehr viel leichter beantworten, als was ein richtiger Mann ist, und das hängt genau mit diesen scheiß letzten 30 Jahren zusammen. Ich sehe für mich immer noch so viel Verunsicherung, was die Beantwortung dieser Frage angeht." (Mitglied einer Männergruppe, 1993) Die das Ideal der Androgynie lobende Philosophin, der medienerprobte Restaurateur einer gefährdeten Männerherrlichkeit, der `neue' Mann - sie sind sich einig in der Diagnose, daß im Verhältnis von Frauen und Männern in den vergangenen 30 Jahren fundamentale Veränderungen stattgefunden haben. Auch wenn heute - insbesondere in Hinblick auf die Reaktion von Männern, aber nicht nur von diesen - vor einem „backlash" gewarnt wird, in dessen Folge Verbesserungen der gesellschaftlichen Situation von Frauen zurückgeschraubt werden (vgl. Faludi 1993), verliert die Diagnose nicht an Gültigkeit. Auf einen „backlash" hinzuweisen impliziert, daß sich zuvor etwas geändert hat. Und es impliziert, daß bestimmte Akteure und gesellschaftliche Gruppierungen auf die veränderte Lage reagieren, mit welchem Ergebnis auch immer. Dieser Teil der Arbeit befaßt sich mit den Reaktionen derjenigen, gegen deren Willen das Geschlechterverhältnis zu einem sozial konflikthaften ge123 macht worden ist. Jedenfalls sind die Prozesse des sozialen Wandels des Geschlechterverhältnisses nicht auf ein intentionales politisches Handeln (der Mehrheit) der Männer zurückzuführen. Beck und Beck-Gensheim (1990) sprechen zutreffend von der „erlittenen Emanzipation" der Männer, so sie denn überhaupt stattfindet'z'. Das Erkenntnisinteresse richtet sich auf Folgendes: Wie reagieren Männer auf den erwähnten und in seinen lebensweltlichen Manifestationen noch näher zti beschreibenden Wandel des Geschlechterverhältnisses? Kommen Selbstverständlichkeiten abhanden? Werden sie Gegenstand eines Diskurses und somit reflexiv eingeholt? Welche (geschlechterpolitischen) Orientierungen werden entwickelt und wie werden sie handlungspraktisch realisiert? Den TheoretikerInnen einer reflexiven Modernisierung gilt der „Zerfallsprozeß stabiler sozialer Zusammenhänge" als eine ausgemachte Sache und die „Frauenemanzipation" als ein wichtiger Erosionsfaktor (Keupp 1994, S. 338). Fraglosigkeiten (ver-)schwinden, eine Vielfalt von Sinnlieferanten versucht die Leerstellen auszufüllen, die brüchig gewordene Traditionen und Ligaturen hinterlassen haben. Für manche kündigt sich eine „Multioptionsgesellschaft` (Gross 1994) an, in der der Mensch zum „homo optionis" wird, dem „Leben, Tod, Geschlecht, Körperlichkeit ..." (Beck/Beck-Gernsheim 1 994b, S. 16) wand vieles mehr zur Entscheidung aufgegeben sind. Diese Tendenzen der Enttraditionalisierung machen vor dem Geschlechterverhältnis nicht halt, und sie machen sich, folgt man der Diagnose von Beck und BeckGernsheim (1990), insbesondere in den privaten Beziehungen von Frau und Mann bemerkeoar. Mit der Freisetzung der Frauen aus quasi-ständischen Bindungen verflüchtigen sich traditionell verbürgte Sicherheiten. Das potenziert das Konfliktpotential zwischen den Geschlechtern und läßt Frau und Mann in einen Beziehungsdauerdiskurs eintreten. Die Gemeinsamkeiten des ehelichen bzw. partnerschaftlichen Zusammenlebens sind nicht mehr durch ökonomische und schon gar nicht durch ständische Zwänge vorgegeben, die Partner müssen sie in immer neuen Aushandlungen selbst konstituieren. Die Ehe verliert den Charakter des Selbstverständlichen, statt dessen wird der Begründungszwang institutionalisiert und auf Dauer gestellt. Die Akteure, die diese Prozesse gesellschaftlicher Modernisierung vorantreiben, gehören nicht dem Geschlecht an, das die Moderne auf den Weg gebracht hat. Die Männer sperren sich eher gegen diesen Modernisierungsschub, als daß sie sich zu In den (polemischen) Worten einer der Parteien im `Krieg der Geschlechter', aus der Sicht der sog. „Maskulinisten" (zu diesem Typus männlicher Orientierung s. Kap. 6.2) stellt sich das, was den Männern widerfährt, folgendermaßen dar. Gegen die feministische These vom „Krieg der Männer gegen die Frauen" wird argumentiert: „Nach üblichem Sprachgebrauch fängt - privat oder von Staats wegen - einen `Krieg' an, wer an einem realen Zustand gegen den willen des anderen etwas mit Gewalt verändern will. Es sind die Feministinnen, die Frauen, die am status quo etwas verändern wollen, nicht die Männer. Diese lassen den Frauenkrieg stillschweigend über sich ergehen" (Walz 1993, S. 8). 124 dessen Protagonisten machen. Es sind die Frauen, die das letzte Relikt aus vormoderner Zeit, „das geschlechtsständische Binnengefüge der Kleinfamilie" (Beck/Beck-Gensheim 1990, S. 8) in Frage stellen - und damit den Grundwiderspruch der Moderne, deren geschlechtliche Halbierung. Die TheoretikerInnen der sozialen Konstruktion von Geschlecht betrachten die Prozesse der Erosion geschlechtlicher Selbstverständlichkeiten aus einer anderen und radikaleren Perspektive. Eine umfassende Veränderung der Geschlechterverhältnisse im Sinne einer „Enthierarchisierung der Differenz" erscheint Gildemeister und Wetterer (1992, S. 248) nur möglich, wenn das binäre Grundmuster selbst in Frage gestellt wird, und sie werfen die Frage auf, „ob gegenwärtig Brüche und Widersprüche in der Codierung der Geschlechterverhältnisse zu beobachten sind, die sich als Ansatzpunkte einer ,realen Dekonstruktion' der Differenz interpretieren lassen" (ebd., S. 246, Fn. 32). Hirschauer sieht (1993, S. 351) Anzeichen einer realen Dekonstruktion. Er stellt zum Abschluß seiner Studie über Transsexualität fest, „daß ein großer Teil der Angehörigen der westlichen Kultur selbst zu Geschlechtsmigranten geworden ist`. Als Indikator nennt er die von den TheoretikerInnen der reflexiven Modernisierung betonten Tendenzen zu Emanzipation, Individualisierung, Nivellierung der Geschlechtsrollen. Wie jene sieht er freilich auch eine „`Rückseite' aus verschwundenen Orientierungen und verlorenen Sicherheiten, aus zögernden Suchbewegungen nach neuen oder ängstlicher Rückkehr zu alten Lebensstilen und aus hastigen Reaffirmationen ` der' Differenz" (ebd.). Diese andere Seite der Moderne beleuchtet Ulrich Beck (1993, S. 99ff.) unter dem Stichwort „Gegenmoderne". Sie wird von der reflexiven Modernisierung selbst provoziert. Das Schwinden von Fraglosigkeiten läßt Sehn süchte nach neuen oder alten Sicherheiten entstehen. „Wieviel Auflösung verträgt der Mensch?" - In dieser Frage drückt sich nach Beck (1993, S. 143) ein zentrales Dilemma reflexiver Modernisierung aus. Das Geschlechterverhäitnis, insbesondere die Reaktionen der Männer auf die Veränderungen, die dieses Verhältnis in den letzten 20 bis 30 Jahren erfahren hat, sind ein 'Anschauungsobjekt' par excellence, an dem sich die Ungleichzeitigkeiten von Modernisierungsprozessen und Widerstände gegen eine Auflösung von Sicherheiten deutlich beobachten lassen. Wenn man den Blick auf den öffentlichen Diskurs über den Mann richtet, dann erscheint die These von der Multioptionsgesellschaft auch für das Geschlechterverhältnis als plausibel. Diverse Sinnlieferanten, von den Kirchen über Therapeuten bis hin zu selbst ernannten Gurus, offerieren eine bunte Vielfalt von Deutungen und Männlichkeitsentwürfen. In der Angebotspalette ist vorn unbeirrten Macho über den mittlerweile als Auslaufmodell gehandelten Softie bis zum neuen `wilden' Mann einiges zu finden. In den Buchhandlungen kann der nach Orientierung suchende Mann oder die Frau, die ihrem Partner auf die Sprünge helfen will, die Sinnofferten käuflich erwerben. 125 Schaut man sich die Optionen im einzelnen an, so entdeckt man Anregungen zu einer auf Dauer gestellten reflexiven Identitätsarbeit in gleicher Weise wie eindeutige Aufforderungen, die alte `Männerherrlichkeit' wieder herzustellen und den Frauen zu zeigen, `was Sache ist'. Das folgende Kapitel (6) wird der Diskursivierung des Mannseins in ihren Konsequenzen für die Habitualisierung von Männlichkeit nachgehen, und es wird dazu die Diskurse, in denen das geschieht, in Hinblick auf Deu tungsmuster und geschlechterpolitische Orientierungen analysieren"'. In der einschlägigen Literatur lassen sich drei Teildiskurse unterscheiden: ein Defizitdiskurs, ein Maskulinismusdiskurs und ein Differenzdiskurs. Der Defizitdiskurs, der den Beginn des Schreibens über Männlichkeit markiert und bis heute fortgeführt wird, macht die Geschlechtszugehörigkeit des Mannes zum Problem und zum Gegenstand einer reflexiven Therapeutisierung. Die beiden anderen Diskurse sind Reaktionen auf den ersten und treten mit dem Versprechen auf, die mit der Reflexivierung verbundenen Unsicherheiten aufzulösen; der Maskulinismusdiskurs durch eine Rückkehr zu alter `Männerherrlichkeit', der Differenzdiskurs durch eine Wiedergewinnung einer ursprünglichen `Männerenergie'. In beiden ist die reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität tendenziell stillgelegt. Hat man sich allerdings einmal auf den Diskurs eingelassen, ist eine Rückkehr zu einem Zustand ` vorreflexiver Unschuld' nicht mehr oder zumindest nicht unmittelbar möglich. Das zeigt sich, wenn man den Blick von dem medial vermittelten Diskurs löst und sich lebensweltlich verankerten kollektiven Orientierungen zuwendet. Dies wird im übernächsten Kapitel (7) geschehen. Einschlägige Daten sind in Gruppendiskussionen mit real existierenden Gruppen von Männern unterschiedlicher Art gewonnen worden. Der Blick auf diese Empirie bewahrt zum einen davor, die Bedeutung des medialen Diskurses in quantitativer Hinsicht zu überschätzen, also was seine Rezeptionsbreite betrifft. Einem großen Teil der Männer, möglicherweise der Majorität ist die eigene Geschlechtlichkeit nach wie vor etwas fraglos Gegebenes. Zwar werden Veränderungen im Verhältnis von Männern und Frauen nicht ignoriert, doch resultieren daraus keine fundamentalen Irritationen. Kognitive Normalisierungsstrategien und die homosoziale Atmosphäre männerbündischer Zusammenschlüsse leisten hier Entscheidendes zur Bewahrung tradierter Sinnwelten. Darin liegt eine zentrale Funktion von Stammtischen, Fußballmannschaften, Männerwohngemeinschaften und Herrenclubs. Eine habituelle Sicherheit kennzeichnet die geschlechtliche Lebenslage dieser Männer. 122 Die beiden nachfolgenden Kapitel (6 und 7) basieren auf Daten, die in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsprojekt mit dem Titel „Die Symbolik der Geschlechtszugehörigkeit. Kollektive Orientierungen vor, Männern im Wandel des Geschlechterverhältnisses" gewonnen wurden. 126 Zum anderen zeigen die Gruppendiskussionen, daß innerhalb der Szene männerbewegter Männer und an deren Rändern der mediale Männlichkeitsdiskurs starke lebensweltliche Entsprechungen und Verankerungen hat. Die jenigen, die ihr Mannsein in den von dem Defizitdiskurs vorgegebenen Deutungsmustern begreifen, haben nahezu jede habituelle Sicherheit verloren, wenn es um den eigenen Geschlechtsstatus geht. Sie sind gewissermaßen ` heimatlos' im eigenen Geschlecht geworden. Da dies in einer Kultur, in der Geschlecht ein ` major status' ist, nur schwer über längere Zeit auszuhalten ist, verwundert es nicht, daß die Sicherheitsverheißungen des Differenzdiskurses in jüngster Zeit in der Männergruppenszene einen wahren Boom der Aufmerksamkeit erfahren. Beide Analysen - die des medial vermittelten Diskurses und die der lebensweltlich verankerten Orientierungen - ergeben ein Bild einer in sich brüchigen Modernisierung der Männlichkeit. In der These von der Krise des Mannes findet dies seinen popularisierten Ausdruck. Im Schlußkapitel wird diskutiert werden, ob diese These auch dann Bestand hat, wenn man einen soziologischen Krisenbegriff zugrundelegt. Die Erörterung dieser Fragen kann nur wenige empirische Untersuchungen zum Vergleich heranziehen. Wie oben (Kap. 3.2) erwähnt, bewegt sich die empirische Männerforschung in Deutschland weitgehend auf unvermes senem Neuland. Die bereits zahlreicheren Untersuchungen aus den USA und aus Großbritannien lassen sich nicht umstandslos als Vergleichshorizont heranziehen. Zwar dürfte es unstrittig sein, daß die Prinzipien und Mechanismen der geschlechtlichen Differenzierung in westlichen Industriegesellschaften gewisse grundlegende Gemeinsamkeiten aufweisen. Dennoch enthebt dies nicht der Notwendigkeit einer eigenständigen Forschung, in der kulturelle Besonderheiten zu Tage gefördert werden, welche die Konstruktion von Geschlecht hierzulande von derjenigen in den USA unterscheiden. Gerade auf der Ebene der Inhalte kultureller geschlechtlicher Leitbilder sind - nicht zuletzt in Folge verschiedener historischer Bedingungen - nicht unerhebliche Differenzen zu erwarten. Als Beispiel sei auf die unterschiedliche Bedeutung hingewiesen, die sportlicher Aktivität bei der Konstruktion von Männlichkeit zukommt. In den USA in einer bestimmten Altersphase und in bestimmten institutionellen Kontexten (College, Universität) von hoher Relevanz (vgl. Messner 1957; Whitson 1990), spielt sie hierzulande eine geringere Rolle. Gerade wenn man die soziokulturelle Variabilität der Konstruktion von Geschlechtszugehörigkeit in Rechnung stellt, kann man solche kulturellen Unterschieden nicht außer acht lassen. Die empirischen Forschungen, die den Ausführungen der folgenden Kapitel zugrundeliegen, sind in der Perspektive der Wissenssoziologie durchgeführt worden. Kapitel sechs basiert auf einer Deutungsmusteranalyse kultu reller Leitbilder, wie sie in der Männerverständigungsliteratur offeriert werden. In Kapitel sieben werden alltägliche Diskurse von Männern in Hinblick 127 auf die darin enthaltenen Deutungs- und Orientierungsmuster rekonstruiert. Die Einzelheiten der methodischen Verfahren werden zu Beginn der jeweiligen Kapitel erläutert. In beiden Analysen geht es um die Rekonstruktion kollektiver Sinngehalte, zunächst auf der Ebene der Kulturproduktion, dann auf der alltäglicher Lebenswelten. Ein Text der Männerverständigungsliteratur wird ebenso wie ein Beitrag in einer Gruppendiskussion als Dokument für eine symbolische Sinnwelt verstanden, die sich in dem Dokument ausdrückt, aber über dieses hinausweist. Das Konzept des Deutungsmusters wird hier in einem wissenssoziologischen Sinne verwendet"'. Mit dem Begriff des Deutungsmusters sind typisierende Problemlösungen mit intersubjektiver Relevanz bezeichnet. Wie Typisierungen stehen sie in einem Verweisungszusammenhang auf gesellschaftlich gültige Normen und Regeln. Sie sind problembezogen in dem Sinne, daß sie in einem funktionalen Bezug zu objektiven Handlungsproblemen stehen. Sie verweisen auf Problemkonstellationen, die -je nach Fokus für eine soziale Gruppe, eine soziale Organisation oder für die Gesellschaft insgesamt von zentraler Bedeutung sind. Deutungsmuster haben den Status „relativer Autonomie". Trotz des funktionalen Bezugs auf objektive Handlungsprobleme sind sie hinsichtlich der Konstruktionsprinzipien und Gültigkeitskriterien autonom und konstituieren so eine eigene Dimension sozialer Wirklichkeit. Das erklärt die beträchtliche Stabilität von Deutungsmustern, die allerdings prinzipiell als entwicklungsoffen konzipiert sind. In den männlichen Selbstdeutungen läßt sich beides, Konstanz und Wandel, beobachten. Deren Ausprägungen sollen in den beiden folgenden Kapiteln nicht nur beschrieben werden, es wird auch gefragt werden, unter wel chen lebensweltlichen Bedingungen das eine oder das andere typischerweise ,gedeiht'. 1 23 Neben dem wissenssoziologischen Ansatz der Deutungsmusteranalyse gibt es einen strukturtheoretischen, der von Ulrich Oevermann entwickelt worden und eng mit dem Verfahren der objektiven Hermeneutik verbunden ist. Zur Entstehung des Deutungsmusteransatzes, seinen Varianten und den methodischen Verfahren der Deutungsmusternalyse vgl. Lüders/Meuser 1996 und Meuser/Sackmann 1992b. 128 m Von Mann z Mann. Rekonstruktionen und Rekonstruktionen von Männlichkeit in der Männerverständigungsliteraturr 24 Es ist unübersehbar, daß der Mann Gegenstand eines öffentlichen Diskurses geworden ist. Kaum eine Bildungsinstitution, die nicht Foren und Gesprächskreise über die Rolle des Mannes, den Wandel der Männlichkeit, über Wege zur männlichen Identität u.v.m anbietet. Die Beiträge über die gesellschaftliche Situation des Mannes und über immer neue Formen von Männerbewegungen (immer noch aktuell sind die sog. `wilden Männer') in Radio, TV und Printmedien sind kaum noch zu überblicken. Die Kirchen haben die Probleme, die (manche) Männer mit ihrer Männlichkeit haben, als Gegenstand seelsorgerischer Arbeit entdeckt. Selbst bis in das Zentrum institutionalisierter Politik, zumindest bis in den Vorhof der Macht - in Gestalt der Parteien SPD und Grüne - hat es die Männerthematik gebracht, eine erstaunliche Karriere in kurzer Zeit. „Männlichkeit" hat Konjunktur 125 , und wie auch immer die Diagnosen lauten - ob der Mann in einer Krise ist oder nur verunsichert, vielleicht auch von den Frauen unterdrückt - sicher ist: Der Mann ist ins Gerede gekommen. Ich lasse zunächst außer Betracht, was die verschiedenen `Geschichten' über die Situation des Mannes erzählen, und betrachte das Phänomen der Diskursivierung als solches. Eine `elaborierte' Form finden wir in dem Genre der Männerverständigungsliteratur, das sich in den letzten 15 bis 20 Jahren recht erfolgreich auf dem Buchmarkt zu etablieren vermocht hat. Die Titel gehen in die Hunderte ' 26 und führen bisweilen die Bestsellerliste der Rubrik „Sachbücher" an. Der Terminus `Verständigungsliteratur' meint Texte, in denen Männer über sich und für sich sprechen, als Betroffene zu Betroffenen. In Verständigungstexten"' schreibt potentiell `jedermann', wenngleich auch 124 Dieses Kapitel ist eine überarbeitete und erweiterte Version von zwei zuvor publizierten Aufsätzen (Meuser 1995a und 1995b). 125 Die hier notierten Beobachtungen beziehen sich auf Diskurse über Männlichkeit, auf verschiedene Weisen einer reflexiven Vergewisserung von bislang fraglos Gegebenem. Parallel dazu läßt sich eine andere Form der medialen Inszenierung von Männlichkeit konstatieren. Eine Sendung wie „Mann-oh-Mann" (SAT 1) präsentiert den Mann als Objekt weiblicher Begierde, und in der Werbung häufen sich Anzeigen, die auf die erotische Ausstrahlung des männlichen Körpers setzen. Wie beides, Diskursivierung des Mannseins und öffentliche Inszenierung des männlichen Körpers, zusammenhängt, ob hier mehr als nur zeitliche Parallelitäten zu entdecken sind, ist eine kultursoziologisch interessante Frage, auf die hier nur hingewiesen werden kann. 1 26 1993 offerierte der Buchhandel knapp 200 einschlägige Bücher (vgl. Köhler 1993, S. 67). 1 27 Der Terminus „Verständigungstexte" bezeichnet eine in den siebziger Jahren entstandene Literaturform, die, emanzipatorisch orientiert, weniger auf professionelle literarische Kompetenz der Autoren und Autorinnen als auf eine aus Betroffenheit resultierende Authentizi- 129 hier Experten den Markt dominieren. In jüngster Zeit werden die allgegenwärtigen Psycho-Experten von Experten für Mythisches und Spirituelles abgelöst. Einige Beispiele besonders auflagenstarker Bücher: „Männer lassen lieben" von Wilfried Wieck (1990), „Mann, bist Du gut!" von Joachim Bürger (1990), „Feuer im Bauch" von Sam Keen (1992) und „Eisenhans" von Robert Bly (1991). Diese Literatur bietet Orientierungshilfen an, symbolische Ressourcen, die in einer Epoche der Individualisierung, in der die Menschen unter den Zwang des Entscheidens gestellt sind, offenkundig breit nachgefragt werden. Geschlechtersoziologisch interessant ist daran, daß es nunmehr - eine vergleichbare Frauenliteratur existiert bekanntlich schon länger - Männer sind, deren Geschlechtlichkeit Gegenstand einer öffentlichen Kommunikation geworden ist. Meine These ist, daß diese Diskursivierung als solche, d.h. unabhängig von den Inhalten der jeweiligen Teildiskurse, am Bestand des fraglos Gegebenen rüttelt, eben indem ein explizites bzw. diskursiv verfügbares Wissen von Männlichkeit erzeugt wird. Männer haben schon immer gewußt, was ein ` ganzer Kerl' ist, wer dazugehört und wer nicht, woran man seinesgleichen erkennt, ob jemand ein Mann ist oder eine `Memme'. Nur, wenn man Männer auffordert zu beschreiben, was Männlichkeit ist, stellt man sie vor große Schwierigkeiten. Sie können das, was sie darüber wissen, in der Regel nicht benennen. Die Form dieses Wissens läßt sich in Anschluß an Anthony Giddens (1988, S. 55ff.) als praktisches Bewußtsein begreifen. Es ist ein implizites, diskursiv nur begrenzt verfügbares Wissen, zentriert um ein normatives Modell und auf eine entsprechende moralische Ordnung verweisend. In dem Konzept der hegemonialen Maskulinität ist dies auf den Begriff gebracht (s. Kap. 3.2). Die traditionell verbürgte Männlichkeit ist eine fraglos gegebene. Männliches ` Geschlechtsbewußtsein' äußert sich gewissermaßen en passant. Männlichkeitsrituale sind eine Ausdrucksform auf symbolisch-expressiver Ebene. Werden sie exzessiv praktiziert, `springt' die geschlechtliche Konnotation gleichsam `ins Auge'. Beim `Kampftrinken' bis zum Umfallen zeigt man sich gegenseitig an, daß man ein `ganzer Mann' ist - sofern man nicht vorzeitig aufgibt. Prügelorgien von Hooligans dienen nicht nur der Aggressionsabfuhr, sondern auch der Selbstvergewisserung und der Darstellung der eigenen Männlichkeit (vgl. Becker 1990; Matthesius 1992, S. 191ff.). Die unter Hooligans verstärkt zu beobachtende Tendenz, auch ohne einen besonderen, sichtbaren Anlaß (z.B. in Reaktion auf die Verletzung territorialer Rechte) körperlich gewaltsam zu agieren, verdeutlicht dies (vgl. Matthesius tät setzte. Der Suhrkamp-Verlag hat eine so bezeichnete Reihe herausgegeben, in der neben Verständigungstexten von z.B. Schülern und Lehrern, von Frauen und Männern mit Kindern, von Gefangenen, von Frauen auch ein Band mit dem Titel „Männersachen" (MüllerSchwefe 1979) erschienen ist. 130 1992, S. 191). Die alltägliche Normalität des fraglos gegebenen männlichen ` Geschlechtsbewußtseins' ist freilich weniger leicht zu entschlüsseln; in Kapitel 7 soll dies zumindest ansatzweise versucht werden. Zunächst aber geht es um die auf der Ebene der Kulturproduktion angesiedelten Bemühungen, das Selbstverständliche diskursiv anzueignen, Bemühungen, die zwar nicht den Alltag des sprichwörtlichen Mannes auf der Stra ße ausmachen, die aber in ihrer kulturellen Bedeutsamkeit, männliches Geschlechtshandeln in der und aus der maskulinen Binnenperspektive zu fokussieren, näher zu betrachten sind. In modernisierungstheoretischer Perspektive ist die Diskursivierung von Männlichkeit als ein Reflexivwerden von Selbstverständlichkeiten zu begreifen. Fraglosigkeiten kommen zumindest tendenziell abhanden. Traditionelle Ordnungsgewißheiten werden ausgehöhlt. Der wissenssoziologischen Modernisierungstheorie gilt als entscheidendes Merkmal der Moderne, daß der „Zustand des unreflektierten ` Zuhauseseins' in der sozialen Welt" (Bergen/Bergen/Kellner 1987, S. 71) verlassen wird. Insofern steht hier auch eine Modernisierung von Männlichkeit zur Debatte. Inwieweit mit all dem eine `Krise des Mannes' einhergeht oder ob die Männerrolle zum Risikofaktor wird, wie vielfach behauptet, wird im abschließenden Kapitel diskutiert werden. An dieser Stelle sei hervorgehoben, daß die Verunsicherung weiter reicht, als dies gemeinhin gesehen wird. Wenn von einem Männlichkeitsdiskurs gesprochen wird, dann richtet sich der Blick auf die sog. `neuen Männer', neuerdings auch auf die `wilden Männer' und auf die Männerbewegung 1 21. Solche das traditionelle Männerbild kritisch beleuchtende Formen männlicher Selbstthematisierung sind ohne Zweifel wichtige Indikatoren. Bedeutsamer - gerade unter modernisiernangstheoretischen Aspekten - scheint mir aber zu sein, daß auch andere Männer beginnen, öffentlich über den Mann zu reden. Wenn Männer, die an traditionellen Mustern von Männlichkeit festhalten bzw. die diese revitalisieren wollen, Bücher schreiben und die Medienöffentlichkeit suchen, um ihre Thesen `unters Volk zu bringen', dann zeigt dies, daß die Basis traditioneller Männlichkeit brüchig zu werden beginnt bzw. daß es keine allgemeingültige Definition von Mannsein mehr gibt. Offensichtlich können Autoren wie Joachim Bürger, der nicht müde wird zu verkünden: „Mann bist du gut", oder 128 Die in der geschlechterpolitischen Auseinandersetzung heftig umstrittene Frage, ob es eine Männerbewegung, analog zur Frauenbewegung oder wie auch immer orientiert, überhaupt gibt, kann im Rahmen der hier verfolgten Forschungsinteressen unbeantwortet bleiben. Die einschlägigen Diskussionen darüber, ob Angehörige des privilegierten Geschlechts in der Lage sind, eine soziale Bewegung zu formieren, deren Programm der Entzug der eigenen Privilegien ist, sollen hier nicht repliziert werden. Als Datum ist vielmehr zu registrieren, daß ein entsprechendes Selbstverständnis weit verbreitet ist. Das berühmte Diktum von William 1. Thomas zugrundelegend, demzufolge etwas real ist, wenn Menschen es als real definieren, muß man also von der Existenz einer Männerbewegung ausgehen, vielleicht nicht in gesamtgesellschaftlicher Perspektive, wohl aber hinsichtlich bestimmter Subsinnwelten. Felix Stern mit seinem Hilferuf „Und wer befreit die Männer", offensichtlich können solche deutlich nicht männerbewegten Männer nicht mehr umhin, sich in ihrer Geschlechtlichkeit zu definieren und ihre Position Frauen gegenüber zu legitimieren. Die kulturelle Bedeutsamkeit solcher Entwicklungen erschließt sich, wenn man sie der von Georg Simmel analysierten Konstitution des Männlichen als eines Allgemein-Menschlichen, mithin der kulturellen ` Entgeschlechtlichung' des Mannes kontrastiert (s. Kap. 1.2). Wenn Männer, die in der von Simmel beschriebenen Welt das Ideal einer männlichen Existenz sehen, die traditionelle Männerherrlichkeit explizit beschwören und in einen Diskurs darüber eintreten, was Mannsein bedeutet, dann ist dies in soziologischer Perspektive ein gravierenderer Indikator für einen Wandel männlicher Existenzweisen, als es die kritischen Thesen veränderungswilliger Männer sind. Daß die verschiedenen Diskurse unterschiedliche Lösungen propagieren, daß sie z.T. diametral entgegengesetzte geschlechterpolitische Perspektiven verfolgen, ist ein relevantes Datum, wenn man die einzelnen Diskurse analysiert. Und es ist natürlich vor allem dann ein relevantes Datum, wenn man sich mit den Bedingungen des Mannseins in politischer Absicht auseinandersetzt, also Perspektiven der Veränderung formulieren will. In gegenwartsdiagnostischer Perspektive ist aber bereits die Diskursivierung von Männlichkeit als solche ein soziologisch bedeutsames Phänomen. Unabhängig vom jeweiligen Inhalt ist diskursive Verständigung der Tod des fraglos Gültigen. Sie befördert eine Erosion von Selbstverständlichkeiten gewissermaßen von innen, auch wenn sie eine Reaktion auf die Herausforderungen des Feminismus ist. Die folgende Darstellung der Teildiskurse konzentriert sich auf einige in zweifacher Hinsicht besonders exponierte Bücher der Männerverständigungsliteratur. Es handelt sich um Titel, die erstens sehr hohe Auflagen er reicht haben (bis zu 250000)' 29 und die zweitens von anderen Autoren sowie in der Medienöffentlichkeit zitiert, diskutiert, kritisiert, also in der einen oder der anderen Form beachtet werden. Die Auswahl umfaßt mithin die den Diskurs dominierenden und prägenden Bücher. Zugleich ist auf diese Weise das Spektrum der Deutungsmuster und geschlechterpolitischen Orientierungen, die den Männlichkeitsdiskurs bestimmen, repräsentiert. Dieser Einschätzung liegt eine inhaltsanalytische Auswertung von insgesamt 50 Büchern zugrunde, die in dem eingangs erwähnten Forschungsprojekt durchgeführt wurde'». 1 29 Die Auflagenhöhe konnte durch Anfragen bei den Verlagen ermittelt werden. Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 1994. Inzwischen haben einige Titel, insbesondere die Bestsell er, höhere Auflagen erreicht. 130 Die Stichprobenbildung erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurden all die Titel ausgewählt, deren Auflagenhöhe über 15000 Exemplaren liegt. Damit ist sichergestellt, daß die den Diskurs dominierenden Bücher, 21 an der Zahl, ohne Ausnahme im sample vertreten sind. In einem zweiten Schritt wurden die restlichen 29 Bücher nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Sie haben eine Auflagenhöhe zwischen 5000 und 10000 Exemplaren. Die mei- 132 Deutungsmusteranalysen kultureller Diskurse, die große Textmengen produzieren, sind vor das Problem gestellt,..eine immense Fülle an Material zu bewältigen (vgl. Lüders/Meuser 1996). Offentliche Diskurse, so auch die Männerverständigungsliteratur, zeichnen sich durch ein hohes Maß an Redundanz aus. Nicht nur variieren verschiedene Autoren ein bestimmtes Thema in durchaus nicht immer origineller Weise, auch bei dem einzelnen Text rechtfertigt der Gehalt in den seltensten Fällen den Umfang. Ein Verfahren, das sich als methodisch kontrolliert bewährt hat, besteht darin, zunächst die Einleitung eines jeden Buches zum Gegenstand einer gründlichen hermeneutischen Interpretation zu machen. Nicht nur bei wissenschaftlichen Texten fungiert die Einleitung als „Ort der Relevanz-Inszenierung" (Knorr-Cetina 1984, S. 207). Gerade bei populären Texten dient die Einleitung dazu, das Interesse einer potentiellen Leserschaft zu wecken; in ihr wird gezeigt, was mit dem Text vermittelt werden soll. Es hat sich herausgestellt, daß sämtliche Einleitungen einem bestimmten formalen Muster der Relevanzinszenierung folgen. Dieses besteht aus den folgenden Elementen: 1. Benennung des für den Text zentralen Themas (z.B. Liebesunfähigkeit des Mannes, Unterdrükkung des Mannes durch die Frau); z. Bezugnahme auf einen Diskurs, in dessen Horizont das Thema abgehandelt wird (Feminismus, Männerbewegung); 3. Benenung eines in diesem Diskurs bislang vernachlässigten Aspektes (die psychischen Leiden des Mannes, die spirituelle Energie des Mannes); 4. Formulierung einer Perspektive (Kampf dem Feminismus, Gründung einer Männergruppe); 5. Demonstration der Kompetenz des Autors, dem Diskurs etwas Relevantes hinzufügen zu können (Erfahrung in der Männerarbeit, Mut zur Provokation); 6. Benennung des Adressatenkreises, an den sich das Buch wendet (nur Männer oder Männer und Frauen). Zentrale Deutungsmuster sowie die darin erkennbaren geschlechterpolitischen Orientierungen lassen sich durch eine Interpretation der Einleitung rekonstruieren. Das Ergebnis einer sequentiell verfahrenden Analyse ist jeweils als eine Strukturhypothese zu verstehen, die dann auf ihre Stimmigkeit am Gesamttext zu überprüfen ist. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk möglichen Gegenevidenzen (Falsifikationskriterium). Ein weiterer Nutzen dieses zweiten Interpretationsschrittes ist, daß die Deutungsmuster eine empirische Verdichtung oder Anreicherung erfahren. So läßt sich beispielsweise bei dem Deutungsmuster des Mannes als Defizitwesen herausarbeiten, in welchen alltäglichen Handlungsfeldern sich die defizitäre Lage in welcher Weise manifestiert: von intimen Beziehungen zu Frauen (in Gestalt männlicher Liebesunfähigkeit) über die Berufstätigkeit (Kooperationsunfähigkeit) bis zum Umgang mit dem eigenen Körper (starke gesundheitliche Gefährdungen). sten der 50 Bücher befassen sich allgemein mit dem Thema Männlichkeit, einige setzen Schwerpunkte, z.B. der Mann als Hausmann oder - in jüngster Zeit vermehrt - der Mann als Vater (vgl. hierzu Meuser 1998). Ich beziehe mich hier nur auf die allgemeinen Texte. 133