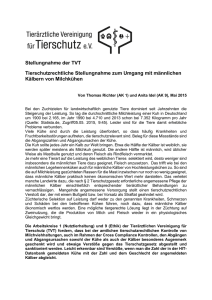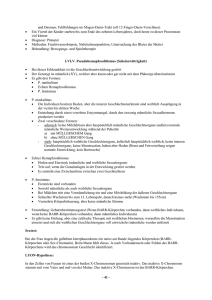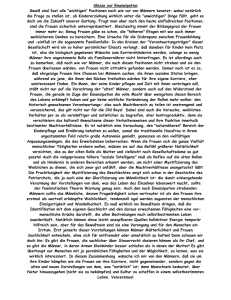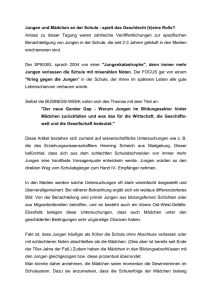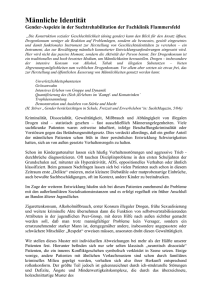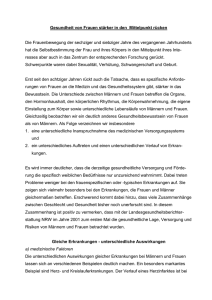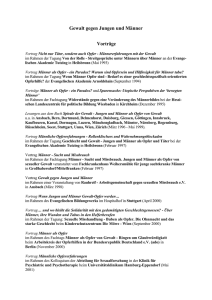Vortrag zur fdr-Tagung Männerspezifische Suchttherapie, 9
Werbung

Rainer Koch-Möhr - Klinikleiter [email protected] Fachklinik Flammersfeld Bergstr.2-4 57632 Flammersfeld 02685 – 953014 Vortrag zur Fachtagung „Männerspezifische Suchttherapie in der Fachklinik Flammersfeld“ am 22.9.2005 Männerspezifische Suchttherapie in der Fachklinik Flammersfeld Liebe Kolleginnen und Kollegen ! Mein Name ist Rainer Koch-Möhr, ich bin Psychologe und seit 2 Jahren Leiter der Fachklinik Flammersfeld. Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen und Ihr Interesse bedanken. Bei vielen Rückmeldungen auf unsere Einladung haben wir gehört, wie schwer es für viele Kollegen und Kolleginnen in Beratungstellen, Entgiftungen und anderswo heutzutage ist, unter dem großen finanziellen Druck, dem Zeitdruck und Personalmangel noch an einer Tagung teilzunehmen. Umso mehr können wir Ihre Teilnahme wertschätzen und freuen uns auf eine fröhliche Begegnung und lebendige Diskussion mit ihnen, natürlich auch, Ihnen zeigen zu können, was wir mit viel Engagement und Mitarbeit vieler Patienten aus der damals infolge Leerstand verwahrlosten Klinik gemacht haben. Kurz etwas zur Vorgeschichte unseres Themas heute: Ich persönlich war früher tätig als Streetworker für rechtsradikaleHeranwachsende, Psychotherapeut in der Heimerziehung dissozialer männlicher Jugendlicher, Erziehungsberater vor allem für Jungen und deren Eltern, Psychologe in diversen Suchteinrichtungen (Kurzzeittherape, Übergangsheim) Forensischer Psychologe (§ 64). Meine berufliche Erfahrung machte mich quasi zum Experten für misslungene Formen männlicher Sozialisation geworden. Als ich die Klinikleitung hier übernahm, in einer Zeit großer klinikinterner Veränderungen, wurde sehr bald deutlich, daß hier viel Erfahrung und viel Kompetenz im Umgang mit männlichen Patienten existierte oder schlummerte, weibliche Patientinnen in der Vorgängerklinik „Wiesengrund“ eher Ausnahmen und zahlenmäßig sehr gering waren. Da war es naheliegend, diese Kompetenz wertschöpfend hervorzuheben und zu konzeptualisieren, in der Form einer „Männerklinik mit männerspezifischer Suchttherapie“. Die „gender mainstreaming“ –Diskussion im gesellschaftlichen Umfeld sorgt zudem für Offenheit und Aufmerksamkeit bezüglich der Geschlechtsspezifität von Handeln und Strukturen, auch im Bereich der Rehabilitation. 1 Wir wollten aber nicht nur auf einen modischen Zug aufspringen oder eine reine MarketingStrategie ausführen, sondern vor allem unsere Erfahrungen und Können als Fachkräfte in der Suchttherapie von Männern konzeptuell umsetzen und begannen uns zu fragen, was in unserem Tun denn männerbezogen spezifisch ist und was nicht. Dieser Prozess dauert an, und wir präsentieren Ihnen heute quasi ein Zwischenergebnis. Dahinter steht nicht nur bei mir persönlich auch, daß ich gerne in einer Männereinrichtung arbeite. Diese Ausschliesslichkeit halte auch für fachlich geboten und möchte dies Ihnen u.a. gerne begründen. Geschlechtsunterschiede in der frühen Sozialisation Die Erkenntnisse der Statistik darüber, dass es große Unterschiede in den Suchterkrankungen und Suchtverläufen von Männern und Frauen gibt, brauche ich Ihnen sicher nicht zu wiederholen. Die Erfahrung der Praxis bestätigt diese Befunde fortwährend. Unstrittig ist gewiss auch, dass neben Genetik und Pharmakologie die familiären und gesellschaftlichen Umstände eine große Bedeutung im Krankheitsgeschehen haben. Ich möchte allerdings auf 2 Besonderheiten in diesem Zusammenhang hinweisen, welche für die Polytoxikomanie bei Männern gestaltend sind: 1. Die Anwesenheit von erwachsenen Männern innerhalb der primären und sekundären Sozialisationsinstanzen (Familie, Vorschulerziehung, Grundschule und nachfolgende Schulen) verringert sich zunehmend. Ein männliches Kind kann unter Umständen mehr als 10 Jahre warten, bis der erste erwachsene Mann von sozialisierender Bedeutung in sein Leben tritt, wenn überhaupt. 2. In der überwiegenden Mehrzahl lassen sich bei unseren polytoxikomanen männlichen Patienten schon frühe Störungen der Einhaltung sozialer Normen feststellen, die sich später in Begleitdiagnosen der „Dissozialität“ oder „Antisozialen Persönlichkeit“ wieder finden, bzw. im Ausmaß ausgeübter Kriminalität und Strafhaft. Grundstörung Wenn wir an dieser Stelle über polytoxikomane Patienten sprechen, dann sprechen wir über Männer, die – gelinde gesagt – ein sehr schlechtes vorbereitendes und begleitendes Training für das Leben hatten. Sei es, dass sie unerwünscht geboren wurden, überforderte Eltern hatten, früh missverstanden, misshandelt oder missbraucht wurden, körperlich oder seelisch. Viele haben multiple Traumata verarbeiten müssen, haben mehrfach Trennungen von wichtigen Bezugspersonen erlebt oder sind selbst in Familien aufgewachsen, in denen Sucht, Gewalt und psychische Krankheit schon lange zuhause waren. Sie haben oft ein Übermass an Verwahrlosung erfahren oder auch grenzenlose Verwöhnung, z.T. im Wechsel mit extremen Versagungen. Sicherheit und Geborgenheit bei Erwachsenen haben die meisten nur sehr begrenzt erfahren. Nach dieser Art von Lebenstraining ist entsprechend die Ausstattung an den Ich-Funktionen, die wir Menschen für das befriedigende Hineinwachsen in die umgebende Gesellschaft benötigen, defizitär. Beeinträchtigt sind beispielsweise diverse Ich-Funktionen wie 2 Affekttoleranz, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Realitätsprüfung, Verdrängung, Räumliche und zeitliche Orientierung, Verknüpfung von Mitteln und Zweck, Angst und Spannungskontrolle, Resistenz gegen Versuchungen, Toleranz gegenüber Schuldgefühlen, Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, (Größenfantasien versus Minderwertigkeitsängste), usw. Natürlich erwerben sich die meisten Patienten innerhalb ihrer Sozialisationsumgebungen auch besondere Fähigkeiten und Kompetenzen, die ihnen ein Weiterleben ermöglichen, wie etwa Schmerzresistenz, Abspaltungsfähigkeit, Projektion, Muskelkraft, kriminelle Kompetenzen, dissozialer Charme oder schizoide Einfühlungsfähigkeiten. Die Fähigkeiten und Defizite bilden oftmals in Kombination mit angeborenem Temperament und anderen genetischen Merkmalen relativ früh schon Charakterbilder, Persönlichkeitsstrukturen als überdauernde Muster des Wahrnehmens, Fühlens, Denkens, Handelns, die später dann als komorbide Persönlichkeitsstörungen, schwere Neurosen oder umfassende Verhaltensstörungen begleitend zur Suchterkrankung diagnostiziert werden. Man gebraucht dafür den Begriff „Grundstörung“. Wir gehen somit von unterschiedlich geformten, individuellen Grundstörungen der persönlichen Entwicklung des Einzelnen aus, die in der Regel schon vor der Pubertät von Krankheitswert sind. Fast alle der in unserer Klinik befindlichen Patienten hätten als Kinder mühelos eine kinderpsychotherapeutische Krankenbehandlung erhalten, wenn denn eine solche beantragt worden wäre. Überformung durch Suchterkrankung Diese Grundstörungen wiederum werden überformt und verändert durch die Suchterkrankung mit all ihren Auswirkungen auf Körper, Seele, Geist, soziale Umwelt. Auch hier gibt es höchst unterschiedliche Formen, geprägt von den individuellen Mustern und Auswirkungen des Konsums der psychotropen Substanzen sowie den Erfahrungen im System Sucht (verändertes soziales Umfeld, Subkultur, Hilfesystem, Justizerfahrungen, usw.). Eine gemeinsame Ursache der Sucht zu finden ist zumindestens im psychotherapeutischen Bereich aufgegeben worden. Ich vermute einmal – ohne große Sachkenntnisse zu haben – dass auch im Bereich der Neurobiologie und Genetik die Einflußgrößen so zahlreich und unterschiedlich sind, dass auch dort keine monokausalen Theorien von allumfassendem Erklärungswert zu finden sind, sondern ebenfalls sehr unterschiedliche, individuelle Faktoren einen Beitrag zur jeweiligen Suchterkrankung leisten. Gemeinsamer Nenner von Grundstörung und Suchterkrankung Dennoch gibt es aber m. E. eine zentrale Gemeinsamkeit, welche den überwiegenden Teil der polytoxikomanen männlichen Patienten charakterisiert: Wer vor oder während der Pubertät über das Ausprobieren und gelegentlichen Missbrauch hinaus eine Suchtentwicklung eingeleitet hat, hat in der Regel auch eine früh diagnostizierbare individuelle Grundstörung, deren vorrangige Auswirkungen eine gestörte Selbstwertregulation ist, insbesondere im Bereich der geschlechtlichen Identität. 3 Oftmals ist bei diesen Patienten schon die Entwicklung der Kern-Geschlechtsidentität im ersten Lebensjahr gestört. Die weitere Entwicklung der Geschlechtsrollen-Identität und deren Differenzierung in den nächsten 5 Lebensjahren sowie die Ablösung von den Müttern und damit auch von eigenen weiblichen Identifizierungen ist in der Regel nicht gelungen, wobei die Abwesenheit oder mangelnde Hilfestellung der Väter entscheidend ist. Das Mißlingen hat weitreichende Folgen: dazu gehören sexuelle Perversionen, Aggressivität gegenüber Frauen und übersteigerte männliche Aktivität. Es gibt in Bezug auf Elternschaft den Begriff „good enough mother/father“, eine Selbstwertkategorie von Elternschaft, die man sich in der Erfahrung mit seinen Kindern erarbeitet. In ähnlicher Weise haben natürlich auch Kinder ein großes Verlangen, sich als „good enough“ zu fühlen. Männliche Kinder fragen sich gleichermaßen: Bin ich ein guter Sohn für meine Mutter? Bin ich ein guter Sohn für meinen Vater? Bin ich ein guter Junge ? Bin ich ein guter Junge ? Und: Wann bin ich gut genug als Junge? Die meisten unserer Patienten konnten diese Fragen keinesfalls sicher mit ja beantworten. Sie suchten nach Wegen, die hochambivalenten oder defizitären Bestätigungen ihres männlichen Wertes schon früh in ihrer Entwicklung durch kompensatorische Aktionen zu komplettieren. In der Latenzzeit und Pubertät übernimmt nämlich die Peergroup die Funktionen der Definition von Gender. Für die basale Regulation des Selbstwertes im Bereich der geschlechtlichen Identifikation ist die Anerkennung durch andere – junge – Männer der jeweiligen Peergroup zentral und kann auch nicht ersetzt werden, es sei denn, durch Personen, denen von der jeweiligen Peergroup die Macht zugestanden wird, Wert als Mann zu definieren. (wie etwa Sporttrainer oder ältere Kriminelle) Die meisten unserer Patienten sind im besonderen Maße ausschliesslich von dieser peergroup-Spiegelung abhängig, weil im familiären Vorlauf in der Regel keine identitäts- und selbstwertstützende Zuwendung durch ein positiv wirkendes männliches Objekt von Bedeutung erfolgte. Hinzu kommen oft Erfahrungen von Entwertungen des Männlichen durch sozialisierende Frauen (Schwestern, Mütter, Erzieherinnen, Lehrerinnen). Hinzu kommen auch die häufigen selbstwert- und identitätsschädigenden Einflüsse des Scheiterns in Schule und anderen sozialen Bereichen, wo auch keine Anerkennung durch andere männliche Personen mit Macht und Ansehen erfolgte, sondern eher im Gegenteil die ohnehin labile Selbstwertregulation weiter geschädigt wurde. Männlichkeit wird dann auch hilfsweise definiert als Verneinung von Weiblichem, das in der Pubertät als tuntenhaft – homosexuelles Verhalten in die Nähe des sozusagen „Abartigen, Perversen“ gerückt wird, u.a. auch um Distanz zu eigenen femininen Identifikationsanteilen oder homoerotischen Wünschen herzustellen. Wir sehen dann im weiteren Entwicklungsverlauf die Konstruktion von Männlichkeit in der Adoleszenz und später mithilfe von Suchtmitteln und kriminellem Handeln, das „doing gender with drugs“ in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen. Begleitet wird dies oft noch von Versuchen, eine Identität im Arbeitsleben zu finden, die bald aber an der Suchterkrankung scheitern. Nebenbei: Ursprünglich war dies auch eine Forschungsrichtung der Kriminologie mit Betonung auf „doing gender – doing crime“, auch schon mit männerspezifischer Ausrichtung. 4 Was bedeutet dies alles für die klinische Praxis der Suchtarbeit ? Suchttherapie und Mit dieser adoleszenten Entwicklung der süchtigen und kriminellen Geschlechtsidentität ist einiges an Fragen verknüpft: Warum so früh ? Warum so heftig ? Warum blieb es nicht beim Ausprobieren von Suchtmitteln ? Warum konnte der Patient kein halbwegs integrierter Alkoholiker werden ? Wo war die Angst vor den harten Drogen ? Weshalb wurde Lust und Bestätigung in kriminellem Tun gesucht ? Warum dieses Ausmaß an Knast-Tätowierungen ? Woher diese heftige Homophobie ? Und die Gewalt ? usw. usw. Sucht als Rettungsaktion für den labilen jungen Mann Wir haben für uns die Schlussfolgerung gezogen, all diese adoleszenten Bewegungen hin zur Polytoxikomanie als großartige Rettungsaktion für die labile Persönlichkeit, für die seelische Rest-Gesundheit zu betrachten, angesichts der Bedrohung eines fragilen Systems, das durch die zusätzlichen Belastungen der pubertären Reifung vor dem Zusammenbruch steht. In diesem Sinne ist für uns „doing drugs“ nicht nur „doing gender“ en passant, nicht nur beiläufige Konstruktion einer süchtigen Männeridentität, sondern die einzige Möglichkeit, kohärente Person zu bleiben oder zu werden, und zwar bezogen auf die Geschlechtlichkeit als zentrales Merkmal der Person. (Person im Sinne von Maske, durch die das Wesen des Menschen hindurchtönt.) Ich will es noch einmal betonend aus der Sicht der Patienten sagen: „Bevor ich ein NichtMann bleibe, ein Versager, ein Schwächling, ein Alkoholikerkind, ein Mädchen oder Mamas Zappelphillip, gehe ich lieber zu den großen bösen Jungs und werde einer von denen. (In diesem Zusammenhang empfehle ich allen, einmal das wunderbare Bilderbuch von Maurice Sendak mit dem Titel „Wo die wilden Kerle wohnen“ zu lesen, da wird vieles deutlich, was die pubertäre männliche Persönlichkeitsformung betrifft.) Infolge dieser Betrachtungsweise stellen wir in der Fachklinik Flammersfeld die männliche Identitätskonstruktion in den Mittelpunkt unserer Behandlung. Alle Manifestationen der Persönlichkeit der Patienten, ob es nun die Suchterkrankung, die Grundstörung oder insbesondere die gesund gebliebenen Fähigkeiten, Eigenschaften und Ressourcen sind, werden vorrangig im Hinblick auf ihren Beitrag zur männlichen Geschlechtsidentität und personalen Selbstwertregulation als Mann betrachtet. Unabhängig von den individuellen Gestaltungen der Erkrankung ist es nach unserer Überzeugung am wichtigsten, den suchtkranken Patienten behilflich zu sein, eine befriedigende maskuline Identität zu errichten, die ihr bisheriges Leben und ihre Erkrankung realitätsgerecht integriert, und alles zu vermeiden, was das fragile maskuline Selbstwertgefühl weiter schädigt. Was dies nun bedeutet, befriedigende gesunde maskuline Identität, wird im Behandlungsdialog individuell für jeden Patienten entwickelt. Hier gilt auch: Den Patienten dort abholen, wo er ist. 5 Allen Behandlungsdialogen gemeinsam aber ist das Ziel, sich von den bisherigen zwanghaften innerlichen Einschränkungen und Abhängigkeiten zu lösen und ein flexibleres „doing gender“ zu ermöglichen. Es soll ein Gefühl von stabilem männlichem Selbst beinhalten und situationsabhängige Anpassung ermöglichen, somit auch die Person differenzierter und reicher werden lassen. Alle anderen Behandlungsziele haben sich auch darauf hin zu definieren, ob dies nun Beziehungs- oder Arbeitsfähigkeit sind, Abstinenz, legale Orientierung, was auch immer. Auch Teilziele therapeutischen Handelns, wie etwa der Aufbau von Frustrationstoleranz, von Affektwahrnehmung, von sozialen Fähigkeiten, werden zuvörderst in Bezug gesetzt zur Unterstützung der Konstruktion einer stabileren und gesünderen männlichen (Kern)-Identität. Also, zusammengefasst, die Maximen unseres klinischen Handeln sind 1.) Die labilen Identitätsfragmente nicht weiter zu schädigen; 2.) Männliche Kern-Identität und Geschlechtsrollen-Identität unbedingt zu fördern 3.) Individuelle Identität als männliche Person im therapeutischen Dialog zu erweitern Das erfordert sehr viel Sensibilität, insbesondere gegenüber dem scheinbar Selbstverständlichen des klinischen Alltags der Arbeit mit suchtkranken Männern. Noch mehr erfordert es aber eine generelle Ausrichtung der gesamten Einrichtung in ihrer Philosophie, ihrer Struktur und ihren Abläufen auf diese Therapiemaximen. Das ist bei weitem mehr als die Einrichtung einer speziellen Männergruppe oder instrumentelle Übertragungen aus der frauenspezifischen Suchttherapie, die allerdings viele wertvolle Impulse geben kann. Ich möchte Ihnen nun etwas aus der gelebten Praxis berichten: Wir sind in der Klinik noch in der Entwicklung einer umfassenden Identität als Männerklinik begriffen, im gemeinsamen Dialog der Mitarbeiter, unter gelegentlicher Miteinbeziehung der Patienten. Wir hatten bislang einzelne Behandlungssegmente schon mehr oder weniger bewußt auf die Stützung männlicher Identität orientiert, die wir nun wie in einem PatchworkVorgang zu einem Gesamt zusammenfügen. Deshalb kann ich Ihnen jetzt einen noch unfertigen Entwurf bieten und an dem ein oder anderen Beispiel deutlich werden lassen, welche Konsequenzen aus der männerspezifischen Ausrichtung zu ziehen sind. Struktur der Fachklinik Flammersfeld Wir behandeln in einem gemischtgeschlechtlichen Team 36 polytoxikomane Patienten. Unser Behandlungsschema im Tagesablauf ist morgens Arbeitstherapie, nachmittags Bezugstherapie und Sport, abends spezielle Module. Ingesamt legen wir sehr viel Wert auf Sport und körpertherapeutische Erfahrung, wir haben einen eigenen hochqualifizierten Sportlehrer mit vielen therapeutischen Zusatzausbildungen. Die Patienten machen neben Fußball z.B. Aikido, Tai Chi, Qi Gong, Konditionsaufbau, Joggen, Volleyball, Badminton. Was uns von vielen anderen Männerkliniken unterscheidet ist: Wir haben eine PatientenFußballmannschaft, die in der offiziellen Liga (Kreisklasse D) mitspielt und vom DFB 6 gefördert wird, dieses Jahr leider nur in der Hallensaison. Bei Heimspielen unserer Mannschaft ist es für alle Patienten Pflicht, auf dem Fußballplatz präsent zu sein und die Fußballmannschaft zu unterstützen. Wir sehen Fussball nicht nur als Sport, sondern als gruppentherapeutische Veranstaltung für Männer mit direktem Bezug auf Geschlechtsrollenkonstitution Unsere Arbeitstherapie ist entsprechend klassischen Rollenmuster besetzt: Schreinerei, Gartenbau, Hausmeisterei sind von männlichen Arbeitstherapeuten geleitet. Küche, Haus wirtschaft, Wäscherei, Ergotherapie werden von weiblichen Arbeitstherapeutinnen geführt. Die Bezugstherapiestellen waren zeitweise paritätisch besetzt, nun haben wir drei Frauen und einen Mann dort, es ist leider sehr schwierig, qualifizierte Männer mit VDR-anerkannter Qualifikation zu finden. Die Einrichtung wird von mir geleitet, als Vertreter fungiert der männliche ärztliche Leiter. Alle drei Nachtwachen sind Männer, der Sozialarbeiter im Sozialdienst ebenfalls. Drei weibliche Verwaltungskräfte ergänzen das bislang genannte Team. Wie sie sehen, entspricht unser personelles Behandlungsangebot größtenteils den klassischen Rollenverteilungen, einer patriarchal erscheinenden Struktur. Wir bieten den männlichen Patienten so eine relativ bekannte bzw. eine ersehnte einfache männliche Struktur an. Insbesondere ausländische Patienten mit starker patriarchaler Prägung (Türken, Deutschrussen, Italiener) finden hierin Geborgenheit. Nun zu einigen Grundsätzen (Allgemeine Thesen) 1. Männerspezifische Suchttherapie bedeutet vordergründig erst einmal, sich zu entscheiden, ausschliesslich Männer zu behandeln. Angesichts des zunehmenden Drucks der umgebenden Gesellschaft auf identitätsunsichere Menschen mit strukturellen Störungen, (das sind Schwächen und Defekte im Stützsystem der Persönlichkeit) und das gilt für die meisten polytoxikomane Patienten, ist Entlastung in der Form eines Schonraumes dringend nötig, um an der Heilung kranker Strukturen arbeiten zu können. Die Zumutung des anderen Geschlechtes in dieser Phase (und auch bei diesen handelt es sich ja um süchtige und zutiefst beziehungsgestörte, schwer psychisch kranke Frauen) mit all den geschlechtstypischen Störungen von Männern wie von Frauen, die auf das jeweils andere Geschlecht wirken, erschwert die Therapie und fügt in der Regel den Patienten weitere Kränkungen hinzu. Die meisten männlichen Suchtkranken sind in großen Teilen ihrer inneren Entwicklung in oder vor der Pubertät stecken geblieben, lange bevor die inneren Instanzen soweit gereift gewesen wären, probehalber schon Beziehungsgeschehen mit Frauen zu üben. Es ist deshalb allemal einfacher, süchtige und schwer beziehungsgestörte Patienten in einem eingeschlechtlichen Rahmen zu unterstützen, eine stabile Identität auszubilden, auf deren Basis dann darauffolgend Partnerschaften mit Frauen aufgebaut oder bestehende Beziehungen verändert werden können. (s. Erikson, Moratorium) 7 2. Wenn man ausschliesslich Männer behandelt, hat dies auch andere Konsequenzen Zum Beispiel kann man keine Frauen als kommunikative Psychogruppen-Gestalterinnen einsetzen, die für die Gefühlsseite stehen. Auch bei der Pflege der Sitten im Umgang miteinander sind keine Frauen in der Funktion einer sozialen Watte da, welche durch ihre Anwesenheit dafür sorgen, dass nicht laut geschmatzt wird oder sich anständig gekleidet wird. Es gibt auch kein Balzverhalten, keine „Mutter der Kompanie“, keine geheimen sexuellen Bündnisse, keine verborgene Zuhälterei und keinen Mitarbeiter, der den Schlüssel für das stundenweise zu nutzende „Beziehungszimmer“ verwaltet und Probleme mit seiner Identität hat. Die Dominanzreihenfolge unter den Männern wird nicht darüber definiert, wer die attraktivste Mitpatientin sexuell besetzt. Referenzrahmen ist stattdessen die Männergruppe mit ihren eigenen Wertsystemen. Man muß sich anders mit den Fragen der Masturbation aussetzen, des Aufsuchens von Prostituierten, mit männertypischen pubertären Regressionen, angefangen vom Wassereimer auf der Tür bis hin zu sadistischen sexualisierten Initiationsriten. Zudem orientiert sich die gesamte frei verfügbare Libido auf die anwesenden weiblichen Mitarbeiterinnen, die sich dessen bewusst sein müssen, dass sie auch als sexuelle Wesen betrachtet werden und Phantasievorlagen der Masturbation der Patienten sind, in Einzelfällen auch schon mal früh Übergriffe begrenzen müssen oder Verliebtsein ertragen müssen. 3. Die Klinik als Gesamt muß die maskuline Kernidentität fördern im Sinne von : Du bist Bestandteil einer wertvollen Organisation, die gut ist und heilsam für Männer, die auch Männer anspricht. (Wobei ausgesprochen und unausgesprochen klar sein muß, dass es für Frauen als Patientinnen ganz andere Organisationsformen und Regeln gäbe). Ausgesprochen werden muß auch, dass es gut ist, dass ausschliesslich Männer behandelt werden. Unausgesprochen muss spürbar sein, daß die Fachkräfte gern mit Männern arbeiten. Ob dies nun strukturell so patriarchal sein muß wie bei uns sei dahingestellt, es erscheint mir allerdings einfacher für Patienten und MitarbeiterInnen, mit einer vereinfachten Struktur und klassischen Rollenverteilung zu arbeiten, der Störung der Patienten nicht mit Komplexität zu begegnen, sondern einfache stützende Strukturen zu bieten. 4. Insgesamt erfordert diese Orientierung ein deutliches Geschlechtsbewusstsein aller weiblichen und männlichen Fachkräfte, die über große Sicherheit in der eigenen Geschlechtsidentität verfügen müssen und sich nicht durch die Patienten emanzipieren oder bestätigen müssen. Dazu gehört natürlich auch, dass die untereinander die andersgeschlechtlichen MitarbeiterInnen Wertschätzung erfahren und Gender und Geschlechtlichkeit nicht nur in der Supervision mit berücksichtigt werden, sondern alltägliche Perspektive sind. Größere Schwierigkeiten – und hier spreche ich mehr aus der früheren Erfahrung in anderen Institutionen - haben meist Kollegen und Kolleginnen, die selbst noch sehr unsicher in ihrer Männlichkeit oder Weiblichkeit verankert sind. Schwierig ist es meiner Erfahrung nach für alleinerziehende Müttern als Therapeutinnen, wenn die Kränkung der verlassenen Weiblichkeit nicht verarbeitet ist. Schwierig ist es auch für Kolleginnen, die selbst sehr wenige oder unglücklich verlaufende Erfahrungen in intimen Beziehungen mit Männern haben. 8 Schwierig haben es auch männliche Kollegen in verlängerter Adoleszenz, die sich den Patienten als „ältere Brüder“ kumpelhaft-jugendlich anbieten und auf diesem Weg den eigenen Prozess des Alterns und Erwachsenwerdens verzögern wollen. Schwierig ist es auch mit Mitarbeitern, die in ungelösten Autoritätskonflikten mit dem eigenen Vater steckengeblieben sind und Probleme haben, sich mit der Staatsgewalt, Recht und Ordnungssystemen zu identifizieren. Männerhorde und Rudel-Psychologie Die individuelle Behandlung erfordert andere Verständnisebenen als die kollektive. Viele Alltagsprobleme lassen sich einfacher angehen, wenn strukturell berücksichtigt wird, dass es in (pubertären) Männerhorden ähnliche Bedürfnisse gibt wie in Rudeln von Säugetieren, man hier also auch etwas aus der Sozialpsychologie von Rudeltieren entlehnen kann. ( Empfehlenswert auch immer: Der Pavianfelsen im Zoo !) Beispiele: 1. Es sind hauptsächlich die körpersprachlichen Abläufe, die zu beobachten sind im inneren Gruppenverhältnis. Wenn Sie darauf achten, entdecken Sie sehr schnell, ob sie einen mafiösen Boss unter den Patienten haben. 2. Die Rangposition im Rudel ist wichtig und gibt Sicherheit. Entsprechend sitzen bei die „dienstältesten“ Patienten oben am Tisch, führen den Vorsitz. ( s. auch Hellinger) 3. Das Rudel kann man sich selber ordnen lassen, bis auf Beschädigungen, da muss man dann trennen. Selbstregulation der Patientengruppe ist erwünscht, wird aber im Hinblick auf dissoziales oder süchtiges Verhalten sehr kontrolliert. 4. Die Entfernung aus dem Rudel ist eine harte Zurechtweisung, ja eine Strafe für Rudeltiere. Entsprechend wirksam ist dies in der Gruppe bei disziplinarischen Problemen, die wir sehr genau von Krankheitsschüben unterscheiden. 5. Die Alpha-Position gegenüber hat immer der menschliche Rudelführer zu behalten. Wer sich jedoch nicht durchsetzen kann, wird nie Alpha. Er hat ein Rangordnungsproblem, das er lösen muss. Entsprechend klar muß das Führungsverhalten der MitarbeiterInnen sein, auch der Klinikleitung. Sie können keine Gruppe von dissozialen Patienten aus der beta-Position heraus therapieren. 6. Sollten in der Klinik disziplinarische Maßnahmen nötig sein, ist es besser, der Leiter führt diese in seiner Funktion als Rudelführer durch, bestätigt seine Rolle und entlastet so z.B. die Therapeuten von höchst ambitendenten Rollenmerkmalen, die nebenbei für manche Patienten ohnehin schwer zu verkraften sind. Der männliche Körper in der männerspezifischen Suchttherapie 1. Männer kommunizieren körperlich Insgesamt gilt es auch zu berücksichtigen, dass Männer andersartige Kommunikationsformen haben als Frauen. Insbesondere der nonverbale Transport bedeutungsvoller Signale mithilfe der Körpersprache ist hierbei zu berücksichtigen. Das bedeutet beispielsweise, dass in Fallsupervisionen immer auch der körpersprachliche Anteil von Interaktionssequenzen berücksichtigt werden muß. Die Frage: „Wie haben Sie das dem Patienten gesagt ?“ ist da unter Umständen hilfreicher für die Beziehungsklärung und Gegenübertragungsanalyse als die Orientierung am Inhalt der Botschaft. 9 2. Körperkontakt unter Männern ist anders zu bewerten als unter Frauen, was z.B. die Frage der Gewalttätigkeit berührt: Kämpferische Muskelaktion – miteinander oder im Vergleich – definiert auch Bestandteile der Männlichkeit und somit der Person. Dementsprechend müssen Ebenen zur Verfügung gestellt werden, in denen dies ohne innere oder äußere Verletzung ermöglicht werden kann. Ob Sport, Kraftsport oder Kampfsport, ritualisierte Formen der Gruppenaggression (Tauziehen) ist relativ egal, wenn die körperliche Leistung Wertschätzung erfährt, aber auch eingebettet wird in ein Gesamt der Persönlichkeit. Nicht zu vergessen, das dies auch Möglichkeiten sind, die immense Sehnsucht nach bestätigendem Körperkontakt durch andere Männer teilweise zu befriedigen (Was gibt es Intimeres unter Pubertären außer einem Ringkampf ?) 3. Mut zum väterlichen Angreifen ist nötig Entsprechend wichtig ist es auch, dass die männlichen Mitarbeiter und Leiter auch körperliche symbolhafte Zugänge zu den Patienten wahrnehmen, diese auch anfassen, sie per Handschlag begrüssen, usw.. Dies ersetzt nicht die Trauer um den erfahrenen Mangel an väterlicher Zuwendung, baut aber nonverbal Brücken des Kontaktes, die oft gerade in Krisensituationen die Beziehung tragen helfen. 4. Der Körper braucht Wertschätzung Jugendkultur hat immer schon ganz stark verwiesen auf den Körper, weil Jugendliche zunächst einmal im Unterschied zu Erwachsenen nicht mehr haben als ihren Körper zur Inszenierung ihres sozialen Status und ihres Selbst. Das gleiche gilt für die sog. Knastkultur und für die Subkultur der drogenabhängigen Männer. Die Körperkultur (Tätowierungen, Piercings, Muskelaufbau, Kleidung, Haartracht)ist deshalb prädestiniert dazu uns zu zeigen, was eigentlich mit dem Körper passiert im Hinblick auf geschlechtliche Identitäten. Diese symbolischen Botschaften über gender und Status müssen dechiffriert werden und in den therapeutischen Dialog miteinbezogen werden. 5. Der männliche Phallus benötigt adäquate narzißtischer Besetzung und symbolische Exhibition Ohne narzißtische Besetzung, d.h. Wertschätzung, des eigenen Geschlechtsteils und ohne symbolische Äußerungsformen dessen bleibt die geschlechtsbezogene Identität labil. Hier müssen in symbolischer Interaktion Wege gebaut oder gefunden werden, als phallischer Mann gesehen und wertgeschätzt zu werden. Neben diesen körperbezogenen allgemeinen Aspekten, die unbedingt berücksichtigt werden müssen, möchte ich Ihnen einige Standards der klinischen Suchtarbeit mit Männern vorschlagen, die wir zunehmend auch in der Fachklinik Flammersfeld berücksichtigen. Unbedingt nötig sind 1.) Anamnestisches Erfragen von männlichen Leitfiguren oder Vaterfiguren 2.) Berücksichtigung passiver Gewalterfahrungen, auch sexualisierter, homo- wie heterosexuell, auch Demütigungen 3.) Anamnestisches Erfragen erektiler Potenz/Impotenzerfahrungen, auch in Verbindung mit Drogengebrauch, und Sexualitätserleben 4.) Berücksichtigung von Vaterschaft, Beziehung zu Kindern und Kindesmutter (Unterhalt) 5.) Berücksichtigung zentraler männlicher Gestaltungsaspekte von Sein und Beziehung wie 10 Externalisierung , Stummheit , Alleinsein, Rationalität, Kontrolle, Gewalt 6.) Ergänzung einseitig gelebter Männlichkeit um die abgespaltenen (Leistung/Entspannung; Aktivität/Reflexivität; Stärke/Begrenztheit) 7.) Berücksichtigung der männlichen Handlungsorientierung in der Therapie 8.) Korrektur der Ängste und Abwertungen bezüglich Frauen 9.) Förderung gefühlvoller Körperlichkeit unter Männern Anteile Einzelempfehlungen aus der gegenwärtigen Literatur Neben diesen Aspekten können Sie mittlerweile viele Impulse aus der wachsenden Fachliteratur über männerspezifische Ansätze in der Suchtarbeit ziehen. Mit ein wenig Mühe und guten Suchmaschinen lassen sich viele Anregungen im Internet finden, welche die eigene Wahrnehmung und Arbeit gender-spezifisch erweitern können. Lesen Sie die Artikel des Kollegen Vosshagen, der aus reicher Praxiserfahrung schreibt, lesen Sie, was Heino Stöver schreibt, schauen Sie das Konzept der Casa Fidelio (Schweiz) an, das Konzept von Michael`s House, einer amerikanischen Männersuchtklinik, schauen Sie auch auf die NIDA-Seiten (National Institute on Drug Abuse) www.nida.nih.gov und vor allem auf die umfangreichen Literaturlisten unter www.archido.de Zum Schluß möchte ich Ihnen nochmals männerspezifischer Suchtarbeit vorschlagen die 3 Handlungsmaximen 1.) Die labilen Identitätsfragmente nicht weiter schädigen; 2.) Männliche Kern-Identität und Geschlechtsrollen-Identität unbedingt fördern 3.) Individuelle Identität als männliche Person im therapeutischen Dialog erweitern Wir wollen im gegenwärtigen Prozeß in unserer Klinik alle Strukturen, Regelungen und Abläufe im direkten und indirekten Umgang mit Patienten daraufhin überprüfen, ob und wie diese 3 Leitlinien Berücksichtigung finden. Angefangen von der Begrüßung (Wer begrüßt, Duzen oder Siezen, Handschlag oder Kopfnicken) über Verfahrensweise bei der Urinabgabe zur Kontrolle (mit direktem Blick auf den Penis des Patienten, mit herabgelassener Hose, durch Arzt oder andere Mitarbeiter?), Zimmergestaltung (Pin-Ups an der Wand? Pornos auf dem Bett? Filmplakate mit männlichen Gewaltheroen?), bis hin zur Gestaltung aller Rituale, der therapeutischen Formen und Inhalte, der Verabschiedung (Handdruck, Umarmung, durch wen ?) steht alles zur Disposition. Man realisiert dabei erstaunt, an wievielen alltäglichen Punkten durch eigenes Handeln Momente der Konstruktion von Männlichkeit im Handlungsdialog beeinflusst werden. Ich hoffe, ich habe Ihre Geduld nun nicht zu lange strapaziert. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen und eigenen Erfahrungen zu diesem Thema. Als Mann selbst freue ich mich darüber, daß der verborgene und vernachlässigte Anteil eigener Geschlechtlichkeit in der Konstruktion der erwachsenen Rolle nunmehr nicht mehr als selbstverständlich, allgemein und „normal“ wahrgenommen wird, sondern auch einer gesonderten Betrachtung und somit Wertschätzung unterzogen wird. In ungleich stärkerer Wertschätzung erleben das unsere Patienten und wir hoffen, damit einen Beitrag zu einer präziseren stationären Behandlungstechnik in der Rehabilitation suchtkranker Männer leisten zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 11