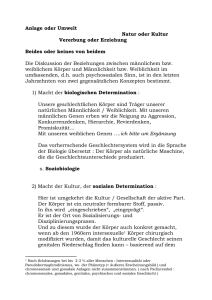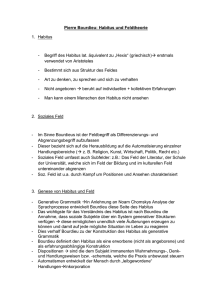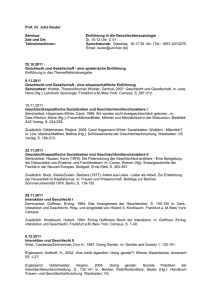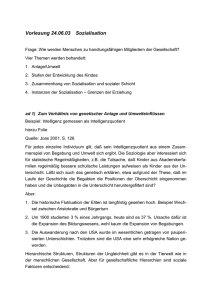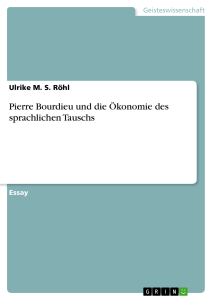Michael Meuser Riskante Praktiken. Zur Aneignung von - A
Werbung

Michael Meuser Riskante Praktiken. Zur Aneignung von Männlichkeit in den ernsten Spielen des Wettbewerbs , l. Einleitung In einem Aufsatz, der die Diskussion über Theorieperspektiven in der Forschung zur geschlechtlichen Sozialisation neu angestoßen hat, moniert Andrea Maihofer (2002), die Dominanz des konstruktivistischen Paradigmas in der rezenten Geschlechterforschung habe sozialisationstheoretische Fragestellungen nicht nur einfach in den Hintergrund gerückt, sondern diese geradezu tabuisiert. In der Tat hat die konstruktivistische Geschlechterforschung keine Sozialisationstheorie vorgelegt, gleichwohl hat sie formuliert, um was es im Prozess der geschlechtlichen Sozialisation im Kern geht. Regine Gildemeister (1988, 1992) zufolge werden im Sozialisationsprozess diejenigen Regeln erworben, nach denen die soziale Konstruktion von Geschlechterdifferenzen erfolgt. Der spezifisch konstruktivistische Fokus besteht darin, dass nicht gefragt wird, in welcher Weise die Geschlechtszugehörigkeit unterschiedliche Sozialisationsverläufe bedingt; vielmehr wird die Geschlechtlichkeit als solche als das begriffen, was angeeignet werden muss. Geschlechtliche Sozialisation „umfasst komplexe Aneignungsprozesse von in der gesellschaftlich spezifischen Fassung der Geschlechterrelation sedimentierten sozialen Differenzierungen." Diese Aneignung bezieht sich vor allem auf die Ebene „der generativen Regeln der Herstellung sozialer Situationen." (Gildemeister 1992: 231; Hervorhebung im Original) Es ist nicht zu übersehen, dass die Aneignung der Geschlechtlichkeit in geschlechtstypisch unterschiedlicher Weise erfolgt. In dem Maße, in dem das Kategoriensystem der Zweigeschlechtlichkeit erworben wird, differenziert sich der Sozialisationsprozess für Jungen und Mädchen auf jeweils typische Weise. Im Folgenden formuliere ich einen Vorschlag, wie die Aneignung von Männlichkeit im Sinne eines Einübens der generativen Regeln des doing masculinity konzipiert werden kann. Ich rekurriere dazu auf eine These sowie auf eine Unterscheidung Bourdieus, die dieser selbst, lose eingestreut in anderweitige Überlegungen, nicht weiter ausgeführt hat, die mir aber für die Diskussion über Modi männlicher Sozialisation fruchtbar zu sein scheinen. Die These findet sich in seinem Aufsatz über die männliche Herrschaft. Dort heißt es, der männliche Habitus werde "konstruiert und vollendet [...] nur in 1 Der vorliegende Text greift Überlegungen aus einem andernorts publizierten Aufsatz auf ( Meuser 2005) und stellt sie in einen sozialisationstheoretischen Kontext. 16 4 Michael Meuser Verbindung mit dem den Männern vorbehaltenen Raum, in dem sich, unter die ernsten Spiele des Wettbewerbs abspielen" (Bourdieu 1997: 203). Männlichkeit hat demzufolge eine kompetitive und in homosozialen Feldern geprägte Struktur. Die Unterscheidung betrifft verschiedene Formen der Sozialisation: das „Lernen durch schlichte Gewöhnung", die explizite Unterweisung und die Strukturübung (Bourdieu 1993: 138). Letztere ist für die geschlechtliche Sozialisation von besonderer Bedeutung. Jede Gesellschaft sähe „Strukturübungen vor, mit denen diese oder jene Form praktischer Meisterschaft übertragen werden dürfte". Mit Bezug auf seine ethnologischen Forschungen in der Kabylei nennt Bourdieu: „alle Spiele, die häufig nach der Logik von Wette, Herausforderung oder Kampf strukturiert sind (Zweikampf oder Gruppenkampf, Scheibenschießen usw.) und bei denen von den Knaben verlangt wird, die Erzeugungsschemata der Ehrenstrategien auf der Ebene des ,Sotun-als-ob' anzuwenden" (ebd.). Männern, Bourdieus Ausführungen zu den ernsten Spielen des Wettbewerbs bleiben spärlich, und der Begriff der Strukturübung wird überhaupt nicht expliziert. Sowohl in seinem Aufsatz zur männlichen Herrschaft als auch in seinen Arbeiten zum Begriff des Habitus sucht man vergeblich nach einer Sozialisationstheorie, nach Erläuterungen, „durch welche Prozesse das Soziale in den Körper kommt" (Villa 2000: 50) bzw. wie die Individuen die „Denkstrukturen, Wahrnehmungsformen und Körperpraxen in ihren individuellen Entwicklungen ausbilden" (Maihofer 2002: 20). Bourdieu weist zwar gelegentlich auf die Bedeutung der Sozialisation für die Herausbildung des Habitus hin (z.B. Bourdieu 1987: 739ff) - und man kann mit Eckart Liebau (1993: 264) das Habitus-Konzept „als eine implizite Sozialisationstheorie verstehen" -, ein darauf gerichtetes Forschungsprogramm entwickelt Bourdieu jedoch nicht. Sein Untersuchungsgegenstand sind die Sozialisationsergebnisse, nicht der Sozialisationsprozess (Bauer 2002: 137). Bourdieu begnügt sich mit dem Hinweis, dass die Grundlagen der Habitus in der primären Sozialisation gelegt werden. Der Habitus ist nichts anderes [...] als dieses durch die primäre Sozialisation jedem Individuum eingegebene immanente Gesetz, lex insita, das nicht nur die Voraussetzung der Übereinstimmung der Praxis(formen), sondern auch die Voraussetzung der Praxis der Übereinstimmung darstellt" (Bourdieu 1979: 178). Das gilt für den geschlechtlichen Habitus nicht weniger als für den Klassenhabitus. Dem häufig geäußerten Einwand, Bourdieu habe es versäumt, eine Sozialisationstheorie des Habitus zu formulieren, könnte man mit Beate Krais und Gunter Gebauer (2002: 61) entgegnen: „Eine Soziologie, die Sozialisation als Ausbildung des Habitus sieht; braucht auch keine Sozialisationstheorie im strengen Sinne." Krais und Gebauer geben dann aber doch einen Hinweis, wie der Erwerb des Habitus üblicherweise erfolgt: „als mimetisches Lernen Riskante Praktiken 165 [...], als praktisches, körperlich-sinnliches Tun in der Interaktion mit anderen" (ebd.: 64). Und dies geschieht weitgehend unabhängig von intentionalen pädagogischen Bemühungen und außerhalb der Institutionen des Bildungsund Erziehungssystems. Es ist ein praktisches, vor-reflexives Lernen, in dem nicht „,Modelle`, sondern die Handlungen der anderen [...] nachgeahmt" werden (Bourdieu 1979: 189). Erworben wird der Habitus „in der und durch die Teilnahme an der Praxis selbst" (Liebau 1992: 139). Bourdieus Skepsis hinsichtlich der Bedeutung einer intentionalen Pädagogik für die Ausbildung des Habitus - die mit einer Skepsis gegenüber der verändernden Wirkung und befreienden Macht einer reflexiven Bewusstwerdung korrespondiert mag ein Grund dafür sein, dass er Sozialisationspraktiken nur selten und allenfalls beiläufig thematisiert. Eingelassen in die alltägliche Praxis und mit dieser weitgehend identisch, lassen sie sich gewissermaßen nur schwer als abgegrenzter Untersuchungsgegenstand fixieren. Eine Form des vorreflexiven Lernens in Gestalt eines praktischen, körperlich-sinnlichen Tuns in der Interaktion mit anderen sind die Strukturübungen. Ich werde dies im Folgenden mit Bezug auf einen Typus sozialen Handelns erläutern, der bei männlichen Individuen in der Jugendphase verstärkt und insgesamt bei Jungen und Männern deutlich häufiger als bei Mädchen und Frauen vorzufinden ist: Risikohandeln (Furstenberg 2000). Meine Überlegungen haben ihren Ursprung darin, dass ich eine Antwort auf die Frage suche, was der soziale Sinn derartiger .Praktiken ist, d.h. wie mit solchen Praktiken eine spezifische Position im sozialen Raum erworben wird. Dem als Strukturübung begriffenen Risikohandeln männlicher Jugendlicher ist ein primärer (hier nicht näher betrachteter) Sozialisationsprozess vorgelagert, in dem der Möglichkeitsraum von Praktiken bereits geschlechtsty pisch sowohl konstituiert als auch eingegrenzt worden ist. Auch in der primären Sozialisation bzw. gerade in dieser erfolgt die geschlechtliche Sozialisation in Gestalt einer vorreflexiven Aneignung von Praktiken: „es ist auch die von allem Anfang an erfahrene Alltäglichkeit geschlechtsspezifischer Praktiken und der daran gebundenen Selbstverständlichkeiten, aus denen die unterschiedlichen Habitusformen erwachsen" (Liebau 1992: 141). 2. Zur Geschlechtsdifferenz des Risikohandelns Das Risikohandeln männlicher Jugendlicher lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten: als Gefährdung der Gesundheit des riskant Handelnden wie der von seinem Handeln möglicherweise Betroffenen, als soziales Problem, das eine pädagogische Intervention notwendig macht, als bewusst gewähltes Mittel, um Achtung und Anerkennung unter Gleichaltrigen zu gewinnen, als funktional in Hinblick auf die Aneignung von Erwachse- 16 6 Michael Meuser nenrollen. Von diesen, in der einschlägigen Literatur zu findenden Betrachtungsweisen, greife ich die funktionalistische auf. Diese Lesart legt nahe, das Risikohandeln männlicher Jugendlicher als Teil der geschlechtlichen Sozialisation zu betrachten. Risikohandeln, so meine These, ist in dem Sinne funktional für die geschlechtliche Sozialisation von Männern, dass in ihm, bedingt durch die Modalitäten und die situativen Umstände, in denen es gewöhnlich praktiziert wird (Umstände des Wettbewerbs), eine Einübung in den männlichen Geschlechtshabitus stattfindet. Dies geschieht typischerweise innerhalb männlicher Peer Groups, also in einem homosozialen Gruppenkontext. Nicht nur Jungen und Männer handeln riskant. Die zentrale Differenz des Risikohandelns von Frauen und Männern ist entlang der Achse internalisierendes und externalisierendes Verhalten zu finden (Helfferich 1997; Kolip 1997a). Als internalisierendes Verhalten gelten z.B. Essstörungen oder Medikamentenmissbrauch, als externalisierendes Verhalten werden u.a. exzessiver Alkoholkonsum oder Extremsportarten beschrieben. Typisch für ein externalisierendes, überwiegend von Männern praktiziertes Risikohandeln ist, dass es in der Regel nicht in individueller Abgeschiedenheit stattfindet, sondern in einem kollektiven Rahmen. Es benötigt offensichtlich ein mehr oder minder großes Publikum. Zum Beispiel ist der Alkoholkonsum häufig Teil eines Gruppenrituals und erfolgt unter starkem Gruppendruck. Das Risikohandeln ist ein Handeln, bei dem nicht selten - mehr oder minder spielerisch, aber mit durchaus ernsten Folgen - die Unversehrtheit des eigenen Körpers wie auch der Körper von anderen aufs Spiel gesetzt wird. Beispiele sind das von den Beteiligten selbst so bezeichnete „Spaßprügeln", wie man es regelmäßig auf Schulhöfen beobachten kann, sowie andere Formen „geselliger Gewalt` (Inheiveen 1997). Auch in diesem Sinne ist männliches Risikohandeln externalisiert. Die Härte wird am eigenen Körper praktiziert, sie ist aber auch gegen andere Körper gerichtet. Einen institutionalisierten Ausdruck findet dies in einem sozialen Feld, das für die geschlechtliche Sozialisation männlicher Jugendlicher von hoher Bedeutung ist, im Sport. Männliches Risikohandeln hat hier einen festen und legitimen Platz. Männer favorisieren Sportarten, bei „denen der Körper als Mittel zu riskanten Auseinandersetzungen eingesetzt werden muss." (Gisler 1995: 654; vgl. auch Rose 1992: 116) Verletzungsanfällige Körperkontakte kennzeichnen typische Männersportarten, während bei typischen Frauensportarten der spielerische Ausdruck im Vordergrund steht. In homologer Weise sind jugendkulturelle, im öffentlichen Raum betriebene (Fun-)Sportaktivitäten geschlechtstypisiert. Den Einsatz und das Riskieren des eigenen Körpers kennzeichnet z.B. Breakdance oder Skating, die überwiegend von Jungen und jungen Männern praktiziert werden.' 2 In der angelsächsischen Forschung wird dem Sport eine nachgerade exzeptionelle Bedeutung für die männliche Sozialisation zugeschrieben (Messner 1990). Sportlicher Erfolg gilt Riskante Praktiken 167 In einer pädagogischen Perspektive mag das männliche Risikohandeln als problematisch erscheinen, unter den Peers hingegen erfährt es Akzeptanz und Anerkennung. Die positive Konnotation kommt z.B. in dem Slogan „no risk, no tun" zum Ausdruck. „Der Kick und die Ehre" (Findeisen/Kersten 1999) gehören untrennbar zusammen. Selbst die durch das Riskieren des Körpers unter Umständen entstehenden Verletzungen können als Zeichen sozialer Anerkennung fungieren. Die positive Wertung bleibt vielfach auch in der Retrospektive des erwachsenen Mannes auf seine jugendlichen ,Abenteuer` und Eskapaden` erhalten, wie Dubet (1997) mit Blick auf jugendliche Schlägereien darlegt. Eine positive Konnotation erfahren aber nur die Folgen eines externalisierenden, mithin männlichen` Risikohandelns; die durch ein internalisierendes Risikohandeln bewirkten Beschädigungen des Körpers (wie z.B. Bullimie, Anorexie) gelten zumeist auch in der Gemeinschaft der Peers als problematisch. Im Risikohandeln wird, so Helfferich (1997: 153) der Status respektierter Männlichkeit gelernt und verdient`. Wenn das zutrifft, dann muss das Risikohandeln - einschließlich der erwähnten Härte -, obwohl es außerhalb der Gemeinschaft der Peers als problematisch und vielfach auch als abweichend wahrgenommen wird, in seiner Struktur der generativen Logik des männlichen Geschlechtshabitus homolog sein. 3. Männlichkeit als homosoziale und kompetitive Praxis Männlichkeit erfährt ihre Gestalt nicht allein in Relation zu Weiblichkeit, sondern auch in den sozialen Beziehungen der Männer untereinander. Darauf hat Connell (1987; 1995) mit seinem Konzept der hegemonialen Männlichkeit hingewiesen. Will man die Geschlechtslogik des männlichen Risikohandelns verstehen, muss man sich der homosozialen Binnendimension von Männlichkeit zuwenden. Männlich-homosoziale settings sind durch zwei ineinander verwobene Eigenschaften gekennzeichnet: eine Distinktion nicht nur gegenüber der Welt der Frauen, sondern auch gegenüber anderen Männern und eine Konjunktion der der homosozialen Gemeinschaft angehörenden Männer untereinander (Meuser 2003a). Arbeiten zur männlichen Sozialisation weisen übereinstimmend darauf hin, dass sich die männliche Geschlechtsidentität über eine Abgrenzung gegenüber Frauen ausbildet sowie (zumindest phasenweise) gegenüber allem, was weiblich konnotiert ist (Friebertshäuser 1995). Diese Abals „a key signifier of successful masculinity" und als „t he Single most effective way of gaining popularity and Status in the male peer group" (Swain 2003: 302). Diesen exzeptionellen Stellenwert dürfte der Sport hierzulande nicht haben 168 Michael Meuser grenzung äußert sich nicht selten in Gestalt einer Abwertung des Weiblichen (Böhnisch/Winter 1993; Chodorow 1985, Hagemann-White 1984). Was in den Theorien zur geschlechtlichen Sozialisation gegenüber der Betonung der heterosozialen Abgrenzung gewöhnlich zu kurz kommt, ist die Distinktion in der binnengeschlechtlichen Dimension. Die Distinktion erfolgt als eine doppelte und führt zu Dominanzverhältnissen sowohl gegenüber Frauen als auch gegenüber anderen Männern. Die Grenzziehung gegenüber den Frauen konstituiert grundlegende Gemeinsamkeiten bzw. Konjunktionen zwischen den Männern. Da aber nicht allen Männern gleichermaßen der Zutritt zu einer bestimmten homosozialen Gemeinschaft gewährt wird, vielmehr bestimmte (milieuspezifisch, ethnisch oder anderweitig definierte) Kategorien von Männern ausgeschlossen werden, kennzeichnen Distinktionen (in Gestalt von sozialer Schließung) auch die geschlechtlichen Binnenverhältnisse. Bourdieu sieht in den binnengeschlechtlichen, in den ernsten Spielen des Wettbewerbs erzeugten Distinktionen den zentralen Ort der Konstruktion des männlichen Habitus. Als dessen Grundlage bzw. generierendes Prinzip be greift er eine „libido dominandi", die das Handeln des Mannes sowohl gegenüber anderen Männern als auch gegenüber Frauen strukturiert. Damit meint er ein Bestreben, „die anderen Männer zu dominieren, und sekundär, als Instrument des symbolischen Kampfes, die Frauen" (Bourdieu 1997: 203). Mit dem aus der Psychoanalyse übernommenen Begriff der libido verbindet Bourdieu kein triebtheoretisches Verständnis des männlichen Habitus, sondern er nimmt an, dass die Ausbildung der libido dominandi das Resultat männlicher Sozialisation ist, in der „die Männer dazu erzogen werden, die gesellschaftlichen Spiele anzuerkennen, deren Einsatz irgendeine Form von Herrschaft ist" (Bourdieu 2005: 133). Erworben wird der männliche Habitus in den „ernsten Spiele des Wettbewerbs", den die (heranwachsenden) Männer unter sich austragen. Bourdieu streicht zwei miteinander verbundene Aspekte heraus: die kompetitive Struktur von Männlichkeit und den homosozialen Charakter der sozialen Felder, in denen der Wettbewerb stattfindet. Die Männer stehen einander als „Partner-Gegner" (Bourdieu 2005: 83) gegenüber. Der Wettbewerb trennt die Beteiligten nicht (oder nicht nur), er ist zugleich, in ein- und derselben Bewegung, ein Mittel männlicher Vergemeinschaftung. Wettbewerb und Solidarität gehören untrennbar zusammen (Meuser 2003a). Auch wenn nicht wenige homosoziale Männerwelten Eigenschaften eines „stahlharten Gehäuses" (Max Weber) aufweisen, fundieren sie habituelle Sicherheit. Die homosoziale Gemeinschaft versorgt die Männer mit „resour ces, skills, solidarity and power" (Gerson/Peiss 1985: 321). Genau dies geschieht auch im Risikohandeln. Mag das Risikohandeln mitunter unter starkem Gruppendruck erfolgen, so bekräftigt die Anerkennung, die ein Riskieren des eigenen Körpers hervorruft, den geschlechtlichen Status. Im pädagogischen Diskurs über männliches Risikohandeln wird dieses vielfach als Riskante Praktiken 169 Ausdruck einer essentiellen Unsicherheit hinsichtlich der geschlechtlichen Identität der männlichen Akteure interpretiert. Das Risikohandeln erscheint in dieser Sichtweise als ein kompensatorischer Akt angesichts einer fragilen Geschlechtsidentität, welche angesichts der gegenwärtigen „gender troubles" in besonderem Maße in Frage gestellt sei. 3 Eine „forcierte Männlichkeit" wird als „Mittel der Angstbewältigung" verstanden; sie gewinne „dort an Bedeutung, wo der Verlust traditioneller Männlichkeit besonders bedrohlich erlebt wird" (King 2004: 239, 241). Jon Swain (2003) beschreibt in einer ethnographischen Studie über die Rolle des Körpers bei der Konstruktion von Männlichkeit die häufigen Schlägereien unter männlichen Schülern als tägliche Verteidigung einer herausgeforderten Männlichkeit. Diese müsse immer wieder unter Beweis gestellt werden. Unsicher ist die Männlichkeit insofern, als sie den männlichen Jugendlichen nicht als unverbrüchlicher Besitz zu Eigen ist, sondern durch bestimmte Praktiken, zu denen Risikohandeln gehört, situativ hergestellt werden muss. Gleichwohl vermittelt die homosoziale Männergemeinschaft habituelle Sicherheit, indem sie keinen Zweifel lässt hinsichtlich der angemessenen Performanz einer anerkannten Männlichkeit. Es sind die ernsten Spiele des Wettbewerbs, in denen Männlichkeit sich formt, und die homosoziale Gemeinschaft sorgt dafür, dass die Spielregeln in das inkorporierte Geschlechtswissen der männlichen Akteure eingehen. --::: - Der historische Blick lehrt, dass eine in Gestalt von Risikohandeln forcierte Männlichkeit kein Spezifikum in Zeiten einer Transformation der Geschlechterordnung darstellt. Auch in der Epoche, die als die Blütezeit` der bürgerlichen Geschlechterordnung gelten kann, in der „gender troubles" noch unbekannt waren und die männliche Herrschaft noch ungebrochen und fraglos gegeben war, bestimmten riskante Praktiken und ernste Spiele des Wettbewerbs die Aneignung einer erwachsenen Männlichkeit. Studien zu der Institution des Duells oder zu den Beleidigungs-; Fecht- und Trinkritualen im studentischen Milieu bieten hier ein vielfältiges und einschlägiges Anschauungsmaterial (z.B. Elias 1989, 125ff, Frevert 1991, Objartel 1984). Die ernsten Spiele des Wettbewerbs fanden und finden in den unterschiedlichsten sozialen Feldern statt, und sie haben eine beträchtliche Breite von Ausdrucksformen. Sie reichen von Wortgefechten bis zu legalen und il legalen Gewaltauseinandersetzungen. Das sei anhand einiger Beispiele aus Peer-Kulturen verdeutlicht. In einer ethnographischen Studie über eine Gruppe adoleszenter türkischer Migranten der zweiten Einwanderungsgeneration, die Turkish Power Boys, beschreibt Hermann Tertilt (1996: 198f£), wie in ritualisierten Rede duellen unter den Gruppenmitgliedern auf spielerische Weise die männliche Ehre verteidigt wird. In diesen Duellen beleidigen sich die Akteure wechsel3 Die Fragilitäts-Kompensations-Annahme findet sich auch im pädagogischen Diskurs zu männlichem Gewalthandeln (Meuser 2002). 170 Michael Meuser seitig, aber diese Wortgefechte sind gewöhnlich kein Ausdruck von Feindseligkeiten. Die Rededuelle werden in Reimform ausgetragen, und jeder versucht, den anderen an verbaler Virtuosität zu überbieten. „Derjenige, der die Reimform nicht beherrschte oder dessen Antworten zu harmlos ausfielen, gerät in die Position des Schwächeren. Schlimmer aber noch als formale und inhaltliche Mängel in der Erwiderung waren Wiederholungen oder gar keine Antwort" (ebd.: 201). Homologe Formen verbalen Wettstreits finden sich auch in anderen männlich geprägten Jugendkulturen, z.B. in der HipHop-Szene in Gestalt des sog. dissen, des Zeigens von dis-respeet (Klein/Friedrich 2003: 38ff.). Das ist eine ritualisierte Form des Beschimpfens oder Beleidigens eines anderen HipHoppers, dem z.B. vorgeworfen wird, sein Stil sei ein Plagiat. „Dissen hat Wettbewerbscharakter: Wird jemand gedisst, dann reagiert dieser, indem er noch beleidigter zurückdisst. Eine Kette von Beschimpfungen ist vorprogrammiert: Dissen provoziert Streit und Dissen ist das Mittel, einen Streit auszutragen" (ebd.: 41). Wie bei den Turkish Power Boys ist der verbale Wettbewerb Teil des ritualisierten Verhaltensrepertoires. Er wird nicht gemieden, sondern eher gesucht. In vielen jugendlichen männlichen Subkulturen und Szenen sind gewaltförmige Auseinandersetzungen, in denen der eigene Körper zum Spieleinsatz wird, eine übliche Form der ernsten Spiele des Wettbewerbs. Je nach sozialem Kontext erfolgt das Gewalthandeln mehr oder minder ritualisiert. Eine hochgradig ritualisierte Form riskanten Körpereinsatzes ist das Mensurschlagen in schlagenden Verbindungen (Elias 1989: 1 25ff.). Weniger ritualisiert, obwohl keinesfalls ungeregelt, sind die Kämpfe unter Hooligans. In dem einen wie dem anderen Fall, bei der sozial konformen Variante des Gewalthandelns wie bei der devianten, geht es darum, seinen Mann zu stehen`. Und dies geschieht dadurch, dass man den eigenen Körper bzw. dessen Unversehrtheit riskiert, dass man standhält und den Kampf bis zum Ende durchsteht (Meuser 2003b). Den „Kick", den der Kampf bewirkt, gibt es nur, wenn die „Ehre" nicht zu kurz kommt. In den Worten eines Hooligans (Bohnsack u.a. 1995: 75): „Entweder er steht beim Fußball seinen Mann, (.) äh-mit mir zusammen; und rennt nich weg, oder er braucht halt nich mit hinfahren." Nach dem gleichen Muster verläuft das sog. , Kampftrinken`, das zu einer Vielzahl männlicher adoleszenter Kulturen gehört. Der Wettbewerb ist, so paradox das erscheinen mag, auch eine Ressource von Solidarität. Nicht selten vergemeinschaftet Gewalt diejenigen, die zunächst gegeneinander gekämpft haben. Aus Schlägereien können Freundschaftsbeziehungen entstehen (Matt 1999: 265). Elias (1989: 125ff) beschreibt die Welt der studentischen Verbindungen als ein kompetitives Leben mit hohem Konkurrenzdruck, dem es dennoch nicht an Kameradschaft und wechselseitiger Zuneigung fehlt. Zu den in diesem Milieu gängigen und verpflichtenden Trinkritualen notiert er: „man trank mit- und gegeneinander um Riskante Praktiken 171 die Wette" (ebd.: 132; Hervorh.: MM). Der gleichen Strukturlogik von Wettbewerb und Solidarität folgt das Ritual des Mensur-Schlagens. Der wechselseitig unternommene Versuch, den Anderen zu verletzen, stiftet Gemeinschaft. Auch dies vermag der historische Blick zu bekräftigen. Im Duell konstituierte sich „eine Art Freundschaftsbund [...1. Durch ein Duell`, hieß es im Jenaer - Comment von 1809, sind die Schlagenden näher miteinander verbunden und per se in Bruderschaft`, was durch Bruderkuß und Brüderschafts-Trinken bekräftigt wurde" (Frevert 1991: 141; vgl. auch Mosse 1997: 32£). Allen beispielhaft beschriebenen Formen des Wettbewerbs eignet eine gemeinsame Strukturlogik, welche auch das Risikohandeln aufweist. Anerkennung als Mann erwirbt man dadurch, dass man sich dem Wettbewerb mit Geschlechtsgenossen stellt, wenn nötig bis zum bitteren Ende`. Im Durchhalten reift der Jugendliche zum Mann. Darin ähneln die Wettbewerbsspiele unter Peers in der modernen Gesellschaft den Initiationsritualen in Stammeskulturen (Gilmore 1991). Zwar verläuft die geschlechtliche Initiation' in modernen Gesellschaften weniger institutionalisiert und weniger unter Anleitung erwachsener Männer (Friebertshäuser 1995), doch folgt auch die von den Peers selbst organisierte Aneignung einer erwachsenen Männlichkeit einer Logik, deren Regeln durch die Struktur dessen, was angeeignet wird, vorgegeben sind. Aus dieser Struktur bezieht die Selbstsozialisation ihre symbolischen Mittel. 4. Risikohandeln als Strukturübung Klaus Hurrelmann (2001: 115) begreift Risikohandeln als „Signal für eine objektiv problematische Ausgangskonstellation bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, ein Anzeichen für Schwierigkeiten in der normalen Entwicklung im Jugendalter." Vor dem Hintergrund der Ausführungen zur Strukturlogik des männlichen Geschlechtshabitus liegt eine andere Lesart nahe. Risikohandeln ist Teil der normalen Entwicklung männlicher Jugendlicher, es ist eine enm , icklungsphasentypische Form der ernsten Spiele des Wettbewerbs, mit der dessen Spielregeln angeeignet werden. Risikohandeln lässt sich im Bourdieu'schen Sinne als „Strukturübung" verstehen. Der Übungscharakter des Risikohandelns wird daraus ersichtlich, dass es gewöhnlich ein Phänomen ist, das mehr oder minder auf das Jugendalter begrenzt ist oder doch zumindest in späteren Lebensphasen nur noch in abge schwächter Form praktiziert wird. Die alten Herren` in den studentischen Verbindungen schlagen keine Mensuren mehr, die Hooligans beteiligen sich in der Regel nicht mehr aktiv an den Schlägereien, wenn sie in die Phase der 172 Michael Meuser Familiengründung eintreten, die kollektiven Alkoholexzesse werden seltener usw. Dass dem Risikohandeln die Eigenschaft des lebensphasentypisch Episodalen zukommt, sehen die Akteure in der Retrospektive selbst. Eine der von Bohnsack u.a. (1995: 73) untersuchten Hooligangruppe, deren „Phase der Randale" der Vergangenheit angehört, bezeichnet sich selbst als „Stinos", als „Stinknormale", und rechnet ihr vormaliges Gewalthandeln einer abgeschlossenen Entwicklungsphase zu, die freilich in positiver Erinnerung bleibt. Das Risikohandeln lässt sich als eine entwicklungsphasentypische Steigerung der Strukturlogik des männlichen Geschlechtshabitus begreifen. Gerade weil diese Logik gleichsam übertrieben in Szene gesetzt wird, fungiert das Risikohandeln als Strukturübung. Bohnsack und Nohl (2000) verstehen den fight der Hooligans und den battle der Breakdancer als typische Formen adoleszenter Efferveszenz, als kollektiv gesteigerte Suchprozesse nach habitueller Übereinstimmung. 4 In einer Studie zum kollektiven Aktionismus der HipHop-Szene beschreibt Liell (2003: 125) efferveszente Praktiken als „in besonderem Maße" geeignet, „kollektive Zugehörigkeit und habituelle Orientierungen zu schaffen, zu erproben und zu reproduzieren." Dass es sich um Strukturübungen handelt, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass der Wettbewerb vielfach über eine Ritualisierung von persönlichen Motiven entkoppelt ist. Dies ist beim „Kampftrinken" ebenso der Fall wie bei den zahlreichen Formen ritualisierter Gewalt, sei es in Gestalt des Mensurschlagens unter Verbindungsstudenten, sei es in Gestalt des Kampfes unter Hooligans. Einer der von Bohnsack u.a. (1995: 225) interviewten Hooligans bringt dies recht anschaulich zum Ausdruck: War wichtig is, is eigentlich dette, daß äh-daß wer hinfahren und uns dann eben treffen, det Drum-Herum, bißchen in der Kneipe sich amüsieren, Spaß haben, bißchen wat trinken und denn vor dem Spiel sich vielleicht n bißchen rumzuprügeln, wenn man eben die Leute da trifft, mit denen man sich rumprügeln kann, oder eben nach dem Spiel, wenn die Polizei nicht dazwischenfunkt`. Die Ritualisierung des Wettbewerbs scheint eine historische Konstante männlicher Strukturübungen zu sein. Für das studentische Milieu Mitte des 19. Jahrhunderts zeigt Georg Objartel (1984: 104), wie sich eine „Kunst des Beleidigens" ausbildet, die „unbeeinflusst von der Affektgeladenheit der Streitsituation in kühler Berechnung Beleidigungen austeilt oder übertrumpft". Eine ähnliche Virtuosität verbalen Wettstreits im Rahmen eines Der französische Begriff „effervescence" steht für Erregung, Aufbrausen, Gärung, Wallung. Emile Durkheim thematisiert in seiner Religionssoziologie mit dem Begriff der „kollektiven Efferveszenz" die gemeinschaftsbildende Kraft kollektiver Rituale, wie sie z.B. in Gestalt des Fests in fast allen Kulturen zu beobachten ist. „Innerhalb einer Ansammlung, die eine gemeinsame Leidenschaft erregt, haben wir Gefühle und sind zu Akten fähig, deren wir unfähig sind, wenn wir auf unsere Kräfte allein angewiesen sind" (Durkheim 1981: 289). Riskante Praktiken 173 vorstrukturierten und mithin erwartbaren Ablaufschemas findet sich, wie zuvor an den Beispielen der Turkish Power Boys und der Szene der HipHopper erläutert, auch in manchen männlichen Jugendsubkulturen der Gegenwart. Die Peer Group ist ein Konstruktionsort von Jugend und Geschlecht (Jösting 2005: 45). Das Risikohandeln männlicher Jugendlicher ist durch eine Konfiguration zweier sozialer Typiken gekennzeichnet. Der _ kompetitive Charakter dieses Handelns verweist auf dessen Geschlechtstvpik, die heranwachenden Männer erwerben ein inkorporiertes Wissen um die Logik der ernsten Spiele des Wettbewerbs, welche den männlichen Habitus prägen. Vor allem lernen sie, diese Spiele zu lieben. Darin, dass diese Spiele in einer gesteigerten und den eigenen Körper riskierenden Form ausgetragen werden, macht sich die Entwicklungstypik geltend. Auch wenn das Risikohandeln vielfach ernste Folgen für Leib und Leben nach sich zieht, ist es gleichsam ein (noch) spielerischer Umgang mit den ernsten Spielen des Wettbewerbs, hat es den skizzierten Übungscharakter. In der Übersteigerung wird gewissermaßen Jugendlichkeit her- und dargestellt. Eva Breitenbach (2001: 200ff.) schlägt vor, die in der Geschlechterforschung entwickelte konstruktivistische Betrachtungsweise für die Forschung zur Adoleszenz fruchtbar zu machen und doing gender und doing adolsecen ce als wechselseitig verschränkte Prozesse zu betrachten. Diesen Gedanken aufnehmend lässt sich das männliche Risikohandeln gleichermaßen als entwicklungsphasentypischer Modus des doing gender und als geschlechtstypischer Modus des doing adolescence begreifen. Die Adoleszer-,~z ist eine vorübergehende Lebensphase, der in dieser Phase erworbene Spielsinn` jedoch bleibt erhalten. 5. Sozialisationstheoretische Folgerungen Der hier für das Jugendalter beschriebene WettbewerbscharaL- ter homosozialer Interaktion unter Männern prägt nicht nur diese Lebensphasen. Er setzt sich fort, allerdings zumeist in Gestalt weniger riskanter Praktiken; und er beginnt auch nicht erst mit der Jugendzeit. Als Ergebnis einer Durchsicht der Forschungen zu Verhaltensdifferenzen zwischen Mädchen }und Jungen hält Eleanor Maccoby (1990) fest, dass das Spiel der Jungen szhon frühzeitig durch einen rauen Stil („rough-and-tumble play style") sowie durch eine Orientierung an Wettbewerb und Dominanz geprägt ist. Es erf rlgt in größeren Gruppen, nimmt mehr Raum ein als das der Mädchen und ist öfter im öffentlichen Raum situiert. Während das Verhalten der Mädchen st~irker kooperationsorientiert ist, weist das der Jungen mehr Kontrollorientierung und negative Reziprozität auf. Jungen haben in ihren Gruppen mehr CJlegenheiten zu lernen, wie man in hierarchischen Strukturen agiert. Sie greif`-en mehr zu Be- 174 Michael Meuser drohungen und setzen häufiger physische Kraft ein. Einen ähnlichen Befund ergibt ein von Gebauer (1997) vorgenommener Vergleich von Jungen- und Mädchenspielen. „Typische Jungenspiele haben eine deutlich erkennbare agonale Struktur", daran teilzunehmen „setzt die Bereitschaft zur Anerkennung der im Wettkampf etablierten Hierarchie voraus" (ebd. 1997: 276). Der raue und kompetitive Stil wird vor allem gepflegt, wenn Jungen von anderen Jungen und Männern beobachtet werden, also im homosozialen Kontext. Dieser Befund lässt sich dahingehend interpretieren, dass im homo sozialen Kontext ein potentiell breiteres Verhaltenspotential eingeschränkt wird. Die Strukturübung besteht darin, dass Kontingenzen vernichtet` werden - in Richtung der Strukturlogik hegemonialer Männlichkeit. Die Akteure, die diese Einschränkung betreiben, sind die Jungen und männlichen Jugendlichen selbst. Insofern handelt es sich hierbei um eine Form der Selbstsozialisation, als „interpretative Reproduktion von Kultur mittels kultureller Netzwerke von Peers" (Zinnecker 2000: 282). Der Begriff der Strukturübung fokussiert auf die aktiven Leistungen der Subjekte, begreift den Sozialisationsprozess allerdings als bestimmt durch die Strukturen, die angeeignet werden. Dies sind im vorliegenden themati schen Zusammenhang die Strukturen einer erwachsenen Männlichkeit, denen der Wettbewerb als generatives Prinzip zugrunde liegt (Meuser/Scholz 2005). Sozialisation besteht in diesem Verständnis in der Aneignung „einer spezifischen Position im sozialen Raum" (Krais/Gebauer 2002: 61). Die aktiven Leistungen der Subjekte sind im Sinne des Habituskonzepts zu verstehen. Dieses „gibt dem Akteur eine generierende und einigende, konstruierende und einteilende Macht zurück und erinnert zugleich daran, dass diese sozial geschaffene Fähigkeit, die soziale Wirklichkeit zu schaffen, nicht die eines transzendentalen Subjekts ist, sondern die eines sozial geschaffenen Körpers, der sozial geschaffene und im Verlauf einer räumlich und zeitlich situierten Erfahrung erworbene Gestaltungsprinzipien in die Praxis umsetzt` (Bourdieu 2001: 175). Strukturübungen sind ein Modus nichtbegrifflicher, vortheoretischer Aneignung der sozialen Welt, bei der deren Struktur- und Ordnungsprinzipien erworben und inkorporiert werden. Mit den Strukturübungen entsteht qua Teilnahme (hier an den ernsten Spielen des Wettbewerbs) „der praktische Glaube an das Feld" (Krais/Gebauer 2002: 62). Mit der Teilnahme erkennen die Akteure das Spiel selbst und dessen Regeln an, und sie lernen es, das Spiel zu lieben. In den Strukturübungen wird ein (feld-)spezifischer praktischer Sinn erworben. Helga Bilden (1991) kritisiert den in der Sozialisationsforschung geläufigen Begriff der „Aneignung", „weil er eine Eindeutigkeit des Anzueignenden voraussetzt (als wenn es da` etwas Festumrissenes gäbe, das ein Individuum sich zu Eigen` macht)". Eine solche Eindeutigkeit ist in dem Konzept der Strukturübung nicht impliziert. Angeeignet werden nicht spezifische Ge- Riskante Praktiken 175 schlechtsnormen, sondern die generativen Regeln der - allerdings ,angemessenen` -Herstellung sozialer Situationen. Bourdieus (1993: 104) Charakterisierung des Habitus als „Erfinderkunst` vermag zu verdeutlichen, wie die Angemessenheit zu verstehen ist. Es können „unendlich viele und (wie die jeweiligen Situationen) relativ unvorhersehbare Praktiken von dennoch begrenzter Verschiedenheit erzeugt werden". Mit Strukturübungen wird eine typische Form der Herstellung sozialer Situationen angeeignet, nicht aber ein spezifisches Norm- und Wertesystem. Mit Bezug auf seine ethnologischen Forschungen in der Kabylei führt Bourdieu (1979: 190) aus, dass das kabylische Kind soziale Praktiken wie Ehrenduelle und Riten dadurch lernt, dass es sie als „Produkt der systematischen Applikation einer kleinen Anzahl zusammenhängender praktischer Prinzipien" begreift und dass dieses Lernen die Gestalt einer Aneignung „eines generativen Prinzips von Praktiken [hat], die auf der gleichen Grundlage organisiert sind". Was, um auf den thematischen Fokus dieses Beitrags zurück zu kommen, Männlichkeit ausmacht, das variiert - zwar nicht von Individuum zu Individuum, wohl aber von sozialem Milieu zu sozialem Milieu, auch von Generation zu Generation; und es hat ethnische Konnotationen. Eine Begrenzung der Verschiedenheit erfolgt allerdings dadurch, dass die jeweilige milieu-, generationen-, ethnisch spezifische Männlichkeit in - wiederum nach Milieu-, Generationen- und ethnischer Zugehörigkeit unterschiedlich ausfallenden - ernsten Spielen des Wettbewerbs erworben wird. Bettina Dausien (1999: 224) bemerkt zum Konzept der geschlechtsspezifischen Sozialisation: Es werde „eher mit individuellen Erziehungs- und Entwicklungsprozessen assoziiert als mit Fragen von Macht und Herrschaft in einer patriarchalen Gesellschaft." Mit dem Begriff der Strukturübung sind beide Aspekte thematisiert: die individuelle Aneignung der Strukturlogik hegemonialer Männlichkeit und, da es um die Aneignung einer auf Distinktions- und Dominanzverhältnisse gründenden Struktur geht, die Reproduktion von Macht und Herrschaft. Auch darin, in dieser doppelten Perspektive, scheint mir, auch wenn Bourdieu keine Sozialisationstheorie vorgelegt hat, die Relevanz seiner Soziologie für die Sozialisationsforschung und -theorie zu liegen. Literatur Bauer, Ulrich (2002): Selbst- und/oder Fremdsozialisation: Zur Theoriedebatte in der Sozialisationsforschung. Eine Entgegnung auf Jürgen Zinnecker. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 22, S. 118-142. Bilden, Helga (1991): Geschlechtsspezifische Sozialisation. In: Hurrelmann, K./ Ulich, D. (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. 4. Aufl. Weinheim/Basel , S. 279-301. 176 Michael Meuser Böhnisch, Lothar/Winter, Reinhard (1993): Männliche Sozialisation. Bewältigungsprobleme männlicher Geschlechtsidentität im Lebenslauf. Weinheim/München. Bohnsack, Ralf/Loos, Peter/Schäffer, Burkhard/Städtler, Klaus/Wild, Bodo (1995): Die Suche nach Gemeinsamkeit und die Gewalt der Gruppe. Hooligans, Musikgruppen und andere Jugendcliquen. Opladen. Bohnsack, Ralf/Nohl, Arnd-Michael (2000): Events, Efferveszenz und Adoleszenz: „battle" - „fight" - „party". In: Gebhard, W./Hitzler, R./Pfadenhauer, M. (Hrsg.): Events. Soziologie des Außergewöhnlichen. Opladen, S. 77-93. Bourdieu, Pierre (1979): Entwurf einer Theorie der Praxis. Frankfurt am Main. Bourdieu, Pierre (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main. Bourdieu, Pierre (1993): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt am Main. Bourdieu, Pierre (1997): Die männliche Herrschaft. In: Dölling, I./Krais, B. (Hrsg.): Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis. Frankfurt am Main, S. 153-217. Bourdieu, Pierre (2001): Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Frankfurt am Main. Bourdieu, Pierre (2005): Die männliche Herrschaft. Frankfurt am Main. Breitenbach, Eva (2001): Sozialisation und Konstruktion von Geschlecht und Jugend. Empirischer Konstruktivismus und dokumentarische Methode. In: Bohnsack, R./Nentwig-Gesemann, I./Nohl, A.-M. (Hrsg.): Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Opladen, S. 165-178. Chodorow, Nancy (1985): Das Erbe der Mütter. München. Connell, R.W. (1987): Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge. Connell, R.W. (1995): Masculinities. Cambridge/Oxford. Dausien, Bettina (1999): „Geschlechtsspezifische Sozialisation" - Konstrukiv(istisch)e Ideen zu Karriere und Kritik eines Konzepts. In: Dies. u.a. (Hrsg.): Erkenntnisprojekt Geschlecht. Opladen, S. 216-246. Dubet, Frangois (1997): Die Logik der Jugendgewalt. Das Beispiel der französischen Vorstädte: In: Trotha, T. von (Hrsg.): Soziologie der Gewalt. Opladen/Wiesbaden, S. 220-234. Durkheim, Emile (1981): Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt am Main. Elias, Norbert (1989): Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main. Findeisen, Hans-Volkmar/Kersten, Joachim (1999): Der Kick und die Ehre. Vom Sinn jugendlicher Gewalt. München. Frevert, Ute (1991): Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft. München. Friebertshäuser, Barbara (1995) : Jugendsubkulturen - Orte der Suche nach einer weiblichen und männlichen Geschlechtsidentität. In: deutsche jugend 43, S. 180-189. Furstenberg, Frank F. (2000): The sociology of adolescence and youth in the 1990s: A critical commentary. In: Journal of Marriage and the Family 62, S. 896-910. Gebauer, Gunter (1997): Kinderspiele als Aufführungen von Geschlechtsunterschieden. In: Dölling, I./Krais, B. (Hrsg.): Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis. Frankfurt am Main, 5.259-284. Riskante Praktiken 177 Gerson, Judith M./Peiss, Kathy (1985): Boundaries, Negotiation, Consciousness: Reconceptualizing Gender Relations. In: Social Problems 32, S. 317-331. Gildemeister, Regine (1988): Geschlechtsspezifische Sozialisation. Neuere Beiträge und Perspektiven zur Entstehung des „weiblichen Sozialcharakters". In: Soziale Welt 39, S. 486-503. Gildemeister, Regine (1992): Die soziale Konstruktion von Geschlechtlichkeit. In: Ostner, 1./Lichtblau, K. (Hrsg.): Feministische Vernunftkritik. Ansätze und Traditionen. Frankfurt am Main/New York, S. 230-239. Gilmore, David D. (1991): Mythos Mann. Rollen, Rituale, Leitbilder. München. Gisler, Priska (1995): Liebliche Leiblichkeit: Frauen, Körper und Sport. In: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 21, S. 651-667. Hagemann-White, Carol (1984): Sozialisation: Weiblich -männlich? Opladen. Helfferich, Cornelia (1997): „Männlicher" Rauschgewinn und „weiblicher" Krankheitsgewinn? Geschlechtsgebundene Funktionalität von Problemverhalten und die Entwicklung geschlechtsbezogener Präventionsansätze. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 17, S. 148-161. Hurrelmann, Klaus (2001): Einführung in den Themenschwerpunkt „Risikoverhalten". In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 21, S. 115. Inhetveen, Katharina (1997).- Ritual, Spiel und Vergemeinschaftung bei Hardcorekonzerten. In: Trotha, T. von (Hrsg.): Soziologie der Gewalt. Opladen/Wiesbaden, S. 235-259. Jösting, Sabine (2005): Jungeenfreundschaften. Zur Konstruktion von Männlichkeit in der Adoleszenz. Wiesbaden. King, Vera (2004): Die Entstehung des Neuen in der Adoleszenz. Individuation, Generativität und Geschlecht in modernisierten Gesellschaften. Wiesbaden. Klein, Gabriele/Friedrich, Malte (2003): Is this real? Die Kultur des HipHop. Frankfurt am Main. Kolip, Petra (1997): Geschlechtlichkeit im Jugendalter - oder: Der blinde Fleck der Jugendgesundheitsforschung. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 17, S. 135-147. Krais, Beate/Gebauer, Gunter (2002): Habitus. Bielefeld. Liebau, Eckart (1992): Habitus, Lebenslage und Geschlecht - Über Sozioanalyse und Geschlechtersozialisation. In: Tillmann, K.-J. (Hrsg.): Jugend weiblich - Jugend männlich. Sozialisation, Geschlecht, Identität. Opladen, S. 134-148. Liebau, Eckart (1993): Vermittlung und Vermitteltheit. Überlegungen zu einer praxeologischen Pädagogik.. In: Gebauer, G./Wulf, Ch. (Hrsg.): Praxis und Ästhetik. Nette Perspektiven im Denken Pierre Bourdieus. Frankfurt am Main, S. 251-269. Liell, Christoph (2003): Jugend, Gewalt und Musik. Praktiken der Efferveszenz in der HipHop-Szene. In: Luigi, U./Seebode, J. (Hrsg.): Ethnologie der Jugend. Soziale Praxis, moralische Diskurse und inszenierte Körperlichkeit. Münster, 5.123-153. Maccoby, Eleanor E. (1990)_ Gender and relationships. A developmental aceount. In: American Psychologist -45, S. 513-520. Maihofer, Andrea (2002): Geschlecht und Sozialisation. In: Erwägen, Wissen, Ethik 13, 1, S. 13-26. Matt, E. (1999): Jugend, Männlichkeit und Delinquenz. Junge Männer zwischen Männlichkeitsritualen Find Autonomiebestrebungen. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 19, S. 259-276. 178 Michael Meuser Messner, Michael (1990): Boyhood, Organized Sports, and the Construction of Masculinities. In: Journal of Contemporaty Ethnography, 18, S. 416=444. Meuser, Michael (2002): „boing Masculinity" - Zur Geschlechtslogik männlichen Gewalthandelns. In: Dackweiler, R.-M./Schäfer, R. (Hrsg.): Gewaltverhältnisse. Feministische Perspektiven auf Geschlecht und Gewalt. Frankfurt am Main/New York, S. 53-78. Meuser, Michael (2003a): Wettbewerb und Solidarität. Zur Konstruktion von Männlichkeit in Männergemeinschaften. In: Arx, S. u.a. (Hrsg.): Koordinaten der Männlichkeit. Orientierungsversuche. Tübingen, S. 83-98. Meuser, Michael (2003b): Gewalt, Körperlichkeit, Geschlechtlichkeit. Überlegungen zur gewaltförmigen Konstruktion von Männlichkeit. In: Kriminologisches Journal 35, S. 175-188. Meuser, Michael (2005): Strukturübungen. Peer Groups, Risikohandeln und die Aneignung des männlichen Geschlechtshabitus. In: Flaake, K./King, V. (Hrsg.): Männliche Adoleszenz. Sozialisation und Bildungsprozesse zwischen Kindheit und Erwachsensein. Frankfurt am Main/New York. Meuser, Michael/Scholz, Sylka (2005): Hegemoniale Männlichkeit - Versuch einer Begriffsklärung aus soziologischer Perspektive. In: Dinges, M. (Hrsg.): Männer Macht - Körper. Hegemoniale Männlichkeiten vom Mittelalter bis heute. Frankfurt am Main/New York, S. 211-228. Mosse, George L. (1997): Das Bild des Mannes. Zur Konstruktion der modernen Männlichkeit. Frankfurt am Main. Objartel, Georg (1984): Die Kunst des Beleidigens. Materialien und Überlegungen zu einem historischen Interaktionsmuster. In: Cherubim, D./Henne, H./Rehbock, H. (Hrsg.): Gespräche zwischen Literatur und Alltag. Beiträge zur germanistischen Gesprächsführung. Tübingen, S. 94-122. Rose, Lotte (1992): Körper ohne Raum. Zur Vernachlässigung weiblicher Bewegungs- und Sportwelten ih der feministischen Körper-Debatte. In: Feministische Studien 10, 1, S. 113-120. Swain, Jon (2003): How young schoolboys become somebody: The role of the body in the construction of masculinity. In: British Journal of Soziology of Education 24, S. 299-314. Tertilt, Hermann (1996): Turkish Power Boys. Ethnographie einer Jugendbande. Frankfurt am Main. Villa, Paula-Irene (2000): Sexy Bodies. Eine soziologische Reise durch den Geschlechterkörper. Opladen. Zinnecker, Jürgen (2000): Selbstsozialisation - Essay über ein aktuelles Konzept. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 20, S. 272-290.