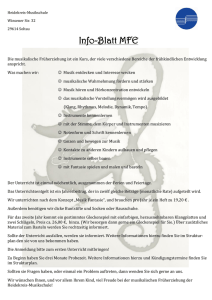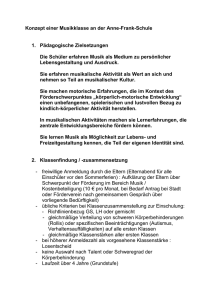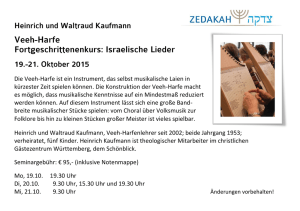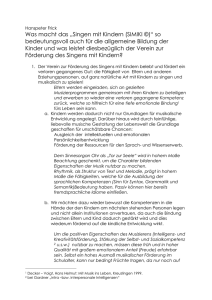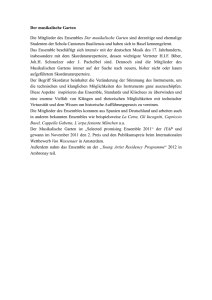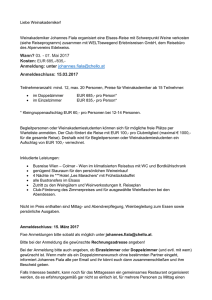Versuch einer Semiotik des Phänomens „Musik“
Werbung

Erwin Fiala Erwin Fiala Versuch einer semiotischen Musik-Aisthesis „Denn solange symbolische Formen nicht bewusst abstrahiert werden, werden sie regelmäßig mit dem, was sie symbolisieren, verwechselt.“ (S. K. Langer) Die Musiktheorie als ein Modell der Medientheorie zu initiieren bzw. zu konzipieren erscheint provokativ … und in mehrfacher Hinsicht interessant. Tatsächlich scheint „Musik“ innerhalb ausformulierter Medientheorien eher ein blinder Fleck zu sein – bzw. nach einfachen klassischen Strickmustern „erledigt“ zu werden. Musiktheorie scheint weitgehend einem „mythischen Bewusstseinsstand“ zu entsprechen – weil musikalische Formen im praktischen wie theoretischen Verständnis meist mit ihren „Inhalten“ verwechselt werden (z. B. in der Form „Musik als Ausdruck oder Darstellung von Gefühlen“). In Anlehnung an Cassirers Symboltheorie formuliert S. K. Langer hinsichtlich einer semiotischen Analyse der Musik, dass dies eben für das mythische Bewusstsein typisch sei, „(so) dass sein Inhalt nicht deutlich in Symbol und Gegenstand geschieden ist“. (S. K. Langer, Philosophie auf neuem Wege, S. 240.) Diese vielleicht befremdlich anmutende Diagnose ist ernst zu nehmen, wenn man sie mit der aktuellen Bildtheorie vergleicht – denn hier zeigt gerade die heutige Analyse hinsichtlich der Begriffe von Abbild und Simulation, wie zentral die Fähigkeit der expliziten Differenzierung von Simulation und Simuliertem ist. (Das Wesen der Simulation ist es ja, zu verbergen, dass sie simuliert, also die Suggestion einer Indifferenz!) Der bildtheoretische Begriff der „ikonischen Differenz“ verweist darauf, dass es ein Bildbewusstsein geben muss, um ein Bild als Bild und nicht als das Dargestellte identifizieren zu können – dies gilt umso mehr, je „realistischer“ (visuelle) Darstellungen bzw. Simulationen sind. Dem entsprechend müsste also eine semiotische Musikanalyse zunächst einmal das musikalische Zeichen (Symbol) „herausschälen“, indem man es von allen „Bedeutungen“ emotionaler, affektiver oder kognitiver Art abstrahiert, um schließlich eine fundamentale Ebene der „Wirkungsweise“ musikalischer Elemente zu definieren. 1 Erwin Fiala Grundlagen semiotischer Systeme Musik ist ein semiotisches System auf akustischer (auditiver) Wahrnehmungsebene mit einem spezifischen Code (analog zu Sprachen, Schriften, visuellen grafischen Formen (abstrakte und konkrete Bildformen), Mathematik etc.) Jedes semiotische System basiert auf einem grundlegenden Funktionsmechanismus, der eine materielle Entität (z. B. einen musikalischen Ton, ein Laut, ein Buchstabe etc.) erst zu einem „Zeichen“ macht, wobei zu beachten ist, dass nichts an sich ein Zeichen ist sondern dass etwas nur dadurch zu einem Zeichenphänomen wird, indem es von einem Zeichenbenutzer als Zeichen verwendet wird. D. h. ein Ton wird nur dadurch zu einem „musikalischen“ Zeichen (im Unterschied etwa zu einem bloß nichts bedeutenden akustischen Geräusch), indem es von jemandem als musikalisches Zeichen gedeutet wird. Im allgemeinen Sinne wäre dies die sog. „semiotische Kompetenz“, im speziellen die „musikalische Kompetenz“. Etwas als ein Zeichen zu definieren (bzw. zu verstehen) impliziert eine fundamentale Differenzierung in a) eine Signifikantenebene, die durch den Code der Kombinationsregeln zwischen Signifikanten bestimmt ist (syntagmatische Gliederung), und b) eine Signifikatsebene, die den Code der Verknüpfungsregeln zwischen der Signifikanten- und Signifikatsebene induziert (und somit definiert, welche Bedeutungen, Inhalte etc. aufgrund welcher Regeln den Signifikanten zugeordnet werden). Um auf die elementare Ebene semiotischer Systeme zu gelangen, muss die semantische Ebene ausgeblendet werden, da man sich hier immer a priori mit der Frage „herumschlägt“, was etwas „bedeutet“ – damit bewegt man sich in der Sphäre von kulturell-psychologischen Sinnzuschreibungen, die hermeneutisch unendlich sind (hermeneutische Interpretationsspirale). Semiotik darf keinesfalls mit einer Art „Bedeutungslehre“ missverstanden werden! Nur eine strikte Reduktion auf die Signifikantenebene ermöglicht die Ausblendung der inhaltlich vordeterminierten Analyseansätze traditioneller Musikästhetik, Kunsttheorien etc. 2 Erwin Fiala Semiotische Prinzipien: a) Einem Signifikanten kommt an sich bzw. a priori keinerlei semantische Dimension zu, es gilt das Prinzip einer grundlegenden semantischen Offenheit (maximale Polysemie bzw. Ambiguität, die sich im Binärsystem in extremis zeigt.) b) Diese semantische Offenheit ist umso größer, je „abstrakter“ ein einzelner Signifikant ist (nach dem semiotischen Prinzip von Langer: „Je karger ein Symbol, umso größer seine semantische Kraft.“) c) Der „Wert“ eines Signifikanten (eines Tones, eines Intervalls etc.) besteht nur darin, dass er nicht das ist, was andere Signifikanten sind. Der Wert und die Funktion ergeben sich also als (Differenz-)Relation! (Der „Wert“ eines Tones ergibt sich nur aus der Relation zu anderen Tönen – „Wert“ ist ein Differenzphänomen.) Damit ist es möglich, „musikalische“ Signifikantenketten prinzipiell als semantisch völlig offene Systeme zu sehen, d. h. zunächst ohne jegliche emotive, affektive oder kognitive „Bedeutung“! Der Signifikant: Materialität und Form Das „Wesen“ akustischer (bzw. aller möglichen) Signifikanten besteht primär darin, eine materiale und formale Dimension auf rein abstrakter Ebene zu besitzen, woraus sich eine Relations- und Funktionslogik ergibt – ähnlich einem rein formalen mathematischen System, das durch Operatoren eine Kombinationslogik entfaltet. (Vergleichen könnte man dies mit den Lautgedichten der Konkreten Poesie, die die sprachlichen Signifikanten sowohl auf phonetisch-akustischer Ebene wie auch auf jener der grafischen Notation von jeder Bedeutungsebene loslöst, um mit reinen Laut- und Buchstaben-Signifikanten neue phonetische und grafische Kombinationen zu entwickeln. Semiotisch formuliert heißt dies, dass der Signifikant sich selbst zum Signifikat hat bzw. auf sich selbst zurückvereist (entspricht dem Typus des selbstreferentiellen Zeichens von Morris). Derart werden reine Materialqualitäten bzw. die Regeln der formalen Codes thematisierbar, ein Prozess, den ja auch die Musikentwicklung (ebenso wie die abstrakte Malerei) vollzogen hat. 3 Erwin Fiala Es ist jetzt einsehbar, dass alle semiotischen Systeme – von der Sprache über Bilder bis hin zur Musik – im Grunde auf einem semantisch offenen (neutralen) System einer Signifikantenordnung beruhen. (Dies ist ja auch die implizite Aussage des Prinzips der Arbitrarität in der Beziehung zwischen Signifikant und Bedeutungszuordnung, wie sie Saussure auf der Ebene der Sprache postulierte! Bis heute hat sich dieses Prinzip aber in der Bildtheorie bzw. Theorie der Ikonizität oft nicht durchgesetzt.) Dem entsprechend sind musikalische Elemente (Signifikanten) zunächst grundsätzlich als arbiträr gegenüber bestimmten „Bedeutungszuschreibungen“ zu konzipieren. Musik ist kognitiv (bedeutungsrepräsentativ) „schwach“ codiert Während auf der Grundlage dieser prinzipiellen semantischen Offenheit die Sprache (bedeutungsrepräsentativ) und der visuelle Graphismus (als „Bild“ bzw. Ikon wahrnehmungsrepräsentativ) ihrer Funktionalität als Kommunikationsmedien gemäß dem Prinzip der „Eindeutigkeit“ (der inhaltlichen Konkretisierung und Disambiguisierung) unterliegen, d. h. auf größtmögliche semantische „Klarheit“ hin ausgerichtet sind, bleiben musikalische Codes in ihrer repräsentativen (inhaltlich bedeutenden) Funktion „schwach“ codiert (um mit Eco zu reden), d. h. den musikalischen Kombinationsvarianten ist keine feste bzw. eindeutige semantische (vor allem „begriffliche“) Dimension zugeordnet. (Empfindungen von Harmonie, Traurigkeit etc. sind kulturelle (und kulturrelative), uneindeutige und damit schwache Codierungen der Bedeutungszuschreibung im Vergleich zu Bedeutungszuschreibungen zwischen einem Wort und seiner Bedeutung!) Mimetischikonische Elemente (Nachahmungen auf akustischer Ebene), die es ja auch in der Musik gibt, folgen hingegen einer festen repräsentativen Zuordnung zu Wahrnehmungsphänomenen. Als Veranschaulichung sei auf das Beispiel der Entwicklungslogik der abstrakten Malerei verwiesen: Die starke und eindeutige Codierung der gegenständlichen Malerei (wahrnehmungsrepräsentativ) wurde durch die Abstraktion zunehmend aufgelöst. Die abstraktiven Bildformen zeigten sich vor allem für das Publikum als semantisch schwach codiert bzw. semantisch vollkommen offen – man wusste nicht, „was“ die Bilder „darstellen“, der neue Zuordnungscode zwischen den bildlichen Signifikanten und den „Bedeutungen“ musste neu gelernt werden. 4 Erwin Fiala Musik ist körperlich-sinnlich stark codiert Im Gegensatz zur schwachen (und primär historisch-kulturellen) Codierung auf der abstrakten semantischen Bedeutungsebene zeichnet sich der akustisch-musikalische Code aber durch eine starke Codierung auf korporaler Ebene aus. Die grundlegenden Elemente des Rhythmus, der Spannung und Entspannung, der Tonhöhen und Tonintensitäten etc., die z. B. die gesprochene Sprache weitgehend unterdrückt, sind eben tatsächlich sinnliche, d. h. primär „aisthetische“ Qualitäten (mit weniger kulturellem „Überbau“). Der musikalische Elementar-Code rekurriert in diesem Sinne stark auf automatisierte korporale Funktionen als deren musikalische „Bedeutung“, die kaum reflexiv und kognitiv „gefiltert“ sind und die als grundlegende musikalische Elemente deshalb auch kaum reflektiert werden bzw. in elaborierten Ästhetiken, die sich an Begriffskonstruktionen der „Schönheit“ bzw. Harmonie (auch im emotionalen Sinne) orientieren, meist schnell übergangen werden. Außerdem zeigt sich: Je elementarer diese musikalischen Signifikanten sind, umso abstrakter erscheinen sie, so dass die vollkommen automatisierten, vegetativen körperlichen Formen mit den abstraktesten musikalischen identisch sind (z. B. in Form der rhythmischen Ordnung, die schließlich auch zur Grundlage der Zeitabstraktion wird!). Umgekehrt heißt dies: die abstraktesten musikalischen Elemente sind auch die sinnlich elementarsten! Vom Sinn der Musik zur sinnlichen Musik Zusätzlich kann das Medium des „Schalls“ unmittelbar immersiv auf den Körper wirken und diese Immersion ist auch unmittelbar spürbar, d. h. auf akustische Phänomene reagiert man ab einer gewissen Intensität sehr stark körperlich – sie bringen den Körper zum Zittern – Trommel- und Zwerchfell reagieren mit Eigen-Schwingung auf die Schwingungen des Schalls. Akustik ist im Grunde ja ein zutiefst synästhetisches, motorisch-kinästhetisch-taktiles Phänomen, d. h. ein Prozess der Bewegungs-, Muskel und Tastwahrnehmung – deshalb setzt sich die musikalische Ästhesie auch unmittelbar in körperliche Bewegung (von der muskulären Kontraktion bis hin zur tänzerischen Geste) um. Die elementare musikalische Signifikantenebene ist primär korporal-aisthetisch codiert und nicht auf eine imaginäre „Bedeutung“ hin orientiert (diese ist immer eine kulturelle 5 Erwin Fiala semantische „Aufladung“), d. h. Töne werden primär empfunden (taktil gespürt) – sie „bedeuten“ keine Empfindung, sie sind auch nicht die Empfindung selbst, denn der Ton ist etwas anderes als die Empfindung bzw. die kinästhetisch-taktile Reaktion auf den Ton. Auf dieser Ebene ist Musik tatsächlich so etwas wie ein „hedonisches“ Phänomen, weil die musikalischen Elemente auf eine weitgehend sinnlich definierte Aisthesis wirken (Musik als Modell einer aisthesis materialis!). Das musikalische System – vor allem auf der elementaren Signifikantenebene – zielt auf ein unmittelbares Reiz-Reaktions-Schema auf korporaler Ebene ab und nicht auf „Sinnvermittlung“. Kulturtheoretisch gesehen fungiert hier der musikalische Code als „Bewusstseinsentlastung“ – aber dass er in der Musikentwicklung des 20. Jahrhunderts (über Schönbergs 12-Ton-Musik, Jazz, Blues, experimentelle Musik, Rock bis Techno) diese Funktion entwickelt, ist kulturell codiert bzw. verursacht. Dies entspricht der paradoxen „Wiederkehr des Körpers“ im Zeitalter des „Verschwindens des Körpers“ in Form einer digital-synthetischen Kombinatorik elementarer musikalischer Signifikanten. Das semiotische System „Musik“ geht im Zeitalter digitaler Technisierung (wie alle audiovisuellen Medien) den Weg „vom Sinn zu den Sinnen“ (J. Hörisch). 6