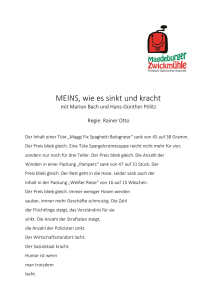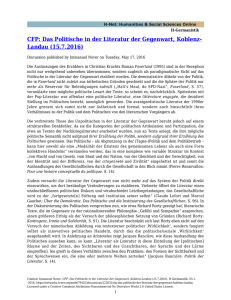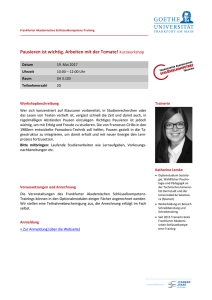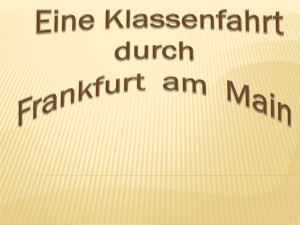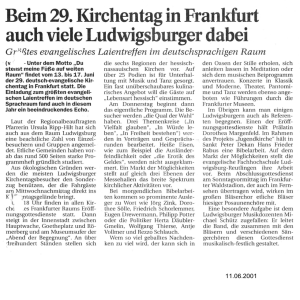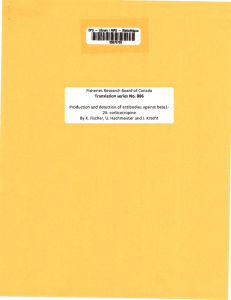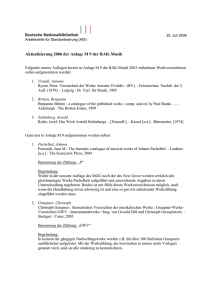Leseprobe - Aisthesis Verlag
Werbung

Leseprobe Matthias N. Lorenz (Hg.) Christian Kracht Werkverzeichnis und kommentierte Bibliografie der Forschung AISTHESIS VERLAG Bielefeld 2014 Abbildung auf dem Umschlag: Christian Kracht. © 2014 Frauke Finsterwalder. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Aisthesis Verlag Bielefeld 2014 Postfach 10 04 27, D-33504 Bielefeld Satz: Germano Wallmann, www.geisterwort.de Druck: docupoint GmbH, Magdeburg Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-8498-1062-7 www.aisthesis.de Inhaltsverzeichnis Matthias N. Lorenz „Schreiben ist dubioser als Schädel auskochen“. Eine Berner Bibliografie zum Werk Christian Krachts ....................... 7 * Teil 1: Werkverzeichnis ................................................................................... 1.1 Selbständige Veröffentlichungen ............................................. 1.2 Herausgeberschaft ...................................................................... 1.3 Facebook ....................................................................................... 1.4 Unselbständige Veröffentlichungen ........................................ 1.4.1In Tempo (1991-1995) .................................................... 1.4.2In Schlagloch resp. ruprecht (1991/1992) ................... 1.4.3In Der Spiegel (1994-1998) ........................................... 1.4.4 In Welt am Sonntag (1999/2000) ................................ 1.4.5In Der Freund (2004-2006) .......................................... 1.4.6In Frankfurter Allgemeine Zeitung und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (2002-2007) .................. 1.4.7Die F.A.Z.-Kolumne (2006/2007) ............................. 1.4.8 Verstreute Veröffentlichungen ...................................... 1.5 Film ................................................................................................ 1.6 Aufnahmen .................................................................................. 1.7 Interviews .................................................................................... 1.7.1 Interviews (Print/Online) .............................................. 1.7.2 Interviews (Sendungen) .................................................. 1.7.3 Sendungen und Interviews über Christian Kracht .... 21 21 42 43 43 43 47 47 49 49 Teil 2: Bibliografie der Forschung ................................................................ 2013 ........................................................................................................ 2012 ........................................................................................................ 2011 ........................................................................................................ 2010 ........................................................................................................ 2009 ........................................................................................................ 61 61 63 66 69 71 52 53 54 55 55 56 56 58 59 ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ 74 76 77 79 79 81 82 83 83 Teil 3: Kommentare ........................................................................................ 2013 ........................................................................................................ 2012 ........................................................................................................ 2011 ........................................................................................................ 2010 ........................................................................................................ 2009 ........................................................................................................ 2008 ........................................................................................................ 2007 ........................................................................................................ 2006 ........................................................................................................ 2005 ........................................................................................................ 2004 ........................................................................................................ 2003 ........................................................................................................ 2002 ........................................................................................................ 2001 ........................................................................................................ 1996 ........................................................................................................ 85 85 102 128 155 170 202 214 227 237 242 254 261 265 269 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1996 * Die Autorinnen und Autoren ........................................................................ 271 Schlagwortregister ........................................................................................... 273 Personen- und Werkregister .......................................................................... 282 Matthias N. Lorenz „Schreiben ist dubioser als Schädel auskochen“ Eine Berner Bibliografie zum Werk Christian Krachts „Was will Christian Kracht?“1 So fragt die literarische Öffentlichkeit nicht erst seit Georg Diez’ Spiegel-Verriss von Imperium (2012), jener SüdseePhantasie, die nicht nur die Verschachtelung der Erzählebenen, das intertextuelle und intermediale Spiel und die Ironisierung der Ironie auf die Spitze treibt2, sondern auch das Kracht’sche Motiv der Anthropophagie. Schreiben sei dubioser als Schädel auskochen – dieses Ressentiment einer Romanfigur seines Schweizer Schriftstellerkollegen Arno Camenisch3 kennzeichnet auch eine verbreitete Rezeptionshaltung, die mit dem unauflösbaren Gewebe von Literatur und Autorfigur im Falle Krachts nicht zurechtkommt. Die Selbstinszenierung des Schriftstellers als Teil seines Werkes und seine daraus resultierende Fiktionalisierung, aber auch kulturpolitische Entmachtung, hat ganz offensichtlich nicht wenige Rezensenten im deutschen Sprachraum verstört. Viele professionelle Leserinnen und Leser versuchten, den neuen Ton, den Faserland 1995 in die Gegenwartsliteratur einbrachte, und das 1 2 3 Georg Diez: Die Methode Kracht, in: Der Spiegel 66 (2012), H. 7, S. 100-103, hier: S. 100. Vgl. hierzu Johannes Birgfeld: Südseephantasien. Christian Krachts „Imperium“ und sein Beitrag zur Poetik des deutschsprachigen Romans der Gegenwart, in: Wirkendes Wort 62 (2012), H. 3, S. 457-477; Ralph Pordzik: Wenn die Ironie wild wird, oder: lesen lernen. Strukturen parasitärer Ironie in Christian Krachts „Imperium“, in: Zeitschrift für Germanistik 23 (2013), H. 3, S. 547-591. Das Titelzitat findet sich bei Arno Camenisch: Ustrinkata, Solothurn: Engeler 2012, S. 24. 8 Matthias N. Lorenz unkonventionelle Auftreten des Autors damit zu bannen, dass sie ihn alsbald der zweiten Generation der deutschen Popliteratur eines Benjamin von Stuckrad-Barre, eines Florian Illies oder einer Alexa Hennig von Lange zuschlugen. Die popliterarische Fixierung lieferte dann in einem Zirkelschluss auch gleich die Erklärung mit, warum dieses Buch sich trotz der zahlreichen Verrisse so gut verkaufte: Popliteratur, zumindest die neue, das war doch mehr Pose als Poesie, etwas für junge Leute ohne Kanonbildung und -interesse, die daher mit leichter Kost und ein paar modischen Markennamen abzuspeisen waren. So ließ sich mit diesem Debütanten leben, seine schnöselhafte Jungenhaftigkeit ertragen und sein auch kommerziell nicht unbeträchtlicher Erfolg erklären – ähnlich wie übrigens auch die Herausforderung eines Bret Easton Ellis domestiziert wurde, dessen American Psycho bis heute nicht als einer der wichtigsten Romane des ausgehenden 20. Jahrhunderts erkannt worden ist und nur selten adäquat hinsichtlich seiner Subtilitäten gelesen wird.4 Neben anderen vermeintlich jugendlichen Äußerungsformen wie Graffiti und Hiphop durfte dann auch Faserland existieren, sozusagen im Ghetto des Jugendzentrums. Dass Faserland 2013 zur Pflichtlektüre an niedersächsischen Gymnasien erhoben wurde, weil der Roman konsequent „der Vorstellungswelt heutiger Jugend- und Alltagskultur“5 entspreche und daher „für junge Erwachsene motivierend und in besonderer Weise geeignet [sei], das spezifisch literarische Lernen zu initiieren“6, ist eine sehr späte Nachwehe dieses fundamentalen Missverständnisses. Vgl. zu den Fehllektüren von American Psycho als Skandal- und Poproman („der wohl schlimmste Hohn, der einem Buch nachträglich widerfahren kann: Dass es die Leser permanent falsch verstehen“) z.B. Constanze Alt: Zeitdiagnosen im Roman der Gegenwart. Bret Easton Ellis’ „American Psycho“, Michel Houellebecqs „Elementarteilchen“ und die deutsche Gegenwartsliteratur, Berlin: trafo 2009, S. 71-81, hier: S. 81. 5 Reinhard Wilczek: Faszinierende Schullektüre im Spannungsfeld von Tradition, Adaption und Transformation. Ein praxisorientierter Lösungsvorschlag zur Beilegung des ungelösten Kanonkonflikts in Deutschland, in: Peter Bekes und Reinhard Wilczek (Hrsg.): Literatur im Unterricht. Texte der Moderne und Postmoderne in der Schule (3/2003), Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier 2004, S. 213–221, hier: S. 218. 6 Cornelsen Verlag: Krachts „Faserland“ als Adoleszenzroman. Leselust, Lesekompetenz und Gewinn von Selbst- und Weltverständnis im Spielfeld der Literatur, in: Deutsch Extra. Das Magazin für den Deutschunterricht (2012), H. 1, S. 1-5, hier: S. 1. 4 „Schreiben ist dubioser als Schädel auskochen“ 9 Das Schicksal andauernder Verkennung seiner Talente blieb Christian Kracht im Gegensatz zu Ellis erspart. Als 2001 mit 1979 der zweite Roman vorlag, wurde jener darüber in die Literatur, über die sich zu sprechen lohne, integriert, dass man ihm das verniedlichende Label der Popliteratur flugs wieder entzog. Seither halten sich Krachts Werke, vor allem die bislang vier Romane, aber auch Bild-, Gesprächs- und Briefbände, Reiseminiaturen und Zeitungskolumnen, hartnäckig im literarischen Gespräch, was sie für den Kanon zumindest der Gegenwartsliteratur unübergehbar macht und ihrem Autor höchste mediale Aufmerksamkeit beschert. Die Autorfigur ‚Christian Kracht‘ stört jedoch weiterhin planmäßig und ohne Ausnahme jene Ordnung, die den deutschsprachigen Literaturbetrieb dominiert, nämlich die unausgesprochene Annahme, dass Autorperson, Erzähler und Werk gleichgestimmt für etwas einzustehen hätten, dass die Person das literarische Projekt beglaubigt und umgekehrt das kulturelle Kapital zur politischen Intervention eingesetzt wird. Der exemplarische Vertreter schlechthin eines Schriftstellertypus, der diese Erwartung des Marktes erfüllt und für sich und andere auch so formuliert, ist Nobelpreisträger Günter Grass. Es darf hier mit Fug und Recht behauptet werden: Christian Kracht ist alles, was Günter Grass nicht ist – oder genauer: Christian Kracht will vermutlich alles sein, nur nicht (so wie) Günter Grass. Und so suspendiert er jede Verantwortlichkeit des engagierten Intellektuellen, wenn er, anstatt wie Grass Waffenlieferungen in den Nahen Osten anzuprangern, behauptet, er wolle die Falklandinseln für Argentinien zurückerobern.7 Das sich Entziehen, nicht elitär à la Peter Handke, sondern über die Fiktionalisierung der eigenen Person, als ein ‚Christian Kracht‘ in einfachen Anführungszeichen, ist eine Strategie, sich den Medien zu verweigern. Seine Autorfigur kommuniziert asymmetrisch, durch ihre Posen ist sie nie fassbar und kann sich stets darüber entziehen, dass ja alles augenzwinkernd gebrochen, zitiert und so nicht gemeint war. Wer ihr in seiner Funktion als Literaturkritiker oder -wissenschaftler begegnet, ist somit von vornherein chancenlos unterlegen, weil ihm durch seine eigene Verortung innerhalb 7 Im Interview mit Denis Scheck, in: Druckfrisch/ARD 02.11.2008. – Vgl. zu Grass’ Israel-Gedicht Jan Süselbeck: Was geantwortet werden muss. Wie Günter Grass sein Gedicht „Was gesagt werden muss“ bereits 1990 in seiner Frankfurter Poetikvorlesung ankündigte – mit einem Exkurs zu seiner Novelle „Im Krebsgang“ (2002), in: literaturkritik.de (2012), H. 5 (online: http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16633) [Abruf am 12.03.2014]. 10 Matthias N. Lorenz professionalisierter Systeme verantwortlichen Sprechens diese Ausweichbewegung nicht zu Verfügung steht. Hinter dieser Strategie, die je nach Betrachtungsweise großen Anteil an der Faszination oder dem Ärgernis Christian Kracht hat, steht jedoch ein radikal anderes Autorbild als das der Gruppe 47, deren Vertreter stets meinten, quasi mit dem eigenen Körper für ihre politische Poetik eintreten zu müssen. Die Fälle erschwindelter Wunschbiografien nicht nur von Grass, Jens oder Andersch sollten auch den Kritikern der Kracht’schen Taktik zu denken geben, denn zumindest in dieser Hinsicht ist ja das 47er-Modell glorios gescheitert.8 Obwohl das Buch im 20. Jahrhundert längst nicht mehr beanspruchen konnte, das Leitmedium zu sein, gerierten sich prominente 47er immer noch so und wollten als Schriftstellerintellektuelle ihren Landsleuten die Leviten lesen. Kracht weiß offensichtlich um die Inszeniertheit solcher Rollenspiele und er stellt die Lächerlichkeit, in der sie allermindestens nach 1968 erscheinen, bloß, indem er die unterschiedlichsten anderen Rollen überaffirmiert. Einen bedeutenden Anteil daran nehmen die fotografischen Selbstinszenierungen, die über das Posieren für ein Modehaus, Buchcover oder -klappen mit Sitar oder Kalaschnikow im Anschlag deutlich hinaus gehen: So kann man auch Anverwandlungen des „Brat Pack“-Autors Ellis, des geschlipst-nachdenklichen Harald Schmidt, des zerzausten August Engelhardt, der Spielberg-Version des Lagerkommandanten Amon Göth (Ralph Fiennes) oder Klaus Manns entdecken. Auf dem Cover dieses Buches erinnert Kracht nun ein wenig an Zar Nikolaus II. Hinter dieser vielgestalten Sichtbarkeit verschwindet die Person Christian Kracht, wobei nicht einmal klar ist, wieviel davon Intention des Autors oder aber bloße Projektion des Betrachters ist. So bleiben – neben dem Gestus der inszenierten Selbstinszenierung – nur die Texte, die analysiert und interpretiert werden können. Trotz dieses Spiels mit den Identitäten und trotz der Tatsache, dass die Frage danach, was ‚Kracht will‘, falsch, weil an den Texten vorbei gestellt ist, sind im Feuilleton immer wieder Autor-Persona und Ich-Erzähler gleichgesetzt worden. Selbst die Verabschiedung des Ich-Erzählers, der in den ersten drei Romanen (in sehr unterschiedlicher Form) aufzufinden war, hat den Autor nicht vor entsprechenden Missverständnissen zu schützen vermocht: 8 Vgl. hierzu Jörg Döring und Markus Joch (Hrsg.): Alfred Andersch ‚revisited‘. Werkbiografische Studien im Zeichen der Sebald-Debatte, Berlin: de Gruyter 2011; Christoph König: Häme als literarisches Verfahren: Günter Grass, Walter Jens und die Mühen des Erinnerns, Göttingen: Wallstein 2008. „Schreiben ist dubioser als Schädel auskochen“ 11 Georg Diez’ Empörung über den kolonial- und nationalapologetischen Ton der Erzählerfigur in Imperium ist ja durchaus richtig, allemal scheint sie vom Text intendiert – nur projiziert sie der Kritiker umstandslos auf den Autor, der seinen Erzähler doch überdeutlich als ebenso literarische wie problematische Figur ausgestellt hat. Gerade weil Krachts Texte „dubios“ und damit deutungsoffen bleiben, sind sie für wissenschaftliche Lektüren interessant. Eine Polemik wie die der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die 2009 fragte, warum „sich die neuere deutsche Literaturwissenschaft bisher nicht mit Christian Kracht beschäftigt“9 habe, zeugt von grober Unkenntnis, wie die Breite des hier zusammengetragenen Materials belegt. „Aufgrund der fehlenden Sekundärliteratur zu den Werken Christian Krachts“10 kann sich heute jedenfalls niemand mehr herausreden. Tatsächlich hat sich die Germanistik schon früh und mit anhaltender Intensität um Krachts Werk gekümmert. Im wissenschaftlichen Diskurs sind unverblümte Abqualifizierungen wie die, Christian Kracht gehöre zu den „light-entertainment-Autoren“11 und darum auch nicht in den Kindler, die Ausnahme. Die Literaturwissenschaft hat die Qualitäten Krachts früher wahrgenommen als das Feuilleton, das ihn lange nur sehr oberflächlich als oberflächlich abgewatscht und später wahlweise als „ästhetische[n] Fundamentalist[en]“ oder „Türsteher der rechten Gedanken“12 besungen oder verschrien hat (und damit vermutlich auch noch Ähnliches meinte). 9 Mara Delius: Ohne Stil bleibt sie still. Bericht von einer Leerstelle: Warum die neuere Literaturwissenschaft nicht so recht weiß, was sie mit dem Werk des Schriftstellers Christian Kracht anfangen soll, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 01.11.2009, S. 30. 10 Fabian Lettow: Der postmoderne Dandy. Die Figur Christian Kracht zwischen ästhetischer Selbststilisierung und aufklärerischem Sendungsbewusstsein, in: Ralph Köhnen (Hrsg.): Selbstpoetik 1800-2000. Ich-Identitäten als literarisches Zeichenrecycling, Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang 2001, S. 285-305, hier: S. 287. 11 Gesa Husemann: Vom „Sprachrohr der Kanaken“ zum „deutschen Dichter“ – Feridun Zaimoglu, in: Christoph Jürgensen, Gerhard Kaiser (Hg.): Schriftstellerische Inszenierungspraktiken – Typologie und Geschichte, Heidelberg: Winter 2011, S. 383-404, hier: S. 404. 12 Gustav Seibt: Dunkel ist die Speise des Aristokraten. Das Jahr „1979“ und der Zerfall der schönen Schuhe: Christian Kracht ist ein ästhetischer Fundamentalist, in: Süddeutsche Zeitung 12.10.2001. / Georg Diez (siehe Anm. 1), S. 103. Teil 1: Werkverzeichnis 1.1 Selbständige Veröffentlichungen Faserland. Roman, Köln: Kiepenheuer & Witsch 1995. Übersetzungen: Japan: Sanshusha 1996; Russland: Ad Marginem 2001; Lettland: AGB 2003; Litauen: Kitos Knygos 2007; Israel: Achuzat Bayit Publishing House 2009; Ukraine: Folio 2012; Korea: Moonji Publishing Co. Ltd. 2012; Schweden: Coltso Ersatz 2014. Inszenierungen: Junges Schauspiel Hannover, April 2012 (Uraufführung), Regie: Robert Lehniger; Deutsches Theater Göttingen, Spielzeit 2012/2013, Regie: Joachim von Burchard. Rezensionen: o.V.: Christian Kracht. Goethilein, in: Bunte 02.03.1995. o.V.: Junge Hühner, alte Hasen. Die Personality-Parade im Stern, in: Stern 09.03.1995. o.V.: Faserland hat das Zeug zum deutschen Kultbuch der 90er, in: Frankfurter Neue Presse 05.04.1995. o.V.: In Wirklichkeit ist da bloß eine Fischbude. Christian Krachts Roman „Faserland“, in: Andersrum 05.09.1995. Bröhan, Nicole: Wenn allein das Design das Bewußtsein bestimmt, in: Berliner Morgenpost 19.07.1995. Bucheli, Roman: Christian Krachts Erstlingsroman „Faserland“. Triumph der Unbekümmertheit über die Ästhetik, in: Der Landbote 12.04.1995. Diez, Georg: Christian Kracht: Faserland, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 17.03.2002, S. 26. Dultz, Sabine: Zynismus, in: Münchener Merkur 06.04.1995. 22 Teil 1: Werkverzeichnis Ehrenberg, Birgit: Nachdenken als Klischee über sich selbst, in: Hamburger Abendblatt 16.05.1995. Falcke, Eberhard: Zeitgeist-Tristesse in einem Lifestyle-Debüt von Christian Kracht. Die Nebenrolle der Saison, in: Die Zeit 07.04.1995. Fessmann, Meike: Das Leben als unschöne Party: Christian Krachts Roman „Faserland“, in: Basler Zeitung 11.08.1995. Flühmann, Susanna: Unrettbar verloren, in: Zürichsee-Zeitung 22.07.1995. Gächter, Sven: Krachts Deutschland-Tournee. Hundert Seiten Haß, in: Profil 08.05.1995. Groß, Thomas: Aus dem Leben eines Mögenichts. Gesellenstück aus der „Tempo“-Literaturwerkstatt: Christian Krachts Debütroman „Faserland“, eine ungnädige Reise durch Deutschland, in: taz. die tageszeitung 23.03.1995. Halter, Martin: Champagner bis es Kracht. Christian Krachts „Faserland“ oder: Mit „Tempo“ durch Deutschland, in: Tages-Anzeiger 29.04.1995. Handloik, Volker: Eine Reise, vertikal durch Deutschland. Christian Kracht lebt in Saus und Braus, in: Märkische Allgemeine 07.04.1995. Henning, Peter: Leergeräumte Schnöselseele. Rauscht an der Wirklichkeit vorbei: Christian Krachts Debütroman „Faserland“, in: Hamburger Rundschau 11.05.1995. Henning, Peter: Der Zeitgeistliche. Das deutsche Feuilleton liebt Christian Kracht und seinen Roman „Faserland“. Dabei gibt es viele Gründe, an dem angeblichen Talent zu zweifeln, in: Tip 20.04.1995. Krumbholz, Martin: Polierte Oberfläche. Christian Krachts Romandebüt „Faserland“, in: Der Freitag 24.03.1995. Martin, Marko: Inmitten des Party-Geplauders erstaunlich spracharm, in: Der Tagesspiegel 23.03.1995. Piepgras, Ilka: Der Autor sinniert über seine Gedanken. Ein Zeitgeistbruch von Christian Kracht, in: Berliner Zeitung 23.03.1995. Ruddert, Alexander: Bücher ich weiß nicht. Ein zynischer RomanErstling über das Lebensgefühl der Zwanzig- bis Dreißigjährigen, in: Vogue 16 (1995), H. 3. Teil 1: Werkverzeichnis 23 Schmierer, Joscha: Faserland, in: Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur 19 (1995), H. 8. Schmitt, Michael: Produkt-Realismus. Christian Krachts Début „Faserland“, in: Neue Zürcher Zeitung 04./05.03.1995. Schwennicke, Christoph: Irgendwie super. „Faserland“: (K)eine Besprechung, in: Badische Zeitung 17.06.1995. Seibt, Gustav: Trendforscher im Interregio. Für Bessergekleidete: Christian Krachts Deutschland, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 22.05.1995. Steinert, Hajo: Dandy, Schnösel oder Ekel. Christian Krachts satirisches „Faserland“: Erlebnisbericht einer erlebnisarmen Zeit, in: Die Weltwoche 30.03.1995. Steinkirchner, Peter: Deutschland-Trip. „Faserland“ von Christian Kracht, in: Westdeutsche Allgemeine Zeitung 19.06.1995. Thuswaldner, Anton: Nur Orte wechseln. Cristian Kracht reist, in: Salzburger Nachrichten 01.04.1995. Tuschik, Jamal: Christian Krachts hoffnungsvolles Romandebüt „Faserland“: Gelangweilt geht’s durchs Land der Väter, und Papa zahlt kräftig dazu. Provozierende Posen, in: Rheinischer Merkur 24.03.1995. Vogl, Walter: Schundiger Bericht zur Lage einer Nation. Deutschland: ein Partymärchen, in: Die Presse 17./18.06.1995. Vormweg, Christoph: Trübe Erben. „Faserland“, Phrasenkatalog eines vermögenden Twen, in: Süddeutsche Zeitung. Literaturbeilage 06.04.1995. Wegmüller, Philip: Zwischen Gut und Böse: Die Leiden des jungen Kracht, in: Berner Zeitung 21.03.1995. Wehlings, Sebastian: Nichts Kracht. Schicker Dandyismus: Christian Kracht huldigt in seinem Erstlingswerk dem affirmativen Heimatroman, in: Junge Welt 06.03.1995. Ziegler, Helmut: Christian Kracht. Faserland, in: Die Woche 24.03.1995. 24 Teil 1: Werkverzeichnis Zus. mit Eckhart Nickel: Ferien für immer. Die angenehmsten Orte der Welt [Mit einem Vorwort von Moritz von Uslar], Köln: Kiepenheuer & Witsch 1998. Rezensionen: o.V : Würgen im Alt Heidelberg. Anders reisen mit Kracht und Nickel: „Ferien für immer“, in: Stuttgarter Zeitung 03.07.1998. o.V: Banales über das Reisen, Die angenehmsten Orte der Welt, in: Handelsblatt 07.08.1998, S. 5. Althen, Michael: Rettung vor Baedekers Fluch. Ferien auf dem Barhocker mit Kracht und Nickel, in: Süddeutsche Zeitung 11.04.1998. Diez, Georg: Faserwelt, in: Spiegel-Kultur extra 30.03.1998. Irsinghaus, Jörg: Höhere Wahrheiten ruhelosen Reisens. „Ferien für immer“ von Kracht und Nickel, in: Remscheider General-Anzeiger 11.04.1998. Pfister, Michael: „Exklusive Dumpfheit“. Zwei Post-Techno-Dandys auf Reisen, in: Zürichsee Zeitung 13.05.1998. Schachinger, Christian: Die Fremde ist feindlich, in: Der Standard 05.06.1998. Weidermann, Volker: Eigentlich saugute Stimmung. Erleben, beschreiben, verdrängen, genießen, in: taz. die tageszeitung 20.03.1998, S. 23. Tristesse Royale. Das popkulturelle Quintett mit Joachim Bessing, Christian Kracht, Eckhart Nickel, Alexander v. Schönburg und Benjamin v. StuckradBarre, hrsg. v. Joachim Bessing, Berlin: Ullstein 1999. Rezensionen: o.V.: Ab nach Grosny!, in: Deutsches Sonntagsblatt 07.01.2000. Bartels, Gerrit: Denn sie wissen, was sie tun, in: taz. die tageszeitung 23.11.1999, S. 15. Balzer, Jens: Joachim, in: Berliner Zeitung 20.11.1999. Broder, Hendrik und Reinhard Mohr: Die faselnden Fünf. Mit einem „Sittenbild“ ihrer Generation wollen fünf junge Autoren brillieren Teil 1: Werkverzeichnis 25 – doch ihr Werk „Tristesse Royale“ kündet nur vor Arroganz und Überdruß, in: Der Spiegel 06.12.1999, S. 264-265. Fries, Meike: Das popkulturelle Quintett im Mojo-Club, in: taz. die tageszeitung Hamburg 06.12.1999. Gauß, Karl-Markus: Was kleidet noch?, in: Die Presse 22.01.2000. Gerstenberg, Ralph: Tristesse Royale – Das popkulturelle Quintett, in: DeutschlandRadio 26.01.2000. Hanselle, Ralf: Alles so schön bunt hier. Über Pop, Hotels und Zeichensysteme, in: Kommune 18 (2000), H. 5, S. 76-77. Harpprecht, Klaus: Von zornigen Alten und braven Jungen. Wer baut, rein geistig gesehen, das neue Berlin? Die Jungen wohl, doch wohl nicht jene Stromliniengespülten, die derzeit zu den neuen Eliten stossen. Brandrede eines Aufrechten, in: Tages-Anzeiger 07.01.2000. Jänner, Harald: Fünf Freunde und das Grand-Hotel, in: Berliner Zeitung 01.12.1999. Knipphals, Dirk: Deine Lakaien, in: taz. die tageszeitung 01.12.1999. Lau, Miriam: Dem Treibsand der Ironie entkommen. Verhelfen schöne Anzüge zu schnöseligen Meinungen? Ein Quintett junger Autoren führt „Tristesse Royale“ auf, in: Die Welt 01.12.1999. Loichinger, Stephan: Wenn Pop-Literaten altern, in: Frankfurter Rund­schau 15.10.2008. Lützow, Gunnar: Delirium am Kaminfeuer. Entgleisungen: Das Buch „Tristesse Royal – Das popkulturelle Quintett“ fällt durch beispiellosen Zynismus unangenehm auf, in: Berliner Morgenpost 29.10.1999. Martenstein, Harald: Ein Aufstand junger Männer. Zehn Jahre nach 1989 formiert sich in Deutschland eine neue Generation – ihr Manifest heißt „Tristesse Royale“, in: Tagesspiegel 13.11.1999. Martenstein, Harald: Bier fünf, in: Tagesspiegel 01.12.1999. Martenstein, Harald: Intellektuelle und andere Raucher, in: Tagesspiegel 01.12.1999. Mertens, Mathias: Die Leiden des Klassensprechers, in: Jungle World 15.03.2000. Mischke, Roland: Ein fein gekleidetes Reptil. Eine extravagante Spezies vermehrt sich wieder: Der Dandy, in Berliner Zeitung 04.12.1999. 26 Teil 1: Werkverzeichnis Radisch, Iris: Mach den Kasten an und schau. Junge Männer unterwegs: Die neue deutsche Popliteratur reist auf der Oberfläche der Welt, in: Die Zeit 14.10.1999. Rutschky, Michael: Die jungen Ernstler. Ironie ist out – verkünden lauthals deutsche Popliteraten und amerikanische Publizisten. Ist da was dran? Ironisieren wir uns etwa zu Tode? Brauchen wir vielleicht eine „neue Verbindlichkeit“?, in: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt 10.03.2000. Seibt, Gustav: Aussortieren, was falsch ist. Wo wenig Klasse ist, da ist viel Generation. Eine Jugend erfindet sich, in: Die Zeit 02.03.2000. Siemons, Mark: Gebt uns ein Leitbild! In Berlin wird Front gegen die Ironie gemacht, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 29.11.1999. Stemmer, Nikolaus Till: Tristesse Royale [Interview mit Joachim Bessing], in: Pro qm 30.11.1999. (Online: http://www.pro-qm.de/ node/17) [Abruf am 29.11.2013] Winkler, Willi: Männer ohne Frauen, in: Süddeutsche Zeitung 15.11.1999, S. 17. Zaimoğlu, Feridun: Knabenwindelprosa. Überall wird von deutscher Popliteratur geschwärmt. Aber sie ist nur reaktionäres Kunsthandwerk. Eine Abrechnung, in: Die Zeit 18.11.1999, S. 56. Der gelbe Bleistift. Reisegeschichten aus Asien [Mit einem Vorwort von Joachim Bessing], Köln: Kiepenheuer & Witsch 2000. Übersetzungen: Russland: Ad Marginem 2009 [unter dem Titel Karta Mira zusammen mit New Wave]. Rezensionen: Fries, Meike: Soundcheck, in: taz. die tageszeitung 08.04.2000. Herrmann, Karsten: Ein Dandy in der weiten Welt. Christian Krachts Asien-Reisereportagen, in: Neue Osnabrücker Zeitung 03.06.2000. Teil 1: Werkverzeichnis 27 Jürgs, Alexander: Drugs don’t work, in: Intro 6 (2000). (Online: www. intro.de/kuenstler/interviews/23012145/krachtdrugs-dont-work) [Abruf am 29. November 2013] Stiekele, Annette: Der gelbe Bleistift. Christian Kracht wagt den Ausflug in die reale Welt, in: Szene Hamburg 5 (2000). Terkessidis, Mark: Das klaustrophobische Subjekt. Neue Romane von der Popfraktion, in: Die Zeit 05.10.2000. 1979. Roman, Köln: Kiepenheuer & Witsch 2001. Übersetzungen: Italien: Rizzoli 2002; Estland: Steamark 2003; Frankreich: Denoel 2003; Niederlande: De Arbeiderspers 2003; Russland: Ad Marginem 2003; Dänemark: Politisk Revy 2004; Israel: Am Oved Publishing House 2004; Spanien: Santillana Ediciones/Alfaguara 2004; Lettland: AGB 2005; Litauen: Kitos Knygos 2008; Bulgarien: Lege Artis Publ. House 2010; Rumänien: Cartier 2013. Inszenierungen: Schauspielhaus Bochum, März 2003 (Uraufführung), Regie: Matthias Hartmann; Schauspielhaus Zürich, Februar 2005 (schweizerische Erstaufführung), Regie: Matthias Hartmann; Burgtheater Wien, November 2009 (österreichische Erstaufführung), Regie: Matthias Hartmann; Volksbühne Berlin, April 2012, Regie: Matthias Hartmann. Rezensionen: Amend, Christoph: Christian Kracht: 1979. Symphonie des Untergangs. Der Popliterat bereist das Jahr 1979, in: Der Tagesspiegel 10.10.2001. Bartels, Gerrit: Wenn Verzweiflung am allergrößten ist. Ernste Geschichten am Anfang des neuen Jahrtausends: Die ganz schön kaputte Welt von Christian Kracht, Rebecca Casati und Joachim Bessing, in: taz. die tageszeitung 10.10.2001. Blanke, Ludger: Herzlose Finsternis. Christian Kracht ist nicht der Peter Scholl-Latour des Pop, in: Jungle World 24.10.2001. 28 Teil 1: Werkverzeichnis Buhr, Elke: Durch nichts erregt werden. Christian Krachts neuer Roman „1979“ schickt einen dummen Dandy durch die Hölle, in: Frankfurter Rundschau 10.10.2001. Corino, Karl: Abspecken im Gelben Gulag. Zeitreise mit Pop-Literat Christian Kracht in den Iran der islamischen Revolution, in: Welt am Sonntag 07.10.2001. Freydag, Nina: Untergang in eisigen Höhen, in: kulturSPIEGEL 24.09.2001, S. 59. Heidenreich, Elke: Autoren – Nichts wird je wieder gut. Christian Kracht erzählt in seinem verstörenden Roman „1979“ vom Elend der Dekadenz und dem Zwang zum Opfer in einer brutalen, unverständlichen Welt, in: Der Spiegel 08.10.2001. Henning, Peter: Kippfiguren, in: Die Weltwoche 18.10.2001. Jähner, Harald: Dandys Straflager. Christian Kracht unterzieht sich der islamischen Revolution. Die Popliteratur konvertiert zu Askese und Terror, in: Berliner Zeitung 09.10.2001. Klotzek, Timm: Ess-Stäbchen, die sich in den Kopf bohren, in: Jetzt [Beilage zur Süddeutschen Zeitung] 15.10.2001. Kobes, Sabine: Lümmel mit Lebensart, in: Gala 15.11.2001. Krekeler, Elmar: Kampf des Kulturlosen. Das Buch zur Zeit: In Christian Krachts neuem Roman „1979“ wird ein Hedonist von sich selbst erlöst, in: Die Welt 06.10.2001. Laumont, Christof: Das Ende des Verstehens oder Die Kapitulation der Literatur. Christian Kracht kokettiert im Roman „1979“ mit der Schauerromantik, in: Der Bund 26.01.2002. Mayer, Verena: Triumph der Oberfläche. Geschichte eines Verlustes: „1979“ von Christian Kracht, in: Wiener Zeitung 05.01.2002. Moritz, Rainer: Im Innersten rein. Christian Krachts „1979“ und der Verlust des Literarischen, in: Schweizer Monatshefte 81/82 (2001), H. 12, S. 63-64. Schröder, Lothar: Ende einer Pilgerfahrt. Christan Kracht, in: Rheinische Post 13.11.2001. Seibt, Gustav: Dunkel ist die Speise der Aristokraten. Das Jahr „1979“ und der Zerfall der schönen Schuhe: Christian Kracht ist ein ästhetischer Fundamentalist, in: Süddeutsche Zeitung 12.10.2001. Teil 1: Werkverzeichnis 29 Spiegel, Hubert: Christian Kracht: 1979. Wir sehen uns mit Augen, die nicht die unseren sind, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 09.10.2001. Zehm, Günter: Verlöschen im Nichts. Der neue Roman von Christian Kracht irritiert, in: Junge Freiheit 02.11.2001. Zus. mit Eva Munz und Lukas Nikol: Die totale Erinnerung. Kim Jong Ils Nordkorea, Berlin: Rogner & Bernhard 2006. Übersetzungen: USA: Feral House 2007. Rezensionen: Arnet, Daniel: Kim Jong Kracht, in: FACTS 21.09.2006. Graffenried, Ariane von: Das Schönste den Gästen, in: taz. die tageszeitung 13.09.2006. Hartwig, Ina: Mediale Möbiusschleife, in: Frankfurter Rundschau 11.10.2006. Hauser, Stefan: Bilder vom totalitären Traum in Nordkorea, in: Neue Zürcher Zeitung 15.10.2006. Herbstreit, Daniel: Die Liebe zum Beton. Ironie und Bekenntnis: Der Schriftsteller Christian Kracht verteidigt in Berlin Nordkorea, in: Der Tagesspiegel 14.09.2006. Müller, Felix: „Machen Sie doch ein sehr schönes Foto!“, in: Die Welt 01.09.2006. [Interview mit Eva Munz] Ostheimer, Michael: Nordkorea, oberflächlich betrachtet, in: Neue Zürcher Zeitung 19.10.2006. 30 Teil 1: Werkverzeichnis New Wave. Ein Kompendium 1999-2006 [Mit einem Vorwort von Volker Weidermann], Köln: Kiepenheuer & Witsch 2006. Übersetzungen: Ägypten: Sphinx 2008 [vom Verlag nicht autorisierte Lizenzausgabe]; Russland: Ad Marginem 2009 [unter dem Titel Karta Mira zusammen mit Der gelbe Bleistift]. Rezensionen: o.V.: Schöne neue Welt, in: Mitteldeutsche Zeitung 10.02.2007. o.V: Der Mensch hinter Edelmarken, in: Märkische Allgemeine 17./18.02.2007. o.V.: In der Mongolei nur Toffifee statt Murmeltier. Christian Krachts Textsammlung „New Wave“, in: Ruhr Nachrichten 15.03.2007. Bunz, Mercedes: Wie radikal ist ein Schnösel? „New Wave“ heißt der neue Band von Christian Kracht, Weltbürger und Autor aus Berlin, in: Zitty 12.10.2006. Hausemer, Georges: Christian Kracht surft auf der ‚New Wave‘. Mongolen mögen Toffifee, in: Tageblatt [Luxemburg] 20.01.2007. Kohnen, Alexander: Der Clown aus Katmandu, in: Rheinischer Merkur 11.01.2007. Martus, Steffen: Buffetcrashing in Kairo. Christian Krachts lässiges und überladenes Kompendium „New Wave“, in: Berliner Zeitung 25.01.2007. Platthaus, Andreas: Überall ist es schön, wo er ist: Christian Kracht bereist die Oberfläche der östlichen Welt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 04.11.2006. Rußmann, Pamela: Christian Kracht im Porträt, in: Österreichischer Rundfunk 21.11.2006. Teil 1: Werkverzeichnis 31 Zus. mit Ingo Niermann: Metan. Erster Teil einer Trilogie, Berlin: Rogner & Bernhard 2007. Übersetzungen: Lettland: AGB 2007; Russland: Ad Marginem 2008. Rezensionen: Amrein, Philippe: Der weltenbummelnde Dandy erklärt die Welt als Gärgas, in: Tages-Anzeiger 19.03.2007 Bartmann, Christoph: Eine große Weltatemtheorie: „Metan“. Christian Kracht und Ingo Niermann spielen Verschwörungskünstler, in: Süddeutsche Zeitung 07.04.2007. Bartels, Gerrit: Lesung. Christian Kracht und Ingo Niermann stellen „Metan“ vor: Mit Vollgas ins Gebirge, in: Der Tagesspiegel 29.03.2007. Bartels, Gerrit: Realität ist ein schlechtes Geschäft. Wolfgang Herrndorf, Christian Kracht, Tom Kummer: Die deutsche Popliteratur macht weiter, in: Der Tagesspiegel 21.03.2007. Hemmerli, Thomas: Eine Schweizer Atombombe, in: SonntagsZeitung 11.03.2007. Hartwig, Ina: Wir riechen (uns), in: Frankfurter Rundschau 14.03.2007. Krekeler, Elmar: Verpupt, in: Die Welt 10.03.2007. Meitzner, Ulrike: Auf dem Gipfel des Abstrusen. Christian Kracht und Ingo Niermann lasen im Festsaal Kreuzberg aus „Metan“, ihrem Pamphlet zur Klimaerwärmung, in: taz. die tageszeitung 05.04.2007. Peters, Harald: Christian Kracht und Ingo Niermann erklären den Klimawandel – Über kleine und größere Stinker, in: Welt am Sonntag 04.03.2007. Thuswaldner, Anton (ath.): Christian Kracht, Ingo Niermann: Metan, in: Salzburger Nachrichten 23.06.2007.