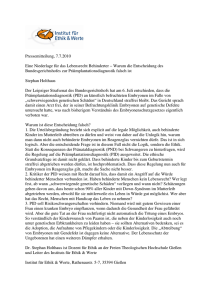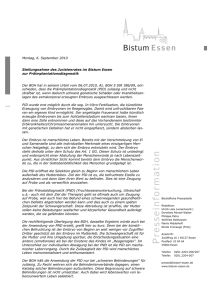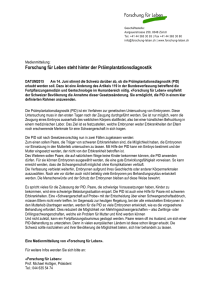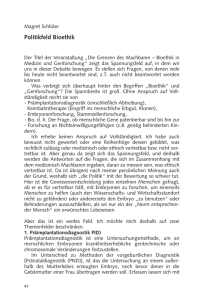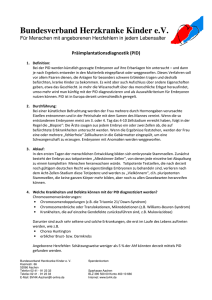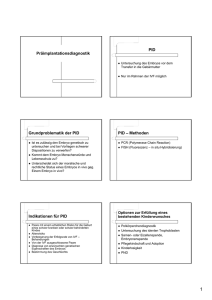Ethische Wertung von Präimplantationsdiagnostik und
Werbung

Konrad Hilpert Ethische Wertung von Präimplantationsdiagnostik und Pränataldiagnostik. Ein Überblick über das Spektrum der Positionen Wenn man den Stand der Diskussion über die ethische Legitimität von PID und PND sowohl in der öffentlichen Debatte (Politik, Medien, Kirchen, Verbände) als auch im akademischen Bereich (wissenschaftliche Literatur, Ethikräte, Sachverständigenkommissionen) erhebt, so ergibt das Bild eine stark kontroverse Beurteilung der Möglichkeiten und Sets vorgeburtlicher genetischer Untersuchungen. Wohl besteht eine große Übereinstimmung in der Überzeugung, dass menschliches Leben in allen Stadien seiner Entwicklung grundsätzlich schutzwürdig ist, und auch darin, dass Embryonen und Feten nicht zu jedem beliebigen Zweck zerstört werden dürfen. Einigkeit herrscht ferner darüber, dass die Erweiterung der medizinischen Möglichkeiten, Erkrankungen zu diagnostizieren, um menschliches Leiden zu vermindern, wünschenswert und moralisch gerechtfertigt ist – vorausgesetzt, dass das mit dem betreffenden Verfahren jeweils verbundene gesundheitliche Risiko vernachlässigt werden kann und die Patienten mit der Durchführung des Tests einverstanden sind. Auch darüber, was zu verhindern ist, besteht weitgehend Übereinstimmung, nämlich die Züchtung von Menschen und die Diskriminierung von Behinderten. Doch schon bei der Frage, ob es sich bei PID und PND um genuin medizinische Maßnahmen handelt, gehen die Einschätzungen angesichts jener nicht wenigen Fälle, wo für die diagnostizierte Krankheit keine effektiven Therapie- oder Präventionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, auseinander. Ein ungünstiges Untersuchungsergebnis lässt in diesen Fällen den Abbruch der Schwangerschaft bzw. die Nicht-Transferierung des Embryos als einzigen Ausweg erscheinen. Die Bewertung der vorgeburtlichen Diagnostikverfahren ist zwangsläufig von der strittigen Frage des moralischen Status von menschlichen Embryonen bzw. Feten in den verschiedenen Phasen der Entwicklung betroffen. Umstritten sind aber auch die Ziele, zu denen die Methoden der vorgeburtlichen Diagnostik eingesetzt werden; mehr noch als die Absichten, die von Ärzten und Standesorganisationen in der Öffentlichkeit vertreten werden, sind es allerdings jene Wünsche, von denen vermutet oder befürchtet wird, dass sie über kurz oder lang diese Verfahren in Dienst 2 nehmen könnten. Erst recht besteht ein erheblicher Dissens hinsichtlich der Folgen, die sich bei der Etablierung der Untersuchungsverfahren sowohl für die Entscheidungslagen betroffener Paare als auch für die Erwartungen der Gesellschaft an Eltern und Kinder ergeben könnten. I. Zwei Ebenen der ethischen Diskussion In der ethischen Diskussion von PID und PND lassen sich zwei Ebenen der Argumentation unterscheiden: auf der einen konzentriert man sich auf das Interaktionsdreieck von Paar, behandelndem Arzt und Embryo bzw. zukünftigem Kind. Die Vertretbarkeit von PND und PID wird erörtert im Blick auf den Leidensdruck einzelner Patienten bzw. auf Gruppen von Patienten. Man kann dies die mikro(traditionell: individual-) ethische Ebene nennen. Auf der zweiten Ebene ist vor allem der soziale und organisatorische Kontext im Blick, dessen Bestandteil ein diagnostisches Verfahren ist oder wird. Reflektiert werden die Einflüsse und Folgewirkungen, die die Etablierung des betreffenden Verfahrens für die Gesellschaft insgesamt oder für Gruppen in ihr bewirken könnte. Man kann dies als makro- bzw. (sozial-)ethische Reflexionsebene charakterisieren. In der konkreten Entscheidung des handelnden Individuums verschmelzen Gesichtspunkte der mikro- und makroethischen Ebene miteinander. Gleichwohl empfiehlt es sich für die ethische Reflexion, die Argumente dieser beiden Ebenen voneinander zu trennen, weil das, was von der einen Ebene her als gerechtfertigt oder gar als wünschenswert erscheint, durchaus im Konflikt zu dem stehen kann, was sich aus der Perspektive als vertretbar darstellt. Dieser groben Einteilung folgend möchte ich jetzt jene Argumente vorstellen, die in den verschiedenen Stellungnahmen und Erörterungen immer wieder angeführt bzw. diskutiert werden, in diesem Sinne also typisch sind. II. Erzeugung von Embryonen unter Vorbehalt Wichtigstes und meist ausschließlich diskutiertes Anwendungsgebiet der PID ist es, Paaren, die das Risiko tragen, ihren Kindern eine genetische Krankheit zu vererben, den Wunsch nach einem eigenen Kind zu erfüllen, das die betreffende genetische Disposition nicht hat. Ermöglicht wird dies durch den Dreischritt extrakorporale 3 Zeugung – Erkennung des Risikos – Selektion. Bezugspunkt der ethischen Bewertung ist nicht so sehr der mittlere Schritt, also die genetische Untersuchung als solche, sondern der anschließende Selektionsvorgang und die diesen überhaupt erst ermöglichende, vorausgehende Zeugung unter Vorbehalt. Problematisch erscheint näherhin zum einen, dass menschliche Embryonen unter dem Vorbehalt erzeugt werden, dass sie sich im Hinblick auf den Wunsch, ein gesundes eigenes Kind zu haben, eignen; und zum anderen, dass nur diejenigen Embryonen zur weiteren Entwicklung zugelassen werden, die sich als frei von dem betreffenden genetischen Defekt erweisen. Die für die Diagnostik notwendige, für die Mutter selbst strapaziöse Befruchtung in vitro wird ausschließlich zu dem Zweck vorgenommen, die bei unerwünschtem Befund daraus abgeleitete Verwerfung zu ermöglichen. Insofern die Annahme des erzeugten Embryos vom Wunsch auf ein gesundes Kind abhängig gemacht wird, erfüllt die PID den Tatbestand einer bedingten Zeugung (oder: Zeugung auf Probe). Aus der Sicht der betroffenen Eltern und ihres Arztes kann sich dieser Sachverhalt allerdings auch anders darstellen: Hier ist das ganze Handlungsset darauf ausgerichtet, einem Paar, das ein Risiko für eine genetisch bedingte Erkrankung trägt, zur gewünschten Schwangerschaft zu verhelfen und es gleichzeitig von der Angst zu befreien, dass dieses Kind genetisch krank ist oder sein könnte. Was letzteres konkret bedeutet, wissen viele der Betroffenen aus eigener Anschauung oder gar aus eigenem dramatischen Erleben. In dieser Sicht wird also der therapeutische Zweck – nämlich ein eigenes gesundes Kind unter risikobelasteten Zeugungsbedingungen zu bekommen – auf den gesamten Handlungszusammenhang bezogen; die PID und die anschließende Selektion werden „nur“ als Handlungsschritte innerhalb einer komplexen Handlungskette aufgefasst, deren Gesamtzweck ganz ein therapeutischer ist. Im Unterschied zur PID verfolgt die bisherige PND vielmehr das Ziel, Schwangere, bzw. die Eltern zu informieren, von unbegründeten Befürchtungen zu befreien bzw. sich bei Vorliegen eines Befunds auf die bevorstehende Situation vorzubereiten, zunehmend auch: schon vorgeburtlich eine Therapie einzuleiten. Die PND als Mittel zur Beruhigung der Schwangeren und zur Verbesserung des Erlebens der Schwangerschaft ist ethisch so gut wie unumstritten. Gleichwohl muss gesehen werden, dass sie auch mit derselben Option wie PID angewendet, begehrt oder 4 sogar von Beginn an eingeplant werden kann. (Der deutsche Gesetzgeber hat diese Nutzung der PND durch die Abschaffung der embryopathischen Indikation bzw. durch deren Subsummierung unter die mütterlich-medizinische in Kauf genommen. Die Ärzte geraten durch die sich herausbildende Kind-als-Schaden-Rechtsprechung zunehmend unter einen Druck, PND auch mit dieser selektiven Zielsetzung anzuraten und durchzuführen, um gegen eventuelle Haftungsklagen gesichert zu sein). Zumindest in diesen Fällen kann die PID also durchaus als vorverlagerte PND betrachtet werden. III. PND und PID In der ethischen Diskussion spielt die nähere Bestimmung des Verhältnisses von PND und PID eine zentrale Rolle. Und zwar sowohl unter dem Aspekt, welches Verfahren bei gleicher Zielsetzung das weniger fragwürdige Mittel darstellt, als auch unter dem Aspekt der Kohärenz. Wird die PID als zeitlich vorverlagerte PND aufgefasst, so kommt ersterer ein Vorrang zu, insofern die genetische Untersuchung im Fall der PID schon vor Eintritt einer eventuellen Schwangerschaft vorgenommen wird und dadurch der Schwangeren ein eventueller Schwangerschaftsabbruch nach PND mit seinen physischen und psychischen Belastungen erspart bleibt. PID bietet also die Chance, embryopathisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche nach PND zu vermeiden, ist also insofern das weniger fragwürdige Mittel zur Erreichung desselben Zieles. Das Kohärenz-Argument sieht einen Widerspruch zwischen der faktisch geübten und rechtlich normierten Wertschätzung des Embryos bzw. des Fetus in vivo und derjenigen des Embryos in vitro. (Auf der Ebene des Strafrechts spiegelt sich dieser Widerspruch in der Nichtvereinbarkeit der Zulässigkeit von nidationshemmenden Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbruch auf der einen Seite und der Nicht-Zulassung von PID im Gefolge des Embryonenschutzgesetzes auf der anderen.) Trotz dieser Nähe stößt die Behauptung, PID sei nur eine zeitlich vorverlegte PND und ihre ethische Problematik sei grundsätzlich dieselbe, in der ethischen Diskussion auf Skepsis. Relevante Unterschiede werden vor allen Dingen hinsichtlich der jeweiligen Entscheidungssituation der Frau geltend gemacht. Diese unterscheidet sich bei PND und PID in drei Momenten: 5 PND PID Weiterführung dieser existierenden Schwangerschaft: ja oder nein vs. Auswahl unter mehreren erzeugten Embryonen nach genetischen Merkmalen vor der Schwangerschaft Untersuchung des Embryos innerhalb des Körpers der Frau; zum werdenden Kind hat sich bereits eine physische und emotionale Beziehung gebildet (spürbar und sichtbar) vs. Prüfung der erzeugten Embryonen außerhalb des Körpers der Frau; indirekte und mittelbare (Kinderwunsch, Wissen, medizinische Umgebung) Beziehung; größere Offenheit für Einflüsse von außen akut bestehender und persönlich erlebter Konflikt der Schwangeren vs. antizipierter und vorweg entschiedener Konflikt eines Paars mit genetischer Belastung Diese Unterschiede lassen vermuten, ein Embryo sei bei PND wegen der Beziehung zur Mutter im allgemeinen besser geschützt als bei der PID. Es kann allerdings nicht in Abrede gestellt werden, dass Paare, besonders solche, die früher eine missglückte Schwangerschaft erleben mussten oder die bereits ein behindertes Kind haben, die noch in der Zukunft liegende Konfliktsituation genau kennen und in ihrer ganzen Schwere und Ausweglosigkeit auch vorwegnehmend erleiden können. IV. Das Problem der Grenzziehung Von Seiten der Ärzte und ärztlichen Standesorganisationen wird eine Indikation zur PID „derzeit bei anamnestisch stark belasteten Paaren gesehen, für deren Nachkommen ein hohes Risiko für eine bekannte und schwerwiegende, genetisch bedingte Erkrankung besteht“ (Hepp 2000; BÄK-Entwurf). Dieser starken Beschränkung liegt das Bewusstsein zugrunde, dass die Aussonderung von Embryonen nicht unproblematisch ist und gleichsam selbstverständlich durchgeführt werden darf, sondern nur als Ausnahme in bedrängenden Einzelfällen und als Ergebnis einer sorgfältigen Beratung hingenommen werden kann. In der ethischen Diskussion wird der daraus abgeleiteten Forderung nach Zulassung der PID nicht generell widersprochen. Ein Problem wird allerdings in der Tendenz zur Ausweitung gesehen, die eintreten könnte, wenn sich die PID erst einmal als ein probates und routiniertes Verfahren etabliert hat. Eine solche Ausweitung erscheint nach verschiedenen Seiten vorstellbar oder sogar wahrscheinlich, nämlich: 6 1. bei den genetischen Belastungen, die zu einer PID berechtigen (= Wo verläuft die Grenze zwischen schweren und leichten Erbkrankheiten?), 2. bei der Höhe des Risikos (= Was ist ein erhebliches, was ein geringes Risiko?) und 3. bei der Ausweitung auf neue Anwendungsgebiete wie der schon absehbaren seriellen Untersuchung sämtlicher in-vitro fertilisierten Embryonen zur Verbesserung der Erfolgsrate bei IVF oder der Kontrolle von eines Tages möglichen Eingriffen in die Keimbahnen (= Wann liegt eine therapeutische Indikation vor, wann geht diese in ein Indikationenspektrum über, in dem auch technische, rein wissenschaftliche oder unter Umständen auch ästhetische Interessen zur Inanspruchnahme berechtigen?). Für die Wahrscheinlichkeit der Ausweitungsdynamik sprechen die Erfahrungen, die sowohl mit der PND als auch mit der IVF gewonnen wurden, die ursprünglich beide nur mit einer eng gefassten therapeutischen Option verbunden waren. Für das Problem der Grenzziehung zwischen vertretbaren und fragwürdigen Anwendungen werden in der Literatur drei Lösungen diskutiert. Die erste und eindeutigste bestünde darin, in einem Katalog von Indikationen festzulegen, welche Erbkrankheiten als schwer und welche Risiken als erheblich zu gelten haben. Ein solcher Katalog könnte einen Überblick über die je augenblickliche Praxis bieten, müsste allerdings laufend aufgrund des neuesten Erkenntnisstandes aktualisiert werden. Außerdem haben Kataloge den Nachteil, von Trägern der darauf verzeichneten Merkmale als diskriminierend empfunden zu werden. Als Alternative zur Katalogisierung der Indikationen wird deshalb zweitens diskutiert, den Belastungsgrad einer zu erwartenden Krankheit der subjektiven Einschätzung durch die potentiellen Eltern und der Beratung durch den Arzt anheim zu stellen. Der Nachteil dieser zweiten Lösung wird darin gesehen, dass über sie auch nichtgesundheitliche Gesichtspunkte als Auswahlkriterien wie etwa das Geschlecht oder die Augenfarbe zur Geltung gebracht werden könnten. Um genau dieses auszuschließen könnte eine dritte, mittlere Form der Grenzziehung darin bestehen, statt eines Anwendungen Katalogs von bestimmter PID und Indikationen einen PND erstellen, zu Negativ-Katalog in dem von jene 7 Anwendungsmöglichkeiten aufgelistet sind, die verboten oder unerwünscht sind (in diese Richtung deutet der Vorschlag der BÄK). V. Erweiterte Autonomie und sanfter Zwang Für Paare und vor allem für Frauen bedeuten die Verfahren der genetischen Frühdiagnostik zweifellos einen Zugewinn an Handlungsalternativen: Bei der PND kann die Mutter in den meisten Fällen von der Angst befreit werden, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen; in den wenigen Fällen aber, in denen ein Befund ermittelt wird, hat sie die Option, die Schwangerschaft abzubrechen, und die, sich schon frühzeitig auf ein Leben mit dem gehandicapten Kind vorzubereiten. Bei der PID wird das erblich belastete Paar vom Dilemma befreit, entweder ganz auf Kinder zu verzichten, oder aber das Risiko einzugehen, ein Kind mit dem gleichen Erbschaden zu zeugen und es später eventuell abzutreiben; statt dessen erhält das Paar eine Chance, ein gesundes Kind zu bekommen. Die Eröffnung solcher Handlungsalternativen verändert die Wahrnehmung von Elternschaft auch über den Kreis der unmittelbar Betroffenen hinaus. Sie stellt nämlich den Eltern bzw. allen Paaren, die Eltern werden wollen, Lösungen für Situationen in Aussicht, die bisher als schicksalhaft gegolten haben. Der „Preis“, der dafür entrichtet werden muss, besteht allerdings darin, dass Eltern sehr viel stärker für die gesundheitliche Verfassung ihres Nachwuchses und die Belastungen ihrer eigenen Lebenspläne für verantwortlich gehalten werden. Vor allem von Seiten der Vertreterinnen feministischer Ethik wird kritisch darauf verwiesen, dass die veränderte Wahrnehmung und Zurechnung Paare und Eltern dazu bewege, alle Möglichkeiten zu ergreifen, die ihnen in Aussicht stellen, die Einschränkungen, die mit dem Kinderhaben verbunden sind, nicht größer werden zu lassen als unbedingt nötig. Die Tatsache, dass das abweichende Aussehen und Verhalten behinderter Kinder und der mit solchen Kindern verbundene Mehraufwand in letzter Konsequenz vom sozialen Umfeld und weiten Teilen der Gesellschaft den Eltern zugelastet werde, wirke als sanfter Druck oder als Sog für die Nachfrage nach frühdiagnostischen Untersuchungen, sofern diese eine Perspektive versprechen, entweder wirkungsvoll für die Gesundheit des Nachwuchses zu sorgen oder aber im schlimmen Falle von der Bedrohung der eigenen Lebenspläne entlastet zu werden. 8 VI. Auf dem Weg zur Eugenik? Das von vornherein feststehende Ziel bei der Durchführung einer PID, die als genetisch krank diagnostizierten Embryonen zum frühest möglichen Zeitpunkt auszusondern, wird in der Diskussion häufig mit der Befürchtung verknüpft, PID könne der Einstieg zur Auswahl von Kindern nach bestimmten Merkmalen werden. Diese Befürchtung verbindet sich mit der unguten Erinnerung an die Visionen und Postulate des Sozialdarwinismus des 19. Jahrhunderts und an die Bemühungen des Nationalsozialismus, diese Ideen für die Programmatik und Praxis staatlicher Gesundheits-, Rassen- und Bevölkerungspolitik zu nutzen. Im Unterschied zu diesen Programmen wird allerdings heute von niemandem gefordert oder auch bloß gewünscht, dem Staat oder irgendwelchen staatlichen Institutionen eine Kompetenz zur Lebensbegutachtung zuzubilligen. Insofern könnte im Blick auf die Zulassung von PID allenfalls mit Jürgen Habermas von liberaler Eugenik die Rede sein. Freilich kann nicht in Abrede gestellt werden, dass die PID mit anschließender Verwerfung ein Auswählen des besten aus einer Mehrzahl von Embryonen darstellt, also den Tatbestand einer Selektion erfüllt (vgl. Birnbacher 2000, 416 f.). Deren medizinisch indizierte Anwendung in wenigen, hochdramatischen Einzelfällen bahnt allerdings nicht automatisch den Weg zur nicht-medizisch indizierten Eugenik für alle oder auch bloß für viele. Dem stehen nicht bloß die physische und psychische Belastung sowie die Risiken der IVF als unumgänglicher Voraussetzung für jede PID entgegen, sondern auch die Tatsache, dass die allermeisten Krankheiten ebenso wie die sozial hoch bewerteten Eigenschaften von Menschen äußerst komplex sind und keineswegs nur genetisch bestimmte Ursachen haben. Gleichwohl verweist die mit „Eugenik“ benannte Befürchtung auf ein reales Problemfeld, nämlich auf den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Denkgewohnheiten, Erwartungen, Perfektionsidealen und Vorurteilen auf der einen Seite und dem medizinischen Angebot, der Regelung des Zugangs und der Übernahme der Kosten auf der anderen Seite. Die Gefahr eugenischer Tendenzen geht aber weniger von der strikt medizinisch indizierten PID und PND aus, sondern von den inkulturierten Vorurteilen und Ausgrenzungsroutinen (gegenüber Andersartigen, Fremden, Kranken und Behinderten), die sich langfristig der genannten diagnostischen Verfahren bedienen könnten. Dem sollte der Gesetzgeber 9 entschlossen und problembewusst entgegentreten und bereits scheinbar harmlose Tendenzen nach dieser Richtung wie etwa der Geschlechtswahl bei IVF kompromisslos eine Absage erteilen. VII. Diskriminierung Behinderter im Gefolge? Eine starke Rolle in der Diskussion spielen die (vermuteten) Auswirkungen, die die Einführung und Etablierung von PID längerfristig für die Behinderten und ihre gesellschaftliche Akzeptanz haben könnten. Befürchtet wird zunächst – das kommt vor allem in den Stellungnahmen der Behindertenverbände massiv zum Ausdruck -, dass die Behinderten selbst den Eindruck bekommen könnten, unerwünscht zu sein, wenn entwicklungsfähige menschliche Lebewesen, die Träger der gleichen Defekte sind wie sie selbst, aufgrund einer PID nicht mehr zur weiteren Entwicklung zugelassen werden. Dies könnte vor allem bei einer Katalogisierung bestimmter genetisch bedingter Krankheiten für eine Indikation zutreffen. Die Befürchtungen gehen aber auch in die Richtung, dass sich das gesellschaftliche Klima zum Nachteil der Behinderten verändern könnte, weil Behinderung als solche in der Bevölkerung als etwas Vermeidbares aufgefasst werden könnte. Diese Bedenken werden auch in der ethischen Diskussion aufgenommen. Auch dort, wo ihnen argumentativ widersprochen wird, wird in ihrer Artikulierung ein Ausdruck der prekären Lage gesehen, in der sich die Behinderten auch schon jetzt im alltäglichen Zusammenleben mit anderen erfahren. Gleichwohl entbehrt das den Befürwortern einer Zulassung von PID häufig unterstellte Ziel, eine Gesellschaft ohne Behinderte zu wollen, jedes Realismus, da die überwiegende Zahl der Behinderungen durch nicht-genetische Einflüsse vor und nach der Geburt (Ernährung, Medikamente, Unfälle, Infektionen) verursacht ist. Nicht einsichtig ist auch die Vermutung, dass eine Gesellschaft, in der es aufgrund von PID weniger Behinderte gäbe, automatisch behindertenfeindlicher werden müsste. Beide Punkte zeigen indessen, wie stark der behindertenfeindliche Effekt, der von der Zulassung von PID ausgehen könnte, davon abhängt, dass flankierend Aufklärungsbemühungen stattfinden, die für die Befindlichkeit der Behinderten in unserer Gesellschaft sensibilisieren. 10 VIII. Das Dilemma der Politik Zwischen der Bewertung präimplantationsdiagnostischer Möglichkeiten im Blick auf individuelle Schicksale und Entscheidungslagen, wie sie sich für betroffene Paare und behandelnde Ärzte stellen (mikroethische Ebene), und ihrer Bewertung im Blick auf gesellschaftliche Trends, in deren Kontext diese Entscheidungslagen eingebunden sind (makroethische Ebene), bestehen deutliche Spannungen. Einerseits gibt es zweifellos Fälle, die für die Betroffenen so konfliktreich und notvoll sind, dass es zumindest unbillig erscheint, dass ausgerechnet der Staat die Anwendung eines an und für sich verfügbaren Verfahrens versagen darf, das eine Wiederholung der schlimmen Erfahrung bzw. einen sicheren Schwangerschaftsabbruch ersparen würde. Andererseits darf auch nicht die Gefahr übersehen werden, dass das, was einmal für schwierigste Einzelfälle erdacht wurde, den Weg öffnen könnte, dass eines Tages auch leichtere Erkrankungen, bloße Dispositionen für eventuelle Risiken oder auch Aussehen und sogar ein bestimmtes Geschlecht als für die Eltern nicht zumutbar empfunden werden und als ausreichende oder wenigstens zusätzliche Gründe für die Inanspruchnahme der Embryonendiagnostik begehrt werden könnten. Auch dürfen die Befürchtungen nicht ignoriert werden, dass der durch PID erfüllbar gemachte Wunsch, bestimmte Risiken auszuschließen, bei jungen Menschen, vor allem bei Frauen, generell in eine Ängstlichkeit beim Kinderbekommen („Pathologisierung der Reproduktionsfähigkeit“) und gesellschaftsweit in eine Erwartungshaltung umschlagen könnte, die gerade jene negativ zu spüren bekämen, die selbst mit einem Handicap leben müssen oder sich als Eltern für die Annahme eines behinderten Kindes entschieden haben. Für Politik und Gesetzgebung ergibt sich daraus das Problem, ob sie diese auseinanderstrebenden Perspektiven möglicherweise vereinbar machen kann, also auf der Ebene der Gesetzgebung, ob es eine Lösung gibt, die den schwierigen Einzelfällen gerecht werden könnte, ohne das Schutzniveau für Embryonen bedenklich abzusenken. Insbesondere stellt sich ihnen die Aufgabe, wirksam zu verhindern, dass mit der Zulassung der PID der enge Kreis eindeutig medizinischer Indikationen überschritten und die Verwendung menschlicher Embryonen zu trivialen Zwecken ermöglicht wird. 11 Um dieses Ziel zu erreichen, bieten sich der Politik zwei Alternativen an, nämlich das strikte Verbot der Etablierung des Verfahrens der PID oder aber eine eingeschränkte Zulassung für bestimmte, identifizierbare Fälle. Ein striktes Verbot ist zweifellos deutlicher und wird auch im öffentlichen Bewusstsein als das wahrgenommen, was es ist, nämlich als ein Verbot. Zugrunde liegt ihm die Überlegung, dass für die schicksalsschweren Anliegen nur ganz weniger Betroffener nicht das feste gesetzliche Prinzip für alle durchbrochen werden soll. Überdies könnte einem strikten Verbot in Deutschland eine symbolische Bedeutung im Hinblick auf die staatlich verordnete Dehumanisierung im 3. Reich zukommen. Freilich kann ein entsprechendes striktes Verbot durch ein Ausweichen in Nachbarländer umgangen (Tourismus) und auch durch medial prominent gemachte Extremfälle als im konkreten Fall unangemessen wirksam in Frage gestellt werden. Solches wiederum muss sich eine eingeschränkte Erlaubnis nicht vorwerfen lassen. Ihr Nachteil besteht allerdings darin, dass die Grenze zwischen erlaubt und nicht erlaubt im Lauf schon weniger Jahre verschoben werden kann, entweder de facto oder durch Analogieargumentation („Wenn diese Indikationen, warum dann nicht auch jene?“). Das zeigen die Erfahrungen mit dem Abtreibungsrecht ebenso wie die mit der IVF. Die Aufgabe, die sich für die Rechts- und Gesellschaftspolitik in diesem ganzen Zusammenhang der vorgeburtlichen Diagnostik und der Reproduktionsmedizin stellt, darf m. E. nicht auf die Frage enggeführt werden, ob PID und bestimmte Anwendungen von PND verboten, zugelassen oder gar gefördert werden sollen. Einbezogen werden müssen in den gesamten Regelungskomplex vielmehr auch: 1. Sicherungen, die die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme von diagnostischen Angeboten und der Kenntnisnahme bzw. Nichtkenntnisnahme ihrer Ergebnisse gewährleisten; 2. die Unterstützung der Paare und Mütter durch eine qualifizierte Beratung (nicht nur vor und während der Behandlung, sondern auch und vor allem nach Erfolg bzw. Misserfolg); 3. Anstrengungen, dass mögliche Alternativen (Verzicht auf eine Schwangerschaft, Adoption, heterologe Insemination) von den Betroffenen überhaupt ernsthaft als realisierbar und zumutbar erwogen werden; 12 4. Garantien, dass Eltern, die das Risiko eingehen, ein krankes oder behindertes Kind zu haben, die damit verbundenen materiellen, psychosozialen und physischen Belastungen tragen können und in ihrer Entscheidung fraglos respektiert werden. Literatur - Akademische Akademie Hofgeismar (Hg.): Humangenetik – Medizinische, ethische, rechtliche Aspekte, Chancen und Risiken, München 1986 A. Arz de Falco: Töten als Anmassung – Lebenlassen als Zumutung. Die kontroverse Diskussion um Ziele und Konsequenzen der Pränataldiagnostik, Freiburg i. Ue. 1996 A. Arz de Falco, Elemente der ethischen Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik, in: A. Holderegger u.a. (Hg.), Theologie und biomedizinische Ethik: Grundlagen und Konkretionen, Freiburg i.Ue./Freiburg i.Br. 2002, 268-279 C.R. Bartram u.a.: Humangenetische Diagnostik. Wissenschaftliche Grundlagen und gesellschaftliche Konsequenzen, Berlin, Heidelberg, New York 2000 R. Baumann-Hölzle u.a. (Hg.): Genetische Testmöglichkeiten. Ethische und rechtliche Fragen, Frankfurt 1990 E. Beck-Gernsheim: Die soziale Konstruktion des Risikos – das Beispiel PID, in: Soziale Welt 47 (1996), 284-296 E. Beck-Gernsheim: Technik, Markt und Moral, Frankfurt 1991 V. Braun u.a.: Ethische und rechtliche Fragen der Gentechnologie und der Reproduktionsmedizin, München 1987 D. Beckmann u.a. (Hg.): Humangenetik – Segen für die Menschheit oder unkalkulierbares Risiko? Frankfurt a. M. u.a. 1991 J. P. Beckmann: Fragen und Probleme einer medizinischen Ethik, Berlin, New York 1996 D. Birnbacher: Embryonenschutz in Gefahr? Vor- und Nachteile der Präimplantationsdiagnostik, in: Universitas 55 (2000) 409-415 A. Bondolfi: Ethisch denken und moralisch handeln in der Medizin. Anstösse zur Verständigung, Zürich 2000 A. Bondolfi/H. Müller: Medizinische Ethik im ärztlichen Alltag, Basel u.a. 1999 C. Breuer: Person von Anfang an? Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens, Paderborn 1995 Bundesgesundheitsministerium (Hg.): Symposium Fortpflanzungsmedizin, BadenBaden 2001 P. Caesar (Hg.): PID. Thesen zu den medizinischen, rechtlichen und ethischen Problemstellungen. Bericht der Bioethik Kommission des Landes Rheinland Pfalz, Mainz 1999 M. Düwell/D. Mieth (Hg.): Von der prädiktiven zur präventiven Medizin. Ethische Aspekte der PID. Supplementband der Zeitschrift für Ethik in der Medizin, Berlin 1999 M. Düwell/D. Mieth (Hg.): Ethik in der Humangenetik. Ethische Aspekte der genetischen Frühdiagnostik im Zusammenhang mit der menschlichen Fortpflanzung, Tübingen 1998 S. Ehrlich: Denkverbot als Lebensschutz?. Pränatale Diagnostik, Fötale Schädigung und Schwangerschaftsabbruch, Opladen 1993. 13 - P. Fonk: Schwangerschaft auf Probe? Pränatale Diagnostik und PID als ethische Herausforderung (II), in: Ethica 7 (1999), 29-46 und 143-173 B. Gesang: Präimplantations- und Pränataldiagnostik – auf dem Weg zum „perfekten“ Menschen?, in: Universitas 56 (2001) 1034-1044 J. Gründel: Ethische Implikationen der Präimplantationsdiagnostik. Ethische Aspekte der genetischen Diagnostik, Sympozja 29, 171-182 J. Habermas: Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Frankfurt a. M. 2001 H. Haker: Ethik der genetischen Frühdiagnostik. Sozialethische Reflexionen zur Verantwortung am Beginn des menschlichen Lebens, Paderborn 2002 A.H. Handyside u.a.: The future of preimplantation genetic diagnosis. Human Reproduction 1998, 13 (Suppl. 4): 249-255 W. Henn/T. Schroeder-Kurth: Die Macht des Machbaren. Gerät die deutsche Zurückhaltung gegenüber dem genetischen Bevölkerungsscreening unter Druck?, in: Deutsches Ärzteblatt 96 (1999), 1555-1556 H. Hepp: PID – medizinische, ethische und rechtliche Aspekte, in: Deutsches Ärzteblatt 97 (2000), 1213-1221 H. Hoffmann: Die feministischen Diskurse über Reproduktionstechnologie. Positionen und Kontroversen in der BRD und den USA, Frankfurt a. M. 1995 W. Holzgreve (Hg.): Pränatale Medizin, Berlin u.a. 1988 H. Holzhey (Hg.): Der Wert des Lebens. Bioethik in der Diskussion, Bern, Stuttgart 1991 M. Honecker: Individualberatung und Grundlagenforschung – Sozialethische Überlegungen zur Genomanalyse, in: Arzt und Christ 38 (1992), 103-114 G.W. Hunold: Vorsorge für das ungeborene Leben, in: Arzt und Christ 36 (1990), 173185 B. Katz-Rothmann: Schwangerschaft auf Abruf. Vorgeburtliche Diagnose und die Zukunft der Mutterschaft, Marburg 1989 M. Kienle: Bioethik und PND in Europa, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 7 (1996) M. Kettner (Hg.): Beratung als Zwang. Schwangerschaftsabbruch, genetische Aufklärung und die Grenzen kommunikativer Vernunft, Frankfurt u.a. 1998 N. Knoepffler: Nicht-Implantation des Embryos nach Präimplantationsdiagnostik (PGD) als passive Sterbehilfe in bestimmbaren Fällen, in: medgen 13 (2001) 305-308 R. Kollek: Präimplantationsdiagnostik. Embryonenselektion, weibliche Autonomie und Recht, 2. aktualisierte Auflage, Tübingen/Basel 2002 R. Kollek: Schutz des Embryos, Freiheit der Forscher. Gegenworte. Zeitschrift für den Disput über das Wissen 1 (1998), 52-56 R. Kollek: Nähe und Distanz. Komplementäre Perspektiven der ethischen Urteilsbildung, in: M. Düwell/K. Steigleder (Hg.), Bioethik, Frankfurt a.M. 2003, 230237 Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und ethische Fragen der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik e.V.: PID – Eine Stellungnahme und ein Missverständnis 1997, 219220 H. Kress: Personwürde am Lebensbeginn. Gegenwärtige Problemstellungen im Umgang mit Embryonen, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 43 (1999), 36-53 T. Krones/G. Richter: Kontextsensitive Ethik am Rubikon, in: M. Düwell/K. Steigleder (Hg.), Bioethik, Frankfurt a.M. 2003, 238-245 A. Laufs: Die deutsche Rechtsgrundlage zur PID, in: Ethik in der Medizin 11 (1999), 55-61 14 - W. Lissens u.a.: Präimplantationsdiagnostik: preimplantation genetic diagnosis (PGD), in: Weibliche Sterilität: Ursachen, Diagnostik und Therapie. Heidelberg, New York 1998, Vol. 1: 692-722 D. Mieth: Was wollen wir können? Ethik im Zeitalter der Biotechnik, Freiburg, Basel, Wien 2002 M. Mikl u.a.: Genanalytische Untersuchungen – Inidividuelle und gesellschaftliche Auswirkungen, Institut für Technikfolgen-Abschätzung der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1996 F.U. Montgomery: Schöne neue Welt: Muss man alles machen, was man kann?, in: Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 18 vom 5.5.00, S. 1198-1200 J. Murken (Hg.): Pränatale Diagnostik und Therapie, Stuttgart 1987 R. Neidert: Brauchen wir ein Fortpflanzungsmedizingesetz?, in: Medizinrecht 8 (1998), 347-353 C. Netzer: Führt uns die PID auf eine Schiefe Ebene?, in: Ethik in der Medizin 10 (1998), 138-151 Th. Neuer-Miebach/R. Tarneden (Hg.), Vom Recht auf Anderssein. Anfragen an pränatale Diagnostik und humangenetische Beratung, Marburg/Düsseldorf 1994 J. Pfammater/E. Christen (Hg.): Leben in der Hand des Menschen, Zürich 1991 G. Pöltner: Grundkurs Medizin–Ethik, Wien 2002 P. Propping: Genetische PND. Brauchen wir eine Qualitätskontrolle? Deutsches Ärzteblatt 95 (1998), 1302-1303 R. Ratzel/N. Heinemann: Zulässigkeit der PID nach Abschnitt D, IV Nr. 14, S. 2 Musterberufsordnung – Änderungsbedarf? Medizinrecht 12 (1997), 540-543 J. Römelt, Pränatale Diagnostik – Medizin zwischen elterlicher Selbstbestimmung und Selektion, in: A. Holderegger u.a. (Hg.), Theologie und biomedizinische Ethik: Grundlagen und Konventionen, Freiburg i.Ue./Freiburg i.Br. 2002, 280-296 H.-M. Sass: Genomanalyse und Gentherapie. Ethische Herausforderungen in der Humanmedizin, Heidelberg u.a. 1991 E. Schindele: Gläserne Gebär-Mütter. Vorgeburtliche Diagnose und die Zukunft der Mutterschaft, Marburg 1989 A. Schmidt: Rechtliche Aspekte der Genomanalyse. Insbesondere die Zulässigkeit genanalytischer Testverfahren in der pränatalen Diagnostik sowie in der PID, Frankfurt a. M. u.a. 1991 N.F. Schneider/H. Matthias-Bleck (Hg.): Elternschaft heute. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und individuelle Gestaltungsaufgaben, Opladen 2002 (= Zeitschrift für Familienforschung, Sonderheft 2) C. Schnell: Der problematische Blick in das Erbgut Ungeborener. Ethische Anfragen an die PND, in: Renovatio 48 (1992), 30-46 T. Schroeder-Kurth: Auf ein Wort: PID, in: Medizinische Genetik 9 (1997), 154-159 T. Schroeder-Kurth: Art. Pränatalmedizin, 1. Diagnostik, in: W. Korff u.a. (Hg.): Lexikon der Bioethik, Gütersloh 1998, Bd. III, 44-51 V. Stollorz: Erbgut-Check für Embryonen. Die PID beschwört eine neue Eugenik herauf, in: Die Zeit 2000, Nr. 10 J.-P. Stössel (Hg.): Tüchtig oder tot. Die Entsorgung des Lebens, Freiburg/Br. 1991 Themenheft „PID“: Zeitschrift für medizinische Ethik 46 (2000), Heft 2 W. Thimm u.a.: Ethische Überlegungen zu humangenetischer Beratung und pränataler Diagnostik, in: Geistige Behinderung 29 (1990), 361-369 P. Weingart/J. Kroll/K. Bayertz: Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland, Frankfurt a. M. 1986 W. Wieland: Strukturwandel der Medizin und ärztliche Ethik, Heidelberg 1986 15 - G. Wolff: Die ethischen Konflikte durch die humangenetische Diagnostik, in: Ethik in der Medizin 1 (1989), 184-194 Referat bei der Sitzung der Bioethik-Kommission der Bayerischen Staatsregierung am 31. Januar 2003